



Home | Patienten | Gesundheitssystem | International | GKV | Prävention | Epidemiologie | Websites | Meilensteine | Impressum
Sämtliche Rubriken in
"Epidemiologie"
Themen- und länderübergreifende Berichte |
Alle Artikel aus:
Epidemiologie
Themen- und länderübergreifende Berichte
Global Health: Öffentliche Gesundheit in Theorie und Praxis
 Global Health steht weit oben auf der internationalen politischen Agenda. Aus gesundheitswissenschaftlicher und -politischer Sicht ist diese Entwicklung so überfällig wie begrüßenswert. Allerdings weist das gängige Verständnis von Global Health Schwächen auf und wird den komplexen Herausforderungen nur teilweise gerecht. Vor allem mangelt es an der konsequenten Umsetzung der globalen Ansätze in der heimischen Politik, denn globale Gesundheit fängt zu Hause an. Zunehmende globale Ungleichheiten bestehen in Deutschland, Europa und der gesamten Welt. Kommerzialisierung bedeutet Ausgrenzung und damit zunehmende gesundheitliche Ungleichheit. Ohne geeignete politische Weichenstellungen und Politikkohärenz wird das Recht Aller auf Gesundheit schwerlich zu gewährleisten sein. Die Auswirkungen der Globalisierung erfordern eine Stärkung und verbesserte Abstimmung von öffentlicher Gesundheitsforschung und -praxis, denn letztlich ist Global Health die folgerichtige Weiterentwicklung von Public Health in der globalisierten Welt.
Global Health steht weit oben auf der internationalen politischen Agenda. Aus gesundheitswissenschaftlicher und -politischer Sicht ist diese Entwicklung so überfällig wie begrüßenswert. Allerdings weist das gängige Verständnis von Global Health Schwächen auf und wird den komplexen Herausforderungen nur teilweise gerecht. Vor allem mangelt es an der konsequenten Umsetzung der globalen Ansätze in der heimischen Politik, denn globale Gesundheit fängt zu Hause an. Zunehmende globale Ungleichheiten bestehen in Deutschland, Europa und der gesamten Welt. Kommerzialisierung bedeutet Ausgrenzung und damit zunehmende gesundheitliche Ungleichheit. Ohne geeignete politische Weichenstellungen und Politikkohärenz wird das Recht Aller auf Gesundheit schwerlich zu gewährleisten sein. Die Auswirkungen der Globalisierung erfordern eine Stärkung und verbesserte Abstimmung von öffentlicher Gesundheitsforschung und -praxis, denn letztlich ist Global Health die folgerichtige Weiterentwicklung von Public Health in der globalisierten Welt.
In seinem Beitrag Produktions Global Health: Öffentliche Gesundheit in Theorie und Praxis in in der Zeitschrift ASU Arbeitsmedizin Sozialmedizin Umweltmedizin fordert der Fuldaer Global-Health Professor Jens Holst einen intensiveren Austausch zwischen ÖGD und theoretischer Public Health benötigt die stärkere Einbeziehung der staatlichen Öffentlichen Gesundheitsdienste in die theoretische Öffentliche Gesundheitsforschung und -lehre ebenso wie gemeinsame Forschungsprogramme und die engere Verknüpfung von Lehre und Ausbildung im ÖGD. Das ist erforderlich, um interdisziplinäre gesundheitswissenschaftliche Erkenntnisse und Empirie nicht nur in die Praxis öffentlicher Gesundheitsvor- und -fürsorge, sondern auch in wirksame Politikberatung übertragen zu können. Dabei handelt es sich keineswegs um einen Automatismus, sondern es braucht aktive Umsetzung, Förderung und Gestaltung. Eine zunehmend globale Perspektive von Wissenschaft, Praxis und Politik im Bereich Öffentliche Gesundheit kann einen wichtigen Beitrag dazu leisten.
Der Artikel steht sowohl zur Online-Lektüre als auch direkt zum Download als PDF kostenfrei zum Download zur Verfügung.
Bernard Braun, 20.8.19
Empfehlungen für die neue Globale-Gesundheitsstrategie der Bundesregierung
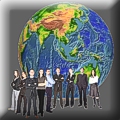 Nur fünf Jahre nach der Verabschiedung ihres ersten globalen Gesundheitskonzeptes erarbeitet die Bundesregierung derzeit ein neues Strategiepapier zur Umsetzung einer kohärenten globalen Gesundheitspolitik. Gesundheitsexpert*innen hatten schon bei der der ersten Strategie von 2013 darauf hingewiesen, sie könnte in der vorliegenden Form keinen durchgreifenden Beitrag zur Lösung globaler Gesundheitsherausforderungen leisten, da es vor allem im Hinblick auf die gesellschaftlichen Faktoren von Gesundheit umkonkret und wenig aussagekräftig blieb - siehe dazu den Forums-Beitrag Globale Gesundheit - scheidende Bundesregierung hinterlässt bedenkliches Erbe. Zudem kamen die für globale Gesundheit überaus relevanten Fragen von gesundheitlicher Ungleichheit in Deutschland und der Welt ebenso wenig zur Sprache wie die Defizite bei der universellen Absicherung von Migrant*innen, Flüchtlingen und Sans-Papiers. Auf diese und andere Punkte hatte bereits der Artikel Globale Gesundheitspolitik ist mehr als Gefahrenabwehr von Jens Holst und Oliver Razum in Das Gesundheitswesen hingewiesen.
Nur fünf Jahre nach der Verabschiedung ihres ersten globalen Gesundheitskonzeptes erarbeitet die Bundesregierung derzeit ein neues Strategiepapier zur Umsetzung einer kohärenten globalen Gesundheitspolitik. Gesundheitsexpert*innen hatten schon bei der der ersten Strategie von 2013 darauf hingewiesen, sie könnte in der vorliegenden Form keinen durchgreifenden Beitrag zur Lösung globaler Gesundheitsherausforderungen leisten, da es vor allem im Hinblick auf die gesellschaftlichen Faktoren von Gesundheit umkonkret und wenig aussagekräftig blieb - siehe dazu den Forums-Beitrag Globale Gesundheit - scheidende Bundesregierung hinterlässt bedenkliches Erbe. Zudem kamen die für globale Gesundheit überaus relevanten Fragen von gesundheitlicher Ungleichheit in Deutschland und der Welt ebenso wenig zur Sprache wie die Defizite bei der universellen Absicherung von Migrant*innen, Flüchtlingen und Sans-Papiers. Auf diese und andere Punkte hatte bereits der Artikel Globale Gesundheitspolitik ist mehr als Gefahrenabwehr von Jens Holst und Oliver Razum in Das Gesundheitswesen hingewiesen.
Seit der Veröffentlichung des ersten Global-Health-Konzepts weist die Deutsche Plattform für Globale Gesundheit (DPGG), ein interdisziplinärer, breiter Zusammenschluss von Gewerkschaften, Nichtregierungsorganisationen und Wissenschaftler*innen aus der nationalen und internationalen Gesundheitspolitik nachdrücklich auf auf die vielfach unzureichend beachteten, nicht-medizinischen Determinanten von Gesundheit hin, deren vorrangige Betrachtung eine unerlässlich Voraussetzung für einen effektiven Beitrag der Bundesregierung zur Weltgesundheit darstellt. Die wachsende Rolle Deutschlands in der globalen Gesundheitspolitik erfordert mehr denn je eine multidisziplinäre, kohärente Politik zur Verbesserung der Gesundheit der Menschen weltweit. Die Fokussierung auf gesundheitliche Bedrohungspotenziale und technologische Lösungen greift zu kurz, und die Unterstützung und wachsende Bedeutung der Global Player aus Wirtschaft und Philanthropie durch die Bundesregierung bringt die Gefahr mit sich, das private Prioritäten und Verwertungsinteressen die Gesundheit auf der Welt von einem Menschenrecht in eine Ware verwandeln.
In zwei Beiträgen fordert und erläutert Jens Holst, der eine Professur für Medizin mit Schwerpunkt Global Health an der Hochschule Fulda innehat, die wesentlich stärkere Berücksichtigung gesellschaftlicher Einflussfaktoren in der globalen Gesundheitspolitik. Viel stärker als bisher müsse die neue Strategie der Bundesregierung die Faktoren außerhalb von Human- und Tiermedizin, One Health, Pharmazie und Technologie in Betracht ziehen und explizit eine Health-in-All-Politik einfordern. Wesentliche Empfehlungen der DPGG können Sie zum einen im BMJ Global Health 4 (2) und zum anderen etwas ausführlicher in der Ausgabe XI des South Eastern European Journal of Public Health (SEEJPH) nachlesen, die beide kostenfrei zum Download zur Verfügung stehen:
Addressing upstream determinants of health in Germany's new global health strategy: recommendations from the German Platform for Global Health
Designing Germany's new global health strategy: Some important recommendations
Bernard Braun, 19.8.19
Global Health - Mehr als Medizin und Technologie
 Global Health - Globale Gesundheit - steht heute weit oben auf der internationalen politischen Agenda. Vor allem die deutsche Bundesregierung und insbesondere das Kanzleramt haben dem Thema Global Health in den letzten Jahren zunehmende Aufmerksamkeit gewidmet und dazu beigetragen, dass es auf vielen internationalen Konferenzen einen prominenten Raum einnimmt. Das ist eine unmittelbare Folge der weitgehenden Globalisierung aller Lebensbereiche, also der zunehmenden internationalen Verflechtung vor allem der Wirtschaft, Politik, Kultur, Umwelt und Kommunikation zwischen Individuen, Gesellschaften, Institutionen und Staaten. Sie bringt für einen wachsenden Teil der Weltbevölkerung erhebliche Veränderungen der Arbeits- und Lebensbedingungen mit sich, führt zu wachsenden Belastungen von Umwelt und Klima, schürt bewaffnete Konflikte um natürliche Ressourcen wie Wasser und Bodenschätze, befördert den Tourismus für die einen und den Migrationsdruck für die anderen und vertieft die sozioökonomischen Gräben in und zwischen Ländern.
Global Health - Globale Gesundheit - steht heute weit oben auf der internationalen politischen Agenda. Vor allem die deutsche Bundesregierung und insbesondere das Kanzleramt haben dem Thema Global Health in den letzten Jahren zunehmende Aufmerksamkeit gewidmet und dazu beigetragen, dass es auf vielen internationalen Konferenzen einen prominenten Raum einnimmt. Das ist eine unmittelbare Folge der weitgehenden Globalisierung aller Lebensbereiche, also der zunehmenden internationalen Verflechtung vor allem der Wirtschaft, Politik, Kultur, Umwelt und Kommunikation zwischen Individuen, Gesellschaften, Institutionen und Staaten. Sie bringt für einen wachsenden Teil der Weltbevölkerung erhebliche Veränderungen der Arbeits- und Lebensbedingungen mit sich, führt zu wachsenden Belastungen von Umwelt und Klima, schürt bewaffnete Konflikte um natürliche Ressourcen wie Wasser und Bodenschätze, befördert den Tourismus für die einen und den Migrationsdruck für die anderen und vertieft die sozioökonomischen Gräben in und zwischen Ländern.
Mit der Bedeutung nimmt auch die Wahrnehmung der weilweiten Verbindungen und der Herausforderungen im Zusammenhang mit der Gesundheit der Menschen zu. Das vergleichsweise neue Konzept Globale Gesundheit bezieht sich auf die Gesundheit von Menschen jenseits von Ländergrenzen, verfolgt eine explizit transnationale und universelle Perspektive und unterscheidet sich von "Internationaler Gesundheit" insbesondere durch die Berücksichtigung der globalen gesundheitsbezogenen Herausforderungen
Global Health ist ein komplexer Sammelbegriff, der zwar erheblich an Bedeutung gewonnen hat, aber bis heute keine eindeutige Verwendung erfährt. Bereits 2006 definierte eine us-amerikanisch-peruanische Forschergruppe um Theodore Brown globale Gesundheit in ihrem Artikel The World Health Organization and the transition from "international" to "global" public health" als Global health is the health of populations in the global context. Die britischen Wissenschaftler David Stuckler und Martin McKee beschrieben 2008 in Five metaphors about global health policy das breite Spektrum von globaler Gesundheit, das von Gesundheit als Instrument der inneren Sicherheit und der Außenpolitik über karitative, philantropische Ansätze und öffentlich-private Partnerschaften bis hin zum allgemeinen Menschenrecht und solidarischem Handeln reicht. Eine internationale Gruppe von Gesundheitswissenschaftlern um Jeffrey Koplan leitete in ihrem Artikel Towards a common definition of global health einen Paradigmenwechsel im Hinblick auf globale Gesundheit ein. Im Anschluss an den aussagekräftigen einleitenden Satz Global health is fashionable forderte die Autoren eine wegweisende Definition von Global Health, die alle gesundheitlichen Herausforderungen und länderübergreifenden Determinanten von der weltweiten Ausrottung von Krankheiten (z. B. Kinderlähmung) über Antibiotikaresistenzen, Ernährungssicherheit, Urbanisierung und Migration bis zum Klimawandel umfassen müsse. Für den deutschsprachigen Raum bietet die Bundeszentrale für politische Bildung eine vergleichbare Begriffserklärung in dem Beitrag Globale Gesundheit / Global Health von Silke Gräser.
Das gängige, im politischen Raum vorherrschende Verständnis von Global Health wird allerdings allzu häufig der gebotenen Komplexität nicht gerecht und weist konzeptionelle Beschränkungen auf. Der herrschende Global-Health-Diskurs erfüllt vielfach weder den implizit mit dem Begriff "global" verknüpften Anspruch auf Universalismus noch die Erfordernisse einer umfassenden transdisziplinären und ressortübergreifenden Gesundheitspolitik. Darauf machen zwei Beiträge in Publikationen des AOK-Bundesverbands aufmerksam. In der Januar-Ausgabe 2019 des Monatsmagazins Gesundheit und Gesellschaft (G+G) zeigt Jens Holst, der an der Hochschule Fulda die neu eingerichtete Professur für Medizin mit Schwerpunkt Global Health innehat, an Hand der besorgniserregenden Antibiotika-Resistenzentwicklung die Bedeutung von globaler Gesundheit bzw. globaler gesundheitsbezogener Zusammenhänge auf. Eine erfolgversprechende Strategie zur Eindämmung der zunehmenden Multiresistenzen von Krankheitserregern darf sich nicht auf die Human- und Tiermedizin beschränken, sondern muss auch grundlegende Fragen der landwirtschaftlichen Produktion, der Arbeitsbedingungen und der Handelspolitik einbeziehen, sich mit der Steuerung transnationaler Konzerne und einem politischen Ausgleich globaler Machtasymmetrien Machtasymmetrien befassen und grundlegende Governancefragen beantworten. Gerade auf die unverzichtbare Bedingung einer konsequenten Politik der Gesundheit-in-allen-Politikbereichen zur Lösung der drängenden Resistenz-Problematik verweist der Beitrag, der auch ein Glossar mit Begriffsbestimmungen relevanter Termini wie primärer, globaler, internationaler und öffentlicher Gesundheit und von "one health" bzw. "health in all" umfasst. Der Artikel Resistenzen ohne Grenzen ist direkt online zu lesen und auch als PDF herunterzuladen.
Eine explizite Begriffsbestimmung von Global Health enthält der zweite Betrag von Jens Holst, der in der April-Ausgabe 2019 der G+G Wissenschaft, der Wissenschaftsbeilage von Gesundheit und Gesellschaft, erschien. Er beschreibt und analysiert die Entstehung und historische Entwicklung des Begriffs Global Health und setzt sich kritisch mit unterschiedlichen Auslegungen, Strömungen und insbesondere mit der selektiven, verengten Sicht auf globale Gesundheit auseinander und nimmt Bezug auf die Forderung nach der Dekolonalisieung von Global Health. Gerade die in Medizin, Politik und Wirtschaft vielfach anzutreffende Verkürzung globaler Gesundheitsfragen auf biomedizinische und technologische Lösungsansätze und der Fokus auf einkommensschwächere Länder im Sinne von international health wird dem Thema Globale Gesundheit nicht hinreichend gerecht. Vielmehr ist Global Health die konsequente Weiterentwicklung von Public Health als inter- bzw. transdisziplinäre Wissenschaft mit systemischer Sichtweise auf die globalen gesundheitlichen Herausforderungen. Auch der Artikel Global Health - Hope oder Hype? steht kostenfrei zum Download zur Verfügung.
Bernard Braun, 10.8.19
Schwachstelle mehrjähriger Gesundheitssurveys: sinkende und dabei noch sozial selektiv sinkende Beteiligung
 Bevölkerungsumfragen zu einer Fülle von Gesundheitsfragen haben einen festen und zunehmenden Stellenwert in der gesundheitswissenschaftlichen und -politischen Diskussion. Sie bieten auch die Möglichkeit für zeitliche und internationale Vergleiche.
Bevölkerungsumfragen zu einer Fülle von Gesundheitsfragen haben einen festen und zunehmenden Stellenwert in der gesundheitswissenschaftlichen und -politischen Diskussion. Sie bieten auch die Möglichkeit für zeitliche und internationale Vergleiche.
Eine im April 2018 erschienene Studie über die in Finnland seit 25 Jahren durchgeführten Surveys zur gesundheitlichen Lage weist aber auf mögliche Verzerrungen und Beeinträchtigungen der Repräsentativität von Ergebnissen durch die insgesamt aber auch selektiv sinkende Bereitschaft sich an solchen Befragungen zu beteiligen hin.
Dazu untersuchten die ForscherInnen die soziale Zusammensetzung (Indikatoren: Bildungsniveau und Beschäftigungsstatus) in sechs Querschnittsbefragungen des FINRISK-Surveys zwischen 1987 und 2012. Da es für diese Surveys einen Link zu nationalen Personenregistern gibt, ist es möglich die soziale Zusammensetzung von Surveyteilnehmern und -nichtteilnehmern zu ermitteln.
Die Ergebnisse sahen so aus:
• Die Teilnehmerraten sanken in allen Untergruppen der befragten Bevölkerung. Die Abnahme der Beteiligung an dem Survey sank aber am stärksten und schnellsten in der Gruppe der Personen mit niedrigem Bildungsniveau. Bezüglich des Beschäftigungssstatus gab es kaum Unterschiede. Die jährliche Abnahme der Beteiligungsbereitschaft an diesem Survey betrug bei Männern oder Frauen mit höherem Bildungsniveau 0,9 oder 0,7 Prozentpunkte und bei Männern und Frauen mit niedrigem Bildungsniveau 1,3 oder 1,4 Prozentpunkte.
• Die AutorInnen weisen noch darauf hin, dass es Hinweise für ähnliche Entwicklungen der TeilnehmerInnenrate in den USA, Australien, den Niederlanden und Dänemark gibt.
Angesichts der möglichen Verzerrungen bei der Repräsentativität jedes solcher Surveys und der Gefahr falscher Ergebnisse von Vergleichen mehrerer Survey-Wellen mit unterschiedlicher sozialer Zusammensetzung weisen die finnischen ForscherInnen darauf hin, dies sowohl bei allen bisherigen Ergebnissen zu beachten als auch in künftigen Surveys über methodische Verbesserungen nachzudenken, wie die beschriebenen Effekte vermieden oder vermindert werden können.
Dazu schlagen sie u.a. vor: "To prevent the increase of bias in estimates and the deterioration of the representativeness of health surveys, we should pay particular attention to the recruitment of those who are less willing to participate or hard to reach. For example, telephone interview has been found out to reach people with low education better than postal survey. Previous studies have shown that even small monetary incentives can increase the response rates and that paying an incentive may be especially useful among the groups that would otherwise be under-represented among respondents. Thus, participation could be increased by tailoring the recruitment separately for different socio-economic groups. ... It is also important to consider using methods for missing data handling, such as multiple imputation or weighting methods and to include possible socio-economic factors in calculations."
Die Studie Participation rates by educational levels have diverged during 25 years in Finnish health examination surveys von Jaakko Reinikainen, Hanna Tolonen, Katja Borodulin, Tommi Härkänen, Pekka Jousilahti, Juha Karvanen, Seppo Koskinen, Kari Kuulasmaa, Satu Männistö und Harri Rissanen ist im "European Journal of Public Health" (Volume 28, Issue 2, 1 April 2018, Pages 237-243) erschienen. Ein Abstract ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 19.3.19
"In welchem Alter haben Sie die Krankheitslast eines durchschnittlich 65-jährigen Menschen?" Wer hat das beste Gesundheitssystem?
 Die meisten Gesundheitspolitiker in entwickelten Staaten Europas oder Nordamerikas brüsten sich gerne damit, dass sie das "beste Gesundheitssystem" haben und stützen sich dabei oft auf die Beantwortung von simplen Zufriedenheitsfragen in Bevölkerungsumfragen. Zufriedenheitsfragen allein produzieren systematisch positiv verzerrte Antworten und müssen dann, wenn sie überhaupt gestellt werden, zusammen mit anderen spezifischeren Fragen und Indikatoren betrachtet werden.
Die meisten Gesundheitspolitiker in entwickelten Staaten Europas oder Nordamerikas brüsten sich gerne damit, dass sie das "beste Gesundheitssystem" haben und stützen sich dabei oft auf die Beantwortung von simplen Zufriedenheitsfragen in Bevölkerungsumfragen. Zufriedenheitsfragen allein produzieren systematisch positiv verzerrte Antworten und müssen dann, wenn sie überhaupt gestellt werden, zusammen mit anderen spezifischeren Fragen und Indikatoren betrachtet werden.
Wie dann manche sich reiner Selbstbespiegelung verdankende Rangreihe durcheinander und realistischer gerät, zeigt eine gerade in der Fachzeitschrift "Lancet Public Health" veröffentlichte international vergleichende Studie von europäischen und us-amerikanischen Wissenschaftlern.
Mit Daten der "Global Burden of Disease study (GBD) 2017" entwickeln die AutorInnen zunächst auf der Basis von 92 unterschiedlichsten Erkrankungen eine Reihe von altersstandardisierten altersspezifischen Indikatoren für die Krankheitslast in 195 Ländern und die Jahre 1990 und 2017.
Allgemein ergibt sich dann folgendes Bild:
• Zwischen 1990 und 2017 reduziert sich die altersbezogene Krankheitslast in allen Regionen der 195 Länder. Dies gilt insbesondere für das Mortalitätsrisiko und die altersbezogene Erkrankungsschwere.
• Verglichen mit dem Durchschnittswert für alle Länder tritt die mit dem Altern verbundene Häufung von Gesundheitsproblemen früher und in 87 Ländern später auf als im Alter von 65 Jahren.
• Weltweit sind vor allem ischämische Herzerkrankungen, Hirnblutungen und chronisch obstruktive Lungenerkrankungen (COPD) für die Sterblichkeit und die durch Behinderung verlorenen Lebensjahre ("disability-adjusted life years (DALY)" verantwortlich.
An welcher Position sich die gesundheitlich vermeintlich besten oder besseren Ländern befinden, wenn untersucht wird, in welchem Lebensalter die gesundheitliche Situation der Bevölkerung so aussieht wie die der durchschnittlich 65-Jährigen, führt zu interessanten Ergebnissen:
• In Japan, und damit erreicht das Land weltweit den Platz 1, sind im Durchschnitt erst die Menschen im Alter von 76,1 Jahren so krank wie durchschnittlich 65-Jährige. Auf den weiteren Plätzen stehen die BürgerInnen der Schweiz (76,1 Jahre), Frankreichs (76 Jahre) oder bereits auf Platz 10 Peru (74,3 Jahre).
• In Papua-Neu-Guinea, und damit belegt das Land weltweit den letzten Platz, haben die BewohnerInnen bereits mit 45,6 Jahren die Krankheitslast von durchschnittlich 65-jährigen Personen. Die Marschall-Inseln (51 Jahre), Afghnanistan (51,6 Jahre) oder Guinea-Bissau (54.5 Jahre) nehmen dann die weiteren Plätze ein.
• Zwischen den Ländern mit früher oder später im Lebensalter auftretenden altersspezifischen Krankheitslasten von durchschnittlichen 65-Jährigen existiert also eine Spanne von rund 30 Lebensjahren.
• Die USA erreichen gerade den Platz 53 und liegen damit zwischen dem Iran (Platz 54) und Algerien Platz 52).
• Und Deutschland liegt wie fast immer auf einem "guten" Mittelplatz: Deutsche BürgerInnen müssen zwar die Krankheitslast von 65-Jährigen erst im Alter von 70,7 Jahren tragen, damit liegt Deutschland aber erst auf Platz 38, einen Platz besser als Costa Rica und einen schlechter als Großbritannien.
Beim Indikator der durch Behinderung verlorenen Lebensjahre sieht es 2017 erneut mit 104,9 DALYs pro 1.000 Erwachsene im Alter von 25 Jahren und älter weltweit am besten in der Schweiz aus und in Papua Neuguinea mit 506,6 DALYs pro 1.000 Erwachsene am schlechtesten. Hier erreicht Deutschland mit 144,7 DALYs den Platz 33.
Zahlreiche weitere Indikatoren und internationale Rangreihen finden sich in dem Aufsatz Measuring population ageing: an analysis of the Global Burden of Disease Study 2017 von Angela Y Chang, Vegard F Skirbekk, Stefanos Tyrovolas, Nicholas J Kassebaum und Joseph L Dieleman. Erschienen ist er im "The Lancet Public Health" (2019; 4 (3): e159-167) und ist komplett kostenlos erhältlich.
Zusätzliche Daten für Länder und Regionen, die den Berechnungen zugrundeliegenden oder ausgeschlossenen Krankheiten und zahlreiche methodische Hinweise finden sich in dem ebenfalls kostenlos erhältlichen 37-seitigen "Supplementary appendix".
Bernard Braun, 11.3.19
MigrantInnen und öffentliche Gesundheit: "…und Krankheiten schleppen die Migranten auch noch ein!"
 Die ausgerechnet im traditionellen Einwanderungsland Deutschland zuletzt bei der Diskussion über den UN-Migrationspakt mehr oder weniger (rechts)-radikal geäußerte Sorge um die drohende Einwanderung von Millionen MigrantInnen "in die Sozialsysteme" ist nicht das einzige Stereotyp wenn es darum geht, wenn derzeit über die weltweit fast eine Milliarde MigrantInnen ("on the move") gesprochen wird.
Die ausgerechnet im traditionellen Einwanderungsland Deutschland zuletzt bei der Diskussion über den UN-Migrationspakt mehr oder weniger (rechts)-radikal geäußerte Sorge um die drohende Einwanderung von Millionen MigrantInnen "in die Sozialsysteme" ist nicht das einzige Stereotyp wenn es darum geht, wenn derzeit über die weltweit fast eine Milliarde MigrantInnen ("on the move") gesprochen wird.
Dazu gehört auch die Behauptung, dass MigrantInnen in vielerlei Hinsicht eine Gefahr für die öffentliche und individuelle Gesundheit in europäischen oder nordamerikanischen Ländern darstellen.
Ob es dafür wissenschaftliche Belege gibt, hat nun die aus 20 führenden Public Health-ExpertInnen aus 13 Ländern bestehende "UCL-Lancet Commission on Migration and Health" in einem zweijährigen Projekt auf der Basis internationaler Daten untersucht und in einem Bericht auf der UN-Konferenz zum Migrationspakt in Marrakesch vorgestellt. Die wichtigsten Ergebnisse sind auch in der aktuellen Ausgabe der auf international vergleichende Gesundheitsanalysen spezialisierten Medizin-Zeitschrift "The Lancet" veröffentlicht.
Aus der Fülle der dort ausführlich belegten Ergebnisse sind folgende für die eingangs erwähnte Debatte beachtenswert:
• Rund 75% der MigrantInnen sind Binnen-MigrantInnen, überschreiten also keine internationalen Grenzen. 258 Millionen Menschen sind internationale MigrantInnen. Deren Anteil an der Weltbevölkerung hat sich zwischen 1990 und 2017 lediglich geringfügig, nämlich von 2,9% auf 3,4% erhöht. 65% von ihnen sind ArbeitsmigrantInnen, d.h. der kleinere Teil sind Flüchtlinge oder Asylsuchende. Dies sind zwar immer noch viele Millionen zu viel, rechtfertigt aber nicht das Stereotyp der gar noch wachsenden "Überflutung" reicher Länder.
• Der zwischen 1990 und 2017 in Ländern mit hohem Einkommen von 7,6% auf 13,4% angestiegene Anteil der internationalen MigrantInnen beinhaltet u.a. auch die wachsende Zahl von StudentInnen oder eben Arbeitsmigrantinnen aus ärmeren Ländern.
• Die Behauptung, Flüchtlinge versuchten überwiegend in die reichen Länder zu kommen, hält einer empirischen Überprüfung nicht stand: Der Anteil von Flüchtlingen ist in Ländern mit niedrigem Einkommen mit 0,7% höher als in Ländern mit hohem Einkommen mit 0,2%.
• Bisher gibt es auch keine Anzeichen, dass MigrantInnen die ökonomische Situation der Aufnahmeländer schädigt, im Gegenteil. Mit jedem Anstieg des Anteil von MigrantInnen an der erwachsenen Bevölkerung um 1% wächst das Bruttosozialprodukt um bis zu 2%.
• Sind MigrantInnen kränker und stellen damit eine besondere Belastung "unserer" bzw. der Gesundheitssysteme der Gastländer dar? Ein aktueller systematischer Review samt Meta-Analyse der Gesundheitsdaten von 15,2 Millionen MigrantInnen aus 92 Ländern stellt fest, dass MigrantInnen in reichen Ländern bei den meisten Erkrankungen (z.B. Herzkreislauferkrankungen, Krebs, psychische Erkrankungen und Verletzungen) im Vergleich mit der Stammbevölkerung in ihren Aufnahmeländern eine geringere Mortalität und damit auch Morbidität samt Behandlung aufweisen. Nur für Infektionen (z.B. Tuberkulose) und externe Ursachen wie körperliche Angriffe sieht dies anders aus. Aber selbst z.B. bei Tuberkulose gibt es Erkenntnisse, dass daran vor allem die Mit-MigrantInnen und nicht die Gastbevölkerung erkranken.
• Diese Erkenntnisse werden durch spezielle Studien u.a. über die Gesundheitsverhältnisse in Großbritannien und den USA vertieft.
• Das Gegenteil ohne Beleg oder wider besseres Wissen zu behaupten, dient der systematischen Ignoranz gegenüber den Migrationsursachen und der Diskriminierung bzw. der Verweigerung oder Erschwernis der Integration. Die Verweigerung von Bildung und anderer sozialer Leistungen sind aber negative Bedingungen für die Gesundheit.
Zusammenfassend stellen die ForscherInnen fest: "Myths about migration and health not supported by the available evidence".
Wer mehr wissen will kann die folgenden Aufsätze, die alle am 5. Dezember 2018 in der Zeitschrift "Lancet" erschienen sind, alle kostenlos herunterladen.
• The UCL-Lancet Commission on Migration and Health: the health of a world on the move von Ibrahim Abubakar et al. (nach einer knappen Anmeldung)
• Global patterns of mortality in international migrants: a systematic review and meta-analysis. von Robert W Aldridge et al.
• Do migrants have a mortality advantage? von Anjali Borhade und Subhojit Dey
• Health impacts of parental migration on left-behind children and adolescents: a systematic review and meta-analysis. von Gracia Fellmeth et al.
• Forgotten needs of children left behind by migration. von Sian M Griffiths, Dong Dong und Roger Yat-nork Chung.
Bernard Braun, 10.12.18
"Diabetes wird zum globalen Problem" - ja, aber regional extrem unterschiedlich
 Ein pünktlich zum diesjährigen Weltgesundheitstag und seinem Thema Diabetes erschienener umfangreicher Bericht über die weltweite Häufigkeit von Diabetes Typ 1 und Typ 2 ist deshalb von besonderer Bedeutung, weil er nicht den Eindruck verstärkt es handle sich bei dieser Krankheit um eine "globale" Epidemie. Er belegt vielmehr mit den Daten aus 751 Studien mit rund 4,372 Millionen erwachsenen TeilnehmerInnen aus 146 Ländern, dass die Zahl der Erkrankten, d.h. die Prävalenz und die Zunahme der Anzahl je nach sozioökonomischer Charakteristik der Region oder des Landes extrem unterschiedlich sind.
Ein pünktlich zum diesjährigen Weltgesundheitstag und seinem Thema Diabetes erschienener umfangreicher Bericht über die weltweite Häufigkeit von Diabetes Typ 1 und Typ 2 ist deshalb von besonderer Bedeutung, weil er nicht den Eindruck verstärkt es handle sich bei dieser Krankheit um eine "globale" Epidemie. Er belegt vielmehr mit den Daten aus 751 Studien mit rund 4,372 Millionen erwachsenen TeilnehmerInnen aus 146 Ländern, dass die Zahl der Erkrankten, d.h. die Prävalenz und die Zunahme der Anzahl je nach sozioökonomischer Charakteristik der Region oder des Landes extrem unterschiedlich sind.
Die wesentlichen Ergebnisse lauten so:
• Die Anzahl der Diabeteserkrankten (85%-95% Diabetes Typ 2) stieg in den untersuchten Ländern von 108 Millionen im Jahr 1980 auf 422 Millionen im Jahr 2014. 28,5% der Zunahme beruht auf dem Wachsen der Prävalenz, 39,7% auf dem Bevölkerungswachstum sowie der Alterung und 31,8% auf der Interaktion zwischen beiden Faktoren.
• Die altersadjustierte Prävalenzrate nahm im selben Zeitraum weltweit bei Männern von 4,3% auf 9% und bei Frauen von 5% auf 7,9% zu.
• Hinter diesem Durchschnittswert verbergen sich aber erhebliche regionale Unterschiede: 2014 war diese Rate in Nordwesteuropa (Schweiz, Dänemark, Niederlande, Österreich und Belgien) mit weniger als 4% bei den Frauen und 5-6% bei den Männern am niedrigsten und in Poly- und Mikronesien mit knapp 25% bei beiden Geschlechtern am höchsten. Dies schließt weitere Unterschiede in der Region nicht aus. So war in Samoa rund éin Drittel der erwachsenen Bevölkerung diabeteskrank.
• Erhebliche Unterschiede gab es auch bei den Wachstumsraten: Während sich in Festland-Westeuropa die altersstandardisierte Diabetesprävalenz zwischen 1980 und 2014 kaum veränderte, wuchs sie z.B. in Poly- und Mikronesien um 15%. Der Zuwachs in Westeuropa beruhte auch vollständig auf der Alterung der Gesellschaft und nicht auf einer steigenden Inzidenz.
• Dies alles hat zur Folge, dass die Hälfte der erwachsenen Diabetiker in fünf Ländern leben: China, Indien, USA, Brasilien und Indonesien.
• Während Deutschland beim Anteil an allen weltweit an Diuabetes erkrankten Personen 1980 noch Platz 6 einnahm, liegt es jetzt trotz einer gestiegenen Anzahl an Diabetikern auf Platz 14.
• In keinem Land sank in dem betrachteten Zeitraum aber die Diabetesprävalenz.
• Die vom selben Forscherteam untersuchte Wahrscheinlichkeit, dass es bis 2025 gelingt, die Prävalenz auf dem Niveau von 2010 zu halten, liegt weltweit bei 1% für Frauen und für bei unter 1% für Männer. Nur 9 (Männer) und 29 (Frauen) Länder - die meisten in Westeuropa - haben eine Wahrscheinlichkeit von 50% oder höher, das Ziel zu erreichen.
Ohne dass das Diabetesproblem zumindest in West- und Nordwesteuropa schon am Verschwinden wäre, ist die dortige Stagnation der Prävalenz entgegen manchen Epidemieszenarien bemerkenswert, muss aber der Schwerpunkt weiterer Analysen und präventiver Aktionen gegen Übergewichtigkeit und Fettsucht in Ländern mit niedrigen oder mittleren Einkommen liegen.
Die von der zig internationale Mitglieder unfassenden "NCD Risk Factor Collaboration" verfasste Studie Worldwide trends in diabetes since 1980: a pooled analysis of 751 population-based studies with 4,4 million participants. ist am 6. April 2016 in der Fachzeitschrift "Lancet" erschienen und komplett kostenlos (evtl. mit kurzer Anmeldung) erhältlich.
Bernard Braun, 8.4.16
Klimawandel - auch ein Thema für den Gesundheitssektor
 Für das deutsche Gesundheitswesen und seine AkteurInnen spielt die Debatte über den Klimawandel und seine Auswirkungen auf die Gesundheit bisher offenbar keine nennenswerte Rolle. Anders als in angelsächsischen Ländern wie Großbritannien, Kanada und Australien ist die Erkenntnis von WHO Generaldirektorin Margaret Chan, der Klimawandel sei "die Herausforderung unseres Jahrhunderts" bisher nicht hinreichend in das Bewusstsein einer kritischen Zahl von ÄrztInnen, Pflegenden und anderen Gesundheitsprofessionen vorgedrungen. Das ist aus zwei Gründen bemerkenswert: Zum einen ist der Gesundheitssektor selber für einen nicht unerheblichen Teil der CO2-Emissionen verantwortlich (in den USA bis zu 8 %) und zweitens stellen die gesundheitlichen Auswirkungen von Umweltverschmutzung und Klimawandel eine erhebliche Gefährdung dar.
Für das deutsche Gesundheitswesen und seine AkteurInnen spielt die Debatte über den Klimawandel und seine Auswirkungen auf die Gesundheit bisher offenbar keine nennenswerte Rolle. Anders als in angelsächsischen Ländern wie Großbritannien, Kanada und Australien ist die Erkenntnis von WHO Generaldirektorin Margaret Chan, der Klimawandel sei "die Herausforderung unseres Jahrhunderts" bisher nicht hinreichend in das Bewusstsein einer kritischen Zahl von ÄrztInnen, Pflegenden und anderen Gesundheitsprofessionen vorgedrungen. Das ist aus zwei Gründen bemerkenswert: Zum einen ist der Gesundheitssektor selber für einen nicht unerheblichen Teil der CO2-Emissionen verantwortlich (in den USA bis zu 8 %) und zweitens stellen die gesundheitlichen Auswirkungen von Umweltverschmutzung und Klimawandel eine erhebliche Gefährdung dar.
Doch die Gefahr scheint für zu viele noch zu weit weg und das Gefährdungspotenzial zu gering zu sein - anders ist das Schweigen kaum zu erklären. In der Tat mag die Bedrohung in Deutschland auch bisher nicht so groß erscheinen, aber zum einen gibt es auch hierzulande Ansatzmöglichkeiten zur Verringerung der CO2- und anderer Emissionen, und zum anderen sind die nationalen und globalen Lebensbedingungen und -chancen viel enger miteinander verknüpft, als dass man die Augen vor der weltweiten Realität verschließen dürfte.
Auf den unmittelbaren Zusammenhang zwischen nationaler und globaler Klima- und Gesundheitspolitik macht ein Positionspapier der Deutschen Plattform für Globale Gesundheit aufmerksam und fordert die Angehörigen des deutschen Gesundheitswesens zum Umdenken auf. Es verweist dabei nicht nur auf Gesundheitsrisiken und -gefahren in Folge der Erderwärmung und auf die sichtbare Häufung von Naturkatastrophen in verschiedenen Weltregionen, sondern auch auf die drohende Wüstenbildung in heute bewohnten Regionen, Wasser- und Nahrungsknappheit und eine zunehmende klimabedingte Migration, die auch Europa mit der neuen Kategorie von Klimaflüchtlingen konfrontieren wird.
Kernproblem ist die weiterhin ungebremste Verbrennung fossiler Energieträger. Das primär wachstums- und vor allem profitorientierte Wirtschaftssystem befördert den rücksichtslosen Abbau und die Verbrennung klimaschädlicher Rohstoffe, und die Politik der öffentlichen Hand subventioniert dieses unverantwortliche Handeln, anstatt es durch angemessene Besteuerung und Sanktionierung einzudämmen: Die staatlichen Subventionen für fossile Brennstoffe sind genauso hoch wie die weltweiten Gesundheitsausgaben! Mittlerweile rufen auch der Internationale Währungsfonds (IWF) und die Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) zum Abbau dieser Subventionen auf.
Ein konkreter Ansatz, potenzielle InvestorInnen in fossile Brennstoffe zum Umdenken zu bringen, ist die Divest/Reinvest-Strategie für nachhaltigen Klimaschutz: fossile Brennstoffe im Boden belassen und Investitionen aus Kohle-, Öl- und Gasunternehmen abziehen. Diesen Ansatz verfolgen schon jetzt einige finanzstarke Institutionen wie der Norwegische Staatsfonds, zwei kalifornische und der niederländische Staatsfonds, die Rockefeller Stiftung und die beiden größten europäischen Versicherungskonzerne Allianz und Axa.
So wie andere Angehörige des Gesundheitswesens sollte sich die deutsche Ärzteschaft, so eine zentrale Forderung des Positionspapiers, dem Forderungskatalog ihrer britischen KollegInnen anschließen, so wie es bereits die Medizinerorganisationen anderer Länder getan haben:
• Stärkeres Augenmerk auf den Zusammenhang zwischen Klimawandel und Gesundheit lenken,
• Investitionen in die fossile Brennstoffindustrie beenden, beispielsweise durch entsprechende Umschichtung der Einlagen der Versorgungswerke,
• Reduzierung von Emissionen im und um den Gesundheitssektor.
Die Deutsche Plattform für Globale Gesundheit stellt das Positionspapier Klimawandel und Gesundheit: Ein Weck- und Aufruf für den Gesundheitssektor mit vielen relevanten Informationen und wertvollen Literaturverweisen kostenfrei zum Download zur Verfügung.
Jens Holst, 10.12.15
Weltbericht zu Sozialer Absicherung
 Die jährlich bzw. zweijährlich erscheinenden Weltgesundheitsberichte der WHO, Weltentwicklungsberichte der Weltbank und Humanentwicklungsberichte des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen UNDP haben sich mittlerweile als Standardwerken der Internationalen Zusammenarbeit etwabliert. Weltberichte der Internationalen Arbeitsorganisation ILO haben bisher keine vergleichbare Tradition. Vergleichbare internationale Übersichtsberichte zu sozialer Sicherung sollen die anderen thematischen Weltberichte ergänzen.
Die jährlich bzw. zweijährlich erscheinenden Weltgesundheitsberichte der WHO, Weltentwicklungsberichte der Weltbank und Humanentwicklungsberichte des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen UNDP haben sich mittlerweile als Standardwerken der Internationalen Zusammenarbeit etwabliert. Weltberichte der Internationalen Arbeitsorganisation ILO haben bisher keine vergleichbare Tradition. Vergleichbare internationale Übersichtsberichte zu sozialer Sicherung sollen die anderen thematischen Weltberichte ergänzen.
Die ILO hatte 2010 erstmalig einen World Social Security Report mit dem Titel Providing coverage in times of crisis and beyond publiziert. Mit dieser ersten umfassenden, systematischen und spartenübergreifenden Aufarbeitung der sozialen Absicherung in der Welt untermauerte die ILO ihren Führungsanspruch im Themenfeld umfassender sozialer Absicherung. In den vorangegangenen Jahren hatte sich die ILO zunehmend gegenüber einem breiteren, über die arbeitsplatzassoziierte Absicherung hinausgehenden Ansatz von sozialer Absicherung geöffnet und dabei nicht zuletzt im Bereich der sozialen Absicherung im Krankheitsfall profiliert.
Sichtbares Ergebnis des vermehrten ILO-Engagements war der 2011 erschienene Bericht Social Protection Floor for a Fair and Inclusive Globalization, der kostenfrei zum Download in englisch, französisch und spanisch zur Verfügung steht. Mit ihrem menschenrechtsbasierten Ansatz der sozialen Absicherung bemüht sich die ILO, einen Referenzrahmen für die Vereinten Nationen zu schaffen. Der unter Vorsitz der früheren und aktuellen chilenischen Präsidentin Michelle Bachelet erarbeitete Vorschlag definierte Mindeststandards für die soziale Absicherung in den Ländern.
Der Weltbericht 2014/15 zu Sicherung gibt einen umfassenden Überblick über den Aufbau sozialer Sicherungssysteme, Ausmaß und Leistungssprektrum sozialer Absicherung sowie die entsprechenden Ausgaben. Die ILO stellt den Bericht so vor: "This ILO flagship report provides a global overview of the organization of social protection systems, their coverage and benefits, as well as public expenditures on social protection. The report follows a life-cycle approach, starting with social protection for children, followed by schemes for women and men in working age, and closing with pensions and other support for older persons. It also assesses progress towards universal coverage in health. The report further analyses trends and recent policies, such as the negative impacts of fiscal consolidation and adjustment measures, and urgently calls to expand social protection for crisis recovery, inclusive development and social justice."
Der nun vorgelegte 2014/15er Bericht dieser Art des Internationalen Arbeitsbüros stellt die jüngsten Entwicklungen im Bereich der sozialen Absicherung in mehr als 190 Ländern dar und liefert ausführliche Informationen über die sozialen Sicherungssysteme, den Umfang und die Leistungen der sozialen Absicherung und die entsprechenden Ausgaben. Er enthält eine ausgesprochen umfangreiche Datensammlung mit den aktuell verfügbaren Zahlen zu sozialer Absicherung weltweit. Dabei zeigt er auch die negativen Effekte von Finanzkrisen auf die soziale Sicherung dar und nimmt die Folgen der ab 2010 sinkenden Sozialausgaben nicht nur in Europa unter die Lupe.
Den Bericht ergänzt ein detaillierter tabellarischer Überblick über die in den einzelnen Ländern der Welt bestehenden sozialen Sicherungssysteme sowie über den jeweils abgesicherten Bevölkerungsanteil. Anders als im ersten derartigen Bericht beschränkt sich die Zahlenbasis beim nun vorgelegten Weltbericht 2014/15 nicht mehr auf die erfass- bzw. messbare formale soziale Absicherung, sondern betrachtet auch die tatsächliche Absicherung und differenziert bei den verschiedenen Subsystemen zusätzlich zwischen verschiedenen Kategorien wie beitrags- und nicht-beitragsfinanzierten Systemen. Auch wenn die Daten nicht für alle Länder vollständig vorliegen, bietet der statistische Anhang des ILO-Berichts 2014/15 umfangreiches Zahlenmaterial und hilfreiche Daten.
Der Bericht steht in voller Länge auf der Website der ILO zum kostenfreien Download.
Jens Holst, 4.9.14
Spieglein, Spieglein an der Wand…Gesundheitssystemvergleich und was bei 11 Ländern von USA bis Deutschland aktuell herauskommt
 Rankings von Gesundheitssystemen gehören mittlerweile zum gesundheitswissenschaftlichen und -politischen Standardrepertoire. Die Auswahl der Indikatoren, die verglichen werden, reichen aber von simplen Fragen nach der allgemeinen Zufriedenheit bis zu sehr differenzierten Abfragen verschiedenster Leistungsmerkmale. Mit der Auswahl - so die Kritik - lässt sich häufig das Ergebnis manipulieren. Eine Schwachstelle vieler Vergleiche ist ferner die verbreitet fehlende Berücksichtigung der unterschiedlichen strukturellen Bedingungen z.B. der Altersstruktur oder der Erkrankungsrisiken. Werden solche Bedingungen im Rahmen umfangreicher Standardisierungs- und Adjustierungsprozeduren berücksichtigt, schwindet nicht nur die Freude an Rankings, sondern rutscht das eine oder andere Land von so genannten Medaillenrängen ins Mittelfeld oder steigt auf.
Rankings von Gesundheitssystemen gehören mittlerweile zum gesundheitswissenschaftlichen und -politischen Standardrepertoire. Die Auswahl der Indikatoren, die verglichen werden, reichen aber von simplen Fragen nach der allgemeinen Zufriedenheit bis zu sehr differenzierten Abfragen verschiedenster Leistungsmerkmale. Mit der Auswahl - so die Kritik - lässt sich häufig das Ergebnis manipulieren. Eine Schwachstelle vieler Vergleiche ist ferner die verbreitet fehlende Berücksichtigung der unterschiedlichen strukturellen Bedingungen z.B. der Altersstruktur oder der Erkrankungsrisiken. Werden solche Bedingungen im Rahmen umfangreicher Standardisierungs- und Adjustierungsprozeduren berücksichtigt, schwindet nicht nur die Freude an Rankings, sondern rutscht das eine oder andere Land von so genannten Medaillenrängen ins Mittelfeld oder steigt auf.
Bereits seit einigen Jahren schaut der Commonwealth Fund für das US-Gesundheitssystem in denselben Spiegel wie 10 andere internationale Gesundheitssysteme: Australien, Kanada, Frankreich, Niederlande, Neuseeeland, Norwegen, Schweden, Schweiz, Großbritannien und schließlich auch Deutschland. Die Daten für den 2013er-Survey stammt aus mehreren internationalen Studien der Stiftung mit Primär- und Befragungsdaten aus den Jahren 2011 bis 2013, aus einem Scorecard-Projekt der Stiftung und diversen Daten der WHO und OECD.
Die für den Vergleich und das Ranking genutzten Indikatoren stammen aus den Bereichen Behandlungsqualität und deren Unteraspekte wirksame, sichere, koordinierte und patientenzentrierte Behandlung. Ein zweiter Bereich ist der Zugang zum Gesundheitssystem mit den Teilaspekten kostenbedingter Barrieren und Nahtlosigkeit bzw. Zügigkeit der Behandlung. Für den Aspekt Effizienz wird u.a. auf die Höhe der Gesundheitsausgaben, der Verwaltungskosten, die Häufigkeit vermeidbarer Notfallambulanzbesuche und von Doppeluntersuchungen geschaut. Beim Aspekt der Gerechtigkeit im Gesundheitssystem spielen Daten über die schichtspezifische Ungleichversorgung die zentrale Rolle. Als Gesundheitsindikatoren ("healthy lives") dienen die vermeidbare Sterblichkeit in der Behandlung, die Kindersterblichkeit und die im Alter von 60 Jahren erwartbare künftige gesunde Lebenszeit. In jedem Fall verdient dieser Vergleich sowohl wegen der Quantität aber auch wegen der Qualität sewiner Merkmale Aufmerksamkeit. Zusätzlich dokumentiert die Studie auch noch Gesundheitsausgaben (Kaufkraftparitäten) pro Kopf in US-Dollar.
Interessant sind aber nicht nur aus US-Sicht auch die Ergebnisse:
• Beim Insgesamt-Ranking liegt das Gesundheitssystem in den USA auf dem letzten, also elften Platz und das in Großbritannien auf Platz 1. Deutschland rangiert wie oft bei solchen Vergleichen im Mittelfeld auf Platz 5.
• Das britische National Health-Service-System liegt bei 8 der 11 Einzelindiokatoren ebenfalls auf Platz 1.
• Deutschland liegt bei keinem der 11 Indikatoren auf Platz 1. Das beste Ergebnis ist ein zweiter Platz beim Zugang zum System, das schlechteste gibt es mit einem zehnten Platz bei der koordinierten Versorgung. Aber auch die Effizienz (Platz 9( und die patientenzentrierte Versorgung (Platz 7) lassen zu wünschen übrig.
Diese und viele weiteren Daten finden sich im Report Mirror, mirror on the wall. How the performance oft he U.S.Health Care System compares internationally - 2014 update von Karen Davis et al., der mit 32 Seiten Umfang im Juni 2014 erschienen ist. Der Report ist komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 19.6.14
Soziale Determinanten der Gesundheit in den 53 europäischen Mitgliedstaaten der WHO
 In Europa sind in den letzten 30 Jahren erhebliche Fortschritte im Hinblick auf die gesundheitliche Lage der Bevölkerung erzielt worden. Aber sowohl zwischen als auch innerhalb der 53 europäischen Mitgliedsstaaten der WHO bestehen weiterhin ausgeprägte soziale Ungleichheiten für die Gesundheit. Das Konzept "Closing the Gap" konnte bislang nur in geringem Maße umgesetzt werden.
In Europa sind in den letzten 30 Jahren erhebliche Fortschritte im Hinblick auf die gesundheitliche Lage der Bevölkerung erzielt worden. Aber sowohl zwischen als auch innerhalb der 53 europäischen Mitgliedsstaaten der WHO bestehen weiterhin ausgeprägte soziale Ungleichheiten für die Gesundheit. Das Konzept "Closing the Gap" konnte bislang nur in geringem Maße umgesetzt werden.
Der von dem europäischen Büro der Weltgesundheitsorganisation unter der Leitung von Prof. Michael Marmot (London) erstellte und Ende 2013 veröffentlichte Bericht basiert auf den Ergebnissen der folgenden dreizehn Arbeitsgruppen: 1 Frühe Kindheit, Erziehung und Familie, 2 Beruf und Arbeitsbedingungen, 3 Soziale Exklusion und soziale Benachteiligung, 4 Bruttosozialprodukt, Einkommen und Sozialleistungen, 5 Aufrechterhaltung des Gemeinwohls, 6 Prävention und Gesundheitsleistungen, 7 Gender, 8 Ältere Bevölkerung 9 Governance, 10 Investitionen für Gesundheit, 11 Globale Einflüsse, 12 Soziale Gerechtigkeit und Menschenrechte, 13 Messprobleme und Gesundheitsziele.
Einer der im Bericht dokumentierten Indikatoren für die Gesundheit ist die mittlere Lebenserwartung (MLE). Dies ist ein sehr robuster Indikator für die Gesundheit. Er misst allerdings nur die Lebensdauer, nicht aber die gesundheitliche Lebensqualität und das individuelle und subjektive Wohlbefinden. Chronische Krankheiten und Beschwerden wie z.B. Diabetes mellitus, starke Rückenschmerzen und vielfältige Suchtproblematiken können die subjektive Lebensqualität erheblich einschränken. Als amtliche Todesursachen treten sie allerdings kaum in Erscheinung.
Innerhalb der 53 europäischen WHO-Mitgliedsländer gibt es erhebliche Unterschiede für die MLE. Bei den Männern beläuft sich der Unterschied zwischen dem Land mit der höchsten und der niedrigsten MLE
auf 17 Jahren: Israel 80 Jahre, Russland 63 Jahre. Der entsprechende Unterschied beträgt bei den Frauen 12 Jahre: Spanien 85 Jahre, Kirgisien 73 Jahre. Hier noch die Ränge 2-5 für die MLE. Frauen: Frankreich, Italien, San Marino und Andorra. Männer: Island, Schweden, Schweiz und Malta.
Frauen aus Spanien haben die höchste mittlere Lebenserwartung unter den 53 WHO-Mitgliedsstaaten. Spanien ist zugleich eines der "Sorgenkinder" der EU, insbesondere wegen der extrem hohen Arbeitslosigkeit.
Leider geht der WHO-Report nicht darauf ein, welche Gründe es für die hohe Lebenserwartung der spanischen Frauen geben könnte. Ländervergleiche haben das primäre Ziel, voneinander zu lernen. Offen bleibt somit die Frage, was wir von Spanien im Hinblick auf die dortige höchste europäische Lebenserwartung bei Frauen lernen könnten. Der häufig zu hörende Verweis auf die positive gesundheitliche Bedeutung der mediterranen Ernährungsweise dürfte wahrscheinlich nicht ausreichen.
Deutschland findet sich bei fast allen Indikatoiren im mittleren oder oberen Mittelfeld.
Der 44 Seiten umfassende Report Review of social determinants and the health divide in the WHO European Region. Final report (2013) ist kostenlos erhältlich
Uwe Helmert, 6.4.14
Weltweit enorme Krankheitslasten und Verluste an Lebensjahren allein durch 7 unerwünschte Behandlungsereignisse in Krankenhäusern
 Regelmäßig auftretende, mehr oder weniger spektakuläre Behandlungsfehler, Hygieneskandale, MRSA-Infektionen oder Druckgeschwüre machen deutlich, dass medizinische Behandlungen trotz allen technischen Fortschritts unsicher sein und Patienten bis zum vorzeitigem Tode schaden können. Ob dies das Werk "einzelner schwarzer Schafe" oder "seltene Ausnahmen" sind, könnte nur durch die größtmögliche Transparenz über die Häufigkeit derartiger unerwünschter Ereignisse geklärt werden.
Regelmäßig auftretende, mehr oder weniger spektakuläre Behandlungsfehler, Hygieneskandale, MRSA-Infektionen oder Druckgeschwüre machen deutlich, dass medizinische Behandlungen trotz allen technischen Fortschritts unsicher sein und Patienten bis zum vorzeitigem Tode schaden können. Ob dies das Werk "einzelner schwarzer Schafe" oder "seltene Ausnahmen" sind, könnte nur durch die größtmögliche Transparenz über die Häufigkeit derartiger unerwünschter Ereignisse geklärt werden.
Ein Forscherteam in den USA hat dazu in Zusammenarbeit mit WHO-Wissenschaftlern am 18. September 2013 die Ergebnisse einer aufwändigen Untersuchung der "global burden of unsafe medical care" in Ländern mit niedrigem oder mittlerem und hohem Einkommen vorgelegt. Als Grundlage ihrer Studie führten sie eine Suche nach entsprechender Beobachtungsstudien in englischer Sprache durch, fanden in der Zeit nach 1976 über 16.000 Artikel und nahmen davon über 4.000 Beiträge genauer unter die Lupe. Sie konzentrierten sich dabei auf sieben unerwünschte, schädliche Ereignisse innerhalb der stationären gesundheitlichen Versorgung, wie z.B. unerwünschte Arzneimittelwirkungen, im Krankenhaus erworbene Lungenentzündungen und Druckgeschwüre, Stürze im Krankenhaus, Thrombosen und verschiedene Blutinfektionen.
Heraus kamen u.a. die folgenden Informationen und Erkenntnisse:
• 2009 hatten die rund 1,1 Milliarden BürgerInnen in "high-income countries (HIC)" ungefähr 117,8 Millionen Krankenhausaufenthalte. Bei den rund 5.5 Milliarden Einwohner der "low- and middle-income countries (LMIC)" waren es 203,1 Millionen Krankenhausaufenthalte.
• In den HICs lag die Krankenhausrate bei 10,8 Aufenthalten je 100 BürgerInnen und Jahr, während die Rate in den LMICs mit 3,7/100 BürgerInnen/Jahr wesentlich niedriger lag.
• Während der insgesamt 421 Millionen Krankenhausbehandlungen traten rund 42,7 Millionen unerwünschter Ereignisse auf, 16,8 Millionen in HICs und 25,9 Millionen in LMICs. Je 100 Krankenhausbehandlungen waren dies in HICs rund 14,2 und in LMICs rund 12,7 unerwünschte Ereignisse.
• Die Inzidenz der sieben ausgewählten unerwünschten Ereignisse unterschied sich nicht nur untereinander erheblich, sondern auch zwischen den beiden Länderarten. Sie betrug bei den unerwünschten Arzneimittelwirkungen in den HICs 5% und in LMICs 2,9%. Das häufigste unerwünschte Ereignis war in HICs das Auftreten unerwünschter Arzneimittelwirkungen (5% pro 100 Krankenhausbehandlungen) und in LMICs das Auftreten von venösen Thrombosen (3% pro 100 Krankenhausbehandlungen).
• Rechnet man die Ereignisse in Verluste an behinderungsbereinigten Lebensjahren (so genannte "disability-adjusted life years (DALYs)") um, verloren die BürgerInnen in den HICs 7,2 Millionen Jahre, die in den LMICs mehr als doppelt so viel, nämlich15,5 Millionen. Der Großteil dieser Verluste beruht auf vorzeitigem Tod (insgesamt=80,2%; HIC=78,6%; LMICs=80,7%). Der Anteil kurzfristiger und langanhaltender Behinderungen betrug insgesamt 14,4% und 5,3%.
• Damit stellen allein diese sieben Ereignisse die zwanzighäufigste Ursache für Morbidität und Mortalität dar. Die Bedeutung der unerwünschten Behandlungswirkungen würde noch steigen, wenn weitere bekannte Ereignisarten in die Analyse einbezogen würden. Hinzu kommt nach Meinung der AutorInnen eine nicht dokumentierte Dunkelziffer dieser Ereignisse in allen Gesundheitssystemen.
Die Schlussfolgerung der WissenschaftlerInnen lautet folgerichtig, es ginge weltweit zwar darum, den Zugang zur gesundheitlichen Versorgung möglichst zu verbessern, dies müsse aber Hand in Hand mit Investitionen einher gehen, das Risiko unerwünschter Behandlungsfolgen zu senken.
Die Studie The global burden of unsafe medical care: an observational study von Ashish K. Jha, Itzia Larizgoitia, Carmen Audera-Lopez, Nittita Prasopa-Plaizier, Hugh Water und David W. Bates ist am 18. September 2013 online als Beitrag der Zeitschrift "BMJ Quality & Safety" (22: 809-815) erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 21.9.13
Lebenserwartung und Anzahl der gesunden Lebensjahre nehmen von 1990 bis 2010 zu - mit Unterschieden und Anregungen zum Nachdenken
 500 ForscherInnen aus 300 Forschungseinrichtungen in 50 Ländern berichten u.a. über 291 Krankheiten in 21 weltweiten Regionen, in 20 Altersgruppen, bewerten 67 Risikofaktoren und vergleichen mit dafür geeigneten Indikatoren, Maßen und Instrumenten die Verhältnisse im Jahr 2010 mit denen des Jahres 1990. Alles zusammen genommen ist dies die "Global Burden Disease (GBD) Study" 2010.
500 ForscherInnen aus 300 Forschungseinrichtungen in 50 Ländern berichten u.a. über 291 Krankheiten in 21 weltweiten Regionen, in 20 Altersgruppen, bewerten 67 Risikofaktoren und vergleichen mit dafür geeigneten Indikatoren, Maßen und Instrumenten die Verhältnisse im Jahr 2010 mit denen des Jahres 1990. Alles zusammen genommen ist dies die "Global Burden Disease (GBD) Study" 2010.
Wer sich über die Geschichte der GBD noch etwas ausführlicher informieren will, kann dies in dem "Lancet"-Aufsatz "The story of GBD 2010: a "super-human" effort" (Volume 380, issue 9859: 2067-2070) kostenlos tun.
Ansonsten ist in der Ausgabe des renommierten Medizinjournals "The Lancet" vom 15. Dezember 2012 eine Vielzahl von Ergebnissen veröffentlicht worden. Dazu zählen folgende Aufsätze: "Age-specific and sex-specific mortality in 187 countries, 1970-2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010", "Global and regional mortality from 235 causes of death for 20 age groups in 1990 and 2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010", "Common values in assessing health outcomes from disease and injury: disability weights measurement study for the Global Burden of Disease Study 2010", "Healthy life expectancy for 187 countries, 1990-2010: a systematic analysis for the Global Burden Disease Study 2010", "Years lived with disability (YLDs) for 1160 sequelae of 289 diseases and injuries 1990-2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010", "Disability-adjusted life years (DALYs) for 291 diseases and injuries in 21 regions, 1990-2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010" und "A comparative risk assessment of burden of disease and injury attributable to 67 risk factors and risk factor clusters in 21 regions, 1990-2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010."
Die Ergebnisse zu der Anzahl von Lebensjahren in Gesundheit bei steigender Lebenserwartung ("healthy life expectancy (HALE)"), einer der Dreh- und Angelpunkte der Demografiedebatte, sollen hier etwas ausführlicher vorgestellt werden:
• Mit einer aufwändigen und einheitlichen Methodik (dies schließt unterschiedliche Datenqualität nicht aus)legen die Autoren für 187 Länder Daten zur Verlängerung der Lebenserwartung und zum Umfang der gesunden Lebensjahre in den Jahren 1990 und 2010 vor. Sie schätzen dabei den Einfluss der in den letzten 20 Jahren geänderten Kinder- und Erwachsenensterblichkeit und von Behinderung auf die Gesamtveränderung der Bevölkerungsgesundheit.
• Die Anzahl der bei der Geburt zu erwartenden gesunden Lebensjahre betrug für alle Männer weltweit 1990 54,4 Jahre und stieg 2010 auf 58,3 Jahre. Bei Frauen waren es 57,8 und 61,8 Jahre. Ein 60-jähriger Mann hatte noch 12,3 bzw. 13,4 gesunde Jahre vor sich. Bei Frauen waren es 14,1 und 15,2 Jahre.
• In Deutschland stieg nach den GBD-Daten die Lebenserwartung der Männer zwischen 1990 und 2010 bei Geburt von 71,9 auf 77,5 Jahre. Die Anzahl der gesunden Lebensjahre stieg von 62,3 auf 65,8 Jahre.
• Einem Jahr zusätzlicher Lebenszeit ab Geburt steht 2010 für Männer im Durchschnitt aller Länder ein Zuwachs gesunder Lebenszeit von 0,84 Jahren gegenüber (für Frauen 0,81 Jahre). Die Lücke zwischen der künftigen Lebenserwartung und den noch bevorstehenden gesunden Lebensjahren wird mit steigendem Lebensalter größer. Ein Jahr längeres Leben führt bei 50-jährigen Männern zu 0,62 gesunden Jahren (bei Frauen sind dies 0,56 Jahre). Obwohl also gewonnene Lebensjahre keineswegs komplett in Krankheit verbrachte Lebensjahre sind, Altern zum größten Teil in "Gesundheit altern" bedeutet, wird ein Teil der gewonnenen Lebensjahre in Krankheit und Behinderung verbracht bzw. führt zu einer Zunahme von Morbidität. Zu der Anzahl der in Krankheit oder Behinderung verbrachten Lebensjahre ("years lived with disability (YLD)") tragen insbesondere psychische und verhaltensbezogene Erkrankungen wie Depressionen, Angst oder die Folgen von Alkohol- und Drogenmissbrauch bei.
• Für die Debatte darüber, ob es bei einer Verlängerung der Lebenserwartung eine Expansion oder eine Kompression von Morbidität gibt, bedeutet dies zweierlei: Es gibt sowohl Evidenz für eine leichte bis moderate Zunahme von Morbidität in Gestalt der krank oder behindert verbrachten Lebensjahre bei hinausgeschobener Mortalität als auch dafür, dass der Großteil der gewonnenen Lebensjahre in Gesundheit gelebt werden können, potenzielle altersassoziierte Morbidität also ins höhere Lebensalter verschoben wird. Die mit den Daten möglichen internationalen Vergleiche zeigen aber auch, dass es sich hierbei keineswegs um ein rein naturbedingtes, sondern um ein stark sozial bedingtes und damit im Prinzip auch um ein durch Prävention oder Sozialkapital beeinflussbares Geschehen handelt. Die Autoren der GBD-Studie fassen dies so zusammen: "Although we report clear evidence of expansion of morbidity, we also show substantial variation among countries in age-specific YLD per person. For people aged younger than 1 year, the highest levels exceed the lowest by 4,9 to 12,4. Even in people aged older than 50 years, for whom disability rates are higher, YLD per person vary by a factor of 1,6 to 2,2 among countries. Although we might expect that addition of marginal years of life through reduction of mortality will be associated with more years lost because of morbidity and disability, there is clearly scope for healthier ageing. To achieve real compression of the total disability in a population, healthy life expectancy would need to increase faster than life expectancy at birth. Although this goal is ambitious, enormous potential exists for making substantial progress. If all countries could achieve the disability rates similar to countries such as Japan, healthy life expectancy would increase substantially and would probably be accompanied by reductions in costs of managing disease and injury sequelae. The potential for healthier ageing, and for reduction of YLD, is supported by several studies of socioeconomic variations in healthy life expectancy in high-income countries."
• Die gerade angesprochenen Länderunterschiede sind enorm: Während 2010 japanische Männer 68,8 und japanische Frauen ab Geburt 71,7 gesunde Lebensjahre zu erwarten haben, und damit weltweit Platz 1 einnehmen, betragen die entsprechenden Werte in Haiti 27,9 und 37,1 Jahre, was den Schluss-Platz 187 bedeutet. Entsprechend haben 2010 Männer in Haiti aber auch nur eine durchschnittliche Lebenserwartung von 32,5 und Frauen von 37,1 Jahren, also Werte, die es in Europa seit Jahrhunderten nicht mehr gibt.
• Deutschland befindet sich im Übrigen weder 1990 noch 2010 unter den 10 Ländern mit der höchsten Anzahl gesunder Lebensjahre.
Der Aufsatz schließt mit einer Reihe (selbst-)kritischer Anmerkungen zur Güte und Messbarkeit der Indikatoren in unterschiedlichen Ländern und Kulturen. Die Autoren erklären außerdem die Absicht regelmäßiger und häufiger Analysen zur weltweiten Lebenserwartung und zur Erwartung gesunder Lebensjahre vorzulegen. Außerdem beabsichtigen sie, zusätzliche Analysen über die Einflussfaktoren auf das Krankheitsgeschehen und die Veränderungen der gesunden Lebensjahre zu erstellen.
Eine Übersicht über den Inhalt dieses "Lancet"-Themenheftes mit Links zu den Abstracts der einzelnen Aufsätze steht kostenlos zur Verfügung.
Zu dem materialreichen Aufsatz "Healthy life expectancy for 187 countries, 1990—2010: a systematic analysis for the Global Burden Disease Study 2010" von Joshua A Salomon, Haidong Wang, Michael K Freeman, Theo Vos, Abraham D Flaxman, Alan D Lopez, Christopher JL Murray (The Lancet, Volume 380, Issue 9859, Pages 2144 - 2162) gibt es ohne zusätzlichen Aufwand leider nur ein Abstract kostenlos. Durch eine kostenlose und auch hinsichtlich unerwünschter Werbung folgenlose Anmeldung als User auf der Lancet-Website bekommt man aber für diesen und manch anderen Aufsatz im "Lancet" kostenlosen Zugang zum gesamten Text.
Bernard Braun, 18.12.12
24% aller Todesfälle bei den mit weniger als 75 Jahren Verstorbenen in 16 Ländern wären vermeidbar gewesen!
 Die gute Nachricht einer Untersuchung über Todesfälle bei den unter 75-Jährigen in 16 mehr oder weniger wohlhabenden Ländern Europas, Nordamerikas und Asiens (Australien, Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Japan, Niederlande, Neuseeland, Norwegen, Schweden, Großbritannien, die USA und Deutschland), die durch rechtzeitige und wirksame gesundheitliche Versorgung vermeidbar gewesen wären (Konzept der "amenable mortality"),lautet: Die Häufigkeit sank in 10 der 16 Länder zwischen 1997-1998 und 2006-2007 um 30% und mehr. Am stärksten sank die Rate der vermeidbaren Todesfälle mit rund 42% in Irland, am schwächsten mit 20,5% in den USA.
Die gute Nachricht einer Untersuchung über Todesfälle bei den unter 75-Jährigen in 16 mehr oder weniger wohlhabenden Ländern Europas, Nordamerikas und Asiens (Australien, Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Japan, Niederlande, Neuseeland, Norwegen, Schweden, Großbritannien, die USA und Deutschland), die durch rechtzeitige und wirksame gesundheitliche Versorgung vermeidbar gewesen wären (Konzept der "amenable mortality"),lautet: Die Häufigkeit sank in 10 der 16 Länder zwischen 1997-1998 und 2006-2007 um 30% und mehr. Am stärksten sank die Rate der vermeidbaren Todesfälle mit rund 42% in Irland, am schwächsten mit 20,5% in den USA.
Die für die Bevölkerung in einigen dieser Länder weniger guten Nachrichten lauten aber:
• 2006/2007 waren 24% der Todesfälle bei den unter 75-Jährigen in den 16 Ländern vermeidbar.
• Die Rate der vermeidbaren Todesfälle war mit 55 Todesfällen pro 100.000 Personen in Frankreich am niedrigsten und in den USA mit 95,5 Todesfällen/100.000 Personen am höchsten. Niedrig war diese Rate auch noch in Australien und Italien, hoch in Großbritannien und Dänemark.
• Deutschland lag wie in den meisten international vergleichenden Studien im Mittelfeld: 1997/98=106 und 2006/07=78 vermeidbare Todesfälle/100.000 Personen.
• Was die Ratenunterschiede wirklich bedeuten, machen die AutorInnen an einem Beispiel deutlich: Wenn die USA es geschafft hätten, das Niveau der drei besten Länder Frankreich, Australien und Italien zu erreichen, wären dort 2006/2007 84.300 weniger Personen unter 75 Jahren gestorben.
Die AutorInnen schauten sich für diese Untersuchung im Auftrag des Commonwealth Fund die Mortalitätsdaten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die dokumentierten Todesursachen im Zusammenhang mit ausgewählten Infektionserkrankungen von Kindern, Krebs, Diabetes, Schlaganfall, Bluthochdruck, ischämischen Herzerkrankungen und Komplikationen bei üblichen Operationen an.
Von dem am 12. September online veröffentlichten Aufsatz "Variations in Amenable Mortality—Trends in 16 High-Income Nations" von E. Nolte und M. McKee in der Fachzeitschrift "Health Policy" gibt es keine kostenlose Version. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse gibt es aber kostenlos in der "In the Literature"-Reihe des Commonwealth Fund.
Bereits im August 2011 waren Ergebnisse einer Untersuchung über die Häufigkeit der durch Versorgungsangebote vermeidbaren Todesfälle in den USA veröffentlicht worden. Sie zeigten, dass es zusätzlich unabhängig vom Niveau innerhalb von Ländern erhebliche Unterschiede gibt. Auch vom Aufsatz Mortality Amenable to Health Care in the United States: The Roles of Demographics and Health Systems Perfor-mance von S. C. Schoenbaum, C. Schoen, J. L. Nicholson und J. C. Cantor, am 25. August 2011 online im "Journal of Public Health Policy" veröffentlicht, gibt es eine Zusammenfassung in der Reihe "In the Literature" des Commonwealth Fund.
Bernard Braun, 28.9.11
Gesundheits- und Versorgungsqualitätsindikator Säuglingssterblichkeit: Deutschland im EU-Mittelfeld.
 Die Säuglingssterblichkeit ist ein gern gewählter Indikator, einerseits die gesundheitliche Lage der Bevölkerung eines Landes zu beurteilen und andererseits aber auch um den Grad und die Qualität der medizinischen Versorgung bewerten zu können.
Die Säuglingssterblichkeit ist ein gern gewählter Indikator, einerseits die gesundheitliche Lage der Bevölkerung eines Landes zu beurteilen und andererseits aber auch um den Grad und die Qualität der medizinischen Versorgung bewerten zu können.
Für eine internationale Vergleichbarkeit und die Verlaufsbetrachtung der Säuglingssterblichkeit ist es aber wichtig, den Einfluss der kurz- bis langfristig unterschiedlich hohen Anzahl der pro Land erfolgten Geburten auszublenden
Dazu berechnet man eine Säuglingssterbeziffer, welche die Anzahl der Sterbefälle im ersten Lebensjahr auf die Zahl der Lebendgeborenen bezieht. Der Indikator bildet also die Anzahl der Sterbefälle je 1.000 Lebendgeborene ab.
Auf der Basis der für internationale Vergleiche geeigneten Daten von EUROSTAT, dem Statistischen Amt der Europäischen Gemeinschaft, liegt in einem Beitrag in der Ausgabe 4/2009 von "Bevölkerungsforschung Aktuell", den Mitteilungen aus dem Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung eine Darstellung der Säuglingssterblichkeit in allen 27 EU-Ländern für das Jahr 2006 vor.
Die wichtigsten Ergebnisse lauten:
• Insgesamt ging die Säuglingssterblichkeit im Durchschnitt aller EU-27 Staaten im Verlauf der letzten zehn Jahre um 30 % zurück.
• Nachwievor existieren aber deutliche Unterschiede zwischen den Ländern: In einer Spitzengruppe, der Luxemburg, Finnland und Schweden angehören, sterben zwischen 2,5 und 3 Säuglinge, in Bulgarien und Rumänien dagegen zwischen 9 und 14 Säuglingen. Deutschland befindet sich in einer Gruppe mit Malta, Österreich, Griechenland, Irland, Dänemark, Frankreich, Spanien und Belgien mit 3,6 bis 4 gestorbenen Säuglingen je 1.000 Lebendgeborenen. Bei Deutschland ist hervorzuheben, dass die Sterblichkeit noch in den 1960er Jahren schlechter war als in vergleichbaren Ländern.
• Ein hoher Risikofaktor für Neugeborene ist das Geburtsgewicht. Säuglinge mit einem Geburtsgewicht von unter 2.500 Gramm unterliegen einer höheren Sterblichkeit als Kinder mit einem Gewicht von mehr als 2.500 Gramm bei der Geburt.
• Auch die medizinische Betreuung wirkt sich deutlich auf die Höhe der Säuglingssterblichkeit aus. Bei der Anzahl von Personal wie Hebammen und Schwestern beziehungsweise Pfleger, die zur Betreuung von Schwangeren zur Verfügung stehen, gibt es deutliche regionale Unterschiede. Die größte Dichte an Pflegekräften und Hebammen weisen die Länder in Nord- und Westeuropa auf. Hier gibt es mehr als 100 Pflegekräfte und Hebammen je 10.000 Einwohner, in Irland sind es mit 195 die meisten, gefolgt von den Niederlanden mit 146. Deutschland liegt zusammen mit einigen anderen Ländern wie Frankreich, Italien, Finnland aber auch der Tschechischen Republik und Ungarn mit rund 80 Pflegekräften und Hebammen je 10.000 Einwohner im mittleren Versorgungsbereich. In Osteuropa beträgt die Zahl unter 70, in Bulgarien, Rumänien und Griechenland liegt sie sogar unter 50.
Der Beitrag "Vergleich der Säuglingssterblichkeit in den Ländern der Europäischen Union" von Karla Gärtner bzw. die gesamte Ausgabe des Infodienstes "Bevölkerungsforschung Aktuell" sind kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 13.11.09
EU-Studie zum Alkoholkonsum: Der Preis für alkoholische Getränke hat auch Einfluss auf die Konsummenge
 Alkohol ist nach Erkenntnissen der EU-Kommission nach Tabak und Bluthochdruck der dritte maßgebliche Risikofaktor für eine erhöhte Mortalität und Behinderungen unter der EU-Bevölkerung. Die Kosten des Alkoholmissbrauchs wurden 2003 auf rund 125 Milliarden Euro geschätzt, was 1,3% des EU-Bruttoinlandsprodukts entspricht. Gleichzeitig ist die Produktion und der Vertrieb alkoholischer Getränke aber ein wichtiger Wirtschaftszweig, der für Arbeitsplätze und Steuereinnahmen sorgt.
Alkohol ist nach Erkenntnissen der EU-Kommission nach Tabak und Bluthochdruck der dritte maßgebliche Risikofaktor für eine erhöhte Mortalität und Behinderungen unter der EU-Bevölkerung. Die Kosten des Alkoholmissbrauchs wurden 2003 auf rund 125 Milliarden Euro geschätzt, was 1,3% des EU-Bruttoinlandsprodukts entspricht. Gleichzeitig ist die Produktion und der Vertrieb alkoholischer Getränke aber ein wichtiger Wirtschaftszweig, der für Arbeitsplätze und Steuereinnahmen sorgt.
Die EU-Kommission wollte nun in einer EU-weiten Studie über die Erschwinglichkeit von Alkohol die potenziellen Wirkungen der leichten Finanzierbarkeit eines schädlichen Alkoholkonsums und die Steuerungsmöglichkeiten über die Preisgestaltung prüfen lassen.
Zu den zentralen Befunde der Studie, die nicht nur epidemiologisch von Interesse sind, sondern auch in präventiver Hinsicht überaus große Bedeutung haben gehören:
• In den meisten Ländern der EU sind alkoholische Getränke seit Mitte der 90er Jahre sehr viel billiger geworden bzw. in Relation zur Einkommensentwicklung deutlich günstiger zu erstehen, in einigen Ländern um über die Hälfte
• Es gibt eine negative Beziehung zwischen dem Preis des Alkohols und seinem Konsum und eine positive Beziehung zwischen Einkommen und Alkoholkonsum. In der Summe besteht ein enger Zusammenhang zwischen dem Ausmaß des Alkoholkonsums und der Erschwinglichkeit alkoholischer Getränke in Europa: Langfristig führt eine Erhöhung der Erschwinglichkeit um 1% zu einer Erhöhung des Konsums um 0,32%. Verschlechtert sich die Erschwinglichkeit um denselben Prozentbetrag, sinkt auch der Konsum um den genannten Wert.
• Es gibt weiterhin einen engen Zusammenhang zwischen Alkoholkonsum und verschiedenen Negativeffekten: Zahl der Verkehrsunfälle, Zahl der Verkehrstoten, Auftreten von Leberzirrhosen. Dabei führt ein erhöhter Alkoholkonsum zu einem nur zu einer geringfügig niedrigeren Erhöhung der schädlichen Folgen: Wenn der Pro-Kopf-Alkoholkonsum um 1% zunimmt, steigt innerhalb des Folgejahres die Anzahl der Verkehrstoten um 0,85%, der Verkehrsunfällen um 0,61% und die Neuerkrankungsrate wegen Leberzirrhose um 0,37%.
• Der grenzüberschreitende Einkauf von Alkoholika kann zu einer Erhöhung des Alkoholkonsums und entsprechenden Folgeschäden führen, wenn die Preisunterschiede zwischen den Ländern größer sind.
Trotz dieser zum Teil auch bereits in der Vergangenheit vermuteten und diskutierten unerwünschten Effekte wurde in der Mehrzahl der EU-Mitgliedsländer Alkohol-Preispolitik vorrangig aus fiskalpolitischer und selten aus Public Health-Sicht verstanden und betrieben. Anzeichen dafür sind die bereits genannte EU-weite Verbilligung von alkoholischen Getränken, die Duldung von Alkoholpreisen unterhalb der Kostendeckungsgrenze oder solche Vermarktungsmethoden wie "two for one" oder "happy hours". Einige Gegenaktivitäten wie etwa das deutsche "Apfelsaft-Gesetz", nach dem in Gaststätten mindestens ein alkoholfreies Getränk billiger sein muss als das billigste alkoholische Getränk oder das Verbot von Niedrigpreisangeboten in Belgien gehen in die richtige Richtung, sind aber eher Ausnahmen.
Ihre eigene und viele andere Untersuchungen belegen nach Ansicht der RAND-Forscher, "that the price and affordability of alcohol do impact on levels of harmful and hazardous alcohol consumption" ("dass Preis und Erschwinglichkeit von Alkohol das Ausmaß von schädlichem und gesundheitsgefährlich Alkoholkonsum mitbeeinflussen") Daher empfehlen sie den politisch Verantwortlichen, um alkoholassoziierte Schäden wirksam zu verringern, ohne wenn und aber solche Maßnahmen durchzuführen, die den Preis beeinflussen und Alkohol weniger erschwinglich machen.
Trotz der großen Bedeutung einer gezielten und EU-weiten Preispolitik weisen die RAND-Gutachter darauf hin, dass schädlicher und gefährlicher Alkoholkonsum ein multifaktorielles Problem ist und eine Gegenstrategie einen Policy-Mix mehrerer Aspekte und evidenzbasierter Maßnahmearten sein muss. Dazu gehört, die Dichte der Verkaufsstellen von Alkohol zu verringern, das Mindestalter für den Einkauf von alkoholischen Getränken spürbar zu erhöhen und Maßnahmen gegen Alkohol im Straßenverkehr durchzuführen oder gegebenenfalls zu verschärfen.
Die Studie wurde im Auftrag der EU-Kommission von dem privaten Think-Tank RAND Europe durchgeführt. Die Studie basiert auf vier Informationsquellen: Eine Analyse der wissenschaftlichen Literatur, eine Sekundäranalyse quantitativer Daten über die Erreichbarkeit von Alkohol, Besteuerung, Konsum und unerwünschte Folgen, eine Online-Umfrage bei 293 Mitgliedern des "European Alcohol and Health Forum" und des "Committee on National Alcohol Policy and Action", und eine Diskussion der gewonnenen Ergebnisse in einem Experten-Workshop.
Quelle: Lila Rabinovich, Philipp-Bastian Brutscher, Han de Vries, Jan Tiessen, Jack Clift, Anais Reding: The affordability of alcoholic beverages in the European Union Understanding the link between alcohol affordability, consumption and harms, Prepared for the European Commission DG SANCO EUROPE, European Commission, 2009, PDF 1,9 MB, 145 Seiten
PDF-Datei verfügbar über die Download-Seite
PDF-Datei, direkter Link
Bernard Braun, 25.7.09
Länder, in denen wenig Rad gefahren und zu Fuß gegangen wird, haben auch ein größeres Übergewichtsproblem
 Ein zu geringes Ausmaß an körperlicher Bewegung, durch Jogging oder Radfahren, Gartenarbeit oder Sport, wirkt sich oft negativ auf das Körpergewicht aus und erhöht das Risiko von Übergewicht und Adipositas. So viel ist aus einer Reihe von Studien bereits bekannt, bei denen man die körperliche Aktivität und den Body-Mass-Index von Kindern oder auch Erwachsenen miteinander in Beziehung gesetzt hat. Eine neuere, jetzt in der Zeitschrift "Journal of Physical Activity and Health" veröffentlichte Studie hat nun noch einmal untersucht, ob dieser Zusammenhang nicht nur auf der Ebene von Individuen, sondern auch auf Länder-Ebene feststellbar ist. Konkret stand die Frage im Raum: Zeigt sich auch im Vergleich nordamerikanischer und europäischer Länder, dass dort, wo Bürger/innen in ihrem Alltag viele Erledigungen und Wege zu Fuß oder mit dem Fahrrad bewältigen, sich dies auch in einem niedrigeren Vorkommen von Übergewicht niederschlägt?
Ein zu geringes Ausmaß an körperlicher Bewegung, durch Jogging oder Radfahren, Gartenarbeit oder Sport, wirkt sich oft negativ auf das Körpergewicht aus und erhöht das Risiko von Übergewicht und Adipositas. So viel ist aus einer Reihe von Studien bereits bekannt, bei denen man die körperliche Aktivität und den Body-Mass-Index von Kindern oder auch Erwachsenen miteinander in Beziehung gesetzt hat. Eine neuere, jetzt in der Zeitschrift "Journal of Physical Activity and Health" veröffentlichte Studie hat nun noch einmal untersucht, ob dieser Zusammenhang nicht nur auf der Ebene von Individuen, sondern auch auf Länder-Ebene feststellbar ist. Konkret stand die Frage im Raum: Zeigt sich auch im Vergleich nordamerikanischer und europäischer Länder, dass dort, wo Bürger/innen in ihrem Alltag viele Erledigungen und Wege zu Fuß oder mit dem Fahrrad bewältigen, sich dies auch in einem niedrigeren Vorkommen von Übergewicht niederschlägt?
Die US-amerikanische Forschungsgruppe hat dazu eine Vielzahl nationaler Studien herangezogen und die dort gefundenen Ergebnisse für einen internationalen Vergleich aufbereitet. In Deutschland war dies die Studie "Mobilität in Deutschland (MiD)", eine bundesweite Befragung von 50.000 Haushalten zu ihrem alltäglichen Verkehrsverhalten im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung. Die Umfrage wurde erstmals im Jahr 2002 durchgeführt und wird im Jahr 2008/2009 wiederholt. (vgl: Mobilität in Deutschland) Insgesamt konnten die Wissenschaftler dann Daten aus 15 Ländern in Europa, Nordamerika und Australien berücksichtigen.
Um einen Indikator zu bekommen, der das Ausmaß körperlicher Bewegung studienübergreifend benennt, verwendeten sie die Angabe: Wie viele der alltäglichen Wegstrecken (zur Arbeit, zum Einkaufen, zum Arzt usw.) werden im Landesdurchschnitt zu Fuß, mit dem Rad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln bestritten in Relation zu allen Wegen, also auch den mit dem Auto zurück gelegten. Öffentliche Verkehrsmittel wurden einbezogen, da man zu den Haltestellen ja auch in der Regel zu Fuß oder mit dem Rad gelangt. Zugleich verwendeten sie auch Studien, in denen die Verbreitung von Adipositas (Body-Mass-Index >= 30) erfasst worden ist, sei es durch objektive Messungen, sei es durch Befragungen und Selbstangaben. Alle Studien stammten aus den Jahren 1994 bis 2006. 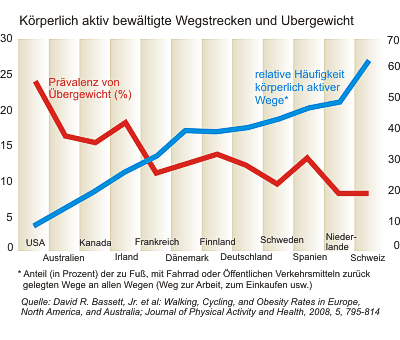
Als Ergebnis zeigte sich dann: Länder mit dem höchsten Anteil adipöser Bürger/innen wiesen auch nur ein sehr geringes Maß an aktiv bewältigten Wegstrecken auf. Besonders deutlich gilt dies etwa für die USA, Kanada und Australien. In der Grafik zeigt die rote Kurve die prozentuale Häufigkeit adipöser Bürger/innen, die blaue Kurve das Ausmaß körperlicher Aktivität durch zu Fuß zurück gelegte Kurzstrecken. In dieser Grafik abgebildet sind Adipositas-Daten aus Umfragen. In einer zweiten Analyse verwendeten die Wissenschaftler auch BMI-Daten auf der Basis objektiver Gewichtsmessungen, um Fehlerquellen auszuschließen. Das Ergebnis war jedoch dasselbe.
In der Studie wurde dann auch noch einmal berechnet, wie viele Kilometer Bürger/innen für die Bewältigung von Kurzstrecken zurücklegen. Hier wurde ebenfalls große Unterschiede deutlich: Während US-Amerikaner im Jahr nur etwa 181 km zu Fuß oder mit dem Rad zurücklegen, sind dies bei Niederländern 1225 km, bei Dänen immerhin noch 1014 km. Deutschland rangiert hier mit 663 km im Mittelfeld.
Quelle: David R. Bassett, Jr., John Pucher, Ralph Buehler, Dixie L. Thompson, and Scott E. Crouter: Walking, Cycling, and Obesity Rates in Europe, North America, and Australia; Journal of Physical Activity and Health, 2008, 5, 795-814
• Hier ist ein Abstract der Studie auf der Website von "Journal of Physical Activity and Health"
• Hier ist eine PDF-Datei mit dem Volltext der Studie auf der Website der Edward J. Bloustein School of Planning and Public Policy, Rutgers, The State University of New Jersey
Gerd Marstedt, 17.3.09
"Trust in Medical Researcher": Warum auch randomisierte Studien Probleme mit dem Einschluss von Minderheiten-Patienten haben?
 Angesichts der oft nach sozialen, ethnischen oder rassischen Kriterien ungleich verteilten Gesundheitsrisiken oder auch ungleicher Behandlungschancen hängt die Aussagekraft oder auch die Machbarkeit evidenzbasierter wissenschaftlicher Studien über die Behandlung von Krankheiten erheblich von der ausreichenden Beteiligung von Patienten aus diesen Risikogruppen ab.
Angesichts der oft nach sozialen, ethnischen oder rassischen Kriterien ungleich verteilten Gesundheitsrisiken oder auch ungleicher Behandlungschancen hängt die Aussagekraft oder auch die Machbarkeit evidenzbasierter wissenschaftlicher Studien über die Behandlung von Krankheiten erheblich von der ausreichenden Beteiligung von Patienten aus diesen Risikogruppen ab.
Was dies bedeutet zeigten gerade zwei Anläufe im Rahmen des "NIH Exploratory Trial in Parkinson's Disease Network (NET-PD)" in den USA. In dieser Studie, die auf Stadt- und Regionsbasis durchgeführt werden sollte, waren 91 % der von den örtlichen ÄrztInnen geworbenen oder zugewiesenen TeilnehmerInnen weiße BürgerInnen, obwohl bekanntermaßen die Inzidenz und Prävalenz von Parkinson mindestens so häufig bei Afroamerikanern und Latinos aussieht wie bei ihren weißen MitbürgerInnen. Ergebnisse einer Studie mit dieser Zusammensetzung sind letztlich nutzlos oder nur sehr bedingt brauchbar.
Da hinter dieser völlig unrepräsentativen Zusammensetzung der Studienpopulation u.a. den Einfluss der jeweiligen örtlichen Ärzte vermutet wurde, starteten die ForscherInnen selber eine Studie, in der sie 200 Ärzte aus 1.250 Angeschriebenen (die Größe der Untersuchungsgruppe beruht auf Zeit- und Geldrestriktionen) in den Studienregionen der NET-PD im Jahre 2006 nach ihren Einstellungen und Überzeugungen über das Gewinnen und die Zuweisung von Patienten rassischer Minoritäten für klinische Studien fragten. Die Auswahl der Ärzte konzentrierte sich auf solche, die vorrangig in der Nähe von Gebieten mit einem Anteil von 40 % und mehr afrikanischer und hispanischer US-AmerikanerInnen praktizierten. Aus den Antworten auf 12 Fragen generierten die ForscherInnen einen so genannten "Trust in Medical Researchers Scale (TIMRS)". Mittels logistischer Regressionen identifizierten die ForscherInnen dann Charakteristika der Ärzte, die mit einem aktiven Gewinnen und Überweisen ihrer Patienten zu Studien assoziiert waren.
Zu den wesentlichen hemmenden und fördernden Faktoren dieses Verhaltens gehörten:
• Der TIMRS-Wert war unter afroamerikanischen Ärzten und bei Ärzten, die einen hohen Anteil von Minderheiten-Patienten betreuten, geringer. Hinsichtlich ihres tatsächlichen Verhaltens bei der Rekrutierung von Patienten unterschieden sich die Ärzte-Gruppen aber nicht.
• Die Wahrscheinlichkeit, einen Patienten für eine Studie zu motivieren oder ihn zuzuweisen hing stark davon ab, ob der Arzt bereits in der Vergangenheit hier engagiert war (Odds ratio=4,24) und bei einem hohen TIMRS-Wert (OR=1,06).
• Da offensichtlich Erfahrungen und Verhalten der Ärzte in der Vergangenheit ein großes Gewicht besaßen, auch heute Patienten für Studien gewinnen zu wollen und zu können, wurde eine Gruppe von Ärzte ohne solche Erfahrungen getrennt analysiert: Nur der TIMRS-Wert (OR=1,14) und ob der Arzt ein Internist (OR=4,59) war steuerten statistisch signifikant das Zuweisungsverhalten.
• Ärzte, die glaubten, Forschung wäre zu teuer, die Forschungsprotokolle seien zu persönlich oder die Angst davor hatten, unfähig zu sein, Patientenfragen zu beantworten, hatten einen niedrigeren TIMRS-Wert.
• Unerwartet hatten auch Hausärzte, Geriater und Neurologen, also Facharztgruppen, die an der Behandlung von Parkinsonpatienten maßgeblich beteilgt sind, relativ wenige Erfahrung mit der Teilnahme ihrer Patienten an einer Studie.
Trotz einiger methodischer und inhaltlicher Limits ihrer eigenen Studie, ist den Forschern zuzustimmen, wenn sie auf die hohe Bedeutung der Entwicklung einer Vertrauensbeziehung zwischen Forschern und örtlichen Ärzten für künftige community-Studien hinweisen.
Die komplette sechsseitige Version der Studie "Factors Influencing Physician Referrals of Patients to Clinical Trials" von Arch G. Mainous III, Daniel W. Smith, Mark E. Geesey und Barbara C. Tilley ist im "Journal of the National Medical Association" der USA am 11. November 2008 (Vol. 100: 1298-1303) erschienen und dort kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 22.11.08
Deutsche haben eine hohe Lebenserwartung - aber die Jahre ohne Behinderung im Alter sind niedriger als in anderen Ländern
 Wer in Deutschland 50 Jahre alt wird (und nicht vorher schon unfall- oder krankheitsbedingt stirbt), kann als Mann noch mit einer weiteren Lebenserwartung von 29 Jahren rechnen, bei Frauen beträgt dieser durchschnittliche Wert der weiteren Lebenserwartung sogar 33 Jahre. Deutsche liegen mit diesen Kennwerten in der EU in der oberen Hälfte, gleichauf mit Ländern wie Schweden oder Frankreich und weit vor den neuen, osteuropäischen EU-Mitgliedern, bei denen diese Erwartung zum Teil nur bei 21 Jahren liegt (Lettland, Litauen). Soweit die gute, wenngleich schon seit einiger Zeit bekannte Nachricht.
Wer in Deutschland 50 Jahre alt wird (und nicht vorher schon unfall- oder krankheitsbedingt stirbt), kann als Mann noch mit einer weiteren Lebenserwartung von 29 Jahren rechnen, bei Frauen beträgt dieser durchschnittliche Wert der weiteren Lebenserwartung sogar 33 Jahre. Deutsche liegen mit diesen Kennwerten in der EU in der oberen Hälfte, gleichauf mit Ländern wie Schweden oder Frankreich und weit vor den neuen, osteuropäischen EU-Mitgliedern, bei denen diese Erwartung zum Teil nur bei 21 Jahren liegt (Lettland, Litauen). Soweit die gute, wenngleich schon seit einiger Zeit bekannte Nachricht.
Die schlechte und bislang unbekannte Nachricht: Deutschland liegt im EU-Vergleich weit hinten, was die Zahl der im Alter von 50 noch zu erwartenden gesunden Lebensjahre ohne Behinderung anbetrifft. Dieser Erwartungswert beträgt beispielsweise bei Männern 24 Jahre für Dänemark, 21 für Italien, 20 für Schweden, aber nur 13,6 Jahre für Deutschland. Lediglich einige Ostblock-Länder rangieren hier noch hinter den Deutschen. Auch bei den Frauen gelten ähnliche Relationen: In 10 EU-Staaten beträgt die Erwartung gesunder Lebensjahre im Alter von 50 für Frauen 20 Jahre und mehr, für deutsche Frauen jedoch nur 13,6 Jahre. (vgl. Abbildung)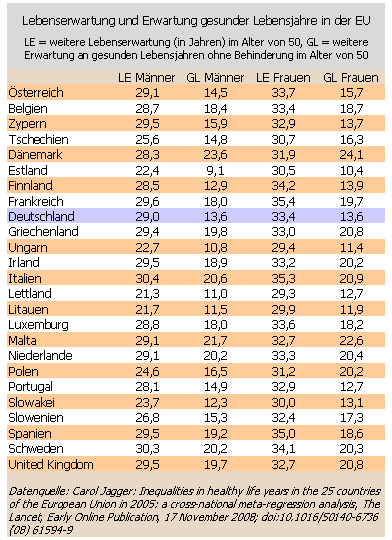
Eine jetzt in der Zeitschrift "The Lancet" online vorab veröffentlichte Studie hat diese überraschenden und für Deutschland besorgniserregenden Befunde gezeigt. Einbezogen waren 25 EU-Staaten, berücksichtigt wurden landesweite Daten des Jahres 2005. Zur Bestimmung der Werte für die noch zu erwartenden gesunden Lebensjahre wurden landesweit unterschiedliche Daten ermittelt über das altersspezifische, also in einzelnen Lebensjahren zu beobachtenden Bevölkerungsanteile mit und ohne Behinderung. Diese Daten wiederum stammen aus repräsentativen nationalen Umfragen.
Die Wissenschaftler fanden dann eine überraschend große Streuweite nicht nur der Lebenserwartung, sondern insbesondere auch der zukünftigen Erwartung gesunder Lebensjahre im Alter von 50. Dieser Wert schwankte bei Männern zwischen 23,6 Jahren (Dänemark) und 9,1 Jahren (Estland). Ähnlich hoch waren die Differenzen bei Frauen: 24,1 Jahre (Dänemark), 10,4 Jahre (Estland). Darüber hinaus waren die Forscher auch erstaunt, dass es keinen eindeutigen Zusammenhang zwischen den beiden Kennwerten gibt. So ist Deutschland recht weit oben anzutreffen, was die Lebenserwartung anbetrifft, aber auch sehr weit unten bei der zukünftigen Erwartung gesunder Lebensjahre.
In die Analysen einbezogen wurden dann eine Reihe statistischer Kennwerte für die Länder, die ihre Wirtschafts- und Sozialleistungen betreffen, unter anderem: Bruttosozialprodukt, Ausgabenanteil für Altenpflege, Armutsrisiko, Arbeitslosenquote, Quote der Langzeit-Arbeitslosen, Durchschnittsalter beim Ausscheiden aus der Erwerbstätigkeit, Bildungsniveau. Tatsächlich zeigt sich auch für die meisten dieser Aspekte in multivariaten Analysen ein mehr oder minder deutlicher Einfluss auf den Kennwert der noch zu erwartenden gesunden Lebensjahre. Eine eindeutige politische Empfehlung lässt sich aus diesen Befunden allerdings nicht ableiten.
In der Diskussion ihrer Befunde heben die Wissenschaftler einen Aspekt hervor, der ganz unabhängig davon politisch bedeutsam ist, welche sozial- oder gesundheitspolitischen Felder in einigen Staaten massive Defizite aufweisen. "Unsere Befunde zeigen", so ihr Fazit, "dass ohne wesentliche Verbesserung des Gesundheitszustands der Bevölkerung das Ziel eines zukünftig größeren Einbezugs Älterer ins Erwerbsleben in vielen EU-Ländern nur sehr schwierig zu erreichen sein wird."
Kostenloses Abstract: Carol Jagger: Inequalities in healthy life years in the 25 countries of the European Union in 2005: a cross-national meta-regression analysis (The Lancet, Early Online Publication, 17 November 2008; doi:10.1016/S0140-6736(08)61594-9)
Gerd Marstedt, 18.11.08
Globale Gesundheit ist ein lokales Phänomen! Oder welche "Gesundheit" wünschen sich Kenianer, Bolivianer, Libanesen oder Deutsche?
 Auf der Liste der Silvester-Wünsche fürs neue Jahr steht weltweit an erster oder an einer der obersten Plätze der nach "Gesundheit". Was dies konkret meint, d.h. was sich Menschen darunter vorstellen, die Abwesenheit welcher Leiden sie darunter verstehen und welche Mittel sie für geeignet halten das Ziel zu erreichen und wie hoch ihre Bereitschaft ist, sie zu besorgen oder zu bezahlen, kann allerdings bereits in einem Land z. B. zwischen sozialen Schichten erhebliche Unterschiede aufweisen. In noch stärkerem Maße gibt es je nach Land und Region auf dieser Erde ebenfalls gravierend verschiedenartige Prioritätensetzungen. Dies fängt schon damit an, dass es länderspezifische Krankheiten und gesundheitliche Problemschwerpunkte gibt. So gibt es z. B. den niedrigen Blutdruck als Krankheit oder die vergleichsweise hohe Bedeutung von Herzkrankheiten nur in Deutschland. Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht in Frankreich dagegen die Leber und ihre Erkrankungen.
Auf der Liste der Silvester-Wünsche fürs neue Jahr steht weltweit an erster oder an einer der obersten Plätze der nach "Gesundheit". Was dies konkret meint, d.h. was sich Menschen darunter vorstellen, die Abwesenheit welcher Leiden sie darunter verstehen und welche Mittel sie für geeignet halten das Ziel zu erreichen und wie hoch ihre Bereitschaft ist, sie zu besorgen oder zu bezahlen, kann allerdings bereits in einem Land z. B. zwischen sozialen Schichten erhebliche Unterschiede aufweisen. In noch stärkerem Maße gibt es je nach Land und Region auf dieser Erde ebenfalls gravierend verschiedenartige Prioritätensetzungen. Dies fängt schon damit an, dass es länderspezifische Krankheiten und gesundheitliche Problemschwerpunkte gibt. So gibt es z. B. den niedrigen Blutdruck als Krankheit oder die vergleichsweise hohe Bedeutung von Herzkrankheiten nur in Deutschland. Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht in Frankreich dagegen die Leber und ihre Erkrankungen.
Die erste weltweite methodisch einheitliche Messung der öffentlichen Erwartungen zu und Prioritätensetzungen bei Gesundheitsproblemen, die von der "Kaiser Family Foundation" und dem "Pew Global Attitudes Project" des "Pew Research Center" im Frühjahr 2007 durchgeführte und im Dezember 2007 veröffentlichte Studie "A Global Look at Public Perceptions of HealthProblems, Priorities, and Donors: The Kaiser/Pew Global Health Survey" liefert erste gründliche Einblicke in die unterschiedlichen Problemschwerpunkte in 47 Ländern in den Regionen Sub-Sahara-Afrika, Lateinamerika, Asien, Mittlerer Osten, Zentral- und Osteuropa, Westeuropa sowie USA und Kanada. Insgesamt wurden dazu Interviews (meist face-to-face) mit 45.239 Personen, darunter 33.422 in Ländern mit niedrigem oder mittleren Einkommensniveau durchgeführt. Dies bedeutet, dass z. B. sowohl in Kenia als auch in Deutschland jeweils 1.000 Interviews stattfanden.
Ein leitendes Interesse der Befragung war, herauszufinden, ob die Gesundheitsprioritäten der Bevölkerung in Entwicklungsländern dieselben sind wie die ihrer Regierungen und die der internationalen Organisationen, die im Bereich der internationalen Gesundheitsentwicklungshilfe arbeiten. Dies wurde u.a. durch die Frage nach der wahrgenommenen Bedeutung ausgewählter gesundheitlicher Probleme wie HIV/AIDS, Malaria, Tuberkulose und sauberem Wasser oder ausreichender Ernährung gemessen.
Zu den "key findings" gehören folgende Punkte:
• Bei der Priorisierung von Gesundheitsfragen gegenüber anderen "very big problems" gibt es große weltweite Unterschiede. Gesundheit mit dem vorgegebenen Schwerpunkt infektiöser Erkrankungen steht im Regionsvergleich in der Sub-Saharazone Afrikas auf Platz 1 und z. B. in Lateinamerika erst auf Platz 5 nach der Kriminalität, illegalen Drogen, Umweltverschmutzung und Politikerkorruption. In Westeuropa steht die Umweltverschmutzung an erster Stelle. Wenn die Prioritätensetzung mit eigenen Bezeichnungen erfolgen kann, schieben sich Gesundheitsthemen in 33 Ländern an die zweiter Stelle nach finanziellen Belangen. In Deutschland und Schweden stehen sie aber an erster Stelle.
• Obwohl der Teil der Bevölkerung, der sich in Ländern mit niedrigem oder mittleren Einkommen wegen der Kosten keine ausreichende Ernährung und Gesundheitsversorgung leisten konnten, in den letzten 5 Jahren (2002 fand bereits eine ähnliche Befragung statt) abnahm, existieren in dieser Frage weiterhin riesige Lücken zwischen armen und reichen Ländern. In 23 untersuchten Ländern berichten wenigstens 40% sie könnten sich wegen Geldmangels keine gesundheitliche Versorgung leisten.
• Auch unter den armen Ländern gibt es verschiedenartige Gesundheitsprioritäten: In der Sub-Saharazone steht HIV/AIDS auf Platz 1 der Probleme, ebenso in Asien. In Mittel- und Osteuropa ist es dagegen der Zugang zur Versorgung, im Mittleren Osten und Lateinamerika Hunger und Mangelernährung.
• In den 18 armen Hauptempfängern von Unterstützung aus den reichen Ländern sagen ein Drittel und mehr der Befragten in 10 dieser Länder, dass die reichen Länder genug täten, den ärmeren Ländern bei der wirtschaftlichen Entwicklung, der Armutsbekämpfung und der Verbesserung der gesundheitlichen Lage zu helfen. In allen anderen 16 ärmeren und sogar interessanter Weise in den 13 reicheren und damit Spender- oder Geber-Ländern selber teilt jeweils höchstens ein Viertel der dort Befragten diese Bewertung.
• In den meisten Ländern mit einer großen und auch noch wachsenden HIV-Epidemie überwiegt der Optimismus zum Fortschritt des Landes bei der Prävention und Behandlung dieser Krankheit.
Die AutorInnen des Reports fassen die wichtigsten allgemeinen Ergebnisse ihrer Forschungen so zusammen: "Looking around the world at views towards health, as seen through the eyes of those in different regions, countries, and situations, it is not surprising that there is great variation in how health figures into people’s lives, and to what extent it is viewed as a problem for governments to address; indeed, global health is a local phenomenon. ... It is notable that in most low- and middle-income countries, large shares of the public want their governments to address a variety of health issues, reflecting the myriad of health-related needs that people face, as underscored by data from the World Health Organization and others on the continued impact of disease, lack of access, and other health-related challenges throughout the world. On the upside, however, there are signs of hope on the ground, with most people in areas hardest hit by HIV citing progress on HIV prevention and treatment, and fewer people now, compared to five years ago, reporting problems paying for health care and other basic necessities. Moreover, international aid appears to resonate where it matters most - among recipients - who tend to give more credit to the role of donors than others, more so than even those in donor government countries themselves. As more attention has been drawn to the role of global health diplomacy and leadership in the international arena, such a finding adds weight to the "soft power" argument that donor funding will indeed be felt by those in need. ... Finally, despite all the differences in views and experiences across countries, this survey underscores how powerfully health is experienced in people's lives, and how many see a role for their governments, and others, to do more. It also offers new and rich information about where differences can be made - and felt."
Neben den gründlichen kapitelweisen Darstellungen der Ergebnissen finden sich in umfangreichen Anhängen noch weitere tabellarisch zusammengestellten Resultate bzw. länderspezifische Rankings und eine Übersicht zu den Befragungsmethodiken in den 47 Ländern.
Der 80 Seiten umfassende Bericht ist in einer 80seitigen PDF-Fassung kostenlos von der Homepage der Kaiser Family Foundation (KFF) herunterladbar.
Bernard Braun, 16.12.2007
Studie zur Verbreitung von AIDS/HIV bilanziert: Ursächlich ist vor allem die Zahl infizierter Prostituierter
 Für den Kampf gegen AIDS/HIV erweckten erst vor kurzem einige klinische Studien große Hoffnung: Die männliche Beschneidung, so hieß es in den Veröffentlichungen, könnte die Infektionsquote etwa um die Hälfte senken. (siehe Artikel im Forum Gesundheitspolitik). Eine nun in der Zeitschrift "PLOS Medicine" veröffentliche Analyse könnte jenen Hoffnungen einen massiven Rückschlag versetzen, die mit der männlichen Beschneidung als ebenso einfache wie effiziente Präventionsmaßnahme gegen AIDS verbunden waren.
Für den Kampf gegen AIDS/HIV erweckten erst vor kurzem einige klinische Studien große Hoffnung: Die männliche Beschneidung, so hieß es in den Veröffentlichungen, könnte die Infektionsquote etwa um die Hälfte senken. (siehe Artikel im Forum Gesundheitspolitik). Eine nun in der Zeitschrift "PLOS Medicine" veröffentliche Analyse könnte jenen Hoffnungen einen massiven Rückschlag versetzen, die mit der männlichen Beschneidung als ebenso einfache wie effiziente Präventionsmaßnahme gegen AIDS verbunden waren.
Im Unterschied zu den klinischen Studien, bei denen Männer in Uganda und Kenia an einer medizinischen Intervention teilnahmen und Ergebnisse in Untersuchungs- und Kontrollgruppen beobachtet wurden, basiert die jetzt vorliegende Untersuchung "nur" auf einer detaillierten Analyse von Daten. Es wurde versucht, die aus verschiedenen Staaten der Welt berichtete "Prävalenz" von AIDS/HIV (also die Quote der Betroffenen) vorherzusagen anhand unterschiedlicher Indikatoren. Diese Quote variiert weltweit ganz massiv: Sie ist am höchsten in afrikanischen Ländern wie Namibia, Botswana oder Südafrika mit um oder sogar über 20%, liegt in Mitteleuropa durchweg unter 1% (Deutschland 0.12%) und ähnlich niedrig auch in den USA (0.3%). Afrika nimmt eine Ausnahmestellung ein, denn andere Entwicklungsländer, etwa in Asien oder Südamerika sind weitaus weniger betroffen, Brasilien hat eine Quote von nur 0.6%, Indien weist 0.9% auf. Durch diese Analyse sollte deutlich werden, welche Faktoren für die epidemische Ausbreitung vor allem in Afrika ursächlich sind und in welchen politischen Feldern daher in erster Linie Anstrengungen unternommen werden sollten.
In die Analyse einbezogen wurden insgesamt 77 Länder auf der ganzen Welt, reiche Nationen wie die USA oder Deutschland, aber auch Entwicklungs- und Schwellenländer. Die Daten zur Verbreitung von AIDS/HIV stammen aus einer Veröffentlichung von UNAIDS und der WHO: 2006 Report on the global AIDS epidemic (UNAIDS - WHO, May 2006). Daten über die Zahl der "Sex-Arbeiterinnen" ("commercial sex workers") wurden übernommen aus einer neueren Veröffentlichung, in der unterschiedlichste Datenquellen von staatlichen und gemeinnützigen Einrichtungen ebenso wie Forschungsinstituten verwendet wurden, um die Zahl der von Prostitution lebenden Menschen zu beziffern: Estimates of the number of female sex workers in different regions of the world (Sexually Transmitted Infections 2006;82(suppl_3):iii18-iii25; doi:10.1136/sti.2006.020081)
Als potentielle Einflussfaktoren wurde eine Reihe von Indikatoren herangezogen, die in schon vorliegenden Untersuchungen und Diskussionen als wichtig erachtet wurden. Dazu zählten:
• Der Frauen-Anteil an der Bevölkerung
• Der Anteil weiblicher Prostituierter an der weiblichen Bevölkerung
• Die Zahl infizierter Prostituierter (pro 100.000 Einwohner)
• Der Anteil der islamisch Gläubigen an der Bevölkerung (als Indikator für die Beschneidungs-Quote)
• Ein ökonomischer Indikator zur Bewertung der Armut bzw. materiellen Lebensbedingungen des Landes (Bruttoinlandsprodukt nach Kaufkraftparität, GDP per Capita-Purchasing Power Parity)
• Die Analphabeten-Quote bei Frauen im Alter von 15-24
• Die Differenz zwischen männlicher und weiblicher Analphabeten-Quote
• Der sog. "Gini-Koeffizient", der das Ausmaß ökonomischer Ungleichheit in einem Land beziffert, also die Schere zwischen Armen und Reichen.
Ergebnisse früherer Analyse wurden in den komplexen statistischen Verfahren (multivariate Regressionen) teilweise bestätigt: So zeigte sich ein recht hoher Zusammenhang zwischen der Ansteckungsquote mit HIV/AIDS und den landesspezifischen Indikatoren für das Ausmaß des Analphabetentums bei Frauen. Der Index für den materiellen Lebensstandard blieb ohne Effekt, die ökonomische Ungleichheit jedoch, die Schere zwischen Armen und Reichen, zeigte jedoch wieder recht nachhaltige Einflüsse. Überraschender Weise fand sich dieser Zusammenhang dann jedoch nicht für den Indikator "Anteil der islamischen Bevölkerung". Da die männliche Beschneidung im Islam obligatorisch ist, die Korrelation zwischen islamischem Bevölkerungsanteil und AIDS jedoch sehr niedrig ausfiel, wurde dies so interpretiert, dass Beschneidung möglicherweise keine strategisch zentrale Bedeutung hat für den Kampf gegen AIDS.
Der stärkste Zusammenhang in der Analyse ergab sich stattdessen für ein anderes Merkmal: Die Zahl der weiblichen Prostituierten eines Landes, die sich bereits selbst mit dem HIV-Virus angesteckt haben. Der Zusammenhang ist nach Ansicht der Forscher recht schlicht und plausibel: Prostituierte haben in jedem Jahr Hunderte von Sexualpartnern, während diese Zahl in der normalen monogam lebenden Bevölkerung unter Umständen nur bei 1 oder 0 liegt.
Die Studienergebnisse basieren nur auf statistischen Querschnitts-Daten, die überdies teilweise auch noch eine recht hohe Unschärfe aufweisen und Dunkelziffern nur abschätzen. Es sind keine Beobachtungsstudien, die etwa über einen größeren Zeitraum verfolgt haben, wie im Gefolge sozialer Veränderungen (z.B. Zunahme oder Abnahme von Prostitution, Armuts- und Reichtums-Entwicklung usw.) auch in unterschiedlichen Ländern die Infektionsquoten für AIDS und HIV nachg oben oder unten driften. Von daher kann es natürlich trotz der Plausibilität der dargestellten Zusammenhänge immer sein, dass sich hinter den herangezogenen Indikatoren noch ganz andere Einflussfaktoren verbergen. Man muss daher kein Prophet sein, um baldige Kritik und Gegeneinwände gegen die Studienbefunde vorherzusagen.
Die Studie ist hier im Volltext nachzulesen (dort auch Link zur PDF-Datei): Size Matters: The Number of Prostitutes and the Global HIV/AIDS Pandemic
Gerd Marstedt, 25.6.2007
WHO-Weltgesundheitsdaten 2007 erschienen
 Eine der großen statistischen Fundquellen für weltweite Daten zu einer Fülle von gesundheitlichen, sozialen, organisatorischen und finanziellen Bedingungen und Faktoren im Gesundheitsbereich ist die jährlich vom "WHO Statistical Information System (WHOSIS)" der Weltgesundheitsorganisation (WHO) veröffentlichte Sammlung "World Health Statistics", deren Ausgabe 2007 gerade erschienen ist.
Eine der großen statistischen Fundquellen für weltweite Daten zu einer Fülle von gesundheitlichen, sozialen, organisatorischen und finanziellen Bedingungen und Faktoren im Gesundheitsbereich ist die jährlich vom "WHO Statistical Information System (WHOSIS)" der Weltgesundheitsorganisation (WHO) veröffentlichte Sammlung "World Health Statistics", deren Ausgabe 2007 gerade erschienen ist.
Die Informationssammlung besteht aus Daten über die Mortalität und Morbidität, den Versicherungsschutz gegen Krankheit, die Risikofaktoren, die Gesundheitssysteme als menschliche Ressourcen, die Finanzierungsseite der gesundheitlichen Versorgung, die Ungleichheit der Erkrankungsrisiken und Versorgungschancen und ausgewählte demografische und sozioökonomische Eckdaten. Die Daten zu diesen Bereichen können jeweils einzeln als PDF-Dateien heruntergeladen werden.
Zusätzlich hat die WHO "10 statistische Highlights der gobalen öffentlichen Gesundheit" zusammengestellt. Dabei geht es 2007 u.a. um die Prognosen von Todesursachen im Jahr 2030, die Unternährung von Kindern (10 % aller Kinder unter 5 Jahren leiden als Folge von Unterernährung an Muskelschwäche), den weltweit engen Zusammenhang von hohem Tabakkonsum und Armut (mit einer steigenden Anzahl von tabakbedingten Todesfällen von 5,4 Millionen in 2005 auf 8,3 Mio. in 2030), mentale Erkrankungen wie Depression (2002 waren Depressionen mit 4,5 % an der weltweiten Krankheitslast beteiligt), das bessere Verständnis der Determinanten der gesundheitlichen Ungleichheit, die Kontrolle der Tuberkulose und die Gesundheitsausgaben.
Die Module und der 88 Seiten umfassende vollständige Bericht können über die WHOSIS-Website heruntergeladen werden.
Bernard Braun, 17.6.2007
EU-Umfrage: Deutsche sind Europameister, was Zukunftsängste anbetrifft
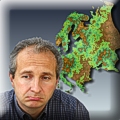 Eine Umfrage der EU bei knapp 27.000 Bürgern der EU aus 27 Mitgliedsländern hat sich mit den Befindlichkeiten und Lebenseinstellungen europäischer Bürger (im Alter über 15 Jahren) beschäftigt. Gefragt wurde im Dezember 2006 nach Ängsten und Hoffnungen, nach der Zufriedenheit mit Arbeits- und Lebensbedingungen, nach dem Vertrauen in politische Institutionen. Insgesamt ergibt sich ein sehr gespaltenes Bild, bei dem in neuen Mitgliedsstaaten (im Osten) sehr viel mehr Skepsis und Befürchtungen laut werden als etwa in Skandinavien. Ein durchgängiges Ergebnis bei einer Vielzahl von Fragen ist aber auch: Es wird "German Angst" offenbar, die Deutschen sind sehr viel zukunftspessimistischer und unzufriedener als der Durchschnitt der EU-Bürger.
Eine Umfrage der EU bei knapp 27.000 Bürgern der EU aus 27 Mitgliedsländern hat sich mit den Befindlichkeiten und Lebenseinstellungen europäischer Bürger (im Alter über 15 Jahren) beschäftigt. Gefragt wurde im Dezember 2006 nach Ängsten und Hoffnungen, nach der Zufriedenheit mit Arbeits- und Lebensbedingungen, nach dem Vertrauen in politische Institutionen. Insgesamt ergibt sich ein sehr gespaltenes Bild, bei dem in neuen Mitgliedsstaaten (im Osten) sehr viel mehr Skepsis und Befürchtungen laut werden als etwa in Skandinavien. Ein durchgängiges Ergebnis bei einer Vielzahl von Fragen ist aber auch: Es wird "German Angst" offenbar, die Deutschen sind sehr viel zukunftspessimistischer und unzufriedener als der Durchschnitt der EU-Bürger.
Erkenntnisinteresse der Europäischen Kommission war es, die "soziale Realität in Europa" genauer zu erfassen. Statt jedoch, wie in anderen Studien praktiziert, objektive Indikatoren zu vergleichen, Studierende und Kinderkrippen, Arbeitslose und Sozialhilfebezieher, hat man sich auf eher subjektive Einschätzungen konzentriert. Untersucht werden sollte die Wahrnehmung und Bewertung der Arbeits- und Lebensbedingungen im Vereinten Europa der nunmehr 27 Staaten durch die Bürger.
Durchblättert man den knapp 200seitigen Bericht mit einer Vielzahl von Tabellen und Grafiken, so hält man an vielen Stellen inne, bei den im Ländervergleich die kleine schwarz-rot-goldene Fahne als Symbol für die Position der Deutschen nicht im Mittelfeld zu finden ist, sondern weit oben, wenn es um Ängste und Befürchtungen geht, recht weit unten, wenn über Aspekte wie Zufriedenheit oder Hoffnungen berichtet wird. So zeigt sich etwa:
• Beim Vertrauen in die Sicherheit der Rente und in die eigene materielle Zukunftssicherung rangiert Deutschland am untersten Ende der Länderskala. Nur 24% sind hier zuversichtlich. Das sind noch weniger als in Ungarn (29%) oder Polen (31%) und nur ein Bruchteil der Quote, die in Dänemark (74%) oder Finnland (67%) erzielt wird.
• Auch "Happiness", Glücklichsein, ist keine vorrangige Domäne der Deutschen. Während in der EU im Durchschnitt 87% der Befragten erklären, sie seien im Leben sehr glücklich oder eher glücklich, sind es in Deutschland nur 82%. Spitzenreiter sind hier wieder einmal Dänen und Niederländer mit über 95%.
• Auch bei der Frage, wie sich die persönliche Lebenssituation in den letzten fünf Jahren entwickelt hat und wie es wohl nach eigener Einschätzung in den nächsten fünf Jahren weiter geht, überwiegt bei den Deutschen Zurückhaltung und Pessimismus. In nahezu allen Ländern wird die Zukunft eher optimistisch gesehen und auch bei den zurückliegenden Entwicklungen werden eher positive Veränderungen erkannt. Nur wenige EU-Staaten weichen von diesem Muster ab, darunter Ungarn, Bulgarien, Griechenland und - Deutschland.
• Wenn die längerfristige Perspektive der nächsten fünf Jahre eher negative Schatten wirft, so kann die kurzfristige Zukunftsprognose nicht besser ausfallen. Bei den Erwartungen, ob die allgemeine Lebenssituation sich in den nächsten 12 Monaten verbessert, sind nur 20% der Deutschen optimistisch. In der EU sind dies im Durchschnitt 35%. Ähnlich negativ wird die Entwicklung der finanziellen Bedingungen gesehen: Hier haben nur 13% der Deutschen (EU: 25%) positive Erwartungen.
• Deutsche sehen nicht nur schwarz für die eigene Zukunft, sie sorgen sich ebenso (überdurchschnittlich stark) um die Zukunft der eigenen Kinder und kommende Generationen. Auf die Frage, ob man glaubt, dass die heutigen Kinder es als Erwachsene im Leben einmal eher leichter oder schwerer haben werden als heutige Erwachsene, sind nur 3% der Deutschen zukunftsoptimistisch. Das ist die niedrigste Quote aller EU-Staaten. Von zukünftig einmal besseren Lebensbedingungen überzeugt sind im EU-Durchschnitt 17% und Portugiesen ragen hier mit 57% ganz besonders heraus.
Der EU-Bericht bringt noch eine Vielzahl weiterer und teilweise recht überraschender Befunde, zur Gleichberechtigung der Frauen und Arbeitsteilung in der Familie, zum Vertrauen in politische Einrichtungen (auch hier liegen Deutsche weit hinten), zu Arbeitsbedingungen wie Stress und Qualifikationsmöglichkeiten.
Was von bundesdeutschen Politiker des öfteren als Mutmaßung und Kritik geäußert wurde, wird im Bericht der Europäischen Kommission nun anhand vieler Daten belegt: Die im EU-Vergleich überdurchschnittlich großen Zukunftsängste der Deutschen. Offen bleibt freilich, ob es sich dabei wirklich um eine Grundhaltung des Lamentierens und Wehklagens handelt, oder ob hier nicht schlichtweg die seit geraumer Zeit verschlechterten Lebensbedingungen vieler Bürger durchschlagen: Massenarbeitslosigkeit, späteres Renteneintrittsalter, Hartz-IV und nicht zu vergessen die allenthalben bemerkte zunehmende Schere zwischen Arm und Reich. Hier wäre es spannend, einmal objektive Indikatoren der Lebensqualität (und ihre Veränderungen) direkt zu vergleichen mit den berichteten Ängstlichkeiten und Hoffnungen der EU-Bürger.
Der Bericht steht hier zum Download zur Verfügung:
European Commission: Special Eurobarometer - European Social Reality (PDF, 196 Seiten, davon 100 Seiten Anhang mit Fragebogen u.ä.)
Gerd Marstedt, 27.2.2007
Analyse von Prozessdaten der Gesetzlichen Krankenversicherung: Vom Quer- zum Längsschnitt.
 Immer mehr Analysen über gesundheitliche Risiken und Versorgungsprozesse stützen sich nicht mehr allein auf primär, d.h. zum Zweck der bestimmten Analyse erhobene Daten, sondern auf so genannte Sekundär- oder Prozess-Daten, die von den Sozialversicherungsträgern für andere versicherungseigene Zwecke aber dafür in Hülle und Fülle erhoben werden. Die historisch wie von der mittlerweile erreichten Menge der wissenschaftlichen oder politischen Analysen her am weitesten entwickelten Sekundär- oder Prozessdatenanalysen stammen aus dem Bereich der Gesetzlichen Krankenversicherung.
Immer mehr Analysen über gesundheitliche Risiken und Versorgungsprozesse stützen sich nicht mehr allein auf primär, d.h. zum Zweck der bestimmten Analyse erhobene Daten, sondern auf so genannte Sekundär- oder Prozess-Daten, die von den Sozialversicherungsträgern für andere versicherungseigene Zwecke aber dafür in Hülle und Fülle erhoben werden. Die historisch wie von der mittlerweile erreichten Menge der wissenschaftlichen oder politischen Analysen her am weitesten entwickelten Sekundär- oder Prozessdatenanalysen stammen aus dem Bereich der Gesetzlichen Krankenversicherung.
Wie eine gerade vom Bundesverband der Betriebskrankenkassen (BKK-BV) durchgeführte "Jubiläumsveranstaltung" zu "30 Jahre BKK Gesundheitsreport - Arbeit und Gesundheit im Wandel" und viele der dort gehaltenen Referate ausweisen, handelt es sich hier um eine mittlerweile fest etablierte und bereits in die Jahre gekommene Errungenschaft. Neben den Pionieren dieser Art von Transparenzanalysen wie dem BKK-BV und der Gmünder Ersatzkasse (GEK) werten mittlerweile aber auch nahezu alle anderen Kassenarten und großen Kassen ihre Daten aus bzw. lassen sie in Kooperation von wissenschaftlichen Einrichtungen auswerten.
Die damit verbundene Routinisierung führt aber keineswegs zum inhaltlichen oder methodischen Stillstand der Prozessdatenanalyse - im Gegenteil.
Zum einen gibt es zahlreiche Bemühungen, das Qualitätsniveau der Analysen zu sichern und zu erhöhen. Dies findet in der von Prozessdatenforschern aus den verschiedensten Institutionen und Zusammenhängen getragenen Initiative "GPS - Gute Praxis Sekundärdatenanalyse" der Arbeitsgruppe Erhebung und Nutzung von Sekundärdaten (AGENS) der Deutschen Gesellschaft für Sozialmedizin und Prävention (DGSMP) einen vorbildlichen Ausdruck.
Zum anderen ist es eine spezielle Weiterentwicklung der Sekundärdatenanalyse. Gemeint ist die wissenschaftliche und politische noch in den Anfängen steckende Nutzung von Prozessdaten für personenbezogene anonymisierte Verlaufs- oder Längsschnittanalysen von Erkrankungen und Versorgungsketten. Derartige Analysen sind natürlich auch mit primär erhobenen, so genannten Panel-Daten möglich, inhaltlich sehr ertragreich aber organisatorisch extrem aufwändig und sehr teuer. Daher gibt es solche Datenpools in Deutschland kaum oder sie decken wie das "Sozioökonomische Panel (SOEP)" so viele Sach- und Fragenbereiche ab, dass für einen Bereich wie den der Gesundheit nur wenige Aspekte übrig bleiben.
Welche Entwicklungslinien es in der Prozessdaten- als Längsschnittforschung während der letzten Jahrzehnte gab, welchen Fortschritt die Ergänzung von traditionellen Querschnittsanalysen durch Längsschnittanalysen darstellt und wie dies konkret aussieht, stellt ein jetzt in der "Schriftenreihe zur Gesundheitsanalyse der GEK als Band 51 erschienener, von den Soziologen Rolf Müller und Bernard Braun aus dem Zentrum für Sozialpolitik der Universität Bremen herausgegebener Sammelband "Vom Quer- zum Längsschnitt. Möglichkeiten der Analysen mit GKV-Daten" in zahlreichen Beiträgen dar.
Wie breit die Palette der Beiträge und Themen ist und wo ihr wissenschaftlicher und politischer Nutzen liegen kann, zeigen die im Folgenden beispielhaft aufgelisteten Beiträge sehr gut:
• Überblick zur Entwicklung der Gesundheitsberichterstattung mit GKV-Daten
• Arzneimitteldaten: Ein Thema für die Gesundheitsberichterstattung
• Verläufe stationärer Versorgung
• Pflegeverläufe älterer Menschen. Eine deskriptive Längsschnittstudie über die Jahre 1998 bis 2004
• Chronizität arbeitsbedingter Rückenbeschwerden am Beispiel von fünf Berufsgruppen
• Übergang in die Erwerbsunfähigkeitsrente und
• Wandel des Sterbegeschehens unter Einfluss sozialstaatlicher Finanzierungsprobleme.
Alle Beiträge des Buches "Vom Quer- zum Längsschnitt" gibt es als PDF-Datei hier herunterzuladen.
Bernard Braun, 11.1.2007
Lebensqualität in Deutschland 1995-2005 : Ein Report zur Versachlichung der Debatte
 Mit der Schlussfolgerung "Die Lebensqualität der Deutschen ist in Gefahr" interpretiert der Auftraggeber eines gerade veröffentlichten Reports zur "Lebensqualität 2006", der "Verband Forschender Arzneimittelhersteller" (VFA), dessen Ergebnisse sehr einseitig. Trotzdem sollte sich dadurch niemand von der Lektüre des wesentlich differenzierteren und äußerst materialreichen Berichts abhalten lassen.
Mit der Schlussfolgerung "Die Lebensqualität der Deutschen ist in Gefahr" interpretiert der Auftraggeber eines gerade veröffentlichten Reports zur "Lebensqualität 2006", der "Verband Forschender Arzneimittelhersteller" (VFA), dessen Ergebnisse sehr einseitig. Trotzdem sollte sich dadurch niemand von der Lektüre des wesentlich differenzierteren und äußerst materialreichen Berichts abhalten lassen.
Bearbeitet haben ihn das Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung (MZES) und das Mannheimer Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen (ZUMA). Dafür haben die Wissenschaftler Europäische Vergleichsdaten von OECD und Eurostat sowie repräsentative Umfragen wie Mikrozensus und Sozio-ökonomisches Panel ausgewertet. Im Zentrum dieser Untersuchung der Entwicklung der Lebensqualität der Deutschen in den letzten zehn Jahren. standen der demografische und sozialstaatliche Wandel und die vier Grundbereiche Familie, Arbeit und Einkommen, Gesundheit, Partizipation und Integration.
Anhand dieser Bereiche wird den Fragen nachgegangen,
• wie sich die Lebensqualität in den letzten zehn Jahren verändert hat,
• ob sich West-Ost-Unterschiede in den vergangenen Jahren abgeschwächt oder vergrößert haben,
• inwieweit sich sozio-ökonomische Ungleichheiten verstärkt oder verringert haben und
• wie sich die Situation in Deutschland im Vergleich zu anderen europäischen Ländern darstellt?
Ausdrücklich stellen die Autoren des Reports fest: "Mit dieser Einordnung in den europäischen Kontext sollen spezifische Defizite in Deutschland aufgezeigt werden. Gleichzeitig möchte dieser Bericht angesichts der gegenwärtig kontroversen öffentlichen Debatte über die "deutsche Krise" einen Beitrag zur Versachlichung der Diskussion in Deutschland leisten."
Dazu finden sich beispielsweise gut belegte Kernsätze wie diese: "Deutschland gehört somit weder zu den besonders "gerontokratischen" Sozialstaaten Europas noch zu den Ländern mit einem hohen Ausgabenanteil (in Prozent aller Sozialausgaben) für Gesundheit. Zusammen mit Frankreich liegt es vielmehr ziemlich genau in der Mitte Europas mit einem relativ ausgewogenen Mix an Sozialleistungen."
Als Fazit stellt die Studie aber kritisch fest, "dass die deutsche Gesellschaft im Blick auf die Lebensqualität ihrer Bürger derzeit vor vielfältigen Herausforderungen steht. Für die hier ausgewählten Bereiche wird deutlich, dass die für frühere Zeiten charakteristische und das Anspruchsniveau der Bevölkerung prägende stetige Verbesserung der Lebensbedingungen mittlerweile zur Ausnahme geworden ist. Zwar lassen sich auch im Verlauf der letzten Dekade positive Veränderungen der Lebensqualität konstatieren - z.B. im Bereich des zivilgesellschaftlichen Engagements und gegenseitiger persönlicher Unterstützung -, aber insgesamt ist die Situation mehr durch Stagnation und vereinzelt durch Verschlechterungen gekennzeichnet. Dazu trägt offensichtlich bei, dass in Deutschland bisher kein Durchbruch bei der Lösung von gesellschaftlichen Schlüsselproblemen gelungen ist, insbesondere in Bezug auf die Schaffung ausreichender Beschäftigungsmöglichkeiten und bei der Reform des Gesundheitssystems. Dadurch bleiben positive Signale auch für andere Bereiche weitgehend aus."
Der Report enthält eine Vielzahl von differenzierenden und differenzierten Hinweisen , die zum einen die politische Beeinflussbarkeit vieler Trends benennen und entsprechende Ansatzpunkte zeigen. Dies gilt z.B. für den Hinweis auf die Relevanz der sozialen Ungleichheit bei der Gesundheitsversorgung, die Beobachtung, dass bei älterwerdenden Männern anders als bei Frauen die Anzahl der beschwerdefreien Jahre im Alter zunimmt oder die "Effektivitäts- und Effizienzbremse" der Fixierung der deutschen Sozialpolitik auf Finanzleistungen statt des vorrangigen Angebots von sozialen Dienstleistungen (insbesondere im Bereich der Familienförderung).
Hier erhält man die PDF-Datei des 136-seitigen "VFA-Report Lebensqualität 2006"
Bernard Braun, 22.11.2006
Public Health-Infos kompakt aus der Schweiz
 Seit 1977 erscheinen als offizielles Organ der Schweizerischen Gesellschaft für Gesundheitspolitik vier- bis fünfmal jährlich die "Gesundheitspolitischen Informationen" (GPI), die für Mitglieder dieser Public Health-orientierten Gesellschaft im Mitgliedsbeitrag enthalten sind.
Seit 1977 erscheinen als offizielles Organ der Schweizerischen Gesellschaft für Gesundheitspolitik vier- bis fünfmal jährlich die "Gesundheitspolitischen Informationen" (GPI), die für Mitglieder dieser Public Health-orientierten Gesellschaft im Mitgliedsbeitrag enthalten sind.
Die GPI sind eine knapp 50 Seiten umfassende lockere und vielfach hilfreiche Zusammenstellung von Hinweisen auf und Kurzrezensionen von gesundheitspolitischen und -wissenschaftlichen Bücher aus dem deutschsprachigen, französischen und angelsächsischen Raum, Auszügen oder Zusammenfassungen entsprechender Zeitschriftenaufsätze aus Health Affairs, British Medical Journal und anderen Journals, Karikaturen, Abbildungen/Tabellen oder gesundheitsbezogenen Meldungen/Reports aus Tageszeitungen. Hinzu kommen natürlich noch intensivere Einblicke in das Innenleben des Verbandes und der schweizerischen Gesundheitspolitik. Die Lektüre dieses Edel-"Ausschnittsdienstes" erspart den LeserInnen viele Stunden Suche und Lektüre.
Hier finden Sie Auszüge aus der aktuellen Ausgabe und das Archiv.
Bernard Braun, 14.11.2006
Statistisches Jahrbuch 2006 zum kostenlosen Download
 Das Statistische Jahrbuch 2006 für die Bundesrepublik Deutschland ist ein statistischer Bericht zur Lage der Nation, der einen umfassenden Überblick über die Verhältnisse in Deutschland bietet. Die Entwicklung der Bevölkerung wird ebenso detailliert dargestellt wie die Lage der Wirtschaft und des Arbeitsmarktes, die Löhne, die Preise oder die Staatsfinanzen. Angaben zum Bildungs- und Gesundheitswesen, zu kulturellen Einrichtungen und Freizeit sowie Trends bei den Sozialleistungen und im Umweltbereich vervollständigen das Bild. Erstmals steht nun das Statistische Jahrbuch 2006 auch im Internet zum kostenlosen Download zur Verfügung, entweder komplett (5.6 MB) oder für einzelne der insgesamt 26 Kapitel.
Das Statistische Jahrbuch 2006 für die Bundesrepublik Deutschland ist ein statistischer Bericht zur Lage der Nation, der einen umfassenden Überblick über die Verhältnisse in Deutschland bietet. Die Entwicklung der Bevölkerung wird ebenso detailliert dargestellt wie die Lage der Wirtschaft und des Arbeitsmarktes, die Löhne, die Preise oder die Staatsfinanzen. Angaben zum Bildungs- und Gesundheitswesen, zu kulturellen Einrichtungen und Freizeit sowie Trends bei den Sozialleistungen und im Umweltbereich vervollständigen das Bild. Erstmals steht nun das Statistische Jahrbuch 2006 auch im Internet zum kostenlosen Download zur Verfügung, entweder komplett (5.6 MB) oder für einzelne der insgesamt 26 Kapitel.
Im Kapitel 9 "Gesundheitswesen" finden sich folgende Daten:
• Kennzahlen im Zeitvergleich
• Kennzahlen nach Ländern
Tabellen:
- Gesundheitszustand (Kranke und Unfallverletzte, entlassene vollstationäre Patienten und Patientinnen)
• Gesundheitsrelevantes Verhalten (Rauchgewohnheiten, Körpergröße und -gewicht, Body-Mass-Index)
• Sterbefälle, Todesursachen (Gestorbene Säuglinge, Sterbefälle nach ausgewählten Todesursachen)
• Schwangerschaftsabbrüche (Gründe, Art des Eingriffs, Dauer der - Schwangerschaft)
• Krankenhäuser (Betten, Patientenbewegung, Personal, Behandlungen nach Fachabteilungen, Kosten)
• Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (Betten, Patientenbewegung, Personal)
• Gesundheitsausgaben (Ausgabenträger, Leistungsarten, Einrichtungen)
• Gesundheitspersonal (Berufe, Einrichtungen, Art der Beschäftigung, Alter, Geschlecht)
• Direkte Krankheitskosten (Diagnosen, Alter, Geschlecht)
• Publikationen und Auskünfte
Downloadseite des Statistischen Bundesamtes Statistisches Jahrbuch 2006
Gerd Marstedt, 29.10.2006
Gesundheitsbericht für Deutschland
 Steigende Lebenserwartung und gute Gesundheit, aber: immer noch zu viele Menschen rauchen, sind zu dick, bewegen sich zu wenig und trinken zu viel Alkohol. Das sind die Kernaussagen des Gesundheitsberichts "Gesundheit in Deutschland", den das Robert Koch-Institut im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit jetzt im Rahmen der Gesundheitsberichterstattung des Bundes (GBE) veröffentlicht hat. Sechs Kapitel auf insgesamt 220 Seiten bieten einen allgemeinverständlichen Überblick über die gesundheitliche Situation der Bevölkerung und das Gesundheitswesen in Deutschland und zeichnen Entwicklungen der letzten zehn Jahre auf: Wie steht es um unsere Gesundheit, welche Faktoren beeinflussen die Gesundheit, was leistet das Gesundheitswesen für Prävention und Gesundheitsförderung, wie haben sich Angebot und Inanspruchnahme in der Gesundheitsvorsorgung verändert, wie viel geben wir für unsere Gesundheit aus, wie können sich Patientinnen und Patienten informieren und an Entscheidungen beteiligen?
Steigende Lebenserwartung und gute Gesundheit, aber: immer noch zu viele Menschen rauchen, sind zu dick, bewegen sich zu wenig und trinken zu viel Alkohol. Das sind die Kernaussagen des Gesundheitsberichts "Gesundheit in Deutschland", den das Robert Koch-Institut im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit jetzt im Rahmen der Gesundheitsberichterstattung des Bundes (GBE) veröffentlicht hat. Sechs Kapitel auf insgesamt 220 Seiten bieten einen allgemeinverständlichen Überblick über die gesundheitliche Situation der Bevölkerung und das Gesundheitswesen in Deutschland und zeichnen Entwicklungen der letzten zehn Jahre auf: Wie steht es um unsere Gesundheit, welche Faktoren beeinflussen die Gesundheit, was leistet das Gesundheitswesen für Prävention und Gesundheitsförderung, wie haben sich Angebot und Inanspruchnahme in der Gesundheitsvorsorgung verändert, wie viel geben wir für unsere Gesundheit aus, wie können sich Patientinnen und Patienten informieren und an Entscheidungen beteiligen?
Die insgesamt positiven Gesundheitstrends der letzten Jahre relativieren sich aber durch den demografischen Wandel. Nicht allein Krebserkrankungen, sondern auch Leiden wie Diabetes mellitus, Osteoporose, Schlaganfall und Demenz nehmen mit steigendem Lebensalter zu. So können die Deutschen zwar mit einem langen - und über lange Zeit in Gesundheit verbrachten - Leben rechnen. Gleichzeitig aber werden zukünftig immer mehr ältere Menschen mit chronischen Krankheiten eine gute Behandlung und Pflege benötigen. Die Alterung der Gesellschaft ist daher eine der größten Herausforderungen des Gesundheitssystems.
PDF-Datei des Berichts "Gesundheit in Deutschland" (6 MB)
Zusammenfassung des Berichts (PDF, 1.4 MB)
Kernaussagen des Berichts
Gerd Marstedt, 25.10.2006
"Sozialbericht 2005": Gesamtüberblick zu den Feldern von Sozialpolitik
 Etwas weniger umfangreich als sonst üblich und früher als geplant (eigentlich Frühjahr 2006) erschien noch vor der vorgezogenen Bundestagswahl der 219seitige "Sozialbericht 2005" . Der vom Bundesministerium für Gesundheit und soziale Sicherung (BMGS) einmal in jeder Legislaturperiode herausgegebene Band beschäftigt sich umfassend mit Feldern von Sozialpolitik. Es finden sich Darstellungen der normativen, ökonomischen und organisatorischen Bedingungen und Resultate der Bildungspolitik, Arbeitsbeziehungen und Arbeitsbedingungen, Alterssicherung, Gesundheit und Prävention, Pflegeversicherung, Rehabilitation und Integration von Behinderten, Unfallversicherung, Familienpolitik, Seniorenpolitik, Gleichstellungspolitik sowie der europäischen und internationalen Sozialpolitik.
Etwas weniger umfangreich als sonst üblich und früher als geplant (eigentlich Frühjahr 2006) erschien noch vor der vorgezogenen Bundestagswahl der 219seitige "Sozialbericht 2005" . Der vom Bundesministerium für Gesundheit und soziale Sicherung (BMGS) einmal in jeder Legislaturperiode herausgegebene Band beschäftigt sich umfassend mit Feldern von Sozialpolitik. Es finden sich Darstellungen der normativen, ökonomischen und organisatorischen Bedingungen und Resultate der Bildungspolitik, Arbeitsbeziehungen und Arbeitsbedingungen, Alterssicherung, Gesundheit und Prävention, Pflegeversicherung, Rehabilitation und Integration von Behinderten, Unfallversicherung, Familienpolitik, Seniorenpolitik, Gleichstellungspolitik sowie der europäischen und internationalen Sozialpolitik.
Auch wenn man nicht damit übereinstimmen kann, wie die Bundesregierung "den Sozialstaat zukunftsfähig machen" will, ist der "Sozialbericht" eine kompakte Gesamtübersicht und liefert Ausgangspunkte für vertiefende Lektüre und Diskussionen. Die teilweise bis 1960 zurückreichenden Daten stellen hierfür ebenfalls eine gute Grundlage dar.
Bernard Braun, 20.9.2005