



Home | Patienten | Gesundheitssystem | International | GKV | Prävention | Epidemiologie | Websites | Meilensteine | Impressum
Sämtliche Rubriken in
"Epidemiologie"
Arbeit und Betrieb, Berufe, Branchen |
Alle Artikel aus:
Epidemiologie
Arbeit und Betrieb, Berufe, Branchen
ErzieherInnen zwischen wachsenden Anforderungen an frühkindliche Bildung, hohen Beanspruchungen und "das ist nicht finanzierbar"
 Bei den aktuellen Streiks von ErzieherInnen in öffentlichen Kindertagesstätten geht es nicht nur um Geld und Anerkennung, sondern auch um eine Verringerung der enormen Arbeitsanforderungen und -belastungen, denen diese Beschäftigten ausgesetzt sind.
Bei den aktuellen Streiks von ErzieherInnen in öffentlichen Kindertagesstätten geht es nicht nur um Geld und Anerkennung, sondern auch um eine Verringerung der enormen Arbeitsanforderungen und -belastungen, denen diese Beschäftigten ausgesetzt sind.
Um was es dabei geht und wie viele Erzieherinnen hoch beansprucht sind, lässt sich einer gerade abgeschlossenen Studie von WissenschaftlerInnen des Bundesinstituts für Berufliche Bildung (BIBB) im Auftrag der Böckler Stiftung entnehmen. Als Datengrundlage diente die letzte BiBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung aus dem Jahr 2012. Dort wurden insgesamt 20.000 Erwerbstätige in Deutschland, unter ihnen knapp 400 Erzieherinnen und Erzieher ausführlich zu ihren Arbeitsbedingungen befragt. Zusammen mit Ergebnissen aus anderen Studien über die Arbeitssituationen in der Kindertagesbetreuung bzw. frühkindlichen Bildung entsteht ein facettenreiches Bild.
Die wichtigsten Erkenntnisse lauten:
• "Zwischen 2007 und 2014 ist die Zahl der Beschäftigten in Kindertageseinrichtungen um 44 Prozent auf 527.000 gestiegen. Der Anspruch, immer mehr und zunehmend jüngere Kinder möglichst ganztags zu betreuen und dabei einen Bildungsauftrag zu verfolgen, hat auch das Berufsbild verändert: Die fachlichen Anforderungen an ihrem Arbeitsplatz hätten sich erhöht, geben 60 Prozent der Erzieherinnen und Erzieher an. In anderen Berufen liegt der Anteil im Schnitt signifikant niedriger - bei gut 46 Prozent.
• Bei den psychischen Anforderungen zeigen die Daten ein besonderes Profil. Erzieherinnen üben seltener Routinearbeiten aus als andere Beschäftigte. Das schützt einerseits vor Monotonie, fordert aber die geistige Flexibilität heraus und kann überfordern. 84 Prozent der Erzieherinnen geben an, häufig mehrere Arbeiten oder Vorgänge gleichzeitig im Auge behalten zu müssen. Im Durchschnitt der Beschäftigten anderer Berufe sagen das nur knapp 60 Prozent. Auch Unterbrechungen einer einmal begonnenen Tätigkeit kommen häufiger vor als an anderen Arbeitsplätzen.
• Lasten heben, arbeiten in unangenehmen Positionen und bei starkem Lärm - was nach Handwerk oder Fabrikarbeit klingt, ist typisch für Tätigkeiten im Erziehungsbereich, zeigen die Daten. So muss ein gutes Drittel der Erzieherinnen häufig mehr als zehn Kilo tragen, während das im Durchschnitt anderer Berufe nur für gut ein Fünftel gilt. In gebückter, hockender oder kniender Stellung arbeiten fast 60 Prozent der Kräfte oft - um den Größenunterschied zu den Kindern auszugleichen oder weil Stühle und Tische an ihrem Arbeitsplatz meist nicht für Erwachsene gebaut sind. In der Vergleichsgruppe müssen nur 16 Prozent in auf Dauer schmerzhaften Körperhaltungen arbeiten.
• 37 Prozent der Erzieherinnen kommen häufig mit Viren oder Bakterien in Berührung, jede Fünfte fühlt sich dadurch gesundheitlich belastet, während es im Mittel aller Beschäftigten nur jeder 20. ist. Kälte oder Chemikalien sind Beschäftigte in Erziehungsberufen zwar unterdurchschnittlich ausgesetzt, was sie mit vielen Büroberufen verbindet. Massive Lärmbelastungen sind hingegen häufig: Drei Viertel der Erzieherinnen berichten von Lärm bei der Arbeit, das sind gut dreimal so viele wie unter allen Beschäftigten. In Fallstudien an Kitas hätten Forscher sehr oft Geräuschpegel über 80 Dezibel und sogar 85 Dezibel gemessen.
• Deutlich häufiger als andere Erwerbstätige berichten ErzieherInnen von Schmerzen, etwa an Rücken, Kreuz, Schulter oder Kopf, der Krankenstand liegt über dem Mittel der anderen Berufe. Doch nicht immer bleiben Erkrankte auch zu Hause: 70 Prozent der befragten Erzieherinnen und Erzieher sagen, sie seien während des letzten Jahres krank bei der Arbeit gewesen - wiederum ein im Vergleich zu allen Beschäftigten überdurchschnittlicher Wert und ein Indikator für eine dünne Personaldecke. Unter diesen Umständen traut sich nur eine Minderheit zu, über ein komplettes Berufsleben durchzuhalten: Fast 77 Prozent der Erzieherinnen und Erzieher möchten gerne vorzeitig in Rente gehen. Mehr als die Hälfte gibt als Grund an, dass die Arbeit sehr anstrengend ist.
• Die Sorge- und Bildungsarbeit für und mit Kindern und Jugendlichen, also den zentralen Inhalt ihrer Tätigkeit, bewerten Erzieherinnen positiver als Beschäftigte anderer Berufsgruppen. Der Anteil der in diesem Punkt "sehr Zufriedenen" liegt mit fast 35 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Auch mit ihren Möglichkeiten, eigene Fähigkeiten anzuwenden, sind relativ viele Erzieherinnen zufrieden. Deutlich kritischer als andere Beschäftigte sehen sie hingegen die Ausstattung ihres Arbeitsplatzes und die körperliche Belastung bei der Arbeit. Als größtes Defizit in ihrem Beruf erscheint vielen Erzieherinnen und Erziehern eine zu geringe Bezahlung: Knapp 50 Prozent der Erzieherinnen und Erzieher zeigen sich damit in der BiBB/BAuA-Befragung weniger oder gar nicht zufrieden. Das sind fast 22 Prozentpunkte mehr als im Mittel der anderen Berufe."
Erneut erweist sich die im Prinzip für wissenschaftliche NutzerInnen frei erhältlichen Daten der seit vielen Jahren regelmäßig durchgeführten BiBB/BAuA-Befragung als eine ertragreiche Quelle für Analysen berufsspezifischer Arbeitsbedingungen.
Zur Unzufriedenheit mit der Entlohnung passen volkswirtschaftliche Zahlen zum Anteil des Bruttoinlandprodukts, der in verschiedenen entwickelten Länder insgesamt für die rhetorisch stets als besonders wichtig erklärte frühkindliche Bildung ausgegeben wird. Die OECD empfiehlt ihren Mitgliedsländern einen Anteil von mindestens 1%, Schweden übertrifft diesen Wert mit etwas über 2% deutlich und Deutschland liegt mit 0,65% deutlich darunter und hält - so die Argumente der kommunalen Arbeitgeber - eine Erhöhung für nicht finanzierbar.
Der Studienbericht "Erzieherinnen und Erzieher in der Erwerbstätigkeit - Ihre Arbeitsbedingungen, Arbeitsbelastungen und die Folgen" von Anja Hall, Anja und Ingrid Leppelmeier, Ingrid wird noch 2015 als Wissenschaftliches Diskussionspapier 161 des Bundesinstituts für Berufsbildung erscheinen (regelmäßig die Website des Instituts besuchen). Bis dahin liefert eine Zusammenfassung von der Böckler Stiftung die wichtigsten Ergebnisse
Bernard Braun, 2.6.15
Was kosten 50 Jahre Abstand zwischen Wissen und Handeln? Bei Asbest bis zu 26.000 Menschenleben!
 Asbest ist ein Paradefall dafür, was passiert, wenn vorhandenes Wissen nicht oder erst nach jahre- oder gar jahrzehntelangen Debatten in entschiedenes Handeln umgesetzt wird.
Asbest ist ein Paradefall dafür, was passiert, wenn vorhandenes Wissen nicht oder erst nach jahre- oder gar jahrzehntelangen Debatten in entschiedenes Handeln umgesetzt wird.
Dass dieses "Mineral der tausend Möglichkeiten" gesundheitsgefährdend ist, wurde bereits Anfang des 20. Jahrhunderts erkannt. In Deutschland ist Lungenkrebs in Verbindung mit Asbest außerdem seit 1942 offiziell als Berufskrankenheit anerkannt. Wer die Anerkennungspraxis gesundheitsgefährdender Arbeitsstoffe kennt, weiß, dass diese Anerkennung auf absolut gesicherten Zusammenhängen beruht. Trotzdem wurden insbesondere beim Wiederaufbau von Wohnungen und sonstigen Gebäuden nach dem zweiten Weltkrieg Unmassen von Asbest verbaut und seine Gesundheitsgefahren verharmlost. Erst 1993 gab es ein umfassendes Verbot.
Einige der Folgen dieses späten Verbots dokumentiert das aktuelle Asbest-Profil für die Bundesrepublkik Deutschland:
• Bis heute sind danach bis zu 2,5 Millionen Beschäftigte in Deutschland asbestgefährdet gewesen oder potenziell immer noch.
• Seit 2001 fielen rund vier Millionen Tonnen asbesthaltiger Müll - zumeist in Form von Bauschutt - an. Aktuell sind immer noch über 35 Millionen Tonnen asbesthaltiges Material verbaut, meist in Form von Asbestzement.
• Dies führt dazu, dass Ende 2012 immer noch fast 89.000 Beschäftigte in Deutschland mit Asbestprodukten in Kontakt gerieten.
• Nach einer durchschnittlichen Latenzzeit zwischen Asbestbelastung und Krebserkrankung von 38 Jahren verstarben allein 2012 über 1.500 Berufserkrankte an den Wirkungen von asbesthaltigen Stäuben.
• Zwischen 1994 und 2012 verstarben insgesamt rund 26.000 Menschen vor allem an asbestverursachten Bindegewebstumore sowie Lungen- und Kehlkopfkrebs.
• "Die Kosten für die medizinische Versorgung und Rentenzahlung für Asbesterkrankte und deren Angehörige lagen in den Jahren 1990 bis 2012 bei etwa 6,1 Milliarden Euro und werden voraussichtlich auf bis zu 10 Milliarden Euro ansteigen."
Wer heute das jahrelange Ringen um das Verbot zahlreicher für gesundheitsgefährdend gehaltenen Stoffe auf nationaler oder EU-Ebene und die beruhigenden Herstellerhinweise auf dessen geringe unerwünschte Folgen mitbekommt, sollte einen Blick in die Geschichte des Asbestverbots und ihrer Auswirkungen werfen.
Die 70 Seiten National Asbestos Profile for Germany sind eine 2014 erschienene Publikation der "Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin" und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 1.2.15
Wie wirken sich viele kürzere Episoden von Arbeitslosigkeit auf Gesundheit und Gesundheitsverhalten aus? Sehr unterschiedlich!
 Mittlerweile bestehen kaum mehr Zweifel daran und gibt es auch ausreichend Daten dafür, dass Langzeitarbeitslosigkeit die Gesundheit der Davon Betroffenen erheblich belastet und verschlechtert. Dass in vielen Ländern neben den Langzeit- und Dauerarbeitslosen aber auch viele Beschäftigte über lange Zeiten häufigere mehr oder weniger kurze Episoden oder Phasen von Arbeitslosigkeit erfahren und damit kumulativ Arbeitslosigkeitsbedrohungen und -zeiten haben, die nicht arg viel kürzer sind als manche Langzeitarbeitslosigkeit, ist eine Tatsache, wurde aber bisher nicht auf ihre Auswirkung auf Gesundheit untersucht.
Mittlerweile bestehen kaum mehr Zweifel daran und gibt es auch ausreichend Daten dafür, dass Langzeitarbeitslosigkeit die Gesundheit der Davon Betroffenen erheblich belastet und verschlechtert. Dass in vielen Ländern neben den Langzeit- und Dauerarbeitslosen aber auch viele Beschäftigte über lange Zeiten häufigere mehr oder weniger kurze Episoden oder Phasen von Arbeitslosigkeit erfahren und damit kumulativ Arbeitslosigkeitsbedrohungen und -zeiten haben, die nicht arg viel kürzer sind als manche Langzeitarbeitslosigkeit, ist eine Tatsache, wurde aber bisher nicht auf ihre Auswirkung auf Gesundheit untersucht.
Dies ändert sich nun durch eine Langzeitstudie eines 1.083 Personen umfassenden Schuljahrgangs in einer nordschwedischen Stadt, deren Arbeits-, Gesundheits- und Gesundheitsverhaltensbiografien über 14 Jahre mittels regelmäßiger Befragungen untersucht wurden.
Die Ergebnisse sahen so aus:
• Der gesundheitliche Zustand (z.B. Depression, somatische Symptome) und das Gesundheitsverhalten (z.B. Arztbesuche, Rauchen, Alkoholkonsum) korrelieren "dosis"abhängig mit der kumulativen Dauer von Arbeitslosigkeit.
• Hierbei gibt es aber beträchtliche Unterschiede zwischen Männern und Frauen: Während sich der gesundheitliche Zustand der Männer unter dem Einfluss kumulativer Arbeitslosigkeit kaum veränderte oder sich gesundheitliche Symptome sogar verringerten, verschlechterte sich die Gesundheit der Frauen unter denselben Bedingungen erheblich. Genau umgekehrt sieht der Zusammenhang von kumulativer Arbeitslosigkeit und dem Gesundheitsverhalten aus: Während das Verhalten der Frauen relativ gering mit der Summe der Arbeitslosigkeitszeiten verknüpft war, verschlechterte es sich bei den Männern unter denselben Bedingungen beträchtlich.
Die AutorInnen appellieren daher an die Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitiker, auch der Aneinanderreihung kurzer Arbeitslosigkeitsepisoden mehr gesundheitspräventive Aufmerksamkeit zu schenken als bisher. Ob dies in anderen Teilen Schwedens und in anderen Ländern auch so ist und woran dies liegt, bleibt weiteren Studien überlassen.
Der Aufsatz Length of unemployment and health-related outcomes: a life-course analysis von Urban Janlert, Anthony H Winefield und Anne Hammarström ist am 23. November 2014 "online first" in der Zeitschrift "European Journal of Public Health" erschienen und ein Abstract ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 30.11.14
Was beeinflusst die Arbeitsunfähigkeit junger Beschäftigter? Blausaufen und -machen oder die Existenz einer Personalvertretung?
 Zu den monotonen Ergebnissen von Analysen des Arbeitsunfähigkeitsgeschehens gehört seit Jahrzehnten, dass ältere Beschäftigte seltener, dafür aber länger und jüngere Beschäftigte bzw. Azubis häufiger arbeitsunfähig sind, aber dann auch nur für kurze Zeit. Je nach gesellschaftspolitischem Standpunkt wird die Arbeitsunfähigkeit (AU) jüngerer Beschäftigte vor allem auf die subjektiven Eingewöhnungsschwierigkeiten an die Arbeitswelt oder als Folge von nächtlichen oder wochenendlichen Diskobesuchen sowie anderen Freizeitvergnügungen interpretiert, verstanden oder auch als Missbrauch sozialer Regelungen thematisiert.
Zu den monotonen Ergebnissen von Analysen des Arbeitsunfähigkeitsgeschehens gehört seit Jahrzehnten, dass ältere Beschäftigte seltener, dafür aber länger und jüngere Beschäftigte bzw. Azubis häufiger arbeitsunfähig sind, aber dann auch nur für kurze Zeit. Je nach gesellschaftspolitischem Standpunkt wird die Arbeitsunfähigkeit (AU) jüngerer Beschäftigte vor allem auf die subjektiven Eingewöhnungsschwierigkeiten an die Arbeitswelt oder als Folge von nächtlichen oder wochenendlichen Diskobesuchen sowie anderen Freizeitvergnügungen interpretiert, verstanden oder auch als Missbrauch sozialer Regelungen thematisiert.
Dass das AU-Geschehen junger MitarbeiterInnen aber auch in erheblichen Maße von der Existenz einer betrieblichen Personalvertretung, d.h. einer kollektiven sozialen Bedingung abhängig sein kann, zeigt eine gerade veröffentlichte Studie eines Wissenschaftlers am Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB).
Der Analyse lagen die Ergebnisse einer vom BIBB durchgeführten Befragung von 1.250 privaten Ausbildungsbetrieben mit mindestens 5 Beschäftigten zugrunde, die mit Personendaten der Bundesagentur für Arbeit verknüpft wurden. Zu den damit bekannten Daten gehörten neben der Kenntnis von AU-Fällen und der Existenz einer Arbeitnehmervertretung das Alter der Betriebe, die Ausbildungsvergütung oder die Schulabschlüsse und die Erwerbsbiografien der Azubis.
Selbst nachdem der Einfluss der meisten zuletzt genannten Faktoren rechnerisch ausgeschlossen wurde, reduziert die Existenz einer Personalvertretung bzw. einer so genannten "voice"-Institution die Anzahl der AU-Tage um 20%. Plausiblerweise ist die Wirkung eines Betriebsrates in Firmen mit geringer AU-Häufigkeit geringer als in Betrieben mit einem hohen Krankenstand ihrer jungen MitarbeiterInnen.
Woran dies im Detail liegt, fasst der Autor so zusammen: "Studien hätten gezeigt, dass unvorteilhafte Arbeitsbedingungen den Krankenstand erhöhen. Betriebsräte wiederum hätten die Aufgabe, die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen zu Ausbildungsinhalten, Arbeitssicherheit und Arbeitszeiten von Azubis zu kontrollieren und gegen Missstände vorzugehen. Daher sei davon auszugehen, dass die Qualität der Ausbildungsbedingungen in mitbestimmten Betrieben höher ist. Wenn es trotzdem zu Konflikten mit Vorgesetzten kommt, biete Mitbestimmung den Azubis die Möglichkeit, ihre Unzufriedenheit zu artikulieren, statt innerlich zu kündigen." Hinzu dürfte das in seinen Details schwer fassbare partizipative Sozialklima in mitbestimmten Betrieben kommen, das die Identifizierung mit "meinem" Betrieb positiv fördert, und damit ebenfalls zu einer Reduktion der Fehlzeiten beiträgt.
Die methodisch hochwertige Studie Absenteeism in Apprenticeships: What Role Do Works Councils Play? von Harald Pfeifer ist im April 2014 als "Swiss Leading House Working Paper No. 98" der Universität Zürich erschienen und in englischer Sprache komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 9.10.14
Wie oft werden Sie während wichtiger Arbeiten unterbrochen? Wenn oft, könnte dies auch die Qualität ihrer Arbeit beeinträchtigen!
 Zu den seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten in Beschäftigtenbefragungen zu Arbeitsbedingungen am häufigsten genannten Einzelbelastungen gehören regelmäßige Unterbrechungen der Arbeit - Büroarbeiter werden bis zu sechs Mal pro Stunde bei ihrer Arbeit unterbrochen - durch andere Personen und mit Angelegenheiten, die nichts mit der gerade bearbeiteten Aufgabe zu tun haben. Während manche Experten aber auch Betroffene dies als Multitasking-Training für moderne Arbeitnehmer tolerieren, betrachten andere es als abträglich für die Produktivität oder die Qualität der Arbeit.
Zu den seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten in Beschäftigtenbefragungen zu Arbeitsbedingungen am häufigsten genannten Einzelbelastungen gehören regelmäßige Unterbrechungen der Arbeit - Büroarbeiter werden bis zu sechs Mal pro Stunde bei ihrer Arbeit unterbrochen - durch andere Personen und mit Angelegenheiten, die nichts mit der gerade bearbeiteten Aufgabe zu tun haben. Während manche Experten aber auch Betroffene dies als Multitasking-Training für moderne Arbeitnehmer tolerieren, betrachten andere es als abträglich für die Produktivität oder die Qualität der Arbeit.
Eine Gruppe von us-amerikanischen Arbeitswissenschaftlern hat sich nun in einer kleinen experimentellen Studie die möglichen Auswirkungen von Unterbrechungen genauer angeschaut. Anders als einige frühere Studien, untersuchten sie nicht nur die benötigte Arbeitszeit oder die Anzahl von Fehlern, sondern auch die Qualität der Arbeit.
Dazu wurde eine Gesamtgruppe von 54 Studierenden, die einen Essay schreiben sollten in drei Gruppen aufgeteilt: Die erste Gruppe wurde während der Konzipierung und Gliederung ihres Aufsatzes regelmäßig unterbrochen, die zweite Gruppe erfuhr dies während der Zeit des Schreibens und die dritte Gruppe konnte komplett ohne Unterbrechungen arbeiten.
Die Aufsätze wurden von einer Gruppe unabhängiger Fachlektoren beurteilt, mit folgendem Ergebnis: Die Texte der Angehörigen der beiden Gruppen mit ständigen Unterbrechungen waren signifikant von geringerer Qualität als die der Gruppe mit keinerlei Unterbrechungen. Die TeilnehmerInnen, die beim Schreiben unterbrochen wurden, schrieben außerdem erheblich weniger Worte.
Die Autoren empfehlen zumindest für den Anfang, Handys während der Arbeit an wichtigen Texten oder Produkten auszuschalten und auch den hör- oder sehbaren Empfang von E-Mails auszublenden.
Um die gewonnenen Ergebnissen zu erhärten, zu untersuchen, ob solche Qualitätsmängel auch bei anderen unterbrochenen Tätigkeiten auftreten und wodurch solche Mängel im Detail zustandekommen, bedarf es sicherlich noch weiterer und vor allem auch Studien mit mehr TeilnehmerInnen.
Der Aufsatz Do Interruptions Affect Quality of Work? von Cyrus Foroughi et al. ist am 7. Juli 2014 in der Zeitschrift "Human Factors" erschienen. Das Abstract ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 15.7.14
Anzahl älterer Arbeitnehmer mit Wechselschicht nimmt zu - schlechter Gesundheitszustand ebenfalls
 Sowohl wegen des tendenziellen Rückgangs der Anzahl jüngerer Arbeitskräfte und damit auch der Facharbeitskräfte als auch wegen der sozialen, finanziellen und gesundheitlichen Nachteile von Berufs- und Erwerbsunfähigkeit vor dem Erreichen des normalen Altersrentenalters, nehmen die Appelle, auch über 50-Jährigen noch zu beschäftigen, seit Jahren zu. Diese Appelle zeigen in einigen Untergruppen der älteren Arbeitnehmer (z.B. der 60-bis 65-Jährigen) auch langsam Wirkung. Bei einigen der wichtigen Voraussetzungen für "gute Arbeit" in diesem Lebensalter, beispielsweise der altersspezifischen Gesundheitsförderung und Weiterbildung bewegt sich allerdings relativ wenig.
Sowohl wegen des tendenziellen Rückgangs der Anzahl jüngerer Arbeitskräfte und damit auch der Facharbeitskräfte als auch wegen der sozialen, finanziellen und gesundheitlichen Nachteile von Berufs- und Erwerbsunfähigkeit vor dem Erreichen des normalen Altersrentenalters, nehmen die Appelle, auch über 50-Jährigen noch zu beschäftigen, seit Jahren zu. Diese Appelle zeigen in einigen Untergruppen der älteren Arbeitnehmer (z.B. der 60-bis 65-Jährigen) auch langsam Wirkung. Bei einigen der wichtigen Voraussetzungen für "gute Arbeit" in diesem Lebensalter, beispielsweise der altersspezifischen Gesundheitsförderung und Weiterbildung bewegt sich allerdings relativ wenig.
Und auch bei einem der wesentlichen Merkmale von Arbeit, der Arbeitszeitform, gibt es Entwicklungen, welche speziell ältere Arbeitnehmer eher belasten als entlasten. Ob dies für die Schichtarbeitsform der Wechselschicht gilt, haben jetzt WissenschaftlerInnen des "Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB)" der Bundesagentur für Arbeit mit Daten von 6.585 im Rahmen des Projekts "lidA - leben in der Arbeit. Kohortenstudie zu Gesundheit und Aelterwerden in der Arbeit" befragten Personen der Geburtsjahrgänge 1959 und 1965 untersucht.
Die wesentlichen Ergebnisse lauten:
• "Die Zahl der über 50-Jährigen in Schichtarbeit hat sich im vergangenen Jahrzehnt mehr als verdoppelt (1998: 594.000 - 2011: 1,29 Millionen). Dieser Anstieg ist sowohl auf das Altern der geburtenstarken Jahrgänge der 1950er und 1960er Jahre als auch auf eine Ausweitung der Schichtarbeit im Dienstleistungssektor zurückzuführen." 2011 arbeiteten 13% der 50- bis unter 65-Jährigen dauernd oder regelmäßig in Wechselschicht. Bei den 20- bis unter 35-Jährigen machten dies 18%.
• "Schichtarbeit kann mit gesundheitlichen Problemen verbunden sein: So weisen Beschäftigte in Schichtarbeit einen schlechteren körperlichen Gesundheitszustand auf und geben häufiger Schlafstörungen an als Beschäftigte mit normalen Arbeitszeiten."
• "Schichtarbeitende sind öfter in Arbeiterpositionen tätig und berichten häufiger von körperlichen und psychischen Arbeitsbelastungen. Außerdem erfahren sie weniger Anerkennung durch Vorgesetzte."
• Auch wenn mit dieser Querschnittststudie keine kausalen Analysen möglich sind, zeigen mehrere multivariate Analysen, dass nicht die Schichtarbeit als Einzelfaktor mit einem schlechteren Gesundheitszustand assoziiert ist. Vielmehr ist "Schichtarbeit vor allem deshalb mit einem schlechteren Gesundheitszustand assoziert", weil Schichtdienstbeschäftigte an Arbeitsplätzen "mit starker körperlicher Belastungen, psychischer Verausgabung und mangelnder sozialer Unterstützung" beschäftigt sind. Sie sind ihr Arbeitsleben überwiegend als Arbeiter tätig auch daher auch in jüngerem Alter höheren Belastungen ausgesetzt als z.B. Angestellte.
• Weitere Erkenntnisse versprechen sich die AutorInnen dann, wenn es weitere Befragungswellen gibt.
Diese Studie zeigt noch zwei generellere Phänomene: Wer aus welchen Gründen auch immer an einer möglichst langen Beschäftigung älterer Arbeitnehmer in guter Gesundheit interessiert ist, muss auch etwas an den Arbeitsbedingungen oder -belastungen in jüngeren Jahren ändern. Auch wenn Arbeit in Wechselschicht allein nicht die befürchtete negative Wirkung auf die älteren Arbeitnehmer hat, sollte ein altersgerechter Arbeits-und Gesundheitsschutz nicht nur den Zuwachs an Schichtarbeit bei älteren Arbeitnehmern bremsen, sondern auch ihren Sockel abbauen und altersangemessene Arbeitsinhalte und -formen entwickeln.
Die Studie Beschäftigte an der Schwelle zum höheren Erwerbsalter Schichtarbeit und Gesundheit von Carina Leser, Anita Tisch und Silke Tophoven ist als IAB-Kurzbericht 31/2013 erschienen, umfasst 8 Seiten und kann kostenlos bezogen werden.
Bernard Braun, 22.11.13
Arbeitszeit für Krankenhausärzte senken und "alles gut"? Ein Trugschluss bei Assistenzärzten in den USA!
 Eine Verkürzung der Pflichtarbeitsstunden für Krankenhausärzte erscheint für ihren Schlafbedarf, ihr Wohlbefinden und ihre und die der Patienten Sicherheit so evident zu sein, dass es überflüssig erscheint, zu überprüfen, ob die kürzere Arbeitszeit auch zu den erwarteten Effekten führt.
Eine Verkürzung der Pflichtarbeitsstunden für Krankenhausärzte erscheint für ihren Schlafbedarf, ihr Wohlbefinden und ihre und die der Patienten Sicherheit so evident zu sein, dass es überflüssig erscheint, zu überprüfen, ob die kürzere Arbeitszeit auch zu den erwarteten Effekten führt.
Bei einer doch durchgeführten Untersuchung der tatsächlichen Folgen der im Jahr 2011 für im ersten Jahr an us-amerikanischen Krankenhäusern tätigen Assistenzärzten eingeführte Begrenzung der Pflichtarbeitsstunden, gab es aber unerwartete und keineswegs nur positive Ergebnisse. Die Studie untersuchte dafür eine Reihe von arbeitszeitassoziierten Ereignissen in einer Kohorte von 2.323 Assistenzärzten an 14 universitären und kommunalen Lehrkrankenhäusern im Zeitraum 2009 bis 2011/12.
Die Ergebnisse:
• Wie erwartet sank die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit signifikant von durchschnittlich 67 Stunden vor der Arbeitszeitreduzierung im Jahr 2011 auf 64,3 Stunden pro Woche nach der Reform.
• Trotz der abnehmenden Arbeitsstundenzahl gab es keine signifikanten Veränderungen bei den Schlafstunden. Die Schlafdauer stieg von 6,8 auf 7 Stunden.
• Auch die Häufigkeit depressiver Symptome oder das Wohlbefinden der Nutznießer dieser neuen Arbeitszeitregelung veränderte sich nach den Angaben der Assistenzärzte nur sehr gering und in keinem Fall signifikant.
• Was sich deutlich und signifikant veränderte und sogar zunahm war der Anteil von angehenden Ärzten, der sich Sorgen machte einen ernsthaften medizinischen Fehler zu begehen. Vor der Reform dachten dies 19,9% und nach der Reform 23,3% (p=0,007).
• Die Studienautoren bieten eine Reihe von Erklärungen an. So scheint z.B. die Anzahl von Assistenzärzten nicht parallel zur Senkung der Arbeitsstunden zugenommen zu haben, was zu einer Verdichtung der Arbeit führte. Zugenommen hat auch die Anzahl der Übergaben von Patienten an andere Ärzte, was u.U. wegen so genannter "stille-Post"-Effekte zu einer Zunahme medizinischer Fehler führte.
Auch wenn die Studie einige Limitationen aufweist (z.B. das übliche Problem, dass die Beteiligungsbereitschaft von Ärzten an derartigen Studien relativ gering ist oder auch die Grenzen der Selbstwahrnehmung der Effekte bei den befragten Ärzten), wird zweierlei klar: Auch dort wo jedermann fest zu wissen meint, welche Folgen eine Reform haben wird, sollten diese untersucht werden. Zweitens können die hier erwarteten positiven Effekte wie mehr Schlaf und besseres Wohlbefinden offensichtlich auch nicht nur durch eine Intervention entstehen, sondern bedürfen eines Bündels von Maßnahmen. Dazu gehören nach Meinung der Wissenschaftler dieser Studie auch noch zusätzliche Qualifikationen der Jungärzte und in jedem Fall auch direkte Verbesserungen der Patientenbehandlung und der Sicherheitskultur in den Krankenhäusern.
Ob diese unerwarteten Folgen einer Arbeitszeitverringerung auch bei berufserfahrenen Fach- oder Oberärzten auftreten oder gar nach der auch in Deutschland seit einiger Zeit verkürzten Arbeitszeit bei deutschen Assistenzärzten und ihren ausgebildeten Facharztkollegen, ist so nicht bekannt. Vielleicht führt eine entsprechende Studie bei deutschen Krankenhausärzten auch zu unerwarteten Ergebnissen!?
Der Aufsatz Effects of the 2011 duty hour reforms on interns and their patients: a prospective longitudinal cohort study. von Sen S, Kranzler HR, Didwania AK, Schwartz AC, Amarnath S, Kolars JC, Dalack GW, Nichols B und Guille C. ist am 22. April 2013 in der Fachzeitschrift "JAMA Internal Medicine" erschienen (173(8): 657-62). Das Abstract ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 7.9.13
Altersgemischte Teams: wirksamste Maßnahme die Beschäftigungsdauer älterer Arbeitnehmern bis zur Altersgrenze zu verlängern!
 In der Debatte über die Folgen des demografischen Umbaus und die Möglichkeiten sie abzumildern oder sie "uns leisten zu können", spielt der Erhalt und der Ausbau der Beschäftigung älterer Erwerbstätiger vor der heutigen Altersgrenze eine wichtige Rolle. Hier geht es also nicht um die Arbeit bis 67 oder gar 70 und auch nicht darum, dass manche Arbeitnehmer u.a. durch Arbeit gesundheitlich so beeinträchtigt sind, dass sie weder das 65. noch das 67. Lebensjahr arbeitend erreichen können. Aus Sicht des Gesundheitssystems tragen möglichst lange erwerbstätige ältere Personen einerseits länger und stärker zur Finanzierung der GKV und anderer Sozialversicherungsträger bei als Arbeitslose oder Frührentner. Da Erwerbstätigkeit auch Erwerbsfähigkeit und damit u.a. relative Gesundheit voraussetzt und im günstigen Fall erhält, trägt die Beschäftigung älterer ArbeitnehmerInnen auch zur Senkung der laufenden Gesundheitsausgaben und vor allem auch zur Vermeidung eines Teils der künftigen gesundheitlichen Beeinträchtigungen oder eines frühzeitigen Todes bei. Verschiedene Studien haben gezeigt, dass z.B. aus gesundheitlichen Gründen frühpensionierten Arbeitnehmer auch nach ihrer Berentung eine wesentliche schlechtere Lebensqualität haben und früher sterben als normal pensionierte Personen. Und schließlich können im Zeichen des tatsächlichen oder vermeintlichen Fachkräftemangels ausgebildete und langjährig erfahrene Beschäftigte in besonderer Weise zur Arbeitsproduktivität von Unternehmen beitragen.
In der Debatte über die Folgen des demografischen Umbaus und die Möglichkeiten sie abzumildern oder sie "uns leisten zu können", spielt der Erhalt und der Ausbau der Beschäftigung älterer Erwerbstätiger vor der heutigen Altersgrenze eine wichtige Rolle. Hier geht es also nicht um die Arbeit bis 67 oder gar 70 und auch nicht darum, dass manche Arbeitnehmer u.a. durch Arbeit gesundheitlich so beeinträchtigt sind, dass sie weder das 65. noch das 67. Lebensjahr arbeitend erreichen können. Aus Sicht des Gesundheitssystems tragen möglichst lange erwerbstätige ältere Personen einerseits länger und stärker zur Finanzierung der GKV und anderer Sozialversicherungsträger bei als Arbeitslose oder Frührentner. Da Erwerbstätigkeit auch Erwerbsfähigkeit und damit u.a. relative Gesundheit voraussetzt und im günstigen Fall erhält, trägt die Beschäftigung älterer ArbeitnehmerInnen auch zur Senkung der laufenden Gesundheitsausgaben und vor allem auch zur Vermeidung eines Teils der künftigen gesundheitlichen Beeinträchtigungen oder eines frühzeitigen Todes bei. Verschiedene Studien haben gezeigt, dass z.B. aus gesundheitlichen Gründen frühpensionierten Arbeitnehmer auch nach ihrer Berentung eine wesentliche schlechtere Lebensqualität haben und früher sterben als normal pensionierte Personen. Und schließlich können im Zeichen des tatsächlichen oder vermeintlichen Fachkräftemangels ausgebildete und langjährig erfahrene Beschäftigte in besonderer Weise zur Arbeitsproduktivität von Unternehmen beitragen.
So weit, so schön, aber auch gut, und wie schafft man dies? Auf diese Fragen gibt nun eine Ende 2012 veröffentlichte Studie des Mannheimer "Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW)" eine Antwort. Das ZEW untersuchte die Wirkung verschiedener Maßnahmen mit Daten des "Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB)" der Bundesagentur für Arbeit zu Arbeitnehmern zwischen 40 und 65 Jahren aus dem Jahr 2002. Grundlage waren Angaben aus 1.063 westdeutschen Unternehmen, die mindestens fünf ältere Mitarbeiter beschäftigen.
Die Ergebnisse lauten im Einzelnen so:
• Nicht alle, sondern nur etwa die Hälfte der untersuchten Unternehmen boten ihren älteren ArbeitnehmerInnen mindestens eine Maßnahme an (so genannte "specific measures for older employees (SMOE)".
• 36% boten mit der Altersteilzeit die Möglichkeit an, bei möglichst bis zur normalen Altersgrenze verlängerter Vertragsdauer die Arbeitszeit zu reduzieren. 18% der Betriebe förderten altersgemischte Arbeitsteams aus älteren berufserfahrenen Arbeitnehmern und jüngeren Beschäftigten mit ihrem neueren Fachwissen und 17% boten allgemeine Weiterbildungsmaßnahmen an.
• Altersgerechte Ausstattung des Arbeitsplatzes, verringerte allgemeine oder auch sehr spezifische Arbeitsanforderungen z.B. im physischen Bereich oder eine altersspezifische Weiterbildung wurden nur sehr selten, d.h. von 4%, 5% und 2% der Unternehmen angeboten. Für alle diese Maßnahmen gibt es seit Jahrzehnten aus der Forschung zur Humanisierung der Arbeitswelt genügend handfeste und modellhaft meist erprobte Maßnahmen. Der beobachtete Mangel ist also kein Wissensproblem.
• Die Wirkungen: In Betrieben, die Altersteilzeitregelungen anbieten, sind Beschäftigungsdauern bis zur heutigen Altersgrenze sogar kürzer als in anderen Betrieben. Nur in Betrieben mit altersgemischten Teams sind Beschäftigungsabgänge im Alter von 52 bis 64 Jahren durchgehend verringert, also die Beschäftigungsdauer länger. Für alle anderen SMOEs, also auch die Weiterbildung finden die ForscherInnen keinen Einfluss auf die Beschäftigungsdauer älterer ArbeitnehmerInnen. Dies kann allerdings auch daran liegen, dass die meisten dieser Maßnahmen zu selten angeboten werden.
Zuzustimmen ist den ZEW-Forschern, dass insbesondere mit personenbezogenen Methoden und Daten noch weitergeforscht werden muss. Warum ein Teil der Unternehmen gar keine Maßnahmen für ältere Arbeitnehmer anbietet oder andere eventuell wirksame nur in geringem Umfang, ist aber keine Frage der Forschung, sondern der sozialen Verantwortung von Unternehmen und einer größeren Übereinstimmung des alarmistischen Diskurses über Alterungsfolgen mit der Bereitschaft selber etwas dagegen zu tun.
Das 40-seitige ZEW-Diskussionspapier Specific Measures for Older Employees and Late Career Employment, Boockmann von Bernhard, Jan Fries und Christian Göbel (ZEW Discussion Paper No. 12-059) ist komplett kostenlos in englischer Sprache erhältlich.
Bernard Braun, 14.3.13
Geringe Arbeitsfähigkeit im mittleren Alter ein Frühwarnindikator für große Gesundheitsprobleme im Alter
 Ein großes Problem der Prävention arbeitsassoziierter Frühinvalidität und gesundheitlicher Probleme im Alter ist, diese Risiken so früh und verlässlich wie möglich identifizieren und quantifizieren zu können. In einer repräsentativen Studie mit 5.971 44-58-jährigen finnischen BürgerInnen, deren gesundheitlicher Zustand über 28 Jahre hinweg untersucht wurde, erweist sich der Indikator der "work ability" oder Arbeitsfähigkeit im mittleren Lebens- und Arbeitsalter als für diese Zwecke tauglich.
Ein großes Problem der Prävention arbeitsassoziierter Frühinvalidität und gesundheitlicher Probleme im Alter ist, diese Risiken so früh und verlässlich wie möglich identifizieren und quantifizieren zu können. In einer repräsentativen Studie mit 5.971 44-58-jährigen finnischen BürgerInnen, deren gesundheitlicher Zustand über 28 Jahre hinweg untersucht wurde, erweist sich der Indikator der "work ability" oder Arbeitsfähigkeit im mittleren Lebens- und Arbeitsalter als für diese Zwecke tauglich.
Arbeitsfähigkeit ist das Ergebnis der Interaktion von Arbeitsbedingungen und Individuum und eine wesentliche Grundlage für das Wohlbefinden des Einzelnen und die Produktivität eines Unternehmens. Sie kann durch arbeitsbezogene und individuelle Maßnahmen gefördert und nachhaltig verbessert werden. Der in Finnland entwickelte "Work Ability Index (WAI)"-Fragebogen dient zur Einschätzung der Arbeitsfähigkeit bei einzelnen Arbeitnehmern wie bei Beschäftigtengruppen. Er wird im Rahmen der betriebsärztlichen Betreuung, flankierend bei Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung und in Forschungsprojekten eingesetzt. Der WAI kann dazu beitragen, dass frühzeitig Handlungsbedarf identifiziert wird und auf dieser Grundlage Präventionsmaßnahmen zum Erhalt und zur Förderung der Arbeitsfähigkeit getroffen werden.
In den Arbeitsfähigkeits-Index gehen im Wesentlichen ein: die Bewertung der derzeitigen Arbeitsfähigkeit im Vergleich zu der besten, je erreichten Arbeitsfähigkeit, die Einschätzung der derzeitigen Arbeitsfähigkeit in Bezug auf die körperlichen und psychischen Anforderungen, die Einschätzung der eigenen Arbeitsfähigkeit in zwei Jahren, Angaben über die Art der Tätigkeit (geistig, körperlich), die Anzahl der aktuellen ärztlich diagnostizierten Krankheiten, die von den Befragten geschätzte Beeinträchtigung der Arbeitsleistung durch die Krankheiten, der Krankenstand in den letzten 12 Monaten und Angaben zu einigen psychischen Leistungsreserven (Aufgaben mit Freude erledigt, aktiv und rege, zuversichtlich für die Zukunft.
Von den ursprünglichen TeilnehmerInnen der 1981 gestarteten "Finnish Longitudinal Study of Municipal Employees (FLAME)" waren bis 2009 rund 32% gestorben und weitere 23% waren in irgendeiner Weise behindert. Die Anzahl der Todesfälle pro 1.000 Personenjahre lag bei den im Büro angestellten Männern ("white-collar men") mit exzellenter Arbeitsfähigkeit bei 7,7, bei den Männern mit moderater Arbeitsfähigkeit bei 14,7 und bei den Männern, die eine geringe Arbeitsfähigkeit aufwiesen bei 23,5. Bei den Arbeitern ("blue-collar men") stieg die Anzahl der Todesfälle/1.000 Personenjahre von 15,5 über 20,2 auf 25,3. Bei den erwerbstätigen Frauen schwankte dieser Sterblichkeitsindikator auch in Abhängigkeit von der Arbeitsfähigkeit, aber lediglich zwischen 6,3 und 10,6 Fällen/1.000 Personenjahre. Die altersadjustierte Risikorate für Sterblichkeit war bei männlichen Arbeitern mit einer geringeren Arbeitsfähigkeit im mittleren Lebensalter zwei- bis dreimal höher als bei männlichen Angestellten mit einer ausgezeichneten Arbeitsfähigkeit im selben Lebensabschnitt.
Fasst man das Sterbe- und das Risiko von Behinderungen im täglichen Leben zusammen, war deren Wahrscheinlichkeit bei den männlichen Arbeitern mit geringer Arbeitsfähigkeit im mittleren Lebensabschnitt um das 4 1/2-Fache (odds ratio=4,56) höher als das der männlichen Angestellten mit sehr hoher Arbeitsfähigkeit. Die Sterbe- und Behinderungswahrscheinlichkeit war bei den ArbeiterInnen mit geringer Arbeitsfähigkeit in ihren mittleren Lebensjahren dreimal so hoch wie bei den männlichen Angestellten mit sehr hoher Arbeitsfähigkeit.
Der Aufsatz "Work ability in midlife as a predictor of mortality and disability in later life: a 28-year prospective follow-up study" von Mikaela B. von Bonsdorff, Jorma Seitsamo, Juhani Ilmarinen, Clas-Håkan Nygård, Monika E. von Bonsdorff und Taina Rantanen ist im März 2011 in der Fachzeitschrift "Canadian Medicine Association Journal (CMAJ)" (183 [4]: E 325-E242) erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 11.12.11
Drei Seiten der Medaille: Gesundheitsrisiken in Berufen, Krankheitslast von Berufen und Belastungen in Berufen mit viel Krankheit
 Im November 2011 erschien ausschließlich online der Band 22 der Reportreihe der "Initiative Gesundheit und Arbeit (iga)", einer Gemeinschaftsveranstaltung der gesetzlichen Kranken- und Unfallversicherung, um arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren vorzubeugen.
Im November 2011 erschien ausschließlich online der Band 22 der Reportreihe der "Initiative Gesundheit und Arbeit (iga)", einer Gemeinschaftsveranstaltung der gesetzlichen Kranken- und Unfallversicherung, um arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren vorzubeugen.
Der Band dokumentiert die wesentlichen Ergebnisse zweier Teilprojekte und stellt eine wahre Fundgrube und eine unverzichtbare Informationsquelle für die Arbeit von Wissenschaftlern, Publizisten oder Betriebsräte zum Themenfeld Arbeit und Gesundheit dar.
Projektteil 1 zielte auf eine Zusammenstellung der wissenschaftlichen Übersichtsliteratur und die Ermittlung der Verbreitung der Risikofaktoren nach Berufen. Hierdurch sollten insbesondere folgende Fragen beantwortet werden:
• Welche systematischen Übersichtsarbeiten gibt es im Hinblick auf Risikofaktoren der Arbeitswelt?
• Was gilt wissenschaftlich als gesicherter arbeitsweltbezogener Risikofaktor für welche Krankheiten?
• In welchen Berufen kommen die als gesichert geltenden Risikofaktoren besonders häufig vor?
In die Auswertung gingen letztlich 53 wissenschaftlich hochwertige Übersichtsarbeiten ein, die über physische und/oder psychische Risikofaktoren aus dem Bereich psychische Störungen, Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems, Muskel-Skelett-Erkrankungen und Verletzungen berichteten
Tabellenförmig wird z.B. gezeigt, wie oft eine Berufsgruppe unter den zehn Berufsgruppen mit der jeweils größten Verbreitung der Risikofaktoren vertreten war. Bei Männern sind es z. B. Maschinisten sowie die Keramik- und Glasberufe, die jeweils sieben Mal zu den zehn Berufen gehörten, bei denen die als wissenschaftlich belegt geltenden Risikofaktoren besonders häufig vorkommen. Die insgesamt meisten Nennungen erfolgten für weibliche Maschinisten und zugehörige Berufe, bei denen neun wissenschaftlich als belegt geltenden Risikofaktoren gehäuft vorkommen (> 80 % der einbezogenen Risikofaktoren). Mit sieben Nennungen sind bei Frauen die Gesundheitsdienstberufe, die Hoch- und Tiefbauberufe sowie die Hilfsarbeiterberufe ähnlich stark betroffen. Bei dieser Betrachtungsweise müssten damit die Maschinisten und zugehörige Berufe sowie die Hilfsarbeiter in den Mittelpunkt von Präventionshandeln rücken.
Projektteil 2 diente der Ermittlung der Krankheitslast nach Berufen und der relativen Belastungsrisiken für Berufe mit hoher Krankheitslast. Ergänzend zu den als wissenschaftlich gesichert geltenden Risikofaktoren sollen auffällige Belastungen identifiziert werden, die bislang in wissenschaftlichen Übersichtsarbeiten nicht ausreichend untersucht wurden.
Konkret zielte dieses Teilprojekt auf die Fragen:
• In welchen Berufen findet sich eine besondere Häufung von Krankheitsmaßen wie z. B. Arbeitsunfähigkeit, Arbeitsunfälle oder Frühberentung?
• Welche Belastungen treten bei diesen Berufen besonders häufig auf?
• Welche Berufe weisen eine hohe Krankheits- und Risikofaktorenlast auf?
Bei Männern nehmen aus dieser Perspektive die Keramik- und Glasberufe den ersten Rang ein. Auf dem Rangplatz zwei finden sich die Textil- und Bekleidungsberufe, deren Krankheitslast sich aus sehr hohen Rängen für die Krankenhausbehandlung ergibt. Bei den Frauen zeigt sich die höchste Krankheitslast bei den Berufen in der Metallerzeugung und -bearbeitung. Sie erreichen einen höheren Wert als Männer und schöpfen 80 % der maximal erreichbaren Rangsumme aus. Mit einer nur geringfügig geringeren Rangsumme wird von den Frauen in Maler- und Lackiererberufen der zweite Platz eingenommen. Auffallend ist, dass sich auf den oberen Rangplätzen traditionelle "Männerberufe" finden, erst auf dem Rangplatz 5 taucht mit den Verkehrsberufen eine Berufsgruppe auf, in denen Frauen einen relativ hohen Beschäftigungsanteil haben.
Um einen Eindruck über Zusammenhänge für alle Berufsgruppen und Belastungsfaktoren zu bekommen, wurden schließlich für alle Berufsgruppen Krankheitslast und Belastungen gleichzeitig berücksichtigt. Von besonderer Bedeutung sind dann die Berufe die eine hohe Krankheitslast und gleichzeitig eine hohe Belastung aufweisen. Bei Männern gilt dies für Keramik- und Glasberufe, Bergleute, Berufe der Metallerzeugung und -bearbeitung sowie für Verkehrsberufe. Bei Frauen sind neben den Metallberufen und Bauberufen die Verkehrsberufe und Ernährungsberufe auffällig.
Der 122-seitige iga.Report 22 "Arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren und Berufe mit hoher Krankheitslast in Deutschland" von Wolfgang Bödeker und Ina Barthelmes ist kostenlos herunterladbar.
Bernard Braun, 26.11.11
Wer oder was gefährdet den Wirtschaftsstandort Deutschland jenseits von Lohnnebenkostensenkung? Beispiel Arbeitszufriedenheit!
 Für diejenigen, denen zur Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Deutschland nur immer einfällt, den bereits rein quantitativ für die Gesamtkosten der Erstellung eines Produkts oder einer Dienstleistung marginalen Anteil des Arbeitgeberanteils für die Kranken- oder Rentenversicherung an den Lohnnebenkosten (vgl. dazu den einen oder anderen zahlreicher Beiträge in diesem Forum) einzufrieren oder zu senken, liefert eine Untersuchung der langjährigen Entwicklung der Arbeitszufriedenheit von Arbeitnehmern in Deutschland und vergleichbaren Ländern deutliche Hinweise auf mindestens genauso gewichtige, wenn nicht sogar gewichtigere Faktoren.
Für diejenigen, denen zur Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Deutschland nur immer einfällt, den bereits rein quantitativ für die Gesamtkosten der Erstellung eines Produkts oder einer Dienstleistung marginalen Anteil des Arbeitgeberanteils für die Kranken- oder Rentenversicherung an den Lohnnebenkosten (vgl. dazu den einen oder anderen zahlreicher Beiträge in diesem Forum) einzufrieren oder zu senken, liefert eine Untersuchung der langjährigen Entwicklung der Arbeitszufriedenheit von Arbeitnehmern in Deutschland und vergleichbaren Ländern deutliche Hinweise auf mindestens genauso gewichtige, wenn nicht sogar gewichtigere Faktoren.
Wissenschaftler des Instituts für Arbeit und Qualifikation (IAQ) der Universität Duisburg/Essen werteten dazu Daten aus der jährlichen Haushaltsbefragung des Sozio-Ökonomischen Panels von 1984 bis 2009 (Frage: "Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Arbeit?" mit einer 11er Skala von "ganz und gar unzufrieden" bis "ganz und gar zufrieden") und Daten des European Social Survey (ESS) aus.
Die Ergebnisse lauten z.B.:
• Seit 1984 Jahre gibt es einen abnehmenden Trend der Arbeitszufriedenheit der 20- 64-jährigen Beschäftigten in Deutschland. Auf einer zehnstufigen Skala lag der Durchschnittswert 1984 bei 7,6 Punkten und sank auf 6,8 Punkte im Jahr 2009.
• Besonders stark ist der Rückgang bei älteren Arbeitnehmern jenseits des 50. Lebensjahres. Ansonsten zeigt sich ein Rückgang der Arbeitszufriedenheit in allen Qualifikationsstufen und in Betrieben unterschiedlicher Größe in ähnlicher Form. Während die 50+-Beschäftigten 1984 noch üdberdurchschnittlich mit ihrer Arbeit zufrieden waren (7,9 Punkte), lag ihr Wert 2009 mit 6,6 Punkten unter dem Durchschnittswert.
• Im internationalen Vergleich weisen Arbeitnehmer in Deutschland eine besonders geringe Arbeitszufriedenheit auf. Konkret sieht es so aus, dass Deutschland 2006 auf Platz 18 in Europa lag. Nur die ArbeitnehmerInnen in der Slowakei, Ukraine, Bulgarien und Russland waren noch weniger mit ihrer Arbeit zufrieden. Am glücklichsten ist man dagegen in Dänemark, der Schweiz und in Finnland.
• Die vermutlichen Ursachen für das Niveau und den Trend der Arbeitszufriedenheit sind nach Meinung der IAQ-Forscher in Entwicklungen wie der Intensivierung der Arbeit in den Betrieben, den Problemen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, geringen Lohnsteigerungen und der wachsenden Unsicherheit über die berufliche Zukunft zu suchen.
Bei dem wahrscheinlich engen Zusammenhang von Arbeitszufriedenheit, Leistungsbereitschaft und damit Arbeitsproduktivität sollte künftig (endlich oder zum wievielten Male eigentlich!?) sowohl in Diskursen über die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Deutschland als auch über die Möglichkeiten, die Alterungsfolgen zu bewältigen, mehr über eine gezielte Veränderung exakt bekannter Arbeitsbedingungen geredet werden als über die Promilleeffekte der Senkung von Lohnnebenkosten.
Genaueres ist im IAQ-Report 3-2011 zum Thema Arbeitszufriedenheit in Deutschland sinkt langfristig. Auch geringe Arbeitszufriedenheit im europäischen Vergleich von Yan Bohulskyy, Marcel Erlinghagen, Friedrich Scheller zu finden, der komplett kostenlos erhältlich ist.
Bernard Braun, 13.8.11
Arbeitsbedingungen im IT-Bereich: Weder belastungsfrei noch ohne Präventionspotenzial
 Jung, dynamisch, kreativ, kommunikativ, wenig Belastungen durch schwer Heben und Tragen, Lärm oder Dreck und höchstens ab und zu etwas Eu-Stress - so stellt man sich Beschäftigte im Informationstechnologiebereich vor oder stilisieren sie sich und ihre Arbeitsbedingungen selber.
Jung, dynamisch, kreativ, kommunikativ, wenig Belastungen durch schwer Heben und Tragen, Lärm oder Dreck und höchstens ab und zu etwas Eu-Stress - so stellt man sich Beschäftigte im Informationstechnologiebereich vor oder stilisieren sie sich und ihre Arbeitsbedingungen selber.
Wie eine aktuelle Studie des Instituts Arbeit und Qualifikation (IAQ) der Universität Duisburg/Essen aber zeigt, traf dies evtl. mal vor Jahren oder Jahrzehnten, aber in vieler Hinsicht nicht mehr heute zu.
In einer Befragung von 331 Beschäftigten aus unterschiedlich großen und filialisierten IT-Unternehmen der Gesamtstichprobe dominiert bei der Altersstruktur die Gruppe der zwischen 41- und 50-Jährigen mit 32,3%, 30,5% der Befragten sind zwischen 31 und 40 Jahren, 25,1% über 50 Jahre alt und 11,8% sind unter 30 Jahren. Die Altersverteilungen unterscheiden sich allerdings zwischen den Unternehmen, wobei in den kleineren Unternehmen der Anteil der älteren Beschäftigten deutlich geringer ist. Hinsichtlich der Tätigkeiten setzt sich die Stichprobe im Wesentlichen aus 163 IT-Projektmitarbeitenden (49,2%), 86 Projektleitenden (26%) und 53 Führungskräften/Managerinnen mit Personalverantwortung (16%) zusammen. Auch wenn diese Stichprobe nicht repräsentativ ist und eine solche angesichts der Dynamik der Branche auch schwer zu bilden ist, ist sie mit Sicherheit auch nicht völlig unrepräsentativ.
Wesentliche inhaltliche Ergebnisse sind z.B.:
• Auch in 'jungen' Innovationsbranchen wie dem IT-Bereich nimmt die Zahl der älteren Mitarbeiter zu: Zwischen 1999 und 2009 stieg u.a. nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit der Anteil der über 50-Jährigen von 12,5% auf 18,5%, während der Anteil der 25- bis 39-jährigen Beschäftigten von 55,9% auf 41,8% sank.
• In der Branche nimmt parallel die Belastung zu, die die Beschäftigten zunehmend in ihrer Arbeitsfähigkeit beeinträchtigt. Lediglich 29% der Befragten gaben an, nach der Arbeit problemlos "abschalten" zu können - sich nicht mehr erholen zu können ist ein Anzeichen für "Burnout". Nur noch 37% der IT-Spezialisten glauben, ihre Tätigkeit sei auf Dauer durchzuhalten. Letztlich riskieren die Firmen erhebliche Umsatzeinbußen, wenn diese Mitarbeiter ernstlich erkranken und ausfallen.
• Stress und Burnout sind in allen Altersgruppen weit verbreitet. Als Burnout-Auslöser konnten Belastungen wie Zeitdruck ermittelt werden, denn es zeigten sich signifikante Zusammenhänge zwischen psychischen Belastungen der Beschäftigten und deren Beanspruchungserleben.
• Ein Vergleich zwischen hoch und gering erschöpften IT-Beschäftigten zeigt den möglichen Effekt von emotionalen Belastungen, Zeitdruck, Arbeitsunterbrechungen, ungeplantem Zusatzaufwand, widersprüchlichen Arbeitsanforderungen, Aneignungsbehinderungen und Synchronisationserschwernissen zwischen Arbeit und Familie auf die Beanspruchung und Erschöpfung der befragten Beschäftigten.
• Zentrale Ressourcen der Burnout-Prävention sind die Unterstützung durch die Führungskräfte, die Möglichkeiten, auf Termine und Arbeitsvolumina Einfluss zu nehmen, und die Pausen während der Arbeit. Keinen Unterschied machte dagegen das individuelle Gesundheitsverhalten (z.B. beim Ausdauersport).
• Arbeitsgestaltende Maßnahmen in der IT-Branche bergen aus Sicht der AutorInnen noch erheblich gesundheitsfördernde Potenziale. Dazu gehört beispielsweise die auch in andereren Arbeitsbereichen immer wieder als präventionsrelevant angesprochene so genannte "beanspruchungsmindernde Defragmenierung". Darunter sind vor allem Regelungen zu verstehen, die Parallelprojekteinsätze begrenzen (Motto: "Der Mensch ist nicht wirklich multitaskingfähig, und wenn er es dennoch probiert, funktioniert es wie bei PC-Betriebssystemen auch nicht besonders") und durch die Einführung von Blockarbeitszeiten sichern, dass man stundenweise ohne Unterbrechungen durch Kollegen und Telefonate arbeiten kann.
• Auch in dieser Studie wird die in anderem Zusammenhang bereits gesicherte Erkenntnis bestätigt, dass weniger das Alter der Beschäftigten entscheidend für die Belastungs- und Beanspruchungssituation ist als ihre Tätigkeit und die damit verbundenen Ressourcen wie etwa Handlungs- und Entscheidungsspielräume.
Der als IAQ-Report 2010-04 erschienene elfseitige Aufsatz Gesund altern in High-Tech-Branchen? Im Spannungsfeld von Innovation und Intensivierung von Anja Gerlmaier, Angelika Kümmerling, Erich Latniak ist komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 13.8.11
Haben sich die Arbeitsbedingungen von Pflegekräften in Krankenhäusern zwischen 2003 und 2008 verändert und wie?
 Veränderten sich die Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte in deutschen Krankenhäusern während und durch die Einführung von sog. diagnosebezogenen Fallpauschalen ("diagnosis related groups (DRG)") im Zeitraum von 2003 bis 2008? Und wenn ja, wie?
Veränderten sich die Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte in deutschen Krankenhäusern während und durch die Einführung von sog. diagnosebezogenen Fallpauschalen ("diagnosis related groups (DRG)") im Zeitraum von 2003 bis 2008? Und wenn ja, wie?
Diese Frage untersuchte das vom Wissenschaftszentrum Berlin (WZB) und dem Zentrum für Sozialpolitik (ZeS) der Universität Bremen durchgeführte Forschungsprojekt "Wandel von Medizin und Pflege im DRG-System (WAMP)" - auf dessen Ergebnisse in diesem Forum schon mehrere Male hingewiesen wurde - u.a. durch eine dreimalige schriftlich standardisierte Befragung jeweils repräsentativer Stichproben examinierter Pflegekräfte in den Jahren 2003, 2006 und 2008. Ohne die organisatorische und finanzielle Unterstützung durch die frühere Gmünder Ersatzkasse (GEK), die Hans Böckler Stiftung, die Robert Bosch Stiftung und die Techniker Krankenkasse wären diese Erhebungen nicht möglich gewesen.
Die Ergebnisse sind nun in einer gesonderten Publikation zugänglich. Die wesentlichen Erkenntnisse lauten:
• "DRG verstärken die Auswirkungen von Kostendruck auf die Behandlungswirklichkeit": Eine ausführliche Pflegeaufnahme findet regelhaft ("immer" und "überwiegend") unter DRGBedingungen deutlich seltener statt (Rückgang um 9 Prozentpunkte von 43 in 2003 auf 34 Prozent in 2008), obwohl unter der Bedingung abnehmender Liegezeiten und in Verbindung mit der Zunahme des Anteils schwerer und pflegeintensiver Fälle (u. a. durch mehr ambulante Operationen) eine umfassende Aufnahme für die zielgerichtete Pflege unter Zeitdruck sinnvoll erscheint. Insgesamt ist der Anteil der Pflegekräfte, die einen eher negativen Einfluss der DRG auf die Durchführung notwendiger Behandlungen wahrnehmen bei 43 Prozent konstant geblieben, während nur 14 (2006) bzw. 13 Prozent (2008) einen eher positiven Einfluss wahrnehmen. Der Anteil der Pflegekräfte, die für ihren Alltag der Feststellung zustimmen, die Patienten in ihrem Haus würden tendenziell auf dem Stand der medizinischen Erkenntnis versorgt ("beste Leistungen") ist von 63 Prozent (2006) auf 60 Prozent (2008) zurückgegangen.
• "DRG stellen bei Pflegekräften das traditionelle berufliche Selbstverständnis in Frage": Während 2008 der sehr allgemein gehaltenen Frage "Lege Wert auf eine würdevolle Behandlung der Patienten" von 79 Prozent (2003: 88 Prozent) der Pflegekräfte zugestimmt wird, ist dies bei der stärker konkretisierten Frage, ob man eine "soziale und emotionale Zuwendung" (psychosoziale Versorgung) grundsätzlich als zur Versorgung der Patienten zugehörig empfinde, mit 66 Prozent (2003: 69 Prozent) um 13 Prozentpunkte geringer.
• "DRG verbessern die Entlassung aus dem Krankenhaus und die Überleitung in nachgeordnete Versorgungsformen nicht": Ein großer Verbesserungsbedarf besteht offensichtlich bei der Organisation der Entlassung aus dem Krankenhaus: Nur etwa 56 % der befragten Pflegekräfte bestätigten im Jahr 2003, also vor der verbindlichen Einführung der DRG, die Existenz eines Entlassungsmanagements. Fünf Jahre später hat sich die Situation formal nicht verbessert und inhaltlich sogar verschlechtert: Während 2003 für 37 Prozent der Befragten das Entlassungsmanagement gut funktioniert, sind es 2008 nur noch 32 Prozent.
• "DRG fördern die Kooperation und den patientenbezogenen Informationsfluss zwischen den Berufsgruppen im Krankenhaus nicht.": Der Informationsfluss hat sich daher unter DRG-Bedingungen verschlechtert, obwohl beschleunigte Abläufe vermehrte Kommunikation erfordern, um beispielsweise (Behandlungs-)Fehler zu vermeiden. So ist etwa der Anteil der Pflegekräfte, die einen schlechten Einfluss der DRG auf die Zusammenarbeit mit Ärzten wahrnehmen, von 24 Prozent in 2003 auf 35 Prozent in 2008. Und auch die - formellen - Kommunikationsstrukturen unter DRG-Bedingungen haben sich eher verschlechtert als verbessert. Vor allem die gemeinsame Visite von Pflegekräften und Ärzten findet immer seltener statt, weil die Pflegekräfte aufgrund der Personalknappheit weniger Zeit haben und die Ärzte keine festen Visitenzeiten einhalten, auf die sich die Pflegekräfte einstellen können. Durch den Wegfall der gemeinsamen Visite werden Informationsverluste und Fehler bei der Patientenversorgung wahrscheinlicher.
• "DRG verschlechtern die sozialen und materiellen Arbeitsbedingungen von Pflegekräften im Krankenhaus.": Durch die aus ihrer Sicht höheren Anforderungen (Mischstationen) und den erhöhten Zeitdruck fühlen sich die Pflegekräfte in gestiegenem Ausmaß nicht mehr gut genug für ihre Arbeit ausgebildet. Waren 2003 noch 79 Prozent der Meinung, sie seien dies, sagen dies 2008 nur noch gut 58 Prozent. Neben störenden Unterbrechungen (+14 Prozentpunkte), unregelmäßigen Arbeitszeiten (+ 11 Prozentpunkte), Organisationsmängeln im Krankenhaus (+ 8 Prozentpunkte), dem andauernd hohen Zeitdruck (+7 Prozentpunkte), hat auch die Belastung durch mangelhaften Arbeitsschutz (+ 5 Prozentpunkte) und zu viele administrative Tätigkeiten (+3 Prozentpunkte) 2008 im Vergleich zu 2003 zugenommen. Den zum Teil zunehmenden, jedenfalls aber nicht geringer werdenden Arbeitsbelastungen stehen Ressourcen (z. B. interessante Tätigkeit) gegenüber, welche die erwartbaren negativen Auswirkungen der DRG für die Arbeitszufriedenheit teilweise kompensieren können. Für Pflegekräfte haben 2008 diese Ressourcen jedoch in den meisten Bereichen und um bis zu 10 Prozentpunkte gegenüber 2003 abgenommen.
Die WissenschaftlerInnen heben an verschiedenen Stellen hervor, dass es sich bei vielen ihrer Funde um stabile Trends und nicht etwa um das "übliche Gejammer" in der Startphase von Innovationen und Veränderungen handelt. Außerdem werden eine Reihe von Schwachstellen oder Fehlentwicklungen sowohl von Ärzten, Pflegekräften und Patienten berichtet, was eine Art interne Validierung der Ergebnisse bedeutet.
Trotzdem wären natürlich weitere Untersuchungen der Wahrnehmungen und Erfahrungen der Beschäftigten und Patienten sinnvoll. Ebenso sollten die für eine sozialwissenschaftliche Studie typischen "nur" subjektiven Informationen durch "objektive" multidisziplinäre Daten aus der Betriebswirtschaft oder über den physischen und mentalen Zustand der Beschäftigten ergänzt und ggfls. korrigiert werden.
Wen die weiteren Erkenntnisse aus der Wahrnehmung durch Pflegekräfte und Details für alle Ergebnisse interessieren, kann sich den 109 Seiten umfassenden Forschungsbericht " Einfluss der DRGs auf Arbeitsbedingungen und Versorgungsqualität von Pflegekräften im Krankenhaus - Ergebnisse einer bundesweiten schriftlichen Befragung repräsentativer Stichproben von Pflegekräften an Akutkrankenhäusern in den Jahren 2003, 2006 und 2008" von Bernard Braun, Sebastian Klinke, Rolf Müller und Rolf Rosenbrock (erschienen als Paper 173 des Forschungszentrums Nachhaltigkeit artec der Universität Bremen im Januar 2011) kostenlos herunterladen. Wer an gedruckten Exemplaren Interesse hat, kann sie über die Mailadresse dieses Forums ebenfalls kostenlos bestellen.
Bernard Braun, 11.2.11
Psychische Erkrankungen: Viel "Epidemie" und relativ wenig evident wirksame Präventionsmaßnahmen in der Arbeitswelt
 Egal, ob es um Arbeitsunfähigkeit, Maßnahmen zur Rehabilitation oder auch Frühberentung geht, so genannte psychische Erkrankungen schieben sich seit mehreren Jahren scheinbar unaufhaltsam auf die ersten Plätze. So ernst man das Geschehen hinter den Zahlen im Einzelfall nehmen muss, so wichtig und überfällig sind aber differenziertere Betrachtungen der "Epidemie" psychischer Erkrankungen. Dies sollte u.a. beinhalten:
Egal, ob es um Arbeitsunfähigkeit, Maßnahmen zur Rehabilitation oder auch Frühberentung geht, so genannte psychische Erkrankungen schieben sich seit mehreren Jahren scheinbar unaufhaltsam auf die ersten Plätze. So ernst man das Geschehen hinter den Zahlen im Einzelfall nehmen muss, so wichtig und überfällig sind aber differenziertere Betrachtungen der "Epidemie" psychischer Erkrankungen. Dies sollte u.a. beinhalten:
• Das Aufdröseln dessen, was zur Flut der "psychischen Erkrankungen" zusammengefasst wird. Hier geht es sowohl um Depressionen, Ängste, Burnout, Neurosen etc. als auch im quantitativ nicht unerheblichen Maße um Suchterkrankungen wie den Alkoholismus.
• Ein Teil des scheinbar neuen Problembergs entsteht nicht aktuell, sondern existierte objektiv und subjektiv im schamhaften Verborgenen bereits immer. Die aktuelle Entwicklung ist also zum Teil ein Entdeckungs- und Akzeptanzphänomen. Statt einer Depression sprach man vor 20 Jahren lieber über ein psychovegetatives Erschöpfungssyndrom.
• Zu fragen ist aber auch, ob ein Teil der psychischen Erkrankungen nicht Ausdruck der auch sonst verbreiteten Medikalisierung von Lebenslagen oder natürlichen Reaktionen ist oder auch hier z.B. neue Medikamente eine "Krankheit" oder Therapeuten "Patienten" suchen und finden. Der anerkannte Psychiater Klaus Dörner warnte im "Deutschen Ärzteblatt" bereits 2002 mit folgenden Beobachtungen und Kommentaren vor einer solchen Entwicklung: "Seit den 90er-Jahren ist die Depression weltweit als unzureichend vermarktet erkannt. Eine Art Rasterfahndung nach unentdeckten Depressiven, wovon immer einige Menschen real profitieren, die meisten jedoch durch zusätzliche Etikettierung in ihrer Vitalität Schaden nehmen, hat zum Beispiel in den USA dazu geführt, dass sich von 1987 bis 1997 die Zahl der wegen Depression Behandelten von 1,7 auf 6,3 Millionen fast vervierfacht hat; ent-scheidend dafür war die suggestive Aufklärungskampagne und aggressive Werbung für Antidepressiva." Und: "Ein Selbstversuch, den jeder wiederholen kann: Ich habe zwei Jahre lang aus zwei überregionalen Zeitungen alle Berichte über Forschungen zur Häu-figkeit psychischer Störungen (zum Beispiel Angst, Depression, Essstörung, Süchte, Schlaflosigkeit, Traumata) gesammelt: Die Addition der Zahlen ergab, dass jeder Bundesbürger mehrfach behandlungsbedürftig ist. Die meist von bekannten Professoren stammenden Berichte versuchten in der Regel, dem Leser zunächst ein Erschrecken über den hohen Prozentsatz der jeweiligen Einzelstörungen zu suggerieren, um ihn dann wieder zu entlasten, weil es heute dagegen die zauberhaftesten Heilmethoden gäbe, fast immer in der Kombination von Psychopharmaka und Psychotherapie; denn hier verspricht die Kooperation der Konkurrenten den größten Gewinn."
Egal, wie häufig psychische Erkrankungen wirklich neu entstehen und versorgt werden müssen, gilt aber auch bei ihnen, dass sie nicht unvermeidbar sind, also präventiv verhindert oder ihr Eintritt hinausgezögert werden kann. Und sicher ist auch, dass dabei die Bedingungen der Arbeitswelt eine wichtige fördernde und hemmende Rolle spielen.
Ein 2010 erschienener Forschungsbericht hat daher für Telekommunikationsunternehmen systematisch Faktoren zu identifizieren versucht, "die das psychische Befinden positiv oder negativ beeinflussen oder die Wiedereingliederung nach krankheitsbedingter Abwesenheit erleichtern." Als Erkenntnisquellen dienten mehrere Literaturreviews und qualitative Interviews mit Unternehmensvertretern. Die wichtigsten Funde der Literaturreviews lauteten:
• Dem Problemberg stehen zum Teil lückenhafte Erkenntnisse oder Beweise über mögliche Ursachen gegenüber. Die Evidenz vieler Maßnahmen ist lückenhaft oder schlecht. Viele der in den Betrieben durchgeführten Praxismodelle sind nie evaluiert worden.
• Als Faktoren mit negativem Effekt auf das psychische Wohlbefinden wurden identifiziert: Arbeit-sanforderungen wie hohe Anforderungen, geringer Entscheidungsspielraum, geringe soziale Unterstützung und geringe Kontrolle, Geringe Arbeitszufriedenheit, Monotonie, Rollenunklarheit und -konflikte, schlechte Kommunikation und großes Ungleichgewicht zwischen Anstrengung und Belohnung, Erlebtes Fehlen von Unternehmensgerechtigkeit und Führungsstile.
• Positiv wirken sich dagegen folgende Faktoren auf das psychische Wohlbefinden aus: In Sommerurlaub gehen, optimierte Aufgaben- und Jobgestaltung, multimodale Ansätze für Interventionen bei schlechtem psychischem Befinden unter Berücksichtigung der Faktoren Eigenverantwortung, Engagement und Eignung, Einsatz psychologischer Interventionen bei Störungen des psychischen Wohlbefindens, Flexible Arbeitszeiten und Wertschätzung der Belegschaft.
• Für die Wirksamkeit von Bedingungen, welche die Wiedereingliederung nach krankheitsbedingter Abwesenheit begünstigen, lag zwar nur eine vergleichsweise geringe Evidenz vor, als potenziell positiv gelten aber: Programme zur stufenweisen Rückkehr an den Arbeitsplatz und/oder psychologische Rehabilitation, die Aufrechterhaltung eines regelmäßigen Kontakts zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, systematische Ursachenanalysen und mögliche Anpassungen im Arbeitsumfeld.
In den acht genauer untersuchten Unternehmen gab es "Beispiele guter Praxis", wobei ihre Wirksamkeit oder ihre Effizienz mangels Evaluation nicht gesichert ist.
Der u.a. von der WHO und der EU-Kommission geförderte 108 Seiten umfassende Forschungsbericht 603-00944 "Gute Arbeit, gute Gesundheit" von Joanne O. Crawford, Phil George, Richard A. Graveling, Hilary Cowie und Ken Dixon ist im Juni 2010 in mehreren Sprachen, darunter auch in deutscher Sprache, erschienen und kostenlos erhältlich (ein bisschen aufwändig: auf Evidence based reports und dann auf die deutsche Fassung klicken).
Bernard Braun, 25.11.10
Dauerproblem Arbeitslärm ist auch mit einem erhöhten Risiko von Herzerkrankungen assoziiert.
 Wer bei Lärm am Arbeitsplatz an frühere Jahrhunderte oder allein an das Risiko von Lärmschwerhörigkeit denkt, täuscht sich gewaltig. Denn leider ist ständiger starker Lärm immer noch eine der häufigsten Arbeitsplatzbelastungen und ist im starken Maße bereits bei relativ jungen Erwerbstätigen mit Bluthochdruck und schweren Herzerkrankungen assoziiert.
Wer bei Lärm am Arbeitsplatz an frühere Jahrhunderte oder allein an das Risiko von Lärmschwerhörigkeit denkt, täuscht sich gewaltig. Denn leider ist ständiger starker Lärm immer noch eine der häufigsten Arbeitsplatzbelastungen und ist im starken Maße bereits bei relativ jungen Erwerbstätigen mit Bluthochdruck und schweren Herzerkrankungen assoziiert.
Dies sind jedenfalls die Ergebnisse einer Querschnittsstudie mit 6.307 TeilnehmerInnen, die älter als 20 Jahre alt und zum Zeitpunkt der Erhebung beschäftigt waren, zwischen 1999 und 2004 im Rahmen des "National Health and Nutrition Examination Survey" Angaben zu ihrer Lärmbelastung am Arbeitsplatz machten. Hinzu kamen selbstberichtete Angaben zu kardiovaskulären Risikofaktoren und Erkrankungen und Messwerte aus einer Blutuntersuchung und außerdem eine Vielzahl von soziodemografischen Merkmalen (z.B. Alter, Ethnie). Die Studie ist damit quantitativ und qualitativ umfassender und aussagefähiger als zahlreiche Studien in der Vergangenheit. Sie war auch so groß, dass die Teilnehmer in Gruppen mit hoher und fehlender Lärmbelastung unterschieden werden konnten.
Die wesentlichen Ergebnissen sind:
• 21 % der durchschnittlich 40 Jahre alten Studienteilnehmer arbeiteten bereits mehr als 9 Monate unter Lärmbedingungen.
• Verglichen mit Teilnehmern, die niemals starkem Lärm exponiert waren, haben die TEilnehmer, die chronisch starkem Arbeitslärm ausgesetzt sind, eine 2-3fach höhere Prävalenz von Angina pectoris, Herzinfarkt, koronare Herzerkrankung. Sie wiesen auch eine deutliche Erhöhung des diastolischen Blutdruckwertes auf: Er war doppelt so hoch wie bei den Personen ohne ständigen Arbeitsplatzlärm.
• Nach dem statistischen Ausschluss des Einflusses mehrerer möglicher Einflussfaktoren oder Kovariaten wie des Alters, der Ethnie etc. war das Risiko für Angina pectoris statistisch signifikant (Irrtumswahrscheinlichkeit <5%) um das 2,91fache, das für eine Erkrankung der Herzkranzgefäße um das 2,04fache und das für einen erhöhten diastolischen Blutdruckwert um das 2,23fache höher als bei den nicht Lärmexponierten.
• Hinzu kommen für die beobachteten Erkrankungen eindeutige Exposition-Dosis-Beziehungen.
• Die Assoziationen von Lärm und Herzerkrankungen traten am deutlichsten bei Personen unter 50 Jahren und Noch-Rauchern auf. Deren Risiko, an den genannten Krankheiten zu erkranken, war um das 4fache gegenüber den Nicht-Lärmexponierten erhöht.
• Die Bluttests ergaben für die besonders gefährdete Gruppe weder erhöhte Cholesterinwerte noch Entzündungsproteine, die normalerweise als Risikofaktoren fürs Herz gelten.
Die Forscher fordern auf der Basis ihrer Ergebnisse eine verstärkte Aufmerksamkeit für das berufsbedingte Risiko von Lärm für verschiedene Herzerkrankungen oder ihre Risikofaktoren - insbesondere bei jüngeren männlichen Rauchern. Auch wenn Querschnittsanalysen der durchgeführten Art keine Kausalschlüsse erlauben, halten die Wissenschaftler die mehrfachen Assoziationen für ursächlich. Sie weisen schließlich auch noch auf den beschränkten Nutzen von lärmdämmenden Stöpseln oder anderen individuellen Schutzmaßnahmen hin und empfehlen mit Vorrang arbeitsorganisatorische oder verhältnisbezogeneMaßnahmen der Arbeitgeber.
Ein von Wen Qi Gan, Hugh W Davies und Paul A Demers verfasster Aufsatz zur Studie ist unter dem Titel "Exposure to occupational noise and cardiovascular disease in the United States: the National Health and Nutrition Examination Survey 1999-2004" am 5. Oktober 2010 zunächst online in der Zeitschrift Occup Environ Med (doi:10.1136/oem.2010.055269) erschienen. Ein Abstract ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 20.10.10
Arbeitssicherheit und Gesundheitsförderung: Probleme und Interessen älterer Arbeitnehmer
 In Griechenland, Spanien und Frankreich trieben im Mai 2010 Pläne der Regierungen zur Erhöhung des gesetzlichen Rentenalters (zurzeit 60 Jahre) Hunderttausend von Demonstranten auf die Straßen. In den Niederlanden einigten sich jetzt Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften auf eine schrittweise Anhebung des Rentenalters auf 67 Jahre und in Deutschland ist bereits gesetzlich festgelegt, dass das Renteneintrittsalter in kleinen Schritten bis zum Jahre 2029 von derzeit 65 auf dann 67 Jahre steigt. Das Durchschnittsalter der Erwerbsbevölkerung in Europa steigt also deutlich, auch im Gefolge dieser Gesetzesänderungen. Unklar ist, ob die Rahmenbedingungen in der Arbeitswelt hinreichend darauf vorbereitet sind.
In Griechenland, Spanien und Frankreich trieben im Mai 2010 Pläne der Regierungen zur Erhöhung des gesetzlichen Rentenalters (zurzeit 60 Jahre) Hunderttausend von Demonstranten auf die Straßen. In den Niederlanden einigten sich jetzt Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften auf eine schrittweise Anhebung des Rentenalters auf 67 Jahre und in Deutschland ist bereits gesetzlich festgelegt, dass das Renteneintrittsalter in kleinen Schritten bis zum Jahre 2029 von derzeit 65 auf dann 67 Jahre steigt. Das Durchschnittsalter der Erwerbsbevölkerung in Europa steigt also deutlich, auch im Gefolge dieser Gesetzesänderungen. Unklar ist, ob die Rahmenbedingungen in der Arbeitswelt hinreichend darauf vorbereitet sind.
Ein schottisches Forschungsteam des "Institute of Occupational Medicine, Edinburgh, UK" hat diese Frage jetzt aufgegriffen und eine internationale Literaturübersicht unter Einbezug von knapp 60 Veröffentlichungen erstellt, in denen schwerpunktmäßig gesundheitliche Probleme älterer Beschäftigter, teilweise aber auch Lösungsansätze vorgestellt werden. Unter anderem zeigt sich in der Bilanz, dass Ältere insgesamt seltener unfallgefährdet sind, jedoch häufiger von schweren Unfällen betroffen.
Die Fragestellungen des Forschungsteams waren: "1.) Was sind die Bedürfnisse und Interessen älterer Arbeitnehmer in Bezug auf den Gesundheitsschutz und die Gesundheitsförderung im Betrieb und unterscheiden sich diese von denen der übrigen Beschäftigten? 2.) Wie geht man im Betrieb mit diesen Interessen um? 3.) Wo gibt es Forschungslücken?" Die ursprünglich 180 dazu gefundenen Veröffentlichungen wurden hinsichtlich ihrer methodischen Fundierung bewertet und dann auf 59 Artikel eingeschränkt.
Altersbedingte biologische Veränderungen
Die Wissenschaftler zitieren viele Studien, in denen ein Absinken der sogenannten "aeroben Leistungsfähigkeit" nachgewiesen wird, also der körperlichen Ausdauer, die unter anderem mit der Sauerstoffaufnahmekapazität zusammenhängt. Dass dies für die Bewältigung körperlicher Belastungen (körperliche Schwerarbeit, aber auch länger dauernde einseitige Belastungen) erhebliche Konsequenzen hat und eine veränderte Arbeitsgestaltung erfordert, ist allzu naheliegend. Auch anthropometrische Veränderungen werden festgestellt, so unter anderem altersbedingt erhöhte Werte für das Körpergewicht und den Body Mass Index. Einzelne Parameter, wie zum Beispiel Körperkraft, Kraft beim Greifen, Gelenkbeweglichkeit, Wirbelsäulen-Flexibilität und andere unterliegen zwar altersbedingten Verschlechterungen, sind aber bei einzelnen Individuen extrem unterschiedlich ausgeprägt und teilweise auch durch Training kompensierbar.
Erholungsbedürfnisse und die Notwendigkeit von Pausen, so ein anderes Ergebnis, steigen mit dem Alter eindeutig an. Ebenso verlängern sich Reaktionsvermögen und Reaktionszeit bei Älteren, was teilweise allerdings wettgemacht werden kann durch Übung und Erfahrung. Leistungsdaten von Arbeitnehmern, in denen Geschwindigkeit eine Komponente ist, zeigen generell mit zunehmendem Alter abnehmende Werte. Was kognitive Fähigkeiten anbetrifft, so verweisen Studien auf die Hypothese "Use it or lose it" (Gebrauch es oder verlier es) - Übung ist demzufolge also ungeheuer wichtig, um intellektuelle Kompetenzen im Alter zu behalten. Andere Fähigkeiten, insbesondere der Sinnesorgane (Hörvermögen, Sehschärfe, Farbunterscheidung usw.) lassen mit dem Alter zunehmend nach, können teilweise aber betrieblich (verbesserte Beleuchtung) oder individuell (Brille) kompensiert werden.
Unfälle und Verletzungen
Obwohl Daten zu Unfällen in der Arbeitswelt aus sehr unterschiedlichen Quellen stammen (persönliche Berichte von Beschäftigten, offizielle Statistiken von Behörden oder Verbänden) scheint unter dem Strich festzustehen, dass ältere Arbeitnehmer seltener als jüngere von Unfällen und Verletzungen betroffen sind. Erschöpfung spielt als Ursache eine überaus große Rolle, in 25% aller Fälle ist dies der Hintergrund. Falls Ältere von Unfällen betroffen sind, zeigt sich jedoch, dass diese schwerwiegender sind. Während Unfälle insgesamt eine Arbeitsunfähigkeit von durchschnittlich 8 Tagen verursachen, liegt dieser Wert bei 12 Tagen für 55-64jährige und bei 18 Tagen für über 65jährige. Tödlich verlaufende Arbeitsunfälle ereignen sich in den USA dreimal so oft bei älteren Beschäftigten, im United Kingdom etwa 1,6mal so oft.
Maßnahmen zur Gesundheitsförderung im Betrieb
Leider fallen die Ergebnisse der Literatursichtung in diesem Bereich außerordentlich spärlich aus: Nur zwei Studien wurden ausgewertet und gefunden, beides sehr lang zurück liegende Studien (1999, 2000). Inzwischen liegt eine weitaus größere Zahl von Untersuchungen vor und wurde auch schon auf der Website der Bundesvereinigung für Prävention und Gesundheitsförderung vorgestellt. Das Fazit aus diesen Studien ist eher dürftig: Ältere begrüßen Maßnahmen zur betrieblichen Gesundheitsförderung, betonen jedoch, dass der Zugang für alle Beschäftigten möglich sein muss.
Von der Literaturbilanz ist kostenlos nur ein Abstract verfügbar: J. O. Crawford, R. A. Graveling, H. A. Cowie and K. Dixon: The health safety and health promotion needs of older workers (Occupational Medicine 2010 60(3):184-192; doi:10.1093/occmed/kqq028)
Gerd Marstedt, 31.7.10
Sie wissen, was sie tun! "National Research Council" der USA analysiert Sicherheitsrisiken des US-Biowaffenlabors Fort Detrick
 Bei vielen Diskussionen über eingetroffene Risiken für die Gesundheit oder das Leben weiter Teile der Bevölkerung gehört es zum Ex-Post-Kommunikationsritual, dass dies nach "Expertenmeinung" unabsehbar gewesen sei. Erst langsam sickern dann, wie beim Beispiel des Lagers für radioaktive Abfälle im Salzstock Asse, nicht nur radioaktive Flüssigkeiten in Richtung Grundwasser, sondern auch Wahrheiten an die Öffentlichkeit, die bereits seit langem in Behördenarchiven vergraben waren. Dieses späte Wissen trägt dann entweder nicht zur Problemlösung bei oder es kostet trotzdem Milliarden, die Folgen dieses Verschweigens und Ignorierens zu beseitigen.
Bei vielen Diskussionen über eingetroffene Risiken für die Gesundheit oder das Leben weiter Teile der Bevölkerung gehört es zum Ex-Post-Kommunikationsritual, dass dies nach "Expertenmeinung" unabsehbar gewesen sei. Erst langsam sickern dann, wie beim Beispiel des Lagers für radioaktive Abfälle im Salzstock Asse, nicht nur radioaktive Flüssigkeiten in Richtung Grundwasser, sondern auch Wahrheiten an die Öffentlichkeit, die bereits seit langem in Behördenarchiven vergraben waren. Dieses späte Wissen trägt dann entweder nicht zur Problemlösung bei oder es kostet trotzdem Milliarden, die Folgen dieses Verschweigens und Ignorierens zu beseitigen.
Umso mehr Aufmerksamkeit gebührt daher Berichten über aktuell geplante Projekte, deren landes- wenn nicht sogar weltweiten Risiken ermittelt, bewertet und im Prinzip auch öffentlich bekannt sind, aber im öffentlichen Risikodiskurs irgendwo zwischen Schweinegrippe-Pandemie und uranangereicherter Präzisionsmunition der US-Armee unterzugehen drohen.
Die Sprache ist hier aktuell vom beabsichtigten Um- und Ausbau des US-Biowaffenlabors Fort Detrick. Was interessiert nun aber Mitteleuropäer eine Anlage der US-Army im Bundesstaat Maryland? Um das verständlich zu machen, bedarf es eines Ausflugs in die jüngere Geschichte weltweiter gesundheitlicher Risiken.
In der Kommunikation schwerer und mysteriöser gesundheitlicher Risiken bzw. epidemischer Ereignisse, meist infektiöser Art, spielte nämlich dieses Biowaffen-Labor bereits mehrfach die Rolle der "Spinne" im Netz von großen gesundheitsbezogenen Verschwörungstheorien. So galt HIV/AIDS in manchen Kreisen und zum Teil bis heute bei südafrikanischen Spitzenpolitikern als "man made in USA" - so die Überschrift eines in der linken "Tageszeitung (TAZ)" am 18. Februar 1987 veröffentlichten Interviews des DDR-Schriftstellers Stefan Heym mit dem Ostberliner Biologen Jakob Segal. Nach dessen anschließend vielfach kolportierten Meinung sei das tödliche Virus der Immunschwächekrankheit einem Laborunfall im US-amerikanischen Militärforschungsinstitut Fort Detrick geschuldet, d.h. dort bei Experimenten entwichen. Dieses nachweisbar falsche Szenario ist immerhin noch so wirkmächtig oder präsent, dass auch heute noch Artikel veröffentlicht werden oder werden müssen, die es zu entkräften versuchen. Zuletzt am 14. Januar 2010 im ZEIT-Online-Angebot unter dem Titel "Verschwörungstheorien: Der Mythos vom Ursprung des Aids-Virus".
Dass derartige Mythen, und ausgerechnet die über das "Army Medical Research Institute of Infectious Diseases in Fredrick, Maryland (USAMRIID)", auch bekannt als Fort Detrick, glaubwürdig wirkten, liegt aber auch daran, dass es in der Vergangenheit ebenfalls nachweisbar und unwidersprochen für die Öffentlichkeit gefährliche Zwischenfälle gab, für die Mitarbeiter und mangelhafte Sicherheitsbedingungen dieses Instituts verantwortlich waren.
So stammten die Ende 2001 in Briefen versandten Anthraxsporen, also den Erregern des potenziell tödlichen Lungenmilzbrandes, und damit die gefährlichsten Mitteln der biologischen Kriegsführung und des Bioterrorismus, nicht von den nach dem 11. September 2001 üblichen Terrorverdächtigen, sondern mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit von einem "netten" leitenden Biochemiker des Instituts, der kurz vor seiner wahrscheinlichen Enttarnung im Jahr 2008 Selbstmord beging. In diesem Zusammenhang wurde zusätzlich publik, dass bereits in den 1990er Jahren das eine oder andere "Reagenzglas" mit Anthraxsporen oder Ebola-Viren nicht mehr inventarisiert werden konnte, also "verschwunden" war.
Es nimmt daher kein Wunder, dass nach einer 2007 getroffenen Regierungsentscheidung, die Aktivitäten dieses Hochsicherheitslabors sogar noch auszudehnen, die Bevölkerung des Fredrick County Sorge um ihre künftige Sicherheit hatte. Weder die Sicherheitsbelange der Öffentlichkeit noch die der rund 7.500 Beschäftigten seien in den Plänen der US-Army und der Regierung ausreichend berücksichtigt. Darauf bat der US-Verteidigungsminister das "National Research Council (NRC)", und deren Experten für Biosicherheit, Infektionserkrankungen, Arbeitshygiene, Umweltschützer, Risikobewertung und Epidemiologie mit einem unabhängigen wissenschaftlichen Review der Risiken dieses Labors und seiner Erweiterung zu beauftragen.
Die umfangreichen Analysen und Bewertungen der technischen Sicherheit, der Sicherheitsregeln, der Notfallregularien, der Übereinstimmung der Regularien mit den anerkannten Standards der regierungsamtlichen"Centers for Disease Control and Prevention" und des "National Institutes of Health" und der Kommunikation der Biowaffen-Verwalter mit der Öffentlichkeit sind 2010 in dem 100-seitigen Buch "Evaluation of the Health and Safety Risks of the New USAMRIID High Containment Facilities at Fort Detrick, Maryland" zusammen mit Empfehlungen veröffentlicht worden.
Die Veröffentlichung erfolgte in der hochangesehenen Publikationsreihe der"National Academies", deren Selbstverständnis so lautet: "The nation turns to the National Academies • National Academy of Sciences, National Academy of Engineering, Institute of Medicine, and National Research Council • for independent, objective advice on issues that affect people's lives worldwide."
Und da es bei einem Biowaffenlabor gar nicht so abwegig ist, dass seine Sicherheit bzw. seine Sicherheitsmängel von weltweiter Bedeutung ist, und weil mit diesem Bericht ein seltenes Beispiel für eine ex ante sehr differenzierte und präventive Beschreibung der Möglichkeit und Art von Sicherheitsproblemen vorliegt, wird seine Zusammenfassung auch etwas ausführlicher und in englischer Sprache zitiert.
Die Ergebniszusammenfassung zu den für möglich gehaltenen Wirkungen auf die Umgebung des Labors lautet:
• "The analyses in the EIS (dem vorgelegten "Environmental Impact Statement" der US-Army) of the risks and the mitigation measures to address them were not comprehensive and there was insufficient documentation for a fully comprehensive independent assessment of the risks to the community posed by biological agents. The problem was compounded by the fact that the MCE (maximum credible event) scenarios were not reasonably foreseeable accidents.
• The epidemiologic characteristics, including transmission pathways, natural reservoirs, geographic distributions, and clinical outcomes of the pathogens, were not systematically documented
• There was incomplete consideration of some of the possible routes through which the general public might be exposed to pathogens.
• Although the congressional mandate placing the National Interagency Biodefense Campus at Fort Detrick precludes siting the new USAMRIID facility elsewhere, it would have been appropriate for the EIS to include consideration of an alternative location, such as one in a less populated area. Such an exercise could have provided a comparison that identified advantages and disadvantages specific to each location, and guided preventive strategies and mitigation efforts if differential risks were found."
Zu den laborinternen Abläufen sieht die Bewertung etwas besser aus, findet aber trotzdem Beunruhigendes:
• Einerseits: "USAMRIID's current procedures and regulations for its biocontainment facilities meet or exceed the standards of NIH and CDC for such facilities and other accepted rules and guidance for handling and containing pathogens during use, inventorying, and storage; treating and safely disposing of laboratory solid waste; and handling and decontaminating wastewater."
• Andererseits: "Although USAMRIID has sought to set high standards for biosurety and biosafety, recent examples of laboratory-acquired infections (glanders and tularemia) and breaches in containment (B. anthracis spores) point to human error or deliberate misuse. The committee recommends further formalized training in responsibility and accountability at USAMRIID, similar to that required for NIHsponsored training programs. The circumstances surrounding the laboratory-acquired infections also should be carefully evaluated to determine what lessons can be learned for preventing future cases."
Zum Zustand der medizinischen Kapazitäten für den Unglücksfall merkt das Komittee ebenfalls Ambivalentes an:
• Einerseits: "USAMRIID, Fort Detrick, and Frederick County have the resources and partnerships in place to address medical and emergency situations at the containment laboratories."
• Andererseits: "A primary concern is the lack of readily available clinicians with the necessary specialized training to consult on the clinical diagnosis and treatment of unusual infectious diseases."
Die Kommunikation und Kooperation mit der Öffentlichkeit ist bei weitem nicht optimal: "A segment of the local population around Fort Detrick is not satisfied that the Army is doing everything it can to protect them from infection by pathogens being studied at USAMRIID."
Nach diesen ausführlichen Zitaten soll aber auch nicht ein wichtiger, insgesamt nach einigen Eiertänzen deeskalierender Schlusspassus dieses Gutachtens zur Risikoabschätzung, unterschlagen werden: "In summary, although the EIS failed to provide adequate and credible technical analyses, current procedures, regulations, physical security, and biosurety guidelines at USAMRIID meet or exceed accepted standards and practices. Furthermore, the Army and Frederick County have the resources and the partnerships in place to address medical and emergency situations at the containment laboratories. Thus, the committee has a high degree of confidence that policies and procedures are in place to provide appropriate protections for workers and the public. Nonetheless, no program can fully stop all threats resulting from human error (for example, laboratory-acquired infections), or from theft or misuse of select agents. In going forward, the Army and USAMRIID should review its methods and procedures for preparing an EIS (including consideration of human health issues), more actively train personnel regarding accountability and responsibility, and more proactively reach out to the local community to inform it of its safety and security policies and procedures and to constructively design approaches for communicating timely information should an adverse incident occur."
Inhalte einer wünschenswerten breiten öffentlichen Debatte könnte sein, ob es wirklich dem Interesse an öffentlicher Gesundheit gerecht wird, bei dem extrem hohen gesundheitlichen Gefahrenpotenzial allein der veröffentlichten Biowaffen in Fort Detrick und vergleichbaren Laboren, nonchalant von unvermeidbaren Restrisiken zu reden und ansonsten den dort Aktiven uneingeschränkt zu vertrauen. Dies ändert aber nichts daran, dass vergleichbare Berichte vor (!!!) der Anlage und dem Start derartiger potenziell gesundheitsgefährdender Einrichtungen standardmäßig vorgelegt werden sollten.
Von dem Bericht "Evaluation of the Health and Safety Risks of the New USAMRIID High Containment Facilities at Fort Detrick, Maryland" des Committee to Review the Health and Safety Risks of High Biocontainment Laboratories at Fort Detrick; National Research Council gibt es eine mehrseitige "Executive summary" und den kompletten Text als PDF-Datei. Um das komplette Buch zu erhalten, muss man sich mit seiner Mailadresse, seinem Namen und seiner Tätigkeit (Student geht auch) anmelden, was erfahrungsgemäß keine unerwünschten Folgen hat.
Bernard Braun, 11.4.10
Berufliche Mobilität vom Fernpendeln bis zum Umzug verschlechtert den Gesundheitszustand und fördert depressive Verstimmungen
 Obwohl die soziale Eigenschaft, flexibel.oder räumlich mobil zu sein, seit einiger Zeit im Range einer fast normalen Erwartung oder Anforderung an den modernen Menschen steht, wurde über die potenziell unerwünschten gesundheitlichen Wirkungen nur selten theoretisch-systematisch oder gar empirisch nachgedacht oder geforscht. Eine der wenigen Ausnahmen ist die kritische Auseinandersetzung des us-amerikanischen Soziologen Sennett mit der Flexibilitätsanforderung als Hauptelement einer zunehmenden Gleichgültigkeit von Beschäftigten gegenüber ihrer Arbeit.
Obwohl die soziale Eigenschaft, flexibel.oder räumlich mobil zu sein, seit einiger Zeit im Range einer fast normalen Erwartung oder Anforderung an den modernen Menschen steht, wurde über die potenziell unerwünschten gesundheitlichen Wirkungen nur selten theoretisch-systematisch oder gar empirisch nachgedacht oder geforscht. Eine der wenigen Ausnahmen ist die kritische Auseinandersetzung des us-amerikanischen Soziologen Sennett mit der Flexibilitätsanforderung als Hauptelement einer zunehmenden Gleichgültigkeit von Beschäftigten gegenüber ihrer Arbeit.
Mit der europäisch (Deutschland, Frankreich, Spanien, Polen, Belgien und der Schweiz) vergleichenden Studie "Job Mobilities and Family Lives in Europe" liegen nun erstmals auch für Deutschland Zahlen vor, die einen direkten Vergleich der Gesundheit, des Wohlbefindens und dem Familienleben zwischen Erwerbstätigen in unterschiedlichen Formen berufsbedingter Mobilität und Erwerbstätigen ohne Mobilitätserfahrungen hinsichtlich verschiedener Lebensbereiche ermöglichen.
Nach den Ergebnissen dieser Studie gibt es einige teilweise hochsignifikanten Zusammenhänge zwischen wesentlichen Gesundheitsindikatoren und der mittlerweile für Millionen von Arbeitnehmern tagtäglich oder regelmäßig erfahrbaren Mobilität zwischen Wohn- und Arbeitsort.
Zu den wesentlichen, jetzt veröffentlichten Ergebnissen gehört:
• Männer ohne Partnerin und ohne Kinder (22 %) sind ähnlich häufig mobil wie kinderlose Männer mit Partnerin (27 %) und Männer mit Partnerin und Kindern (23 %). Bei Frauen hingegen nimmt die Mobilitätsrate mit ansteigender partnerschaftlicher und vor allem familialer Einbindung deutlich ab. Sind 34 % der Frauen ohne Partner und ohne Kinder mobil, reduziert sich dieser Anteil für kinderlose Frauen mit Partner auf 27 % und für Frauen mit Partner und Kindern auf 6 %.
Misst man Gesundheit mit den Indikatoren des allgemeinen Stresserlebens, des allgemeinen Gesundheitszustands sowie der depressiven Verstimmung und Mobilität mit den Kategorien Tägliche Fernpendler, Umzugsmobile (vor max. 1,5 Jahren), Umzugsmobile (vor 1,5-3 Jahren), Overnighter und Multi-Mobille, ergeben sich folgende Ergebnisse:
• Wer täglich fernpendelt hat bei allen drei Gesundheitsindikatoren statistisch signifikant schlechtere Werte als die Untersuchten, die bisher keinerlei Mobilitätsanfordernisse aus beruflichen Gründen erfahren haben.
• Bei Umzugsmobilität ist eine Abnahme der Belastungen in der Gruppe der vor mehr als anderthalb Jahren Umgezogenen im Vergleich zu denen, deren Umzug erst maximal 1,5 Jahre her ist, erkennbar. Erst vor kurzem umgezogene Personen haben ein adjustiertes Risiko eines schlechten Gesundheitszustandes, das das 4,4-Fache des Risikos Nichtmobiler beträgt. Auffällig sind bei dieser Kategorie mobiler Personen die langfristig verbleibenden Beeinträchtigungen des psychischen Befindens in Form depressiver Verstimmungen. Die nach Alter, Geschlecht, formaler Schulbildung, Erwerbsumfang, Familienform und Familienstand adjustierten Odds Ratios der Umzugsmobilen vor maximal 1,5 Jahren lagen bei 3,2 und bei Personen, die schon vor 1,5 bis drei Jahren umzugsmobil waren immer noch 2,1.
• Sind Menschen freiwillig mobil, unterscheiden sie sich hinsichtlich Gesundheit und Wohlbefinden kaum von nicht-mobilen Personen.
• Schon bei der Wahrnehmung der Mobilität als notwendies Übel verschlechtern sich die Gesundheitsindikatoren deutlich.
• Begreifen Menschen ihre Mobilität aber als Zwang, zeigen sich deutliche negative Folgen für Gesundheit und Wohlbefinden.
Diese Zahlen und weitere Informationen werden in dem Aufsatz "Berufsbedingte räumliche Mobilität in Deutschland und die Folgen für Familie und Gesundheit von Heiko Rüger im Newsletter "Bevölkerungsforschung Aktuell" (Ausgabe 02/2010" des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung veröffentlicht. Er steht kostenlos zur Verfügung, was auch für die abonnierbaren Mitteilungen des Instituts gilt. Kostenlos kann man sich auch die weiteren Ergebnisse der diesen Zahlen zugrundeliegenden EU-geförderte Studie anschauen.
Bernard Braun, 16.3.10
Altersteilzeit ist gesünder als ein abrupter Übergang vom Erwerbsleben in die Rente
 Ältere Menschen, die nicht vom einen auf den anderen Tag aus einer Vollzeitbeschäftigung in Rente gegangen sind, sondern diesen Übergang mit unterschiedlichen Formen einer "Brückenbeschäftigung" bewältigten, sind danach körperlich und geistig signifikant gesünder. Zu diesem Ergebnis kommen Alternsforscher im Journal of Occupational Health Psychology. Die an der University of Maryland und der California State University in San Bernardino arbeitenden Psychologen haben die Daten der "Health and Retirement Study" ausgewertet. Diese Langzeitstudie des US-National Institute on Aging befragt seit 1992 eine Gruppe von 12.189 US-Bürgern, damals zwischen 51 und 61 Jahre alt, regelmäßig nach ihren Lebensumständen. Zu den dabei erhobenen Merkmalen zählen neben Alter und Geschlecht auch ihr Bildungsniveau und ihre gesamte finanzielle Situation. Außerdem werden Angaben zum Beschäftigungsverhältnis, zu ärztlich diagnostizierten Krankheiten oder Risikofaktoren wie Bluthochdruck, Diabetes, Krebs, Lungen- und Herzerkrankungen, Schlaganfall und zur mentalen Gesundheit erhoben.
Ältere Menschen, die nicht vom einen auf den anderen Tag aus einer Vollzeitbeschäftigung in Rente gegangen sind, sondern diesen Übergang mit unterschiedlichen Formen einer "Brückenbeschäftigung" bewältigten, sind danach körperlich und geistig signifikant gesünder. Zu diesem Ergebnis kommen Alternsforscher im Journal of Occupational Health Psychology. Die an der University of Maryland und der California State University in San Bernardino arbeitenden Psychologen haben die Daten der "Health and Retirement Study" ausgewertet. Diese Langzeitstudie des US-National Institute on Aging befragt seit 1992 eine Gruppe von 12.189 US-Bürgern, damals zwischen 51 und 61 Jahre alt, regelmäßig nach ihren Lebensumständen. Zu den dabei erhobenen Merkmalen zählen neben Alter und Geschlecht auch ihr Bildungsniveau und ihre gesamte finanzielle Situation. Außerdem werden Angaben zum Beschäftigungsverhältnis, zu ärztlich diagnostizierten Krankheiten oder Risikofaktoren wie Bluthochdruck, Diabetes, Krebs, Lungen- und Herzerkrankungen, Schlaganfall und zur mentalen Gesundheit erhoben.
Allerdings ist die Art des Übergangs in die Rente nicht unerheblich. Unterschiedlichen Formen der "Brückenbeschäftigung" (wie etwa eine zeitlich begrenzte Teilzeitbeschäftigung, eine Beschäftigung innerhalb oder außerhalb der bisherigen beruflichen Tätigkeit oder ein zeitlich begrenzter neuer Job) zeigen nämlich deutliche Effektunterschiede für die Gesundheit.
Die positiven Auswirkungen auf die weitere gesundheitliche Entwicklung traten lediglich bei solchen Personen auf, die eine "Brückentätigkeit" im ursprünglichen Beruf und am besten im bisherigen Betrieb ausübten. Die theoretische Möglichkeit, dass dabei die körperliche und mentale Gesundheit der RentnerInnen vor ihrer Berentung eine Hauptrolle gespielt hat, schließen die Wissenschaftler nach einer entsprechenden Standardisierung aus. Selbst wenn also der Gesundheitszustand vor dem Eintritt in die Rente keine Rolle mehr spielt, sind Personen, die eine "Brückentätigkeit" im bisherigen Beruf ausüben, im weiteren biografischen Verlauf gesünder. Wenn sie sich, vor allem aus finanziellen Gründen im Rentenalter nach einem neuen Job umsehen mussten, was in den USA keine Seltenheit ist, fiel der Gesundheitsbonus der "Brückenbeschäftigung" weg. Die Autoren führen dies auf den Stress zurück, dem ältere Menschen ausgesetzt sind, wenn sie sich für kurze Zeit in ein neues Berufsfeld einarbeiten müssen.
Auch wenn dies in dieser Studie nicht ausdrücklich untersucht wurde und keine aussagekräftigen Ergebnisse vorliegen, sollte das vorliegende Ergebnis Anlass dazu geben, generell darüber nachzudenken, den traditionell abrupten Übergang von Arbeit in Rente auch in Deutschland durch intelligente Formen von Altersteilzeit zu vermeiden.
Die Studie "Bridge Employment and Retirees' Health: A Longitudinal Investigation" von Yujie Zhan, Mo Wang, Songqi Liu und Kenneth S. Shultz erschien im Journal of Occupational Health Psychology (2009, Vol. 14, No. 4, 374-389) der American Psychological Association.
• Die komplette Fassung als PDF ist kostenlos erhältlich.
• Bei PubMed findet man ein Abstract der Studie.
• Bei der APA gibt es auch eine etwas ausführlichere Pressemitteilung
Bernard Braun, 6.2.10
Lieber krank feiern als krank arbeiten oder umgekehrt!? Was fördert oder hemmt die beiden Umgangsweisen mit Krankheit?
 Die Abwesenheit von Arbeit aus Krankheitsgründen oder "sickness absenteeism" spielt bereits seit vielen Jahren eine zentrale Rolle in Untersuchungen zum Zustand der Arbeitswelt. Seit den 1990er Jahren wächst parallel das systematische und empirische Interesse an der Anwesenheit am Arbeitsplatz trotz Krankheit, dem so genannten "sickness presenteeism".
Die Abwesenheit von Arbeit aus Krankheitsgründen oder "sickness absenteeism" spielt bereits seit vielen Jahren eine zentrale Rolle in Untersuchungen zum Zustand der Arbeitswelt. Seit den 1990er Jahren wächst parallel das systematische und empirische Interesse an der Anwesenheit am Arbeitsplatz trotz Krankheit, dem so genannten "sickness presenteeism".
Trotz zahlreicher Nachweise der Existenz (vgl. dazu u.a. die drei Forumbeiträge aus den letzten 6 Jahren. Dazu gehören mehrere deutsche und internationale Studien aus den letzten 2 Jahren, diverse internationale Beiträge aus den Jahren 2005 bis 2009 und die Ergebnisse des WIdO-Monitors aus 2003 für Deutschland ) gibt es nur wenig differenzierte Einblicke, warum sich eine wachsende Anzahl von Beschäftigten krank zur Arbeit schleppt. Der Hinweis auf die prekäre Arbeitsplatzsituation vieler Beschäftigten ist sicherlich richtig und notwendig, aber für eine Erklärung nicht hinreichend.
Das Präsentismusverhalten ist auf Dauer weder für den so agierenden Arbeitnehmer noch für seinen Arbeitgeber von Nutzen oder nur mit geringen nachteiligen Effekten verbunden. Für den Arbeitnehmer steigt das Risiko, in mehr oder weniger kurzem Abstand schwerer und dann auch insgesamt länger und teurer arbeitsunfähig zu werden. Der Arbeitgeber riskiert u.a. Produktivitätsverluste durch Qualitätsmängel durch unkonzentriertes Arbeiten und mittel- bis langfristig den Verlust von Arbeitskräften.
Die genannte Erklärungslücke versuchte nun finnische Studie mit umfassenden Daten von 725 finnischen Gewerkschaftsmitgliedern in einem Survey durch einen Vergleich eines Bündels von soziodemografischen und Arbeitsfaktoren und -bedingungen (z.B. Arbeitszeitarrangements, Arbeitsplatzregeln aber auch Angaben zum Wirtschaftssektor und zur formalen Bildung und Ausbildung) der im Jahr 2008 absenten und präsenten Personen zu schließen.
Unter Kontrolle der Arbeitercharakteristika erwies sich das Präsentismusverhalten als wesentlich sensitiver gegenüber Arbeitszeit-Arrangemts als Absentismusverhalten. Ständige Vollzeitarbeit, eine Diskrepanz zwischen der gewünschten und tatsächlich erbrachten Anzahl von Arbeitsstunden, Schichtarbeit, und überlange Arbeitswochen auch mit anschließendem Freizeitausgleich erhöhen die Häufigkeit präsentiven Verhaltens. Regelmäßige Überstunden senken etwa die Prävalenz von Absentismus um 13%, während Schichtarbeit die Prävalenz von Absentismus um 8% erhöht. Zwischen beiden Formen des arbeitsbezogenen Umgangs mit dem Kranksein gibt es ein paar interessante Gemeinsamkeiten aber auch grundlegende Unterschiede: So erhöht die Teilnahme an Schichtarbeit sowohl die Absentismus- wie die Präsentismusrate. Anders sieht es bei den Wirkungen regelmäßiger Überstunden aus. Das Verhaltensmodell des Präsentismus wird dadurch um 12% erhöht, der Absentismus dagegen um 13% verringert.
Einige Ergebnisse der Studie weisen auch auf Möglichkeiten der betrieblichen Beeinflussung beider Verhaltensweisen hin. Die Möglichkeit der vorübergehenden Besetzung des Arbeitsplatzes durch Stellvertreter senkt z.B. die Prävalenz des Präsentismus um 11%, was auch als Zeichen für die Rolle des Sichverantwortlichfühlens von Erwerbstätigen interpretiert werden kann. Dort, wo es möglich ist, drei Tage ohne ärztliche Bescheinigung der Arbeitsunfähigkeit bezahlt vom Arbeitsplatz fern bleiben zu können, sinkt der Präsentismus ebenfalls, und zwar um 8%. Den unverbesserlichen Anhängern der Vorstellung, solche Regelungen würden grenzenlos zum "Krankfeiern" missbraucht, nimmt schließlich noch die Tatsache Wind aus den Segeln, dass auch der Absentismus unter ihrer Geltung um rund 1% sinkt, und keineswegs ansteigt.
Auch wenn man die von den Autoren selbst aufgelisteten methodischen Grenzen der Untersuchung voll teilt,, also z.B. die Unmöglichkeit kausaler Analysen in Querschnittdaten oder die Nichtrepräsentativität von finnischen Gewerkschaftsmitgliedern für die finnische und andere Arbeitnehmerschaften, liefert die Studie wichtige Hinweise für die arbeitspolitische Praxis und künftige (Panel-)Studien zu beiden Verhaltenstypen oder Umgangsweisen.
Von der Studie "What makes you work while you are sick? Evidence from a survey of workers" von Petri Böckerman und Erkki Laukkanen, im Januar 2010 im European Journal of Public Health(2010; 20: 43-46) erschienen, ist lediglich das Abstract kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 22.1.10
Beruflichen Ärger und Konflikte nur herunterzuschlucken kann zum Herzinfarkt führen
 In Zeiten von Massenarbeitslosigkeit, Kurzarbeit und drohenden Betriebsschließungen erscheint es für Beschäftigte nur vernünftig, Konflikten mit Vorgesetzten aus dem Weg zu gehen und ebenso Streit mit Kollegen zu vermeiden. Dass solche Bewältigungsstrategien im Betrieb einerseits der Arbeitsplatzsicherheit dienen, andererseits aber gesundheitlich überaus problematisch sein können, hat jetzt eine schwedische Studie gezeigt. Das Risiko, einen Herzinfarkt zu erleiden oder daran sogar zu sterben, ist erheblich höher bei männlichen Arbeitnehmern, die sich auf der Arbeit ungerecht behandelt fühlen, diesen Ärger aber in sich hinein fressen und nicht offen artikulieren.
In Zeiten von Massenarbeitslosigkeit, Kurzarbeit und drohenden Betriebsschließungen erscheint es für Beschäftigte nur vernünftig, Konflikten mit Vorgesetzten aus dem Weg zu gehen und ebenso Streit mit Kollegen zu vermeiden. Dass solche Bewältigungsstrategien im Betrieb einerseits der Arbeitsplatzsicherheit dienen, andererseits aber gesundheitlich überaus problematisch sein können, hat jetzt eine schwedische Studie gezeigt. Das Risiko, einen Herzinfarkt zu erleiden oder daran sogar zu sterben, ist erheblich höher bei männlichen Arbeitnehmern, die sich auf der Arbeit ungerecht behandelt fühlen, diesen Ärger aber in sich hinein fressen und nicht offen artikulieren.
Basis der jetzt in der Zeitschrift "Journal of Epidemiology and Community Health" veröffentlichten schwedischen Studie sind Daten von 2.755 männlichen Arbeitnehmern im Großraum Stockholm. Diese hatten ein sehr unterschiedliches Lebensalter (im Durchschnitt 41 Jahre) und auch die Berufe und beruflichen Qualifikationen zeigten eine große Streuweite. Bei diesen Studienteilnehmern wurden im Zeitraum 1992-1995 einerseits viele sozialstatistische (u.a. Bildungsniveau, Einkommen, beruflicher Status, Verantwortung am Arbeitsplatz) und auch gesundheitliche Daten erhoben (u.a. BMI, Blutdruck, Diabetiker, Raucher, Cholesterinwerte).
Darüber hinaus wurde andererseits aber auch die bevorzugte Bewältigungsstrategie, der "Coping-Stil", bei Ärger und Konflikten im Berufsleben mit einem Fragebogen erfasst. Dort waren Fragen zu beantworten wie: "Wie reagieren Sie normaler Weise, wenn Sie ungerecht behandelt werden oder in einen Konflikt mit Ihrem Vorgesetzten geraten?"
• Lassen Sie das geschehen und sagen nichts?
• Gehen Sie weg?
• Geht es Ihnen schlecht (z.B. Kopfschmerzen, Magenbeschwerden)?
• Sind Sie dann später zuhause in schlechter Stimmung?
Die Antwortvorgaben für diese Fragen waren "selten oder nie", "manchmal" oder "oft". Diese Fragen wurden dann noch einmal gestellt für das Szenario "Konflikte mit Arbeitskollegen". Die Antworten wurden dann zusammengefasst und die Studienteilnehmer in drei Gruppen eingeteilt: Beschäftigte mit einem stark, mittel oder schwach ausgeprägten Bewältigungsstil der Unterdrückung von Ärger und Konflikten.
In die Studie einbezogen wurden dann nur Arbeitnehmer ohne vorherige gesundheitliche Auffälligkeiten im Hinblick auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Über einen Zeitraum von 10 bis 12 Jahren wurde dann kontrolliert, ob die Teilnehmer einen Herzinfarkt erlitten hatten und daran unter Umständen sogar gestorben waren.
Im Rahmen einer multivariaten Analyse, in der auch der Einfluss vieler anderer Faktoren (Lebensalter, Rauchen, Schulbildung usw.) für das Auftreten eines Herzinfarktes mit berücksichtigt wurde, zeigte sich dann nach 10-12 Jahren, dass die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten eines Herzinfarkts (mit oder ohne tödlichen Ausgang) für Arbeitnehmer mit einer sehr ausgeprägten Unterdrückung von Ärger etwa 2,4mal so hoch war wie bei anderen mit eher schwacher Tendenz zu diesem Coping. Die Wissenschaftler fanden teilweise sogar für einzelne Verhaltensweisen solche Effekte: Für Befragte, die bei Konflikten manchmal oder öfter weggehen und die Flucht antreten, zeigte sich eine 4,0 bis 4,5mal so hohe Wahrscheinlichkeit für einen Herzinfarkt.
Unterscheidet man als Indikatoren das Bewältigungsverhalten selbst (nichts sagen, weggehen) und spätere Effekte (Beschwerden, Stimmung), dann erlauben in erster Linie die Verhaltensweisen eine Prognose über spätere Herzerkrankungen. Ein hohes Maß an Konfliktunterdrückung zeigt eine etwa sechs mal so hohe Auftrittswahrscheinlichkeit für spätere Infarkte (sog. "Odds-Ratio": 6-6,5).
Hier ist ein Abstract der Studie: Constanze Leineweber et al: Covert coping with unfair treatment at work and risk of incident myocardial infarction and cardiac death among men: Prospective cohort study (J Epidemiol Community Health doi:10.1136/jech.2009.088880)
Gerd Marstedt, 8.12.09
Trotz Krankheit zur Arbeit: "Präsentismus" ist oft Ursache späterer Langzeit-Arbeitsunfähigkeit
 Wenn Arbeitnehmer trotz Krankheit zur Arbeit gehen, so scheint dies für den Betrieb nur vorteilhaft, spart er doch Lohnersatzleistungen und muss sich nicht um Personalersatz kümmern. Dass dies eine Milchmädchenrechnung sein kann, hat jetzt eine dänische Verlaufsstudie bei knapp 12 Tausend Beschäftigten gezeigt. Wer häufiger trotz Krankheit zur Arbeit erscheint, so der zentrale Befund, läuft ein hohes Risiko, sich in der Folgezeit längerfristig (über zwei Wochen oder sogar über zwei Monate) krankmelden zu müssen.
Wenn Arbeitnehmer trotz Krankheit zur Arbeit gehen, so scheint dies für den Betrieb nur vorteilhaft, spart er doch Lohnersatzleistungen und muss sich nicht um Personalersatz kümmern. Dass dies eine Milchmädchenrechnung sein kann, hat jetzt eine dänische Verlaufsstudie bei knapp 12 Tausend Beschäftigten gezeigt. Wer häufiger trotz Krankheit zur Arbeit erscheint, so der zentrale Befund, läuft ein hohes Risiko, sich in der Folgezeit längerfristig (über zwei Wochen oder sogar über zwei Monate) krankmelden zu müssen.
"Absentismus" nennt man Fehlzeiten von Arbeitnehmern, die nicht auf Krankheiten zurückzuführen sind. In letzter Zeit sehr viel häufiger diskutiert wird das gegenteilige Phänomen des "Präsentismus", also das Erscheinen von Beschäftigten im Betrieb und am Arbeitsplatz, obwohl sie krank sind (vgl. als Überblick: Besser krank feiern als krank arbeiten - Das Problem "Präsentismus").
Dass dies keinesfalls nur auf Einzelfälle beschränkt ist, hat unlängst eine repräsentative Befragung der Bertelsmann-Stiftung gezeigt. Danach sind insgesamt 71 Prozent der Erwerbstätigen im Alter von 18-79 Jahren in vergangenen zwölf Monaten mindestens einmal zur Arbeit gegangen, obwohl sie sich richtig krank gefühlt haben. Knapp die Hälfte (46%) gibt an, dass dies bei ihnen sogar zweimal oder öfter der Fall war. Gegen den Rat ihres Arztes der Arbeit nachgegangen sind in den letzten 12 Monaten 30 Prozent der Befragten mindestens einmal, etwa die Hälfte davon sogar mehrmals. (vgl. Bertelsmann Stiftung Pressemeldungen: Mehrheit der Deutschen arbeitet auch im Krankheitsfall, Fast jeder zweite Beschäftigte geht krank zur Arbeit)
Eine dänische Studie hat nun überprüft, wie sich der Präsentismus auf spätere Arbeitsunfähigkeitsmeldungen auswirkt. Die Untersuchung basiert auf Daten von 11.838 dänischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die aus einer größeren, repräsentativen Bevölkerungsstichprobe gezogen wurden. Für diese lagen dann Daten über den Bezug von Krankengeld vor, und zwar aus einem staatlichen Register mit Namen "DREAM", einer Einrichtung des dänischen Arbeitsministeriums. In Dänemark erhalten krankgemeldete Arbeitnehmer in den ersten zwei Wochen Lohnersatzleistungen vom Arbeitgeber, danach vom Staat.
Weitere Informationen wurden durch postalisch versendete Fragebögen gewonnen, für die eine hohe Beteiligungsquote zu verzeichnen war (ca. 70%). Diese unterschiedlichen Daten wurden in der Studie dann darauf hin überprüft, ob das Verhaltensmuster "trotz Krankheit zur Arbeit gehen" auch Risiken einer Verschleppung oder Chronifizierung von Krankheiten birgt und sich in späteren, längerfristigen Krankmeldungen niederschlägt. Erfasst wurden Informationen zu den Arbeitsbedingungen der Studienteilnehmer, familiären Rahmenbedingungen sowie Einstellungen zur Arbeit und zu Krankmeldungen. Weiterhin erhoben wurden Arbeitsunfähigkeitszeiten, Ursachen und Dauer über einen Beobachtungszeitraum von 18 Monaten, und zwar anhand von Daten des staatlichen DREAM-Registers. Das Merkmal "Präsentismus" wurde erfasst anhand der Frage: "Wie oft sind Sie in den letzten 12 Monaten zur Arbeit gegangen, obwohl es vernünftiger gewesen wäre, sich krank zu melden? Keinmal, einmal, 2-3mal, 4-5mal, 6-10mal, über 10mal".
In multivariaten Analysen wurde dann nicht nur das Merkmal "trotz Krankheit zur Arbeit gehen" überprüft, sondern eine Reihe weiterer möglicher Einflüsse mitberücksichtigt: Gesundheitszustand, Alter, Geschlecht, sozioökonomische Schichtzugehörigkeit, Arbeitsbedingungen, familiäre Situation. Überprüft wurde dann, ob diese Faktoren einen Einfluss auf spätere Krankmeldungen von längerer Dauer haben, und zwar Arbeitsunfähigkeitsmeldungen über zwei Wochen und solche über zwei Monate.
Tatsächlich zeigt sich in den Analysen:
• Wer häufiger krank zur Arbeit erscheint, zeigt auch später ein erhöhtes Risiko für längerfristige Krankmeldungen, und zwar sowohl für solche, die länger als zwei Wochen dauern und ebenso für solche, die länger als zwei Monate dauern.
• Dieser Zusammenhang ist nahezu linear, das heißt, je öfter jemand krank zur Arbeit erscheint, desto größer fällt das Risiko aus, dass er später auch länger krank gemeldet ist.
• Im Vergleich zu Beschäftigten, die keinmal oder nur einmal in 12 Monaten krank zur Arbeit gehen, liegt das Risiko für eine spätere Langzeit-Arbeitsunfähigkeit über zwei Monate bei 2-5 Episoden von Präsentismus um 21% höher, bei 6 und mehr Episoden um 74% höher. (Diese Daten basieren auf jenem statistischen Modell, das die meisten weiteren Einflussfaktoren mitberücksichtigt, also am konservativsten ist, was den Effekt des Präsentismus anbetrifft).
Die Wissenschaftler weisen in der Diskussion ihrer Befunde darauf hin, dass sie Beschäftigte mit chronischen Erkrankungen aus der Analyse ausgeschlossen haben, so dass die Zusammenhänge vermutlich noch sehr viel deutlicher und stärker ausgefallen wären, wenn man diese Arbeitnehmer auch mitberücksichtigt hätte. Sie weisen ferner darauf hin, dass betriebliche Arbeits- und Gesundheitspolitik, die Arbeitsunfähigkeitsmeldungen sanktioniert und so den Präsentismus fördert, vielen Beschäftigten eine wichtige Coping-Strategie raubt. Längerfristig wird dies in vielen Fällen einen Bumerang-Effekt haben und zu längeren Krankmeldungen führen.
Kostenloses Abstract: C D Hansen and J H Andersen: Sick at work—a risk factor for long-term sickness absence at a later date? (Journal of Epidemiology and Community Health 2009;63:397-402;doi:10.1136/jech.2008.078238)
Gerd Marstedt, 12.9.09
US-amerikanische Verlaufsstudien zeigen: Länger dauernde Angst vor einem Jobverlust macht krank
 Eine Vielzahl von Studien hat bereits Hinweise dafür geliefert, dass die Angst vor einem Verlust des Arbeitsplatzes mit Gesundheitsrisiken verbunden ist. Ein Großteil dieser Studien ist methodisch jedoch angreifbar, da es Einmal-Erhebungen mit Befragungsdaten sind: Erwerbstätige werden zu einem bestimmten Zeitpunkt um eine Einstufung ihres Gesundheitszustands und der Sicherheit ihres Arbeitsplatzes befragt und die Ergebnisse miteinander in Verbindung gebracht. Die dabei gefundenen Zusammenhänge sind jedoch in zweierlei Richtung interpretierbar: a) Beschäftigte erkennen, dass ihr Arbeitsplatz unsicher ist und dies beeinträchtigt ihre Gesundheit. Oder b) Gesundheitlich schon beeinträchtigte Arbeitnehmer schätzen (aufgrund dieses Handicaps) auch ihren Arbeitsplatz häufiger als unsicher ein.
Eine Vielzahl von Studien hat bereits Hinweise dafür geliefert, dass die Angst vor einem Verlust des Arbeitsplatzes mit Gesundheitsrisiken verbunden ist. Ein Großteil dieser Studien ist methodisch jedoch angreifbar, da es Einmal-Erhebungen mit Befragungsdaten sind: Erwerbstätige werden zu einem bestimmten Zeitpunkt um eine Einstufung ihres Gesundheitszustands und der Sicherheit ihres Arbeitsplatzes befragt und die Ergebnisse miteinander in Verbindung gebracht. Die dabei gefundenen Zusammenhänge sind jedoch in zweierlei Richtung interpretierbar: a) Beschäftigte erkennen, dass ihr Arbeitsplatz unsicher ist und dies beeinträchtigt ihre Gesundheit. Oder b) Gesundheitlich schon beeinträchtigte Arbeitnehmer schätzen (aufgrund dieses Handicaps) auch ihren Arbeitsplatz häufiger als unsicher ein.
Eine US-amerikanische Studie hat nun allerdings mit Daten aus zwei Verlaufsstudien, die für US-amerikanische Arbeitnehmer repräsentativ sind, aufgezeigt, dass die erste Interpretation plausibler ist: Arbeitsplatzunsicherheit beeinträchtigt die Gesundheit. Die zur Analyse verwendeten Studien waren einerseits "American's Changing Lives (ACL)" (durchgeführt 1986-1989) und andererseits "Midlife in the United States (MIDUS)" (durchgeführt 1995-2005). Beides sind Studien, die bei denselben Teilnehmern zumindest zwei Befragungen zu verschiedenen Zeitpunkten durchgeführt haben. Daher konnten die Wissenschaftler auch überprüfen, ob sich über einen längeren Zeitraum (zwischen 3 und 10 Jahren) die Arbeitsplatzunsicherheit und/oder der Gesundheitszustand verändert hatte.
Als Indikatoren für den Gesundheitszustand wurde einerseits die Frage herangezogen, wie man diesen selbst einschätzt, zum anderen wurden Skalen zur Erfassung von Depressivität und negativen Emotionen verwendet. Für die Bewertung der Arbeitsplatzunsicherheit wurden in den beiden Studien ACL und MIDUS zwei ähnliche, aber nicht völlig identische Fragen benutzt: "Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie in den nächsten Jahren unfreiwillig Ihren Hauptjob verlieren?" bzw. "Wenn Sie Ihren jetzigen Arbeitplatz behalten möchten, wie hoch schätzen Sie Ihre Chancen dafür in den nächsten 2 Jahren ein?". Darüber hinaus wurden auch tatsächliche Ereignisse eines Arbeitsplatzverlusts - erfasst über Befragungen der Betroffenen - in die Analysen einbezogen.
In den multivariaten Analysen, in denen neben den beiden zentralen Variablen Arbeitsplatzunsicherheit und Gesundheit noch viele andere Aspekte mitberücksichtigt wurden (Alter, Hautfarbe, Geschlecht, Rauchen, Bildungsniveau, Einkommenshöhe, Vollzeit-Teilzeit-Arbeit usw.) wurde auch die Häufigkeit oder "Chronizität" von Arbeitsplatzunsicherheit untersucht, durch Unterscheidung von Gruppen, die nur zum ersten Befragungszeitpunkt über eine hohe Arbeitsplatzunsicherheit berichteten, solchen, bei denen dies nur zum 2.Zeitpunkt der Fall war und solchen, bei denen dies zu beiden Zeitpunkten der Fall war. Und auch der tatsächlich Verlust des Arbeitsplatzes wurde als potentieller Einflussfaktor untersucht.
Als zentrales Ergebnis zeigte sich dann, das ein chronisches, also zu mehreren Zeitpunkten feststellbares Erleben von Arbeitsplatzunsicherheit erhebliche Beeinträchtigungen des Gesundheitszustands und auch depressive Verstimmungen verursacht. Waren die Befragten nur vorübergehend und zu einem Befragungs-Zeitpunkt unsicher, so war kein signifikanter negativer Effekt zu finden. Überraschend war für die Wissenschaftler, dass der gesundheitlich negative Einfluss "chronischer" Arbeitsplatzunsicherheit sogar deutlich stärker ausfiel als der Effekt einer vorübergehender Arbeitslosigkeit oder eines vor kurzem erfahrenen Arbeitsplatzverlusts. Dass es sich bei dem Merkmal "chronische Angst vor Arbeitsplatzverlust" nicht in erster Linie um ein Persönlichkeitsmerkmal bestimmter Befragungsteilnehmer handelt (höhere Ängstlichkeit, pessimistisch-depressive Stimmung, Zukunftsangst) wurde von den Wissenschaftlern durch entsprechende Fragen überprüft und erscheint ihnen in der Diskussion ihrer Befunde unwahrscheinlich.
Zur Studie gibt es kostenlos leider nur ein Abstract: Sarah A. Burgard, Jennie E. Brand, James S. House: Perceived job insecurity and worker health in the United States (Social Science & Medicine, Volume 69, Issue 5, September 2009, Pages 777-785)
Gerd Marstedt, 30.8.09
"Immer an der Spitze!" - Arbeitsbedingungen und Belastungen der Gesundheits- und Krankenpfleger/innen
 Egal ob es um die Anzahl der Beschäftigten im Gesundheitswesen oder den Beitrag zum gesundheitlichen Wohlbefinden von PatientInnen geht: Krankenpflege und Pflegekräfte sind immer ganz vorne dabei. Wie eine gerade veröffentliche Ausgabe des STATmagazin des Statistischen Bundesamtes mit Daten der Gesundheitspersonalrechnung, der Krankenhausstatistik des Bundes und der Länder und des Mikrozensus zeigt, liegen Pflegekräfte auch bei manchen belastenden Arbeitsbedingungen an der Spitze.
Egal ob es um die Anzahl der Beschäftigten im Gesundheitswesen oder den Beitrag zum gesundheitlichen Wohlbefinden von PatientInnen geht: Krankenpflege und Pflegekräfte sind immer ganz vorne dabei. Wie eine gerade veröffentliche Ausgabe des STATmagazin des Statistischen Bundesamtes mit Daten der Gesundheitspersonalrechnung, der Krankenhausstatistik des Bundes und der Länder und des Mikrozensus zeigt, liegen Pflegekräfte auch bei manchen belastenden Arbeitsbedingungen an der Spitze.
Die wichtigsten Daten zeichnen folgendes Bild der Krankenpflege:
• Mit 712.000 Beschäftigten stellten die Gesundheits- und Krankenpflegerinnen/-pfleger 2007 die größte Berufsgruppe unter den Gesundheitsdienstberufen. 490.000 arbeiteten primär in Krankenhäusern, 98.000 in der ambulanten Pflege.
• Ihre Zahl stieg von 1997 bis 2007 um 5%. Rechnet man aber alle Beschäftigungsverhältnisse in Vollzeitstellen um, war deren Anzahl im selben Zeitraum rückläufig, und zwar von 518.000 auf 512.000. Vollzeitstellen waren um 12% zurückgegangen während Teilzeit- und geringfügige Beschäftigungsverhältnisse um rund 39% zunahmen. Aktuell dürfte sich daran wegen der personellen Aufstockungen in den Jahren 2008 und 2009 etwas verändert haben: quantitativ, aber nicht qualitativ.
• Um Genaueres über die allgemeine Belastung des Pflegepersonals in Krankenhäusern sagen zu können, berechnet das Statistische Bundesamt zwei Pflegedienstbelastungszahlen: die durchschnittliche Zahl der Behandlungsfälle je Pflegevollkraft pro Jahr und die durchschnittliche Zahl der zu versorgenden Betten je Pflegevollkraft pro Jahr.
• Die Anzahl der zu versorgenden Betten fiel von 504 im Jahr 1997 auf 474 im Jahr 2004 und bewegte sich von diesem Wert auf 479 im Jahr 2007 - was insgesamt einer Verringerung von 5% entsprach.
• Die Zahl der Behandlungsfälle pro Pflegevollkraft nahm im selben Zeitraum von 48 kontinuierlich auf 58 zu - was einer Erhöhung um 21% entsprach.
• Zusätzlich zu dem was der letzte Indikator zur Verdichtung der Pflegearbeit zeigt, stellt das höhere werdende Alter der KrankenhauspatientInnen einen zweiten Verdichtungsfaktor dar. 1997 waren rund 32% von ihnen 65 Jahre und älter, 2007 bereits 43%. Auch wenn nicht automatisch alle älteren Personen multimorbide sind oder weniger Selbstversorgungsfähigkeit haben als Jüngere, nimmt der Anteil der deswegen zeitlich und mental aufwändigeren PatientInnen in jedem Fall zu.
• 2007 arbeiteten nach den Daten des Mikrozensus rund 69% der Gesundheits- und Krankenpflegerinnen/-pfleger ständig, regelmäßig oder gelegentlich im Schichtdienst. Dies traf auf die Beschäftigten in Gesundheitsdienstberufen und in der Gesamtwirtschaft mit rund 17% und 14% wesentlich seltener zu. Pflegekräfte arbeiteten auch besonders häufig an Samstagen (85%), Sonn- und Feiertagen (84%) und nachts (58%).
• Der Anteil der Pflegekräfte mit Überstunden war mit knapp 22% dagegen ähnlich hoch wie bei allen Gesundheitsdienstberufen (21%) oder in der Gesamtwirtschaft (20%). Dies hängt wahrscheinlich direkt mit der höheren Anzahl von Teilzeitbeschäftigten unter den Pflegekräften zusammen.
• Die Frage, ob sie in den letzten 12 Monaten mindestens ein arbeitsbedingtes Gesundheitsproblem gehabt hätten, bejahten 16% der Pflegekräfte aber nur 6,4% und 6,5% der Beschäftigten in allen Gesundheitsdienstberufen und in der Gesamtwirtschaft.
• Als Hauptbelastungsfaktoren nannten alle drei Beschäftigtengruppen schwierige Körperhaltungen, Zeitdruck und Arbeitsüberlastung. Auch hier gab es deutliche Unterschiede zwischen Pflegekräften und den beiden anderen Beschäftigtengruppen. Den 35% der Pflegekräfte, die schwierige Körperhaltungen oder Hantieren mit schweren Lasten als Hauptbelastungen angaben, stehen 15% (Gesundheitsdienstberufe) und 7% (Gesamtwirtschaft) gegenüber. Ein ähnliches Bild ergibt sich bei der Belastung durch Zeitdruck: 33% der Pflegekräfte klagten darüber, aber "nur" 24% bei Beschäftigten in Gesundheitsdienstberufen und 15% in der Gesamtwirtschaft.
Das 4 Seiten umfassende STATmagazin "Krankenpflege - Berufsbelastung und Arbeitsbedingungen" des Statistischen Bundesamtes ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 29.8.09
Finnische Studie zeigt: "Burnout"-Syndrome sind häufig Vorboten und Warnsignale für Frühverrentungen
 Eine finnische Verlaufsstudie mit 3.125 Männern und Frauen im Alter von 30-60 Jahren hat jetzt gezeigt, dass "Burnout"-Syndrome häufig Vorboten vorzeitiger Verrentungen wegen Berufsunfähigkeit sind und daher im Betrieb auch als Alarmsignal und Hinweis auf einen Veränderungsbedarf gewertet werden sollten. Die einbezogenen Erwerbstätigen waren Teilnehmer an der sogenannten "Health 2000 Study", einer interdisziplinär angelegten epidemiologischen Studie in Finnland, bei der in den Jahren 2000-2001 verschiedene Daten bei einer repräsentativen Stichprobe 30-60jähriger Männer und Frauen gesammelt wurden. Dazu zählten zunächst einmal Informationen über psychische Störungen und körperliche Beeinträchtigungen, die anhand von Fragebögen gewonnen wurden.
Eine finnische Verlaufsstudie mit 3.125 Männern und Frauen im Alter von 30-60 Jahren hat jetzt gezeigt, dass "Burnout"-Syndrome häufig Vorboten vorzeitiger Verrentungen wegen Berufsunfähigkeit sind und daher im Betrieb auch als Alarmsignal und Hinweis auf einen Veränderungsbedarf gewertet werden sollten. Die einbezogenen Erwerbstätigen waren Teilnehmer an der sogenannten "Health 2000 Study", einer interdisziplinär angelegten epidemiologischen Studie in Finnland, bei der in den Jahren 2000-2001 verschiedene Daten bei einer repräsentativen Stichprobe 30-60jähriger Männer und Frauen gesammelt wurden. Dazu zählten zunächst einmal Informationen über psychische Störungen und körperliche Beeinträchtigungen, die anhand von Fragebögen gewonnen wurden.
Besonderes Interesse galt jedoch Indikatoren für ein "Burnout"-Syndrom. Gemessen wurde dies mit einem speziellen Fragebogen, dem "Maslach Burnout Inventory-General Survey", dem am häufigsten verwendeten Instrument zur Erfassung des Ausgebranntseins. Dieser erfasst mit insgesamt 16 Fragen drei unterschiedliche Aspekte des Burnout: Erschöpfung (z.B. "Am Ende eines Arbeitstages fühle ich mich ausgelaugt"), Zynismus ("In Bezug auf meine Arbeit empfinde ich mittlerweile kaum noch Begeisterung") und verminderte berufliche Effektivität ("Ich glaube, dass ich gut bin in meinem Beruf"). Alle Fragen sind auf einer siebenstufigen Skala von 0 (niemals) bis 7 (täglich) einzustufen.
All diese Informationen wurden dann mit offiziellen staatlichen Daten zu Verrentungen und Rentenursachen aus dem Jahre 2004 verknüpft. Zunächst zeigte sich, dass von den Teilnehmern 113 Personen vorzeitig verrentet worden waren:
• 22% derjenigen, die 2000/2001 schwere Anzeichen eines Burnout gezeigt hatten,
• 6% mit mildem Burn out und
• 2% der Personen ohne Hinweise auf ein Erschöpfungssyndrom.
In einer multivariaten Analyse, bei der viele gesundheitliche und sozialstatistische Merkmale mitberücksichtigt wurden (unter anderem: Alter Geschlecht, Familienstand, Stellung im Beruf, Branche und Wirtschaftsbereich der Erwerbstätigkeit, psychische Störungen sowie körperliche Beeinträchtigungen und Erkrankungen zu Beginn der Studie) zeigte sich dann: Für jeden Anstieg auf der Burnout-Skala um 1 Punkt ergibt sich ein um 49% erhöhtes Risiko für eine vorzeitige spätere Verrentung aus gesundheitlichen Gründen. Als besonders vorhersagekräftig erwies sich dabei die Teilskala "Erschöpfung". Die häufigsten Krankheitsursachen der Frühverrentungen waren "muskulo-skeletale" Erkrankungen (z.B. Wirbelsäulenerkrankungen, Arthrose) und psychische Störungen.
Die Erfassung von Burnout-Indikatoren und speziell von Erschöpfungs-Gefühlen noch während der Erwerbstätigkeit wäre nach Ansicht der Wissenschaftler ein sehr zuverlässiges Instrument, um überhöhte berufliche Belastungen (bzw. so von Arbeitnehmern erlebte Anforderungen) frühzeitig zu identifizieren und nach Wegen zu suchen, um Beschäftigte bis zum normalen Rentenalter in der Erwerbstätigkeit zu behalten. Sie empfehlen in der Diskussion ihrer Befunde sogar, Beschäftigte regelmäßig auf Burnout-Indikatoren durch betriebliche Gesundheitsdienste überprüfen zu lassen, um so die gesellschaftlichen Kosten von Frühverrentungen zu reduzieren und Arbeitnehmern eine langfristige Teilhabe an der Erwerbstätigkeit zu ermöglichen.
Kostenloses Abstract: K Ahola, R Gould, M Virtanen, T Honkonen, A Aromaa, J Lönnqvis: Occupational burnout as a predictor of disability pension: a population-based cohort study (Occupational and Environmental Medicine 2009;66:284-290doi:10.1136/oem.2008.038935)
Gerd Marstedt, 23.8.09
Unterschätzte Risiken und überschätzte Wirksamkeit präventiver Maßnahmen im Arbeitsschutz - Das Beispiel Lärm
 Die in der Kommunikation über Gesundheitsrisiken der Arbeitswelt gerade boomenden psychischen Belastungen erzeugen den Eindruck, es gäbe kaum mehr traditionelle Arbeitsbelastungen und daraus resultierende gesundheitliche Risiken und die Prävention wäre dort rundum wirksam. Ein genauerer Blick lohnt sich aber immer noch. Neuere Veröffentlichungen über den Lärm an Arbeitsplätzen und die Wirklichkeit des Schutzes gegen Lärmschäden zeigen nämlich: Der Anteil von Beschäftigten, die unter Lärm arbeiten müssen, steigt in diesem Jahrzehnt sogar wieder an und die Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen wird erheblich durch falsche Benutzung bzw. zu geringe Nutzungsübungen eingeschränkt.
Die in der Kommunikation über Gesundheitsrisiken der Arbeitswelt gerade boomenden psychischen Belastungen erzeugen den Eindruck, es gäbe kaum mehr traditionelle Arbeitsbelastungen und daraus resultierende gesundheitliche Risiken und die Prävention wäre dort rundum wirksam. Ein genauerer Blick lohnt sich aber immer noch. Neuere Veröffentlichungen über den Lärm an Arbeitsplätzen und die Wirklichkeit des Schutzes gegen Lärmschäden zeigen nämlich: Der Anteil von Beschäftigten, die unter Lärm arbeiten müssen, steigt in diesem Jahrzehnt sogar wieder an und die Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen wird erheblich durch falsche Benutzung bzw. zu geringe Nutzungsübungen eingeschränkt.
Ein Ergebnis der fünften und jüngsten Welle der mit rund 20.000 TeilnehmerInnen im Alter von 15 Jahren und älter und mit einer Arbeitszeit von mindestens 10 Stunden pro Woche größten Erwerbstätigenbefragung Deutschlands, der so genannten IAB/BiBB-Befragung, lautet: Der Anteil von Beschäftigten, der angibt, unter Lärm zu arbeiten, ist nach einem Rückgang Ende der 90er Jahre (22%) im Vergleich zu den 80er Jahren (26%) wieder angestiegen. Im Jahr 2005/2006 gaben 24% der Befragten an, häufig oder manchmal unter Lärm zu arbeiten und 54% fühlten sich durch die wahrgenommene Belastung auch wirklich belastet. Nur noch die klassischen, überwiegend physischen Belastungen der Arbeit im Stehen oder Sitzen, bestimmten das Belastungspanorama von Erwerbstätigen mehr. Und nur durch Erschütterungen oder Rauche, Stäube und Gasse fühlten sich ArbeitnehmerInnen noch mehr belastet als durch Lärm.
In derselben Befragung wird aber auch die Existenz von eher psychischen Anforderungen und die dadurch bedingten Belastungen dokumentiert: 54% der Befragten geben Termin- und Zeitdruck als häufige Anforderung an und 59% dieser Erwerbstätigen nehmen dies auch als Belastung wahr. Für die häufige Unterbrechung der Arbeit durch Kollegen etc. lauten die Werte 46% und 60%.
Wie eine andere aktuelle Untersuchung zeigt, wird aber nicht nur die Weiterexistenz der klassischen Arbeits- oder Umweltbelastung Lärm unterschätzt, sondern auch die Wirksamkeit der ebenfalls traditionellen Schutzmethoden. Beides zusammen könnte dazu führen, dass die Anzahl der Erwerbstätigen, die an Lärmfolgen zu leiden haben eher steigt als sinkt.
In der Studie "Schalldämmung von Gehörschützern in der betrieblichen Praxis" wurde zwischen 2005 und 2007 die tatsächliche Wirkung von Gehörschutz und damit dessen präventiver Nutzen genauer untersucht. Der Untersuchung lag das Ergebnis einer früheren nationalen Untersuchung aber auch von internationalen Untersuchungen zugrunde, dass die eingesetzten Gehörschutzmittel beim betrieblichen Einsatz oft eine geringere Schalldämmung als in der so genannten "Baumusterprüfung" erreichen. Letztere bestimmt aber, welchen Dämmnutzen der Hersteller des jeweiligen Produkts deklariert und was letztlich die Nutzer des Produkts an Dämmwirkung erwarten.
In Deutschland trat außerdem im März 2007 die Lärm- und Vibrationsarbeitsschutzverordnung in Kraft. Sie legt nicht nur fest, dass die maximale Tagesbelastung durch Lärm 85 Dezibel (A) nicht überschreiten darf, sondern sie fordert erstmals auch, dass die dämmende Wirkung des Gehörschutzes hierbei berücksichtigt sein muss, und zwar für jede Person und jede Situation.
Daher initiierte der Arbeitskreis "Gehörschutz" im Fachausschuss "Persönliche Schutzausrüstung" der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) eine Untersuchung, um die in der Praxis tatsächlich erreichte Schalldämmung von Gehörschutz zu ermitteln. In Zusammenarbeit mit mehreren Berufsgenossenschaften wurde in verschiedenen Industriebereichen die Schalldämmung dort verwendeter Gehörschützer gemessen. Für alle Produkte ergab sich in der Praxis im Mittel eine geringere Schalldämmung als in den Labormessungen.
Am deutlichsten ist der Effekt bei Gehörschutzstöpsel, die vor ihrem Gebrauch in die richtige Form zu bringen sind. Der im Anwendungsalltag gemessene Wert durchschnittlich um 7,8 dB ab, d.h. ein nicht unwesentlicher Teil des Umgebungslärms wird nicht gedämmt, sondern erreicht das Hörorgan des Hörschutzträgers. Andere Stöpselvarianten weisen mit 5,0 dB und 4,5 dB geringere Unterschiede auf. Für Kapselgehörschützer ergibt sich eine Differenz von Labor- und Alltagswert von 3,0 dB, für individuell angepasste Otoplastiken (dies sind Formpassstücke, die ins Ohr eingesetzt werden) ein Wert von 6,0 dB.
Da zwischen gehörschädigender und nichtschädigender Exposition gegenüber Lärm oftmals nur wenige Dezibel liegen, kann jede der Differenzen zu unerwünschten Folgen führen. Zusätzlich zu dem Dauerproblem des Arbeitsschutzes, ArbeitnehmerInnen überhaupt zum Tragen von Schutzmitteln zu motivieren bzw. das Tragen organisatorisch zu erleichtern, müssen also auch noch die genauen Umstände des Gebrauchs beachtet werden.
Um die Benutzung von Gehörschutz in der Praxis zu verbessern, sollten daher Beschäftigte bei Unterweisungen im Betrieb oder bei der arbeitsmedizinischen Vorsorge auf die erforderliche Sorgfalt beim Ein- und Aufsetzen von Gehörschutz hingewiesen und dessen Gebrauch regelmäßig geübt (empfohlen werden von Experten vier Übungen pro Jahr) werden. Dies gilt insbesondere, wenn vor Gebrauch zu formende Gehörschutzstöpsel verwendet werden.
Da auch bei anderen Arbeitsschutzmitteln und -maßnahmen wie beispielsweise Schutzbrillen, Masken oder Bildschirmen der Nutzungsalltag oft anders aussieht als es Laborwerte unterstellen, bedarf es eigentlich auch im Arbeitsschutzbereich einer systematischeren Anwendungsforschung und mehr als technisch perfekter Bedienungsanleitungen.
Einen Überblick zu den Ergebnissen der IAB/BiBB-Erwerbstätigenbefragung liefert der 18-Seiten-Aufsatz "Arbeitsbedingungen in Deutschland - Belastungen, Anforderungen und Gesundheit" von Beate Beermann, Frank Brenscheidt und Anke Siefer, der kostenlos erhältlich ist und Hinweise auf und Links zu weiteren Auswertungen der Befragung enthält.
Die 82 Seiten umfassende Studie "Schalldämmung von Gehörschützern in der betrieblichen Praxis- Studie von 2005 bis 2007" ist als Heft 4/2008 des BGIA-Reports erschienen und ebenfalls kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 28.7.09
Gesundheitsförderung für Krankenhausärzte und in Krankenhäusern - Fehlanzeige!
 Anders als man dies vielleicht in oder von einer Einrichtung der Gesundheitsversorgung und bei Ärzten erwartet: "Erstens ist die Arbeitsbelastung der Krankenhausärzte ... vergleichsweise hoch. Zweitens gibt es trotz einer Reihe positiver Ansätze ein Verbreitungs- und Umsetzungsdefizit vor allem für ausgewählte verhaltenspräventive wie verhältnispräventive Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung im Krankenhaus. Und drittens beeinflussen Maßnahmen des betrieblichen Gesundheits- und Qualitätsmanagements die Arbeitsbedingungen und die Gesundheit der Krankenhausärzte bislang kaum."
Anders als man dies vielleicht in oder von einer Einrichtung der Gesundheitsversorgung und bei Ärzten erwartet: "Erstens ist die Arbeitsbelastung der Krankenhausärzte ... vergleichsweise hoch. Zweitens gibt es trotz einer Reihe positiver Ansätze ein Verbreitungs- und Umsetzungsdefizit vor allem für ausgewählte verhaltenspräventive wie verhältnispräventive Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung im Krankenhaus. Und drittens beeinflussen Maßnahmen des betrieblichen Gesundheits- und Qualitätsmanagements die Arbeitsbedingungen und die Gesundheit der Krankenhausärzte bislang kaum."
Dies sind die drei wesentlichen Ergebnisse einer im Januar 2009 abgeschlossenen und von der Hans-Böckler-Stiftung geförderten Untersuchung der "Psychosoziale Arbeitsbelastungen, Patientenversorgung und betriebliche Gesundheitsförderung im Krankenhaus. - Eine Befragung von Ärzten und Krankenhäusern".
In dem gemeinsam von MitarbeiterInnen des Institut für Medizin-Soziologie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, des Düsseldorfer Deutschen Krankenhausinstituts und des Instituts für Medizinische Soziologie an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf durchgeführten empirischen Forschungsprojekt wurde sowohl eine Befragung von Krankenhausärzten als auch der Krankenhäuser, d.h. in der Regel der Krankenhausleitungen durchgeführt.
Die Grundgesamtheit der Ärztebefragung umfasste alle hauptamtlichen Krankenhausärzte in Allgemeinkrankenhäusern ab 100 Betten mit einer Fachabteilung für Chirurgie und/oder Gynäkologie bzw. Geburtshilfe (ohne Belegabteilungen). Das sind rund 31.000 Ärzte, die etwa 98% der stationär tätigen Ärzte beider Fachgebiete insgesamt ausmachen. Die bereinigte Ärztestichprobe umfasste 3.648 Ärzte, wovon 2643 aus einer chirurgischen und 1005 aus einer gynäkologischen Fachabteilung einbezogen wurden. Die Rücklauf-Stichprobe betrug auf der Arztebene 35,9%, was eine für Ärztebefragungen respektable Quote ist. Noch deutlich besser wird die Quote, wenn man nur die Ärzte rechnet, die aus Krankenhäusern stammten, die an der zusätzlichen Krankenhausbefragung teilnahmen. Von deren Ärzten antworteten immerhin 64,9%. Die Möglichkeit das Antwortverhalten von Ärzten und ihrem Krankenhaus aufeinander zu beziehen besteht selten, erhöht aber auch die Aussagekraft der Ergebnisse.
Die Krankenhausbefragung befasste sich mit dem Stand der betrieblichen Gesundheitsförderung und des Qualitätsmanagements in den Krankenhäusern. Ziel dieses Teilprojektes war es, Maßnahmen und Instrumente der betrieblichen Gesundheitsförderung und des Qualitätsmanagements in deutschen Krankenhäusern systematisch zu beschreiben.
Bereinigt wurden brutto 922 Krankenhäuser angeschrieben. Insgesamt antworteten 291 Krankenhäuser, einer Rücklaufquote von 31,6% entspricht. Die Ausschöpfungsquote fiel in der Krankenhausbefragung insofern merklich niedriger aus als in der Ärztebefragung.
Neben einer detaillierten Darstellung der eingangs zusammengefassten Ergebnisse beider Befragungen, versuchte das ForscherInnenteam auch Schlussfolgerungen zu ziehen und kam im Wesentlichen auf zwei: "Zum einen ist die Verbreitung und Wirksamkeit der betrieblichen Gesundheitsförderung im Krankenhaus insgesamt zu erhöhen. Zum anderen sind zielgruppenorientiert Gesundheitsförderungsmaßnahmen speziell für die Ärzteschaft zu entwickeln und umzusetzen."
Um mehr betriebliche Gesundheitsförderung aber wirklich implementieren zu können bedarf es mehr als reiner Appelle. Ob die stattdessen vorgeschlagene Entwicklung einer "gesundheitsförderlichen Unternehmenskultur und -organisation" sowie professionell und systematisch durchgeführeter einschlägiger Gesundheitsförderungsprojekte wirklich zum erwarteten "Ruck" in Sachen Gesundheitsförderung führt ist solange nicht zwingend wie man nicht genug weiß, welche Faktoren, Bedingungen, Akteure, Handlungsroutinen etc. zum aktuellen Zustand beigetreagen haben.
Immerhin kann "im Grundsatz auf das WHO-Konzept Gesundheitsfördernder Krankenhäuser verwiesen werden", das in wenigen Kliniken einige tatsächliche Veränderungen bewirkt hat.
So richtig in diesem Zusammenhang die Hinweise sind
• "das Krankenhaus" möge "eine nach Möglichkeit schriftlich festgelegte Gesundheitsförderungspolitik" entwickeln
• sowie "Strategie und Ziele der Gesundheitsförderung sowie operative Maßnahmen zur Zielerreichung" festlegen,
• die "Krankenhausleitung sowie die Bereichsleitungen" hätten "das betriebliche Gesundheitsmanagement aktiv zu unterstützen und konstruktiv zu begleiten" und eine "entsprechende Investitionsbereitschaft" zeigen,
• eine "spezifische Managementstruktur für die Gesundheitsförderung einrichten" und
• die "Mitarbeitervertretung oder ausgewählte Mitglieder davon partizipativ und aktiv in Veränderungsprozesse einzubinden" (was nach der Studie bisher kaum geschah),
so unklar bleibt fast durchweg, warum und wodurch dies eigentlich plötzlich geschehen oder möglich sein sollte.
Hilfreich ist aber sicherlich trotzdem der Vorschlag, die "Effektivität konkreter zielgruppenorientierter Veränderungsmaßnahmen" dadurch zu steigern, "dass die Gesundheitsförderung im Krankenhaus den Ärztlichen Dienst stärker als bislang in den Mittelpunkt stellt. ... Darüber hinaus sind die Ärzte stärker in das Projektmanagement im Rahmen der Gesundheitsförderung zu integrieren."
Eine Projektbeschreibung, weitere Einzelheiten und Links zu kostenlos erhältlichen projektbezogenen Publikationen finden sich im Rahmen der Projektübersicht der Hans Böckler Stiftung.
Bernard Braun, 19.7.09
Besser krank feiern als krank arbeiten - Das Problem "Präsentismus"
 Arbeiten trotz Krankheit ist zwar keineswegs ein neues Phänomen, aber in Zeiten wachsender Arbeitslosigkeit gewinnt es regelmäßig an Bedeutung. So auch in der aktuellen Debatte über die Folgen der weltweiten Finanzkrise für Deutschland. Die Frankfurter Rundschau titelte am 14. Juli 2009 "Das Tabu Krankheit" und nennt unterschiedliche Gründe für das aktuelle Rekordtief bei der Zahl der Krankschreibungen in Deutschland. Die Süddeutsche Zeitung weist in ihrem Artikel mit dem doppeldeutigen Titel "Das Ende der Knochenarbeit" auf den engen Zusammenhang zwischen Krankenstand und der Lage auf dem Arbeitsmarkt sowie des betrieblichen Klimas am Arbeitsplatz hin. Und unter dem taz-typisch gelungenen Titel "Angst macht 'gesund'" zeigt die tageszeitung, dass AOK-Bundesverband und Gesundheitsministerium den Zusammenhang zwischen Bedrohung des Arbeitsplatzes und krank arbeiten nicht so dramatisch sehen möchten, wie es wissenschaftliche Untersuchungen nahe legen.
Arbeiten trotz Krankheit ist zwar keineswegs ein neues Phänomen, aber in Zeiten wachsender Arbeitslosigkeit gewinnt es regelmäßig an Bedeutung. So auch in der aktuellen Debatte über die Folgen der weltweiten Finanzkrise für Deutschland. Die Frankfurter Rundschau titelte am 14. Juli 2009 "Das Tabu Krankheit" und nennt unterschiedliche Gründe für das aktuelle Rekordtief bei der Zahl der Krankschreibungen in Deutschland. Die Süddeutsche Zeitung weist in ihrem Artikel mit dem doppeldeutigen Titel "Das Ende der Knochenarbeit" auf den engen Zusammenhang zwischen Krankenstand und der Lage auf dem Arbeitsmarkt sowie des betrieblichen Klimas am Arbeitsplatz hin. Und unter dem taz-typisch gelungenen Titel "Angst macht 'gesund'" zeigt die tageszeitung, dass AOK-Bundesverband und Gesundheitsministerium den Zusammenhang zwischen Bedrohung des Arbeitsplatzes und krank arbeiten nicht so dramatisch sehen möchten, wie es wissenschaftliche Untersuchungen nahe legen.
Dabei hatte bereits 2005 eine Arbeitsgruppe um den finnischen Arbeitsmediziner Mika Kivimäki auf den Zusammenhang zwischen dem Erscheinen am Arbeitsplatz trotz Krankheit und Symptomen einer koronaren Herzkrankheit hingewiesen. Der Artikel von Mika Kivimäki, Jenny Head, Jane Ferrie, Harry Hemingway, Martin Shipley, Jussi Vahtera und Michael Marmot im American Journal of Public Health steht als Volltext kostenfrei zur Verfügung: Working While Ill as a Risk Factor for Serious Coronary Events: The Whitehall II Study.
Bereits Mitte 2008 ging ein Beitrag im Forum Gesundheitspolitik auf ein verwandtes Thema ein. Der Artikel Arbeitsunfähigkeitstage: Risikomarker von späterer Erwerbsunfähigkeit- oder Behinderungsrente stellte die Ergebnisse einer dänischen Studie vor, wonach Beschäftigte, die eine jährliche Arbeitsunfähigkeitsdauer von mehr als 6 Tagen angaben, hatten ein zweieinhalbfaches Risiko für den frühzeitigen Rentenbezug als die Befragten mit weniger oder gar keiner Arbeitsunfähigkeitszeit. Von den Betroffenen selber berichtete Arbeitsunfähigkeitstage sind folglich als Hinweis auf ein erhöhtes Frühberentungsrisiko für gefährdete Beschäftigte und Beschäftigtengruppen von Bedeutung.
Mit zwei arbeits- und sozialpolitisch bedeutsamen Artikeln trat kürzlich ein schwedisches Forscherteam an die Öffentlichkeit. In ihrem Artikel Sickness Presenteeism Today, Sickness Absenteeism Tomorrow? A Prospective Study on Sickness Presenteeism and Future Sickness Absenteeism untersuchen Gunnar Bergström, Lennart Bodin, Jan Hagberg, Gunnar Aronsson und Malin Josephson nun prospektiv, ob Präsentismus - also die Anwesenheit am Arbeitsplatz trotz Krankheit - Auswirkungen auf zukünftige krankheitsbedingte Fehlzeiten hat. Dazu verglichen sie zwei Studiengruppen mit unterschiedlichen Beschäftigungsbedingungen bzw. Arbeitsverhältnissen, nämlich eine von 3757 vorwiegend weiblichen ArbeitnehmerInnen im öffentlichen Dienst und eine vorwiegend männliche Kohorte von 2485 Angestellten im Privatsektor. Dabei stellte sich heraus, dass mehr als fünfmalige Anwesenheit am Arbeitsplatz trotz Krankheit in einem Jahr einen statistisch signifikanten Risikofaktor für über einmonatige Krankschreibungen im zweiten und dritten Folgejahr darstellte. Dieses Ergebnis hielt auch einer multivariaten Adjustierung nach Faktoren wie vorangehenden Krankschreibungen, Gesundheitsstatus, Alter, Geschlecht und beschäftigungsbezogenen Variablen stand, wobei das relative Risiko im Privatsektor etwas höher lag als im öffentlichen Dienst.
In ihrem Artikel Does sickness presenteeism have an impact on future general health?] analysieren Gunnar Bergström, Lennart Bodin, Jan Hagberg, Tomas Lindh, Gunnar Aronsson und Malin Josephson darüber hinaus die Auswirkungen von Präsentismus anderthalb und drei Jahre nach der jeweiligen Phase des krank Arbeitens. Dabei bestand zu beiden Zeitpunkten eine umgekehrte Korrelation zwischen der Häufigkeit, mit der Beschäftigte trotz Krankheit an ihrem Arbeitsplatz erschienen waren, und dem selbst wahrgenommenen bzw. berichteten Gesundheitszustand. In der abschließenden Diskussion schreiben die Autoren: "This suggests the emergence of sickness presenteeism as an issue to be considered not only from the perspective of lost productivity but also as a health issue for employers and the occupational health services, as well as other possible stakeholders. For instance, as earlier reported, some measures aimed at decreasing sickness absence may instead increase sickness presenteeism and, in the longterm, lead to detrimental health effects among employees, finally giving rise to more sickness absence."
Von dem Artikel Sickness Presenteeism Today, Sickness Absenteeism Tomorrow? A Prospective Study on Sickness Presenteeism and Future Sickness Absenteeism im Journal of Occupational and Environmental Medicine 51 (6), S. 629-638 ist nur das Abstract kostenfrei zugänglich. Das Gleiche gilt für die Anfang Juni erschienene zweite Publikation der Arbeitsgruppe um Gunnar Bergström, deren Abstract unter dem Titel Does sickness presenteeism have an impact on future general health? in den International Archives of Occupational and Environmental Health zu finden ist.
Vergleichbare Ergebnisse hatten kurz zuvor die beiden Arbeitsmediziner Claus Hansen und Johan Andersen aus Kopenhagen in einer breit angelegten Studie ermittelt. Bei dieser Untersuchung zeigte sich, dass der hohe Krankenstand bei Beschäftigten, die in einem Jahr ebenfalls mehr als sechs Mal trotz Erkrankung zur Arbeit gegangen waren, bereits im Folgejahr und nicht erst mit der Latenz wie in den schwedischen Studien zu beobachten war. Dazu befragten sie fast 12.000 dänische Arbeitnehmer zu Arbeits- und Familienverhältnissen sowie zum Arbeitsverhalten bei Krankheit. Auch von der dänischen Studie Sick at work - a risk factor for long-term sickness absence at a later date? ist nur das Abstract kostenfrei herunterzuladen.
Eine mögliche Erklärung für die erhöhte Morbidität von Arbeitsnehmern, die mehr als ein halbes Dutzend Mal pro Jahr trotz subjektiv bestehender Erkrankung zur Arbeit gehen, liefert eine frühere finnisch-britische Untersuchung eines Forscherteams um den Mika Kivimäki. Bei einer prospektiven Kohortenstudie mit 6895 männlichen und 3413 weiblichen Angestellten zwischen 35 und 55 Jahren, die in verschiedenen Regionen Großbritanniens im öffentlichen Dienst beschäftigt waren, hatte sich gezeigt, dass Beschäftigte mit mehr als fünf ärztlich begründeten Krankschreibungen im Jahr einem fast fünf Mal so hohen Sterberisiko ausgesetzt waren wie Arbeitnehmer ohne krankheitsbedingten Arbeitsunfall. Die Studie Sickness absence as a global measure of health: evidence from mortality in the Whitehall II study ist kostenfrei als Volltext im British Medical Journal herunterzuladen. Dieses Ergebnis bestätigt auch eine im Oktober 2008 im British Medical Journal erschienene Arbeit von Jenny Head, Jane Ferrie, Kristina Alexanderson, Hugo Westerlund, Jussi Vahtera, und Mika Kivimäki. Bei der Analyse der Daten der Whitehall-II-Längsschnittstudie zeigte sich, dass Arbeitnehmer mit mindestens einer Krankschreibung pro Jahr insgesamt ein 1,7-fach höheres Sterberisiko hatten als ihre Kollegen ohne krankheitsbedingten Arbeitsausfall. Und bei kardiovaskulären Erkrankungen war das Risiko sogar 4,7-mal so hoch! Von dem Artikel Diagnosis-specific sickness absence as a predictor of mortality: the Whitehall II prospective cohort study ist bisher nur das Abstract kostenfrei zugänglich.
Gerade bei der Gruppe von Arbeitnehmern mit schlechterem Gesundheitszustand oder gar chronischer Krankheit sind erhöhte Arbeitsausfälle in Folge des "krank Arbeitens" nicht sonderlich überraschend. Unabhängig davon sind diese Beobachtungen gesundheitspolitisch und im Hinblick auf den Arbeitsschutz überaus bedenkenswert und rufen zur Ergreifung präventiver Maßnahmen auf. Und sie zeigen einmal mehr, dass ökonomische Betrachtungen der Welt der großen Gefahr sind, externe Effekte zu unterschätzen oder gar ganz unter den Tisch fallen zu lassen. Die Empirie entlarvt die gängige und gerne wiederholte Aufforderung an alle Drückeberger und Simulanten in den blühenden Landschaften und Freizeitparks der sozialstaatlichen Republik als sehr gefährlichen Mythos: Weniger Krankschreibung bedeutet eben nicht unbedingt ein volkswirtschaftliches Mehr.
Jens Holst, 15.7.09
"Jobmotor" Gesundheitswesen? Jein!
 Wer oder was hinter der seit Jahren monstranzartig für alle möglichen Bewertungen und Prognosen zitierten Anzahl von 4,3 Millionen Beschäftigten im Gesundheitswesen steckt, die es auch für das aktuellste Berichtsjahr 2006 zu berichten gibt, stellt das Heft Nr. 46 der Gesundheitsberichterstattung des Bundes mit dem Titel "Beschäftigte im Gesundheitswesen" ausführlich dar. Außerdem bietet es einen Überblick über die Rahmenbedingungen für die verschiedenen Tätigkeitsfelder des Gesundheitspersonals; es befasst sich mit der Vielfalt der Berufe im Gesundheitswesen und den unterschiedlichen Einrichtungen. Besonderheiten der Beschäftigten hinsichtlich Alter, Geschlecht, Migrationserfahrung, und Arbeitszeiten werden ebenfalls unter die Lupe genommen.
Wer oder was hinter der seit Jahren monstranzartig für alle möglichen Bewertungen und Prognosen zitierten Anzahl von 4,3 Millionen Beschäftigten im Gesundheitswesen steckt, die es auch für das aktuellste Berichtsjahr 2006 zu berichten gibt, stellt das Heft Nr. 46 der Gesundheitsberichterstattung des Bundes mit dem Titel "Beschäftigte im Gesundheitswesen" ausführlich dar. Außerdem bietet es einen Überblick über die Rahmenbedingungen für die verschiedenen Tätigkeitsfelder des Gesundheitspersonals; es befasst sich mit der Vielfalt der Berufe im Gesundheitswesen und den unterschiedlichen Einrichtungen. Besonderheiten der Beschäftigten hinsichtlich Alter, Geschlecht, Migrationserfahrung, und Arbeitszeiten werden ebenfalls unter die Lupe genommen.
Charakteristisch für das Gesundheitspersonal sind eine hohe Frauenquote (72,3% mit Ausnahme bei den Ärzten und Zahnärzten mit 40% und 38,7%), die Arbeit in Schicht- und Nachtdiensten sowie an Wochenenden und Feiertagen und ein hoher Anteil an Teilzeitbeschäftigten (10% der Männer und 35,9% der Frauen). Differenzierte fachliche Kenntnisse und Fähigkeiten sowie eine eng an den Bedürfnissen der Patienten ausgerichtete Kooperation der Berufsgruppen bilden die Basis für eine gute Versorgung.
Aus beschäftigungs- oder arbeitsmarktpolitischer Sicht haben die 284.000 praktizierenden Ärzte im Jahr 2006 für die medizinische Versorgung eine besondere Bedeutung. Sie behandeln nicht nur selbst Patienten, sondern einbeziehen auch weitere Beschäftigte im Gesundheitswesen bei Diagnose, Therapie und Prävention mit ein und verordnen Leistungen Dritter, darunter die von Krankenhäusern, Apotheken, Heilmittel-Kaufhäuser oder Pharmaherstellern mit ihren zahlreichen Beschäftigten. Fast die Hälfte der Ärzte ist ambulant tätig. Die Alterung der Ärzte schreitet stark voran. Zwischen 1997 und 2006 nahm dort die Zahl 50-Jähriger und Älterer um 37% zu. Schwer abschätzbar sind darüber hinaus zukünftige Migrationsbewegungen von Ärzten.
Die mit Abstand häufigsten Berufe sind Gesundheits- und Krankenpflegerinnen/-pfleger (717.000) und die medizinischen und zahnmedizinischen Fachangestellten (522.000) im Jahr 2006. Im Laufe von zehn Jahren hat die Zahl der Altenpflegerinnen und Altenpfleger stark zugenommen auf inzwischen 321.000. Dies kann auf die Alterung der Gesellschaft und zunehmende Professionalisierung der Altenpflege nach Einführung der Pflegeversicherung zurückgeführt werden.
Zu den Vorzügen dieses Heftes zählt, dass das Statistische Bundesamt über seine Gesundheitspersonalrechnung alle verfügbaren Daten zur Ermittlung der Beschäftigten zusammenführt, zum Beispiel aus dem Mikrozensus und der Krankenhausstatistik des Bundesamtes, aus Datenquellen der Bundesanstalt für Arbeit oder der Bundesärztekammer.
Zu den für die weitere Debatte über den "Jobmotor" Gesundheitswesen wichtigen Ausführungen des GBE-Heftes gehören beispielsweise:
• Die einschränkenden Alternativdaten zur reinen "Job"-Zählerei: "Die Zahl der Vollzeitäquivalente im Gesundheitswesen betrug im Jahr 2006 rund 3,3 Millionen. Die Zahl der Vollzeitäquivalente sank von 1997 bis 2006 um 31.000 oder - 0,9 %. Obwohl seit 1997 ein Anstieg des Gesundheitspersonals um rund 198.000 Beschäftigte zu verzeichnen ist (+ 4,8 %), zeigen die Vollzeitäquivalente, dass das Beschäftigungsvolumen insgesamt leicht rückläufig ist."
• "Die Analyse des Gesundheitspersonals nach Berufen bzw. Berufsgruppen hat kontinuierliche Beschäftigungsanstiege vor allem in den Gesundheitsdienstberufen und sozialen Berufen deutlich gemacht. Einrichtungsbezogen galt dies für die Einrichtungen der stationären und teilstationären bzw. ambulanten Pflege. Allgemeine Prognosen über die Entwicklung der Zahl der Beschäftigten im Gesundheitswesen lassen sich jedoch schwer treffen, da viele Einflussfaktoren in ihrer Wirkung nicht abgeschätzt werden können."
• Die ausführlichen Darstellungen zur Wochenend-, Abend- und Nachtarbeit vieler Gesundheitsbeschäftigten werden hier als exemplarisch für das spezifische Arbeitsbelastungsspektrum dieser Berufstätigen etwas ausführlicher dargestellt: "In sozialen Berufen leisteten 81,2 % der Beschäftigten im Jahr 2006 ständig, regelmäßig oder gelegentlich Samstagsarbeit. Bei den Gesundheitsdienstberufen waren es über die Hälfte, insbesondere Ärztinnen und Ärzte (75,0 %) und Apothekerinnen und Apotheker (81,3 %). Zudem waren von der Samstagsarbeit über 80 % der Gesundheits- und Krankenpflegerinnen/-pfleger sowie Hebammen und Entbindungspfleger, Gesundheits- und Krankenpflegehelferinnen/-helfer, Altenpflegerinnen und Altenpfleger und Augenoptikerinnen und Augenoptiker betroffen. Vergleichsweise hierzu betrug der Anteil der Beschäftigten in der Gesamtwirtschaft 48,4 %."
• "Ähnlich wie bei der Samstagsarbeit war auch der Anteil derjenigen Beschäftigten, die ständig, regelmäßig oder gelegentlich sonn- bzw. feiertags arbeiteten, bei den Ärztinnen und Ärzten, Gesundheits- und Krankenpflegerinnen/-pflegern sowie Hebammen und Entbindungspflegern, Gesundheits- und Krankenpflegehelferinnen/-helfern, Altenpflegerinnen und Altenpflegern mit 71 % bis 85 % besonders hoch. Zum Vergleich arbeiteten 28,2 % der Beschäftigten in der Gesamtwirtschaft an Sonn- bzw. Feiertagen."
• "Ähnliches gilt für die ständige, regelmäßige oder gelegentliche Arbeit in den Abendstunden, d. h. zwischen 18 und 23 Uhr. Auch hier hoben sich die sozialen (73,2 %) und Gesundheitsdienstberufe (61,9 %) im Jahr 2006 durch einen überdurchschnittlichen Anteil hervor. In der Gesamtwirtschaft erbrachten 45,7 % der Beschäftigten ihre Arbeit auch in den Abendstunden. Von Abendarbeit waren wiederum Ärztinnen und Ärzte, Gesundheits- und Krankenpflegerinnen/-pfleger sowie Hebammen und Entbindungspfleger, Gesundheits- und Krankenpflegehelferinnen/-helfer, Altenpflegerinnen und Altenpfleger am häufigsten betroffen (70 % bis 82 %)."
• "Nachtarbeit zwischen 23 und 6 Uhr musste sowohl im Gesundheitswesen als auch in der Gesamtwirtschaft von deutlich weniger Beschäftigten geleistet werden als Samstags-, Sonntags-, Feiertags- und Abendarbeit. Dabei leisteten im Jahr 2006 die Gesundheitsdienstberufe am häufigsten ständig, regelmäßig oder gelegentlich Nachtarbeit (31,8 %) und hier speziell die Ärztinnen und Ärzte, Gesundheits- und Krankenpflegerinnen/-pfleger sowie Hebammen und Entbindungspfleger zu über 55 %. In der Gesamtwirtschaft waren es 15,2 % der Beschäftigten."
Was leider etwas zu kurz kommt, ist eine intensivere Darstellung anderer als der klassischen physischen oder organisatorischen Arbeitsbelastungen wie etwa die unter dem Druck der Ökonomisierung und Demographie beklagte Arbeitsverdichtung oder die tendenzielle Dissonanz von professionellen und ethischen Normen der Berufstätigen mit ihren tatsächlichen Arbeitsbedingungen.
Das 2009 erschienene Heft 46 der "Gesundheitsberichterstattung des Bundes - Beschäftigte im Gesundheitswesen"
von Anja Afentakis und Karin Böhm vom Statistischen Bundesamt in Bonn umfasst 46 Seiten erhält und man erhält es kostenlos als PDF-Datei oder in Papierform beim Robert-Koch-Institut (RKI)
Bernard Braun, 9.7.09
Studie mit über 50.000 Erwerbstätigen zeigt: Überdurchschnitt lange Arbeitszeiten beeinträchtigen die Gesundheit
 Schlafstörungen bei Erwerbstätigen werden mitverursacht durch lange Arbeitszeiten und ebenso steigt das Risiko anderer gesundheitlicher Beeinträchtigungen wie Rückenschmerzen und Herzbeschwerden bei überdurchschnittlich langen Arbeitszeiten. Dies sind Ergebnisse einer Studie der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA), die sich auf vier unterschiedliche Befragungen und Aussagen von über 50.000 Erwerbstätigen stützt. Bei der Auswertung der Umfragen ließ sich ein direkter Zusammenhang zwischen der Dauer der geleisteten Arbeitsstunden und der Häufigkeit gesundheitlicher Beschwerden (Schlafstörungen, Rückenschmerzen, Herzbeschwerden) nachweisen. Darüber hinaus zeigte sich, dass Faktoren wie Schichtarbeit, variable Arbeitszeiten und Arbeitsschwere sich verstärkend auswirken.
Schlafstörungen bei Erwerbstätigen werden mitverursacht durch lange Arbeitszeiten und ebenso steigt das Risiko anderer gesundheitlicher Beeinträchtigungen wie Rückenschmerzen und Herzbeschwerden bei überdurchschnittlich langen Arbeitszeiten. Dies sind Ergebnisse einer Studie der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA), die sich auf vier unterschiedliche Befragungen und Aussagen von über 50.000 Erwerbstätigen stützt. Bei der Auswertung der Umfragen ließ sich ein direkter Zusammenhang zwischen der Dauer der geleisteten Arbeitsstunden und der Häufigkeit gesundheitlicher Beschwerden (Schlafstörungen, Rückenschmerzen, Herzbeschwerden) nachweisen. Darüber hinaus zeigte sich, dass Faktoren wie Schichtarbeit, variable Arbeitszeiten und Arbeitsschwere sich verstärkend auswirken.
Schon seit längerem haben Arbeitswissenschaftler einen Zusammenhang zwischen langen Arbeitszeiten und gesundheitlichen Beschwerden vermutet. Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) führte deshalb eine Datenanalyse durch, die mehrere Stichproben einbezieht:
• die dritte und vierte europäische Umfrage über die Arbeitsbedingungen (2000 und 2005),
• die Befragung "Was ist gute Arbeit?" (2004)
• und die BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung (2006).
Damit flossen die Daten von insgesamt über 50.000 Befragten in die Untersuchung ein.
Die Auswertung der Daten zeigt beispielhaft den Zusammenhang zwischen der wöchentlichen Arbeitsdauer und drei gesundheitlichen Symptomen: Schlafstörungen, Rückenschmerzen und Herzbeschwerden. In allen vier Datensätzen lassen sich vergleichbare Strukturen erkennen in Form eines linearen Anstiegs der Beschwerdehäufigkeit in Abhängigkeit von der Dauer der Arbeitszeit.
Besonders deutlich machen dies die beiden untersuchten Umfragen aus Deutschland. Hier klagt nur jeder zehnte Befragte in Teilzeit (weniger als 19 Wochenarbeitsstunden) über Schlafstörungen, bei Beschäftigten in Vollzeit (zwischen 35 und 44 Wochenarbeitsstunden) ist es bereit jeder Fünfte. Im Bereich der Beschäftigten mit deutlich überlangen Arbeitszeiten von mehr als 60 Stunden pro Woche leidet nach eigenen Angaben sogar etwa jeder vierte unter Schlafbeschwerden. Faktoren wie Schichtarbeit, variable Arbeitszeiten, Arbeit an Wochenenden oder schlechte Planbarkeit der Arbeitszeit wirken sich verstärkend auf gesundheitliche Beeinträchtigungen aus.
Die Ergebnisse der vier untersuchten Stichproben zeigen so starke Übereinstimmungen, dass gesichert festgestellt werden kann: Längere Arbeitszeiten erhöhen das Risiko gesundheitlicher Beeinträchtigung. Die negativen Auswirkungen langer täglicher und wöchentlicher Arbeitszeiten auf das Unfallrisiko sind bereits seit einiger Zeit bekannt. In Diskussionen um Arbeitszeitverlängerungen sollte nach Ansicht der Wissenschaftler deshalb nicht nur auf die wirtschaftliche Komponente geschaut, sondern auch deren gesundheitlichen und sozialen Effekte berücksichtigt werden.
• Studie im Volltext: A. Wirtz, F. Nachreiner, B. Beermann, F. Brenscheidt, A. Siefer: Lange Arbeitszeiten und Gesundheit (BAUA 2009. 6 Seiten, PDF-Datei)
• Download auch von dieser Seite: "Lange Arbeitszeiten und Gesundheit"
Gerd Marstedt, 21.5.09
Das Vorgesetztenverhalten im Betrieb: Nicht nur ein Wohlfühl-Faktor, sondern bedeutsam für Gesundheit und Krankenstand
 Eine Meta-Analyse von 27 schon veröffentlichten Studien hat jetzt erneut deutlich gemacht, dass ein schlechter Führungsstil und ein autoritäres Vorgesetztenverhalten, das für Untergebene wenig Rücksichtnahme und soziale Unterstützung bietet, überaus kontraproduktiv ist für betriebliche Ziele: Beschäftigte, die mit solchen Vorgesetzten zusammenarbeiten müssen, haben einen schlechteren Gesundheitszustand, melden sich häufiger krank und müssen sich teilweise sogar aus gesundheitlichen Gründen frühverrenten lassen.
Eine Meta-Analyse von 27 schon veröffentlichten Studien hat jetzt erneut deutlich gemacht, dass ein schlechter Führungsstil und ein autoritäres Vorgesetztenverhalten, das für Untergebene wenig Rücksichtnahme und soziale Unterstützung bietet, überaus kontraproduktiv ist für betriebliche Ziele: Beschäftigte, die mit solchen Vorgesetzten zusammenarbeiten müssen, haben einen schlechteren Gesundheitszustand, melden sich häufiger krank und müssen sich teilweise sogar aus gesundheitlichen Gründen frühverrenten lassen.
Das finnische Forschungsteam, das seine Arbeitsergebnisse jetzt in der Zeitschrift "Journal of Occupational and Environmental Medicine" veröffentlichte, hat noch einmal 27 Studien ausgewertet, die in methodisch besonders fundierter Weise den Zusammenhang von Führungsstil und daraus folgenden gesundheitlichen Effekten untersucht hatten. Der Führungsstil wurde in den Studien mit unterschiedlichen Verfahren gemessen, gemeinsam war diesen jedoch, dass als positives Elemente des Vorgesetzten-Verhaltens Aspekte definiert wurden wie: Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit, Rücksichtnahme auf Untergebene, soziale Unterstützung, Motivierung zur Arbeit, Eröffnung von Chancen zur intellektuellen Weiterentwicklung.
Als Effekte wurden unterschiedliche Faktoren in den Studien untersucht: Arbeitszufriedenheit, psychische Gesundheit und Wohlbefinden, Arbeitsproduktivität und Leistung, Krankmeldungen, Frühverrentungen. Während sich für die Arbeitszufriedenheit und die Produktivität keine bzw. nur extrem schwache Zusammenhänge fanden, zeigten sich sehr viel deutlichere Einflüsse des Führungsstils auf die übrigen Indikatoren:
• Beschäftigte, die über einen guten Führungsstil ihres Vorgesetzten berichteten, wiesen mit einer 40 Prozent höheren Wahrscheinlichkeit auch bessere Werte auf bei Aspekten wie beruflicher Stress, Depressivität, Ängstlichkeit.
• Ähnliche Zusammenhänge zeigten sich auf für den Krankenstand (27 Prozent niedriger bei gutem Vorgesetztenverhalten) und Frühverrentungen (46 Prozent niedriger).
Hier ist ein Abstract der Studie, die auch sehr viele Literaturhinweise zum Thema "Führungsstil und Gesundheit" enthält: Kuoppala, Jaana u.a.: Leadership, Job Well-Being, and Health Effects-A Systematic Review and a Meta-Analysis (Journal of Occupational & Environmental Medicine. 50(8):904-915, August 2008)
Gerd Marstedt, 17.8.2008
WSI-Studie: Arbeitszeitregelungen mit hohen Gesundheitsrisiken nehmen seit den 90er Jahren erheblich zu
 Arbeitnehmer in Deutschland arbeiten zunehmend häufiger in Wechselschicht, nachts oder haben eine Arbeitszeit von deutlich über 40 Wochenstunden. Die damit verbundenen physischen und psychischen Belastungen stellen ein hohes Risiko für frühen Gesundheitsverschleiß dar. Eine Studie von Hartmut Seifert, Leiter des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der Hans-Böckler-Stiftung, hat jetzt deutlich gemacht, dass mit diesen Trends auch eine Umsetzung der Beschlüsse zum Renteneintritt mit 67 Jahren massiv gefährdet ist.
Arbeitnehmer in Deutschland arbeiten zunehmend häufiger in Wechselschicht, nachts oder haben eine Arbeitszeit von deutlich über 40 Wochenstunden. Die damit verbundenen physischen und psychischen Belastungen stellen ein hohes Risiko für frühen Gesundheitsverschleiß dar. Eine Studie von Hartmut Seifert, Leiter des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der Hans-Böckler-Stiftung, hat jetzt deutlich gemacht, dass mit diesen Trends auch eine Umsetzung der Beschlüsse zum Renteneintritt mit 67 Jahren massiv gefährdet ist.
Jeder sechste Neu-Rentner ging 2006 wegen verminderter Erwerbsfähigkeit in den Ruhestand. Diese hohe Quote könnte Bestand haben - denn mehr als die Hälfte der derzeit Beschäftigten erwartet, dass sie im höheren Alter kaum noch arbeitsfähig sein werden. "Sollten sich die Arbeitszeittrends der letzten Jahre fortsetzen, werden sich die Bedingungen für einen längeren Verbleib im Berufsleben verschlechtern", warnt Hartmut Seifert, Leiter des WSI. Vor allem die gleichzeitigen Trends von zu langer und atypisch gelegener Arbeitszeit während der Nacht und im Schichtbetrieb bringen höhere Belastungen mit sich.
Die Studie verweist einerseits auf längere Arbeitszeiten: Wer eine Vollzeitstelle hat, arbeitet zunehmend länger. Von 2002 bis 2007 stieg die durchschnittliche Wochenarbeitszeit um etwa 40 Minuten auf 40,3 Stunden. Fast jeder Dritte leistet 42 und mehr Stunden - obwohl die Effizienz nach der achten Arbeitsstunde deutlich abnimmt und das Unfallrisiko steigt. Seifert weist auf ein weiteres Problem hin: Nach einem langen Arbeitstag fällt es schwer, noch Zeit und Energie für Weiterbildung aufzubringen.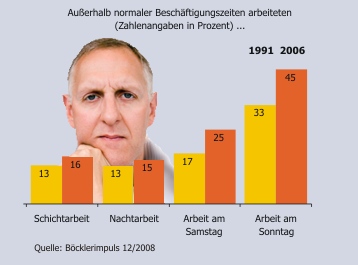
Von zunehmender Bedeutung sind aber auch atypische Arbeitszeiten: Seit den 90er-Jahren wächst der Anteil der Beschäftigten mit Wechselschichten spürbar. Jeder Siebte arbeitet nachts, jeder Sechste im Schichtdienst. Damit sind Risiken verbunden: "Nachtarbeit und Wechselschichtarbeit gefährden die Gesundheit. Schlafstörungen, Magen- und Verdauungsbeschwerden oder Herzschmerzen treten häufiger auf als bei Beschäftigten mit Normalarbeitszeit, die durchschnittliche Krankheitsdauer ist länger."
Wie sehen Arbeitsbedingungen aus, die Beschäftigten einen langen Verbleib im Erwerbsleben ermöglichen? Seifert zufolge ist es vorrangig, den Trend zu längeren Arbeitszeiten zu stoppen. Außerdem empfiehlt er, keine Anreize mehr zu setzen, sich phasenweise zu überarbeiten: Statt Geldzuschläge für Nacht- und Schichtarbeit wäre ein zügiger Freizeitausgleich denkbar. Auch die Altersteilzeit kann helfen, Belastungen zu dosieren. Und wer über Jahre nachts und in Schichten gearbeitet hat, sollte in den Genuss eines vorzeitigen Renteneintritts ohne Abschläge oder verminderte Arbeitszeiten kommen.
• Kurzfassung: "Trend zu ungesunden Arbeitszeiten" (Aufsatz in Böcklerimpuls 12/2008, 1 Seite)
• Langfassung: Hartmut Seifert: Alternsgerechte Arbeitszeiten (Aus Politik und Zeitgeschichte, APuZ 18-19/2008)
Gerd Marstedt, 27.7.2008
Freiburger Studie: Aggressionen und Beleidigungen von Schülern belasten Lehrer in ihrem Beruf am meisten
 Zwar ist die Frühverrentungs-Quote für Lehrer/innen, die in den 90er Jahren einmal bei 50 Prozent lag, jetzt zurück gegangen auf etwa 30 Prozent. Gleichwohl liegt sie damit immer noch erheblich über den Werten für andere Berufsgruppen und dokumentiert ein hohes Maß an psychischen und physischen Belastungen im Lehrerberuf. Auch andere Studien haben schon festgestellt, dass Lehrer ein Stress-Beruf ist. Mediziner der Freiburger Universitätsklinik haben jetzt aber erstmals analysiert, welche Faktoren es eigentlich sind, die schulische Lehrkräfte krank machen. Die Ergebnisse der Untersuchung wurden jetzt online vorab veröffentlicht in der Zeitschrift "International Archives of Occupational and Environmental Health".
Zwar ist die Frühverrentungs-Quote für Lehrer/innen, die in den 90er Jahren einmal bei 50 Prozent lag, jetzt zurück gegangen auf etwa 30 Prozent. Gleichwohl liegt sie damit immer noch erheblich über den Werten für andere Berufsgruppen und dokumentiert ein hohes Maß an psychischen und physischen Belastungen im Lehrerberuf. Auch andere Studien haben schon festgestellt, dass Lehrer ein Stress-Beruf ist. Mediziner der Freiburger Universitätsklinik haben jetzt aber erstmals analysiert, welche Faktoren es eigentlich sind, die schulische Lehrkräfte krank machen. Die Ergebnisse der Untersuchung wurden jetzt online vorab veröffentlicht in der Zeitschrift "International Archives of Occupational and Environmental Health".
Die Studie war Teil eines übergeordneten Projektes zur Gesundheitsförderung für Lehrer/innen, innerhalb dessen auch ein Manual zum unterstützenden Coaching für Lehrer ("Gesundheitsprophylaxe für Lehrkräfte - Manual für Lehrer-Coachinggruppen nach dem Freiburger Modell") entwickelt wurde. Unterstützt wurde die Studie von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Berlin.
Etwa 950 Lehrer an südbadischen Hauptschulen und Gymnasien wurden ausführlich befragt über ihre Arbeitsbedingungen: Stressfaktoren und Belastungen, aber auch Erfahrungen, die sie positiv stimmen. Offene Feindseligkeit, schwere Beleidigungen und Aggressivität, denen Lehrer/innen im Klassenzimmer von Schülerseite ausgesetzt sind, erwiesen sich als die stärksten Stress-Faktoren. Dabei wurde eine Reihe weiterer Einflussbedingungen (Alter, Geschlecht, familiäre Situation des Lehrers usw.) statistisch kontrolliert. Auch eine von Seiten der Eltern erlebte Aggressivität und Unzufriedenheit hatte einen signifikanten negativen Einfluss. Besonders dramatisch scheint die Situation an Hauptschulen zu sein, stellten die Freiburger Forscher fest: Dort erleben innerhalb eines Jahres mehr als 53% der Lehrkräfte, dass sie im Unterricht von Schülern schwer beleidigt oder aggressiv "angemacht" werden.
Die Freiburger Mediziner analysierten auch, welche Faktoren einen protektiven Effekt auf die Lehrergesundheit haben. Hier zeigte sich: Vor allem positive Rückmeldungen von Schülern oder Eltern, aber auch die gegenseitige Unterstützung, die sich Lehrkräfte innerhalb des Kollegiums einer Schule geben, sind von Bedeutung. Weibliche Lehrkräfte bleiben vor allem dann gesund, wenn das Klima im Kollegium gut ist, männliche Lehrkräfte profitieren vor allem davon, dass sie vonseiten ihrer Schulleitung Unterstützung erleben. Der Studienleiter Joachim Bauer kritisierte, dass alle derzeit von einigen Kultusministerien durchgeführte Untersuchungen zur gesundheitlichen Situation von Lehrerinnen und Lehrern das Thema der im Unterricht erlebten Aggressivität und Gewalt ausklammern. "Alle Standard-Fragebögen, mit denen derzeit an vielen Orten die gesundheitlichen Belastungen im Lehrerberuf erfasst werden, machen um das Thema eine große Kurve", so Bauer. "Unsere Untersuchung zeigt, dass Initiativen in Sachen Lehrergesundheit, die das Aggressions- und Gewaltpotential an Schulen nicht berücksichtigen, den wichtigsten Punkt außer Acht lassen, der Lehrer krank macht".
• Hier ist ein Abstract der Studie aus der Zeitschrift "International Archives of Occupational and Environmental Health": Thomas Unterbrink u.a.: Parameters influencing health variables in a sample of 949 German teachers
• Hier ist die Veröffentlichung im Volltext als PDF-Datei: Thomas Unterbrink u.a.: Parameters influencing health variables in a sample of 949 German teachers (Website der Universität Freiburg)
Gerd Marstedt, 11.7.2008
Ist das Risiko von Langzeit-Arbeitsunfähigkeit erkennbar und verhinder- oder minderbar? IGA: Theoretisch und praktisch ja!
 Die diversen auf der Analyse von Arbeitsunfähigkeitsdaten basierenden betrieblichen oder Branchen-Gesundheitsberichte einer Vielzahl von gesetzlichen Krankenkassen weisen durchweg auf die quantitative und qualitative Bedeutung der Langzeit-Arbeitsunfähigkeit hin.
Die diversen auf der Analyse von Arbeitsunfähigkeitsdaten basierenden betrieblichen oder Branchen-Gesundheitsberichte einer Vielzahl von gesetzlichen Krankenkassen weisen durchweg auf die quantitative und qualitative Bedeutung der Langzeit-Arbeitsunfähigkeit hin.
Diese Form der Arbeitsunfähigkeit (AU), in der Regel ein länger als 6 Wochen dauernder AU-Fall, betrifft zwar lediglich ca. 5 % aller AU-Fälle, löst aber rund 41 % aller AU-Tage aus. 2004 entstanden der GKV durch die für diese Versicherten anfallende Zahlung von Krankengeld nach Berechnungen der Betriebskrankenkassen ein Ausgabenposten von 6,4 Mrd. Euro oder Ausgaben von durchschnittlich 3.015 Euro pro Fall. Langzeit-AU konzentriert sich dabei auf relativ wenige Krankheitsarten. So folgte etwa ein Drittel aller Krankengeldausgaben aus Erkrankungen des Muskel- und Skelettsystems, 18 % aus Verletzungen/Vergiftungen und 13 % aus psychiatrischen Erkrankungen.
Aus den erwähnten Berichten und Forschungsarbeiten weiß man auch, dass Langzeit-AU von einer Vielzahl von Faktoren abhängt, zu denen vor allem das Lebensalter, der Sozialstatus sowie die Anzahl und Dauer des vorangehenden AU-Geschehens gehören. Von den 64 Milliarden Euro Krankengeldleistungen sind nach Schätzungen wenigstens 23 % auf arbeitsbedingte Belastungen zurückzuführen.
Ein großer Anteil der Langzeit-AU-Fälle kommt nicht aus dem Nichts, sondern baut sich über eine bestimmte und zum Teil regelhafte Reihe von kleineren Ereignissen und Erkrankungsepisoden auf, die direkt oder über Indikatoren zu beobachten sind. Eine Konstellation mit hohem prädiktivem Wert ist die Anzahl von AU-Fällen pro Jahr: Je mehr davon bei einer Person auftreten, desto wahrscheinlicher ist eine Langzeit-AU in den Folgejahren.
Beispielsweise zeigt der in der GEK-Edition "Schriften zur Gesundheitsanalyse" als Band 51 im Dezember 2006 veröffentlichte Sammelband "Vom Quer- zum Längsschnitt mit GKV-Daten", herausgegeben von Rolf Müller und Bernard Braun aus dem Zentrum für Sozialpolitik (ZeS) der Universität Bremen, im Aufsatz "Chronizität arbeitsbedingter Rückenbeschwerden am Beispiel von fünf Berufsgruppen" (Seite 103 ff.) von Melanie Zinke, Rolf Müller und Bernard Braun diese und andere Zusammenhänge konkret auf der Basis von GKV-Daten.
Zum Wert der Kenntnis einer regelmäßig größeren Anzahl von Arbeitsunfähigkeitstagen für die Prognose eines erhöhten Erwerbsunfähigkeits- oder Behinderungsrisikos gibt es außerdem verlässliche Belege. Die möglichst genaue und frühzeitige Kenntnis spezifischer personengruppen- oder arbeitsbereichsbezogener Risikoprofile hat somit einen hohen präventiven Nutzen für die betroffenen Personen, ihre Krankenversicherungen, Arbeitgeber und Rentenversicherungsträger.
Der im Mai 2008 erschienene 15-seitige IGA(Initiative Gesundheit und Arbeit)-Report 14 "Frühindikatoren für Langzeit-Arbeitsunfähigkeit Entwicklung eines Vorhersageinstruments für die Praxis in Betrieben und Krankenkassen" von Wolfgang Bödeker und Katja Zelen gibt einerseits einen kompakten Überblick über diese und andere Zusammenhänge von Erkrankungen und Langzeit-AU und die darauf beruhenden Analyse-Modelle. Zum anderen stellt der Report die Entwicklung, die Hauptindikatoren und den anwendungsbezogenen Nutzen eines elektronischen Instruments dar, das es technisch unaufwändig und nach Eingabe weniger Arbeitsunfähigkeitsdaten ermöglicht, das Risiko des weiteren gesundheitlichen Verschleisses abzuschätzen.
Die IGA wird getragen vom BKK Bundesverband, der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV), dem AOK-Bundesverband und dem Arbeiter-Ersatzkassen-Verband (AEV).
Der Bericht und das elektronische Prognoseinstrument entstand im Projekt "Vorhersagbarkeit von Langzeit-Arbeitsunfähigkeit" der IGA. Hier sollte ein Vorhersageinstrument von Langzeit-Arbeitsunfähigkeit für Unternehmen entwickelt werden, das ohne Rückgriff auf die Daten der Krankenkassen auskommt und daher z. B. im betriebsärztlichen Alltag eingesetzt werden kann. Den Versicherten werden vom Betriebsarzt einige Fragen zur Arbeitsunfähigkeit der Vorjahre gestellt. Aus den Antworten wird die Wahrscheinlichkeit errechnet, mit der eine künftige Langzeit-Arbeitsunfähigkeit zu erwarten ist. Der Betriebsarzt kann sodann bei den Beschäftigten mit hohem Risiko eine Ursachen bezogene Analyse beginnen. Die Analyse kann erkennen lassen, welche beruflichen oder außerberuflichen Belastungen im Kontext der drohenden Langzeit-Arbeitsunfähigkeit gesehen werden müssen und daher einer dringlichen Intervention bedürfen.
Die Entwicklung des Vorhersageinstruments begann mit einer Untersuchung, welche Faktoren eine Langzeit-Arbeitsunfähigkeit besonders beeinflussen. Im Folgenden soll daher zunächst die Bedeutung von Langzeit-Arbeitsunfähigkeit auch im Hinblick auf die zu Grunde liegenden Erkrankungen hervorgehoben werden. Sodann wird dargestellt, welche Zusammenhänge zwischen Langzeit-Arbeitsunfähigkeit und Arbeitsunfähigkeit in den Vorjahren bestehen. Schließlich wird beschrieben, wie auf der Grundlage dieser Ergebnisse das Vorhersageinstrument entwickelt wurde.
Für diese Untersuchungen wurden anonymisierte Arbeitsunfähigkeitsdaten von circa 56.000 Versicherten verwendet. Ein-bezogen wurden Versicherte, die über den Zeitraum von 2000 bis 2004 durchgehend versichert waren, so dass die Arbeitsun-fähigkeitsdaten längsschnittlich über einen Zeitraum von fünf Jahren vorlagen. Versicherte mit einer Langzeit-Arbeitsunfähigkeit im Jahre 2004 wurden den anderen Versicherten hinsichtlich des Arbeitsunfähigkeitsgeschehens der Vorjahre gegenübergestellt. Durch multiple logistische Regression wurden relative Langzeit-Arbeitsunfähigkeit-Risiken als Odds Ratios unter Adjustierung für verschiedene Störgrößen wie Alter und Sozialstatus geschlechtsspezifisch bestimmt. Die Stichprobe setzte sich zu 39 % aus Frauen zusammen. Circa die Hälfte der Versicherten war jünger als 40 Jahre, wobei im Vergleich der Geschlechter Männer durchschnittlich etwas älter waren. Bei beiden Geschlechtern verfügten mehr als die Hälfte über eine abgeschlossene Berufsausbildung ohne Abitur als höchsten Ausbildungsstand.
Die Modelle wurden in ein Excel-Programm überführt, das in der Praxis von Betrieben und Krankenkassen zur Vorhersage der Langzeit-Arbeitsunfähigkeit leicht angewendet werden kann. Die in eine Excelumgebung integrierte Eingabemaske erhebt neben Angaben zu Geschlecht, Alter und Ausbildungsstand auch die Informationen über das Arbeitsunfähigkeitsgeschehen in den letzten vier Jahren. Aus diesen Informationen wird anschließend die Wahrscheinlichkeit für eine künftige Langzeit-Arbeitsunfähigkeit geschätzt. Der Eingabemaske liegen die beschriebenen drei Modelle für Frauen und drei Modelle für Männer zugrunde, nämlich das minimale, das maximale und das optimal reduzierte Modell. Abhängig davon, welche Felder in der Eingabemaske ausgefüllt werden, wird das geeignete Modell ausgewählt und mit seiner Hilfe die individuelle Wahrscheinlichkeit für eine Langzeit-Arbeitsunfähigkeit geschätzt. Es müssen also nicht alle Informationen verfügbar sein bzw. erinnert werden.
Zeitgleich mit dem Ausfüllen der Eingabefelder wird eine Rückmeldung gegeben:
• Die Rückmeldung enthält zunächst die individuelle Wahrscheinlichkeit für eine Langzeit-Arbeitsunfähigkeit im nächsten Jahr.
• Diese Wahrscheinlichkeit wird in Relation zur Wahrscheinlichkeit der entsprechenden Alters- und Geschlechtsgruppe gesetzt. Das sich dadurch ergebende relative Risiko zeigt an, um wie viel höher oder geringer das Risiko für eine künftige Langzeit-Arbeitsunfähigkeit bei der betrachteten Person im Vergleich zu den Personen aus der gleichen Alters- und Geschlechtsgruppe ist.
• Die relativen Risiken werden in den folgenden Kategorien zusammengefasst und in einer Ampel visualisiert.
Das Programm ist lauffähig unter MS-Excel ab Version 2003. Die Autoren geben sicherheitshalber folgenden technischen Hinweis: "Um das Programm ausführen zu können, müssen gegebenenfalls Einstellungen geändert werden. Gehen sie dazu in MS-Excel unter "Extras" > "Optionen" auf das Blatt "Sicherheit" und klicken dort auf "Makrosicherheit". In dem sich dann öffnenden Fenster unter "Sicherheitsstufen" die Stufe "mittel" markieren. Mit dieser Einstellung lässt sich dann das Programm ausführen."
Den 215 Seiten umfassenden Sammelband "Vom Quer- zum Längsschnitt mit GKV-Daten" u.a. mit dem Aufsatz zur "Chronizität von Rückenbeschwerden" gibt es als PDF-Datei auf der Studienseite der Gmünder Ersatzkasse (GEK).
Der Report "Frühindikatoren für Langzeit-Arbeitsunfähigkeit Entwicklung eines Vorhersageinstruments für die Praxis in Betrieben und Krankenkassen" ist nur in elektronischer Form kostenlos herunterladbar.
Kostenlos erhältlich ist zur praktischen Übung und Anwendung auch das Excel-Programm "Vorhersage der Langzeit-AU im nächsten Jahr".
Bernard Braun, 15.6.2008
Psychische Belastungen in der Arbeitswelt: Burnout bei Ärzten, Frühpensionierungen bei Lehrern
 Ein neuer Bericht des Berufsverbands Deutscher Psychologinnen und Psychologen hat sich mit psychischen Belastungen in der Arbeitswelt und den gesundheitlichen Folgen beschäftigt. Die Veröffentlichung geht in mehreren Kapiteln auf sehr unterschiedliche Aspekte des Themas ein: Einzelne Berufsgruppen mit besonderen Belastungen (Ärzte, Lehrer und Lokführer), Arbeitslosigkeit und Angst vor Arbeitsplatzverlust, Frauen im Arbeitsleben, Konzepte und Maßnahmen zur betrieblichen Gesundheitsförderung.
Ein neuer Bericht des Berufsverbands Deutscher Psychologinnen und Psychologen hat sich mit psychischen Belastungen in der Arbeitswelt und den gesundheitlichen Folgen beschäftigt. Die Veröffentlichung geht in mehreren Kapiteln auf sehr unterschiedliche Aspekte des Themas ein: Einzelne Berufsgruppen mit besonderen Belastungen (Ärzte, Lehrer und Lokführer), Arbeitslosigkeit und Angst vor Arbeitsplatzverlust, Frauen im Arbeitsleben, Konzepte und Maßnahmen zur betrieblichen Gesundheitsförderung.
In einem einleitenden Kapitel von Eberhard Ulich wird darauf hingewiesen, dass die "psychischen und Verhaltensstörungen drastisch zunehmen. Ihr Anteil an den Ausfalltagen ist von 6,6% auf 10,5% angewachsen. Es wird geschätzt, dass allein die depressiven Verstimmungen bereits 2020 nach den Herzerkrankungen an zweiter Stelle stehen werden. Dieser Anstieg ist zu hoch, um sich aus der größeren Bereitschaft und Fähigkeit, eine psychische Störung als solche zu diagnostizieren, zu erklären." Ursachen liegen dem BDP-Bericht zufolge in Arbeitsbelastungen wie Zeitdruck, Komplexität der Arbeit und Verantwortung, fehlende Partizipationsmöglichkeiten, prekäre Arbeitsverhältnisse (Leiharbeit, Zeitarbeit), mangelnde Wertschätzung, Defizite im Führungsverhalten. "Wir haben in Deutschland nicht nur ein Problem mit Managergehältern, wir haben einen weit verbreiteten Mangel an Managerqualitäten, der sich auch in psychischen Problemen von Beschäftigten niederschlägt", erklärte BDP-Vizepräsidentin Thordis Bethlehem.
Heute ist es nicht mehr allein Arbeitslosigkeit, sondern darüber hinaus auch schon die permanente Sorge um den Arbeitsplatz, die zu erheblichen psychischen Belastungen führt. Arbeitsüberlastung, hoher Erfolgsdruck und Mangel an sozialer Anerkennung führen unter denen, die permanent um ihren Job fürchten, zu ausgeprägten sozialen Spannungen und chronischem Stress. Arbeitslose, so zeigte sich bei Untersuchungen, haben ein hohes Maß an körperlichen Beschwerden und eine besonders niedrige Lebensqualität. Kosteneinsparungen in Unternehmen und die daraus zum Teil erwachsende stärkere Arbeitsbelastung führen aber nicht nur zu einer höheren Zahl von Krankentagen aus psychischen Gründen, sondern verändern auch das Arbeitsklima: Intrigen und Mobbing nehmen zu.
Der Bericht widmet einzelnen Berufsgruppen mit besonderen Belastungen spezielle Aufmerksamkeit. Dazu gehören Ärzte, Lehrer und Lokführer. Mindestens 20 Prozent der Ärzte, heißt es im Bericht, leiden an einem Burnout-Syndrom, einer individuellen Reaktion auf berufliche Überforderung bzw. ungünstige Stressbewältigung, rund 10 Prozent an einer substanzbezogenen Störung. Die Suizidraten sind bei Medizinern bis zu 3-fach erhöht, bei Medizinerinnen bis zu 5-fach. Die Risikofaktoren für Lehrer liegen laut BDP-Bericht vor allem in der fehlenden Balance von Wollen, Sollen und Können. Die nach wie vor hohe Zahl von Frühpensionierungen (24%), insbesondere an Grund- und Hauptschulen, ist alarmierend.
Entschieden fordert der BDP ein nachhaltiges betriebliches Gesundheitsmanagement, geeignete Methoden bei der Personal- und Organisationsentwicklung und Präventionsprogramme, wie sie z.B. die Deutsche Bahn wegen des Traumatisierungsrisikos für Lokführer etabliert hat. Neue Arbeitsbedingungen, so heißt es, verlangen neue Fähigkeiten, z.B. die, widerstandsfähig gegenüber äußeren Belastungen und Krisensituationen zu sein. In den am Schluss des Berichts formulierten Empfehlungen für Politik und Wirtschaft fordert der Verband dazu auf, die bereits existierenden gesetzlichen Regelungen in Verwaltung und Wirtschaft endlich umzusetzen statt über steigende Gesundheitskosten zu lamentieren.
Hier ist der Bericht des Berufsverbands Deutscher Psychologinnen und Psychologen e.V.: Psychische Gesundheit am Arbeitsplatz in Deutschland (PDF, 84 Seiten)
Gerd Marstedt, 28.4.2008
Stress bei der Arbeit schadet der Gesundheit - ganz besonders bei Arbeitnehmern mit niedrigem beruflichem Status
 Stress bei der Arbeit durch eine hohe Arbeitsintensität, Zeit- und Termindruck sowie gleichzeitig fehlende Entscheidungsspielräume und soziale Unterstützung hat erhebliche Negativeffekte auf die Gesundheit der Beschäftigten - dies hat zuvor schon eine große Zahl von Untersuchungen empirisch gezeigt. Eine jetzt in der Zeitschrift "Journal of Epidemiology and Community Health" veröffentlichte deutsche Studie hat nun gezeigt, dass diese gesundheitlichen Beeinträchtigungen sich ganz besonders stark auswirken bei Arbeitnehmern mit niedriger Schulausbildung oder auch niedriger Stellung im Beruf.
Stress bei der Arbeit durch eine hohe Arbeitsintensität, Zeit- und Termindruck sowie gleichzeitig fehlende Entscheidungsspielräume und soziale Unterstützung hat erhebliche Negativeffekte auf die Gesundheit der Beschäftigten - dies hat zuvor schon eine große Zahl von Untersuchungen empirisch gezeigt. Eine jetzt in der Zeitschrift "Journal of Epidemiology and Community Health" veröffentlichte deutsche Studie hat nun gezeigt, dass diese gesundheitlichen Beeinträchtigungen sich ganz besonders stark auswirken bei Arbeitnehmern mit niedriger Schulausbildung oder auch niedriger Stellung im Beruf.
Basis der von Wissenschaftlern der Universitäten Düsseldorf, Essen und Halle durchgeführten Studie waren Befragungen von 1.749 berufstätigen Männern und Frauen im Alter von 45-65 Jahren, die Teilnehmer an einer größeren Kohortenstudie ("Heinz Nixdorf Recall Study") waren und in drei Städten im Ruhrgebiet lebten. Ausgeschlossen waren Arbeitnehmer, in deren Krankengeschichte Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorkamen. In der Befragung erfasst wurde eine große Zahl von Merkmalen: Neben Gesundheitsrisiken (wie Rauchen und körperliche Bewegung, Body-Mass-Index) waren dies Angaben zur Schulbildung und vor allem zum Gesundheitszustand. Dabei wurde eine Selbsteinstufung der Gesundheit ebenso erfasst wie Herzbeschwerden nach körperlicher Anstrengung oder auch Symptome einer depressiven Erkrankung.
Weiterhin wurde als wichtige unabhängige Variable der Arbeitsstress erhoben. Dieses Merkmal Stress bei der Arbeit wurde in der Studie sehr detailliert mit zwei verschiedenen Fragebögen erfasst, einmal nach dem theoretischen Konzept von Karasek, das Arbeitsanforderungen und Entscheidungsspielräume erfasst ("Demand-Control"), einmal nach einem von Siegrist entwickelten Fragebogen, in dem Anforderungen und Belastungen einerseits sowie "Belohnungen" (Respekt, Anerkennung, soziale Unterstützung durch Vorgesetzte und Kollegen) zu einander in Beziehung gesetzt werden ("Effort-Reward").
Als Ergebnis der multivariaten Analyse, in der Einflüsse aller Einflussfaktoren gleichzeitig berücksichtigt wurden, zeigte sich dann:
• Ein hohes Maß an beruflichem Stress zeigt hochsignifikante negative Einflüsse für alle untersuchten Indikatoren zum Gesundheitszustand (Selbsteinstufung, Herzbeschwerden, Depression)
• Diese Effekte sind jedoch besonders intensiv in den Gruppen mit niedrigem beruflichem Status, also bei Arbeitnehmern mit niedrigem Niveau der Schul- und Berufsausbildung bzw. niedriger Stellung im Beruf.
• Vergleicht man etwa die Wahrscheinlichkeit für gesundheitliche Beeinträchtigungen in den beiden Extremgruppen "einfache Arbeiter oder Angestellte" (Gruppe 1) und "leitende Führungskräfte" (Gruppe 2) miteinander, dann fällt dieses Risiko sehr unterschiedlich aus.
• Es beträgt für eine negative Bewertung des Gesundheitszustands 3.0 (Gruppe 1) bzw. 2.3 (Gruppe 2),
• für Herzbeschwerden nach körperlicher Anstrengung 2.2 bzw. 1.7 und
• für Depressionen 8.2 bzw. 2.6.
Die Studie macht einerseits deutlich, dass Stress und Arbeitsbelastungen auf allen betrieblichen Hierarchiestufen vorzufinden sind. Topmanager können ebenso wie Fließbandarbeiter unter Zeitdruck und hoher Arbeitsintensität leiden. Sie macht andererseits aber auch deutlich, dass die gesundheitlichen Negativeffekte noch einmal sehr viel drastischer ausfallen bei Beschäftigten auf unteren Stufen der Hierarchie - vermutlich deshalb, weil hier neben den Stressfaktoren auch noch andere Faktoren (Arbeitsplatzunsicherheit, geringe Verdiensthöhe) wirksam sind. Die Untersuchungsergebnisse sind jedenfalls nicht dadurch beeinflusst, dass Beschäftigte mit niedrigem beruflichem Status meist auch gesundheitsriskanter leben, denn diese Einflussfaktoren (Rauchen, körperliche Bewegung, Body-Mass-Index) wurden in den multivariaten Analysen statistisch kontrolliert.
Hier ist ein Abstract der Studie: N Wege, N Dragano1, R Erbel, K-H Jöckel, S Moebus, A Stang, J Siegrist: When does work stress hurt? Testing the interaction with socioeconomic position in the Heinz Nixdorf Recall Study (Journal of Epidemiology and Community Health 2008;62:338-341; doi:10.1136/jech.2007.062315)
Gerd Marstedt, 14.3.2008
Krankheit als Störfaktor im Betrieb: Fatales Zusammenspiel betrieblicher und individueller Umgangsweisen mit Gesundheitsproblemen
 Mit 3,3 Prozent war der Krankenstand in Deutschland 2006 auf einem historischen Tiefststand, Mitte der 1970er Jahren waren es noch 5,5 Prozent. Seitdem sind die Fehlzeiten kontinuierlich zurückgegangen. Die Ursachen für den Rückgang der Krankmeldungen sind jedoch kaum darin zu sehen, dass betriebliche Belegschaften immer gesünder werden, sondern eher in einem zunehmenden sozialen Druck in der Arbeitswelt durch veränderte Arbeitsstrukturen wie Selbstorganisation, Ergebnisverantwortung, Zielvereinbarungen, Gruppen-, Team- und Projektarbeit. "Krankheit wird zum Störfaktor, der ignoriert und oder ausgeblendet wird", konstatiert Dr. Stephan Voswinkel, der gemeinsam mit Dr. Hermann Kocyba ein von der Hans-Böckler-Stiftung gefördertes Projekt zur "Krankheitsverleugnung" durchgeführt hat. Und der Soziologe Dr. Hermann Kocyba stellt fest: "Der Rückgang der Fehlzeiten ist durchaus ambivalent: So kann beispielsweise Gruppenarbeit zur Reduktion von Fehlzeiten beitragen, weil Motivation und Arbeitszufriedenheit steigen, aber auch weil Gruppendruck und falsch verstandene Kollegialität dazu führen, krank zur Arbeit zu gehen."
Mit 3,3 Prozent war der Krankenstand in Deutschland 2006 auf einem historischen Tiefststand, Mitte der 1970er Jahren waren es noch 5,5 Prozent. Seitdem sind die Fehlzeiten kontinuierlich zurückgegangen. Die Ursachen für den Rückgang der Krankmeldungen sind jedoch kaum darin zu sehen, dass betriebliche Belegschaften immer gesünder werden, sondern eher in einem zunehmenden sozialen Druck in der Arbeitswelt durch veränderte Arbeitsstrukturen wie Selbstorganisation, Ergebnisverantwortung, Zielvereinbarungen, Gruppen-, Team- und Projektarbeit. "Krankheit wird zum Störfaktor, der ignoriert und oder ausgeblendet wird", konstatiert Dr. Stephan Voswinkel, der gemeinsam mit Dr. Hermann Kocyba ein von der Hans-Böckler-Stiftung gefördertes Projekt zur "Krankheitsverleugnung" durchgeführt hat. Und der Soziologe Dr. Hermann Kocyba stellt fest: "Der Rückgang der Fehlzeiten ist durchaus ambivalent: So kann beispielsweise Gruppenarbeit zur Reduktion von Fehlzeiten beitragen, weil Motivation und Arbeitszufriedenheit steigen, aber auch weil Gruppendruck und falsch verstandene Kollegialität dazu führen, krank zur Arbeit zu gehen."
Vor diesem Hintergrund haben sich die Wissenschaftler des Frankfurter Instituts für Sozialforschung mit dem Phänomen der Krankheitsverleugnung befasst: Nehmen Beschäftigte gesundheitliche Probleme und Belastungen nicht angemessen wahr und setzen sie ihre Prioritäten einseitig auf berufliche Belange? Das Projekt basiert auf Interviews mit Betriebsärzten, Mitarbeitern von Betriebskrankenkassen und sozialmedizinischen Beratungsstellen, mit in Gesundheitsfragen engagierten Betriebsräten, Vertauensleuten und Mitarbeitern von Personalabteilungen. Neben Unternehmen der Automobil- und Automobilzulieferindustrie bezogen die Forscher auch Unternehmen der chemischen Industrie, der IT- und Software-Industrie, des Finanzdienstleistungs- sowie des Krankenhausbereichs in ihre Studie ein.
Die Untersuchung belegt, dass Krankheitsverleugnung in der Regel auf einem fatalen Zusammenspiel betrieblicher und individueller Umgangsweisen mit Gesundheitsproblemen basiert. Bei den Beschäftigten sind verschiedene Formen der Krankheitsverleugnung anzutreffen: verschweigen, ignorieren, die Symptome nur begrenzt wahrnehmen, nicht zur Kenntnis nehmen, obwohl anderen die Krankheit bereits deutlich auffällt. Die erhöhte Identifikation mit der Arbeit und der steigende Erfolgsdruck hindern die Arbeitnehmer offensichtlich daran, sich arbeitsunfähig schreiben zu lassen, wenn dies nicht absolut "unumgänglich" ist. Gleichzeitig wächst der Zeit- und Termindruck, krankheitsbedingte Abwesenheit würde Kolleginnen und Kollegen stärker belasten und Terminzusagen gegenüber den Kunden gefährden.
Wie Unternehmen mit gesundheitlichen Belastungen umgehen, hat Auswirkungen auf das Verhalten des Einzelnen. Wenn Betriebe leugnen, dass Krankheitsursachen vielfach in der Arbeit und ihrer organisatorischen Gestaltung liegen, geschieht dies nach unterschiedlichen Mustern:
• Verantwortung wird abgewehrt; die Rahmenbedingungen ändern sich nicht, aber dem Einzelnen wird der Weg in den Vorruhestand geebnet (Opferfürsorge);
• Leistung und Personal sind so ausgelegt, dass jede Krankheit zu Funktionsproblemen führt (Ignorieren);
• es wird genau kontrolliert, wer wann krank ist, um den Betroffenen zu kontrollieren ("Jagd auf Kranke") oder
• bestenfalls ihm "kontrollierende Fürsorge" angedeihen zu lassen ("Anwesenheitsverbesserungsprozesse").
Ist ein Arbeitnehmer zwar physisch präsent, krankheitsbedingt aber nicht voll einsatzfähig und steckt möglicherweise auch noch Kollegen an, dann erweist sich die einseitige Ausrichtung an den Fehlzeiten nicht nur gesundheitspolitisch, sondern auch betriebswirtschaftlich als verkürzt.
Die Autoren der Studie plädieren für ein breiteres Verständnis betrieblicher Gesundheitspolitik. Denn Krankheitsverleugnung bedeute im Kern, dass ein angemessener Umgang mit Gesundheitsproblemen blockiert wird. Vor dem Hintergrund, dass es immer mehr ältere Arbeitnehmer gibt, müssen sich Unternehmen nicht nur Gedanken über eine alternsgerechte, sondern auch "krankheitsgerechte" Arbeitsgestaltung machen." Das Betriebsklima muss eine rechtzeitige und angemessene Auseinandersetzung mit Gesundheitsproblemen zulassen", so Kocyba.
• Hier ist eine PDF-Datei mit einem Aufsatz aus der Zeitschrift "Forschung Frankfurt 3/2007", der die wichtigsten Ergebnisse zusammenfasst: Störfaktor Krankheit - Warum der rückläufige Krankenstand das falsche Signal für betriebliche Gesundheitspolitik ist
Erst vor kurzem hatten Arbeitnehmer-Befragungen gezeigt, dass insgesamt 71 Prozent der Deutschen in den vergangenen zwölf Monaten mindestens einmal zur Arbeit gegangen sind, obwohl sie sich richtig krank gefühlt haben. 46 Prozent geben an, dies sogar zweimal oder öfter getan zu haben. Das zeigt die aktuelle Bevölkerungsbefragung des Gesundheitsmonitors der Bertelsmann Stiftung. Gegen den Rat ihres Arztes der Arbeit nachgegangen sind demnach im vergangenen Jahr 30 Prozent der Bevölkerung mindestens einmal, etwa die Hälfte davon sogar mehrmals.
• 7 von 10 Erwerbstätigen sind im letzten Jahr trotz Krankheit zur Arbeit gegangen
Gerd Marstedt, 21.1.2008
Schicht- plus Hausarbeit = erhöhtes Risiko von Frühberentung und Behindertenrente für Frauen!?
 Langjährige Schichtarbeit, also Arbeit zu ständig wechselnden Zeiten oder permanente Abend- oder Nachtarbeit, wurde bereits in vielen Stunden als eine Ursache für zahlreiche Erkrankungen identifiziert. Dazu gehören Herzerkrankungen, Brustkrebs, Geschwüre im Verdauungstrakt aber auch Probleme während der Schwangerschaft. Zu den möglichen Ursachen werden Stress, Schlafmangel oder -störungen und hormonelle Irritationen gezählt. Dabei zeigte sich auch, dass Wechsel- oder Nachtschichtarbeitende ein deutlich höheres Frühinvaliditätsrisiko haben als Tagschichtbeschäftigte.
Langjährige Schichtarbeit, also Arbeit zu ständig wechselnden Zeiten oder permanente Abend- oder Nachtarbeit, wurde bereits in vielen Stunden als eine Ursache für zahlreiche Erkrankungen identifiziert. Dazu gehören Herzerkrankungen, Brustkrebs, Geschwüre im Verdauungstrakt aber auch Probleme während der Schwangerschaft. Zu den möglichen Ursachen werden Stress, Schlafmangel oder -störungen und hormonelle Irritationen gezählt. Dabei zeigte sich auch, dass Wechsel- oder Nachtschichtarbeitende ein deutlich höheres Frühinvaliditätsrisiko haben als Tagschichtbeschäftigte.
Eine Gruppe von Gesundheitswissenschaftlern am dänischen "National Research Centre for the Working Environment" in Kopenhagen untersuchte nun unter Leitung von Finn Tüchsen wie hoch das Frühinvaliditäts- oder Behindertenrentenrisiko unter Berücksichtigung des Geschlechts ist.
Dazu verfolgten sie alle Formen des Ausscheidens aus dem Erwerbsleben von 3.980 weiblichen und 4.025 männlichen Beschäftigten, die sie in drei Wellen der "Danish Work Environment Cohort Study" personenbezogen verfolgen und in Gruppen von Schicht- und Tagarbeitenden aufteilen konnten. Zu den im Survey erhobenen Daten gehörten auch das Alter, Rauchgewohnheiten, der Body Mass Index und Informationen über die Arbeitsergonomie der Kohortenmitglieder. Die prospektive Studie dauerte im Durchschnitt 15 Jahre und endete mit dem 60. Lebensjahr der Survey-TeilnehmerInnen.
Die Ergebnisse der Studie bestätigen das allgemeine Frühinvaliditätsrisiko von Wechselschichtarbeit, aber vor allem auch das unterschiedliche Risikopotenzial der Geschlechter:
• Von den beiden Kohorten erhielten 253 Frauen und 173 Männer eine Behindertenrente (disability pension).
• Unter den langjährig schichtarbeitenden Frauen war nach der Adjustierung nach Alter, allgemeinem Gesundheitszustand und sozioökonomischem Status betrug das Risiko, eine Behindertenrente zu erhalten im Vergleich mit den schichtarbeitenden Männern 1.39 (hazard ratio) (95% CI: 1.07-1.82). Das um rund ein Drittel höhere Risiko blieb auch nach der weiteren Adjustierung nach dem BMI und den ergonomischen Bedingungen statistisch signifikant und lag bei 1,34 (95% CI: 1.02-1.75). Schichtarbeit und Behindertenrente wiesen bei Männern keinen besonderen Zusammenhang auf.
Der Leiter der Forschungsgruppe spricht angesichts der bekannten Erkrankungsrisiken von Schichtarbeit und seiner Ergebnisse selber über einige Schwierigkeiten sie zu erklären: "It is therefore not surprising if the incidence of disability requirement is higher among shift workers, but we have no knowledge about why women should be more vulnerable to shift work than men as out study suggests."
Als wichtigster Erklärungsfaktor in der bisherigen Debatte über die Ergebnisse von Tüchsen et al. schält sich der von der "double burden" heraus, die erwerbstätige Frauen durch die meist immer noch von ihnen erledigte Hausarbeit tragen müssen.
Da einerseits in Deutschland 2003 bereits rund 15% der Erwerbstätigen dauerhaft in Wechsel- oder Nachtschicht und sogar nach einer 2005/2006 durchgeführten Befragung von IAB, BiBB und BAuA 25,5% "gelegentlich" in Schichtarbeiten und dieser Anteil im Zeichen der "24-Stunden-Ökonomie" eher noch weiter zu- als abnehmen wird, sollte andererseits mehr Klarheit über die Ursachen erhöhter Krankheitsrisiken aber vor allem auch über die Gründe dafür geschaffen werden, die es offensichtlich Frauen schwer oder unmöglich macht, ein gesamtes Arbeitsleben so arbeiten zu können.
Einen guten Überblick über die Häufigkeit von Schichtarbeit und ihre Entwicklung der letzten Jahre, die Risiken von Schichtarbeit und vor allem bzw. zumindestens mal über die bekannten und erprobten Modelle ihre Risiken durch Arbeitsgestaltung zu reduzieren, vermittelt der komplett kostenlos erhältliche Aufsatz "Gesundheitsgerechte Gestaltung von Schichtarbeit" von Martina Kollig im "Bundesarbeitsblatt" (1; 2006: 13-22).
Von dem am 15. Januar 2008 in der Onlineausgabe der Fachzeitschrift "Occupational Environment Medicine" veröffentlichtem Aufsatz "A 15 year prospective study of shift work and disability pension" von Finn Tüchsen, Karl Bang Christensen, Thomas Lund und Helene Feveile gibt es kostenlos lediglich ein Abstract.
Bernard Braun, 20.1.2008
Flexibilität bei der Arbeit kann auch ein Einflussfaktor für eine gesunde Lebensweise sein
 Bei Beschäftigten, die innerhalb eines Jahres mehr Flexibilität bei der Bewältigung ihrer Arbeitsaufgaben erleben, erhöhen sich auch die Chancen, im privaten Alltag gesundheitsbewusster zu leben. Sie achten zum Beispiel mehr auf ausreichenden Schlaf und nehmen häufiger an betrieblichen Gesundheitskursen zur Stressbewältigung teil. Dies ist das Ergebnis einer Längsschnittstudie, die von einem englisch-amerikanischen Forschungsteam durchgeführt und jetzt im "Journal of Occupational & Environmental Medicine" veröffentlicht wurde.
Bei Beschäftigten, die innerhalb eines Jahres mehr Flexibilität bei der Bewältigung ihrer Arbeitsaufgaben erleben, erhöhen sich auch die Chancen, im privaten Alltag gesundheitsbewusster zu leben. Sie achten zum Beispiel mehr auf ausreichenden Schlaf und nehmen häufiger an betrieblichen Gesundheitskursen zur Stressbewältigung teil. Dies ist das Ergebnis einer Längsschnittstudie, die von einem englisch-amerikanischen Forschungsteam durchgeführt und jetzt im "Journal of Occupational & Environmental Medicine" veröffentlicht wurde.
Basis der Untersuchung waren Mitarbeiterbefragungen in einem großen multinationalen Pharmakonzern, die im Jahre 2004 und 2005 durchgeführt wurden. Beteiligt waren etwa 3.200 Beschäftigte mit unterschiedlichsten Berufen, Qualifikationsniveaus und entsprechend unterschiedlichen Möglichkeiten zu einer flexiblen Bewältigung ihrer Arbeitsaufgaben in zeitlicher und inhaltlicher Hinsicht. Entsprechend der Antwort hierauf wurden Studienteilnehmer einer von drei Gruppen zugeordnet mit niedriger, mittlerer und hoher Flexibilität. Darüber hinaus wurden aber auch Veränderungen bei diesem Merkmal im Zeitraum 2004-2005 ermittelt und weitere Gruppen gebildet, mit einer Verbesserung, Verschlechterung oder Konstanz der Flexibilität.
In den Analysen zeigte sich dann:
• Zwischen den Gruppen mit hoher, mittlerer und niedriger Flexibilität zeigten sich bei zwei Merkmalen des Gesundheitsverhaltens deutliche Unterschiede: Die Teilnahme an betrieblichen Seminaren zur Stressbewältigung und die Gesamteinschätzung des persönlichen Lebensstils in gesundheitlicher Hinsicht.
• Deutlicher noch waren Effekte, die aus einer Veränderung der wahrgenommenen Flexibilität resultierten. So zeigten Gruppen, die hier eine Verbesserung wahrnahmen (im Vergleich zu anderen Gruppen mit Konstanz oder Verschlechterung), Änderungen in ihrem Schlafverhalten (mehr Schlaf), eine höhere Teilnahme an Gesundheitskursen und einen insgesamt gesundheitsbewussteren Lebensstil.
Eine Schwäche der Studie liegt wohl darin, dass als Merkmal die subjektiv erlebte Flexibilität berücksichtigt wurde, nicht aber andere, damit vermutlich recht stark zusammenhängende Faktoren im Beruf (Verantwortung, Position in der Statushierarchie, Qualifikation) oder auch in der Freizeit. Überdies wurde diese Flexibilität nur mit einer Frage erfasst, als subjektive Wahrnehmung, ohne Kontrolle der realen Arbeitsanforderungen und Verhaltensspielräume. Daher kann man nicht fundiert aufzeigen, ob nun Veränderungen der Arbeitstätigkeit oder Änderungen im privaten Umwelt oder veränderte Einstellungen und Verhaltensorientierungen zentrale Einflussfaktoren waren.
Gleichwohl deuten die Ergebnisse der Studie an, dass das Ausmaß der Entscheidungs- und Verhaltensspielräume am Arbeitsplatz und speziell die zeitlichen Freiheitsgrade zur Bewältigung von Arbeitsanforderungen ein wesentlichen Element im Rahmen betrieblicher Maßnahmen zur Gesundheitsförderung sein können.
Hier ist ein kostenloses Abstract: Joseph G. Grzywacz u.a.: The Effects of Workplace Flexibility on Health Behaviors: A Cross-Sectional and Longitudinal Analysis (J Occup Environ Med. 2007;49:000 - 000)
Gerd Marstedt, 13.12.2007
Verschlechterungen im Betriebsklima beeinträchtigen die Gesundheit der betroffenen Arbeitnehmer
 Wenn Arbeitnehmer im Betrieb über einen längeren Zeitraum hinweg Störungen im Betriebsklima erleben, dann hat dies nicht nur Einfluss auf ihre Motivation oder ihr Wohlbefinden am Arbeitsplatz, sondern erhöht auch nachhaltig das Risiko gesundheitlicher Beeinträchtigungen. Eine finnische Studie, die Beschäftigte in Öffentlichen Einrichtungen und Verwaltungen von zehn Städten über einen Zeitraum von 3-4 Jahren hinweg befragte, hat dies jetzt gezeigt. Beteiligt waren Angestellte und Arbeiter verschiedenster Berufe und mit sehr unterschiedlichem Qualifikationsniveau, Beschäftigte mit Routine-Tätigkeiten ebenso wie Führungskräfte. Insgesamt umfasst die Studie Daten von knapp 10.000 Arbeitnehmern aus etwa 1.500 verschiedenen Einrichtungen und Betrieben: Schulen, Kindergärten, Verwaltungen, Kliniken.
Wenn Arbeitnehmer im Betrieb über einen längeren Zeitraum hinweg Störungen im Betriebsklima erleben, dann hat dies nicht nur Einfluss auf ihre Motivation oder ihr Wohlbefinden am Arbeitsplatz, sondern erhöht auch nachhaltig das Risiko gesundheitlicher Beeinträchtigungen. Eine finnische Studie, die Beschäftigte in Öffentlichen Einrichtungen und Verwaltungen von zehn Städten über einen Zeitraum von 3-4 Jahren hinweg befragte, hat dies jetzt gezeigt. Beteiligt waren Angestellte und Arbeiter verschiedenster Berufe und mit sehr unterschiedlichem Qualifikationsniveau, Beschäftigte mit Routine-Tätigkeiten ebenso wie Führungskräfte. Insgesamt umfasst die Studie Daten von knapp 10.000 Arbeitnehmern aus etwa 1.500 verschiedenen Einrichtungen und Betrieben: Schulen, Kindergärten, Verwaltungen, Kliniken.
Die Daten der Studie, die jetzt in der Zeitschrift "Social Science & Medicine" veröffentlicht wurde, stammen aus der sogenannten "10-Town Study", einer Längsschnittstudie, die Verhaltensorientierungen und Einstellungen von Arbeitnehmern in staatlichen und kommunalen Betrieben Finnlands untersucht. Befragt wurden zunächst in den Jahren 2000/2001 etwa 32.000 Teilnehmer. Im Jahre 2004 wurden dann in die eigentliche Datenanalyse noch 9.500 Beschäftigte einbezogen, die einerseits zu Beginn der Studie einen guten Gesundheitszustand aufwiesen, die nach 3 Jahren immer noch in derselben Einrichtung beschäftigt waren und zu denen Daten aus beiden Befragungen vorlagen.
Der theoretische Ansatz der Studie geht nicht vom "Betriebsklima" aus, sondern verwendet das in den Sozialwissenschaften zuletzt immer häufiger benutzte Konzept des "Sozialkapital", das von Bourdieu entwickelt wurde. Dieser Begriff des sozialen Kapitals bezeichnet die individuellen Ressourcen des "sozialen und gesellschaftlichen Lebens wie Unterstützung, Hilfeleistung, Anerkennung, Wissen und Verbindungen bis hin zum Finden von Arbeits- und Ausbildungsplätzen". Auf betrieblicher Ebene und auch in den Fragen der finnischen Studie hängt der Begriff aber eng zusammen mit dem "Betriebsklima". Gefragt wurde dort in beiden Erhebungsjahren nach dem Zusammengehörigkeits-Gefühl im Betrieb, der gegenseitigen Anerkennung und Unterstützung, der Qualität der Zusammenarbeit mit anderen im Betrieb, dem Vertrauen in Vorgesetzte, der Qualität des Führungsstils. Auf der Basis dieser Einschätzungen wurden dann vier Gruppen gebildet, je nachdem, ob zu den beiden Erhebungen das Betriebsklima (bzw. "Sozialkapital") als positiv oder negativ eingeschätzt wurde. Die vier Gruppen waren dann: positiv-positiv, positiv-negativ, negativ-positiv, negativ-negativ.
Abhängige Variable in der Studie war die Selbsteinschätzung des Gesundheitszustands. In einer multivariaten Analyse wurden dann einerseits die vier Gruppen als Indikator für Störungen im Betriebsklima einbezogen, andererseits aber auch noch eine Reihe sozialstatistischer, gesundheitlicher und beruflicher Merkmale (Alter, Geschlecht, Rauchen, körperliche Bewegung, BMI, Alkohol, berufliche Position und Verantwortung).
Als Ergebnis zeigte sich dann:
•Nimmt man als Bezugsgruppe jene Beschäftigten mit durchgängig positivem Betriebsklima, dann liegt das Risiko gesundheitlicher Beeinträchtigungen doppelt so hoch bei Arbeitnehmern, die a) durchgängig über ein schlechtes Betriebsklima berichten oder b) zunächst positive, später aber negative Einschätzungen abgeben. Dies gilt auch unter Berücksichtigung der oben genannten vielfältigen anderen Einflussfaktoren.
• Dieser Effekt wirkt sich besonders deutlich (und mit quantitativ noch höheren Risiken) in solchen Einrichtungen aus, in denen sehr viele Arbeiter und Arbeiterinnen beschäftigt sind, d.h. vermutlich, dass Störungen des Betriebsklimas sich besonders stark auswirken, wenn die Beschäftigtenstruktur sehr heterogen ist, Arbeiter und Angestellte, Höher- und Geringer-Qualifizierte umfasst.
• Der Effekt zeigt sich, wenn man individuelle Aussagen und Daten berücksichtigt, aber auch dann, wenn man Betriebe und Einrichtungen miteinander vergleicht, also individuelle Aussagen aus einem Betrieb zusammenfasst. Die Wissenschaftler bewerten dies als einen Beleg dafür, dass die Bewertungen des Betriebsklimas bzw. Sozialkapitals nicht nur rein subjektive Wahrnehmungen sind, die von der Realität abweichen können, sondern weitgehend stimmige und "objektive" Indikatoren.
Hier ist ein kostenloses Abstract der Studie: Tuula Oksanen u.a.: Social capital at work as a predictor of employee health: Multilevel evidence from work units in Finland (Social Science & Medicine, Article in Press, Corrected Proof, doi:10.1016/j.socscimed.2007.10.013)
Gerd Marstedt, 12.12.2007
WHO-Krebsforschungszentrum: Schichtarbeit und Nachtarbeit mit "hoher Wahrscheinlichkeit krebserregend"
 So bekannt die Krebsrisiken gefährlicher Arbeitsstoffe wie beispielsweise von Bleifarbe, ultravioletten Strahlen, diversen Schwermetalle oder von PCB sind und zu den Kernthemen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes gehören, so wenig wurde eine Arbeitszeitform wie regelmäßige Nachtarbeit bisher als Krebsrisiko betrachtet und behandelt. Wenn Nachtarbeit als "ungesund" thematisiert wurde, geschah es bisher wegen vergleichsweise geringfügiger gesundheitlicher Probleme wie Schlaflosigkeit, Gereiztheit oder Verdauungsstörungen.
So bekannt die Krebsrisiken gefährlicher Arbeitsstoffe wie beispielsweise von Bleifarbe, ultravioletten Strahlen, diversen Schwermetalle oder von PCB sind und zu den Kernthemen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes gehören, so wenig wurde eine Arbeitszeitform wie regelmäßige Nachtarbeit bisher als Krebsrisiko betrachtet und behandelt. Wenn Nachtarbeit als "ungesund" thematisiert wurde, geschah es bisher wegen vergleichsweise geringfügiger gesundheitlicher Probleme wie Schlaflosigkeit, Gereiztheit oder Verdauungsstörungen.
Nach der Sichtung mehrerer aktueller Studien über die Gesundheit insbesondere von Frauen, die in wechselnden Schichten mit Nachtarbeit arbeiten, veröffentlichten die WHO-Krebsforscher im Lyoner IARC (International Agency for Research on Cancer) zunächst in einer knappen Pressemitteilung Nr. 180 vom 5. Dezember 2007 ihre neue Risikobewertung.
Dieses Risiko kommt danach dadurch zustande, dass Nachtarbeit im Schichtdienst mit unregelmäßigen Arbeitsperioden die biologische Uhr durcheinander. Krankenschwestern und Stewardessen, die über lange Zeit immer wieder Nachtschichten arbeiten, haben demzufolge eindeutig ein höheres Risiko, an Brustkrebs zu erkranken. Auch wenn dieses Risiko nach Angaben der WHO von den Experten als "mäßig" eingestuft wird, ist es "ein reales Risiko". "Der Organismus funktioniert nach dem Wechselspiel von Tag und Nacht. Licht unterbricht die Produktion des Hormons Melatonin, das der Körper normalerweise nachts ausschüttet. Die Unterdrückung des Melatonins begünstigt demnach die Entstehung von Tumoren, während die Veränderung des Schlaf-Wach-Rhythmus Gene durcheinanderbringt, die ebenfalls im Zusammenhang mit der Tumorentstehung stehen." Ob dies bei Männern generell auch so verläuft, ist im Moment nicht bekannt. Bekannt ist nur ein erhöhtes Risiko von Piloten, an Prostatakrebs zu erkranken. Mindestens bei Stewardessen und Piloten könnten aber auch noch andere Faktoren eine Rolle spielen: Zum Beispiel kosmische Strahlungen.
Der Leiter des IARC-"Monographs Programm", Vincent Cogliano, bewertet die Relevanz und die weitere Arbeit an diesem Thema in der Presserklärung so: "Fast 20% der erwerbstätigen Bevölkerung in Europa und Nordamerika arbeiten in Schichtarbeit, am häufigsten im Gesundheitswesen, der Industrie, im Transport- und Kommunikationswesen sowie in der Gastronomie. Bis heute haben die meisten Studien die Entstehung von Brustkrens bei Krankenschwestern und Stewardessen untersucht. Es ist erscheint unnötig, weitere Studien durchzuführen um die Krebsrisiken auch noch für andere Berufsgruppen und Krebsarten festzustellen.".
Eine etwas längere Darstellung der dieser Risikobewertung zugrundeliegenden Arbeiten veröffentlichte die IARC-Arbeitsgruppe unter Leitung von Kurt Straif unter der Überschrift "Carcinogenicity of shift-work, painting, and fire-fighting" in der Fachzeitschrift "Lancet Oncology" (2007; 8:1065-1066). Wer den Link nutzen will, muss sich aber vorher bei der Zeitschrift "The Lancet" kostenfrei als Nutzer eintragen.
Eine umfassende Veröffentlichung als IARC-Monographie Nr. 98 (IARC. IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans. Volume 98. Shift-work, painting and fire-fi ghting. Lyon: International Agency for Research on Cancer) erscheint 2008.
Eine im Juli 2006 veröffentlichte Untersuchung über das Risiko von Prostatakarzinomen bei japanischen Schichtarbeitern und eine bereits im Jahr 2001 veröffentlichte Studie über Brustkrebsrisiken bei Krankenschwestern mit Nachtarbeit unterstreichen aber auch schon, auf der Basis welcher Forschungsergebnisse die WHO zu ihrer aktuellen Risikobewertung gekommen ist.
Die wesentlichen Ergebnisse der im "American Journal of Epidemiology" (2006. 164(6):549-555) vorgestellten Studie "Prospective Cohort Study of the Risk of Prostate Cancer among Rotating-Shift Workers: Findings from the Japan Collaborative Cohort Study" von Kubo et al. basieren auf einer systematischen Erhebung sämtlicher Arbeitszeitformen und Prostatakrebserkrankungen zwischen 1988 und 2001 bei 14.052 erwerbstätigen japanischen Männern. Nach dem rechnerischen Ausschluss des möglichen Einflusses des Alters, der möglichen Familienhistorie mit dieser Krebsart, gesundheitsschädigenderer Verhaltensweisen (Rauchen, Alkoholkonsum), Gewicht, Arbeitstyp, körperliche Beanspruchung durch die Arbeit, Bildungsstand, Stressniveau und des Familienstands, gab es statistisch hochsignikante Unterschiede der Prostatarisiken: Dieses Risiko war bei Arbeitern mit wechselnder Schichtarbeit einschließlich Nachtarbeit dreimal so hoch wie bei Arbeitern, die lediglich tagsüber arbeiten (relatives Risiko = 3,0, 95% und Konfidenzintervall: 1,2; 7,7). Wer nur in Nachtschicht arbeitete hatte lediglich ein geringfügig erhöhtes und auch statistisch nicht signifikantes Erkrankungsrisiko.
Der 7 Seiten umfassende Aufsatz von Kubo et al. ist komplett und kostenfrei herunterladbar.
Mit den möglichen Risiken von Nachtschichtarbeit für Brustkrebs bei Krankenschwestern befassten sich Eva Schernhammer et al. bereits 2001 in dem Aufsatz "Rotating night shifts and risk of breast cancer in women participating in the Nurses' Health Study", der im US-"Journal of the National Cancer Institute" erschien (2001 17. Oktober; 93: 1563-1568).
Dazu befragten die Forscher im Jahr 1988 78.562 Krankenschwestern, mit keinerlei Brustkrebs-Vorgeschichte, unter welchen Arbeitszeitformen sie bisher gearbeitet hatten. Diese Personengruppe wurde die nächsten 10 Jahre weiter beobachtet. In einer Analyse, in der erneut der mögliche Einfluss der bereits weiter oben aufgezählten so genannten Confounder ausgeschlossen wurde, zeigten sich folgende Ergebnisse:
• Frauen, die 30 Jahre oder länger in Wechselschichten auch in der Nacht arbeiteten, hatten im Vergleich mit Nur-Tagschicht-Krankenschwestern ein statistisch signifikant ehöhtes Risiko für Brustkrebs (relatives Risiko = 1,36).
• Ihre Kolleginnen, die weniger als 30 Jahre in Wechselschicht mit Nachtarbeit arbeiteten, hatten ein kleineres und nur knapp die Signifikanz verfehlendes Brustkrebs-Risiko (relatives Risiko =1.08).
• In einer in diesem Aufsatz zitierten Studie ergaben sich ähnliche Resuktate: Hier wurden 813 Frauen mit Brustkrebs mit 793 altersgleichen Frauen ohne eine derartige Erkrankung hinsichtlich ihren Arbeitszeitformen verglichen. Diejenigen, die in den letzten Jahren regelmäßig in Nachtschicht arbeiteten, hatten - mehrfach standardisiert - ein 1.6faches Brustkrebsrisiko. Die Frauen, die aus welchen Gründen auch immer mindestens zwischen 2 und drei Nächte in der Woche keinen unterbrechungsfreien Schlaf erhält, haben sogar noch ein etwas höheres Brustkrebsrisiko (relatives Risiko = 1,7).
Trotz dieser Studien und der Risikobewertung der WHO ist aber keine Ursache-Wirkungsrelation zwischen Brustkrebs und der fehlenden Lichtexposition in Nachtschichten bewiesen.
Vom Aufsatz "Rotating night shifts and risk of breast cancer in women participating in the Nurses' Health Study" ist ein Abstract oder auch kostenfrei die 6seitige Vollversion erhältlich.
Wiederum unter Leitung von Eva Schernhammer veröffentlichte eine Gruppe von Medizinern und Epidemiologen 2003 eine weitere, auf Daten der "Nurses' Health Study" beruhende Studie zum Zusammenhang des Auftretens anderer Krebserkrankungen, d. h. konkret von Dickdarmkrebs mit Nachtschichtarbeit.
Das Abstract zu dem im "JNCI (Journal of the National Cancer Institute) (2003 95(11): 825-828) veröffentlichten Aufsatz "Night-Shift Work and Risk of Colorectal Cancer in the Nurses' Health Study" fasst die Datenbasis und das wichtigste Ergebnis so zusammen: "Wir haben 602 neue Fälle von Darmkrebs bei 78.586 Frauen erfasst, die wir von 1988-1998 beobachtet haben. Im Vergleich zu Frauen, die nie in Wechselschicht gearbeitet haben, ist das Risiko für Frauen, die solche Schichtarbeit mindestens 15 Jahre lang ausgeübt haben (mindestens dreimal monatlich) etwa 1.4mal so hoch."
Auch von diesem Aufsatz gibt es kostenfrei das vollständige Abstract und die vierseitige Vollversion einzusehen und herunterzuladen.
Bernard Braun, 8.12.2007
Höchste arbeitsbedingte Asthmarisiken bei Krankenpflegekäften, Druckern und Holzverarbeitern
 Mehr als 10 % aller im Erwachsenenalter einsetzenden und oft chronischen Asthmaerkrankungen beruhen auf Expositionen gegenüber bestimmten Stoffen am Arbeitsplatz. Dies ist das gegenüber bisherigen Studien wesentlich gewichtigere Ergebnis einer internationalen prospektiven Bevölkerungsstudie, deren Ergebnisse am 28. Juli 2007 in der britischen Fachzeitschrift "Lancet" (2007; 370: 336-41) erschienen sind. Während also bisher in französischen, britischen und us-amerikanischen Studien von einer Rate der arbeitsbedingten Asthmaerkrankungen von 20-30 Fällen pro 1 Million Personen ausgegangen wurde, beträgt der tatsächliche Wert 250-300 Fälle/1 Million Personen.
Mehr als 10 % aller im Erwachsenenalter einsetzenden und oft chronischen Asthmaerkrankungen beruhen auf Expositionen gegenüber bestimmten Stoffen am Arbeitsplatz. Dies ist das gegenüber bisherigen Studien wesentlich gewichtigere Ergebnis einer internationalen prospektiven Bevölkerungsstudie, deren Ergebnisse am 28. Juli 2007 in der britischen Fachzeitschrift "Lancet" (2007; 370: 336-41) erschienen sind. Während also bisher in französischen, britischen und us-amerikanischen Studien von einer Rate der arbeitsbedingten Asthmaerkrankungen von 20-30 Fällen pro 1 Million Personen ausgegangen wurde, beträgt der tatsächliche Wert 250-300 Fälle/1 Million Personen.
Unter der Leitung des Epidemiologen Manolis Kogevinas vom "Center for Research in Environmental Epidemiology" am "Municipal Institute of Medical Research" in Barcelona untersuchte die Forschungsgruppe das Erkrankungsgeschehen von 6.837 Personen im Alter von 20-44 Jahren, die 1990 bis 1995 am "European Community Respiratory Health Survey (ECRHS)" teilgenommen hatten und damals weder Atemwegserkrankungen noch eine individuelle oder familiäre Asthmavorgeschichte hatten. Im Schnitt wurden diese Personen noch 9 Jahre beobachtet und in einem Folgesurvey in den Jahren 1998 bis 2003 gründlich nach Asthmaproblemen untersucht.
In dieser Befragung erhoben die Wissenschaftler detailliert die Berufs- und Tätigkeitgeschichten der Personen und identifizierten Personen mit vermuteten Hochrisikotätigkeiten für Atemwegserkrankungen wie z.B. Bäcker, Maler, Pflegekräfte, Friseure, Reinigungskräfte und Arbeiter in der chemischen Industrie. Diesen Angaben und weiteren Expositionsdaten wurden dann die diagnostizierten Fälle von Atemwegserkrankungen und darunter vor allem die Asthmaerkrankungen gegenüber gestellt.
Alle Ergebnisse wurden nach dem Alter, dem Geschlecht, dem Raucherstatus und der Nationalität adjustiert. Die Ergebnisse waren sowohl allgemein als auch bis in kleine Facetten hinein eindeutig:
• Die Personen, die in einer der Risikotätigkeiten arbeiteten, hatten in den 12 Monaten vor dem Folgesurvey ein höheres Risiko eine Asthmaattacke zu bekommen und Asthma-Arzneimittel einnehmen zu müssen als Personen, die in Niedrigrisikotätigkeiten wie z. B. als Geistlicher oder Büroangestellter arbeiteten (relatives Risiko = 1,69).
• Das höchste Risiko für Asthma findet sich bei Personen, die mit Druckarbeiten (RR = 2,37), der Holzbearbeitung (RR = 2,22) und pflegerischen Tätigkeiten (RR = 2,22)befasst sind.
Von dem Aufsatz von Manolis Kogevonas et al. ist kostenfrei ein Abstract erhältlich: Exposure to substances in the workplace and new-onset asthma: an international prospective population-based study (ECRHS-II)
Bernard Braun, 26.10.2007
Arbeitslosigkeit und Gesundheit: Eine neue Literaturübersicht
 Etwa 25 % aller Arbeitslosen, 40 % aller älteren Arbeitslosen über 50 Jahre und rund 50 % aller Langzeitarbeitslosen (über 1 Jahr) zeigen gesundheitliche Einschränkungen, die die Möglichkeit einer Arbeitsvermittlung erschweren. Arbeitslosigkeit und Krankheit zeigen also sehr enge statistische Zusammenhänge, doch in welche Richtung geht der Kausalzusammenhang - macht Arbeitslosigkeit krank oder verlieren Kranke eher ihre Arbeitsstelle? Dies ist eine der Fragen, denen ein Forschungsteam am "Institut für Qualitätssicherung in Prävention und Rehabilitation an der Deutschen Sporthochschule (IQPR)" jetzt in einer Literaturübersicht nachgegangen ist, die im Deutschen Ärzteblatt veröffentlicht wurde.
Etwa 25 % aller Arbeitslosen, 40 % aller älteren Arbeitslosen über 50 Jahre und rund 50 % aller Langzeitarbeitslosen (über 1 Jahr) zeigen gesundheitliche Einschränkungen, die die Möglichkeit einer Arbeitsvermittlung erschweren. Arbeitslosigkeit und Krankheit zeigen also sehr enge statistische Zusammenhänge, doch in welche Richtung geht der Kausalzusammenhang - macht Arbeitslosigkeit krank oder verlieren Kranke eher ihre Arbeitsstelle? Dies ist eine der Fragen, denen ein Forschungsteam am "Institut für Qualitätssicherung in Prävention und Rehabilitation an der Deutschen Sporthochschule (IQPR)" jetzt in einer Literaturübersicht nachgegangen ist, die im Deutschen Ärzteblatt veröffentlicht wurde.
Der Aufsatz "Arbeitslosigkeit und Gesundheit aus sozialmedizinischer Sicht" basiert auf einer Literaturrecherche in den Datenbanken PubMed und PsycInfo und berücksichtigt Studien aus der gesundheitsbezogenen Arbeitslosenforschung der letzten 20 Jahre. Zentrale Erkenntnisse aufgrund der Aufarbeitung des Forschungsstands sind folgende:
• Die statistischen Zusammenhänge zwischen Arbeitslosigkeit und schlechterem Gesundheitszustand sind hinlänglich belegt. Insbesondere die Dauer der Arbeitslosigkeit beeinflusst das gesundheitliche Wohlbefinden. So war die Lebenszufriedenheit bei Langzeitarbeitslosen im Jahr 2005 so niedrig wie bei Pflegebedürftigen und diese Gruppe berichtet auch vermehrt über ein Auftreten von Erkrankungen. Die gesundheitlichen Folgen von Arbeitslosigkeit für Frauen sind aufgrund tradierter Rollenerwartungen früher wahrscheinlich unterschätzt worden. Neuere Forschungsergebnisse erkennen aufgrund der zunehmenden Angleichung der Berufsorientierung von Männern und Frauen keine wesentlichen Unterschiede mehr hinsichtlich der gesundheitlichen Effekte von Arbeitslosigkeit.
• Die Frage, ob Arbeitslosigkeit krank macht oder Krankheit zur Arbeitslosigkeit führt, lässt sich nicht eindeutig im Sinne der einen oder anderen Hypothese beantworten. Die Vielzahl der vorliegenden Studienergebnisse deutet wohl an, dass beide Mechanismen wirksam sind und dass Arbeitslosigkeit sowohl Folge als auch (Mit-)Ursache einer Erkrankung sein kann. Für die Selektionstheorie spricht unter anderen, dass etwa ein Drittel aller Kündigungen in den 1980er- und 1990er-Jahren krankheitsbedingt erfolgten und nach den Daten des telefonischen Gesundheitssurveys aus dem Jahr 2003 etwa ein Viertel aller arbeitslosen Männer ihre Arbeit wegen Krankheit verloren. Andererseits gibt es auch zahlreiche Studien, die zeigen, dass Arbeitslosigkeit eine Ursache von Krankheiten ist.
• Als theoretische Erklärungsansätze für den Zusammenhang von Arbeitslosigkeit und Gesundheit konkurrieren mehrere Konzepte, von denen bislang keines sich als eindeutig überlegenes Modell erweisen konnte: Das Stressmodell (Arbeitslosigkeit ist ein starken sozialen Stressor dar, der zu emotionalen, kognitiven, verhaltensbezogenen und auch physiologischen Reaktionen führt), Risikoverhalten (gesundheitsschädigendes Eigenverhalten mit riskantem Lebenssti)l, Deprivationstheorie und "Vitaminmodell" (Elemente der Erwerbsarbeit wie Gelderwerb, Zeitstruktur, Sozialkontakt, Status und Identität, die für das emotionale Wohlbefinden und die psychische Stabilität wichtig sind, gehen verloren).
• Bei den beobachteten Krankheitsbildern Arbeitsloser treten Adipositas, Stoffwechselstörungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen besonders häufig auf. Auch psychische und psychosomatische Erkrankungen gelten aufgrund vieler fundierter Studien als gesicherte Folgen von Arbeitslosigkeit. Hier lassen sich sogar Dosis-Wirkungs-Beziehungen aufzeigen: Eine zunehmende Dauer der Arbeitslosigkeit führt ebenso zu steigenden psychischen Beschwerden wie der Wiedereintritt in die Erwerbsarbeit diese Beschwerden reduziert.
Weber, Andreas; Hörmann, Georg; Heipertz, Walther: Arbeitslosigkeit und Gesundheit aus sozialmedizinischer Sicht (Deutsches Ärzteblatt 104, Ausgabe 43 vom 26.10.2007, Seite A-2957)
Gerd Marstedt, 25.10.2007
Rente mit 67 - Aber schon ab 45 werden viele Erwerbstätige durch Arbeitsbelastungen krank, zeigen internationale Studien
 Arbeitnehmer sollen in Deutschland künftig bis zum Alter von 67 Jahren arbeiten, bevor sie in Rente gehen können. Eine Auswertung internationaler Studien über arbeitsbedingte Gesundheitsbeeinträchtigungen im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung zeigt jedoch: Schon in der Altersgruppe zwischen 45 und 65 werden viele durch die Belastungen am Arbeitsplatz und im Betrieb krank.
Arbeitnehmer sollen in Deutschland künftig bis zum Alter von 67 Jahren arbeiten, bevor sie in Rente gehen können. Eine Auswertung internationaler Studien über arbeitsbedingte Gesundheitsbeeinträchtigungen im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung zeigt jedoch: Schon in der Altersgruppe zwischen 45 und 65 werden viele durch die Belastungen am Arbeitsplatz und im Betrieb krank.
Welchen Anteil an den Gesundheitsrisiken für Ältere haben berufliche Belastungen und was beruht auf "normalem Verschleiß"? Wo helfen bessere Arbeitsbedingungen? Um dies zu ermitteln, haben die Forscher Johannes Siegrist und Nico Dragano zahlreiche internationale Studien ausgewertet. Dabei konzentrieren sie sich auf weit verbreitete Leiden, die auch den größten Teil der Frühverrentungen verursachen: Muskel- und Skeletterkrankungen, Herz-Kreislauf- und Stoffwechselleiden sowie psychische Störungen, etwa Depressionen. Die Wissenschaftler stellen hohe Anforderungen an die Methodik: Berücksichtigt wurden Langzeitstudien, die verzerrende Faktoren statistisch kontrollieren, etwa arbeitsunabhängige Alterseffekte oder gesundheitsschädigendes Verhalten. In der Zusammenschau attestieren die Autoren, problematische Arbeitsbedingungen hätten "durchgehend signifikante Effekte" auf die Häufigkeit von Erkrankungen bei älteren Beschäftigten und die Wahrscheinlichkeit einer Frühverrentung.
Körperliche Belastungen: Lärm, schmerzhafte Körperhaltungen, Kontakt mit Gefahrstoffen - solche Arbeitsbedingungen sind in der EU noch weit verbreitet. Auch Computerarbeit belastet den Körper durch ständig wiederholte Bewegungen oder Bewegungsmangel. Die Folgen sind breit gefächert: Studien weisen bei Beschäftigten, die länger als fünf Jahre starkem Lärm ausgesetzt sind, erhöhte Blutdruckwerte nach. Wer im Job dauernd sitzt und in der Freizeit keinen Bewegungs-Ausgleich schafft, muss nach zehn Jahren mit einer um 90 Prozent erhöhten Herzinfarktgefahr leben.
Schichtarbeit: Etwa jeder fünfte jüngere Arbeitnehmer in der EU arbeitet in Schichtsystemen. In der Altersgruppe ab 55 sind es immerhin noch zehn Prozent. Knapp sechs Prozent der deutschen Beschäftigten müssen sich mit Mehrschicht- und Nachtarbeit arrangieren. Siegrist und Dragano referieren vier Studien, die Beschäftigten in Wechselschichtsystemen ein erhöhtes Risiko von Herz-Kreislauf-Krankheiten attestieren. Je nach Untersuchung liegt es zwischen 30 und 180 Prozent höher als bei Beschäftigten mit Normalarbeitszeit.
Psychosoziale Arbeitsbelastungen: Wissenschaftler haben mehrere Modelle konstruiert, um solche Belastungen von "normalem" Stress abzugrenzen. Auf der Basis deutscher und europäischer Untersuchungen gehen Siegrist und Dragano davon aus, dass im Schnitt etwa 20 Prozent der Beschäftigten psychosozial belastet sind - mit deutlich höheren Werten in Branchen wie der Land- und Forstwirtschaft, der Metallerzeugung, dem Kraftfahrzeughandel oder bei personenbezogenen Dienstleistungen, etwa im Gesundheitswesen. Um die gesundheitlichen Konsequenzen genauer abschätzen zu können, haben die Düsseldorfer mehr als ein Dutzend Forschungsarbeiten herangezogen. Ergebnis: Würde Dauerstress im Arbeitsleben konsequent vorgebeugt, könnten theoretisch etwa ein Viertel der bei Erwerbstätigen neu auftretenden Depressionen und etwa ein Fünftel aller koronaren Herzkrankheiten vermieden werden.
Die Wissenschaftler diskutieren auch unterschiedliche Möglichkeiten, diese Belastungen und Gesundheitsrisiken im Betrieb abzubauen. Starke Belastungen, vor allem physische und psychosoziale Doppelllasten, müssen identifiziert werden, um stark betroffenen Arbeitnehmern rasch helfen zu können. "Dies betrifft beispielsweise ältere Beschäftigte mit Stressbelastung und mehrjähriger Schichtarbeit." Dazu könnten auf Betriebsebene etwa anonymisierte betriebsärztliche Daten verwendet werden. Ein weiteres Instrument wären Mitarbeiterbefragungen. Allerdings mangele es oft an der Kompetenz, solche Belastungen zu diagnostizieren.
Der deutsche Arbeitsschutz hat ein vergleichsweise hohes Niveau. Aber gerade in kleinen und mittleren Unternehmen würden komplexere Maßnahmen oft nicht konsequent umgesetzt, so Siegrist und Dragano. Sie plädieren auch für eine gesundheitsförderliche Arbeitsorganisation. Dazu zählen beispielsweise Teamarbeit oder Job-Rotation. Diese kann vor allem Berufsgruppen mit besonders belastenden Tätigkeiten helfen, etwa im Bau- oder Transportgewerbe oder in der Alten- und Krankenpflege. Wichtig, gerade für ältere Beschäftigte, ist auch die Möglichkeit, die eigene Arbeitszeit mitzugestalten.
Auch Maßnahmen zur Personalentwicklung, Laufbahngestaltung und zum Führungsverhalten sind von Bedeutung. Derzeit ist die Weiterbildungsquote bei älteren Beschäftigten besonders niedrig. Ein unhaltbarer Zustand, so die Forscher. Sie plädieren für eine "bessere Abstimmung von Weiterbildungsangeboten und Personaleinsatzstrategien" und für "altersadäquate Positionswechsel" - etwa vom Gruppenakkord auf einen Einzelarbeitsplatz. Studien aus Schweden, Kanada und Finnland belegen, dass ein Führungsstil, der die Leistung der Beschäftigten angemessen würdigt, den Gesundheitszustand sehr positiv beeinflusst. Das gilt besonders bei älteren Arbeitnehmern, aber längst nicht nur bei ihnen.
• Hier ist eine Kurzfassung des Berichts (PDF, 2 Seiten): Fit bis 67? Wie der Job ältere Beschäftigte krank macht (Böckler Impuls 14/2007)
Hier ist der Ergebnisbericht (PDF, 34 Seiten): Johannes Siegrist, Nico Dragano: Rente mit 67 - Probleme und Herausforderungen aus gesundheitswissenschaftlicher Sicht, Gutachten für die Hans-Böckler-Stiftung
Gerd Marstedt, 1.10.2007
Volkswirtschaftliche Kosten von Frühinvalidität durch Arbeitsbelastungen betragen 10,3 Milliarden Euro pro Jahr
 Die volkswirtschaftlichen Kosten von Frühverrentungen, die durch berufliche Gesundheitsgefahren und Arbeitsbelastungen hervorgerufen sind, belaufen sich in Deutschland auf mindestens 10,3 Milliarden Euro im Jahr. Davon fallen rund 1,2 Milliarden Euro als direkte Kosten beispielsweise für die medizinische Behandlung der Frühinvaliden an. Die darüber hinaus reichenden Folgekosten für die Rentenversicherung - unter anderem durch entgangene Beitragszahlungen und Effekte auf die Altersrente - lassen sich jährlich mit mindestens 2,8 Milliarden Euro ansetzen. Hinzu kommen indirekte Kosten nach dem Humankapitalansatz wie zum Beispiel entgangene Arbeitseinkommen.
Die volkswirtschaftlichen Kosten von Frühverrentungen, die durch berufliche Gesundheitsgefahren und Arbeitsbelastungen hervorgerufen sind, belaufen sich in Deutschland auf mindestens 10,3 Milliarden Euro im Jahr. Davon fallen rund 1,2 Milliarden Euro als direkte Kosten beispielsweise für die medizinische Behandlung der Frühinvaliden an. Die darüber hinaus reichenden Folgekosten für die Rentenversicherung - unter anderem durch entgangene Beitragszahlungen und Effekte auf die Altersrente - lassen sich jährlich mit mindestens 2,8 Milliarden Euro ansetzen. Hinzu kommen indirekte Kosten nach dem Humankapitalansatz wie zum Beispiel entgangene Arbeitseinkommen.
Zu diesen Ergebnissen kommt ein Forschungsprojekt der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA), das vom Institut für Prävention und Gesundheitsförderung an der Universität Duisburg-Essen durchgeführt wurde. Das deutsche Sozialbudget wies 2003 rund 20,4 Milliarden Euro für gesundheitsbedingte Frührenten aus. Für Präventionsmaßnahmen in der Arbeitswelt ist es wichtig, berufliche Einflüsse auf die Frühinvalidität und damit verbundenen Kosten zu kennen, um effiziente und im Betrieb praktikable Interventionen durchführen zu können. Daten zur Bedeutung der Arbeitswelt für die krankheitsbedingte Frühberentung liegen jedoch für Deutschland nicht routinemäßig vor. Deshalb mussten die Wissenschaftler des BKK-Bundesverbands und des Instituts für Gesundheitsförderung und Prävention der Universität Duisburg-Essen zunächst ein methodisch aufwändiges Untersuchungsdesign entwickeln. Damit konnten erstmalig die Daten der gesetzlichen Rentenversicherung mit erwerbsbiografischen Informationen der Bundesagentur für Arbeit sowie Befragungsdaten verknüpft und im Längsschnitt auf das Risiko einer Frühinvalidität ausgewertet werden.
Direkte Kosten der arbeitsweltbezogenen Frühberentung umfassen alle Ausgaben, die im Rahmen der ambulanten und stationären Krankheitsbehandlung, der öffentlichen und privaten Gesundheitsvorsorge und für Pflege, Gesundheitsgüter und Verwaltung, Ausbildung und Forschung anfallen. Indirekte Kosten stellen die der Volkswirtschaft durch Frühinvalidität entgangene Wertschöpfung durch die Verluste an Arbeitseinkommen dar. Als Ergebnis zeigte sich: Die Leistungsausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung und der sozialen Pflegeversicherung für die 1,9 Mio. frühinvaliden Personen des Jahres 1999 belaufen sich auf ca. 12,5 Mrd. €. Hiervon ausgehend wurden die direkten Kosten der Frühinvalidität mit ca. 9,7 Mrd. € veranschlagt.
Schwere körperliche Belastungen, vor allem aber geringer Handlungs- und Entscheidungsspielräume erwiesen sich in den Analysen als besonders einflussreiche Ursachen für Frühverrentungen. Präventionsmaßnahmen sollten nach Meinung der Wissenschaftler daher vor allem hier einsetzen. Allein durch moderate Verbesserung des Handlungsspielraums bei der Arbeit ließen sich potenziell jährlich bis zu 2 Milliarden Euro einsparen. Sowohl Bergleute, als auch Pflegekräfte beiderlei Geschlechts tragen ein hohes Berentungsrisiko. Da krankheitsbedingte Erwerbsunfähigkeit bereits im Vorfeld der Frühberentung auch für die Krankenversicherung relevant wird, ergibt sich damit ein erhebliches Präventionspotenzial für eine die Sozialversicherungszweige übergreifende Kooperation.
• Abstract des Aufsatzes H. Friedel, M. Friedrichs, C. Röttger, W. Bödeker: Direkte Kosten der Frühinvalidität in Deutschland
• Abstract des Aufsatzes The impact of work on morbidity-related early retirement
• Die Buchveröffentlichung zur Studie: Schriftenreihe der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Dortmund/Berlin, Forschungsbericht Fb 1080 "Kosten der Frühberentung. Abschätzung des Anteils der Arbeitswelt an der Erwerbs- und Berufsunfähigkeit und der Folgekosten"; W. Bödeker, H. Friedel, M. Friedrichs, C. Röttger
Gerd Marstedt, 7.9.2007
Ehemalige Bremer Werftarbeiter leiden zehn Jahre nach Betriebsschließung an massiven arbeitsbedingten Erkrankungen
 Die letzte Großwerft Bremens, der Bremer Vulkan, ging 1996 in Konkurs, alle Rettungsversuche zuvor waren fehlgeschlagen. Zurück blieben 2.500 Arbeiter und Angestellte, die in die Arbeitslosigkeit entlassen wurden. Viele von ihnen waren krank - durch Asbest, Schweiß- und Brennrauche und harte körperliche Arbeit. Zehn Jahre nach der Schließung der Bremer Vulkan-Werft leiden viele ehemalige Beschäftigte immer noch unter den Folgen ihrer Arbeitsbelastungen. "Der Gesundheitszustand bei den Ex-Vulkanesen ist deutlich schlechter als in der Bevölkerung, und dies gilt auch für Vergleichsgruppen anderer Industriearbeiter", erklärte der Bremer Arbeits- und Gesundheitswissenschaftler Wolfgang Hien anlässlich der Vorstellung der Studie "Ein neuer Anfang wars am Ende nicht. Zehn Jahre Vulkan-Pleite: Was ist aus dem Menschen geworden?"
Die letzte Großwerft Bremens, der Bremer Vulkan, ging 1996 in Konkurs, alle Rettungsversuche zuvor waren fehlgeschlagen. Zurück blieben 2.500 Arbeiter und Angestellte, die in die Arbeitslosigkeit entlassen wurden. Viele von ihnen waren krank - durch Asbest, Schweiß- und Brennrauche und harte körperliche Arbeit. Zehn Jahre nach der Schließung der Bremer Vulkan-Werft leiden viele ehemalige Beschäftigte immer noch unter den Folgen ihrer Arbeitsbelastungen. "Der Gesundheitszustand bei den Ex-Vulkanesen ist deutlich schlechter als in der Bevölkerung, und dies gilt auch für Vergleichsgruppen anderer Industriearbeiter", erklärte der Bremer Arbeits- und Gesundheitswissenschaftler Wolfgang Hien anlässlich der Vorstellung der Studie "Ein neuer Anfang wars am Ende nicht. Zehn Jahre Vulkan-Pleite: Was ist aus dem Menschen geworden?"
Die Wissenschaftler wollten wissen, wie es den ehemaligen Vulkanesen heute hinsichtlich Arbeit, Gesundheit und Leben insgesamt geht. Im Dezember 2006 wurden alle noch lebenden bei der früheren Vulkan-Betriebskrankenkasse (Vulkan-BKK) Versicherten angeschrieben. Neben der schriftlichen Befragung wurden 35 offene Interviews durchgeführt. Mit Hilfe dieses Projekts wurde die einmalige Chance genutzt, dem Schicksal einer früheren Belegschaft und ihrer sozialen und gesundheitlichen Situation zehn Jahre nach dem kollektiven Arbeitsplatzverlust weiter nachzugehen.
Es zeigt sich, dass vor allem die Altergruppe der 50-59-Jährigen die Leidtragenden des Strukturwandels der Arbeitsgesellschaft sind. Viele von ihnen haben ernsthafte Krankheitssymptome, Folge eines langjährigen Gesundheitsverschleißes bei Vulkan, die sich nicht nur in körperlichen, sondern auch in psychischen Symptomen äußern. Für viele beginnt nach der Werftschließung ein langer und teilweise entwürdigender Leidensweg durch die Institutionen mit der Erfahrung von Langzeitarbeitslosigkeit, Krankheit und Frührente.
Am häufigsten findet man bei den befragten Schiffsbauern schwere Rückenleiden, verursacht durch das Heben und Tragen schwerer Lasten. Darüber hinaus leiden viele aber auch an Lungenerkrankungen durch schädliche Umgebungsbelastungen auf der Werft wie Asbeststaub und Rauch bei Schweißarbeiten. Auch psychische Störungen treten häufiger auf als bei anderen Industriearbeitern. "Praktisch bei allen Interviewpartnern wurde gesagt: Meine Psyche ist auch im Eimer", erklärte Wolfgang Hien. 28% leiden an depressiven Symptomen, bei anderen Industriearbeitern sind es nach einer repräsentativen deutschen Studie nur 12%. Ähnliche Differenzen zeigen sich auch für Krebserkrankungen, 7% der "Vulkanesen" sind betroffen, aber nur etwa 3% der übrigen Arbeiter in Industriebetrieben.
Die Studie zählt auch die Gründe für diese überdurchschnittliche Krankheitslast auf:
• harte körperliche Arbeit (schweres Heben und Tragen, Hitze, Kälte) und hohe Belastungen durch Asbeststäube, Schweiß- und Brennrauche und anderer gefährlicher Stoffe während der aktiven Vulkan-Zeit
• psychische Belastungen durch drohende oder eingetretene Arbeitslosigkeit und durchgehend negative Erfahrungen mit den Arbeitsbehörden (Behandlung als Bittsteller statt als Arbeitssuchende)
• physische und psychische Belastungen an neuen Arbeitsplätzen und viele negative Erfahrungen mit dem neuen Arbeitgeber (Diskriminierung, fehlende Anerkennung usw.)
• entwürdigende Behandlung durch medizinische Gutachter (MDK; Gutachter der Rentenversicherung, Berufsgenossenschaft). Typische Aussage: "Einfache Tätigkeiten im Sitzen - das können Sie doch noch"
• entwürdigende Behandlung durch die zuständige Berufsgenossenschaft (technische und medizinische Begutachtungen): "Ihr Lungenemphysem hat nichts mit Asbest oder den Schweiß- und Brennrauchen zu tun"
Für die Studie im Auftrag des Vereins «Arbeit und Zukunft» waren 310 Fragebögen und 35 Interviews von den Wissenschaftlern ausgewertet worden. Die Vulkan-Werft hatte im August 1997 ihre Tore geschlossen. Dabei verloren 2500 Menschen ihren Arbeitsplatz.
• Hier findet man eine Pressemitteilung der Universität Bremen: Zehn Jahre nach der Vulkan-Pleite: Was ist aus den Menschen geworden?
• Die Buchveröffentlichung ist im VSA-Verlag erschienen: Wolfgang Hien, Rolf Spalek, Ralph Joussen, Gudrun Funk, Renate von Schilling, Uwe Helmert: Ein neuer Anfang wars am Ende nicht. Zehn Jahre Vulkan-Pleite: Was ist aus den Menschen geworden? Eine Studie im Auftrag des Vereins Arbeit und Zukunft e.V. in Bremen zu Arbeit, Leben und Gesundheit der ehemaligen Vulkanesen, 128 Seiten (August 2007), ISBN 978-3-89965-268-0
• Hier findet man eine PDF-Datei mit Einleitung und Zusammenfassung der Ergebnisse als Buchauszug
Gerd Marstedt, 5.9.2007
Erwerbstätigenbefragung 2006: 60 Prozent klagen über Stress durch Termin- und Leistungsdruck
 Jeder zehnte Beschäftigte in Deutschland beurteilt seinen Gesundheitszustand als weniger gut oder schlecht. Dies ist ein Ergebnis der fünften Erwerbstätigenbefragung durch die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) und das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB). Die repräsentative Befragung von 20.000 Beschäftigten liefert aktuelle Daten über die Arbeitsbedingungen in Deutschland. Als Trend zeichnet sich eine zunehmende Flexibilisierung der Arbeitszeiten ab. Mangelnde Unterstützung durch Vorgesetzte und Kollegen, fehlende Informationen, Termin- und Zeitdruck belasten Betroffene stark. Etwa jeden achten Befragten große Angst vor dem Jobverlust. Demgegenüber beurteilt jedoch nur etwa die Hälfte (55%) die wirtschaftliche Lage ihres Betriebs als gut und sehr gut.
Jeder zehnte Beschäftigte in Deutschland beurteilt seinen Gesundheitszustand als weniger gut oder schlecht. Dies ist ein Ergebnis der fünften Erwerbstätigenbefragung durch die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) und das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB). Die repräsentative Befragung von 20.000 Beschäftigten liefert aktuelle Daten über die Arbeitsbedingungen in Deutschland. Als Trend zeichnet sich eine zunehmende Flexibilisierung der Arbeitszeiten ab. Mangelnde Unterstützung durch Vorgesetzte und Kollegen, fehlende Informationen, Termin- und Zeitdruck belasten Betroffene stark. Etwa jeden achten Befragten große Angst vor dem Jobverlust. Demgegenüber beurteilt jedoch nur etwa die Hälfte (55%) die wirtschaftliche Lage ihres Betriebs als gut und sehr gut.
Die Beschäftigten arbeiten länger als vereinbart. 61 Prozent leisten mehr als vierzig Wochenstunden ab, obwohl nur etwa ein Drittel (35%) Arbeitsverträge mit diesen Wochenarbeitszeiten hat. Viele Beschäftigte gehen zudem Nebentätigkeiten nach, sodass etwa jeder Fünfte (21%) über 48 Stunden in der Woche erwerbstätig ist. In Schichtarbeit arbeitet zumindest gelegentlich jeder vierte Beschäftigte. An Wochenenden fällt mindestens gelegentlich für 70 Prozent der Samstag und für 40 Prozent der Sonntag als Ruhetag aus. Etwa jeder Fünfte kennt Nachtarbeit aus eigener Erfahrung.
Hinsichtlich körperlicher Belastungen und der Umgebungsbedingungen nennen die Befragten Arbeiten im Sitzen (53%) oder Stehen (56%) am häufigsten. Jedoch fühlt sich nur jeder fünfte Betroffene durch Sitzen beziehungsweise jeder Vierte durch Stehen belastet. Bedingungen wie das Heben und Tragen schwerer Lasten, Lärm sowie Kälte oder Nässe finden mehr als 20 Prozent an ihrem Arbeitsplatz vor. Die beiden letztgenannten verzeichnen seit der letzten Befragung 1998/99 einen Anstieg. Diese Faktoren empfinden über die Hälfte der Betroffenen als belastend. Obwohl Zwangshaltung (14%) schlechte Lichtverhältnisse (9%) sowie Erschütterungen und Schwingungen (5%) seltener auftreten, erreichen sie ähnlich hohe Werte hinsichtlich der empfundenen Belastung.
Der Großteil der Befragten ist den beruflichen Anforderungen gewachsen. Angesichts seiner Qualifikation fühlt sich jedoch fast jeder Siebte unterfordert, angesichts des Arbeitspensums fast jeder Sechste überfordert. Mehr als die Hälfte der Befragten (54%) ist Termin- und Leistungsdruck ausgesetzt, fast 60 Prozent der Betroffenen empfinden ihn als belastend. Ähnlich verhält es sich mit Störungen bei der Arbeit. Ebenso führen vorgegebene Mindestleistungen sowie schnelles Arbeiten zu hohen Belastungsquoten. Bei mehr als der Hälfte der Befragten wiederholt sich der Arbeitsgang häufig in allen Einzelheiten, fast 60 Prozent müssen oft mehrere Vorgänge im Auge haben. Jedoch nur jeder siebte beziehungsweise jeder vierte Befragte empfindet das als belastend.
Etwa drei von vier Befragten leiden darunter, wenn ihnen eine Entscheidung zu spät mitgeteilt wird oder wenn ihnen alle notwendigen Informationen fehlen. Ersteres widerfährt jedem Achten (13%), letzteres immerhin jedem Zwölften (8%) häufig. Zwar bezeichnen über 80 Prozent der an der Befragung Teilnehmenden die Zusammenarbeit mit den Kollegen häufig als gut, nötige Unterstützung erhalten jedoch nur knapp 70 Prozent häufig. Nur auf jeden zweiten Chef ist immer Verlass, wenn seine Mitarbeiter Unterstützung benötigen. Mangelnde Unterstützung durch Kollegen (6%) und Vorgesetzte (16%) kommt zwar seltener vor, führt jedoch zu hohen Belastungsquoten.
Nur jeder dritte Betrieb bot in den vergangenen zwei Jahren Maßnahmen der Gesundheitsförderung an. Bestehende Angebote nutzen zwei von drei Befragten. Hingegen konnte nur etwa jeder Vierte die Frage bejahen, ob eine Gefährdungsbeurteilung an seinem Arbeitsplatz durchgeführt wurde. 60 Prozent antworteten mit Nein, 14 Prozent waren sich nicht sicher.
Eine 18seitige Zusammenfassung der Ergebnisse findet man auf der Website der BAuA: Arbeitsbedingungen in Deutschland - Belastungen, Anforderungen und Gesundheit
Gerd Marstedt, 15.8.2007
Harvard Medical School: Unerwünschte Wirkungen von langen Arzt-Arbeitszeiten und Schlafmangel auf Patienten und Ärzte.
 Nicht erst seitdem Arbeitszeitvorschriften der EU den Abbau überlanger Arbeits-, Schicht- oder Bereitschaftsdienste für Krankenhausärzte in Deutschland erzwangen, sondern eigentlich schon vorher waren die Risiken der tage-und nächtelangten Bereitschaftsdienste für die Gesundheit der Ärzte und vor allem für die Gesundheit und Sicherheit der von oft übermüdeten Ärzten behandelten Patienten klar gewesen.
Nicht erst seitdem Arbeitszeitvorschriften der EU den Abbau überlanger Arbeits-, Schicht- oder Bereitschaftsdienste für Krankenhausärzte in Deutschland erzwangen, sondern eigentlich schon vorher waren die Risiken der tage-und nächtelangten Bereitschaftsdienste für die Gesundheit der Ärzte und vor allem für die Gesundheit und Sicherheit der von oft übermüdeten Ärzten behandelten Patienten klar gewesen.
Gestützt wurde dies u.a. durch eine Fülle von Forschungsergebnissen aus den USA über die Auswirkungen von Übermüdung, die wir exemplarisch einem Überblicksartikel "Safety of Medical Residents' Long Hours Questioned" des National Public Radio [NPR] aus dem Jahr 2005 entnehmen.
Dabei zeigte sich beispielsweise, dass
• sich 24 Stunden Schlaflosigkeit oder -mangel ungefähr so auswirken wie ein Blutalkoholspiegel von 1 Promille,
• sich die durchschnittliche Reaktionszeit bei Individuen, die 24 Stunden hintereinander wach waren verdreifachte,
• sich Aufmerksamkeitsfehler bei den Ärzten häuften, die 24 aufeinanderfolgende Stunden arbeiteten bzw. in Rufbereitschaft waren,
• solche Fehler bei den Ärzten, die in einer 30-Stundenschicht arbeiteten, doppelt so häufig auftraten als bei ihren Kollegen, die 16 Stunden am Stück arbeiteten und
• dass es bei 30-Stundenschicht-Ärzten zu 36 % mehr ernsten medizinischen Irrtümern kam als bei den 16-Stundenschicht-Ärzten.
Wer noch mehr über das Thema langer Arbeitszeiten, Schlaf und Müdigkeit von Ärzten (differenziert nach Ärzten im Praktikum, Assistenzärzten und Fachärzten) und die vielfältigen Auswirkungen dieser Bedingungen in den USA und damit wenigstens teilweise auch in Deutschland wissen will, findet dies in konzentrierter Form auf einer speziellen Website des Bostoner "Brigham and Women's Hospital" und der "Harvard Medical School", die sie zu ihrem Forschungs- und Dokumentationsvorhaben "Harvard Work hours, health and safety study" gestaltet haben. Im Mittelpunkt dieses Projekts steht die Situation bei Assistenzärzten bzw. in postgraduierter Ausbildung befindlicher Ärzte in Krankenhäusern ("medical residents").
Auf der Seite finden sich u.a. komplette Originalveröffentlichungen vor allem aus dem Projekt in den beiden anerkannten us-amerikanischen Medizinjournals "New England Journal of Medicine (NEJM)" und "Journal of American Medical Association (JAMA)" zu Themen wie "Fatigue among Clinicians and the Safety of Patients" oder "Effects of Sleep Inertia on Cognition". Ergänzt werden diese wissenschaftlichen Arbeiten um Links zu Organisationen und ihren Materialien über die Auswirkungen von langen Arbeitszeiten und Schlafmangel. Zum Schluss gibt es die Möglichkeit, einen informellen Survey der beiden Institutionen über KFZ-Unfälle, Beinahe-Unfälle, medizinische Fehler und andere unerwünschte Folgen von Schlafmangel von Ärzten mit Berichten zu bedienen.
Auch die Endergebnisse der seit einiger Zeit in der Datenerfassung beendeten "Harvard Work hours, health and safety study" und weitere Forschungsergebnisse sollen auf der Website künftig zugänglich gemacht werden.
Bernard Braun, 7.8.2007
Hoher Stress am Arbeitsplatz verdoppelt das Risiko depressiver Erkrankungen bei jungen Arbeitnehmern
 Hoher Stress im Beruf, insbesondere durch ein nur schwer zu bewältigendes Arbeitspensum oder durch einen scharfen Zeit- und Termindruck, führt bei jüngeren Arbeitnehmern (Anfang der 30er) überdurchschnittlich häufig zu psychischen Problemen in Form von Angstzuständen und Depressionen. Dies hat jetzt eine Längsschnittstudie in Neuseeland gezeigt, bei der rund 1.000 Männer und Frauen, die 1972 oder 1973 geboren waren, hinsichtlich ihrer Arbeitsbedingungen und ihrer psychischen Verfassung näher untersucht wurden. Die Ergebnisse der von einem internationalen Forschungsteam aus England, Frankreich, Neuseeland und den USA durchgeführten Studie wurden jetzt in der Zeitschrift "Psychological Medicine" veröffentlicht.
Hoher Stress im Beruf, insbesondere durch ein nur schwer zu bewältigendes Arbeitspensum oder durch einen scharfen Zeit- und Termindruck, führt bei jüngeren Arbeitnehmern (Anfang der 30er) überdurchschnittlich häufig zu psychischen Problemen in Form von Angstzuständen und Depressionen. Dies hat jetzt eine Längsschnittstudie in Neuseeland gezeigt, bei der rund 1.000 Männer und Frauen, die 1972 oder 1973 geboren waren, hinsichtlich ihrer Arbeitsbedingungen und ihrer psychischen Verfassung näher untersucht wurden. Die Ergebnisse der von einem internationalen Forschungsteam aus England, Frankreich, Neuseeland und den USA durchgeführten Studie wurden jetzt in der Zeitschrift "Psychological Medicine" veröffentlicht.
Die Befragungsteilnehmer waren allesamt 1972/73 in der neuseeländischen Stadt Dunedin geboren und wurden im Rahmen einer umfassenden Längsschnittstudie bereits mehrfach in ihrem Leben zu unterschiedlichen Erfahrungen befragt. Jetzt im Alter von 32 Jahren lebten noch 972 der ursprünglich 1.010 Studienteilnehmer. In Interviews und schriftlichen Befragungen erhoben die Wissenschaftler bei ihnen einerseits mit Hilfe von Fragebögen Symptome depressiver Erkrankungen und von Angststörungen. Auf der anderen Seite erfasste man auch Merkmale der beruflichen Tätigkeit: Geistige Anforderungen, Verantwortungsdruck und Entscheidungsspielräume, körperliche Belastungen, Zeit- und Termindruck, soziale Unterstützung durch Vorgesetzte und Kollegen. In der Untersuchungsgruppe war eine Vielzahl unterschiedlicher Berufe vertreten, Schauspielerinnen und Chirurgen, Lehrer und Piloten, Journalisten und Polizisten.
Als Ergebnis zeigte sich:
• Insgesamt fand man bei 10% der Männer und 14% der Frauen Hinweise auf eine Depression.
• Bei knapp der Hälfte (45%) dieser Gruppen, bei denen man zum ersten Mal Anzeichen einer (zuvor noch nicht existenten) depressiven Erkrankung feststellte, war dies auf ein überdurchschnittlich hohes Ausmaß an beruflichem Stress zurückzuführen..
• Als besondere Risikofaktoren im Rahmen der beruflichen Belastungen erwiesen sich ein hohes Arbeitspensum und extremer Zeit- und Termindruck, der individuell nicht beeinflussbar war.
• Frauen und Männer zeigten gleichermaßen bei hohem Stress ein doppelt so großes Risiko (Männer 1.9, Frauen 2.0), depressive Symptome zu entwickeln.
Die Forscher betonen in ihrer Veröffentlichung, dass sie auch exakt überprüft haben, ob ihre Befunde nicht durch ganz andere Faktoren erklärbar sind als durch den Job-Stress. Sie konnten jedoch eine Reihe solcher Einflussmomente ausschließen: Die depressiven Symptome traten bei den Untersuchungsteilnehmern erstmals auf, vor Berufseintritt waren bei den Betroffenen keinerlei Merkmale psychischer Störungen feststellbar. Auch bei Kontrolle des sozialen Status (Einkommen, Bildungsniveau, Stellung im Beruf) bestätigten sich die gefundenen Ergebnisse. Und ebenso war nicht festzustellen, dass nun Persönlichkeitsfaktoren wirksam waren, die zu einer besonders negativen Darstellung der Arbeitsbedingungen führten, so dass man einen umgekehrten Wirkungsmechanismus (Depressive erleben ihre beruflichen Belastungen besonders eindringlich) unterstellen könnte.
Die Wissenschaftler erklären ihre Befunde aus den Folgen vermehrt ausgeschütteter Stress-Hormone, die wiederum mittel- und langfristig zu Schlafstörungen und Erschöpfungszuständen führen. Ebenso könnten fehlende zeitliche Möglichkeiten für ausgleichende Freizeitbeschäftigungen und soziale Kontakte eine Rolle spielen. "Einem besonders hohen Risiko unterliegen Arbeitstätigkeiten, bei denen Fehler schnell von anderen bemerkt werden," erklärte eine der Wissenschaftlerinnen, Professor Terrie Moffitt, "so wie zum Beispiel Vorgesetzte in einem Restaurant. Am anderen Ende des Stress-Spektrums steht die Tätigkeit von Leuten, die als Babysitter in privaten Haushalten tätig sind und nur zwei oder drei Kinder betreuen müssen."
Professor Cary Cooper, der für die Studie hauptverantwortliche Autor, wies auf Möglichkeiten der Veränderung hin. Zum einen sollten Arbeitszeiten flexibler geregelt werden, mit Möglichkeiten für freue Stunden oder Tage, statt Arbeitnehmer dauerhaft für lange Zeiten in Büros einzuschließen. Darüber hinaus erkennt er auch Probleme im Vorgesetztenverhalten, Untergebene müssten durch Delegation von Verantwortung das Gefühl bekommen, dass sie ihr Pensum und ihre Anforderungen jederzeit im Griff haben, auch wenn sie unter Zeitdruck stehen.
Ein kostenloses Abstract der Studie ist hier nachzulesen: Work stress precipitates depression and anxiety in young, working women and men (Psychological Medicine, Volume 37 Issue 08 , pp 1119-1129)
Gerd Marstedt, 2.8.2007
Nacht-, Schicht- und Wochenendarbeit: Manager klagen öfter über Krankheits- und Motivationsprobleme der Beschäftigten
 In fast jedem zweiten Betrieb in Europa wird dann gearbeitet, wenn der Durchschnitts-Beschäftigte schläft oder Freizeit hat - nachts, am Wochenende oder zu wechselnden Zeiten (wie bei Schichtarbeit). Die Unternehmen handeln sich mit der Flexibilität rund um die Uhr allerdings häufig massive Personalprobleme ein: Manager in Betrieben mit "unüblichen" Arbeitszeiten" klagen häufiger über mangelnde Motivation ihrer Mitarbeiter, höhere Fehlzeiten, hohen Krankenstand und Fluktuation. Dies zeigt eine aktuelle Untersuchung des Instituts Arbeit und Qualifikation (IAQ) der Universität Duisburg-Essen.
In fast jedem zweiten Betrieb in Europa wird dann gearbeitet, wenn der Durchschnitts-Beschäftigte schläft oder Freizeit hat - nachts, am Wochenende oder zu wechselnden Zeiten (wie bei Schichtarbeit). Die Unternehmen handeln sich mit der Flexibilität rund um die Uhr allerdings häufig massive Personalprobleme ein: Manager in Betrieben mit "unüblichen" Arbeitszeiten" klagen häufiger über mangelnde Motivation ihrer Mitarbeiter, höhere Fehlzeiten, hohen Krankenstand und Fluktuation. Dies zeigt eine aktuelle Untersuchung des Instituts Arbeit und Qualifikation (IAQ) der Universität Duisburg-Essen.
Die Studie basiert auf Daten der Europäischen Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen (Dublin). Befragt wurden über 26 000 Beschäftigte in Betrieben mit mehr als zehn Mitarbeitern aus 21 europäischen Ländern, in denen mindestens 20 Prozent der Beschäftigten zu unüblichen Zeiten arbeiten. Am meisten verbreitet sind Samstagsarbeit und wechselnde Arbeitszeiten wie etwa Schichtdienst. Schweden, Großbritannien und Finnland liegen hier an der Spitze, Deutschland und Frankreich teilen sich Platz vier, stellte die IAQ-Arbeitsmarktforscherin Dr. Angelika Kümmerling fest. In Dienstleistungsbranchen kommen Nacht- und Wochenendarbeit und wechselnde Arbeitszeiten inzwischen häufiger vor als im produzierenden Gewerbe.
Jeder vierte Betrieb in Europa arbeitet auch samstags, in Deutschland sogar fast jeder dritte. In den späten Abendstunden oder nachts arbeiten ungefähr neun Prozent aller europäischen Betriebe. Schichtarbeit und versetzte Arbeitszeiten sollen helfen, die individuelle Arbeitszeit von den Öffnungs- und Betriebszeiten zu entkoppeln. Jeder fünfte Betrieb in Europa nutzt diese Instrumente heute. In den neuen Mitgliedsstaaten der EU kommen die neuen Arbeitszeitformen sehr viel häufiger vor als in den alten Beitrittsländern.
Die Ausnahmen vom Standardarbeitstag helfen individuell oftmals, Familie und Beruf zu vereinbaren. Die Masse der Arbeitnehmer sieht sich aber im Konflikt zwischen Arbeitszeiten und den Anforderungen des Privat- und gesellschaftlichen Lebens. "Arbeiten zu müssen, während andere Freizeit haben, schränkt die privaten Lebenswünsche ein und behindert soziale Kontakte," so Dr. Angelika Kümmerling. Darüber hinaus sehen Manager sich auch mit massiven Personalproblemen konfrontiert. Dies geht aus zusätzlichen Befragungen nur von Vertretern im betrieblichen Management hervor. Dabei wurde das Management gefragt, ob sie sich in ihrem Betrieb mit Problemen wie Krankheit und Absentismus, Fluktuation oder geringer Motivation der Beschäftigten konfrontiert sähen.
• Dabei klagt etwa jeder vierte Manager in Betrieben, in denen mehr als 20% der Beschäftigten Nachtarbeit verrichten, über Abwesenheits- und Krankheitsprobleme der Arbeitnehmer - in Betrieben ohne Nachtarbeit nur etwa jeder zehnte.
• Ähnlich verhält sich mit der Fluktuation von Beschäftigten: Hier erkennen doppelt so viele Manager Probleme, wenn im Betrieb mehr als 20% in Nacht-, Wochenend- oder Schichtarbeit tätig sind.
• Und auch die Arbeitnehmer-Motivation wird nach den vorliegenden Daten negativ beeinflusst durch unübliche Arbeitszeitregelungen.
Der IAQ-Report von Angelika Kümmerling steht als PDF im Netz: Arbeiten, wenn andere frei haben - Nacht- und Wochenendarbeit im europäischen Vergleich
Gerd Marstedt, 25.7.2007
7 von 10 Erwerbstätigen sind im letzten Jahr trotz Krankheit zur Arbeit gegangen
 Insgesamt 71 Prozent der Deutschen sind in den vergangenen zwölf Monaten mindestens einmal zur Arbeit gegangen, obwohl sie sich richtig krank gefühlt haben. 46 Prozent geben an, dies sogar zweimal oder öfter getan zu haben. Das zeigt die aktuelle Bevölkerungsbefragung des Gesundheitsmonitors der Bertelsmann Stiftung. Gegen den Rat ihres Arztes der Arbeit nachgegangen sind demnach im vergangenen Jahr 30 Prozent der Bevölkerung mindestens einmal, etwa die Hälfte davon sogar mehrmals. Zur Genesung bis zum Wochenende durchgehalten haben 24 Prozent der Erwerbstätigen einmal und 44 Prozent zweimal oder öfter.
Insgesamt 71 Prozent der Deutschen sind in den vergangenen zwölf Monaten mindestens einmal zur Arbeit gegangen, obwohl sie sich richtig krank gefühlt haben. 46 Prozent geben an, dies sogar zweimal oder öfter getan zu haben. Das zeigt die aktuelle Bevölkerungsbefragung des Gesundheitsmonitors der Bertelsmann Stiftung. Gegen den Rat ihres Arztes der Arbeit nachgegangen sind demnach im vergangenen Jahr 30 Prozent der Bevölkerung mindestens einmal, etwa die Hälfte davon sogar mehrmals. Zur Genesung bis zum Wochenende durchgehalten haben 24 Prozent der Erwerbstätigen einmal und 44 Prozent zweimal oder öfter.
Als Beweggründe für das Arbeiten trotz gesundheitlicher Beschwerden werden vor allem Pflichtgefühl (53 Prozent) und Rücksicht auf Kolleginnen und Kollegen (46 Prozent) genannt. Jeweils rund ein Viertel der Deutschen äußert, dass die Angst vor beruflichen Nachteilen oder Arbeitsplatzverlust sie dazu bewogen hat, auch krank zur Arbeit zu gehen. Bei 13 Prozent der Befragten führt der Vorgesetzte regelmäßig ein Rückkehrgespräch mit dem Mitarbeiter, sobald er nach einer Krankschreibung wieder zur Arbeit erscheint.
Soweit es die Befragten übersehen können, kam es bei Kollegen, die in den letzten zwölf Monaten häufiger oder länger krank geschrieben waren, nur in Einzelfällen zu beruflichen Nachteilen, Abmahnungen oder Ähnlichem. Etwa ein Viertel der Befragten berichtet mit Blick auf häufig krankheitsbedingt fehlende Mitarbeiter von Hilfe und Unterstützung durch Kollegen sowie Rücksicht und Verständnis bei Vorgesetzten. Bei rund einem Drittel der Befragten ist dies jedoch nie der Fall.
"Die Zahlen weisen darauf hin, dass die Fehlzeiten als alleinige Kennzahl für den Gesundheitszustand der Arbeitnehmer nicht mehr ausreichen", sagt Andreas Heyer, Projektmanager im Kompetenzzentrum Unternehmenskultur/Führung der Bertelsmann Stiftung. "Vielmehr muss die Gesundheit und Leistungsfähigkeit der anwesenden Belegschaft in den Betrieben stärker beachtet werden. Denn Mitarbeiter, die sich trotz Krankheit zur Arbeit schleppen, sind durch Produktivitätseinbußen und Ansteckungsgefahr für Kollegen langfristig auch nicht im Interesse der Unternehmen", so Heyer.
Eine US-amerikanische Studie aus dem Jahr 2004 hat sogar zu zeigen versucht, dass die Produktivitätsverluste durch Arbeitnehmer, die krank zur Arbeit erscheinen, zumeist - etwa durch Chronifizierung der Beschwerden und später längerfristigere und gravierendere Erkrankungen - deutlich höher liegen als wenn Arbeitnehmer sich krank melden. Die Forscher der Cornell University sprechen bei dem Ereignis "trotz Krankheit zur Arbeit gehen" von "presenteeism", übersetzt etwa "Präsentismus" in Abgrenzung vom "Absentismus", also dem Fernbleiben vom Arbeitsplatz. Basis ihrer Analyse sind Daten von rund 375.000 Beschäftigten in den USA. Eine Pressemitteilung der Cornell University mit den wichtigsten Ergebnissen der Studie ist hier nachzulesen: Economists coin new word, 'presenteeism,' to describe worker slowdowns that account for up to 60 percent of employer health costs
In den vergangenen zehn Jahren ist der Krankenstand der Arbeitnehmer in Deutschland stetig gesunken auf nur noch 3,3 Prozent im Jahr 2006 (7,2 Tage pro Jahr). Dies ist das geringste Niveau seit der Wiedervereinigung. Heyer betont: "Eine partnerschaftliche Unternehmenskultur, die Mitarbeiter in Entscheidungsprozesse einbezieht, trägt entscheidend dazu bei, die Gesundheit der Mitarbeiter zu erhalten. Auch Faktoren wie Arbeitsorganisation, Arbeitsumgebung und Führungsverhalten beeinflussen, ob der Arbeitsplatz eine Belastung oder eine Ressource für die Gesundheit der Belegschaft darstellt."
Es ist unschwer zu prognostizieren, dass die aktuelle und wahrscheinlich schon mehrere Jahre anhaltende und kumulierende Nicht- oder Unterbehandlung von akuten und chronischen Erkrankungen das Risiko einer Chronifizierung von akuten Erkrankungen oder das Beschwerdenniveau bereits chronischer Erkrankungen erhöht. Von dort bis zu Erhöhung des Risikos von Frühberentung ist es dann nur noch ein kleiner Schritt. Wer gleichzeitig eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit für nötig erachtet oder einen drohenden Facharbeitermangel befürchtet, tut gut daran, betriebliche Gesundheitsförderung nicht allein an Krankenständen, sondern an dem hier dokumentierten Erkrankungszustand und des Umgangs mit gesundheitlichen Problemen zu orientieren.
Der Gesundheitsmonitor der Bertelsmann Stiftung befragt repräsentativ zweimal jährlich die Bevölkerung zu aktuellen Themen des deutschen Gesundheitswesens. Für die dargestellten Ergebnisse wurden im März und April 2007 insgesamt 1.689 Personen befragt. Hier ist die Pressemitteilung zur Umfrage: Mehrheit der Deutschen arbeitet auch im Krankheitsfall
Die aktuellen Befragungsergebnisse bestätigen weitgehend, was das Wissenschaftliche Institut der Ortskrankenkassen im Jahre 2003 an Befunden veröffentlicht hatte. Dort sagten:
91%: Ich versuche auch zur Arbeit zu gehen, wenn es mir nicht so gut geht.
78%: Ich melde mich nur dann krank, wenn der Arzt mich krank schreibt.
71%: Ich bin im letzten Jahr zur Arbeit gegangen, obwohl ich mich richtig krank gefühlt habe.
62%: Ich habe im letzten Jahr zur Genesung bis zum Wochenende gewartet.
30%: Ich bin im letzten Jahr gegen den Rat des Arztes meiner Arbeit nachgegangen.
21%: Ich habe im letzten Jahr zur Genesung Urlaubstage genommen.
Quelle: WIdO, GKV-Monitor 2003
Gerd Marstedt, 3.7.2007
EU-Studie zeigt: Kranke Arbeitnehmer werden häufiger arbeitslos und finden seltener einen neuen Arbeitsplatz
 Eine chronische Krankheit oder ein angegriffener Gesundheitszustand stellt in den meisten Ländern der EU ein überaus großes Risiko dar, den Arbeitsplatz zu verlieren oder nach einer Phase der Arbeitslosigkeit keinen neuen Arbeitsplatz zu bekommen. Dies ist das zentrale Ergebnis einer Studie niederländischer Wissenschaftler aus Rotterdam, die jetzt in der Zeitschrift "Journal of Epidemiology and Community Health" veröffentlicht wurde. Die Daten der Untersuchung stammen aus den ersten fünf Erhebungswellen (1994-1998) der sogenannten " European Community Household Panel (ECHP)", einer Längsschnittstudie der EU, die jährlich einen repräsentativen Querschnitt von EU-Bürgern zu unterschiedlichen Themen interviewt.
Eine chronische Krankheit oder ein angegriffener Gesundheitszustand stellt in den meisten Ländern der EU ein überaus großes Risiko dar, den Arbeitsplatz zu verlieren oder nach einer Phase der Arbeitslosigkeit keinen neuen Arbeitsplatz zu bekommen. Dies ist das zentrale Ergebnis einer Studie niederländischer Wissenschaftler aus Rotterdam, die jetzt in der Zeitschrift "Journal of Epidemiology and Community Health" veröffentlicht wurde. Die Daten der Untersuchung stammen aus den ersten fünf Erhebungswellen (1994-1998) der sogenannten " European Community Household Panel (ECHP)", einer Längsschnittstudie der EU, die jährlich einen repräsentativen Querschnitt von EU-Bürgern zu unterschiedlichen Themen interviewt.
Aus diesem Datensatz wurden zwei Gruppen von Personen ausgewählt: Die erste Gruppe bildeten etwa 4.500 Betroffene, die zumindest zwei Jahre lang arbeitslos gewesen waren. Von dieser Gruppe hatte etwa jeder Dritte (N=1590) später wieder eine neue Arbeitsstelle gefunden. Die zweite Gruppe bildeten etwa 57.000 Bürger/innen, die in den letzten zwei Jahren einer Erwerbsarbeit nachgegangen waren. Von diesen hatten etwa 6.200 ihre Berufstätigkeit aufgegeben bzw. aufgeben müssen, sei es aufgrund einer Entlassung und nachfolgenden Arbeitslosigkeit, sei es aufgrund krankheitsbedingter Frühverrentung, zum Teil auch (bei Frauen), weil sie aus familiären Gründen und Geburt eines Kindes nicht mehr berufstätig sein konnten. Der Gesundheitszustand wurde erfasst durch eine persönliche Selbsteinschätzung, ein Indikator, der sich in vielen Studie als zumindest genau so aussagekräftig (etwa für spätere Erkrankungen oder auch die Lebenserwartung) erwiesen hat wie "objektive" Einschätzungen von Ärzten. Darüber hinaus wurde auch gefragt, ob die Betroffenen an einer chronischen Erkrankung oder Behinderung leiden.
Um auch andere Faktoren zu berücksichtigen, die unabhängig vom Gesundheitszustand die Erwerbssituation beeinflussen können, wurden multivariate Analyseverfahren (logistische Regressionen) verwendet, in denen unter anderem auch Einkommenshöhe, Familienstand, Alter und Bildungsniveau als mögliche Einflussfaktoren berücksichtigt wurden. Als Ergebnis dieser Analysen zeigte sich dann:
• Die Chance, nach einer Arbeitslosigkeit wieder eine Stelle zu bekommen, ist für Männer wie Frauen mit schlechterem Gesundheitszustand nur etwa halb so hoch wie für Befragte mit gutem Gesundheitszustand.
• Auch das Risiko, seinen Arbeitsplatz zu verlieren, steigt bei EU-Bürgern mit weniger gutem Gesundheitszustand deutlich an. Besonders hoch ist dieses Risiko, wenn zusätzlich auch noch ein niedriger Bildungsabschluss vorliegt.
• Ähnliche Effekte zeigen sich auch für das Risiko einer Frühverrentung.
• Bei einer Analyse nach einzelnen Ländern zeigte sich, dass das Risiko des Arbeitsplatzverlusts aus gesundheitlichen Gründen besonders hoch in Deutschland, Dänemark und den Niederlanden ausfällt. Kranke Arbeitnehmer verlieren hier etwa 2,5-3mal so oft ihre Arbeit wie gesunde. Neben Belgien ist Deutschland das einzige Land, in dem auch die Risiken eioner krankheitsbedingten Frühverrentung besonders hoch ausfallen.
• Auch für das Geschlecht zeigt sich ein relevanter Effekt, insofern, als die genannten Risiken für Frauen teilweise noch höher ausfallen als für Männer.
Die Wissenschaftler schließen ihre Veröffentlichung mit dem Fazit ab: "Ein schlechter Gesundheitszustand ist in vielen europäischen Ländern ein wichtiger Einflussfaktor, ob man eine bezahlte Arbeit bekommt und on man sie auch behält. Diese Folgen eines schlechten Gesundheitszustands werden die soziale Ungleichheit weiter vergrößern. Es ist bekannt, dass Arbeitslosigkeit, Frühverrentung und Arbeitsunfähigkeit einen großen Teil der gesundheitlichen Ungleichheit in Europa ausmachen. Politisch wäre es daher von zentraler Bedeutung, Maßnahmen in die Wege zu leiten, die auf sozio-demographische Besonderheiten von Arbeitnehmern zugeschnitten sind. Diese sollten Arbeitnehmer mit schlechterem Gesundheitszustand wieder in die Erwerbstätigkeit integrieren und ebenso verhindern, dass Erwerbstätige mit angegriffener Gesundheit aus dem Erwerbsleben ausscheiden müssen."
Ein Abstract der Studie ist hier nachzulesen: The effects of ill health on entering and maintaining paid employment: evidence in European countries (Journal of Epidemiology and Community Health 2007;61:597-604; doi:10.1136/jech.2006.047456)
Gerd Marstedt, 20.6.2007
Arbeitszufriedenheit, Gesundheit und Arbeitsqualität von Ärzten - Wichtige Zusammenhänge für Ärzte und Patienten
 Auch wenn die Autoren - sämtlich Mitarbeiter des privaten Berliner "Instituts für Gesundheits- und Sozialforschung (IGES)" - dazu raten, "Ergebnisse der vorliegenden Übersicht in ihrer Übertragbarkeit auf Deutschland mit Vorsicht zu interpretieren", liefert ihre im Rahmen der Förderinitiative "Versorgungsforschung" der Bundesärztekammer entstandene Übersicht der internationalen Literatur über die "Arbeits- und Berufsunzufriedenheit von Ärzten einige beachtenswerte Ergebnisse.
Auch wenn die Autoren - sämtlich Mitarbeiter des privaten Berliner "Instituts für Gesundheits- und Sozialforschung (IGES)" - dazu raten, "Ergebnisse der vorliegenden Übersicht in ihrer Übertragbarkeit auf Deutschland mit Vorsicht zu interpretieren", liefert ihre im Rahmen der Förderinitiative "Versorgungsforschung" der Bundesärztekammer entstandene Übersicht der internationalen Literatur über die "Arbeits- und Berufsunzufriedenheit von Ärzten einige beachtenswerte Ergebnisse.
Zum einen ist das die Erkenntnis des auch hier erkennbaren Mangels an Studien, die sich mit dem Einfluss des komplexen Bündels von Einflussfaktoren auf die Zufriedenheit mit der Berufs- und Arbeitssituation und der ernsthaften Auswirkungen auf die Arzt- und Patientenseite beschäftigen. Angesichts der gesundheitlichen, ökonomischen, kulturellen und politischen Bedeutung der gesundheitlichen Versorgung oder sogar der rein quantitativen Bedeutung der allein in Deutschland jährlich stattfindenden vielen Hundertmillionen Arzt-Patientkontakten eigentlich unvorstellbar. Einige der jüngeren journalistischen Zusammenfassungen von Fallstudien über die Auswirkungen ihrer Arbeitsbedingungen auf die psychische und somatische Gesundheit von Ärzten in Deutschland (z.B. der am 25.1. 2007 in der Wochenzeitung "Die Zeit" erschienene Artikel "Guter Arzt, kranker Arzt") belegen nur die dringende Notwendigkeit systematischerer und repräsentativerer Untersuchungen.
Zu recht konstatieren die Autoren aber auch, dass der "Einfluss, den die Veränderung von Arbeitsbedingungen und professionellem Selbstverständnis von Ärzten auf die gesundheitliche Versorgung der Patienten und die Attraktivität des Arztberufes ausübt" auch schon vor der Durchführung von Studien wenig beachtet wird.
Zum anderen trägt der IGES-Review dann aber doch eine Reihe gesicherter Erkenntnisse über die vielschichtige Relevanz der Arbeitsunzufriedenheit der Ärzte zusammen.
Ihrer Recherche liegt ein so genanntes "Physician-Factor"-Modell zugrunde, das die folgenden 9 Einflussfaktoren umfasst: ökonomische Anreize und Einkommen sowie Arrangements der Risikoteilung, Organisationsform/Betriebstyp, Steuerung klinisch-ärztlicher Entscheidungen/Kooperation Medizin-Management, administrative Aufgaben, Autonomie versus Erfahrung externer Kontrolle, ärztliche Aus-, Fort- und Weiterbildung, ärztliches Berufsprestige/gesellschaftliche Anerkennung und soziodemografische und psychosoziale Aspekte. Bei den Ergebnisparametern unterscheiden die Berliner Reviewer arzt-, versorgungs- und patientenbezogene Resultate, die von "weichen" Faktoren wie der Zufriedenheit mit Familie und Freizeit" bis zu den "harten" Indikatoren der Kosten und Inanspruchnahmefrequenz reichen.
Die Resultate der Sichtung von letztlich 77 Publikationen, die allerdings überwiegend aus dem angloamerikanischen Gesundheitssystem stammen, lassen sich so zusammenfassen:
• Im Mittelpunkt der Studien standen vor allem die Auswirkungen neuer Organisationsformen ärztlicher Tätigkeit rings um die Managed Care-Umstrukturierung und von speziellen ökonomischen Anreizen in der Vergütung. Dabei zeigt sich z. B. eine hohe Assoziation von restriktiven Kopfpauschalen mit niedriger Arbeitszufriedenheit.
• In 44 % der berücksichtigten Studien wurden explizit Auswirkungen niedrigerer Arbeitszufriedenheit auf die medizinische Versorgung untersucht und auch gefunden. Dabei handelt es sich um Behandlungsfehler, Fehler bei der Arzneimitteltherapie und Nachlässigkeiten beim aufwändigen Herstellen eines für den Behandlungserfolg wichtigen Arzt-Patient-Zusammenhalts und der ebenfalls wichtigen Patienten-Compliance.
• Eine Reihe von Untersuchungen zeigen auch negative Auswirkungen individueller, beruflicher und organisationaler Faktoren auf die Prävalenz psychischer Erkrankungen von Ärzten (27 % der befragten Ärzte einer Studie hatten in einem standardisierten und validierten Fragebogen Werte, die auf eine psychische Erkrankung hinwiesen) auf gehäuftes Auftreten von Angstsymptomen und Depressionen und eine deutlich erhöhte Selbstmordrate.
Der Aufsatz über die wesentlichen Ergebnisse des Reviews endet mit einer Reihe methodischer Überlegungen für die Messung von Zufriedenheit, den Methodentyp (weg von der Dominanz von Querschnittsanalysen) und eine stärker ergebnisorientierte Forschung (z. B. durch Einbeziehung von Routinedaten der GKV) in der künftigen, evtl. ja auch mal in Deutschland stattfindenden, Forschung. Vorbildlich ist die komplette bibliografische Dokumentation der 77 reviewten Studien im Anhang des Aufsatzes.
Der Aufsatz von Gothe, Köster, Storz, Nolting und Häussler "Arbeits- und Berufszufriedenheit von Ärzten. Eine Übersicht der internationalen Literatur" ist am 18. Mai 2007 im "Deutschen Ärzteblatt" (Jg. 104, Heft 20: A 1394-1399 mit bibliografischem Anhang A1 bis A3) veröffentlicht und hier u.a. als PDF-Datei herunterladbar.
Bernard Braun, 29.5.2007
Personalabbau in Betrieben schädigt die psychische Gesundheit - auch der ungekündigten Arbeitnehmer
 Ängste um den Arbeitsplatz beinträchtigen nachhaltig die Gesundheit von Arbeitnehmern. Und Arbeitslose weisen überdurchschnittlich oft ein schlechteren psychischen und physischen Gesundheitszustand auf. So viel ist bekannt und durch viele Studien belegt. Eine neuere finnische Studie hat jetzt jedoch gezeigt, dass bei Personalabbau und Entlassungen auch diejenigen, die es nicht "erwischt" hat, in ganz erheblichem Maße von gesundheitlichen Beeinträchtigungen betroffen sind. Nachgewiesen wurde dies jetzt durch die sehr viel höhere Einnahme und medizinische Verordnung von stimmungsaufhellenden Medikamenten, Beruhigungs- und Schlafmitteln bei Arbeitnehmern, in deren Betrieb Entlassungen stattgefunden hatten.
Ängste um den Arbeitsplatz beinträchtigen nachhaltig die Gesundheit von Arbeitnehmern. Und Arbeitslose weisen überdurchschnittlich oft ein schlechteren psychischen und physischen Gesundheitszustand auf. So viel ist bekannt und durch viele Studien belegt. Eine neuere finnische Studie hat jetzt jedoch gezeigt, dass bei Personalabbau und Entlassungen auch diejenigen, die es nicht "erwischt" hat, in ganz erheblichem Maße von gesundheitlichen Beeinträchtigungen betroffen sind. Nachgewiesen wurde dies jetzt durch die sehr viel höhere Einnahme und medizinische Verordnung von stimmungsaufhellenden Medikamenten, Beruhigungs- und Schlafmitteln bei Arbeitnehmern, in deren Betrieb Entlassungen stattgefunden hatten.
Basis der jetzt im "Journal of Epidemiology and Community Health" veröffentlichten finnischen Studie sind Daten von über 22.000 Arbeitern und Angestellten des Öffentlichen Dienstes aus zehn finnischen Städten. Für den Zeitraum von 1994-2000 lagen für diese Arbeitnehmer einerseits Daten vor, in welchen Betrieben sie beschäftigt waren und wie sich der Personalbestand in diesen Unternehmen veränderte, also ob es größere Entlassungen gab oder personelle Kontinuität bzw. sogar zusätzliche Einstellungen. Die Beschäftigten wurden daraufhin drei Gruppen zugeordnet: Erwerbstätige in Unternehmen ohne nennenswerten Personalabbau, Erwerbstätige in Unternehmen mit Personalabbau und arbeitslos gewordene Beschäftigte.
Zum zweiten wurden diese Informationen dann verknüpft mit Daten des finnischen Sozialversicherung-Registers, das auch Daten über ärztliche Medikamentenverschreibungen enthält. Möglich war dies, weil jeder finnische Bürger bei der Geburt eine Identifikations-Nummer erhält, die bei allen Vorgängen im Kontakt mit den Einrichtungen des Wohlfahrtsstaats registriert ist.
Bei der Auswertung der Daten zeigte sich dann: Männliche Arbeitnehmer, in deren Betrieb größere Entlassungen stattgefunden hatten, nahmen wesentlich häufiger Medikamente gegen psychiatrische Erkrankungen ein im Vergleich zu Arbeitnehmern ohne diese Negativerfahrungen. Und dies lies sich auch feststellen für arbeitslos gewordene Beschäftigte. Die Quoten variierten dabei nach Geschlecht und ob jemand Angestellter oder Arbeiter war. Männliche Arbeiter, die arbeitslos geworden waren, nahmen 2,2mal so oft entsprechende Medikamente ein. Wenn sie Entlassungen in ihrem Betrieb erfahren hatten, war dies 1,7mal so oft der Fall. Berücksichtigt wurden Antidepressiva, Anxiolytika und Hypnotika (stimmungsaufhellende Medikamente, Beruhigungs- und Schlafmittel). Bei Angestellten lagen die Quoten (Odds-Ration) bei 1,4 bzw. 1,9.
Bei weiblichen Erwerbstätigen war der Einfluss von Entlassungs-Erfahrungen deutlich niedriger oder statistisch nicht signifikant. Statistisch kontrolliert wurde in der Studie, ob sich die drei Gruppen nicht im Hinblick auf Merkmale (wie Bildungsniveau, Alter, Geschlecht, Stellung im Beruf) unterscheiden, die ganz unabhängig von betrieblichen Entlassungs-Erfahrungen einen Zusammenhang zur Einnahme von Medikamenten aufweisen. Bei anderen Medikamenten, die nicht zur Therapie psychischer Beeinträchtigungen eingesetzt werden, konnten keinerlei Zusammenhänge festgestellt werden.
Die Studie zeigt damit in eindrucksvoller Weise auf, dass nicht nur Arbeitslosigkeit, sondern auch schon Arbeitsplatzunsicherheit aufgrund der mittelbaren Erfahrung betrieblichen Personalabbaus gesundheitliche Beeinträchtigungen hervorruft. Die zuletzt immer wieder in Auswertungen der GKV-Kassen von Arbeitsunfähigkeitsdaten beobachtete Zunahme psychiatrischer und insbesondere depressiver Erkrankungen kann in Anbetracht der Forschungsbefunde und der stets aufs Neue vermeldeten Berichte über beschlossene oder geplante Massenentlassungen großer Konzerne nicht mehr verwundern.
Die Studie ist hier im Volltext kostenlos verfügbar: Organisational downsizing and increased use of psychotropic drugs among employees who remain in employment (J Epidemiol Community Health 2007;61:154-158)
Bereits im Jahre 2004 hatte das finnische Forschungsteam eine Studie veröffentlicht, die mit einer vergleichbar großen Stichprobe (ebenfalls aus der sog. finnischen "10-Städte-Studie") andere gesundheitliche Negativeffekte für die Erfahrung von Personalabbau aufgezeigt hatte. Dort war deutlich geworden, dass Beschäftigte, deren Unternehmen Entlassungen durchgeführt hatten, in der Folgezeit deutlich häufiger krankgeschrieben waren und sogar eine zweimal höhere Mortalität aufgrund von Herz-Kreislauferkrankungen aufwiesen als Arbeitnehmer ohne solch beunruhigende Erfahrungen.
Auch diese Studie ist kostenlos im Volltext verfügbar: Organisational downsizing, sickness absence, and mortality: 10-town prospective cohort study (BMJ 2004;328:555, March, 6)
Gerd Marstedt, 10.5.2007
Arbeitsplatzängste sind mit eine Ursache für die Volkskrankheit Depression
 Jede dritte Frühverrentung in Deutschland wird verursacht durch eine psychische Erkrankung, wobei Depressionen den Hauptanteil stellen. Damit sind knapp 7% aller Frühverrentungen Folge einer chronisch gewordenen depressiven Erkrankung, die zu dauerhafter Erwerbsunfähigkeit führt. Dass auch psychische Belastungen in der Arbeitswelt und insbesondere die Angst vor einem Verlust des Arbeitsplatzes mit darauf folgender Arbeitslosigkeit eine wesentliche Ursache für Depressionen sein können, hat jetzt eine Literaturstudie gezeigt, die in der Zeitschrift "Gute Arbeit" veröffentlicht wurde.
Jede dritte Frühverrentung in Deutschland wird verursacht durch eine psychische Erkrankung, wobei Depressionen den Hauptanteil stellen. Damit sind knapp 7% aller Frühverrentungen Folge einer chronisch gewordenen depressiven Erkrankung, die zu dauerhafter Erwerbsunfähigkeit führt. Dass auch psychische Belastungen in der Arbeitswelt und insbesondere die Angst vor einem Verlust des Arbeitsplatzes mit darauf folgender Arbeitslosigkeit eine wesentliche Ursache für Depressionen sein können, hat jetzt eine Literaturstudie gezeigt, die in der Zeitschrift "Gute Arbeit" veröffentlicht wurde.
Dass psychische Erkrankungen sich in den letzten Jahrzehnten immer stärker verbreitet haben und zu einer Volkskrankheit geworden sind, ist keine Neuigkeit. Erst unlängst hatte die EU in einem Dossier "Grünbuch psychische Gesundheit" festgestellt, dass Depressionen und Angststörungen die am weitesten verbreiteten Krankheiten in der EU seien, 27% aller Erwachsenen sind betroffen. Und auch in einer Broschüre des BMBF "Es ist, als ob die Seele unwohl wäre... Depression - Wege aus der Schwermut. Forscher bringen Licht in die Lebensfinsternis" wurde kürzlich auf die zunehmende Bedeutung hingewiesen: Rund vier Millionen Menschen in Deutschland leiden an einer Depression.
Über die Ursachen der Depression wird seltener berichtet. Dass dabei auch psychische Belastungen im Berufsleben und insbesondere Arbeitsplatzängste eine große Rolle spielen können, hat jetzt eine Veröffentlichung des Bremer Sozialwissenschaftlers Dr. Wolfgang Hien gezeigt, der mehrere Studien über den Zusammenhang von Arbeitsbedingungen und psychischen Störungen noch einmal bilanziert hat. Dabei zeigt sich ein sehr deutlicher Zusammenhang zwischen dem Belastungsniveau und der psychischen Gesundheit.
• So fand eine australische Studie bei rund 1.200 hoch qualifizierten Berufstätigen, dass in einer Gruppe mit hoher Arbeitsplatzunsicherheit Depressionen 3,5mal so oft auftauchten im Vergleich zu anderen, die ihren Arbeitsplatz als relativ sicher wahrnahmen. Auch der allgemeine Gesundheitszustand war deutlich beeinflusst von Arbeitsplatzängsten. In der Studie wurde dabei auch der Einfluss anderer Faktoren (wie Krankheiten, Familienstand, Stresserfahrungen im sozialen Umfeld) kontrolliert.
• In einer Studie in Kanada wurden 6.000 Erwerbstätige zweimal im Abstand von 12 Monaten interviewt. Bei der ersten Befragung wurde das Ausmaß der Stressbelastungen im Betrieb erfasst. Nach einem Jahr wurde dann überprüft, ob eine depressive Erkrankung vorlag. Es zeigte sich, dass bei hohem Stress das Risiko für eine Depression um das zweieinhalbfache erhöht war.
• Eine finnische Studie, der die Daten von 15.000 Personen zugrunde lag, kam zu dem Ergebnis, dass vor allem eine mit geringem Einkommen verbundene Arbeitslosigkeit ein hohes Gesundheitsrisiko darstellt. Im Vergleich zu Personen mit fester Beschäftigung lag das Risiko, an einer Depression zu erkranken, bei Frauen zweimal so hoch, bei Männern sogar 3,5mal so hoch.
In der Literaturstudie wird nicht nur der Zusammenhang von Arbeit bzw. Arbeitslosigkeit und psychischen Erkrankungen, insbesondere depressiven Störungen bilanziert. Darüber hinaus werden auch die Arbeitsmarktprobleme von bereits psychisch Erkrankten, der Zusammenhang von Depression und Älterwerden sowie die Bedeutung von Freiräumen und Fragen der Prävention erörtert.
Die Literaturstudie ist hier nachzulesen (PDF, 6 Seiten): Wolfgang Hien: Volkskrankheit Depression - auch eine Folge von schlechten Arbeitsbedingungen und Arbeitslosigkeit
Der Bremer Gesundheits- und Sozialwissenschaftler Dr. Wolfgang Hien betreibt das "Forschungsbüro für Arbeit, Gesundheit und Biographie". Auf seiner Homepage findet sich noch eine Reihe weiterer Aufsätze und Vorträge zum Themenkreis Arbeit und Gesundheit. Forschungsbüro für Arbeit, Gesundheit und Biographie
Gerd Marstedt, 30.4.2007
Berufliche Belastungen in Europa 1990-2005: Arbeitsintensität und Zeitdruck sind massiv gestiegen
 Die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen hat ihren 4.Bericht über Arbeitsbedingungen und berufliche Belastungen in Europa vorgelegt, der auf einer Umfrage von fast 30.000 Arbeitnehmern in 31 Ländern basiert. Betrachtet man die Entwicklungstendenzen seit dem ersten Bericht im Jahre 1990, so werden recht widersprüchliche Entwicklungstendenzen deutlich, was die Qualität der Arbeitsbedingungen anbetrifft.
Die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen hat ihren 4.Bericht über Arbeitsbedingungen und berufliche Belastungen in Europa vorgelegt, der auf einer Umfrage von fast 30.000 Arbeitnehmern in 31 Ländern basiert. Betrachtet man die Entwicklungstendenzen seit dem ersten Bericht im Jahre 1990, so werden recht widersprüchliche Entwicklungstendenzen deutlich, was die Qualität der Arbeitsbedingungen anbetrifft.
So zeigt sich einerseits, dass die Anzahl der Arbeitnehmer, die ihre Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz als gefährdet ansehen, in den letzten 15 Jahren leicht zurückgegangen ist: Von 31 % im Jahr 1991 auf 27 % im Jahr 2005. Allerdings bestehen in diesem Punkt deutliche Unterschiede zwischen den alten EU15-Ländern (25 %) und den neuen Mitgliedstaaten (40 %). Positiv hervorgehoben wird in dem Bericht auch, dass der Anteil der in hoch qualifizierten Angestelltenberufen beschäftigten Arbeitnehmer in den vergangenen 15 Jahren von 32 % auf 38 % gestiegen ist. Der Anteil der Arbeitsplätze für hoch qualifizierte Angestellte liegt mittlerweile in vielen Ländern einschl. Deutschland bei mindestens 40 %.
Auf der anderen Seite zeigen sich jedoch auch einige Befunde, die auf negative Entwicklungstendenzen und Veränderungsbedarfe hindeuten:
• Arbeitsintensität, Zeitdruck und Stress sind seit 1990 deutlich gestiegen. Der Anteil an Beschäftigten, der zumindest gelegentlich unter sehr hohem Zeitdruck arbeiten muss, hat sich von 64% auf 79% erhöht. Ähnliche Tendenzen gibt es für die Arbeit unter sehr starkem Termindruck.
• In der Bezahlung klafft zwischen Männern und Frauen weiterhin eine deutliche Lücke. Tendenzen, dass diese Lücke sich schließen könnte, sind nicht zu erkennen. Rund die Hälfte aller Frauen in den Ländern der EU25 sind dem unteren Drittel der Einkommensskala zuzuordnen.
• Die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit ist in den letzten 15 Jahren kontinuierlich gesunken. Dies liegt vor allem an der zunehmenden Bedeutung von Teilzeitarbeit und der dem Abbau extrem hoher Überstunden-Arbeit. Insgesamt ist eine deutliche Zunahme "atypischer Beschäftigungsverhältnisse" erkennbar: Teilzeitarbeit ist von 13% auf 18% gestiegen, befristete Beschäftigung ist insbesondere von 1990-2000 deutlich häufiger geworden. Ebenso ist die Zahl der Arbeitnehmer mit mehr als einem Job angestiegen.
• Zwar berichten die meisten Arbeitnehmer, dass sie selbst verantwortlich sind für die Arbeitsqualität (73%), dass sie unvorhergesehene Probleme selbständig lösen (81%) oder dass sie bei ihrer Arbeit auch Neues lernen (70%). In der Entwicklung der letzten 10 Jahre zeigt sich jedoch, dass diese Merkmale einer qualifizierten und autonomen Arbeit nicht massiv, aber kontinuierlich abgenommen haben (jeweils um rund 5%).
Weitere Ergebnisse der Studie:
• Der Anteil jener Arbeitnehmer, deren unmittelbarer Vorgesetzter eine Frau ist, hat in den letzten zehn Jahren stetig zugenommen. In den zehn neuen Mitgliedstaaten ist der Anteil an weiblichen Vorgesetzten mit 29 % deutlich höher als in den EU15-Ländern (24 %).
• Vier von fünf Arbeitnehmern (80 %) geben an, dass sie zufrieden mit der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben sind. Allerdings berichten über 44 % der Arbeitnehmer, die über die Normalarbeitszeit hinaus arbeiten (mehr als 48 Stunden pro Woche), dass sie mit der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben unzufrieden sind.
• Für die meisten europäischen Arbeitnehmer scheint die Normalarbeitszeit nach wie vor die Norm zu sein. In den EU27-Ländern ist für die Mehrheit der Erwerbsbevölkerung die Arbeitszeit insgesamt durch eine Kern-Arbeitswoche von fünf Arbeitstagen und 40 Arbeitsstunden gekennzeichnet. Über 55 % aller Arbeitnehmer arbeiten jeden Tag dieselbe Anzahl an Stunden, und mehr als 70 % arbeiten in jeder Woche dieselbe Anzahl an Tagen. Der Anteil der Arbeitnehmer, die außerhalb der üblichen Arbeitszeiten (nachts oder an den Wochenenden) arbeiten, ist seit 1995 leicht zurückgegangen.
Die europäischen Erhebungen über die Arbeitsbedingungen liefern seit 1990 alle fünf Jahre viele Daten zur Qualität der Arbeit, darunter zu Themen wie Arbeitsorganisation, Arbeitszeit, Chancengleichheit, Aus- und Weiterbildung, Gesundheit und Wohlbefinden sowie Zufriedenheit mit der Arbeit. Ende 2005 wurden dazu Befragungen von knapp 30.000 Arbeitnehmern aus 31 Ländern (EU25 sowie Bulgarien, Rumänien, Kroatien, Norwegen, Schweiz und Türkei) durchgeführt.
• Hier ist eine Zusammenfassung des 4.Berichts mit den Ergebnissen von 2005 (PDF, 12 Seiten)
Fourth European Working Conditions Survey - Résumé
• Der komplette Bericht (PDF, 139 Seiten) ist hier verfügbar:
Fourth European Working Conditions Survey
• Entwicklungstendenzen aus den Erhebungen 1991-2005 (PDF, 8 Seiten):
Fifteen years of working conditions in the EU: charting the trends
• Hier ist die Website der
Europäischen Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen
Gerd Marstedt, 22.2.2007
Krankenstand auf Rekordtief: Viele Arbeitnehmer gehen auch krank zur Arbeit
 Der Krankenstand sank 2006 auf 3,0 Prozent, während er im Vorjahr noch bei 3,1 Prozent lag. DAK-Versicherte waren 2006 durchschnittlich nur noch 11,1 Tage krank (2005: 11,3 Tage) und knapp sechs von zehn Arbeitnehmern (56 Prozent) waren gar nicht krank. Seit Einführung der Lohnfortzahlung war der Krankenstand in Deutschland noch nie so niedrig. "Ob die erwerbstätige Bevölkerung jedoch wirklich gesünder ist als vor 20 Jahren, muss aber bezweifelt werden," kommentierte Herbert Rebscher die Veröffentlichung der Zahlen im DAK Gesundheitsreport 2007. "Experten vermuten, dass der Druck am Arbeitsmarkt und die Angst, den Job zu verlieren, manche Menschen auch krank zur Arbeit gehen lässt. Allerdings zeigt eine Analyse des Krankenstandes in den verschieden Branchen, dass auch andere Faktoren Einfluss auf die Höhe des Krankenstandes haben. Dazu gehören die Arbeitsbedingungen wie körperliche Belastungen, eigene Gestaltungsspielräume, aber auch Arbeitsmotivation, Betriebsklima und Betriebsgröße."
Der Krankenstand sank 2006 auf 3,0 Prozent, während er im Vorjahr noch bei 3,1 Prozent lag. DAK-Versicherte waren 2006 durchschnittlich nur noch 11,1 Tage krank (2005: 11,3 Tage) und knapp sechs von zehn Arbeitnehmern (56 Prozent) waren gar nicht krank. Seit Einführung der Lohnfortzahlung war der Krankenstand in Deutschland noch nie so niedrig. "Ob die erwerbstätige Bevölkerung jedoch wirklich gesünder ist als vor 20 Jahren, muss aber bezweifelt werden," kommentierte Herbert Rebscher die Veröffentlichung der Zahlen im DAK Gesundheitsreport 2007. "Experten vermuten, dass der Druck am Arbeitsmarkt und die Angst, den Job zu verlieren, manche Menschen auch krank zur Arbeit gehen lässt. Allerdings zeigt eine Analyse des Krankenstandes in den verschieden Branchen, dass auch andere Faktoren Einfluss auf die Höhe des Krankenstandes haben. Dazu gehören die Arbeitsbedingungen wie körperliche Belastungen, eigene Gestaltungsspielräume, aber auch Arbeitsmotivation, Betriebsklima und Betriebsgröße."
Die DAK hat zusammen mit dem Institut für Gesundheits- und Sozialforschung (IGES) die Krankschreibungen von 2,6 Millionen erwerbstätigen Mitgliedern ausgewertet und besonders Kopfschmerzerkrankungen untersucht. Ergebnis des Reports: Mehr als die Hälfte aller Deutschen hatte im letzten halben Jahr Kopfschmerzen. 17 Prozent gaben an, unter Migräne zu leiden. Kopfschmerzerkrankungen führen überwiegend zu vergleichsweise kurzen Fehlzeiten. Nahezu 70 Prozent der Erkrankungsfälle dauern maximal drei Tage. Überraschend: Besonders häufig fehlen 15- bis 24-Jährige aufgrund von Kopfschmerzen am Arbeitsplatz. "Kopfschmerzen und Migräne werden häufig bagatellisiert," so Rebscher. "Sie sind keine Drückeberger-Krankheiten, sondern oft mit hohem Leidensdruck und Leistungseinschränkungen verbunden."
Hier findet man den DAK Gesundheitsreport 2007 (PDF, 136 Seiten)
Weitere Pressematerialien zum Gesundheitsreport
Dass der niedrige Krankenstand nicht primär damit zusammenhängt, dass Arbeitnehmer/innen immer gesünderer sind, ist im Übrigen nicht nur eine Vermutung von Experten. Dem widerspricht zum einen die Beobachtung, dass der Krankenstand in den letzten 15 Jahren um rund ein Drittel gesunken ist, obwohl das Durchschnittsalter der Erwerbsbevölkerung in diesem Zeitraum um 2 Jahre gestiegen ist ist. Zum anderen zeigt auch eine Befragung des "GKV-Monitor", durchgeführt vom Wissenschaftlichen Institut der Ortskrankenkassen (WidO), dass sehr viele Beschäftigte aufgrund von Ängsten um ihren Arbeitsplatz trotz Krankheit und gesundheitlicher Beschwerden zur Arbeit gehen.
So antworteten knapp 2.000 Erwerbstätige im Jahr 2003 auf die Frage "Wie sieht das bei Ihnen aus - wie verhalten Sie sich im Krankheitsfall?" (Trifft-Zu-Antworten)
• Ich versuche auch zur Arbeit zu gehen, wenn es mir nicht so gut geht: 91%
• Ich melde mich nur dann krank, wenn der Arzt mich krank schreibt: 78%
• Ich bin im letzten Jahr zur Arbeit gegangen, obwohl ich mich richtig krank gefühlt habe: 71%
• Ich habe im letzten Jahr zur Genesung bis zum Wochenende gewartet: 62%
• Ich bin im letzten Jahr gegen den Rat des Arztes meiner Arbeit nachgegangen: 30%
• Ich habe im letzten Jahr zur Genesung Urlaubstage genommen: 21%
• Kurze Meldung zu den Ergebnissen: Krankmeldungen weiter rückläufig - Jeder Zweite hat Angst, seinen Job zu verlieren - WidO 17.06.03
• Presse-Info zum Fehlzeiten-Report mit obigen Daten
Gerd Marstedt, 13.2.2007
Warum viele Arbeitnehmer so früh wie möglich in Rente gehen wollen - Befunde einer EU-Studie
 Das Renteneintrittsalter ist unlängst pauschal erhöht worden auf 67 Jahre, ungeachtet der Tatsache, dass viele Erwerbstätige in Berufen mit hohen körperlichen Belastungen und gesundheitsgefährdenden Umgebungseinflüssen meist schon Mitte 50 aufgrund körperlichen Verschleißes vorzeitig in Rente gehen müssen. Es sind jedoch nicht nur Bauarbeiter, Schweißer oder Dachdecker, die heute ein frühzeitiges Ende ihrer Erwerbstätigkeit herbeisehnen: Der Wunsch nach einem Ausstieg aus Arbeitsstress und beruflichen Belastungen ist heute ein Wunsch sehr vieler Arbeitnehmer. Aber es gibt Unterschiede: Dieses Interesse ist besonders stark ausgeprägt bei Beschäftigten, die ihre Arbeitstätigkeit als besonders belastend und unbefriedigend erleben.
Das Renteneintrittsalter ist unlängst pauschal erhöht worden auf 67 Jahre, ungeachtet der Tatsache, dass viele Erwerbstätige in Berufen mit hohen körperlichen Belastungen und gesundheitsgefährdenden Umgebungseinflüssen meist schon Mitte 50 aufgrund körperlichen Verschleißes vorzeitig in Rente gehen müssen. Es sind jedoch nicht nur Bauarbeiter, Schweißer oder Dachdecker, die heute ein frühzeitiges Ende ihrer Erwerbstätigkeit herbeisehnen: Der Wunsch nach einem Ausstieg aus Arbeitsstress und beruflichen Belastungen ist heute ein Wunsch sehr vieler Arbeitnehmer. Aber es gibt Unterschiede: Dieses Interesse ist besonders stark ausgeprägt bei Beschäftigten, die ihre Arbeitstätigkeit als besonders belastend und unbefriedigend erleben.
Während noch vor 30 oder 40 Jahren recht häufig ein "Rentenschock" beobachtet wurde, weil Beschäftigte den Renteneintritt als Identitäts-Verlust und Erfahrung ihrer Entbehrlichkeit erlebten, ist es heute genau umgekehrt: Arbeitnehmer ersehnen zumeist ein möglichst baldiges Ende ihrer Berufstätigkeit. Nicht selten wurde dahinter ein kultureller Verfall von Wertorientierungen vermutet, ein Einfall von Hedonismus und ein Verfall der Leistungsmotivation. Tatsächlich, so haben Forschungsergebnisse jetzt gezeigt, ist der Wunsch nach frühzeitigem Eintritt in die Rente nichts anderes als eine Reaktion auf unbefriedigende, körperlich wie psychisch belastende Arbeitsanforderungen. Die Forschungsergebnisse stammen aus dem von der EU finanzierten Projekt "SHARE", das bei 22.000 Personen im Alter von 50 oder mehr Jahren aus 11 europäischen Ländern, von Skandinavien bis zum Mittelmeer, wiederholt Befragungen zum Gesundheitszustand und Lebensqualität, Freizeit und Verrentung durchführt. In einer Teilstichprobe von fast 7.000 Männern und Frauen wurde nun analysiert, wie sich verschiedene Merkmale wie Gesundheitszustand, Wohlbefinden und auch die erlebte Qualität der Arbeitsbedingungen auf den Wunsch nach einem Verbleib im Erwerbsleben bzw. frühzeitigem Ausscheiden auswirken. Obwohl es hier einige Differenzen zwischen Arbeitnehmern verschiedener EU-Staaten gab, zeigte sich doch durchgängig auch der Effekt: Je geringer die Entscheidungsspielräume am Arbeitsplatz sind, je ungünstiger das Verhältnis von beruflicher Leistung und Belohnung ausfällt, desto eher möchten die befragten Erwerbstätigen in Rente gehen.
Ein Abstract des Aufsatzes findet man hier: Quality of work, well-being, and intended early retirement of older employees - baseline results from the SHARE Study (The European Journal of Public Health 2007 17(1):62-68)
Schon zuvor waren in einer anderen Veröffentlichung mit Ergebnissen aus dem SHARE-Projekt (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) ähnliche Ergebnisse berichtet worden. So zeigt sich:
• Der Wunsch nach einem möglichst frühzeitigen Ausstieg aus dem Erwerbsleben ist bei älteren Arbeitnehmern (50+) in den einzelnen europäischen Ländern höchst ungleich ausgeprägt. So schnell wie möglich in Rente gehen möchten 67% der Spanier, 60% der Italiener, 57% der Franzosen und 54% der Österreicher, während dies nur 33% der Schweizer und 31% der Niederländer wünschen. Deutsche, Dänen und Schweden liegen hier (mit 43-45%) im Mittelfeld. Eine eindeutige und schlüssige Erklärung für diese großen länderspezifischen Unterschiede konnten die Wissenschaftler bislang nicht finden.
• Parallel zu diesen länderspezifischen Ergebnissen zeigt sich jedoch auch, dass zwischen einzelnen Beschäftigten große Unterschiede bestehen, je nachdem wie ihre Arbeitsbedingungen sind. So steigt der Wunsch nach möglichst frühem Rentenbeginn bei hoher Arbeitsintensität und Stress oder geringen Möglichkeiten beruflicher Weiterentwicklung. Einen besonders starken Effekt haben Ängste, aufgrund von Krankheit und Arbeitsunfähigkeit betriebliche Sanktionen zu erfahren.
• Der Aufsatz ist hier im Volltext nachlesbar: Retirement intentions, health and satisfaction at work: a European comparison. Issues in Health Economics No. 103, IRDES: Paris
• Der komplette erste Berichtsband zum SHARE-Projekt ist hier verfügbar (9.6 MB, 372 Seiten)
• Hier findet man eine Übersicht über die vielfältigen, meist online verfügbaren Veröffentlichungen von SHARE: SHARE-Publications
Gerd Marstedt, 8.2.2007
Ein-Euro-Jobs verdrängen reguläre Arbeitsplätze "in nicht zu vernachlässigendem Umfang"
 Die Ergebnisse einer anonymisierten Arbeitgeberbefragung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) deuten darauf hin, dass Ein-Euro-Jobs reguläre Beschäftigung "in nicht zu vernachlässigendem Umfang" ersetzen. In vier Prozent der Einrichtungen, die Ein-Euro-Jobber beschäftigen, waren nach Angaben der Befragten Personaleinsparungen die Folge. Hochgerechnet handelt es sich bundesweit um mehr als 2000 Einrichtungen. Wie viele Arbeitsplätze betroffen sind, lasse sich aus den bislang vorliegenden Daten allerdings nicht bestimmen, betonen die IAB-Forscherinnen Anja Kettner und Martina Rebien.
Die Ergebnisse einer anonymisierten Arbeitgeberbefragung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) deuten darauf hin, dass Ein-Euro-Jobs reguläre Beschäftigung "in nicht zu vernachlässigendem Umfang" ersetzen. In vier Prozent der Einrichtungen, die Ein-Euro-Jobber beschäftigen, waren nach Angaben der Befragten Personaleinsparungen die Folge. Hochgerechnet handelt es sich bundesweit um mehr als 2000 Einrichtungen. Wie viele Arbeitsplätze betroffen sind, lasse sich aus den bislang vorliegenden Daten allerdings nicht bestimmen, betonen die IAB-Forscherinnen Anja Kettner und Martina Rebien.
Die Ergebnisse der Studie liefern Indizien dafür, dass fast jede zweite Einrichtung zumindest einen Teil Ihrer Ein-Euro-Jobber nicht nur im Sinne des Gesetzgebers einsetzt, zum Beispiel auch für Krankheitsvertretungen oder Überstundenabbau. Wenn Einrichtungen den Ein-Euro-Jobbern keine zusätzlichen Tätigkeiten übertragen, sondern Arbeiten der regulären Belegschaft, kann dies nach Einschätzung der Arbeitsmarktforscherinnen längerfristig zum Personalabbau führen. "Eine zu 100 Prozent öffentlich finanzierte Beschäftigung darf nicht dazu führen, dass reguläre Beschäftigung verringert und damit Arbeitslosigkeit bei anderen Personen erhöht wird", schreiben die IAB-Forscherinnen. Sie schlagen ein "Einzelfall-Monitoring" der Ein-Euro-Jobber und der Einrichtungen vor, um die Verdrängungseffekte zu minimieren. Zwar würde der Aufwand für die Arbeitsvermittler durch den regelmäßigen Kontakt steigen. Gleichzeitig könnten die Vermittler aber durch die Rückmeldungen der Einrichtungen ein genaueres Bild der Stärken und Schwächen der Ein-Euro-Jobber erhalten. Durch individuell angepasste Trainingsmaßnahmen ließe sich dann die Beschäftigungsfähigkeit der Ein-Euro-Jobber weiter fördern.
Die Einrichtungen wurden im Rahmen der Erhebung auch darum gebeten, die Eignung für ein reguläres Beschäftigungsverhältnis in einer ähnlichen oder anderen Tätigkeit zu beurteilen. Im Durchschnitt wurden rund 44 Prozent der Personen für geeignet befunden, 27 Prozent dagegen nicht. Bei 29 Prozent konnten die Einrichtungen dies zum Befragungszeitpunkt nicht beurteilen. Nur bei zwei Prozent der generell geeigneten Ein-Euro-Jobber haben die Einrichtungen fest geplant, sie in die Belegschaft zu übernehmen. Bei weiteren fünf Prozent denken sie darüber nach, eine tatsächliche Übernahme ist jedoch ungewiss. Bei 78 Prozent aller geeigneten Ein-Euro-Jobber erklärten die Einrichtungen, dass keine finanziellen Mittel für eine Einstellung zur Verfügung stehen.
Seit dem In-Kraft-Treten des "Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt" (HARTZ IV) am 1. Januar 2005 besteht die Möglichkeit, erwerbsfähige hilfebedürftige Personen in eine zeitlich begrenzte Arbeitsgelegenheit zu vermitteln. Für ihre Arbeit wird eine Aufwandsentschädigung von 1 bis 2 Euro pro Stunde gezahlt. Die offizielle Bezeichnung lautet deshalb "Arbeitsgelegenheit in der Mehraufwandsvariante", gängiger sind allerdings die Bezeichnungen "Soziale Arbeitsgelegenheit" oder "Ein-Euro-Job". Die Zahl dieser Jobs betrug Ende 2005 etwa 380.000. Die häufigsten Einsatzbereiche im Westen sind Hausmeisterdienste oder handwerkliche Arbeiten, in den Neuen Ländern überwiegt der Bereich Garten- und Landschaftspflege sowie die Betreuung und Altenpflege.
Auf der Website des IAB ist die Studie als PDF-Datei (79 Seiten) verfügbar: Soziale Arbeitsgelegenheiten - Einsatz und Wirkungsweise aus betrieblicher und arbeitsmarktpolitischer Perspektive
Gerd Marstedt, 27.1.2007
Arbeitnehmer beklagen mangelhaften Führungsstil in Betrieben
 Obwohl die meisten Arbeitnehmer in Deutschland sich sehr stark mit ihrer Arbeit identifizieren und eine hohe Leistungsbereitschaft zeigen, vermissen sie im Gegenzug oftmals eine ausreichende Anerkennung ihrer Arbeit durch Vorgesetzte und klagen über Mängel im Führungsstil. Dies ist ein wesentlicher Befund der Studie "Was ist gute Arbeit? - Anforderungen aus der Sicht von Erwerbstätigen", die bei über 7.000 abhängig und selbständig Beschäftigten untersucht hat, welche beruflichen Rahmenbedingungen für Arbeitnehmer einen besonders hohen Stellenwert haben und wie es in der betrieblichen Realität in dieser Hinsicht tatsächlich ausschaut.
Obwohl die meisten Arbeitnehmer in Deutschland sich sehr stark mit ihrer Arbeit identifizieren und eine hohe Leistungsbereitschaft zeigen, vermissen sie im Gegenzug oftmals eine ausreichende Anerkennung ihrer Arbeit durch Vorgesetzte und klagen über Mängel im Führungsstil. Dies ist ein wesentlicher Befund der Studie "Was ist gute Arbeit? - Anforderungen aus der Sicht von Erwerbstätigen", die bei über 7.000 abhängig und selbständig Beschäftigten untersucht hat, welche beruflichen Rahmenbedingungen für Arbeitnehmer einen besonders hohen Stellenwert haben und wie es in der betrieblichen Realität in dieser Hinsicht tatsächlich ausschaut.
Einige Ergebnisse der Studie waren:
• Hohe Identifikation mit der Arbeit: 72 % der Befragten geben an, oft stolz auf ihre Arbeit zu sein, rund 64 % haben in den letzten vier Arbeitswochen oft mit Freude gearbeitet. 54 % der Beschäftigten hat ihre eigene Arbeit sogar begeistert.
• Negativerfahrungen beim Führungsstil: Trotz dieser hohen Identifikation mit der Arbeit gaben in der Umfrage 61 % an, nie oder selten Anerkennung für Ihre Arbeit zu erfahren. 48 % erklärten, dass sie sich in den letzten vier Wochen nie oder selten mit ihrem Unternehmen besonders verbunden gefühlt haben.
• Hohe Bedeutung von Einkommen und Arbeitsplatzsicherheit: Mit Abstand das wichtigste Kriterium von "guter Arbeit" aus der Sicht von abhängig Beschäftigten ist ein festes, verlässliches Einkommen - 92% der Befragten sind dieser Auffassung. Auch an Platz 2 wird ein Aspekt aus dem Bereich Einkommens- und Beschäftigungssicherheit genannt, nämlich ein sicherer Arbeitsplatz, den 88% als sehr wichtiges Kriterium guter Arbeit benennen. Der Bereich Einkommens- und Beschäftigungssicherheit hat eine zentrale Stellung in der subjektiven Charakterisierung von guter Arbeit einnimmt.
• Unzureichende Einkommen bilden aus der Sicht von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern einen Brennpunkt ihrer aktuellen Arbeitssituation: Mit keinem anderen Bereich der Arbeitsgestaltung sind abhängig Beschäftigte derart unzufrieden wie mit dem Verhältnis von Einkommen und Leistung, und in keinem anderem Feld wird ein derart hoher Handlungsbedarf gesehen wie bei den Einkommen.
Die Studie wurde in Auftrag gegeben von der "Initiative Neue Qualität der Arbeit". Die Umfrage, die auf einem 16-seitigen Fragebogen basiert, wurde durch das Internationale Institut für empirische Sozialökonomie (INIFES), Forschungsteam Internationaler Arbeitsmarkt und TNS Infratest Sozialforschung durchgeführt. Ziel der Untersuchung war es, Ansatzpunkte für eine innovative Gestaltung der Arbeit aus Sicht der Erwerbstätigen zu erkennen. Befragt wurden 7.444 zufällig ausgewählte abhängig und selbständig Beschäftigtedie ihre derzeitigen Arbeitsbedingungen beschreiben und bewerten sowie ihre Anforderungen an "gute Arbeit" benennen sollten.
Zum Projekt gibt es auf der Website der Initiative Neue Qualität der Arbeit verschiedene Materialen zum kostenlosen Download, unter anderem:
• Was ist gute Arbeit? - Anforderungen aus der Sicht von Erwerbstätigen, Endbericht der Studie (PDF: 4,1 MB, 269 Seiten)
Gerd Marstedt, 10.1.2007
Arbeitsbedingungen in Europa aus Arbeitnehmersicht: Erste Ergebnisse der 4. Erhebung der "Dubliner Stiftung"
 Seit 1990 gehören die europaweiten Erhebungen der "Europäischen Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen" in Dublin, einer Einrichtung der EU, über die Arbeitsbedingungen in den jeweiligen Mitgliedsländern der EU aus Sicht der Arbeitnehmer zu einer der besten thematischen Informationsquellen.
Seit 1990 gehören die europaweiten Erhebungen der "Europäischen Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen" in Dublin, einer Einrichtung der EU, über die Arbeitsbedingungen in den jeweiligen Mitgliedsländern der EU aus Sicht der Arbeitnehmer zu einer der besten thematischen Informationsquellen.
Da diese Erhebung alle fünf Jahre durchgeführt wurde, liegen jetzt die Ergebnisse der vierten Erhebung aus dem Jahre 2005 vor. In ihr fanden Gespräche mit einer repräsentativen Stichprobe von 29.680 Arbeitnehmern in 31 Ländern, nämlich den EU-25-Ländern, den beiden Anfang 2007 beigetretenen Länder Bulgarien und Rumänien sowie den Ländern Kroatien, Türkei, Schweiz und Norwegen statt.
Mit 1990 20 und heute rund 100 Fragen, werden in mündlichen Interviews mit diesen Beschäftigten Informationen über körperliche Risiken, Arbeitszeiten, Arbeitsorganisation, Beschöäftigungsfähigkeit, Arbeitszufriedenheit, Gesundheitsauswirkungen, Fehlzeiten, Nachhaltigkeit der Beschäftigung, Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, Gewalt und Belästigung am Arbeitsplatz sowie Arbeitsleistung erfasst.
Die Erhebung "will ein umfassendes Bild davon zeichnen, wie die europäischen Arbeitnehmer ihr Erwerbsleben und ihre Arbeitsbedingungen erleben und bewerten."
Über die Website der "European Working Conditions Surveys (EWCS)" gelangt man zu den Fragebögen und Ergebnissen aller bisher stattgefundener Erhebungen, einschließlich der Erhebung im Jahr 2005 mit Links zu weiteren internationalen und nationalen Informationsquellen über Arbeitsbedingungen (in Deutschland etwa der Verweis auf die Erhebungen und Auswertungen von IAB und BiBB).
Die ersten, auf 12 Seiten veröffentlichten Resultate der 2005-er Erhebung lauten etwa:
• 12 % der Erwerbsbevölkerung hatte selten oder nie genug Zeit gehabt, ihre Arbeit zu erledigen.
• Mehr als zwei Drittel der Arbeitnehmer können sich ihren Arbeitsrhythmus selbst aussuichen oder ändern.
• 23 % der Befragten arbeitet entweder sechs oder sieben Tage pro Woche.
• Rund 23 % der abhängig Beschäftigten arbeiten im Rahmen eines wie auch immer gearteten nicht regulären Arbeitsvertrags (meist befristete Verträge). Bei den jüngsten Neuzugängern zum Arbeitsmarkt beträgt der Anteil solcher nicht regulären Arbeitsverträge nahezu 50 %.
• Jeder Dritte erklärt, dass er imstande wäre, anspruchsvollere Arbeiten zu erledigen (Unterforderung).
• 35 % der Befragten geben an, dass die Arbeit ihre Gesundheit beeinträchtige.
• 82 % der Arbeitnehmer sind mit ihren Arbeitsbedingungen zufrieden, aber nur 31 % sind beispielsweise der Meinung, ihre Arbeit biete ihnen gute Karrierechancen.
Ein ausführlicher Bericht wird ebenso wie bei den früheren Erhebungen auch zur vierten Erhebung in Kürze erscheinen.
Zusätzlich zu den Jahresergebnissen, stellt die Dubliner Stiftung jetzt auch Veränderungen wichtiger Arbeitsbedingungen zwischen 1991 und 2005 dar.
Einige der dabei sichtbar werdenden Haupttrends sehen so aus:
• Die durchschnittliche Arbeitszeit fiel konstant, was vor allem durch die Zunahme der Teilzeitarbeit erfolgte.
• Der Anteil von Nacht-, Abend- oder Wochenendarbeitenden blieb sehr gering, änderte sich aber auch nicht wesentlich.
• Die Intensität der Arbeit nimmt stetig zu.
• Die hohe Arbeitsautonomie scheint am Schwinden zu sein.
• Der Anteil von Arbeitnehmern, die regelmäßig Computer nutzt nahm von 31 auf 47 % zu. 44 % der Arbeitnehmer hatte aber auch 2005 nichts mit Computern zu tun.
• Frauen kommen in den letzten 10 Jahren langsam mehr in Führungspositionen.
Hier finden Sie den achtseitigen mit Abbildungen versehenen Bericht "Fifteen Years of Working Conditions in the EU: Charting the Trends"
Bernard Braun, 10.1.2007
Gesundheitliche Auswirkungen alternativer Beschäftigungsformen: Widersprüchliche Befunde
 Alternative Beschäftigungsformen wurden bislang vor allem mit Blick auf ihre Arbeitsmarkt-Effekte untersucht. Die Initiative Arbeit und Gesundheit (IGA) hat jetzt eine Literatur-Übersicht über insgesamt 16 Studien veröffentlicht, in denen alternative Beschäftigungsformen unter arbeitsmedizinischen Gesichtspunkten und hinsichtlich ihrer Gesundheitsriken behandelt worden sind. Der Report informiert über die aktuelle quantitative Bedeutung alternativer Beschäftigungsmodelle anhand verfügbarer Statistiken sowie über die in den Studien festgestellten gesundheitlichen Effekte.
Alternative Beschäftigungsformen wurden bislang vor allem mit Blick auf ihre Arbeitsmarkt-Effekte untersucht. Die Initiative Arbeit und Gesundheit (IGA) hat jetzt eine Literatur-Übersicht über insgesamt 16 Studien veröffentlicht, in denen alternative Beschäftigungsformen unter arbeitsmedizinischen Gesichtspunkten und hinsichtlich ihrer Gesundheitsriken behandelt worden sind. Der Report informiert über die aktuelle quantitative Bedeutung alternativer Beschäftigungsmodelle anhand verfügbarer Statistiken sowie über die in den Studien festgestellten gesundheitlichen Effekte.
Studien zu folgenden Modellen wurden gesichtet:
• Teilzeitarbeit (auch: Mini-Jobs, Job-Sharing)
• Befristete Tätigkeit
• Telearbeit (häufig mit der zeitversetzten Nutzung betrieblicher Ressourcen, etwa dem sogenannten Desk-Sharing, verknüpft)
• Kontingentarbeit ("Arbeit auf Anforderung", aber auch Sonderformen kurzer, befristeter Tätigkeit)
• Neue Selbständigkeit (Freelancer, Ich-AGs)
• Leiharbeit (Beschäftigte in Unternehmen, die hier immer schon tätigwaren, ferner in den vom Staat geförderten Personal Service Agenturen PSA)
Als Ergebnis der Literatursichtung wird festgehalten, dass die Forschungslage außerordentlich große Defizite aufweist und die Zahl der aussagekräftigen Studien sehr gering ist. Die Ergebnisse sind uneinheitlich und zum Teil sogar widersprüchlich. So zeigen sich zum Beispiel für Teilzeitarbeit in verschiedenen Befragungen subjektiv eher positive Effekte, während bei den objektiven Indikatoren wie Suizide und Mortalität deutliche negative Auswirkungen zutage treten.
Zweierlei wird von den Autoren als Bilanz hervorgehoben. Auffällig sind einerseits die Ergebnisse zur Auswirkung auf die allgemeine Sterblichkeit von Teilzeitkräften und befristet Beschäftigten, die mit zwei groß angelegten Studien in Schweden und Finnland als gesichert gelten können und wonach derart prekär Beschäftigte im Untersuchungszeitraum deutlich häufiger sterben als Vollzeitbeschäftigte. Auch die gleichgerichteten Ergebnisse zu erhöhten Freitodraten für diese Personenkreise in Kanada gründen sich auf gesicherte Ergebnisse.
Andererseits scheint eine Tendenz zur besseren subjektiven Wahrnehmung des Gesundheitszustandes von prekär Beschäftigten zu bestehen, die sich in einer ganzen Reihe von Studien findet. "Dies mag sich zum Teil in einem erhöhten Freizeitpensum begründen, andererseits darf allerdings die Möglichkeit, dass hier die Arbeitsplatzangst zu einer veränderten Wahrnehmungsschwelle führt, nicht außer Acht gelassen werden. Vor dem Hintergrund der oben dargestellten, erhöhten Mortalität sollte die Prüfung der Existenz einer solchen Wahrnehmungsverschiebung als Auftrag an die Wissenschaft formuliert werden." (S.54)
Initiative Gesundheit & Arbeit, IGA-Report 10, Michael Friedrichs und Antje Kathrin Schröder: Gesundheitliche Auswirkungen neuer Beschäftigungsformen. Kommentierte Zusammenstellung der einschlägigen Literatur (PDF, 64 Seiten)
Gerd Marstedt, 4.1.2007
Ambulante Pflegekräfte sind häufiger krank als andere Berufsgruppen
 Der DAK-Krankenpflege Report 2005 hatte sich auf Arbeitsbedingungen und Belastungen in der stationären Krankenpflege konzentriert, der neue Bericht "DAK-BGW Gesundheitsreport 2006 - Ambulante Pflege" beschäftigt sich nun mit der Arbeittssituation in der ambulanten häuslichen Alten- und Krankenpflege. Ein zentraler Befund ist: Pflegekräfte aus ambulanten Diensten leiden häufiger als andere Berufsgruppen an gesundheitlichen Problemen. Sie sind hohen körperlichen und psychischen Belastungen ausgesetzt und mehr als andere von Rückenschmerzen und psychischen Erkrankungen betroffen. Aber: Beschäftigte in der ambulanten Pflege sind deutlich zufriedener als ihre Kollegen im Krankenhaus. Sehen in der ambulanten Pflege knapp 68% ihre Arbeit positiv, traf dies nur auf 53% der Pflegenden im Krankenhaus zu. Immerhin 92% der Pflegerinnen und Pfleger in ambulanten Diensten finden, dass sie mit ihrem Beruf etwas Sinnvolles tun.
Der DAK-Krankenpflege Report 2005 hatte sich auf Arbeitsbedingungen und Belastungen in der stationären Krankenpflege konzentriert, der neue Bericht "DAK-BGW Gesundheitsreport 2006 - Ambulante Pflege" beschäftigt sich nun mit der Arbeittssituation in der ambulanten häuslichen Alten- und Krankenpflege. Ein zentraler Befund ist: Pflegekräfte aus ambulanten Diensten leiden häufiger als andere Berufsgruppen an gesundheitlichen Problemen. Sie sind hohen körperlichen und psychischen Belastungen ausgesetzt und mehr als andere von Rückenschmerzen und psychischen Erkrankungen betroffen. Aber: Beschäftigte in der ambulanten Pflege sind deutlich zufriedener als ihre Kollegen im Krankenhaus. Sehen in der ambulanten Pflege knapp 68% ihre Arbeit positiv, traf dies nur auf 53% der Pflegenden im Krankenhaus zu. Immerhin 92% der Pflegerinnen und Pfleger in ambulanten Diensten finden, dass sie mit ihrem Beruf etwas Sinnvolles tun.
Zwar empfinden 68% der Befragten in der ambulanten Pflege Zeitdruck als Belastung, im stationären Bereich sind es jedoch 83%. Auch bei Belastungen durch Leistungsdruck (ambulant: 41%, stationär: 52%), zu hohe Verantwortung (16 zu 39%) und Unterbrechungen bei der Arbeit (18 zu 69%) liegen die stationären Krankenpflegekräfte vorn. Für die hohe Arbeitszufriedenheit sind mehrere Faktoren ausschlaggebend: Die große Mehrheit (90%) schätzt vor allem die Möglichkeit, selbstständig zu arbeiten. Knapp zwei von drei Befragten (61%) nehmen die Tätigkeit als abwechslungsreich und interessant wahr. Etwas mehr (62%) sind der Meinung, dass sie mitbestimmen können und ihre Verbesserungsvorschläge Gehör finden.
Kranken- und Altenpflege ist körperliche Schwerarbeit: 46% der Befragten führen häufiger als sechs Mal am Tag Tätigkeiten mit dem Schwerpunkt "Heben und Tragen" aus. Dabei kommt erschwerend hinzu, dass die Pflegekraft meistens allein in der Wohnung tätig ist. Schwere Hebe- und Tragetätigkeiten müssen ohne Unterstützung ausgeführt werden.
• Auf der Website der DAK gibt es eine Pressemitteilung und Kurzfassung des Berichts
• und ebenso den kompletten Bericht (181 Seiten) als PDF-Datei: DAK-BGW Gesundheitsreport 2006 - Ambulante Pflege
Gerd Marstedt, 28.12.2006
OECD-Reportreihe über Langzeit-Arbeitsunfähigkeit und Arbeitsmarktblockaden für Behinderte gestartet: Norwegen, Polen und Schweiz
 Als eine "soziale und ökonomische Tragödie" in nahezu allen ihren Mitgliedsländern bezeichnet die OECD den hohen Anteil der Erwerbstätigen und -fähigen, die aus gesundheitlichen Gründen dauerhaft den Arbeitsmarkt verlassen müssen oder die wegen Einschränkungen ihrer Arbeitsfähigkeit bzw. Behinderungen keine Arbeitsmöglichkeiten finden. Die Aufwändungen aller OECD-Regierungen für Krankheit und Behinderungen summierten sich 2004 auf 2,4 % des Bruttosozialprodukts. Zum Vergleich: Der Sozialproduktanteil, den die Regierungen für Arbeitslosigkeit aufbrachten betrug im selben Jahr "nur" 1,3 %.
Als eine "soziale und ökonomische Tragödie" in nahezu allen ihren Mitgliedsländern bezeichnet die OECD den hohen Anteil der Erwerbstätigen und -fähigen, die aus gesundheitlichen Gründen dauerhaft den Arbeitsmarkt verlassen müssen oder die wegen Einschränkungen ihrer Arbeitsfähigkeit bzw. Behinderungen keine Arbeitsmöglichkeiten finden. Die Aufwändungen aller OECD-Regierungen für Krankheit und Behinderungen summierten sich 2004 auf 2,4 % des Bruttosozialprodukts. Zum Vergleich: Der Sozialproduktanteil, den die Regierungen für Arbeitslosigkeit aufbrachten betrug im selben Jahr "nur" 1,3 %.
Wie es dazu kommt, dass sich einerseits die gesundheitliche Situation in den OECD-Ländern verbessert aber trotzdem ein hoher Anteil Arbeitsfähiger langzeitig oder dauerhaft arbeitsunfähig ist, ob es Leistungsanreize für diesen Zustand gibt oder zu wenig getan wird, um gesundheitlich eingeschränkte Personen wieder ins Arbeitleben zu integrieren und wie eine "win-win"-Politik aussehen muss, die den Ausschluss von Menschen vermeidet und ökonomischen Nutzen stiftet, will die OECD in drei vergleichenden Studien und einem Abschluss-Report genauer untersuchen.
Der erste 172 Seiten umfassende Band "Sickness, Disability and Work: Breaking the Barriers - Norway, Poland and Switzerland" ist gerade erschienen. In diesen Ländern werden überdurchschnittliche 3 bis 5 % des Bruttosozialprodukts für Arbeitsunfähigkeit und Behinderung ausgegeben. Zwei weitere Länderreports sollen 2007 über Australien, Luxemburg, Spanien und Großbritannien und 2008 über Dänemark, Finnland, Irland und die Niederlande erscheinen.
Hier finden Sie die OECD-Browse_it-Version des ersten OECD-Reports.
Bernard Braun, 26.11.2006
Demografie, Arbeit und Gesundheit: "Barmer"-Gesundheitsreport 2006
 Auch die "Barmer Ersatzkasse" gehört zu der wachsenden Gruppe von gesetzlichen Krankenkassen, die ihre Routinedaten regelmäßig in so genannten "Gesundheitsreports" analytisch aufbereiten. Der gerade erschienene "Gesundheitsreport 2006" gibt einen umfassenden Überblick über das Arbeitsunfähigkeitsgeschehen von 1,4 Millionen bei der Barmer versicherten Beschäftigten, die im Jahr 2005 in 2,7 Millionen Fällen krankheitsbedingt der Arbeit fernblieben.
Auch die "Barmer Ersatzkasse" gehört zu der wachsenden Gruppe von gesetzlichen Krankenkassen, die ihre Routinedaten regelmäßig in so genannten "Gesundheitsreports" analytisch aufbereiten. Der gerade erschienene "Gesundheitsreport 2006" gibt einen umfassenden Überblick über das Arbeitsunfähigkeitsgeschehen von 1,4 Millionen bei der Barmer versicherten Beschäftigten, die im Jahr 2005 in 2,7 Millionen Fällen krankheitsbedingt der Arbeit fernblieben.
Der thematische Schwerpunkt liegt bei der Entwicklung des demografischen Wandels und den damit in Zusammenhang stehenden gesundheitlichen und arbeitsbezogenen Folgen: "Sinkende Geburtenraten, immer weniger junge Arbeitskräfte "rücken" nach. Die Folgen: Das Durchschnittsalter der Belegschaften steigt stetig an. Und die heute noch zu den "Jüngeren" zählenden Beschäftigten werden aufgrund der Rentenproblematik wahrscheinlich alles in allem noch länger im Berufsleben stehen als ihre älteren Kollegen.
Der demografische Wandel macht deutlich: Sowohl ein auf junge als auch auf "ältere Arbeitnehmer" zugeschnittenes betriebliches Gesundheitsmanagement wird für die Unternehmen immer wichtiger. Alle müssen fit und leistungsfähig sein und sollen das auch möglichst lange bleiben!"
Hier finden Sie die PDF-Datei des Reports: Barmer Gesundheitsreport 2006: Demografischer Wandel - ältere Beschäftigte im Focus betrieblicher Gesundheitsförderung
Bernard Braun, 14.11.2006
Musizieren kann der Gesundheit schaden - Berufsperspektiven, Belastungen und Gesundheit von Musikern
 Aktives Musizieren gilt als Hobby, das die Persönlichkeit, Kreativität und soziale Fähigkeiten stärkt, Musiker als Beruf, in dem man persönlichen Neigungen und Leidenschaften umfassend nachgehen darf. Dass viele Freizeit- wie Berufsmusiker jedoch trotz eines jungen Lebensalters schon erhebliche gesundheitliche Beeinträchtigungen zeigen, hat jetzt eine von der GEK (Gmünder Ersatzkasse) in Auftrag gegebene Studie gezeigt. Befragt wurden insgesamt 705 Musiker und Musikschüler im Alter von 16-25 Jahren, die sich entweder noch in einer musikalischen Ausbildung befinden oder bereits als Berufsmusiker in Sinfonieorchestern tätig sind. Damit wurde erstmals in einer Studie mit internationaler Beteiligung von Musikern (u.a. aus Deutschland, Finnland, Slowenien, Niederlande) der Frage nach Berufsperspektiven, Belastungen und Gesundheit junger Musiker nachgegangen.
Aktives Musizieren gilt als Hobby, das die Persönlichkeit, Kreativität und soziale Fähigkeiten stärkt, Musiker als Beruf, in dem man persönlichen Neigungen und Leidenschaften umfassend nachgehen darf. Dass viele Freizeit- wie Berufsmusiker jedoch trotz eines jungen Lebensalters schon erhebliche gesundheitliche Beeinträchtigungen zeigen, hat jetzt eine von der GEK (Gmünder Ersatzkasse) in Auftrag gegebene Studie gezeigt. Befragt wurden insgesamt 705 Musiker und Musikschüler im Alter von 16-25 Jahren, die sich entweder noch in einer musikalischen Ausbildung befinden oder bereits als Berufsmusiker in Sinfonieorchestern tätig sind. Damit wurde erstmals in einer Studie mit internationaler Beteiligung von Musikern (u.a. aus Deutschland, Finnland, Slowenien, Niederlande) der Frage nach Berufsperspektiven, Belastungen und Gesundheit junger Musiker nachgegangen.
Deutlich wurde dabei, dass junge Musiker und Musikschüler im Vergleich zu einer repräsentativen gleichaltrigen Bevölkerungsstichprobe erheblich öfter über Gesundheitsbeschwerden und Schmerzen klagen. So finden sich Nackenschmerzen, Schmerzen an den Schultern, in den Fingern, an Unter- und Oberarm bei Musikern zwei-, drei- oder sogar viermal so oft wie bei jüngeren Schülern, Studenten oder Erwerbstätigen in der Bevölkerung. Gerade diese Körperpartien jedoch sind es, so bilanzieren die Autoren der Studie, die zum Musizieren besonders häufig und intensiv beansprucht werden.
Ein zweites Ergebnis hat die Wissenschaftler vom Zentrum für Sozialpolitik der Universität Bremen und von der Deutschen Gesellschaft für Musikphysiologie und Musikermedizin in Berlin zumindest genau so stark verblüfft. Obwohl Musiker und Musikschüler deutlich häufiger von Schmerzen betroffen sind und auch häufiger als im Bevölkerungsdurchschnitt über Beeinträchtigungen des Wohlbefindens berichten (Schlafstörungen, innere Unruhe, Magenbeschwerden usw.), bewerten sie ihren Gesundheitszustand insgesamt deutlich besser, sagen also öfter, dass sie sich gesund und fit. Fühlen. Damit ist ein Defizit in der Risikowahrnehmung der Gesundheitsbeeinträchtigungen bei Musikern zu verzeichnen: Beschwerden, die sich aus dem Musizieren ergeben, werden bagatellisiert oder verdrängt und werden nicht konsequent in ein individuelles Gesundheitskonzept integriert. Offensichtlich steht dahinter die Furcht, dass die Schmerzen eine zukünftige musikalische Betätigung in Frage stellen könnten.
Die Wissenschaftler fanden jedoch auch heraus, dass gesundheitliche Beeinträchtigungen keineswegs eine zwangsläufige Folge häufigen Übens und Musizierens sind. Als sie überprüften, welche Teilnehmer der Befragung "kerngesund" sind, besonders wenig oder keine Beeinträchtigungen aufweisen, so fand sich ein überraschendes Ergebnis: Diese Gruppe ist von der eigenen musikalischen Leistung und Begabung voll überzeugt, hat bereits auf der Karriereleiter einige Stufen erfolgreich bewältigt, ist von äußeren Erwartungen wenig beeindruckt und schätzt seine Zukunftsaussichten überaus positiv ein. Er bzw. sie ist überaus "selbstbewusst", weist hohe soziale Kompetenzen auf, und auch das Gesundheitsverhalten "kerngesunder" Musiker ist in medizinischer Hinsicht vorbildlich: Sie treiben häufig Sport oder körperlich anstrengende Tätigkeiten, sind Nichtraucher, essen viel Obst und finden ausreichend Schlaf. Den höchsten Anteil "Kerngesunder" fand man bei einer hohen Selbsteinstufung der musikalischen Talente und Leistungen und zugleich einem gesundheitsbewussten Alltagsverhalten.
Gesundheitsbeschwerden sind also trotz intensiver Beanspruchung von Muskeln und Sehnen durchaus vermeidbar. Ein besonders wirksames Regulativ scheint in diesem Zusammenhang die Ausübung von Sport zu sein. Wer regelmäßig Sport betreibt, ist entweder von seiner Persönlichkeitsstruktur her weniger stressanfällig oder aber er erreicht durch die körperliche Aktivität einen Abbau von Stress.
Ein Problem erkennen die Wissenschaftler allerdings darin, dass präventive Maßnahmen, (wie etwa Entspannungsverfahren) oftmals erst dann zum Einsatz zu kommen, wenn sich bereits negative Gesundheitsfolgen eingestellt haben. Im Hinblick auf solche Stressbewältigungs- und Entspannungstechniken artikulieren Musiker und Musikerschüler einerseits zwar große Informations- und Wissensdefizite. Gleichzeitig sind aber Vorurteile und emotionale Vorbehalte eher gering, die Wirksamkeit der Techniken wird sehr hoch eingeschätzt, und das Interesse an mehr Informationen auch als Bestandteil des Musikunterrichts ist groß.
Die Ergebnisse sind auch insofern von Bedeutung, als junge Musiker keine quantitativ so unbedeutende Berufsgruppe sind wie man vermuten könnte: In Deutschland sind derzeit etwa 11.500 Berufsmusiker in Sinfonie- und Theaterorchestern tätig, weitere 35.700 in Musikschulen. In den Musikstudiengängen sind etwa 25.500 Studenten eingeschrieben und an den staatlichen Musikschulen nahezu 1 Mio. Schülerinnen und Schüler angemeldet.
Auch ein in der Bevölkerung verbreitetes Vorurteil über Musiker konnte durch Befragung widerlegt werden: Das bisweilen kolportierte Klischee des musikbesessenen, nur mit seinem Instrument "verheirateten" Musikers ist falsch. Ganz im Gegenteil: Ehrgeizige, übungsfleißige und engagierte junge Musiker zeichnen sich aus durch häufige soziale Kontakte und Freizeitaktivitäten mit Freunden und Bekannten. Insgesamt zeigt sich, dass Musiker und Musikschüler hinsichtlich ihrer Probleme und Wertorientierungen, von Ausnahmen abgesehen, kaum von "Normalbürgern" ihres Alters abweichen.
Die gesamte Studie (Hrsg.: GEK, Gmünder ErsatzKasse; Autoren: Walter Samsel, Gerd Marstedt, Helmut Möller, Rainer Müller) kann hier als PDF-Datei heruntergeladen werden:
Musiker-Gesundheit - Ergebnisse einer Befragung junger Musiker über Berufsperspektiven, Belastungen und Gesundheit
Verfügbar ist auch eine Kurzfassung
Gerd Marstedt, 14.3.2006
BKK-Gesundheitsreport 2005: Krankenstand seit 1991 halbiert, psychische Erkrankungen nehmen zu
 Der jetzt vom BKK-Bundesverband herausgegebene Gesundheitsreport 2005 nimmt insbesondere die mehrjährige Entwicklung der Arbeitsunfähigkeit und der Krankenhausbehandlungen in den Blick. Ein Schwerpunkt liegt überdies auf psychischen Erkrankungen. Einige wesentliche Ergebnisse des Berichts:
Der jetzt vom BKK-Bundesverband herausgegebene Gesundheitsreport 2005 nimmt insbesondere die mehrjährige Entwicklung der Arbeitsunfähigkeit und der Krankenhausbehandlungen in den Blick. Ein Schwerpunkt liegt überdies auf psychischen Erkrankungen. Einige wesentliche Ergebnisse des Berichts:
• Auf die Gesamtzahl der Arbeitstage im Betrieb gerechnet ergibt sich für das Jahr 2004 eine durchschnittliche, gesundheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit von 6,2 Tagen. Seit den neunziger Jahren hat sich die krankheitsbedingte Fehlzeit damit fast halbiert. Den höchsten Krankenstand gab es 1980 mit 15,7 Tagen.
• Im Vergleich zu 1991 sind Arbeitsunfähigkeitszeiten wegen körperlicher Erkrankungen durchweg zurück gegangen, bei Herz-Kreislauf-Diagnosen auf ein Drittel, Verdauungserkrankungen
verursachten 60% weniger Krankheitstage, Muskel- und Skeletterkrankungen verringerten mit 55 % weniger Krankheitstagen ihren Anteil am Krankenstand 2004 um etwa ein Fünftel gegenüber 1991
• Einzige Ausnahme von dieser Tendenz, also einen Anstieg mit deutlich mehr Krankheitstagen (+ 28%) bilden die psychischen Störungen, deren Anteil an der Arbeitsunfähigkeit in diesem Zeitraum auf das Zweieinhalbfache angewachsen ist - bei allen Pflichtmitgliedern (inkl. Arbeitslose) von 3,8 % auf 9,2 %
• Somit sind die psychischen Störungen die viertwichtigste Ursache für Arbeitsunfähigkeit. Bei Frauen (inkl. Arbeitslose) nehmen sie mit 12% der Krankheitstage sogar den dritten Rang ein.
• Bezogen auf Wirtschaftsgruppen war der höchste Krankenstand bei der Abfallbeseitigung zu verzeichnen, dicht gefolgt von Post- und Kurierdiensten sowie Eisenbahnen und Verkehrsbetrieben
• Umgekehrt verzeichnet die wenigsten Arbeitsunfähigkeitstage Beschäftigte bei Banken und Versicherungen
- Ein ähnliches Bild sozialer Ungleichheit ergibt die Analyse nach Berufen. Bei Männern waren Straßenreiniger und Abfallbeseitiger am häufigsten krank gemeldet, am wenigsten krank waren Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Chemie- und Physikotechniker.
Die Datenbasis des Reports umfasst den BKK-Versichertenbestand und spiegelt damit die gesundheitlichen Befunde etwa eines Viertels der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und jedes/r fünften GKV-Versicherten in Deutschland wider. Diese Datenbasis gilt damit als repräsentativ.
Der umfassende Bericht des BKK-Bundesverbandes kann als PDF-Datei (287 Seiten, 2,6 MB) heruntergeladen werden: BKK Gesundheitsreport 2005: Krankheitsentwicklungen - Blickpunkt Psychische Gesundheit
Gerd Marstedt, 2.12.2005
USA: Längere Arbeitszeiten und Überstunden als Unfall- und Erkrankungsrisiko
 Eine im Zeitraum von 1987 bis 2000 von US-amerikanischen Arbeitswissenschaftlern durchgeführte Analyse der Antworten zur Arbeitssituation und den berufsbedingten Verletzungen und Krankheiten von fast 11 000 US-Amerikanern im Rahmen des jährlichen National Longitudinal Survey of Youth identifizierte einen deutlichen Zusammenhang langer Arbeitszeiten mit einem höheren Risiko für Krankheiten und Unfällen.
Eine im Zeitraum von 1987 bis 2000 von US-amerikanischen Arbeitswissenschaftlern durchgeführte Analyse der Antworten zur Arbeitssituation und den berufsbedingten Verletzungen und Krankheiten von fast 11 000 US-Amerikanern im Rahmen des jährlichen National Longitudinal Survey of Youth identifizierte einen deutlichen Zusammenhang langer Arbeitszeiten mit einem höheren Risiko für Krankheiten und Unfällen.
In der Fachzeitschrift Occupational and Environmental Medicine (2005; 62: 588-97 und 585) kommen A. Dembe vom Center for Health Policy and Research an der Medical School der University of Massachusetts und seine Kollegen nach der Adjustierung von Alter, Geschlecht, Berufsrichtung und Überstundenkontingent zu dem Schluss, dass 61 Prozent der länger arbeitenden Befragten ein größeres Risiko für eine berufsbedingte Erkrankung oder Verletzung hatten, als Personen, die keine Überstunden erbringen mussten. Mit Zunahme der Überstunden stieg auch das Risiko für eine Erkrankung oder Verletzung. Bei einer 60-Stunden-Woche war das Risiko im Vergleich mit weniger arbeitenden Personen um 23 Prozent gesteigert; ein Arbeitstag von mehr als zwölf Stunden war assoziiert mit einem um 37 Prozent erhöhten Verletzungs- oder Erkrankungsrisiko. Da weder die konkrete berufliche Tätigkeit noch straffe Arbeitsabläufe eine zentrale Ursache der höheren Krankheitsrisiken darstellte, unterstützen diese Ergebnisse die Theorie, dass lange Arbeitszeiten indirekt durch damit einhergehende Müdigkeit und Stress Unfälle verursachen. Dembe et al. sprechen sich für eine Verkürzung der Arbeitszeit aus und plädieren gegen die in den USA zulässige Möglichkeit, zusätzlich zur normalen Arbeitszeit bis zu einem Drittel Überstunden zu fordern oder zu leisten.
Hier gibt es ein Abstract der Arbeitszeitstudie
Bernard Braun, 12.9.2005
Längere Arbeitszeiten verursachen höhere Gesundheitsrisiken
 Plädoyers für eine Verlängerung der wöchentlichen Arbeitszeit in Deutschland gab es in der letzten Zeit des öfteren, nicht nur von Arbeitgebervertretern, sondern auch von prominenten Politikern. Edmund Stoiber: "Wir müssen unsere wöchentliche Arbeitszeit um bis zu drei Stunden verlängern.", Angela Merkel: "Wir müssen für dasselbe Geld länger arbeiten.", Erwin Teufel: "Für einen gesunden Menschen macht es nun wirklich keinen Unterschied, ob er in der Woche 38, 40 oder 42 Stunden arbeitet." Auch Wissenschaftler wie Professor Hans-Werner Sinn erklärten, mit längerer Arbeitszeit seien die Menschen produktiver und trügen damit zur Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft bei.
Plädoyers für eine Verlängerung der wöchentlichen Arbeitszeit in Deutschland gab es in der letzten Zeit des öfteren, nicht nur von Arbeitgebervertretern, sondern auch von prominenten Politikern. Edmund Stoiber: "Wir müssen unsere wöchentliche Arbeitszeit um bis zu drei Stunden verlängern.", Angela Merkel: "Wir müssen für dasselbe Geld länger arbeiten.", Erwin Teufel: "Für einen gesunden Menschen macht es nun wirklich keinen Unterschied, ob er in der Woche 38, 40 oder 42 Stunden arbeitet." Auch Wissenschaftler wie Professor Hans-Werner Sinn erklärten, mit längerer Arbeitszeit seien die Menschen produktiver und trügen damit zur Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft bei.
Unabhängig von der Frage, welche Effekte eine solche Maßnahme für den Arbeitsmarkt hätte (Produktivitätsgewinne und damit Arbeitsplatzinvestitionen oder umgekehrt Vernichtung von Arbeitsplätzen durch reduzierten Personalbedarf) haben zwei Studien nun gezeigt, dass die volkswirtschaftlichen Effekte in jedem Fall problematisch wären. Längere Arbeitszeiten, so belegen eine deutsche und eine US-amerikanische Studie erhöhen nachhaltig Krankheitsrisiken für die betroffenen Arbeitnehmer und damit auch volkswirtschaftliche Folgekosten durch höhere Arbeitsunfähigkeit, Frühverrentungen, Kosten für Krankheitsbehandlung und Rehabilitation.
Oldenburger Arbeitswissenschaftler sind in einer neuen, von der Hans-Böckler-Stiftung geförderten Studie dem Zusammenhang zwischen der Dauer der Arbeitszeit und den gesundheitlichen Beeinträchtigungen genauer nachgegangen. Sie haben für ihre Studien die Ergebnisse der Befragungen der "Europäischen Stiftung für die Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen" herangezogen. Dort wurden EU-weit insgesamt etwa 22.000 Beschäftigte zu ihren Arbeitsbedingungen befragt, pro Land etwa 1500. Die repräsentative Befragung zeigt unter anderem, dass mit längerer Wochenarbeitszeit die psychovegetativen Beschwerden gravierend ansteigen, vor allem ab 40 Wochenstunden. Bei Beschäftigten mit Wochenarbeitszeiten von 45 und mehr Stunden fühlten sich fast 40% von solchen Beschwerden betroffen, bei Arbeitszeiten unter 19 Wochenstunden galt das nur für 16%. Die Studie Arbeitszeit und gesundheitliche Beeinträchtigungen kann von der Internetseite der Hans-Böckler-Stiftung herunter geladen werden.
Unabhängig davon kam jetzt auch eine US-amerikanische Studie zu demselben Befund. Wissenschaftler vom Center for Health Policy and Research der University of Massachusetts Medical School, Massachusetts, USA, analysierten die Antworten von fast 11.000 US-Amerikanern auf Fragen im Rahmen einer jährlichen Befragung. Auch hier zeigt sich deutlich ein Zusammenhang zwischen der Länge der Arbeitszeit sowie Überstunden einerseits und Unfällen und Gesundheitsbeschwerden andererseits. Besonders deutlich wird dies bei regelmäßigen Überstunden und einer täglichen Arbeitszeit von mehr als 11 Stunden. In ihrer Schlussbemerkung unterstützen die Autoren daher ausdrücklich Bemühungen der EU und anderer Regierungen zur Regulierung und Einschränkung der Arbeitszeitdauer. Die Studie The impact of overtime and long work hours on occupational injuries and illnesses ist in der Zeitschrift Occupational and Environmental Medicine im Internet abrufbar.
Gerd Marstedt, 21.8.2005
Arbeits- und Gesundheitssituation von Zahntechnikern
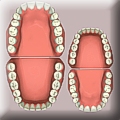 Auf einer Pressekonferenz veröffentlichte die Gmünder ErsatzKasse (GEK) erstmalig die Ergebnisse ihrer in Zusammenarbeit mit der Sozialforschungsstelle Dortmund (sfs) durchgeführten Untersuchungen zur Belastungs- und Gesundheitssituation der Zahntechniker und stellte gleichzeitig Maßnahmen zur Prävention arbeitsbedingter Erkrankungen vor. Der Gesundheitsbericht basiert auf den Analysen der Arbeitsunfähigkeitsdaten sowie auf Ergebnissen einer an 2.000 Zahntechniker gerichteten Versichertenbefragung zu Belastungen und Beanspruchungen am Arbeitsplatz. Da beinahe jeder zweite Zahntechniker bei der GEK versichert ist, können die veröffentlichten Ergebnisse als repräsentativ gelten. Von den Befragten klagten fast 70 % über Schulter- und Nackenbeschwerden, 55 % über häufige Rückenbeschwerden, 60 % über psychosomatische Beschwerden, z.B. Erschöpfungszustände und 46 % über Nervosität oder innere Unruhe.
Auf einer Pressekonferenz veröffentlichte die Gmünder ErsatzKasse (GEK) erstmalig die Ergebnisse ihrer in Zusammenarbeit mit der Sozialforschungsstelle Dortmund (sfs) durchgeführten Untersuchungen zur Belastungs- und Gesundheitssituation der Zahntechniker und stellte gleichzeitig Maßnahmen zur Prävention arbeitsbedingter Erkrankungen vor. Der Gesundheitsbericht basiert auf den Analysen der Arbeitsunfähigkeitsdaten sowie auf Ergebnissen einer an 2.000 Zahntechniker gerichteten Versichertenbefragung zu Belastungen und Beanspruchungen am Arbeitsplatz. Da beinahe jeder zweite Zahntechniker bei der GEK versichert ist, können die veröffentlichten Ergebnisse als repräsentativ gelten. Von den Befragten klagten fast 70 % über Schulter- und Nackenbeschwerden, 55 % über häufige Rückenbeschwerden, 60 % über psychosomatische Beschwerden, z.B. Erschöpfungszustände und 46 % über Nervosität oder innere Unruhe.
Eine wichtige Grundlage für Aktivitäten der arbeitsweltbezogenen Prävention arbeitsbedingter Krankheiten und der betrieblichen Gesundheitsförderung ist die spezifische Berichterstattung über die möglicherweise mit Arbeitsbedingungen assoziierten gesundheitlichen Risiken. Eine für derartige Berichte immer häufiger und kompetenter genutzte Quelle sind die Prozessdaten der GKV aus der Inanspruchnahme von Arbeitsunfähigkeit, stationären Krankenhausaufenthalten und Arzneimittelverordnungen. Eine andere ebenfalls immer höher bewertete und genutzte Informationsquelle sind die subjektiven Wahrnehmungen von Beschäftigten einer Berufsgruppe, Branche oder Betriebs über ihre Arbeitsbedingungen und gesundheitliche Situation.
Die Gmünder Ersatzkasse (GEK) ist eine gesetzliche Krankenkasse, die seit Jahren Berichte erstellen lässt (u.a. vom Zentrum für Sozialpolitik der Universität Bremen) und nutzt, in denen Erkenntnisse aus beiden Quellen zusammengeführt und analysiert werden. Eine Besonderheit stellen mehrjährige Analysen der genannten Inanspruchnahme-Daten der Angehörigen der untersuchten Berufsgruppe etc. dar. Hinzu kommen Überblicke zum Stand des arbeitsmedizinischen Wissens über Gefährdungspotenziale und Hinweise auf gesicherte und teilweise erprobte Gestaltungsmöglichkeiten.
GEK-Gesundheitsbericht: Zahntechniker-Report
Bernard Braun, 12.8.2005
Arbeits- und Gesundheitssituation von Bürofachkräften
 Die Studie basiert auf der Analyse anonymisierter Krankheits-Indikatoren der in der Gmünder ErsatzKasse (GEK) versicherten Bürofachkräfte. Hierzu wurden u. a. Daten über Krankschreibungen, Krankenhausaufenthalte und Arzneimittelverordnungen ausgewertet und mit anderen Berufsgruppen verglichen. Zum anderen wurden die Ergebnisse einer schriftlichen Befragung unter Arbeitnehmern in diesem Berufszweig ausgewertet. Die Bürofachkräfte geben Belastungen an, die vor allem im Bereich von Zwangshaltungen, Bewegungsmangel, der Unterbrechung ihrer Arbeit durch andere und im Bereich der Bildschirmarbeit liegen. Bei den angegebenen gesundheitlichen Beschwerden handelt sich vorrangig um Schulter- und Nackenbeschwerden, Glieder- und Gelenkbeschwerden und Rückenschmerzen sowie psychosomatische Beeinträchtigungen (Müdigkeit, Erschöpfung, Kopfschmerzen, Nervosität).
Die Studie basiert auf der Analyse anonymisierter Krankheits-Indikatoren der in der Gmünder ErsatzKasse (GEK) versicherten Bürofachkräfte. Hierzu wurden u. a. Daten über Krankschreibungen, Krankenhausaufenthalte und Arzneimittelverordnungen ausgewertet und mit anderen Berufsgruppen verglichen. Zum anderen wurden die Ergebnisse einer schriftlichen Befragung unter Arbeitnehmern in diesem Berufszweig ausgewertet. Die Bürofachkräfte geben Belastungen an, die vor allem im Bereich von Zwangshaltungen, Bewegungsmangel, der Unterbrechung ihrer Arbeit durch andere und im Bereich der Bildschirmarbeit liegen. Bei den angegebenen gesundheitlichen Beschwerden handelt sich vorrangig um Schulter- und Nackenbeschwerden, Glieder- und Gelenkbeschwerden und Rückenschmerzen sowie psychosomatische Beeinträchtigungen (Müdigkeit, Erschöpfung, Kopfschmerzen, Nervosität).
Eine wichtige Grundlage für Aktivitäten der arbeitsweltbezogenen Prävention arbeitsbedingter Krankheiten und der betrieblichen Gesundheitsförderung ist die spezifische Berichterstattung über die möglicherweise mit Arbeitsbedingungen assoziierten gesundheitlichen Risiken. Eine für derartige Berichte immer häufiger und kompetenter genutzte Quelle sind die Prozessdaten der GKV aus der Inanspruchnahme von Arbeitsunfähigkeit, stationären Krankenhausaufenthalten und Arzneimittelverordnungen. Eine andere ebenfalls immer höher bewertete und genutzte Informationsquelle sind die subjektiven Wahrnehmungen von Beschäftigten einer Berufsgruppe, Branche oder Betriebs über ihre Arbeitsbedingungen und gesundheitliche Situation.
Die Gmünder Ersatzkasse (GEK) ist eine gesetzliche Krankenkasse, die seit Jahren Berichte erstellen lässt (u.a. vom Zentrum für Sozialpolitik der Universität Bremen) und nutzt, in denen Erkenntnisse aus beiden Quellen zusammengeführt und analysiert werden. Eine Besonderheit stellen mehrjährige Analysen der genannten Inanspruchnahme-Daten der Angehörigen der untersuchten Berufsgruppe etc. dar. Hinzu kommen Überblicke zum Stand des arbeitsmedizinischen Wissens über Gefährdungspotenziale und Hinweise auf gesicherte und teilweise erprobte Gestaltungsmöglichkeiten.
GEK-Gesundheitsbericht: Bürofachkräfte-Report
Bernard Braun, 12.8.2005
Psychische Erkrankungen führen immer häufiger zur Arbeitsunfähigkeit
 Der Trend zu niedrigen Krankenständen setzt sich nach Angaben des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO) weiter fort. Bei den fast 10 Millionen AOK-Mitgliedern ging der Krankenstand auch im Jahr 2004 deutlich zurück und erreichte mit 4,5% den niedrigsten Wert seit mehr als 10 Jahren. Trotz insgesamt sinkender Krankenstände nehmen aber die Fehlzeiten aufgrund psychischer Erkrankungen zu. Die Zahl der Krankmeldungen nahm auch im Jahr 2004 erheblich ab. Gegenüber dem Vorjahr war ein Rückgang um 8,9% zu verzeichnen. Im Durchschnitt waren die AOK-Mitglieder 16,4 Tage krank geschrieben. Im Jahr zuvor waren es noch 17,7 Tage gewesen. In Ostdeutschland fiel der Krankenstand mit 4,3% noch niedriger als im Westen aus. Dort lag er bei 4,5%.
Der Trend zu niedrigen Krankenständen setzt sich nach Angaben des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO) weiter fort. Bei den fast 10 Millionen AOK-Mitgliedern ging der Krankenstand auch im Jahr 2004 deutlich zurück und erreichte mit 4,5% den niedrigsten Wert seit mehr als 10 Jahren. Trotz insgesamt sinkender Krankenstände nehmen aber die Fehlzeiten aufgrund psychischer Erkrankungen zu. Die Zahl der Krankmeldungen nahm auch im Jahr 2004 erheblich ab. Gegenüber dem Vorjahr war ein Rückgang um 8,9% zu verzeichnen. Im Durchschnitt waren die AOK-Mitglieder 16,4 Tage krank geschrieben. Im Jahr zuvor waren es noch 17,7 Tage gewesen. In Ostdeutschland fiel der Krankenstand mit 4,3% noch niedriger als im Westen aus. Dort lag er bei 4,5%.
Psychische Erkrankungen haben in den letzten Jahren vermehrt zu Arbeitsausfällen geführt. Allein im Jahr 2004 stieg die Anzahl der dadurch bedingten Ausfalltage um 10%. Frauen sind häufiger von psychischen Erkrankungen betroffen als Männer. Bei ihnen stellen diese nach den Muskel- und Skeletterkrankungen und Atemwegserkrankungen mittlerweile die häufigste Ursache für krankheitsbedingte Fehlzeiten dar. In den letzten Jahren haben allerdings psychische Erkrankungen bei Männern stark zugenommen (Anstieg der AU-Fälle um 82% im Zeitraum von 1994 - 2003), so dass sich die geschlechtsspezifischen Unterschiede hinsichtlich der Häufigkeit der Erkrankungen verringert haben. Überdurchschnittlich viele Erkrankungstage aufgrund psychischer Erkrankungen sind im Gesundheitswesen, im Versicherungsgewerbe und in der öffentlichen Verwaltung zu verzeichnen. Bei den psychischen Erkrankungen dominieren Depressionen und neurotische Erkrankungen. Dazu gehören beispielsweise Angsterkrankungen, Zwangsstörungen, Reaktionen auf schwere Belastungen und psychosomatische Erkrankungen.
Weitere Infos: Wissenschaftliches Institut der AOK (WIdO)
Gerd Marstedt, 6.7.2005