



Home | Patienten | Gesundheitssystem | International | GKV | Prävention | Epidemiologie | Websites | Meilensteine | Impressum
Sämtliche Rubriken in
"Epidemiologie"
Männer & Frauen, Gender-Aspekte |
Alle Artikel aus:
Epidemiologie
Männer & Frauen, Gender-Aspekte
"Für Firmen packt man die Bazooka aus, für Eltern nicht mal die Wasserpistole" (SZ 4.5.2020) Eltern, Corona-Pandemie in Österreich
 Dass Eltern von Kita- und schulpflichtigen Eltern, die erwerbstätig sind, durch die Corona-Lockdowns besonders unter dem Neben- und der tendenziellen Unvereinbarkeit von Homeoffice, ganztägiger häuslicher Kinderbetreuung, Homeschooling und normalem Leben zu leiden haben, war von Beginn an klar. Weder die akute Situation noch die möglichen langfristigen sozialen und psychischen Folgen für Eltern und Kinder führte aber zu mehr als den wohlfeilen Etikettierungen als "Alltagshelden" oder "systemrelevant". Eine ähnliche Kluft zwischen Risiko-Rhetorik (Hochrisikogruppen) und Nichtstun (fehlende Schutzausrüstung) existierte wochenlang beim Umgang mit der Lage in Alten- und Pflegeheimen. Warum ausgerechnet besonders vulnerable Gruppen lange Zeit und zum Teil bis heute nicht im Zentrum von Hilfsbemühungen standen, sollte bei der Aufarbeitung von Corona-Risikokommunikation und -management besonders thematisiert werden.
Dass Eltern von Kita- und schulpflichtigen Eltern, die erwerbstätig sind, durch die Corona-Lockdowns besonders unter dem Neben- und der tendenziellen Unvereinbarkeit von Homeoffice, ganztägiger häuslicher Kinderbetreuung, Homeschooling und normalem Leben zu leiden haben, war von Beginn an klar. Weder die akute Situation noch die möglichen langfristigen sozialen und psychischen Folgen für Eltern und Kinder führte aber zu mehr als den wohlfeilen Etikettierungen als "Alltagshelden" oder "systemrelevant". Eine ähnliche Kluft zwischen Risiko-Rhetorik (Hochrisikogruppen) und Nichtstun (fehlende Schutzausrüstung) existierte wochenlang beim Umgang mit der Lage in Alten- und Pflegeheimen. Warum ausgerechnet besonders vulnerable Gruppen lange Zeit und zum Teil bis heute nicht im Zentrum von Hilfsbemühungen standen, sollte bei der Aufarbeitung von Corona-Risikokommunikation und -management besonders thematisiert werden.
Wie es Eltern in der Corona-Pandemie ging und geht, lässt sich jetzt recht plastisch einer Befragungsstudie in Österreich entnehmen. Dazu befragte das sozialwissenschaftliche Institut SORA in Wien zwischen dem 14. und 22. April 2020 524 Eltern von Kindern unter 15 Jahren. Da die Lockdownmaßnahmen ähnlicher Art wie in Deutschland waren und sich wahrscheinlich auch sonst die sozialen Verhältnisse nicht grundlegend unterscheiden, sind die Ergebnisse auch für die Lage von Eltern in Deutschland aussagefähig.
Die wesentlichen Ergebnisse in Schlagzeilen aus der Kurzfassung des Studienberichts lauten:
• "Je niedriger der soziale Status, desto wahrscheinlicher sind Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit." "Auch die Nutzung vom Home-Office unterscheidet sich, je nach Bildungsstand: Unter AkademikerInnen arbeiten mehr als zwei Drittel (67%) im Corona-bedingten Homeoffice. Hingegen sind es bei Menschen mit maximal Pflichtschulabschluss nur 11% - hier müssen 55% der Eltern wie immer zum Arbeitsplatz reisen." Wie dann Zwangs-Kinderbetreuung funktioniert, hat die Studie nicht erhoben, stressfrei mit Sicherheit aber nicht.
• "Home-Office führt nicht zu besserer Vereinbarkeit: Eltern arbeiten weniger und nachts"
• "Kinderbetreuung: Mehr als 10.000 Kinder bei Oma und Opa" - und dies obwohl ja Großeltern zu den (Hoch-)Risikopersonen gehören! "11% aller Eltern sagen, sie müssen ihre Kinder derzeit einen Teil des Tages auch unbetreut Zuhause lassen, unter AlleinerzieherInnen sind es 17%."
• "Mütter weiterhin hauptverantwortlich für die Kinderbetreuung. Die Coronakrise hat nicht zu einer gerechteren Aufteilung der Verantwortung für die Kinderbetreuung geführt. In der aktuellen Krise haben zwar 23% der Väter die Hauptverantwortung für die Kinderbetreuung übernommen, dies vor allem in jenen Haushalten, in denen die Männer derzeit zuhause sind und die Frauen weiterhin ihrer Arbeit auswärts nachgehen müssen. Mütter bleiben in 42% aller Haushalte hauptverantwortlich für die Betreuung ihrer Kinder."
• "Mehr als die Hälfte der Mütter sehr stark belastet. Fast die Hälfte (46%) der befragten Eltern gibt an, dass die derzeitige Situation sie sehr stark belastet. Die Belastungen sind jedoch nicht gleich verteilt: Während Männer zu 40% angeben, unter der derzeitigen Situation zu leiden, sind es unter Frauen bzw. Müttern 51%. Das liegt nicht daran, dass Mütter die Vereinbarkeit von Berufs- und Familienleben grundsätzlich negativer bewerten: Vor der Krise haben Mütter die Vereinbarkeit sogar positiver gesehen als ihre Partner, aktuell ist es umgekehrt."
• Und zum schlechten Schluss noch ein Ausblick auf den Sommer: "Jede/r Vierte vor großen Problemen. Die Hälfte der Eltern hat für die Kinderbetreuung Urlaubstage verbraucht, dies betrifft vor allem Doppelverdiener-Haushalte und Beschäftigte ohne Möglichkeit auf Home-Office. Jedes vierte Elternteil schätzt deshalb, im Sommer nicht genug Urlaubstage für die Kinderbetreuung zu haben. Ebenso viele wissen nicht, wie sie die durchgängige Betreuung der Kinder im Sommer leisten sollen. Fast die Hälfte gibt an, sich keine externe Betreuung im Sommer leisten zu können, in der ArbeiterInnenschicht sind es 59%, unter Alleinerziehenden 71%."
Wer mehr Details wissen will kann den im Mai 2020 veröffentlichten 29-seitigen Endbericht Zur Situation von Eltern während der Coronapandemie von Daniel Schönherr kostenlos herunterladen.
Bernard Braun, 6.5.20
Ehemänner-Stress zwischen Alleinverdienerlast und Zweitverdiener"schmach". Die Macht und Hartnäckigkeit von Geschlechterrollen
 Auch wenn es im Durchschnitt immer noch die so genannte "gender pay gap" gibt, d.h. eine trotz oft gleicher Tätigkeit und Leistung geringere Bezahlung von Frauen, steigt mit der wachsenden Frauen- und Ehefrauenerwerbstätigkeit auch deren Anteil am Haushaltseinkommen.
Auch wenn es im Durchschnitt immer noch die so genannte "gender pay gap" gibt, d.h. eine trotz oft gleicher Tätigkeit und Leistung geringere Bezahlung von Frauen, steigt mit der wachsenden Frauen- und Ehefrauenerwerbstätigkeit auch deren Anteil am Haushaltseinkommen.
Ob und wie sich dies auf das Wohlbefinden oder die psychische Gesundheit ihrer Ehepartner auswirkt, hat jetzt eine Wissenschaftlerin der britischen Universität von Bath mit über 15 Jahren erhobenen Daten (insgesamt 19.688 Einzelbeobachtungen) der "Panel Study of Income Dynamics (PSID)" von 6.034 us-amerikanischen heterosexuellen Partnern untersucht und ist zu paradoxen Ergebnissen für das Selbstbewusstsein und die Geschlechtsrollenidentität von Männern gelangt.
• Erstens fühlen sich Ehemänner in der Rolle als Alleinverdiener des Haushaltseinkommens negativ gestresst (Disstress gemessen mit der "Kessler Psychological Distress Scale (K6)") was zu einer Reihe von unerwünschten gesundheitlichen Problemen führen kann bzw. führt.
• Zweitens fühlen sich Ehemänner dann am wenigsten gestresst, wenn ihre Ehefrauen erwerbstätig sind und mit ihrem Einkommen bis zu 40% zum Haushaltseinkommen beitragen.
• Drittens fühlen sich Ehemänner dann schnell zunehmend gestresst und "uncomfortable", wenn ihre Ehefrauen mehr als 40% des Haushaltseinkommens verdienen. Überschreitet dieser Anteil die 50%-Grenze, nehmen sich die Ehemänner als ökonomisch völlig abhängig wahr und erreichen den höchsten Stressgrad.
Für die Geschlechterforschung interessant sind in diesem Zusammenhang die zwischen Ehefrauen und -männern deutlich unterschiedlichen Einschätzungen des geringsten Stresslevels in Abhängigkeit von den Anteilen am Haushaltseinkommen. Während Männer dann sagen, sie seien am wenigsten wegen der Einkommen gestresst, wenn die Frauen mit 40% zum Haushaltseinkommen beitragen, meinen Ehefrauen, dies sei erst der Fall, wenn das Verhältnis 50%:50% sei - und schließen dann wahrscheinlich von sich auf ihren Partner.
Mehr über einkommensassoziierten Hintergründe mancher Verhaltens- und gesundheitlichen Symptomatik von verpartnerten Männern findet sich im Aufsatz Spousal Relative Income and Male Psychological Distress der Ökonomin Joanna Syrda, im November 2019 veröffentlicht in der Fachzeitschrift "Personality and Social Psychology Bulletin". Ein kurzes Abstract ist kostenlos erhältlich. Auf der Webseite der University of Bath findet man außerdem eine etwas längere Kurzübersicht über die Ergebnisse der Studie und ein Interview mit der Autorin.
Bernard Braun, 25.11.19
Profitieren Ehemänner gesundheitlich von Ehekrach? Ja, bei Diabetes, aber Ehefrauen nicht!
 In die lange Reihe der pharmakologischen Therapeutika und Verhaltensregeln gegen Diabetes gehört nach Ansicht einer am 25. Mai 2016 veröffentlichten Studie us-amerikanischer Soziologen auch eine unglückliche oder krisenhafte Ehe - jedenfalls für Männer. Dies ist zumindest auf den ersten Blick deshalb unerwartet, weil bisher die Ansicht überwog, Männer wie Frauen würden Ehekrisen vorrangig durch Frustessen und/oder -trinken sowie Körpervernachlässigung zu bewältigen versuchen, über kurz oder lang übergewichtig werden und damit beide einen klassischen Risikofaktor für Diabetes entwickeln.
In die lange Reihe der pharmakologischen Therapeutika und Verhaltensregeln gegen Diabetes gehört nach Ansicht einer am 25. Mai 2016 veröffentlichten Studie us-amerikanischer Soziologen auch eine unglückliche oder krisenhafte Ehe - jedenfalls für Männer. Dies ist zumindest auf den ersten Blick deshalb unerwartet, weil bisher die Ansicht überwog, Männer wie Frauen würden Ehekrisen vorrangig durch Frustessen und/oder -trinken sowie Körpervernachlässigung zu bewältigen versuchen, über kurz oder lang übergewichtig werden und damit beide einen klassischen Risikofaktor für Diabetes entwickeln.
Die neue Erkenntnis ist das Ergebnis einer Untersuchung der über 5 Jahre beobachteten Entwicklung der Ehequalität sowie der Gesundheitsqualität (389 Untersuchungspersonen waren am Ende des Untersuchungszeitraums an Diabetes Typ 2 erkrankt) von 1.228 verheirateten und zwischen 57 und 68 Jahren alten TeilnehmerInnen im us-amerikanischen "National Social Life, Health and Aging Project".
Wenn es sich um Männer handelte, verringerte eine Verschlechterung der Ehequalität das Risiko innerhalb der 5 Jahre diabeteskrank zu werden oder erhöhte sie für die an Diabetes Erkrankten die Chancen die Erkrankung gut steuern zu können. Quantitativ verringerte jede Einheit der Verschlechterung von Ehequalität auf einer dazu gebildeten mehrstufigen Ehequalitätsskala die Wahrscheinlichkeit diabeteskrank zu werden um 32%. Und nur bei Männern verringert eine Verschlechterung der Ehequalität mit jeder Einheit auf der Skala außerdem die relative Wahrscheinlichkeit einer unkontrollierten Diabeteserkrankung um 58%. Die AutorInnen vermuten, dass dies u.a. daran liegt, dass zwar einerseits Frauen ihre Ehemänner stark zu einem gesunden Verhalten anstacheln, dies aber andererseits im Laufe der Zeit zu einer Belastung der ehelichen Beziehungen führen kann. Diese Erklärung stimmt mit einer Reihe anderer im Text zitierten Studien über die sozialen Dynamiken von Ehen überein.
Ganz anders sieht es bei Frauen aus. Bei ihnen war in den fünf Untersuchungsjahren eine gute Ehe mit einem niedrigeren Risiko verbunden, diabeteskrank zu werden. Mit jeder Einheit der Verbesserung von Ehequalität auf der gerade erwähnten Skala verringerte die Wahrscheinlichkeit an Diabetes zu erkranken um 45%.
Auch wenn man die Limitationen dieser Studie berücksichtigt, d.h. es wurden eine Vielzahl möglicher kranheits- oder gesundheitsfördernder oder -gefährdender Details von Ehen nicht berücksichtigt und auch 5 Jahre Betrachtungszeitraum sind nicht sonderlich lang, ist das Ergebnis ein interessanter Beitrag zur genderspezifischen Analyse von Erkrankungsrisiken. Sicherlich wäre eine Replikation einer derartigen Longitudinalstudie auch außerhalb der USA wünschenswert. Interessant wäre, auch die genderspezifischen Wechselwirkungen von Ehequalität oder der Qualität vergleichbaren Paarbeziehungen mit anderen Erkrankungen zu untersuchen.
Der Aufsatz Diabetes Risk and Disease Management in Later Life: A National Longitudinal Study of the Role of Marital Quality von Hui Liu, Linda Waite und Shannon Shen ist in der Zeitschrift "The Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences" erschienen und sein Abstract ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 27.5.16
Wie wirken sich viele kürzere Episoden von Arbeitslosigkeit auf Gesundheit und Gesundheitsverhalten aus? Sehr unterschiedlich!
 Mittlerweile bestehen kaum mehr Zweifel daran und gibt es auch ausreichend Daten dafür, dass Langzeitarbeitslosigkeit die Gesundheit der Davon Betroffenen erheblich belastet und verschlechtert. Dass in vielen Ländern neben den Langzeit- und Dauerarbeitslosen aber auch viele Beschäftigte über lange Zeiten häufigere mehr oder weniger kurze Episoden oder Phasen von Arbeitslosigkeit erfahren und damit kumulativ Arbeitslosigkeitsbedrohungen und -zeiten haben, die nicht arg viel kürzer sind als manche Langzeitarbeitslosigkeit, ist eine Tatsache, wurde aber bisher nicht auf ihre Auswirkung auf Gesundheit untersucht.
Mittlerweile bestehen kaum mehr Zweifel daran und gibt es auch ausreichend Daten dafür, dass Langzeitarbeitslosigkeit die Gesundheit der Davon Betroffenen erheblich belastet und verschlechtert. Dass in vielen Ländern neben den Langzeit- und Dauerarbeitslosen aber auch viele Beschäftigte über lange Zeiten häufigere mehr oder weniger kurze Episoden oder Phasen von Arbeitslosigkeit erfahren und damit kumulativ Arbeitslosigkeitsbedrohungen und -zeiten haben, die nicht arg viel kürzer sind als manche Langzeitarbeitslosigkeit, ist eine Tatsache, wurde aber bisher nicht auf ihre Auswirkung auf Gesundheit untersucht.
Dies ändert sich nun durch eine Langzeitstudie eines 1.083 Personen umfassenden Schuljahrgangs in einer nordschwedischen Stadt, deren Arbeits-, Gesundheits- und Gesundheitsverhaltensbiografien über 14 Jahre mittels regelmäßiger Befragungen untersucht wurden.
Die Ergebnisse sahen so aus:
• Der gesundheitliche Zustand (z.B. Depression, somatische Symptome) und das Gesundheitsverhalten (z.B. Arztbesuche, Rauchen, Alkoholkonsum) korrelieren "dosis"abhängig mit der kumulativen Dauer von Arbeitslosigkeit.
• Hierbei gibt es aber beträchtliche Unterschiede zwischen Männern und Frauen: Während sich der gesundheitliche Zustand der Männer unter dem Einfluss kumulativer Arbeitslosigkeit kaum veränderte oder sich gesundheitliche Symptome sogar verringerten, verschlechterte sich die Gesundheit der Frauen unter denselben Bedingungen erheblich. Genau umgekehrt sieht der Zusammenhang von kumulativer Arbeitslosigkeit und dem Gesundheitsverhalten aus: Während das Verhalten der Frauen relativ gering mit der Summe der Arbeitslosigkeitszeiten verknüpft war, verschlechterte es sich bei den Männern unter denselben Bedingungen beträchtlich.
Die AutorInnen appellieren daher an die Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitiker, auch der Aneinanderreihung kurzer Arbeitslosigkeitsepisoden mehr gesundheitspräventive Aufmerksamkeit zu schenken als bisher. Ob dies in anderen Teilen Schwedens und in anderen Ländern auch so ist und woran dies liegt, bleibt weiteren Studien überlassen.
Der Aufsatz Length of unemployment and health-related outcomes: a life-course analysis von Urban Janlert, Anthony H Winefield und Anne Hammarström ist am 23. November 2014 "online first" in der Zeitschrift "European Journal of Public Health" erschienen und ein Abstract ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 30.11.14
"Frauen, die wie Männer rauchen sterben auch wie Männer" - 50-Jahre-Trends der nikotinassoziierten Sterblichkeit nach Geschlecht
 Die zahlreichen Berichte über den Zusammenhang von Zigarettenrauchen mit diversen schweren Erkrankungen oder auch mit einer erhöhten Sterblichkeit, die plakativen Hinweise auf diese Zusammenhänge auf Zigarettenpackungen sowie die in einigen Verfahren vor US-Gerichten bekannt gewordenen vorsätzlich gesundheitsgefährdenden Vermarktungsstrategien der Tabakindustrie haben insbesondere in Westeuropa und den USA einen Teil der RaucherInnen aufhören lassen.
Die zahlreichen Berichte über den Zusammenhang von Zigarettenrauchen mit diversen schweren Erkrankungen oder auch mit einer erhöhten Sterblichkeit, die plakativen Hinweise auf diese Zusammenhänge auf Zigarettenpackungen sowie die in einigen Verfahren vor US-Gerichten bekannt gewordenen vorsätzlich gesundheitsgefährdenden Vermarktungsstrategien der Tabakindustrie haben insbesondere in Westeuropa und den USA einen Teil der RaucherInnen aufhören lassen.
Bei denjenigen, die nicht zu rauchen aufhören spielen falsche oder unklare Annahmen über die Entwicklung des Risikos, Fehleinschätzungen über die Risikoreduktion durch den Verzicht auf Rauchen und auch schlichtweg fehlende Daten eine Rolle.
Eine jetzt für die USA durchgeführte Analyse der Mortalitätstrends für bevölkerungsrepräsentative RaucherInnen, die in den Jahren 1959-1965, 1982-1988 und 2000-2010 bei einem Follow-up 55 Jahre und älter geworden waren, liefert wichtige Daten für eine Entscheidung mit dem Rauchen aufzuhören.
Die wichtigsten Erkenntnisse der ForscherInnen lauten:
• Das relative Risiko von aktuell rauchenden Frauen an Lungenkrebs zu sterben nahm in den drei untersuchten Zeiträumen und im Vergleich mit Frauen, die nie rauchten stetig zu, und zwar von 2,73 über 12,65 auf 25,66.
• Anders als manchmal vermutet gleicht sich das Lungensterblichkeitsrisiko der rauchenden Frauen innerhalb des Untersuchungszeitraums dem der rauchenden Männer an. Deren relatives Risiko nahm von 12,22 über 23,81 auf 24,97 zu.
• In der zuletzt untersuchten Kohorte der Jahre 2000 bis 2010 ähnelten sich auch die geschlechtsspezifischen Sterberisiken der Raucher für COPD (25,61 für Männer und 22,35 für Frauen), ischämische Herzerkrankung (2,50/2,86), jegliche Form von Schlaganfall (1,92/2,1) und die Kombination aller Sterbeursachen (2,8/2,76).
• Die Sterblichkeit an der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) stieg bei männlichen Rauchern in den letzten Kohorten nahezu in allen Altersgruppen und innerhalb aller Dauerklassen sowie bei allen Intensitäten des Rauchens weiter an. Dies ist auch deshalb von großer Bedeutung weil dieses Risiko bei den Nie-Rauchern gleichzeitig deutlich gesunken ist.
• Bei den Männern im Alter von 55 bis 74 Jahren und den Frauen zwischen 60 und 74 Jahren war die Gesamtsterblichkeit wenigstens drei Mal so hoch wie bei den gleichaltrigen Nie-Rauchern.
• Aufzuhören mit dem Rauchen "at any age dramatically reduced death rates." Wer vor dem vierzigsten Lebensjahr aufhört, baut die erhöhten Sterblichkeitsrisiken im weiteren Lebensverlauf ständig und am Ende fast völlig ab. Diese Untersuchung bestätigt außerdem, dass das vollständige Aufhören mit Rauchen wesentlich wirksamer für die Reduktion von Risiken ist als eine Reduktion der Anzahl von Zigaretten. Um nicht als Plädoyer für risikofreies "Rauchen bis 40" missverstanden zu werden, merkt einer der Studienautoren an: "That's not to say; however, that it is safe to smoke until you are 40 and then stop. Former smokers still have a greater risk of dying sooner than people who never smoked. But the risk is small compared to the huge risk for those who continue to smoke."
Auch wenn diese Studie anders als die bisherigen RaucherInnenstudien (z.B. eine Untersuchung der RaucherInnen unter Pflegekräften) nicht nur relativ gesunde TeilnehmerInnen untersucht, räumen auch ihre VerfasserInnen ein, dass erst in künftigen Studien das Rauchverhalten und die Erkrankungs- wie Sterblichkeitsrisiken jüngerer Personen untersucht werden müsste.
Der materialreiche Aufsatz "50-Year Trends in Smoking-Related Mortality in the United States" von Michael J. Thun et al. ist am 24. Januar 2013 im "New England Journal of Medicine" (368: 351-36) erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 5.2.13
"Baby blues". Nachgeburtliche Depression hat nicht selten nichts mit dem Baby zu tun, sondern mit gewalttätigen Partnern
 In der medizinischen Enzyklopädie des Internetportals "Medline plus" ("Motto: Trusted Health Information for you"), einem Service der "U.S. National Library of Medicine" und"National Institutes of Health" der USA, steht als Erklärung zu der bei vielen jungen Müttern in den ersten Tagen bis Monaten nach der Geburt ihres Kindes auftretende nachgeburtliche Depression (postpartum depression) folgendes: "Researchers think that changes in your hormone levels during and after pregnancy may lead to postpartum depression. If you think you have it, tell your health care provider. Medicine and talk therapy can help you get well."
In der medizinischen Enzyklopädie des Internetportals "Medline plus" ("Motto: Trusted Health Information for you"), einem Service der "U.S. National Library of Medicine" und"National Institutes of Health" der USA, steht als Erklärung zu der bei vielen jungen Müttern in den ersten Tagen bis Monaten nach der Geburt ihres Kindes auftretende nachgeburtliche Depression (postpartum depression) folgendes: "Researchers think that changes in your hormone levels during and after pregnancy may lead to postpartum depression. If you think you have it, tell your health care provider. Medicine and talk therapy can help you get well."
Dass eine Partnertherapie oder auch eine Trennung vom Kindesvater möglicherweise die bessere Lösung sein könnte, bleibt unerwähnt, obwohl mehrere Studien die körperliche, sexuelle und psychische Gewaltausübung der männlichen Partner als eine relativ häufige individuelle oder soziale Ursache der zum Teil schweren und langwierigen depressiven Erkrankung von jungen Müttern identifiziert haben.
Bereits 2010 veröffentlichten brasilianische Wissenschaftler die Ergebnisse einer prospektiven Studie mit 1.045, überwiegend unteren sozialen Schichten angehörender 18 bis 49-jährigen Frauen aus dem Nordosten Brasilien, die sie von vor der Geburt bis zu acht Monaten nach der Geburt systematisch untersuchten bzw. interviewten. Von diesen Frauen gaben 26% an, an nachgeburtlichen depressiven Symptomen gelitten zu haben bzw. zu leiden. 31% berichteten über männliche Partner, die sich während der Schwangerschaft gewalttätig verhielten. Am häufigsten, nämlich bei 28% der Frauen, handelte es sich um psychische Gewalt (z.B. Beleidigungen, Verängstigungen, Demütigungen), 12% der Frauen berichteten über körperliche Gewalt und 6% über sexuelle Gewalt, die oft mit psychischer Gewalt verbunden war. Das Risiko für eine Depression nach der Geburt hatten besonders die Frauen, welche zugleich unter körperlicher und sexueller Gewalt plus psychischer Gewalt zu leiden hatten. Das Depressionsrisiko nahm stetig mit der Zunahme psychischer Gewalt zu: Von 18% bei den Frauen ohne die Erfahrung psychischer Gewalt oder psychischen Missbrauchs bis zu 63% bei jenen Frauen, die am stärksten psychisch misshandelt wurden. Die zentrale Bedeutung der psychischen Gewalt zeigt sich schließlich daran, dass selbst bei Abwesenheit körperlicher oder sexueller Gewalt und unter Ausschaltung möglicher Confounder (z.B. niedriges Bildungsniveau und geringe soziale Unterstützung) das Depressionsrisiko bei häufiger psychischer Gewalt signifikant ansteigt.
Die Autoren empfehlen daher allen, die mit "Baby blues"-Müttern zu tun haben, an die mögliche (Mit-)Verursachung durch Partnergewalt zu denken oder gezielt danach zu fragen und dann vor allem mehr Aufmerksamkeit auf die psychischen Misshandlungen zu richten.
Wer jetzt denkt, hier handle es sich um "exotische" brasilianische Verhältnisse, irrt. Die am 7. Dezember 2011 online veröffentlichten Ergebnisse einer prospektiven Studie mit 1.504 zum ersten Mal schwangeren Frauen im australischen Melbourne, fördert ähnliche Verhältnisse in einem großstädtischen Milieu des 5. Kontinents zutage. Die Frauen wurden zwischen der sechsten und vieruundzwanzigsten Schwangerschaftswoche in die Studie aufgenommen (zwischen April 2003 und Dezember 2005) und nach einer Startbefragung noch drei, sechs und zwölf Monate nach der Niederkunft mit einem Standardinstrument ("Edinburgh Postnatal Depression Scale") zu ihrer psychischen Verfassung unter besonderer Berücksichtigung des Auftretens schwerer depressiver Symptome befragt. Erfahrungen mit Partnergewalttätigkeit wurden mit der Kurzfassung der "Composite Abuse Scale" bewertet. Ergänzt wurde die Datensammlung durch eine Reihe soziodemografischer Merkmale der Teilnehmerinnen.
Die wichtigsten Ergebnisse sahen so aus:
• 16,1% der Frauen berichteten schwere depressive Symptome während aller 12 nachgeburtlichen Monate bzw. zu jedem der Erhebungszeitpunkte. 57,6% der Frauen erlebten dies erst nach dem dritten nachgeburtlichen Monat. Die Autoren ziehen daraus den praktischen Schluss, dass ein Screening zur Identifikation der Frauen mit nachgeburtlicher Depression, das sich auf die ersten drei Monate konzentrierte, einen großen Teil der insgesamt im ersten Lebensjahr ihres Kindes auftretenden Depressionen überhaupt nicht erkennen kann.
• 16,6% der befragten Frauen berichteten von irgendeiner Form von Misshandlung oder Gewalttätigkeit, die sie in den 12 Monaten nach der Entbindung erfahren hatten. Von diesen Frauen gaben 54,2% an, ausschließlich emotional missbraucht worden zu sein, 34,2% berichteten von emotionaler und physischen Misshandlungen und 13,4% "nur" von körperlicher Gewalt
• Rund 40% der Frauen, die bei jeder Follow-up-Befragung von depressiven Symptomen berichteten, wurden nach ihren Angaben von ihren Partnern in irgendeiner Weise misshandelt.
• In einer multivariaten Analyse des Einflusses ausgewählter Faktoren auf die Häufigkeit nachgeburtlicher Depression verdoppelte sich die Wahrscheinlichkeit bei emotionalem Missbrauch fast (adjustierte Risikorate odds ratio [OR] 2,72). Die Risikorate stieg bei körperlichen Misshandlungen auf 3,94, bei dem Auftreten von schweren depressiven Symptomen in der Schwangerschaft auf 2,89 und bei Arbeitslosigkeit in der frühen Shwangerschaft als einer Art sozialer Gewalt, auf 1,6.
Die australischen ForscherInnen unterstreichen, dass die Gewalt gegen werdende Mütter auch in Australien ein verbreitetes Phänomen ist und weisen ähnlich wie ihre brasilianischen KollegInnen darauf hin, dass sich die im Gesundheitsbereich Beschäftigten daran stets erinnern sollten.
Von dem "brasilianischen" Aufsatz "Violence against women by their intimate partner during pregnancy and postnatal depression: A prospective cohort study." von Ludermir AB et al., erschienen 2010 in der Fachzeitschrift "Lancet" (Vol. 376, 11. September 2010: 903-910), ist ein Abstract kostenlos erhältlich.
Von dem "australischen" Aufsatz "Depressive symptoms and intimate partner violence in the 12 months after childbirth: a prospective pregnancy cohort study" von H Woolhouse; D Gartland, K Hegarty, S Donath und SJ Brown (erschienen im internationalen "British Journal of Obstetrics and Gynaecology" am 7. Dezember 2011 online) ist ebenfalls nur ein Abstract kostenfrei erhältlich.
Bernard Braun, 11.12.11
Kinder sind nicht nur "süß", sondern können ihre Väter auch vor dem Herztod bewahren - je mehr Kinder desto besser!
 Während der positive Zusammenhang zwischen der Fruchtbarkeit der Frauen und einigen Aspekte ihrer Gesundheit vielfach nachgewiesen ist, gab es bisher sehr wenige Untersuchungen, die ähnliche Zusammenhänge bei den Männern untersuchten oder gar nachwiesen.
Während der positive Zusammenhang zwischen der Fruchtbarkeit der Frauen und einigen Aspekte ihrer Gesundheit vielfach nachgewiesen ist, gab es bisher sehr wenige Untersuchungen, die ähnliche Zusammenhänge bei den Männern untersuchten oder gar nachwiesen.
Mit einer Auswertung der Gesundheits- und Sterbedaten von 137.903 US-Amerikanern im Alter zwischen 50 und 71 Jahren, die zu Beginn der Beobachtungszeit nicht an einer kardiovaskulären Erkrankung litten, liegen nun aber eine Reihe von Hinweisen vor, dass auch die Männer von ihrem bzw. ihrer "fertility potential and reproductive fitness" gesundheitlich profitieren. Die Daten wurden im Rahmen der "NIH-AARP Diet and Health Study" in den USA über eine Zeit von 10,2 Jahren erhoben.
92% der Studienteilnehmer hatten wenigstens ein Kind und 50% drei oder mehr Nachkommen. Das Durchschnittsalter der Männer betrug 62 Jahre und fast 95% waren Weiße.
Die Ergebnisse sahen so aus:
• Wenn man die Männer bzw. Väter nach Alter, Ausbildung, Rasse, Personenstand, Einkommen, nach diversen Gesundheitsverhaltensfaktoren und ihrem selbst wahrgenommen Gesundheitszustand adjustiert, also den möglichen Einfluss dieser Faktoren auf den untersuchten gesundheitlichen Effekt ausschließt, haben 50 Jahre und älteren Männer ohne Kinder eine im Vergleich mit Männern mit einem oder mehreren Kindern signifikant um 17% erhöhte Risikorate, wegen einer kardiovaskulären Erkrankung zu sterben.
• Die Untersuchungen zeigen auch, dass die protektive oder lebensverlängernde Wirkung von Kindern mit deren Anzahl zunimmt: Wenn kinderlose Männer mit Vätern von fünf oder mehr Kindern verglichenen werden, ist die genannte Risikorate um 21% erhöht. Das kardiovaskuläre Sterberisiko sinkt zwar stetig, aber nicht linear mit der Anzahl der Kinder.
Trotz einiger von den AutorInnen selber genannten Limitationen ihrer Studie (relativ geringe Dauer und Messprobleme für das reproduktive Potenzial), dürfte der beobachtete Zusammenhang bei künftigen Studien, die z.B. längere Beobachtungszeiten haben, aber eher noch deutlicher und größer werden.
Von dem am 26. September 2011 vorab veröffentlichten Aufsatz "Fatherhood and the risk of cardiovascular mortality in the NIH-AARP Diet and Health Study. von Michael L. Eisenberg et al. aus der Fachzeitschrift "Human Reproduction" ist ein Abstract kostenlos zugänglich.
Bernard Braun, 24.10.11
Hitzewallungen in der Menopause: Wenn eine "kurze Zeit" dauert und dauert und was dies für eine gute Versorgung bedeutet.
 Schon 2009 zog eine Auswertung von Behandlungsdaten (das Abstract des in der Zeitschrift Menopause [Mai/Juni; 16: 453] Aufsatzes Duration of vasomotor symptoms in middle-aged women: A longitudinal study von Col NF et al. ist kostenlos erhältlich) in Zweifel, dass es sich bei den Hitzewallungen und Schweißausbrüchen, einer der unerwünschten Begleiterscheinungen der weiblichen Wechseljahre, um eine "kurzfristige" Erscheinung handle, bis zu deren Verschwinden "waiting out" ausreiche. Die Zeitdauer reichte von 6 Monaten bis zu mehr als 5 Jahre. Damit war klar, dass mehr oder weniger offene Appelle, die Frauen mögen sich für eine kurze Zeit "zusammenreißen", völlig an der Wirklichkeit großer Teile der Frauen in den Wechseljahren vorbeigingen. Für mehrere Jahre war das für diese Situation weltweit verbreitete Therapeutikum der Wahl die Hormonersatztherapie. Der Hinweis in der zitierten Studie, die Beschwerden dauerten bei Frauen mit intensiverer körperlicher Bewegung nicht so lange, blieb eher ohne praktisches Echo.
Schon 2009 zog eine Auswertung von Behandlungsdaten (das Abstract des in der Zeitschrift Menopause [Mai/Juni; 16: 453] Aufsatzes Duration of vasomotor symptoms in middle-aged women: A longitudinal study von Col NF et al. ist kostenlos erhältlich) in Zweifel, dass es sich bei den Hitzewallungen und Schweißausbrüchen, einer der unerwünschten Begleiterscheinungen der weiblichen Wechseljahre, um eine "kurzfristige" Erscheinung handle, bis zu deren Verschwinden "waiting out" ausreiche. Die Zeitdauer reichte von 6 Monaten bis zu mehr als 5 Jahre. Damit war klar, dass mehr oder weniger offene Appelle, die Frauen mögen sich für eine kurze Zeit "zusammenreißen", völlig an der Wirklichkeit großer Teile der Frauen in den Wechseljahren vorbeigingen. Für mehrere Jahre war das für diese Situation weltweit verbreitete Therapeutikum der Wahl die Hormonersatztherapie. Der Hinweis in der zitierten Studie, die Beschwerden dauerten bei Frauen mit intensiverer körperlicher Bewegung nicht so lange, blieb eher ohne praktisches Echo.
Seit dem Erscheinen mehrerer Ergebnisse über die Wirkungen und Nebenwirkungen dieser Therapie in der "Women's Health Initiative (WHI)"-Studie (vgl. mehr auf der Website der "Women's Health Initiative") standen die Frauen vor einem mehrfachen Dilemma: Einerseits hatte die Hormonersatztherapie nur in einer verhältnismäßig kurzen Phase von 4-5 Jahren eine positive Wirkung auf die Häufigkeit und Intensität der Symptome und damit auf die Lebensqualität. Andererseits stiegen mit der Dauer der Hormonaufnahme verschiedene Erkrankungsrisiken kontinuierlich an. Es wird geschätzt, dass jede hundertste Frau, die länger als 5 Jahre Hormone einnahm, ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen, Thrombosen oder gar Brustkrebs hat. Dies ist mit ein Grund warum das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) unter Beachtung strenger Vorsichtsmaßnahmen empfiehlt, die Hormonersatztherapie mit Estrogen nicht länger als ein bis zwei Jahre und in der Kombination Estrogen-Gestagen allerhöchstens ein Jahr anzuwenden.
Insofern sind die neuesten Forschungsergebnisse über die Zeiträume, in dem Hitzewallungen auftreten können, ein echtes Problem.In der so genannten "Penn Ovarian Aging Study" wurde eine Kohorte von 259 bzw. 349 Frauen im Alter von 35 bis 47 Jahre prospektiv über 13 Jahre zu ihren Wechseljahresbeschwerden interviewt. Dabei stand die Frage nach dem Auftreten moderater bis ernsthafter Hitzewallungen im Mittelpunkt der Befragungen. In ihnen wurde allerdings auch der Menopause-Status, das Alter, die Rasse, das Niveau natürlicher Hormone, der Body Mass Index (BMI) und der Raucherstatus erhoben.
Die Dauer der Hitzewallungen sah so aus:
• Die durchschnittliche, mediane Dauer war 10,2 Jahre. Die individuelle Dauer hing aber erheblich davon ab, wann im Verlaufe der Wechseljahre die Symptome auftraten. Wenn sie bereits zu Beginn des Übergangs in die Menopause da waren, dauerten sie im Durchschnitt 11,57 Jahre und länger. Wenn sie erst beim Übergang in die postmenopausale Phase zum ersten Mal auftraten, dauerten sie im Schnitt "nur" noch 3,84 Jahre.
• Die Symptome starteten meistens im Alter von 45-49 Jahren.
• Schwarzafrikanische Frauen hatten nach Adjustierung bei anderen individuellen Merkmalen eine längere Zeit mit Hitzewallungen als sonst vergleichbare weiße Frauen.
• Raucherinnen und Nichtraucherinnen hatten in etwa gleich lange Beschwerden. Nicht übergewichtige Frauen mussten aber länger leiden als ihre übergewichtigen Altersgenossinnen.
Damit wird klar, dass selbst die kürzeste Dauer von Symptomen bei den meisten Frauen länger ist als Experten für die Therapie mit Hormonen als Dauer empfehlen, die keine unerwünschten Wirkungen auslöst.
Die Empfehlungen der AutorInnen der aktuellsten Studie, die Behandlung noch strenger als bisher zu individualisieren, das Risiko-Nutzenverhältnis der Hormonersatztherapie sorgfältig zu bewerten und auch andere Therapien (z.B. der Komplementärmedizin) in Erwägung zu ziehen, machen die Patientinnen und ihre ÄrztInnen eher ratlos. Sie versuchen zwar, eine riskante Fehlversorgung zu vermeiden, ohne aber wirklich etwas anzubieten, was den betroffenen Frauen während der offensichtlich langen Beeinträchtigung ihrer Lebensqualität helfen könnte.
Die aktuelle Studie Duration of menopausal hot flushes and associated risk factors von Freeman EW et al.. ist in der Fachzeitschrift "Obstetric Gynecology" ( 2011 May; 117: 1095) erschienen. Das Abstract ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 5.6.11
100 Jahre Internationaler Frauentag: Für viele Mädchen und Frauen in unterentwickelten Ländern (noch) kein Grund zu feiern.
 Pünktlich zum einhundersten Jahrestag des Internationalen Frauentag legte das US-amerikanische "Population Reference Bureau" eine Datenübersicht zur Lage der Mädchen und Frauen in aller Welt vor. Das "data sheet" umfasst Daten und Fakten zur Demografie, reproduktiven Gesundheit, Ausbildung sowie Arbeit und der Position im öffentlichen Leben. Hinzu kommen Informationen über die Gleichstellung von Männern und Frauen, die Einschränkung der Entwicklungschancen von Frauen durch frühe Verheiratung etc. oder auch die Gewalt gegen Frauen.
Pünktlich zum einhundersten Jahrestag des Internationalen Frauentag legte das US-amerikanische "Population Reference Bureau" eine Datenübersicht zur Lage der Mädchen und Frauen in aller Welt vor. Das "data sheet" umfasst Daten und Fakten zur Demografie, reproduktiven Gesundheit, Ausbildung sowie Arbeit und der Position im öffentlichen Leben. Hinzu kommen Informationen über die Gleichstellung von Männern und Frauen, die Einschränkung der Entwicklungschancen von Frauen durch frühe Verheiratung etc. oder auch die Gewalt gegen Frauen.
Zur gesundheitlichen Lage im engeren Sinne und meist für die letzten Jahre belegt die Sammlung u.a. folgende Zustände:
• Durch eine frühe und oft erzwungene Heirat und die meist damit einhergehenden Schwangerschaften entstehen für Mädchen große gesundheitliche Risiken. Die Müttersterblichkeit ist höher als bei Frauen, die ihre Kinder im Erwachsenenalter bekommen, und Komplikationen bei der Geburt sind bei Frauen unter 18 Jahren deutlich häufiger.
• Ob sich Frauen selber um ihre gesundheitliche Versorgung kümmern dürfen, ist weltweit sehr unterschiedlich: In Ländern wie Malawi und Senegal machen dies zu rund 70 % die Männer, was meistens zum Nachteil der Frauen ausgeht. In Kolumbien machen dies nur 9 % der Männer.
• Zudem verlassen Frauen, die jung heiraten, die Schule in der Regel früher und haben damit meist weniger Möglichkeiten, ein unabhängiges Einkommen zu erwerben. In Mali, Niger und Tschad etwa heiraten 70 Prozent der Mädchen, bevor sie 18 Jahre alt sind - diese Länder rangieren alle am untersten Ende des UN-Entwicklungsindex.
• Wäöhrend 2008 in Ägypten 58 % der Frauen aus der untersten sozialen Schicht Geburtshilfe durch eine qualifizierte Person erhalten, sind dies in Bangladesh nur 9 %. Dort erhalten selbst nur 57 % der Gebärenden aus der obersten sozialen Schicht eine derartige Hilfe. Im Weltdurchschnitt sind es 67 %.
• Die gesundheitliche Integrität wird häufig auch immer noch durch die körperliche Gewalt gegen Frauen gefährdet. Dies ist in vielen Ländern noch an der Tagesordnung und makabrerweise halten dies die Frauen sogar häufig und zum Teil häufiger für legitim als Männer. In Indien stimmten 30 Prozent der Frauen und 26 Prozent der Männer der Aussage zu, es sei in Ordnung, eine Frau zu schlagen, wenn sie ihrem Mann widerspricht. In Uganda halten es 31 Prozent der Frauen und 19 Prozent der Männer für legitim, eine Frau zu schlagen, wenn sie sich weigert, mit ihrem Mann zu schlafen. Hier sieht man, welch mächtigen Einfluss kulturelle Einstellungen und Prägungen haben können, deren Folgen bei weitem nicht allein durch Appelle an Männer verhindert werden können.
• Immer noch werden in vielen Ländern oder Kulturen Söhne gegenüber Töchtern bevorzugt. So gibt es in Ländern wie China oder Indien geschlechtsspezifische Abtreibungen und in der Folge ein quantitativ unnatürliches Verhältnis von Männern und Frauen. Sofern aber geboren, bekommen häufig Jungen mehr zu essen als Mädchen oder werden häufiger oder früher geimpft - mit Folgen für ihre Gesundheit und Lebenserwartung.
Die kommentarlose überwiegend tabellarische Datensammlung "World's Women and Gilrs 2011 Data Sheet" ist 2011 erschienen, umfasst 15 Seiten und ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 8.3.11
Geschlechterunterschiede in der Asia-Pacific-Region: 100 Millionen "fehlende Mädchen" und "verschwundene Frauen"
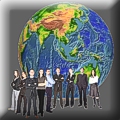 Trotz allseits erkannter sozialer und ökonomischer Nachteile wächst im asiatisch-pazifischen Raum mit den bevölkerungsmäßig größten Ländern Indien und China der Anteil der sogenannten "fehlenden Mädchen" und "verschwundenen Frauen" noch. Er erreicht laut dem "Asia Pacific Human Development Report 2010" der "United Nations Development Programm (UNDP)"-Organisation gegenwärtig die Anzahl von rund 100 Millionen Personen. Damit existiert in dieser Region einer der weltweit schlimmsten Geschlechterunterschiede.
Trotz allseits erkannter sozialer und ökonomischer Nachteile wächst im asiatisch-pazifischen Raum mit den bevölkerungsmäßig größten Ländern Indien und China der Anteil der sogenannten "fehlenden Mädchen" und "verschwundenen Frauen" noch. Er erreicht laut dem "Asia Pacific Human Development Report 2010" der "United Nations Development Programm (UNDP)"-Organisation gegenwärtig die Anzahl von rund 100 Millionen Personen. Damit existiert in dieser Region einer der weltweit schlimmsten Geschlechterunterschiede.
Dass hier nicht das "normale" Zahlenverhältnis zwischen Männern und Frauen (im Weltdurchschnitt entfallen 107 neugeborene Jungen auf 100 neugeborene Mädchen) existiert, beruht auf verschiedenen Faktoren, Bedingungen und Interventionen: Dies fängt mit "missing girls" an, d.h. auf 100 geborene Mädchen entfallen 119 geborene Jungs. Ursachen dieser "birth gender disparity" ist vor allem die teilweise durch Regierungsprogramme initiierte und immer noch geförderte vorrangige Abtreibung weiblicher Föten. Hinzu kommt aber bei heranwachsenden Mädchen oder erwachsenen Frauen eine systematische Diskriminierung beim Erhalt von Gesundheitsversorgung, beim Zugang zu guter Ernährung oder einfach durch kulturell verankerte Vernachlässigung. Die Länder mit den höchsten Raten "verschwundener Frauen" sind mit je ungefähr 42,6 Millionen Personen Indien und China.
Den (über)-lebenden Frauen im Asien-Pazifik-Raum geht es aber keineswegs gut, im Gegenteil:
• Ein Zehntel der im Report berücksichtigten Frauen wurden von ihren Partner körperlich verletzt.
• Bis zu 85% der in Südasien arbeitenden Frauen machen dies in instabilen "low-end"-Jobs in der Schattenwirtschaft.
• Obwohl Frauen in der Landwirtschaft, ähnlich wie weltweit, in der Agrarwirtschaft überwiegen, haben nur 7% der Farmen in dieser Region eine Eigentümerin.
• In der Hälfte der Länder Südasiens und in mehr als 60% der Pazifikländer existieren keine Gesetze gegen häusliche Gewalt.
• Mangels wirksamer Gesetze oder betrieblicher Vereinbarungen berichten 30-40% der arbeitenden Frauen über eine Vielfalt von Formen des sexuellen Missbrauchs am Arbeitsplatz.
• Dort, wo Frauen überhaupt erwerbstätig sind bzw. sein dürfen, reicht der "pay gap" zu Männern von 54 bis 90 Prozent. In Ostasien arbeiten fast 70% der Frauen gegen Lohn, in Indien und Pakistan machen dies nur weniger als 35%. Der weltweite Anteil beträgt 53%.
• Diese Benachteiligung findet trotz der gesicherten Erkenntnis statt, dass eine hohe, d.h. bei 70% liegende Beteiligung der Frauen am Arbeitsleben in Ländern wie Indien, Indonesien und Malysia zu einer jährlichen Erhöhung des Bruttosozialprodukts zwischen 2 und 4% führen würde. In der Region könnten durch eine durchschnittliche Frauenerwerbstätigkeit jährlich rund 89 Milliarden US-Dollar mehr erwirtschaftet werden als ohne sie.
Zu den Handlungsempfehlungen des Reports gehören das Landbesitzrecht für Frauen, die Ausdehnung der bezahlten Arbeit für Frauen, sichere Bedingungen für Migranten, hohe Investitionen in höhere Ausbildung und natürlich auch eine umfassendere, bedarfsgerechte und hochwertigere Gesundheitsversorgung. Hilfreich dabei erscheinen den VerfasserInnen des Reports vor allem ein Bewusstseins- und Verhaltenswandel bei "jedermann".
Interessant ist schließlich noch die fehlende oder nicht lineare Korrelation des Entwicklungsniveaus oder der Erwerbshäufigkeit mit dem Grad der politischen Beteiligung. Die Anzahl der von Frauen besetzten Sitze in Parlamenten und in vergleichbaren Institutionen lag in Japan oder Südkorea, also relativ gutgestellten Ländern, bei 10%. Der Anteil lag in Ländern mit bewegter (Bürgerkrieg, Befreiungskrieg) jüngerer Vergangenheit wie Nepal bei 31% oder in Timor Leste bei fast 30%.
Auch wenn viele der in diesem Report veröffentlichten Daten geschätzt sind und damit auch einige sozialen Indikatoren über- oder unterschätzt sein können, schließt der Bericht eine in den entwickelten Ländern weit verbreitete Erkenntnislücke über soziale und auch gesundheitliche Benachteiligungen und Unterschiede.Auf diesem Hintergrund erscheint beispielsweise die monatelange Debatte über die angeblich lebensbedrohlichen Folgen der ersten, zweiten oder winterlichen Schweinegrippen-Pandemie-Wellen in Europa und Nordamerika einem eigentümlichen Licht.
Von dem am 8. März 2010 in Neudehli vom UNDP veröffentlichten materialreichen Report "Asia-Pacific Human Development Report: Power, Voice and Rights. A Turning Point for Gender Equality" gibt es eine 4-Seiten-Fassung und auch den 255 Seiten umfassenden Kompletttext kostenlos (Achtung: lange Downloadzeiten).
Bernard Braun, 9.3.10
Alle Jahre wieder: Ein, zwei, drei und viele Gleichheits-"Lücken" zum Weltfrauentag
 Egal ob man die Initiative des mittlerweile fast weltweit bekannten internationalen Frauen- oder Weltfrauentags auf Klara Zetkin, Alexandra Kollontaj, Wladimir Lenin oder wegen der drohenden sozialistischen Schlagseite lieber auf die Vereinten Nationen zurückführt, und egal ob er seit 1911, 1917 oder Ende der 1960er Jahre gefeiert wird: Das Thema unterschiedlicher Löhne für Frauen und Männer spielt nahezu immer und in jedem Land eine der Hauptrollen und sie anzugleichen war und ist ein handfestes Dauerziel.
Egal ob man die Initiative des mittlerweile fast weltweit bekannten internationalen Frauen- oder Weltfrauentags auf Klara Zetkin, Alexandra Kollontaj, Wladimir Lenin oder wegen der drohenden sozialistischen Schlagseite lieber auf die Vereinten Nationen zurückführt, und egal ob er seit 1911, 1917 oder Ende der 1960er Jahre gefeiert wird: Das Thema unterschiedlicher Löhne für Frauen und Männer spielt nahezu immer und in jedem Land eine der Hauptrollen und sie anzugleichen war und ist ein handfestes Dauerziel.
Amtlich festgestellt hört sich dies für die Bundesrepublik Deutschland in der Pressemitteilung Nr.079 des Statistischen Bundesamtes vom 05.03.2010 so an: "Gender Pay Gap 2008: Deutschland weiterhin eines der Schlusslichter in der EU".
Der Gender Pay Gap wird auf Basis der nationalen Verdienststrukturerhebungen ermittelt. Da es sich bei dieser Datengrundlage um eine in vierjährigen Abständen durchgeführte Erhebung handelt, die zuletzt für das Jahr 2006 stattfand, werden die Ergebnisse für die Jahre zwischen den Erhebungen jeweils mit nationalen Quellen fortgeschätzt. Für Deutschland wird hierzu die Vierteljährliche Verdiensterhebung genutzt.
Nach Feststellung der amtlichen Statistiker lag der so genannte "Gender Pay Gap, das heißt der prozentuale Unterschied im durchschnittlichen Bruttostundenverdienst von Männern und Frauen, … in Deutschland mit 23,2% auch im Jahr 2008 deutlich über dem Durchschnitt der Europäischen Union (18,0%)."
Nach einer anderen Mitteilung des Statistischen Bundesamtes aus dem November 2009 bedeutet dies für die deutschen Frauen in Euro: Sie verdienten im Jahr 2008 mit durchschnittlich 14,51 Euro pro Stunde 4,39 Euro weniger als ihre männlichen Kollegen.
Diese Unterschiede stellen einerseits ein gravierendes Gerechtigkeitsproblem dar, tragen aber zusammen mit vielen anderen bekannten Faktoren (z.B. berichtet das Statistische Bundesamt aktuell über den seit 1949 erstmaligen Rückgang der Bruttoverdienste in Deutschland um 0,4% im Jahr 2009) zu der tendenziell zunehmenden Einnahmeschwäche der immer noch weitgehend über einkommensbezogene Beiträge finanzierten deutschen Sozialversicherungsträger und ist daher z. B. auch ein gesundheitspolitisches Problem.
Zurück zum internationalen Vergleich: Von den 27 Ländern der europäischen Union wiesen lediglich Estland (letzter Wert für 2007: 30,3%), die Tschechische Republik (26,2%), Österreich (25,5%) und die Niederlande (letzter Wert 2007: 23,6%) einen gegenüber Deutschland höheren geschlechtsspezifischen Verdienstabstand auf. Das Land mit den europaweit geringsten Unterschieden im Bruttostundenverdienst von Männern und Frauen war im Jahr 2008 Italien (4,9%). Auch (oder selbst?) Slowenien (8,5%), Rumänien, Belgien (jeweils 9,0%), Malta und Portugal (jeweils 9,2%) verzeichneten einen eher moderaten Gender Pay Gap.
Das zusätzlich Brisante an dieser Meldung ist, dass sich verglichen mit den Vorjahren kaum Veränderungen feststellen lassen - jedenfalls nicht für die deutschen Frauen! Es gab sogar seit 2006 eine leichte Verschlechterung von 22,7 % auf den aktuellen Wert. Die deutlichen Verbesserungen für die erwerbstätigen Frauen in Zypern und der Slowakei, die im Jahr 2007 noch schlechter bezahlt wurden, zeigen, dass es bei weitem kein "ehernes gender-pay-gap-Gebot" gibt.
Auch nicht zum ersten Mal gießt das Statistische Bundesamt an dieser Stelle aber gewaltig Schweröl auf die möglicherweise aufkommenden Wogen. Denn, so der Stehtext: "Bei der Interpretation der Werte sollte berücksichtigt werden, dass es sich um den unbereinigten Gender Pay Gap handelt. Aussagen zum Unterschied in den Verdiensten von weiblichen und männlichen Beschäftigten mit gleichem Beruf, vergleichbarer Tätigkeit und äquivalentem Bildungsabschluss sind damit nicht möglich."
Wenn dies auch für die beim Statistischen Bundesamt generierten Daten sein mag, so gibt es seit Jahren aber in Gestalt des vom "World Economic Forum" in Davos herausgegebenen und von renommierten Experten verfassten "Global Gender Gap Report" eine Datenquelle, die nicht nur im internationalen Maßstab über die Verdienstlücken der Frauen berichtet, sondern auch eine Fülle weiterer "Gaps" dokumentiert. Die aktuellste Quelle ist der am 27.10.2009 veröffentlichte "Global Gender Gap Report 2009", der von Ricardo Hausmann (Harvard University), Laura D. Tyson (University of California, Berkeley) und Saadia Zahidi (World Economic Forum) verfasst wurde.
Und in diesem Report findet sich für den Verdienstabstand folgender Indikator: "The remuneration gap is captured through a hard data indicator (ratio of estimated female-to-male earned income) and a qualitative variable calculated through the World Economic Forum's Executive Opinion Survey (wage equality for similar work)."
Der Executive Opinion Survey ist die Hauptdatenquelle für den "Global Competitiveness Report" des Forums, der regelmäßig viele nicht anderweitig erfassten Daten durch eine weltweite Befragung von rund 15.000 Ökonomen sowie Experten aus öffentlichen Verwaltungen, internationalen Organisationen und Unternehmen zusammenzutragen versucht. Die Ergebnisse sind daher wie alle qualitativen Daten in mancherlei Hinsicht verzerrt. Angesichts der sozialen Zusammensetzung der Befragten dürften aber ungerechte soziale Verhältnisse eher unterschätzt als übertrieben werden. Und selbst wenn die einzelnen Länderwerte absolut fehlerhaft sein sollten, taugen die Zahlen zumindest noch gut für Vergleiche zwischen Ländern und in der Zeit - vorausgesetzt die Verzerrungen tauchen identisch für jedes Land und jedes Befragungsjahr auf.
Der "gender pay gap"- bzw. "female-to-male ratio"-Wert" für "wage equality for similar work" betrug 2008 nach dem Report für 2009 in Deutschland 0,58. Dieser Wert liegt auf einer Skala von 0,00 für völlige Ungleichheit bis 1,00 für völlige Gleichheit der Einkommen von Frauen und Männern. Damit liegt Deutschland im Vergleich der 134 Länder, die im Report berücksichtigt wurden, auf Platz 101 und damit unter dem Durchschnittswert von 0,66. Dass es besser, aber keineswegs wesentlich gleicher geht, zeigen z.B. die Indikatorwerte für Schweden (0,72) und den Niederlanden (0,63).
Die im "Gender Gap-Report" dokumentierten Unterschiede der Einkommen in Geldeinheiten bestätigen das Niveau und die Tendenz der vom Statistischen Bundesamt gemachten Angaben: Bei dem von den Report-Autoren gewählten Indikator "estimated earned income" mit in US-Dollar umgerechneten Kaufkraftparitäten (PPP) verdienten 2008 deutsche Frauen 24.138 US-$ und deutsche Männer 39.600 US-$. Das Verhältnis beider Einkommen betrug 0,61 zu Ungunsten der Frauen.
Zum Vergleich: Der Durchschnittswert für diesen Indikator betrug 0,52, was angesichts der Fülle von Entwicklungsländern im Report nicht verwundert. In den beiden vergleichbaren Ländern Schweden und Niederlande sah dies schon besser aus: 0,84 waren es in Schweden und immerhin 0,66 in Holland. Entsprechend landen die deutschen Frauen beim Einkommensunterschied zu Männern weltweit auf Platz 49, Schweden auf Platz 1 und Holland auf Platz 33.
Wie bereits angedeutet, gibt es aber weder weltweit noch in Deutschland nur eine erhebliche und für Frauen nachteilige Lücke zu den sozialen Verhältnissen der Männer.
Einige weitere Beispiele aus dem Report 2009 illustrieren dies prägnant:
• Beim "Gender Gap Index" der die bereits genannten und einige weitere wirtschaftlichen Indikatoren zur Arbeitsmarkt- und Berufslage, Angaben zum Bildungsstand, zu Gesundheit und Lebenserwartung sowie zur politischen Partizipation und Repräsentanz zusammenfasst, landet Deutschland 2009 trotz einiger verringerter "gaps" auf Platz 12. Dies war aber gegenüber den Vorjahren eine stetige und deutliche Verschlechterung: 2006 lag Deutschland bereits einmal auf Platz 5, fiel dann 2007 auf den siebten und 2008 auf den elften Platz.
• Fasst man die fünf Einzelindikatoren zur wirtschaftlichen Lage zusammen, landen die deutschen Frauen im internationalen Vergleich auf Rang 37. Bei den Errungenschaften im Bildung- und Qualifikationsbereich reichte es trotz einiger Spitzenwerte insgesamt nur für den 49ten Platz. Bei Gesundheit und Lebenserwartung rutschen die deutschen Frauen auf Platz 60, liegen aber beim "political empowerment" wieder auf Platz 13.
Der Report des "World Economic Forum" enthält eine Fülle weiterer, auch teilweise positiv wie negativ überraschender Detailinformationen zur Lage der Frauen in den 134 Ländern. Die wesentlichen Ergebnisse sind im Querschnitt und bei einigen Indikatoren auch im Längsschnitt seit 2006 für jedes der Länder auf einer einzigen Seite zusammengefasst.
Der 205 Seiten umfassende "The Global Gender Gap Report 2009" ist kostenlos zu erhalten. Dies gilt auch für die vorherigen Berichte ab 2006, die noch auf einer speziellen Website des Davoser Forums erhältlich sind.
Bernard Braun, 7.3.10
"Schlägst Du mich, schlag ich meine Frau" - Wie in Palästina politische Gewalt mit häuslicher Gewalt gegen Frauen verbunden ist
 Die Resolution 1325 des UN-Sicherheitsrats weist auf die Gewalt gegen Frauen und Mädchen als Folge kollektiver Gewalt durch Kriege, staatliche Repression, Folter und gewalttätige politische Konflikte hin. Die ebenfalls verabschiedeten humanitären Leitlinien zur Prävention dieser Folgegewalt gegenüber meist völlig unbeteiligten Personen konzentrieren sich auf die Verhinderung von physischer, psychischer und sexueller Gewalt gegen Personen außerhalb des Familienkreises der gewalttätig werdenden Personen.
Die Resolution 1325 des UN-Sicherheitsrats weist auf die Gewalt gegen Frauen und Mädchen als Folge kollektiver Gewalt durch Kriege, staatliche Repression, Folter und gewalttätige politische Konflikte hin. Die ebenfalls verabschiedeten humanitären Leitlinien zur Prävention dieser Folgegewalt gegenüber meist völlig unbeteiligten Personen konzentrieren sich auf die Verhinderung von physischer, psychischer und sexueller Gewalt gegen Personen außerhalb des Familienkreises der gewalttätig werdenden Personen.
Die Aufforderung an alle am Konflikt beteiligten Parteien, Frauen und Mädchen vor Gewalt zu schützen und internationales Recht zu achten, kannte bisher nicht die Gewalt gegen weibliche Familienangehörige oder ignorierte sie. Dass diese existiert, belegte eine Reihe von meist kleineren und methodisch eingeschränkten Studien in verschiedenen Ländern mit mehr oder weniger heftigen Gewaltereignissen und -erfahrungen.
In einer jetzt u.a. in den von Israel besetzten, besiedelten oder militärisch angegriffenen Gebieten (vor allem West Bank und Gazastreifen) mit mehrheitlich palästinensischer Bevölkerung durchgeführten umfangreichen Studie wurden die bisherigen Ergebnisse methodisch abgesichert und inhaltlich bestätigt und weiter differenziert.
Das Ergebnis lautet zusammengefasst: Verheiratete Frauen, deren Ehemänner in den palästinensischen Gebieten direkter politischer Gewalt bzw. massiver sozialer und ökonomischer Verunsicherung ausgesetzt waren, haben ein mehr als zweifach höheres Risiko, Gewalt durch den Partner zu erleben, als Frauen, deren Männer davon verschont blieben. Dies ist eine der Schlussfolgerungen eines aktuellen Artikels der "Konflikt-Spezialausgabe" des britischen Medizin-Journals "Lancet".
Für diesen Aufsatz analysierten Cari Jo Clark vom "Program in Health Disparities Research" an der University of Minnesota und Muhammad M. Haj-Yahia von der "Hebrew University of Jerusalem" zusammen mit weiteren Kollegen Querschnittsdaten, die das palästinensische Büro für statistische Erhebungen (PCBS) zwischen Dezember 2005 und Januar 2006 gesammelt hat. Insgesamt wurden 4.156 Haushalte per Zufallsverfahren ausgewählt, in denen insgesamt 3.815 Frauen im Alter von 15 bis 64 Jahren lebten, die jemals verheiratet waren. Die Analyse beschränkte sich auf die aktuell verheirateten 3.510 Frauen. Die Beteiligung war mit 92% so hoch, dass die Ergebnisse als repräsentativ gelten können. Die Frauen erhielten die Kurzversion eines Fragebogens, mit dessen Instrumenten, den "Conflict Tactics Scales (CTS)" und dem "Exposure to Political Violence Inventory (EPVI)", das Ausmaß der individuellen und familiären Erfahrungen mit Besatzungstruppen oder Siedlern, die die persönliche Sicherheit bedrohen gemessen werden sollte. Das Erleben politischer Gewalt wurde als direktes Ausgesetztsein des Ehemanns z.B. gegenüber israelischen Soldaten charakterisiert, seiner indirekten Betroffenheit durch die Erfahrungen von Diskriminierungen seiner Familie (z.B. die Erschwernis des Zusammenhalts der meist großen Familien durch die Wallanlagen) sowie der wirtschaftlichen Auswirkungen der Gewalterfahrung auf den Haushalt.
Die Exposition gegenüber Gewalt durch israelische Streitkräfte oder Siedler machen folgende ebenfalls erhobenen Daten plastisch: 8% der Ehemänner waren in irgendeiner Weise Gewalt ausgesetzt, 20% der Familien waren Gewalt ausgesetzt, die von der Zerstörung des Hauses (8%) über die Inhaftierung von Familienangehörigen in 4% der Familien bis zum Arrest von weniger als einem Prozent reichte und schließlich verschlechterte sich die ökonomische Situation von 43% der Haushalte und der Ehemann von 22% der befragten Frauen verlor seinen Arbeitsplatz.
Politische Gewalt war in multivariaten Analysen signifikant mit höheren Raten häuslicher Gewalt durch den Ehepartner verbunden:
• Frauen, deren Ehemänner direkt politische Gewalt erfahren hatten, hatten ein zwischen 89% und 123% erhöhtes Risiko, körperliche oder sexuelle Gewalt zu erleben, als Frauen, deren Ehemänner bislang noch nicht direkt betroffen waren.
• Frauen, deren Ehemänner indirekt angegriffen wurden, hatten ein um 61% und 97% höheres Risiko, körperliche und sexuelle Gewalt zu erleiden, verglichen mit den Frauen, deren Ehemänner nicht indirekt betroffen waren.
• Ökonomische Nachteile oder Gewalt führte nur im Gazastreifen zu einer statistisch signifikant deutlich höheren Betroffenheit der Ehefrauen von Gewalt. Zur Erinnerung: Der Gazastreifen ist mit 360 Quadratkilometern etwas kleiner als das deutsche Bundesland Bremen, besteht überwiegend aus Sand und Dünen und wird von rund 1,5 Millionen Menschen bewohnt, die sich in wenigen Siedlungen und Lagern zusammenballen.
Die Autoren diskutieren eine Reihe von Faktoren, die der Verknüpfung zwischen politischer Gewalt und häuslicher Gewalt durch den Ehepartner zugrunde liegen könnten. Sie stellen fest: Besatzungspolitik und Erfahrungen mit den Besatzungstruppen haben fortwährende Demütigungen der Männer zur Folge und machen es ihnen unmöglich, ihre Familien zu schützen und zu versorgen, was potenziell zu Frustrationen und Gewalt gegen schwächere Menschen führt, nämlich Frauen und Kinder. Aus Sicht einer Ressourcen-Theorie könnte die Gewalt ausgeführt werden, um die sozial etablierte Machtposition der Männer in der Familie wieder geltend zu machen." Die Forscher fügen hinzu: "Die Besatzungspolitik, darunter die Sperranlagen, die in verschiedenen Teilen der West-Bank errichtet werden, beeinträchtigen die familiäre Verbundenheit, indem sie den Frauen den regelmäßigen Kontakt zu ihren Familien entziehen, die anderenfalls eingreifen würden, um häusliche Gewalt durch den Ehepartner zu vermeiden."
Die Autoren folgern daraus: "Notwendig ist die Erforschung der potenziellen Wege, die von der politischen Gewalt zur häuslichen Gewalt führen, wobei eine Reihe von Erklärungen und deren Wechselwirkungen in Betracht gezogen werden müssen, da jede einzelne Erklärung nicht ausreicht, die Verknüpfung zu begründen. Unsere Ergebnisse weisen außerdem auf die Wichtigkeit der Beurteilung verschiedener Arten der Gewalterlebnisse hin, wenn der potenzielle Bedarf psychosozialer Interventionen berücksichtigt werden soll, da das Erleben vieler traumatischer Ereignisse mit vermehrten psychischen und körperlichen Gesundheitsproblemen verknüpft ist."
Durch die Durchdringung auch privater Verhältnisse mit Gewalt verlieren die betreffenden Personen auch noch letzte Ressourcen zur Bewältigung psychosozialer Krisen und wichtige Voraussetzungen für eine Art langfristige Rest-Lebensqualität.
Wenn man bedenkt, dass zur Zeit weltweit in mindestens 15 bis 20 Ländern mit mehreren Zigmillionen Einwohnern völkerrechtlich erklärte Kriege oder so genannte assymmetrische Auseinandersetzungen mit allen Formen der Gewalt stattfinden, wird die Bedeutung der hier untersuchten Zusammenhänge für eine friedlichere und humanere Zukunft in diesen Ländern besonders deutlich. Der beschriebene Zusammenhang kann allerdings in den meisten Fällen nur durch politische Lösungen durchbrochen werden. Mit den Ergebnissen aus Palästina liegt ein weiterer Grund vor, sich um politische Lösungen zu kümmern.
Der siebenseitige Aufsatz "Association between exposure to political violence and intimate-partner violence in the occupied Palestinian territory: a cross-sectional study" von Cari Jo Clark, Susan A Everson-Rose, Shakira Franco Suglia, Rula Btoush, Alvaro Alonso, Muhammad M Haj-Yahia ist in der Ausgabe "Lancet"-Ausgabe vom 23. Januar 2010 erschienen (2010. Vol. 375: 310-316) erschienen und nach einer problem- und garantiert nicht von unerwünschten Mails gefolgten Registrierung komplett kostenfrei erhältlich.
Bernard Braun, 25.1.10
Wenn ein Partner an Krebs erkrankt: Frauen übernehmen eher die häusliche Pflege, Männer neigen zu Flucht und Trennung
 Lebensbedrohliche Erkrankungen wie Krebs sind fast immer mit schweren psychischen Belastungen und Stress verbunden - und dies sowohl für den erkrankten Patienten wie auch für seinen Partner oder seine Partnerin. Nicht selten sind diese Belastungen so schwerwiegend, dass sie zur Trennung oder Scheidung führen. Eine US-amerikanische Studie hat in diesem Zusammenhang jetzt eine überraschende Entdeckung gemacht: Bei einer schwer wiegenden Erkrankung (wie Krebs oder Multiple Sklerose) ist das Risiko einer Trennung oder Scheidung zehn mal so hoch wenn die Partnerin bzw. Ehefrau betroffen ist. Frauen sind offensichtlich eher bereit, sich für den kranken Partner aufzuopfern und eine pflegende und sozial unterstützende Rolle zu übernehmen, während Männer sich von dieser Aufgabe häufiger überfordert fühlen und ihre Partnerin verlassen.
Lebensbedrohliche Erkrankungen wie Krebs sind fast immer mit schweren psychischen Belastungen und Stress verbunden - und dies sowohl für den erkrankten Patienten wie auch für seinen Partner oder seine Partnerin. Nicht selten sind diese Belastungen so schwerwiegend, dass sie zur Trennung oder Scheidung führen. Eine US-amerikanische Studie hat in diesem Zusammenhang jetzt eine überraschende Entdeckung gemacht: Bei einer schwer wiegenden Erkrankung (wie Krebs oder Multiple Sklerose) ist das Risiko einer Trennung oder Scheidung zehn mal so hoch wenn die Partnerin bzw. Ehefrau betroffen ist. Frauen sind offensichtlich eher bereit, sich für den kranken Partner aufzuopfern und eine pflegende und sozial unterstützende Rolle zu übernehmen, während Männer sich von dieser Aufgabe häufiger überfordert fühlen und ihre Partnerin verlassen.
Basis der jetzt in der Zeitschrift "Cancer" veröffentlichten Studie sind Daten von 515 männlichen und weiblichen Patienten, bei denen im Zeitraum 2001-2002 eine schwere Erkrankung diagnostiziert wurde: Bei den meisten ein Gehirntumor oder eine andere Krebserkrankung und bei etwa 20 Prozent Multiple Sklerose. Alle waren verheiratet, etwas mehr als die Hälfte war weiblich (53%). Bei diesen Patienten wurde dann bis zum Jahre 2006 überprüft, ob sich an der familiären Situation etwas änderte, und zwar derart, dass es zu einer dauerhaften auch räumlichen Trennung (Verlassen der gemeinsamen Wohnung über einen Zeitraum von mindestens 3 Monaten) oder zu einer Scheidung kam.
Tatsächlich war dies bei insgesamt 60 Studienteilnehmern (12%) der Fall. In einer detaillierteren Analyse zeigten sich dann jedoch überraschend deutliche Geschlechtsunterschiede. Wenn die Frau an Krebs oder MS erkrankte, kam es in 21% aller Fälle zu einer Trennung, war der Mann erkrankt, war dies nur bei 3% der Fall. Dieser markante Geschlechtsunterschied zeigt sich auch bei separater Betrachtung der einbezogenen Errankungsarten.
Auch im Rahmen einer multivariaten Analyse, in der eine große Zahl von möglichen Einflussfaktoren gleichzeitig überprüft wird, bestätigte sich das Ergebnis. Hier wurde dann deutlich:
• Ist die Frau erkrankt, liegt das Risiko einer Trennung über 10mal so hoch ("Odds-Ratio" = 10,8 p<0,001)
• Einen deutlichen Einfluss hat auch das Alter bei der Diagnose: Ist der erkrankte Patient (oder die Patientin) unter 50 Jahre alt, ist das Trennungsrisiko über 6mal so hoch (Odds-Ratio = 6,3 p<0,01).
• Keinen Einfluss haben dagegen: Die Art der Erkrankung, die mit dem sogenannten Karnofsky-Index gemessene Beeinträchtigung durch die Krankheit (Einschränkungen der Aktivität, Selbstversorgung und Selbstbestimmung), das Bildungsniveau der Patienten oder der Wohnort (städtisch oder ländlich).
Bei allen Patientinnen und Patienten, die von ihrem Partner bzw. ihrer Partnerin verlassen wurde zeigte sich dann, dass die Versorgungsqualität, aber auch die subjektiv erlebte Lebensqualität sich erheblich verschlechterte im Vergleich zu anderen, deren Ehe nach der Diagnose weiterhin Bestand hatte. So nahmen 96% der getrennten Patienten/innen Antidepressiva ein (nicht getrennte: 11%), ebenfalls 96% wurden zweimal oder öfter in eine Klinik eingewiesen (nicht getrennte: 4%).
Die Wissenschaftler hatten die jeweiligen Gründe und psychologischen Motive der Trennungen nicht empirisch erhoben, vermuten jedoch in der Diskussion ihrer Befunde, dass Frauen sehr viel eher bereit sind (und dazu sozialisiert wurden), die Rolle der häuslichen Krankenpflegerin zu übernehmen, während Männer sich angesichts dieser Aufgabe zumeist überfordert fühlen und die Flucht antreten.
Hier ist ein Abstract der Studie: Michael J. Glantz et al: Gender disparity in the rate of partner abandonment in patients with serious medical illness (Cancer, Volume 115, Issue 22, Pages 5237-5242)
Gerd Marstedt, 17.11.09
Eine Scheidung hinterlässt gesundheitliche Spuren - lebenslänglich!
 Seit langem sind die gesundheitlich erwünschten aber auch unerwünschten Wirkungen so genannter lebensverändernder Ereignisse oder "life events" bekannt, wie die der Geburt eines Kindes, des Tod bekannter Personen, der Heirat aber auch Scheidung.
Seit langem sind die gesundheitlich erwünschten aber auch unerwünschten Wirkungen so genannter lebensverändernder Ereignisse oder "life events" bekannt, wie die der Geburt eines Kindes, des Tod bekannter Personen, der Heirat aber auch Scheidung.
Gerade bei Scheidungen, inbesondere wenn das Scheidungspaar noch Kinder hat, kumuliert eine Reihe finanzieller, psychischer und sozialer Faktoren, die z.B. das Selbstwertgefühl der Beteiligten tangieren oder Ängste vor dem Alleinsein und -bleiben auslösen.
Nach dem Sprichwort "die Zeit heilt Wunden" war mit diesem Psychostress trotzdem die Hoffnung verbunden, dass insbesondere die psychischen Folgen und das zusätzliche Risiko von Folgeerkrankungen am Herz-Kreislaufsystem, im Stoffwechsel (Diabetes) und sogar von Krebs rasch wieder verschwinden.
Dies scheint aber für Geschiedene nicht zuzutreffen. So jedenfalls die Ergebnisse einer jetzt veröffentlichten Studie über den weiteren Gesundheitsverlauf von 8.652 Personen zwischen 51 und 61 Jahren, die seit 1992 in der US-repräsentativen Längsschnittsstudie "Health and Retirement Study (HRS)" mit Personen über 50 Jahre sind und deren Familienstandsveränderungen und Erkrankungsgeschichte seitdem dokumentiert sind.
Danach tragen
• Geschiedene und auch Verwitwete ein um 18% höheres Risiko für chronische Erkrankungen wie Verheiratete. Außerdem hatten sie mit einer um 21% erhöhten Wahrscheinlichkeit Probleme beim Laufen oder Treppensteigen, kurz bei ihrer Mobilität.
• Eine neue Ehe beseitigt zwar einige dieser Folgen, verhindert sie aber nicht vollständig. Das Risiko chronisch krank zu werden ist bei Wiederverheirateten immer noch um 12% höher als bei immer Verheirateten und die Wahrscheinlichkeit für Mobilitätsverlust ist um 19% höher.
• Der Schluss, dann lieber gar nicht zu heiraten und das Scheidungsrisiko samt Folgen zu umgehen, ist aber nach derselben Studie auch kein Königsweg. Nachgewiesen wurden zwar im Vergleich zu Verheirateten keine Unterschiede mehr bei der Wahrscheinlichkeit chronischer Erkrankungen, aber bei den Chancen Mobilitätsprobleme und Depressionen zu bekommen schnitten Dauer-JunggesellInnen um 18% und 14% schlechter ab als Verheiratete.
• Personen mit mehrfachen Unterbrechungen oder Veränderungen ihres Familienstandes hatten höhere Chancen chronisch krank oder immobil zu werden als nur einmal Geschiedene.
• Personen mit längerer Ausbildungszeit hatten durchweg bessere Gesundheitswahrscheinlichkeiten. Schwarze hatten höhere Wahrscheinlichkeiten für alle negativen Zustände als weiße oder hispanische US-BürgerInnen.
Die Ergebnisse sind mit verschiedenen multivariaten Regressionsmodellen gewonnen worden und statistisch durchweg hochsignifikant.
Der Aufsatz "Marital Biography and Health at Mid-Life" von Mary Elizabeth Hughes und Linda Waite erscheint in der Septemberausgabe der Fachzeitschrift "Journal of Health and Social Behavior" (2009, Vol 50 (September):344-358) und ist im Moment in einer Feature-Version komplett und kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 2.8.09
"Vor dem Schlaganfall sind alle gleich" ? Viele ältere Frauen unterschätzen ihr Schlaganfall-Risiko
 Entgegen landläufigen Erwartungen über das eher gesundheitsbewusste Alltagsverhalten von Frauen sind diese oft unfähig, individuelle gesundheitliche Verhaltensmerkmale auch als Risikofaktoren für einen Schlaganfall zu identifizieren. Frauen unterschätzen ihr eigenes Schlaganfallrisiko und versuchen auch weniger als man vermuten könnte, ihr Verhalten primärpräventiv zu verändern. Da Frauen Risikofaktoren für einen Schlaganfall aufweisen, die sich von denen bei Männern unterscheiden, und auch, weil sie ein höheres Sterblichkeitsrisiko nach einem Schlaganfall haben als Männer, müssen gesundheitserzieherische Strategien sehr frauenspezifisch angelegt sein.
Entgegen landläufigen Erwartungen über das eher gesundheitsbewusste Alltagsverhalten von Frauen sind diese oft unfähig, individuelle gesundheitliche Verhaltensmerkmale auch als Risikofaktoren für einen Schlaganfall zu identifizieren. Frauen unterschätzen ihr eigenes Schlaganfallrisiko und versuchen auch weniger als man vermuten könnte, ihr Verhalten primärpräventiv zu verändern. Da Frauen Risikofaktoren für einen Schlaganfall aufweisen, die sich von denen bei Männern unterscheiden, und auch, weil sie ein höheres Sterblichkeitsrisiko nach einem Schlaganfall haben als Männer, müssen gesundheitserzieherische Strategien sehr frauenspezifisch angelegt sein.
Dies sind die wesentlichen Ergebnisse einer Studie, die an der Universität von Conneticut in den USA mit 805 Frauen im Alter von 50 bis 70 Jahren und mindestens einem bekannten Schlaganfallrisikofaktor durchgeführt wurde. Die untersuchte Frauenkohorte hatte einen hohen Anteil weißer (92%), sozial gut gestellter (33% verdienten mehr als 75.000 $) und hoch qualifizierter (29% hatten einen höheren Schulabschluss) Frauen.
Die Teilnehmerinnen erhielten in der Studie einen fünfteiligen Fragebogen, in dem ihr Wissen über den Schlaganfall, ihre Risikowahrnehmung, die ihnen bekannten Risikofaktoren, ihr Zugang zu Versorgungsangeboten und eine Reihe soziodemographischen Merkmale abgefragt wurden. Für die Gesamtbewertung des Risikobewusstseins und des Umgangs mit ihrem Schlaganfallrisiko waren insbesondere folgende Ergebnisse ausschlaggebend:
• Nur 5% der Frauen mit diagnostiziertem und erfahrenem Vorhofflimmern identifizierten dies als Risikofaktor für einen Schlaganfall. Nur 64% dieser Frauen berichteten über eine Behandlung mit dem dazu in den USA als sinnvoll empfohlenen Wirkstoff Warfarin, der die Blutgerinnung oder Blutverklumpung verhindern hilft. Andere bekannte Risikofaktoren wurden zwar behandelt, aber bei weitem nicht bei allen davon betroffenen Frauen: Rund 87% der Frauen mit Bluthochdruck gaben an, ihn gut zu kontrollieren, 7% der Frauen rauchten noch und 62% der Frauen mit Diabetes hatten einen niedrigen Blutzuckerwert (HbA1c < 6,5%). Fast zwei Drittel der Frauen nahmen täglich Aspirin ein.
• Lediglich 15% der Frauen, die an einer Herzerkrankung litten, dachten dabei an ein Risiko für den Eintritt eines Schlaganfalls.
• Auf einer Zehnerskala ordneten die Frauen ihr wahrgenommenes Schlaganfallrisiko durchschnittlich nur bei 5,7 ein. Damit ist die Wahrnehmung des persönlichen Risikos der Frauen mit erhöhtem Risiko nicht höher als die anderer risikoärmerer Frauen.
• Die befragten Frauen identifizierten aus einer Liste von 6 möglichen Warnzeichen für einen Schlaganfall durchschnittlich 2,7 Faktoren.
• Obwohl 71% der Frauen Schwäche und Benommenheit als Warnsignal angaben, betrachteten nur 34% der Befragten konkret Sichtveränderungen, 32% Kopfschmerzen oder 26% Sinnesverwirrungen als konkrete Warnzeichen. Rund 69% nannten verwirrtes Sprechen als ein Warnsignal.
• Von 11 beeinflussbaren Risikofaktoren gaben die befragten Frauen im Schnitt 3,9 als bekannt an.
• Als Einflussfaktoren der Risikowahrnehmung erwiesen sich in einer multivariaten Analyse vor allem die Sorge, einen Schlaganfall zu erleiden, der eigene hohe Blutdruck und Diabetes und etwas schwächer noch das Erkrankungs-Risiko anderer Frauen. Zu den Faktoren, die in dem multivariaten Modell keine signifikante Rolle spielten, gehören u.a. das Rauchen (mindestens 100 Zigaretten im Lebensverlauf), der Krankenversicherungsschutz und einige körperliche Symptome - darunter auch eine gefährliche Verengung der Halsschlagader (Carotis-Stenose).
• Überraschenderweise besteht bei der Risikowahrnehmung der hier untersuchten Frauen keine Beziehung zum Kontakt mit einem Arzt. Die Wissenschaftlerinnen nehmen an, dass insbesondere Fachärzte, bei denen die Frauen wegen ihrer anderen Erkrankungen in Behandlung sind, das Schlaganfallrisiko nicht ansprechen.
• Fasst man einige Ergebnisse zusammen, ist das Wissen über Schlaganfall bei den Frauen mit dem höchsten Risiko am niedrigsten und die verpassten Gelegenheit für Primärprävention ebenfalls.
• Auch wenn die Wissenschaftlerinnen auf eine Reihe von Grenzen der Verallgemeinerbarkeit ihrer Studie hinweisen (u.a. überdurchschnittlich viele weiße Frauen aus Vorstädten und ein relativ geringer Rücklauf an beantworteten Fragebögen) ist ihr Hinweis auf die Notwendigkeit von gezielten Aufklärungskampagnen über Art und Niveau des Schlaganfallrisikos und entsprechende präventive Maßnahmen für Frauen sehr wichtig. Dazu gehören auch Informationen für Familienmitglieder, die praktische Hinweise auf den Umgang mit akuten, aber verkannten Anzeichen eines Schlaganfalls beinhalten.
Quelle: Von dem siebenseitigen Aufsatz "Perception of risk and knowledge of risk factors in women at high risk for stroke" von JL Dearborn JL und LD McCullough aus der Fachzeitschrift "Stroke" (Stroke 2009;40;1181-1186) ist
- ein Abstract und der
- komplette Text kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 10.7.09
Jüngerer Partner = Jungbrunnen oder Sterberisiko? Es kommt aufs Geschlecht an!
 Die talkshowtaugliche Floskel "die Menschen leben immer länger" verbirgt, so die sozialepidemiologische Forschung, eine Menge Ungleichheiten. Darunter fallen die Unterschiede zwischen städtischer und ländlicher, armer und reicher, gebildeter und ungebildeter sowie auch der Unterschied zwischen verheirateten oder mit Partner lebenden und alleinstehenden Personen.
Die talkshowtaugliche Floskel "die Menschen leben immer länger" verbirgt, so die sozialepidemiologische Forschung, eine Menge Ungleichheiten. Darunter fallen die Unterschiede zwischen städtischer und ländlicher, armer und reicher, gebildeter und ungebildeter sowie auch der Unterschied zwischen verheirateten oder mit Partner lebenden und alleinstehenden Personen.
Etwas, was trotz des Hinweises auf die Bedeutung von Partnerschaft im Allgemeinen in dieser differenzierenden Reihe bisher nicht vorkam, ist der Altersabstand zwischen Partnern.
Eine aktuelle Studie aus dem renommierten Rostocker "Max-Planck-Instituts für demografische Forschung" mit umfänglichen Personenstandsdaten aller Einwohner Dänemarks zwischen 1990 und 2005 schließt diese Wissenslücke und fördert Interessantes zutage.
Die Forschungsfrage, ob der Altersabstand zum Ehepartner die Lebenserwartung von Frauen und Männern beeinflusst und dies sogar unterschiedlich, wurde durch vielfache Vergleiche der relativen Sterberisiken von Paaren in verschiedenen Altersgruppen mit einer Referenzaltersgruppe des gleichen Geschlechts ermittelt, die mit einem praktisch gleichaltrigen Partner zusammen leben.
Die Ergebnisse sehen so aus:
• Männer, die mit einer jüngeren Partnerin zusammen leben, profitieren davon. Je größer der Altersabstand zur Partnerin ist, desto höher ist ihre Lebenserwartung. Wenn Männer 7 bis 9 Jahre älter sind, haben sie ein 11% geringeres Sterberisiko als Männer gleichen Alters mit einer gleichaltrigen Partnerin. In der Gruppe mit dem maximalen Abstand von 15 bis 17 Jahren ist das Sterberisiko vergleichsweise um 19% niedriger. Ob der "Gewinn" noch größer wird, wenn der Altersabstand noch größer ist, ist mangels entsprechender Untersuchungen nicht bekannt.
• Wenn Männer eine ältere Partnerin haben, steigt dagegen ihr Sterberisiko und zwar bei einem Altersabstand von 7 bis 17 Jahren um rund 22%.
• Bei Frauen wirken sich dagegen Altersabstände systematisch anders aus: Sie haben das geringste Sterberisiko, wenn sie und ihr Partner gleichaltrig sind. Ist ihr Partner jünger steigt ihr Sterberisiko und zwar um rund 20%, wenn ihr Partner 7 bis 9 Jahre jünger ist - wiederum im Vergleich mit einer Partnerschaft in der Frau wie Mann in etwa gleich alt sind.
• In Partnerschaften eines jüngeren Manns mit einer älteren Frau haben zumindest in Dänemark beide Partner ein erhöhtes Sterberisiko.
Unklar bleibt in der Studie, wie die beobachteten und teilweise gegenläufigen Effekte und vor allem die für die Lebenserwartung von Frauen viel gravierenderen Auswirkungen einer Partnerschaft mit einem jüngeren Mann zu erklären sind. Mit Sicherheit spielen dabei eine Menge sozialer, psychologischer und geschlechtsspezifischer Faktoren, Normalitätsnormen und Vorurteile eine Rolle. Zu denken ist dabei z.B. daran, dass die vermutete Beziehung des gestandenen SPD-Vorsitzenden Müntefering zu einer 40 Jahre jüngeren Frau unter dem Etikett "toller Hecht" durchaus die Lebensfreude Münteferings fördern kann, während schon die Beziehungen der prominenten 50-jährigen Entertainerin Madonna mit wesentlich jüngeren Männern naserümpfend als "peinlich" bewertet werden. Frauen mit geringerem Selbstwertgefühl als Madonna könnten darunter leiden - was sich möglicherweise auf ihre Lebenserwartung auswirkte. Wenn es sich nicht um prominente Partner handelt, hält es die Studie aus Rostock für möglich, dass Partnerschaften zwischen einem jüngeren Ehemann und einer älteren Ehefrau so stark "unter Druck" geraten, dass dadurch ein negativer Einfluss auf die Lebenserwartung beider entsteht.
Eine Zusammenfassung unter der Überschrift "Ein jüngerer Partner - ein längeres Leben?" der demnächst in der Zeitschrift "Demography" erscheinenden Studie "How does the age gap between partners affect their survival?" von Sven Drefahl ist kostenlos in der neuesten Ausgabe (Jahrgang 6, Nr. 1/2009) des vierteljährlich erscheinenden und uneingeschränkt empfehlenswerten und bestellbaren Newsletter "Demografische Forschung Aus erster Hand" des Max-Planck-Instututs für demografische Forschung, des Rostocker Zentrums zur Erforschung des demografischen Wandels und des Vienna Institute of demography erhältlich.
Bernard Braun, 28.5.09
Leitliniengerechte Behandlung von Herzinsuffizienz: Ärzte benachteiligen Frauen, Ärztinnen aber Männer nicht!
 Wer Genderaspekte oder geschlechtsspezifische Ungleichheiten bei der Diagnose und Behandlung von Krankheiten für unmöglich oder eine etwas überzogene Wichtigtuerei von Frauenbeauftragten gehalten hat, wird in einer gerade veröffentlichten Studie über die Behandlung von Männern und Frauen, die an Herzinsuffizienz litten, durch Ärzte und Ärztinnen eines Besseren belehrt. Dabei stand die Frage im Mittelpunkt, ob die Behandlung den Leitlinien der "European Society of Cardiology" entsprach. Nach diesen Leitlinien sollte bei manifester Herzinsuffizienz mit ACE-Hemmern, Angiotensinrezeptorblockern (ARB) oder Betablocker behandelt werden.
Wer Genderaspekte oder geschlechtsspezifische Ungleichheiten bei der Diagnose und Behandlung von Krankheiten für unmöglich oder eine etwas überzogene Wichtigtuerei von Frauenbeauftragten gehalten hat, wird in einer gerade veröffentlichten Studie über die Behandlung von Männern und Frauen, die an Herzinsuffizienz litten, durch Ärzte und Ärztinnen eines Besseren belehrt. Dabei stand die Frage im Mittelpunkt, ob die Behandlung den Leitlinien der "European Society of Cardiology" entsprach. Nach diesen Leitlinien sollte bei manifester Herzinsuffizienz mit ACE-Hemmern, Angiotensinrezeptorblockern (ARB) oder Betablocker behandelt werden.
Bei der Untersuchung der Behandlung von 1.857 Patienten mit chronischer Herzinsuffizienz im Jahr 2006 durch 829 Ärzte von denen 65 % Allgemeinärzte, 27 % Internisten und 7 % Kardiologen waren, durch eine Forschergruppe an der Universität Homburg/Saar, gab es folgende relevante Ergebnisse:
• Erstens wurde auch in Behandlungseinrichtungen in städtischen Ballungszentren Ostdeutschlands eine bereits mehrmals erkannte Benachteiligung von Frauen bei der Diagnostik und Therapie von kardiologischen Erkrankungen nachgewiesen. Die Frauen in der untersuchten Gruppe erhielten bei vergleichbarer Krankheitssituation weniger der empfohlenen Medikamente und die Mittel, die sie verordnet bekamen, waren dann niedriger dosiert als bei Männern.
• Neu war, dass dies umso ausgeprägter ist, wenn der verordnende Arzt ein Mann war. ACE-Hemmer oder Angiotensinrezeptorblocker wurden signifikant seltener verordnet, wenn eine weibliche Patientin von einem männlichen Arzt behandelt wurde. Völlig anders und erheblich leitlinienkonformer fielen die Verordnungen aus, wenn ein männlicher Patient von einer Ärztin behandelt wurde. Dann waren auch die verordneten Dosen am höchsten.
• In einer multivariaten Analyse der die medikamentöse Behandlung von Herzinsuffizienz-PatientInnen beeinflussenden Krankheitsfaktoren und soziodemografischen Charakteristika waren das Geschlecht der Patienten und das der Ärzte die stärksten und jeweils statistisch höchst signifikanten Risikofaktoren.
• Zum widerholten Male erwiesen sich Ärztinnen in dieser Studie nicht nur als kommunikativer (vgl. dazu bereits die Untersuchung "Phycisian gender effects in medical communication" von Roter et al in JAMA 2002: 288: 756-764) aus dem Jahr 2002, die komplett kostenlos erhältlich ist) oder mehr an psychosozialen Problemen ihrer PatientInnen interessiert, sondern es konnte das erste Mal nachgewiesen werden, auch eine medikamentöse Behandlung "is more complete when female phycisians are taking care of patients." Weder bei der Verordnung noch der Dosierung behandelten Ärztinnen ihre Patienten bei ACE-Hemmern und ARBs nach Geschlecht unterschiedlich - ganz im Gegensatz zu ihren Kollegen.
Trotz einiger selbst eingeräumter methodischer Schwächen (z.B. Selektion "guter" Ärzte und Patienten, Beobachtungsstudie) sollte in weiteren Studien nach Erklärungen für diesen Zusammenhang von Geschlecht beider Akteursgruppen und Behandlungsqualität gesucht werden. Der Hinweis, Ärztinnen würden häufiger in Teilzeit arbeiten und dadurch produktiver arbeiten und eine höhere Zufriedenheit ihrer Patienten auslösen, weisen möglicherweise in die richtige Richtung, sind aber noch bei weitem zu eindimensional.
Der Aufsatz "Influence of gender of physicians and patients on guideline-recommended treatment of chronic heart failure in a cross-sectional study" von Magnus Baumhäkel, Ulrike Müller und Michael Böhm wurde am 21. Januar 2009 im Onlineteil des "European Journal of Heart Failure" veröffentlicht. Den interessierten LeserInnen steht ein Abstract oder der komplett fünfseitige Aufsatz in einer PDF-Version kostenlos zur Verfügung.
Bernard Braun, 31.1.09
"Kein Problem mit null Bock im Bett" oder gute Argumente gegen eine geschlechterübergreifende Viagraisierung des Sexuallebens.
 Die zitierte griffige Schlagzeile der "Ärztezeitung" vom 3.12.2008 bereitet auf die Ergebnisse einer großen us-amerikanischen Studie unter 31.581 Frauen im Alter über 18 Jahren aus 50.002 Haushalten vor, die für die Gesamtheit der US-Frauen repräsentativ ist. In der Untersuchung kamen Standardinstrumente zum Einsatz: Der "Changes in Sexual Functioning Questionnaire" mit 14 Abfragepunkten und die "Female Sexual Distress Scale" mit über zwölf Punkte wenn es um die Messung von Schuld, Frust oder Ärger ging.
Die zitierte griffige Schlagzeile der "Ärztezeitung" vom 3.12.2008 bereitet auf die Ergebnisse einer großen us-amerikanischen Studie unter 31.581 Frauen im Alter über 18 Jahren aus 50.002 Haushalten vor, die für die Gesamtheit der US-Frauen repräsentativ ist. In der Untersuchung kamen Standardinstrumente zum Einsatz: Der "Changes in Sexual Functioning Questionnaire" mit 14 Abfragepunkten und die "Female Sexual Distress Scale" mit über zwölf Punkte wenn es um die Messung von Schuld, Frust oder Ärger ging.
Angesichts der Tatsache, dass die Hersteller von Viagra oder Cialis nach ihrem Siegeszug bei den Männern nun auch den Frauen mit Lustproblemen Hilfe anzubieten beabsichtigen, enthalten die Ergebnisse auch eine Menge Zündstoff gegen das in die intimsten zwischenmenschlichen Bereiche vordringende Leistungsdenken und die dabei hilfreiche Medikalisierung menschlicher Schwächen.
Als erstes zeigte sich, dass altersadjustiert rund 44 % der dazu befragten Frauen über Libidoprobleme von sexueller Unlust bis zu Erregungs- und Orgasmusproblemen berichteten. Erwartungsgemäß nahmen diese Erscheinungen mit steigendem Alter zu. 27 % der Frauen im Alter von 18 bis 44 Jahren, 45 % der 45- bis 64-Jährigen und 80 % der älteren Frauen nannten derartige sexuelle Probleme.
Ob es sich aber wirklich um ein Problem handelte, war eines der zentralen Erkenntnisziele der Studie. Um dem näherzukommen wurden die Frauen, die eines der sexuellen Probleme für sich angaben, gebeten, auf einem anderen Fragebogen zu sagen, ob ihnen dies Kummer bereitet.
Dies taten deutlich weniger als die 44 %, nämlich noch 12 % der Frauen, mit ebenfalls beträchtlichen Altersgruppen-Unterschieden. Am meisten, nämlich 15 %, litten mittelaltrige Frauen unter ihren sexuellen Problemen, am zweitintensivsten jüngere zu 11 % und am wenigsten ältere Frauen mit 9 %.
Die AutorInnen der Studie heben hervor, dass diese Erscheinungen relativ neu zu beobachten sind, aber auch in Europa identifiziert werden konnten.
Nicht alle Frauen mit Sexualproblemen machen sich daraus aber kein oder lediglich ein kleines Problem: Bei verheirateten Frauen traten die Probleme und harter Leidensdruck doppelt so häufig auf wie bei Singles. Ebenfalls schwer haben es Frauen ohne Partner und Frauen mit Depressionen. Frauen, die an Schilddrüsenstörungen erkrankt sind, die Angst hatten, ein niedriges Bildungsniveau hatten, an Harninkontinenz litten und generell ihren Gesundheitszustand als schlecht bezeichneten, hatten ebenfalls einen höheren Leidensdruck. Andere Erkrankungen, wie etwa Bluthochdruck oder Diabetes hatten dagegen keinen Einfluss auf den Leidensdruck bei sexuellen Problemen.
Bevor also von der Existenz eines flächendeckenden Leidensdrucks wegen Libidoschwächen ausgegangen wird und nach den chemischen Helfern gerufen wird, lohnt sich die Frage nach dem tatsächlichen Leidensniveau, das Suchen nach niedrigschwelligeren Lösungsmitteln und die Konzentration auf Personen, die massiv unter den genannten Sexualproblemen leiden.
Ein Abstract des Aufsatzes "Sexual Problems and Distress in United States Women Prevalence and Correlates" von Jan L. Shifren, Brigitta U. Monz, Patricia A. Russo, Anthony Segreti, und Catherine B. Johannes aus der Zeitschrift "Obstetrics & Gynecology" (2008;112: 970-978) gibt es kostenlos.
Bernard Braun, 4.12.08
Frauen leiden stärker unter einer Krebsdiagnose - selbst wenn nicht sie selbst, sondern der Partner an Krebs erkrankt ist
 Wenn bei einem Paar einer der beiden Partner an Krebs erkrankt und die Diagnose erfährt, dann leiden Frauen häufiger und auch stärker darunter - ganz gleich, ob sie selbst von der Krebserkrankung betroffen sind oder ob sie selbst gesund sind, aber ihr Partner erkrankt ist. Dies ist das Ergebnis einer Meta-Analyse von über 40 Studien, die sich mit der Bewältigung von Krebserkrankungen beschäftigt haben. Die Forschungsgruppe aus den USA und den Niederlanden hat ihre Befunde jetzt in der Zeitschrift "Psychological Bulletin" veröffentlicht und dabei hervorgehoben, dass das Geschlecht eine größere Rolle für die emotionale Verarbeitung der Krebserkrankung spielt als die Tatsache, ob jemand selbst betroffen ist oder Partner/in eines Krebskranken.
Wenn bei einem Paar einer der beiden Partner an Krebs erkrankt und die Diagnose erfährt, dann leiden Frauen häufiger und auch stärker darunter - ganz gleich, ob sie selbst von der Krebserkrankung betroffen sind oder ob sie selbst gesund sind, aber ihr Partner erkrankt ist. Dies ist das Ergebnis einer Meta-Analyse von über 40 Studien, die sich mit der Bewältigung von Krebserkrankungen beschäftigt haben. Die Forschungsgruppe aus den USA und den Niederlanden hat ihre Befunde jetzt in der Zeitschrift "Psychological Bulletin" veröffentlicht und dabei hervorgehoben, dass das Geschlecht eine größere Rolle für die emotionale Verarbeitung der Krebserkrankung spielt als die Tatsache, ob jemand selbst betroffen ist oder Partner/in eines Krebskranken.
Seit über zwanzig Jahren, so heben die Wissenschaftler der University of Pennsylvania (USA) und des University Medical Center Groningen (Niederlande) hervor, gibt es überaus widersprüchliche Forschungsbefunde zu der Frage, wer von einer Krebsdiagnose emotional stärker betroffen ist: Der erkrankte Patient oder der gesunde Partner. In einer Bilanzierung von insgesamt 43 schon veröffentlichten internationalen Studien kommen sie nun zu dem Ergebnis: "Das Geschlecht ist der entscheidende Faktor und weniger die Betroffenheit von der Erkrankung selbst. Frühere Studien haben hier nicht unterschieden nach Männern und Frauen und daher waren die Ergebnisse vieler Studien widersprüchlich." In den Studien, die hauptsächlich in den USA und in Europa durchgeführt worden waren, standen sehr unterschiedliche Krebsarten im Vordergrund.
"In praktischer Hinsicht", so erklärte Mariët Hagedoorn, Professor für Gesundheitspsychologie am University Medical Center Groningen, "bedeutet dies: Brustkrebs-Patientinnen leiden im Durchschnitt sehr viel stärker unter der Diagnose als ihre Ehemänner davon emotional betroffen sind. Gleichzeitig gilt aber auch: Ehefrauen, deren Männer die Diagnose Prostatakrebs erhalten, sind ebenfalls sehr viel stärker in Mitleidenschaft gezogen als die kranken Männer selbst."
Die Wissenschaftler weisen aber auch noch auf ein weiteres Ergebnis ihrer Analysen hin: Nur eine Minderheit von Krebspatienten leidet wirklich ganz extrem stark unter der Diagnose, bei den allermeisten halten sich Ängste und Verzweiflung in Grenzen und im Rahmen "des Erträglichen". Es sei ein Mythos, dass die Diagnose Krebs heute noch für nahezu jeden Patienten einen Schock mit sich bringt, der zu emotionaler Lähmung führt. Dies gelte nur für eine Minderheit von Patienten.
Eine schlüssige Erklärung, warum Frauen unter einer Krebsdiagnose stärker leiden als Männer, selbst wenn sie selbst gar nicht betroffen sind, sondern "nur" ihr Partner, finden die Wissenschaftler nicht. Sie diskutieren jedoch sehr unterschiedliche theoretische Erklärungsmöglichkeiten und formulieren auch weitergehende Forschungsbedarfe, die nicht nur für das Verständnis der Krankheitsbewältigung von Bedeutung sind, sondern auch für die Gender-Perspektive in der Medizinsoziologie und den Gesundheitswissenschaften.
• Hier ist ein Abstract der Studie aus der Zeitschrift "Psychological Bulletin", 2008 Jan Vol 134(1) 1-30
• Hier ist eine PDF-Datei mit der kompletten Studie: Hagedoorn, Mariët u.a.: Distress in couples coping with cancer: A meta-analysis and critical review of role and gender effects
Gerd Marstedt, 3.3.2008
Verlaufsstudie über 17 Jahre zeigt: Streitunterdrückung in einer Paarbeziehung verkürzt die Lebenserwartung
 Paare, in denen beide ihre Wut oder ihren Ärger über den Partner unterdrücken, wenn sie sich angegriffen oder gekränkt fühlen, haben eine kürzere Lebenserwartung als andere Paare, die sich in solchen Situationen streiten und ihre Konflikte offen austragen. Dies ist das Ergebnis einer Studie der Universität von Michigan, in der die die Wissenschaftler 192 Paare über einen Zeitraum von 17 Jahren wissenschaftlich begleiteten. Die Paare wurden dabei einer von vier Gruppen zugeordnet: Beide Partner drücken ihre Gefühle, auch negative und aggressive Emotionen gegenüber dem anderen, offen aus. In der zweiten Gruppe und dritten Gruppe waren Paare, bei denen ein Partner dies auslebt, während der andere Ärger und Enttäuschung in sich hineinfrisst. In der vierten Gruppe schließlich war das Unterdrücken und Verdrängen negativer Emotionen beiderseits gängige Verhaltensnorm.
Paare, in denen beide ihre Wut oder ihren Ärger über den Partner unterdrücken, wenn sie sich angegriffen oder gekränkt fühlen, haben eine kürzere Lebenserwartung als andere Paare, die sich in solchen Situationen streiten und ihre Konflikte offen austragen. Dies ist das Ergebnis einer Studie der Universität von Michigan, in der die die Wissenschaftler 192 Paare über einen Zeitraum von 17 Jahren wissenschaftlich begleiteten. Die Paare wurden dabei einer von vier Gruppen zugeordnet: Beide Partner drücken ihre Gefühle, auch negative und aggressive Emotionen gegenüber dem anderen, offen aus. In der zweiten Gruppe und dritten Gruppe waren Paare, bei denen ein Partner dies auslebt, während der andere Ärger und Enttäuschung in sich hineinfrisst. In der vierten Gruppe schließlich war das Unterdrücken und Verdrängen negativer Emotionen beiderseits gängige Verhaltensnorm.
Von den 192 untersuchten Paaren waren 26 Paare in der letzten Gruppe, in der beide Partner Gefühls-Verdränger waren. In dieser Gruppe gab es im 17jährigen Untersuchungszeitraum insgesamt 13 Todesfälle. Dabei stellte man innerhalb dieser Gruppe fest, dass bei etwa jedem vierten Paar (23%) beide Partner innerhalb der 17 Jahre verstarben. Bei den übrigen 166 Paaren stellte man insgesamt 41 Todesfälle fest. In diesen drei Gruppen fand man jedoch Todesfälle für beide Partner nur bei 6%.
In der Studie wurde eine große Zahl von anderen Einflussbedingungen im Rahmen multivariater Analysen statistisch kontrolliert, darunter das Alter, Rauchen, Körpergewicht, Blutdruck, bronchiale Probleme, Atmungsbeschwerden, Herz-Kreislauf-Risiken. Unter dem Strich stellte sich dann heraus, dass das Sterberisiko doppelt so hoch ausfiel, wenn ein Partner oder beide ihre Gefühle nicht offen auslebten, sondern verdrängten oder in sich hineinfraßen.
Die Studie berücksichtigte dabei in den Datenerhebungen und Analysen nur solche Fälle, in denen verbale Angriffe oder Kränkungen vom Partner als unfair oder unnötig erlebt wurden. Alle anderen Fälle, in denen ein Partner das Verhalten des anderen als heftige, aber berechtigte Gefühlsäußerung wahrnahm, wurden für die generelle Einstufung der "Streitlust" nicht berücksichtigt. Die Wissenschaftler räumen in der Diskussion ihrer Befunde ein, dass die Stichprobengröße ihrer Studie noch sehr klein ist, so dass die Ergebnisse nur als vorläufig betrachtet werden dürfen. Sie planen jetzt allerdings eine Fortsetzung der Studie über einen Zeitraum von 30 Jahren, so dass die Todesfälle sich voraussichtlich verdoppeln werden und damit die statistische Basis für ihre Ergebnisse zuverlässiger sein wird.
Die Studie wird in der Januar-2008-Ausgabe des "Journal of Family Communication" veröffentlicht werden: "Ernest Harburg u.a.: Marital Pair Anger Coping Types May Act as an Entity to Affect Mortality: Preliminary Findings from a Prospective Study (Tecumseh, Michigan, 1971-88)"
Eine Pressemitteilung der University of Michigan informiert über die wichtigsten Befunde: A good fight with your spouse may be good for your health, research suggests
Gerd Marstedt, 23.1.2008
Osteuropa nach dem Kommunismus: Die Lebenserwartung der Männer ist durch den Systemwechsel gesunken
 Der Zusammenbruch der sozialistischen Systeme in Osteuropa hat für die Bevölkerung in diesen Ländern drastische Veränderungen mit sich gebracht. Diese Verwerfungen in den Arbeits- und Lebensbedingungen wurden von vielen Betroffenen als existenzieller Stress erlebt und haben sogar zu einer kürzeren Lebenserwartung geführt. Dies betrifft insbesondere die Männer im ehemaligen Ostblock: Deren Lebenserwartung ist in den ersten Jahren nach dem Systemzusammenbruch um sechs Jahre gesunken, während sich bei Frauen nur geringfügige Veränderungen zeigten.
Der Zusammenbruch der sozialistischen Systeme in Osteuropa hat für die Bevölkerung in diesen Ländern drastische Veränderungen mit sich gebracht. Diese Verwerfungen in den Arbeits- und Lebensbedingungen wurden von vielen Betroffenen als existenzieller Stress erlebt und haben sogar zu einer kürzeren Lebenserwartung geführt. Dies betrifft insbesondere die Männer im ehemaligen Ostblock: Deren Lebenserwartung ist in den ersten Jahren nach dem Systemzusammenbruch um sechs Jahre gesunken, während sich bei Frauen nur geringfügige Veränderungen zeigten.
Insgesamt zeigt sich nach einer jetzt in der Zeitschrift "Evolutionary Psychology" veröffentlichten Studie, dass der Geschlechts-Unterschied in der Mortalität, also die unterschiedliche Sterblichkeitsrate bei Männern und Frauen sich massiv vergrößert hat. Männer erleben die Anforderungen der Marktwirtschaft und die damit gesetzten Zwänge in erheblich höherem Maße als persönlichen Stress, mit der Folge, dass ihre Lebenserwartung sich seit 1990 im Vergleich zu Frauen sehr viel stärker gesunken ist.
Die beiden Wissenschaftler der University of Michigan verglichen in ihrer Studie die Sterblichkeit von Männern und Frauen und bildeten daraus einen Mortalitäts-Quotienten "Mortalität Männer : Mortalität Frauen". Die Veränderungen dieses Quotienten in unterschiedlichen Phasen (vor, während und nach dem Systemwechsel, von 1985-1999) verfolgten sie für insgesamt 14 Länder des ehemaligen Ostblocks und etwa ein Dutzend westeuropäische Länder. Die Daten hierzu stammen von der World Health Organization WHO bzw. für die DDR aus der Human Mortality Database.
Der zentrale Befund der Studie wird von der Forschern so interpretiert, dass "ein stärkerer Wettbewerb um Ressourcen auch verbunden ist mit dem Zwang zur erfolgreichen Sicherung des Lebensunterhalts, und dies führt zu gesundheitsriskanteren Verhaltensweisen und Stress." Dies wird nach Angaben der Autoren, Daniel J. Kruger und Randolph M. Nesse, etwa daran deutlich, dass die Mortalität durch Gewalttaten und Tötungsdelikte angestiegen sind. "Der ökonomische und politische Systemwechsel war in gesundheitlicher Hinsicht für Männer sehr viel schädlicher als für Frauen, da es vorher kaum Wettbewerbszwänge gab: Hinsichtlich des Sozialstatus oder der materiellen Bedingungen gab es kaum Unterschiede." Nun aber, so Kruger, würden Männer sehr viel stärker als Frauen zu Verhaltensweisen angestachelt, die gesundheitsschädlich sind und Stress mit sich bringen.
Die Analyse hat nach Meinung der Forscher jedoch nicht nur Aussagekraft für den ehemaligen Ostblock. "Die Ergebnisse", so ihr Fazit, "zeigen uns, welche politischen und ökonomischen Rahmenbedingungen auch unsere Gesundheit beeinflussen. Weitere dramatische Steigerung der Einkommens-Ungleichheit könnten zu ähnlichen Effekten auch in westlichen Ländern führen." Sie weisen in ihrem Aufsatz darauf hin, dass der sogenannte Gini-Koeffizient, eine Maßzahl für die ökonomische Ungleichheit eines Landes beispielsweise in Russland sich drastisch erhöht hat. Die Einkommenshöhe der unteren 10 Prozent der Bevölkerung im Vergleich zum Einkommen der oberen 10 Prozent ist dort im Zeitraum 1980-1994 von 3.16 auf 15.10 gestiegen.
• Hier ist eine Pressemitteilung der University of Michigan mit den wichtigsten Befunden: Freedom isn't always healthy for men
• Die Studie ist hier im Volltext nachzulesen (PDF): Economic Transition, Male Competition, and Sex Differences in Mortality Rates (Evolutionary Psychology, 2007. 5(2): 411-427)
Gerd Marstedt, 2.7.2007
Alleinerziehende Väter und Mütter haben einen schlechteren Gesundheitszustand als Paare
 Der Gesundheitszustand alleinerziehender Väter und Mütter ist deutlich schlechter als der von Ehepaaren oder zusammenlebenden Paaren mit Kindern. Darüber hinaus hat die soziale Einbindung von Eltern in Nachbarschaft und Gemeinschaftsleben, die Intensität und Dichte ihres sozialen "Netzwerks" einen nachhaltigen Einfluss auf ihre eigene Gesundheit, aber auch die der Kinder. Dies sind zwei Ergebnisse einer jetzt an der schwedischen Universität Uppsala veröffentlichten Doktorarbeit.
Der Gesundheitszustand alleinerziehender Väter und Mütter ist deutlich schlechter als der von Ehepaaren oder zusammenlebenden Paaren mit Kindern. Darüber hinaus hat die soziale Einbindung von Eltern in Nachbarschaft und Gemeinschaftsleben, die Intensität und Dichte ihres sozialen "Netzwerks" einen nachhaltigen Einfluss auf ihre eigene Gesundheit, aber auch die der Kinder. Dies sind zwei Ergebnisse einer jetzt an der schwedischen Universität Uppsala veröffentlichten Doktorarbeit.
Basis der Studie sind zwei in Schweden landesweit durchgeführte Repräsentativbefragungen aus den Jahren 2001 und 2003, an denen sich 2.600 bzw. 1.600 Männer und Frauen beteiligten, Ehepaare mit Kind oder mehreren Kindern, aber auch alleinerziehende Väter und Mütter, alle im Alter von 20-64 Jahren. Die in den Fragebögen erhobenen Themen waren außerordentlich vielseitig und umfassend. Sie betrafen neben sozialstatistischen Merkmalen unter anderem auch Fragen zur Selbsteinstufung des Gesundheitszustands, zur Inanspruchnahme der medizinischen Versorgung, zum sozialen Netzwerk und zur Teilnahme an Gemeinschafts-Aktivitäten.
Die zentralen Ergebnisse seiner Dissertation fasst Marcus Westin in mehreren Kapiteln zusammen. Drei Aspekte sind dabei besonders bedeutsam.
• Alleinerziehende Väter und Mütter berichten sehr viel häufiger über einen schlechten Gesundheitszustand als verheiratete oder unverheiratete, aber zusammenlebende Paare mit einem Kind oder mehreren Kindern. Bei den Alleinerziehenden ist der Anteil derjenigen mit angegriffener Gesundheit etwa 2-3mal so hoch wie bei den Paaren. Auffällig war in diesem Zusammenhang auch, dass alleinerziehende Mütter wesentlich seltener medizinische Hilfe in Anspruch nehmen, selbst dann, wenn sie Schmerzen oder Beschwerden haben und im Grunde die Notwendigkeit sehen, zum Arzt zu gehen. Dabei zeigte sich in der statistischen Analyse, dass zeitliche Belastungen, Stresserfahrungen, ein Gefühl von Müdigkeit und Erschöpfung zentrale Hintergrundbedingungen für den Verzicht auf eine Inanspruchnahme medizinischer Hilfe sind.
• Nicht nur die Gesundheit der alleinerziehenden Elternteile, sondern auch die psychische Gesundheit ihrer Kinder, eingestuft anhand elterlicher Aussagen, war bei Alleinerziehenden überraschender Weise schlechter.
• Das in den Sozial- und Politikwissenschaften so genannte "Sozialkapital" (das Netz sozialer Beziehungen und Kontakte und die damit verfügbaren Hilfen und Unterstützungsleistungen sowie die daraus gewonnene psychische Stärke) sind in erheblichem Maße ein Einflussfaktor für die Gesundheit der Väter und Mütter. Alleinerziehende zeigten hier in der Befragung ein geringeres Maß an sozialer Einbindung, also dem Besuch von kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen, der Mitgliedschaft in Vereinen, der Teilnahme an Parties oder Familienfesten usw. Dadurch verstärken sich jedoch Risikofaktoren (allein erziehen, Sozialkapital) für die Gesundheit wechselseitig, so dass insbesondere die Gruppe der alleinerziehenden Mütter von sehr viel höheren Belastungen und Stresserfahrungen betroffen ist, zugleich aber auch sehr viel weniger von sozialer Teilhabe profitieren kann, einer Bedingung, die vor den gesundheitlichen Folgen von Stress teilweise schützt.
Die Dissertation ist hier nachzulesen: Marcus Westin: Health and Healthcare Utilization Among Swedish Single Parent Families (ISBN 978-91-554-6907-8)
Gerd Marstedt, 13.6.2007
Finnische Studie zeigt: Chronisch erkrankte Männer sind öfter als Frauen verletzlich und depressiv
 Herbert Grönemeyer hat es schon 1984 in seinem Song "Männer" besungen, doch eine finnische Studie hat es jetzt auch wissenschaftlich belegt: "Männer sind so verletzlich" - verletzlicher jedenfalls als gleichaltrige Frauen. Berücksichtigt wurden in der Untersuchung zwar nur jüngere Männer und Frauen (Alter 32) und nur Personen, die an einer chronischen Erkrankung (vor allem Asthma, Allergie, Diabetes) litten. Es zeigte sich dann, dass die einbezogenen männlichen Chroniker in erheblichem Maße auch über depressive Symptome klagten, während dies bei den weiblichen Chronikern sehr viel seltener der Fall war. Trotz der stichprobenbedingten Einschränkungen interpretieren die Wissenschaftler ihre Forschungsergebnisse jedoch so, dass sie dahinter einen generellen Effekt vermuten, der Männer gegenüber externen Beeinträchtigungen schutzloser macht. Sie fanden nämlich auch heraus, dass psychosoziale Schutzmechanismen bei Frauen mit einer chronischen Erkrankung sehr stark wirksam sind, also die psychischen Folgen einer chronischen Erkrankung deutlich mildern, während dieser Effekt sich bei Männern nicht aufzeigen ließ.
Herbert Grönemeyer hat es schon 1984 in seinem Song "Männer" besungen, doch eine finnische Studie hat es jetzt auch wissenschaftlich belegt: "Männer sind so verletzlich" - verletzlicher jedenfalls als gleichaltrige Frauen. Berücksichtigt wurden in der Untersuchung zwar nur jüngere Männer und Frauen (Alter 32) und nur Personen, die an einer chronischen Erkrankung (vor allem Asthma, Allergie, Diabetes) litten. Es zeigte sich dann, dass die einbezogenen männlichen Chroniker in erheblichem Maße auch über depressive Symptome klagten, während dies bei den weiblichen Chronikern sehr viel seltener der Fall war. Trotz der stichprobenbedingten Einschränkungen interpretieren die Wissenschaftler ihre Forschungsergebnisse jedoch so, dass sie dahinter einen generellen Effekt vermuten, der Männer gegenüber externen Beeinträchtigungen schutzloser macht. Sie fanden nämlich auch heraus, dass psychosoziale Schutzmechanismen bei Frauen mit einer chronischen Erkrankung sehr stark wirksam sind, also die psychischen Folgen einer chronischen Erkrankung deutlich mildern, während dieser Effekt sich bei Männern nicht aufzeigen ließ.
In die Untersuchung einbezogen waren Teilnehmer einer größeren finnischen Verlaufsstudie, insgesamt 257 chronisch erkrankte und 664 gesunde Männer und Frauen, alle im Alter von 32 Jahren. Es zeigte sich dann, dass etwa 20 Prozent der chronisch Erkrankten, aber nur 12 Prozent der Gesunden auch Anzeichen einer depressiven Erkrankung aufwiesen. Gemessen wurde dies mit klinischen Fragebögen zur Erfassung von Depressivität. Besonders überraschend waren dann aber die Geschlechtsunterschiede: Innerhalb der Gruppe chronisch Erkrankter wurden 25 Prozent der Männern, aber nur 10 Prozent der Frauen als depressiv eingestuft. Bei einer Kontrolle auch sozialstatistischer Merkmale blieb dieser Unterschied bestehen: Während chronisch erkrankte Männer etwa dreimal so oft wie nicht erkrankte Männer Depressions-Symptome zeigten (3,1:1), unterschieden sich chronisch erkrankte und nicht erkrankte Frauen hinsichtlich psychischer Auffälligkeiten gar nicht (1,1:1).
Die Wissenschaftler hatten neben dem Aspekt Depressivität auch noch einige andere Persönlichkeitsmerkmale in Fragebögen erfasst wie Kontrollerwartung (Locus of Control, das Ausmaß, in dem man glaubt, selbst Bedingungen beeinflussen zu können), unterschiedliche Bewältigungsstrategien im Umgang mit Krankheit (wie kognitive Deutungen, aktives Handeln) und soziale Unterstützung, also die Intensität und Reichweite des persönlichen Netzwerkes guter Freunde. Hier zeigte sich nun, dass insbesondere die persönliche Kontrollerwartung bei Frauen stärker ausgeprägt war, also die Überzeugung, die eigenen Lebensumstände und damit auch die Krankheit erheblich mit beeinflussen zu können. Bei Männern hingegen überwogen Überzeugungen, dass dies eher von äußeren Einflüssen (Schicksal, Erbanlagen usw.) abhängig ist. Die persönliche Kontrollerwartung war nach den Analyse-Ergebnissen jedoch jener Faktor, der am stärksten vor psychischen Beeinträchtigungen bei Vorliegen einer chronischen Erkrankung schützt.
Die Wissenschaftler der jetzt online und vorab in der Zeitschrift "Social Science & Medicine" veröffentlichten Studie formulieren als Fazit, "dass in präventiver Perspektive jüngere Männer mit einer chronischen Erkrankung als Risikogruppe für Depressivität zu betrachten sind, die möglicherweise davon profitieren könnten, wenn sie zu einem aktiveren Umgang mit ihrer Krankheit gelenkt werden könnten und wenn sie es lernen, ein stärkeres Ausmaß an persönlicher Kontrolle und Überzeugung davon zu gewinnen, dass sie ihre Krankheit beherrschen und nicht umgekehrt."
Ein kostenloses Abstract der Studie ist hier nachzulesen: Psychosocial resources and depression among chronically ill young adults: Are males more vulnerable? (Social Science & Medicine (2007), doi:10.1016/j.socscimed.2007.02.030)
Gerd Marstedt, 7.6.2007
Geplante Kaiserschnitt-Geburten: Höhere Risiken als bislang angenommen
 Der Anteil der Entbindungen durch Kaiserschnitt in deutschen Krankenhäusern hat sich in den letzten zehn Jahren deutlich erhöht und stieg von 17 auf 27 Prozent. Dass diese Art der Entbindung möglicherweise sehr viel höhere Gesundheitsrisiken aufweist als bislang angenommen, haben jetzt zwei große Studien aus den USA und Kanada gezeigt.
Der Anteil der Entbindungen durch Kaiserschnitt in deutschen Krankenhäusern hat sich in den letzten zehn Jahren deutlich erhöht und stieg von 17 auf 27 Prozent. Dass diese Art der Entbindung möglicherweise sehr viel höhere Gesundheitsrisiken aufweist als bislang angenommen, haben jetzt zwei große Studien aus den USA und Kanada gezeigt.
In einer Studie aus Massachusetts (USA) wurden 240.000 Mütter, die zuvor nicht per Kaiserschnitt entbunden hatten und die vor der Geburt auch keine gesundheitlichen Risikofaktoren aufwiesen, aus einer etwa doppelt so großen Stichprobe ausgewählt. Diese Mütter, die im Zeitraum 1998 bis 2003 ein Kind zur Welt gebracht hatten, wurden dann einer von mehreren Gruppen zugeteilt, je nachdem, ob sie erwerbstätig waren oder nicht und ob das Kind mit einem Kaiserschnitt oder mit einer normalen Vaginal-Geburt zur Welt gekommen war.
Überprüft wurden anhand der Daten dann mehrere gesundheitsbezogene Faktoren: Die Wiedereinweisung in eine Klinik im Zeitraum von 30 Tagen nach der Geburt, die medizinischen Kosten der Entbindung und die Dauer des Klinikaufenthalts. Im Ergebnis zeigte sich: Frauen, die per Kaiserschnitt entbunden hatten, wurden nach der Geburt zweieinhalb Mal so oft erneut in eine Klinik eingewiesen wie Frauen mit Normalgeburt (19.2 Fälle pro 1.000 Geburten im Vergleich zu 7.5 Fällen). Dieses höhere gesundheitliche Risiko zeigte sich auch dann, wenn man Faktoren wie Lebensalter, Rasse oder Hautfarbe mitberücksichtigte. Die häufigsten Gründe für den erneuten Klinikaufenthalt waren Komplikationen durch Wunden und Infektionen. Bei einem Vergleich der medizinischen Kosten zeigte sich, dass ein Kaiserschnitt um etwa 75% teuer ist als eine Normalgeburt (umgerechnet etwa 3.400 Euro im Vergleich zu 1.900 Euro). Bei einer Kaiserschnittgeburt waren die Frauen im Durchschnitt 4.3 Tage im Vergleich zu 2.4 Tagen in der Klinik.
Hier ist ein Abstract der Studie: Maternal Outcomes Associated With Planned Primary Cesarean Births Compared With Planned Vaginal Births (Obstetrics & Gynecology 2007;109:669-677)
Auch in einer zweiten, jetzt veröffentlichten Studie wurden für Kaiserschnittgeburten höhere Gesundheitsrisiken gefunden. Bei dieser Untersuchung aus Kanada wurden die Daten für einen repräsentativen Querschnitt aller kanadischen Frauen, die zwischen 1991 und 2005 ein Kind zur Welt gebracht hatten, näher analysiert. Einbezogen waren so knapp 47.000 Frauen mit Kaiserschnittgeburt und 2,3 Millionen Frauen mit Normalgeburt. Überprüft wurden dann für den gesamten 14jährigen Beobachtungszeitraum die Häufigkeiten unterschiedlichster Erkrankungen in den beiden Gruppen, wie z.B. Herzstillstand, Blutergüsse, Entfernung der Gebärmutter, Wochenbettfieber oder Thrombosen.
Einerseits zeigte sich, dass das absolute Risiko für solche Erkrankungen insgesamt sehr niedrig ist. So fand man beispielsweise nur in 1.6 von 1.000 Fällen einen Herzstillstand und auch für die übrigen Erkrankungen waren die Risiken ähnlich niedrig. Andererseits fanden die Wissenschaftler jedoch auch, dass die Häufigkeit solcher Erkrankungen nach einer Kaiserschnittgeburt etwa (je nach Art der Erkrankung) 2-5mal so hoch lagen wie nach einer Normalgeburt.
Ein Abstract der Studie ist hier nachzulesen: Maternal mortality and severe morbidity associated with low-risk planned cesarean delivery versus planned vaginal delivery at term (CMAJ. 2007 Feb 13;176(4):455-60)
Gerd Marstedt, 27.3.2007
Jede dritte Frau hat auch ein Jahr nach der Geburt noch Beschwerden beim Sex oder Inkontinenzprobleme
 Dass bei vielen Frauen nach einer Geburt noch eine Zeitlang Gesundheitsbeschwerden auftreten können, ist hinlänglich bekannt und durch viele Studien belegt. Dass aber die Mehrheit der Frauen auch noch nach einem Zeitraum von einem Jahr nach einer Geburt unter ernsthaften gesundheitlichen Problemen leidet, darunter Schmerzen beim Sex oder Inkontinenz, hat jetzt eine englische Studie gezeigt, die in der März-Ausgabe des "Journal of Clinical Nursing" veröffentlicht wurde.
Dass bei vielen Frauen nach einer Geburt noch eine Zeitlang Gesundheitsbeschwerden auftreten können, ist hinlänglich bekannt und durch viele Studien belegt. Dass aber die Mehrheit der Frauen auch noch nach einem Zeitraum von einem Jahr nach einer Geburt unter ernsthaften gesundheitlichen Problemen leidet, darunter Schmerzen beim Sex oder Inkontinenz, hat jetzt eine englische Studie gezeigt, die in der März-Ausgabe des "Journal of Clinical Nursing" veröffentlicht wurde.
Die Wissenschaftler hatten 2.100 Frauen, die in Kliniken in Birmingham ein Jahr zuvor ein Kind zur Welt gebracht hatten, einen Fragenbogen zugeschickt, in dem die jungen Mütter Auskunft geben sollten über ihren Gesundheitszustand und aktuelle Beschwerden wie z.B. Schmerzen im Bereich des Damms, Harndrang und Harninkontinenz, Dyspareunie (sexuelle Funktionsstörung) und Schmerzen beim Geschlechtsverkehr. Zusätzlich berücksichtigten sie auch Klinikdaten zum Alter der Frauen, der Art der Geburt und vorliegenden gesundheitlichen Risikofaktoren. Knapp 500 Frauen, etwa jede vierte, beantwortete den Fragebogen.
Das für die Wissenschaftler überraschendste Ergebnis war die Häufigkeit von Beschwerden auch noch nach einem Zeitraum von 12 Monaten: Knapp 90% der Frauen berichtete über zumindest eines der im Fragebogen angesprochenen Symptome. Das am häufigsten genannte Problem betraf die Sexualität (55%), wobei unterschiedliche Aspekte angesprochen wurden: Ausbleiben eines Orgasmus, sexuelle Lustlosigkeit oder körperliche Beschwerden beim Geschlechtsverkehr. Häufig genannt wurden aber auch Gesundheitsprobleme wie Inkontinenz in Stress-Situationen (54%) und Inkontinenz bei starkem Harndrang (37%). Über direkte Schmerzen beim Geschlechtsverkehr berichtete jede dritte Frau, wobei dies etwas seltener auftrat bei Frauen, die per Kaiserschnitt entbunden hatten.
Weitere Ergebnisse der Befragung waren:
• Beschwerden traten häufiger auf bei älteren Frauen und bei einem größeren Geburtsgewicht der Kinder.
• Auch Frauen asiatischer Herkunft, die in der Stichprobe etwa zu 15% vertreten waren, waren häufiger von Gesundheitsproblemen betroffen.
• Über sexuelle Beschwerden und auch Schmerzen beim Geschlechtsverkehr wurde häufiger berichtet, wenn eine Geburtszange eingesetzt worden war. Am seltensten trat dies auf nach einem Kaiserschnitt.
Dass eine Kaiserschnitt-Geburt deutlich seltener zu langfristigen gesundheitlichen Beschwerden führt, auch im Vergleich zur "normalen" Geburt und erst recht zu einer Geburt mit Einsatz von Instrumenten, wird von den Wissenschaftlern nicht als Empfehlung verstanden: "Zwar haben Frauen, die per Kaiserschnitt entbunden haben, weniger jene Art von Beschwerden, wie sie in unserer Studie erfasst wurden. Andererseits treten dort jedoch andere Probleme auf, die die Lebensqualität beeinträchtigen, etwa durch Adhäsionen [Verwachsungen oder Verklebungen von Organabschnitten oder Geweben] oder durch Wundinfektionen." Sie weisen zugleich darauf hin, dass die Ergebnisse der Studie für die medizinische Versorgung von Frauen nach der Geburt eine Reihe von Fragen aufwerfen, aber auch Anforderungen zur Verbesserung der aktuellen Versorgungsqualität mit sich bringen.
Möglicherweise ist die in der Studie zutage getretene Häufigkeit der Beschwerden deshalb erhöht, weil nur jede vierte Empfängerin eines Fragebogens diesen auch beantwortet hat. Aufgrund von Erfahrungen in der Umfrageforschung kann man vermuten, dass hier mehr Frauen sich beteiligt haben, die sich durch das Thema "Gesundheitsbeschwerden nach einer Geburt" auch angesprochen fühlten aufgrund persönlicher Betroffenheit. Gleichwohl sind die mitgeteilten Prozentquoten für die unterschiedlichen Gesundheitsprobleme so hoch, dass man die Ergebnisse ernst nehmen muss.
Ein Abstract der Studie ist hier nachzulesen: The prevalence of enduring postnatal perineal morbidity and its relationship to type of birth and birth risk factors (Journal of Clinical Nursing. 16,549-561, March 2007)
Gerd Marstedt, 19.3.2007
Women are sicker, but men die quicker - der "Gender Datenreport"
 Auf diesen etwas saloppen Nenner bringt der vom "Bundesministerium für Familie, Frauen, Senioren und Jugend" 2005 herausgegebene Gender Datenreport seine Informationen zu Gesundheitsstatus und Gesundheitsrisiken von Frauen und Männern.
Auf diesen etwas saloppen Nenner bringt der vom "Bundesministerium für Familie, Frauen, Senioren und Jugend" 2005 herausgegebene Gender Datenreport seine Informationen zu Gesundheitsstatus und Gesundheitsrisiken von Frauen und Männern.
Das 54 Seiten umfassende Gesundheitskapitel ist dabei nur eines von 10 Kapiteln. Die anderen Kapitel befassen sich mit Bildung, Erwerbstätigkeit, Erwerbseinkommen, Familien- und Lebensformen, Sozialer Sicherung, Behinderung, Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie Gewalthandlungen - immer aus der geschlechtervergleichenden Perspektive.
Im Gesundheitsteil arbeiten die beiden Autorinnen, Monika Stürzer, Waltraud Cornelißen, eine Reihe von Gesundheitstrends heraus, die sie auch empirisch belegen. Dazu zählen folgende, mehr oder weniger bekannten Sachverhalte, die in 5 Kapiteln (Lebenserwartung, Gesundheit und Krankheit, Verhaltensweisen, Arbeit und Gesundheit und Gesundheit der MigrantInnen) kompakt zusammengestellt worden sind:
• Frauen werden älter als Männer. Die Lebenserwartung von neugeborenen Mädchen beträgt in Deutschland heute 81 Jahre, die von neugeborenen Jungen 75 Jahre.
• Gesundheit und Krankheit hängen nicht nur von objektiven Faktoren, sondern auch von subjektiver Wahrnehmung und Bewertung ab.
• Frauen geben im Durchschnitt etwas häufiger als Männer an, in den vergangenen vier Wochen krank gewesen zu sein. Männer erleiden durchschnittlich häufiger folgenschwere Unfälle als Frauen. Für Männer ist die Jugend, für Frauen das Alter eine besonders unfallträchtige Lebensphase.
• Männer bewerten ihren Gesundheitszustand im Durchschnitt besser und sind mit ihrer Gesundheit zufriedener als Frauen. Am zufriedensten mit ihrer Gesundheit sind junge Männer mit (Fach-)Hochschulabschluss, die voll erwerbstätig sind, über ein hohes Einkommen verfügen und in den westlichen Bundesländern leben.
• Frauen stellen circa 55 Prozent der Krankenhauspatientinnen und -patienten, Männer verbringen aber durchschnittlich mehr Tage im Krankenhaus, wenn sie erkranken.
• 58 Prozent der deutschen Männer und 41 Prozent der deutschen Frauen ab dem Alter von 18 Jahren sind übergewichtig oder stark übergewichtig. Im Alter von 18 bis 19 Jahren sind 13 Prozent der jungen Frauen und 6 Prozent der jungen Männer untergewichtig.
• Männer rauchen mehr und sie konsumieren mehr Alkohol und illegale Drogen als Frauen; Frauen sind häufiger von Medikamenten abhängig.
• Männer erleiden mehr schwere und tödliche Arbeitsunfälle als Frauen. Sie begehen auch deutlich häufiger als Frauen Selbstmord.
• Zum Gesundheitszustand von Migrantinnen und Migranten gibt es nur wenige aufschlussreiche Daten. Sie gehören durchschnittlich jüngeren Altersgruppen an als die Deutschen. Ausländische Männer mittleren Alters rauchen häufiger als deutsche. Alkoholabstinenz ist unter ausländischen jungen Frauen und Männern deutlich verbreiteter als unter deutschen.
Sie finden den Zugang zur PDF-Version des Gesundheitskapitels und zu allen anderen Kapiteln hier.
Bernard Braun, 9.2.2007
Neue Datenbank der BzgA zur Frauengesundheit
 Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) hat jetzt eine Datenbank zum Thema "Frauengesundheit und Gesundheitsförderung" online gestellt. Die Datenbank wurde auf Initiative des Bundesministeriums für Gesundheit in Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Expertinnen und Experten entwickelt. Dazu erklärte Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt: "Mit dieser neuen Datenbank gibt es einen übersichtlichen und zuverlässigen Wegweiser durch die zahlreichen Angebote im Internet. Damit haben Frauen und alle weiteren Interessierten Zugang zu deutschsprachigen und internationalen Informationen rund um die Frauengesundheit und die Gesundheitsförderung, wie Frauen sie brauchen. Das ist ein weiterer wichtiger Schritt, um die spezifischen Aspekte von Frauen in der gesundheitlichen Versorgung und in der Förderung der Gesundheit von Frauen weiter voran zu bringen."
Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) hat jetzt eine Datenbank zum Thema "Frauengesundheit und Gesundheitsförderung" online gestellt. Die Datenbank wurde auf Initiative des Bundesministeriums für Gesundheit in Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Expertinnen und Experten entwickelt. Dazu erklärte Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt: "Mit dieser neuen Datenbank gibt es einen übersichtlichen und zuverlässigen Wegweiser durch die zahlreichen Angebote im Internet. Damit haben Frauen und alle weiteren Interessierten Zugang zu deutschsprachigen und internationalen Informationen rund um die Frauengesundheit und die Gesundheitsförderung, wie Frauen sie brauchen. Das ist ein weiterer wichtiger Schritt, um die spezifischen Aspekte von Frauen in der gesundheitlichen Versorgung und in der Förderung der Gesundheit von Frauen weiter voran zu bringen."
Unzählige Informationen im Internet zu Fragen der Gesundheit machen es den Nutzerinnen und Nutzern schwer, den Überblick zu behalten. Die Datenbank hilft verlässlich bei der Suche nach qualitätsgesicherten Angeboten und Antworten. Sie bietet Orientierung zu verschiedenen Frauengesundheitsthemen, wie z.B. Brustkrebs, Ernährung, Rauchen oder Wechseljahre und erschließt über ausgewählte Links weitere Informationsquellen. Damit bietet die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklarung (BZgA) die erste deutsche Datenbank im Bereich Frauengesundheit an, die auch internationale Daten berücksichtigt. Sie wird ständig aktualisiert und zukünftig um neue Themen erweitert werden.
Einige der zur Zeit schon angebotenen Themen sind etwa: Alkohol, Behinderung, Brustkrebs, Ernährung, Essstörungen, Frauengesundheitsforschung, Gewalt, HIV/Aids, Krankheitsspektrum, Lebenserwartung, Migration, Politische Strategien, Schwangerschaft und Geburt, Tabak / Rauchen, Wechseljahre.
BzgA-Datenbank Frauengesundheit und Gesundheitsförderung
Gerd Marstedt, 31.1.2006