



Home | Patienten | Gesundheitssystem | International | GKV | Prävention | Epidemiologie | Websites | Meilensteine | Impressum
Sämtliche Rubriken in
"International"
USA - Versorgungsqualität |
Alle Artikel aus:
International
USA - Versorgungsqualität
Schlaganfallpatient*innen in Covid-19-Zeiten: 39% Rückgang! Ursachen unklar, aber Covid-19-Kollateralschaden nicht auszuschließen.
 Seit einigen Wochen melden einzelne Krankenhäuser in Deutschland und Europa einen Rückgang von Notfall-Patient*innen mit - so die Einschätzung - leichten bis mittelschweren Schlaganfallsymptomen bzw. Erkrankungen und vermuten Zusammenhänge mit der aktuellen Covid-19-Pandemie. Schlaganfälle sind eine ernste und stationär zu behandelnde Erkrankung und eine verzögerte oder nicht erfolgende Behandlung kann zu langfristigen schweren Schäden und Schwerstbehinderung oder gar zum Tod führen. Umso wichtiger ist, den beobachteten Rückgang genauer zu quantifizieren und die Ursachen zu identifizieren.
Seit einigen Wochen melden einzelne Krankenhäuser in Deutschland und Europa einen Rückgang von Notfall-Patient*innen mit - so die Einschätzung - leichten bis mittelschweren Schlaganfallsymptomen bzw. Erkrankungen und vermuten Zusammenhänge mit der aktuellen Covid-19-Pandemie. Schlaganfälle sind eine ernste und stationär zu behandelnde Erkrankung und eine verzögerte oder nicht erfolgende Behandlung kann zu langfristigen schweren Schäden und Schwerstbehinderung oder gar zum Tod führen. Umso wichtiger ist, den beobachteten Rückgang genauer zu quantifizieren und die Ursachen zu identifizieren.
Dies hat nun eine Gruppe US-amerikanischer Gesundheitsforscher*innen und Krankenhausärzt*innen versucht und die Ergebnisse am 8. Mai 2020 in der Fachzeitschrift "New England Journal of Medicine (NEJM)" veröffentlicht.
Dazu untersuchten sie wie oft eine Software (RAPID) bei mit Schlaganfallsymptomatik eingelieferten Patient*innen eingesetzt wird, d.h. anhand von Gehirn-Scans die Art des Schlaganfalls und seine wirksamste Behandlung bestimmt wird. In die Untersuchung gingen die Daten von 856 USA-weiten Krankenhäusern (ohne New Hampshire) mit 231.753 im Februar 2020, also vor Beginn der Covid-19-Pandemie und in der Zeit vom 26. März und 8.April 2020 untersuchten Patient*innen ein.
Während vor der Pandemie die Software bei 1,18 Patient*innen pro Tag und Krankenhaus zum Einsatz kam, sank dieser Wert Ende März/Anfang April auf 0,72 RAPID-Untersuchungen pro Tag und Krankenhaus, also um 39%.
Anders als u.a. in deutschen Krankenhäusern beobachtet oder vermutet, ging die Anzahl behandelter Patient*innen in allen Altersgruppen, bei Männern wie Frauen und vor allem sowohl bei leichten wie schweren Schlaganfällen zurück. Der Rückgang erfolgte auch in allen Bundesstaaten, im ländlichen wie städtischen Bereich und auch unabhängig von regionalen Covid-19-Inzidenzen.
Zur Erklärung dieser gravierenden Kollateralschäden der Covid-19-Pandemie weist der Hauptautor der Studie auf Folgendes hin:
• "I suspect we are witnessing a combination of patients being reluctant to seek care out of fear that they might contract COVID-19, and the effects of social distancing,"
• Und: "The response of family and friends is really important when a loved one is experiencing stroke symptoms. Oftentimes, the patients themselves are not in a position to call 911, but family and friends recognize the stroke symptoms and make the call. In an era when we are all isolating at home, it may be that patients who have strokes aren't discovered quickly enough."
Zwar schwer denkbar, aber auch nicht ausschließbar ist, dass es sich bei einem Teil der Schlaganfallfälle in der Vor-Pandemiezeit um Über- oder Fehlversorgung handelte, bei der Symptome wie partielle Lähmungen oder Verwirrung automatisch aber fälschlicherweise für Schlaganfallsymptome gehalten wurden.
Eine spontane Abnahme des Risikos, einen Schlaganfall zu erleiden, schließen die Forscher*innen allerdings definitiv aus.
Ähnlich differenzierte Ergebnisse für Deutschland gibt es bisher nicht. Die eingangs zitierten Beobachtungen lassen aber vermuten, dass es auch in Deutschland ähnliche Entwicklungen gibt.
Der 2 Seiten umfassende Forschungsbrief Collateral Effect of Covid-19 on Stroke Evaluation in the United States von Akash P. Kansagra, Manu S. Goyal, Scott Hamilton und Gregory W. Albers und ein 12-seitiger Tabellenanhang sind in der Zeitschrift NEJM erschienen und beide komplett und kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 13.5.20
Kritik an Choosing Wisely-Empfehlungen gegen medizinische Überversorgung
 Die Choosing Wisely-Kampagne wurde in den USA im Jahr 2012 von der ABIM Foundation initiiert. Das Anliegen besteht in Minderung überflüssiger Diagnostik und Therapie durch die Förderung des Gesprächs zwischen Arzt und Patient. Fachgesellschaften waren und sind dazu aufgerufen, sog. Top 5-Listen als Grundlage für diese Gespräche zu erstellen. Als Erfolge kann die Kampagne u.a. verbuchen: Ausbreitung auf 24 Länder, insgesamt knapp 1300 Empfehlungen und eine Reihe von Erfolgsgeschichten.
Die Choosing Wisely-Kampagne wurde in den USA im Jahr 2012 von der ABIM Foundation initiiert. Das Anliegen besteht in Minderung überflüssiger Diagnostik und Therapie durch die Förderung des Gesprächs zwischen Arzt und Patient. Fachgesellschaften waren und sind dazu aufgerufen, sog. Top 5-Listen als Grundlage für diese Gespräche zu erstellen. Als Erfolge kann die Kampagne u.a. verbuchen: Ausbreitung auf 24 Länder, insgesamt knapp 1300 Empfehlungen und eine Reihe von Erfolgsgeschichten.
Die ABIM hat die Kriterien für die Erstellung von Empfehlungen aus pragmatischen Gründen relativ allgemein gefasst und lässt den Fachgesellschaften damit viel Spielraum im Aufgreifen bzw. Ignorieren bekannter Probleme der Überversorgung. Auf die fehlende methodische Stringenz sowie auf die Fokussierung allein auf Überversorgung, wurden von Seiten des Deutschen Netzwerks Evidenzbasierte Medizin bereits frühzeitig kritisch hingewiesen.
Die Vermutung lag nahe, dass die Fachgesellschaften erst einmal Listen mit Maßnahmen erstellten, in denen umstrittene, brisante und für das Einkommen von Mitgliedern relevante Themen ausgespart blieben.
Eine im November 2019 veröffentlichte Studie ging dieser Frage nach. Die australischen Autoren wollten wissen, welcher Anteil von Empfehlungen einkommensrelevant ist und ob sich die einkommensrelevanten Empfehlungen an die eigene oder an andere Fachgruppen richtete. Als einkommensrelevant wurde Leistungen klassifiziert, deren Durchführung üblicherweise außerhalb eines normalen Arzt-Patient-Kontaktes erfolgen und mit einem Geldbetrag vergütet werden, wie chirurgische Eingriffe, endoskopische Verfahren (z.B. Darmspiegelung) und Bestrahlungen.
Weiterhin prüften sie, ob die Empfehlung eindeutig ("keine Transfusion von roten Blutzellen in stabilen Intensivpatienten mit einem Hämoglobinwert >7 g/dL") oder weicher und interpretationsfähig formuliert war ("vermeide … ","erwäge …").
Analysiert wurden insgesamt 1293 unterschiedliche Choosing Wisely-Empfehlungen aus 8 Ländern. Je etwa die Hälfte bezog sich auf Diagnostik bzw. Therapie. 94% waren negativ ("don't"), 6% positiv ("do").
Von den 1293 Empfehlungen bezogen sich je etwa Hälfte auf diagnostische bzw. therapeutische Leistungen. Von den 552 therapeutischen Empfehlungen auf die eigene Fachgruppe und knapp 10% auf andere Fachgruppen. 98 therapeutische Empfehlungen klassifizierten die Autoren als einkommensrelevant - davon betrafen 16% die eigene Fachgruppe und 40% andere Fachgruppen.
Eindeutig formuliert waren knapp 60% aller Empfehlungen und knapp 50% der einkommensrelevanten Empfehlungen, die sich auf die eigene Fachgruppe bzw. andere Fachgruppen beziehen.
Das Fazit lautet, dass die Empfehlungen der Fachgesellschaften im Rahmen der Choosing Wisely-Kampagne solche Überversorgungsthemen vermeiden, deren Korrektur das Einkommen der eigenen Fachgruppe vermindern würde. Bei einkommensrelevanten Themen anderer Fachgruppen ist man weniger zögerlich. Noch dazu sind die einkommensrelevanten Empfehlungen häufig so formuliert, dass Interpretationsspielräume bleiben.
Die Empfehlungen im Rahmen der Gemeinsam Klug Entscheiden-Initative der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF) unterscheiden sich grundlegend. Diese Empfehlungen werden im Rahmen der sog. S3-Leitlinien entwickelt und stellen das gemeinsame Werk unterschiedlicher Fachgesellschaften unter Beteiligung anderer Gesundheitsberufe und von Patienten dar. Grundlage ist eine systematische Recherche der Evidenz, das Management von Interessenkonflikten, ein Konsensverfahren sowie spezifische Kriterien, welche die Relevanz und Umsetzbarkeit der Gemeinsam Klug Entscheiden-Empfehlungen sicherstellen sollen.
Zadro, J. R., Farey, J., Harris, I. A., & Maher, C. G. (2019). Do choosing wisely recommendations about low-value care target income-generating treatments provided by members? A content analysis of 1293 recommendations. BMC Health Services Research, 19(1), 707. Volltext
David Klemperer, 6.2.20
Beeinflusst in den USA die Behandlung durch nicht-weiße Ärzte die Gesundheit nicht-weißer Männer? Ja, und was ist in Deutschland!?
 Afroamerikanische männliche (auch weibliche) US-Bürger leben fast 5 Jahre kürzer als nichthispanische weiße Männer. Rund 60% dieser kürzeren Lebenserwartung beruht auf der höheren Prävalenz chronischer Erkrankungen unter den Afroamerikanern. Ein wiederum großer Anteil dieser Erkrankungen könnte durch präventive Interventionen z.B. durch Veränderungen des Lebensstiles, durch Impfungen oder durch die Nutzung von Früherkennungsuntersuchungen vermieden oder der Zeitpunkt der Erkrankung zeitlich hinausgeschoben werden. Die meisten dieser Maßnahmen setzen aber einen Arztbesuch bzw. eine ärztliche Behandlung voraus. Und damit kommt eine weitere Ungleichheit im us-amerikanischen Gesundheitssystem zur Geltung. Während der Anteil der Afroamerikaner an der Gesamtbevölkerung rund 13% beträgt, gehören nur 4% der Ärzt*innen und 7% der Medizinstudierenden dieser ethnischen (im englischen Originaltext werden hier immer Begriffe wie "race" oder "same-race" benutzt, die im Deutschen negativ belastet sind und deshalb nicht direkt übersetzt werden) Gruppe an.
Afroamerikanische männliche (auch weibliche) US-Bürger leben fast 5 Jahre kürzer als nichthispanische weiße Männer. Rund 60% dieser kürzeren Lebenserwartung beruht auf der höheren Prävalenz chronischer Erkrankungen unter den Afroamerikanern. Ein wiederum großer Anteil dieser Erkrankungen könnte durch präventive Interventionen z.B. durch Veränderungen des Lebensstiles, durch Impfungen oder durch die Nutzung von Früherkennungsuntersuchungen vermieden oder der Zeitpunkt der Erkrankung zeitlich hinausgeschoben werden. Die meisten dieser Maßnahmen setzen aber einen Arztbesuch bzw. eine ärztliche Behandlung voraus. Und damit kommt eine weitere Ungleichheit im us-amerikanischen Gesundheitssystem zur Geltung. Während der Anteil der Afroamerikaner an der Gesamtbevölkerung rund 13% beträgt, gehören nur 4% der Ärzt*innen und 7% der Medizinstudierenden dieser ethnischen (im englischen Originaltext werden hier immer Begriffe wie "race" oder "same-race" benutzt, die im Deutschen negativ belastet sind und deshalb nicht direkt übersetzt werden) Gruppe an.
Zu dieser quantitativen Lücke kommt noch ein qualitatives Misstrauen der Afroamerikaner gegen das mehrheitlich weiße Ärzte-Establishment, das an einer Reihe rassistischer oder die Afroamerikaner systematisch benachteiligenden Aktivitäten beteiligt war. Auch wenn sie bereits vor einiger Zeit beendet wurde, gehört dazu die zwischen 1932 und 1972 durch staatliche Public Health-Institutionen durchgeführte so genannte Tuskegee-Syphilis-Studie. Und ganz aktuell zeigte eine Studie, dass durch Fehlannahmen bzw. Geringschätzung über die Gesundheitsrisiken von Afroamerikanern ein in der Behandlungssteuerung im Krankenhaus verwandter Algorithmus schwarze Patient*innen gegenüber weißen erheblich benachteiligte. Zu den weiteren Einzelheiten siehe den Artikel Algorithmus im US-Gesundheitswesen benachteiligt Afroamerikaner im Deutschen Ärzteblatt vom 25. Oktober 2019 und den Aufsatz Hospital 'risk scores' prioritize white patients in der Zeitschrift "Science" vom 24. Oktober 2019.
Auf diesem Hintergrund entstand die Vermutung, die eingangs beschriebene Ungleichheit beim Sterberisiko könne dadurch verringert werden, wenn afroamerikanische Patienten bei Ärzt*innen ihrer Ethnie in Behandlung wären und wegen des wesentlich höheren Vertrauen auch gesundheitsfördernden Verhaltensempfehlungen dieser Ärzt*innen eher und mit größerem gesundheitlichen Effekt folgen.
Ob dies nur gut gemeint ist oder wirklich zutrifft untersuchte jetzt eine Gruppe von US-Wissenschaftler*innen mit einer randomisierten kontrollierten Studie von über 1.3000 afroamerikanischen Männern aus Kalifornien.
Für die Untersuchung wählten die Wissenschaftler*innen ein anspruchsvolles mehrdimensionales methodisches Konzept aus: Die Teilnehmer füllten zuerst einen umfangreichen Fragebogen zu ihrem gesundheitlichen Zustand aus. Sie erhielten zugleich einen Gutschein für eine Gesundheitsuntersuchung in einer kooperierenden Klinik. Die Studienteilnehmer, die sich für eine Screeninguntersuchung entschieden wurden per Zufall einem schwarzen oder nichtschwarzen (weiß oder asiatisch) Arzt zugewiesen. Sie erhielten dann ein Bild ihres Arztes und konnten angeben welche invasiven oder nicht-invasiven Untersuchungen sie aus einer umfangreichen Liste in Anspruch nehmen wollten. In dem sich anschließenden Gespräch mit dem ihnen zugewiesenen Arzt konnten sie ihre Auswahl an Untersuchungen revidieren. Bis zu Beginn dieses Gesprächs gab es keine signifikanten Unterschiede des Auswahlverhaltens nach der Ethnie der Ärzt*innen.
Dies änderte sich nach dem persönlichen Kontakt mit dem Arzt aber grundlegend. Der Anteil der Patienten, die sich mit einem afroamerikanischen Arzt unterhalten hatten und bei denen anschließend z.B. präventive Untersuchungen des Blutdrucks, Blutzuckers und des Cholesterins durchgeführt wurden oder der Body Mass-Index bestimmt wurde, war 20 bis 25 Prozentpunkte höher als bei den Patienten, die mit einem weißen oder asiaamerikanischen Arzt zu tun hatten.
Entscheidend für dieses Ergebnis war die wesentlich bessere Kommunikation zwischen afroamerikanischen Patienten und Ärzten, die u.a. invasive Untersuchungen, die ein bestimmtes Vertrauen zum Arzt voraussetzen.
Abschließend versuchten die Forscher*innen unter Berücksichtigung anderer Studien noch den potenziellen Gesundheitsgewinn zu bestimmen, der durch ein afroamerikanisches Patient-Arzt-Team entsteht. Sie schätzen, dass die Lücke bei der kardiovaskulären Sterblichkeit zwischen weißen und schwarzen Patienten durch mehr solcher Teams oder Paarungen zu Gunsten der afroamerikanischen Patienten um 19% geschlossen werden könnte und die bei der generellen Lebenserwartung um 8%.
Auch wenn jetzt deutsche Leser*innen denken, die Ergebnisse dieser Studie aus der wesentlich diverseren us-amerikanischen Gesellschaft, gingen an der deutschen Wirklichkeit vorbei, weisen sie auf Dynamiken und Effekte von Patient-Arzt-Interaktionen hin, die nur mit anderen Hautfarben oder Phänotypen auch hierzulande Behandlungsergebnisse verbessern oder verschlechtern könnten.
Von dem Aufsatz Does Diversity Matter for Health? Experimental Evidence from Oakland von Marcella Alsan, Owen Garrick und Grant Graziani (erschienen als "NBER Working Paper No. 24787), gibt es kostenlos eine kurze Zusammenfassung. Prüfen sollte jeder, der duiese aber auch noch weitere NBER-Studien komplett lesen will, ob er eine der Zugangsvoraussetzungen (z.B. Universitätsangehöriger, Journalist) erfüllt. Das NBER (National Bureau of Economic Research) ist keine regierungszahme Einrichtung und auch nicht dem neoliberalen Ökonomie-Mainstream verfallen.
Eine umfangreiche Sammlung von Daten und Literatur zum Aufsatz 'Does Diversity Matter for Health? Experimental Evidence from Oakland'. Appendix — For Online Publication gibt es kostenlos zum Herunterladen.
Bernard Braun, 14.12.19
Fundgrube zum Burnout von Krankenhausbeschäftigten, von den Ursachen bis zu möglichen Lösungen
 Dass ausgerechnet Krankenhäuser nicht die gesündesten Arbeitsorte sind, ist seit längerem durch zahlreiche internationale und nationale Studien belegt. Dabei spielt der so genannte Burnout eine große Rolle, was nicht nur die Gesundheit und das Wohlbefinden der ÄrztInnen, Pflegekräfte und anderer Berufstätigen beeinträchtigt, sondern auch die Gesundheit und die Zufriedenheit der PatientInnen. Und last, but not least wirken sich alle Folgen belastender Arbeitsverhältnisse auf die Produktivität und den wirtschaftlichen Erfolg der Krankenhäuser aus.
Dass ausgerechnet Krankenhäuser nicht die gesündesten Arbeitsorte sind, ist seit längerem durch zahlreiche internationale und nationale Studien belegt. Dabei spielt der so genannte Burnout eine große Rolle, was nicht nur die Gesundheit und das Wohlbefinden der ÄrztInnen, Pflegekräfte und anderer Berufstätigen beeinträchtigt, sondern auch die Gesundheit und die Zufriedenheit der PatientInnen. Und last, but not least wirken sich alle Folgen belastender Arbeitsverhältnisse auf die Produktivität und den wirtschaftlichen Erfolg der Krankenhäuser aus.
Wer sich daher als Betroffener oder Akteur in Krankenhäusern gründlicher mit der Häufigkeit von Burnout, seinem Wesen, den Ursachen, den Folgen und möglichen theoretischen wie praktischen Möglichkeiten ihn zu vermeiden oder abzubauen beschäftigen will, findet auf der von der National Academy of Sciences und der National Academy of Medicine der USA entwickelten und gepflegten Website "Action Collaborative on Clinician Well-Being and Resilience" bzw. dem "Clinician Well-Being Knowledge Hub" eine Fülle von qualitativ hochwertigen Materialien.
So enthält z.B. der Bereich "Resource Center" 1.068 (Stand August 2019) Hinweise auf zum größten Teil peer-reviewte Veröffentlichungen (fast ausschließlich in englischer Sprache) zu allen Aspekten des Burnouts (z.B. Ursachen, Folgen für Beschäftigte und Patienten, Kosten, Präventionsmöglichkeiten und andere Lösungsmöglichkeiten) von Beschäftigten im Gesundheitswesen für den Zeitraum seit 1980. Neben Kurzzusammenfassungen gibt es auch Links zu den Originalorten der Veröffentlichungen, die auch häufig komplett erhältlich sind.
Ein wichtiger Bereich der Website sind systematisch von externen ExpertInnen erstellte Fallstudien, die "models of good practice" sein können. Auch wenn aus der Sicht von Interessenten aus deutschen Krankenhäusern eingewandt werden könnte, Krankenhäuser in den USA seien völlig anders und die dortigen Erfahrungen für das Kreiskrankenhaus in Oberschwaben nutzlos, stimmt dies nicht ganz. Die Mehrheit der Krankenhäuser in den USA sind z.B. non-for-profit. Dies gilt auch für die beiden bisherigen Fallstudien aus der Ohio State University und dem Virginia Mason Kirkland Medical Center, einer so genannten "501 (c) (3) tax-exempt nonprofit corporation" im Besitz einer gemeinnützigen Stiftung.
Welchen Stellenwert und Nutzen Fallstudien haben, fassen ihre Ersteller so zusammen: The following case studies highlight organizational initiatives that have demonstrated success in supporting well-being and reducing burnout among practicing clinicians, trainees, and/or students. The case studies are intended to inform and inspire organizations facing similar challenges and seeking similar outcomes. Although there is no one-size-fits-all solution for clinician well-being, techniques and resources described in the case studies may provide a useful starting point for other groups."
Damit ist auch für deutsche InteressentInnen klar, dass selbst die gründliche Nutzung dieser Website nicht die gründliche Auseinandersetzung mit den eigenen Verhältnissen mit fachlicher Unterstützung ersetzt, aber wertvolle Hinweise liefert um was es da gehen könnte und was zu beachten ist.
Der Clinician Well-Being Knowledge Hub ist kostenlos erreichbar. Die VerfasserInnen kündigen auch die stetige Weiterentwicklung an. Regelmäßige Besuche sind also zu empfehlen.
Bernard Braun, 6.8.19
Je mehr "primary care phycisians" desto höher ist die Lebenserwartung in den USA. Beitrag von Spezialärzten geringer
 Dass primärärztliche Versorgung bevölkerungsbezogen positive gesundheitliche Wirkungen hat, gehört zu den Basisannahmen und -erkenntnissen der weltweiten Gesundheitsversorgungsforschung und -politik. Etwas weniger weiß man, ob die Praxis der Erkenntnis folgt und über die Größe dieses Nutzens.
Dass primärärztliche Versorgung bevölkerungsbezogen positive gesundheitliche Wirkungen hat, gehört zu den Basisannahmen und -erkenntnissen der weltweiten Gesundheitsversorgungsforschung und -politik. Etwas weniger weiß man, ob die Praxis der Erkenntnis folgt und über die Größe dieses Nutzens.
Daran ändert eine gerade veröffentlichte Studie von GesundheitswissenschaftlerInnen der us-amerikanischen Stanford und Harvard-Universität über die Entwicklung der Anzahl von Allgemeinmedizinern und Fachärzten in den 3.142 US-Landkreisen/Kreisen ("counties" - das sind fast alle dieser Verwaltungseinheiten), 7.144 US-Primärversorgungsregionen/-märkte ("primary care service areas") und 306 US-Gesundheitsversorgungsmärkten ("hospital referral regions" - das sind alle dieser Märkte) zwischen den Jahren 2005 und 2015 einiges.
Ihre wichtigsten Erkenntnisse sind:
• Obwohl die absolute Anzahl von PrimärärztInnen in den USA in diesen 10 Jahren von 196.014 auf 204.419 zugenommen hat, sank die Anzahl pro 100.000 EinwohnerInnen von 46,6 auf 41,4.
• Bei der Untersuchung des statistischen Zusammenhangs zwischen der Versorgungsdichte durch PrimärärztInnen und Mortalität oder Lebenserwartung zeigt sich, dass 10 zusätzliche ÄrztInnen dieser Art pro 100.000 Einwohner in dem 10-Jahreszeitraum die Lebenserwartung um 51,5 Tage verlängerte. 10 zusätzliche FachärztInnen verlängerten die Lebenserwartung dagegen "nur" um 19,2 Tage.
• 10 zusätzliche Primärärzte reduzierten die kardiovaskuläre Sterblichkeit um 0,9%, die Krebssterblichkeit um 1% und die atremwegsbezogene Sterblichkeit um 1,4%.
• Da den AutorInnen zu Recht klar ist, dass auch noch ganz andere Faktoren als die ärztliche Tätigkeit auf die Lebenserwartung einwirken, berechnen sie wie groß der Anteil der Effekte von Primärärzten an den Effekten der Armut und des Tabakkonsums ist: PrimärärztInnen bewirken rund 20% dessen, was Armutsbekämpfung bei der Lebenserwartung bewirkt und rund zwei Drittel von der Auswirkung des Reduktion des Tabakkonsums.
• Zu den Gründen warum in den USA trotz dieses bevölkerungsgesundheitlichen Nutzens zu wenig Medizinstudierende Primärärzte werden wollen und werden, bemerkte der Hauptautor folgendes: "The passionate students who care about population health really want to go into primary care…But they also have serious education debts and are looking at the paychecks for fields like dermatology, ophthalmology or urology. They don't actually find those fields compelling, but the pay disparity is often just too much for them to take a low-level primary care job instead."
Und was bedeutet dies für die Gesundheitsversorgung in Deutschland? Selbst wenn Vergleiche zwischen "primary care phycisians" und PrimärärztInnen in Deutschland nicht ganz einfach sind, fehlt eine derartige Untersuchung in Deutschland zunächst einmal. Was aber im Lichte der Ergebnisse in den USA wohl bedacht werden sollte, ist die je nach Zählweise stetige abnehmende oder aber leicht zunehmende Anzahl von HausärztInnen (welche primärärztlich tätigen (Fach-)ÄrztInnen in dieser Gruppe zusammengefasst sind, bleibt aber unklar) im deutschen Gesundheitssystem. Der in Festreden beschworenen Bedeutung der primärärztlichen Versorgung steht auch in Deutschland keine entsprechende Zunahme dieser Arztgruppe gegenüber. Was dies für die Lebenserwartung bedeutet, belegt nun die US-Studie sehr genau.
Der Aufsatz Association of Primary Care Physician Supply With Population Mortality in the United States, 2005-2015 von Sanjay Basu et al. ist am 18. Februar 2019 online first in der Fachzeitschrift "JAMA Internal Medicine" erschienen und kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 19.2.19
USA: Wie viele BewohnerInnen müssen Pflegekräfte im besten oder schlimmsten Fall in jedem Altenpflegeheim betreuen?
 In den USA leben fast 1,4 Millionen Personen in einem der über 14.000 (Alten)Pflegeheime mit professioneller Versorgung rund um die Uhr.
In den USA leben fast 1,4 Millionen Personen in einem der über 14.000 (Alten)Pflegeheime mit professioneller Versorgung rund um die Uhr.
Eine der vielen eher unbekannten Leistungen des "Affordable Care Act (ACA)" oder Obamacare ist die systematische, kontinuierliche und differenzierte Erhebung der Anzahl von ausgebildeten Pflegekräften (registered nurses) und Pflegehelfern im Verhältnis zu den bei Medicare versicherten Pflegebedürftigen. Dazu dienen anders als bisher die täglichen Gehaltsabrechnungen für das Pflegepersonal. Die bisherige Datenbasis waren Angaben über die Pflegepersonen und BewohnerInnen innerhalb der letzten zwei Wochen vor einer Inspektion. Da dieser Termin den Pflegeeinrichtungen oft bekannt war, war die Personalausstattung oft "geschönt". Mit den nun von den "Centers for Medicare & Medicaid Services" erhobenen Daten ist es möglich für jedes Pflegeheim zu erfahren, ob die Gesamtausstattung mit Personal und die Ausstattung mit ausgebildeten Pflegekräften weit überdurchschnittlich, überdurchschnittlich, durchschnittlich, unterdurchschnittlich oder weit unterdurchschnittlich ist. Gleichzeitig kann berechnet werden wie viele Pflegebedürftige eine ausgebildete Pflegekraft und ein Pflegehelfer an den Tagen mit bester oder schlechtester Personalausstattung zu versorgen hat.
Diese Daten sind seit dem 12. Juli 2018 für sämtliche Bundesstaaten der USA und für jedes Pflegeheim das Medicare-Versicherte betreut mittels eines von der "Kaiser Family Foundation" erstellten interaktiven Tool grafisch und tabellarisch gut aufbereitet verfügbar.
Das Tool Look-Up: How Nursing Home Staffing Fluctuates Nationwide ist kostenlos nutzbar.
In dem am 7. Juli 2018 zuerst in der "New York Times" veröffentlichten Artikel 'Like A Ghost Town': Erratic Nursing Home Staffing Revealed Through New Records finden sich weitere Angaben zu den beiden Verfahren zur Erhebung der Personalausstattung in Pflegeheimen und Beispiele für die enormen Unterschiede bei der personellen Ausstattung zwischen Heimen aber auch die zwischen Werk- und Feiertagen je Heim.
Bernard Braun, 16.7.18
Wie häufig ist die Überversorgung mit nutzlosen oder schädlichen Leistungen und wie viel kostet das? Antworten aus WA und VA (USA)
 Über- und Fehlversorgung mit gesundheitlich nicht notwendigen, im besten Fall nutzlosen, im schlimmsten Fall aber für die PatientInnen schädlichen diagnostischen Tests und therapeutischen Interventionen ist eines der international wie national seit vielen Jahren beschriebenen (Haupt-)Probleme der Gesundheitssysteme entwickelter Länder.
Über- und Fehlversorgung mit gesundheitlich nicht notwendigen, im besten Fall nutzlosen, im schlimmsten Fall aber für die PatientInnen schädlichen diagnostischen Tests und therapeutischen Interventionen ist eines der international wie national seit vielen Jahren beschriebenen (Haupt-)Probleme der Gesundheitssysteme entwickelter Länder.
Bei aller Einigkeit wird die Anzahl der davon Betroffenen und der finanzielle Umfang der Überversorgung aber unterschiedlich bewertet, wenn dazu überhaupt halbwegs präzise Zahlen genannt werden.
Hier etwas Abhilfe zu schaffen, war das Anliegen einer Untersuchung der Behandlungsdaten von rund 2,4 Millionen bei privaten Krankenversicherungen versicherten Personen im US-Bundesstaat Washington im Zeitraum von Juli 2015 bis Juni 2016. Für diese Personen wurde mittels des Analyseinstruments "Health Waste Calculator" untersucht, wie häufig 47 diagnostische und therapeutische Leistungen erbracht wurden, die im Rahmen der "choosing wisely"-Initiative zahlreicher us-amerikanischen medizinischen Fachgesellschaften als potenziell unnütz oder schädlich bewertet wurden. Die Liste der Leistungen reicht von der wahllosen Verordnung von Antibiotika bei komplikationslosen Infektionen der oberen Atemwege über die Erstellung von Elektrokardiogrammen (EKG) bei symptomlosen und "low risk"-Patienten bis zu arthroskopischen Operationen zur Behandlung von Knien mit Osteoarthritis (die gesamte Liste findet sich im Anhang der hier vorgestellten Studie). Auf Basis der gesamten Behandlungsdaten wurde für jede dieser Leistungen bewertet, ob sie nützlich oder klinisch angemessen, wahrscheinlich verschwenderisch oder unangemessen oder sehr wahrscheinlich nicht notwendig bzw. Verschwendung war.
Die wichtigsten Ergebnisse lauten:
• 1,298 Millionen Personen erhielten eine oder mehrere der 47 Leistungen. 46,4% von ihnen erhielten Leistungen, die eindeutig unangemessen waren. Bei weiteren 1,5% waren sie wahrscheinlich unangemessen.
• Von den 758 Millionen US-Dollar, die sämtliche 47 Leistungen kosteten, wurden 32,9% für eindeutig unangemessene Leistungen ausgegeben.
• 11 der 47 Leistungen wurden als Schlüsselleistungen der Überversorgung bewertet. Darunter waren zu häufige Screenings auf Gebärmutterhalskrebs und alle bildgebenden Untersuchungen bei komplikationslosen Kopfschmerzen. Diese 11 Leistungen trugen zu 93% aller wahrscheinlich oder gesichert geringwertigen oder nutzlosen Leistungen bei. 578.503, also rund ein Viertel der 2,4 Millionen in der Studie betrachteten Personen erhielten mindestens eine dieser 11 Leistungen.
• So wurden ungefähr drei von vier jährlichen Screeninguntersuchungen auf Gebärmutterhalskrebs bei Frauen durchgeführt, die bereits vorher angemessen untersucht worden waren.
• Rund 85% aller Labortests, gesunde Patienten auf geringfügige und risikofreien Operationen vorzubereiten waren nicht notwendig.
• Bei 35% der 103.332 Personen, die screeningmäßig auf einen Vitamin D-Mangel untersucht wurden, war diese Untersuchung mangels Indikation völlig nutzlos und reine Verschwendung von 12 Millionen US-Dollar.
Weitere Beispiele für Überversorgung, aber auch Hinweise auf Limitationen der Daten und Vorschläge für das weitere Vorgehen finden sich in dem 27 Seiten umfassenden und im Februar 2018 veröffentlichten Bericht First, Do No Harm. Calculating Health Care Waste in Washington State erstellt von der "Washington Health Alliance" und der "Choosing Wisely initiative in Washington state", der komplett kostenlos erhältlich ist.
Für das weitere Vorgehen schlagen die VerfasserInnen der Studie u.a. vor:
• "The concepts of "choosing wisely" and shared decision-making must become the bedrock of provider-patient communications.
• We need to keep our collective "foot on the gas" to transition from paying for volume to paying for value in health care.
• Value-based provider contracts must include measures of overuse, and not just measures of access and underuse of evidence-based care."
Wer jetzt vielleicht meint, diese Verhältnisse seien regionaler Art oder in Washington State gäbe es eben viele "schwarze Schafe", muss diesen Gedanken zumindest für die USA aufgeben.
Beim einem vergleichbaren Einsatz des "Health Waste Calculator" bei 5,5 Millionen bei privaten Krankenversicherungen aber auch bei den öffentlichen Versicherungen Medicare und Medicaid versicherten Personen im US-Bundesstaat zeigte sich, dass 2014 1,7 Millionen Personen nutzlose Leistungen erhielten. Die Überversorgungs- oder Verschwendungsrate betrug 31%. Der Aufsatz Low-Cost, High-Volume Health Services Contribute The Most To Unnecessary Health Spending von John N. Mafi et al. ist im Oktober 2017 in der Zeitschrift "Health Affairs" (10: 1701-1704) erschienen. Ein Abstract ist kostenlos erhältlich.
Ob die Überversorgungsrate in Deutschland gleich hoch ist oder derartiges im "besten Gesundheitssystem der Welt" nicht existiert, lässt sich abschließend erst nach inhaltlich vergleichbaren Untersuchungen mit Abrechnungsdaten der GKV und der PKV beantworten. Die hohen Raten von sofortigen bildgebenden Untersuchungen bei Rückenschmerzen oder die immer noch große Anzahl von Antibiotikaverordnungen bei Atemwegsinfektionen sollten aber Anlass sein genauso intensiv hinzuschauen wie in Washington und Virginia.
Zum Schluss: Wie gesamte Überversorgungsraten aussehen, wenn also nicht nur die 47 Leistungen, sondern alle gesundheitsbezogen erbrachten Leistungen berücksichtigt würden, muss erst in umfassenderen Untersuchungen ermittelt werden.
Bernard Braun, 4.2.18
Verbessern finanzielle Anreize die Qualität gesundheitlicher Leistungen? Nein, und auch nicht wenn sie länger einwirken!
 Zu den immer wieder patentrezeptartig empfohlenen Mitteln die Qualität der Gesundheitsversorgung zu verbessern gehören finanzielle Anreize für das Erreichen bestimmter quantitativer und qualitativer Ziele der Prozess- und Ergebnisqualität. Eine Fülle derartiger Programme im Bereich der stationären und ambulanten Versorgung existieren und wirken insbesondere in den USA unter der Sammelüberschrift "pay-for-performance" oder P4P bereits seit den 1990er Jahren und wurden dort auch evaluiert.
Zu den immer wieder patentrezeptartig empfohlenen Mitteln die Qualität der Gesundheitsversorgung zu verbessern gehören finanzielle Anreize für das Erreichen bestimmter quantitativer und qualitativer Ziele der Prozess- und Ergebnisqualität. Eine Fülle derartiger Programme im Bereich der stationären und ambulanten Versorgung existieren und wirken insbesondere in den USA unter der Sammelüberschrift "pay-for-performance" oder P4P bereits seit den 1990er Jahren und wurden dort auch evaluiert.
Die wesentlichen Ergebnisse der Evaluationsstudien zu zwei wichtigen P4P-Programmen (die "Premier Hospital Quality Incentive Demonstration [HQID]" in den Jahren 2003 bis 2009 und das "Hospital Value-based Purchasing"-Programm [HVBP] seit 2010) lauten, dass sich P4P-Programme nur in sehr geringem Umfang auf wichtige Faktoren der Prozessqualität auswirken, den patientenbezogenen Outcome nicht verbessern und auch nichts zur Kostenreduktion beitragen. Wer sich genauer für diese Ergebnisse interessiert findet im Literaturverzeichnis des hier vorgestellten Aufsatzes 10 relevante Studien.
Trotz der Fülle der Belege für die eingeschränkten oder fehlenden Effekte des eingangs skizzierten Anreiz-Wirkungsmodells machen seine Protagonisten dafür aber die zu geringe Wirkungszeit der Anreize und/oder den zu geringen Umfang der Anreize verantwortlich. Um die gewünschten Effekte doch noch erreichen zu können, müssten also P4P-Programme länger laufen oder ihr Finanzvolumen größer sein.
Zumindest die Hoffnung auf die Wirkung längerer Einwirkungszeiten finanzieller Anreize erweist sich nach einer aktuellen Studie in den USA aber als irrig.
In dieser Studie werden für den Zeitraum von 2003 bis 2013 die Outcomes (Mortalität innerhalb der ersten 30 Tage nach Entlassung und ein Scorewert für verschiedene Faktoren der Prozessqualität) von 1.371.364 Patienten, die 65 Jahre und älter waren und in der staatlichen Krankenversicherung Medicare versichert waren in 1.189 us-amerikanischen Kliniken verglichen. Eine Gruppe von 214 Kliniken behandelte ihre PatientInnen bereits seit 2003 und bis 2009 im Rahmen des P4P-Programms HQID und setzte ihre P4P-Praxis bis 2013 unter dem HVBP-Programm fort. Diesen so genannten "early adopters" von P4P mit einer Anreizdauer von runbd 10 Jahren stand eine Gruppe von 975 so genannten "late adopters" mit einer P4P-Dauer von drei Jahren (2010 bis 2013) gegenüber.
Trotz der enormen Unterschiede der Dauer mit der die finanziellen Anreize der P4P-Programme einwirken konnten gab es weder beim Gesamtwert für die Prozessqualität noch bei den Mortalitätstrends für ausgewählte Erkrankungen einen signifikanten Unterschied zwischen den beiden Krankenhausgruppen.
Die für die weitere Debatte entscheidende Erkenntnis ihrer Studie fassen die AutorInnen so zusammen: "Pay for performance programs as currently implemented are unlikely to be successful in the future, even if their timeframes are extended."
Trotz einiger methodischer Limitationen der Studie (z.B. Konzentration auf die Behandlung älterer Patienten, Vergleich zweier Beobachtungsstudien) sollten diese Ergebnisse den gesundheitspolitischen Akteuren, die auch in Deutschland über die Qualitätsverbesserung mittels P4P-Programmen nachdenken, zu denken geben. Ob höhere finanzielle Anreize dabei hilfreich sind oder ganz andere Anreize und Zielgrößen relevanter sind, sollte vor dem Start neuer Patentrezepturen gründlich geprüft werden.
Der Aufsatz Impact of Financial Incentives on Early and Late Adopters among US Hospitals: observational study von Igna Bonfrer, Jose F Figueroa, Jie Zheng, E John Orav und Ashish K Jha ist im Januar 2018 in der Fachzeitschrift "BMJ" erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 8.1.18
Erwünschte und unerwünschte Effekte eines Anreizes zur Reduktion der Wiedereinweisungen in Krankenhäusern
 Zu den wenig bekannten Inhalten des "Patient Protection and Affordable Car Act" oder Obamacare aus dem Jahr 2010 gehören finanzielle Anreize für Krankenhäuser bei PatientInnen, die in der steuerfinanzierten Krankenversicherung für ältere Personen, Medicare, versichert sind, die Häufigkeit von Wiedereinweisungen zu vermeiden - das so genannte "Hospital Readmissions Reduction Program (HRRP)".
Zu den wenig bekannten Inhalten des "Patient Protection and Affordable Car Act" oder Obamacare aus dem Jahr 2010 gehören finanzielle Anreize für Krankenhäuser bei PatientInnen, die in der steuerfinanzierten Krankenversicherung für ältere Personen, Medicare, versichert sind, die Häufigkeit von Wiedereinweisungen zu vermeiden - das so genannte "Hospital Readmissions Reduction Program (HRRP)".
Gelingt ihnen dies nicht bzw. können sie nicht nachweisen, dass der weitere stationäre Aufenthalt nichts mit Komplikationen beim ersten Aufenthalt zu tun hat, wird der zweite Aufenthalt nur zu einem geringen Teil bezahlt.
Der erwünschte Effekt trat auch ein. Ob es auch wie bei den meisten komplexen Interventionen im Gesundheits- aber auch anderen sozialen Bereichen, unbeabsichtigt unerwünschte Effekte gab, sollten mehrere Untersuchungen feststellen.
Eine gerade veröffentlichte Studie von Wissenschaftlern der UCLA und der Harvard Universität mit den zwischen 2006 (also die Zeit vor Obamacare) und 2014 erhobenen Daten von 115.245 an einem Herzfehler leidenden Medicare-PatientInnen an 416 Krankenhäusern zeigt zweierlei:
— Nach der Implementation des Reduktionsprogramms sank sowohl die Häufigkeit der Wiedereinweisung 30 Tage nach Entlassung als auch die nach einem Jahr signifikant.
— Gleichzeitig stieg aber unter diesen PatientInnen wider Erwarten und gegen die jahrzehntelange Abnahme der Sterblichkeit wegen Herzschwäche die Sterblichkeit signifikant an.
— Beide Trends bleiben auch nach umfangreichen Adjustierungen z.B. nach Ethnie oder Erkrankungsschwere bestehen. Ob es derartige Effekte auch bei PatientInnen mit anderen Erkrankungen gibt, ist noch nicht untersucht, aber durchaus möglich.
Die AutorInnen vermuten, dass viele Krankenhäuser es geschafft haben, das "game" des HRRP mitzuspielen und z.B. durch verzögerte Aufnahmen oder Verlegungen innerhalb und außerhalb der Klinik (Intensivstation, Hospiz) versuchen, den Strafzahlungen des HRRP zu entgehen. Die Anreize des Gesetzes seien zu stark oder ausschließlich auf Kostenreduktion durch Vermeidung von Wiederaufnahmen gerichtet und berücksichtigten zu wenig oder gar nicht eine Verbesserung der Behandlungsqualität und der Outcomes für diese Patientengruppe.
Der Anreiz könne daher durchaus zum folgenden zynischen Schluss führen: "If a patient dies, then that patient cannot be readmitted."
Sollten sich die Ergebnisse dieser Studie in weiteren Untersuchungen bestätigen, müsse der Ansatz des HRRP deutlich verändert werden. Untersucht wird aber auch noch, ob die unerwünschten Auswirkungen auf die Sterblichkeit eventuell nur in bestimmten Krankenhaustypen auftreten - wofür allerdings bisher wenig spricht.
Die Studie Association of the Hospital Readmissions Reduction Program Implementation With Readmission and Mortality Outcomes in Heart Failure von Adrian F. Hernandez, Eric D. Peterson, Roland A. Matsouaka, Clyde W. Yancy, Gregg C. Fonarow ist online am 12. November 2017 in der Fachzeitschrift "JAMA Cardiology" erschienen und kostenlos erhältlich.
Aktueller Nachtrag: Nachtrag: Am 2. August 2017 veröffentlichte die Kaiser Family Foundation unter der Überschrift Medicare's Readmission Penalties Hit New High die folgenden Daten über Strafzahlungen bzw. Abzüge bei der Honorierung von stationären Leistungen für sechs Erkrankungen (darunter die Herzinsuffizienz): 2.597 Krankenhäusern, dies sind rund 50% aller Krankenhäuser in den USA, wurde wegen zu häufiger Wiedereinweisungen 528 Millionen US-Dollar nicht bezahlt. Der im Gesetz vorgesehene Maximalabzug vom Gesamthonorar in Höhe von 3% erfolgte bei 49 Kliniken. In den letzten 5 Jahren wurden 1.621 Kliniken jedes Jahr für zu hohe Wiedereinweisungsraten bestraft.
Bernard Braun, 15.11.17
Vorbild USA: US-Kongress will von 7 Pharmafirmen komplette Transparenz über ihre Preisgestaltung für Medikamente gegen MS
 Auch wenn es in den USA seit einigen Jahren gesundheitspolitisch ausgesprochen schrill, makaber und wiedersprüchlich zugeht wäre es ein großer Fehler die dortige Gesundheitspolitik auf Obama- versus Trumpcare oder auf die Dominanz radikal marktwirtschaftlicher und anbieterhöriger Positionen zu reduzieren. Jenseits der großen Care-Debatten gibt es eine Vielzahl von verabschiedeten Innovationen oder Initiativen, die zum Teil wesentlich anbieter- oder wettbewerbskritscher oder evidenbzbasierter sind als z.B. im GKV-System.
Auch wenn es in den USA seit einigen Jahren gesundheitspolitisch ausgesprochen schrill, makaber und wiedersprüchlich zugeht wäre es ein großer Fehler die dortige Gesundheitspolitik auf Obama- versus Trumpcare oder auf die Dominanz radikal marktwirtschaftlicher und anbieterhöriger Positionen zu reduzieren. Jenseits der großen Care-Debatten gibt es eine Vielzahl von verabschiedeten Innovationen oder Initiativen, die zum Teil wesentlich anbieter- oder wettbewerbskritscher oder evidenbzbasierter sind als z.B. im GKV-System.
Dazu gehört beispielsweise eine am 17. August 2017 an sieben Pharmaunternehmen (darunter auch die Firma Bayer) versandte parlamentsoffizielle Anfrage des "House-Committee of Oversight and Government Reform" des US-Congresses für eine so genannte "in-depth investigation" zu den Ursachen der Preisentwicklung von Arzneimitteln zur Behandlung von Multipler Sklerose (MS). Für deren Beantwortung erhielten die Unternehmen eine Frist bis zum 31. August 2017.
Die Ausgangslage für diese Untersuchung sieht so aus:
• Eine komplett kostenlos erhältliche Studie über The cost of multiple sclerosis drugs in the US and the pharmaceutical industry von Daniel Hartung et al. in der Fachzeitschrift "Neurology" vom 25. Mai 2015 (84(21): 2185-2192) wies nach, dass der Preis der gängigsten Medikamente gegen die multiple Sklerose zwischen 1993 und 2013 von von 8 bis 11.000 US-$ auf über 60.000 US-$ gestiegen war. Der Zuwachs lag damit um das 5- bis 7-Fache über der durchschnittlichen Preissteigerung für alle Arzneimittelverordnungen (3 bis 5%).
• Der Autor wies ferner nach, dass immer dann, wenn neue und zum Teil berechtigterweise teurere MS-Arzneimittel auf den Markt, die Preise für die älteren am stärksten stiegen (!) und nicht gleichblieben oder gemäß der klassischen ökonomischen Theorie sanken.
• Dies führte die AutorInnen zu folgendem bemerkenswerten Schluss: "However, the unbridled rise in the cost of MS drugs has resulted in large profit margins and the creation of an industry "too big to fail." It is time for neurologists to begin a national conversation about unsustainable and suffocating drug costs for people with MS—otherwise we are failing our patients and society."
• Bayer machte allein mit dem Alt-Präparat Betaseron 2016 in den USA einen Umsatz von 386 Millionen Euro.
Wenn man so will greifen die Kongressabgeordneten nur den letzten Satz der WissenschaftlerInnen auf und versuchen die "Unterhaltung" mit der Pharmaindustrie auf der Basis von deren internen Dokumenten zu führen.
So wird in dem Brief an die Firma Bayer für deren altes MS-Präparat Betaseron ein Anstieg des Preises von 11.532 US-$ im Erstzulassungsjahr 1993 auf 91.261 US-$ im Jahr 2017, also ein Anstieg um 691% nachgewiesen. Für die Abgeordneten ist dies ein "skyrocketing price" dessen "underlying causes" sie mit Hilfe der Firma bzw. Firmen untersuchen wollen. Dafür fordern sie "a list of your company's profits and expenses for Betaseron, including, but not limited to" 17 detailliert angeforderte Arten von Unterlagen zum Gewinn, Zuzahlungen der Patienten, Marketingausgaben, Forschungsausgaben, Steuern und alle weiteren Ausgaben und Kosten im Kontext des Medikaments. Desweiteren werden die Firmen um 5 weitere Dokumentenarten bis hin zu internen Memoranden, Patentkorrespondenz oder Rückerstattungen an Apotheken gebeten.
So akribisch diese Untersuchung angelegt und ist und wahrscheinlich auch zu Preissenkungen führen wird, so problematisch ist, dass damit der weitgehend unregulierte US-Markt zunächst weiterbestehen wird.
Wann deutsche Gesundheitspolitiker als Mitglieder des Bundestages bei ähnlichen Preissprüngen vergleichbare tiefgehende Untersuchungen ermöglichen und dann auch durchführen, bleibt abzuwarten - wahrscheinlich lange.
Der Brief des Congress oft he United States an Bayer Healthcare Pharmaceuticals kann wie die ähnlich argumentierenden Briefe an die anderen 6 Pharmafirmen (darunter Roche, Sanofi oder Novartis) kostenlos heruntergeladen werden.
Ob die Firmen pünktlich geantwortet haben, die Unterlagen vollständig waren und was damit geschieht, ist bisher nicht öffentlich erfahrbar. Wer will kann aber am Ball bleiben.
Bernard Braun, 17.9.17
Wirkungen von "choosing wisely"-Empfehlungen geringer als erwartet
 Zu den innerprofessionellen Konzepten die Qualität der Gesundheitsversorgung durch Empfehlungen notwendiger und nachgewiesen wirksamen und Warnungen vor nicht notwendigen und unnützen diagnostischen und therapeutischen Leistungen zu verbessern, gehört "choosing wisely". Die überwiegend durch medizinische Fachgesellschaften erstellten Entscheidungslisten sind zuerst in den USA mittlerweile aber unter dem Titel "klug entscheiden" auch in Deutschland verbreitet.
Zu den innerprofessionellen Konzepten die Qualität der Gesundheitsversorgung durch Empfehlungen notwendiger und nachgewiesen wirksamen und Warnungen vor nicht notwendigen und unnützen diagnostischen und therapeutischen Leistungen zu verbessern, gehört "choosing wisely". Die überwiegend durch medizinische Fachgesellschaften erstellten Entscheidungslisten sind zuerst in den USA mittlerweile aber unter dem Titel "klug entscheiden" auch in Deutschland verbreitet.
Ob "choosing wisely" sein Ziel erreicht und in welchem Umfang, ist bisher wenig untersucht worden. Umso interessanter sind die Ergebnisse einer Studie über die Entwicklung potenzieller "low value" d.h. nicht notwendiger bildgebenden Diagnostik (z.B. Röntgen, Computertomogramm) bei Rückenschmerzen. Für diese sehr häufigen Beschwerden liefert die entsprechende "choosing wisely"-Liste sehr präzise evidenzbasierte Empfehlungen, in der Mehrzahl der Fälle zunächst oder auf Dauer auf bildgebende Diagnostik zu verzichten.
Mit Daten eines privaten US-Krankenversicherungsunternehmens verglich nun eine Gruppe us-amerikanischer Versorgungsforscher die Häufigkeit dieser "low value"Diagnostik vor und zweieinhalb Jahre nach der Entwicklung und Veröffentlichung der Empfehlungen.
Mit wenigen regionalen Unterschieden nahm die Häufigkeit nur um 4% ab. Anders als erwartet, nahm die Häufigkeit auch in so genannten "consumer-directed health plans", wo Patienten in den Worten der Forscher ihre "skin in game" haben, nicht wesentlich mehr ab.
Ob es für die Wirkung mehr Zeit verlangt und die Diffusion auch dieser Art von Behandlungsempfehlungen zusätzlicher Qualifikations- und Beratungsbemühungen bedarf, sollt in weiteren Wirkungsanalysen genauer angesprochen und überprüft werden.
Die Studie Small Decline In Low-Value Back Imaging Associated With The 'Choosing Wisely' Campaign, 2012-14 von A.S. Hong et al. ist in der Aprilausgabe 2017 der Zeitschrift "Health Affairs" (vol. 36 no. 4 671-679) erschienen. Das Abstract ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 24.4.17
"Sugar shock": Das zehnjährige Ab und gewaltige Auf der Preise für orale Antidiabetika und Insulin in den USA
 Passend zum diesjährigen Weltgesundheitstag am 7. April 2016 und seinem Schwerpunktthema Diabetes liegen die Ergebnisse einer Analyse der Kostenentwicklung verschiedener Diabetes-Therapeutika bzw. blutzuckersenkenden Arzneimittel in den Jahren 2002 bis 2013 für die USA vor.
Passend zum diesjährigen Weltgesundheitstag am 7. April 2016 und seinem Schwerpunktthema Diabetes liegen die Ergebnisse einer Analyse der Kostenentwicklung verschiedener Diabetes-Therapeutika bzw. blutzuckersenkenden Arzneimittel in den Jahren 2002 bis 2013 für die USA vor.
Dazu werteten die ForscherInnen die Diagnose- und Behandlungsdatren von fast 28.000 Personen, die in diesem Zeitraum aufgrund einer Diabetesdiagnose behandelt worden sind.
Danach erhöhten sich die Kosten für Insulin innerhalb eines Jahrzehnts um gut das Dreifache von durchschnittlich 231 US-Dollar auf 736 US-Dollar pro Jahr. Die Kosten für einen Milliliter Insulin stiegen entsprechend von 4,34 US-Dollar auf 12,92 US-Dollar.
Interessant ist, dass im Untersuchungszeitraum der durchschnittliche jährliche Verbrauch von Insulin von 171 auf 206 Milliliter stieg - wahrscheinlich aufgrund des gestiegenen Gewichts der PatientInnen und neuer nationaler Empfehlungen für das Erreichen des Behandlungsziels.
Ganz anders sah die Preisentwicklung bei allen anderen oralen Antidiabetika aus: Die Ausgaben für sie sanken in konstanten Preisen von rund 600 US-Dollar auf 502 US-Dollar. Der Preis für das weit verbreitete und als Generika verfügbare Metformin sank von 1,24 US-Dollar pro Tablette auf gerade noch 31 Cent. Der stärkste Preisrückgang erfolgte bis 2011. Und selbst die neuen Medikamente, wie z.B. der DPP4-Inhibitoren, Gliptine oder Inkretinverstärker verteuerten sich ab ihrem Marktzugang 2006 bis 2013 "nur" um 34 %.
25% der untersuchten Personen wurden mit Insulin behandelt und zwei Drittel nahmen zusätzlich orale Mittel zur Blutzuckersenkung. Nur wenige Prozent begannen neuentwickelte injizierbare Arzneimittel zu nutzen.
Unbekannt war in dieser Studie welche Art von Insulin gespritzt wurde und ob die PatientInnen von den oralen Antidiabetika Original-Präparate oder Generika einnahmen.
Ob es eine solche unterschiedliche Entwicklung auch in Deutschland gab, ist nicht bekannt, könnte aber mit vorhandenen Daten für einen längeren Zeitraum untersucht werden. Ein erster Hinweis: 2011 betrugen die jährlichen Kosten für Insulin für Typ 2 Diabetiker 774 Euro, also sogar mehr als im selben Jahr in den USA.
Von dem am 5. April 2016 erschienenen Forschungsbrief Expenditures and Prices of Antihyperglycemic Medications in the United States: 2002-2013 von Xinyang Hua et al. - erschienen in der Fachzeitschrift "Journal of the American Medical Association" (315(13): 1400-1402) - ist ein Abstract kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 6.4.16
Commonwealth Fund-Newsletter: Wie kann die gesundheitliche Versorgung in den USA aber auch anderswo verbessert werden?!!
 Seit Oktober 2015 veröffentlicht der liberale Gesundheitspolitik-Think Tank "Commonwealth Fund" einen Newsletter, der sich programmatisch mit dem Themenbereich "Transforming Care: Reporting on Health System Improvement" beschäftigt. Die Zielsetzung fassen die Herausgeber so zusammen: Die Publikation "focuses on new models of care, payment approaches, and patient engagement strategies that have the potential to reshape our delivery system to better meet the needs of the nation's sickest and most vulnerable patients. Published quarterly, the newsletter is a source of innovative ideas for health system leaders, clinicians, and policymakers.
Seit Oktober 2015 veröffentlicht der liberale Gesundheitspolitik-Think Tank "Commonwealth Fund" einen Newsletter, der sich programmatisch mit dem Themenbereich "Transforming Care: Reporting on Health System Improvement" beschäftigt. Die Zielsetzung fassen die Herausgeber so zusammen: Die Publikation "focuses on new models of care, payment approaches, and patient engagement strategies that have the potential to reshape our delivery system to better meet the needs of the nation's sickest and most vulnerable patients. Published quarterly, the newsletter is a source of innovative ideas for health system leaders, clinicians, and policymakers.
Nach den Themen "Integrating Community Health Workers into Care Teams" (Dezember 2015) und "Paying Physicians for Value-Based Care" (Oktober 2015) beschäftigt sich die jüngste Ausgabe vom 24. März 2016 mit dem Thema "Redesigning Primary Care for Those Who Need It Most".
Dies wird in der letzten Ausgabe in drei Beiträgen bzw. Rubriken konkretisiert:
• Ein Beitrag zum Leitthema "Redesigning Primary Care for Those Who Need It Most",
• ein weiterer Beitrag zum Thema "Wiring New Models of Primary Care: The Role of Health Information Technology" und in der
• Rubrik "Publications of Note" wo eine Reihe von Aufsätzen aus verschiedenen gesundheitswissenschaftlichen und -politischen Zeitschriften vorgestellt und via Links zugänglich gemacht werden. In der aktuellen Ausgabe sind dies u.a. die Aufsätze "Using Behavioral Economics to Design Physician Incentives That Deliver High-Value Care" (Annals of Internal Medicine), "Implementation Science: A Potential Catalyst for Delivery System Reform" (Journal of the American Medical Association) und "Formerly Homeless People Had Lower Overall Health Care Expenditures After Moving into Supportive Housing" (Health Affairs).
Für alle, die am Gesundheitssystem der USA und seinen hierzulande oft kaum oder lediglich mit dem Schlagwort "Obamacare" nicht angemessen wahrgenommenen enormen Veränderungsprozessen interessiert sind, liefert der Newsletter wichtige Informationen. Ein Teil der dort vorgestellten Modelle und Konzepte zur Verbesserung der Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der gesundheitlichen Versorgung ist aber auch für die Debatten in Deutschland nützlich. Dies umso mehr als dass nicht selten tatsächlich oder angeblich jahrelang in den USA erprobte Modelle (z.B. DMP, shared decision making, DRG, choosing wisely) ohne genügend Kenntnis der dort dazu durchgeführten Analysen und Bewertungen importiert werden und dann nicht selten nicht die erwünschten Effekte haben.
Der aktuelle Newsletter Transforming Care: Reporting on Health System Improvement ist kostenlos erhältlich. Weitere Ausgaben können auf dieser Seite bestellt werden.
Bernard Braun, 26.3.16
USA: Zu viele Früherkennungsuntersuchungen trotz guter Leitlinien
 Die U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF), ein unabhängiges Expertengremium für Fragen der evidenzbasierten Prävention hat im Jahr 2009 bzw. 2012 überarbeitete Versionen ihrer Leitlinien für die Früherkennungsuntersuchungen auf Brustkrebs und Gebärmutterhalskrebs veröffentlicht. Darin wurde die aktuelle Evidenz zu Nutzen und Schaden berücksichtigt. Zu den Neuerungen zählen die Empfehlungen, das Mammographie-Screening mit 50 statt mit 40 Jahren zu beginnen und ein zweijährliches statt einem jährlichen Intervall einzuhalten.
Die U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF), ein unabhängiges Expertengremium für Fragen der evidenzbasierten Prävention hat im Jahr 2009 bzw. 2012 überarbeitete Versionen ihrer Leitlinien für die Früherkennungsuntersuchungen auf Brustkrebs und Gebärmutterhalskrebs veröffentlicht. Darin wurde die aktuelle Evidenz zu Nutzen und Schaden berücksichtigt. Zu den Neuerungen zählen die Empfehlungen, das Mammographie-Screening mit 50 statt mit 40 Jahren zu beginnen und ein zweijährliches statt einem jährlichen Intervall einzuhalten.
Die Früherkennung auf Gebärmutterhalskrebs soll nicht vor dem 21. Lebensjahr beginnen, unabhängig vom Sexualverhalten. Frauen im Alter von 21 bis 30 Jahren sollen zytologische Abstrichuntersuchungen in dreijährlichen Abständen angeboten werden und zusätzliche HPV-Testung alle 5 Jahre oder Weiterführung der 3-jährlichen Untersuchung bis zum 65. Lebensjahr.
Die überarbeiteten Empfehlungen sollen das Verhältnis von Nutzen und Schaden günstiger gestalten, insbesondere die Zahl falsch positiver Befunde und unnötiger Biopsien mindern.
Wie sich die Veränderungen in den Leitlinien auf die Haltung der Ärzte und ihre Vorgehensweisen ausgewirkt haben, ist das Thema einer kürzlich veröffentlichten Studie.
Per Internet und per Brief gaben im Jahr 2014 385 primärversorgende Ärzte aus 4 Ärztenetzwerken Auskunft über ihre Haltungen und Einschätzungen zu den Früherkennungsuntersuchungen sowie auf Veränderungen ihrer Praxis als Reaktion auf die veränderten Leitlinien.
Die Mehrzahl der Ärzte bezeichnete das Mammographie-Screening bei Frauen im Alter von 40 bis 75 Jahren und die Zell-Abstrichuntersuchung bei Frauen im Alter von 21 bis 64 Jahren als effektiv zur Senkung der Krebssterblichkeit. Die Leitlinien der USPSTF wurden zwar als einflussreich anerkannt. Trotzdem gaben beim Brustkrebs-Screening 75.7% und beim Gebärmutterhalskrebs-Screening 41.2 % an, mehr Untersuchungen zu empfehlen oder zu veranlassen als in den Leitlinien vorgesehen.
Bezüglich der Brustkrebsfrüherkennung empfehlen 40% eine regelmäßige Mammographie bei Frauen zwischen 40 und 49 Jahre, 32% eine jährliche und 8% eine zweijährliche Untersuchung; mehr als die Hälfte gibt an, die Optionen mit den Patientinnen zu besprechen. 50 bis 75-jährigen Frauen empfehlen knapp 2/3 der Ärzte die jährliche und nur 8% die zweijährliche Mammographie; 13 % besprechen die Optionen.
Ein nennenswerter Anteil von Ärzten empfiehlt die Mammographie auch 30 bis 39-jährigen Frauen (3,2% jährlich, 0,8% zweijährlich) und Frauen von 75 oder mehr Jahren (16% jährlich, 8,7% zweijährlich).
Bei der Gebärmutterhalskrebs-Früherkennung empfehlen 21% der Ärzte die Abstrichuntersuchung sexuell aktiven Frauen unter 21 Jahren. 22% empfehlen die Untersuchung für Frauen im Alter 29 Jahren in jährlichen statt dreijährlichen Intervallen.
Als Gründe gaben für das Abweichen von den Empfehlungen der USPSTF geben Ärzte an: Bedenken der Patienten bezüglich der Leitlinien, anderer Meinung zu sein, als die Leitlinien, Qualitätsmaße, die nicht mit den Leitlinien-Empfehlungen übereinstimmen, Befürchtung von Kunstfehler-Prozessen und unzureichende Zeit für das Gespräch mit den Patientinnen.
US-amerikanische primärversorgende Ärzte halten sich somit nicht durchgehend an die Empfehlungen der nationalen Früherkennungs-Leitlinien, veranlassen Früherkennungsuntersuchungen, die mehr Schaden als Nutzen erbringen und tragen zur Überversorgung bei.
Haas JS, Sprague BL, Klabunde CN, et al. Provider Attitudes and Screening Practices Following Changes in Breast and Cervical Cancer Screening Guidelines. J Gen Intern Med 2015 Abstract
David Klemperer, 19.8.15
Zur Empirie von Gesundheitssystem-Mythen am Beispiel Medicare und Medicaid
 Vorurteile oder Mythen über die Leistungen fremder ausländischer Krankenversicherungs- und Gesundheitsversorgungssysteme bestimmen zahlreiche gesundheitspolitische Diskurse. Während konservative Politiker in den USA das deutsche Gesundheitswesen für den Hort von "socialized medicine" halten, wird das britische Gesundheitswesen bzw. der "National Health Service" in Deutschland häufig mit dem Stichwort "englische Verhältnisse" klassifiziert und ihm jede Menge unerwünschter Outcomes zugesprochen.
Vorurteile oder Mythen über die Leistungen fremder ausländischer Krankenversicherungs- und Gesundheitsversorgungssysteme bestimmen zahlreiche gesundheitspolitische Diskurse. Während konservative Politiker in den USA das deutsche Gesundheitswesen für den Hort von "socialized medicine" halten, wird das britische Gesundheitswesen bzw. der "National Health Service" in Deutschland häufig mit dem Stichwort "englische Verhältnisse" klassifiziert und ihm jede Menge unerwünschter Outcomes zugesprochen.
Sowohl im Ausland als auch in den USA selber werden die beiden staatlichen und steuerfinanzierten Krankenversicherungssysteme Medicaid und Medicare im Vergleich mit den privaten Krankenversicherungen oft als dysfunktional und qualitativ schlecht hingestellt - Notbehelfe für RentnerInnen und Arme eben.
Dass diese Bewertungen einer empirischen Überprüfung nicht standhalten und hinter der Kritik nicht die Sorge um die Gesundheit der beiden Versichertengruppen steht, sondern die argumentative Aufbereitung für die Expansionsgelüste der privaten Versicherungen, zeigen jetzt zwei Studien.
Das Ziel der Studien waren empirisch gestützte Antworten auf zwei Kritikpunkte bzw. Urteile:
• Illegale bzw. EinwanderInnen ohne aktuell gültige US-Ausweispapiere ("undocumented immigrants" ) nach Schätzungen des "Department of Homeland Security (DHS)" waren dies 2011 rund 11,5 Millionen Personen), die sich über Medicare für den Fall einer stationären Behandlung krankenversichern können (Medicare Hospital Insurance Trust Fund), würden diesen Schutz missbräuchlich ausnutzen, also mehr versuchen "herauszuholen" als sie einbezahlt haben.
• Wer über Medicaid krankenversichert ist, erhielte eine schlechte Versorgungsqualität.
Eine Gruppe von Wissenschaftlern der Harvard Medical School beschäftigte sich mit der ersten Behauptung und stellte fest, dass die Wirklichkeit zwischen den Jahren 2000 und 2011 diametral anders aussah: Insgesamt zahlte diese Versichertengruppe jährlich zwischen 2.2 und 3.8 US-Dollar Milliarden mehr als ihre Versorgung kostete. Der "Überschuss" betrug pro Kopf und Jahr 316 US-Dollar ein Betrag, der in der restlichen US-Bevölkerung "nur" 106 US-Dollar groß war.
Ob die zweite Behauptung zutreffend ist, wurde in einem Report des "Commonwealth Fund" mit Daten des bevölkerungsrepräsentativen "Commonwealth Fund Biennial Health Insurance Survey" aus dem Jahr 2014 untersucht.
Die vier wichtigsten Ergebnisse lauteten:
• 95% der 19- bis 64-jährigen ganzjährig versicherten Medicaid-Patienten wurden durchweg versorgt, 53% erhielten im Bedarfsfall am selben Tag oder spätestens am Folgetag einen Arzt- oder Pflegetermin und 55% sagten, die Qualität ihrer Behandlung sei exzellent oder sehr gut gewesen.
• Bei sämtlichen dieser Versorgungsindikatoren gab es kaum Unterschiede zu den privat Krankenversicherten. Die Anteile betrugen 94%, 58% und 58%.
• Nur gegenüber den nicht Krankenversicherten gab es gravierende und auch statistisch signifikante Unterschiede. Von denen hatten 77% eine durchgehende Versorgungen, sagten 40%, ihre Versorgung wäre exzellent oder sehr gut und erhielten 43% rasch einen Behandlungstermin.
• Wenn es um Probleme beim Zahlen von Arztrechnungen etc. ging, hatten schließlich die Medicaid-Versicherten sogar sowohl deutlich weniger Probleme als die privat und nicht Krankenversicherten: Die Anteile der jeweiligen Personen betrugen 10%, 21% und 35%.
Auch bei einer Reihe weiterer Indikatoren für die Behandlungsqualität ergab sich kein grundlegend anderes Bild.
Zum Hintergrund der Mythen ist wichtig zu wissen, dass sie bei der Weigerung von bis zu 20 Bundesstaaten eine Rolle spielen, Medicare und Medicaid im Verbund mit dem Affordable Care Act/Obamacare auszubauen.
Die Studie Unauthorized Immigrants Prolong the Life of Medicare's Trust Fund von Leah Zallman et al. erschien am 18. Juni 20915 in der Zeitschrift "Journal of General Internal Medicine". Ein Abstract ist kostenlos erhältlich.
Die Studie Does Medicaid make a difference? Findings from The Commonwealth Fund Biennial Health Insurance Survey 2014 von Blumenthal D, et al. erschien als Publikation des Commonwealth Fund im Juni 2015 und ist komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 2.7.15
Das Neueste aus dem Reich der "Gesundheits"wirtschaft: Reine Muttermilch mit einem kräftigen Schuss Kuhmilch.
 Auch wer die lange Liste der vorsätzlich oder fahrlässig bestenfalls unschädlichen (z.B. zahlreiche Vitaminpräparate oder Nahrungsergänzungsmittel) oder auch gesundheitsgefährdenden (z.B. Silikonimplantate für die weibliche Brust) Produkte der Gesundheitswirtschaft zu kennen glaubt, merkt in regelmäßigen Abständen, dass die schlimmsten Befürchtungen im Zeichen hemmungsloser Gewinnsucht noch getopt werden können.
Auch wer die lange Liste der vorsätzlich oder fahrlässig bestenfalls unschädlichen (z.B. zahlreiche Vitaminpräparate oder Nahrungsergänzungsmittel) oder auch gesundheitsgefährdenden (z.B. Silikonimplantate für die weibliche Brust) Produkte der Gesundheitswirtschaft zu kennen glaubt, merkt in regelmäßigen Abständen, dass die schlimmsten Befürchtungen im Zeichen hemmungsloser Gewinnsucht noch getopt werden können.
Für das neueste Beispiel muss man zuerst einmal auf den Gedanken kommen, es gäbe hier überhaupt etwas aufzudecken. Es geht um die Güte von über Internetanbieter erhältlichen Muttermilchkonserven. Eltern, die für ihr Kind Muttermilch kaufen wollen, machen dies, weil die Mutter ihr Kind nicht selber stillen kann oder will, weil sie ihrem Kind alle nachgewiesenen Vorteile der Muttermilch zugutekommen lassen wollen und/oder weil - und hier endet die reine Geldmacherei mit teurer "Muttermilch" - ihr Kind gegen Kuhmilch allergisch ist oder sie nicht verträgt. Trotz einiger Warnungen der US Food and Drug Administration (FDA) vor nicht eindeutig überwachten "SpenderInnen" und Anbietern nahm die Anzahl der auf entsprechenden Websites plazierten Angebote von Muttermilch ständig auf aktuell mindestens 13.000 pro Jahr zu.
Eine Gruppe von us-amerikanischen Kinderernährungsexperten und Biologen beschloss nun, stichprobenartig und anonym zu überprüfen, ob die Qualitätsversprechen der Wirklichkeit entsprechen. Sie bestellten dafür 102 der als Muttermilch angepriesenen Produkte.
Das Ergebnis einer aufwändigen zweistufigen Inhaltsanalyse lautete:
• 11 der Produkte (11%) enthielten eindeutig nicht nur menschliche, sondern auch Kuhmilch.
• Zehn dieser 11 Produkte enthielten mindestens 10% flüssige Kuhmilch, was den häufig im Nahrungsmittelgeschäft benutzten Hinweis unglaubwürdig macht, das Produkt enthielte lediglich "Spuren", die "rein zufällig" in es gekommen sind. Hier wurde also mit voller Absicht gemixt und damit die genannten gesundheitlichen Risiken billigend in Kauf genommen.
Auch hier erweist sich also die Hoffnung auf Skrupel, Selbstkontrolle oder "social responsibility" der Hersteller solcher "Gesundheits"produkte als problematisch und könnten sich wesentlich härtere Kontrollen durch unabhängige öffentliche Einrichtungen und entsprechende Strafen bei so eindeutig schädigendem Verhalten als die einzig wirksame Alternative erweisen.
Dies gilt leider auch für den Appell der WissenschaftlerInnen, Eltern und Kinderärzte sollten sich trotz ihrer relativen Ohnmacht dieser Risiken bewusst sein: "Because buyers have little means to verify the composition of the milk they receive, all should be aware of the possibility that it may be adulterated. Pediatricians who care for infants should be aware that milk advertised as human is available via the internet, and some of it may not be 100% human milk."
Der Aufsatz Cow's Milk Contamination of Human Milk Purchased via the Internet von Sarah A. Keim et al. ist kostenlos online erschienen und wird gedruckt am 5. Mai 2015 in der Fachzeitschrift "Pediatrics" (Volume 135) erscheinen.
Bernard Braun, 6.4.15
Geburten nach Fahrplan: 8,9% aller Geburten in den USA sind elektive (Zu-)Frühgeburten
 Wer dachte, dass die seit Jahren in Deutschland und vergleichbaren Ländern herrschende Rate von Kaiserschnitten zum errechneten Geburtszeitpunkt (die WHO hält eine Rate von 10% bis 15% für notwendig), die einzig gesundheitlich problematische Variante der Geburt ist, täuscht sich nach den Ergebnissen einer gerade veröffentlichten Studie aus den USA möglicherweise erheblich.
Wer dachte, dass die seit Jahren in Deutschland und vergleichbaren Ländern herrschende Rate von Kaiserschnitten zum errechneten Geburtszeitpunkt (die WHO hält eine Rate von 10% bis 15% für notwendig), die einzig gesundheitlich problematische Variante der Geburt ist, täuscht sich nach den Ergebnissen einer gerade veröffentlichten Studie aus den USA möglicherweise erheblich.
Eine ForscherInnengruppe untersuchte in 22 dazu bereiten US-Bundesstaaten retrospektiv die dort im Versicherungsbereich der staatlichen Versicherung Medicaid (Medicaid bezahlt bis zu 48% der jährlichen Geburten in den USA), also der Versicherung für eher ärmere US-BürgerInnen, in den Jahren 2010 bis 2012 stattgefundenen 839.688 Einlings-Geburten. Sie schaute dabei genauer auf die Art und den Zeitpunkt der Geburten.
Dabei machten die ForscherInnen eine Reihe unerwünschter Beobachtungen:
• 8,9% dieser Geburten (75.131) waren elektive (Zu-)Frühgeburten ("early elective deliveries"). Dabei handelt es sich um Geburten, bei denen ohne medizinische Notwendigkeit bei Mutter und Kind die vaginale Geburt eingeleitet wurde oder per Kaiserschnitt erfolgte - bei ungeborenen Kindern mit weniger als 39 bestätigten Schwangerschaftswochen. Normal sind durchschnittlich 40 oder 41 Schwangerschaftswochen.
• Zu früh ohne gesundheitliche Not eingeleitete Geburten führen oft zu schlechten Zuständen bei Mutter und Kind und verursachen auch zusätzliche Kosten bei Patientinnen, Kliniken und Krankenversicherungen.
• Die AutorInnen schätzen auf der Basis ihrer Studie, dass es USA-weit jährlich zu rund 160.000 derartiger Geburten kommt.
• Dass es auch anders geht, zeigt die Abnahme dieser Geburtsart in 12 der 22 Bundesstaaten und zwischen 2007 und 2011 um 32%.
Der Aufsatz Early Elective Deliveries Accounted For Nearly 9 Percent Of Births Paid For By Medicaid von Tara Trudnak Fowler et al. erschien in der Dezemberausgabe 2014 der Zeitschrift "Health Affairs" (vol. 33 no. 12 2170-2178). Ein Abstract ist kostenlos erhältlich.
Wer sich noch intensiver mit der im Moment enorm interessanten Entwicklung des Gesundheitswesens in den USA beschäftigen will, und entsprechende hochwertige Studien sucht, dem sei erneut der Hinweis auf das sogar halbwegs erschwingliche Abonnement dieser Zeitschrift für Privatnutzer gegeben (mit oder ohne Onlinezugang).
Bernard Braun, 9.12.14
"Beds create their own demand" oder die Realität von Nachfrageelastizität am Beispiel von Intensivstationsbetten in den USA
 Im Gesundheitswesen spielt die anbieter- oder angebotsinduzierte Nachfrage eine gewichtige Rolle bei der Art und Inanspruchnahme angebotener Leistungen. Dabei spielen Informations-Asymmetrien zwischen Ärzten und Patienten aber auch die schlichte Existenz bestimmter Versorgungsangebote praktisch relevante Rollen.
Im Gesundheitswesen spielt die anbieter- oder angebotsinduzierte Nachfrage eine gewichtige Rolle bei der Art und Inanspruchnahme angebotener Leistungen. Dabei spielen Informations-Asymmetrien zwischen Ärzten und Patienten aber auch die schlichte Existenz bestimmter Versorgungsangebote praktisch relevante Rollen.
Das kostenträchtige und für die Versorgungsqualität relevante Beispiel der Inanspruchnahme der in den USA weltweit größten Menge von Intensivbetten (intensive care unit [ICU]) wurde am 9. Januar 2014 in der Fachzeitschrift "Journal of the American Medical Association" etwas ausführlicher vorgestellt. In den USA gibt es 25 Intensivstationsbetten pro 100.000 Personen auf deren Nutzung rund 3% der us-amerikanischen Gesundheitsausgaben und fast 1% des Bruttoinlandsprodukts entfallen. Ihre Anzahl wuchs zwischen 2000 und 2005 um 7%. Großbritannien kommt mit 5 solcher Betten pro 100.000 Personen aus, ohne dass sich dies erkennbar negativ auf die Behandlungsergebnisse oder die Lebenserwartung auswirkt. Auf dieser Basis gibt es zwei deutlich unterschiedliche Effekte: Zum einen unterscheidet sich der Schweregrad oder case-mix der behandelten Patienten in den beiden Ländern so, dass die Mehrheit der ICU-Patienten in Großbritannien schwerstkrank ist oder ein hohes Sterberisiko hat, während in den USA zahlreiche ICU-Patienten dort "nur" zur Beobachtung sind. Zum anderen sterben aber in den us-amerikanischen ICU's wesentlich mehr Patienten als in den britischen.
Mit ihrem dazu vor allem vorgetragenen Erklärungsversuch, "increased bed availability appears to reduce the incentive to keep dying patients out oft the ICU", fokussieren die AutorInnen auf die vielfältige Rolle und Wirkung des Umfangs von Behandlungsangeboten bzw. -ressourcen wie z.B. von Krankenhausbetten auf die Nachfrage und deren Elastizität. Das Angebot von Intensivstationsbetten führt dann sowohl dazu, dass Patienten dort eingewiesen werden, die eigentlich gar keinen intensivmedizinischen Behandlungsbedarf haben, als auch solche Patienten, bei denen es unwahrscheinlich ist, dass ihnen eine intensivmedizinische Behandlung hilft bzw. ihr Sterblichkeitsrisiko beeinflusst.
Im Rest des kurzen Artikels wägen die AutorInnen die gesundheitspolitische und -ökonomische Relevanz eines Abbaus von ICU-Betten ab und schlagen weitere Forschung über die ökonomisch wie gesundheitlich unerwünschten oder sinnlos-belastenden Auswirkungen dieser Art von Nachfrageelastizität vor.
Der kurze Artikel ("viewpoint") ICU Bed Supply, Utilization, and Health Care Spending. An Example of Demand Elasticity von Rebecca A. Gooch und Jeremy M. Kahn ist am 9.1. 2014 online first in "Journal of the American Medical Association" erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 9.1.14
Amerikanische Studie: Ärzte verschweigen Patienten essentielle Informationen für weitreichende Entscheidungen
 In einer amerikanischen Studie wurde der Frage nachgegangen, inwieweit die Patient vor eine Operation wegen Prostatakrebs bzw. vor dem Einsetzen einer Gefäßprothese (Stent) über das Pro und Kontra sowie über die alternativ zur Verfügung stehenden Behandlungsmöglichkeiten informiert und sie nach ihren Präferenzen befragt wurden.
In einer amerikanischen Studie wurde der Frage nachgegangen, inwieweit die Patient vor eine Operation wegen Prostatakrebs bzw. vor dem Einsetzen einer Gefäßprothese (Stent) über das Pro und Kontra sowie über die alternativ zur Verfügung stehenden Behandlungsmöglichkeiten informiert und sie nach ihren Präferenzen befragt wurden.
Bei den Eingriffen handelt es sich um "präferenzsensitive" Maßnahmen. Damit werden medizinische Interventionen bezeichnet, bei denen kein eindeutiges Überwiegen des Nutzens im Vergleich zum Schaden besteht. Die Entscheidung erfordert daher, dass sich der Patienten im Rahmen eines Abwägungsprozesses darüber klar wird, ob die Argumente für oder gegen die Maßnahme schwerer wiegen - welche der Optionen also seiner Präferenz entspricht.
Die operative Entfernung der Prostata verspricht im Vergleich zur Bestrahlung oder zum Abwarten eine leichte Verbesserung der Lebenserwartung bei allerdings hoher Wahrscheinlichkeit schwerer unerwünschter Wirkungen, wie Impotenz und Inkontinenz.
Das Einsetzen eines Stents verringert die Mortalität in den ersten 24 Stunden des Herzinfarkts, danach können durch den Eingriff Beschwerden gelindert aber nicht die Lebenserwartung verbessert oder das Risiko für einen erneuten Infarkt gemindert werden. Dies lässt sich jedoch durch eine medikamentöse Therapie erreichen. Prostataoperation und Stentimplantation haben also Auswirkungen auf die Lebensqualität, dagegen kaum oder gar nicht auf die Lebensdauer.
Teilnehmer der Studie waren 472 Patienten, die im Alter von mindestens 66 Jahren im 2. Halbjahr 2008 eine Prostataoperation oder eine Stentimplantation erhalten haben und über Medicare Part A und B krankenversichert waren.
Die Ergebnisse für Patienten mit Prostatakrebs, die eine Operation erhielten, lauten: 95% berichten, dass der Arzt die Gründe für die Operation besprochen habe, jedoch nur 63%, dass er mit ihnen über die Argumente gegen eine Operation gesprochen habe. Das Gespräch über die anderen Behandlungsmethoden (beobachtendes Abwarten bzw. Bestrahlung) gaben 34% an. Nach ihrer Präferenz wurden 76% gefragt.
Die Ergebnisse für die Patienten, die einen Stent eingesetzt bekamen lauten: 77% berichteten, dass der Arzt mit ihnen über die Gründe für den Eingriff, aber nur 16%, dass er über die Gründe gegen den Eingriff gesprochen habe. Nur 10% erhielten Informationen über andere Vorgehensweisen, wie beobachtendes Abwarten oder Bypass-Operation und nur 16% wurden nach ihrer Präferenz gefragt. 54% hatten im vorangegangenen Monat keine Herzbeschwerden gehabt
Die Studie belegt, dass die Informationen, die Patienten zu einer präferenzsensitiven Maßnahme erhielten, unzureichend waren. Die Ergebnisse für die Patienten mit Prostataoperation sind dabei weniger ungünstig aber immer noch schlecht, weil nicht 34% sondern 100% die Information erhalten sollten, dass sie nicht viel verpassen, wenn sie die Operation nicht erhalten. Die Information der Patienten mit Stent kann hingegen nur als desaströs bezeichnet werden. Am meisten erschüttert, dass bei 54% keine Indikation für den Eingriff vorlag, weil sie frei von Herzbeschwerden waren.
Die Autoren fordern die Verlagerung der Entscheidung zu den Hausärzten, die eher zu einer ausgewogenen Informationen in der Lage seien und den vermehrten Einsatz von Entscheidungshilfen, also evidenzbasierten Informationen zur Unterstützung der Entscheidung.
Fowler, F., Jr.; Gallagher, P.; Bynum, J. W.; Barry, M.; Lucas, F. L.; Skinner, J. (2012): Decision-Making Process Reported by Medicare Patients Who Had Coronary Artery Stenting or Surgery for Prostate Cancer. In: Journal of General Internal Medicine 27/8: 911-916. doi: 10.1007/s11606-012-2009-5 Abstract Open Access
David Klemperer, 5.12.13
USA: Interregionale Unterschiede beim Zuviel und Zuwenig von Arzneiverordnungen mit der Kumulation nachteiliger Verordnungsmuster
 Die Altmeister der "small area variation"-Forschung vom Dartmouth Atlas Projekt der gleichnamigen US-Universität veröffentlichen immer noch regelmäßig Reports, welche die regionale Ungleichverteilung wichtiger Gesundheitsleistungen insbesondere unter den Versicherten der staatlichen Krankenversicherung Medicare für Rentner und bestimmte arme Personen. Diese Forschungsarbeiten wirkten weltweit ansteckend und ihre Kernhypothese und Methodik liegen mittlerweile in Deutschland z.B. den Arbeiten in der von der Bertelsmann Stiftung gegründeten und gesponsorten Berichtsreihe "Faktencheck" zugrunde.
Die Altmeister der "small area variation"-Forschung vom Dartmouth Atlas Projekt der gleichnamigen US-Universität veröffentlichen immer noch regelmäßig Reports, welche die regionale Ungleichverteilung wichtiger Gesundheitsleistungen insbesondere unter den Versicherten der staatlichen Krankenversicherung Medicare für Rentner und bestimmte arme Personen. Diese Forschungsarbeiten wirkten weltweit ansteckend und ihre Kernhypothese und Methodik liegen mittlerweile in Deutschland z.B. den Arbeiten in der von der Bertelsmann Stiftung gegründeten und gesponsorten Berichtsreihe "Faktencheck" zugrunde.
Der aktuellste, am 15. Oktober 2013 veröffentlichte Report des Dartmouth Atlas Project untersucht die regionalen Variationen der Verordnung von Arzneimitteln. Der Report stellt zum ersten fest, dass viele Medicare-Versicherte Medikamente, die bei ihrer Behandlung wirksam wären, nicht erhalten und gleichzeitig eine andere Gruppe von Versicherten Arzneimittel verordnet bekommen, die bekannterweise hohe Nebenwirkungsrisiken haben und nicht notwendigerweise wirksam sind. Zum zweiten stellt der Report fest, dass beide Verordnungsmuster je nach Region sehr unterschiedlich sind und dabei auch Konstellationen bzw. Risikokumulationen von zu geringer Verordnung wirksamer Arzneimittel und zu häufiger Verordnung von riskanten Arzneimitteln auftreten.
Die Spannbreiten bei Medikamenten, die sehr spezifisch eingesetzt werden sollten und für deren Zweck es auch Alternativen gibt, zeigt sich bei Protonenpumpenhemmern, die u.a. bei nicht selten schmerzmittelbedingtem Sodbrennen und Geschwüren im Verdauungstrakt angezeigt sind. Der Prozentsatz der Patienten, denen diese Arzneimittel verordnet wurden schwankte zwischen 15,8% in Grand Junction, Colorado und 45,5% in Miami.
Die tatsächlichen Gründe für diese Unterschiede sind den ForscherInnen unbekannt. Es handle sich um "the million dollar question". Sie schließen nach ihrer Analyse allerdings einen bestimmenden Einfluss von unterschiedlichen Einkommen und unterschiedlichen Gesundheitzuständen aus. Obwohl die Mehrheit der Verordnungen ambulant erfolgt, weisen sie für das Krankenhaus auf die Bedeutung einer guten Vorbereitung auf die nachstationäre Verordnung von Medikamenten und deren Einnahme im Rahmen des Entlassungsmanagements hin. Beispielsweise ende die Therapietreue von stationär behandelten Herz-/Kreislaufpatienten bei der Einnahme von gesundheitlich notwendigen Betablockern häufig ohne gezielte Vorbereitung und Aufklärung bereits sechs Monate nach der Entlassung, obwohl bis zu drei Jahre für die erwünschte Wirkung notwendig wären.
Die Studie schließt mit einer knappen Darstellung der Bedeutung ihrer Ergebnisse für die Gesundheitspolitik. Dabei betonen die in solchen Analysen ja bereits seit Jahren erfahrenen ForscherInnen, der kritische Blick sollte nicht nur auf die mangelhaften Zustände in vielen Regionen, sondern auch auf die positiven Regionen gerichtet werden. Es ginge vielleicht sogar vorrangig darum "successful regions that provide effective care efficiently" genauer zu betrachten und dabei "determine what factors lead to this success, and disseminate these systems more broadly."
Der Report The Dartmouth Atlas of Medicare Prescription Drug Use von Jeffrey C. Munson, David C. Goodman, Luca F. Valle und John E. Wennberg ist 59 Seiten lang, enthält interessante Grafiken und Verteilungsdarstellungen und komplett kostenlos erhältlich.
Das jüngste Beispiel der deutschen Variante der "small area variation"-Berichterstattung ist der im Oktober 2013 erschienene Faktencheck Gesundheit: Knieoperationen (Endoprothetik) - Regionale Unterschiede und ihre Einflussfaktoren Zusammenfassung einer Studie der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und orthopädische Chirurgie (DGOOC) im Auftrag der Bertelsmann Stiftung, basierend auf Daten der AOK von Chr. Lühring et al.
Zwei herausragende und gesundheitspolitisch brisante Ergebnisse lauten:
• "Bei Kniegelenkersatz-Operationen, Folgeoperationen und Arthroskopien gibt es z. T. erhebliche regionale Unterschiede: Auf der Ebene der Bundesländer unterscheidet sich die Rate der Kniegelenkersatz-Operationen um das 1,8-Fache, auf der Ebene der Kreise um das Dreifache, bezogen nur auf Männer sogar um das Vierfache. Bei der Häufigkeit von Folgeoperationen gibt es Unterschiede bis zum Fünffachen, bei Arthroskopien bis zum 65-Fachen.
• Patienten im Südosten Deutschlands erhalten im Verhältnis fast doppelt so häufig ein neues Kniegelenk wie Patienten im Nordosten."
Was diese gleichzeitige Über- und Unterversorgung innerhalb weniger hundert Kilometer bewirkt und was daran verändert werden kann, wissen aber auch die deutschen ExpertInnen nicht.
Bernard Braun, 23.10.13
Das auch noch wachsende Leid mit den Leitlinien am Beispiel der ambulanten Behandlung von Patienten mit Rückenschmerzen
 Rückenschmerzen gehören weltweit zu den häufigsten Anlässen für einen ambulanten Arztbesuch. Sie sind auch eine Hauptursache für Arbeitsunfähigkeit, die Verschreibung von schmerzstillenden Mitteln oder Massagen, verschiedene Operationen im Bereich des Rückens und auch von Frühberentung. Wegen dieser gesundheitlichen und ökonomischen Folgen gibt es auch bereits seit vielen Jahren zahlreiche, oft evidenzbasierte Leitlinien für eine wirksame, möglichst schädigungsfreie und wirtschaftliche Behandlung von Rückenschmerz-Patienten.
Rückenschmerzen gehören weltweit zu den häufigsten Anlässen für einen ambulanten Arztbesuch. Sie sind auch eine Hauptursache für Arbeitsunfähigkeit, die Verschreibung von schmerzstillenden Mitteln oder Massagen, verschiedene Operationen im Bereich des Rückens und auch von Frühberentung. Wegen dieser gesundheitlichen und ökonomischen Folgen gibt es auch bereits seit vielen Jahren zahlreiche, oft evidenzbasierte Leitlinien für eine wirksame, möglichst schädigungsfreie und wirtschaftliche Behandlung von Rückenschmerz-Patienten.
Ob diese Leitlinien aber die Behandlungskonzepte und -methoden für diese Patientengruppe bestimmen glaubten us-amerikanische Gesundheitswissenschaftler nicht einfach, sondern untersuchten dies mit Daten der bundesweit repräsentativen "National Ambulatory Medical Care Survey" und des "National Hospital Ambulatory Medical Care Survey" aus den Jahren 1999/2000 und 2009/10. Die im Detail untersuchten 23.918 Arztbesuche mit einem Wirbelsäulenproblem repräsentieren geschätzte 440 Millionen Besuche mit schmerzhaften Rückenproblemen.
Die wesentlichen Ergebnisse der beiden Querschnittsuntersuchungen und ihres Vergleichs lauten:
• Während die Geschlechterzusammensetzung in der Untersuchungszeit mit 58% weiblichen Patienten gleich blieb, stieg das Durchschnittsalter signifikant von 49 auf 53 Jahre.
• Die Häufigkeit mit der je Arztbesuch nichtsteroidale entzündungshemmende Medikamente oder das schmerzstillende Acetaminophen verordnet wurden, eine von Leitlinien empfohlene Therapie, sank signifikant von 36,9% auf 24,5%.
• Im Gegensatz dazu stieg die Häufigkeit mit der narkotisierende Medikamente verordnet wurden, wovon Leitlinien abraten, signifikant von 19,3% auf 29,1% an.
• Die Häufigkeit der Überweisung in eine physikalische Therapie - von Leitlinien empfohlen - blieb mit knapp 20% gleich, die zu anderen Ärzten - von Leitlinien nicht empfohlen oder toleriert - stieg ebenfalls signifikant von 6.8% auf 14%.
• Bei den bildgebenden Verfahren - Indikatoren für die Nichtübereinstimmung mit Leitlinien - stagnierte die Häufigkeit von Röntgenaufnahmen bei rund 17%, während die Anzahl der Computer-Tomogramme und Magnetresonanz-Aufnahmen signifikant von 7,2% auf 11,3% stieg.
Sämtliche Trends zeigten sich auch nach einer Unterscheidung von Kurz- und Langzeitbehandlung und Besuchen bei Allgemein- und anderen Fachärzten sowie nach einer Adjustierung nach Alter, Geschlecht, Ethnie, Dauer der Symptome, Region und weiteren Merkmalen.
Trotz zahlreicher publizierter Behandlungsleitlinien nahm die Nichtorientierung an ihnen beim Management und der Behandlung von Rückenschmer-Patienten in rund 10 Jahren zu - trotz der potenziellen Kostenersparnisse und der besseren Behandlungsqualität bei der Orientierung an den Leitlinien.
Ein Kommentator des Aufsatzes fügt der Analyse das Ergebnis einer eigenen Recherche von 183 spezifischen Rückenschmerz-Leitlinien hinzu und erwähnt die von Gesundheitspolitikexperten in den USA geäußerte Frist von durchschnittlich 17 Jahren, die eine Leitlinie oder Erkenntnisse aus randomisierten kontrollierten Studien brauchen, um vollständig im Behandlungsalltag angekommen zu sein. Als wesentliche Gründe nennt der Kommentator fehlendes Wissen, und eine Fülle von leitlinien-adversen Einstellungen und Verhaltensweisen von Ärzten.
Unter seinen Vorschlägen, diesen Zustand zu verbessern, bewertet er als die größte Herausforderung "the vast multitude of individual professional, govermental, payer, employer, and consumer groups that promote self-proclaimed intellectual property-based ownership of interventions … that guarantee the best outcomes for back pain but without formal and rigorous quality of evidence evaluations, such as through systematic reviews." Sein Vorschlag all diese Anbieter mögen sich zusammensetzen und eine gemeinsame Basis für Empfehlungen schaffen, ist sicherlich sinnvoll, vernachlässigt aber, dass viele dieser Anbieter genau an solchen ergebnisoffenen Verständigungsprozessen vor allem aus ökonomischen Gründen kein Interesse haben. Richtig ist schließlich sein bereits in der Überschrift angedeutete Hinweis, das an der Nichtorientierung an Leitlinien auch entsprechende Erwartungen oder Forderungen von Patienten z.B. an bildgebenden Untersuchungen beteiligt sind.
Der Aufsatz Worsening Trends in the Management and Treatment of Back Pain von John N. Mafi et al. ist im September 2013 in der Fachzeitschrift "JAMA Internal Medicine" (173(17): 1573-1581) erschienen. Das Abstract ist kostenlos erhältlich.
Der Kommentar Why don't phycisians (and patients) consistently follow clinical practice guidelines? von Donald Casey ist in derselben Ausgabe der Zeitschrift (S. 1581-1583) erschienen - Abstract kostenlos.
Bernard Braun, 15.10.13
USA: Über 80% aller Antibiotika-Verordnungen bei Halsentzündungen sind nicht notwendig und zu viele Breitband-Antibiotika
 Um verstehen zu können warum Antibiotika bei vielen Krankheiten nicht helfen aber trotzdem durch Resistenzbildungen schädliche Auswirkungen haben können und man bei bestimmten Erkrankungen lieber Penicillin statt Breitband-Antibiotika verordnet und einnimmt, braucht man keine komplexen Risikoraten rechnen oder Dreisatzaufgaben bewältigen. Es reichen regelmäßige Blicke in die medizinische und pharmakologische Fachliteratur, gute Tageszeitungen oder TV-Magazine in denen seit Jahren vor der herrschenden Verordnungs- und Behandlungspraxis bei Antibiotika mit immer drastischeren Eckzahlen gewarnt wird.
Um verstehen zu können warum Antibiotika bei vielen Krankheiten nicht helfen aber trotzdem durch Resistenzbildungen schädliche Auswirkungen haben können und man bei bestimmten Erkrankungen lieber Penicillin statt Breitband-Antibiotika verordnet und einnimmt, braucht man keine komplexen Risikoraten rechnen oder Dreisatzaufgaben bewältigen. Es reichen regelmäßige Blicke in die medizinische und pharmakologische Fachliteratur, gute Tageszeitungen oder TV-Magazine in denen seit Jahren vor der herrschenden Verordnungs- und Behandlungspraxis bei Antibiotika mit immer drastischeren Eckzahlen gewarnt wird.
Trotzdem scheinen diese Informationen und Szenarien nicht bei verordneten Ärzten und ihren PatientInnen anzukommen - in den USA. Dies ist jedenfalls das Ergebnis einer Analyse der Verordnung von Antibiotika bei banalen Halsentzündungen ("sore throat") in den Jahren 1997 bis 2010, über die am 3. Oktober 2013 in einem "Research letter" in der Fachzeitschrift "JAMA Internal Medicine" berichtet wird.
Für die weitere Bewertung sind zwei gesicherte Erkenntnisse wichtig: Erstens werden lediglich rund 10% aller Halsentzündungen durch einen mit Antibiotika überhaupt behandelbaren Erreger verursacht. Dieser Erreger ist zweitens am besten mit dem "schmalen" und preisgünstigen Antibiotika-Klassiker Penicillin behandelbar und braucht nicht den Einsatz eines wesentlich teureren Breitband-Antibiotikums.
Wie sich die Verschreibungshäufigkeiten von Ende der 1980er Jahre bis 1993, 1998 und zuletzt 2010 verändert haben, wie also der Public Health-Diskurs zu den Antibiotika bei Ärzten und PatientInnen angekommen ist, untersuchten zwei Gesundheitswissenschaftler mit Daten aus zwei repräsentativen Surveys zur ambulanten Versorgung in den USA.
Dabei kam mehrerlei heraus:
• Der Anteil der Besuche bei Allgemeinärzten wegen einer Halsentzündung sank von 1997 bis 2010 signifikant von 7,5% auf 4,3%. Der Anteil von Halsentzündungen an sämtlichen Besuchen einer stationären Notfallstation bewegte sich zwischen 2,2% und 2,3%.
• Bis 1993 sank die Rate der PatientInnen, die einen niedergelassenen Arzt mit einer Halsentzündung konsultierten und von ihm Antibiotika verordnet bekamen, von rund 80% auf 70%. Im Jahr 2000 war die Rate noch einmal auf 60% gefallen - also gemessen an der versorgungsepidemiologischen Notwendigkeit von rund 10% immer noch auf ein völlig unangemessenes Niveau.
• Trotz verstärkter Aufklärungsbemühungen über den nicht notwendigen Antibiotika-Einsatz betrug die Rate 2010 aber immer noch 60%.
• 2010 wurde die von Leitlinien unentwegt empfohlene Verordnung von Penicillin mit stabiler Tendenz während 9% der Arztbesuche wegen einer Halsentzündung verordnet, ein Breitband-Antibiotikum dagegen mit steigender Tendenz während 15% der Besuche.
• Allein die nicht notwendige Verordnung von Antibiotika kostete zwischen 1997 und 2010 konservativ geschätzt 500 Millionen US-Dollar. Hinzu kommen noch erhebliche Ausgaben im Zusammenhang mit den unerwünschten Wirkungen der Antibiotika-Einnahme.
Offensichtlich kann die enorme Resistenz gegen allgemeine wissenschaftliche oder populärwissenschaftliche Aufklärung bei Ärzten selbst nach jahrelange Bemühungen nicht beseitigt werden. Die bereits in Modellversuchen getestete direkte und datengestützte Information der einzelnen Ärzte über ihre Antibiotika-Verordnungspraxis könnte u.U. wirklich die einzige Methode sein, an ihrer gesundheitlich problematischen Praxis etwas zu ändern. Das Problem ist nur, dass kein Arzt verpflichtet werden kann, diese Information zu erhalten und auch umzusetzen.
Der Forschungsbrief Antibiotic Prescribing to Adults With Sore Throat in the United States, 1997-2010 von Michael L. Barnett und Jeffrey A. Linder ist in der Fachzeitschrift "JAMA Internal Medicine" zuerst online erschienen und kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 7.10.13
Jährlich bis zu 400.000 Personen sterben derzeit in Krankenhäusern der USA an den Folgen vermeidbarer Behandlungsfehler
 Der auch 2013 noch lesenswerte, 1999 vom "Institute of Medicine (IOM)" der USA herausgegebene Report "To err is human. Building a Safer Health System" (vgl. dazu für den eiligen Leser die achtseitige Kurzfassung) konstatierte auf der Basis von Daten aus dem Jahr 1984, dass jährlich wenigstens 44.000 und vielleicht bis zu 98.000 Personen in Krankenhäusern wegen vermeidbarer medizinischer Fehler und Irrtümer starben. Diese Zahlen wurden im Kern nicht bezweifelt und lösten in den USA eine Welle von Überlegungen und Instrumenten aus, die Behandlungsqualität zu verbessern.
Der auch 2013 noch lesenswerte, 1999 vom "Institute of Medicine (IOM)" der USA herausgegebene Report "To err is human. Building a Safer Health System" (vgl. dazu für den eiligen Leser die achtseitige Kurzfassung) konstatierte auf der Basis von Daten aus dem Jahr 1984, dass jährlich wenigstens 44.000 und vielleicht bis zu 98.000 Personen in Krankenhäusern wegen vermeidbarer medizinischer Fehler und Irrtümer starben. Diese Zahlen wurden im Kern nicht bezweifelt und lösten in den USA eine Welle von Überlegungen und Instrumenten aus, die Behandlungsqualität zu verbessern.
Eine im September 2013 veröffentlichte, auf Daten von vier Studien mit Behandlungs-Routinedaten (so genanntes "Global trigger tool") aus den Jahren 2008 bis 2011 basierende Untersuchung, kommt zu dem Ergebnis, dass diese Bemühungen relativ wenig bis nichts gefruchtet haben - im Gegenteil. Die Anzahl der Personen, die derzeit jährlich in US-Krankenhäusern wegen vermeidbarer Behandlungs-Fehler und -Irrtümer sterben, bewegt sich zwischen 210.000 und 400.000 Menschen. Damit stellt diese Todesart die dritthäufigste Todesursache in us-amerikanischen Krankenhäusern dar.
In der Diskussion seiner Ergebnisse versucht der Autor, diesen gewaltigen Anstieg genauer zu erklären. Einerseits könnte dies seines Erachtens daran liegen, dass die 1999er Daten u.a. auf Ärztebeurteilungen der Häufigkeit vermeidbarer unerwünschter Ereignisse beruhte und die Anzahl der in den 199oer Jahren vermeidbar gestorbener Krankenhauspatienten unterschätzt wurde. Andererseits könnte aber auch die aktuelle Schätzung zu niedrig sein. Dies könnte daran liegen, dass viele Behandlungsfehler erst nach so langer Zeit zum Tode führen, dass dies in Routinedaten nicht erkennbar ist. Unklar ist auch, ob die Zunahme der Gestorbenen nicht auch auf der Zunahme der technischen Komplexität der Behandlungen, der Zunahme resistenter Erreger, dem Fehlgebrauch von Arzneimitteln, der Alterung der Patienten und dem allzu häufigen Einsatz riskanter, invasiver aber gewinnfördernder Medizintechnik beruht. An dem Gesamtniveau der aktuellen vermeidbaren Sterblichkeit und ihrer Zunahme gegenüber früheren Jahren dürfte sich dadurch aber nichts ändern.
Schließlich ist dem Autor zustimmen, wenn er sagt: "It does not matter whether the deaths of 100.000, 200.000 or 400.000 Americans each year are associated with preventable adverse effects in hospitals. Any of the estimates demands assertive action on the part of providers, legislators, and people who will one day become patients." Leider kommt er aber auch zu dem Ergebnis, der Fortschritt bei der Patientensicherheit sei in den USA frustierend langsam.
Nachdem nun in den USA innerhalb von 15 Jahren immerhin zwei derartige Untersuchungen veröffentlicht wurden, fällt das Fehlen auch nur einer vergleichbaren Studie über die vermeidbaren Behandlungsfehler mit Todesfolge in deutschen Krankenhäusern besonders deutlich auf. Statt der Litanei, so etwas gäbe es in deutschen Krankenhäusern nicht oder die US-Ergebnisse seien überhaupt nicht übertragbar, sollten endlich alle Beteiligten eine erste unabhängige Studie in Deutschland beginnen - bevor die dritte in den USA fertig ist.
Die Studienergebnisse sind in dem Aufsatz A New, Evidence-based Estimate of Patient Harms Associated with Hospital Care von John James in der Zeitschrift "Journal of Patient Safety" im September 2013 (Volume 9, Issue 3: 122-128) erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 26.9.13
Leitliniengerechte schnelle Behandlung von Herzinfarktpatienten durch Gefäßerweiterung senkt nicht das Sterblichkeitsrisiko
 Aktuelle Leitlinien zur Behandlung von Herzinfarktpatienten empfehlen, dass der zeitliche Abstand zwischen dem Infarkt und der Erweiterung von Herzkranzgefäßen mit einem Ballonkatheter (perkutane Koronararterien-Erweiterung [PCI]) 90 oder weniger Minuten betragen sollte. Diese so genannte "door-to-balloon-time" gilt daher auch als Maß für eine optimale Behandlung und als Richtschnur für Maßnahmen, diese Zeit so weit wie möglich zu verkürzen. Ob eine "door-to-balloon-time" von 90 und weniger Minuten die Sterblichkeit der Patienten innerhalb des Krankenhauses oder die Sterblichkeit innerhalb der 30 Tage nach dem Herzinfarkt senkt, war bisher nicht bekannt oder klar.
Aktuelle Leitlinien zur Behandlung von Herzinfarktpatienten empfehlen, dass der zeitliche Abstand zwischen dem Infarkt und der Erweiterung von Herzkranzgefäßen mit einem Ballonkatheter (perkutane Koronararterien-Erweiterung [PCI]) 90 oder weniger Minuten betragen sollte. Diese so genannte "door-to-balloon-time" gilt daher auch als Maß für eine optimale Behandlung und als Richtschnur für Maßnahmen, diese Zeit so weit wie möglich zu verkürzen. Ob eine "door-to-balloon-time" von 90 und weniger Minuten die Sterblichkeit der Patienten innerhalb des Krankenhauses oder die Sterblichkeit innerhalb der 30 Tage nach dem Herzinfarkt senkt, war bisher nicht bekannt oder klar.
Um diesen Zustand zu beenden untersuchten nun us-amerikanische WissenschaftlerInnen mit Daten des so genannten "CathPCI Registry", ob und wie die Sterblichkeit bei 96.738 Herzinfarktpatienten, bei denen eine PCI durchgeführt wurde, mit der Zeitdauer zwischen Infarkt und PCI zusammenhängt. Die Daten stammen aus 515 Krankenhäusern, die an diesem Register mitarbeiten und aus dem Zeitraum Juli 2005 bis Juni 2009.
Zu den wichtigsten Ergebnissen zählen:
• Die mittlere "door-to-balloon-time" sank in den ersten 12 Monaten des Beobachtungszeitraums signifikant von durchschnittlich 83 Minuten auf 67 Minuten in den letzten 12 beobachteten Monaten.
• Entsprechend nahm der Anteil der Patienten mit einer "door-to-balloon-time" von 90 und weniger Minuten ebenfalls signifikant von 59,7% im ersten auf 83,1% im letzten Jahr zu.
• Trotz dieser Verbesserungen des Zeitraums zwischen Infarkt und Gefäßerweiterung veränderte sich die Sterblichkeit im Krankenhaus unadjustiert nur geringfügig (von 4,8% auf 4,7%) und nicht signifikant. Daran änderte sich auch nach einer Risikoadjustierung der Patienten nichts: Die Sterblichkeitsrate innerhalb des Krankenhauses sank von 5% auf 4,7% und verfehlte die Signifikanz erneut erheblich (p=0,34).
• Die mit Daten der staatlichen Krankenversicherung Medicare durchgeführte Analyse der 30-Tage-Sterblichkeit nach Herzinfarkt und PCI identifizierte sogar trotz der beträchtlichen Abnahme der "door-to-balloon-time" einen leichten Anstieg von 9,7% auf 9,8%, der allerdings auch nicht statistisch signifikant war (p=0,64).
Diese Ergebnisse sollten zwar nicht zum Anlass genommen werden, die Zeit zwischen Infarkt und PCI oder anderen klinischen Interventionen nicht noch weiter zu verkürzen. Sie sollten aber Motivation sein auch noch über andere Maßnahmen für Infarktpatienten nachzudenken, die deren Sterblichkeitsrisiko senken können.
Der Aufsatz Door-to-Balloon Time and Mortality among Patients Undergoing Primary PCI von Daniel S. Menees et al. ist am 5. September 2013 im "New England Journal of Medicine" (369: 901-909) erschienen von dem das Abstract kostenlos erhältlich ist.
Bernard Braun, 6.9.13
USA: Antibiotika ohne gesundheitlichen Nutzen und Breitband-Antibiotika werden anhaltend zu oft verordnet.
 Sowohl die Verordnung von Antibiotika bei offensichtlich damit nicht behandlungsfähigen Erkrankungen (z.B. Virusinfektionen) als auch die Verordnung von Breitband-Antibiotika an Stelle von Antibiotika mit schmalerem oder spezifischerem Wirkungsspektrum, werden seit Jahren kritisch diskutiert. Die dabei vor allem angesprochenen unerwünschten und gefährlichen Effekte stellen die damit verbundenen Resistenzbildungen bei immer mehr bakteriellen Erregern sowie die Kosten dar.
Sowohl die Verordnung von Antibiotika bei offensichtlich damit nicht behandlungsfähigen Erkrankungen (z.B. Virusinfektionen) als auch die Verordnung von Breitband-Antibiotika an Stelle von Antibiotika mit schmalerem oder spezifischerem Wirkungsspektrum, werden seit Jahren kritisch diskutiert. Die dabei vor allem angesprochenen unerwünschten und gefährlichen Effekte stellen die damit verbundenen Resistenzbildungen bei immer mehr bakteriellen Erregern sowie die Kosten dar.
Wie die Verordnungsweise Über mehrere Jahre hinweg aussieht, ob also die Kritik nachweisbare positive Spuren hinterlässt, hat jetzt ein Team us-amerikanischer Spezialisten für die Behandlung von Infektionserkrankungen für die Jahre 2007 bis 2009 in den USA untersucht. Sie nutzten dazu Daten des "National Ambulatory Medical Care Survey" und des "National Hospital Ambulatory Medical Care Survey", repräsentative Datensammlungen zu den Behandlungsvisiten von 238.624 erwachsenen PatientInnen in normalen stationären und ambulanten ärztlichen Sprechstunden und Notfallambulanzen.
Die wichtigsten Ergebnisse sahen so aus:
• Antibiotika wurden jährlich am Ende von 101 Millionen ambulanten Arztbesuchen, d.h. nach rund 10% aller Arztbesuche verordnet.
• Die jährliche Rate der Antibiotika-Verordnungen veränderte sich in dem dreijährigen Untersuchungszeitraum nicht.
• 41% aller Antibiotika-Verordnungen erfolgten wegen einer Erkrankung der oberen Atemwege, 19% bei Hautinfektionen/Akne und 8% bei Infektionen der Harnwege.
• 61% aller Antibiotika-Verordnungen waren Breitband-Antibiotika.
• Rund 21% aller Behandlungskontakte in Notfallambulanzen endeten in einer Antibiotika-Verordnung. In normalen stationären Arzt-Patientkontakten betrug dieser Anteil nur 9% und in ambulanten Settings 11%. Diese Unterschiede waren statistisch hochsignifikant.
• Insgesamt waren 28% aller Antibiotika-Verordnungen wahrscheinlich unnötig, erfolgten also z.B. bei Erkrankungen gegen die sie wirkungslos waren. Dies trifft u.a. für 68% aller Verordnungen gegen Atemwegsinfektionen zu.
• Der Anteil nicht notwendiger Antibiotika-Verordnungen war in Notfallambulanzen am höchsten und in Kliniksprechstunden für ambulante Patienten am niedrigsten.
• Der Anteil der verordneten Breitband-Antibiotika war u.a. bei vorhandener Komorbidität, bei älteren PatientInnen und privat Krankenversicherten signifikant überdurchschnittlich.
Von der elektronischen Vorveröffentlichung der Studie Antibiotic prescribing for adults in ambulatory care in the USA, 2007-09 von Shapiro DJ et al. am 25. Juli 2013 in der britischen Fachzeitschrift "Journal of Antimicrobial Chemotherapy" gibt es ein kostenloses Abstract.
Bernard Braun, 5.9.13
Selten teure "rauchende Colts": Fast 500 Millionen US-$ Strafe für vorsätzlich gesetzwidrige Vermarktung eines Medikaments
 Weil die kritische Auseinandersetzung mit Vermarktungsstrategien der Arzneimittelhersteller, die Gewinnziele vor Patienteninteressen stellen, oft keine eindeutigen Belege findet, verdienen die wenigen klaren Fälle umso mehr öffentliche Aufmerksamkeit.
Weil die kritische Auseinandersetzung mit Vermarktungsstrategien der Arzneimittelhersteller, die Gewinnziele vor Patienteninteressen stellen, oft keine eindeutigen Belege findet, verdienen die wenigen klaren Fälle umso mehr öffentliche Aufmerksamkeit.
Dies gilt auch für die am 30 Juli 2013 öffentlich abgeschlossene Auseinandersetzung zwischen dem bis 2009 selbstständigen und dann vom Branchenführer Pfizer gekauften Pharmaunternehmen Wyeth und der in den USA für die Zulassung von Arzneimitteln zuständigen US-Food and Drug Administration (FDA) bzw. dem US-Justizministerium. Das Unternehmen akzeptiert damit, für die mit Vorsatz und mit enormem Aufwand betriebene ungesetzliche Vermarktung seines Medikaments Rapamune eine Strafe von 490,9 Millionen US-Dollar bezahlen zu müssen.
Das Medikament sollte Abstoßreaktionen des körpereigenen Immunsystems gegen ein implantiertes Organ verhindern. 1999 erhielt die Firma nach entsprechenden Vorstudien und Prüfungen durch die FDA die Zulassung - allein und ausdrücklich für den Einsatz bei Patienten mit einer Nierentransplantation. Die Firma hinderte dies nicht daran, fast unmittelbar nach dieser Zulassung ihre Pharmareferenten mit Vertriebsmaterialien auszustatten, in denen das Medikament ohne Nutzenbelege und vor allem ohne FDA-Zulassung auch für Patienten empfohlen wurde, die ein anderes Organ implantiert bekommen hatten. Um Ärzte zu diesem so genannten "off label"-Einsatz überreden zu können, trainierte die Firma ihre Referenten speziell und offerierte ihnen für den Erfolgsfall auch spezielle finanzielle Anreize bzw. Bonusse. Die staatlichen Aufseher und Ermittler sahen darin nicht nur ein Verhalten, das den Firmengewinn "ahead of the health and safety of a highly vulnerable patient population dependent on life-sustaining therapy" stellte, sondern einen von 1998 bis 2009 reichenden fortgesetzten Verstoß gegen den "False Claims Act".
Weitere Einzelheiten können in der vom US-Justizministerium erstellten Presseerklärung Wyeth Pharmaceuticals agrees to pay $490,9 million for marketing the prescription drug Rapamune for unapproved uses" nachgelesen werden.
Bernard Braun, 9.8.13
Beispiel Rückenschmerzen: Behandlungswirklichkeit verschlechtert sich in den USA trotz "gut etablierter"Leitlinien
 Die für immer mehr Krankheiten vorhandenen Leitlinien bestimmen nachwievor nicht verbindlich die Behandlung der jeweiligen Kranken. Dies liegt erstens und vor allem an ihrer unter Ärzten nicht leiser werdenden Diskreditierung als "Kochbuchmedizin" oder "Einheitsbehandlung". Hinzu kommt zweitens, dass die Qualität bzw. Evidenz von Leitlinien unterschiedlich ist und die Vielzahl der nationalen und internationalen Leitlinien fast schon wieder eine "Leitlinie" zur Orientierung bei den Leitlinien erfordert. Und drittens erfordert die Veralltäglichung von Leitlinien-Handeln gegen das traditionell eminenzlastige Denken gerade im ärztlichen und medizinischen Bereich wesentlich mehr Zeit als erwartet oder erhofft.
Die für immer mehr Krankheiten vorhandenen Leitlinien bestimmen nachwievor nicht verbindlich die Behandlung der jeweiligen Kranken. Dies liegt erstens und vor allem an ihrer unter Ärzten nicht leiser werdenden Diskreditierung als "Kochbuchmedizin" oder "Einheitsbehandlung". Hinzu kommt zweitens, dass die Qualität bzw. Evidenz von Leitlinien unterschiedlich ist und die Vielzahl der nationalen und internationalen Leitlinien fast schon wieder eine "Leitlinie" zur Orientierung bei den Leitlinien erfordert. Und drittens erfordert die Veralltäglichung von Leitlinien-Handeln gegen das traditionell eminenzlastige Denken gerade im ärztlichen und medizinischen Bereich wesentlich mehr Zeit als erwartet oder erhofft.
Ist es also nicht völlig überraschend, dass Leitlinien nicht sofort dazu beitragen den Erfolg einer Behandlung zu verbessern, sondern die Behandlung über längere Zeit beim Status quo ante verharrt, gibt es jetzt auch Belege, dass sich die Qualität der Behandlung verbreiteter Erkrankungen auch nach langjähriger Existenz und Verbreitung von Leitlinien sogar deutlich verschlechtert.
Dies zeigt eine Studie über die Entwicklung der Qualität des Managements und der Behandlung von Rückenschmerzen zwischen den Jahren 1999 und 2010. Mit den für die USA repräsentativen Daten aus dem "National Ambulatory Medical Care Survey" und dem "National Hospital Ambulatory Medical Care Survey" untersuchte eine us-amerikanische Forschergruppe exemplarisch 23.918 Besuche (repräsentieren nahezu 440 Millionen Arztbesuche) bei ambulant tätigen Ärzten wegen eines Rückenschmerzproblems. Die ForscherInnen untersuchten das Behandlungsgeschehen mit Kriterien, die sie aus den langjährig vorhandenen und bekannten ("well-established") Leitlinien übernommen haben. Abgesehen von den wenigen akut schweren Fällen wird der frühzeitige Einsatz aufwändiger bildgebenden Untersuchungen, die Verordnung von Narkotika und die Überweisung zu einem anderen (Fach-)Arzt (hauptsächlich Chirurgen) als Nichtübereinstimmung ("discordant") mit den Leitlinien bewertet. Sofern nichtsteroidale entzündungshemmende Arzneimittel oder Paracetamol ("acetaminophen") (so genannte "first-line medications") verordnet wurden und eine Überweisung zu einer physikalischen Therapie erfolgte, galt dies als leitlinienkonform ("guideline concordant").
Die Behandlungswirklichkeit sieht nach einer Reihe von Adjustierungen (z.B. nach Alter, Ort und Gesamtbehandlungszeit) wie folgt aus:
• Die Chance bei einem Arztbesuch ein nichtsteroidales entzündungshemmendes Medikament oder Paracetamol verordnet zu bekommen sank von 1999 bis 2010 signifikant von 36,9% auf 24,5%. Ganz anders sah es bei den Narkotika aus: Deren Verordnung und Einnahme stieg im selben Zeitraum signifikant von 19,3% auf 29,1%.
• Die Überweisung zu einem Physiotherapeuten o.ä. veränderte sich im Untersuchungszeitraum nicht, d.h. schwankte um die 20%-Marke. Die Überweisung zu einem anderen Arzt stieg aber signifikant von 6,8% auf 14%.
• Zu beiden Zeitpunkten wurde im Rahmen von rund 17% der Arztbesuche ein Röntgenbild angefertigt. Die Anzahl der zusätzlich erstellten Computer- und der Magnetresonanztomographien stieg aber signifikant von 7,2% auf 11,3%.
Insbesondere in einem in derselben Ausgabe der Fachzeitschrift "JAMA Internal Medicine" veröffentlichten Kommentar wird deutlich, dass die Veränderung eines derartigen Verhaltens mehrere Barrieren gleichzeitig beseitigen muss. Der Autor zählt als Faktoren, welche die Leitlinientreue der Ärzte beeinflussen Mängel beim Wissen, Mängel bei den Einstellungen (z.B. Mangel an Erwartungen zum Outcome und mangelnde Selbstwirksamkeitsüberzeugung) und Mängel bei den Verhaltensbedingungen (z.B. Zeitmangel, Verweigerung von Patienten, widersprüchliche Leitlinien) auf.
Der Aufsatz Worsening Trends in the Management and Treatment of Back Pain von John N. Mafi, Ellen P. McCarthy, Roger B. Davis und Bruce E. Landon ist in der Fachzeitschrift "JAMA Internal Medicine" zuerst einmal online am 29. Juli 2013 erschienen. Das Abstract ist kostenlos erhältlich.
Der Kommentar Why Don't Physicians (and Patients) Consistently Follow Clinical Practice Guidelines? Comment on "Worsening Trends in the Management and Treatment of Back Pain von Donald Casey ist in derselben Online-Ausgabe der Zeitschrift erschienen. Hier ist nur ein kurzer Antext kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 31.7.13
Viele, die "uns" am Hindukusch oder sonstwo verteidigen, werden schwer krank! Erfahrungsvorsprung der USA könnte Leid verkürzen!
 Auch hierzulande wird bei jeder irgendwie international bedeutsam erscheinenden kriegerischen Auseinandersetzung - zuletzt nach dem Einsatz französischer Truppen in Mali - fast automatisch überlegt, ob man Deutschland nicht nur am Hindukusch sondern z.B. auch vor Timbuktu in Gestalt von Soldaten verteidigen müsse.
Auch hierzulande wird bei jeder irgendwie international bedeutsam erscheinenden kriegerischen Auseinandersetzung - zuletzt nach dem Einsatz französischer Truppen in Mali - fast automatisch überlegt, ob man Deutschland nicht nur am Hindukusch sondern z.B. auch vor Timbuktu in Gestalt von Soldaten verteidigen müsse.
Was der Einsatz in diesen zum Teil so genannten asymmetrischen Kriegen für die Soldaten bedeutet und dass die Probleme nicht mit dem Abzug der entsandten Soldaten vorbei sind, wird spätestens seit der Beteiligung deutscher Soldaten am Afghanistankrieg auch in Deutschland in ersten Studien oder in Fernseh-Spielfilmen immer deutlicher gezeigt und bedacht.
Wer dies für übertrieben oder zu literarisch hält, kann sich mit der Lektüre der Anfang 2013 auf neun Bände angewachsenen Reihe der u.a. vom "Institute of Medicine" der USA herausgegebenen Erkenntnisse über die Spätfolgen des 1991 relativ schnell beendeten Golfkriegs gegen irakische Invasionstruppen gründlich eines Anderen belehren lassen.
22 Jahre nach Beendigung dieses Krieges zeigen Untersuchungen der staatlichen Krankenversicherung Veteran Affairs für aktive und ehemalige SoldatInnen der USA zweierlei:
• Von den in diesem Krieg eingesetzten rund 700.000 militärischen Personen leiden 175.000 bis 250.000 noch heute an einer Vielzahl langwieriger und medizinisch auch noch nicht richtig erklärten Symptomen, die als chronisch multisymptomatische Krankheit ("chronic multisymptom illness (CMI)") bezeichnet werden. 2001 lautete die Bezeichnung für diese Art von Krankheit noch "medically unexplained physical symptoms" oder MUPS.
• MUPS oder CMI sind weit mehr als die mittlerweile auch unter deutschen SoldatInnen erkannte, anerkannte aber ansonsten nur zum Teil ausreichend behandelte so genannte posttraumatische Belastungsstörung. CMI ist derartig vielgestaltig, dass das Krankheitsbild von Person zu Person andersartig sein kann. Eine Behandlung nach dem Ansatz "one size fits all" halten die us-amerikanischen ExpertInnen für völlig nutzlos.
Der Band 9 der Reihe beschäftigt sich daher vor allem damit Evidenz für die Behandlungsmöglichkeiten von CMI zusammenzutragen. Ein Studienreview zeigte, dass im Rahmen des notwendigen individuellen Krankheitsmanagement dem einen Ex-Soldaten eine kognitive Verhaltenstherapie, anderen Soldaten dagegen auch noch Serotonin-haltige Arzneimittel und weiteren erkrankten KriegsteilnehmerInnen Biofeedback, Akupunktur, St. John's wort (Johanniskraut), Aerobic-Training, Motivationsgespräche und/oder eine Fülle multimodaler Therapien geholfen haben. Für deren generelle Wirkung gibt es dagegen meist (noch) keine robuste wissenschaftliche Evidenz. Die von den IOM-AutorInnen angeregten Evidenzstudien dürften wahrscheinlich für die erkrankten Golfkriegs-TeilnehmerInnen kaum mehr von Nutzen sein.
Auch ohne das Ergebnis der Studien schlagen die CMI-ExpertInnen aber die Bildung von streng patientenbezogenen Behandlungsteams ("patient-aligned care teams") aus Allgemeinmedizinern, Fachärzten, Pflegekräften, Psychiatern, Sozialarbeitern und anderen Spezialisten vor. In jeder Veteran Affairs-Klinik sollen außerdem so genannte behandlungserfahrene "CMI-champions" gewonnen werden, welche die behandelnden Aerzte unterstützen sollen. Dabei spielt auch die Tatsache eine entscheidende Rolle, dass 2011/12 mindestens 2,6 Millionen militärische US-Amerikaner in Kriegen involviert waren, die nicht minder gesundheitsbelastend sind als der Golfkrieg.
Es kann nicht erwartet werden, dass es in Afghanistan stationierten Bundeswehrsoldaten nach ihrer Rückkehr gesundheitlich besser geht als den US-Soldaten. Vermutlich ist dies auch nicht der letzte Kriegseinsatz deutscher SoldatInnen. Daher sollten diese SoldatInnen nicht ihrem Schicksal oder der normalen GKV-basierten Behandlung überlassen bleiben. Und es sollte auch nicht erst auf jeden weiteren Fall gewartet werden, bevor diejenigen, die gestern und heute am Schreibtisch in Berlin oder Brüssel über Auslandseinsätze entscheiden sich des Erfahrungsschatzes der Veteran Affairs-Krankenversicherung und ihrer Behandlungsexperten bedienen und parallel zu ihren kriegerischen Entscheidungen für eine umfassende Behandlung und Versorgung der erkrankten Rückkehrer sorgen.
Die ausführliche Zusammenfassung der Ergebnisse des aktuellen Band 9 der IOM-Schriftenreihe "Gulf War and Health: Treatment for Chronic Multisymptom Illness." erhält man kostenlos. Dies gilt auch für die "summaries" acht vorher erschienenen Bände.
Bernard Braun, 26.1.13
Kürzeres Leben und dies in schlechterer Gesundheit - Die Gesundheit der US-BürgerInnen im Vergleich mit 16 Industriestaaten
 Die Erkenntnis, dass nicht nur das Gesundheitssystem, sondern auch die wesentlichen gesundheitlichen Lebensbedingungen in den USA schlechter sind als in vergleichbaren Industrieländern, wird durch zahlreiche Studien seit Jahren oder gar Jahrzehnten immer wieder belegt. Daran hat sich trotz einiger Verbesserungen in den letzten Jahren weder bei der Lebenserwartung, noch dem Risiko und der Versorgung einer Reihe von Erkrankungen nichts geändert.
Die Erkenntnis, dass nicht nur das Gesundheitssystem, sondern auch die wesentlichen gesundheitlichen Lebensbedingungen in den USA schlechter sind als in vergleichbaren Industrieländern, wird durch zahlreiche Studien seit Jahren oder gar Jahrzehnten immer wieder belegt. Daran hat sich trotz einiger Verbesserungen in den letzten Jahren weder bei der Lebenserwartung, noch dem Risiko und der Versorgung einer Reihe von Erkrankungen nichts geändert.
Daher beauftragten die staatlichen "National Institutes of Health (NIH)" der USA ein Expertengremium unter Koordination durch das "Institute of Medicine (IOM)" damit, sowohl die aktuelle Situation international vergleichend systematisch darzustellen als auch die potenziellen Gründe für dieses Hinterherhinken umfassend aufzuarbeiten.
"Highlights" der Status quo-Analyse sind im Vergleich mit 16 "peer countries" (z.B. Kanada, Australien, Japan und die reicheren europäischen Länder) die Plätze 17 (Männer) und 16 (Frauen) bei der USA-Lebenserwartung ab Geburt im Jahr 2007. Nebenbei: Die deutschen Männer und Frauen belegen in diesem Vergleich die Plätze 13 und 12.
In neun Gesundheitsbereichen, die von der Kindersterblichkeit und niedrigem Geburtsgewicht über Selbstmorde, HIV, Diabetes bis zur Behinderung reichen, sieht die gesundheitliche Situation der US-BürgerInnen quasi von der Geburt bis ins höhere Alter schlechter als im Durchschnitt der "peer countries" aus. Interessant ist dabei, dass die enorme Ungleichheit der Erkrankungsrisiken und Behandlungschancen in den USA nicht völlig durch die Ungleichheiten nach Hautfarbe, Versicherungsstatus, Bildungsniveau oder Einkommen erklärt werden kann. Mehrere Studien zeigen vielmehr, dass es selbst bevorteilten oder privilegierten Bevölkerungsgruppen in den USA gesundheitlich schlechter geht als den vergleichbaren Personenkreisen in den Vergleichsländern.
Nur in wenigen Bereichen geht es US-BürgerInnen gesundheitlich besser. Dazu zählen die niedrigeren Krebssterblichkeitsraten, die bessere Kontrolle des Bluthochdrucks und des Cholesterinspiegels (ob dies wirklich einen größeren gesundheitlichen Nutzen bedeutet, sei hier einmal dahingestellt) und die fernere Lebenserwartung der 75-Jährigen.
Als Erklärung dieser hartnäckigen Nachteile reicht nicht ein einziger Faktor oder eine einzige Bedingung, sondern erst ein Bündel sich bedingender, verstärkender oder hemmender sozialer und ökonomischer (z.B. Armut und besonders Kinderarmut, Bildung), Umwelt- (z.B. die Autofixierung der Umwelt), Gesundheitssystem- (z.B. hohe Anzahl von Un- oder Unterversicherter, Zugangsprobleme zu bestimmten Versorgungsleistungen) und Verhaltensfaktoren (z.B. hohe Kalorienaufnahme, Waffengewalt, geringe Gurtnutzung). Was dies im Einzelnen bedeutet wird in den Teilen I und II des Berichts ausführlich dargestellt.
Was bei der Absicht daran etwas zu ändern beachtet werden muss, und dass es dabei keine Wunder- oder Patentrezepte gibt, stellen die Experten vor allem im Teil III des Berichts dar.
Zu den richtungsweisenden Hinweisen für eine entsprechende Gesundheitspolitik zählt die für die Information und Mobilisierung der us-amerikanischen Öffentlichkeit wichtige Erkenntnis: "The tragedy is not that the United States is losing a contest with other countries, but that Americans are dying and suffering from illness and injury at rates that are demonstrably unnecessary."
Wichtig ist auch der Hinweis, dass Information nicht alles sein kann, sondern um wirksam sein zu können in andere Dimensionen und Instrumente eingebettet werden muss: "Although these are positive steps, addressing the U.S. health disadvantage will require not only a list of goals, but also a societal commitment of effort and resources to meet them".
Der enorm informative und materialreiche Bericht "U.S. Health in International Perspective: Shorter Lives, Poorer Health" ist 2013 vom "Panel on Understanding Cross-National Health Differences Among High-Income Countries" (Herausgeber: Steven H. Woolf and Laudan Aron) erstellt und vom "National Research Council and Institute of Medicine" herausgegeben worden.
Kostenlos verfügbar ist eine 4 Seiten Kurzfassung und nach einer kurzen und garantiert spamfreien Anmeldung auch eine 405 Seiten PDF-Vorabpublikation des Berichts.
Bernard Braun, 9.1.13
"Pay for performance" auch nach 6 Jahren ohne positive Wirkung auf das Ergebnis "30-Tagesterblichkeit" in US-Kliniken
 Eines der jüngsten Patentrezepte in der langen Reihe von Honorierungskonzepten für eine bessere Gesundheitsversorgungsqualität ist "pay for performance" oder P4P.
Eines der jüngsten Patentrezepte in der langen Reihe von Honorierungskonzepten für eine bessere Gesundheitsversorgungsqualität ist "pay for performance" oder P4P.
Dass Ärzte und Krankenhäuser, die ihre Einnahmen im Rahmen solcher Programme erhöhen können, mit dieser Art der Verknüpfung des Erreichens definierter Qualitätsziele mit der Honorierung zufrieden sind, ist einleuchtend. Und ebenfalls, dass sich Patienten in einem Krankenhaus wohler fühlen, in dem sie möglicherweise (das hängt von vereinbarten Zielwerten ab) mehr nach ihrer Zufriedenheit gefragt werden und auch überhaupt oder intensiver auf die künftige Behandlung vorbereitet werden.
Frühere Studien in den USA oder in Großbritannien über die auch im Forum-Gesundheitspolitik berichtet wurde, hatten aber bereits deutlich auf kräftige Abweichungen der Wirklichkeit von den wunderbaren Erwartungen hingewiesen. So verbesserten z.B. meist nur Krankenhäuser ihre Behandlungsqualität, die bereits gut waren, während sich schlechtere Krankenhäuser entweder gar nicht an P4P-Programmen beteiligten oder dort nur wenig Qualitätsverbesserungen vorzuweisen hatten. Andere Studien wiesen auf die Indikationsspezifik der Wirkungen hin. Je nachdem um welche Erkrankung es sicher handelte gab es Verbesserungen aber auch Verschlechterungen der Qualität.
Eine nicht nur bei der Bewertung von P4P vernachlässigte Frage war, ob sich diese Honorierungsform auf die Ergebnisqualität der Behandlung auswirkt oder "nur" auf die Struktur- oder Prozessqualität. In diesem Zusammenhang taucht auch immer wieder die Frage auf, ob die Qualitätsverbesserungen erst nach längerer Einwirkzeit eintreten und ob sie dauerhaft sind.
Die Ende März 2012 im "New England Journal of Medicine (NEJM)" veröffentlichten Ergebnisse einer den Zeitraum 2003 bis 2009 umfassenden Studie, liefern dazu erste Antworten. In dieser derzeit umfassendsten P4P-Studie wird untersucht, ob sich der harte Ergebnisqualitätsindikator der 30-Tagesterblichkeit nach einer Entlassung aus dem Krankenhaus von rund 6 Millionen wegen eines akuten Herzinfarkts, einer Lungenentzündung, einer By pass-Operation oder einer Herzinsuffienz behandelten PatientInnen in 252 an dem Medicare-P4P-Programm "Premier Hospital Quality Incentive Demonstration (HQID)" von dem in 3.363 normalen Krankenhäusern unterscheidet.
Die mit einem erheblichen methodischen Aufwand analysierten Daten ergaben folgendes Bild:
• Die 30-Tage-Mortalität in den HQID-Krankenhäusern (12,33%) unterschied sich zu Beginn der Untersuchung gegenüber der in den Nicht-HQID-Kliniken (12,40%) nicht.
• An dieser Ähnlichkeit hat sich auch nach sechs Jahren Programmintervention nichts geändert (11,82% versus 11,74%). Es gab zwar leichte Verbesserungen, die aber in beiden Gruppen ähnlich ausfielen. Ein spezieller Effekt des P4P-Programms war nichts zu erkennen.
• Ein Vergleich der diagnosespezifischen Sterblichkeit bei Erkrankungen für deren Behandlung es P4P-Anreize gab mit anderen Erkrankungen, wo es solche Anreize nicht gab, lieferte ebenfalls keinen Beleg für eine besondere Wirkung dieser Anreize.
• In den Krankenhäusern mit schlechterer Start-Ergebnisqualität (15,12% versus 14,73%) gab es zwar während der Untersuchungszeit zwar Verbesserungen (13,37% versus 13,21%). Aber auch hier lässt sich kein spezifischer Effekt von P4P erkennen.
Erwartungen an Programme wie HQID, die Ergebnisqualität zu verbessern, sollten nach Meinung der WissenschaftlerInnen "remain modest". Der Aufsatz kommt aber auch bei Verbesserungen der Behandlungsprozessqualität auf der Basis entsprechender Literatur zu dem Ergebnis, dort gäbe es lediglich "modest improvements".
Was diese Ergebnisse für die in den USA geplante flächendeckende Übernahme des P4P-Systems bedeuten, ist offen. Wer in Deutschland aber mit dem Gedanken spielt das "US-Erfolgsmodell" zu übernehmen und damit das Nachdenken über andere Anreize einzustellen, sollte sich diese und ähnliche Studien genau anschauen und nicht erst 6 oder 9 Jahre warten, um u.U. ähnliche Ergebnisse gewonnen zu haben - wenn überhaupt Wirkungsforschung stattfindet.
Der Aufsatz "The Long-Term Effect of Premier Pay for Performance on Patient Outcomes" von Ashish K. Jha, Karen E. Joynt, E. John Orav und Arnold M. Epstein ist am 29. März 2012 im New England Journal of Medicine" (2012; 366: 1606-15) erschienen und in Gänze kostenlos erhältlich.
Auch der Kommentar Making the Best of Hospital Pay for Performance von Andrew Ryan und Jan Blustein (N Engl J Med 2012; 366: 1557-155) ist frei erhältlich.
Bernard Braun, 13.5.12
Als ob es nicht bereits genug multiresistente Krankheitserreger gäbe: Breitband-Antibiotika gegen Erkältungen boomen in den USA.
 Winterzeit ist Erkältungszeit und damit auch Antibiotika-Verordnungszeit. Und da auch Krankheitskeimen sich global verbreiten, verbreiten sich erwünschte aber auch unerwünschte Effekte unangebrachter Behandlungen rasch in den Erdteilen und Regionen mit hohem Mobilitätspotential. Was also in den USA im Bereich der Verordnung von Antibiotika passiert und welche besonderen Problematiken dabei auftreten, ist daher auch für die künftige Entwicklung in Deutschland relevant (siehe zur Situation in Deutschland u.a. eine mit zahlreichen Hintergrundinformationen angereicherte regionale Studie aus dem letzten Jahr.
Winterzeit ist Erkältungszeit und damit auch Antibiotika-Verordnungszeit. Und da auch Krankheitskeimen sich global verbreiten, verbreiten sich erwünschte aber auch unerwünschte Effekte unangebrachter Behandlungen rasch in den Erdteilen und Regionen mit hohem Mobilitätspotential. Was also in den USA im Bereich der Verordnung von Antibiotika passiert und welche besonderen Problematiken dabei auftreten, ist daher auch für die künftige Entwicklung in Deutschland relevant (siehe zur Situation in Deutschland u.a. eine mit zahlreichen Hintergrundinformationen angereicherte regionale Studie aus dem letzten Jahr.
Was in den USA im Bereich der Verordnung von Antibiotika aktuell passiert zeigt eine aktuelle Auswertung der Diagnose- und Verordnungsdaten einer national repräsentativen Stichprobe aus den "National Ambulatory and National Hospital Ambulatory Medical Care Surveys" von mehr als 60.000 Besuchen von Jugendlichen und Kindern unter 18 Jahren in ambulanten Kinderarztpraxen in den Jahren 2006 bis 2008. Das besondere Augenmerk lag dabei auf den Verordnungen von Antibiotika und den Besuchsanlässen oder Diagnosen, die ihnen zugrundelagen.
Zu den wesentlichen Funden gehören:
• Am Ende von 21% aller Arztbesuche wurden Antibiotika verordnet.
• Mehr als 70% der Arztbesuche an deren Ende die Verordnung von Antibiotika oder Breitband-Antibiotika stand, erfolgten wegen einer Infektion der oberen Atemwege.
• 23% aller Arztbesuche, die mit der Verordung von Antibiotika endeten, erfolgten wegen akuten Infektionen der oberen Atemwege, bei denen Antibiotika meistens nicht angebracht gewesen waren. Dabei handelt es sich um mehr als 10 Millionen Arztbesuche pro Jahr.
• Bei der Hälfte der Arztbesuche, die mit einer Antibiotika-Verordnung abgeschlossen wurden, wurde ein Breitband-Antibiotika verordnet, das in den meisten Fällen nicht angemessen war und aufgrund seiner breiten Wirkung auch besonders breite unerwünschte Effekte hatte. Das Paradoxe ist: Mit der schrottschussartigen Verordnung von Breitband-Antibiotika versuchen die Ärzte einerseits den vermuteten Resistenzen vieler Bakterien gegen einfache Antibiotika auszuweichen. Andererseits forcieren sie mit der häufigen aber nicht notwendigen und unwirksamen Verordnung von Breitband-Antibiotika bei den überwiegend durch Viren verursachten Atemwegserkrankungen erst recht Resistenzbildungen bei einer Vielzahl von Erregern.
• Multivariate Analysen zeigen, dass die "Chance" der Verordnung von Breitband-Antibiotika u.a. im Süden der USA, bei privat Krankenversicherten und jüngeren PatientInnen am größten ist.
Zu dem am 1. Dezember 2011 in der Fachzeitschrift "Pediatrics" (Vol. 128 No. 6: 1053 -1061) veröffentlichten Aufsatz "Antibiotic Prescribing in Ambulatory Pediatrics in the United States" von Adam L. Hersh, Daniel J. Shapiro, Andrew T. Pavia und Samir S. Shah gibt es kostenlos nur das Abstract.
Bernard Braun, 12.12.11
Amerikanische Kardiologen: Geld beeinflusst die Indikationsstellung für Belastungsuntersuchungen
 Ärzte reagieren in ihren diagnostischen und therapeutischen Entscheidungen auf finanzielle Anreize. Dieser durch zahlreiche Studien (hier eine Arbeit aus 1990) belegte Sachverhalt wird erneut durch eine kürzlich erschienene Studie bestätigt.
Ärzte reagieren in ihren diagnostischen und therapeutischen Entscheidungen auf finanzielle Anreize. Dieser durch zahlreiche Studien (hier eine Arbeit aus 1990) belegte Sachverhalt wird erneut durch eine kürzlich erschienene Studie bestätigt.
Untersucht wurde, inwieweit die Indikationsstellung für eine Belastungsuntersuchung bei Herzpatienten mit dem finanziellen Vorteil für den Arzt zusammenhängt. Abrechenbar und somit lukrativ ist die Durchführung der Untersuchung und ihre Befundung. Für beide Leistungen gibt es jeweils eine Abrechnungsziffer. Ein Arzt, der zur Untersuchung überweist und selbst weder durchführt noch befundet, kann dies nicht abrechnen - er verdient also nicht daran.
Der finanzielle Vorteil steigt in folgenden Stufen:
1) zur Untersuchung überweisen
2) Untersuchung befunden,
3) Untersuchung durchführen und befunden.
Bei den Patienten handelte es sich um Herzpatienten, die mindestens 90 Tage vor der Untersuchung eine koronaren Revaskularisation erhalten hatten, also einem Eingriff zur Überbrückung (Bypass) oder Aufdehnung (perkutane koronare Intervention, PCI) von Engstellen an den Herzkranzgefäßen. Die Studie prüfte, ob die Indikationsstellung zur Belastungsuntersuchung durch den Arzt mit dem Ausmaß des finanziellen Anreizes zusammenhängt.
Mit einer Belastungsuntersuchung soll der Blutfluss am Herzen und somit der Zustand der Herzkranzgefäße gemessen werden. Bei körperlicher oder durch ein Medikament hervorgerufener Belastung wird die Verteilung einer radioaktiven Substanz (z.B. Technetium 99) gemessen (Nuklearmedizinische Untersuchung) oder das Kontraktionsverhalten des Herzmuskels im Ultraschall beurteilt (Stress-Echokardiographie).
Die Daten von 17.847 Mitgliedern einer großen amerikanischen Krankenversicherung (United Healthcare) wurden ausgewertet, die zwischen November 2004 und Juni 2006 eine Belastungsuntersuchung nach Revaskularisation erhielten.
Insgesamt erhielten 12,2% der Patienten eine der beiden Belastungsuntersuchungen.
Ärzte der Stufe 3 stellten die Indikation für die Nuklearuntersuchung bei 12,6% ihrer Patienten, Ärzte der Stufe 2 bei 8,8% und Ärzte der Stufe 1 bei 5%. Diese "Dosis-Wirkungs-Beziehung" von finanziellem Anreiz und Durchführungsraten zeigte auch sich für die Stressechokardiographie mit 2,8%, 1,4% und 0,4%.
Auch die verfeinerten Auswertungen, die z.B. die Krankheitsschwere der Patienten berücksichtigten, bestätigten den Zusammenhang.
Das Fazit lautet, dass in dieser Studie die Ärzte die Indikation zur Belastungsuntersuchung nicht allein nach medizinischer Notwenigkeit stellen. Vielmehr folgen die Ärzte in der Indikationsstellung den finanziellen Anreizen.
Shah BR, Cowper PA, O'Brien SM, Jensen N, Patel MR, Douglas PS, et al. Association Between Physician Billing and Cardiac Stress Testing Patterns Following Coronary Revascularization. JAMA: The Journal of the American Medical Association 2011;306:1993-2000 Abstract
David Klemperer, 22.11.11
Neues aus Oregon: Was passiert, wenn arme Menschen ohne Krankenversicherungsschutz ihn per Lotterie doch erhalten?
 Wer künftig über die Wirkungen von Krankenversicherung auf das Verhalten von Menschen nicht mehr nur zwischen "moral hazard"- und "Gutmenschen"-Annahmen herumspekulieren will, kommt um die ersten Ergebnisse eines aktuellen Oregon-Experiments nicht herum.
Wer künftig über die Wirkungen von Krankenversicherung auf das Verhalten von Menschen nicht mehr nur zwischen "moral hazard"- und "Gutmenschen"-Annahmen herumspekulieren will, kommt um die ersten Ergebnisse eines aktuellen Oregon-Experiments nicht herum.
In ihm geht es darum, welche ökonomischen, sozialen und gesundheitlichen Effekte es haben könnte, wenn ab 2014 geplant - sofern der "Patient Protection and Affordable Care Act" der Obama-Administration nicht doch noch scheitert - ein Großteil der bisher nicht krankenversicherten und geringverdienenden US-AmerikanerInnen einen obligatorischen Krankenversicherungsschutz erhält. Herausbekommen will dies eines der typischen us-amerikanischen sozialen Experimente, mit dessen Durchführung der gesundheits- und sozialpolitisch (vgl. dazu die aktuell wie historisch interessante Website zum so genannten Oregon Health Plan aus den 1990er Jahren) schon immer besonders experimentierfreudige Us-Bundesstaat Oregon eine Reihe von WissenschaftlerInnen (die so genannte "The Oregon Health Study Group") beauftragte. Die meisten ForscherInnen arbeiten an der Harvard University in Boston und sind langjährige ExpertInnen im "National Bureau of Economic Research (NBER)". Unter ihnen auch der mit dem ähnlich innovativen "RAND Health Insurance Experiment" aus den 1970er Jahren über die Effekte von Zuzahlungen bekannt gewordene Joseph Newhouse.
Als erstes wurden aus der nicht- oder nur episodisch krankenversicherten geringverdienenden und nicht vermögenden Bevölkerung mittels einer Lotterie 29.589 Personen für die Interventionsgruppe und weitere 28.816 Personen für eine Kontrollgruppe gewonnen. Die Intervention bestand in der Aufnahme in die von den Bundesstaaten getragene Armen-Krankenversicherung Medicaid, in der diese Personen trotz eines möglichen Anspruchs ohne diese Auswahl nicht versichert waren.
Für bisher ein Jahr wurde dann mit administrativen Daten der Krankenversicherung und mit Surveys untersucht, ob und wie die Personen mit Krankenversicherungsschutz im Vergleich zu den Nichtversicherten verschiedene Gesundheitsversorgungsleistzungen in Anspruch nehmen, wie sich ihre gesundheitliche, soziale und finanzielle Situation verändert.
Die substantiellen und statistisch signifikanten Wirkungen des Versicherungsschutzes sehen u.a. folgendermaßen aus:
• Die Wahrscheinlichkeit einer Krankenhausaufnahme stieg um 30%
• Die Wahrscheinlichkeit, irgendein Medikament verordnet zu bekommen stieg um 15%
• Um 35% stieg die Wahrscheinlichkeit einer ambulanten Behandlung
• Die jährlichen Gesundheitsausgaben stiegen insgesamt um 25%.
• Erste Untersuchungen weisen darauf hin, dass es sich bei den Angehörigen der Interventionsgruppe um Personen handelt, die vorher unterversorgt waren und daher eventuell einen gewissen "Nachholbedarf" haben.
• Die erwünschte Inanspruchnahme präventiver Leistungen wie regelmäßige Mammographien oder Messungen des Cholesterinspiegels stieg deutlich an.
• Der Versicherungsschutz senkte die Häufigkeit der Erfahrungen mit durch Arztrechnungen bedingte Schulden und die Belastung durch "out-of-pocket"-Zahlungen für Medikamente etc. beträchtlich. Die Wahrscheinlichkeit, eine unbezahlte Arztrechnung zu haben, die der Gläubiger an eine Inkasso-Agentur geschickt hat, sank um 25%. Die Wahrscheinlichkeit irgendeiner "out-of-pocket"-Zahlung sank um 35%. Die ForscherInnen weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass diese Entwicklung sowohl den Versicherten als auch den Ärzten oder Krankenhäuser nützt. Letztere hatten nämlich nur selten Erfolg, ihre finanziellen Ansprüche einzutreiben.
• Schließlich stieg die Wahrscheinlichkeit, dass die Versicherten ihren Gesundheitszustand als gut oder exzellent bewerteten um 25%. Ähnlich sieht es beim Niveau des Wohlbefindens aus. Und auch die Häufigkeit einer bisher nur kleinen untersuchten Anzahl von Erkrankungen scheint niedriger zu sein: 10% nahm beispielsweise die Häufigkeit von Depressionen ab.
Die WissenschaftlerInnen wehren sich zu Recht dagegen, bereits jetzt abschließende Folgerungen für die möglichen Effekte der flächendeckenden Verbesserung des Versicherungsschutzes durch das Gesundheitsreformwerk der Obama-Administration zu ziehen. Was aber bereits deutlich wird, ist die enorme Breite und inhaltlich Unterschiedlichkeit der gleichzeitig zu erwartenden direkten und indirekten (z.B. die gesamtwirtschaftlichen Wirkungen geringerer Verschuldung aufgrund von Arztrechnungen) Wirkungen. Dies wird Prioritätensetzung und Abwägungen (z.B. Gesundheitsausgaben versus Gesundheitszustand) letztlich politischer und sozialer Art erfordern.
Ob sich die quantitativen und qualitativen Trends fortsetzen oder es sich beispielsweise bei einigen der Inanspruchnahme-Effekten um Nachhol- oder Starteffekte handelte und welche Assoziationen es z.B. zwischen dem Versicherungsschutz und der Inzidenz und Prävalenz weiterer einzelner Krankheiten gibt, will die Study-group mindestens noch in einem weiteren Jahr beobachten und analysieren. Auf die Ergebnisse darf man gespannt sein.
Die Ergebnisse des ersten Jahres sind in zwei Arbeitspapieren zusammengefasst und zugänglich. Das NBER-Arbeitspapier 17190 THE OREGON HEALTH INSURANCE EXPERIMENT: EVIDENCE FROM THE FIRST YEAR von Amy Finkelstein, Sarah Taubman, Bill Wright, Mira Bernstein, Jonathan Gruber, Joseph P. Newhouse, Heidi Allen, Katherine Baicker gibt es kostenlos.
Kostenlos erhältlich ist ebenfalls ein über die gerade genannte NBER-Website erreichbarer 87-Seiten-Appendix in dem neben diversen methodischen Erläuterungen, zahlreiche unkommentierte Ergebnistabellen, Statistiken und z.B. die Survey-Fragebögen enthalten sind.
Bernard Braun, 9.7.11
"Less is more" oder wie professionelle Verantwortung von Ärzten praktisch aussehen kann. Ein Beispiel aus den USA.
 Weniger Leistungen sparen nicht nur Geld oder verbessern den Gebrauch wertvoller klinischer Ressourcen, sondern führen auch zu mehr, nämlich weniger unerwünschten Wirkungen und zu einer höheren Behandlungsqualität! Klingt utopisch oder arg medizinkritisch? Und trotzdem ist es die Quintessenz eines mehrstufigen Entwicklungs- und Erprobungsprozesses in einer fest etablierten Gruppe us-amerikanischer Primärärzte, dessen Ergebnis drei so genannte "Top 5"-Listen für primärärztlich aktive Familienärzte, Internisten und Pädiater sind.
Weniger Leistungen sparen nicht nur Geld oder verbessern den Gebrauch wertvoller klinischer Ressourcen, sondern führen auch zu mehr, nämlich weniger unerwünschten Wirkungen und zu einer höheren Behandlungsqualität! Klingt utopisch oder arg medizinkritisch? Und trotzdem ist es die Quintessenz eines mehrstufigen Entwicklungs- und Erprobungsprozesses in einer fest etablierten Gruppe us-amerikanischer Primärärzte, dessen Ergebnis drei so genannte "Top 5"-Listen für primärärztlich aktive Familienärzte, Internisten und Pädiater sind.
Die Mitglieder dieser "Good Stewardship Working Group" trugen zuerst die wissenschaftliche Evidenz für eine Reihe von weit verbreiteten Behandlungskonzepten zusammen. Ein erster Entwurf von Empfehlungen, bestimmte Behandlungen zu unterlassen, wurde von 83 Primärärzten in ihren Praxen gründlich auf Machbarkeit, Vermittelbarkeit und auch das Eintreffen der erwünschten Wirkungen getestet. Eine überarbeitete Fassung dieser Empfehlungen wurde danach von einer zusätzlichen Runde von 172 Familien-, internistischen und Kinderärzten erneut getestet.
Zu den dann konsentierten 12 Aktivitäten, welche die klinische Behandlung verbessern konnten, gehörten z.B.:
• Das Unterlassen von bildgebenden Untersuchungen in den ersten 6 Wochen nach Auftreten von Rückenschmerzen - bis auf sehr seltene Ausnahmen.
• Keine Verordnung von Antibiotika bei milder oder moderater Sinusitis
• Keine Verordnung von jährlichen screeningmäßigen EKG- oder anderen Kardio-Untersuchungen bei asymptomatischen und Niedrigrisiko-Patienten
• Ausschließliche Verordnung von Statin-Generika wenn eine fettstoffsenkende Arzneimittel-Therapie begonnen wird.
• Keine "für-alle-Fälle"-Radiologie-Diagnostik bei kleineren Kopfverletzungen nach einem Sturz, wenn der Patient nicht das Bewusstsein verloren hat oder sonstige Risikofaktoren existieren.
• Beratung von Patienten, keine OTC-Präparate gegen Erkältungskrankheiten zu kaufen, da diese kaum erwünschte Wirkungen aber eine Menge unerwünschte Wirkungen haben.
In Kooperation mit Konsumentengruppen und Patientensicherheitsgruppen sollen die "Top 5"-Listen jetzt weiter verbreitet werden und dabei den Geruch von Rationierung verlieren. Dass dies auch vieler Überzeugungsarbeit bei und mit Patienten bedarf, ist den Verfassern dieser Listen bewusst, entmutigt sie aber nach den positiven Erfahrungen in den beiden Testläufen in keiner Weise.
Zu dem in der Online-Ausgabe der Fachzeitschrift "Archives of Internal Medicine" am 23. Mai 2011 veröffentlichten Aufsatz "LESS IS MORE. The "Top 5" Lists in Primary Care. Meeting the Responsibility of Professionalism" der The Good Stewardship Working Group gibt es kostenlos lediglich das Abstract.
Bernard Braun, 24.5.11
Ist selbst das "Profit vor Sicherheit"-US-System für Medizinprodukte besser als das deutsche "Profit mit Sicherheit"-System?
 Wer sich bisher vor allem mit den Abgründen der Zulassungsbestimmungen bei Arzneimitteln beschäftigt hat, könnte das Gefühl bekommen, vom Regen unter die Traufe zu geraten, wenn er sich eine Studie über die in den USA systematisch zu oberflächlichen Sicherheitsüberprüfungen bei Medizinprodukten anschaut, deren Versagen zu schweren gesundheitlichen Schäden, wenn nicht sogar zum Tode führen könnte.
Wer sich bisher vor allem mit den Abgründen der Zulassungsbestimmungen bei Arzneimitteln beschäftigt hat, könnte das Gefühl bekommen, vom Regen unter die Traufe zu geraten, wenn er sich eine Studie über die in den USA systematisch zu oberflächlichen Sicherheitsüberprüfungen bei Medizinprodukten anschaut, deren Versagen zu schweren gesundheitlichen Schäden, wenn nicht sogar zum Tode führen könnte.
In der Studie wurden 113 Rückrufe von Medizinprodukten einer bestimmten höheren Risikoklasse (darunter z.B. 35 Produkte für den Einsatz bei Herzerkrankungen) durch die dafür zuständige "Food and Drug Administration" (FDA) in den Jahren 2005 bis 2009 genauer untersucht. 81 % dieser Produkte wurden nicht den strengsten wissenschaftlichen PMA (premarket approvals)-Tests unterworfen, sondern nur durch wesentlich oberflächlichere Verfahren (vor allem mittels des so genannten "510(k) process") überprüft. Dies bedeutet u.a., dass nie untersucht wurde, wie diese zum Teil hochkomplexen Produzkte an und im Menschen wirken und möglicherweise eben auch schaden. Für einen Teil der Produkte gibt es schließlich gar keine Regulierung. Aber auch wenn Sicherheitsüberprüfungsvorschriften existieren und angewandt werden müssen, kommt es z.B. zu der sicherheitsrelevant absurden Gleichbehandlung eines Teils der Hüft- und Knieimplantate mit den Reinigungslösungen für Kontaktlinsen.
Wer nun als deutscher potenzieller Nutzer von Medizinprodukten die US-BürgerInnen zu bemitleiden be-ginnt, reagiert vorschnell und sollte sich seine Tränen für die Zeit nach Kenntnis der deutschen Zulassungswirklichkeit für Medizinprodukte aufsparen. Wie diese aussieht wird bereits daran sichtbar, dass US-Hersteller die viel raschere Zulassung ihrer Produkte in den meisten europäischen Ländern argumentativ für ihre Forderung nutzen, das US-System zu liberalisieren. Und in der Tat ist z.B. das deutsche Modell nach dem Medizinproduktegesetz (MPG) u.a. dadurch herstellerfreundlicher, dass die Zulassung über die Vergabe der so genannten CE-Bezeichnung (vgl. dazu die §§ 6 ff. des MPG) für das Inverkehrbringen im EU-Raum nicht durch eine staatliche Behörde, sondern durch meist privatwirtschaftliche und gewinnorientierte so genannte "benannte Stellen" erfolgt, die diese Produkte gegen entsprechende Gebühren zertifizieren. Das öffentliche, d.h. dem Gemeinwohl verpflichtete "Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte" wird erst dann aktiv, wenn es zu Schäden etc. von Medizinprodukten kommt. Ausländische Hersteller können außerdem ihre Produkte für den EU-Wirtschaftsraum von jedem dazu befugten Institut in einem Mitgliedsland der EU zertifizieren lassen und dabei ein offen genanntes Gefälle der Prüfintensität innerhalb des EU-Wirtschaftsraums nutzen.
Ohne dass in Europa und Deutschland bisher unabhängig untersucht wurde, ob und welche erwünschten oder auch unerwünschte Wirkungen das CE-Zertifizierungssystem für Medizinprodukte auf Patienten aber auch Beschäftigte in Gesundheitseinrichtungen hat, zeigt der Nachweis, dass in Europa US-Produkte zuge-lassen werden, die in ihrem Herstellungsland noch nicht, nur nach einer oberflächlichen Prüfung oder viel-fach umstritten auf dem Markt sind, den nicht besonders vertrauenerweckenden Zustand des CE-Systems. Eine naheliegende Erklärung, dass es sich hierbei um eine Art versteckte Wirtschaftsförderungspolitik handelt, ist insofern möglich, weil die Medizintechnikbranche Deutschlands, mit der Firma Siemens an der Spitze, die weltweite Nummer 3 der Branche ist. Dass es wahrscheinlich noch etwas komplizierter ist, zeigt die Tatsache, dass auf Platz 1 der Medizintechnikbranche die USA und auf Platz 2 Japan stehen und zumindest in den USA etwas herstellerkritischer nach der Produktqualität geschaut wird als in Deutschland.
Von dem im Februar 2011 zuerst online veröffentlichten Aufsatz "Medical Device Recalls and the FDA Approval Process" von Diana M. Zuckerman, Paul Brown und Steven E. Nissen (in "Archives of Internal Medicine" 14, 2011. doi:10.1001/archinternmed.2011.30) gibt es kostenlos lediglich ein Abstract.
Bernard Braun, 7.3.11
USA: Wohnort entscheidet über die Zahl der Diagnosen
 Geographische Unterschiede in der Versorgung werfen Fragen nach der Versorgungsqualität, erlauben jedoch keine einfachen Antworten (wir berichteten).
Geographische Unterschiede in der Versorgung werfen Fragen nach der Versorgungsqualität, erlauben jedoch keine einfachen Antworten (wir berichteten).
Eine kürzlich veröffentlichte amerikanische Studie befasste sich mit der Frage der Verlässlichkeit der gestellten Diagnosen. Regional unterschiedliche Vorgehensweisen in der Diagnostik könnten zu regionalen Unterschieden in der Zahl der Diagnosen führen. So könnte der in manchen Regionen stärkere Einsatz diagnostischer Methoden wie Labortests und bildgebender Verfahren bei gleichem Gesundheitszustand durch eine höheren Zahl an Diagnosen zu scheinbaren regionalen Unterschieden des Gesundheitszustands führen.
Grundlage der Analyse war die Intensität der Versorgung mit Medizinischen Leistungen in den 303 Medicare-Versorgungsregionen. Die Versorgungsintensität wurde für die Regionen mit dem "End-of-Life Expenditure Index" gemessen. Der End-of-Life Expenditure Index erfasst die durchschnittlichen Ausgaben der Versicherten von 65 oder mehr Jahren in einer Region in den 6 letzten Monaten ihres Lebens (adjustiert für Alter, Geschlecht und Ethnie). Die 303 Regionen wurden entsprechend der Versorgungsintensität in Quintile also in fünf gleich große Gruppen aufgeteilt, die unterste Quintile mit der niedrigsten und die oberste mit der höchsten Versorgungsintensität.
Aus den Medicare-Daten ist bekannt, dass bei Versicherten mit Wohnsitz in einer Region mit höherer Versorgungsintensität eine höhere Zahl chronischer Krankheiten diagnostiziert wird. Ziel der Studie war die Klärung der Frage, ob dies Ausdruck von tatsächlichen Unterschieden im Gesundheitszustand ist oder bei gleichem Gesundheitszustand die Folge der stärkeren diagnostischen Aktivität.
Methodisch nutzen die Forscher ein "natürliches Experiment". Ein Teil der Medicare-Versicherten wechselt den Wohnsitz und zieht in eine Region mit höherer oder niedrigerer Versorgungsintensität. Es stellt sich die Frage, ob sich bei diesen Versicherten die Zahl an Untersuchungen und Diagnosen entsprechend verändert. Dafür wurden die Leistungsdaten von 225.726 Medicare-Versicherten ausgewertet, die in den Jahren 2001 bis 2003 ihren Wohnsitz wechselten. Versicherte, die in eine Region mit höherer Versorgungsintensität zogen wurden mit Versicherten verglichen, die in eine Region mit niedrigerer oder gleicher Versorgungsintensität zogen.
Es zeigte sich, dass der Umzug in eine Region mit höherer Versorgungsintensität tatsächlich zu einem Anstieg diagnostischer Untersuchungen, zur Erhöhung der Anzahl der Diagnosen und zu höherer Risikoklassifikation führte im vergleich zu den Personen, die in eine Region mit gleicher oder niedrigerer Versorgungsintensität. führte. Dieser Anstieg ging weit über den bei zunehmendem Alter bestehenden Trend hinaus.
Die Studie zeigt, dass in den USA substantielle geographische Unterschiede in der diagnostischen Praxis bestehen, die nicht durch Patientenmerkmale erklärbar sind. Der Wohnort hat somit Einfluss auf die Zahl diagnostischer Untersuchungen und die Zahl der Diagnosen eines Medicare-Versicherten.
Song Y, Skinner J, Bynum J, Sutherland J, Wennberg JE, Fisher ES. Regional Variations in Diagnostic Practices. N Engl J Med 2010:NEJMsa0910881 Download
David Klemperer, 15.6.10
Falsche Annahmen führen zu Skepsis gegenüber der Evidenzbasierten Medizin
 Evidenzbasierte Medizin zielt darauf ab, dass Patienten Entscheidungen treffen, nach dem sie die Evidenz bezüglich der für sie relevanten Behandlungsergebnisse mit ihren Präferenzen in Einklang gebracht haben. Eine gerade in der Zeitschrift Health Affairs erschienene Studie liefert Evidenz dafür, dass unter den Nutzern des amerikanischen Gesundheitssystems noch Annahmen und Vorstellungen weit verbreitet sind, die der Umsetzung einer evidenzbasierten Medizin im Wege stehen.
Evidenzbasierte Medizin zielt darauf ab, dass Patienten Entscheidungen treffen, nach dem sie die Evidenz bezüglich der für sie relevanten Behandlungsergebnisse mit ihren Präferenzen in Einklang gebracht haben. Eine gerade in der Zeitschrift Health Affairs erschienene Studie liefert Evidenz dafür, dass unter den Nutzern des amerikanischen Gesundheitssystems noch Annahmen und Vorstellungen weit verbreitet sind, die der Umsetzung einer evidenzbasierten Medizin im Wege stehen.
Die Wissenschaftler um Kristin Carman sammelten Daten mit Hilfe eines Methodenmix aus konventionellen Interviews, Fokusgruppeninterviews und einer webbasierten Befragung von 1.558 Nutzern des Gesundheitssystems.
Die Ergebnisse sind nicht einheitlich, zeigen aber, dass falsche Annahmen wie die folgenden, weit verbreitet sind:
• Mehr Behandlung ist besser als weniger Behandlung.
• Neue Behandlungsmethoden sind besser als alte Behandlungsmethoden.
• Was weniger kostet ist schlechter.
• Die besten Behandlungsmethoden sind auch die teuersten.
• Eine Behandlungen, die wenig Geld kostet, ist einer teuren Behandlung unterlegen.
Mit Begriffen wie medizinische Evidence, Leitlinien und Qualitätsstandards wussten viele Befragte wenig anzufangen.
Falsche Vorstellungen finden sich auch zur Versorgungsqualität. So meinen viele Befragte, dass alle Ärzte bestimmte Qualitätsstandards stets erfüllen und Behandlung unterhalb der Standards nicht möglich sei. Leitlinien werden als rigide Instrumente wahrgenommen, welche die Ärzte daran hinderten, ihre Erfahrung dem individuellen Patienten zukommen zu lassen.
Aus diesen und weiteren Ergebnissen folgern die Autoren: "Unsere Studie zeigt, dass es kritische Lücken im Wissen der Nutzer gibt, die unsere Anstrengungen behindern, die Nutzer zu einer evidenzbasierten Gesundheitsversorgung zu ermutigen." Es gebe aber auch ermutigende Zeichen: "Eine kleine aber signifikante Minderheit der Befragten stimmt den grundlegenden Annahmen der evidenzbasierten Versorgung zu und möchte sich aktiv und informiert an Entscheidungen beteiligen, die sie selbst betreffen."
Auf Grundlage dieser Ergebnisse haben die Wissenschaftler einen Werkzeugkasten mit Lehr- und Informationsmaterialien entwickelt.
Carman KL, Maurer M, Yegian JM, Dardess P, McGee J, Evers M, et al. Evidence That Consumers Are Skeptical About Evidence-Based Health Care. Health Affairs 2010:hlthaff.2009.0296. Download Volltext
American Institutes for Research. The communication toolkit: using information to get high quality care Website
David Klemperer, 3.6.10
Ursachen für regionale Versorgungsunterschiede in den USA
 Im amerikanischen Gesundheitswesen werden schon seit mehreren Jahrzehnten regionale Versorgungsunterschiede ("geographical variations") untersucht und diskutiert. Ausgangspunkt war die Beobachtung von John Wennberg, einem der Begründer dieser Forschungsrichtung, dass der Anteil der Kinder, denen bis zum 15. Lebensjahr die Rachenmandeln entfernt waren, im Schulbezirk seiner Kinder 20% und im benachbarten Schulbezirk 70% betrug. Offensichtlich ist bei diesem Beispiel, dass unterschiedliche Krankheitshäufigkeiten eher wenig zur Erklärung dieses Unterschiedes beitragen. Erste Ergebnisse veröffentlichte Wennberg 1973 in Science unter dem Titel " Small Area Variations in Health Care Delivery".
Im amerikanischen Gesundheitswesen werden schon seit mehreren Jahrzehnten regionale Versorgungsunterschiede ("geographical variations") untersucht und diskutiert. Ausgangspunkt war die Beobachtung von John Wennberg, einem der Begründer dieser Forschungsrichtung, dass der Anteil der Kinder, denen bis zum 15. Lebensjahr die Rachenmandeln entfernt waren, im Schulbezirk seiner Kinder 20% und im benachbarten Schulbezirk 70% betrug. Offensichtlich ist bei diesem Beispiel, dass unterschiedliche Krankheitshäufigkeiten eher wenig zur Erklärung dieses Unterschiedes beitragen. Erste Ergebnisse veröffentlichte Wennberg 1973 in Science unter dem Titel " Small Area Variations in Health Care Delivery".
Unterschiede in der Versorgung wurden in der Folge für viele Aspekte des Leistungsgeschehens auf unterschiedlichen geographischen Aggregationsebenen nachgewiesen. Diese zu erklären ist nicht einfach. Zu einfach ist in jedem Fall die Deutung, regionale Unterschiede entsprächen grundsätzlich fehlender Effektivität. Dieses Interview mit John Wennberg führt sehr anschaulich in die Materie ein. Der Dartmouth Atlas, über den wir bereits berichteten, bietet die bislang differenzierteste Darstellung und Erklärung des Variation-Phänomens. Angebotsinduzierte Nachfrage ("supply-sensitive care") und präferenzsensitive Versorgung("preference sensitive care") sind zwei Schlüsselkonzepte zur Erklärung der Unterschiede.
Eine vor kurzem im New England Journal of Medicine veröffentlichte Studie ging der Frage vertiefend nach, inwieweit regionale Unterschiede der Medicare-Ausgaben durch demographische Faktoren oder durch Unterschiede im Gesundheitszustand der Versicherten in Regionen unterschiedlicher Ausgabenhöhe erklärbar sind.
Dafür wurden entsprechend ihrer Ausgabenhöhe pro Medicare-Versicherten die geographischen Versorgungsbereiche ("Hospital Referral Regions") in fünf zahlenmäßig gleiche Gruppen (Quintile) eingeteilt. Differenzierte Leistungsdaten stammen aus Interviews mit 6725 Leistungsempfängern bzw. ihren Angehörigen (Medicare Current Beneficiary Survey).
Die Durchschnittsausgaben pro Mitglied betrugen $4.721 in der untersten und $7.183 in der obersten Quintile - entsprechend einer Differenz von 52%.
Zur Erklärung der Unterschiede wurden folgende Variablen in einem Rechenmodell berücksichtigt:
• der Gesundheitszustand zum Ausgangszeitpunkt - selbst-berichtete Gesundheit, Rauchstatus, Bodymass index, Diabetes mellitus, Hypertonie, Herzinfarkt, Koronare Herzkrankheit, andere Herzkrankheiten, Schlaganfall, Krebs außer Hautkrebs und
• Veränderungen der Gesundheit - Tod, neue Diagnosen im Beobachtungsjahr aus dem Bereich der oben genannten
• demographische Parameter - Alter, Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit, Wohnort Stadt bzw. Land,
• weitere individuelle Determinanten der Nachfrage - Einkommen, Zusatzversicherungen
• regionale Maße der Angebotsstruktur - Krankenhausbetten und Ärzte pro 1.000 Ältere, Anteil der Ärzte in der Primärversorgung, Anzahl der Krankenhausärzte pro Bett
Der Einbezug der demographischen Merkmale und des Gesundheitszustandes zum Ausgangszeitpunkt minderte die Ausgabendifferenz von 52% auf 40%. Dem liegt u.a. zugrunde, dass der Anteil der Personen, die einen schlechten Gesundheitszustand angeben in der Quintile mit den höchsten Ausgaben 7,9%, in der Quintile mit den niedrigsten Ausgaben 4,5% beträgt.
Nach zusätzlicher Berücksichtigung der Veränderung der Gesundheit beträgt die Differenz noch 33%. Die Variable Zusatzversicherungen unterschied sich in den Gruppen deutlich (statistisch signifikant), wirkte sich aber nur gering auf die Ausgabenunterschiede aus. Die Variablen jährliches Familieneinkommen und die Variablen, die sich auf die Angebotsseite der Versorgung beziehen, unterschieden sich in den Ausgabenregionen kaum.
Das Fazit lautet, dass Unterschiede in den demographischen Faktoren und im Gesundheitszustand einen großen Anteil der geographischen Ausgabenunterschiede erklären. Ein erheblicher Teil der Ausgabenunterschiede - mehr als 60% - bleibt jedoch unerklärt.
Die Autoren nennen hier als mögliche Ursachen u.a. die Marktstruktur, das Profitstreben der Anbieter, kulturelle oder soziale Präferenzen der Versicherten und Unterschiede im Gesundheitszustand, die mit den bisherigen Methoden noch nicht erfasst wurden. So wurden bisher der Schweregrad der Erkrankung und das gleichzeitige Vorhandensein mehrerer Erkrankungen (Multimorbidität) nicht berücksichtigt.
Diese Studie zeigt, dass die geographischen Versorgungsunterschiede wichtige Hinweise zur Analyse des Versorgungsgeschehens geben, die jedoch nicht direkt zu einfachen Lösungen führen. Nicht Teil der Fragestellung dieser Arbeit war es, inwieweit die Versorgung auf der aktuellsten und besten Evidenz und auf den Präferenzen informierter Patienten beruht. Hier sind Defizite zu vermuten. Zu bedenken ist auch, dass sich Qualitätsprobleme, die sich gleichmäßig auf die Regionen verteilen, bei dieser Art der Analyse nicht zeigen.
• Zuckerman S, Waidmann T, Berenson R, Hadley J. Clarifying Sources of Geographic Differences in Medicare Spending. N Engl J Med 2010:NEJMsa0909253. Download Volltext
• The Dartmouth Atlas of Healthcare -Website
• Mullhan F (2004). Wrestling with Variation: An interview with Jack Wennberg. Health Affairs; Web Exclusive: (7October 2004) Download Volltext
• Wennberg J, Gittelsohn A. Small Area Variations in Health Care Delivery: A population-based health information system can guide planning and regulatory decision-making. Science 1973;182(4117):1102-08 Abstract".
David Klemperer, 3.6.10
US-Studie: Haben Arztpraxen zu wenig Patienten für gute Qualitätssicherung der Behandlung einer Vielzahl von Erkrankungen?
 Der § 135a SGB V verpflichtet ausdrücklich Vertragsärzte, medizinische Versorgungszentren, zugelassene Krankenhäuser und Erbringer von Vorsorgeleistungen oder Rehabilitationsmaßnahmen dazu, ihre Leistungen nach dem "jeweiligen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse ... und in der fachlich gebotenen Qualität" zu erbringen.
Der § 135a SGB V verpflichtet ausdrücklich Vertragsärzte, medizinische Versorgungszentren, zugelassene Krankenhäuser und Erbringer von Vorsorgeleistungen oder Rehabilitationsmaßnahmen dazu, ihre Leistungen nach dem "jeweiligen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse ... und in der fachlich gebotenen Qualität" zu erbringen.
Sie sollen sich dazu an "einrichtungsübergreifenden Maßnahmen der Qualitätssicherung ... beteiligen, die insbesondere zum Ziel haben, die Ergebnisqualität zu verbessern und einrichtungsintern ein Qualitätsmanagement" einführen. So weit, so gut und sicherlich ein gewaltiger Fortschritt gegenüber der Vergangenheit.
Die Frage, wie z.B. Einzelarztpraxen dies praktisch schaffen und ob sie überhaupt von ihren Strukturbedingungen in der Lage sind, dem hohen Anspruch genügen zu können, ist nach der Veröffentlichung einer Studie, welche die Möglichkeit us-amerikanischer niedergelassener Ärzte, die dortigen Anforderungen an Qualitätssicherung zu erfüllen, untersuchte, eine absolut berechtigte.
Die US-Forscher fanden nämlich nach der Analyse der Anzahl von Patienten mit ausgewählten Behandlungsanlässen oder Diagnosen und dem damit in Allgemein-/Hausarztpraxen und -zentren verbundenen Aufwand folgendes für die Qualitätssicherungsrealität heraus:
• Will man der Qualitätssicherung im Medicaresystem der USA statistisch zuverlässige, d.h. mindestens 10% betragende Unterschiede in Kosten und Behandlungsqualität zugrundelegen, und dies z.B. bei der Mammographierate von Frauen im Alter zwischen 66 und 69 Jahren, der Bestimmung des HbA(1c)-Wertes bei 66-75-jährigen Diabetikern, der Rate vermeidbarer Hospitalisierung und der Rate der stationären Wiederaufnahme nach Entlassung bei kongestiver Herzinsuffizienz., müssen die Praxen eine beträchtliche Anzahl von Patienten mit der jeweiligen Erkrankung behandeln.
• Die Versorgungszentren und Arztpraxen der Primärversorgung behandelten im jährlichen Mittel insgesamt 260 Medicare-Patienten 25 Mammographie-Patientinnen, 30 Diabetespatienten mit Hämoglobin A(1c)-Bestimmung und 0 Patienten mit Hospitalisierung wegen kongestiver Herzinsuffizienz.
• Bei der Mammographierate und der Hämoglobin A(1c)-Bestimmung lag der Anteil von Praxen mit ausreichender Patientenfallzahl bei Praxen mit weniger als 11 Primärärzten unter 10% und erst bei Praxiszentren mit mehr als 50 Ärzten bei 100%. Keine der Praxen der Primärversorgung hatte genügend Patienten, um 10%-ige Qualitätsunterschiede hinsichtlich vermeidbarer Hospitalisierung oder Wiederaufnahme bei kongestiver Herzinsuffizienz innerhalb von 30 Tagen zu erfassen.
• Viele Einzelarztpraxen und auch relativ viele kleine bis mittlere primärärztliche Versorgungszentren haben also eine ausreichende große Patientenfallzahlen, um die übliche Bestimmung von Behandlungsqualität und Kosteneffizienz mit 10%-igen Unterschiede bei Medicare-Patienten mit kostenfreier Behandlung verlässlich durchführen zu können. Damit fehlt ihnen aber ein wichtiges Datum für Qualitätssicherung oder -management bei vielen ihrer Patienten, das sie auch durch eine Absenkung der quantitativen Anforderungen an die Patientenzahl unter die 10-Prozentmarke nicht generieren können.
Wie fast immer, gibt es für den Bereich der ambulanten ärztlichen Behandlung in Deutschland (noch) keine vergleichbare Untersuchung und daher auch keine spezifischen Daten. Wie mehrere Analysen der letzten Jahre zeigten, konzentriert sich das Krankheitsgeschehen der meisten Patienten von Allgemeinärzten zwar auf relativ wenig Diagnosen. Dahinter verbergen sich aber vor allem in der durchschnittlichen Einzelarztpraxis (2005 waren noch 63% aller Praxen Einzelpraxen, was mittlerweile weniger sein dürften) eine je nach Diagnose absolut rasch kleiner werdende Anzahl von Personen, die eine Qualitätsüberprüfung auf dem US-Niveau der 10%-Unterschiede auch unmöglich machen:
• In der DETECT-Studie von 2007 war die häufigste Diagnose der Bluthochdruck, der bei 35,5% der TeilnehmerInnen an einer Basisuntersuchung diagnostiziert wurde. Auf den weiteren Häufigkeitsrängen landeten erhöhte Bluttfertwerte (29,5%), Übergewichtigkeit/Adipositas (32,9%) oder die koronare Herzkrankeit (12,1%). Depressionen waren mit 10,6% schon seltener und völlig selten war in einer ambulanten Praxis der Schlaganfall (1,7%).
• Im Praxenpanel des "Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung in der Bundesrepublik Deutschland" (ZI-ADT-Panel) der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, das für eine ausgewählte Anzahl von 58 Allgemeinarztpraxen (darunter 49 Einzelpraxen) im KV-Bezirk Nordrhein das Diagnosenspektrum dokumentiert, sah dies im I.Quartal 2008 bei 71.915 PatientInnen so aus: Auf Platz 1 stand auch die essentielle (primäre) Hypertonie (30,9% der PatientInnen), gefolgt von Störungen d. Lipoproteinstoffwechs. u.sonst.Lipidämien (22,9%), Rückenschmerzen (14,3%), Sonstigen nichttoxische Struma (9,8%), der chronischen ischämischen Herzkrankheit (9,8%), dem nicht primär insulinabhäng. Diabet. mell.[Typ-2-Diab.] (9,3%), der Adipositas (8,1%), der akut.Infektion.mehrer.od.n.n.bez.Lokalis.d.ob.Atemwege (7,9%), der sonst. Krankh. v. Wirbelsäule/Rücken, and.nicht klass. (7,1%) und der Gastritis und Duodenitis (6,9%). Auf Platz 25 befand sich dann die Herzinsuffizienz (4,3%) und auf dem letzten Platz 29 somatoforme Störungen (Störungen, die sich eindeutig auf körperliche Störungen zurückführen lassen wie z.B. Erschöpfung,Müdigkeit und bestimmte Schmerzen), die bei 3,8% der PatientInnen von Allgemeinärzten/Hausärzten auftraten. Berücksichtigt man, dass das ZI (siehe dazu den faktenreichen Vortrag eines ZI-Mitarbeiters auf der 54. Gmds-Jahrestagung 2009) eine durchschnittliche Anzahl von 2.045 Patienten pro Praxis (Mehrfachzählungen möglich) im gesamten Jahr 2008 angibt, haben die meisten Praxen bei den meisten Krankheiten zu wenig Patienten für eine methodisch hochwertige Qualitätskontrolle und -sicherung.
Damit besteht trotz der guten normativen Ausgangssituation im deutschen Gesundheitssystem die Gefahr, dass sich Qualitätsmanagement weiter und überwiegend in Untersuchungen zur Struktur- und bestenfalls Prozessqualität erschöpft und mit dem Anbringen von Zertifikaten und Plaketten endet.
Die Ergebnisqualität als wichtigster Indikator für Qualität bliebe dabei - nur jetzt wegen nicht ausreichender Fälle bzw. Patienten - im Dunkeln. Wenn sich dies bewahrheitet, muss sich der Gesetzgeber und die gemeinsame Selbstverwaltung von Krankenkassen und Ärzten rasch einfallen lassen, ob dies mit den einrichtungsübergreifendenb Maßnahmen doch machbar ist oder was sonst noch passieren müsste, um die zitierten Normen und Ziele umsetzen zu können.
Zu der US-Studie "Relationship of primary care physicians' patient caseload with measurement of quality and cost performance" von Nyweide DJ, Weeks WB, Gottlieb DJ, Casalino LP und Fisher ES, die im "Journal of American Medical Association (JAMA)" am 9. Dezember 2009 (302(22):2444-50) erschienen ist, gibt es kostenlos nur ein Abstract.
Einige Auszüge zum Diagnosenspektrum aus dem Buch "Detect: Ergebnisse einer klinisch-epidemiologischen Querschnitts- und Verlaufsstudie mit 55.000 Patienten in 3.000" von Wittchen H.U. und Pieper L. gibt es kostenlos im Internet zum Lesen.
Einige Daten aus dem ZI-ADT-Panel I. Quartal 2008 des Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in der Bundesrepublik Deutschland gibt es kostenlos.
Bernard Braun, 16.3.10
"Take-it-or-leave-it" für Ärzte und Versicherte: Rasche Konzentration der US-Krankenversicherer zu regionalen Fastmonopolen
 Wer meint, die von der Obama-Administration immer noch gewollte Gesundheitsversicherungsreform würde den Staat so stark machen, dass der Wettbewerb ver- oder behindert würde und damit auch dessen propagierten Vorteile für die Kosten und die Qualität der Leistungen, täuscht sich gewaltig: Hier gibt es nämlich gar nicht mehr viel zu verhindern!
Wer meint, die von der Obama-Administration immer noch gewollte Gesundheitsversicherungsreform würde den Staat so stark machen, dass der Wettbewerb ver- oder behindert würde und damit auch dessen propagierten Vorteile für die Kosten und die Qualität der Leistungen, täuscht sich gewaltig: Hier gibt es nämlich gar nicht mehr viel zu verhindern!
Der am 23. Februar 2010 erschienene Bericht "Competition in health insurance: A comprehensive study of U.S. markets" der "American Medical Association (AMA)" über die Verhältnisse auf dem Markt für private Krankenversicherung der USA im Jahr 2009 vermittelt nämlich ein völlig anderes Bild vom Status quo des Wettbewerbs:
• In 99% der 313 städtischen Ballungsgebiete der USA herrschen bei den Krankenversicherungsunternehmen bzw. Anbietern von "health plans" nach den Kriterien des "U.S. Department of Justice" und der "Federal Trade Commission" "highly concentrated" Verhältnisse. Der Konzentrationsgrad wird mit dem so genannten "Herfindahl-Hirschman-Index (HHI)" gemessen, der durch die Division der in einem Ort aktiven Unternehmen und ihren relativen Marktanteilen gemessen wird und von 0 bis 10.000 reichen kann. Nach den Regeln des US-amerikanischen Justizministeriums gelten Märkte, in denen sich der HHI zwischen 1.000 und 1.800 bewegt, als mäßig konzentriert, und Märkte, in denen der HHI die Grenze von 1.800 übersteigt, als konzentriert. Nur Miami und Fort Lauderdale in Florida und Colorado Springs in Colorado gab es danach keinen hochkonzentrierten Versicherungsmarkt.
• Dabei nahm der Konzentrationsprozess und damit die Abnahme der Wahlmöglichkeiten für Krankenversicherte sogar gerade in jüngster Zeit zu. Im Vorjahresbericht betrug der Anteil der Ballungsgebiete erst 94%.
• In 24 von 43 Bundesstaaten für die diese Daten vorlagen, beherrschte ein Versicherer einen Anteil des Krankenversicherungsmarktes von 70% und mehr. Im Vorjahr war dies erst in 18 der damals untersuchten 42 Bundesstaaten so.
• In 92% der 313 großstädtischen Märkte hielt jeweils ein Versicherungsunternehmen mindestens einen 30%-Anteil des Marktes.
• Angesichts der von mehreren goßen Versicherungsunternehmen um bis zu 39% erhöhten Krankenversicherungsprämien, charakterisieren die AMA-Autoren die Entwicklung so: 2008 erlaubte ihre Marktdominanz vielen privaten Krankenversicherungen Ärzten so genannte "take-it-or-leave-it"-Verträge anzubieten. 2009 erlaubte ihnen der Konzentrationsgrad auf den großstädtischen Märkten, Patienten "take-it-or-leave-it"-Preise anzubieten.
Trotz einiger Versuche der Krankenversicherer, das Problem klein zu reden, fasste der AMA-Präsident J. Rohack die Situation so zusammen: The near total collapse of competitive and dynamic health insurance markets has not helped patients. As demonstrated by proposed rate hikes in California (um rund 39%) and other states, health insurers have not shown greater efficiency and lower health care costs. Instead, patient premiums, deductibles and co-payments have soared without an increase in benefits in these increasingly consolidated markets."
Nicht nur, weil sich in der Bundesrepublik jüngst das Kartellamt um das möglicherweise oligopolartig, wettbewerbswidrig abgestimmte Verhalten einiger gesetzlichen Krankenkassen bei der Einführung von Zusatzbeiträgen kümmert, sondern angesichts der rasanten Fusion vieler Krankenkassen zu immer größeren Einheiten, ist eine Diskussion um den politisch gewollten und gesetzlich seit 1993 immer weiter ausgebauten Wettbewerb der Krankenkassen als Körperschaften öffentlichen Rechts und um die ebenfalls politisch gewollte und gesetzlich geregelte Verhinderung unerwünschter Folgen von Monopolen und Oligopolen hierzulande überfällig.
Wenn es weiter, und daran zweifelt niemand, zu Fusionen à la Barmer/GEK oder DAK/Hamburg-Münchner kommt, werden bald auf vielen regionalen Versicherungs- und Anbietermärkten Oligopole der genannten Großkassen zusammen mit der AOK existieren, die bestimmte Konditionen ohne jeglichen Wettbewerb absprechen, bestimmen oder auch diktieren können. Dass dies nur erwünschte Wirkungen auf die Preise und die Qualität der kontraktierten Leistungen hat, ist wahrscheinlich blauäugig. "Take-it-or-leave-it" für jedermann könnte ohne prinzipielles Gegensteuern und Umstruktieren auch in der GKV bald das Geschehen bestimmen.
Leider ist nur eine Zusammenfassung der AMA-Studie "Competition in health insurance: A comprehensive study of U.S. markets, 2009 update" kostenlos erhältlich. Wer die 41 Seiten komplett lesen will, muss dafür als Nichtmitglied der AMA 150 US-Dollar bezahlen.
Bernard Braun, 11.3.10
USA: Beratende Sachverständige für HPV- und Schweinegrippe-Impfung hatten mehr Interessenkonflikte als Unabhängigkeit
 Als die dafür zuständigen staatlichen "Centers for Disease Control and Prevention (CDC)" im Jahr 2007 u.a. Berater bzw. "special Government employees (SGE)" in die Beratungsgremien ("Federal advisory committees (committees)" beriefen, welche die Gesundheitsbehörden bei der Einführung solch wichtiger, teurer und möglicherweise folgenreicher Interventionen wie der HPV-Impfung gegen Zervikalkrebs sowie der Gestaltung des aktuellen Schweinegrippe-Impfprogramms beraten und bewerten sollten, machten sie in den Worten eines gerade in der "New York Times" vom 17. Dezember 2009 erschienene Analyse "a poor job".
Als die dafür zuständigen staatlichen "Centers for Disease Control and Prevention (CDC)" im Jahr 2007 u.a. Berater bzw. "special Government employees (SGE)" in die Beratungsgremien ("Federal advisory committees (committees)" beriefen, welche die Gesundheitsbehörden bei der Einführung solch wichtiger, teurer und möglicherweise folgenreicher Interventionen wie der HPV-Impfung gegen Zervikalkrebs sowie der Gestaltung des aktuellen Schweinegrippe-Impfprogramms beraten und bewerten sollten, machten sie in den Worten eines gerade in der "New York Times" vom 17. Dezember 2009 erschienene Analyse "a poor job".
Dieses herbe Urteil stützt sich auf einen 54 Seiten umfassenden Bericht des Inspector General des "Department of Health and Human Services (HHS)" der USA, Daniel Levinson, der am selben Tag erschienen war.
Nach diesem Bericht wies das Auswahlverfahren so ziemlich alle denkbaren und potenziell folgenreichen Fehler und Versäumnisse auf, die man sich ausmalen kann. In diesem Auswahlverfahren geht es vor allem darum, einen vollständigen Überblick über mögliche finanziellen Vorteile zu erhalten, welche die Sachverständigenräte von den Firmen erhalten oder erhalten könnten, die von den Entscheidungen der Sachverständigen profitieren oder eben auch nicht. Um sich diesen Überblick verschaffen zu können, wertete Levinson die so genannten "Confidential Financial Disclosure Reports" des Office of Government Ethics (OGE) bzw. die "Forms 450 and ethics agreements" für 246 beratende Sachverständige in 17 CDC- Komitees im Jahr 2007 aus.
Der staatliche Kontrolleur fand vor allem folgende Probleme:
• In 97% der OGE-Formblätter 450 gab es mindestens eine Lücke oder einen erkennbaren Irrtum. Die meisten Fragebögen für die Mitglieder der Kommissionen hatten mehr als eine Auslassung. Die CDC kümmerte sich offensichtlich nicht darum, diese Lücken zu schließen. Die meisten dieser Panel-Mitglieder arbeiten bis in die Gegenwart hinein in einem der zahlreichen CDC-Komitees beratend und entscheidend mit.
• 64% der SGE hatten potenzielle Interessenkonflikte, welche die CDC nicht identifiziert oder nicht gelöst hatten bevor sie diese Personen zertifizierte und als Ratgeber zuließ. 58% der zertifizierten SGEs hatten mindestens einen potenziellen Konflikt, den die CDC nicht merkten. 32% der zertifizieren und damit zugelassenen SGEs hatten potenzielle Interessenkonflikte, welche die CDC gemerkt hatten aber nicht lösten.
• Die CDC stellten bei 41% der SGE nicht sicher, dass sie die benötigten Ethik-Trainingsprogramme innerhalb des notwendigen Zeitfensters erhielten und besuchten.
• 15% der Berater hielten die ethischen Regeln für ihre Tätigkeit in Sitzungen der Komitees nicht ein. 13% der Ratgeber nahmen an Sitzungen teil und beeinflussten sie auch ohne dass sie auf der Basis der Prozedur des OGE-Fragebogens 450 zertifiziert worden waren. 3% nahmen auch dann an Sitzungen teil, wenn ihnen dies wegen möglicher Interessenkonflikte von den "Ethik-Offizieren" verboten war.
• Die meisten der von Levinson identifizierten Sachverständigen mit Interessenkonflikten hatten die deshalb, weil sie entweder bei einer der von Entscheidungen des Komitees betroffenen Firmen beschäftigt waren oder Zuschüsse von ihnen erhielten oder auch Aktien der betreffenden Unternehmen besaßen.
Mit den Ergebnissen des Berichts konfrontiert, reagierte der aktuelle Direktor der CDC, Thomas Frieden, schnell und ohne dies öffentlich empirisch zu belegen, folgendermaßen: "Since the period covered in this review, CDC has strengthened the financial disclosures and conflict-of-interest process by instituting improved business processes and realigning responsibilities and oversight".
Das einzig Positive an diesem Bericht ist sein Erscheinen. Ob und wie sich die nicht erkannten oder verharmlosten Interessenkonflikte auf Entscheidungen zugunsten der HPV- oder Schweinegrippeimpfung und damit von Pharmakonzernen wie Sanofi-Pasteur, Novartis oder GlaxoSmithKline auswirkten, untersuchte und berichtete Levinson nicht. Weitere Untersuchungen sollten aber von der plausiblen Hypothese ausgehen, dass dies der Fall war.
Wer von den deutschen LeserInnen sich jetzt beruhigt zurücklehnt und das US-Gesundheitssystem bedauert, sollte dies nicht machen bevor eine vergleichbare Transparenz und derartige Analysen für das Robert-Koch-Institut (RKI), die Ständige Impfkommission (StIKo) oder das Paul-Ehrlich-Institut vorliegen. Auf den Rat der dort geballten Experten und sachverständigen Berater werden immerhin seit 2005 zu Gunsten fast derselben Unternehmen plus der Firma Roche Arzneimittelberge und millionenfach Impfseren im Wert von weit über 1 Milliarde Euro gelagert, angeboten und appliziert, die inhaltlich durchaus kontrovers bewertet werden können.
Die potenziell gefährdete Unabhängigkeit us-amerikanischer Gesundheitsinstitutionen kann aber aus deutscher oder europäischer Sicht auch schon deswegen nicht ignoriert werden, weil sich häufig die hiesigen Einrichtungen auf Entscheidungen dieser Institutionen stützen.
Der vom "Department of Health and Human Services" und seinem Inspector General Daniel R. Levinson erstellte Bericht "CDC'S ETHICS PROGRAM FOR SPECIAL GOVERNMENT EMPLOYEES ON FEDERAL ADVISORY COMMITTEES" ist in Gänze kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 21.12.09
Moderne Legenden: Kosten sparen und Qualität verbessern mit Computern im Krankenhaus!?
 Die real existierende IT-Ausstattung ist fast in jedem Krankenhaus spätestens seit Einführung der DRG ein beliebtes Beispiel für nicht endenwollende Organisationsprobleme, überbordende Dokumentationsarbeit oder abgehobene Programmierer ohne jeglichen "Sinn für das Besondere der ärztlichen oder pflegerischen Arbeit".
Die real existierende IT-Ausstattung ist fast in jedem Krankenhaus spätestens seit Einführung der DRG ein beliebtes Beispiel für nicht endenwollende Organisationsprobleme, überbordende Dokumentationsarbeit oder abgehobene Programmierer ohne jeglichen "Sinn für das Besondere der ärztlichen oder pflegerischen Arbeit".
Trotzdem wird natürlich von IT-Beratern und Anbietern von "Systemlösungen" aber auch von Ärzten, Krankenkassen und manchen Patientenvertretern eher auf mehr und neue Patientenerfassungs- und -informationssysteme oder bed-side-online-Tablets gesetzt und von einem Telematikparadies geträumt. Zumindest die jeweils künftigen EDV-Systeme sollen Kosten sparen helfen, die Patientensicherheit erhöhen und auch die restliche Behandlungsqualität verbessern.
Tun sie das aber wirklich oder bedeutet die Forderung nach "mehr Computer und IT" nur noch mehr Beschäftigung mit als sinnlos und belastend empfundener Technik? Wie nahezu gewohnt, gibt es dazu aus Deutschland trotz der auch hierzulande enormen EDV-Ausgaben (noch) keine empirisch seriöse und belastbare Antwort.
Ebenfalls mit großer Verzögerung, aber immerhin, bietet jetzt aber eine in den USA für die Jahre 2003 bis 2007 durchgeführte Auswertung von Daten über den Einsatz von Computern (Daten aus dem größten Längsschnittdatensatz, dem jährlichen "Healthcare Information and Management Systems Society"-Survey) aus beinahe 4.000 Krankenhäusern tiefe Einblicke in die Wirklichkeit hinter Werbeprospekten und Selbstbeschwörungsrhetorik.
Das unerwartet ernüchternde Ergebnis lautet: Weder die Verwaltungskosten noch die Behandlungskosten sanken durch den EDV-Einsatz. Dieser bewirkte auch keine nennenswerte Straffung oder Dynamisierung ("streamlined") der Verwaltung. Die Frage, ob Computer dann wenigstens die Qualität verbessern und damit indirekt doch noch Kosteneffekte haben, lässt sich nach Ansicht der Forschergruppe von der Harvard University nicht eindeutig positiv beantworten: "Auch, wenn optimale Computerisierung wahrscheinlich die Qualität verbessert, bleibt unklar, ob die gegenwärtig in den meisten Kliniken eingesetzten Systeme solche Verbesserungen erzielen."
Die ForscherInnengruppe von der Harvard Medical School berechnete für jedes der knapp 4.000 Krankenhäuser einen Gesamtwert für deren Computerisierung und außerdem drei Sub-Scores, welche die Ausstattung mit 24 speziellen EDV-gestützten Programmen (z.B. elektronische Patientenakte oder Verordnungsprogramm) abbildeten. Dem gegenüber gingen Verwaltungskostendaten aus den "Medicare Cost Reports" sowie Kosten- und Qualitätsdaten aus dem legendären und beispielhaft guten Dartmouth Health Atlas für das Jahr 2008 in die Berechnungen ein. Zentrale Fragen drehten sich darum, ob Krankenhäuser mit besserer EDV-Ausstattung geringere Behandlungs- und Verwaltungskosten haben oder bessere Qualität. Dazu verglichen die Bostoner ForscherInnen auch die Werte der Kliniken, die der Liste der "100 Most wired" angehörten, mit anderen Kliniken. In den multivariaten Analysen wurde neben der EDV-Ausstattung, Faktoren wie der Status als Ausbildungskrankenhaus, die Bettenanzahl, die regionale Lage (Stadt/Land), die Eigentümerverhältnis (gewinnorientiert, öffentlich oder privat non-profit-Status) Bundesstaat und die Versorgungsstufe des Krankenhauses mit berücksichtigt.
Die wichtigsten Ergebnisse lauteten:
• Computerisiertere Krankenhäuser hatten in bivariaten statistischen Analysen sogar signifikant höhere Gesamtkosten als Häuser mit geringerer IT-Ausstattung. In multivariaten Analysen zeigten sich keinerlei statistisch signifikante Zusammenhänge mit niedrigeren Verwaltungs- und Behandlungskosten, aber auch keine mit höheren Kosten.
• Weder die Indikatoren für die Gesamtausstattung mit EDV noch Subgruppen für den Grad der Computerisierung waren durchweg oder konsistent mit weniger Verwaltungskosten verbunden. Bei Betrachtung einzelner Aspekte hatten Krankenhäuser in denen die EDV sehr schnell eingeführt wurde, einen hochsignifikant schnelleren Anstieg ihrer Verwaltungskosten als Häuser mit langsamerer Einführung.
• Summa summarum: "We found no evidence that computerization has lowered costs or streamlined administration."
• Ein höheres allgemeines Ausstattungsniveau mit IT korrelierte nur schwach mit der Qualität der Versorgung von Patienten und dies auch nur bei der Versorgung von PatientInnen mit Akut-Herzinfarkt. Keinerlei signifikante Zusammenhänge gab es aber mit der Versorgungsqualität von PatientInnen mit Herzschwäche, Lungenentzündung oder mit einem Indikator, der die Qualität der Behandlung mehrerer Krankheiten zusammenfasst.
• In multivariaten Analysen hatten mehr computerisierte Krankenhäuser eine leicht bessere Qualität ihrer Behandlungsangebote. Wie schwach letztlich dieser Zusammenhang ist, zeigt sich aber daran, dass die 100 Spitzenreiter bei der Computerisierung weder bei Verwaltungs- und Behandlungskosten noch bei der Qualität besser waren als die restlichen 3.900 Kliniken.
Dass kaum oder nur sehr eingeschränkt Kosteneinsparungen erkennbar sind, führen die ForscherInnen darauf zurück, dass die Beschaffungs- und Einsatzkosten von EDV die erzielten oder erzielbaren Einsparungen konstant übertreffen. Für möglich halten sie es auch, dass die Einspareffekte erst nach einem sehr hohen Grad des Computereinsatzes auftreten. Auch wenn es dafür Belege in der 100er-Spitzengruppe zu geben scheint, gibt es auch gerade dort jede Menge Beispiele für hochausgerüstete Kliniken, die keine Kostenersparnisse hatten.
Insbesondere die sehr bescheidenen oder fehlenden qualitätsverbessernden Effekte der Computerisierung sind nach Meinung der ForscherInnen nicht einfach zu erklären. Von ihnen wird nach einer kurzen Sichtung einiger Analysen zu den Wirkungen des Einsatzes von IT in US-Krankenhäusern zwar keineswegs prinzipiell eine positive Wirkung von IT auf Kosten und Qualität ("optimal computerization probably improves quality") ausgeschlossen. Warum dies trotzdem empirisch nur selten funktioniert, liegt ihres Erachtens vor allem daran, dass "the commercial marketplace does not favor optimal products. Coding and other reimbursement-driven documentation might take precedence over efficiency and the encouragement of clinical parsimony."
Dass die herrschenden Vergütungssysteme ein gewichtiger Erklärungsfaktor für die geringen Effekte des IT-Einsatzes sein könnten, macht das Beispiel der Krankenhäuser der "Veterans Administration" (der speziellen staatlichen Versicherung und des speziellen Leistungsanbieters für Exsoldaten) plausibel. Dort erfolgt die gesamte Finanzierung über Globalbudgets, die individuelle Rechnungsstellung und detaillierte interne Kostenerfassung als klassische Produktivitätsbremsen überflüssig machen und auch den kommerziellen Druck minimieren.
Auch wenn die letzten Thesen und ihre Evidenz gründlicher untersucht werden müssen, zeigen sie deutlich, an wie vielen und vor allem welchen "Rädchen" im sozialen System Krankenhaus und vor allem außerhalb von ihm gedreht werden muss, um die erhofften und wünschenswerten Effekte der IT erzielen zu können. Und er zeigt auch, dass die Lösung nicht in der Bestellung und Implementation einer neuen Rechnerarchitektur oder neuer Software also in neuer Technik liegt. Dieses Geld sollte man sich nach den nun gut belegten Ergebnissen in den USA für den Start einer inhaltlicheren Lösungsstrategie sparen.
Nebenbei: Die Analyse der Qualitätsangaben für die unterschiedlichen Krankenhaus-Typen belegt aufs Neue die höhere Qualität in Krankenhäusern mit Ausbildungsbetrieb und die geringere Qualität in gewinnorientierten Kliniken. Wer vielleicht dachte, höhere Verwaltungsausgaben wären durch bessere Qualität gerechtfertigt, findet dafür in diesen Daten keinen Beleg.
Der Aufsatz "Hospital Computing and the costs and quality of care: A National Study" von David Himmelstein, Adam Wright und Steffie Woolhandler wird noch 2009 in der Zeitschrift "The American Journal of Medicine" erscheinen, ist aber bereits jetzt online komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 9.12.09
1990-2007: "Lack of detection and widespread under-reporting". Qualitätssicherung durch Ärzte-"peer review" in US-Krankenhäusern
 Seit dem 1. September 1990 existiert in den USA auf der gesetzlichen Basis des "Health Care Quality Improvement Act" aus dem Jahre 1986 eine bundesweite Datenbank für Informationen über Krankenhausärzte, denen Behandlungsrechte in Krankenhäusern durch ein so genanntes internes "peer review"-Verfahren für mehr als 30 Tage entzogen oder begrenzt worden sind.
Seit dem 1. September 1990 existiert in den USA auf der gesetzlichen Basis des "Health Care Quality Improvement Act" aus dem Jahre 1986 eine bundesweite Datenbank für Informationen über Krankenhausärzte, denen Behandlungsrechte in Krankenhäusern durch ein so genanntes internes "peer review"-Verfahren für mehr als 30 Tage entzogen oder begrenzt worden sind.
Auch wenn die so genannte "National Practitioner Data Bank" nur in depersonalisierter Form als "public use file" für die breite Öffentlichkeit zugänglich ist, sollten diese Meldungen der Krankenhäuser vor allem auch zu einer Art selbstreinigenden innerprofessionellen Transparenz beitragen, die Krankenhausverwaltungen z.B. bei Neueinstellungen Informationen über möglicherweise fachlich nicht qualifizierte Ärrzte geben sollte und damit letztlich auch Patienten zu Gute kommen sollte. Das US-Medizinjournal JAMA nannte das "hospital peer review one of the pillars of quality assurance in the United States" und sah die Wirksamkeit dieses Verfahrens der von staatlichen und professionsfremden Kontrollen und Kontrolleure überlegen.
Im Vorfeld des Start dieser Datenbank im Jahre 1990 schätzte die US-Bundesregierung aufgrund der zuvor beobachteten Häufigkeit solcher innerprofessioneller Disziplinierungsmaßnahmen der Ärzteschaft, dass dort mindestens 5.000 derartiger Meldungen jährlich eingingen. Die American Medical Association ging sogar von 10.000 Meldungen aus. Sie stützte sich dabei auf eine Studie der "American Hospital Association (AHA)", also des Verbandes der Krankenhäuser, die festgestellt hatte, dass es pro Jahr in jedem Krankenhaus durchschnittlich 2,5 interner fachlicher Disziplinarmaßnahmen gab, was bei rund 5.000 Kliniken zu der geschätzten Anzahl von Meldungen geführt hätte.
Ein von der gemeinnützigen Public Citizen's Health Research Group am 27. Mai 2009 der Öffentlichkeit vorgestellter Bericht analysierte nun das tatsächliche Meldeverhalten soweit es aus verschiedenen öffentlich zugänglichen Quellen erkennbar war und kam zu ernüchternden Ergebnissen:
• Die durchschnittliche Anzahl der in den 17 untersuchten Jahren pro Jahr eingehenden Berichte betrug 650, also ein Achtel der von der Regierung und ein Sechzehntel der von der Mediziner-Assoziation geschätzten Anzahl.
• 49% der US-Krankenhäuser sandte in den 17 Jahren keinen einzigen Bericht.
• 34,2% aller Krankenhäuser berichteten während der 17 Jahre wenigstens einen Fall.
• Die Durchführung von "peer reviews" und entsprechende Meldungen variierte zwischen einzelnen Bundesstaaten enorm: Während 70% aller Kliniken in Louisiana niemals Meldungen sandten waren es in Conneticut "nur" 25% Nie-Melder.
• Aber auch in Bundesstaaten mit hohem Berichtsniveau konzentrierten sich die Meldungen nach Feststellung der Berichterstatter oft auf wenige Einrichtungen.
• In zahlreichen Fällen folgte einer oder mehreren Meldungen über Ärzte keine erkennbare aber zwingend notwendige Folgeaktion wie etwa die eines wie auch immer gearteten Lizenzentzugs. Dies gilt z.B. für 952 unter den insgesamt gemeldeten 9.877 Ärzten mit zwei und mehr Reports über unerwünschte Handlungen und 31 mit fünf und mehr dieser Meldungen.
• Da das Problem bereits seit langem bekannt war, gab es seit 1996 verschiedene Anläufe, den Zustand der Transparenz zu verbessern oder Sanktionen einzuführen. Aber schon der Versuch, von den Krankenhäusern mehr über die Gründe ihrer zurückhaltenden Nutzung von "peer review"-Verfahren und der Meldung von Ereignissen zu erfahren, scheiterte 2002. Die Unternehmensberatung PwC versuchte 42 Krankenhäuser und 36 Managed Care Organizations in eine Pilotstudie einzubeziehen, musste aber die Studie einstellen, weil sich nur 3 Krankenhäuser und 5 MCOs zur Teilnahme bereit erklärt hatten.
Die AutorInnen des Public Citizen-Reports schließen trotz der desillusionierenden Geschichte ihren Bericht mit einer Reihe von Verbesserungsvorschlägen, ohne aber genau angeben zu können, warum diese wirklich etwas am Verhalten der Krankenhäuser ändern sollen.
Trotz der deutlichen Zahlen und der langen Geschichte systematischer und kontinuierlichen Unterberichterstattung beharrt die "American Hospital Association" schließlich auf folgender Sicht der Dinge: "Hospitals are actively involved in a wide variety of efforts to continuously improve care and talk publicly about the care we provide". Derartige Reaktionen verstärken die Zweifel an der Wirksamkeit von Qualitätssicherungen, die ausschließlich auf Selbstverpflichtungen und Freiwilligkeit beruhen und bei denen offenkundige Verstöße nicht sanktioniert werden - so unwohl man sich bei staatlich verpflichtenden Alternativen auch fühlen mag.
Der sehr detaillierte, material- und quellenreiche Bericht "Hospitals Drop the Ball on Physician Oversight. Failure of Hospitals to Discipline and Report Doctors Endangers Patients" von Alan Levine und Sidney Wolfe umfasst 38 Seiten und ist kostenlos erhältlich.
Wer mehr über das im Prinzip interessante Modell der National Practitioner Data Bank. Healthcare Integrity and Protection Data Bank erfahren will, erhält hier einen kostenlosen Zugang.
Bernard Braun, 29.5.09
Technikvision und Wirklichkeit: Weniger als 10% der US-Hospitäler haben irgendein elektronisches Gesundheitsinformationssystem
 Eigentlich ist dies für Fernsehzuschauer, die sich "zufällig" in US-Krankenhaus-Serien à la "Emergency Room" festzappen und noch aufmerksam bei "Dr. House" vorbeischauen, keine Überraschung: Eine umfassende elektronische Dokumentation, funktionierende elektronische Krankenakten und ein darauf basierendes Behandlungsmanagement sind in us-amerikanischen Krankenhäusern eher die Ausnahme als die Regel. Ob es aber dort in Wirklichkeit so zugeht wie in den genannten und vielen anderen internationalen und nationalen Krankenhausserien gezeigt, kann bezweifelt werden.
Eigentlich ist dies für Fernsehzuschauer, die sich "zufällig" in US-Krankenhaus-Serien à la "Emergency Room" festzappen und noch aufmerksam bei "Dr. House" vorbeischauen, keine Überraschung: Eine umfassende elektronische Dokumentation, funktionierende elektronische Krankenakten und ein darauf basierendes Behandlungsmanagement sind in us-amerikanischen Krankenhäusern eher die Ausnahme als die Regel. Ob es aber dort in Wirklichkeit so zugeht wie in den genannten und vielen anderen internationalen und nationalen Krankenhausserien gezeigt, kann bezweifelt werden.
Trotzdem förderte jetzt eine umfassende Untersuchung des Standes der Einführung einer elektronischen Informations-, Planungs- und Steuerungs-Infrastruktur und der Nutzung von "electronic health records (EHR)" aus dem Jahr 2008 in 3.049 (nach dem Ausschluss einiger Krankenhäuser blieben noch 2.952 Studienkliniken übrig) an der Untersuchung teilnehmenden (dies entspricht einer Responserate von 63,1%) Akutkrankenhäusern der USA, die Mitglied der "American Hospital Association" sind, eine unerwartete Wirklichkeit zu Tage. Der Untersuchung lag die Annahme oder sogar fast die Gewissheit zugrunde, dass eine umfassende Informationstechnologie die Qualität der Gesundheitsversorgung in Krankenhäusern verbessert und medizinische oder Behandlungsirrtümer vermeiden hilft.
Auf der Basis von Informationen, die sie von den teilnehmenden Krankenhäusern über das Verständnis der Bedeutung von EHR, den Grad ihrer Einführung in den klinischen Alltag und über die Barrieren für ihre Übernahme erhielten, teilten die ForscherInnen die Kliniken drei Kategorien zu: umfassende EHR (abgeschlossene Einführung in allen Klinikabteilungen), Basisversion von EHR (abgeschlossene Einführung in mindestens einer Abteilung) oder eine nicht existente EHR-Infrastruktur.
Von den fast 3.000 Krankenhäusern besaßen und nutzten
• nur 1,5% eine umfassende elektronische Infrastruktur,
• 7,6% zumindest eine Basisversion von EHR, die beispielsweise ärztliche Aufzeichnungen und Bewertungen über Patienten von Pflegekräften enthielt und
• der Rest der untersuchten Kliniken arbeitete ohne EHR.
Zusätzlich lieferte die Untersuchung noch weitere Einzelheiten über die aktuelle elektronische Infrastruktur:
• 17% der Krankenhäuser setzten computergestützte Bestellsysteme ein,
• dies ist u.a. ein Beleg dafür, dass auch Krankenhäuser ohne ein umfassendes EHR-System einige Voraussetzungen für dessen späteren Aufbau, wie etwa klinische Informationssysteme und andere Module haben können,
• größere Krankenhäuser, Ausbildungs-Kliniken und Häuser mit speziellen Herz-/Kreislauf-Behandlungseinheiten waren besser elektronisch ausgerüstet als die jeweils anderen Kliniken,
• von den Krankenhäusern ohne eine EHR-Infrastruktur gaben 74% fehlendes Investitionskapital, 44 % die zu hohen Betriebskosten, 36% den Widerstand von Ärzten, 32% Unklarheiten über den "return of investment" und 30% inkompetentes Fachpersonal für Informationstechnologie an.
Die Beobachtung, dass der Widerstand von Ärzten gegen EHR in Kliniken mit eingeführter Informationstechnologie in etwa gleich groß war wie in Kliniken ohne EHR, weist auf die Existenz einer offensichtlich mächtigen und faktenfernen oder -resistenten subjektiven Implementationsbarriere hin.
Nach Erkenntnis der AutorInnen sollte sich die teilweise mit Mitteln des aktuellen US-Konjunkturprogramms geförderte Verbesserung der Zustimmung zu EHR-Systemen und deren Einführung vor allem auf die finanzielle Unterstützung, die Gewährleistung einer EHR mit hoher Interoperabilität mit Systemen außerhalb des konkreten Anwendungsbereichs und das Training des Personals konzentrieren, das mit der Informationstechnologie im Haus befasst ist.
Den Aufsatz "Use of Electronic Health Records in U.S. Hospitals" von Ashish K. Jha, Catherine M. DesRoches, Eric G. Campbell, Karen Donelan, Sowmya R. Rao, Timothy G. Ferris, Alexandra Shields, Sara Rosenbaum, und David Blumenthal im "New England Journal of Medicine (NEJM)" (2009;360 vom 25. März 2009) erhält man kostenlos als 11 Seiten umfassende PDF-Datei.
Neben den Hinweisen auf einige Beschränkungen der Studie (z.B. der Ausfall bestimmter Typen von Krankenhäusern durch Nonresponse) weisen die AutorInnen aber auch auf die noch recht frische (aus 2006) Erkenntnis hin, die Qualitätsgewinne durch EHR seien keineswegs so stabil, verallgemeinerbar und zwingend nachgewiesen worden wie stillschweigend angenommen wurde und wird.
So kommt der am 16. Mai 2006 in der Fachzeitschrift "Annals of Internal Medicine" (Volume 144 Issue 10: 742-752) auf 29 Seiten veröffentlichte und komplett kostenlos zugängliche Aufsatz "Systematic Review: Impact of Health Information Technology on Quality, Efficiency, and Costs of Medical Care" von Basit Chaudhry et al. nach gründlicher Analyse der damals vorliegenden 257 Studien über den Nutzen elektronischer Infrastruktur in Krankenanstalten zu folgendem quantitativ und qualitativ sehr zurückhaltenden Schluss: "Available quantitative research was limited and was done by a small number of institutions. Systems were heterogeneous and sometimes incompletely described. Available financial and contextual data were limited. Conclusions: Four benchmark institutions have demonstrated the efficacy of health information technologies in improving quality and efficiency. Whether and how other institutions can achieve similar benefits, and at what costs, are unclear."
Bernard Braun, 15.4.09
Wie evident sind die evidenzbasierten Leitlinien der führenden kardiologischen Fachgesellschaften in den USA?
 Seitdem sich eminenzbasiertes Handeln immer mehr hinterfragen lassen muss, ob es wissenschaftlich verlässlich seine versprochene Wirkung nachweisen kann, gewinnen die Methoden und Kriterien der "evidence based medicine (EBM)" und darauf aufbauende Leitlinien und Empfehlungen eine ebenfalls wachsende Bedeutung in der Bewertung alter und neuer diagnostischer und therapeutischer Gesundheitsangebote.
Seitdem sich eminenzbasiertes Handeln immer mehr hinterfragen lassen muss, ob es wissenschaftlich verlässlich seine versprochene Wirkung nachweisen kann, gewinnen die Methoden und Kriterien der "evidence based medicine (EBM)" und darauf aufbauende Leitlinien und Empfehlungen eine ebenfalls wachsende Bedeutung in der Bewertung alter und neuer diagnostischer und therapeutischer Gesundheitsangebote.
Verwunderlich dabei ist, dass es bisher relativ wenige Einblicke in die Qualität und Evidenz der Leitlinien und Empfehlungen selber gab, und das Etikett "evidence-based" scheinbar per se Qualität zu gewährleisten schien.
Dies hat sich nun durch eine Studie verändert in der die Leitlinien des "American College of Cardiology" und der "American Heart Association" (ACC/AHA) für den Bereich der Herzerkrankungen auf den Prüfstand der Evidenzbasierung gestellt wurden und nach EBM-Kriterien bewertet wurden. Dabei handelt es sich um zwei Bewertungsklassen: Die Klassen von I (Definition: "Conditions for which there is evidence and/or general agreement that a given procedure or treatment is useful and effective") bis III (Definition: "Conditions for which there is evidence and/or general agreement that the procedure/treatment is not useful/effective, and in some cases may be harmful."), mit denen die Strenge oder Härte der Empfehlung bezeichnet werden und das so genannte "level of evidence (LOE)", das absteigend von A ("Data derived from multiple randomized clinical trials") nach C ("Consensus opinion of experts") anzeigt, welche Art von Forschungsdaten hinter der klassifizierten Therapie etc. steht.
Die ForscherInnen untersuchten die 53 Praxis-Leitlinien, die von ACC/AHA zwischen 1984 und September 2008 veröffentlicht wurden, die 22 kardiologische Behandlungsgebiete abdeckten und insgesamt 7.196 Empfehlungen enthielten.
Die wesentlichen ERgebnisse lauteten:
• In den Leitlinien, die in diesem Zeitraum mindestens einmal erneut bewertet worden waren,stieg die Anzahl von Empfehlungen signifikant um 48%.
• Was sich weniger deutlich veränderte war das Qualitäts- oder Evidenzniveau der Empfehlungen: Bereits einmal überprüfte Leitlinien stiegen vielfach von der Klasse III in die Klasse II auf. Der Anteil der Empfehlungen in der obersten Klasse I blieb aber während des Untersuchungszeitraums konstant.
• Unter den 1.305 Klasse I-Empfehlungen erreichten nur 245 (rd. 19%) das LOE-Niveau A, während 481 (37%) ein LOE von C hatten.
• Von den 2.711 Empfehlungen aus 16 publizierten Leitlinien für die überhaupt ein LOE-Wert berichtet wurde, erreichten 314 (12%) das A-Niveau, 1.246 (46%) aber nur das C-Level.
Zusammengefasst heißt dies, dass ein großer Anteil der "class I"-Empfehlungen der Fachgesellschaften zur Behandlung kardiovaskulärer Erkrankungen in den USA sich nur auf eine schmale und dünne Evidenzbasis oder auf Expertenmeinungen stützt.
Die Schlussfolgerung der Autoren des Kommentars "Reassessment of clinical practice guidelines: go gently into that good night" von Shaneyfelt TM und Centor RM (JAMA. 2009 Feb 25; 301(8):868, dass "clinicians and policy makers must reject calls for adherence to guidelines", ist etwas überzogen und berücksichtigt nicht, dass von Fall zu Fall auch ein niedriges Evidenzniveau für qualitätsgesichertes Handeln ausreichen kann.
Trotzdem gibt die Zunahme der Empfehlungen mit geringerer Evidenz Anlass über eine qualitative Verbesserung des Schreibens von Leitlinien intensiver nachzudenken.
Von dem Aufsatz "Scientific evidence underlying the ACC/AHA clinical practice guidelines" von Tricoci P, Allen JM, Kramer JM, Califf RM, Smith SC Jr. im US-Medizinjournal "Journal of American Medical Association (JAMA)" (JAMA 2009 vom 25. Februar; 301:831-41) gibt es kostenlos lediglich ein umfangreiches Abstract. Mehr über die "Classification of Recommendations and Level of Evidence" der US-Fachgesellschaften gibt es in dem in der Fachzeitschrift "Circulation" veröffentlichten und kostenlos zugänglichen "Manual for ACC/AHA Guideline Writing Committees Methodologies and Policies from the ACC/AHA Task Force on Practice Guidelines".
Bernard Braun, 7.4.09
Stationär-ambulant im Medicare-System der USA: Hohe Rehospitalisierungsrate und wenig patientenzentrierte Behandlungskoordination
 Die patientenzentrierte Verknüpfung von stationärer mit ambulanter Versorgung oder mindestens eine standardmäßige Kooperation ist offensichtlich nicht nur ein Problem des deutschen Gesundheitssystems. Dies zeigt jedenfalls eine gerade veröffentlichte Analyse der nachstationären Krankheits- und Behandlungsverläufe von Medicare-Patienten in den USA.
Die patientenzentrierte Verknüpfung von stationärer mit ambulanter Versorgung oder mindestens eine standardmäßige Kooperation ist offensichtlich nicht nur ein Problem des deutschen Gesundheitssystems. Dies zeigt jedenfalls eine gerade veröffentlichte Analyse der nachstationären Krankheits- und Behandlungsverläufe von Medicare-Patienten in den USA.
Wissenschaftler untersuchten dazu über einen Zeitraum von 15 Monaten Routinedaten von 11.855.702 Versicherten mit einem Krankenhausaufenthalt aus den Jahren 2003 und 2004.
Dabei förderten sie folgende Muster von Behandlungsverläufen zu Tage:
• 52 % der nach einer Operation aus dem Krankenhaus entlassenen Personen wurden im ersten Jahr nach der Entlassung entweder wieder in ein Krankenhaus aufgenommen (so genannte "bounce-back admissions") oder starben.
• Rund 20 % der Entlassenen kamen innerhalb von 30 Tagen wieder ins Krankenhaus. 34 % kamen innerhalb 90 Tagen wieder, 45 % nach 180 Tagen und 56 % machten dies innerhalb eines Jahres
• 90 % der erneuten Aufenthalte waren ungeplant, der Rest geplant.
• Für die Hälfte der Versicherten, die innerhalb 30 Tagen wieder im Krankenhaus behandelt werden mussten, gab es keinen stichhaltigen Hinweis (kontrolliert wurde das Vorliegen von Abrechnungen niedergelassener Ärzte), dass sie zwischen den beiden stationären Behandlungsepisoden einen Arzt gesehen hatten.
• Die höchsten Rehospitalisierungsraten gab es u.a. bei Psychosen, nach gefäßchirurgischen Eingriffen und chronisch obstruktiver Lungenerkrankung (COPD). Obwohl Patienten mit chronischen Erkrankung höhere Wiedereinweisungsraten aufwiesen, wurden auch akut erkrankte Patienten oft wiedereingewiesen. Dies gilt z.B. für 20 % der Patienten mit Lungenentzündungen.
• Der durchschnittliche Aufenthalt der hier identifizierten Patienten mit Wiederaufnahme war 0,6 Tahe länger als bei einem Patienten, der mit derselben DRG in Behandlung war, aber innerhalb der letzten 6 Monate nicht in einem Krankenhaus lagen.
• Die Studie schätzt den Anteil der durch diese Wiedereinweisungen entstandenen Ausgaben am 102,6 Mrd.-Haushalt von Medicare im Jahr 2004 auf 17,4 Mrd. US-Dollar.
• Dass es sich bei den Rehospitalisierungsraten keineswegs um eine "natürliche" Erscheinung handelt, zeigt der Sachverhalt, dass die fünf Bundesstaaten mit den höchsten Raten (Maryland, New Jersey, Louisiana, Illinois und Mississippi) 45 % über denen der fünf Bundesstaaten (Idaho, Utah, Oregon, Colorado und New Mexico) mit den niedrigsten Raten lagen.
Besonders die Beobachtung, dass ein großer Teil der "bounce-back admissions" auf mangelhafter Koordination der Behandlung beruht, ist für die Wissenschaftler Anlass zu betonen, eine sichere Versorgung "requires care that centers on the patient and transcends organizational boundaries."
So richtig diese Forderung ist, so schwer fällt es den Autoren, dies zu konkretisieren. Ein Vorschlag lautet, dass die "Medicare Payment Advisory Commission (MedPac)" den "Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS)" empfiehlt, den Krankenhäusern ihre risikoadjustierten Wiedereinweisungsraten mitzuteilen. Außerdem sollten Krankenhäusern mit hohen Wiedereinweisungsraten bei bestimmten Erkrankungen die Honorare gekürzt werden.
Der in einem Editorial der Redaktion des "New England Journal of Medicine (NEJM)", in dem diese Ergebnisse jetzt veröffentlicht wurden, geäußerte Ruf nach "shared incentives to create "better coordination of care between inpatient and outpatient domains" ist nur etwas konkreter, drückt sich aber darum herum, Genaueres zu der Art der Anreize zu sagen.
Dabei gibt es in den USA aktuelle Debatten und erste grobe Konzepte wie man ein am Behandlungs- und Versorgungsbedarf der Patienten orientiertes kooperatives Vorgehen unterschiedlicher Leistungserbringer mit den Mitteln der Honorierung stimulieren könnte.
Sowohl die gerade in der "Web Exclusives"-Ausgabe der renommierten Gesundheitspolitikzeitschrift "Health Affairs" (28, no. 2 (2009): 262-271) veröffentlichte Studie "Payment Reform Options: Episode Payment is a good place to start" - kostenfrei nur ein Abstract - als auch ein im März erschienenes komplett kostenlos erhältliches 37-seitiges Konzeptpapier von MitarbeiterInnen (Stuart Guterman, Karen Davis, Cathy Schoen und Kristof Stremikis) des liberalen "Commonwealth Fund" zum Thema "Reforming provider payment. Essential Building block for health reform" diskutieren Formen von "bundled payment" als einer Möglichkeit spürbare Anreize zu sektorenübergreifender Behandlung zu geben. Dabei spielt insbesondere der Gedanke eine Rolle, nicht mehr jeden an der Behandlung beteiligten Leistungserbringer einzeln zu bezahlen, sondern z.B. einen Betrag oder ein Budget für die gesamten "episodes of care" zu zahlen. Welche Anteile dieser Behandlungsepisodenbezahlung auf die einzelnen Behandler entfallen und wie die Übergänge auszusehen haben, müssen die Beteiligten zusammen vereinbaren. Platt ausgedrückt: Wer Geld verdienen will, muss kooperieren und bestimmten Qualitätskriterien an der Schnittstelle genügen.
In den Worten von Gutermann et al. geht es darum "(to) promote more effective, efficient, and integrated care delivery through "bundled payment" approaches that reimburse providers for care delivered over a period of time or for the duration of an illness, with rewards for quality, outcomes, and efficiency".
Der im "New England Journal of Medicine (NEJM)" (Volume 360, 14: 2. April 2009: 1418-1428) erschienene Aufsatz "Rehospitalizations among Patients in the Medicare Fee-for-Service Program" von Stephen F. Jencks, Mark V. Williams und Eric A. Coleman ist komplett kostenlos erhältlich.
Das in derselben NEJM-Ausgabe veröffentlichte Editorial "Revisiting Readmissions — Changing the Incentives for Shared Accountability" von Arnold M. Epstein ist ebenfalls komplett frei erhältlich.
Bernard Braun, 2.4.09
Was taugen Selbsteinstufungen von Krankenhäusern über die Patientensicherheit in ihren Häusern? Nichts.
 Die Leapfrog Gruppe ist eins von vielen US-Unternehmen, das für Patienten Informationen und Ranglisten über Krankenhäuser anbietet. Die große Vielfalt der US-Klinikführer bewirkt nicht selten, dass die Informationen unübersichtlich sind und teilweise sogar einander widersprechen (vgl. Kritik an Klinikführern in den USA: Völlig abweichende Bewertungen für ein und dasselbe Krankenhaus). Auf ein weiteres Problem der Klinikführer hat jetzt eine Studie aufmerksam gemacht, die in der Zeitschrift JAMA (Journal of the American Medical Association) veröffentlicht wurde: Die Unzuverlässigkeit von Informationen, die von den Kliniken selbst geliefert werden.
Die Leapfrog Gruppe ist eins von vielen US-Unternehmen, das für Patienten Informationen und Ranglisten über Krankenhäuser anbietet. Die große Vielfalt der US-Klinikführer bewirkt nicht selten, dass die Informationen unübersichtlich sind und teilweise sogar einander widersprechen (vgl. Kritik an Klinikführern in den USA: Völlig abweichende Bewertungen für ein und dasselbe Krankenhaus). Auf ein weiteres Problem der Klinikführer hat jetzt eine Studie aufmerksam gemacht, die in der Zeitschrift JAMA (Journal of the American Medical Association) veröffentlicht wurde: Die Unzuverlässigkeit von Informationen, die von den Kliniken selbst geliefert werden.
In Klinikführern der Leapfrog-Gruppe werden derzeit Angaben zur Patientensicherheit gemacht, die auf Indikatoren beruhen, die von den Kliniken selbst berichtet werden. Dabei handelt es sich um etwa ein Dutzend Indikatoren zur Struktur- und Prozess-Qualität in den Häusern, die bestimmte Routinen und Maßnahmen betreffen etwa zur Arzneimittelvergabe, zur Vorgehensweise bei Infektionen usw. Aufgrund dieser Angaben erhalten Krankenhäuser in der Kategorie "Patientensicherheit" eine bestimmte Punktzahl und werden danach einer von 4 Gruppen zugeordnet, Kliniken mit sehr hohen, eher hohen, eher niedrigen, sehr niedrigen Punktwerten. Es gibt auch noch andere Verfahren zur Bewertung der Patientensicherheit, aber die Klinik-Selbstangaben werden häufig verwendet, insgesamt etwa 1100 Kliniken sind auf diese Weise bewertet.
Eine kalifornische Forschungsgruppe hat nun untersucht, wie zuverlässig diese Klassifizierungen sind. Dazu wurden alle Kliniken ausgewählt, für die in den verschiedenen US-Bundesstaaten objektive Daten zur Mortalität (während des Klinik-Aufenthalts) vorlagen. Für die Analysen kamen so Daten aus dem Jahr 2005 von insgesamt 155 Kliniken und knapp 1,7 Millionen Patienten zusammen. Dabei wurden etwa 37 Tausend Todesfälle beobachtet.
Die Wissenschaftler stuften die erfassten 155 Kliniken dann hinsichtlich ihrer Patientensicherheit in vier Gruppen ein - entsprechend der Leapfrog-Klassifizierung und überprüften dann, ob sich die Mortalitäts-Raten in den vier Gruppen unterschied. Festgestellt wurden dann folgende risiko-adjustierten Quoten, also unter Berücksichtigung von Art und Schweregrad der Erkrankung, Risiko des Eingriffs etc.:
• Gruppe 1 (sehr hohe Patientensicherheit) Mortalität 1,97%
• Gruppe 2: 2,04%
• Gruppe 3: 1,96%
• Gruppe 4 (sehr niedrige Patientensicherheit): 2,00%
Das heißt: Es gab keinerlei statistisch signifikante Unterschiede zwischen den Klinik-Gruppen hinsichtlich der Mortalitätsquote. Die von Leapfrog gebotenen Informationen zur Patientensicherheit sind also völlig wertlos. Die Wissenschaftler diskutieren dann, dass die Mortalitätsrate während des Klinik-Aufenthalts nicht der einzige Indikator ist, um "Patientensicherheit" zu messen, auch Infektionsraten oder Komplikationen sind zweifellos Hinweise. Nicht zu Unrecht argumentieren sie allerdings, dass Aussagen darüber, wie oft in einer Klinik der Tod auf dem OP-Tisch zu verzeichnen ist, nach wie vor der für Patienten relevanteste Indikator ist. Die Wissenschaftler diskutieren auch, was ursächlich sein könnte für ihre Ergebnisse. Eine Möglichkeit wäre naheliegend: Kliniken teilen zwar mit, dass bestimmte Sicherheitsvorschriften oder Routinen eingeführt worden sind, nicht aber, ob diese auch in der Alltagspraxis auch immer eingehalten werden.
Studie im Volltext (kostenlos): Leslie P. Kernisan et al: Association Between Hospital-Reported Leapfrog Safe Practices Scores and Inpatient Mortality (JAMA. 2009;301(13):1341-1348)
Gerd Marstedt, 1.4.09
Dreh- und Angelpunkt von "chronic care management"-Programmen: Multidisziplinäres Team und persönliche Kommunikation
 Angesichts des hohen und wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch wachsenden Anteils chronischer Erkrankungen bzw. Erkrankter am gesamten Morbiditäts- und Versorgungsgeschehen gibt es weltweit Konzepte und Programme, die Qualität, Wirksamkeit und Kosten der Versorgung dieser Patientengruppe durch spezielle "chronic care management programs" oder auch spezielle Disease Managementprogramme zu verbessern.
Angesichts des hohen und wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch wachsenden Anteils chronischer Erkrankungen bzw. Erkrankter am gesamten Morbiditäts- und Versorgungsgeschehen gibt es weltweit Konzepte und Programme, die Qualität, Wirksamkeit und Kosten der Versorgung dieser Patientengruppe durch spezielle "chronic care management programs" oder auch spezielle Disease Managementprogramme zu verbessern.
Die zentrale Frage nach dem Nutzen dieser Programme insgesamt und möglicherweise auch noch gravierende Nutzenunterschiede zwischen unterschiedlich aufgebauten Programmen ist aber bisher noch nicht ausreichend untersucht und beantwortet worden.
Einen wichtigen Beitrag, diesen Zustand zu beenden, liefert eine Studie, die die Daten von zehn randomisierten kontrollierten Studien über die Wirksamkeit und den Nutzen von Versorgungsmanagementprogrammen für Patienten mit Herzinsuffizienz poolte und durch eine Gruppe von Spezialisten für die Behandlung von Herzinsuffizienz nach sieben Kriterien reanalysieren ließ. Dabei kam die von der "American Heart Association's (AHA's) Writing Group" entwickelte "Taxonomy of Disease Management" zum Einsatz. Die Studien wurden zwischen 1990 und 2004 mit insgesamt 2.028 Fällen in den USA (6 Studien), Australien (2), den Niederlanden (1) und Großbritannien (1) durchgeführt. 961 der TeilnehmerInnen in diesen Studien erhielten spezielle Chronikerversorgungen und 1.067 erhielten eine Routineversorgung. Die Maßstäbe oder Indikatoren für den Nutzen eines Programms war die Häufigkeit der raschen Wiedereinweisung mit derselben Erkrankung in ein Krankenhaus und die Anzahl der Wiedereinweisungstage.
Die in den Studien unterscheidbaren Versorgungskonzepte waren zum einen eine Art Routineversorgung durch einen einzigen Herzexperten bzw. Ansprechpartner (in den meisten Studien war dies eine registrierte Krankenschwester (nurse) mit klinischer Sachkunde in Kardiologie und Herzinsuffizienz) und Beratung per Telefon, diese Routineversorgung mit persönlicher Kommunikation zwischen Patient und einer Fachkrankenschwester und schließlich die Programm-Versorgung durch ein multidisziplinäres Team und standardmäßig persönliche Kommunikationsmöglichkeiten. Die letzte Versorgungsvariante entspricht dem Kerngehalt aller Chronic-care-management-Programme.
Die Relevanz der Untersuchungsergebnisse ergibt sich allein schon aus dem Faktum, dass Herzinsuffizienz weltweit zu den führenden Ursachen von Klinikaufenthalten älterer Menschen gehört und in den USA 10 % aller Krankenhausausgaben der staatlichen Versicherung Medicare auf die Versorgung der an dieser Erkrankung leidenden Personen entfielen, was einem Anteil an den Gesamtausgaben von Medicare von 5 % entspricht.
Die durch logistische Regressionsanalysen gewonnenen Ergebnisse sahen so aus:
• Die Patienten in der Routineversorgung unterschieden sich von den Patienten in der "chronic care"-Versorgung hinsichtlich ihrer soziodemografischen und klinischen Charakteristika kaum.
• Weniger Programmpatienten (42 %) wurden innerhalb der follow up-Periode nach einem Krankenhausaufenthalt wieder in ein Krankenhaus eingewiesen als Routineversorgungspatienten (49 %).
• Programmpatienten hatten 25 % weniger Krankenhauswiedereinweisungen und 30 % weniger Krankenhaustage wegen einer Wiedereinweisung als Patienten mit einer Routineversorgung.
• Wenn Chronic-Care-Management-Programme als strukturierte Versorgung durch einen einzelnen Experten und Kommunikation per Telefon erfolgte, unterschieden sich die Ergebnisse nicht von denen bei Patienten in der Routineversorgung.
• Wenn die Versorgung zwar durch einen einzelnen Experten aber zumindest auf der Basis persönlicher Kommunikation erfolgte, wurde die Wiedereinweisungshäufigkeit im Vergleich mit der Routineversorgungsgruppe um 2 % pro Monat und die Anzahl der dadurch veranlassten Krankenhaustage um über 4 % pro Monat reduziert.
• Patienten, die in Chronikerprogrammen mit einem multidisziplinären Team und persönlicher Kommunikation waren, hatten noch einen etwas größeren Nutzen als die Routineversorgten, nämlich eine statistisch hoch signifikante Reduktion der Wiedereinweisungshäufigkeit um 2,9 % pro Monat und der damit ausgelösten Tagezahl um 6,4 % pro Monat.
• Rechnet man diese Effekte in die Anzahl von Fällen stationärer Behandlung um, sind in den Ländern mit komplexen Chronic-Care-Programmen zwischen 14.700 und 29.140 pro Jahr weniger Krankenhaushalte notwendig.
Selbst wenn sich einige Strukturen und Gewohnheiten schon zwischen den Studienländern (z.B. zwischen Großbritannien und den USA) und erst recht von den beispielsweise in Deutschland existierenden Rahmenbedingungen unterscheiden, geben sie mit Sicherheit die relativ einfache Richtung vor, in der auch in Deutschland spezielle Versorgungsprogramme für chronisch Kranke verstärkt vorgehen sollten.
Ein sehr knappes Abstract des in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift "Health Affairs" (Januar/Februar 2009 28(1):179-89) erschienenen elfseitigen Aufsatzes "What Works in Chronic Care Management: The Case of Heart Failure" von J. Sochalski, T. Jaarsma, H. M. Krumholz et al. gibt es kostenlos.
Bernard Braun, 9.1.09
Übergewicht und Adipositas wird auch bei Kindern und Jugendlichen von US-Ärzten viel zu oft übersehen
 Erst vor kurzem hatte eine Studie der renommierten US-amerikanischen Mayo-Klinik festgestellt, dass Übergewicht und Adipositas von Ärzten viel zu selten als Erkrankung diagnostiziert und den Patienten auch als solche mitgeteilt wird. Innerhalb der Gruppe mit Adipositas (also einem Body Mass Index von 30 und mehr) wurde jedoch nur bei jedem Fünften (20%) auch eine entsprechende Diagnose im Protokoll festgehalten und genau so selten (23%) fand man in den Behandlungsunterlagen Hinweise darauf, dass ein Therapieplan aufgestellt worden war. Basis der Studie waren Daten von knapp 10.000 Patienten, die bei 101 Ärzten in einer auf Übergewicht spezialisierten Mayo-Klinik zur Untersuchung waren. (vgl. Übergewicht: Eine bedeutsame Veränderungsbarriere ist auch die mangelhafte Diagnose und Therapieberatung durch Ärzte)
Erst vor kurzem hatte eine Studie der renommierten US-amerikanischen Mayo-Klinik festgestellt, dass Übergewicht und Adipositas von Ärzten viel zu selten als Erkrankung diagnostiziert und den Patienten auch als solche mitgeteilt wird. Innerhalb der Gruppe mit Adipositas (also einem Body Mass Index von 30 und mehr) wurde jedoch nur bei jedem Fünften (20%) auch eine entsprechende Diagnose im Protokoll festgehalten und genau so selten (23%) fand man in den Behandlungsunterlagen Hinweise darauf, dass ein Therapieplan aufgestellt worden war. Basis der Studie waren Daten von knapp 10.000 Patienten, die bei 101 Ärzten in einer auf Übergewicht spezialisierten Mayo-Klinik zur Untersuchung waren. (vgl. Übergewicht: Eine bedeutsame Veränderungsbarriere ist auch die mangelhafte Diagnose und Therapieberatung durch Ärzte)
Eine jetzt in der Zeitschrift "Pediatrics" veröffentlichte Studie hat nun gezeigt, dass Ärzte auch bei Kindern und Jugendlichen viel zu selten eine Diagnose stellen, die den Betroffenen Übergewicht oder Adipositas als gesundheitliches Problem verdeutlicht. Dies ist umso überraschender, als die "Übergewichts-Epidemie" bei Kindern und Jugendlichen im United Kingdom und ebenso in den USA in den letzten Jahren immer wieder in den Medien auftauchte und mit Horror-Szenarien hinsichtlich der zukünftigen gesundheitsökonomischen Folgen ausgemalt wurde.
Basis der jetzt veröffentlichten Studie waren Daten von über 60.000 Kindern und Jugendlichen im Alter von 2 bis 18 Jahren. Alle waren Mitglieder bei "MetroHealth", einer Krankenversicherung in Ohio mit überwiegend akademischen Mitgliedern. Berücksichtigt wurden dabei Daten, die Ärzte bei sogenannten "well-child visits" (vergleichbar den deutschen Vorsorge-Untersuchungen) erhoben hatten. Hier wurde dann von den Forschern einerseits anhand von Körpergröße und Gewicht der jeweilige Body-Mass-Index errechnet und andererseits in den Krankenakten überprüft, ob gegebenenfalls auch eine entsprechende Diagnose (Übergewicht, Adipositas, schwere Adipositas) vom Arzt eingetragen worden war.
Hierbei zeigte sich dann:
• 19% der Kinder und Jugendlichen hatten Übergewicht, 23% Adipositas, 8% schwere Adipositas. Insgesamt waren also 50% der Untersuchungsteilnehmer oberhalb der empfohlenen Norm zum Körpergewicht.
• Hinsichtlich ärztlicher Diagnosen wurde dann deutlich, dass Ärzte bei einem ganz erheblichen Teil der Kinder und Jugendlichen keine entsprechende Diagnose festgehalten hatten. So wurden Gewichtsprobleme nur bei 76% der schwer Adipösen, 54% der Adipösen und 10% der Übergewichtigen aktenkundig.
Problematisch erscheint dies den Wissenschaftlern, weil erst eine zutreffende Diagnose und ihre Dokumentation den Weg für weitere therapeutische Maßnahmen, welcher Art auch immer, eröffnet und ohne eine Diagnose das Problem für die Betroffenen unter den Tisch gekehrt oder zumindest bagatellisiert wird. Allerdings erscheint ihnen die Vorgehensweise der Ärzte aus mehreren Gründen nachvollziehbar, denn erst 2004 wurde der Satz "Übergewicht an sich ist noch keine Krankheit" aus den Regularien der Medicare-Krankenversicherung gestrichen. Erst danach gab es dann für Ärzte auch Möglichkeiten der finanziellen Vergütung, wenn sie sich um das BMI-Problem von Patienten kümmerten. Darüber hinaus besteht bei vielen Ärzten nach wie vor die Sichtweise, dass die Übergewichts-Problematik medizinisch nur sehr schwer beherrschbar ist und dass es andere Merkmale gibt (Rauchen, Alkohol- und Drogenmissbrauch), die gesundheitlich ebenso problematisch sind, aber von Ärzten mit mehr Erfolg angesprochen werden können.
Hier ist nicht nur das Abstract von Lacey Benson u.a.: Trends in the Diagnosis of Overweight and Obesity in Children and Adolescents: 1999-2007, sondern auch der gesamte Artikel aus PEDIATRICS Vol. 123 No. 1 January 2009, pp. e153-e158, doi:10.1542/peds.2008-1408 herunterladen.
Gerd Marstedt, 31.12.08
237.420 Medicare-Krankenhaustote von 2005-2007 vermeidbar - Extreme Ungleichheiten des Sterblichkeitsrisikos in US-Krankenhäusern
 Trotz der in den USA bereits seit langem durchgeführten regionalisierter Analysen insbesondere der Ergebnisqualität medizinischer Versorgung und trotz des umfangreichen, mit hohen Steuerungserwartungen besetzten Ratings von Krankenhäusern und Arztpraxen zeigt der aktuellste Vergleich der Krankenhausmortalität weiterhin eklatante Unterschiede.
Trotz der in den USA bereits seit langem durchgeführten regionalisierter Analysen insbesondere der Ergebnisqualität medizinischer Versorgung und trotz des umfangreichen, mit hohen Steuerungserwartungen besetzten Ratings von Krankenhäusern und Arztpraxen zeigt der aktuellste Vergleich der Krankenhausmortalität weiterhin eklatante Unterschiede.
Die wesentlichen Ergebnisse der im Oktober 2008 erschienenen "Healthgrades 11th hospital quality in America study" lauteten nämlich:
• Patienten, die in den "top-rated" 5-Sterne-Krankenhäusern der USA wegen 17 ausgewählten Erkrankungen und Prozeduren behandelt wurden, hatten zwischen 2005 und 2007 ein um 70 % geringeres Sterblichkeitsrisiko ("inhospital risk-adjusted mortality rates") als die Patienten in den am schlechtesten bewerteten 1-star-Kliniken.
• Auch wenn die Gesamtsterberaten in Krankenhäusern im selben Zeitraum insgesamt zurückgingen (um 14,2 %), sanken sie in den am besten bewerteten Einrichtungen wesentlich schneller als in den schlecht bewerteten (Spannweite der Abnahme von -6,3 % bis -20,9 %).
• Was derartige Unterschiede konkret bedeuten, zeigt das folgende Ergebnis der Studie: Wenn alle Krankenhäusern das Niveau der 5-Sterne-Häuser gehabt hätten, hätte in den drei Untersuchungsjahren der Tod von 237.420 Medicare-Versicherten vermieden werden können ("Medicare lives"). Mehr als die Hälfte der vermeidbaren Todesfälle entfielen auf vier Krankheiten, nämlich Sepsis, Lungenentzündun, Herzversagen und Atmungsversagen.
• Das regionale Gefälle des Krankenhaus-Sterblichkeitsrisiko reicht von der relativ guten Nordost-Region der USA bis zur relativ schlechten Südost-Region.
• Schließlich existiert auch noch ein enger Zusammenhang zwischen dem Behandlungsvolumen und dem Mortalitätsrisiko: In Krankenhäusern mit einem hohen Behandlungsvolumen in einer Reihe ausgewählter Interventionen und Prozeduren sank die Mortalitätsrate in den Untersuchungsjahren um 20 %. Dieser Wert sank dagegen in Krankenhäusern mit niedrigem Behandlungsvolumen um lediglich 13 %. 5-Star-Kliniken hatten höhere Behandlungsvolumina als 1-Star-Kliniken.
Die "HealthGrades Hospital Quality in America Study" ist die umfassendste jährlich durchgeführte Untersuchung der patientenbezogenen Behandlungsergebnisse an den rund 5.000 Krankenhäusern in den USA. Sie basiert auf der Analyse von mehr als 41 Millionen Medicare-Datensätze über ein breites Spektrum stationärer Behandlungen (von Herzklappenoperationen über Herzinfarkte bis zur Lungenentzündung). Die private Institution HealthGrades liefert regelmäßig detaillierte Bewertungen der 5.000 Krankenhäuser, 16.000 Pflegeheimen und 650.000 Ärzten in den USA. Die Website von HealthGrades gehört zu einer der am häufigsten von Patienten bzw. "consumers" angeklickten im Versorgungsberatungsbereich (aktuell ca. 5 Millionen Klicks pro Monat).
Nimmt man mit einigem Recht an, dass die Versorgungsqualität von Nicht-Medicare- also Privat-Versicherten mindestens so gut ist wie die in der staatlichen Versicherung für Ältere, wenn nicht sogar besser, sind die Ungleichheiten bei der Ergebnisqualität und damit der komplette "Todes- oder Totenzoll" des US-Krankenhaussystems höchstwahrscheinlich noch größer. Die Studie enthält sehr detaillierte Angaben über die Sterblichkeit nach ausgewählten Erkrankungen und Prozeduren sowie nach Bundesstaaten und Regionen.
Die 127 Seiten umfassende "Eleventh Annual HealthGrades Hospital Quality in America Study" ist als PDF-Datei kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 15.10.2008
Kooperations-Ethos und ländliche Community-Kultur! Warum ist North Dakotas Gesundheitswesen leistungsfähiger als das Kaliforniens?
 Wenn aus deutscher Sicht überhaupt positive Unterschiede innerhalb des us-amerikanischen Gesundheitssystems vermutet oder wahrgenommen werden, glaubt man sie allenfalls im Nordosten der USA, d.h. in Bundesstaaten wie Massachusetts, Vermont und Maine zu finden. Die wenigen Berichte über erfolgreiche Reforminitiativen, die großen Teilen der Bevölkerung ein wirksames und qualitativ hochwertiges Gesundheitssystem zugänglich machen, stammen auch aus diesen und ein paar weiteren Staaten.
Wenn aus deutscher Sicht überhaupt positive Unterschiede innerhalb des us-amerikanischen Gesundheitssystems vermutet oder wahrgenommen werden, glaubt man sie allenfalls im Nordosten der USA, d.h. in Bundesstaaten wie Massachusetts, Vermont und Maine zu finden. Die wenigen Berichte über erfolgreiche Reforminitiativen, die großen Teilen der Bevölkerung ein wirksames und qualitativ hochwertiges Gesundheitssystem zugänglich machen, stammen auch aus diesen und ein paar weiteren Staaten.
Dass der Schluss auf ein im Rest der USA monolithisch rundum schlechtes Gesundheitssystem zu vorschnell und falsch ist, zeigt u.a. ein vom Commonwealth Fund im Rahmen seines größeren Projekts "Commonwealth Fund State Scorecard on Health System Performance" jetzt veröffentlichter Bericht über das Gesundheitssystem im kleinen (640.000 Einwohner) ländlichen Bundesstaat North Dakota.
In diesem Scorecard Projekt wird mit Informationen bzw. 32 Indikatoren aus Leistungsdaten und ergänzt durch Vor-Ort-Besichtigungen bzw. Interviews über die Dimensionen
• Zugang zum Versorgungssystem,
• Qualität der Leistungen,
• Gerechtigkeit,
• gesundheitliche Lebensqualität und
• Grad der Vermeidung unnötiger Krankenhausversorgung und ihrer Kosten
ein Gesamtindikator über die Leistungsfähigkeit der regionalen Gesundheitssysteme erstellt und zuletzt für das Jahr 2007 ein Ranking vorgenommen.
Unabhängig von der wie bei allen Indikatorentableaus in Teilen berechtigten Kritik an der Auswahl und Aussagefähigkeit der Indikatoren, birgt schon dieses Ranking einige Überraschungen in sich: Auf Platz 1 steht nämlich Hawaii, dicht gefolgt von Iowa und erst auf Platz 3 taucht mit New Hampshire der erste Nordost-Staat auf. Die Schlusslichter tragen die Süd-Bundesstaaten Arkansas, Texas, Mississippi und Oklahoma. Der in letzter Zeit oft durch Reforminitiativen aufgefallene Bundesstaat Kalifornien liegt unter den 51 Staaten auf Platz 39.
North Dakota liegt schon bei der Gesamtbeurteilung auf Platz 13 und in allen Untersuchungsdimensionen im zweitbesten Viertel der Leistungsfähigkeit.
Über eine Reihe der möglichen Einflussfaktoren und Erklärungsgründe liefert der im Mai 2008 erschienene und von Douglas McCarthy, Rachel Nuzum, Stephanie Mika, Jennifer Wrenn und Mary Wakefield verfasste 36 Seiten umfassende Länderbericht "THE NORTH DAKOTA EXPERIENCE: ACHIEVING HIGH-PERFORMANCE HEALTH CARE THROUGH RURAL INNOVATION AND COOPERATION" der COMMISSION ON A HIGH PERFORMANCE HEALTH SYSTEM" wichtige Einblicke.
Um dieses Ergebnis ausreichend würdigen zu können, weisen die Autoren zunächst auf die Nachteile hin, die ein ländlicher Staat bei der Attraktivität für Gesundheitsprofis hat. Außerdem gibt es Schwierigkeiten die insgesamt geringen Ressourcen in kleinen und geographisch weit verstreuten Gemeinden einzusetzen.
Trotzdem gelang es den Akteuren in North Dakota, eine Reihe von messbar besseren Versorgungsangebotsstrukturen und Leistungen zustandezubringen:
• Aufbau und Stützung eines "primary care"-Systems und eines Konzepts oder "approach" patientenzentrierter "medizinischer Heimat oder Geborgenheit (medical home)" und
• eine Organisation der Versorgung durch Koordination und Kooperation in Netzwerken und
• der intensive Einsatz innovativer Technologie, um die Bedürfnisse der Patienten besser zu befriedigen und u.a. dadurch die Kosten niedrig zu halten.
Dadurch ist North Dakota nach Angaben des "Dartmouth Atlas of Health Care" einer der effizientesten Staaten bei der Behandlung von chronisch kranken Medicare-Patienten innerhalb deren letzten 2 Lebensjahre. Der Aufwand lag dort in den Jahren 2001-2005 25% unter dem nationalen Durchschnitt. In absoluten Beträgen bedeutet dies, dass die qualitativ in etwa gleichwertige Versorgung eines derartigen Patienten in North Dakota rund 39.000 US-$ und im Spitzenreiterstaat New Jersey rund 59.000 US-$ gekostet hat.
Als vorrangige und ungewohnte Erklärung benennen die ForscherInnen eine Reihe immaterieller Faktoren, die sie aus einem besonderen Kooperations-Ethos oder -Geist entspringen sehen: "Commission members were impressed by the spirit of cooperation that was evident in the dynamics of health care provision in North Dakota. This cooperative ethos is driven by resource scarcity and fostered by a rural community culture that enhances a sense of mutual accountability among health professionals and their patients."
Demnach haben die Leistungsanbieter, die Krankenversicherungen und die Politiker im ländlichen North Dakota gelernt, "that only through cooperative, interdependent relationships and a willingness to innovate in both the organization and regulation of services can they achieve the reach, care coordination, and economies of scale that are necessary for delivery of quality and efficient care in rural settings." Die Erfolge eines solchen Vorgehens sind so eindeutig und erklärbar, dass sie "provide insights and lessons that may be transferable to other rural areas of the country and to urban areas as well."
Zur Information: Das "medical home"-Konzept umfasst in der Definition von Wikipedia folgende Dimensionen: "Central to the Medical Home approach is the premise that patient-centered care requires a fundamental shift in the relationship between patients and their primary care physicians. There must be a higher degree of personalized care coordination, access beyond the acute care episode, and identification of key medical and community resources to meet the patients’ needs."
Komplett und kostenlos im Internet erhältlich sind der
• 36 Seiten-Bericht über die Performance des Gesundheitssystems in North Dakota und
• die neueste 2008-Ausgabe des "Dartmouth Atlas of Health Care" mit dem Schwerpunkt "Tracking the Care of Patients with Severe Chronic Illness".
Ergänzend findet sich auch ein kostenloser Internet-Zugang zu noch ausführlicheren Informationen über die Ziele, Methoden, Indikatoren und Ergebnisse des "Commonwealth Fund State Scorecard on Health System Performance"-Projekts: Aiming Higher: Results from a State Scorecard on Health System Performance.
Bernard Braun, 18.5.2008
Wissenslücken und Schwierigkeiten der praktischen Umsetzung von Wissen bei US-Ärzten: Beispiel Virus-Grippe und CMV-Infektion
 Mit den Kenntnissen von us-amerikanischen Primär-Ärzten (primary care physicians [PCP]) über Behandlungsempfehlungen von medizinischen Fachgesellschaften oder Leitlinien der "Centers for Disease Control and Prevention (CDC)" sowie dem praktischen Umgang von Ärzten mit ihnen bekannten und bewussten Empfehlungen bei der Behandlung von Patienten beschäftigten sich zwei aktuelle Ärzte-Surveys, deren wesentlichen Ergebnisse jetzt in zwei Ausgaben des con den CDC herausgegebenen "Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR)" veröffentlicht wurden.
Mit den Kenntnissen von us-amerikanischen Primär-Ärzten (primary care physicians [PCP]) über Behandlungsempfehlungen von medizinischen Fachgesellschaften oder Leitlinien der "Centers for Disease Control and Prevention (CDC)" sowie dem praktischen Umgang von Ärzten mit ihnen bekannten und bewussten Empfehlungen bei der Behandlung von Patienten beschäftigten sich zwei aktuelle Ärzte-Surveys, deren wesentlichen Ergebnisse jetzt in zwei Ausgaben des con den CDC herausgegebenen "Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR)" veröffentlicht wurden.
In der Ausgabe vom 25. Januar 2008 (2008; 57(03): 61-65) berichten D. Fazio, A. Laufer, J. Meek, J. Palumbo, R. Lynfield, C. Morin, K. Vick, J. Baumbach, M. Mueller, R. Belflower, C. Long und L. Kamimoto, Wissenschaftler an verschiedenen universitären und staatlichen Institutionen, die sich in den USA mit Infektionskrankheiten befassen, über "Influenza-Testing and Antiviral-Agent Prescribing Practices - Connecticut, Minnesota, New Mexico, and New York, 2006/07 Influenza Season".
Virus-Grippe ist eine der Hauptursachen für frühzeitige Sterblichkeit und schwere Krankheitsfolgelasten in den USA, mit derzeit rund 36.000 Toten pro Jahr. Insofern ist der Umgang mit Symptomen, die auf eine Virusgrippe hindeuten und eine möglichst ursachengerechte Behandlung etwas, was für den Alltag jeden Arztes von großer Bedeutung ist. Durch die weltweit geführte Debatte über die Gefahr einer großen, ebenfalls weltweiten Epidemie bzw. Pandemie mit möglicherweise Millionen von Toten gewinnt natürlich der Umgang mit den möglichen "Startfällen" einer solchen Erkrankungswelle besondere Bedeutung. Ein Teil des Behandlungsgeschehens wird natürlich auch durch solche Schreckensszenarien bestimmt.
In einer Befragung von 2.679 Ärzten antworteten 1.262 (47,1%). 730 von ihnen genügten einer Reihe von Inklusionskriterien der ForscherInnen (57,8%). Darunter befanden sich 268 (36,7%) Familien-/Hausärzte, 213 (29,2%) Internisten, 204 (27,9%) Kinderärzte und 45 (6,2%) Gynäkologen.
Die Ärzte wurden danach gefragt, wie sie mit so genannter "influenza-like illness (ILI)" umgegangen sind. ILI ist definiert als das Vorliegen einer Körpertemperatur von 37,8 Grad Celsius oder mehr sowie von Husten oder entzündetem Hals.
Obwohl seit einiger Zeit fachliche Empfehlungen vorliegen wegen der Bildung resistenter Erregerstämme weder zu schnell antivirale Medikamente einzusetzen und dabei vor allem vor dem Einsatz bestimmter Mittel (Amantadine oder Rimantadine) gewarnt wurde, sah die Behandlungswirklichkeit in der "Grippesaison" in den ausgewählten Bundesstaaten deutlich anders aus:
• 393 (53,8%) der befragten Ärzte hatten zumindestens einigen ihrer ILI-PatientInnen antivirale Mittel verordnet.
• Dabei griffen 87% zu Medikamenten mit dem Wirkstoff Oseltamivir (bekanntestes Arzneimittel ist Tamiflu), 17,8% zum Wirkstoff Amantadine, 8,7% zu Mittel mit dem Wirkstoff Rimantadine und 5,3% zu Zanamivir. Vor einem zu vorschnellen bzw. nicht streng indizierten Einsatz aller dieser Wirkstoffe wird seit einiger Zeit gewarnt. Bei Oseltamivir und Zanamivir liegen Empfehlungen vor, dass besonders auf eine korrekte Einnahme und auf mögliche Nebenwirkungen geachtet werden solle. Speziell wenn Tamiflu bei Kindern eingesetzt wird, sollte enge und ständige Kontrollen neuropsychiatrischer Effekte wie Halluzinationen, Delirien und abnormales Verhalten geachtet werden. Schon bei Tamiflu und wirkstoffidentischen anderen Mitteln aber besonders beim Wirkstoff Zanamivir sollten bei der Verordnung untere Altersgrenzen eingehalten werden. Zanamivir kann außerdem zu Bronchospasmen führen, was der Grund für die Warnung davor ist, das Mittel beispielsweise an Asthmatiker zu verordnen. Vor der Verordnung von Arzneimitteln mit den beiden anderen Wirkstoffen wird in den USA seit Januar 2006, also vor der hier untersuchten Verordnungspraxis der Grippesaison 2006/07 wegen der hohen Resistenzrate der vorherrschenden Form der Influenza A offiziell gewarnt. Trotzdem verordnete ein Viertel der sowieso schon zu hohen Anzahl von Primärärzten ausgerechnet derartige Mittel.
• Insgesamt ließen 504 (69%) der befragten Primärärzte während der untersuchten Grippesaison bei ihren PatientInnen mit ILI einen Grippetest durchführen: 88% einen so genannten "rapid antigen test", rund 19% eine Viruskultur und 6% einen großen serologischen Test. 56,5% machten dies, um Sicherheit über die Ätiologie der ILI zu erhalten und 30,8%, um eine Sicherheit über die Angemessenheit einer antiviralen Behandlung zu gewinnen. Die Tests unterscheiden sich vor allem durch die Wartezeit auf Ergebnisse, die beim Schnelltest die kürzeste ist. Dennoch warnen Test-Experten vor der niedrigen Sensivität (70-75%) dieser Tests und damit dem Vorliegen falscher (meist falsch-negativ) Ergebnisse bei 25 bis 30% der Untersuchten und empfehlen den Ärzten dringend, dies gegen den Zeitgewinn abzuwägen und zu "understand the limitations of these tests when interpreting test results.
Der knappe Ratschlag der Wissenschaftler an die PCPs lautet: "More educational measures are needed to make PCPs aware of the current treatment recommendations."
Über weitere Ergebnisse dieser Studie erfährt man mehr in einer Zusammenfassung. Von dort gelangt man auch zu einer umfangreicheren Informationsseite zur Therapie der Virusgrippe.
Dass mehr fachliche Weiterbildung von Ärzten allein nicht unbedingt die Lösung von leitlinienwidrigem Verhalten oder mangelhafter Umsetzung eindeutiger Empfehlungen ist, dass Wissen bei ein und demselben Arzt nicht zu entsprechenden Handlungen führen muss, zeigt das Ergebnis einer zweiten Befragung.
Das "American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG)", also die Fachgesellschaft der Geburtshelfer und Gynäkologen in den USA, hatte im März 2007 an 606 für die ACOG-Mitglieder repräsentativen Ärzten einen Fragebogen über ihren Wissensstand und ihren präventiven Bemühungen während der Schwangerschaft ihrer Patientinnen gegen eine Infektion mit dem "congenital cytomegalovirus (CMV)" oder dem Humanen-Herpes-Virus 5, einer bei den Müttern meist harmlose grippeähnliche Erkrankung, die aber für den Fötus bzw. die Neugeborenen eine schwere bis lebensgefährliche Angelegenheit darstellt.
Ein neugeborenes neugeborenes Kind von 150 Neugeborenen hatte eine CMV-Infektion und ein Neugeborenes von 750 wurde durch diese Infektion dauerhaft behindert. CMV ist eine Hauptquelle schwerer frühkindlicher Behinderungen wie beispielsweise Hör- und Sehverlust und kognitive Beerinträchtigungen. Die schätzungsweise 5-8.000 Kinder, die in den USA jährlich durch eine CMV-Infektion behindert werden, sind in etwa so viele oder sogar mehr als an besser bekannten Erkrankungen wie etwa dem Down-Syndrom leiden. Rund ein Drittel der Schwangeren, die zum ersten Mal an CMV erkranken, geben die Infektion an ihren Fötus weiter. Dies trifft bei einer zum zweiten Mal infizierten Frau nur noch für 1% zu.
Da es keinen Impfschutz gegen CMV gibt und auch die Behandlungsmöglichkeiten sehr eingeschränkt sind, kommt es bei dieser potenziellen Erkrankung des neugeborenen Kindes besonders stark auf die Verhütung einer Infektion an.
Im Fragebogen wurden die folgenden Fragen gestellt: "I have diagnosed one or more of the following infections in pregnant women in since 2003: congenital cytomegalovirus (CMV)" "Do you counsel your patients about why and how to prevent congenital cytomegalovirus (CMV)?" "Do you routinely recommend the following precautions about: hand washing after diaper changing, not sharing utensils with toddlers, or not getting children's saliva in eyes or mouth? (Verbally, in print, neither, or both)" "Which of the following best describes your practice regarding testing for…congenital cytomegalovirus (CMV): test all patients, test no patients, test after report of significant exposure by patient, test in response to patient request, test if fetal anomaly identified, test if negative history for previous illness?"
Von den 305 antwortenden Geburtshelfern und Gynäkologen erfuhren die von der ACOG beauftragten WissenschaftlerInnen (B. Anderson, J. Schulkin, DS. Ross, SA. Rasmussen und JL. Jones) folgende Einzelheiten des Versorgungsgeschehens:
• 27% der Befragten hatten seit 2003 bei mindestens einer Schwangeren eine CMV-Infektion diagnostiziert.
• Nur 44% der Befragten berieten die von ihnen betreuten schwangeren Frauen über die generelle Notwendigkeit und die Möglichkeiten der Prävention einer CMV-Infektion während der Schwangerschaft. Die ACOG verbreitet dazu seit einigen Jahren Empfehlungen, die sich allerdings bisher nicht auf Studien stützen können.
• 90% der Fachärzte gaben an zu wissen, dass gründliches Händewaschen nach einem Windelwechsel bei Kleinkindern das Risiko einer CMV-Infektion reduziert. Nur noch 57% kannten die Risiken der Infektion durch eine gemeinsame Nutzung von Utensilien und 55% nannten das Risiko einer Infektion nach einem Kontakt mit dem Urin oder dem Speichel anderer Neugeborenen oder Kleinkinder. Untersuchungen hatten gezeigt, dass 5 bis 25% dieser Gruppe CMV-Träger waren.
• Trotz ihres hohen Wissensstand berichteten nur 60% der Ärzte, es gehöre zu ihrer Betreuungsroutine, den schwangeren Frauen regelmäßiges Händewaschen zu empfehlen. Nur noch knapp ein Drittel von ihnen berichteten dann noch, sie würden ihnen empfehlen, den gemeinsamen Gebrauch von Gegenständen und den Speichel von bereits geborenen Kindern zu meiden.
Diese hier nicht erstmalig beobachtbare Kombination von Wissenslücken ("did not have a comprehensive understanding of modes of CMV transmission and possible prevention measures") und Umsetzungs- oder Anwendungsdefiziten oder Blockaden des Wissens verlangen eine ebenfalls komplexe Antwort und zunächst ein besseres Verständnis darüber, wie es zu derartigen kombinierten Therapiemängeln kommt.
Die ACOG fasst dies so zusammen: "These results emphasize the need for additional training of OB/GYNs regarding CMV infection prevention and better understanding of the reasons that physician knowledge about CMV transmission does not necessarily result in patient counseling."
Beide Studien weisen auf einige ihrer methodischen Defizite und Begrenzungen selbst offen hin, die u.a. durch die allein aus den Reihen von Fachgesellschaftsmitgliedern gewonnene Befragtenstichprobe, die räumliche Konzentration der Befragten und den weitgehenden Verlass auf Eigenberichte begründet sind. Trotzdem gibt es keine Anhaltspunkte, dass in einer repräsentativen Stichprobe der US-Ärzte keines der erkannten Probleme verschwinden würde. Sie könnten eher noch zunehmen. Selbstverständlich lassen sich die Ergebnisse auch nicht 1:1 auf die deutsche Ärzteschaft übertragen. Der kleinste Nutzen besteht aber darin, Aufhänger dafür zu sein, dass auch in Deutschland im Rahmen der Qualitätssicherung endlich ähnliche Untersuchungen durchgeführt werden.
Eine Zusammenfassung des MMWR-Report "Knowledge and Practices of Obstetricians and Gynecologists Regarding Cytomegalovirus Infection During Pregnancy •- United States, 2007 vom 25. Januar 2008 (2008; 57(03): 65-68) gibt es kostenlos. Das CDC stellt auch zur CMV-Infektion ergänzende Informationen für PatientInnen und Ärzte zur Verfügung. Kostenfrei zugänglich sind auch die ACOG guidelines on perinatal viral and parasitic infections.
Bernard Braun, 28.1.2008
"Clarion call for action" - Über 50 % des ambulanten Behandlungsgeschehens bei US-Kindern qualitativ problematisch.
 Warum auch immer dieser Fanfarenstoß nicht erwartet wurde: Experten reagierten geschockt darauf, dass Kinder in den USA nur in 47 % aller ambulanten Behandlungen richtig versorgt werden. So lautet das Kernergebnis einer gerade im "New England Journal of Medicine (NEJM)" veröffentlichten Studie von Forschern der RAND-Corporation, dem Seattle Children’s Hospital Research Institute und der School of Medicine der Universität des Bundesstaates Washington.
Warum auch immer dieser Fanfarenstoß nicht erwartet wurde: Experten reagierten geschockt darauf, dass Kinder in den USA nur in 47 % aller ambulanten Behandlungen richtig versorgt werden. So lautet das Kernergebnis einer gerade im "New England Journal of Medicine (NEJM)" veröffentlichten Studie von Forschern der RAND-Corporation, dem Seattle Children’s Hospital Research Institute und der School of Medicine der Universität des Bundesstaates Washington.
Dazu wurden die Daten von 1.536 Kindern (Neugeborene bis 18-Jährige) in 12 städtischen Bezirken im Zeitraum von 1996 bis 2000 herangezogen und die jeweiligen in medizinischen Dokumentationen erfassten Behandlungsschritte aufwändig mit 175 etablierten Behandlungsstandards für 12 klinische Bereiche verglichen (ausführliche Beispiele finden sich im Aufsatz). Drei Viertel der StudienteilnehmerInnen waren weißer Hautfarbe, 82 % waren privat krankenversichert und alle lebten in oder in der Nähe von mittelgroßen Städten.
Die Vergleiche von Behandlungswirklichkeit und -standards erbrachten auf dem insgesamt hohen Niveau qualitativer Fehlversorgung nochmals kräftige Unterschiede bei den einzelnen Behandlungsarten: Bei akuten gesundheitlichen Problemen gab es in 68 % der Behandlungsfälle eine gute Versorgung, bei der Versorgung chronischer Erkrankungen war dies noch bei 53 % des Geschehens der Fall und der Tiefpunkt erreichte die präventive Behandlung, die nur noch bei 41 % des Geschehens den Standards entsprach.
Im Einzelnen identifizierte die Studie beispielsweise folgende Behandlungslücken:
• Bei weniger als einem Drittel der Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren wurde innerhalb zweier Jahre die Größe und das Gewicht gemessen.
• Bei ernstem Durchfall erhielten die StudienteilnehmerInnen in 38 % der Fälle eine gute, d.h. in Leitlinien und Standards vereinbarte Behandlung. Dies traf bei Infektionen der ableitenden Harnwege bei 48 % zu und bei Asthma bei 46 % der Fälle.
• Selbst bei den Allerweltsinfektionen der oberen Atemwege erhielten 8 % der Kinder nicht die angemessene Behandlung.
Die Leiterin der Studie, Rita Mangione-Smith vom "Seattle Children's Hospital Research Institute", wies trotz der jetzt schon problematischen Fehlversorgung relevanter Anteile der untersuchten Kinder darauf hin, dass es sich hier sogar um ein "best-case scenario" handle, da die Mehrheit der Kinder gut versichert wären. Würde man die 15-20 % der nicht krankenversicherten Kinder noch hinzunehmen, würde die Diskrepanz von Standards und Realität der Behandlung noch größer.
Zu den Faktoren, die nach Meinung der WissenschaftlerInnen diese Situation mitschaffen gehören Ausbildungs- und Fortbildungsdefizite der Ärzte, die vorrangig auf die Behandlung akuter Krankheiten ausgerichtet ist und Versicherungsverträge, die nicht selten keine präventiven Leistungen einbeziehen.
Ebenfalls schockiert räumt James Perrin, der Chefpädiater am "Massachusetts General Hospital" und Professor an der "Harvard Medical School", in einem inhaltlich und methodisch interessanten Editorial ein: "We've been lulled into complacency, thinking this kind of thing doesn't happen with children." Einer der Hauptfaktoren, die wahrscheinlich verhinderten, dass es zu einer komplett zufälligen und repräsentativen Studie kommen konnte, war im übrigen die extrem geringe Bereitschaft der Eltern, selbst Wissenschaftlern Einblick in die Behandlungsdaten ihrer Kinder zu gewähren.
Ob auch die deutschen Akteure eingelullt (worden) sind, könnte erst eine ähnliche Studie bestätigen oder widerlegen. Bis dahin: Im Zweifel zweifeln und über Verbesserungsmöglichkeiten nachdenken!
Von dem Aufsatz "The Quality of Ambulatory Care Delivered to Children in the United States" von Rita Mangione-Smith, Alison H. DeCristofaro, Claude M. Setodji, Joan Keesey, B.A., David J. Klein, John L. Adams, Mark A. Schuster, und Elizabeth A. McGlynn im NEJM (2007; 357(15): 1515-1523 vom 11. Oktober) gibt es kostenlos eine neunseitige komplette PDF-Fassung. Dies gilt auch für das ausführliche Editorial "The Quality of Children's Health Care Matters — Time to Pay Attention" von James M. Perrin, und Charles J. Homer (357(15): 1549-1551).
Bernard Braun, 14.10.2007
Mangelnde Beratung über Empfängnisverhütung bei Verordnung fruchtschädigender Arzneimittel für gebärfähige Frauen
 Die Erkenntnis, dass die Verordnung und Einnahme jeglicher Medikamente bei aktuell oder möglicherweise in naher Zukunft schwangeren Frauen ein besonderes Risiko in sich bergen und daher auch von einer Beratung über Methoden der Empfängnisverhütung begleitet werden müssen, scheint weitverbreitet und Standard zu sein. Dies gilt noch mehr für Medikamente, von denen ein erhöhtes Risiko der Fruchtschädigung wissenschaftlich und "amtlich" bekannt ist und durch eine entsprechende Klassifikation klar und eindeutig signalisiert wird.
Die Erkenntnis, dass die Verordnung und Einnahme jeglicher Medikamente bei aktuell oder möglicherweise in naher Zukunft schwangeren Frauen ein besonderes Risiko in sich bergen und daher auch von einer Beratung über Methoden der Empfängnisverhütung begleitet werden müssen, scheint weitverbreitet und Standard zu sein. Dies gilt noch mehr für Medikamente, von denen ein erhöhtes Risiko der Fruchtschädigung wissenschaftlich und "amtlich" bekannt ist und durch eine entsprechende Klassifikation klar und eindeutig signalisiert wird.
Ernüchternd ist insofern eine Studie, die in den USA auf Basis der Verordnungsdaten von 488.175 Frauen im Alter von 15 bis 44 Jahren für das Jahr 2001 gemacht wurde, die bei einer HMO in Nordkalifornien krankenversichert waren.
Diese sich durchweg im gebärfähigen Alter befindlichen Frauen erhielten in diesem Jahr 1.011.658 Arzneimittelverordnungen der Klassifikation A, B, D oder X. Von den Medikamenten vom amtlich zugewiesenen Typ D oder X ist ihre Fähigkeit Missbildung zu erzeugen oder ihre so genannte Teratogenität bekannt, die Klassen A und B sind hier sicherer.
Untersucht wurden nun die Verordnungshäufigkeit der teratogenen Präparate, die mit ihrer Verordnung verbundene Beratung über Empfängnisverhütung als eine Vorsichtsmaßnahme bei der wahrscheinlich zeitlich begrenzten Notwendigkeit, solche Medikamente einzunehmen und die Häufigkeit von Schwangerschaften innerhalb von 3 Monaten nach Erhalt eines solchen Medikaments.
Die Ergebnisse im Einzelnen:
• Ein Sechstel aller Frauen, die überhaupt eine Arzneimittelverordnung erhielten, erhielt ein Klasse D oder X-Präparat.
• Frauen, die ein solches Medikament verordnet bekamen, wurden keineswegs häufiger über das Risiko und die Möglichkeiten von prophylaktischer Empfängnisverhütung beraten (48 %) als Frauen mit Typ A und B-Präparaten (51 %). Dies umfasst auch die Verordnung von empfängnisverhütenden Mitteln.
• Mit einer Ausnahme (Verordnung von Isotretinoin zur Behandlung schwerer Formen von Akne)galt diese Nichtberatung für alle Typ D oder X-Medikamente.
• Frauen mit verordneten potenziell missbildungsverursachenden Medikamenten wurden nur geringfügig weniger innerhalb der 3-Monatsfrist nach Beginn einer Arzneimitteltherapie dieser Art schwanger als Frauen mit A oder B-Medikamenten (1 % versus 1,4 %). Soweit in den Daten ersichtlich war, trat keine der möglichen Missbildungen auf.
Auch wenn man aufgrund der Daten möglicherweise den Mangel an Empfängnisverhütungs-Beratung und die Medikation etwas überschätzt, kommt man nicht darum herum, dass zumindest diesen kalifornischen Frauen häufig potenziell fruchtschädigende Medikamente ohne jegliche Beratung zur vorbeugenden Empfängnisverhütung verordnet worden sind.
Was man mit den Daten nur schlecht untersuchen kann ist die noch weitergehende Frage, ob die Verordnung dieser Art von Medikamenten wirklich medizinisch notwendig war oder nicht hier bereits ein massives Qualitätsproblem bzw. ein gering entwickeltes Problembewusstsein bei den verordnenden Ärzten vorliegt.
Zum Aufsatz "Documentation of Contraception and Pregnancy When Prescribing Potentially Teratogenic Medications for Reproductive-Age Women" von Schwarz, Postlethwaite, Hung und Armstrong in der Fachzeitschrift "Annals of Internal Medicine" (18 September 2007, Volume 147 Issue 6: 370-376) gibt es ein kostenfreies Abstract.
Bernard Braun, 18.9.2007
Übergewicht: Eine bedeutsame Veränderungsbarriere ist auch die mangelhafte Diagnose und Therapieberatung durch Ärzte
 Die bislang erprobten Interventionen, um der weiteren Verbreitung von Übergewicht und Adipositas Einhalt zu gebieten, zeigen durchweg nur sehr bescheidene und oftmals auch nur kurzfristige Erfolge - dies hat eine Literaturübersicht in einem Newsletter der Bertelsmann-Stiftung gezeigt ("Deutsche sind die dicksten Europäer? Wie es zu einer Zeitungsente kam und was die neuesten Fakten sind"). Hintergründe für die auch in Deutschland wachsenden Raten übergewichtiger Bürger sind überaus vielfältig und komplex und betreffen anerzogene Ernährungs- und Bewegungsgewohnheiten, aber auch soziale und kulturelle Normen.
Die bislang erprobten Interventionen, um der weiteren Verbreitung von Übergewicht und Adipositas Einhalt zu gebieten, zeigen durchweg nur sehr bescheidene und oftmals auch nur kurzfristige Erfolge - dies hat eine Literaturübersicht in einem Newsletter der Bertelsmann-Stiftung gezeigt ("Deutsche sind die dicksten Europäer? Wie es zu einer Zeitungsente kam und was die neuesten Fakten sind"). Hintergründe für die auch in Deutschland wachsenden Raten übergewichtiger Bürger sind überaus vielfältig und komplex und betreffen anerzogene Ernährungs- und Bewegungsgewohnheiten, aber auch soziale und kulturelle Normen.
Eine in der Zeitschrift "Mayo Clinic Proceedings" veröffentlichte Studie jetzt ein völlig neues Ursachenbündel ausgemacht: Adipositas, so der Befund, wird von Ärzten viel zu selten als Erkrankung diagnostiziert und den Patienten auch als solche mitgeteilt. Auch wird in den meisten Fällen kein Therapieplan aufgestellt, der Behandlungsschritte auflistet und konkrete Empfehlungen etwa zur Änderung von Verhaltensgewohnheiten enthält. Basis der Studie waren Daten von knapp 10.000 Patienten, die bei 101 Ärzten in einer auf Übergewicht spezialisierten Mayo-Klinik zur Untersuchung waren. Für alle Patienten wurden über einen Zeitraum von 12 Monaten (November 2004 - Oktober 2005) routinemäßig umfangreiche Daten und Befunde protokolliert, unter anderem Alter und Geschlecht, schon vorliegende Erkrankungen und auch der Body-Mass-Index (BMI).
Als die Wissenschaftler dann später anhand der Datenbanken überprüften, welche Diagnosen und welche Therapiepläne in den Untersuchungsprotokollen (auf EDV gespeichert) vorlagen, stießen sie auf überraschende Befunde:
• Bei etwa 2.500 der knapp 10.000 Patienten wurde ein BMI von 30 oder mehr festgestellt, jeder vierte Patient war also adipös.
• Innerhalb dieser Gruppe mit Adipositas wurde jedoch nur bei jedem Fünften (20%) auch eine entsprechende Diagnose im Protokoll festgehalten und genau so selten (23%) fand man in den Behandlungsunterlagen Hinweise darauf, dass ein Therapieplan aufgestellt worden war.
• Selbst bei Patienten mit einem BMI >= 35 war man nur in 62% der Fälle eine entsprechende Diagnose vermerkt.
• Von Assistenzärzten wurden Diagnosen doppelt so oft festgehalten wie von Ärzten, die ihre Ausbildung schon hinter sich hatten und längere Zeit in der Klinik tätig waren. Bei der Aufstellung von Therapieplänen unterscheiden beide Gruppen sich allerdings nicht .
Die Forscher diskutieren leider nur sehr kurz, welche Hintergründe sie als maßgeblich für diese Befunde erachten. Es könnte ihrer Meinung nach sowohl zutreffen, dass Übergewicht von Ärzten aufgrund der hohen Verbreitung in den USA nicht als "richtige Krankheit" wahrgenommen und daher auch nur selten protokolliert wird. Ebenso könnte ein Stück Resignation mitschwingen: Wenn es in langen Jahren nur in wenigen Fällen gelungen ist, übergewichtige Patienten zu einer Änderung ihrer Alltagsgewohnheiten (Ernährung, Bewegung) zu motivieren, dann lohnt es auch nicht, erneut "hoffnungslose Fälle" als solche statistisch zu dokumentieren. Aber auch Zeitdruck könnte für Ärzte eine Rolle spielen oder auch Überlegungen zur Finanzierung, da Krankenversicherungen in vielen Fällen für die Therapie von Übergewicht keine Kosten übernehmen. In jedem Falle jedoch, so ihr Fazit, besteht eine tiefe Kluft zwischen der medizinischen Beobachtung von Risikofaktoren und deren Umsetzung in konkrete Therapien.
Die Studie Aditya Bardia u.a.: Diagnosis of Obesity by Primary Care Physicians and Impact on Obesity Management ist hier verfügbar als
Abstract
Gerd Marstedt, 26.8.2007
74 % der Kinder mit gemessenem hohem Blutdruck bleiben trotz mehrerer Arztbesuche ohne Diagnose
 Eines der seit langem bekannten Probleme der Behandlung von Kindern und Jugendlichen (aber auch von älteren Menschen oder Frauen) z. B. mit Arzneimitteln ist das weitgehende Fehlen von gesicherten Erkennnissen der Wirkung dieser Mittel bei Angehörigen dieser Gruppen. Arzneimittel werden meist für mittelaltrige Männer entwickelt und auch bezüglich der Dosierung erprobt und meist nicht an den genannten Bevölkerungsgruppen. Die pragmatische Vorgehensweise, Kinder als halbe Erwachsene zu betrachten und ihnen halbe Dosen zu verabreichen, hat unerwünschte Wirkungen.
Eines der seit langem bekannten Probleme der Behandlung von Kindern und Jugendlichen (aber auch von älteren Menschen oder Frauen) z. B. mit Arzneimitteln ist das weitgehende Fehlen von gesicherten Erkennnissen der Wirkung dieser Mittel bei Angehörigen dieser Gruppen. Arzneimittel werden meist für mittelaltrige Männer entwickelt und auch bezüglich der Dosierung erprobt und meist nicht an den genannten Bevölkerungsgruppen. Die pragmatische Vorgehensweise, Kinder als halbe Erwachsene zu betrachten und ihnen halbe Dosen zu verabreichen, hat unerwünschte Wirkungen.
Eine nun in den USA durchgeführte Studie zeigt aber auch für den Bereich der Diagnostik verbreiteter kindlicher oder jugendlicher Krankheitszustände oder ihrer Vorstufen Probleme und Mängel.
In einer Kohortenstudie mit 14.187 Kindern und Heranwachsenden im Alter von 3 bis 18 Jahren, die zwischen Juni 1999 und September 2006 mindestens dreimal zu einer Gesundheitsunsuchung bei einem Arzt in einer großen akademischen und städtischen Gesundheitseinrichtung im Nordosten Ohios waren, wurde mit den elektronischen Behandlungsunterlagen untersucht, ob die Ärzte auf der Basis von mehreren Blutdruckmessungen einen erhöhten Blutdruck oder eine Vorstufe von Bluthochdruck ("prehypertension") diagnostizierten oder nicht. Bluthochdruck ist insbesondere bei übergewichtigen oder adipösen Kindern keine Seltenheit mehr.
Die Forscher ermittelten mit den genannten Messdaten die Anzahl von Kindern und Jugendlichen, die nach Leitlinien und Behandlungsempfehlungen mindestens dreimal einen Blutdruckwert hatten, der zu einer Diagnose Bluthochdruck oder Pre-Hochdruck hätte führen müssen. Da das Alter, die Größe und das Geschlecht der Kinder Faktoren sind, die über die Normalität oder Anormalität des Blutdrucks mitbestimmen, wurden die Daten alters- und größenadjustiert.
Die Ergebnisse sind deutlich:
• 507 untersuchte Kinder und Jugendliche, das sind 3,6 % der Kohorte, hatten Bluthochdruck. Bei 131 oder 26 % dieser Gruppe fand sich eine entsprechende Diagnose oder zumindest ein Hinweis auf erhöhten Blutdruck in den Behandlungsunterlagen.
• 485 Personen aus der Kohorte (3,4 %) hatten Werte, die eine Vorstufe von Bluthochdruck bedeuteten. 55 oder 11 % hatten eine angemessene Diagnose.
• In beiden Fällen nahm die Häufigkeit einer ausdrücklichen Diagnose mit dem Alter, der Größe, dem Vorhandensein von Übergewicht und der Ausprägung beider Blutdruckwerte zu, blieb aber immer deutlich unter dem Optimum.
Solange nicht davon ausgegangen werden kann, dass es sich hierbei um Effekte von Fehldokumentationen handelt (wobei dies dann ebenfalls ein erhebliches Problem darstellen würde), handelt es sich offensichtlich um ein weiteres spezifisches Qualifikations- und Qualitätsdefizit der Ärzteschaft in den USA und wahrscheinlich auch in Deutschland. Die Verfasser des Aufsatzes formulieren dies sehr zurückhaltend, wenn sie den Allgemein- und Hausärzten angesichts der objektiven Variabilität des Blutdrucks in diesem Lebensabschnitt zugutehalten, sie "typically cannot remember normal blood pressures for the wide range of children."
Exemplarisch nachgefragt: Dies kann so sein und wäre ja geradezu menschlich. Nur warum dürfen dann dieselben Ärzte in einem großen medizinischen Zentrum in den USA und anderswo ohne weiteres so genannte "well-child care" anbieten und dafür Honorare berechnen?
Ein kostenfreies Abstract des Aufsatzes "Underdiagnosis of Hypertension in Children and Adolescents" von Matthew L. Hansen; Paul W. Gunn und David C. Kaelber aus der aktuellen Ausgabe des "Journal of the American Medical Association (JAMA)" vom 22. August 2007 (JAMA. 2007;298:874-879) mit weiteren Informationen finden Sie hier.
Bernard Braun, 22.8.2007
"Wehe, Du hast nur eine Krankheit!" oder: Wer viele Krankheiten hat, bekommt eine qualitativ bessere Behandlung
 Auf diesen platten Nenner lässt sich das unerwartete Ergebnis einer Studie bei drei verschiedenen Patientengruppen mit insgesamt 7.680 Erwachsenen in der Ausgabe des angesehenen Medizinjournal "New England Journal of Medicine (NEJM)" vom 14. Juni 2007 bringen. Die drei Kohorten stammen aus der "Community Quality Index study", der "Assessing Care of Vulnerable Elders study" und der "Veterans Health Administration project". Ausgewertet wurden Qualitätsindikatoren zum Erhalt der empfohlenen Behandlungselementen in den Behandlungsdatensätzen.
Auf diesen platten Nenner lässt sich das unerwartete Ergebnis einer Studie bei drei verschiedenen Patientengruppen mit insgesamt 7.680 Erwachsenen in der Ausgabe des angesehenen Medizinjournal "New England Journal of Medicine (NEJM)" vom 14. Juni 2007 bringen. Die drei Kohorten stammen aus der "Community Quality Index study", der "Assessing Care of Vulnerable Elders study" und der "Veterans Health Administration project". Ausgewertet wurden Qualitätsindikatoren zum Erhalt der empfohlenen Behandlungselementen in den Behandlungsdatensätzen.
Die Forscher untersuchten die Beziehung zwischen dem Anteil mehrerer gut ausfallenden Qualitätsindikatoren und der Anzahl von Erkrankungen (nicht weiter differenziert nach ihrer Schwere), die bei jedem Patienten vorlagen.
Das Ergebnis lautete: Die mit diesen Indikatoren gemessene Qualität steigt mit jeder zusätzlichen Erkrankung um mehrere Prozent, also mit der Komplexität der Behandlung aber natürlich auch der Vertrautheit mit dem Patienten.
Der Wert differierte in den drei Untersuchungsgruppen zwischen 2,2 % in der "Community Quality Index cohort", 1,7 % in der "Assessing Care of Vulnerable Elders cohort" und in der "Veterans Health Administration cohort". Diese Beziehung blieb auch noch erhalten nachdem die Patienten nach ihren wichtigsten Charakteristika adjustiert wurden, wenngleich die absoluten Werte sanken.
Der Ausgangspunkt der Studie war die sehr praktische Annahme oder Befürchtung, ob bei den insbesondere in den USA stark zunehmenden "Pay-for-performance"- oder P4P-Programme, welche die Bezahlung ärztlicher Tätigkeit davon abhängig machen, ausgewählte Qualitätsparameter erreicht werden. Konkret bestand die Befürchtung darin, dass Ärzte, die multimorbide und auch meist chronisch kranke PatientInnen behandeln, es schwer oder schwerer hätten eine qualitativ hochwertige Behandlung hinzubekommen.
Überprüfungen mehrerer möglicher Einflussfaktoren auf das gegenteilige Ergebnis, die von individuellen bis zu versorgungsorganisatorischen Merkmalen reichten, lieferten keine schlüssigen oder vollständigen Erklärungen. Auch beim Hinweis auf die Rolle der Vertrautheit zwischen chronisch Kranken und ihren Ärzten oder der Möglichkeit, dass sich Ärzte bei diesen Patienten erst richtig "herausgefordert" fühlen, sind spekulativer Art bis zu einer wissenschaftlichen Überprüfung.
Ein Abstract des Aufsatzes "Relationship between Number of Medical Conditions and Quality of Care" von Takahiro Higashi, Neil S. Wenger, John L. Adams, Constance Fung, Martin Roland, Elizabeth A. McGlynn, David Reeves, Steven M. Asch, Eve A. Kerr und Paul G. Shekelle im NEJM (Volume 356 2007:2496-2504) können Sie hier einsehen.
Bernard Braun, 6.7.2007
"In Health Care, Cost Isn't Proof of High Quality" zeigt Herzchirurgie-Studie in Pennsylvania
 Mit dieser nüchternen und wahrscheinlich für manchen Leser ernüchternden Formulierung überschrieb die New York Times (NYT) vom 14. Juni 2007 ihren Artikel über die vom staatlichen Pennsylvania Health Care Cost Containment Council (PHC4) an den 60 Krankenhäusern des US-Bundesstaates Pennsylvania durchgeführte Studie "Cardiac Surgery in Pennsylvania 2005. Information about hospitals and cardiothoracic surgeons".
Mit dieser nüchternen und wahrscheinlich für manchen Leser ernüchternden Formulierung überschrieb die New York Times (NYT) vom 14. Juni 2007 ihren Artikel über die vom staatlichen Pennsylvania Health Care Cost Containment Council (PHC4) an den 60 Krankenhäusern des US-Bundesstaates Pennsylvania durchgeführte Studie "Cardiac Surgery in Pennsylvania 2005. Information about hospitals and cardiothoracic surgeons".
Für alle 60 namentlich genannten Krankenhäuser sammelten die Forscher die Anzahl verschiedener herzchirurgischer Interventionen (Bypass-Operation und Herzklappenoperation), die Sterberaten während des Behandlungsaufenthalts und innerhalb eines 3o-Tagezeitraums nach der Operation, die Wiedereinweisungen nach 7 und 30 Tagen, die postoperative Liegezeit und die durchschnittlichen Kosten der Eingriffe. Zusammen waren es Daten von 17.331 Personen.
Die wesentliche Erkenntnis der Studie ist eine unverhüllte Evidenz ("stark evidence") dafür, dass mit hohen Behandlungszahlungen nicht notwendigerweise qualitativ hochwertige Behandlung verbunden ist. So gab es z. B. zwischen einem Krankenhaus, das fast 100.000 US-Dollar für eine Bypassoperation abrechnete und einem Haus, in dem dieselbe Operation weniger als 20.000 US-Dollar kostete, weder Liegezeit- noch Sterblichkeitsunterschiede. Es ist sogar so, dass unter den 20 Krankenhäusern in der Metropole Philadelphia zwei der teuersten höhere Sterblichkeitsraten aufwiesen als erwartet wurde. Die Argumente der Krankenhäuser, es handle sich immer um Effekte seltener aber ganz schwerer Fälle, können lediglich einen Bruchteil der Unterschiede erklären.
Die Daten dieser Untersuchung sind geeignet die in den USA weitverbreitete Grundhaltung oder -bereitschaft, mit mehr Geld gute Behandlung einzukaufen, zu erschüttern. In den Worten der NYT: "Expensive medicine may, in fact, be poor medicine" und zitiert einen Versicherungsmanager folgendermaßen: "For most consumers, the fact that there is no connection between quality and cost is one of the dirty secrets of medicine."
Ganz nebenbei förderte die Studie auch noch ein paar andere Hinweise auf die Bedeutung mancher Seite der Qualitätssicherung zu Tage:
• Patienten, die gleichzeitig Bypässe gelegt bekamen und an den Herzklappen operiert wurden, hatten die höchste Sterblichkeit- und Wiedereinweisungsrate. Patienten, die "nur" eine Bypassoperation hatten, hatten dagegen die niedrigsten Werte der beiden Raten.
• Von allen Herzpatienten traten bei insgesamt 4,4 % so genannte Krankenhausinfektionen ("hospital-acquired infection" [HAI]) auf. 8 % unter den Doppel-Operierten und 3,6 % bei den Bypass-Patienten.
• Von allen HAI-Patienten starben 13,5 % im Krankenhaus wohingegen es unter den Patienten ohne HAI "nur" 2,4 % waren.
• Mit HAI lagen Patienten noch 21,7 Tage lang im Krankenhaus, während die Patienten ohne Infektionen das Krankenhaus schon nach 7,1 Tagen verlassen konnten.
• Und schließlich kosten die HAI auch noch sehr viel Geld: Patienten mit Infektionen und privater kommerzieller Versicherung bezahlten im Durchschnitt 65.514 US-$, denen 32.764 US-$ bei Nichtinfizierten standen. Die durchschnittliche Zahlung lag bei Medicare-Patienten mit HAI bei 57.883 US-$ und 32.911 US-$ bei Patienten ohne HAI.
Den 40-seitigen Report "Cardiac Surgery in Pennsylvania 2005. Information about hospitals and cardiothoracic surgeons" kann man hier kostenlos herunterladen.
Bernard Braun, 21.6.2007
Zwei Welten der Gesundheitsversorgung in den USA: Vom Abstand zwischen "lowest- and top-performing states"
 Auch wenn die Erforschung von so genannten "small areas variations" der gesundheitlichen Versorgung in den USA fast schon zur Tradition oder zu den Standardbemühungen von Public Health gehört und die räumlichen Unterschiede der Risiko- und Versorgungsstruktur und -qualität in der Versorgungsplanung beachtet werden, beschäftigt sich eine weiter anwachsende Anzahl von Primärstudien und Forschungsüberblicken mit diesen Problemen.
Auch wenn die Erforschung von so genannten "small areas variations" der gesundheitlichen Versorgung in den USA fast schon zur Tradition oder zu den Standardbemühungen von Public Health gehört und die räumlichen Unterschiede der Risiko- und Versorgungsstruktur und -qualität in der Versorgungsplanung beachtet werden, beschäftigt sich eine weiter anwachsende Anzahl von Primärstudien und Forschungsüberblicken mit diesen Problemen.
Dies gilt auch für die gerade erschienene Studie des privaten Commonwealth Fund, die unter der Überschrift "Aiming Higher: Results from a State Scorecard on Health System Performance" (Autoren: Joel C. Cantor, Sc.D., Dina Belloff, M.A, Cathy Schoen, M.S) überwiegend bereits erschienene Ergebnisse und Auswertungen der Daten zahlreicher Regierungseinrichtungen, von Medicare, dem Statistischen Bundesamt der USA und der "Centers for Disease Control and Prevention" zu 32 Performance-Indikatoren für alle US-Bundesstaaten zusammengestellt, eine Bewertung jedes inhaltlichen Bereichs und daran anschließend ein mehrstufiges Ranking der Staaten durchgeführt hat.
Die 32 Messungen konzentrieren sich vor allem auf den Zugang zum Gesundheitssystem, d.h. beispielsweise auf den Anteil der krankenversicherten Bevölkerung, auf die Qualität der Versorgung, die sich z.B. daran bemisst wie oft die Menschen empfohlene Versorgungsleistungen wirklich erhalten, auf vermeidbare Kosten u.a. durch Wiedereinweisungen in Krankenhäusern, die Gerechtigkeit, wie sie sich z.B. in der Verteilung von Leistungsfähigkeit nach Einkommen und ethnischer Herkunft zeigt und auf gesundes Leben bemessen an der Sterblichkeit an bestimmten Erkrankungen vor dem Erreichen des 75. Lebensjahrs.
Die gefundenen Unterschiede der Gesundheits- und Lebensverhältnisse der einzelnen Bundesstaaten sind erheblich, haben ein eindeutiges Muster und sind für eine erhebliche Anzahl von US-Amerikanern gravierend:
• Die BürgerInnen der am schlechtesten gerankten 5 Bundesstaaten haben ein doppelt so hohes Risiko vorzeitig, d.h. vor dem 75. Lebensjahr an einer verzögerbaren oder angemessen behandelbaren Krankheit zu sterben als ihre MitbürgerInnen in den 5 am besten positionierten.
• Die Unterschiede der so definierten Frühsterblichkeit folgen einem eindeutigen Nord-Südgefälle. So handelt es sich bei den Bundesstaaten mit der schlechtesten Gesundheits-Performance um South Carolina, Tennessee, Arkansas, Louisiana und Mississippi (150,4 vermeidbare Tote auf 100.000 Personen), bei den am besten positionierten um Minnesota (70,2 vermeidbare Tote pro 100.000 Personen), Utah, Vermont, Wyoming und Alaska. Nur die Bundeshauptstadt Washington bzw. der District of Columbia belegt mit 160 frühzeitigen Toten pro 100.000 BürgerInnen hier noch den allerletzten Platz.
• Auch wenn man alle Messungen und Indikatoren berücksichtigt, gehören Nord-Staaten wie Hawaii, Iowa, New Hampshire, Vermont und Maine zu den Top-Performern und wiederum eher südliche Bundesstaaten wie Kentucky, Louisiana, Nevada, Arkansas, Texas, Mississippi und Oklahoma zu den Leistungsschlusslichtern.
• Der Bericht weist auf einen direkten Zusammenhang der unterschiedlichen Bemühungen von Bundesstaaten hin, ihren Bürgern einen Krankenversicherungsschutz zu verschaffen: So sorgt in Hawaii ein 1974 verabschiedetes Gesetz dafür, dass 78 % aller Erwachsenen und 94,7 % aller Kinder versichert sind. Genau umgekehrt sieht es bei den "Schlusslichtern" Mississippi und Oklahoma, wo politisch gewollt ein äußerst restriktiver Zugang zu Medicaid existiert.
• Wie hart weitere Unterschiede aussehen, zeigt zwei weitere Beispiele: Die Rate von Kindern, die trotz bestehender Möglichkeiten, dies präventiv zu verhindern, wegen Asthma stationär behandelt werden müssen, ist in South Carolina sechsmal höher als in Vermont. Die simple rechtzeitige Gabe von Antibiotika bei Operierten zum richtigen Zeitpunkt zur Vermeidung von Infektionen variiert zwischen einem Anteil von 50 % bei solchen Patienten in Nevada und 90 % ihrer LeidensgenossInnen in Conneticut.
• Selbst unter den Top-Performern existieren aber noch erhebliche Versorgungsdefizite. So bekommen auch in Hawaii nur 65 % der erwachsenen Diabeteskranken die empfohlene Behandlung zur Vermeidung von gravierenden Folgeschäden.
• Zur finanziellen Bedeutung der Unterschiede: Medicare könnte 5 Milliarden US-Dollar sparen, wenn alle Staaten die Rate der verhinderbaren Krankenhauseinweisungen für chronisch Kranke auf das Level der besten Bundesstaaten absenken würden.
Die komplette Studie (über 3 MB PDF-Datei) und weitere Überblickstexte und Materialien (Powerpoint- oder PDF-Chartpack und Executive Summary) erhält man kostenlos auf dieser Website des Commonwealth Fund.
Bernard Braun, 15.6.2007
Kostendämpfung und Rationalisierung in US-Krankenhäusern erhöhen das Risiko unerwünschter Wirkungen bei Patienten
 Die Anstrengungen an us-amerikanischen Krankenhäusern, Operationen zu rationalisieren und Kosten durch die Reduktion von Personal zu senken, erhöht in Spitzenzeiten des Behandlungsgeschehens das Risiko vermeidbarer Fehler und damit das Risiko unerwünschter Behandlungsereignisse. Das ist das Ergebnis einer gründlichen Analyse der Behandlungsdaten von 6.841 Patienten an zwei städtischen Lehrkrankenhäusern und zwei vorstädtischen Krankenhäusern in zwei Bundesstaaten der USA über den Zeitraum von 12 Monaten in den Jahren 2000 und 2001.
Die Anstrengungen an us-amerikanischen Krankenhäusern, Operationen zu rationalisieren und Kosten durch die Reduktion von Personal zu senken, erhöht in Spitzenzeiten des Behandlungsgeschehens das Risiko vermeidbarer Fehler und damit das Risiko unerwünschter Behandlungsereignisse. Das ist das Ergebnis einer gründlichen Analyse der Behandlungsdaten von 6.841 Patienten an zwei städtischen Lehrkrankenhäusern und zwei vorstädtischen Krankenhäusern in zwei Bundesstaaten der USA über den Zeitraum von 12 Monaten in den Jahren 2000 und 2001.
Die Forscher um Joel Weissman, die meisten davon beschäftigt an zwei renommierten Bostoner Krankenhäusern, wiesen zum Beleg ihrer These auf mehrere eindeutige Ereignisse und Zusammenhänge hin. Ihre Analysen zeigten 1.530 unerwünschte Ereignisse, die nicht durch die behandelte Erkrankung der Patienten verursacht wurden. Die vermeidbaren Behandlungsfehler schlossen Fehler bei der Arzneimittelbehandlung, Nervenverletzungen und Infektionen ein. In einem Hospital führte ein Anstieg der quantitativen Relation von Patienten und Pflegekräften um 10 % zu einem statistisch signifikanten Anstieg der vermeidbaren unerwünschten Effekte um 28 %. An den drei anderen Krankenhäusern, an denen auch ein insgesamt schwächerer Rationalisierungsdruck im Personalbereich berechnet wurde, konnten derartige extremen Zusammenhänge nicht gefunden werden oder sie waren ohne statistische Signifikanz.
David Bates, einer der leitenden Verfasser der Studie und Leiter der Allgemeinmedizin an einem großen Krankenhaus, wies warnend darauf hin, dass die Ziele Kostendämpfung und Qualitätsverbesserung der Patientenbehandlung "working against each other".
Von der Studie "Hospital Workload and Adverse Events" von Weissman, Rothschild, Bates et al. in der Fachzeitschrift "Medical Care" (45(5):448-455, May 2007) gibt es kostenlos lediglich ein Abstract.
Bernard Braun, 4.5.2007
Who pays the pizza today? 94% der US-Fachärzte haben ertragreiche Beziehungen zur Pharmaindustrie
 Eigentlich enthalten Studien, die über die intensive gratifizierte Kooperation von Ärzten mit Herstellern von Arzneimitteln und medizintechnischen Geräten berichten, keine schockierenden Neuigkeiten mehr. Warum sie trotzdem Aufmerksamkeit verdienen, liegt daran, dass es sich um Verhaltensweisen handelt, die nach mittlerweile jahrelangen öffentlichen Debatten über die ethische und professionelle Fragwürdigkeit und über den nachweisbaren Verlust professioneller Autonomie für viele dieser Ärzte stattfinden und die wie im vorliegenden Fall auch offen in Befragungen berichtet werden. Es geht also nicht um "Ausrutscher" von "schwarzen Schafen" oder Berufsanfängern.
Eigentlich enthalten Studien, die über die intensive gratifizierte Kooperation von Ärzten mit Herstellern von Arzneimitteln und medizintechnischen Geräten berichten, keine schockierenden Neuigkeiten mehr. Warum sie trotzdem Aufmerksamkeit verdienen, liegt daran, dass es sich um Verhaltensweisen handelt, die nach mittlerweile jahrelangen öffentlichen Debatten über die ethische und professionelle Fragwürdigkeit und über den nachweisbaren Verlust professioneller Autonomie für viele dieser Ärzte stattfinden und die wie im vorliegenden Fall auch offen in Befragungen berichtet werden. Es geht also nicht um "Ausrutscher" von "schwarzen Schafen" oder Berufsanfängern.
Wie viel Ärzte dies in den USA sind und welche nicht ganz zufälligen Unterschiede es in der mit materiellen Gratifikationen verknüpften Zusammenarbeit mit Arztgruppen gibt, zeigt ein gerade erschienener Aufsatz im "New England Journal of Medicine (NEJM)" (26.4. 2007; Volume 356: 1742-1750) über die Ergebnisse der Befragung von 3.167 Fachärzten aus den Bereichen Anästhesie, Kardiologie, Familienmedizin, Chirurgie, innere Medizin und Kinderheilkunde Ende 2003/Beginn 2004 durch eine us-amerikanische und australische Forschergruppe. Die u.a. an der Harvard Medical School in Boston und den Universitäten in Yale und Stanford forschenden Wissenschaftler werteten dazu den so genannten "Institute on Medicine as a Profession (IMAP)"-Survey aus. Der gewichtete Rücklauf belief sich auf für eine Ärztebefragung außerordentlich gute 58 %.
Die wesentlichen Ergebnisse lauten:
• 94 % der befragten Ärzte gaben irgendeine Art von Beziehung mit der Pharmaindustrie an und die meisten dieser Beziehungen umfassten verzehrbare Geschenke (83 %) oder Arzneimittelproben (78 %).
• 35 % erhielten Zuschüsse oder Erstattungen von Ausgaben für Besuche berufsbezogener Tagungen oder medizinischer Weiterbildungskurse.
• 28 % bekamen Zahlungen für Vorträge oder die Rekrutierung von Patienten in Studien.
• Mehr als doppelt so viel Kardiologen als Hausärzte erhielten diese Art von Zahlungen. Hausärzte trafen allerdings viel regelmäßiger als andere Fachärzte mit Vertetern von Herstellerfirmen zusammen. Dies trifft ebenfalls für Einzel-, Doppel- und Gruppenarztpraxen gegenüber Ärzten in Krankenhäusern zu.
• Dass es sich bei einer Reihe dieser Beziehungen und Gratifikationen nicht um freundliche "Gießkannenaktionen" handeln könnte, zeigt die deutlich höhere Häufigkeit von Zahlungen für die Ärzte, die Ausbilder von Ärzten (Odds ratio: 1.67), Reviewer in medizinischen Fachzeitschriften (OR 1,41) oder Verfasser von Leitlinien für die klinische Praxis (OR 1,41) waren.
Über die Hintergründe der unterschiedlichen Beziehungsdichte zu den Facharztgruppen und die Auswirkungen dieser Beziehungen konnten die Forscher lediglich spekulieren und zunächst auf andere und eigene, aber erst künftige Forschung verweisen. Die erkannte Konzentration der "Beziehungspflege" auf Multiplikatoren legt allerdings nahe, dass hier in den USA auf ähnliche Effekte gehofft wird, wie sie in den Niederlanden bereits für das Geschehen zwischen Kardiologen und Hausärzten bei der Verordnung von Herz-/Kreislaufmedikamenten nachgewiesen wurden. Zwei Drittel der dortigen Hausärzte folgte den Verordnungsvorgaben der Kardiologen.
Zu den Risiken der engen Beziehungen von Ärzten und Herstellern verweisen die Autoren des aktuellen Aufsatzes aber nochmals ausdrücklich auf die bereits 2003 in den USA gestartete Debatte um die problematischen Verstrickungen (Moynihan: Who pays for the pizza? Redefining the relationsships between doctors ands drug companies. 1. Entanglement. BMJ 2003; 326: 1189-92) und Möglichkeiten der Entstrickungen (Moynihan: Who pays for the pizza? Redefining the relationsships between doctors ands drug companies. 2. Disentanglement. BMJ 2003; 326: 1193-99) von Ärzten mit der Industrie. Weitere wichtige Literaturverweise finden sich im aktuellen Aufsatz und in weiteren Beiträgen des Forum-Gesundheitspolitik.
Hier finden sie die kostenlose PDF-Version des Aufsatzes von Campbell et al. "A National Survey of Physician-Industry Relationsships" im "New England Journal of Medicine vom 26.4. 2007.
Bernard Braun, 26.4.2007
Versicherungsschutz für Arzneimittel allein hat weniger gesundheitliche Wirkungen als erwartet.
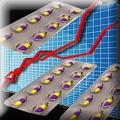 Zu den Versorgungsproblemen des us-amerikanischen Gesundheitssystems gehörte lange, dass die in der staatlichen Krankenversicherung Medicare versicherten RentnerInnen nicht von Beginn dieser Versicherung an, also seit 1965, einen vergleichbar breiten Zugang zur Verordnung von Arzneimitteln hatten, wie z.B. die privat Krankenversicherten. Erst 2003 wurde mit dem "Medicare Prescription Drug, Improvement, and Modernization Act (MMA)" ein etwa gleicher Zugang geschaffen.
Zu den Versorgungsproblemen des us-amerikanischen Gesundheitssystems gehörte lange, dass die in der staatlichen Krankenversicherung Medicare versicherten RentnerInnen nicht von Beginn dieser Versicherung an, also seit 1965, einen vergleichbar breiten Zugang zur Verordnung von Arzneimitteln hatten, wie z.B. die privat Krankenversicherten. Erst 2003 wurde mit dem "Medicare Prescription Drug, Improvement, and Modernization Act (MMA)" ein etwa gleicher Zugang geschaffen.
Dem MMA lagen die Erwartungen zugrunde, dass damit die Nutzung der Verordnungsmöglichkeit erhöht, die Versorgung mit Arzneimitteln wachsen und die Gesundheit der Senioren verbessert würde. Immerhin hatten Studien vor Inkrafttreten des MMA gezeigt, dass vielfach ärztliche Verordnungen aus Kostengründen nicht eingelöst oder Dosierungen nicht eingehalten wurden, was beispielsweise mehr als die Hälfte der Diabetes- und Herzkranken ohne Arzneimittelversicherung betraf.
Ob es aber tatsächlich systematische Unterschiede bei der Einnahme verordneter Arzneimittel gab, ob sich die betroffenen Patienten stattdessen stationär behandeln ließen und ob die Absicherung der Arzneimittel Einfluss auf die Gesundheit hat, wurde interessanterweise erst in den letzten Jahren genauer untersucht. Als Datenbasis dienten die "Medicare Current Beneficiary Data" für die Jahre 1992 bis 2000. Dieser nationale Survey ist repräsentativ, verfolgt die Befragten noch vier Jahre weiter in ihrer Entwicklung und verknüpft subjektive Befragungsdaten mit Routinedaten.
Die Ergebnisse ihrer Analysen fassten die Autoren Khan, Kaestner und Lin in einem gerade erschienenen Working Paper (Nr. 12848) des "National Bureau of Economic Research (NBER)" der USA unter dem Titel "Prescription Drug Insurance and ist Effect on Utilization and Health of the Elderly" zusammen.
Danach gibt es beim Vorhandensein einer Medikamentenversicherung gegenüber Personen ohne Versicherungsschutz
• keinen signifikanten Anstieg der Wahrscheinlichkeit einer Medikamentenverordnung und zwar unabhängig von der Form der Versicherung (öffentlich, HMO etc.),
• keinerlei Evidenz für die Vermeidung oder ein besseres Management von Krankenhausaufenthalten und
• eine nur geringe Evidenz dafür, dass ein Versicherungsschutz für Medikamente den selbst bewerteten Gesundheitszustand oder die "Activities of daily Living (ADL)" verbessert.
Für die zusätzliche Annahme, dass die Effekte zumindest bei ökonomisch benachteiligten Personen aufträten, gab es ebenfalls keine empirischen Anhaltspunkte.
Für den Mangel an Effekten auf die Gesundheit schlagen die Autoren mehrere Gründe vor:
• Ein steigender Medikamentenkonsum könnte auch eine größere Anzahl von Nebenwirkungen und unerwünschten Ereignissen bedeuten.
• Eine zweite Möglichkeit wäre, die dass eine Arzneimittel unangemessen verordnet wurden oder die verordnete Therapie keine Compliance bei den Patienten fand.
Die Gesundheitsökonomen kommen zu dem Schluss, dass allein ein verbesserter Arzneimittel-Versicherungsschutz keineswegs zu einer gesundheitlichen Verbesserung führen muss. Verbessert werden müssen u.a. auch noch die Verordnungsweisen und -qualität sowie die Vermittlung des Sinns der Medikation an die Patienten.
Eine etwas längere Zusammenfassung der Arbeit von Nasreen Khan, Robert Kaestner und Swu Jane Lin "Prescription Drug Insurance and ist Effect on Utilization and Health of the Elderly" findet sich kostenlos in der "Winter 2007"-Ausgabe (Nr. 18) des kostenlos abonnierbaren "Bulletin on Aging and Health" des NBER.
Für 5 US-Dollar kann der komplette Text auch als PDF-Datei heruntergeladen werden und wer Zugang zu den Literaturdatenbanken einiger Universitäten (z.B. Tübingen, Fernuni Hagen) hat, erhält diesen Text dort auch kostenfrei.
Bernard Braun, 24.4.2007
Wie viele Ärzte sind an der Behandlung eines Patienten beteiligt oder Grenzen von P4P-Programmen?!
 Die Grundidee der sich in den USA seit einiger Zeit verbreitenden Honorierungsform des "Pay-for-Performance (P4P)" ist einfach und verspricht viel: Die Honorierung der Behandlung oder Zuschläge zu einem Basishonorar von insbesondere chronisch erkrankten Menschen wird davon abhängig gemacht, ob ein vorher vereinbarter Behandlungsstandard und -erfolg erreicht wird. Die P4P-Programme erschienen nahezu als Quadratur des Kreises, da sie versprachen, Kostensteuerung mit Qualitätssicherung zu verknüpfen.
Die Grundidee der sich in den USA seit einiger Zeit verbreitenden Honorierungsform des "Pay-for-Performance (P4P)" ist einfach und verspricht viel: Die Honorierung der Behandlung oder Zuschläge zu einem Basishonorar von insbesondere chronisch erkrankten Menschen wird davon abhängig gemacht, ob ein vorher vereinbarter Behandlungsstandard und -erfolg erreicht wird. Die P4P-Programme erschienen nahezu als Quadratur des Kreises, da sie versprachen, Kostensteuerung mit Qualitätssicherung zu verknüpfen.
Auf ein Problem, das zumindest die rasche und problemlose Verbreitung dieser Programme unter den Bedingungen eines aus vielen Allgemein- und Fachärzten bestehenden Versorgersystems behindern dürfte, weisen die in der Ausgabe des "New England Journal of Medicine" vom 15. März 2007 ( Volume 356. Heft 11: 1130-1139) veröffentlichten Ergebnisse einer Studie im Bereich des staatlichen Medicare-Systems der USA hin.
Forscher des "Center for Studying Health System Change (HSC)" und des "Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (MSKCC)" hatten zwei der Grundbedingungen für funktionierende P4P-Programme untersucht: Erstens müssten es die Daten von Medicare retrospektiv ermöglichen, Patienten einzelnen Ärzten und Praxen zuzuordnen, die die primäre Verantwortung für deren Behandlung getragen haben. Zweitens müssten Ärzte für die Behandlung eines bedeutsamen Teil der von ihnen behandelten und abgerechneten Patienten verantwortlich sein bzw. gemacht werden können.
Die Studie über "Care Patterns in Medicare and Their Implications for Pay for Performance" von Pham et al. basiert auf dem vom HSC für die Jahre 2000 bis 2002 repräsentativ erhobenen "Community Tracking Study Physician Survey" mit den Daten von 8.604 Ärzten und 1.787.454 älteren Medicare-Patienten.
Die Wirklichkeit sah aber deutlich anders aus:
• So sind an der Versorgung der älteren Medicare-Patienten meist viele verschiedene Ärzte und Praxen beteiligt. Der durchschnittliche Medicare-Patient wurde in einem gegebenen Jahr von sieben verschiedenen Ärzten in vier verschiedenen medizinischen Praxen behandelt.
• Zu identifizieren, welcher Leistungsanbieter für die Behandlung welchen Patienten verantwortlich ist, erwies sich als sehr schwierig. Nur rund 35 % aller Arztkontakte mit Leistungen der untersuchten Patienten fanden bei dem Arzt statt, der nach der P4P-Methodik den verantwortlichen Versorger darstellt. Außerdem wechseln 33 % der Nutznießer von P4P-Programmen jährlich ihre Ärzte oder Praxen.
• Für Ärzte ist es unter diesen Umständen unwahrscheinlich, für einen nennenswerten Teil ihrer Patienten die von diesen Programmen erwünschte primäre Verantwortung aufbauen zu können. Wenn Ärzte nicht wissen, dass sie für eine kritische Masse von Patienten für eine gewisse Zeit, mit Sicherheit eine mehrjährige Verantwortung tragen können oder müssen, "then it is hard to envision how P4P incentives will motivate phycisians to improve the quality of care they deliver" - so die Autoren der Studie.
• Ironischerweise sieht dies bei den chronisch Kranken, also den Patienten, bei denen eine Qualitätssteuerung mit solchen Anreizen das größte Potenzial haben könnte, noch schwieriger aus: Chronisch Kranke haben nämlich mit noch mehr Ärzten und Praxen Kontakt als ein durchschnittlicher Patient: Bei Herzkranken sind im Durchschnitt 10 Ärzte in sechs verschiedenen Praxen beteiligt, während es bei Diabetikern "nur" acht Ärzte in 5 verschiedenen Praxen sind. Multimorbide Patienten mit sieben oder mehr Erkrankungen oder Beschwerden sahen in einem Jahr 11 Ärzte in sieben Praxen, wohingegen Patienten mit drei Beschwerden gerademal drei Ärzte in zwei Praxen in Anspruch nahmen. Welche "Köche" hier die Qualität sichern, ist kaum zu ermitteln, führt schnell zu Streitigkeiten und mindert den theoretischen Anreiz der P4P-Programme gerade hier nachhaltig.
In ihren Überlegungen wie diese sehr bewegten Verhältnisse zwischen Ärzten und Patienten etwas stabiler gestaltet werden und damit überhaupt wirksame und effiziente P4P-Programme funktionieren können, sprechen die Forscher offen die Folge an, dass dies "implies some limitation for the freedom of both patients and physicians to choose the physician with whom they work."
Hier erhalten Sie die vollständige Fassung des Aufsatzes "Care Patterns in Medicare and Their Implications for Pay for Performance" von Pham et al. auch kostenlos als PDF-Datei.
Bernard Braun, 20.4.2007
Krankenversicherungsschutz ist "lebenswichtig" - Das Beispiel unversicherter Kinder in den USA.
 Wie im wahrsten Sinne des Wortes "lebenswichtig" eine fehlende Krankenversicherung für die Kinder in den USA ist, zeigt die im Februar 2007 erschienene Studie "The Great Divide: When Kids get sick, Insurance matters":
Wie im wahrsten Sinne des Wortes "lebenswichtig" eine fehlende Krankenversicherung für die Kinder in den USA ist, zeigt die im Februar 2007 erschienene Studie "The Great Divide: When Kids get sick, Insurance matters":
• Kinder ohne Versicherung starben, wenn sie wegen allgemeiner Verletzungen dann doch in Krankenhäusern behandelt wurden, zweimal so häufig wie versicherte Kinder. Überlebten sie ihren Aufenthalt, betrug die Wahrscheinlichkeit, dass sie rehabilitative Leistungen erhielten, nur 44 % der der versicherten Kinder.
• Bei den unversicherten Kindern mit schweren Schädeltraumata (z.B. als Folge eines Verkehrsunfalls oder durch elterliche Gewalt) wurde um 32 % seltener als bei versicherten Kindern der Druck der Hirnflüssigkeit gemessen. Außerdem wurden sie im Durchschnitt bereits nach 5 statt nach acht Tagen entlassen. Die Wahrscheinlichkeit in rehabilitative Versorgung entlassen zu werden, war um 46 % geringer als bei versicherten Kindern. Auch ihr Risiko zu sterben, war doppelt so hoch wie bei versicherten Kindern.
• Um 18 % seltener als bei versicherten wurde bei unversicherten Kindern die kostenträchtigere Methode der laparoskopische Blinddarmentfernung ("Schlüsselloch-Operationstechnik") angewandt.
• Unversicherte Kinder mit Mittelohrentzündungen erhielten 57 % seltener als versicherte Kinder Röhrchen zum Abfluss von Entzündungssekreten eingesetzt.
Im Auftrag der Nichtregierungsorganisation "Families USA" untersuchten Forscher der Universität Arkansas staatliche Daten der "Kids’ Inpatient Database (KID)", einem Teil des "Agency for Healthcare Research and Quality’s Health Care Utilization Project (HCUP)" in zahlreichen Bundesstaaten über die Versorgung von 25.000 unversicherten Kinder mit allgemeinen Verletzungen und 6.500 mit schweren Schädelverletzungen aus den Jahren 2002 und 2003. Die Daten erlauben konkrete Einblicke in das Leben und die Lebensqualität von Kindern dies- und jenseits der "Wasserscheide (divide)" Krankenversicherungsschutz.
Das Kostenvolumen der wegen der Schwere ihrer Erkrankung dann doch erfolgten Behandlung unversicherter Kinder teilen sich im Moment die Unversicherten und ihre Eltern sowie die Krankenhäuser: Ein Drittel der Kosten bezahlen die Betroffenen und zwei Drittel die Krankenhäuser. 2004 beliefen sich die direkt nicht ausgeglichenen Kosten der amerikanischen Krankenhäuser für unversicherte Kinder auf 5, 4 Milliarden Dollar.
Die Forscher weisen aber auch darauf hin, dass die Krankenhäuser einen großen Teil dieser Ausgaben durch Spenden und "costshifting" zu Lasten der Privatversicherten letztlich doch zusammentragen. Menschen mit einer Arbeitgeber-Krankensicherung zahlten danach 2005 durchschnittlich 922 $ mehr Familienversicherung, um die Kosten der Gesundheitsversorgung der Unversicherten mit zu bezahlen - also eine Art "Solidarprinzip durch die Hintertür".
Zu den Forderungen von "Families USA" gehört vor allem die Einbeziehung der dazu berechtigten Kinder in die staatliche Medicaid-Versicherung und das spezielle "State Children’s Health Insurance Program (SCHIP)". Über dessen Fortsetzung bzw. "reauthorization" wird allerdings im Moment auf Bundesebene gerungen.
Angesichts des in der Studie erfolgten Nachweises von 327 Kindern, deren Tot vermeidbar gewesen wäre, reagieren die Interessenorganisationen der Krankenhäuser, die "Federation of American Hospitals" und die "American Hospital Association" bemerkenswert kalt und überwiegend mit methodischen Einwänden: Die Stichproben seien nicht groß genug und die Studie wäre nicht "peer-reviewed". Der inhaltliche Hinweis, die Krankenhäuser hätten doch schließlich auch Kinder behandelt, von denen klar war, dass sie die Behandlung nicht zahlen konnten, erscheint im Lichte der Ergebnisse dieser Behandlung reichlich zynisch.
Die 29 Seiten umfassende, mit zahlreichen methodischen Hinweisen versehene, PDF-Version der Studie "The Great Divide: When Kids Get Sick, Insurance Matters" von "Families USA" finden Sie hier.
Bernard Braun, 4.3.2007
Medizinische Versorgungszentren weisen bessere Versorgungsqualität auf als Gemeinschaftspraxen
 Eine Analyse von rund 120 ambulanten Versorgungseinrichtungen in Kalifornien mit etwa 1,7 Millionen Versicherten hat jetzt gezeigt, dass die Art der Praxisorganisation in den USA auch einen Einfluss auf die Versorgungsqualität hat. Das mit Mitteln des Commonwealth Fund durchgeführte Forschungsprojekt hat gezeigt, dass sowohl präventive Maßnahmen als auch qualitativ hochwerte Therapieformen in Versorgungszentren (mit angestellten Ärzten) häufiger umgesetzt werden als in Gemeinschaftspraxen, zu denen einzelne Ärzte sich als selbständige Mediziner organisatorisch zusammenschließen.
Eine Analyse von rund 120 ambulanten Versorgungseinrichtungen in Kalifornien mit etwa 1,7 Millionen Versicherten hat jetzt gezeigt, dass die Art der Praxisorganisation in den USA auch einen Einfluss auf die Versorgungsqualität hat. Das mit Mitteln des Commonwealth Fund durchgeführte Forschungsprojekt hat gezeigt, dass sowohl präventive Maßnahmen als auch qualitativ hochwerte Therapieformen in Versorgungszentren (mit angestellten Ärzten) häufiger umgesetzt werden als in Gemeinschaftspraxen, zu denen einzelne Ärzte sich als selbständige Mediziner organisatorisch zusammenschließen.
Anhand der Abrechnungen der verschiedenen Versorgungseinrichtungen wurde analysiert, wie oft bei Patienten, die dafür in Frage kamen, bestimmte Vorsorgeuntersuchungen durchgeführt wurden (Mammographie zur Brustkrebs-Diagnose, die sog. Papanicolaou-Frühdiagnostik zur Diagnose von Gebärmutter-Tumoren, die Untersuchung auf Chlamydien, Bakterien der Schleimhäute im Augen-, Atemwegs- und Genitalbereich). Darüber hinaus wurde auch die Durchführung qualitativ hochwertiger Therapieformen bei chronischen Erkrankungen überprüft (eine Untersuchung der Netzhaut bei Diabetikern und zwei andere Maßnahmen für Asthmatiker bzw. Patienten nach einem Infarkt).
Als Ergebnis zeigte sich, dass insbesondere bei den Früherkennungs- und Vorsorgeuntersuchungen Versorgungszentren ihren Patienten diese medizinische Leistung häufiger zuteil werden ließen als Gemeinschaftspraxen. So verteilten sich die Anteile von Patienten, die Diagnose- bzw. Therapie-Leistungen erhielten:
• Mammographie: Versorgungszentren 73%, Gemeinschaftspraxen 58%
• Papanicolaou-Frühdiagnostik: 53% zu 30%
• Chlamydien-Untersuchung: 23% zu 9%
• Netzhaut-Untersuchung bei Diabetikern: 42% zu 29%
Für die übrigen Leistungen wurden keine statistisch fundierten Unterschiede gefunden. Es zeigte sich jedoch aufgrund einer Befragung der Leiter der Versorgungseinrichtungen auch, dass diese häufiger PC-gestützte Patientenakten führen (37% zu 2%) und ebenso auch häufiger Maßnahmen zur Qualitätssicherung und -verbesserung durchführen (im Durchschnitt 7.2 im Vergleich zu 4.5 Maßnahmen).
Die Wissenschaftler führen die gefundenen Unterschiede im Wesentlichen auf zwei Bedingungen zurück. Zum einen vermuten sie, dass in Versorgungszentren die Kooperation der beteiligten Ärzte intensiver ist und dass auch die zentralisierte Entscheidungsstruktur (Welche Diagnose- und Therapieformen für welche Erkrankung bei welchen Patienten?) besser fundiert und organisiert ist. Ein zweiter Grund könnte nach Meinung der beteiligten Forscher ebenso bedeutsam sein: Andere Studien hätten gezeigt, dass jüngere Mediziner sich heute sehr viel öfter dafür entscheiden, eine angestellte Position in einem Versorgungszentrum anzunehmen, statt sich mit Kollegen selbständig zu machen. Jüngere Mediziner seien aber einfach besser ausgebildet, so dass diese bessere Qualifikation sich auch in einer höheren Versorgungsqualität für Patienten niederschlägt.
Hier findet man ein kurzes Abstract der Studie.
Eine ausführlichere Beschreibung des Studiendesign und der Ergebnisse gibt es auf der Seite des Commonwealth Fund "In the Literature": Do Integrated Medical Groups Provide Higher-Quality Medical Care Than Individual Practice Associations?
Die Ergebnisse der Studie lassen sich nicht ohne Weiteres auf deutsche Verhältnisse übertragen, schon deshalb nicht, weil Medizinische Versorgungszentren noch keine so große Rolle spielen wie in den USA. Erst aufgrund der Gesundheitsreform 2004 wurden die Gründungs-Möglichkeiten auch in den alten Bundesländern erleichtert und eine Aufstellung des Bundesministeriums für Gesundheit, Redaktionsbüro Gesundheit listet für Februar 2007 immerhin schon über 500 Medizinische Versorgungszentren in Deutschland auf. Folgt man allerdings den Schlussfolgerungen der Wissenschaftler, dass die intensivere Kooperation der Ärzte und die zentralisierte Entscheidung über Versorgungsrichtlinien mit ein wesentlicher Grund für die bessere Versorgungsqualität ist, dann wäre dies auch ein Hinweis auf möglicherweise bessere Voraussetzungen für eine qualitativ hochwertige Patientenversorgung in größeren Zentren im Vergleich zu Einzelarzt-Praxen. Auch die in Versorgungszentren der USA gefundenen stärkeren Bemühungen zur Qualitätssicherung und -verbesserung deuten in diese Richtung.
Unterschlagen darf man andererseits auch nicht, dass die Studie nur einen sehr begrenzten Ausschnitt der "Versorgungsqualität" untersucht hat. Nicht nur die diagnose- und therapiebezogenen Indikatoren sind sehr begrenzt. Völlig ausgeblendet wurde auch ein Aspekt, der in der ambulanten Versorgung überaus bedeutsam ist: Die Arzt-Patient-Kommunikation und das Vertrauensverhältnis zum behandelnden Arzt.
Gerd Marstedt, 19.2.2007
Medicare: Große Kommunikationslücken über Arzneimittel zwischen älteren Patienten und Ärzten
 Eine in der Januar 2007-Ausgabe des "Journal of General Internal Medicine" veröffentlichte us-amerikanische Studie fand eine alarmierend hohe Zahl älterer Amerikaner, die mit ihren Ärzten nicht von sich aus über Probleme mit den ihnen verordneten Medikamenten redeten. Dies umschloss auch die Kommunikation über unerwünschte Nebenwirkungen, Erhältlichkeit oder die wahrgenommene Wirksamkeit der Arzneimittel.
Eine in der Januar 2007-Ausgabe des "Journal of General Internal Medicine" veröffentlichte us-amerikanische Studie fand eine alarmierend hohe Zahl älterer Amerikaner, die mit ihren Ärzten nicht von sich aus über Probleme mit den ihnen verordneten Medikamenten redeten. Dies umschloss auch die Kommunikation über unerwünschte Nebenwirkungen, Erhältlichkeit oder die wahrgenommene Wirksamkeit der Arzneimittel.
Die am "Tufts-New England Medical Center" forschende Gruppe um Ira B. Wilson, Cathy Schoen, Patrician Neuman et al. hat in ihrer vom "Commonwealth Fund" und der "Henry J. Kaiser Family Foundation" geförderten Studie "PHYSICIAN-PATIENT COMMUNICATION ABOUT PRESCRIPTION MEDICATION NONADHERENCE: A 50-STATE STUDY OF AMERICA'S SENIORS" u.a. folgende Kommunikationsdefiziten bei den rund 17.000 befragten Medicare-Versicherten im Alter von 65 und mehr Jahren identifiziert:
• Ein Drittel der befragten Senioren hatte in den letzten 12 Monaten nicht über alle ihrer Arzneimittel mit ihrem behandelten Arzt gesprochen.
• Insgesamt 41 % aller Befragten hielten sich nicht an die ärztlichen Vorgaben zum Umgang mit den verordneten Arzneimitteln. Diese so genannte "Non-compliance" war sogar unter den Senioren größer, nämlich 52 %, die an drei und mehr chronischen Erkrankungen litten.
• Patienten, die mit ihrem Arzt über die Kosten der Verordnung redeten waren eher dazu zu bewegen, sich preisgünstigere Alternativen verordnen zu lassen.
Dass es sich hier um keinen "Ausrutscher" handelt, zeigt ein Blick in die Zusammenfassung der Ergebnisse einer im Jahre 2003 publizierten vergleichbaren Studie "PRESCRIPTION DRUG COVERAGE AND SENIORS: FINDINGS FROM A 2003 NATIONAL SURVEY" von Safran et al.: 40 % der auch damals befragten Medicare-Versicherten hatten die ihnen verordneten Arzneimittel wegen der Kosten, Nebenwirkungen, wahrgenommenen Mangel an Wirksamkeit oder der Überzeugung, sie bräuchten die Mittel nicht, nicht eingenommen, was wahrscheinlich zum Teil ebenfalls auf Verständigungsproblemen beruhte.
Eine zweiseitige Zusammenfassung der Ergebnisse des Aufsatzes "PHYSICIAN-PATIENT COMMUNICATION ABOUT PRESCRIPTION MEDICATION NONADHERENCE: A 50-STATE STUDY OF AMERICA'S SENIORS" gibt es als "In the literature"-Fassung beim Commonwealth Fund.
Bernard Braun, 14.2.2007
Patientenzentrierung und -mitwirkung nicht "nur" zum Wohlfühlen, sondern sie verbessern den gesundheitlichen Outcome
 Auch in den USA gibt es zahlreiche Klagen über einen Mangel an Krankenbehandlung, die patientenzentriert ("Patient-centered care") ist und die Patienten mitwirken lässt ("collaborative care").
Auch in den USA gibt es zahlreiche Klagen über einen Mangel an Krankenbehandlung, die patientenzentriert ("Patient-centered care") ist und die Patienten mitwirken lässt ("collaborative care").
Das us-amerikanische "Institute of Medicine" definiert dabei patientenzentrierte Versorgung als "care that is respectful of and responsive to individual patient preferences, needs, and values" und hält sie für eine der Schlüsselzutaten einer qualitativ hochwertigen Gesundheitsversorgung.
Der beklagte Mangel wird häufig dadurch zu erklären versucht, dass es sich bei den genannten Merkmalen der Behandlung vorrangig um "Wohlfühlfaktoren" handle, die angenehm sind, aber wenig oder nichts zur Qualität und zum Ergebnis der Behandlung beitragen. Sie können daher auch unter Kostendruck weggelassen werden. Demgegenüber steht die Meinung, Patientenzentrierung und die Mitwirkung von Patienten an der Behandlung trage wesentlich zum "harten" Erfolg dieser Behandlung bei oder mindere ihn, wenn diese Elemente nicht aufträten.
In einer großen Befragung von 24.609 Erwachsenen zwischen 15 und 69 Jahren, die an geläufigen chronischen Erkrankungen wie Bluthochdruck oder Diabetes erkrankt waren sowie an Schmerzen und emotionalen Problemen litten und deren Ergebnisse 2006 veröffentlicht wurden ("Patients Report Positive Impacts of Collaborative Care" im "Journal of Ambulatory Care Management. Technology for Patient-centered, Collaborative Care. 29(3):199-206, July/September 2006), versuchten John Wasson et al. von der "Dartmouth Medical School" zweierlei herauszubekommen: Wie viele dieser Patienten erhielten eine patientenzentrierte und auf ihre Mitwirkung bedachte Behandlung und welche Auswirkungen hatte dies auf die Outcomes?
Dabei wurde "collaborative care" als gut bewertet, wenn die Patienten von ihren Ärzten nützliche Informationen über ihr Leiden erhielten und außerdem Vertrauen in ihre Fähigkeit vermittelt bekamen sowie besaßen, ihren Zustand kontrollieren und managen zu können. Sie wurde für noch gut genug ("fair") gehalten, wenn eines der beiden Elemente erfüllt war. Schlecht ("poor") war sie, wenn keines der beiden Elemente eine Rolle in der Behandlung spielte.
Das Ergebnis sieht so aus: 21 % der Befragten charakterisierten ihre Möglichkeiten zur Mitwirkung und Beteiligung als gut, 36 % als "fair" und 43 % als schlecht. Kritisch zu bewerten ist dies, weil eine gute patientenzentrierte und -beteiligende Behandlung in mehrfacher Hinsicht die Prozess- und vor allem Ergebnisqualität der Behandlung spürbar positiv beeinflusste.
Konkret heißt dies beispielsweise, dass nach der Adjustierung von mehreren soziodemografischen Merkmalen der Befragten (z.B. Alter, Geschlecht), ihrer Krankheitslast, ihrem Gesundheitsverhalten und der Gesamtqualität der Gesundheitsversorgung
• die Kontinuität der Behandlung bei einem Leistungserbringer besser war,
• der Zugang zu weiteren Behandlungsangeboten leichter war,
• die Ergebnisse der Behandlung wie z.B. der Blutdruckwert, Blutzuckerwert oder die Schmerzbewältigungsfähigkeit erheblich besser aussahen,
• im höheren Maße präventive Angebote genutzt wurden sowie
• weniger Arbeitsunfähigkeitstage oder bettlägrige Tage zu Hause anfielen.
Das Resumé der Forscher lautete: "Good collaborative care is very likely to increase quality care and lower its costs."
Zusammenfassungen der Ergebnisse dieser und anderer Studien finden sich auch in einer vom "Commonwealth Fund" erstellten zweiseitigen "In the literature"-Zusammenfassung der dazu veröffentlichten Aufsätze in einer Spezialausgabe des "JOURNAL OF AMBULATORY CARE MANAGEMENT" zum Thema "TECHNOLOGY FOR PATIENT-CENTERED, COLLABORATIVE CARE".
Hier finden Sie kostenfrei lediglich ein Abstract des Aufsatzes "Patients Report Positive Impacts of Collaborative Care".
Bernard Braun, 5.2.2007
Der neue Diät-Trend in den USA: Operative Magenverkleinerung
 Die Zahl operativer Magenverkleinerungen aufgrund von Übergewicht ist in den USA zwischen den Jahren 1998 und 2004 dramatisch angestiegen. Bei Patienten im Alter von 18-54 Jahren stieg die Anzahl der Operationen um über 700% und betrug 2004 über 104.000. Besonders drastisch ist der Anstieg bei älteren Patienten, wo eine Steigerung von 772 (1998) auf über 15.000 (2004) zu beobachten war, also um rund 2.000%. Diese Zahlen teilte jetzt die "Agency for Healthcare Research and Quality" mit, eine Behörde des US-Gesundheitsministeriums. Die operative Methode wird von Ärzten meist bei Patienten mit einem Body Mass Index (BMI) von 40 oder mehr empfohlen und dann, wenn vorherige Versuche zur Änderung der Ernährungsgewohnheiten fehlgeschlagen sind. Ein BMI von 40 trifft zum Beispiel auf jemanden zu, der 180 cm groß ist und 130 kg wiegt.
Die Zahl operativer Magenverkleinerungen aufgrund von Übergewicht ist in den USA zwischen den Jahren 1998 und 2004 dramatisch angestiegen. Bei Patienten im Alter von 18-54 Jahren stieg die Anzahl der Operationen um über 700% und betrug 2004 über 104.000. Besonders drastisch ist der Anstieg bei älteren Patienten, wo eine Steigerung von 772 (1998) auf über 15.000 (2004) zu beobachten war, also um rund 2.000%. Diese Zahlen teilte jetzt die "Agency for Healthcare Research and Quality" mit, eine Behörde des US-Gesundheitsministeriums. Die operative Methode wird von Ärzten meist bei Patienten mit einem Body Mass Index (BMI) von 40 oder mehr empfohlen und dann, wenn vorherige Versuche zur Änderung der Ernährungsgewohnheiten fehlgeschlagen sind. Ein BMI von 40 trifft zum Beispiel auf jemanden zu, der 180 cm groß ist und 130 kg wiegt.
Bei Frauen wurde der Eingriff deutlich häufiger durchgeführt, etwa vier mal so oft wie bei Männern. Die durchschnittlichen Krankenhaus-Kosten für die Operation betrugen im Jahr 2004 gut 10.000$, hinzu kommen noch Honorare für die behandelnden Ärzte. Fast alle Eingriffe (78%) wurden bei privat versicherten Patienten durchgeführt. Die Behörde stellte in ihrer Mitteilung auch fest, dass zukünftig wohl mit weiteren Steigerungsraten für den Eingriff zu rechnen ist, da der Anteil Übergewichtiger in der Bevölkerung weiterhin anwächst und die Risiken der Operation, insbesondere was Todesfälle anbetrifft, in den letzten Jahren deutlich gesunken seien. Diese Quote der Todesfälle ist nach Angaben der Behörde von 0,8% auf 0,2% im Jahr 2004 gesunken. Der Bericht ist hier nachzulesen: Obesity Surgeries Have Jumped Dramatically Since 1998
In einer Studie "Early Mortality Among Medicare Beneficiaries Undergoing Bariatric Surgical Procedures" (erschienen in: "JAMA", Bd. 294, S. 1903, 19. Oktober 2005) werden hierzu allerdings deutlich höhere Risiken benannt. Neuere Daten der Wissenschaftler hätten gezeigt, dass etwa fünf Prozent aller 35- bis 44-jährigen Männer und drei Prozent aller Frauen dieser Altersgruppe ein Jahr nach dem Eingriff gestorben waren. Bei älteren Patienten (65-74 Jahre) lag die Todesrate ein Jahr nach der Operation noch wesentlich höher (6-13%). Ursachen dafür waren Mangelernährung, Infektionen, Darm- und Gallenblasenprobleme sowie ein "tödlicher Schockzustand". Die komplette Studie findet man hier: David R. Flum u.a.: Early Mortality Among Medicare Beneficiaries Undergoing Bariatric Surgical Procedures
Andere US-Forscher warnen überdies seit einiger Zeit auch vor den Osteoporose-Risiken im Gefolge einer operativen Magenverkleinerung. Bei einer - allerdings sehr kleinen - Stichprobe von Patienten hatte man einen Knochenschwund um acht Prozent sechs Monate nach dem Eingriff festgestellt, obwohl die Patienten Kalzium und Vitaminpräparate zu sich genommen hatten. Eine Zusammenfassung dieser Studie findet man im Online-Magazin "Innovations-Report": Osteoporose nach Magenverkleinerung möglich - US-Forscher warnen vor operativen Eingriffen zur Gewichtsreduktion
Gerd Marstedt, 13.1.2007
Qualitätsorientierte Vergütung bei US-Ärzten: Ein sich langsam entwickelndes Minderheitsgeschehen.
 Eine zuerst in den USA konzipierte und mit einigen Programmen (z. B. P4P oder "pay-for-performance") auch vor einigen Jahren gestartete Methode, Ärzten finanzielle oder Vergütungsanreize für qualitätsorientierte Leistungen zu geben, verbreitet sich wesentlich langsamer als erwartet oder erhofft. Das ist jedenfalls das Ergebnis einer Studie von Reschovsky und Hadley, die für den Zeitraum von 1996/97 oder 2000/2001 bis 2004/2005 die Entwicklung der Vergütungsanreize in us-amerikanischen Gruppen- und Einzelpraxen untersucht hat. Es handelt sich um Ergebnisse des USA-repräsentativen "HSC Community Tracking Study Physician Survey", in dem zwischen 6.600 und 12.000 amerikanische Ärzte seit 1996 in mehrjährigen Abständen u. a. mit Unterstützung der "American Medical Association" befragt werden (Näheres über Methode und sonstige Inhalte des Surveys finden sie hier).
Eine zuerst in den USA konzipierte und mit einigen Programmen (z. B. P4P oder "pay-for-performance") auch vor einigen Jahren gestartete Methode, Ärzten finanzielle oder Vergütungsanreize für qualitätsorientierte Leistungen zu geben, verbreitet sich wesentlich langsamer als erwartet oder erhofft. Das ist jedenfalls das Ergebnis einer Studie von Reschovsky und Hadley, die für den Zeitraum von 1996/97 oder 2000/2001 bis 2004/2005 die Entwicklung der Vergütungsanreize in us-amerikanischen Gruppen- und Einzelpraxen untersucht hat. Es handelt sich um Ergebnisse des USA-repräsentativen "HSC Community Tracking Study Physician Survey", in dem zwischen 6.600 und 12.000 amerikanische Ärzte seit 1996 in mehrjährigen Abständen u. a. mit Unterstützung der "American Medical Association" befragt werden (Näheres über Methode und sonstige Inhalte des Surveys finden sie hier).
Die Ergebnisse sind im Januar 2007 unter dem Titel "Physician Financial Incentives: Use of Quality Incentives Inches Up, but Productivity Still Dominates" in der Nummer 108 des Informationsdienstes des "Center for studying Health System Change (HSC)" veröffentlicht worden und lauten folgendermaßen:
• In Gruppenpraxen nahm der Anteil der Ärzte, deren Bezahlung zu einem spürbaren Teil in Abhängigkeit vom Erreichen vereinbarter Qualitätszielen erfolgte, leicht und statistisch signifikant von 17,6 % im Jahre 2000/01 auf 20,2 % im Jahr 2004/05 zu. Der Anteil der Ärzte für den Qualität einen sehr wichtigen Faktor der Vergütung darstellte betrug 2004/05 aber lediglich 9,1 %.
• Für einen praktisch unveränderten Anteil von 70,4 % aller Ärzte in "non-solo-practises" waren aber weiterhin Vergütungssysteme wichtig, die sich an ihrer Produktivität, d. h. im wesentlichen an den Mengen ihrer Leistungen orientierten. 2004/05 war diese Form der Vergütung immer noch für 51,8 % der Gruppenpraxis-Ärzte sehr wichtig. Ärzte mit Qualitätsanreizen arbeiteten auch meist immer noch parallel nach Produktivitätsanreizen.
• Die qualitätsorientierte Vergütung kommt bei bestimmten Ärzten und bei bestimmten Praxisformen häufiger vor: Dazu gehören Primärärzte (2004/05 waren es 27,9 % dieser Arztgruppe bei denen Qualität ein Vergütungsfaktor ist), Arztpraxen mit mehr als 30 Ärzten (25,9 %) und die allerdings wenigen von HMOs getragenen Praxen (64,3 %). Aber selbst bei diesen Ärzten steigt der Anteil bei dem Qualität ein sehr wichtiger Vergütungsfaktor ist maximal auf 26,4 % bei den HMO-Ärzten. Eine unterdurchschnittliche Rolle spielte die qualitätsorientierte Vergütung bei Fachärzten (17,8 %), Spezial-Chirurgen (12,6 %) und in Praxen mit weniger als 10 Ärzten (11,1 %).
• Nur ein sehr kleiner Teil des Zuwachses qualitätsorientiert vergüteter Ärzte beruht darauf, dass Ärzte sich bevorzugt in Praxisformen niederlassen, die qualitätsorientiert arbeiten und vergütet werden.
Als Ursachen dieser zögerlichen und uneinheitlichen Entwicklung erscheinen den Wissenschaftlern mehrere Faktoren plausibel: die noch zu geringe Entwicklung von mehr und besseren krankheitsspezifischen Qualitätsindikatoren und die hemmende Funktion von Einzelpraxen mit ihren relativ wenigen Patienten und Fällen ("The 'small number' problem makes it difficult to apply quality/performance measures with the statistical reliability crucial to their acceptability.") für die Verbreitung qualitätsorientierter Vergütungsanreize.
Hier finden Sie den vierseitigen "HSC Issue Brief Physician Financial Incentives: Use of Quality Incentives Inches Up, but Productivity Still Dominates."
Bernard Braun, 8.1.2007
Vom Mythos der aufwändigen Qualitätssicherung: 5 Regeln zur Vermeidung von Infektionen durch Kathetereinsatz
 Jedes Jahr kommt es in den USA zu 80.000 durch den Einsatz von Kathetern verursachten bakteriellen Entzündungen über die Blutbahn, die pro Patient Kosten von 45.000 US-Dollar (landesweit 2,3 Milliarden US-Dollar) verursachen und jedes Jahr für 28.000 Todesfälle verantwortlich sind.
Jedes Jahr kommt es in den USA zu 80.000 durch den Einsatz von Kathetern verursachten bakteriellen Entzündungen über die Blutbahn, die pro Patient Kosten von 45.000 US-Dollar (landesweit 2,3 Milliarden US-Dollar) verursachen und jedes Jahr für 28.000 Todesfälle verantwortlich sind.
Die "altbekannten Probleme", dass mit zentralvenösen Kathetern nicht nur Messinstrumente, Medikamente oder therapeutische Flüssigkeiten in den Körper gelangen, sondern auch jede Menge gefährliche Erreger, stellen den Ausgangspunkt einer von Peter Pronovost und weiteren Mitarbeitern des "Center for Innovation in Quality Patient Care" an der Johns Hopkins University in Baltimore jetzt im "New England Journal of Medicine" vom 28. Dezember 2006 (NEJM 2006; 355: 2725-2732) vorgestellten Interventionsstudie "An Intervention to Decrease Catheter-Related Bloodstream Infections in the ICU (Intensivstationen)" dar. Diese Infektionen erschienen bisher praktisch nicht vermeidbar oder ihre Vermeidung galt als zu kostenaufwändig: "A common misperception among hospital-based clinicians is that it often costs much too much money and time to significantly improve patient safety" sagte Pronovost.
Als Ergebnis ihrer Studie stellte er aber auch fest: "Our data destroys this myth by showing that profound improvements can be made with minimum cost and effort, as long as clinical teams are committed to improving safety and willing to diligently observe relatively simple safety measures."
Das in 103 Krankenhaus-Intensivstationen im Bundesstaat Michigan durchgeführte Projekt zur Vermeidung von Katheterinfektionen umfasste genau solche einfachen und auch längst durch Leitlinien staatlicher Qualitätseinrichtungen bekannten Regeln oder Ziele und hatte einen enormen Erfolg.
Bei den Regeln ging es um
• strenges und systematisches Händewaschen des Krankenhauspersonals,
• intensive Barrieremaßnahmen beim Legen der Zugänge für die Katheter,
• die Desinfektion der Haut mit Chlorhexidin,
• Vermeidung des Zugangs im Bereich des Oberschenkels und stattdessen Zugang über Gefäße im Bereich des Schlüsselbeins und die
• konsequente Entfernung von unnötigen Kathetern.
Diese Regeln wurden im Projekt im Rahmen einer preiswerten einwöchigen Fortbildung für die im Projekt in jeder Intensivstation eingesetzten Teamleiter vermittelt, die anschließend deren Einhaltung überwachten. Die Autoren betonten, ihr Programm erfordere kein zusätzliches Personal und keine neue Ausrüstung: "There's just no reason any more not to do these relatively simple things" - so Pronovost.
Die Herausgeber des NEJM fügten dem hinzu: "The story is compelling and the costs and efforts so relatively minor that the five components of the intervention should be widely adopted" - und am besten auch nicht nur in Michigan oder den USA.
Weitere Einzelheiten des Projekts finden sich im Abstract des Aufsatzes.
Bernard Braun, 28.12.2006
Der "Medicare Drug War" 2004 in den USA: Ein Lehrstück über die Einflussnahme der Pharmaindustrie auf die Arzneimittelgesetzgebung
 Man mag vom us-amerikanischen politischen System und insbesondere seinem Sozial- und Gesundheitssystem sonst halten was man mag: Die zivilgesellschaftliche Transparenz über manche Gesetzgebungsprozesse und ihre Folgen im Bereich wichtiger Leistungen ist teilweise bedeutend größer und konkreter als in Deutschland. Dazu tragen hauptsächlich Non-Profit-Organisationen bei, die gestützt auf ihre zahlreichen Mitglieder immer wieder bemerkenswerte Berichte veröffentlichen.
Man mag vom us-amerikanischen politischen System und insbesondere seinem Sozial- und Gesundheitssystem sonst halten was man mag: Die zivilgesellschaftliche Transparenz über manche Gesetzgebungsprozesse und ihre Folgen im Bereich wichtiger Leistungen ist teilweise bedeutend größer und konkreter als in Deutschland. Dazu tragen hauptsächlich Non-Profit-Organisationen bei, die gestützt auf ihre zahlreichen Mitglieder immer wieder bemerkenswerte Berichte veröffentlichen.
Eine derartige Organisation ist "Public Citizen" mit im Jahr 2004 160.000 Mitgliedern. In ihrer programmatisch titulierten Publikationsreihe "Congress Watch" erschien im Juni 2004 der Bericht "The Medicare Drug War", der seinen wesentlichen Inhalt im Untertitel auf den Punkt bringt: "An Army of Nearly 1.000 Lobbyists Pushes a Medicare Law that Puts Drug Company and HMO Profits Ahead of Patients and Taxpayers."
Selbst wenn man sich nicht für jegliches Detail der damals virulenten Gesetzgebung zur Arzneimittelversorgung der Medicare-Mitglieder in den USA interessiert, sind die dortigen Beeinflussungsmanöver vor allem der Pharmahersteller deshalb auch für Deutschland interessant, weil viele dieser Unternehmen (z.B. Novartis, Hoffman-La Roche, GlaxoSmithKline) ihre Arzneimittel auch in Deutschland anbieten und an möglichst hohen Gewinnen interessiert sind. Warum sollten also diesselben Akteure plötzlich in Deutschland politisch zurückhaltender sein als in den USA?
Mangels vergleichbarer Untersuchungen in Deutschland sollen daher einige Fakten dieser "Pharma-Attacken" auf die parlamentarischen Entscheidungsgremien dargelegt werden:
• Im Vorjahr der Entscheidung, 2003, gaben die Pharmaindustrie und die HMO-Krankenversicherer 141 Millionen US-Dollar für Lobbyistentätigkeit im Bereich der Arzneimittelpolitik aus. Den Großteil, nämlich 108 Millionen US-Dollar zahlte die Pharmaindustrie.
• Dieselben Akteure beschäftigten allein für diesen Bereich 952 Lobbyisten im Bereich der Gesetzgebungsinstitutionen und des Weißen Hauses.
• Mit 824 individuellen Lobbyisten, einem Allzeit-Hoch, setzten die Arzneimittelhersteller allein auf jedes Senatsmitglied 8 Vertreter an.
• Von den 222 Lobbyisten, die von HMOs und Health Plans auf die Parlamentarier angesetzt waren, vertraten 42 % auch die Pharmaindustrie.
• 431 der Pharma-Lobbyisten, was einem Anteil von 45 % dieser Gruppe entspricht, waren vorher innerhalb von Regierungsbehörden angestellt. Im Report werden die prominentesten dieser Sorte von Lobbyisten auch namentlich vorgestellt. Umgekehrt werden aber auch die ehemaligen Pharma-Manager genannt, die aktuell in der Bush Administration beschäftigt waren
Die 39-seitige PDF-Datei des Reports "The Medicare Drug War" können Sie hier einsehen und herunterladen.
Bernard Braun, 21.12.2006
Patienteninformation über Krankenhausqualität auch in den USA nicht problemlos
 Wer mit der Qualität der so genannten Qualitätsberichte der deutschen Krankenhäuser nicht zufrieden ist, also beispielsweise umfassende, leicht zugängliche, verständliche und zuverlässige Informationen über die Struktur-, Prozess- und vor allem die Ergebnisqualität vermisst, wird auch in den USA nicht befriedigende Verhältnisse oder gar uneingeschränkte Vorbilder finden.
Wer mit der Qualität der so genannten Qualitätsberichte der deutschen Krankenhäuser nicht zufrieden ist, also beispielsweise umfassende, leicht zugängliche, verständliche und zuverlässige Informationen über die Struktur-, Prozess- und vor allem die Ergebnisqualität vermisst, wird auch in den USA nicht befriedigende Verhältnisse oder gar uneingeschränkte Vorbilder finden.
Zwar sind Daten über die Angebotspalette, den Zugang zu, die Versorgungsqualität und die Kosten einer Behandlung mittlerweile für nahezu alle Krankenhäuser in den USA im Internet erreichbar, aber der Gebrauch kann nach aktuellen Berichten für viele Nutzer schwierig sein und viele Informationen machten keinen Sinn.
Dies gilt ausdrücklich auch für die vom Regierungs-Departement of Health and Human Services angebotene bundesweite Krankenhausvergleichs-Datenbank ""Hospitalcompare". Die Bundesdatenbank wird durch Länderdatenbanken wie die von Florida ("Floridacomparecare") ergänzt, die bereits seit November 2005 als erste in den USA Infektionsraten und Sterblichkeitsraten der Krankenhäuser und seit Juni 2006 auch Qualitätsdaten zur Versorgung von Kindern veröffentlicht.
Die Kritik an der US-Krankenhausinformation fasst ein Vertreter des Center for Practical Health Reform so zusammen: "It's still a tower of Babel out there. We're getting data. We're not getting information. Information is data made understandable." Auf das Problem, dass viele der Qualitätsdaten aus Abrechnungsbelegen der Krankenhäuser entnommen werden und die Reliabilität der Daten dadurch zweifelhaft ist, weisen andere Kritiker hin.
Híer finden Sie einige weitere aktuelle Einblicke in die kritische Debatte über Krankenhausqualitätssysteme in den USA.
Bernard Braun, 28.11.2006
Öffnung verstopfter Gefäße nach Herzinfarkt durch kathetergestützte Interventionen (z.B. Stents): Über- oder Fehlversorgung
 Viele Diskussionen in Deutschland konzentrieren sich aktuell darauf , ob die Erweiterung und das Offenhalten von verstopften Blutgefäßen am Herzen besser durch wesentlich teurere, mit Medikamenten beschichtete Stents (kleine Streben oder Stempel aus Metall) als den herkömmlichen Metall-Stents erfolgt.
Viele Diskussionen in Deutschland konzentrieren sich aktuell darauf , ob die Erweiterung und das Offenhalten von verstopften Blutgefäßen am Herzen besser durch wesentlich teurere, mit Medikamenten beschichtete Stents (kleine Streben oder Stempel aus Metall) als den herkömmlichen Metall-Stents erfolgt.
In dem hier vorgestellten Aufsatz findet sich dazu eine hochinteresante Anmerkung: "Randomized trials comparing drug-eluting stents and bare-metal stents have shown no reduction in the components of our primary end point with the use of drug-eluting stents. On the contrary, there is growing concern regarding the increased risk of late thrombosis with the use of drug-eluting stents, as compared with bare-metal stents. Moreover, trials of thrombectomy and distal-protection devices to prevent downstream embolization during PCI for myocardial infarction with ST-segment elevation have yielded disappointing results."
Die jetzt vorveröffentlichten Ergebnisse einer randomisierten Interventionsstudie bei Herzinfarktpatienten im "New England Journal of Medicine" (NEJM) vom 7. Dezember 2006 relativieren aber vor allem den Nutzen der so genannten PCI-Intervention (percutaneous coronary intervention=perkutane (C-)Koronarintervention, medizinische Bezeichnung für unterschiedliche Methoden der herzkathetergestützten Behandlung eingeengter oder verschlossener Herzkranzgefäße durch Aufdehnung mittels Ballonkatheter, Einsetzen eines Stents) erheblich.
Die wichtigsten Eckpunkte und Ergebnisse der unter dem Titel "Coronary Intervention for Persistent Occlusion after Myocardial Infarction" vorgestellten Studie sind:
• 2.166 Personen, bei denen sich 3 bis 28 Tage nach einem Herzinfarkt Blutgefäße hartnäckig geschlossen hatten und deren Risiko einen erneuten Infarkt zu bekommen und auch daran zu sterben damit erhöht war, wurden in zwei Gruppen aufgeteilt. In der einen Gruppe erfolgte eine Behandlung mit PCI-Methoden (z.B. Einsetzen von Stents und Ballonerweiterung von Gefäßen) und einer optimalen medikamentösen Therapie, in der zweiten erhielten die Patienten ausschließlich die medikamentöse Therapie.
• Als primäre Endpunkte der Therapien wurden über 4 Jahre Reinfarkte, Tod und schwere Herzschwäche beobachtet.
• Am Ende dieses Zeitraums ähnelten sich die Häufigkeiten der Endpunkt-Ereignisse weitgehend, was die Forschergruppe zum Schluss führte: "PCI did not reduce the occurrence of death, reinfarction, or heart failure".
Gesundheitswissenschaftlich und -politisch folgt daraus: Noch mehr als bisher sollten dramatisierende positive wie negative Debatten über den Nutzen aber auch die Unfinanzierbarkeit relevanter medizinisch-technischer Innovationen vor der Durchführung solider Studien vermieden werden.
Hochman JS, Lamas GA, Buller CE,et al. Coronary Intervention for Persistent Occlusion after Myocardial Infarction. New England Journal of Medicine 2006;355:2395-407. 7.Dezember 2006
Abstract
PDF der Studie
Bernard Braun, 17.11.2006
"Black box"-Warnhinweise auf Arzneimittelrisiken werden von amerikanischen Ärzten oft ignoriert
 Die härteste Form eines Hinweises auf hohe Risiken von Medikamenten, den die us-amerikanische "Food and Drug Administration (FDA)" verbreitet, sind so genannte "Black Box Warnings" (BBWs). Bisher war allerdings unbekannt, wie oft und intensiv amerikanische Ärzte Arzneimittel mit BBWs verordnen und ob sie dabei die Warnhinweise beachten.
Die härteste Form eines Hinweises auf hohe Risiken von Medikamenten, den die us-amerikanische "Food and Drug Administration (FDA)" verbreitet, sind so genannte "Black Box Warnings" (BBWs). Bisher war allerdings unbekannt, wie oft und intensiv amerikanische Ärzte Arzneimittel mit BBWs verordnen und ob sie dabei die Warnhinweise beachten.
In einer retrospektiven Analyse der Abrechnungsdaten für 929.958 Krankenversicherten in 10 geographisch unterschiedlichen Krankenversicherungen im Zeitraum von Anfang 1999 bis Mitte 2001 brachte eine Gruppe von Pharmakologen, Ärzten und Sozialwissenschaftlern (Anita K. Wagner; K. Arnold Chan; Inna Dashevsky; Marsha A. Raebel; Susan E. Andrade; Jennifer Elston Lafata; Robert L. Davis; Jerry H. Gurwitz; Stephen B. Soumerai; Richard Platt)unter Leitung der Bostoner Wissenschaftlerin Anita Wagner , etwas Licht in dieses möglicherweise gefährliche Dunkel. Die am 18. November in der Onlineausgabe der Zeitschrift "Pharmacoepidemiology and Drug Safety" unter der Überschrift "FDA drug prescribing warnings: is the black box half empty or half full?" veröffentlichten Ergebnisse (kostenlos ist nur ein Abstract erhältlich) zeigen verbreitete Informations- und Informationsnutzungs-Defizite der Ärzte:
• Mehr als 40 Prozent der Versicherten erhielten mindestens eine Medikation, die einen BBW erhalten hatte, der sie potenziell betreffen hätte können.
• Die meisten Fälle der Nichtbefolgung dieser Art von Warnhinweisen bestanden darin, dass Therapien ohne die davor empfohlenen Laboruntersuchungen gestartet wurde. Bei 49,6 Prozent aller Therapien, bei denen eine solche Handlungsabfolge empfohlen wird, folgten die Ärzte nicht diesen Empfehlungen.
• Wenig Missachtungen von Warnhinweisen gab es immerhin bei absolut kontraindizierten Arzneimitteln während der Schwangerschaft.
Um die Kommunikation über Arzneimittelrisiken zu verbessern und solche Systeme wie die BBWs wirksamer zu machen, benötigt man nach Meinung der US-Forscher mehr Informationen über die Art und Weise wie Verordnungen im Behandlungsalltag eingesetzt werden. Außerdem muss man viel mehr darüber wissen, welche Einflüsse im wesentlichen die Verordnungsweise von Ärzten beeinflussen und ihnen helfen, sich an Sicherheitsempfehlungen zu halten.
Empfohlen wird u.a., die BBWs einheitlicher und schematischer zu gestalten, um in kürzester Zeit auf eindeutig wichtige Warnhinweise stoßen zu können. Ein anderer Weg erscheint den Wissenschaftlern ebenfalls gangbar: Die Patienten sollten dann, wenn sie die Arzneimittel erhalten, automatisch einen Hinweis auf die Existenz von BBWs bekommen. Dies setzte allerdings eine entsprechend große und aktuelle Datenbank über die Risiken und Risikohinweise voraus.
Bernard Braun, 22.11.2005
USA: Fast 50 Prozent der Senioren haben Probleme mit der Einnahme von Arzneimitteln
 Auch wenn sich das Gesundheitssystem in den USA speziell im Bereich der Versorgung mit Arzneimittel deutlich von den Verhältnissen in Deutschland unterscheidet, weisen die Ergebnisse eines speziellen Surveys über die Versorgung und die Einnahme oder Nichteinnahme von Arzneimitteln durch ältere Menschen auf die Existenz und die Dimensionen einiger Probleme bei der Verordnungs- und Einnahmequalität hin, die auch im GKV-System vorkommen dürften.
Auch wenn sich das Gesundheitssystem in den USA speziell im Bereich der Versorgung mit Arzneimittel deutlich von den Verhältnissen in Deutschland unterscheidet, weisen die Ergebnisse eines speziellen Surveys über die Versorgung und die Einnahme oder Nichteinnahme von Arzneimitteln durch ältere Menschen auf die Existenz und die Dimensionen einiger Probleme bei der Verordnungs- und Einnahmequalität hin, die auch im GKV-System vorkommen dürften.
In einem in der Web Exclusive-Ausgabe der Zeitschrift "Health Affairs" im April 2005 veröffentlichten Aufsatz über "Prescription Drug Coverage and Seniors: Findings from a 2003 National Survey" (Autoren: Safran, D.; Neuman, T.; Schoen, C.: Kitchman, M. et al.) wurden detaillierte Daten über den Arzneimittel-Versicherungsschutz und die Einnahme von Arzneimitteln von 17.685 Medicare-Versicherten zusammengestellt.
Die wichtigsten Ergebnisse waren:
• 27 Prozent aller Senioren und ein Drittel der armen Senioren hatten keinen oder nur einen mangelhaften Versicherungsschutz für verschreibungspflichtige Medikamente,
• fast 45 Prozent der Befragten berichteten, sie bekämen mindestens 5 Medikamente verordnet,
• 54 Prozent hatten mehr als einen verschreibenden Arzt und
• 36 Prozent besuchten mehr als eine Apotheke,
• fast ein Drittel der befragten älteren Personen gaben mindestens 100 US-$ für Zuzahlungen bei Medikamenten aus,
• mehr als ein Viertel der Befragten verschob die Einlösung des Rezepts aus Kostengründen,
• ebenfalls ein Viertel nahm aufgrund schlechter vergangener oder aktueller Erfahrung und Wirkung der Medikamente die verordneten Arzneimittel nicht ein oder reduzierte die Dosis. Dieser Anteil betrug bei den Patienten mit komplexen chronischen Erkrankungen sogar 34 Prozent und
• 15 Prozent hielten sich nicht an die verordnete Menge der Arzneimittel, weil sie dachten, das sei zu viel oder sei nicht notwendig.
Insgesamt hielten sich damit 40 Prozent der befragten SeniorInnen aus verschiedenen Gründen nicht an den verordneten Umfang und die Art der Medikamentenverordnung. Dieser Anteil belief sich bei armen Alten auf 48 Prozent und bei Personen mit 3 und mehr chronischen Erkrankungen sogar auf 52 Prozent.
Sieht man von den speziellen Defiziten des Versicherungsschutzes in den USA ab, existieren offensichtlich bei älteren Menschen als einer der Bevölkerungsgruppen mit großen Bedarf an Medikamenten zahlreiche Schwierigkeiten mit deren Einnahme. Diese teilweise gesundheitsgefährdenden Verhaltensweisen erfordern eine deutliche Verbesserung der Arzt-Patient-Kommunikation und -Interaktion über Arzneimittel.
Hier finden Sie eine 2-seitige Zusammenfassung des Health Affairs-Aufsatzes
Bernard Braun, 9.10.2005