



Home | Patienten | Gesundheitssystem | International | GKV | Prävention | Epidemiologie | Websites | Meilensteine | Impressum
Sämtliche Rubriken in
"International"
Andere Länder |
Alle Artikel aus:
International
Andere Länder
Zwei neue Studien: COVID-19 ist gef�hrlicher als die saisonale Influenza
 Eine Studie aus Frankreich befasst sich mit der Frage, wie sich COVID-19 und Influenza bezüglich Morbidität und Mortalität unterscheiden. Verglichen wurden dazu Krankenhauspatient*innen zum Zeitpunkt der Entlassung. Dazu wurden die Daten von 89.530 COVID-19-Patient*innen aus dem Zeitraum 1.3.-30.4.2020 mit 45.819 Influenza-Patienten aus dem Zeitraum 1.12.2018 bis 28.2.2019 verglichen. Es handelt sich um eine retrospektive Kohortenstudie. Die Diagnosen und Prozeduren (abrechenbare Behandlungsmaßnahmen) aller Patienten, die in öffentlichen und privaten Krankenhäusern in Frankreich behandelt werden, stehen in einer nationalen Datenbank (Programme de médicalisation des systèmes d'information) zur Verfügung.
Eine Studie aus Frankreich befasst sich mit der Frage, wie sich COVID-19 und Influenza bezüglich Morbidität und Mortalität unterscheiden. Verglichen wurden dazu Krankenhauspatient*innen zum Zeitpunkt der Entlassung. Dazu wurden die Daten von 89.530 COVID-19-Patient*innen aus dem Zeitraum 1.3.-30.4.2020 mit 45.819 Influenza-Patienten aus dem Zeitraum 1.12.2018 bis 28.2.2019 verglichen. Es handelt sich um eine retrospektive Kohortenstudie. Die Diagnosen und Prozeduren (abrechenbare Behandlungsmaßnahmen) aller Patienten, die in öffentlichen und privaten Krankenhäusern in Frankreich behandelt werden, stehen in einer nationalen Datenbank (Programme de médicalisation des systèmes d'information) zur Verfügung.
Im Krankenhaus verstarben 15.104 der 89.530 COVID-19-Patienten (16,9%) und 2640 der 45.819 Influenza-Patient*innen (5,8%). Das Sterberisiko war also 2,9 mal höher für COVID-19-Patient*innen als für Influenza-Patient*innen, altersadjustiert war das Risiko mit 2,82 geringfügig niedriger.
Auf die Intensivstation (ICU) wurden mehr COVID-19-Patient*innen aufgenommen (16,3% vs. 10,8%), die Dauer des ICU-Aufenthaltes war länger (15 vs. 8 Tage), der Anteil der mechanisch Beatmeten unter den ICU-Patient*innen war höher (71,5% vs. 61,0%).
Der Anteil der Verstorbenen (Fallsterblichkeitsrate) war erhöht bei
• ICU-Patienten (27,1% vs. 18%),
• ICU-Patienten mit mechanischer Beatmung (31,8% vs. 26)
• ICU-Patienten ohne mechanische Beatmung (17,2% vs. 5,4%).
Das Durchschnittsalter der COVID-19-Patient*innen war höher (65 vs. 59 Jahre), insbesondere war der Anteil jüngerer Patienten niedriger, so waren 1,4% der COVID-19-Patient*innen unter 18 Jahre im Vergleich zu 19,5% der Influenza-Patient*innen. Der Anteil der Männer war bei COVID-19 höher (53,0% vs. 48,3%).
Folgende Ko-Morbiditäten waren bei COVID-19-Patient*innen mit statistischer Signifikanz erhöht: Bluthochdruck (33,1% vs. 28,2%), Übergewicht (11,3% vs. 6,1%), Adipositas (9,6% vs. 5,4%), Diabetes (19,0% vs. 16,0%), Fettstoffwechselstörung (5,0% vs. 4,5%). Bei der Influenza waren mit statistischer Signifikanz häufiger: chronische Atemwegserkrankungen (4,0% vs. 1,6%), Immunschwäche (4,4% vs. 3,8%).
Folgende Ereignisse während des Krankenhausaufenthaltes waren bei COVID-19-Patient*innen erhöht: akutes Lungenversagen (27,2% vs. 17,4%), Lungenembolie (3,4% vs. 0,9%), septischer Schock (2,8% vs. 2,0%), akutes Nierenversagen (6,4% vs. 4,9%). Bei Influenza waren häufiger: Herzinfarkt (Herzinfarkt 1,1% vs. 0,6% und Vorhofflimmern (15,8% vs. 12,4%).
Zusammenfassend hat COVID-19 in Frankreich in 2 Monaten im Jahr 2020 zu fast doppelt so vielen Krankenhausaufenthalten geführt, als die Influenza in 3 Monaten um die Jahreswende 2018/19. Die Komplikationsraten waren höher, die Verläufe ungünstiger und die Sterblichkeit (Fallsterblichkeitsrate) im Krankenhaus fast 3fach erhöht.
Eine methodisch ähnliche amerikanische Studie mit den Daten der mehr als 9 Mio. Personen, die über das US Department of Veterans Affairs gesundheitlich versorgt werden, ergab ähnliche Ergebnisse (Xie et al. 15.12.2020). Verglichen wurden 3641 COVID-19-Patient*innen, die zwischen dem 1.2. und 17.6 2020 ins Krankenhaus aufgenommen wurden mit 12.676 Influenza-Patient*innen zwischen 2017 und 2019. Bei Patient*innen mit der Diagnose COVID-19 war das Sterberisiko um den Faktor 4,97 erhöht, Die Wahrscheinlichkeit für mechanische Beatmung 4,01fach und die Wahrscheinlichkeit für die Verlegung auf die ICU 2,41fach (alle Werte für Alter und weitere Einflussfaktoren adjustiert).
Zusammenfassend handelt es sich um zwei Studien mit soliden Daten einer jeweils großen Population (alle Krankenhauspatienten in Frankreich bzw. alle Veterans Affairs-Versicherten in den USA). Der Vergleich der Patient*innen mit der Diagnose COVID-19 und Influenza ergibt in beiden Populationen eine deutlich erhöhte Sterblichkeit und ein höheres Risiko für Komplikationen und schwere Verläufe für COVID-19.
Im Zusammenhang mit der Übersterblichkeit der ersten und jetzt auch zweiten SARS-CoV-2-Infektionswelle dürfte für die These, COVID-19 sei nicht gefährlicher als eine Grippe, kein Raum mehr bleiben.
Piroth L, Cottenet J, Mariet A-S, Bonniaud P, Blot M, Tubert-Bitter P, et al. Comparison of the characteristics, morbidity, and mortality of COVID-19 and seasonal influenza: a nationwide, population-based retrospective cohort study. The Lancet Respiratory Medicine. Veröffentlicht 17.12. 2020. Download
Xie Y, Bowe B, Maddukuri G, Al-Aly Z. Comparative evaluation of clinical manifestations and risk of death in patients admitted to hospital with covid-19 and seasonal influenza: cohort study. BMJ. 2020;371:m4677. Veröffentlicht am 15.12.2020 Link
Vertiefung: Zusatzkapitel Corona (fortlaufende Aktualisierung) zum Lehrbuch Sozialmedizin - Public Health - Gesundheitswissenschaften. 4. Auflage März 2020.
Download: www.sozmad.de
David Klemperer, 25.12.20
"Für Firmen packt man die Bazooka aus, für Eltern nicht mal die Wasserpistole" (SZ 4.5.2020) Eltern, Corona-Pandemie in Österreich
 Dass Eltern von Kita- und schulpflichtigen Eltern, die erwerbstätig sind, durch die Corona-Lockdowns besonders unter dem Neben- und der tendenziellen Unvereinbarkeit von Homeoffice, ganztägiger häuslicher Kinderbetreuung, Homeschooling und normalem Leben zu leiden haben, war von Beginn an klar. Weder die akute Situation noch die möglichen langfristigen sozialen und psychischen Folgen für Eltern und Kinder führte aber zu mehr als den wohlfeilen Etikettierungen als "Alltagshelden" oder "systemrelevant". Eine ähnliche Kluft zwischen Risiko-Rhetorik (Hochrisikogruppen) und Nichtstun (fehlende Schutzausrüstung) existierte wochenlang beim Umgang mit der Lage in Alten- und Pflegeheimen. Warum ausgerechnet besonders vulnerable Gruppen lange Zeit und zum Teil bis heute nicht im Zentrum von Hilfsbemühungen standen, sollte bei der Aufarbeitung von Corona-Risikokommunikation und -management besonders thematisiert werden.
Dass Eltern von Kita- und schulpflichtigen Eltern, die erwerbstätig sind, durch die Corona-Lockdowns besonders unter dem Neben- und der tendenziellen Unvereinbarkeit von Homeoffice, ganztägiger häuslicher Kinderbetreuung, Homeschooling und normalem Leben zu leiden haben, war von Beginn an klar. Weder die akute Situation noch die möglichen langfristigen sozialen und psychischen Folgen für Eltern und Kinder führte aber zu mehr als den wohlfeilen Etikettierungen als "Alltagshelden" oder "systemrelevant". Eine ähnliche Kluft zwischen Risiko-Rhetorik (Hochrisikogruppen) und Nichtstun (fehlende Schutzausrüstung) existierte wochenlang beim Umgang mit der Lage in Alten- und Pflegeheimen. Warum ausgerechnet besonders vulnerable Gruppen lange Zeit und zum Teil bis heute nicht im Zentrum von Hilfsbemühungen standen, sollte bei der Aufarbeitung von Corona-Risikokommunikation und -management besonders thematisiert werden.
Wie es Eltern in der Corona-Pandemie ging und geht, lässt sich jetzt recht plastisch einer Befragungsstudie in Österreich entnehmen. Dazu befragte das sozialwissenschaftliche Institut SORA in Wien zwischen dem 14. und 22. April 2020 524 Eltern von Kindern unter 15 Jahren. Da die Lockdownmaßnahmen ähnlicher Art wie in Deutschland waren und sich wahrscheinlich auch sonst die sozialen Verhältnisse nicht grundlegend unterscheiden, sind die Ergebnisse auch für die Lage von Eltern in Deutschland aussagefähig.
Die wesentlichen Ergebnisse in Schlagzeilen aus der Kurzfassung des Studienberichts lauten:
• "Je niedriger der soziale Status, desto wahrscheinlicher sind Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit." "Auch die Nutzung vom Home-Office unterscheidet sich, je nach Bildungsstand: Unter AkademikerInnen arbeiten mehr als zwei Drittel (67%) im Corona-bedingten Homeoffice. Hingegen sind es bei Menschen mit maximal Pflichtschulabschluss nur 11% - hier müssen 55% der Eltern wie immer zum Arbeitsplatz reisen." Wie dann Zwangs-Kinderbetreuung funktioniert, hat die Studie nicht erhoben, stressfrei mit Sicherheit aber nicht.
• "Home-Office führt nicht zu besserer Vereinbarkeit: Eltern arbeiten weniger und nachts"
• "Kinderbetreuung: Mehr als 10.000 Kinder bei Oma und Opa" - und dies obwohl ja Großeltern zu den (Hoch-)Risikopersonen gehören! "11% aller Eltern sagen, sie müssen ihre Kinder derzeit einen Teil des Tages auch unbetreut Zuhause lassen, unter AlleinerzieherInnen sind es 17%."
• "Mütter weiterhin hauptverantwortlich für die Kinderbetreuung. Die Coronakrise hat nicht zu einer gerechteren Aufteilung der Verantwortung für die Kinderbetreuung geführt. In der aktuellen Krise haben zwar 23% der Väter die Hauptverantwortung für die Kinderbetreuung übernommen, dies vor allem in jenen Haushalten, in denen die Männer derzeit zuhause sind und die Frauen weiterhin ihrer Arbeit auswärts nachgehen müssen. Mütter bleiben in 42% aller Haushalte hauptverantwortlich für die Betreuung ihrer Kinder."
• "Mehr als die Hälfte der Mütter sehr stark belastet. Fast die Hälfte (46%) der befragten Eltern gibt an, dass die derzeitige Situation sie sehr stark belastet. Die Belastungen sind jedoch nicht gleich verteilt: Während Männer zu 40% angeben, unter der derzeitigen Situation zu leiden, sind es unter Frauen bzw. Müttern 51%. Das liegt nicht daran, dass Mütter die Vereinbarkeit von Berufs- und Familienleben grundsätzlich negativer bewerten: Vor der Krise haben Mütter die Vereinbarkeit sogar positiver gesehen als ihre Partner, aktuell ist es umgekehrt."
• Und zum schlechten Schluss noch ein Ausblick auf den Sommer: "Jede/r Vierte vor großen Problemen. Die Hälfte der Eltern hat für die Kinderbetreuung Urlaubstage verbraucht, dies betrifft vor allem Doppelverdiener-Haushalte und Beschäftigte ohne Möglichkeit auf Home-Office. Jedes vierte Elternteil schätzt deshalb, im Sommer nicht genug Urlaubstage für die Kinderbetreuung zu haben. Ebenso viele wissen nicht, wie sie die durchgängige Betreuung der Kinder im Sommer leisten sollen. Fast die Hälfte gibt an, sich keine externe Betreuung im Sommer leisten zu können, in der ArbeiterInnenschicht sind es 59%, unter Alleinerziehenden 71%."
Wer mehr Details wissen will kann den im Mai 2020 veröffentlichten 29-seitigen Endbericht Zur Situation von Eltern während der Coronapandemie von Daniel Schönherr kostenlos herunterladen.
Bernard Braun, 6.5.20
Gesundheit global. Anforderungen an eine nachhaltige Gesundheitspolitik
 Global health, globale Gesundheit, steht weit oben auf der internationalen politischen Agenda. Diese Entwicklung ist aus gesundheitswissenschaftlicher und -politischer Sicht so überfällig wie begrüßenswert. Das gängige Verständnis von Global Health weist dabei allerdings einige konzeptionelle Beschränkungen auf, Reichweite und Inhalte der Diskussion werden vielfach nicht den komplexen Herausforderungen in der globalisierten Welt gerecht.
Global health, globale Gesundheit, steht weit oben auf der internationalen politischen Agenda. Diese Entwicklung ist aus gesundheitswissenschaftlicher und -politischer Sicht so überfällig wie begrüßenswert. Das gängige Verständnis von Global Health weist dabei allerdings einige konzeptionelle Beschränkungen auf, Reichweite und Inhalte der Diskussion werden vielfach nicht den komplexen Herausforderungen in der globalisierten Welt gerecht.
Heute wäre es naiv zu glauben, Gesundheit und Wohlbefinden der Menschen ließen sich allein innerhalb der eigenen Grenzen gewährleisten. Das liegt allerdings nicht so sehr an der schnelleren Ausbreitung ansteckender Krankheiten, sondern vor allem daran, dass die wesentlichen Einflussfaktoren für die Gesundheit der Bürger*innen nicht an den Grenzen eines Landes halt machen. Zwar bestimmen in der Praxis sowie in der ersten Strategie der deutschen Bundesregierung zu globaler Gesundheit - siehe dazu den entsprechenden Bericht im Forum Gesundheitspolitik - bis heute ein technik- und exportorientiertes und ein stark sicherheitsorientiertes Verständnis von Global Health den offiziellen Diskurs - globale Gesundheitspolitik und Gesundheitssystemstärkung versprechen weltweite Absatzmöglichkeiten für Arzneimittel, Medizintechnik und Know-how made in Germany. Aber eine international ausgerichtete Gesundheitspolitik, die primär auf die Sicherung nationaler Territorien und Bevölkerungen durch Schutz vor grenzüberschreitenden Gesundheitsgefahren zielt, verstellt den Blick auf die Komplexität des Themas; darauf verweist auch die Deutsche Plattform für Globale Gesundheit, wie das Forum im August 2014 berichtete.
Die Herausforderungen an die internationale Gesundheitspolitik gehen tatsächlich weit über biomedizinische, pharmakologische und technologische Forschung und den Export von Know-how, Arzneimitteln und Medizintechnik hinaus. Was globale Gesundheitspolitik umfasst und berücksichtigen muss, um wirksam zur Verbesserung der Gesundheit der Menschen auf diesem Globus beizutragen, zeigt der in der März/April-Ausgabe der Fachzeitschrift Dr. Med. Mabuse erschienene, hier kostenfrei verfügbare Artikel Gesundheit global. Anforderungen an eine nachhaltige Gesundheitspolitik von Jens Holst.
David Klemperer, 12.8.19
Global Health - Mehr als Medizin und Technologie
 Global Health - Globale Gesundheit - steht heute weit oben auf der internationalen politischen Agenda. Vor allem die deutsche Bundesregierung und insbesondere das Kanzleramt haben dem Thema Global Health in den letzten Jahren zunehmende Aufmerksamkeit gewidmet und dazu beigetragen, dass es auf vielen internationalen Konferenzen einen prominenten Raum einnimmt. Das ist eine unmittelbare Folge der weitgehenden Globalisierung aller Lebensbereiche, also der zunehmenden internationalen Verflechtung vor allem der Wirtschaft, Politik, Kultur, Umwelt und Kommunikation zwischen Individuen, Gesellschaften, Institutionen und Staaten. Sie bringt für einen wachsenden Teil der Weltbevölkerung erhebliche Veränderungen der Arbeits- und Lebensbedingungen mit sich, führt zu wachsenden Belastungen von Umwelt und Klima, schürt bewaffnete Konflikte um natürliche Ressourcen wie Wasser und Bodenschätze, befördert den Tourismus für die einen und den Migrationsdruck für die anderen und vertieft die sozioökonomischen Gräben in und zwischen Ländern.
Global Health - Globale Gesundheit - steht heute weit oben auf der internationalen politischen Agenda. Vor allem die deutsche Bundesregierung und insbesondere das Kanzleramt haben dem Thema Global Health in den letzten Jahren zunehmende Aufmerksamkeit gewidmet und dazu beigetragen, dass es auf vielen internationalen Konferenzen einen prominenten Raum einnimmt. Das ist eine unmittelbare Folge der weitgehenden Globalisierung aller Lebensbereiche, also der zunehmenden internationalen Verflechtung vor allem der Wirtschaft, Politik, Kultur, Umwelt und Kommunikation zwischen Individuen, Gesellschaften, Institutionen und Staaten. Sie bringt für einen wachsenden Teil der Weltbevölkerung erhebliche Veränderungen der Arbeits- und Lebensbedingungen mit sich, führt zu wachsenden Belastungen von Umwelt und Klima, schürt bewaffnete Konflikte um natürliche Ressourcen wie Wasser und Bodenschätze, befördert den Tourismus für die einen und den Migrationsdruck für die anderen und vertieft die sozioökonomischen Gräben in und zwischen Ländern.
Mit der Bedeutung nimmt auch die Wahrnehmung der weilweiten Verbindungen und der Herausforderungen im Zusammenhang mit der Gesundheit der Menschen zu. Das vergleichsweise neue Konzept Globale Gesundheit bezieht sich auf die Gesundheit von Menschen jenseits von Ländergrenzen, verfolgt eine explizit transnationale und universelle Perspektive und unterscheidet sich von "Internationaler Gesundheit" insbesondere durch die Berücksichtigung der globalen gesundheitsbezogenen Herausforderungen
Global Health ist ein komplexer Sammelbegriff, der zwar erheblich an Bedeutung gewonnen hat, aber bis heute keine eindeutige Verwendung erfährt. Bereits 2006 definierte eine us-amerikanisch-peruanische Forschergruppe um Theodore Brown globale Gesundheit in ihrem Artikel The World Health Organization and the transition from "international" to "global" public health" als Global health is the health of populations in the global context. Die britischen Wissenschaftler David Stuckler und Martin McKee beschrieben 2008 in Five metaphors about global health policy das breite Spektrum von globaler Gesundheit, das von Gesundheit als Instrument der inneren Sicherheit und der Außenpolitik über karitative, philantropische Ansätze und öffentlich-private Partnerschaften bis hin zum allgemeinen Menschenrecht und solidarischem Handeln reicht. Eine internationale Gruppe von Gesundheitswissenschaftlern um Jeffrey Koplan leitete in ihrem Artikel Towards a common definition of global health einen Paradigmenwechsel im Hinblick auf globale Gesundheit ein. Im Anschluss an den aussagekräftigen einleitenden Satz Global health is fashionable forderte die Autoren eine wegweisende Definition von Global Health, die alle gesundheitlichen Herausforderungen und länderübergreifenden Determinanten von der weltweiten Ausrottung von Krankheiten (z. B. Kinderlähmung) über Antibiotikaresistenzen, Ernährungssicherheit, Urbanisierung und Migration bis zum Klimawandel umfassen müsse. Für den deutschsprachigen Raum bietet die Bundeszentrale für politische Bildung eine vergleichbare Begriffserklärung in dem Beitrag Globale Gesundheit / Global Health von Silke Gräser.
Das gängige, im politischen Raum vorherrschende Verständnis von Global Health wird allerdings allzu häufig der gebotenen Komplexität nicht gerecht und weist konzeptionelle Beschränkungen auf. Der herrschende Global-Health-Diskurs erfüllt vielfach weder den implizit mit dem Begriff "global" verknüpften Anspruch auf Universalismus noch die Erfordernisse einer umfassenden transdisziplinären und ressortübergreifenden Gesundheitspolitik. Darauf machen zwei Beiträge in Publikationen des AOK-Bundesverbands aufmerksam. In der Januar-Ausgabe 2019 des Monatsmagazins Gesundheit und Gesellschaft (G+G) zeigt Jens Holst, der an der Hochschule Fulda die neu eingerichtete Professur für Medizin mit Schwerpunkt Global Health innehat, an Hand der besorgniserregenden Antibiotika-Resistenzentwicklung die Bedeutung von globaler Gesundheit bzw. globaler gesundheitsbezogener Zusammenhänge auf. Eine erfolgversprechende Strategie zur Eindämmung der zunehmenden Multiresistenzen von Krankheitserregern darf sich nicht auf die Human- und Tiermedizin beschränken, sondern muss auch grundlegende Fragen der landwirtschaftlichen Produktion, der Arbeitsbedingungen und der Handelspolitik einbeziehen, sich mit der Steuerung transnationaler Konzerne und einem politischen Ausgleich globaler Machtasymmetrien Machtasymmetrien befassen und grundlegende Governancefragen beantworten. Gerade auf die unverzichtbare Bedingung einer konsequenten Politik der Gesundheit-in-allen-Politikbereichen zur Lösung der drängenden Resistenz-Problematik verweist der Beitrag, der auch ein Glossar mit Begriffsbestimmungen relevanter Termini wie primärer, globaler, internationaler und öffentlicher Gesundheit und von "one health" bzw. "health in all" umfasst. Der Artikel Resistenzen ohne Grenzen ist direkt online zu lesen und auch als PDF herunterzuladen.
Eine explizite Begriffsbestimmung von Global Health enthält der zweite Betrag von Jens Holst, der in der April-Ausgabe 2019 der G+G Wissenschaft, der Wissenschaftsbeilage von Gesundheit und Gesellschaft, erschien. Er beschreibt und analysiert die Entstehung und historische Entwicklung des Begriffs Global Health und setzt sich kritisch mit unterschiedlichen Auslegungen, Strömungen und insbesondere mit der selektiven, verengten Sicht auf globale Gesundheit auseinander und nimmt Bezug auf die Forderung nach der Dekolonalisieung von Global Health. Gerade die in Medizin, Politik und Wirtschaft vielfach anzutreffende Verkürzung globaler Gesundheitsfragen auf biomedizinische und technologische Lösungsansätze und der Fokus auf einkommensschwächere Länder im Sinne von international health wird dem Thema Globale Gesundheit nicht hinreichend gerecht. Vielmehr ist Global Health die konsequente Weiterentwicklung von Public Health als inter- bzw. transdisziplinäre Wissenschaft mit systemischer Sichtweise auf die globalen gesundheitlichen Herausforderungen. Auch der Artikel Global Health - Hope oder Hype? steht kostenfrei zum Download zur Verfügung.
Bernard Braun, 10.8.19
Was haben 10 Jahre Gesundheitsreform in China bewirkt? Ein überfälliger Überblick.
 Die Volksrepublik China hat mit rund 1,4 Milliarden Menschen nicht nur die weltweit größte Einwohneranzahl in extrem unterschiedlichen geographischen und sozioökonomischen Kontexten, sondern auch ebenso viele Personen, die potenziell einen Bedarf an gesundheitlicher Versorgung haben. Bei ihrer Gründung im Jahr 1949 bestand die Gesundheitsversorgung fast ausschließlich auf dem Wirken von "BarfussärztInnen". Spätestens mit der umfassenden Gesundheitssystemreform im Jahre 2009 lautete das politische Ziel: "establishing a basic health care system covering all the population by 2020" (so das Zentralkomittee der Kommunistischen Partei Chinas im Jahr 2009).
Die Volksrepublik China hat mit rund 1,4 Milliarden Menschen nicht nur die weltweit größte Einwohneranzahl in extrem unterschiedlichen geographischen und sozioökonomischen Kontexten, sondern auch ebenso viele Personen, die potenziell einen Bedarf an gesundheitlicher Versorgung haben. Bei ihrer Gründung im Jahr 1949 bestand die Gesundheitsversorgung fast ausschließlich auf dem Wirken von "BarfussärztInnen". Spätestens mit der umfassenden Gesundheitssystemreform im Jahre 2009 lautete das politische Ziel: "establishing a basic health care system covering all the population by 2020" (so das Zentralkomittee der Kommunistischen Partei Chinas im Jahr 2009).
Was sich seitdem geändert hat und welche Erfahrungen und Lehren gemacht bzw. gewonnen wurden, ist hierzulande und wahrscheinlich in weiten Teilen der Erde unbekannt.
Wer beginnen will daran etwas zu ändern, kann dies durch die Lektüre von 18 wissenschaftlichen Aufsätzen, die in den letzten Jahren in der von der Oxford University Press und der London School of Hygiene & Tropical Medicine herausgegebenen Zeitschrift "Health Policy and Planning" erschienen sind und nun anlässlich des zehnten Jahrestags der chinesischen Gesundheitsreform zusammengestellt wurden und frei zugänglich sind.
U.a. beschäftigen sich die Aufsätze mit folgenden Themen: 10 years of China's comprehensive health reform: a systems perspective (Jin Xu, Anne Mills), Health reform and out-of-pocket payments: lessons from China (Lufa Zhang, Nan Liu), Paying for outpatient care in rural China: cost escalation under China's New Co-operative Medical Scheme (Wei Yang, Xun Wu), Challenges to healthcare reform in China: profit-oriented medical practices, patients' choice of care and guanxi culture in Zhejiang province (Dan Wu, Tai Pong Lam, Kwok Fai Lam, et al.), Engaging sub-national governments in addressing healthequities: challenges and opportunities in China's health system reform (Hana Brixi, Yan Mu, Beatrice Targa, et al.), Prospects for regulated competition in the health care system: what can China learn from Russia's experience? (Weiwei Xu, Igor Sheiman, Wynand P M M van de Ven, et al.), An evaluation of systemic reforms of public hospitals: the Sanming model in China (Hongqiao Fu, Ling Li, Mingqiang Li, et al.) und The impact of clinical pharmacy services in China on the quality use of medicines: a systematic review in context of China's current healthcare reform (Jonathan Penm, Yan Li, Suodi Zhai, Yongfang Hu, et al.).
Alle Aufsätze zu China's health system reform: 10 years on sind vollständig und kostenlos zugänglich.
Bernard Braun, 16.7.19
"Was kümmern uns Antibiotikaeinnahme und resistente Bakterien in Rufisque (Senegal)?": Warum vielleicht doch!
 Auch wenn es kaum einen europäischen Leser geben dürfte, dem der Ort um den es in einer Ende 2018 veröffentlichten Studie geht bekannt ist, gehört das Wissen seiner EinwohnerInnen über Antibiotika bzw. das Wissen über den richtigen Umgang mit Antibiotika unbedingt zu "unserem" Wissen über die Triebkräfte der Globalisierung von Gesundheitsrisiken und der Notwendigkeit ihrer globalen Prävention.
Auch wenn es kaum einen europäischen Leser geben dürfte, dem der Ort um den es in einer Ende 2018 veröffentlichten Studie geht bekannt ist, gehört das Wissen seiner EinwohnerInnen über Antibiotika bzw. das Wissen über den richtigen Umgang mit Antibiotika unbedingt zu "unserem" Wissen über die Triebkräfte der Globalisierung von Gesundheitsrisiken und der Notwendigkeit ihrer globalen Prävention.
In einer mit EinwohnerInnen der Stadt Rufisque im Senegal durchgeführten Studie ging es einer Gruppe senegalesischer Mediziner und GesundheitswissenschaftlerInnen um deren Wissen über die Zweckmäßigkeit oder Notwendigkeit der Einnahme von Antibiotika überhaupt und die Art und Weise der Einnahme und das Wissen darüber, dass die gesundheitlich nicht notwendige oder z.B. eine zu kurze Einnahme von Antibiotika zu Resistenzbildungen von Bakterien gegenüber immer mehr Antibiotika führt und sich auch derartige Bakterien dank der weltweiten Mobilität länder- und kontinentübergreifend verbreiten können. Das aus der Chaostheorie bekannte Bild, dass und wie sich ein umfallender Reissack in China auf wesentlich bedeutendere Ereignisse in Europa auswirken kann, gilt also im übertragenen Sinn auch für durch irrationale Einnahme von Antibiotika verursachte resistente Bakterien.
Die Bildung von Resistenzen findet weltweit statt, also auch unter bestimmten Bedingungen im Senegal. Dass diese Bedingungen existieren zeigen die Ergebnisse einer mündlichen Befragung von 400 in der senegalesischen Stadt wohnenden und für die dortige erwachsene Bevölkerung repräsentativen Personen.
Zu den wichtigsten Ergebnissen gehören die folgenden:
• Die meisten Befragten, zwischen 64,4% und 72,3%, glaubten Antibiotika würden gegen eine Reihe von Erkrankungen der oberen Atemwege helfen, obwohl die Mehrzahl dieser Erkrankungen auch im Senegal Viruserkrankungen sind gegen die Antibiotika wirkungslos sind.
• 42,8% der Befragten waren sich sicher, dass die Antibiotikatherapie sofort gestoppt werden könne, wenn die Symptome verschwunden sind, was u.a. die Bildung von Resistenzen fördert.
• Nur 8,8% und 41,8% der Befragten wussten von der präventiven Bedeutung von Händewaschen und Impfen gegen eine Reihe von Erkrankungen, die unsinnigerweise mit Antibiotika behandelt werden.
• Insgesamt hatten nur 7% aller Befragten ein insgesamt gutes Wissen über die Bedeutung und richtige Einnahme von Antibiotika sowie das Risiko der bakteriellen Resistenzen, und zwar unabhängig von soziodemografischen Merkmalen. Dies schloss nicht aus, dass mehr als 7% der Befragten bei Einzelaspekten über mehr Wissen verfügten.
• Ähnlich wie in Befragungsstudien in europäischen Ländern, dachten auch 78,3% der im Senegal Befragten, dass die Bevölkerung zu viele Antibiotika verordnet bekommt und einnimmt.
• Zwischen 28% und 53,5% der Befragten fühlten sich auch nicht genug während Arztbesuchen informiert. 45% dachten außerdem, dass sie keine große Rolle beim Kampf gegen resistente Bakterien spielten.
Daran durch geeignete Public Health-Aktionen sowohl im Senegal als auch nn vielen vergleichbaren Regionen etwas zu ändern und im Sinne der dort lebenden Menschen auch bei uns, gehört dazu, wenn es um die Zusammenhänge von Globalisierung und Gesundheit geht.
Die Studie Assessment of General Public's Knowledge and Opinions towards Antibiotic Use and Bacterial Resistance: A Cross-Sectional Study in an Urban Setting, Rufisque, Senegal von Oumar Bassoum et al. ist im September 2018 in der Zeitschrift "Pharmacy" (6(4), 103) erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 20.2.19
Wie kann die Einkommenssituation von Pflegekräften verbessert werden? Ein ungewöhnliches Beispiel aus Kanada!
 Zu den prinzipiell von niemand mehr bestrittenen notwendigsten Verbesserungen der stationären Versorgung gehört eine deutliche Erhöhung der Anzahl von Pflegekräften. Zu den Voraussetzungen ohne die dieses Ziel kaum zu erreichen sein dürfte, gehört eine höhere Attraktivität oder Wertschätzung der pflegerischen Tätigkeit, was konkret u.a. eine höhere Bezahlung und eine Verbesserung der organisatorischen und sozialen Arbeitsbedingungen umfassen müsste.
Zu den prinzipiell von niemand mehr bestrittenen notwendigsten Verbesserungen der stationären Versorgung gehört eine deutliche Erhöhung der Anzahl von Pflegekräften. Zu den Voraussetzungen ohne die dieses Ziel kaum zu erreichen sein dürfte, gehört eine höhere Attraktivität oder Wertschätzung der pflegerischen Tätigkeit, was konkret u.a. eine höhere Bezahlung und eine Verbesserung der organisatorischen und sozialen Arbeitsbedingungen umfassen müsste.
Ohne dass dies als Patentrezept für die weitere Entwicklung im deutschen Krankenhauswesen oder anderen pflegerischen Bereichen verstanden werden soll, zeigt ein Blick auf eine seit dem 28. Februar 2018 im öffentlichen kanadischen Gesundheitssystem laufende ungewöhnliche Initiative zur Verbesserung der Einkommen von Pflegekräften zweierlei: Erstens sieht die Einkommenssituation von Pflegekräften auch in vergleichbaren Ländern im Vergleich mit dem anderer Gesundheitsbeschäftigten nicht gut aus und zweitens endet der dortige Einfallsreichtum nicht beim Appell an Gewerkschaften, Arbeitgeber und Politik.
Bisher 964 ÄrztInnen unterschrieben vor einem vergleichbaren Hintergrund relativ schlechter Bezahlung von Pflegekräften eine Erklärung, deren Kernaussagen so lauten:
• "Wir, Ärzte aus Québec, die an ein starkes öffentliches System glauben, wenden uns gegen die jüngsten Gehaltserhöhungen, die von unseren medizinischen Verbänden ausgehandelt wurden. Diese Erhöhungen sind umso schockierender, da unsere Krankenschwestern, Pfleger und andere Fachkräfte mit sehr schwierigen Arbeitsbedingungen konfrontiert sind, während unsere Patienten aufgrund der drastischen Kürzungen in den letzten Jahren und der Zentralisierung der Macht im Gesundheitsministerium mit einem fehlenden Zugang zu den erforderlichen Dienstleistungen leben müssen."
• "Nous, médecins québécois, demandons que les hausses salariales octroyées aux médecins soient annulées et que les ressources du système soient mieux distribuées pour le bien des travailleuses et travailleurs de la santé".
Der von der Ärztevereinigung "Médecins Québécois pour le Régime Public (MQRP)" erstellte Brief "Nous demandons l'annulation des hausses" ist komplett erhältlich.
Bernard Braun, 7.5.18
"Want a healthier population? Spend less on health care and more on social services" - in Kanada und anderswo
 Eigentlich ist das im Titel zugespitzte Ergebnis einer großen aktuellen Studie in Kanada über den Beitrag von medizinischer Versorgung und Sozialausgaben zur Gesundheit der Bevölkerung seit den Studien von Thomas McKeown (vgl. dazu als einen knappen Überblick zu den Positionen McKeown und ihre Debatte das komplett kostenlos erhältliche International Journal of Epidemiology, Volume 34, Issue 3, 1 June 2005), Michael Marmot (vgl. u.v.a. als Überblick den 2010 veröffentlichten 242-Seiten-Report The Marmot review final report: Fair society, healthy lives oder Richard Wilkinson (u.a. die WHO-Publikation Social determinants of health: the solid facts) ein sozialepidemiologisch "alter Hut".
Eigentlich ist das im Titel zugespitzte Ergebnis einer großen aktuellen Studie in Kanada über den Beitrag von medizinischer Versorgung und Sozialausgaben zur Gesundheit der Bevölkerung seit den Studien von Thomas McKeown (vgl. dazu als einen knappen Überblick zu den Positionen McKeown und ihre Debatte das komplett kostenlos erhältliche International Journal of Epidemiology, Volume 34, Issue 3, 1 June 2005), Michael Marmot (vgl. u.v.a. als Überblick den 2010 veröffentlichten 242-Seiten-Report The Marmot review final report: Fair society, healthy lives oder Richard Wilkinson (u.a. die WHO-Publikation Social determinants of health: the solid facts) ein sozialepidemiologisch "alter Hut".
Das Krankenversorgungssystem trägt danach nur mit deutlich unter 50% oder gar 30% zum gesundheitlichen Outcome entwickelter Gesellschaften bei. Da aber die geballte Macht der gesamten Gesundheitswirtschaft von niedergelassenen Ärzten über Kliniken und deren gesamtem Personal bis zu den Herstellern von gesundheitsbezogenen Produkten und Dienstleistungen diese Ergebnisse bewusst oder unbewusst ignoriert oder ganz simpel mit dem Hinweis auf individuelle Behandlungserfolge kranker Menschen das Gegenteil suggeriert und immer mehr "Geld ins System" zur Lösung gesundheitlicher Probleme als richtig propagiert, sind Replikationen auf aktueller empirischer Basis notwendig und hilfreich.
Die kanadische Studie ist eine retrospektive Längsschnittstudie über die Ausgaben für die traditionelle Gesundheitsversorgung und für soziale Maßnahmen für die BewohnerInnen von 9 der 10 kanadischen Provinzen über den Zeitraum von 1981 bis 2011. Als anerkannte abhängige Indikatoren für den gesundheitsbezogenen Outcome bzw. die Performanz von Gesundheitssystemen und der Bevölkerungsgesundheit wurden die potenziell vermeidbare Sterblichkeit (altersstandardisiert pro 100.000 EinwohnerInnen), die Kindersterblichkeit (pro 1.000 Lebendgeborene) und die Lebenserwartung zum Zeitpunkt der Geburt (in Jahren) untersucht.
Zu den zahlreichen nachdenkenswerten Ergebnissen (die differenzierten Berechnungen können in drei kostenlos erhältlichen zahlenmächtigen Anhängen im Detail nachvollzogen werden) der Vergleiche der Effekte beider Ausgabenarten gehört folgendes: Ein Anstieg der Sozialausgaben ist mit einer Abnahme der vermeidbaren Sterblichkeit um 0,034% und einer Zunahme der Lebenserwartung um 0,006% verbunden. Steigen die Gesundheitsausgaben um 1% steigt (!) die vermeidbare Sterblichkeit um 0,064% und gibt es keinen Effekt bei der Lebenserwartung.
Trotz einiger selbst referierten Einschränkungen zu der Möglichkeit kausaler Aussagen auf der Basis der benutzten Daten ("reverse causality" ist aber ausgeschlossen) und zur Verallgemeinerbarkeit für ein gesamtes Land halten die AutorInnen zweierlei fest:
• "Our sensitivity analysis … showed that social spending is associated with improvements in the population health variables, evidence of the notion that further spending on health may not improve population health outcomes as effectively as social spending. If social spending addresses the social determinants of health, then it is a form of preventive health spending and changes the risk distribution for the entire population rather than treating those who present with disease."
• Und die politische Empfehlung lautet daher konsequent: "Redirecting resources from health to social services, at the margin, is an efficient way to improve health outcomes." Was dies bedeutet zeigen die Angaben zu den jährlichen Prokopfausgaben von 930 CA-Dollar für soziale Leistungen und 2.900 CA-Dollar für Gesundheitsausgaben im Jahr 2011. Die Gesundheitsausgaben hatten im Untersuchungszeitraum zehnmal mehr zugenommen wie die Sozialausgaben.
Ob die Ergebnisse dieser Studie zumindest in Kanada die Prioritätensetzung bei öffentlichen Leistungen zur Verbesserung der Bevölkerungsgesundheit beeinflussen bleibt abzuwarten. In Deutschland ist dagegen der Lärm von Kassenärztlicher Bundesvereinigung oder Deutscher Krankenhausgesellschaft nach "mehr Geld ins System" oder Aufhebung der Budgetierung bestimmter ambulanter Leistungen dominant, gab die Gesetzliche Krankenversicherung im letzten Jahr noch nicht mal alle gesetzlich vorgeschriebenen Euros für Verhältnis/Setting-Prävention aus (1,63 Euro pro Versicherten statt der vorgeschriebenen 2 Euro) und sind viele Kommunen nicht (mehr) in der Lage den Status quo ihrer Sozialausgaben zu halten, geschweige denn ihn kräftig auszubauen.
Und wenn man ganz böse werden will, stehen in der GKV den knapp 500 Millionen Euro für Prävention (laut Präventionsbericht 2017) die rund 700 Millionen Euro gegenüber, welche die GKV in diesem Jahr für die scheinbar never-ending "Vorbereitung" der digitalen Infrastruktur für die elektronische Gesundheitskarte bezahlt.
Der Aufsatz Effect of provincial spending on social services and health care on health outcomes in Canada: an observational longitudinal study von Daniel J. Dutton, Pierre-Gerlier Forest, Ronald D. Kneebone und Jennifer D. Zwicker ist in der anerkannten Fachzeitschrift "Canadian Medical Association Journal (CMAJ)" vom 22. Januar 2018 erschienen (Volume 190, Issue 3: E66-E71) und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 23.1.18
Verlässlichkeit und Nutzen der Antwort auf die Frage nach dem selbst wahrgenommenen Gesundheitszustand erneut bestätigt
 Bereits eine Reihe von methodisch hochwertigen Studien in den 2000-Nuller-Jahren hatten belegt, dass der mit einer Frage mit 5 Antwortmöglichkeiten erhobene subjektiv wahrgenommene Gesundheitszustand ein einfach einsetzbarer, valider und reliabler Indikator oder Prädiktor für die aktuelle wie künftige gesundheitliche Situation ganzer Bevölkerung oder einzelner "Risikogruppen" ist (siehe dazu den 2009 verfassten Überblick Selbsteinschätzung des Gesundheitszustands: Studien bestätigen wieder einmal die Zuverlässigkeit dieses Indikators). Kritisiert wurde an diesem Indikator, dass er überwiegend in Ländern mit höherem oder hohem Einkommen getestet wurde, d.h. nicht für Ländern mit niedrigem oder mittlerem Einkommen tauglich ist.
Bereits eine Reihe von methodisch hochwertigen Studien in den 2000-Nuller-Jahren hatten belegt, dass der mit einer Frage mit 5 Antwortmöglichkeiten erhobene subjektiv wahrgenommene Gesundheitszustand ein einfach einsetzbarer, valider und reliabler Indikator oder Prädiktor für die aktuelle wie künftige gesundheitliche Situation ganzer Bevölkerung oder einzelner "Risikogruppen" ist (siehe dazu den 2009 verfassten Überblick Selbsteinschätzung des Gesundheitszustands: Studien bestätigen wieder einmal die Zuverlässigkeit dieses Indikators). Kritisiert wurde an diesem Indikator, dass er überwiegend in Ländern mit höherem oder hohem Einkommen getestet wurde, d.h. nicht für Ländern mit niedrigem oder mittlerem Einkommen tauglich ist.
Ein Bündel von bevölkerungsbezogenen Kohortenstudien mit 16.940 TeilnehmerInnen im Alter von 65 Jahren und mehr in China, India, Cuba, Dominican Republic, Peru, Venezuela, Mexico und Puerto Rico, die im Jahre 2003 stattfanden, kam nach Berücksichtigung der sozio-demografischen Charakteristika der UntersuchungsteilnehmerInnen, deren Nutzung von Gesundheitsleistungen und verschiedenen Gesundheitsfaktoren auch für die genannten Länder zu folgenden Ergebnissen:
— Die Prävalenz eines mit dieser Frage gemessenen guten Gesundheitszustands (die Frage lautete "'how do you rate your overall health in the past 30 days' mit den Antwortmögkichkeiten von excellent bis poor) war in städtischen Gebieten höher als in ländlichen - ausgenommen in China.
— Männer wiesen einen besseren Gesundheitszustand auf als Frauen.
— Depressionen hatten in allen Ländern und unter allen Umständen die größte negative Wirkung auf den selbst erworbenen Gesundheitszustand.
— Unadjustiert zeigten Personen mit einem selbst wahrgenommenen schlechten Gesundheitszustand innerhalb der 4 Jahre nach Befragung eine Zunahme des Sterberisikos um 142% - verglichen mit den Personen, die ihren Gesundheitszustand als moderat bewerteten. Selbst nach Adjustierung mit eine Reihe von Faktoren und Bedingungen war das Sterberisiko im o.g. Vergleich um 43% höher.
Die Frage nach dem selbst wahrgenommenen Gesundheitszustand ist also auch in Ländern mit geringem oder mittlerem Einkommen ein einfaches und verlässliches Instrument um besonders bedürftige Gruppen zu identifizieren und in Ländern mit geringen Evaluationsressourcen Gesundheitsinterventionen evaluieren zu können.
Die Studie Self-rated health and its association with mortality in older adults in China, India and Latin America—a 10/66 Dementia Research Group study von Hanna Falk, Ingmar Skoog, Lena Johansson, Maëlenn Guerchet, Ingmar Skoog ist am 1. November 2017 online in der Fachzeitschrift "Age and Ageing" (Volume 46, Issue 6, Seite 932-939) erschienen. Das Abstract ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 23.11.17
Wie viel Erkrankte und Tote kostete die Reduktion eines Anti-Malariaprogramms der US-Regierung um 44%?
 Bei vielen Gesundheitsprojekten ist weder bei ihrer Entwicklung und Implementation noch dann, wenn sie vor allem durch Mittelkürzungen abgebaut werden, klar, welche konkreten gesundheitlichen Auswirkungen damit zu erwarten sind.
Bei vielen Gesundheitsprojekten ist weder bei ihrer Entwicklung und Implementation noch dann, wenn sie vor allem durch Mittelkürzungen abgebaut werden, klar, welche konkreten gesundheitlichen Auswirkungen damit zu erwarten sind.
Für einen aktuellen Fall wurden die wahrscheinlichen Effekte auf die Erkrankungshäufigkeit und die Sterblichkeit in einer Modellberechnung im Department of Infectious Disease Epidemiology im Imperial College London ermittelt. Es geht um die für 2018 in der Haushaltsplanung des US-Kongress vorgeschlagene Reduktion des Budgets der so genannten "President's Malaria Initiative (PMI)" um 44%, d.h. von etwas über 700 Millionen im Jahr 2017 auf 424 Millionen US-Dollar. Das PMI existiert seit 2005, wurde also noch während der Präsidentschaft von Georg W. Bush gestartet, unterstützt Anti-Malariaprogramme in 19 afrikanischen Ländern und ist der größte bilaterale Förderer von Programmen zur Prävention und Behandlung von Malaria als einer der häufigsten schweren Krankheiten in der Dritten Welt.
Als erstes berechneten die britischen WissenschaftlerInnen, welchen positiven Nutzen der Weiterbestand des PMI auf dem bisherigen Niveau zwischen 2017 und 2020 hätte. Gegenüber dem völligen Fehlen dieses Programms könnten 162.000.000 Malaria-Erkrankungsfälle abgewendet und 692.589 Leben gerettet werden.
Die 44%-Reduktion führte im Vergleich zum Weiterbestand des bisherigen Programmvolumen im selben Zeitraum zu zurückhaltend geschätzten 67.000.000 zusätzlichen Malariafällen und zu 290.649 zusätzlichen Todesfällen.
Die Fortschritte von 15 Jahren, die selbst aus der Sicht von Ökonomen äußerst kosteneffektives erreicht werden konnten, wären nach Ansicht der AutorInnen mit der Reduktion in wenigen Jahren verschwunden. Anwachsen könnte aber dadurch die Anzahl afrikanischer BürgerInnen, die versuchen u.a. diesen Risiken durch die Flucht in Richtung Europa zu entkommen.
Die Ergebnisse der Studie The US President's Malaria Initiative, Plasmodium falciparum transmission and mortality: A modelling study. von Peter Winskill, Hannah C. Slater, Jamie T. Griffin, Azra C. Ghani, Patrick G. T. Walker sind in der Zeitschrift "PLOS Medicine" (2017; 14 (11)) erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 23.11.17
Wie Massenmedien die Wahrnehmung von Erkrankten verzerren und spezifische Behandlungsangebote behindern - Beispiel Krebs in Irland
 Die Berichterstattung von Massenmedien spielt für die Wahrnehmung von Krankheiten, ja sogar teilweise bei ihrer "Entstehung" (so wurde der Anstieg von Patienten, welche wegen der Symptome der Krankheiten über die am Tag zuvor in dem in den 1960er bis 1980er Jahren populären ZDF-Gesundheitsmagazin Praxis berichtet wurde, nach dem Moderator "Morbus Mohl" genannt) und die Vorstellung von der Art von Erkrankungen und Erkrankten in der Öffentlichkeit eine große Rolle.
Die Berichterstattung von Massenmedien spielt für die Wahrnehmung von Krankheiten, ja sogar teilweise bei ihrer "Entstehung" (so wurde der Anstieg von Patienten, welche wegen der Symptome der Krankheiten über die am Tag zuvor in dem in den 1960er bis 1980er Jahren populären ZDF-Gesundheitsmagazin Praxis berichtet wurde, nach dem Moderator "Morbus Mohl" genannt) und die Vorstellung von der Art von Erkrankungen und Erkrankten in der Öffentlichkeit eine große Rolle.
Dass dies auch zu gravierenden Fehlwahrnehmungen führen kann, zeigt jetzt exemplarisch eine kleine Studie in Irland.
Es geht dabei um die auch in Irland häufigen und zunehmenden Krebserkrankungen. 70% der an Krebs erkrankten Personen sind 65 Jahre und älter. Trotz der damit verbundenen altersspezifischen Versorgungsbedürfnisse mangelt es auf der grünen Insel an speziellen geronto-onkologischen Versorgungsangeboten.
Zwei irische Gesundheitswissenschaftlern vermuteten, dass dies mit der dominanten Medienberichterstattung über Krebs als Erkrankung junger Menschen zusammenhängen könnte.
Um diese Hypothese zu überprüfen analysierten die Wissenschaftler die Berichterstattung zweier großer irischer Printmedien über Krebserkrankungen und -erkrankte im Zeitraum zwischen dem 1. Oktober 2014 und Oktober 2015.
Die Ergebnisse sehen so aus:
• In den insgesamt 167 gefundenen Artikeln gibt es Darstellung von an Krebs erkrankten Personen. Davon spezifizierten 48 das Alter der Patienten.
• Das durchschnittliche Alter der Erkrankten war 44,74 Jahre und das durchschnittliche Alter bei der Diagnose 39,87 Jahre.
• Vergleicht man dies mit dem in der Gesamtheit der Erkrankten bei durchschnittlich 67 Jahren liegenden Alter bei der Diagnose einer Krebserkrankung, sind die Erkrankten über die in den untersuchten Zeitungen berichtet wurde rund 27 Jahre jünger.
Wenn es eine Wirkung medialer Berichterstattung auf die Perzeption von Erkrankungen und Erkrankten gibt, könnte also der Mangel an speziellen geronto-onkologischen Leistungen zumindest teilweise auf dieser Art von verzerrter Darstellung (die Autoren sprechen sogar von "ageism") beruhen.
Ob es solche medialen Verzerrungen mit möglichen Folgen für die Thematisierung von Krankheiten und von spezifischen Angeboten auch z.B. in Deutschland gibt, könnte relativ leicht untersucht werden. Solche Untersuchungen könnten neben dem Merkmal Alter natürlich auch noch andere Inhalte der Berichterstattung miteinbeziehen. So gibt es z.B. Hinweise, dass die künftige Entwicklung der Inzidenz und Prävalenz von Erkrankungen in Massenmedien (aber nicht nur dort) eher übertrieben dargestellt und die Rolle möglicher sozialer Einflüsse eher untertrieben oder gar nicht dargestellt wird.
Der Kurzbericht MISSING IN THE MEDIA: CANCER AND OLDER PEOPLE von A Fallon und D O'Neill ist am 16. Mai 2017 in der Zeitschrift "Age Ageing (46 (suppl_1): i1-i22) erschienen.
Bernard Braun, 21.5.17
Universelle Absicherung im Krankheitsfall - eine weltweite Herausforderung
 Eine wirksame und tatsächlich hilfreiche Absicherung gegen die finanziellen und ökonomischen Risiken von Krankheit gehört keineswegs zu den Selbstverständlichkeiten auf der globalisierten Welt. Neben vielen anderen Entbehrungen und Notlagen wie Armut, fehlenden Arbeits- und Verdienstmöglichkeiten und mangelnden Chancen auf ein besseres Leben treiben auch inexistente oder unterentwickelte soziale Sicherungssysteme immer mehr Menschen in die Flucht, die wohlstandsgewöhnte EuropäerInnen allzu leichtfertig als "Wirtschaftsflüchtlinge" abqualifizieren, so als wäre unausweichliches Elend nicht Grund genug, zu neuen Ufern aufzubrechen. Angesichts der privilegierten Reisemöglichkeiten gerade von MitteleuropäerInnen und des massenhaften Vertriebs von Produkten aus den Weltmarktfabriken in den armen Ländern des Südens besteht ein in der globalisierten Informationsgesellschaft ein oftmals erstaunliches Unwissen über die realen Lebensbedingungen in der Welt. Den Teilaspekt der sozialen Absicherung im Krankheitsfall beleuchtete Ende 2014 und Anfang 2015 eine dreiteilige Serie in der AOK-Zeitschrift Gesundheit und Gesellschaft des AOK-Bundesverbands. Der kompart-Verlag hat nun die Beiträge der beiden Entwicklungs- und Gesundheitsexperten Jens Holst und Jean-Olivier Schmidt in aktualisierter Fassung in einem Sonderdruck erneut aufgelegt.
Eine wirksame und tatsächlich hilfreiche Absicherung gegen die finanziellen und ökonomischen Risiken von Krankheit gehört keineswegs zu den Selbstverständlichkeiten auf der globalisierten Welt. Neben vielen anderen Entbehrungen und Notlagen wie Armut, fehlenden Arbeits- und Verdienstmöglichkeiten und mangelnden Chancen auf ein besseres Leben treiben auch inexistente oder unterentwickelte soziale Sicherungssysteme immer mehr Menschen in die Flucht, die wohlstandsgewöhnte EuropäerInnen allzu leichtfertig als "Wirtschaftsflüchtlinge" abqualifizieren, so als wäre unausweichliches Elend nicht Grund genug, zu neuen Ufern aufzubrechen. Angesichts der privilegierten Reisemöglichkeiten gerade von MitteleuropäerInnen und des massenhaften Vertriebs von Produkten aus den Weltmarktfabriken in den armen Ländern des Südens besteht ein in der globalisierten Informationsgesellschaft ein oftmals erstaunliches Unwissen über die realen Lebensbedingungen in der Welt. Den Teilaspekt der sozialen Absicherung im Krankheitsfall beleuchtete Ende 2014 und Anfang 2015 eine dreiteilige Serie in der AOK-Zeitschrift Gesundheit und Gesellschaft des AOK-Bundesverbands. Der kompart-Verlag hat nun die Beiträge der beiden Entwicklungs- und Gesundheitsexperten Jens Holst und Jean-Olivier Schmidt in aktualisierter Fassung in einem Sonderdruck erneut aufgelegt.
Spätestens seit Erscheinen des Weltgesundheitsberichts 2010: Health systems financing: the path to universal coverage steht zumindest in der entwicklungsbezogenen gesundheitspolitischen Szene das Thema der universellen Absicherung im Krankheitsfall weit oben auf der Agenda. Auch das Forum Gesundheitspolitik hat diese Thematik mehrfach aufgegriffen, so in den Beiträgen zum Weltgesundheitsbericht 2010 und zum Weltgesundheitsbericht 2013, der Kritik WHO-Einsatz für universelle Sicherung abgeschwächt sowie in dem Artikel Globale Soziale Sicherung: So utopisch wie unverzichtbar.
Nun haben der Leiter des Kompetenzcenters Gesundheit und Soziale Sicherung der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, Jean-Olivier Schmidt, und der gesundheits- und entwicklungspolitische Berater sowie Vertretungsprofessor an der Hochschule Fulda, Jens Holst, eine schlaglichtartige Übersicht über weltweite Bestrebungen nach Auf- und Ausbau sozialer Sicherungssysteme vorgelegt. Die journalistisch geschriebene, kenntnisreiche Abhandlung beschreibt aktuelle Entwicklungen in ausgewählten Ländern Asiens, Afrikas und Lateinamerikas. Mehrere Interviews mit Gesundheits- und EntwicklungspolitikerInnen ergänzen die Berichte. Die Länderbeispiele stehen stellvertretend und exemplarisch für die gängigen sozial- bzw. gesundheitspolitischen Ansätze in Entwicklungs- und Schwellenländern. Riesenländer wie Indien und China, aber auch viele andere Staaten in Asien, Afrika und Lateinamerika wollen mit dem Ausbau der Sozialsysteme die Gesundheit ihrer Bevölkerung verbessern und zugleich die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung vorantreiben.
Das erste Kapitel mit dem Titel Medizin gegen Armut widmet sich den gesundheits- und sozialpolitischen Ansätzen in verschiedenen asiatischen Ländern und beleuchtet dabei nicht nur die höchst unterschiedlichen Ansätze der beiden Riesenländer China und Indien, sondern auch verschiedene Strategien mittelgroßer Länder wie Philippinen und Vietnam. Dabei wird klar, dass soziale Absicherung im Krankheitsfall grundlegende Bedeutung für die Überwindung der geringen Lebenserwartung und letztlich auch der Armut ist und die Länder diese Ziele mit unterschiedlicher Konsequenz verfolgen. Das Fazit der Autoren spricht für sich: "Solidarische Finanzierung ist unverzichtbar. So verschieden die Länder in Asien sind, so zeigen die Erfahrungen der vergangenen fünfzehn Jahre doch in eindrucksvoller Weise, wie sie den wirtschaftlichen Aufschwung nutzen, um wachsenden Ungleichheiten mit sozialpolitischen Maßnahmen zu begegnen. Mit Gesundheit können sich Politiker im Wahlkampf gut profilieren. Bei allen Unterschieden in Kultur und Gesellschaft scheint Einigkeit darin zu bestehen, dass solidarische Finanzierung und Risikoverteilung für Gesundheitssysteme unverzichtbar sind. Die größten Herausforderungen bilden im Moment die Einbeziehung des riesigen informellen Sektors und die Regulierung privater Anbieter. Gerade beim letzten Punkt könnten die Länder auch von deutschen Erfahrungen profitieren."
Das zweite Kapitel des Dreiteilers widmet sich dem afrikanischen Kontinent, beschränkt sich aber de facto auf das Afrika südliche der Sahara. Obwohl vor allem Tunesien, aber auch Marokko und andere nordafrikanische Länder sozialpolitische Erfolge vorzuweisen haben, richten die beiden Autoren das Augenmerk auf die Länder Südafrika, Ruanda, Ghana und Kenia. Das reichste Land im südlichen Afrika ist auch im Gesundheitswesen bis heute durch schroffe soziale Unterschiede gekennzeichnet, die allen Bemühungen um universelle Sicherungssysteme erhebliche Hürden in den Weg stellen. Ghana und Ruanda haben beide die Einführung von Kleinstversicherungen zum Ausgangspunkt für umfangreichere soziale Sicherungsstrukturen gemacht, wobei das ruandische System deutliche autoritärer funktioniert als das ghanaische, dafür aber mittlerweile einen größeren Bevölkerungsanteil einbezieht. In Kenia hingegen, dem Land mit der ältesten sozialen Krankenversicherung im südlichen Afrika, mahlen die Mühlen langsam, möglicherweise zu langsam, um mit der wirtschaftlichen Dynamik Schritt zu halten.
Entgegen aller gängigen eurozentristischen Skepsis beschließen die Autoren den Afrika-Teil mit einem eher zuversichtlichen Fazit: "Der enormen Krankheitslast zum Trotz, die auf dem afrikanischen Kontinent liegt, lässt die jüngere Entwicklung afrikanischer Gesundheitssysteme Hoffnung aufkeimen. Auch wenn manche Länder wie Kenia oder auch Tansania eher im Status quo verharren, sind andernorts deutliche Fortschritte erkennbar. Immer mehr Staaten südlich der Sahara leiten grundlegende Reformen ihrer Systeme ein und steigern ihre Gesundheitsausgaben. ... Entscheidend sind politischer Wille und gute Regierungsführung. Die Lage verbessert sich nur, wenn die Menschen Zugang zu und Anspruch auf gute Versorgung haben. Immer mehr Regierungen in Afrika nehmen diese Aufgabe ernst und investieren in die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung."
Innerhalb des Trikont spielt Lateinamerika zweifelsohne eine besondere Rolle, wenngleich die asiatischen Tiger inzwischen erheblich aufgeholt haben. Aber die Ländern in Mittel- und Südamerika hatten anderthalb Jahrhunderte mehr Zeit, sich als selbständige Nationen von den Folgen der Kolonialherrschaft zu befreien als die in Afrika oder Südostasien. Viele Nationen der einstigen spanischen und portugiesischen Weltreiche blicken mittlerweile auf eine lange Geschichte sozialer Sicherung zurück, allen voran Chile, das erste lateinamerikanische Land mit einem umfassenden sozialen Sicherungssystem, das später als Pionier neoliberaler Reformen von sich reden machte. Mexiko war stark vom deutschen System beeinflusst und steht heute für ein Land, das universelle Sicherung über parallele Versicherungssysteme anstrebt. Kolumbien folgte zunächst Chile, wendet sich nun aber wieder von marktorientierten Ansätzen in der Sozialpolitik ab. Und Brasilien wählte inmitten der Blütezeit des Neoliberalismus den Weg der staatlichen Absicherung und des verfassungsmäßigen Rechts auf Gesundheit. Die sozialpolitische Landschaft in Lateinamerika veranlasste die Autoren zu einer interessanten Schlussfolgerung: "Zweifelsohne können lateinamerikanische Sozialsysteme bis heute einiges von der langen Erfahrung europäischer Institutionen lernen. Mittlerweile haben die einstigen europäischen Kolonien aber selber bemerkenswerte gesundheitspolitische Erfahrungen und Erfolge vorzuweisen. Die Zunahme unsteter und prekärer Arbeitsverhältnisse in Europa erfordert auch hierzulande neue sozialpolitische Strategien. Lateinamerika hat auf diesem Gebiet viel zu bieten - internationale Zusammenarbeit muss keine Einbahnstraße sein."
Der lesenswerte Dreiteiler von Jens Holst und Jean-Olivier Schmidt steht sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache kostenfrei zum Download zur Verfügung:
Deutsche Fassung: Was macht die Welt gesund-Gesundheit global
English version: What makes the world healthy - global health.
Bernard Braun, 24.3.16
Zusammenhänge zwischen Gesundheitsreformen, Sterblichkeit und Nutzung des Gesundheitssystems: Zwischen Wunsch- und Alptraum
 Offen oder zumindest insgeheim haben Gesundheitspolitiker den Wunschtraum, sie könnten durch Gesundheitsreformen "die Gesundheit der Bevölkerung" verbessern, und zwar bis hin zur Verlängerung der Lebenserwartung.
Offen oder zumindest insgeheim haben Gesundheitspolitiker den Wunschtraum, sie könnten durch Gesundheitsreformen "die Gesundheit der Bevölkerung" verbessern, und zwar bis hin zur Verlängerung der Lebenserwartung.
Dabei spielt natürlich auch der Vergleich entsprechender Indikatoren, also z.B. der Mortalität, zwischen ansonsten vergleichbar entwickelten Ländern eine große Rolle.
In diesem Wettbewerb sah es in den 1980er und 1990er Jahren bei der Sterblichkeit so aus, dass sie den meisten Industrieländern zurückging, nur nicht in den Niederlanden, wo sie stagnierte und in einigen Bevölkerungsgruppen sogar anstieg. Dies änderte sich schlagartig ab dem Jahr 2002 und insbesondere bei den niederländischen 65+-BürgerInnen. Nicht nur Gesundheitspolitiker führten diese Verlängerung der Lebenserwartung in den Niederlanden auf die umfassenden Gesundheitsreformen und die dadurch bedingte bessere Gesundheitsversorgung zu Beginn der Nullerjahre zurück.
Ob dies stimmt bzw. stimmen kann, untersuchte jetzt eine Gruppe von niederländischen Epidemiologen durch den Vergleich zahlreicher Befragungsdaten einer 7.691 Personen umfassenden Kohorte aus dem "Dutch Health interview survey" im Jahr 2001/2002 mit einer 8.362 umfassenden Koghorte, die im Jahr 2007/08 befragt wurde. Diese Daten wurden durch eine Reihe von Daten aus Routinedatenregistern zur Mortalität, zu Arzneimittelverordnungen und Arztbesuchen ergänzt. Bei sämtlichen Analysen wurden mögliche Unterschiede des Gesundheitszustandes, der Risikofaktoren, verschiedener Verhaltensweisen, Übergewicht und soziodemografische Faktoren zwischen den beiden Kohorten adjustiert.
Die Ergebnisse können trotzdem paradoxer nicht sein:
• Wunschtraummäßig ging die Sterblichkeit zwischen den beiden Kohorten um 15% zurück. Die größte Reduktion fand in der Gruppe der am schwersten erkrankten Menschen (mit mindestens einer tödlichen und einer nicht-tödlichen Krankheit) statt. Der Rückgang betrug dort 58%.
• Angesichts der umfangreichen Adjustierungen kommen die Wissenschaftler zu dem Schluss, dass der Rückgang "cannot be expolained by chganges in sociodemographic characteristics, behavioural risk factors or changes in health status".
• Alptraummäßig mutet aber dann ein weiteres Ergebnis an: Es gibt zum einen keinen Zusammenhang zwischen der niedrigeren Sterberate und einer verstärkten Nutzung von Gesundheitsleistungen. Zum anderen aber erhöhte sich sogar das Sterberisiko mit einer intensiveren bzw. häufigeren Nutzung von Gesundheitsversorgungsleistungen.
Den Schluss, unreformierte oder reformierte Angebote des Gesundheitssystems könnten mehr schaden als nutzen, verneinen die Forscher zwar, und hoffen in weiteren Untersuchungen Störfaktoren oder bisher ungenaue Angaben zur Versorgung identifizieren und deren Einfluss reduzieren zu können.
So richtig gut schlafen können aber aufmerksame Gesundheitspolitiker bis dahin wohl auch nicht!?
Näheres über die Studie erfährt man zum einen in dem von Frederik Peters, einem Koautor der Studie, verfassten kurzen Artikel Längeres Leben dank Gesundheitsreform? Zusammenhang zwischen höheren Gesundheitsausgaben und Rückgang der Sterblichkeit in den Niederlanden in der aktuellen Ausgabe (Nr. 2, 2015) des immer lesenswerten Newsletter "Demografische Forschung. Aus erster Hand" des Rostocker Max-Planck-Instituts für demografische Forschung. Der Aufsatz wie Newsletter sind kostenlos erhältlich.
Der Aufsatz A closer look at the role of healthcare in the recent mortality decline in the Netherlands: results of a record linkage study von Peters F, Nusselder WJ und Mackenbach JP. Ist in der Fachzeitschrift "J Epidemiol Community Health" (2015; 69 (6): 536-542) erschienen. Leider ist nur das Abstract kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 30.6.15
"Und träumen vom Sommer in Schweden" aber auch vom dortigen Gesundheitssystem!?
 Während es sich "verschüttet im Regen" (so der aktuelle Song von Revolverheld) leicht vom schwedischen Sommer träumen lässt, benötigt man für die Beantwortung der Frage nach dem Gesundheitssystem in Schweden schon etwas mehr gesichertes Wissen.
Während es sich "verschüttet im Regen" (so der aktuelle Song von Revolverheld) leicht vom schwedischen Sommer träumen lässt, benötigt man für die Beantwortung der Frage nach dem Gesundheitssystem in Schweden schon etwas mehr gesichertes Wissen.
In kompakter Form liefert dies der am 1. Januar 2015 erschienene erste Aufsatz einer geplanten Serie über internationale Gesundheitssysteme des "New England Journal of Medicine (NEJM)" - in Zusammenarbeit mit dem liberalen US-Think Tank "Commonwealth Fund".
Auch 2015 wird die schwedische Gesundheitsreformpolitik zwar ähnlich wie bereits 1973 als "not very rational" charakterisiert, deren "strong commitment to equality in health care services" aber anerkennend als Rechtfertigung genannt. Wie der Titel des Aufsatzes andeutet, ist das schwedische Gesundheitssystem auch nuancierter als es seine Gleichheitsverpflichtung und seine öffentlich-staatliche Grundstruktur zunächst erwarten lassen. So gibt es z.B. einerseits seit 2007 eine Reprivatisierung des seit 1970 existierenden staatlichlichen Apothekenmonopols. Andererseits zeigen aber Studien, dass "the Swedish public wants choice but is more skeptical about profit incentives in tax-funded markets and about the payment of dividends by health care providers to owners". Letzteres verhindert auch faktisch eine weitere Verbreitung gewinnorientierter Akteure im schwedischen Gesundheitssystem.
Der Aufsatz enthält zusätzlich zur Darstellung des "Public-Private Pendulum" eine Auswahl wichtiger Indikatoren zur Struktur und zum Outcome des schwedischen Gesundheitssystems.
Der Aufsatz The Public-Private Pendulum — Patient Choice and Equity in Sweden von Anders Anell ist am 1. Januar 2015 im NEJM (372: 1-4) erschienen und kostenlos zugänglich.
Wer an vergleichbaren Informationen über weitere Gesundheitssysteme interessiert ist, sollte regelmäßig nach Beiträgen in der Rubrik "International Health Care Systems" des NEJM suchen.
Bernard Braun, 6.1.15
Kein "Schubs" aber ein "Stups": Der Nutzen von SMS-Erinnerungen an die Einnahme von Malariamedikamenten
 Trotz einiger wirksamer primärpräventiver Anstrengungen (z.B. Verteilung von Moskitonetzen und Trockenlegung von Sumpfgebieten) ist Malaria immer noch eine der weltweit größten Todesursachen. Die Schätzungen schwanken für 2010 zwischen 655.000 und 1,24 Millionen. Die Hälfte dieser Toten waren Kinder unter 5 Jahren. 92% der Malariatoten stammten aus der Sub-Sahara-Region Afrikas.
Trotz einiger wirksamer primärpräventiver Anstrengungen (z.B. Verteilung von Moskitonetzen und Trockenlegung von Sumpfgebieten) ist Malaria immer noch eine der weltweit größten Todesursachen. Die Schätzungen schwanken für 2010 zwischen 655.000 und 1,24 Millionen. Die Hälfte dieser Toten waren Kinder unter 5 Jahren. 92% der Malariatoten stammten aus der Sub-Sahara-Region Afrikas.
Speziell gegen den in dieser Region verbreiteten Erregertyp der Malaria gibt es ein wirksames Medikament bzw. eine Arzneimitteltherapie (Artemisin-basiert), die von der WHO mit wenigen Ausnahmen als "first-line treatment" empfohlen wird. Da dieser Erreger bereits gegen andere Medikamente Resistenzen entwickelt hat, stellt die Artemisinbehandlung im Moment aber auch eine "last-line"-Behandlungsmöglichkeit dar.
Um sowohl die Sterblichkeit unter den mit Malaria infizierten Personen zu verringern als auch zu verhindern, dass durch mangelnde Therapietreue, d.h. das vorzeitige Absetzen der Einnahme des Arzneimittels, auch hier Resistenzen entstehen können, kommt es vor allem darauf an, die Therapietreue zu verbessern.
In einer Interventionsstudie mit 1.140 TeilnehmerInnen in Ghana erhielten nun 277 bzw. 309 TeilnehmerInnen kurze ("Please take your MALARIA drugs!") bzw. längere ("Please take your MALARIA drugs! Even if you feel better, you must take all the tablets to kill all the malaria.") SMS-Texte mit denen sie an die Einnahme ihres Medikaments erinnert wurden. Diese SMS erhielten sie zusätzlich zu den von Ärzrten gegebenen Einnahmehinweisen in 12-Stunden-Abständen drei Tage lang. Die 538 TeilnehmerInnen in der Kontrollgruppe erhielten keine SMS-Erinnerungen. Sämtliche TeilnehmerInnen wurden aber auch noch über den primärpräventiven Nutzen von Mückennetzen informiert.
Die Ergebnisse unterschieden sich signifikant:
• Von den TeilnehmerInnen an der Kontrollgruppe nahmen 61,5% das ihnen verordnete Medikament vollständig ein.
• Die Wahrscheinlichkeit der Therapietreue wurde bei den 572 EmpfängerInnen der kurzen SMS um 45% erhöht (adjustierte OR 1,45, p=0,028). Eine längere SMS hatte keinen zusätzlichen signifikanten Nutzen.
• Nach Beendigung der Behandlung durchgeführte mündliche Interviews mit den TeilnehmerInnen ergaben allerdings, dass der Erhalt der SMS-Erinnerung sich nicht signifikant auf den Anteil der PatientInnen ausgewirkt hat, die weiter an Malariasymptomen litten. Dieser betrug rund 30%.
Angesichts der anhaltend hohen Anzahl von überwiegend vermeidbaren Malariatoten sollten trotz aller Begrenzungen (z.B. der Nichterreichbarkeit der ärmeren Bevölkerung per Mobilgeräten) und der bescheidenen Erfolge, die elektronischen Möglichkeiten, die Therapietreue zu verbessern, weiter genutzt und verbessert werden. Dies gilt in besonderem Maße für die zusätzliche Information der betreffenden Bevölkerungen über die Wirksamkeit von Moskitonetzen (mit oder ohne Einsatz von Insektiziden) und deren möglichst kostenlose Verteilung bei ärmeren Personen oder Familien. Ein kostenlos verteiltes Netz kostet insgesamt rund 4 Euro.
Hier wie bei der immer noch zögerlichen Unterstützung der westafrikanischen durch europäische oder nordamerikanische Länder bei der Bewältigung der Ebola-Epidemie stellt sich die Frage warum es keine rechtzeitige und entschiedenere internationale öffentliche Hilfe bei den "afrikanischen Krankheiten" gibt. Da Unkenntnis über die Ursachen, Mangel an bekannten präventiven und therapeutischen Interventionsmöglichkeiten und Unfinanzierbarkeit als Erklärungen ausscheiden, bleiben sehr unangenehme wie z.B. latente ethnische Geringschätzung übrig.
Der Aufsatz The Impact of Text Message Reminders on Adherence to Antimalarial Treatment in Northern Ghana: A Randomized Trial. von Raifman JRG, Lanthorn HE, Rokicki S und Fink G ist am 28. Oktober 2014 in der Zeitschrift "PLoS ONE" erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 29.10.14
Erster Evaluierungsbericht des DEval erschienen
 Obwohl Entwicklungshilfe bzw. Entwicklungs-zusammenarbeit seit je her in Deutschland und anderswo eine untergeordnete Rolle spielt, gerät auch sie unter zunehmenden Rechtfertigungszwang. Die wachsende Unterordnung des Politischen unter das Ökonomische macht auch vor komplexen sozialen, politischen und sozialpolitischen Wirklichkeit nicht Halt. Ganz im Sinne des weltweit um sich greifenden Neo-Neo-Positivismus hat das deutsche Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung im November 2012 das Deutsche Institut für Entwicklungsevaluierung ins Leben gerufen, auf dessen Homepage es heißt: "Übergeordnetes Ziel des Deutschen Evaluierungsinstituts der Entwicklungszusammenarbeit (DEval) ist die unabhängige Beurteilung des Erfolges von Maßnahmen der deutschen Entwicklungszusammenarbeit." Der Nachweiszwang für ihre Wirksamkeit hat nun auch die deutsche Entwicklungszusammenarbeit erfasst: "Durch seine unabhängige und externe Gesamtsicht hilft das Institut, Methoden und Standards von Evaluierungen aufzuarbeiten und damit die Qualität von Erfolgsbewertungen zu erhöhen."
Obwohl Entwicklungshilfe bzw. Entwicklungs-zusammenarbeit seit je her in Deutschland und anderswo eine untergeordnete Rolle spielt, gerät auch sie unter zunehmenden Rechtfertigungszwang. Die wachsende Unterordnung des Politischen unter das Ökonomische macht auch vor komplexen sozialen, politischen und sozialpolitischen Wirklichkeit nicht Halt. Ganz im Sinne des weltweit um sich greifenden Neo-Neo-Positivismus hat das deutsche Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung im November 2012 das Deutsche Institut für Entwicklungsevaluierung ins Leben gerufen, auf dessen Homepage es heißt: "Übergeordnetes Ziel des Deutschen Evaluierungsinstituts der Entwicklungszusammenarbeit (DEval) ist die unabhängige Beurteilung des Erfolges von Maßnahmen der deutschen Entwicklungszusammenarbeit." Der Nachweiszwang für ihre Wirksamkeit hat nun auch die deutsche Entwicklungszusammenarbeit erfasst: "Durch seine unabhängige und externe Gesamtsicht hilft das Institut, Methoden und Standards von Evaluierungen aufzuarbeiten und damit die Qualität von Erfolgsbewertungen zu erhöhen."
Die Evaluierung der eigenen Politik im Auftrag der Bundesregierung hebt sich allerdings in interessanter Weise von gängigen Bewertungsansätzen anderer Länder ab, die einfache Gleichungen aus dem eigenen finanziellen Input und veränderten Zielgesundheitsparametern als Beleg für Erfolg anführen. Oder weiterhin vorrangig ökonometrische Wirkungsforschung betreiben. Befördert durch die Fokussierung der internationalen Staatengemeinschaft auf die Millenium Development Goals und teils massive Kapitalspritzen wurde dies zu einem neuen Schwerpunkt in der internationalen Entwicklungsforschung. Die interessante Literaturrecherche The aid effectiveness literature: The sad results of 40 years of research des australisch-dänischen Forscherteams Hristos Douzouliagos und Martin Paldam analysierte bereits im Jahr 2005 rund 100 empirische Studien über die Wirksamkeit der Entwicklungszusammenarbeit und ihre Auswirkungen auf verschiedenen Ebenen der Entwicklung. Das Ergebnis dieser Meta‐Analyse war ernüchternd und zeigte, dass die empirische Evidenz für positive Wirkung der EZ noch höchst brüchig ist. So schlussfolgern Hristos Douzouliagos und Martin Paldam (2005) aus ihrer Metaanalyse zur Frage der Aid Effectiveness Literature (AEL): "We have demonstrated that the AEL has not managed to show that there is a significantly positive effect of aid. Consequently, if there is an effect, it must be small. Development aid is consequently an activity that has proved difficult to do right. When something is difficult, it is of paramount importance that it is transparent, i.e., that it is done by simple, clear and easily controllable rules" (S. 27).
Nun hat das Deutsche Evaluierungsinstitut der Entwicklungszusammenarbeit den Bericht zu seinem ersten Evaluierungsunterfangen vorgelegt. Zwei Jahre dauerte das anspruchsvolle Unterfangen, bei dem sich das DEval der Bewertung von nicht weniger als 30 Jahren ruandisch-deutscher Zusammenarbeit widmet. Dabei verfolgte es einen komplexen, vornehmlich qualitativen Ansatz, der die jeweiligen politischen und sozialen Bedingungen berücksichtigt. Die Analyse bzw. die Studie ist in drei Zeiträume unterteilt, um damit sowohl der phasenweise dramatischen historischen Entwicklung in Ruanda als auch veränderten Schwerpunkten der deutschen Entwicklungshilfe bzw. -zusammenarbeit Rechnung zu zollen. Die erste Phase von 1980 bis 1994 war durch den Einsatz von ÄrztInnen und Pflegekräften als EntwicklungshelferInnen gekennzeichnet und lässt keine nachhaltige Wirkung erkennen, die den Genozid am Ende dieser Periode überlebt hätte. Die zweite Phase 1995-2003 begann eher mit Nothilfe zum Wiederaufbau der weitgehend zerstörten Infrastruktur des Gesundheitswesens, ging aber ab 2000 in die Unterstützung einer grundlegenderen Entwicklungsstrategie des ostafrikanischen Landes über; hier kommt die Evaluierung zu dem Ergebnis, dass die deutsche Entwicklungszusammenarbeit einen wichtigen Beitrag zur Bereitstellung grundlegender Gesundheitsdienste auf lokaler Ebene und zur Qualifikation des Personals leistete. In der letzten Phase 2004-2012, mit der die deutsch-ruandische Zusammenarbeit im Gesundheitsbereich auf Wunsch der ruandischen Regierung zu Ende ging, stand ganz im Zeichen deren wachsenden Engagements im Sozialbereich, einer verbesserten Koordinierung der EntwicklungspartnerInnen sowie der Millenium-Entwicklungsziele. Dabei erwiesen sich die verschiedenen Ansätze der deutschen Entwicklungszusammenarbeit als unterschiedlich wirksam und nachhaltig:
• Die auch von Deutschland unterstützte Budgetfinanzierung, die auf Eigenverantwortung der ruandischen PartnerInnen setzt, durchlebte mehrere Engpässe und ist durch die zunehmende Kooperation der vornehmlich in ganz eigenen Interesse aktiven USA mit Ruanda in seiner Nachhaltigkeit bedroht
• im Bereich der Gesundheitsfinanzierung spielte die technische Unterstützung der deutschen Entwicklungszusammenarbeit eine wichtige Rolle beim erfolgreichen Aufbau anfänglich gemeindebasierter und mittlerweile durch die öffentliche Hand organisierter Krankenversicherung, die mittlerweile die Bevölkerungsmehrheit erfasst haben
• die Ansätze zur Verbesserung der sexuellen und reproduktiven Gesundheit reichte von der Unterstützung der Familienplanungsstrategie über die Bereitstellung erforderlicher Gesundheitsleistungen bis zu peer education, was nach Einschätzung der EvaluiererInnen zur Verbesserung der Zielindikatoren beigetragen hat.
Neben diesen konkreten Befunden bewertet der DEval-Bericht auch gängige indirekte Parameter der Entwicklungszusammenarbeit, die das Direktorat für Entwicklungszusammenarbeit der Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) unter den Begriffen Relevanz, Effektivität, Effizienz, Impact und Nachhaltigkeit vereinheitlicht hat. Die Evaluierung der ruandisch-deutschen Kooperation im Gesundheitssektor kommt bei den verschiedenen Kriterien naturgemäß zu unterschiedlichen Einschätzungen der diversen Ansätze.
Der Auftraggeber der Ruanda-Evaluierung, das BMZ, scheint laut seiner Stellungnahme zum ersten DEval-Bericht mit der Bewertung seiner Aktivitäten und Ansätze zufrieden zu sein. "Die Ergebnisse der Evaluierung sind insgesamt positiv und im Einzelnen sehr differenziert dargestellt. Sie zeigen, dass die deutschen Beiträge vielfach an den richtigen Stellen ansetzten, aber auch aus Erfahrungen gelernt bzw. auf sich verändernde Rahmenbedingungen eingegangen wurde."
Der in zwei Bänden erschienene Evaluierungsbericht steht kostenfrei in voller Länge auf der Website des Deutschen Evaluierungsinstituts der Entwicklungszusammenarbeit zum Download zur Verfügung: Band 1 und Band 2 bzw. Annexes.
Dort findet sich auch eine kurze Darstellung des DEval.
Jens Holst, 6.10.14
Wer oder was sorgt für desolate Gesundheitssysteme in Afrika? Die Rolle von Pharmafirmen am Beispiel Uganda.
 Zu den Bedingungen welche die Ausbreitung der akuten Ebola-Erkrankungswelle in Westafrika förderten und zukünftige Ausbrüche ermöglichen, zählen u.a. das Fehlen öffentlicher Krankenversicherungen und fehlende oder personell wie infrastrukturell desolate Versorgungssysteme.
Zu den Bedingungen welche die Ausbreitung der akuten Ebola-Erkrankungswelle in Westafrika förderten und zukünftige Ausbrüche ermöglichen, zählen u.a. das Fehlen öffentlicher Krankenversicherungen und fehlende oder personell wie infrastrukturell desolate Versorgungssysteme.
Dabei entsteht oft der Eindruck oder wird sogar erzeugt, es handle sich dabei ausschließlich um die Unfähigkeit oder den Unwillen der afrikanischen Staaten und Gesellschaften.
Dass für das schwache oder dysfunktionale Gesundheitsversorgungssystem jenseits von Ebola aber auch europäische Akteure aktiv verantwortlich sind, zeigt der gerade veröffentlichte "Pharma Brief spezial" 1/2014 von BUKO Pharma-Kampagne und HEPS Uganda über das Geschäftsverhalten der Pharmafirmen Boehringer Ingelheim, Bayer und Baxter in Uganda, einem der ärmsten Länder Afrikas.
Fakten- und facettenreich kommt diese Untersuchung zu dem Fazit: "Die Markenhersteller haben kein oder nur geringes Interesse daran, ein Land ohne zahlungskräftige PatientInnen mit Arzneimitteln zu beliefern und sich dort in der Forschung zu engagieren. Während Baxter den ugandischen Markt bereits aufgegeben hat, plant Boehringer Ingelheim den Rückzug. Nur die Firma Bayer vertreibt weiterhin Medikamente in Uganda - darunter etliche Hormonpräparate und Verhütungsmittel, manche von eher zweifelhaftem Nutzen."
Das "manche" eine sehr zurückhaltende Bewertung ist, zeigt das Angebot der Firma Bayer auf dem ugandischen Markt: Dort "sind 49 Mayer-Medikamente registriert, von denen wir 21 als irrational bewerteten. 13 Produkte wurden als unentbehrlich eingestuft." Als "irrational" bewerteten die damit beauftragten Pharmazeuten vor allem Meduikamente mit mehreren Wirkstoffen.
Die Studie schildert ausführlich und aus Sicht aller daran Beteiligten oder davon Betroffenen die Folgen dieser Art des freien Marktes, also u.a. die massive gesundheitliche Benachteiligung und Schädigung der sozial schwachen Mehrheit der Bevölkerung.
Und schließlich spricht die Studie noch Fragen an, "denen sich entwicklungs- und gesundheitspolitische Akteure und EntscheidungsträgerInnen stellen sollten: Wie kann es z.B. gelingen, gravierende Versorgungslücken zu schließen, wenn der freie Markt versagt? Wie kann die lokale Produktion gestärkt werden? Und last but not least: Sind Entwicklungshilfegelder - die etwa im Rahmen der Contraceptive-Security-Initiative oder des Jadelle-Access-Programms an die Firma Bayer fließen - ein sinnvoller Anreiz, um Pharmaunternehmen dazu zu bewegen, einen vernachlässigten Markt wie Uganda zu bedienen?"
Positiv vermerken die AutorInnen schließlich das insgesamt positive und konstruktive Kommunikationsverhalten der Firmen, insbesondere im Vergleich zu ihrem Verhalten im Rahmen einer Vorgängerstudie. Dies zeigt, dass Studie wie die jetzt vorgelegte keineswegs nur ohnmächtige Anklagen sind, sondern etwas bewegen können.
Den 52 Seiten umfassenden und ansprechend aufgemachten "Pharma Brief Spezial 1/2014" Arm und vergessen - Untersuchung des Geschäftsverhaltens von Boehringer Ingelheim, Bayer und Baxter in Uganda erhält man als PDF-Datei kostenlos, kann ihn aber auch für 5 € bei der BUKO Pharma-Kampagne in Bielefeld bestellen (info@bukopharma.de).
Über den Stand der Verbreitung des Ebola-Fiebers in Westafrika erfährt man Verlässliches in dem Aufsatz Ebola Virus Disease in West Africa — The First 9 Months of the Epidemic and Forward Projections des WHO Ebola Response Team. Er ist auf der "Ebola Outbreak site" der Fachzeitschrift NEJM am 23. September 2014 veröffentlicht und kostenlos erhältlich. Sein Fazit lautet: "These data indicate that without drastic improvements in control measures, the numbers of cases of and deaths from EVD are expected to continue increasing from hundreds to thousands per week in the coming months."
Bernard Braun, 1.10.14
Weltbericht zu Sozialer Absicherung
 Die jährlich bzw. zweijährlich erscheinenden Weltgesundheitsberichte der WHO, Weltentwicklungsberichte der Weltbank und Humanentwicklungsberichte des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen UNDP haben sich mittlerweile als Standardwerken der Internationalen Zusammenarbeit etwabliert. Weltberichte der Internationalen Arbeitsorganisation ILO haben bisher keine vergleichbare Tradition. Vergleichbare internationale Übersichtsberichte zu sozialer Sicherung sollen die anderen thematischen Weltberichte ergänzen.
Die jährlich bzw. zweijährlich erscheinenden Weltgesundheitsberichte der WHO, Weltentwicklungsberichte der Weltbank und Humanentwicklungsberichte des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen UNDP haben sich mittlerweile als Standardwerken der Internationalen Zusammenarbeit etwabliert. Weltberichte der Internationalen Arbeitsorganisation ILO haben bisher keine vergleichbare Tradition. Vergleichbare internationale Übersichtsberichte zu sozialer Sicherung sollen die anderen thematischen Weltberichte ergänzen.
Die ILO hatte 2010 erstmalig einen World Social Security Report mit dem Titel Providing coverage in times of crisis and beyond publiziert. Mit dieser ersten umfassenden, systematischen und spartenübergreifenden Aufarbeitung der sozialen Absicherung in der Welt untermauerte die ILO ihren Führungsanspruch im Themenfeld umfassender sozialer Absicherung. In den vorangegangenen Jahren hatte sich die ILO zunehmend gegenüber einem breiteren, über die arbeitsplatzassoziierte Absicherung hinausgehenden Ansatz von sozialer Absicherung geöffnet und dabei nicht zuletzt im Bereich der sozialen Absicherung im Krankheitsfall profiliert.
Sichtbares Ergebnis des vermehrten ILO-Engagements war der 2011 erschienene Bericht Social Protection Floor for a Fair and Inclusive Globalization, der kostenfrei zum Download in englisch, französisch und spanisch zur Verfügung steht. Mit ihrem menschenrechtsbasierten Ansatz der sozialen Absicherung bemüht sich die ILO, einen Referenzrahmen für die Vereinten Nationen zu schaffen. Der unter Vorsitz der früheren und aktuellen chilenischen Präsidentin Michelle Bachelet erarbeitete Vorschlag definierte Mindeststandards für die soziale Absicherung in den Ländern.
Der Weltbericht 2014/15 zu Sicherung gibt einen umfassenden Überblick über den Aufbau sozialer Sicherungssysteme, Ausmaß und Leistungssprektrum sozialer Absicherung sowie die entsprechenden Ausgaben. Die ILO stellt den Bericht so vor: "This ILO flagship report provides a global overview of the organization of social protection systems, their coverage and benefits, as well as public expenditures on social protection. The report follows a life-cycle approach, starting with social protection for children, followed by schemes for women and men in working age, and closing with pensions and other support for older persons. It also assesses progress towards universal coverage in health. The report further analyses trends and recent policies, such as the negative impacts of fiscal consolidation and adjustment measures, and urgently calls to expand social protection for crisis recovery, inclusive development and social justice."
Der nun vorgelegte 2014/15er Bericht dieser Art des Internationalen Arbeitsbüros stellt die jüngsten Entwicklungen im Bereich der sozialen Absicherung in mehr als 190 Ländern dar und liefert ausführliche Informationen über die sozialen Sicherungssysteme, den Umfang und die Leistungen der sozialen Absicherung und die entsprechenden Ausgaben. Er enthält eine ausgesprochen umfangreiche Datensammlung mit den aktuell verfügbaren Zahlen zu sozialer Absicherung weltweit. Dabei zeigt er auch die negativen Effekte von Finanzkrisen auf die soziale Sicherung dar und nimmt die Folgen der ab 2010 sinkenden Sozialausgaben nicht nur in Europa unter die Lupe.
Den Bericht ergänzt ein detaillierter tabellarischer Überblick über die in den einzelnen Ländern der Welt bestehenden sozialen Sicherungssysteme sowie über den jeweils abgesicherten Bevölkerungsanteil. Anders als im ersten derartigen Bericht beschränkt sich die Zahlenbasis beim nun vorgelegten Weltbericht 2014/15 nicht mehr auf die erfass- bzw. messbare formale soziale Absicherung, sondern betrachtet auch die tatsächliche Absicherung und differenziert bei den verschiedenen Subsystemen zusätzlich zwischen verschiedenen Kategorien wie beitrags- und nicht-beitragsfinanzierten Systemen. Auch wenn die Daten nicht für alle Länder vollständig vorliegen, bietet der statistische Anhang des ILO-Berichts 2014/15 umfangreiches Zahlenmaterial und hilfreiche Daten.
Der Bericht steht in voller Länge auf der Website der ILO zum kostenfreien Download.
Jens Holst, 4.9.14
Globale Gesundheitspolitik - mehr als deutsche Pillen und Technik für den Weltmarkt
 Die 2011 von verschiedenen zivilgesellschaftlichen und akademischen AkteurInnen gegründete Deutsche Plattform für Globale Gesundheit hat ein grundlegendes Papier zu Fragen globaler Gesundheitspolitik vorgelegt. Unter dem Titel Globale Gesundheitspolitik - für alle Menschen an jedem Ort zeigt die Plattform entscheidende Aspekte von dem auf, was globale Gesundheitspolitik ausmachen muss.
Die 2011 von verschiedenen zivilgesellschaftlichen und akademischen AkteurInnen gegründete Deutsche Plattform für Globale Gesundheit hat ein grundlegendes Papier zu Fragen globaler Gesundheitspolitik vorgelegt. Unter dem Titel Globale Gesundheitspolitik - für alle Menschen an jedem Ort zeigt die Plattform entscheidende Aspekte von dem auf, was globale Gesundheitspolitik ausmachen muss.
Auslöser für dieses Papier war die Verabschiedung des Konzeptpapiers Globale Gesundheitspolitik gestalten - gemeinsam handeln - Verantwortung wahrnehmen im September 2013 durch die damalige schwarz-gelbe Bundesregierung. Ende 2013 stellte das Forum Gesundheitspolitik dieses Papier in dem Beitrag Globale Gesundheit - scheidende Bundesregierung hinterlässt bedenkliches Erbe vor und verwies auf weitere Stellungnahmen und Analysen. Insgesamt bleibt festzuhalten, dass das Konzeptpapier der Bundesregierung zu globaler Gesundheitspolitik dem formulierten Anspruch schwerlich gerecht wird.
Die Plattform für globale Gesundheit hat sich intensiv mit dem Konzeptpapier der Bundesregierung auseinandergesetzt und ist zu dem Schluss gekommen, dass die Bundesregierung in ihrem Konzeptpapier von einem verkürzten Gesundheitsbegriff ausgeht.
Die Plattform, in der Gewerkschaften, Sozial- bzw. Wohlfahrtsverbände, entwicklungs- wie migrationspolitische Organisationen, Wissenschaft, soziale Projekte und Bewegungen zusammenarbeiten, hat sich mit dem Ziel gegründet, unter den Bedingungen der fortschreitenden Internationalisierung der Lebensbedingungen den engen Zusammenhang zwischen globalen und lokalen Einflussfaktoren von Gesundheit stärker ins öffentliche Bewusstsein zu bringen, vorhandene Kräfte zu bündeln und in Deutschland politisch Einfluss zu nehmen. Sie will keine weitere gesundheits- oder entwicklungspolitische Lobby-Gruppe sein, sondern eine übergreifende Initiative mit dem Ziel, die sozialen Bedingungen für Gesundheit stärker in den Mittelpunkt der nationalen und internationalen Gesundheitsdebatte zu rücken. Dafür will sie die Zusammenarbeit zwischen nationaler und internationaler Gesundheitspolitik intensivieren und damit einen Beitrag zur Überwindung der bestehenden Trennung zwischen innenpolitischer und globaler Gesundheitspolitik leisten.
Wenn man diesen Anspruch Ernst nimmt, muss man, wie die Plattform, zu dem Schluss kommen, dass im Konzeptpapier der Bundesregierung zentrale gesundheitspolitische Probleme entweder gar nicht, nicht hinreichend oder gar fehlleitend zur Sprache kommen. Wichtige Aspekte globaler Gesundheitspolitik fehlen. Denn globale Gesundheitspolitik muss nicht nur alle Menschen weltweit in den Blick nehmen, sondern auch die sozialen Determinanten von Gesundheit und alle anderen Faktoren indirekter Gesundheitspolitik.
Als Grundlagen für eine künftige ressortübergreifende Strategie für globale Gesundheit fordert die Deutsche Plattform für globale Gesundheitspolitik daher
• eine stärkere Ausrichtung auf Gesundheitsförderung als auf Biomedizin
• eine hinreichende Beachtung sozialer Ungleichheiten
• gesunderhaltende Arbeits- und Lebensbedingungen
• universelle soziale Absicherung im Krankheitsfall
• ausreichende und sichere Ernährung
• angemessene handels- und steuerpolitische Regulierungen
• Kontrolle und Zurückdrängen von Profitinteressen in der Gesundheitswirtschaft
• Steuerung der Migration von Fachkräften
• Verminderung der gesundheitlichen Risiken des Klimawandels
• Gesundheitsförderliche Energiepolitik
• Eindämmung von Rüstungsexporten und Krieg
• Zugang zur Krankenversorgung auch für Illegale
• Demokratisierung der WHO als relevante Sonderorganisation der Vereinten Nationen.
Im Fazit des Plattform-Papiers heißt es: "In der globalisierten Welt ist globale Gesundheitspolitik eine bedeutende wie auch vielschichtige Querschnittsaufgabe. Es ist ermutigend, dass die weltweiten Zusammenhänge von Gesundheit in den vergangenen Jahren verstärkt in den Blick gerückt sind. Und es ist gut, dass sich auch die Bundesregierung mit der Vorlage eines Konzeptpapiers dieser Herausforderung gestellt hat. Das vorgelegte Papier macht allerdings auch deutlich, wie weit der Weg zu einem umfassenden Verständnis von globaler Gesundheitspolitik und geeigneten politischen Strategien zur Verbesserung der weltweiten Gesundheit noch ist."
Zusammenfassend kommt die Plattform in ihrem Gegenkonzept zu der Einschätzung: "Auch wenn mit Blick auf den laufenden Post-2015-Prozess nun eine Chance vertan sein könnte, besteht für die Deutsche Plattform für Globale Gesundheit kein Zweifel, dass der eingeschlagene Weg in die richtige Richtung führt. Dafür ist allerdings ein klares Bekenntnis zu einem menschenrechtlichen Verständnis erforderlich, das Gesundheit nicht als profitables "Geschäftsmodell" begreift, sondern als Anspruch jedes Menschen. Die Krise der gegenwärtigen Gesundheitspolitik ist nicht zuletzt Folge des Gefangenseins in Einstellungen und Überzeugungen, die bestehende Probleme verlängern, nicht aber überwinden. "Probleme", darauf hat schon Albert Einstein verwiesen, "kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind."
Allen Interessierten steht das Grundsatzpapier der Deutschen Plattform für globale Gesundheit zum Thema Globale Gesundheitspolitik - für alle Menschen an jedem Ort kostenfrei zum Download zur Verfügung.
Jens Holst, 27.8.14
Ist der "brain drain" von Ärzten aus Ländern der Dritten Welt durch Einkommensverbesserungen zu stoppen? Das Beispiel Ghana.
 In der aktuellen Debatte über den Mangel an Ärzten und Pflegekräften zur Behandlung der Ebola-PatientInnen in den westafrikanischen Ländern, spielt auch das Argument eine Rolle, hier handle es sich um eine Folge des so genannten "brain drains" der Angehörigen dieser und anderer Berufe in europäische oder nordamerikanische Länder und Gesundheitssysteme. Als ein Grund für diese Mobilität gelten die Einkommensunterschiede zwischen den Entwicklungs- und Industrieländern. Höhere Einkommen für Ärzte etc. in Ghana, Indonesien oder Honduras, so die Schlussfolgerung, würden die Abwanderung spürbar mindern.
In der aktuellen Debatte über den Mangel an Ärzten und Pflegekräften zur Behandlung der Ebola-PatientInnen in den westafrikanischen Ländern, spielt auch das Argument eine Rolle, hier handle es sich um eine Folge des so genannten "brain drains" der Angehörigen dieser und anderer Berufe in europäische oder nordamerikanische Länder und Gesundheitssysteme. Als ein Grund für diese Mobilität gelten die Einkommensunterschiede zwischen den Entwicklungs- und Industrieländern. Höhere Einkommen für Ärzte etc. in Ghana, Indonesien oder Honduras, so die Schlussfolgerung, würden die Abwanderung spürbar mindern.
Ob dies stimmt und um welche Summen es dabei geht, untersuchte jetzt ein Wissenschaftler der RAND Corporation für den afrikanischen Staat Ghana genauer.
Dazu untersuchte er den Anteil afrikanischer Ärzte in 16 OECD-Ländern über 14 Jahre (1991 bis 2004). Er berücksichtigte dabei, dass es in Ghana im gesamten Zeitraum das staatliche Programm "Additional duty hours allowance (ADHA)" gab, das letztlich zu einer Erhöhung der dortigen Ärzteeinkommen beitrug. Obwohl für andere Zwecke geplant, stammte 2005 laut einer Studie knapp die Hälfte des Einkommens der ghanaesischen Ärzte aus dem ADHA-Topf.
Im Vergleich des "brain drain" aus Ghana mit dem aus den restlichen afrikanischen Staaten ohne vergleichbare Einkommensanreize zeigte sich bereits kurz nach dem Start und der Einwirkung von ADHA eine Abnahme bei den ghanaesischen Ärzten und nur bei diesen. Insgesamt zeigen die Analysen über den gesamten Zeitraum eine Abnahme der Emigration von Ärzten aus Ghana in die USA, Deutschland und vergleichbare Länder um 10%.
In der sehr intensiven Diskussion dieses Ergebnis, sind zwei Aspekte besonders interessant:
• In eine Weiterentwicklung des Analysemodells müssten u.a. auch die Entwicklung der Immigrationsbedingungen in den Aufnahmeländern und die sonstigen politischen und sozialen Entwicklungen in den Immigrationsländern berücksichtigt werden. Dies ist mit komplexen methodischen Anforderungen verbunden.
• Ein anderer Aspekt fasst der Autor so zusammen: "Even if the wage increase programme reduced physician migration, this does not automatically make it a good policy solution. An important question is whether the programme would pass a cost-benefit test." Dafür schätzt er die ADHA-Kosten im Untersuchungszeitraum für jeden in Ghana zusätzlich verbliebenen Arzt auf 167.000 US-Dollar. Für die Frage nach der "cost-effectiveness" stellt er dem die "cost of producing a new doctor" gegenüber, die auf 30.000 bis 70.000 US-Dollar geschätzt werden.
Auch wenn man weitere vom Autor skizzierte Limitationen hinzunimmt, handelt es sich um einen wichtigen ersten Versuch, mit einem künftig noch wachsenden Problem analytisch und konzeptionell umzugehen. Die professionell und immer aggressiver von allen "westlichen" Ländern weltweit in den so genannten Entwicklungsländern geführten Abwerbekampagnen für Beschäftigte im Gesundheitswesen könnte z.B. dazu führen, dass sich dort verstärkt tatsächlich oder vermeintlich gefährliche Erkrankungsereignisse bzw. Epidemien bilden, die mangels Personal und sonstiger Infrastruktur nicht mehr akut versorgt werden können. Speziell wenn es sich um ansteckende Erkrankungen handelt, stehen die entwickelten Länder vor der Herausforderung, mit Hunderten von Millionen Dollars oder Euros daran vor Ort etwas zu verändern. Ob dies dann nicht u.U. teurer wird als ADHA-Programme und gleichzeit nationale Ausbildungsprogramme für mehr Gesundheitspersonal in Europa oder Nordamerika, sollte in künftigen "brain drain"-Studien ebenfalls mitberücksichtigt werden.
Von dem materialreichen Aufsatz Do higher salaries lower physician migration? von Edward N Okeke, der am 26. Juli 2014 in der Zeitschrift "Health Policy Planning. (2014; 29 (5): 603-614) erschienen ist, gibt es kostenlos das Abstract.
Bernard Braun, 7.8.14
Ärztinnen sind bei der Behandlung von Diabetikern besser als Ärzte, aber weniger "produktiv" - doch stimmt letzteres wirklich?
 Die Frage, ob das Geschlecht von Ärzten Auswirkungen auf die Art und Weise bzw. die Qualität ihrer Leistungen hat oder ob bei bestimmten Fachdisziplinen Frauen nicht besser bei Ärztinnen (z.B. Gynäkologie) oder Männer bei Ärzten (z.B. Urologie/Andrologie) behandelt werden wollen, wird seit einiger Zeit in verschiedenen Studien kontrovers diskutiert.
Die Frage, ob das Geschlecht von Ärzten Auswirkungen auf die Art und Weise bzw. die Qualität ihrer Leistungen hat oder ob bei bestimmten Fachdisziplinen Frauen nicht besser bei Ärztinnen (z.B. Gynäkologie) oder Männer bei Ärzten (z.B. Urologie/Andrologie) behandelt werden wollen, wird seit einiger Zeit in verschiedenen Studien kontrovers diskutiert.
Eine jetzt in Kanada und genauer in der dortigen französischsprachigen Region Québec abgeschlossene Studie verglich mit Unterstützung durch die Krankenversicherung anhand ausgewählter Qualitätsparametern und mit Behandlungs-Leistungsdaten, wie die Qualität und die "Produktivität" von 431 Ärztinnen und 475 Ärzten aus der Arztgruppe der Familienärzte bei der Behandlung von DiabetikerInnen aussah. Die Kriterien für eine gute Behandlung stammen aus den krankheitsspezifischen Leitlinien in Kanada. Als Kriterien für "Produktivität" wurden die Anzahl regelmäßiger Arztbesuche und die Anzahl von Leistungen wie z.B. die Verordnung von Arzneimitteln gezählt.
Generell folgten die von Ärztinnen behandelten Patienten mehr deren Ratschlägen als die Patienten von Ärzten. 73% der Ärztinnenund 70% der Ärzte forderten ihre Patienten wegen der möglichen unerwünschten Wirkungen des Diabetes auf, ihre Augen leitlinienkonform bei einem Augenarzt untersuchen zu lassen. Zur Inanspruchnahme einer Beratung über die Gefahren des Rauchens motivierten 1,8% der ÄrztInnen und 1,4% der Ärzte ihre Patienten. Und die Anteile der Patienten mit einer ebenfalls leitlinienangemessenen Statin-Verordnung betrug 68,2% bei Ärztinnen und 64% bei Ärzten. Schließlich boten 39% der Ärztinnen und 33% der Ärzte ihren Patienten eine vollständige Untersuchung an. Auch wenn die AutorInnen der Studie einräumen, sie wüssten nicht, ob die PatientInnen z.B. die verordneten Medikamente eingenommen hätten, spricht manches dafür, dass die Behandlungsqualität der Ärztinnen eher den Leitlinienempfehlungen entspricht und damit wahrscheinlich der Gesundheit ihrer Patienten gut tut als die von Ärzten.
Waren die Unterschiede zwar bisher relativ klein aber durchweg signifikant, gibt es bei der "Produktivität" gewaltige und signifikante Unterschiede. So rechneten die Ärzte für die Behandlung ihrer Diabetespatienten im Untersuchungszeitraum 4.920, die Ärztinnen dagegen nur 3.100 Leistungen und damit rund 37% weniger Leistungen ab. Die AutorInnen weisen an dieser Stelle zutreffend darauf hin, dass die bloße Anzahl von Leistungen kein Indiz für eine qualitativ höhere Produktivität im Sinne von produktiv für die Behandlung und Gesundheit von Patient sein könne. So erbringen Ärzte zwar mehr einzelne Leistungen und arbeiten damit mehr, Ärztinnen dagegen brächten deutlich mehr Zeit für den einzelnen Patienten auf. In weiteren ähnlichen Untersuchungen wollen die Montréaler WissenschaftlerInnen sich noch mit der Behandlung von Bluthochdruck, Asthma und COPD durch Ärztinnen und Ärzte beschäftigen.
Ob diese Ergebnisse nach Deutschland übertragbar sind, kann nicht verlässlich beantwortet werden. Am besten sollten aber die Zweifler die dafür notwendige Zeit in die Vorbereitung und Durchführung einer vergleichbaren Studie in Deutschland investieren.
Diese Ergebnisse wurden gerade auf dem vom 17. bis 19. Oktober dauernden internationalen Gesundheitskongress "Santé publique et Prévention" in Bordeaux vorgestellt, erscheinen aber auch noch in dem von R. Borgès Da Silva et al. von der Universität Montréal (Québec, Kanada) verfassten Aufsatz Qualité et productivité dans les groupes de médecine de famille : qui sont les meilleurs ? Les hommes ou les femmes ? in der Zeitschrift "Revue d'Épidémiologie et de Santé Publique" (Volume 61, Supplement 4, October 2013, Pages S210-S211). Eine frei und kostenlos zugängliche Version oder Abstract gibt es leider nicht.
Bernard Braun, 26.10.13
Shared Decision Making nur etwas für entwickelte Länder und ihre Ärzte und Patienten? Wie sieht es z.B. in Malaysia aus?
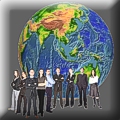 Egal, ob jemand denkt, "shared decision making" (SDM) oder gemeinsame Entscheidungsfindung bei gesundheitsbezogene Entscheidungsfindung sei nur etwas für Patienten und Ärzte in west-, mittel- oder nordeuropäischen und nordamerikanischen Länder und nichts für so genannte Entwicklungsländer oder ob er hofft, dass SDM vielleicht mangels traditionellem Paternalismus dort etwas besser funktioniert: Ein gerade veröffentlichter Review über SDM in Malysia zeigt, dass es sich um zwei Irrtümer handelt.
Egal, ob jemand denkt, "shared decision making" (SDM) oder gemeinsame Entscheidungsfindung bei gesundheitsbezogene Entscheidungsfindung sei nur etwas für Patienten und Ärzte in west-, mittel- oder nordeuropäischen und nordamerikanischen Länder und nichts für so genannte Entwicklungsländer oder ob er hofft, dass SDM vielleicht mangels traditionellem Paternalismus dort etwas besser funktioniert: Ein gerade veröffentlichter Review über SDM in Malysia zeigt, dass es sich um zwei Irrtümer handelt.
Auch in Malaysia, wie in einigen anderen asiatischen Ländern und Gesundheitssystemen gibt es gesetzliche Vorschriften zur Pflicht Patienten aufzuklären (informed consent). Der malayische Ärzteverband hat außerdem bereits 2001 eine Leitlinie zu den Pflichten eines Arztes ausgearbeitet, in der ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass die Beziehung zwischen Arzt und Patient "collaborative" und in "partnership" erfolgen solle. Trotzdem fanden die ForscherInnen unter 1.262 Aufsätzen, die sich überhaupt mit der Beteiligung von PatientInnen in Malaysia beschäftigten, gerade einmal 20 Artikel, die sich umfassend mit SDM bzw. der Patientenbeteiligung an Entscheidungen beschäftigten. Zusätzlich führten sie zwei Online-Surveys mit Hochschulwissenschaftlern aus dem Bereich des klinischen Trainings und der Lehrangebote zu SDM und mit Patientenunterstützungsgruppen durch.
Die bisher ausschließlich deskriptiven Ergebnisse zeigen, dass Ärzte sich zwar über die Bedeutung von Shared Decision Making und informed consent bewusst sind, nur wenige dies aber in ihrer Praxis berücksichtigen. Dies wird durch einen sehr begrenztes Lehrangebot und relativ schlechte Informationsmöglichkeiten für PatientInnen begleitet. Erschwerend wirkt sich in Malaysia aber auch noch die ethnische und sprachluiche Vielfalt aus. Trotz verschiedener Ideen, an diesen Zuständen etwas zu ändern, gibt es bisher auch noch keinen definitiven Implementationsplan.
Daran etwas zu ändern ist dann auch die Absicht eines eigenen Strategievorschlags, der sowohl das Bewusstsein über und die Implementation von SDM verbessern helfen soll.
Erste Reaktionen z.B. aus Brasilien zeigen, dass andere WissenschaftlerInnen in anderen Ländern daran interessiert sind mit eigenen Länderreports nachziehen Daher könnte es demnächst eine Weltkarte über die Verbreitung von SDM geben, in der nicht mehr wesentliche Länder und Erdteile fehlen.
Der Aufsatz An overview of patient involvement in healthcare decision-making: a situational analysis of the Malaysian context von Chirk-Jenn et al. ist 2013 in der Open Access-Zeitschrift "BMC Health Services Research" (13: 408) erschienen und daher komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 22.10.13
Was bedeutet es, dass alle heute Geborenen 100 Jahre alt werden sollen? Wahrscheinlich weniger Schlimmes als gemenetekelt wird!
 Zu den auch nicht mehr so jungen Schrecken der Debatte über die gesundheitlichen Effekte der steigenden Lebenserwartung gehört die auf niedrigem Niveau kräftig zunehmende Anzahl von hochbetagten Menschen. Auch wenn im Moment nur wegen der geringen absoluten Anzahl von einer "Explosion" geredet werden kann, wird die Debatte u.a. mit der Prognose angefeuert, die seit 2000 in Deutschland und vergleichbaren Ländern geborenen Kinder könnten alle 100 Jahre alt werden - in 99 Jahren. Auch wenn natürlich niemand über deren Verlauf genügend Klarheit besitzt, kann und soll sich jeder vorstellen, was passiert, wenn diese 100-Jährigen alle krank und behandlungsbedürftig wären ….
Zu den auch nicht mehr so jungen Schrecken der Debatte über die gesundheitlichen Effekte der steigenden Lebenserwartung gehört die auf niedrigem Niveau kräftig zunehmende Anzahl von hochbetagten Menschen. Auch wenn im Moment nur wegen der geringen absoluten Anzahl von einer "Explosion" geredet werden kann, wird die Debatte u.a. mit der Prognose angefeuert, die seit 2000 in Deutschland und vergleichbaren Ländern geborenen Kinder könnten alle 100 Jahre alt werden - in 99 Jahren. Auch wenn natürlich niemand über deren Verlauf genügend Klarheit besitzt, kann und soll sich jeder vorstellen, was passiert, wenn diese 100-Jährigen alle krank und behandlungsbedürftig wären ….
Mehr Licht in die gesundheitlichen Verhältnisse der "oldest-old"- oder gar "supercentenarians"-(110- bis 119-Jährige) Bevölkerungsgruppe bringen seit einigen Jahren Demographen mit Hilfe von Register- und Surveydaten der Bevölkerung Dänemarks. Die Ergebnisse zeichnen ein differenziertes und zum Teil eher entdramatisierendes Bild oder weisen auf die für eine rationalere politische Demographie-Debatte notwendigen differenzierten Sichtweisen und Methoden hin.
Eine zwischen 1998 und 2005 durchgeführte und 2008 veröffentlichte Längsschnittstudie aller 1905 in Dänemark geborenen Personen erhob für die 93- bis 100-Jährigen mit Standardinstrumenten (z.B. dem MiniMental State Examination Score) zu vier Zeitpunkten das Vorhandensein von Behinderungen und vor allem ihrer Unabhängigkeit.
Zu den wichtigsten Ergebnissen gehörte
• der mäßige Rückgang des Anteils unabhängiger Personen in den vier Untersuchungsgruppen der 1905er-Kohorte von 38,9% auf 32,7% - mit einem Konfidenzintervall von 1% bis 14%,
• der deutlich größere Rückgang des Anteils unabhängiger "oldest-old" in der Gruppe der 1905 geborenen DänInnen, die an allen vier Messungen teilgenommen haben von 69,9% im Jahr 1997/98 auf 32,7% im Jahr 2005. Der Durchschnittswert des Verlustes an Unabhängigkeit bei den 2005 noch lebenden Kohortenmitgliedern betrug 37% und schwankte zwischen 28% und 46%.
• ähnlich sah es auch bei den anderen gemessenen Funktionsparametern aus.
Die etwas makabre aber politisch relevante Zweischneidigkeit dieser Ergebnisse fasst die international besetzte Forschergruppe so zusammen: "For the individual, long life brings an increasing risk of loss of independence. For society, mortality reductions are not expected to result in exceptional levels in cohorts of the very old."
Die Forscherinnen zeigen in ihrem kompakten Überblick über die weltweite Forschung zur Gesundheit von Hochbetagten, dass es dazu damals (und auch heute) noch keine abschließende Antwort gibt, und unterscheiden sich damit wohltuend von der selbstgewissen Krisen-Rhetorik zu diesem Thema.
In einer am 26. März 2013 veröffentlichten Studie wurden die Häufigkeit der Krankenhausaufenthalte, operativen Behandlungen sowie die stationäre oder nachoperative Sterblichkeit der Geburtsjahrgänge 1895 (N=12.326) und 2005 (N=15.477) zweier dänischer Bevölkerungskohorten im Lebensalter von 85 bis 99 Jahren verglichen. Auch hier wird die altersgesundheitliche Debatte eher durch dramatisch-negative Erwartungen und Prognosen geprägt.
Die Mischung aus erwarteten und unerwarteten Ergebnissen sieht so aus:
• Die Mitglieder der 1905er-Kohorte waren häufiger in stationärer Behandlung bzw. wurden häufiger im Krankenhaus operiert als die 1895er-Kohorte. Der Unterschied bewegte sich zwischen 2% und 17,2%.
• Die Krankenhauspatienten der 1905er Kohorte hatten vom 85. bis zum 99. Lebensjahr kürzere Liegezeiten als die der älteren Kohorte. Bei Männern waren die Krankenhausaufenthalte zwischen 1,6 und 3,6 Tagen kürzer und bei den Frauen zwischen 1,9 und 5,3 Tagen.
• Trotz mehr Krankenhausaufenthalten und Operationen gab es in der 1905er Kohorte keinen Anstieg der Krankenhaus- oder nachstationären Sterblichkeit. Hier gab es außerdem keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen.
• Die Autoren bewerten dieses differenzierte Geschehen als Ausdruck eines Abbaus altersspezifischer Ungleichheit bei der operativen Behandlung, einer besseren Gesundheit bzw. gesundheitlichen Robustheit der Angehörigen des Geburtsjahrgangs 1905 sowie von besser gewordenen anästhesistischen und operativen Fertigkeiten. In der nicht gestiegenen Sterblichkeit der stationär Behandelten sehen die Autoren auch einen Beleg dafür, dass nicht das Alter bzw. die traditionelle Absicht im Krankenhaus zu sterben, sondern der gesundheitliche Status und die Sicherheit von Operation und Behandlung der Hochbetagten Grundlage für die Einweisung oder Aufnahme ins Krankenhaus waren.
• Interessant, aber nicht weiter hinterfragt ist schließlich die Beobachtung, dass der Anteil dieser Altersgruppe, der zwischen dem 86. und 99. Lebensjahr und bis zum Tode zu Hause lebte, in der 1905er Kohorte für beide Geschlechter höher war als in der 1895er Kohorte.
Der Aufsatz Exceptional longevity does not result in excessive levels of disability von Kaare Christensen, Matt McGue, Inge Petersen, Bernard Jeune und James W. Vaupel ist am 9. September 2008 in den "Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS)" (vol. 105 no. 36) erschienen und kostenlos erhältlich.
Von dem am 23. März 2013 in der Fachzeitschrift "Age Ageing" erschienenen Aufsatz Changes in hospitalisation and surgical procedures among the oldest-old: a follow-up study of the entire Danish 1895 and 1905 cohorts from ages 85 to 99 years von Anna Oksuzyan, Bernard Jeune, Knud Juel, James W. Vaupel und Kaare Christensen, gibt es kostenlos nur das Abstract.
Bernard Braun, 29.3.13
Systematische Umverteilung von unten nach oben
 Der beständig zunehmenden Ungleichheit der Einkommen und ihren Ursachen widmet sich eine aktuelle Publikation der Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Er basiert auf einem von der OECD für ein Treffen der Sozialminister der Mitgliedsländer im Mai 2011 vorbereiteten Bericht, wie bereits der Beitrag OECD: Einkommensungleichheit wächst - Deutschland an der Spitze - "Wegheiraten" keine Lösung und der Ruf nach Regierungstransfers im Forum Gesundheitspolitik erläuterte.
Der beständig zunehmenden Ungleichheit der Einkommen und ihren Ursachen widmet sich eine aktuelle Publikation der Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Er basiert auf einem von der OECD für ein Treffen der Sozialminister der Mitgliedsländer im Mai 2011 vorbereiteten Bericht, wie bereits der Beitrag OECD: Einkommensungleichheit wächst - Deutschland an der Spitze - "Wegheiraten" keine Lösung und der Ruf nach Regierungstransfers im Forum Gesundheitspolitik erläuterte.
Nach dem sehr umfangsreichen und ausführlichen OECD-Bericht beträgt das durchschnittliche Einkommensverhältnis zwischen den einkommensstärksten und -schwächsten Dezilen OECD-weit mittlerweile 9 zu 1 - Tendenz stetig und stabil steigend. In der Mehrzahl der OECD-Länder lässt sich beobachten, dass die Einkommen des reichsten Bevölkerungszehntels in den letzten Jahrzehnten anteilig deutlich stärker gestiegen sind als die des untersten Einkommensdezils, was naturgemäß erheblich umfangreicheren absoluten Einkommenszuwächsen entspricht. Der relative Einkommensanstieg fiel innerhalb der OECD nur in Belgien, Chile, Frankreich, Irland, Portugal, Spanien und der Türkei bei den einkommensschwächsten 10 Prozent größer aus als beim reichsten Zehntel, was in den meisten dieser Länder eher auf sozialpolitische Maßnahmen als auf Arbeitsmarkteffekte zurückzuführen sein dürfte.
Deutschland gehörte in den 1980er und 1990er Jahren zu den Gesellschaften mit eher geringen Einkommensdiskrepanzen, liegt hier aber mittlerweile im OECD-Mittelfeld - dessen Durchschnittswerte sich durch den Beitritt von Schwellenländern wie Mexiko und Chile mit höchst ungleicher Einkommensverteilung im Übrigen verschlechtert haben. Die OECD-Studie belegt nun die Entwicklung Deutschlands zu einem Land mit wachsenden Einkommensungleichheiten: Mit einem Durchschnittseinkommen von 57.300 Euro verdienten die obersten zehn Prozent der deutschen Einkommensbezieher im Jahr 2008 etwa achtmal so viel wie Angehörige des untersten Dezils mit 7.400 Euro - in den 1990er Jahren hatte das Verhältnis noch bei 6 zu 1 gelegen. Der jährliche Realanstieg der Haushaltseinkommen um durchschnittlich 0,9 % seit 1985 begünstigte die sozialen Schichten also höchst ungleichmäßig. Während die Einkommen in der untersten Einkommensgruppe lediglich um 0,1 Prozent stiegen, konnten die zehn Prozent der am besten verdienenden Haushalte ihr Einkommen um 1,6 Prozent steigern.
Da Löhne und Gehälter mit etwa 75 Prozent den Löwenanteil des Einkommens der Privathaushalte ausmachen, ist deren Entwicklung maßgeblich für die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich verantwortlich. Allein bei den Vollzeitarbeitenden hat sich die Lohnschere zwischen den obersten und untersten zehn Prozent in den vergangenen 15 Jahren um ein Fünftel vergrößert. Zur Einkommensungleichheit trägt auch die rasante Zunahme von Teilzeitbeschäftigten von knapp drei Millionen im Jahr 1984 in der alten Bundesrepublik auf mehr als acht Millionen Menschen im vereinigten Deutschland bei, deren Anteil im gleichen Zeitraum von 11 auf 22 Prozent der Arbeitskräfte gestiegen ist. Häufig handelt es sich hierbei um Frauen, die tendenziell geringere Bezahlung für vergleichbare Arbeit erhalten als ihre männlichen Kollegen. Neben der steigenden Zahl von Geringverdienern wirkt sich auch die Verringerung der durchschnittlichen Arbeitszeit auf das wachsende Einkommensgefälle aus: Kamen deutsche Beschäftigte vor 20 Jahren im Durchschnitt noch auf 1000 Arbeitsstunden pro Jahr, so liegt die Arbeitszeit hierzulande nur noch bei 900 Stunden.
Nicht nur notorischen Steuersenkungsplänen, sondern auch den ordnungspolitischen Forderungen nach Entlastung der sozialen Sicherungssysteme von ihren Umverteilungsfunktionen, da dies ausschließlich Aufgabe des Steuersystems sei, teilt die OECD auf Seite 36 eine deutliche Abfuhr: "Public cash transfers, as well as income taxes and social security contributions, played a major role in all OECD countries in reducing market-income inequality. Together, they were estimated to reduce inequality among the working-age population (measured by the Gini coefficient) by an average of about one-quarter across OECD countries. This redistributive effect was larger in the Nordic countries, Belgium and Germany, but well below average in Chile, Iceland, Korea, Switzerland and the United States". Diese Aussage lässt außerdem zwei Schlüsse zu: Die Umverteilung über Steuern lässt nicht nur in Schwellenländern wir Korea und Chile sowie dem sozialpolitischen Entwicklungsland USA gänzlich zu wünschen übrig, sondern auch in Steuerparadiesen wie Island und der Schweiz - die von Wirtschaftskreisen so gelobten günstigen Steuersätze haben unerwünschte Auswirkungen auf die soziale Gerechtigkeit. Und: Ohne das Steuersystem wären die Folgen des Lohndumpings und der Agenda-21-Politik in Deutschland noch viel schlimmer.
Die OECD-Studie liefert unüberhörbare Argumente für eine Erhöhung des in den meisten Ländern gesenkten Spitzensteuersatzes. Dabei erteilt nun auch die OECD eine ausdrückliche Lizenz zur höheren Besteuerung der wachsenden Spitzeneinkommen: "Nevertheless, the growing share of income going to top earners means that this group now has a greater capacity to pay taxes than before and in some countries they are already paying a greater share of income taxes than in the past."
Das ist nicht der einzige Hinweis, den die Befunde der OECD-Ökonomen für die deutsche Debatte und die Politik der Bundesregierung liefern. Die existierenden Umverteilungsmechanismen in den meisten OECD-Ländern einschließlich der Bundesrepublik Deutschland sind in ihrer Gesamtheit überfordert, die beständig wachsenden Einkommensungleichheiten so wirksam auszugleichen wie in früheren Jahren. Die in den letzten Jahren in Deutschland zu beobachtende zunehmende Verschiebung der Fiskaleinnahmen von direkten - also progressiven - zu den indirekten - also regressiven - Steuern zeugt von einer rückläufigen Umverteilungskapazität des Steuersystems. Interessant ist dabei allerdings, dass nach Angaben der OECD der Mehrwertsteueranteil an den gesamten Steuereinnahmen OECD-weit zwischen 1985 und 2005 leicht rückläufig war.
Das deutsche Kernproblem legt der soeben erschienene Beitrag No Representation without Taxation von Claus Schäfer in den WSI-Mitteilungen der Boeckler-Stiftung an Hand der Daten des Statistischen Bundesamt dar: Während die Lohnquote brutto wie netto über die Jahre zurückgegangen ist, stiegen die Gewinnquoten zumindest bis zum Beginn der Finanzkrise 2008 kontinuierlich an. Trotz des krisenbedingten Rückgangs der Gewinneinkünfte in Folge der Krise war die Netto-Lohnquote im ersten Halbjahr 2011 schon wieder unter das Niveau vor der Krise gesunken. Arbeitnehmer und ihre Einkommen profitierten also nach dem Abebben der Krise nicht hinreichend vom wirtschaftlichen Aufstieg. Auch die an sinkenden Arbeitslosenzahlen ablesbare Entspannung am Arbeitsmarkt wirkt nur auf den ersten Blick überzeugend, den 75 % des gesamten Beschäftigungszuwachses entfiel 2010 neben geringfügiger Beschäftigung auf sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse im Rahmen von Leiharbeit, Teilzeit und Befristung, wie auch das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in seiner Publikation Jobwunder durch Teilzeit? darlegte.
Kritiker des "kleptomanischen Steuerstaats" und die berühmten "Leistungsträger" dieser Gesellschaft verweisen immer wieder auf den hohen Anteil des Steueraufkommens, den die oberen Einkommensgruppen aufbringen. In der Tat zahlt das "oberste" Prozent aller Lohn- oder Einkommensteuerpflichtigen, immerhin 13,1 % aller steuerpflichtigen Einkünfte kassiert, ein Viertel der Gesamtheit der festgesetzten Lohn- und Einkommensteuern; dagegen entrichten die fast 20 Millionen Menschen in der unteren Hälfte aller Steuerpflichtigen mit einem Einkommensanteil von zusammen 14,3 % "nur" 3,6 % des gesamten Lohn- und Einkommensteueraufkommens. Aber der mit dieser Gegenüberstellung vermittelte Eindruck ist ebenso banal wie irreführend, erklärt Claus Schäfer in den WSI-Mitteilungen. Das eigentliche Problem besteht nämlich darin, dass offenbar die Gruppe mit unteren Einkommen so groß ist bzw. so viele Steuerpflichtige in Deutschland so wenig verdienen, dass sie kaum Steuern zahlen. Tatsächlich lässt sich die untere Hälfte aller Steuerpflichtigen einteilen in fünf Dezile, deren obere Einkommensgrenze pro Jahr für das erste bzw. unterste Dezil bei 1.830 €, für das zweite bei 5.692 €, für das dritte bei 10.947 €, für das vierte bei 16.609 € und für das fünfte Dezil bei 22.507 € liegt. Hier drängt sich die Frage auf, ob die Menschen in den unteren Einkommensgruppen überhaupt genug verdienen zum Steuern zahlen, und erst recht zum Befriedigen wichtiger Lebensbedürfnisse und zur aktiven Steigerung der Binnennachfrage.
Jenseits der deutschen Problematik widerlegt die aktuelle OECD-Studie einmal mehr die von der herrschenden Wirtschaftswissenschaft lange Jahre propagierten Annahmen, Wirtschaftswachstum käme letztlich automatisch allen Bevölkerungsgruppen zu Gute und Ungleichheit fördere die soziale Mobilität. Den Trickle-down-Effekt erwarteten die Menschen in den Ländern Lateinamerikas und anderswo in den harten Zeiten der Strukturanpassungsprogramme von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank jahrelang vergebens. Die UN-Wirtschaftskommission für Lateinamerika und die Karibik (CEPAL/ECLAC) stellte bereits zu Beginn des Jahrtausends fest, dass die sich Gewinne des Wirtschaftswachstums der lateinamerikanischen Länder höchst ungleichmäßig auf die Bevölkerung verteilten und soziale Ungleichheiten hemmend auf die wirtschaftliche Entwicklung wirkten. Der vom ehemaligen CEPAL-Direktor José Luis Machinea und den beiden Sozialstaatsexperten Daniel Titelman und Andras Uthoff herausgegebene, sehr lesenswerte Bericht Shaping the Future of Social Protection: Access, Financing and Solidarity von 2006 steht sowohl in Englisch als auch auf Spanisch kostenfrei zur Verfügung. Wenig später korrigierte auch die Weltbank ihre zuvor vehement verfolgte und den Entwicklungsländern aufgedrückte Trickle-Down-Ideologie. Mit der Publikation Poverty Reduction and Growth: Virtuous and Vicious Circles von Guillermo Perry, Omar Arias, Humberto López, William Maloney und Luis Servén begann Weltbank 2006 eine bemerkenswerte Kehrtwende zur Förderung der aktiven Beteiligung der Armen am Wirtschaftsaustausch und besserer sozialer Absicherung.
Nun ist diese Erkenntnis auch bei der OECD angekommen, wie auch den Worten von Generalsekretär Angel Gurría zu entnehmen ist: "Zunehmende Ungleichheit schwächt die Wirtschaftskraft eines Landes, sie gefährdet den sozialen Zusammenhalt und schafft politische Instabilität - aber sie ist nicht unausweichlich. Wir brauchen eine umfassende Strategie für sozialverträgliches Wachstum, um diesem Trend Einhalt zu gebieten." Es bleibt abzuwarten, wann sich derartige Erkenntnisse auch in der bundesdeutschen Politik und bei ihren Wirtschaftsberatern durchsetzen.
Die OECD stellt den umfangreichen Gesamtbericht Divided We Stand. Why Inequality keeps rising kostenfrei auf ihrer Homepage zur Verfügung. Zusätzlich lässt sich dort die Kurzfassung An Overview of Growing Income Inequalities in OECD Countries: Main Findings mit den wichtigsten Ergebnissen herunterladen. Das Berliner OECD-Büro hat außerdem eine kurze Mitteilung mit dem Titel Einkommensungleichheit nimmt OECD-weit zu - in Deutschland besonders schnell zur Verfügung gestellt, das in deutscher Sprache auch die wichtigsten Befunde zur Einkommensentwicklung in diesem Land zusammenfasst.
Jens Holst, 6.12.11
Zuzahlungen in Entwicklungsländern: Viel Klamauk, wenig Substanz
 Den Auswirkungen von Zuzahlungen und Selbstbeteiligungen in Entwicklungs- und Schwellenländern geht eine Meta-Analyse aus der Reihe der Cochrane-Studien nach. Lange bevor die verstärkte Beteiligung der BürgerInnen an den Kosten ihrer Gesundheitsversorgung in den Sozialsystemen der europäischen Industrieländer Einzug hielt, hatten internationale Organisationen den Entwicklungsländern die Einführung von user fees verordnet. Direktzahlungen der Armen und Ärmsten in den Ländern Afrikas, Asiens und Lateinamerikas sollten unterfinanzierte Gesundheitssysteme am Leben halten und stärken. Auf Druck von Weltbank, IWF, UNICEF und WHO einigten sich beispielsweise die afrikanischen Gesundheitsminister 1987 in der malischen Hauptstadt Bamako auf die umfassende Einführung von Nutzergebühren in öffentlichen Einrichtungen. Ziel der so genannten Bamako-Initiative war es, durch Kostenbeteiligung der PatientInnen die öffentlichen Gesundheitssysteme effizienter zu machen und die Versorgung bei Gesundheitszentren und in Krankenhäusern zu verbessern.
Den Auswirkungen von Zuzahlungen und Selbstbeteiligungen in Entwicklungs- und Schwellenländern geht eine Meta-Analyse aus der Reihe der Cochrane-Studien nach. Lange bevor die verstärkte Beteiligung der BürgerInnen an den Kosten ihrer Gesundheitsversorgung in den Sozialsystemen der europäischen Industrieländer Einzug hielt, hatten internationale Organisationen den Entwicklungsländern die Einführung von user fees verordnet. Direktzahlungen der Armen und Ärmsten in den Ländern Afrikas, Asiens und Lateinamerikas sollten unterfinanzierte Gesundheitssysteme am Leben halten und stärken. Auf Druck von Weltbank, IWF, UNICEF und WHO einigten sich beispielsweise die afrikanischen Gesundheitsminister 1987 in der malischen Hauptstadt Bamako auf die umfassende Einführung von Nutzergebühren in öffentlichen Einrichtungen. Ziel der so genannten Bamako-Initiative war es, durch Kostenbeteiligung der PatientInnen die öffentlichen Gesundheitssysteme effizienter zu machen und die Versorgung bei Gesundheitszentren und in Krankenhäusern zu verbessern.
Sechs Jahre später unterstrich der Weltbank-Jahresbericht Investing in Health die Notwendigkeit von Nutzergebühren sowie einer Zweiklassenmedizin, da umfangsreiche Leistungspakete für Arme aus öffentlichen Mitteln nicht bezahlbar seien (S. 57). Mittlerweile hat sich allerdings gezeigt, dass die erwünschten Effekte nur teilweise und in geringem Ausmaß eingetreten. Vielmehr hat sich mittlerweile herausgestellt, dass user fees gerade arme Menschen von der Inanspruchnahme abhalten, zumal aufgrund der Kosten für die Anreise zur Gesundheitseinrichtung und des Verdienstausfalls ohnehin relativ hohe finanzielle Belastungen entstehen. Die Forderung nach Abschaffung sämtlicher Zuzahlungen bestimmt zunehmend die entwicklungspolitische Debatte. Erwähnenswert sind in diesem Kontext zwei im Lancet publizierte Artikel über Auswirkungen von Zuzahlungen in Entwicklungsländern. Margaret Whitehead, Göran Dahlgren und Tim Evans veröffentlichten bereits 2001 einen Beitrag unter dem Titel Equity and health sector reforms: can low-income countries escape the medical poverty trap? im Lancet 358 (9284), S. 833-836, und in Nr. 373 (6680), S. 2078-2081 folgte der Artikel Universal health care and the removal of user fees von Rob Yates. Einige Länder wie Ghana, Jamaica, Sambia und Uganda haben daher inzwischen Nutzergebühren wieder abgeschafft.
Nun legten zwei Politik- und Wirtschaftswissenschaftlerinnen von der London School of Hygiene and Tropical Medicine eine systematische Cochrane-Analyse zum Thema user fees in Entwicklungs- und Schwellenländern vor. Im Mittelpunkt standen dabei die Auswirkungen von Änderungen der Zuzahlungsbelastung, also sowohl Erhöhungen als auch Senkungen sämtlicher Direktzahlungen, die im Augenblick der Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen fällig werden. Primäre Endpunkte waren bei dieser Metaanalyse zum einen Veränderungen bei der Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen als Proxy für den Zugang zur Versorgung und zum anderen Änderungen der Gesundheitsausgaben der Haushalte. Als sekundäre Endpunkte betrachteten die Londoner WissenschaftlerInnen den Gesundheitszustand und die soziale Gerechtigkeit beim Zugang zur Gesundheitsversorgung.
Sie analysierten dabei drei Typen von Untersuchungen - randomisierte oder cluster-randomisierte Kontrollstudien, kontrollierte Vorher-Nachher-Vergleichsstudien und unterbrochene Zeitreihenstudien zu klar definierten Zeitpunkten. Die Einschlusskriterien entsprachen denen der Cochrane Effective Practice and Organisation of Care Group (EPOC), einer international agierenden Review-Gruppe der Cochrane Collaboration, die sich der Förderung informierter Entscheidungen in Bezug auf Gesundheitsversorgungsfragen verschrieben hat. EPOC erstellt systematische Reviews über finanzielle, regulatorische sowie erziehungs-, verhaltens- und organisationsbezogene Interventionen zur Verbesserung des professionellen Umgangs und der Organisation der Gesundheitsversorgung.
Die Literaturrecherche erfolgte in 25 einschlägigen Datenbanken sowie in "grauer Literatur" auf Websites von Entwicklungsorganisationen, Universitäten und Instituten. Von den 243 ursprünglich als potenziell relevant eingestuften Publikationen erfüllte die große Mehrzahl die Einschlusskriterien nicht, da sie vorwiegend deskriptiv waren und in den meisten Fällen keinen Kontrollarm aufwiesen. Letztlich fanden nur 18 Untersuchungen Eingang in die Meta-Analyse, wobei in der Hälfte der berücksichtigten Studien eine erneute Analyse der Daten für den Einschluss erforderlich war. Acht Studien erfassten die Effekte der Einführung und fünf der Abschaffung von Nutzergebühren, während weitere fünf Studien den Auswirkungen von Zuzahlungserhöhungen oder -senkungen nachgingen.
Die analysierten Studien über Auswirkungen von Zuzahlungsänderungen wiesen ein breites Spektrum an Ansätzen und Methoden und große Unterschiede bei den jeweils beobachteten Interventionen auf. Auch die erfassten Ergebnisindikatoren waren sehr unterschiedlich und reichten von Erstkonsultationen, Patientenregistrierung, wöchentlichen, monatlichen oder vierteljährlichen Behandlungen bis zu ambulanten oder stationären Behandlungen insgesamt. Die größte Gefahr von Verzerrungen und Fehlinterpretationen geht nach Erkenntnissen der beiden britischen Wissenschaftlerinnen von nicht hinreichend oder gar nicht beachteten Rahmenbedingungen aus, die als Confounder wirken. So findet vielfach der Umstand keine angemessene Berücksichtigung, dass die Änderungen von Direktzahlungen oft Teil umfassenderer Reformen der Gesundheitsfinanzierung sind und insbesondere die Einführung oder Erhöhung von Nutzergebühren in Zeiten ökonomischer Krisen erfolgen. Das kann insbesondere bei Längsschnittstudien zu Fehlinterpretationen führen oder in Zeiten hoher Inflation die Ergebnisse in Frage stellen. Auch fehlt bei Vorher-Nachher-Vergleichsstudien oft eine zufrieden stellende Klärung der rage, ob denn die von Nutzergebühren befreite Gesundheitsversorgung für die Menschen tatsächlich kostenfrei ist. In anderen Fällen sind die angewendeten statistischen Methoden suboptimal, die Sample-Größen zu klein für signifikante Ergebnisse oder es fehlen statistische Signifikanzprüfungen.
Aus den eingeschlossenen Studien ergibt sich nach dieser Cochrane-Analyse ein etwas heterogenes Bild. Drei von sechs Studien über die Effekte neu eingeführter Zuzahlungen wiesen bei jeweils beiden untersuchten Einrichtungstypen (wie Gesundheitsposten, Krankenhaus, Arzneimittelvergabestelle) einen sofortigen Rückgang der Inanspruchnahme von betroffenen Gesundheitsleistungen um 5,5 bis 51,2 % (Mittelwert 29,5 %) sowie nach einem halben Jahr um 7,6 - 55,1 % (Mittelwert 29,6 %) auf, während bei zwei Studien jeweils gegenläufige Tendenzen bei den beiden Indikatoren zu beobachten waren. In diesen Fällen variierte die Zunahme der Nutzung nach Einführung von Zuzahlungen zwischen 22-40 %.
Insgesamt 5 Studien gingen den Effekten der Abschaffung von Selbstbeteiligungen in verschiedenen Entwicklungs- und Schwellenländern nach. Auch hier waren die Ergebnisse zunächst heterogen: In 4 Fällen zeigte sich unmittelbar nach der Maßnahme eine 7- bis 65-prozentige (Mittelwert 37 %; Stand.abw. 15,22%) Zunahme der Inanspruchnahme, die nach einem halben Jahr sogar auf 9,5 bis 66 % (Mittelwert 44 %; Stand.abw. 10,9 %) gestiegen war. Eine Studie ergab hingegen für jeweils zwei präventive und zwei kurative Nutzungsindikatoren einen Rückgang der Inanspruchnahme um 5,75 - 10,4 % (Mittelwert 8,9 %; Stand.abw. 2,8 %) unmittelbar nach Abschaffung der user fees bzw. um 0,16 - 6,8 % (Mittelwert 4,25 %; Stand.abw. 2,5%) nach sechs Monaten; allerdings war nach 12 und 18 Monaten auch hier ein Anstieg der Nutzung zu verzeichnen. Erhöhungen der Nutzergebühren, die zwischen 35,6 und 66 % (Mittelwert 44 %; Stand.abw. 8 %) variierten, verursachten nach den Ergebnissen von sechs Studien Rückgänge der Nutzung um 5 bis 47 % (Mittelwert 26 %; Stand.abw. 24%), während die Verringerung von Zuzahlungen um 25 - 75 % (im Mittel um 47 %) Steigerungen der Inanspruchnahme um 27 bis 280 % (Mittelwert 172 %; Stand.abw. 148%) nach sich zog.
Die genannten Änderungen waren von Fall zu Fall unterschiedlich und hingen vor allem auch der Art der betroffenen Gesundheitsleistungen ab, was insgesamt die Annahme verschiedener Preiselastizitäten bestärkt. Insbesondere, aber nicht nur bei präventiven Maßnahmen überstieg der Effekt nach sechs oder zwölf Monaten die spontanen Auswirkungen von Zuzahlungsänderungen. Trotz aller Kritik an den Unzulänglichkeiten der herangezogenen Studien ist die Schlussfolgerung der Autorinnen recht eindeutig: "Our findings broadly support the view that user fees present a barrier to access to curative health services for those groups who would be eligible to pay them. Therefore policy-makers willing to introduce user fees, should do so whilst bearing in mind the potential risks for access to health care for these populations" (S. 36).
Methodische und statistische Schwächen bemängeln sie vor allem bei den Studien, die BefürworterInnen von user fees gerne als Beleg für die Wirksamkeit dieser Maßnahme anführen. Zwei mit Weltbankbeteiligung in den 1990er Jahren entstandene Studien, nämlich User fees plus quality equals improved access to health care: Results of a field experiment in Cameroon von Jennie Litvack und Claude Bodart sowie The impact of alternative cost recovery schemes on access and equity in Niger von François Diop, Abdo Yazbeck und Ricardo Bitrán verwiesen auf steigende Inanspruchnahme im zeitlichen Zusammenhang mit der Einführung von Nutzergebühren. Die AutorInnen erklären dies ganz im Sinne der theoretischen Erwartungen an Nutzergebühren mit den Qualitätsverbesserungen und vor allem der zuverlässigen Verfügbarkeit von Arzneimitteln aufgrund der vermehrten Einnahmen der Gesundheitseinrichtungen - verdrängen aber bei der Interpretation ihrer Ergebnisse, dass internationale Entwicklungsinstitutionen genau diese Qualitätsverbesserungen finanzierten. Das ist vergleichbar mit der aktuellen Debatte über die leistungsabhängige Honorierung, deren Förderer geflissentlich übersehen, dass die verbesserte Behandlungsqualität vor allem auf zusätzliche externe Mittel und weniger auf performance-based payment zurückzuführen sein dürfte. Die Autorinnen der Cochrane-Analyse kritisieren zwar zu Recht die geringe Studiengröße und methodisch-statistische Schwächen, lassen diesen politisch motivierten Bias aber völlig außer Acht.
Damit zeigt sich eine Schwäche derartiger systematischer Analysen, die immer eine gewisse technokratische Perspektive mit sich bringen müssen, um die gewünschte methodische Rigidität zu erreichen. Der politischen, ökonomischen und sozialen Komplexität können stringente Metaanalysen nur eingeschränkt gerecht werden. Das erkennen auch Mylène Lagarde und Natasha Palmer: "Finally, the policy issues raised by the debate on user fees go beyond the question of their effects, which was the focus of this review. Issues of implementation have been underlined as key to understanding the reasons for the success or failure of such policies, in particular when they are implemented at the national level, in the complexity of a health system" (S. 36).
Auf den Seiten der Cochrane-Library steht zwar nur ein kostenfreies Abstract der relevanten und lesenswerten Metaanalyse von Lagarde und Palmer zum Download zur Verfügung. Allerdings stellt die WHO die Vollversion des Cochrane-Reviews The impact of user fees on access to health services in low and middle-income countries zum Download bereit. Einen Überblick über den Aufbau, die Untersuchungsfragen und die wichtigsten Ergebnisse liefert die Kurzfassung Do user fees have an impact on access to health services?. Und eine Kurzfassung mit den wichtigsten Ergebnissen ist in der Novemberausgabe des WHO-Bulletin von 2008 unter dem Titel The impact of user fees on health service utilization in low- and middle-income countries: how strong is the evidence? nachzulesen.
Jens Holst, 28.10.11
Kenia: Zwischen Armut, Hungerkatastrophe, Flüchtlingselend und Open data-Government 2.0
 Selbst nicht ohne interne Konflikte u.a. durch die spekulativ explodierenden Grundnahrungsmittelpreise und die vielfältigen Probleme einer armen Bevölkerung, beherbergt Kenia im Moment mit knapp 500.000 Hungerflüchtlingen vor allem aus Somalia das größte Hungerflüchtlingslager der Welt - alles in allem "eben typisch Afrika".
Selbst nicht ohne interne Konflikte u.a. durch die spekulativ explodierenden Grundnahrungsmittelpreise und die vielfältigen Probleme einer armen Bevölkerung, beherbergt Kenia im Moment mit knapp 500.000 Hungerflüchtlingen vor allem aus Somalia das größte Hungerflüchtlingslager der Welt - alles in allem "eben typisch Afrika".
Dass in Kenia mit dem "Kenyan Open Government Data Portal" oder "Kenya open data" auch ein vorbildliches, frei zugängliches Informationsportal mit einer Vielzahl von Volksbefragungs- und anderen, amtlichen oder halbamtlichen politischen, ökonomischen, sozialen und demografischen Daten existiert bzw. am Entstehen ist, ist leider weitgehend unbekannt. Das Niveau und die Performance der damit geschaffenen Transparenz oder des dadurch erhofften und möglichen "decision making" wird daher auch nicht inhaltlich oder gestalterisch als Vorbild für den Aufbau von "open data"-Infrastrukturen in Ländern wie Deutschland diskutiert.
Im Moment finden sich auf der Website mit unterschiedlichem regionalen und soziodemografischen Differenzierungsgrad über 160 Datensätze. Dazu gehören die Ergebnisse der kompletten 2009 durchgeführten Volksbefragung, Staatshaushaltsdaten, Übersichten zu den öffentlichen Ausgaben, Informationen über die Gesundheitsversorgung und über die schulischen Angebote, Armutsraten, Statistiken zur Wasserversorgung und den sanitären Verhältnissen, Entwicklungsindikatoren aber auch z.B. ein Vergleich der Anzahl der Kinder, die in einem Bett mit Mückennetz schlafen und dem Anteil der im selben Landkreis an Malaria erkrankten Personen. Bei der Aufbereitung der Daten gibt es für jedwede Gewohnheit sich Daten anzueignen ein oft interaktives Angebot: Dies reicht von Landkarten, über Faktenblätter für jeden Landkreis bis zu Tabellen und Grafiken.
Wer noch mehr analysieren will und eigene Darstellungsformen von Ergebnissen präferiert, kann dies auch mit herunterladbare Originaldatensätzen angehen. Der Hinweis, die vorliegenden Informationsangebote seien "just a taste of what's to come", läßt noch viel auf dem selbst erklärten Weg zur "Government 2.0 inKenya" erwarten.
Viel erwarten sich die Verantwortlichen der Website dazu von einer interessanten und nachahmenswerten Erweiterung des "open data"-Systems um "Public health"-Potenzial und soziale Netzwerkkommunikation. Für jeden der NutzerInnen besteht nämlich die Möglichkeit, gesuchte und nicht gefundene Informationen zur Aufnahme in das System vorzuschlagen. Der Wunsch wird öffentlich gemacht und kann weiter kommentiert werden. Der weitere Umgang mit den Vorschlägen wird differenziert dokumentiert. Es werden von den Statistikexperten zurückgewiesene, offene und anerkannte Vorschläge unterschieden. Beispielsweise schlägt am 8.Juli 2011 ein Nutzer des Informationssystems vor, Details der Landregistrierung und die registrierten Namen unter Berücksichtigung der Veränderungen im Laufe der Zeit zu veröffentlichen. Neben einem zustimmenden Kommentar eines Bürgers, wies ein bei der Weltbank in Kenia beschäftigter Experte am 14. August 2011 darauf hin, dass im Moment die gewünschten Unterlagen im zuständigen Ministerium digitalisiert würden und so schnell wie möglich öffentlich zugänglich sein werden.
Die Website "Kenya open data" ist kostenlos zugänglich.
Bernard Braun, 17.8.11
Subjektive Gründe für Zugangsprobleme zur gesundheitlichen Versorgung? Zur Bedeutung der Annahme, Zugangsbarrieren seien "normal".
 Zahlreiche organisatorische, finanzielle, soziale oder räumliche Barrieren verhindern in allen Gesundheitssystemen bestimmten Bevölkerungsgruppen, die oft zugleich den größten Versorgungsbedarf haben, den Zugang zu für sie notwendigen Leistungen. Die Gründe für die Existenz und Persistenz solcher Hindernisse sind vielfältig und überwiegend auch politisch beeinflussbar.
Zahlreiche organisatorische, finanzielle, soziale oder räumliche Barrieren verhindern in allen Gesundheitssystemen bestimmten Bevölkerungsgruppen, die oft zugleich den größten Versorgungsbedarf haben, den Zugang zu für sie notwendigen Leistungen. Die Gründe für die Existenz und Persistenz solcher Hindernisse sind vielfältig und überwiegend auch politisch beeinflussbar.
Auf eine qualitativ sehr spezielle und beeinflussbare subjektive oder sozio-mentale Barriere auf Seiten der Personen, die einen Versorgungsbedarf haben, weist nun eine kleine qualitative Studie auf der Basis von Interviews mit 13 Frauen im Alter von 24 bis 77 Jahren aus Kolumbien hin. Die Frauen hatten unterschiedliche sozio-kulturelle und ökonomische Hintergründe. In den Interviews ging es um von den Frauen wahrgenommene Barrieren zu einer rechtzeitigen Diagnostik und Behandlung von Brustkrebs.
Eine wichtige Erschwernis war, dass die meisten Frauen die Barrieren mangels Systemkenntnissen überhaupt nicht als solche erkannten. Als zweite Barriere nannten die WissenschaftlerInnen das Phänomen, dass viele Frauen die Existenz von Barrieren, eines erschwerten Leistungszugang und eines geringeren Gesundheitsversorgungsniveaus als völlig normal oder "natürlich" betrachteten ("normalization of health care system barriers") und nicht entfernt auf den Gedanken kamen, daran etwas ändern zu können.
Auch wenn die Verallgemeinerbarkeit dieser Beobachtungen sowohl für Kolumbien als auch andere Länder nicht gesichert ist, sollte in künftigen Studien auf die Möglichkeit einer derartigen Normalitätsannahme geachtet werden. Wenn ein solches Paradigma wirklich so bedeutend ist, stellt sich allerdings die Frage, ob die in der kolumbianischen Studie geäußerte Hoffnung, dieses Paradigma zu erschüttern oder zu beseitigen, nicht seine Persistenz unterschätzt.
Der komplette Text der im Mai 2011 nur in Spanisch veröffentlichten Studie Acostumbrarse a las barreras: Estudio cualitativo de las barreras del sistema de salud colombiano para el diagnóstico y tratamiento oportuno de cáncer de mama von Clara Victoria Giraldo und Grey Yuliet Ceballos G. ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 21.6.11
Steuerung durch Kassenwettbewerb - wenn ja, wie viel?
 Seit etlichen Jahren bestimmt ein Thema zu beachtlichen Teilen die gesundheitspolitische Debatte in Deutschland und anderswo. Wettbewerbselemente sollen die Effizienz des Gesundheitswesens steigern und zur Kostendämpfung beitragen. Während der Wettbewerb unter Leistungserbringern vor allem im ambulanten Bereich bisher kaum eine Rolle spielt, hat die Politik seit den 1990er Jahren auf der Finanzierungsseite Marktelemente eingeführt. Der Kassenwettbewerb hat das bisher eher beschaulich-bürokratische Dasein der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) erschüttert und die Zahl der öffentlichen Kassen in einen Bereich verringert, den man auch ohne Kenntnis der Vorgeschichte der sozialen Krankenversicherung in Deutschland akzeptieren mag.
Seit etlichen Jahren bestimmt ein Thema zu beachtlichen Teilen die gesundheitspolitische Debatte in Deutschland und anderswo. Wettbewerbselemente sollen die Effizienz des Gesundheitswesens steigern und zur Kostendämpfung beitragen. Während der Wettbewerb unter Leistungserbringern vor allem im ambulanten Bereich bisher kaum eine Rolle spielt, hat die Politik seit den 1990er Jahren auf der Finanzierungsseite Marktelemente eingeführt. Der Kassenwettbewerb hat das bisher eher beschaulich-bürokratische Dasein der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) erschüttert und die Zahl der öffentlichen Kassen in einen Bereich verringert, den man auch ohne Kenntnis der Vorgeschichte der sozialen Krankenversicherung in Deutschland akzeptieren mag.
Neuen Auftrieb erhält die Idee von der steuernden Wirkung des Kassenwettbewerbs allerdings durch die neueste Entwicklung in Deutschland. Dafür sorgt der Zusatzbeitrag, den bereits die Große Koalition der GKV zugestanden hat, um finanzielle Engpässe oder Dauermängel zu überwinden. Vor einiger Zeit kam es zu einem zunehmenden Wechsel von den Kassen, die den Zusatzbeitrag bereits erheben, zu solchen, die bisher nicht mehr als den 14,9-prozentigen Beitrag kassieren. Der Stern hatte sogar nachgezählt und meldete 500.000 wechseln Kasse. Der einkommensunabhängige Festbeitrag treibt in erster Linie Hartz-IV-EmpfängerInnen und RentnerInnen in die Flucht zu derzeit preisgünstigeren Kassen. Wettbewerb bedeutet eben immer auch Selektion. Und in diesem Fall gewährleistet er, dass alsbald auch die anderen Krankenkassen einen Zusatzbeitrag erheben müssen. Dank letzten Reformmaßnahme von Gesundheitsminister Philipp Rösler, die eine Verdoppelung des maximalen Belastungsanteils von einem auf zwei Prozent des Einkommens durch Zusatzbeiträge erlaubt, wird der Kassenwettbewerb noch effizienter die Gruppe aus den Versicherungen heraustreiben, die die geringsten Beiträge leisten und den größten Behandlungsbedarf haben. Schließlich soll Kassenwettbewerb ja die Effizienz steigern.
Theorien und Ideen sind ja eine schöne Sache - doch was steckt wirklich hinter dem gesundheitspolitischen Mantra des Krankenkassenwettbewerbs? Zu dieser Frage veröffentlichte die Zeitschrift Health Expectations kürzlich eine interessante niederländische Studie mit dem Titel The intention to switch health insurer and actual switching behaviour: are there differences between groups of people?. Darin untersuchen die Wissenschaftler von Zentrum für Versorgungsforschung in Utrecht gemeinsam mit Kollegen von der dortigen Universität die Bereitschaft von Versicherten, ihre Krankenkasse zu wechseln, und verglichen dies mit der Zahl der tatsächlichen Kassenwechsler nach einem gegebenen Stichtag.
Im Oktober 2006 gaben nur 166 von 12.249 befragten NiederländerInnen, also gerade einmal (1,4 %) an, ihre Krankenkasse zum Jahresende wechseln zu wollen; die große Mehrheit der Kohorte, nämlich 10 547 bzw. 86 % der Befragten beabsichtigten keinen Kassenwechsel, und die übrigen 1.536 (13%) wussten nicht, ob sie ihre Krankenversicherung wechseln würden. Dabei zeigten Frauen, ältere Menschen und solche mit geringerer Bildung, langjährige Mitglieder einer Versicherung und Personen mit schlechtem oder mäßigem Gesundheitszustand weniger geneigt, ihre Krankenkasse zu wechseln.
Nach dem Jahreswechsel, an dem ein Kassenwechsel möglich war, wechselten allerdings nur 31 % der wechselwilligen Befragten tatsächlich ihre Kasse, während 39 % bei ihrer vorherigen Versicherung geblieben waren. Immerhin 164 Personen bzw. 2 % aus der großen Gruppe der wechselwilligen Versicherten und 72 bzw. 7 % der zuvor Unentschiedenen gehörten nach dem Jahreswechsel einer anderen Kasse an, so dass in absoluten Zahlen mehr wechselunwillige als -willige tatsächlich eine neue Kasse bevorzugten.
Bezogen auf frühere Einschätzungen beispielsweise von Maarse und Kollegen in Health Care Analysis, 2006; 14 (1): 37-49 ziehen die Autoren eine eher ernüchternde Schlussfolgerung: " We might have to temper the optimistic expectations on enhanced choice". Was sie allerdings nicht davon abhält, immanent in der Logik des Kassenwettbewerbs zu verharren: "Future research should determine why people do not switch health insurer when they intend to and which barriers they experience."
Ein paar Anregungen aus einer Untersuchung über die Gründe der Nichtnutzer der Kassenwahlfreiheit in Deutschland aus dem Zentrum für Soizialpolitik der Universität Bremen, finden sich in einem früheren "Forum-Gesundheitspolitik-Beitrag". Maßgeblich sind dafür Wechselbarrieren verantwortlich, die aus grundlegenden Missverständnisse der Effekte des Kassenwechsel bestehen.
Von dem Artikel von Groenewegen und KollegInnen steht kostenlos nur das Abstract zur Verfügung.
Jens Holst, 10.11.10
Trotz einem Positivlisten-System für Arzneimittel: Frankreich fast immer in der Spitzengruppe des Arzneimittelmarktes dabei!
 Im Herbst 2009 hat ein bei SPIEGEL-Online veröffentlichter Artikel über das Preisdiktat der Pharmaindustrie in Deutschland auf einen interessanten externen Effekt der deutschen Verhältnisse hingewiesen: "Im europäischen Ausland gilt Deutschland wegen dieser Einzigartigkeit als Referenzmarkt - zur Freude der dortigen Behörden. In Frankreich zum Beispiel wartet man gern, welchen Preis die Hersteller in Deutschland den Kassen diktieren. Dort hat die Pharmaindustrie dann wenig zu melden - sogenannte Verhandlungen laufen vielmehr nach dem Prinzip: Preis in Frankreich = deutscher Preis minus 20 Prozent." (SPIEGEL-Online 8.10.2009)
Im Herbst 2009 hat ein bei SPIEGEL-Online veröffentlichter Artikel über das Preisdiktat der Pharmaindustrie in Deutschland auf einen interessanten externen Effekt der deutschen Verhältnisse hingewiesen: "Im europäischen Ausland gilt Deutschland wegen dieser Einzigartigkeit als Referenzmarkt - zur Freude der dortigen Behörden. In Frankreich zum Beispiel wartet man gern, welchen Preis die Hersteller in Deutschland den Kassen diktieren. Dort hat die Pharmaindustrie dann wenig zu melden - sogenannte Verhandlungen laufen vielmehr nach dem Prinzip: Preis in Frankreich = deutscher Preis minus 20 Prozent." (SPIEGEL-Online 8.10.2009)
Bei der Zulassung von Arzneimitteln zur Verordnung auf Kosten der Gesetzlichen Krankenversicherung wird in Frankreich aber nicht nur auf die Deutschen gewartet. Es existieren vielmehr eine Reihe von Maßnahmen, Instrumenten und Prozeduren, die auch in Frankreich so etwas wie die Quadratur des Kreises hinbekommen sollen: So viel qualitativ hochwertige, d.h. wirksame und nützliche Arzneimittel wie nötig und diese einem möglichst fairen Preis.
Eines dieser in Frankreich und einer ganzen Reihe anderer europäischer Länder existierenden Instrumente ist ein differenziertes System von Positivlisten, also jener unter primär pharmakologischen und medizinischen Kriterien gebildeten Listen, auf denen nicht mehr jedes von den nationalen oder internationalen Zulassungsbehörden zugelassene Arzneimittel steht, sondern wesentlich weniger und auf ihre Wirksamkeit überprüfte.
In Deutschland gab es zwar 1993 und zuletzt 2003 wiederholte Anläufe ein Positivlistensystem einzuführen und es gab sogar schon fertige Listen. Doch ausgerechnet der heutige Kopfpauschalen-Rebell Horst Seehofer knickte als damaliger Bundesgesundheitsminister so tief vor der Pharmaindustrie ein, dass er 1995 die fertige Liste in einem Akt politischer Pornografie schreddern ließ und die in einen Plastiksack gepackten Schnipsel durch seinen Staatssekretär Baldur Wagner dem Präsidenten des Bundesverband der pharmazeutischen Industrie, Hans-Rüdiger Vogel, als Geburtstagsgeschenk überreichen ließ (der Beleg findet sich u.a. in einem umfassenden Text über die Pharmalobby auf der Seite 141).
Außerdem gibt es in Frankreich die "Haute Autorité de Santé (HAS)", die ähnlich wie das deutsche "Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen" - aber schon etwas länger und deswegen produktiver - die entscheidende Einrichtung für die Benennung von Kosten-Nutzenrelationen für Arzneimittel aber auch andere Medizinprodukte ist. Zu dem, was die HAS ist und was sie macht, findet sich auf ihrer Website eine ganze Menge und speziell unter der Überschrift "Key facts and figures" zahlreiche Daten und Arbeitsüberblicke für die letzten Jahre. Die meisten Dokumente stehen in französischer und englischer Sprache zur Verfügung.
Wie das französische System der Positivlisten, der HAS und weiterer Prozeduren gesetzlich fundiert ist und wie es zu welchen Grundlagen für die Regulierung von Menge, Preis und Qualität der Arzneimittelversorgung durch die Gesetzliche Krankenversicherung kommt, ist in einem aktuellen Text der französischen Medizinerin und Kennerin des dortigen Gesundheitssystems, Dr. Ursula Descamps, übersichtlich dargestellt. Dort wird sehr gut die Komplexität dargestellt, welche die Maßnahmen, die diese Ziele erreichen will, in Frankreich erreicht haben. Und natürlich versucht auch in Frankreich die Pharmaindustrie Einfluss auf die Positionierung innerhalb der Positivlisten zu nehmen.
Das damit in der Struktur deutlich andere System der Arzneimittelregulation muss sich aber auch auf dem Prüfstand der empirischen Wirksamkeit bewähren.
Ein systematischer internationaler Vergleich wichtiger Indikatoren des Arzneimittelgeschehens mit den OECD-Health Data 2009, zeigt, dass auch die Wirksamkeit des französischen Systems der Zulassung von Arzneimitteln als Leistung der gesetzlichen Krankenkassen nicht so aussieht wie es dort und von denjenigen, die von Positivlisten spürbare Effekte erwartet wird:
• Frankreich belegt bei den Arzneimittelausgaben (in Kaufkraftparitäten - PPP) mit 711 PPP pro Kopf Rang 3 (Deutschland mit 656 PPP: Rang 6)
• Frankreich erreicht bei dem Anteil sämtlicher Arzneimittelausgaben an den gesamten Gesundheitsausgaben mit 16,3 % Rang 11 (Deutschland mit 15,1 % Rang 13)
• Beim Anteil öffentlich finanzierter Arzneimittelausgaben pro Kopf liegen Frankreich und Deutschland auf dem zweiten und ersten Platz.
• Und auch beim Anteil der öffentlich finanzierten Arzneimittelausgaben an sämtlichen Ausgaben für Arzneimittel liegen beide Länder in der Spitzengruppe: In Deutschland sind dies 75,9 %, was es auf Platz 1 bringt. In Frankreich 69,4 % und Platz 4.
Auch wenn diese Verhältnisse nicht als absoluter Beleg für die völlige Nutzlosigkeit eines Positivlistensystems interpretiert werden sollten, zeigen sie aber, dass es sich auch bei Positivlisten um kein selbstlaufendes Patentrezept oder Wundermittel handelt. Ähnlich wie in dem von der Anzahl der Instrumente her überregulierten deutschen Arzneimittelsystem kommt es wahrscheinlich auf eine Kombination von Maßnahmen an.
Die kurze informative Übersicht " Zulassung zur Kostenübernahme durch die Krankenversicherung, Kosten-Nutzen-Evaluation, Preisfestsetzung von Arzneimitteln in Frankreich" von U. Descamps kann kostenlos heruntergeladen werden.
Bernard Braun, 20.6.10
Santé à la francaise: Croissants, petit rouge, savoir de vivre. Aber in welchem Gesundheitssystem? Beispiel ambulante Versorgung
 Geht es in Deutschland um Gesundheitssysteme, an denen sich die Gesundheitspolitiker ein Beispiel nehmen sollten, gehören die Niederlande oder die Schweiz und wenn "wir" unter gar keinen Umständen ein System übernehmen wollen, die USA oder Großbritannien seit Jahrzehnten zu den "guten" oder "schlechten" Vorbildern.
Geht es in Deutschland um Gesundheitssysteme, an denen sich die Gesundheitspolitiker ein Beispiel nehmen sollten, gehören die Niederlande oder die Schweiz und wenn "wir" unter gar keinen Umständen ein System übernehmen wollen, die USA oder Großbritannien seit Jahrzehnten zu den "guten" oder "schlechten" Vorbildern.
Wie sind aber eigentlich die BürgerInnen Frankreichs, immerhin dem größten Nachbarland der Bundesrepublik Deutschland, krankenversichert? Wird auch in Frankreich der Großteil der gesundheitlichen Versorgung von niedergelassenen Allgemein-und Fachärzten getragen? Was passiert mit pflegebedürftigen demenzkranken FranzösInnen? Erfolgt die Finanzierung des Gesundheitssystems durch Beiträge, Gesundheitsprämien oder aus dem Steuersäckel? All dies ist hierzulande nicht nur aber auch wegen der trotz jahrzehntelanger deutsch-französischer Verständigung mageren Sprachkenntnisse auf beiden Seiten des Rheins unbekannt. Es bewegt sich im Bereich von "Halbbildung" oder wird nur dann punktuell etwas näher beleuchtet, wenn in Frankreich während einer sommerlichen Hitzeperiode zahlreiche ältere BürgerInnen schwer erkranken oder sterben. Gegen diese Wissensmängel tut bislang auch das "forum-gesundheitswissenschaft" praktisch nichts.
Dies soll langsam etwas besser werden und zwar durch eine Mischung von aktuellen Überblicksartikeln zu wichtigen Aspekten des französischen Gesundheitssystems, die von in Frankreich lebenden und mit dessen Gesundheitssystem vertrauten AutorInnen in deutscher Sprache geschrieben werden und daneben durch Expertisen und Studien in französischer aber auch englischer Sprache erfolgen.
Beginnen wollen wir mit einem deutschsprachigen Beitrag der französischen Ärztin Ursula Descamps über das aktuelle, d.h. erst im Jahr 2009 gründlich reformierte System der ambulanten gesundheitlichen Versorgung in Frankreich. Der Beitrag gibt einen kurzen aber sehr differenzierten Überblick über die
• Arten von ambulanten Leistungserbringern,
• die Organisationsformen für freiberufliche Leistungserbringer,
• den Zugang zur Versorgung,
• die Honorarstruktur,
• die Modalitäten der Kostenübernahme,
• die Niederlassung und Zulassung der Leistungserbringer,
• die Organisation der Leistungserbringer, Regulation und Vertragsgestaltung im ambulanten Bereich und
• die Demografie der Leistungserbringer.
Die Darstellung wird durch zwei Tabellen über die Entwicklung der ambulanten Leistungserbringer und der ambulanten Fachärzte abgeschlossen.
Der 11 Seiten umfassende aktuelle Beitrag über "Die ambulante Versorgungssituation in Frankreich" von Ursula Descamps ist hier frei erhältlich.
Wer sich zusätzlich einen ersten allerdings leider an wichtigen Punkten veralteten Gesamtüberblick über das französische Gesundheitssystem verschaffen will, kann dies mit dem Landes-Band der "Health Systems in Transition (HiT)"-Reihe des WHO-Projektes "European Observatory on Health Systems and Policies" mit Stand 2003 ebenfalls kostenlos machen.
Bernard Braun, 16.5.10
Von der Langsamkeit der Implementation und des Wirksamwerdens evidenter Behandlungs-Leitlinien. Ein Beispiel aus "down under".
 Trotz ausreichender wissenschaftlicher Evidenz für wirksame Behandlungsweisen selbst häufiger Krankheiten und entsprechenden Behandlungsleitlinien medizinischer Fachgesellschaften, erhalten diese gerade die Zielpersonen mit dem größten Bedarf am seltensten oder gar nicht.
Trotz ausreichender wissenschaftlicher Evidenz für wirksame Behandlungsweisen selbst häufiger Krankheiten und entsprechenden Behandlungsleitlinien medizinischer Fachgesellschaften, erhalten diese gerade die Zielpersonen mit dem größten Bedarf am seltensten oder gar nicht.
Dass dies so ist und offensichtlich auch ein weltweites Problem darstellt, zeigt ein am 30. Dezember 2009 in der Fachzeitschrift "Australia and New Zealand Health Policy" veröffentlichter Aufsatz über die Versorgung der australischen Aborigines und einer weiteren ethnischen Ureinwohnergruppe (der "Torres Strait Islander people") mit rehabilitativen und sekundärpräventiven Maßnahmen für Herzkranke. Kardiovaskuläre Erkrankungen stellen die Hauptursache der frühzeitigen Sterblichkeit dieser indigen Bevölkerungsgruppen Australiens dar. Anders als in der weißen Bevölkerung Australien nimmt die Inzidenz koronarer Herzkrankheiten bei der indigenen Bevölkerung nicht ab, sondern bis in die Gegenwart hinein sogar zu. Zugleich gibt es ausreichende Evidenz für die Wirksamkeit und den Nutzen kardiologischer Rehabilitation und sekundärpräventiver Interventionen für die Erkrankungsverläufe und die Sterblichkeit an diesen Krankheiten.
Deshalb publizierte das "National Health and Medical Research Council (NHMRC)" 2005 die Leitlinie "Strengenthing Cardiac Rehabilitation and Secondary Prevention for Aboriginal and Torres Strait Islander peoples". Sie sollte in übersichtlicher Listenform vor allem Angehörigen der für Rehabilitation und Sekundärprävention zuständigen Gesundheitsdienste Anleitung für gezielte, spezielle rehabilitative Angebote für herzkranke Aborigines an die Hand geben.
Um zu erfahren wie die Leitlinie im Versorgungsalltag angekommen ist, befragten Gesundheitswissenschaftler zwischen Ende 2007 und Mitte 2008 in halbstrukturierten mündlichen Interviews 24 Gesundheitsprofessionals aus 10 ländlichen und 7 städtischen Gesundheitsdiensten in Westaustralien nach ihrer Wahrnehmung der Leitlinie in ihrem beruflichen Alltag und den möglichen Barrieren oder Förderfaktoren für eine leitliniengerechte Behandlung der an Herzerkrankungen leidenden Ureinwohner.
Die Ergebnisse sahen folgendermaßen aus:
• Nur 25 Prozent der befragten Spezialisten für diese Versorgungsangebote berichteten, die Leitlinien erhalten zu haben. Von diesen Befragten konnten sich dann aber nur wenige an spezifische Elemente oder Empfehlungen erinnern oder angeben, wie sie versucht hatten, die Ansätze in ihrer beruflichen Umgebung zu implementieren.
• Durchweg nur Minderheiten der Befragten (maximal 30 Prozent) hatten spezielle Kontakte und gemeinsame Aktivitäten mit dem "Aboriginal Medical Service (AMS)" oder waren an Überweisungen von Erkrankten in die Rehabilitation beteiligt. Knapp 9 Prozent gaben an, beim Design und der Art und Weise der Gewährung von kardiologischer Rehabilitation Inputs von Aborigines-Gemeinden berücksichtigt zu haben.
• Von den Rehabilitationsexperten, die überhaupt indigene PatientInnen während eines Krankenhausaufenthalts aufsuchten, sprachen 29 Prozent mit den PatientInnen über die Wichtigkeit von Rehabilitation. Die Mehrheit der für Rehabilitation und Sekundärprävention verantwortlichen Befragten hatte keinen Einblick in die stationäre Krankheits- und Behandlungsgeschichte dieser PatientInnen und hatte keinen Zugang zu spezifischen Erziehungsprogrammen der indigenen Personen. Nur eine kleine Minderheit verfügte daher auch über Programme und Versorgungskonzepte welche die spezifische Kultur der Aborigines berücksichtigten.
• Aber auch andere Leistungserbringer wie beispielsweise Ärzte aus "tertiary hospitals" welche PatientInnen weiter betreuten, die nach einem kardiologischen Krankheitserlebnis in ihre Wohnumgebung zurückkehrten, nahmen Kontakt zu den Rehabilitationsexperten auf. Nur 8 Prozent von ihnen berichteten von solchen Kontaktaufnahmen. Nur einer der Interviewten berichtete von einem speziellen nachstationären Mentorenprogramm, das u.a. mit Bildungsmaterialien arbeitete, die auf die speziellen subjektiven und objektiven Bedingungen der indigenen PatientInnen eingingen.
• 54 Prozent der Befragten hatten Zugang zu verantwortlichen Vertretern der beiden Ureinwohnergruppen, was ein Haupthindernis darstellt, diese Bevölkerungsgruppen in die Versorgung einzubeziehen.
• Zu den Barrieren, welche den Zugang der indigenen PatientInnen zu den hier betrachteten Leistungen verhinderten, zählten die befragten Leistungserbringer deren familiäre Verpflichtungen und Restriktionen, den Mangel an Bewusstsein über erhältliche Leistungen, Mangel an Transportmöglichkeiten oder finanzielle Hindernisse. Viele der Leistungserbringer bieten ihre Leistungen auch nur zeitlich begrenzt an und verschlimmern damit die Zugangsschwierigkeiten durch lange Anreisewege.
• Alles in Allem fanden die ForscherInnen in Westaustralien keinerlei Hinweise auf systematische Implementationsstrategien oder Strategien zur Bewertung des Versorgungsergebnisses.
• Last not least spielen natürlich die extrem schlechten sozialen und gesundheitlichen Bedingungen der indigenen Minderheiten in Australien eine Rolle. Sie sind wesentlich durch die jahrhundertelangen politischen, kulturellen und gesellschaftlichen Interventionen der weißen Mehrheit in Australien geprägt.
Zu den auch hierzulande relevanten Schlussfolgerungen der australischen WissenschaftlerInnen für eine erfolgreichere Implementation, Verbreitung und Nutzung von evidenten Behandlungs-Leitlinien im Gesundheitswesen gehört die Erkenntnis, dass dies komplexe Prozesse mit vielen Facetten sind und gleichzeitig subjektive (z.B. Kommunikationsbereitschaft und -fähigkeit zwischen Akteuren unterschiedlicher Versorgungssektoren) und objektive (z.B. Umgang mit Stadt-Land-Gefälle) Bedingungen des Gesundheitssystems, der Patienten und der Leistungserbringer beachtet werden müssen. Klar ist auch: "No one single strategy is adequate."
Dass selbst solche Hinweise noch lange keine Handlungen auslösen müssen, zeigen die AutorInnen indirekt. Iht Hinweis, man könne durch eine Beteiligung von Patienten und Leistungserbringern an der Entwicklung der technischen Umsetzung von Leitlinien und durch materielle oder immaterielle Anreize eine erfolgreiche Implementation erreichen, stützt sich nämlich auf die Ergebnisse von Studien aus den 1990er Jahren, die offensichtlich noch nicht in das Repertoire der Selbstverständlichkeiten gesundheitspolitischer Interventionen eingegangen sind.
Auch wenn diese Studie eine Reihe methodischer, quantitativer und Repräsentations-Grenzen aufweist, demonstriert sie das Risiko allein auf Selbstläufer, "magic buletts" oder "Patentrezepten" zu vertrauen und die Notwendigkeit wie den potenziellen Nutzen identischer oder auch aufwändigerer Studien über die Umsetzung und Wirkung von Leitlinien auch in Deutschland.
Der 16 Seitenaufsatz "Are the processes recommended by the NHMRC for improving Cardiac Rehabilitation (CR) for Aboriginal and Torres Strait Islander people being implemented?: an assessment of CR Services across Western Australia von Thompson SC, DiGiacomo ML, Smith JS, Taylor KP, Dimer L, Ali M, Wood MM, Leahy TG und Davidson PM ist am 30. Dezember 2009 in der Fachzeitschrift "Australia and New Zealand Health Policy" (2009, 6:29) und in einer provisorischen PDF-Fassung komplett erhältlich.
Bernard Braun, 3.1.10
Ansätze der Regionalisierung von sozialer Sicherung
 Im Zuge der anhaltenden Globalisierung und mit beständigem Anstieg der internationalen Wirtschaftsbeziehungen und der Migration entstehen nicht nur neue Herausforderungen für die Gesundheit, sondern zunehmend auch für die soziale Absicherung der Menschen. Soziale Sicherungssysteme sind traditionell auf nationalstaatlicher Ebene angelegt und werden den sich verändernden Anforderungen in der globalisierten Welt immer weniger gerecht. Um den neuen internationalen Herausforderungen besser begegnen zu können, schließen sich die Länder weltweit in regionalen Wirtschaftblöcken zusammen, die in erster Linie verbesserten Handelsbeziehungen und forcierter Wirtschaftsentwicklung dienen. Über die ökonomischen Ziele hinaus bieten regionale Wirtschaftsblöcke aber auch die Erfordernis und die Chance, die soziale Absicherung der BürgerInnen zu verbessern und insbesondere auf die gesamte Region auszuweiten. Dies hängt allerdings von den jeweils vorhandenen Gesellschaftsvorstellungen, Werten und Prioritätensetzungen ab. Ein soeben erschienener Artikel aus The Open Health Services and Policy Journal untersucht die sozialpolitischen Strategien und Erfahrungen der Europäischen Union (EU), des südamerikanischen MERCOSUR und der Nordamerikanischen Freihandelszone NAFTA. Gerade aus der recht unterschiedlichen Entwicklung dieser drei Wirtschaftsblöcke lassen sich grundlegende Lehren und Empfehlungen ableiten, deren Bedeutung in Zukunft zweifellos steigen wird.
Im Zuge der anhaltenden Globalisierung und mit beständigem Anstieg der internationalen Wirtschaftsbeziehungen und der Migration entstehen nicht nur neue Herausforderungen für die Gesundheit, sondern zunehmend auch für die soziale Absicherung der Menschen. Soziale Sicherungssysteme sind traditionell auf nationalstaatlicher Ebene angelegt und werden den sich verändernden Anforderungen in der globalisierten Welt immer weniger gerecht. Um den neuen internationalen Herausforderungen besser begegnen zu können, schließen sich die Länder weltweit in regionalen Wirtschaftblöcken zusammen, die in erster Linie verbesserten Handelsbeziehungen und forcierter Wirtschaftsentwicklung dienen. Über die ökonomischen Ziele hinaus bieten regionale Wirtschaftsblöcke aber auch die Erfordernis und die Chance, die soziale Absicherung der BürgerInnen zu verbessern und insbesondere auf die gesamte Region auszuweiten. Dies hängt allerdings von den jeweils vorhandenen Gesellschaftsvorstellungen, Werten und Prioritätensetzungen ab. Ein soeben erschienener Artikel aus The Open Health Services and Policy Journal untersucht die sozialpolitischen Strategien und Erfahrungen der Europäischen Union (EU), des südamerikanischen MERCOSUR und der Nordamerikanischen Freihandelszone NAFTA. Gerade aus der recht unterschiedlichen Entwicklung dieser drei Wirtschaftsblöcke lassen sich grundlegende Lehren und Empfehlungen ableiten, deren Bedeutung in Zukunft zweifellos steigen wird.
So kann man die EU im Bereich Gesundheits- und Sozialpolitik trotz der Kontroversen und zum Teil berechtigten Kritik an der Ausrichtung des Lissabon-Vertrags zweifelsohne als sozialpolitischen Pionier der Freihandelszonen bezeichnen. Auch wenn Gesundheits- und Sozialpolitik bis heute eine Angelegenheit der Mitgliedsstaaten ist, sind vielerorts grenzüberschreitende Versorgungs- und Sicherungsstrukturen gewachsen. Vor allem aber sind mittlerweile viele soziale Ansprüche, die EU-Bürger in einem Land erworben haben, in allen Staaten der Gemeinschaft einlösbar, beispielsweise Rentenansprüche und medizinische Versorgung. Der MERCÒSUR (Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay sowie Venezuela als formales und Bolivien, Chile und Peru als assoziierte Mitglieder) ist zwar von dieser Portabilität von sozialen Ansprüchen und regionaler sozialer Absicherung noch meilenweit entfernt, hat aber einige Regelungen eingeführt, die der zunehmenden Migration insbesondere aus den ärmeren in die wohlhabenderen Mitgliedsstaaten Rechnung trägt. Die MERCOSUR-Länder beobachten sehr aufmerksam die Geschehnisse in Europa und verfügen bei aller Unterschiedlichkeit der sozialen und ökonomischen Entwicklung über vergleichbare sozialstaatliche Vorstellungen. Dies kann man von der NAFTA nicht behaupten, die in starkem Maße von den USA geprägt ist und deren Freizügigkeiten sich bis heute Güter und Dienstleistungen, aber nicht auf Menschen bezieht. Wo die reichen Länder die Migration aus dem ärmsten Mitgliedsstaat unterdrücken bzw. ausschließlich nach eigenem Bedarf zulassen, besteht kein spürbarer Bedarf an grenzüberschreitender sozialer Sicherung. Die Tatsache, dass die USA bis heute ein sozialpolitisches Entwicklungsland sind, das im Unterschied sowohl zu Kanada als auch zu Mexiko keinen Anspruch auf universelle Krankenversicherung durchsetzen konnte, wirkt sich hemmend auf die Regionalisierung der sozialen Sicherung in der NAFTA aus.
Der Artikel The Potential of Regional Trade Agreements for Extending Social Protection in Health: Lessons Learned and Emerging Challenges ist kostenfrei in der Open-Access zeitschrift The Open Health Services and Policy Journal 2, pp. 84-93 herunterzuladen.
Den Download ohne weitere Suche in der Online-Zeitschrift können Sie hier starten.
Jens Holst, 17.12.09
Was kinderfreundliche Menschen beim "Genuss" einer Zigarette wissen sollten! "Tabakrauchen tötet", aber ist Tabak vorher harmlos?
 Über einen Teil der gesundheitlichen Risiken des Tabakkonsums kann man sich seit ein paar Wochen im Tabak-Atlas Deutschland informieren. Welche gesundheitlichen und sozialen Probleme bereits vor dem Anstecken einer Zigarette, also beispielsweise durch den Anbau und die Ernte von Tabak, entstehen und wer davon betroffen ist, zeigt nun exemplarisch ein Bericht der vor allem in der 3. Welt aktiven Kinderhilfsorganisation Plan International für das Dritte-Welt-Land Malawi.
Über einen Teil der gesundheitlichen Risiken des Tabakkonsums kann man sich seit ein paar Wochen im Tabak-Atlas Deutschland informieren. Welche gesundheitlichen und sozialen Probleme bereits vor dem Anstecken einer Zigarette, also beispielsweise durch den Anbau und die Ernte von Tabak, entstehen und wer davon betroffen ist, zeigt nun exemplarisch ein Bericht der vor allem in der 3. Welt aktiven Kinderhilfsorganisation Plan International für das Dritte-Welt-Land Malawi.
Malawi ist einer der größten Tabakproduzenten weltweit. In dem südostafrikanischen Land verdienen vier Fünftel der Menschen ihren Lebensunterhalt direkt oder indirekt mit dem Anbau von Tabak. In Malawi arbeiten außerdem schätzungsweise 78.000 Kinder auf Tabakplantagen. Zum Teil sind sie erst fünf Jahre alt. Im Schnitt zahlen ihnen die als Arbeitgeber fungierenden multinationalen Tabakproduzenten 17 US-Cent pro Tag. Die Studie von Plan International kommt zu dem Ergebnis, dass die Kinder durch das ständige Berühren der Pflanzen und das Einatmen des Staubes bis zu 54 Milligramm Nikotin täglich aufnehmen, eine Menge, die der beim Rauchen von 50 Zigaretten entspricht. Da sie ohne Handschuhe und Atemschutz arbeiten, leiden viele unter der so genannten grünen Tabakkrankheit. Diese äußert sich in Form von starken Kopf- und Bauchschmerzen, Husten, Atembeschwerden und Muskelschwäche.
Auch wenn die Zustände in den tabakproduzierenden Länder zum Teil bereits in der Vergangenheit bekannt wurden (siehe auch weiter unten), unterscheidet sich die jetzt veröffentlichte Plan-Studie dadurch, dass sie betroffene Kinder direkt zu den Folgen der Arbeit auf den Tabakplantagen befragt hat. Insgesamt nahmen 44 Kinder aus drei Distrikten an der Studie "Harte Arbeit, lange Arbeitszeiten und schlechte Bezahlung" teil. 23 davon waren unter 16 Jahren. Die Kinder beklagten nicht nur sehr konkret die körperlichen Folgen durch den Kontakt mit den Tabakblättern ("Es fühlt sich an, als ob man keine Luft mehr bekommt. Das Atmen tut so weh, dass der ganze Brustkorb brennt. Dann kommt die Übelkeit und mit dem Übergeben spuckt man Blut"), sondern sie gaben auch an, von ihren Arbeitgebern geschlagen, missbraucht und oft genug nicht wie vereinbart bezahlt zu werden.
Die wahrscheinlich nur Westeuropäern herausrutschende Frage, warum sich dann die Kinder und ihre Eltern nicht andere Arbeit suchen, ist leicht mit der sonstigen sozialen Lage großer Teile der Bevölkerung in einem durch die Monoproduktion unter multinationaler Aufsicht völlig bestimmten Dritte-Welt-Land zu beantworten.
Einschlägige Websites wie die der "unfairtobacco"-Initiative schildern die Lage so:
• "Die Kultivierung von Tabak ist gerade auch in Malawi so arbeitsintensiv, dass den Bauern keine Zeit bleibt, um Nahrungsmittel für sich anzubauen. Von der Saat bis zum Verkauf der getrockneten Blätter gehen die Pflanzen zwischen 30 und 50 Mal durch die Hände der Arbeiter: Sie werden von Hand ausgesät, mehrfach umgesetzt, gegen Schädlinge behandelt und schließlich geerntet. Zudem gehen große, für die Subsistenzwirtschaft wichtige Agrarflächen verloren.
• Sechzig Prozent der Exporteinnahmen dieses ostafrikanischen Staates stammen aus dem Tabakanbau.
• Wegen der extrem niedrigen Löhne fehlt den Bauern sogar das Geld für die grundlegendsten Mittel zum Leben. Zu arm, um sich Schutzkleidung leisten zu können, leiden viele Tabakbauern unter den Auswirkungen von Nikotin- und Pestizidvergiftungen. Wegen notwendiger Investitionen hochverschuldet, geraten sie und ihre Familien in Hunger und Armut. Der große Arbeitsaufwand erfordert die Mitarbeit der gesamten Familie", und daher auch der Kinder und dies ist wohl auch in frühkapitalistischer Art und Weise in die Löhne "eingepreist".
Den umfangreichen (81 Seiten), fakten- und zitatenreichen Bericht "Hard work, long hours and little pay. Research with children working on tobacco farms in Malawi" erhält man kostenlos.
Bernard Braun, 27.8.09
Ambivalent: Nachtschichtarbeit als mögliche Ursache von Brustkrebs bei Krankenschwestern und Flugbegleitern in Dänemark anerkannt!
 2007 reklassifizierte die "International Agency for Research on Cancer (IARC)" der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Lyon Nacht-Schichtarbeit als einen für Menschen wahrscheinlich ("probable") (Gruppe 2a) krebserregenden Faktor. Zuvor galt Nachtschichtarbeit lediglich als mögliches ("possible") Karzinogen.
2007 reklassifizierte die "International Agency for Research on Cancer (IARC)" der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Lyon Nacht-Schichtarbeit als einen für Menschen wahrscheinlich ("probable") (Gruppe 2a) krebserregenden Faktor. Zuvor galt Nachtschichtarbeit lediglich als mögliches ("possible") Karzinogen.
Auch ohne dass die IARC die für 2008 angekündigte ausführliche wissenschaftliche Monographie der Beweggründe ihrer Neubewertung des gesundheitlichen Risikos vorgelegt hat, zog nun die dänische Regierung eine radikale praktische Schlussfolgerung: Frauen, die an Brustkrebs erkrankten und erkranken werden, keinen anderen bekannten Risikofaktor für Brustkrebs aufweisen und mindestens einmal pro Woche während der letzten 20 Jahre in Nachtschicht gearbeitet haben, bekommen ihre Erkrankung als Berufskrankheit anerkannt und erhalten eine finanzielle Kompensation. Im Moment erhalten in Dänemark schon 40 Krankenschwestern und Flugbegleiter Zahlungen.
Der Entscheidung liegen einerseits die bekannten belastenden Wirkungen der Nachtarbeit auf Schlafmuster, chronischen Schlafmangel, das circadianische System und die Produktion des krebsunterdrückenden Melatonin und andererseits die Erkenntnis zugrunde, dass Brustkrebs mit einer anwachsenden Konzentration von Östrogen assoziiert ist, das wiederum durch Arbeiten unter künstlichem Licht und bei unterdrückter Melatoninproduktion besonders stark produziert wird.
Angesichts der bisher eher schwachen oder karg nachgewiesenen Evidenz dieses Risikos von Nachtschichtarbeit und der potenziellen Bedeutung für die 20 % der Erwerbstätigen, die in Europa und Nordamerika in Nachtschicht arbeiten, überrascht die Entscheidung in Dänemark.
Die Kommentatoren der Zeitschrift "Lancet", die in ihrer Ausgabe vom 28. März 2009 über diese Entscheidung berichten, weisen auf deren generelle Ambivalenz hin:
• Einerseits könne damit ein gesetzlicher Druck auf die Arbeitgeber ausgeübt werden, Risiken, die mit Nachtschichtarbeit assoziiert sind zu reduzieren. Was dies letztlich konkret heißt, bleibt dabei offen, wird aber nicht einfach zu beantworten sein.
• Dadurch könnte auf der anderen Seite aber auch in einigen Berufen oder Tätigkeiten eine geschlechtsbezogene Diskriminierung stattfinden.
Bevor es Ergebnisse der für notwendig erachteten weiteren Forschung über das wahrscheinliche oder gesicherte Krebsrisiko von Nachtschichtarbeit gibt, sollte nach Meinung der Lancet-Kommentatoren aber noch mehr oder unvermindert auf andere Mittel zur Krebsprävention gesetzt werden. Wichtig ist eine Prävention, welche die klassischen Risikofaktoren wie Übergewicht, zu geringe Bewegung oder zu starken Alkoholkonsum kontrolliert.
Den knappen Kommentar, der unter der Überschrift "Breast cancer on the night shift" in der Ausgabe der Zeitschrift "The Lancet" vom 28. März 2009 erschienen ist, erhält man kostenlos, wenn man sich unter der angegebenen Adresse ebenfalls kostenlos und ohne damit lästige Werbemails auszulösen persönlich anmeldet.
Bernard Braun, 29.3.09
Gesundheitspolitische Beratung auf Albaniens Weg in die EU
 Die gesetzliche Krankenversicherung in Albanien steht vor großen Herausforderungen. Seit seiner Gründung Mitte der 1990er Jahre ermöglicht das albanische Krankenversicherungsinstituts ISKSH den AlbanerInnen Zugang zu ausgewählten Gesundheitsleistungen. Allen AlbanerInnen? Nein, keineswegs der ganzen Bevölkerung, nur einer kleinen Auswahl von RentnerInnen und chronischen Kranken, die zudem beitragsfrei versichert sind. Die allermeisten BeitragszahlerInnen nutzen das Angebot des ISKSH nicht und besorgen sich nicht einmal das erforderliche Versicherungsbüchlein. Zu gering ist der Versicherungsschutz, den die albanische Einheitskasse bietet.
Die gesetzliche Krankenversicherung in Albanien steht vor großen Herausforderungen. Seit seiner Gründung Mitte der 1990er Jahre ermöglicht das albanische Krankenversicherungsinstituts ISKSH den AlbanerInnen Zugang zu ausgewählten Gesundheitsleistungen. Allen AlbanerInnen? Nein, keineswegs der ganzen Bevölkerung, nur einer kleinen Auswahl von RentnerInnen und chronischen Kranken, die zudem beitragsfrei versichert sind. Die allermeisten BeitragszahlerInnen nutzen das Angebot des ISKSH nicht und besorgen sich nicht einmal das erforderliche Versicherungsbüchlein. Zu gering ist der Versicherungsschutz, den die albanische Einheitskasse bietet.
Mindestens zwei großen Hürden sieht sich das ISKSH folglich überwinden, bevor Albanien den ersehnten Weg in die Europäische Union finden kann. Ein akzeptabler Versicherungsschutz und die Absicherung der ganzen Bevölkerung sind zurzeit noch Zukunftsmusik in dem kleinen südosteuropäischen Land. Nun ist es zwar nicht so, dass die EU universellen Krankenversicherungsschutz und umfassende soziale Absicherung als Bedingung für den Beitritt fordert. Vielmehr fallen Gesundheits- und Sozialpolitik erklärtermaßen in den Hoheitsbereich der Mitgliedsstaaten. Allerdings bekennt sich die Europäische Kommission zunehmend zu gemeinsamen Werten und Grundsätzen, die auch die Sozialpolitik der zurzeit 27 europäischen Staaten nicht unberührt lassen. So besagt die Konsolidierte Fassung des Vertrags über die Europäische Union und des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft klipp und klar in Art. 152 (5): "Bei der Tätigkeit der Gemeinschaft im Bereich der Gesundheit der Bevölkerung wird die Verantwortung der Mitgliedstaaten für die Organisation des Gesundheitswesens und die medizinische Versorgung in vollem Umfang gewahrt. Insbesondere lassen die Maßnahmen nach Absatz 4 Buchstabe a die einzelstaatlichen Regelungen über die Spende oder die medizinische Verwendung von Organen und Blut unberührt.
Doch spätestens seit der so genannte Lissabon-Prozess begann, ist Sozial- und Gesundheitspolitik auf der Prioritätenliste der EU weiter nach oben gerutscht. In verschiedenen Ergänzungen zum EU-Vertrag hat die Europäische Kommission explizit Stellung zu den Erwartungen an die Mitgliedsstaaten formuliert. So ist in den Schlussfolgerungen des Rates zum Thema "Gemeinsame Werte und Prinzipien in den Europäischen Union-Gesundheitssystemen" unter anderem zu lesen: "Die Grundwerte Universalität, Zugang zu einer Gesundheitsversorgung von guter Qualität, Gleichbehandlung und Solidarität finden im Handeln der verschiedenen EU-Organe breite Zustimmung. Zusammen bilden sie ein Wertgefüge, das in ganz Europa geteilt wird. Universalität bedeutet, dass niemandem der Zugang zur Gesundheitsversorgung verwehrt ist; Solidarität ist eng verbunden mit der finanziellen Gestaltung unserer nationalen Gesundheitssysteme und dem Erfordernis, die Zugänglichkeit für alle zu gewährleisten; Gleichbehandlung bezieht sich auf gleichen Zugang je nach den Bedürfnissen, unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit, Geschlecht, Alter, sozialem Status oder Zahlungsfähigkeit. Die EU-Gesundheitssysteme haben auch zum Ziel, entsprechend dem Anliegen der EU-Mitgliedstaaten bestehende Ungleichheiten bei der Gesundheitsversorgung zu verringern; in enger Verbindung damit steht die Arbeit in den Systemen der Mitgliedstaaten zur Verhütung von Krankheiten, unter anderem durch die Förderung einer gesunden Lebensweise."
In der Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen vom 20.4. 2004 äußerte sich die Europäische Kommission recht explizit zu den Vorstellungen der Gemeinschaft bei der Modernisierung des Sozialschutzes für die Entwicklung einer hochwertigen, zugänglichen und zukunftsfähigen Gesundheitsversorgung und Langzeitpflege: Unterstützung der einzelstaatlichen Strategien durch die "offene Koordinierungsmethode". Darin heißt es in Absatz 3.1. unter der Überschrift Sicherung des Zugangs zur Gesundheitsversorgung: Universalität, Angemessenheit, Solidarität: Ein beachtlicher Erfolg der europäischen Gesundheitssysteme war es, dass sie eine hochwertige Gesundheitsversorgung allgemein zugänglich gemacht haben. Sie sollen weiterhin verhüten, dass es durch Krankheiten, Unfälle oder hohes Alter zu Verarmung und sozialer Ausgrenzung kommt, sowohl für die Patienten als auch für ihre Familien. Ihr universeller Erfassungsbereich muss auf einer solidarischen Grundlage beruhen, deren Modalitäten jedem System eigen sind. Diese Solidarität muss besonders diejenigen begünstigen, die über ein niedriges Einkommen verfügen, und Menschen, deren Gesundheitszustand aufwändiger, dauernder oder kostspieliger Pflege bedürfen, der Palliativmedizin und der Sterbebegleitung."
Die Umsetzung dieser Vorgaben obliegt allerdings den Mitgliedsstaaten und entzieht sich dem direkten Einfluss der Europäischen Kommission. Den Spagat zwischen Anspruch und Wirklichkeit innerhalb der EU in Bezug auf gesundheitspolitische Vorstellungen greift auch er von der WHO Regionalabteilung herausgegebenen Vierteljahrespublikation Euro Healthin der Ausgabe 10 (3) auf. Julia Lear und Elias Mossialos und beleuchten in ihrem kostenfrei herunterzuladenden Artikel EU Law and Health Policy in Europe.
Trotz zurzeit noch unklarer Signale aus Brüssel ist davon auszugehen, dass die sozial- und gesundheitspolitschen Anforderungen an zukünftige Neumitglieder steigen werden. Das liegt nicht zuletzt im Eigeninteresse der bisherigen Mitgliedsstaaten, denn im Zuge der Freizügigkeit des Personenverkehrs innerhalb der Gemeinschaft sind auch Gesundheits- und soziale Sicherungsprobleme international. Potenzielle Importländer von billigen Arbeitskräften werden nur ungerne die Zeche unzureichenden Sozialschutzes in deren Heimatländern zahlen. Bisher herrscht in Albanien nur wenig Bewusstsein über derartige Herausforderungen, aber der erklärte Wunsch einer baldigen EU-Mitgliedschaft sollte die politisch Verantwortlichen des kleinen Landes an der Adriaküste auch dazu bewegen, die bisher ungenügende Absicherung der Bevölkerung gegen finanzielle Krankheitsrisiken zu verbessern.
Zurzeit unterstützt die deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) die albanische Krankenversicherung bei der Verbesserung ihrer Strukturen, Qualifizierung der MitarbeiterInnen sowie bei der Ausweitung des Versicherungsschutzes auf die ganze Bevölkerung. Der Weg bis zu den europäischen Grundwerten Universalität, Solidarität und Zugangsgerechtigkeit ist noch weit. Der hier in Auszügen frei herunterzuladende Endbericht einer Mission im Rahmen des GTZ-Projekts zur Beratung des Krankenversicherungsinstituts ISKSH vermittelt einen Einblick in wichtige gesundheitspolitische Herausforderungen des Landes und stellt sie den sozialpolitischen Forderungen der EU gegenüber.
Hier können Sie Auszüge herunterladen aus dem englischsprachigen Abschussbericht
Jens Holst, 29.10.08
Vorsicht vor "Bäumchen-wechsel-dich" in Kanada: Was ist davon zu halten, das öffentliche System a la USA teilzuprivatisieren?
 Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass parallel zu der zunehmenden Skepsis der us-amerikanischen Öffentlichkeit gegenüber der gesamtgesellschaftlichen Wirksamkeit und Effizienz von Marktsteuerung in ihrem dominant privatwirtschaftlich funktionierenden Versicherungs- und Versorgungssystem, im Nachbarland Kanada nahezu zeitgleich die Skepsis gegenüber dem eher sozialen und bevölkerungsweiten Gesundheitssystem wächst und über einen strengeren Privatisierungskurs nachgedacht wird.
Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass parallel zu der zunehmenden Skepsis der us-amerikanischen Öffentlichkeit gegenüber der gesamtgesellschaftlichen Wirksamkeit und Effizienz von Marktsteuerung in ihrem dominant privatwirtschaftlich funktionierenden Versicherungs- und Versorgungssystem, im Nachbarland Kanada nahezu zeitgleich die Skepsis gegenüber dem eher sozialen und bevölkerungsweiten Gesundheitssystem wächst und über einen strengeren Privatisierungskurs nachgedacht wird.
Die an der Harvard Medical School in Boston, USA, arbeitende Sozialmedizinerin Marcia Angell, nimmt dies zum Anlass in der Ausgabe des Medizinjournals "Canadian Medical Association Journal (CMAJ)" vom 6. Oktober 2008, eine engagierte, klare sowie erfahrungsgesättigte Warnung vor diesem Schritt im nördlichen Nachbarland der USA zu formulieren.
Unter dem unmissverständlichen Titel "Privatizing health care is not the answer: lessons from the United States" weist sie auf folgende für ihr Plädoyer entscheidende und knapp empirisch fundierte Punkte hin:
• Die Gesundheitsausgaben sind in den USA zweimal so hoch wie in Kanada.
• Das US-System hat schlechtere Ergebnisse vorzuweisen, ist weniger wirtschaftlich und liefert weniger Basisdienste wie das kanadische System.
• Das US-System ist das einzige unter den industrialisierten Ländern, das Gesundheitsversorgung als Marktgut behandelt und nicht als sozialen Dienst und dadurch u.a. die Nichtzahlungsfähigen als Unversicherte ausgrenzt.
• In den USA ist gewinnorientierte Gesundheitsversorgung wesentlich teurer und von geringerer Qualität als non-profit- oder öffentlich-staatliche Versorgung und hat außerdem viel höhere Overheadkosten.
• Die Vorstellung, dass eine partielle Privatisierung des kanadischen System Wartezeiten für elektive Prozeduren oder Operationen reduziert, ist irregeleitet.
• Eine teilweise Privatisierung würde Ressourcen vom öffentlichen System abziehen, die Gesamtausgaben erhöhen und dazu die Ungerechtigkeiten des US-Systemen einführen.
• Als besten Weg, das System Kanadas zu verbessern sieht Angell darin, mehr Ressourcen in das System einfließen zu lassen.
Wie andere schon etwa zu Beginn der Regierungszeit von Bill Clinton in den USA (z. B. Theodor Marmor, David Himmelstein, Steffie Woolhandler) vor ihr, kommt Angell zu dem Schluss: "Canada’s medicare is one of the best health systems in the world - far superior to the US system". Das was beide Systeme unterscheidet bringt sie zudem auf die griffige Formel: "The problem with Canadian medicare is not the system, it is the amount of money put into it. The US problem is exactly the opposite. It is not the money, it is the system."
Die vierseitige Analyse "Privatizing health care is not the answer: lessons from the United States" von Marcia Angell erhält man, wie die meisten Aufsätze des CMAJ kostenlos.
Bernard Braun, 21.10.08
Chiles Gesundheitswesen: Evaluierung und Kritik
 Es ist nicht das erste Mal, dass Chile auf der Seite des Forum Gesundheitspolitik zur Sprache kommt siehe z.B. Die Reichen ins Töpfchen, die Armen ins Kröpfchen, und es wird wohl auch nicht das letzte Mal bleiben. Trotz der geografischen Entfernung zwischen Mitteleuropa und dem lang gestreckten Land am Westrand Südamerikas und der geringen Beachtung, die es in der vorherrschenden sozialpolitischen Diskussion in Deutschland erfährt, liefert das lateinamerikanische Schwellenland relevante Erfahrungen und Erkenntnisse über erwünschte und vor allem unerwünschte Auswirkungen marktorientierter Reformen.
Es ist nicht das erste Mal, dass Chile auf der Seite des Forum Gesundheitspolitik zur Sprache kommt siehe z.B. Die Reichen ins Töpfchen, die Armen ins Kröpfchen, und es wird wohl auch nicht das letzte Mal bleiben. Trotz der geografischen Entfernung zwischen Mitteleuropa und dem lang gestreckten Land am Westrand Südamerikas und der geringen Beachtung, die es in der vorherrschenden sozialpolitischen Diskussion in Deutschland erfährt, liefert das lateinamerikanische Schwellenland relevante Erfahrungen und Erkenntnisse über erwünschte und vor allem unerwünschte Auswirkungen marktorientierter Reformen.
Eine Evaluierung der chilenischen Gesundheitsreform von 1981 unter den Aspekten Effizienz, Zugang zur Versorgung und soziale Gleichheit veröffentlichte kürzlich die Open-Access-Zeitschrift PLoS Med in ihrer Ausgabe 5 (4) - e79. Unter den Bedingungen einer eisenharten Militärdiktatur unterzog Chile seine sozialen Sicherungssysteme einer Radikalkur, und das bereits zu einem Zeitpunkt, als in Mitteleuropa noch der Glaube an Vollbeschäftigung und die Bedeutung öffentlicher Sozialleistungen trotz erster Ölkrisen weitgehend ungebrochen war. Im Mittelpunkt der Gesundheitsreform von 1981 stand die Privatisierung der sozialen Absicherung gegen Krankheitsrisiken. In Chile fand die marktradikale Theorie der Chicagoer Schule um den Ökonomen Milton Friedman erstmalig Anwendung, gegeistert gefeiert beispielsweise von der FAZ und überaus wohlwollend begleitet von Weltbank und Internationalem Währungsfonds. Noch bevor eine vernünftige Evaluierung wirtschaftsliberaler Patentrezepte möglich war, bewegten die internationalen HerrInnen über die Geldhähne die Regierungen anderer Länder mit meist unsanftem Druck dazu, im Sinne neoliberaler Glaubenssätze die Axt an ihren Sozialsystemen und an allen öffentlichen Diensten anzusetzen.
Mittlerweile sind die MarktscheierInnen des Wirtschaftsliberalismus etwas ruhiger geworden und kritische Stimmen haben Oberwasser bekommen. Doch vielerorts sind die Pflöcke derart tief eingeschlagen und die Gehirne so gründlich gewaschen, das Veränderungen auf sich warten lassen oder schwer fallen. Ein hervorragendes Beispiel für die Nachhaltigkeit marktradikaler Umbrüche ist Chile. Unter den Bedingungen jahrelangen stabilen Wachstums und sozialdemokratisch denkender Regierungen konnte das südamerikanische Land den Anteil der Armen deutlich verringern und die öffentlichen sozialen Dienste spürbar nachbessern. Doch auf diesem Wege steht ihnen zunehmend die Hinterlassenschaft der Wirtschaftsliberalen GewaltherrscherInnen im Wege.
So gehört Chile zwar heute bei den klassischen Gesundheitsindikatoren ganz weit oben auf der Weltrangliste, wie die belgisch-chilenische Autorengruppe des PLoS-Artikels schreiben. Gleichzeitig zeichnet sich das Land durch extreme Ungleichverteilung des Einkommens und durch ein sehr ungerechtes Gesundheitswesen aus. Zwar haben die demokratisch gewählten Regierungen seit dem Ende der Militärdiktatur einen beachtlichen Anteil des wachsenden Volkseinkommens in den Aufbau öffentlicher Versorgungsstrukturen gesteckt, aber entfällt eine zwei bis drei Mal höherer Anteil der Gesundheitsausgaben auf gut verdienende Privatversicherte mit Zugang zu einem der weltweit teuersten privaten Versorgungssysteme.
Dabei fallen die sozialen Unterschiede bei der Nutzung des Gesundheitswesens vergleichsweise gering aus: 1999 standen durchschnittlich 3,85 Arztkontakte von gesetzlich Versicherten 4,12 von PrivatpatientInnen gegenüber; während 79,7 % der Menschen aus der obersten Einkommensquintile bei Erkrankungen einen Arzt aufsuchten, lag dieser Anteil beim ärmsten Fünftel der Bevölkerung immerhin noch bei 73,9 %. Vor dem Hintergrund der neoliberalen Gesundheitsreform ist es bemerkenswert, wie die Autoren betonen, dass der wesentlichen Anteil an dem im Vergleich zur Einkommensschere relativ geringen Unterschied bei der Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen dem öffentlichen System zufällt, das die Väter der Reform eigentlich schrittweise abschaffen wollten.
Eine Analyse der privaten Krankenversicherungen in Chile ist nicht nur ernüchternd, sondern stellt die ganze Theorie von Effizienzgewinnen durch Kassenwettbewerb in Frage. Privatisierung und Wettbewerb alleine sorgen, so eine Schlussfolgerung des Artikels, keineswegs für Kostendämpfung, zumal die Verwaltungskosten im Privatsektor etwa neun Mal so hoch sind wie bei der gesetzlichen Krankenkasse. Und die vergleichsweise guten Gesundheitsindikatoren hat das südamerikanische Land nicht wegen, sondern trotz der Gesundheitsreform unter der Militärdiktatur erreicht: "It is absolutely clear that the country’s health indicators are not due to the superior access to health care enjoyed by the better-off minority, who in any case continued to rely significantly on the public system for many conditions and services."
Der gemeinsam von Gesundheitswissenschaftlern des Tropenmedizinischen Instituts Antwerpen und der Universität Chile in Santiago verfassten Artikel der steht kostenfrei in voller Länge zur Verfügung. Hier kommen Sie zu Chile’s Neoliberal Health Reform: An Assessment and a Critique.
Des Spanischen mächtige ZeitgenossInnen finden weiterführende Informationen und aktuelle Zahlen auf der Homepage der gesetzlichen Krankenkasse FONASA
Jens Holst, 21.4.2008
Indonesien und Bangladesch: Kinder mit besserer Schulbildung haben weniger wahrscheinlich unterernährte Nachkommen
 Erneut zeigt eine große Studie in einem Entwicklungs- bzw. Schwellenland den wichtigen Einfluss von Bildung auf die Entwicklungschancen vieler Individuen und des Landes insgesamt.
Erneut zeigt eine große Studie in einem Entwicklungs- bzw. Schwellenland den wichtigen Einfluss von Bildung auf die Entwicklungschancen vieler Individuen und des Landes insgesamt.
In der von Richard Semba und weiteren WissenschaftlerInnen der "Johns Hopkins School of Medicine in Baltimore, Maryland" durchgeführten Untersuchung bei 590.570 Familien in Indonesien und 395.122 Familien in Bangladesch, deren Daten von großen Gesundheits- und Ernährungsüberwachungsprogrammen zusammengetragen worden waren, ging es um den Einfluss der Ausbildungsdauer der Eltern eines Kindes für die Verringerung von Unterernährung ihrer Kinder.
Unterernährung von Kindern ist gerade in der frühen Kindheit mit einer schlechten kognitiven, motorischen und sozioemotionalen Entwicklung, erhöhter Sterblichkeit oder irreversiblen Schädigungen einschließlich einer geringeren Körpergröße als Erwachsener, schlechterem Schulabschluss, einem geringeren Einkommen im Erwachsenenleben und praktisch als Schlussglied der intergenerativen Verkettung auch oft mit einem geringerem Geburtsgewicht der nächsten Nachkommen assoziiert.
Ob und welchen Zusammenhang es zwischen dem kindlichen Wachstum, dem Bildungsstand der Eltern und deren sozioökonomischen Status gibt, untersuchten die us-amerikanischen ForscherInnen.
Die Forscher stellten fest, dass die Häufigkeit für verzögertes Wachstum bei Kindern im Alter zwischen 0 und 59 Monaten in Indonesien bei 33,2% lag. Eine bessere Schulbildung der Mutter führte pro zusätzlichem Ausbildungsjahr ("extra year of education [EYE]") zu einer Reduktion des Risikos für Wachstumsverzögerung beim Kind zwischen 4,4% (in Städten) und 5% (in ländlichen Gegenden) In Bangladesch (wo die Häufigkeit von Kindern mit Wachstumsstörung über 50% lag), führte jedes EYE der Mutter zu einer 4-prozentigen Reduktion des Risikos für ein Kind mit Wachstumsverzögerung. Interessanterweise reduzierte jedes EYE des Vaters das Risiko "nur" um 2,9% (in ländlichen Gegenden) und 5,4% (in den Städten). In Indonesien war eine gute Ausbildung beider Elternteile mit einem deutlich erhöhten protektivem Verhalten gegenüber ihren Kindern assoziiert. Dies umfasste die Verabreichung von Vitamin-A-Kapseln, eine komplette Grundimpfung, bessere sanitäre Verhältnissen und die Verwendung jodierten Speisesalzes.
Auch unter den manchmal durch zivile Unruhen und Naturkatastrophen geprägten Bedingungen von Entwicklungsländern gibt es also realistische und erfolgreiche politische oder soziale Interventionen im Bildungsbereich und der gezielten Förderung von Frauen, mit denen die gesundheitliche und soziale Zukunft zahlreicher Angehöriger der nächsten Generationen und ihrer Länder verbessert werden kann. Hier zu intervenieren schließt nicht aus, über die hier existierenden komplexen Wechselwirkungen mehr zu forschen. Dazu würde auch die Erforschung der Zusammenhänge im Längsschnitt gehören.
Zu dem in der neuesten Ausgabe der Fachzeitschrift "The Lancet" (2008; 371: 322) erschienenen Aufsatz "Effect of parental formal education on risk of child stunting in Indonesia and Bangladesh: a cross-sectional study" von Richard Semba et al. gibt es kostenfrei ein Abstract. Nach einer kurzen kostenlosen Anmeldung, die keine Werbeflut o.ä. nach sich zieht, erhält man auch eine komplette Fassung kostenfrei.
Bernard Braun, 28.1.2008
"We must end doctor brain drain." - Ein Fünftel von Afrikas Ärzten und ein Zehntel seiner Pflegekräfte arbeiten im Ausland!
 Der Kontinent mit den höchsten Erkrankungs- und Frühsterblichkeitsrisiken, den schlechtesten hygienischen Verhältnissen und den geringsten Versorgungschancen durch ärztliches und nicht-ärztliches Personal ist Afrika und dort vor allem die Länder südlich der Sahara.
Der Kontinent mit den höchsten Erkrankungs- und Frühsterblichkeitsrisiken, den schlechtesten hygienischen Verhältnissen und den geringsten Versorgungschancen durch ärztliches und nicht-ärztliches Personal ist Afrika und dort vor allem die Länder südlich der Sahara.
Entsprechend stehen afrikanische Länder an der Spitze der Länder, auf die internationale, meist mittel- und nordeuropäische und nordamerikanische Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen den Großteil ihrer materiellen Hilfe konzentrieren.
Um dem "armen Afrika" zu helfen, fließt gerade im Gesundheitsbereich nicht nur Geld, sondern werden Ärzte, Krankenschwestern und Angehörige weiterer Gesundheitsberufe entsandt, zu deren Aufgaben auch die Hilfe zur Selbsthilfe gehört.
Auf Dauer helfen nämlich der Bevölkerung dieser Länder nicht oder nicht allein "viele, viele Albert Schweitzers" (deren Bedeutung damit aber nicht gemindert werden soll), sondern eher "viele, viele sudanesische, mozambiquische oder kongolesische Ärzte, Krankenschwester und vielleicht auch Naturheiler", die den Teil der extrem entwicklungshemmenden gesundheitlichen Risiken verhindern oder beseitigen helfen, der von medizinischen oder pflegerischen Interventionen abhängig ist. Ohne eine parallele Verbesserung der hygienischen Verhältnisse (z. B. Trinkwasser und Sanitärverhältnisse), des Bildungsstandes und der sozialen Ungleichheiten wird es aber nicht zu mehr Überleben und Gesundheit kommen.
Doch ob "Afrika" bei den Gesundheitsberufen wirklich so "arm" ist oder nicht sogar bereits einen gewissen "Reichtum" besitzt, fragt man sich nach der Lektüre einer jetzt erstmalig durchgeführten standardisierten berufsspezifischen Untersuchung der Anzahl von in Afrika geborenen und zum großen Teil auch dort ausgebildeten Ärzten und KrankenpflegerInnen, die im Ausland arbeiten.
Hier ist bemerkenswert, dass nur 12 von 53 afrikanischen Länder und nur 11 von 48 so genannten "sub-Saharan"-Länder keine "medical school" hatten, die bei der "Foundation for Advancement of International Medical Education and Research (FAIMER)" akkreditiert war. Diese Akkreditierung ist die Voraussetzung dafür, dass in Afrika ausgebildete Mediziner z. B. in den USA anerkannt warden und arbeiten können.
Die vom unabhängigen us-amerikanischen "not-for-profit think tank" "Center for Global Developement (CGD)" ("that works to reduce global poverty and inequality by encouraging policy change in the U.S. and other rich countries through rigorous research and active engagement with the policy community") mit Berufs- und Beschäftigungsdaten zahlreicher afrikanischer und außerafrikanischer Länder erarbeitete Studie kommt für das Jahr 2000 (für jüngere Daten gibt es nicht in allen Ländern verfügbare Daten) zu folgenden Resultaten:
• 64.941 in Afrika geborene Ärzte und 69.589 ebenfalls dort geborenen und meist ausgebildeten Krankenschwestern und -pfleger arbeiteten zu diesem Zeitpunkt im Ausland.
• Damit arbeiten 19% aller in Afrika geborenen Ärzte (aus den "sub-Saharan"-Länder waren es 28%) und 8% aller afrikanischen Pflegekräfte (aus den "sub-Saharan"-Ländern waren es 11%) nicht in einem afrikanischen Land.
• Die Betroffenheit der afrikanischen Länder durch diese Exodus-Prozesse ist extrem ungleich und schwankt je nach Beruf und Land zwischen 1% und 70%. So arbeiten beispielsweise 75% der Ärzte, die in Mozambique geboren sind, im Ausland, während dies lediglich bei 5% der ägyptischen Ärzte der Fall ist. 81% der Pflegekräfte aus Liberia arbeiten im Ausland und erneut lediglich 1% ihrer ägyptischen BerufskollegInnen
Da sich die Untersuchung auf den "physisians and nurses drain" in 9 außerafrikanische Länder konzentriert, dürften die erhobenen Zahlen den Umfang dieses Prozesses allerdings noch unterschätzen.
Die Studie geht zusätzlich auch noch auf die generellen Schwierigkeiten derartiger Untersuchungen mit unterschiedlichsten Quellen aus unterschiedlichen Ländern ein, ohne dass dies ihre qualitative Aussage schmälern würde.
Das 23-seitige "CGD-Working-Paper Nr. 95 "New Data on African Health Professionals Abroad" von Michael Clemens und Gunilla Pettersson und eine Excel-Datei mit den Originaldaten für alle Geber- und Nehmerländer der Ärzte und Pflegekräfte erhält man kostenfrei.
Bernard Braun, 12.1.2008
Gesundheitsversorgung in Albanien
 Jahrzehntelang war Albanien weitgehend abgeschieden vom Rest der Welt. Die politische und wirtschaftliche Isolierung des kleinen Landes an der Adria zwischen Montenegro und Griechenland betraf spätestens in den 1980er Jahren auch das staatliche Gesundheitswesen. Im Zuge des politischen Umbruchs ab 1990 brach auch die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung ein, und die Unruhen in den ersten Jahren verursachten jeweils spürbare Einschnitte.
Jahrzehntelang war Albanien weitgehend abgeschieden vom Rest der Welt. Die politische und wirtschaftliche Isolierung des kleinen Landes an der Adria zwischen Montenegro und Griechenland betraf spätestens in den 1980er Jahren auch das staatliche Gesundheitswesen. Im Zuge des politischen Umbruchs ab 1990 brach auch die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung ein, und die Unruhen in den ersten Jahren verursachten jeweils spürbare Einschnitte.
Mitte der 1990er Jahre unternahm die albanische Regierung erste Reformen des Gesundheitswesens und führte in diesem Rahmen ein Krankenversicherungsinstitut ein. Insgesamt blieben die Fortschritte bis zur Jahrhundertwende und auch darüber hinaus eher bescheiden und Albanien gehört bis heute zu den europäischen Schlusslichtern bei der Gesundheitsversorgung.
Einen detaillierten Überblick über die Situation des albanischen Gesundheitswesen um die Jahrtausendwende bietet das vom European Observatory on Health Care Systems der WHO Euro-Region im Rahmen der Serie [Gesundheitrssysteme im Umbruch] herausgegebene Buch über Albanien. Darin beschreiben Besim Nuri und Ellie Tragakes die Organisation, Finanzierung des Gesundheitswesens, seine Versorgungsstruktur und laufende Reformprozesse. Obwohl bisher keine aktuellere Ausgabe zu Albanien vorliegt, gehört dieses Werk bis heute sicherlich zu den umfassendsten Darstellungen des albanischen Gesundheitssystems. Das englischsprachige Buch Health Systems in Transition - Albania steht kostenfrei zum Download zur Verfügung.
Etliche Untersuchungen haben sich mit dem allgegenwärtigen Thema legaler und illegaler Patientenzahlungen befasst. In dem Paper "Out-of-pocket payments and utilization of health care services in Albania: Evidence from three districts" finden sich Hinweise auf das Ausmaß der Direktzahlungen und deren Einfluss auf den Zugang zu medizinischer Versorgung. Von dem Artikel von Hotchkiss et al. steht nur das Abstract kostenfrei in der online-Ausgabe von Health Policy zur Verfügung.
Einen weiteren Artikel zum Thema illegaler Patientenzahlungen im Krankheitsfall publizierte im Jahr 2006 "Social Science and Medicine"; auch von dem Paper "Informal payments in government health facilities in Albania: Results of a qualitative study" von Vian et al. ist lediglich das Abstract aus Soc Sci Med kostenfrei zugänglich.
Die neueste Ausgaben des vom European Observatory der WHO Europa herausgegebenen Magazins EuroHealth widmet sich unter anderem der zumindest partiellen Privatisierung des Gesundheitswesens und den bestehenden private-public-partnerships. Den Beitrag "Public-private partnerships in Eastern Europe: Case studies from Lithuania, Republika Srpska and Albania" ist kostenfrei in Eurohealth13-2 herunterzuladen.
Etliche internationale Entwicklungsorganisationen unterstützen Albanien seit fast 20 Jahren beim Aufbau eines funktionierenden Gesundheitswesens, allen voran die Weltbank, die EU und die Cooperazione Italiana. Auch die deutsche Entwicklungshilfe hat sich in dem kleinen Land engagiert, und kürzlich ersuchte die albanische Regierung Deutschland um weitere Unterstützung im Gesundheitswesen. Der Bericht der zugehörigen Prüfmission vermittelt einen guten Überblick über die Lage und Erfordernisse des albanischen Gesundheitswesens. Neben etlichen statistischen Angaben umfasst der deutschsprachige Bericht der Einschätzung der Versorgungssituation und der Gesundheitsfinanzierung in Albanien. Hier finden Sie die allgemein interessierenden Auszüge aus dem Ersten Abschlussbericht der Prüfmission im Auftrag der Deutschen Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ).
Ergänzende Hinweise und Einschätzung anderer potenzieller Stakeholder der Gesundheitsfinanzierung ergab die Anfang November 2007 durchgeführte zweite Prüfmission. In Auszügen steht auch der Zweite Prüfbericht im Auftrag der GTZ zum Download zur Verfügung.
Jens Holst, 29.10.2007
Jemen auf der Suche nach dem geeigneten Krankenversicherungssystem
 Zu Jemen fällt den meisten Menschen sicherlich alles andere ein als die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung oder gar ein Krankenversicherungssystem. Das Land am südlichen Ende der arabischen Halbinsel gerät gelegentlich wegen der Entführung von Touristen oder gewaltsamer Auseinandersetzungen in die Schlagzeilen. Manch einer mag sich noch daran erinnern, dass es einst zwei jemenitische Staaten gab, die sich fast zeitgleich mit den beiden deutschen Staaten zur Republik Jemen vereinigten. Auch die Altstadt von Sana’a, die den Rang eines Weltkulturerbe genießt, wird sich einer gewissen Bekanntheit erfreuen.
Zu Jemen fällt den meisten Menschen sicherlich alles andere ein als die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung oder gar ein Krankenversicherungssystem. Das Land am südlichen Ende der arabischen Halbinsel gerät gelegentlich wegen der Entführung von Touristen oder gewaltsamer Auseinandersetzungen in die Schlagzeilen. Manch einer mag sich noch daran erinnern, dass es einst zwei jemenitische Staaten gab, die sich fast zeitgleich mit den beiden deutschen Staaten zur Republik Jemen vereinigten. Auch die Altstadt von Sana’a, die den Rang eines Weltkulturerbe genießt, wird sich einer gewissen Bekanntheit erfreuen.
Doch ansonsten ist das Land mit seinen etwa 20 Millionen Einwohnern, das erst vor wenigen Jahren das Mittelalter hinter sich gelassen zu haben scheint und bisher nicht vollends in der Neuzeit angekommen ist, für die meisten ein weißer Fleck auf der Weltkarte. Diesen zumindest mit einigen Farbklecksen anzufärben bemüht sich die jemenitische Regierung seit einigen Jahren. Zwar lebt über die Hälfte der Bevölkerung noch auf dem Land, doch die Dynamik der Entwicklung neuer Technologien ist zumindest in städtischen Gebieten nicht mehr aufzuhalten. Jemen vereint die typischen sozialen Probleme und Widersprüche eines Entwicklungslands, das sich immer weniger der Globalisierung entziehen kann. Archaische Strukturen auf dem Lande existieren in enger räumlicher Nähe zu einigen Inseln moderner Technologie und frühkapitalistischer Umbruchstimmung.
Entsprechend heterogen ist auch das Krankheitsspektrum in Jemen, das einerseits die herkömmlichen Probleme armer Entwicklungsländer und andererseits eine zunehmende Krankheitslast durch Zivilisationskrankheiten zu tragen hat. Während auf dem Land noch immer die Müttersterblichkeit hoch ist und Kinder an vermeidbaren Krankheiten sterben, unterstützen beispielsweise Berliner Kardiologen ihre Kollegen bei der Einführung von Herzkatheteruntersuchungen in vorwiegend privaten Kliniken. Ein Überblick über die soziale Lage im Jemen sowie weitere links finden sich auch auf der Homepage der US-Entwicklungshilfeorganisation USAID. Die wichtigsten Fakten zur Gesundheitssituation mit weiteren Verknüpfungen auch zu verschiedenen UN-Organisationen bietet das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen UNDP.
Zwar blüht die Hightech-Nischenmedizin für die betuchte städtische Oberschicht, aber insgesamt ist die medizinische Versorgung für die Bevölkerung rudimentär und unzureichend. Im Jemen addieren sich die ebenfalls typischen Entwicklungslandprobleme fehlender oder unzulänglicher Infrastruktur mit finanziellen Zugangsbarrieren. Selbst in öffentlichen Gesundheitsposten und Krankenhäusern müssen die Patienten einen erheblichen Teil der Behandlungskosten aus der eigenen Tasche zahlen, nach WHO-Schätzungen liegt der Anteil der out-of-pocket Zahlungen bei etwa 70 % der gesamten Gesundheitsausgaben. Zwar kommt zumindest theoretisch der Staat für die Gesundheitskosten seiner Bürger auf, doch in der Praxis kommen die nicht unerheblichen Einnahmen aus dem Erdölexport des Landes eher den Herrschenden als der Bevölkerung zu Gute. Krankenversicherungsschutz genießen nur wenige Jemeniten, die in öffentlichen sowie in einigen privaten Firmen formal angestellt sind.
Vor diesem Hintergrund hat sich die Regierung in den letzten Jahren das ehrgeizige Ziel auf die Fahnen geschrieben, eine landesweite Krankenversicherung im Jemen einzuführen. Zur Vorbereitung dieser Initiative beauftragte sie 2005 ein Konsortium der Deutschen Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ), dem Internationalen Arbeitsbüro (ILO) und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) mit einer detaillierten Analyse der Gegebenheiten im Land und mit der Entwicklung von Perspektiven für den Aufbau eines nationalen Krankenkassensystems. Ein achtköpfiges Team unter Leitung von Prof. Detlef Schwefel (Berlin) erfasste insgesamt drei Monate lang die aktuelle Situation und die Bedingungen für ein solches Versicherungssystem und entwickelte verschiedene Alternativen zum Aufbau einer langfristig universellen Krankenversicherung.
Der Abschlussbericht dieser Prüf- und Evaluierungsmission liegt nun vor und ist auf Englisch und Arabisch im Internet zugänglich.
Hier können Sie kostenlos den dreiteiligen Bericht Towards a national health insurance system in Yemen in englischer Sprache herunterladen:
Here you can download free of charge the three parts of the report entitled Towards a national health insurance system in Yemen:
Part 1: Background and Assessment
Part 2: Options and Recommendations
Part 3: Documents and Materials
Und hier finden Sie den zweiteiligen Bericht in arabischer Sprache:
And here you will find the two parts of the Arabic version of the report:
Arabic version Part 1
Arabic version Part 2.
Jens Holst, 4.9.2007
Erhebliche Stadt-/Landunterschiede bei der Nutzung von Gesundheitsdiensten in China
 Bei einem derartig großen und bevölkerungsreichen Land wie der Volksrepublik China ist das Risiko ungleich verteilter Angebote gesundheitlicher Versorgung und ungleicher Möglichkeiten, diese in Anspruch zu nehmen, relativ hoch. Wie hoch, zeigen jetzt die Ergebnisse des quantitativ weltweit größten Gesundheits- und Gesundheitsversorgungs-Survey, veröffentlicht in der August-2007-Ausgabe des hochkarätigen us-amerikanischen Medizinversorgungs-Journals "Medical Care" der "American Public Health Association".
Bei einem derartig großen und bevölkerungsreichen Land wie der Volksrepublik China ist das Risiko ungleich verteilter Angebote gesundheitlicher Versorgung und ungleicher Möglichkeiten, diese in Anspruch zu nehmen, relativ hoch. Wie hoch, zeigen jetzt die Ergebnisse des quantitativ weltweit größten Gesundheits- und Gesundheitsversorgungs-Survey, veröffentlicht in der August-2007-Ausgabe des hochkarätigen us-amerikanischen Medizinversorgungs-Journals "Medical Care" der "American Public Health Association".
Dabei handelt es sich um den dritten "National Health Services Survey" Chinas aus dem Jahre 2003, den 193.689 per Zufallsstichprobe befragte Personen beantworteten (Responserate=77,8 %). In dieser Gruppe befanden sich 6.429 in Städten lebende und 16.044 auf dem Lande lebende Teilnehmer, die über 18 Jahre alt waren und berichteten, dass sie innerhalb der letzten 2 Wochen vor ihrer Befragung an einer Erkrankung litten.
Diese Personen berichteten auf entsprechende Fragen folgendes über die Versorgung ihrer Erkrankung:
• Rund die Hälfte aller erkrankten Personen hatten keinen Kontakt zu einem Arzt.
• Auf dem Lande lebenden Chinesen nahmen stärker als in Städten lebende Landsleute Ärzte in Anspruch (52 % : 43 %), aber nutzten deutlich weniger ein Krankenhaus (7,6 % : 11,1 %). Beide Unterschiede waren statistisch signifikant.
• Erhöhte Inanspruchnahme eines Arztes hing u.a. davon ab, ob die betreffenden Personen auf dem Lande in einer mehrheitlichen mehrheits-chinesischen Population ( z. B. in der ethnischen Gruppe der Han) lebten, näher als 3 Kilometer von einem medizinischen Zentrum entfernt wohnten oder nichtversichert waren.
• Wer auf dem Land zu einer chinesischen Minderheitsgruppe gehörte besuchte signifikant weniger einen Arzt als Minderheitschinesen in Städten.
• Ein Krankenhaus nutzten signifikant weniger auf dem Land lebende Männer, Rentner über 65 Jahre, Personen mit niedrigem Bildungsabschluss oder auch versicherte Landmenschen als ihre jeweiligen städtischen Counterparts.
Die ForscherInnen schlussfolgerten, dass es nach den Ergebnissen dieses Surveys in einer Gesundheitssystemreform in China auf drei Hauptansätze ankommt: allgemeiner Versicherungsschutz, höhere Aufwendungen für den Versicherungsschutz und Anhebung des Bildungsniveaus der Bevölkerung. Außerdem müsse sich eine Reform um den Versorgungszugang in abgelegenen Gegenden und für die ländlichen ethnischen, aber chinesischen Minderheiten kümmern.
Leider gibt es keine kostenfreie Möglichkeit des Zugangs zu diesem und weiteren der teilweise sehr informativen Aufsätze der Zeitschrift "Medical Care" (ein Jahres-Abonnement kostet für "individuals" außerhalb der USA im Moment 475 US-Dollar, was angesichts des günstigen Kurses des Euros also letztlich gar nicht unfinanzierbar ist. Dies soll und ist weder bezahlte oder unbezahlte Werbung sein, sondern nur ein Versuch, dem Totschlagargument der "utopischen Kosten" eines Abos einer solchen Zeitschrift etwas von seiner Kraft zu nehmen).
Eine etwas ausführlichere und mit statistischen Kennziffern angereicherte Zusammenfassung des Artikels gibt es hier: Liu, Meina; Zhang, Qiuj; Lu, Mingshan; Kwon, Churl-Su und Quan, Hude: Rural and Urban Disparity in Health Services Utilization in China (Medical Care, (45(8):767-774)
Bernard Braun, 28.8.2007
Weiter Weg bis zur echten Unabhängigkeit des Kosovo
 Die Zukunft des Kosovo steht zurzeit wieder weit oben auf der internationalen Agenda. Seit dem Eingreifen einer multinationalen Schutztruppe 1999 strebt die südserbische Provinz die Unabhängigkeit an. Die albanische Bevölkerungsmehrheit vermochte es von Anfang an, verbreitete antiserbische Ressentiments zu schüren und die westlichen Länder für sich einzunehmen. Die Unabhängigkeit des kosovarischen Gemeinwesens mit seinen gerade zwei Millionen Einwohnern scheint mittlerweile ausgemachte Sache zu sein, und die USA haben bereits entsprechende unilaterale Schritte angekündigt.
Die Zukunft des Kosovo steht zurzeit wieder weit oben auf der internationalen Agenda. Seit dem Eingreifen einer multinationalen Schutztruppe 1999 strebt die südserbische Provinz die Unabhängigkeit an. Die albanische Bevölkerungsmehrheit vermochte es von Anfang an, verbreitete antiserbische Ressentiments zu schüren und die westlichen Länder für sich einzunehmen. Die Unabhängigkeit des kosovarischen Gemeinwesens mit seinen gerade zwei Millionen Einwohnern scheint mittlerweile ausgemachte Sache zu sein, und die USA haben bereits entsprechende unilaterale Schritte angekündigt.
Jenseits der politischen Dimension und geostrategischer Interessen bleibt die Frage der Lebensfähigkeit eines zukünftigen Staates Kosovo indes weitgehend unbeantwortet. Die BefürworterInnen der Autonomie und einer Kleinstaaterei, die angesichts der fortschreitenden Globalisierung und Errichtung von länderübergreifenden Blöcken antiquiert erscheint, sind bisher überzeugende Antworten auf die Frage schuldig geblieben, wovon denn ein unabhängiges Kosovo wirtschaftlich leben soll - außer von EU-Zuwendungen und Heimüberweisungen. Nahezu acht Jahre nach der Intervention im Kosovo ist es überfällig, mehr Verantwortung auch für die Kehrseite der politisch angestrebten Unabhängigkeit einzufordern. Wer eine selbständige politische Einheit anstrebt, muss auch die Frage der makroökonomischen Perspektiven und damit die Finanzierbarkeit eines zukünftigen Staates Kosovo beantworten können.
Die Ausgangssituation nach jahrelanger Auseinandersetzung mit der serbischen Obrigkeit und deren Rückzug lag die Gesundheitsversorgung weitgehend darnieder. Das Gesundheitswesen war weitgehend zerstört und wurde nach 1999 zu einem wichtigen Bereich internationaler Bemühungen um den Wiederaufbau der ehemals serbischen Provinz Kosovo. Das Britische Medical Journal (BMJ) veröffentlichte bereits 1999 den Artikel Restoring medical services in Kosovo will be a massive task, der einen Einblick in die damalige Situation vermittelt.
Zu den augenscheinlichen Mängeln in der Substanz und Funktionalität der Gesundheitseinrichtungen gesellten sich weitere Probleme, die den Aufbau eines Versor-gungssystems erschwerten. So erwies sich die Qualifikation des verbliebenen Personals als unzureichend für eine gute Versorgung der Bevölkerung. Nach Wegfall der sozialistisch geprägten Strukturen des ehemaligen Jugoslawien bestand zudem ein eklatanter Mangel an Verwaltungs- und Managementerfahrungen. Und schließlich gab es keine verlässlichen Zahlen über Krankheitshäufigkeit, Sterblichkeit und andere für die Gestaltung eines Gesundheitswesens grundlegende Daten.
Zwar erfolgte mit Hilfe der internationalen Gemeinschaft ein umfassender Wiederaufbau einer akzeptablen Versorgungsinfrastruktur. Im Mittelpunkt der Entwicklungszusammenarbeit stand zudem eine Stärkung der Primärversorgung mit dem Ziel, die für ehemals sozialistische Länder typische, ausgeprägte Hospitalisierungstendenz zu überwinden. Hierzu findet sich ebenfalls im BMJ ein lesenswerter Beitrag mit dem Titel Development of family medicine in Kosovo. Insgesamt zeigt das kosovarische Gesundheitswesen nach übereinstimmender Einschätzung internationaler Beobachter bisher jedoch wenig Fortschritte und Verbesserungen. Die öffentliche Finanzierung ist weiterhin unzulänglich und der rechtmäßige Gebrauch des Geldes nicht immer gewährleistet. Demnach ließen die KosovarInnen oft das erforderliche Engagement vermissen und verwiesen gerne darauf, dass erst einmal der Status geklärt sein müsse, bevor man entscheidende Schritte einleiten könne. Dass auch nach der Unabhängigkeit bestimmte Aufgaben zu leisten sind, kommt dabei nicht vor. Die internationale Gemeinschaft hat Unsummen in den Kosovo gesteckt, ohne dass sich die Gesamtlage entsprechend verbessert hätte. Der Versuch der weiteren Stabilisierung in dieser Region wird auch in Zukunft erhebliche Mittel verschlingen, aber der Ausgang ist überaus ungewiss.
Im Rahmen einer Evaluierungsmission zur Begutachtung zweier von luxemburgischer Seite unterstützter Gesundheitsprojekte im Kosovo erbat das Außenministerium des Großherzogtums Luxemburg auch eine generelle Einschätzung der gesamtwirtschaftlichen Perspektiven und insbesondere der Situation des Gesundheitswesens. Die entsprechenden Passagen des von Jens Holst, Alfons Fuchs und Anton Berishaj verfassten Evaluierungsberichts mit dem Titel "Evaluation des activités de la Coopération au développement luxembourgeoise dans le secteur de la santé au Kosovo"(Evaluierung der Aktivitäten der Luxemburger Entwicklungszusammenarbeit mit dem Gesundheitssektor im Kosovo / Vlerësimi i aktiviteteve të Agjencisë së Luksemburgut për Bashkëpunim Zhvillimor në sektorin e shëndetësisë në Kosovë) hat das luxemburgische Außenministerium für weitere Veröffentlichungen zur Verfügung gestellt. Auf dieser Homepage können Sie sowohl eine Zusammenstellung der Kapitel 6 (Makroökonomie) und 7 (Gesundheitssystem) nebst relevanter Anhänge als auch nur Kapitel 7 mit den zugehörigen Annexen in drei Sprachen - deutsch, französisch und albanisch - herunterladen.
• Hier finden sich Kapitel 6 und 7 plus Anhänge.
• Ici vous trouvez les chapitres 6 et 7 avec des annexes.
• Këtu gjenden kapitulli 6 dhe 7 plus shtojcat.
• Und hier können Sie nur Kapitel 7 über das kosovarische Gesundheitswesen herunterladen.
• Et ici vous pouvez télécharger seulement le chapitre 7 sur le système de santé du Kosovo.
• Kurse këtu mund ta shkarkoni vetëm kapitullin 7 mbi shëndetësinë kosovare.
Jens Holst, 28.8.2007
Die Reichen ins Töpfchen, die Armen ins Kröpfchen
 Mehr als fünfundzwanzig Jahre sind vergangen, seit marktradikale ReformerInnen um den ehemaligen Militärdiktator Augusto Pinochet (1973-90) das zuvor überwiegend staatliche Gesundheitswesen grundsätzlich umkrempelten. Chile war damals das erste Land der westlichen Welt, dass die Gesundheitsversorgung nach privatwirtschaftlichen Vorstellungen ausrichtete. Mittlerweile haben es viele Länder dieser Erde den südamerikanischen Vorreitern nachgemacht, die ihr Gesundheitswesen in Zeiten knapper werdender beziehungsweise systematisch verknappter öffentlicher Kassen reformieren. Die Begründungsstrategien bedienen sich ebenso allgegenwärtiger wie inhaltsleerer Schlagwörter wie "Effizienzsteigerung", "Modernisierung" oder "Anpassung nicht mehr zeitgemäßer Strukturen", um ihr Vorgehen einer skeptischen Öffentlichkeit schmackhaft zu machen.
Mehr als fünfundzwanzig Jahre sind vergangen, seit marktradikale ReformerInnen um den ehemaligen Militärdiktator Augusto Pinochet (1973-90) das zuvor überwiegend staatliche Gesundheitswesen grundsätzlich umkrempelten. Chile war damals das erste Land der westlichen Welt, dass die Gesundheitsversorgung nach privatwirtschaftlichen Vorstellungen ausrichtete. Mittlerweile haben es viele Länder dieser Erde den südamerikanischen Vorreitern nachgemacht, die ihr Gesundheitswesen in Zeiten knapper werdender beziehungsweise systematisch verknappter öffentlicher Kassen reformieren. Die Begründungsstrategien bedienen sich ebenso allgegenwärtiger wie inhaltsleerer Schlagwörter wie "Effizienzsteigerung", "Modernisierung" oder "Anpassung nicht mehr zeitgemäßer Strukturen", um ihr Vorgehen einer skeptischen Öffentlichkeit schmackhaft zu machen.
Parallel zur Umstellung der Rentenversicherung vom Umlageverfahren auf Kapitaldeckung führten ÖkonomInnen aus der Chicagoer Schule um Milton Friedman ab 1981 den Krankenkassenwettbewerb ein. Neben der öffentlichen Versicherung Fondo Nacional de Salud (FONASA) sind in Chile seither private Krankenkassen als Pflichtversicherungen zugelassen. Die Chilenen können wählen, ob sie ihren Beitrag von sieben Prozent des Bruttolohns an FONASA oder an eine der zurzeit sechzehn Instituciones de Salud Previsional (ISAPREs) überweisen. Zumindest diejenigen, die genügend verdienen. Privatisiert wurde nämlich bloß der lukrative Teil des Gesundheitswesens. Nur jeder fünfte Chilene führt heute seine Krankenkassenbeiträge an eine ISAPRE ab, in erster Linie Besserverdienende und Kinderlose.
Wie die gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland arbeitet FONASA nach dem Solidarprinzip: Die Beiträge richten sich nach dem Einkommen ab, die Leistungen nach der Bedürftigkeit der Versicherten. Bei den ISAPREs hingegen herrscht das Äquivalenzprinzip, höheres Einkommen bzw. höhere Prämien führen zu besserem Versicherungsschutz. Das Nebeneinander von solidarischer Sozialkasse und Privatversicherungen mit risikoadaptierten Beiträgen führt zu sozialer Risikoselektion und erheblichen Gerechtigkeitsproblemen im chilenischen System. Der heute allerorten propagierte Kassenwettbewerb reduziert sich in Chile auf das Ringen um die "guten Risiken". Ein Ausgleich unfairer Risikoverteilungen ist nicht vorgesehen.
Für die unteren Einkommensgruppen, vor allem für kinderreiche Familien, bietet die private Versicherungsbranche keine bezahlbaren Verträge. Die viel gerühmte Wahlfreiheit bleibt kaufkräftigen Schichten vorbehalten. Bis heute sorgt die öffentliche Krankenkasse für die medizinische Versorgung der ärmeren Mehrheit in der chilenischen Eindrittelgesellschaft. Dabei versorgt die Sozialkasse neben den zahlenden Versicherten zusätzlich drei Millionen Mittellose beitragsfrei mit. Die erforderlichen Mittel bringt der Fiskus auf, der mehr als die Hälfte des Budgets aus Steuergeldern finanziert. Wie in allen auf Privatisierung ausgerichteten Systemen ist der ansonsten so heftig gescholtene und geschmähte Staat für die soziale Absicherung einer großen Bevölkerungsgruppe verantwortlich.
Doch das Beispiel Chile zeigt nicht nur, dass die Privatisierung sozialer Dienste immer teuer mit Steuergeldern erkauft ist. Es verdeutlicht auch eindrücklich die hohen sozialen Kosten und vielfachen unerwünschten Wirkungen von Kassenwettbewerb, Ökonomisierung des Gesundheitswesens und mit Privatisierung untrennbar verbundener Profitinteressen.
Die im Verlag Hans Jacobs in Lage erschienene Diplomarbeit, die Jens Holst im Jahr 2001 an der Fakultät für Gesundheitswissenschaften der Universität Bielefeld vorlegte, war fraglos die bis dahin umfangreichste und detaillierteste deutschsprachige Darstellung des chilenischen Gesundheitssystems.
Hier können Sie den Text herunterladen: Krankenversicherung in Chile - Privatisierung führt zu Risikoselektion und hohen Patientenzahlungen
Jens Holst, 12.8.2007
Durchfallerkrankungen in Lateinamerika: Private Ärzte und Apotheker behandeln schlechter als öffentliche Anbieter
 Jedes Jahr sterben nach Angaben der UN-Kinderhilfsorganisation UNICEF weltweit mehr als 10 Millionen Kinder an vermeidbaren Ursachen. Mehr als 40 % dieser Sterbefälle beruhen auf Atemwegsinfektionen, Mangelernährung und dem dramatischen Verlust an Körperflüssigkeit und Salzen, der durch Durchfallerkrankungen (18 %) verursacht wird. In allen Fällen sind kosteneffektive Behandlungsmöglichkeiten verfügbar und bekannt gemacht.
Jedes Jahr sterben nach Angaben der UN-Kinderhilfsorganisation UNICEF weltweit mehr als 10 Millionen Kinder an vermeidbaren Ursachen. Mehr als 40 % dieser Sterbefälle beruhen auf Atemwegsinfektionen, Mangelernährung und dem dramatischen Verlust an Körperflüssigkeit und Salzen, der durch Durchfallerkrankungen (18 %) verursacht wird. In allen Fällen sind kosteneffektive Behandlungsmöglichkeiten verfügbar und bekannt gemacht.
Bereits seit einiger Zeit häuften sich Studien, die auf einen unerwarteten und lange für unmöglich gehaltenen Grund hinwiesen, der trotz der Behandlungsmöglichkeiten zu der hohen Sterblichkeit insbesondere an den Folgen von Durchfallerkrankungen vor allem in Entwicklungs- und Schwellenländern hinwiesen: Die auch in Ländern mit niedrigem Einkommen bevorzugte Behandlung in privaten Arztpraxen oder Apotheken statt in öffentlichen Gesundheitseinrichtungen. Trotz der vielfach genau gegenteiligen Empfindungen (z.B. bessere Ausstattung, kürzere Wartezeiten, Bereitschaft, mehr Zeit für Patienten aufzubringen) zeigte eine Zusammenstellung von demografischen und gesundheitlichen Daten aus 28 weltweiten Ländern in den 1990er Jahren, dass private Anbieter keineswegs immer besser ausgestattet sind und im Vergleich zu öffentlichen Gesundheitsdiensten bei Diarrhoe weniger auf die einfache und wirksame Methode der Wiederanreicherung mit Wasser durch die Gabe von in Flüssigkeit gelösten Salzen (so genannte "oral rehydration salts/solution" [ORS]) setzten als auf die Verschreibung von meist unnützen Medikamenten. Die von der "World Health Organization (WHO)" publizierte Leitlinie zur Behandlung von Kinder-Durchfallerkrankungen empfiehlt eindeutig, dass nur eine kleine Anzahl dieser Erkrankten (z.B. die mit blutigem Stuhlgang) mit Arzneimitteln behandelt werden soll und bei der weit überwiegenden Mehrheit Salz-/Glukoselösungen und der Zinkersatz die einzig angebrachte, wirksame und vor allem extrem preisgünstige Behandlung ist.
Eine populäre Zusammenfassung der Behandlungsempfehlungen enthält die als PDF-Datei erhältliche achtseitige WHO/UNICEF-Broschüre "CLINICAL MANAGEMENT OF ACUTE DIARRHOEA".
Ebenfalls in den 1990er Jahren wurde für Lateinamerika und die karibische Region, wo die Behandlung durch private Anbieter weit verbreitet ist, gezeigt, "that more than half of the providers treating child diarrhoea cases and acute respiratory infections (ARI) are in the private sector" und dass beispielsweise in Mexiko "private practitioners perform significantly worse than public ones in terms of advice, therapy, and drugs prescribed for both diarrhoea and ARI."
Ob dies überholt ist oder nur in wenigen Ländern dieser Region so war oder ist, wollten nun Gesundheitswissenschaftler von der Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health in Baltimore (USA) wissen. Dazu nutzten sie 10 von der Weltbank unterstützte "Living Standards Measurement Surveys (LSMS)" aus lateinamerikanischen und karibischen Ländern (Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Panama, Peru, Bolivien), die für den Zeitraum 1993-2003 repräsentative Daten lieferten. Damit konnten die Erkrankungs- und Behandlungsdaten von 31.073 Kindern unter 5 Jahren analysiert werden, von denen in den Erhebungszeiten 8.241 an einer Durchfallerkrankung litten.
Die wichtigsten Ergebnisse lauten:
• 36,8 % der erkrankten Kinder wurden eher durch einen privaten Behandler (Arzt oder Apotheker) behandelt als durch einen in einer öffentlichen Einrichtung.
• Nachdem der ökonomische Status der Befragtenhaushalte auf einer Skala in 20 %-Gruppen (Quintile) bestimmt wurde, erhöhte sich statistisch hochsignifikant mit jedem Übergang von einem niedrigeren zu einem höheren Status die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder mit Durchfall von einem privaten statt einem öffentlichen Leistungserbringer behandelt wurden, um 6,5 Prozentpunkte. Unter den Kindern mit dem ärmsten Elternhaus betrug dieser Anteil 23,3 % und unter den bestsituiertesten Kindern bzw. Elternhäuser 52,1 %.
• Auch die aktuelle Studie belegt nun eindeutig, dass die Behandlung im privaten Sektor qualitativ schlechter ist als im öffentlichen Bereich: Während 13,7 % der Kinder, die von privaten Ärzten behandelt wurden, orale Salzlösungen erhielten, waren dies immerhin 33 % der Kinder, die einen öffentlichen Anbieter aufsuchten. Umgekehrt erhielten die von privaten Anbietern behandelten Kinder mit höherer Wahrscheinlichkeit Arzneimittel verordnet, die von den Wissenschaftlern als "most commonly unnecessary antibiotics" bewertet wurden. 78,9 % der privaten Ärzte verschrieben den von ihnen behandelten Kinder Arzneimittel. Von den privaten Apothekern griffen, nicht weiter verwunderlich, 96,5 % zur Medikamentenschachtel. Der Anteil der privaten Behandler, die ORS "verordneten" bzw. empfohlen, lag betrug unter den Ärzten 20,2 % und bei den Apothekern 3,9 %.
• Ein weiteres Ergebnis ihrer Analyse fassen die Public Health-Experten so zusammen: "Ironically, when it comes to treatment for child diarrhoea, wealthier and better educated households in Latin America are paying for treatment in the private sector that is ineffective in comparison with treatments that are commonly and inexpensively avialable."
Auch wenn die Behandlung durch private Leistungserbringer deutlich unangemessener, schlechter und teurer ist als bei öffentlichen Gesundheitsdiensten, bleibt die Frage, warum auch bei letzteren nur eine Minderheit der erkrankten Kinder die im Normalfall einzig empfehlenswerte, wirksame und preiswerte Behandlung oder Beratung erhalten haben.
Wer sich mehr über den Umfang der Kinder-Durchfallerkrankungen sowie ihre wirksame Vermeidung und Behandlung informieren will, kann dies auf der beeindruckenden, sehr materialreichen und zum Teil auch bedrückenden (z.B. wegen der laufenden "Uhr" der am Besuchstag an Diarrhöe erkrankten und gestorbenen Kinder) Website des indischen Rehydration Project tun.
Kostenlos erhältlich ist leider nur das Abstract des gerade in der Onlineausgabe der Fachzeitschrift "Health Economics" erschienenen, d.h. noch in Druck befindlichen Aufsatzes
"The Role of Private Providers in Treating Child Diarrhoea In Latin America" von Hugh Waters, Laurel Hatt und Robert Black.
Wer einen entsprechenden Zugang über eine Bibliothek hat, kann den 9 Seiten umfassenden Aufsatz über diese Adresse herunterladen.
Bernard Braun, 6.5.2007
"Priorisierung" von Gesundheitsleistungen: Der skandinavische Weg
 Das Thema "Rationierung von Gesundheitsleistungen" wird in der gesundheitspolitischen Debatte in Deutschland tunlichst umgangen. Zwar gelten hier noch nicht wie im "National Health Service" der Engländer klare Ausschlusskriterien, die unlängst etwa dazu führten, dass Übergewichtige und Fettleibige keine künstlichen Hüft- oder Kniegelenke mehr erhalten. (vgl. zur Rationierung in England: Rationierung und Wartezeit in Großbritannien - eine Bewertung aus deutscher Sicht) Gleichwohl wurde auch im deutschen Versorgungssystem eine Vielzahl medizinischer Eingriffe oder Diagnosemethoden aus dem Leistungskatalog der GKV ausgegliedert, wobei die hierzu gefällten Beschlüsse des Gemeinsamen Bundesausschusses insbesondere "alternative" Heilmethoden betrafen.
Das Thema "Rationierung von Gesundheitsleistungen" wird in der gesundheitspolitischen Debatte in Deutschland tunlichst umgangen. Zwar gelten hier noch nicht wie im "National Health Service" der Engländer klare Ausschlusskriterien, die unlängst etwa dazu führten, dass Übergewichtige und Fettleibige keine künstlichen Hüft- oder Kniegelenke mehr erhalten. (vgl. zur Rationierung in England: Rationierung und Wartezeit in Großbritannien - eine Bewertung aus deutscher Sicht) Gleichwohl wurde auch im deutschen Versorgungssystem eine Vielzahl medizinischer Eingriffe oder Diagnosemethoden aus dem Leistungskatalog der GKV ausgegliedert, wobei die hierzu gefällten Beschlüsse des Gemeinsamen Bundesausschusses insbesondere "alternative" Heilmethoden betrafen.
Charakteristisch für die deutsche Debatte ist etwa jenes Statement, das Gesundheitsministerin Ulla Schmidt in ihrer Rede vor dem Deutschen Ärztetag im Mai 2005 abgab. "Eine explizite Rationierung in dem Sinne, dass medizinisch notwendige und sinnvolle Leistungen vorenthalten werden, wird es mit mir nicht geben", führte sie einerseits aus. Und setzte dann andererseits fort: "Wenn wir wollen, dass medizinischer Fortschritt für alle in Zukunft finanzierbar ist, dann müssen wir auch den Mut haben zu sagen: Nicht alles kann und muss überall zur Verfügung stehen." Einerseits - andererseits. Rationierung nein - aber medizinisch Machbares für alle auch wieder nein. Man muss den Thesen des Kieler Gesundheitsforschers Fritz Beske nicht bis ins letzte Detail folgen, der unlängst in einem Gutachten eine Verdreifachung der GKV-Ausgaben bis 2050 durch medizinischen Fortschritt prognostizierte und daraus die Alternative ableitete: "Mehr Geld ins System oder Leistungsausgrenzungen". Absehbar scheint gleichwohl, dass die Kostensteigerungen im Gesundheitswesen durch medizinisch-technische und pharmazeutische Innovationen nur sehr begrenzt durch jene Maxime aufzufangen sind, die hierzulande das Rationierungs-Menetekel lange Zeit gebannt hatte mit der Formel "Rationalisierung statt Rationierung!"
Gesundheitssysteme in Skandinavien haben die Frage nach der gerechten Verteilung gesundheitlicher Leistungen bei begrenzten Ressourcen schon seit längerem aufgegriffen. Unter dem Stichwort "Priorisierung" wird dort nicht nur diskutiert, sondern auf Provinzebene bereits praktisch erprobt, welche medizinischen Leistungen in welcher Reihenfolge aus öffentlichen Mitteln finanziert werden sollen. Die beiden wohl auch über die Grenzen Schwedens hinaus bekanntesten Beispiele hierfür sind das sogenannte Blekinge-Modell, zum anderen die Richtlinien des Provinziallandtages Västerbottens Län.
Uwe K. Preusker beschreibt in einem Aufsatz im "Deutschen Ärzteblatt" ausführlich den gesundheitspolitischen Hintergrund und die Vorgehensweise bei diesen Modellen. Vorgestellt werden auch Ergebnisse, wie beispielsweise die dort festgelegten vier Priorisierungsgruppen. In der 1.Gruppe finden sich: Versorgung lebensbedrohlicher akuter Krankheiten, Versorgung solcher Krankheiten, die ohne Behandlung zu dauerhafter Invalidisierung oder zu vorzeitigem Tod führen, Versorgung schwerer chronischer Krankheiten, Palliative (lindernde) Versorgung und Versorgung in der Endphase des Lebens, Versorgung von Menschen mit herabgesetzter Autonomie. In Gruppe 2 sind Präventions- und Rehabilitationsmaßnahmen vorgesehen. In Gruppe 3 die Versorgung weniger schwerer akuter und chronischer Erkrankungen und in Gruppe 4 die Versorgung aus anderen Gründen als Krankheit oder Schaden.
Vorgestellt wird auch eine sogenannte "Stoppliste", die Indikationen und medizinische Behandlungen umfasst, die nun nicht mehr aus öffentlichen Geldern, sondern privat zu finanzieren sind. Dazu zählen beispielsweise: Krampfadern als kosmetisches Problem, chronische Rückenschmerzen, Sterilisation des Mannes, Kaiserschnitt ohne offenbare psychische oder medizinische Indikation, Operation gutartiger Tumoren, leichte Prostatabeschwerden, Kopfläuse, Blasenkatarrh bei Kindern, Kniebeschwerden bei älteren Patienten, Arthroskopie, anale Erkrankungen oder auch die chirurgische Versorgung von Magen-Darm-Erkrankungen bei multimorbiden älteren Patienten.
Es wäre wünschenswert, wenn die Diskussion des skandinavischen Wegs auch zu einer offeneren Diskussion der Probleme und Perspektiven in deutschen Gesundheitswesen führt.
Der Artikel ist hier im Volltext abrufbar: Preusker, Uwe K.: Skandinavische Gesundheitssysteme: Priorisierung statt verdeckter Rationierung
(Deutsches Ärzteblatt 104, Ausgabe 14 vom 06.04.2007, Seite A-930 / B-830 / C-791)
Eine frühere und noch etwas ausführlichere Fassung des Aufsatzes (PDF, 7 Seiten) findet man hier: Offene Priorisierung als Weg zu einer gerechten Rationierung? (GGW, WIdO G+G Wissenschaft, 2/2004 (April), 4. Jg.)
Gerd Marstedt, 20.4.2007
"Ärzte ohne Grenzen" beklagen das öffentliche Verdrängen humanitärer Krisen
 Obwohl Millionen von Menschen weltweit unter den Folgen von Krisen und Konflikten leiden, bleiben diese für die Weltöffentlichkeit häufig unsichtbar, so beklagt die internationale Hilfsorganisation "Ärzte ohne Grenzen" und nennt unter anderem das Hinwegsehen über die verheerende Situation in der Zentralafrikanischen Republik, in Sri Lanka oder Kolumbien. Über viele humanitäre Katastrophen haben die Medien auch im Jahr 2006 kaum berichtet. "Ärzte ohne Grenzen" veröffentlichte jetzt eine Liste jener 10 Krisen, die im vergangenen Jahr am wenigsten erwähnt wurden. Nur gut 7 von insgesamt mehr als 14.500 Nachrichtenminuten haben die drei großen US-amerikanischen Fernsehsender im vergangenen Jahr über die aufgeführten Krisen berichtet. Zwei der zehn aufgeführten Beispiele:
Obwohl Millionen von Menschen weltweit unter den Folgen von Krisen und Konflikten leiden, bleiben diese für die Weltöffentlichkeit häufig unsichtbar, so beklagt die internationale Hilfsorganisation "Ärzte ohne Grenzen" und nennt unter anderem das Hinwegsehen über die verheerende Situation in der Zentralafrikanischen Republik, in Sri Lanka oder Kolumbien. Über viele humanitäre Katastrophen haben die Medien auch im Jahr 2006 kaum berichtet. "Ärzte ohne Grenzen" veröffentlichte jetzt eine Liste jener 10 Krisen, die im vergangenen Jahr am wenigsten erwähnt wurden. Nur gut 7 von insgesamt mehr als 14.500 Nachrichtenminuten haben die drei großen US-amerikanischen Fernsehsender im vergangenen Jahr über die aufgeführten Krisen berichtet. Zwei der zehn aufgeführten Beispiele:
In Industrieländern halten viele Tuberkulose (TB) für eine Krankheit vergangener Zeiten. Dabei fordert sie weltweit immer mehr Menschenleben, besonders in Entwicklungsländern, in denen viele an HIV/Aids erkranken. Jedes Jahr sterben rund zwei Millionen Menschen an TB, rund neun Millionen erkranken an ihr. Hinzu kommen jährlich etwa 450.000 neue Fälle von multiresistenter Tuberkulose. Diese bereits Besorgnis erregende Situation verschlimmerte sich 2006 noch: Eine Studie unter 544 Tuberkulosepatienten in Südafrika, ergab, dass zehn Prozent der Erkrankten extrem resistente TB entwickelt hatten. Keines der Medikamente, die sich momentan in der Entwicklung befinden, wird die Behandlungsmöglichkeit in naher Zukunft deutlich verbessern. "Obwohl Tuberkulose jedes Jahr mehrere Millionen Leben fordert, werden keine ausreichenden Anstrengungen unternommen, um die Krankheit zu bekämpfen", kritisierte Tido von Schön-Angerer, Direktor der Medikamentenkampagne von Ärzte ohne Grenzen.
"Das Leben in Haitis Hauptstadt Port au Prince beispielsweise ist seit langem von Gewalt geprägt. Doch obwohl das Land nur 50 Meilen von den USA entfernt liegt, hatten die Fernsehanstalten im vergangenen Jahr gerade mal 30 Sekunden Sendezeit dafür übrig", sagte Nicolas de Torrente, Geschäftsführer der US-amerikanischen Sektion von Ärzte ohne Grenzen. Insgesamt wurden drei der Krisen aus der Liste in den Medien kurz als Randthemen erwähnt, über fünf gab es gar keine Berichterstattung.
Die zehn vergessenen humanitären Krisen des Jahres 2006, über die Ärzte ohne Grenzen kürzere Artikel bringt:
• Zentralafrikanische Republik: Auf der Flucht vor Gewalt
• Tuberkulose: Die Krankheit fordert immer mehr Menschenleben
• Tschetschenien: Die Folgen des Krieges
• Sri Lanka: Zivilisten unter Beschuss - Hilfe nur begrenzt möglich
• Unterernährung: Wirksame Behandlungsstrategien werden nicht umgesetzt
• D. R. Kongo: Extreme Entbehrungen und Gewalt
• Somalia: Im Griff von Krieg und Katastrophen
• Kolumbien: Leben in Angst
• Haiti: Gewalt beherrscht die Hauptstadt
• Zentralindien: Gewalt und Vertreibung
Gerd Marstedt, 10.1.2007
Note mangelhaft für Arzneimittel-Informationen österreichischer Ärzte
 Das Wiener Marketing- und Meinungsforschungs-Unternehmen OEKONSULT hat in einer Studie im Dezember 2006 in einer für Österreich repräsentativen Interviewbefragung erhoben, wie gut der Patientendialog mit behandelnden Ärzten und die Information von Ärzten und Apothekern über Medikamente funktioniert. Das Ergebnis stellt den medizinischen Dienstleistern ein überaus schlechtes Zeugnis aus. Nur eine kleine Minderheit der Befragten sagt, dass Ärzte immer und in jedem Fall ausreichend über Wirkungsweisen, Nebenwirkungen, Wechselwirkungen und mögliche Unverträglichkeiten der von ihnen verordneten Medikamente informieren. Und ebenso sind Fragen von Ärzten oder Apothekern über andere, zur Zeit eingenommene Medikamente und damit nicht unerhebliche Risiken durch Wechselwirkungen der Arzneien eher Ausnahme als Regel. Wenn man davon ausgeht, dass österreichische Mediziner sich nicht völlig anders gegenüber ihren Patienten verhalten als deutsche, dann zeigen die Ergebnisse der Studie auch für Deutschland dringenden Veränderungsbedarf.
Das Wiener Marketing- und Meinungsforschungs-Unternehmen OEKONSULT hat in einer Studie im Dezember 2006 in einer für Österreich repräsentativen Interviewbefragung erhoben, wie gut der Patientendialog mit behandelnden Ärzten und die Information von Ärzten und Apothekern über Medikamente funktioniert. Das Ergebnis stellt den medizinischen Dienstleistern ein überaus schlechtes Zeugnis aus. Nur eine kleine Minderheit der Befragten sagt, dass Ärzte immer und in jedem Fall ausreichend über Wirkungsweisen, Nebenwirkungen, Wechselwirkungen und mögliche Unverträglichkeiten der von ihnen verordneten Medikamente informieren. Und ebenso sind Fragen von Ärzten oder Apothekern über andere, zur Zeit eingenommene Medikamente und damit nicht unerhebliche Risiken durch Wechselwirkungen der Arzneien eher Ausnahme als Regel. Wenn man davon ausgeht, dass österreichische Mediziner sich nicht völlig anders gegenüber ihren Patienten verhalten als deutsche, dann zeigen die Ergebnisse der Studie auch für Deutschland dringenden Veränderungsbedarf.
Einige Befragungsergebnisse seien kurz vorgestellt.
• "Wenn ich ein Medikament vom Arzt verschrieben oder in der Apotheke ausgehändigt bekomme, werde ich immer gefragt, welche Arzneien ich gegenwärtig sonst noch einnehme." Befragungsteilnehmer bejahen dies eher bei Ärzten zu 39%, bei Apothekern zu 44%.
• "Ich meine, Ärzte informieren ihre Patienten immer und in jedem Fall ausreichend über Wirkungsweisen, Nebenwirkungen, Wechselwirkungen und mögliche Unverträglichkeiten der von ihnen verordneten Medikamente." 22% der Befragten stimmen eher zu.
• "Die verständliche und ausreichende Information über Medikamente und ihre (Wechsel)-Wirkungen und Risken ist keine Hol-Schuld des Patienten sondern eine Bringschuld des Arztes." 75% stimmen eher zu
• "Ich denke, mein Arzt würde es sehr begüßen, wenn ich ihn immer sehr eingehend und ausführlich befrage, welche etwaigen Unverträglichkeiten, Risiken oder Wechselwirkungen die von ihm verordneten Medikamente haben." Nur 22% stimmen eher zu.
Die obigen Statements waren auf einer 6stufigen Skala zu beantworten, von "trifft voll und ganz zu" bis "trifft überhaupt nicht zu". Wir haben die Antworthäufigkeiten für Antworten auf den ersten drei Skalenstufen wieder gegeben, so dass dem Statement zumindest in der Tendenz eher zugestimmt wird. Nähme man nur Antworthäufigkeiten jener, die stark oder voll und ganz zustimmen, so würden die Ergebnisse eine noch massivere Kritik beinhalten.
Die Studie basiert auf 1.083 Interviews, durchgeführt im Dezember 2006 im Rahmen einer anonymen Straßenbefragung, repräsentativ für die österreichische Wohnbevölkerung im Alter von 16 bis 81
Jahren. Der Bericht mit allen Befragungsergebnissen ist hier als PDF-Datei (37 Seiten) verfügbar: OEKONSULT Lifestyle Trend Focus Umfrage: Medikamente (Un-)Verträglichkeit?
Gerd Marstedt, 7.1.2007
Das "4-2-1"-Problem der Volksrepublik China: Gesundheitsversorgung in Zeiten rasanter Konjunktur und Bevölkerungsalterung
 Nicht um ein Spielsystem geht es, sondern um die Tatsache, dass u.a. durch frühere bevölkerungspolitische Intervention (z.B. die Ein-Kindpolitik), demnächst eine junge Person die soziale Absicherung von zwei Eltern und möglicherweise auch noch von vier Großeltern finanzieren muss.
Nicht um ein Spielsystem geht es, sondern um die Tatsache, dass u.a. durch frühere bevölkerungspolitische Intervention (z.B. die Ein-Kindpolitik), demnächst eine junge Person die soziale Absicherung von zwei Eltern und möglicherweise auch noch von vier Großeltern finanzieren muss.
Der vielfach beschriebene wirtschaftliche Boom des Schwellenlandes China führt auch zu einem schnellen demografischen Wandel, der sogar schneller erfolgt als in dem häufig dramatisierten Fall Deutschlands.
Wer also studieren will, was ein politisch gewollter und teilweise erzwungener dramatischer Rückgang der Fertilität, ein rasanter Alterungsprozess und eine Kostenexplosion im Gesundheits- und Invaliditätswesen bedeutet, sollte sich die Entwicklung in China genau ansehen.
Die Entwicklung auf der Makroebene des chinesischen Gesundheitswesens fasst ein Artikel auf der stets informativen und lesenswerten Homepage des Rostocker Zentrums für den demografischen Wandel (ZDWA) so zusammen:
"Während die Zahl der zu versorgenden alten Menschen steigt, geht der Anteil der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter (die einen Großteil der Kosten des Gesundheitswesens trägt) zurück. So wird das Verhältnis zwischen Erwachsenen im erwerbsfähigen Alter (zwischen 15 und 64 Jahre) und alten Menschen (65 Jahre und älter) voraussichtlich stark abfallen und bis zum Jahr 2050 von 9 Personen auf 2,5 Personen sinken. Der demografische Wandel ist für ein Gesundheitssystem, das ohnehin mit zahlreichen Herausforderungen — insbesondere mit dem raschen Anstieg der Gesamtkosten und der privaten Zuzahlungen für Gesundheitsleistungen — zu kämpfen hat, alles andere als förderlich. Das chinesische Gesundheitswesen galt früher als exemplarisch für einkommensschwache Agrargesellschaften; es basierte vornehmlich auf staatlicher Bezuschussung und bot gleichberechtigten Zugang zur medizinischen Grundversorgung. Seit Anfang der 1980er Jahre, also seit Beginn des Kostenanstiegs, hat sich die Gesundheitsversorgung für die Bevölkerung verschlechtert: Es ist ein marktorientiertes System geworden, das stark auf private Beteiligung baut und sich durch überhöhte Gebühren auszeichnet. Steigende Selbstbeteiligungskosten haben mittlerweile dazu geführt, dass Arztbesuche von vielen Chinesen hinausgezögert werden und besonders zwischen städtischen und ländlichen Gebieten ein großes Ungleichgewicht beim Zugang zur ärztlichen Versorgung besteht. Besorgniserregend sind diese Entwicklungen besonders für alte Menschen, die voraussichtlich einen höheren Bedarf an medizinischer Betreuung haben und gleichzeitig über weniger finanzielle Mittel verfügen. Hinzu kommt, dass gerade in den ländlichen Gebieten, dort wo die Gesundheitsversorgung schlechter ist, der Anteil älterer Menschen an der Gesamtbevölkerung besonders groß ist."
Dabei entpuppen sich die speziellen Entwicklungsdynamiken der chinesischen Gesellschaft sogar als für das Gesundheitswesen krisenverschärfend:
"Die Herausforderungen der Bevölkerungsalterung sind für jedes Land gewaltig, doch für China sind sie besonders entmutigend. Denn im Gegensatz zu entwickelten Ländern, in denen der Alterung eine wirtschaftliche Entwicklung vorausgegangen ist, sieht China sich mit den massiven Bedürfnissen einer sehr viel schneller alternden Bevölkerung konfrontiert, während der wirtschaftliche Aufbau des Landes noch am Anfang steht — d.h. die für die Deckung des Bedarfs notwendigen Gelder fehlen. Chinas Dilemma besteht also darin, die dringend benötigten Mittel unter den miteinander konkurrierenden Bereichen aufzuteilen und gleichzeitig das wirtschaftliche Wachstum aufrechtzuerhalten."
Auf der Website des "Population Reference Bureau" finden Sie den von Toshiko Kaneda im Juni 2006 verfassten ausführlichen Report "China's concern over population aging and health"
Bernard Braun, 10.12.2006
Die Krankenversicherungsreform in den Niederlanden: Vorbild für Deutschland?
 Die Reform des niederländischen Krankenversicherungssystems wird von deutschen Experten aufmerksam beobachtet, da sie Elemente sowohl der Bürgerversicherung wie auch der Gesundheitspauschale enthält. Seit der Reform gilt in den Niederlanden eine einheitliche Wettbewerbsordnung für alle Krankenversicherer. Finanziert wird das System zu gleichen Teilen aus einkommensunabhängigen Beiträgen und aus Pauschalen. Einen Teil davon finanziert der Staat, indem er die Beiträge für Kinder und Jugendliche sowie den Gesundheitszuschuss für Niedrigverdiener finanziert.
Die Reform des niederländischen Krankenversicherungssystems wird von deutschen Experten aufmerksam beobachtet, da sie Elemente sowohl der Bürgerversicherung wie auch der Gesundheitspauschale enthält. Seit der Reform gilt in den Niederlanden eine einheitliche Wettbewerbsordnung für alle Krankenversicherer. Finanziert wird das System zu gleichen Teilen aus einkommensunabhängigen Beiträgen und aus Pauschalen. Einen Teil davon finanziert der Staat, indem er die Beiträge für Kinder und Jugendliche sowie den Gesundheitszuschuss für Niedrigverdiener finanziert.
Vor diesem Hintergrund hat ein Projekt der Hans-Böckler-Stiftung mit einer Analyse des Reformprozesses in den Niederlanden durchgeführt und dabei Gründe für die Verabschiedung der Reform ebenso dargelegt wie die eingeleiteten Veränderungen. Die Frage der Übertragbarkeit auf das deutsche Krankenversicherungssystem wird von den Wissenschaftlern eher skeptisch beurteilt. Sie nennen vor dem Hintergrund der niederländischen Erfahrungen weitere wesentliche Elemente für eine effiziente Krankenversicherungsreform. Diese würden "gleichzeitig die Nachhaltigkeit der Finanzierung in der gesetzlichen Krankenversicherung erhöhen, Ungleichheiten im Zugang zur gesundheitlichen Versorgung beseitigen, Effizienzreserven erschließen." Zudem sind sie nach Einschätzung der Wissenschaftler auch in Deutschland "politisch kompromissfähig". Diese Elemente sind:
• Eine Beitragspflicht für weitere Einkunftsarten, etwa aus Kapitalvermögen, in der GKV würde die Finanzierungsbasis nachhaltig stärken. Die Niederlande machen vor, wie der Beitragseinzug ohne bürokratischen Aufwand möglich ist.
• Das bisherige Verhältnis von PKV und GKV führt zu einer Risikoselektion zu Gunsten der privaten Krankenversicherung. Diese hat im Durchschnitt jüngere und besser verdienende Mitglieder. Ähnlich wie in den Niederlanden könnten die einseitigen Wirkungen dieser Selektion durch Ausgleichszahlungen der PKV kompensiert werden. Dazu könnten die privaten Versicherer in den Risikostrukturausgleich der gesetzlichen Kassen einbezogen werden.
• Eine Angleichung des Vergütungsniveaus für ärztliche Leistungen beseitigt die finanziellen Anreize für Ärzte, privat Versicherte bevorzugt zu behandeln. Das niederländische Beispiel zeigt, dass eine Angleichung kostenneutral möglich ist. Das bedeutet, dass die Vergütungen für GKV-Versicherte steigen und für PKV-Versicherte sinken.
Download des Abschlussberichts des Projekts (Autoren: Stefan Greß, Maral Manouguian, Jürgen Wasem; 38 Seiten): Krankenversicherungsreform in den Niederlanden. Vorbild für einen Kompromiss zwischen Bürgerversicherung und Pauschalprämie in Deutschland? Duisburg Essen 2006.
Einen kurzen 4seitigen Überblick über die Krankenversicherungsreform in den Niederlanden, einschließlich einer Darstellung der Vor- und Nachteile und der Übertragungsmöglichkeiten in das deutsche Gesundheitssystem findet man auch in einem für die Friedrich-Ebert-Stiftung erstellten Aufsatz von Katja Lass: Die Gesundheitsreform in den Niederlanden - ein Vorbild für Deutschland?
Gerd Marstedt, 5.12.2006
Afrika in der Krankheits- und Armutsspirale: Ein WHO-Report
 Die derzeit 738 Millionen Einwohner des afrikanischen Kontinents werden niemals ihre verheerende Armut überwinden ohne ihre katastrophale gesundheitliche Situation erfolgreich angegangen zu sein. Das ist der Ausgangspunkt des von der Weltgesundheitsorganisation WHO gerade zum ersten Mal veröffentlichten speziellen "African Regional Health Report".
Die derzeit 738 Millionen Einwohner des afrikanischen Kontinents werden niemals ihre verheerende Armut überwinden ohne ihre katastrophale gesundheitliche Situation erfolgreich angegangen zu sein. Das ist der Ausgangspunkt des von der Weltgesundheitsorganisation WHO gerade zum ersten Mal veröffentlichten speziellen "African Regional Health Report".
Auf 194 Seiten fasst die WHO als erstes die wichtigsten Gesundheitsprobleme Afrikas zusammen:
• Eine "stille Epidemie" ist die extrem hohe Mütter- und Kindersterblichkeit. 19 der 20 Länder, die bei diesen beiden Personengruppen die weltweit höchsten Sterberaten haben, liegen in Afrika. Afrika hat außerdem die höchste Säuglingssterblichkeitsrate weltweit.
• AIDS dezimiert weiterhin die Bevölkerung. Dem Anteil von 11 %, den Afrika an der Weltbevölkerung hat, steht sein Anteil von 60 % an allen weltweit HIV-Infizierten gegenüber.
• 90 % aller Malariainfektionen findet man in Afrika und dort besonders bei den Kindern unter 5 Jahren.
Eine der zentralen Ursachen dieser und anderer gesundheitlicher Probleme sind für die Verfasser des WHO-Reports die weitgehend ungelösten sanitären Probleme der Versorgung mit genießbarem Trinkwasser und der getrennten Entsorgung von Abwässern. Nur 58 % der Menschen südlich der Sahara haben Zugang zu einer sicheren Wasserversorgung.
Der Bericht enthält aber auch einige Beispiele für positive Entwicklungen, was zeigt, dass mit der entsprechenden Unterstützung und politischem Willen Auswege aus dem geschilderten Elend möglich sind:
• Kinderlähmung ist u.a. durch Impfprogramme fast beseitigt und ein wachsender Teil Kinder sind gegen Masern geimpft.
• In Uganda konnten 50 % der HIV/AIDS-Patienten mit antiretroviralen Medikamenten versorgt werden.
• In Ruanda half eine rigorose Helm- und Gurtpflicht, die Anzahl von Verkehrstoten innerhalb eines Jahres um ein Viertel zu senken und
• In Südafrika transportiert ein "Gesundheitszug" regelmäßig Ärzte und Medizinstudenten zur Bersorgung der Einwohner in abgelegene ländliche Gegenden.
Ein Fazit eines der WHO-Verantwortlichen weist auf die enormen Barrieren hin, die trotzdem überwunden werden müssen, um die gesundheitliche Erosion der Zukunft Afrikas zu verhindern: "We know what the challenges are, and we know how to address them — but we also recognize that Africa's fragile health systems represent an enormous barrier to wider application of the solutions highlighted in this report. If we are to continue moving forward, African governments and their partners must make a major commitment and invest more funds to strengthen health systems" (Luis Gomes Sambo, Regional Director of the WHO Regional Office for Africa).
Hier finden Sie die PDF-Datei des WHO-Berichts "The Health of the people: The African Regional Health Report"
Bernard Braun, 28.11.2006
Reformstrategien in Lateinamerika
 Die deutsche Debatte über die Gesundheitsreform zeichnet sich häufig durch eine ausgeprägte Provinzialität aus. Unter dem Einfluss des allmählich zunehmenden Harmonisierungsdrucks schauen die Mitgliedsstaaten heute allerdings zunehmend in die Nachbarländer, und nach vergleichbaren Kriterien durchgeführte Länderstudien z.B. des European Observatory öffnen langsam auch das Bewusstsein dafür, dass nicht jedes Land jede Erfahrung selber durchmachen muss, sondern ein Lernen aus vergleichbaren Vorläufern anderswo sinnvoll sein kann. Kaum Beachtung finden in Deutschland indes Reformprozesse außerhalb der industrialisierten Welt, sprich Europas, Nordamerikas und Australiens. Dabei haben vor allem etliche Schwellen- und sogar Entwicklungsländer interessante Reformideen in die Praxis umgesetzt.
Die deutsche Debatte über die Gesundheitsreform zeichnet sich häufig durch eine ausgeprägte Provinzialität aus. Unter dem Einfluss des allmählich zunehmenden Harmonisierungsdrucks schauen die Mitgliedsstaaten heute allerdings zunehmend in die Nachbarländer, und nach vergleichbaren Kriterien durchgeführte Länderstudien z.B. des European Observatory öffnen langsam auch das Bewusstsein dafür, dass nicht jedes Land jede Erfahrung selber durchmachen muss, sondern ein Lernen aus vergleichbaren Vorläufern anderswo sinnvoll sein kann. Kaum Beachtung finden in Deutschland indes Reformprozesse außerhalb der industrialisierten Welt, sprich Europas, Nordamerikas und Australiens. Dabei haben vor allem etliche Schwellen- und sogar Entwicklungsländer interessante Reformideen in die Praxis umgesetzt.
Trotz einschlägiger und teils sehr prägnanten Erfahrungen beispielsweise aus Chile und Mexiko, spielt Lateinamerika in der hiesigen Debatte eigentlich keine Rolle. Dabei können uns diese beiden Länder viel über Chancen und Grenzen von Privatisierung und Kassenwettbewerb bzw. über die Verknüpfung von Beitrags- und Steuerfinanzierung lehren. Und bisher hat niemand in der aktuellen Debatte über den Gesundheitsfonds nach Kolumbien geschaut. Dort fließen seit über zehn Jahren Ressourcen aus verschiedenen Quellen in einen solidarisch finanzierten Fonds zusammen, der gezielte Maßnahmen zur Allokationssteuerung und aktive Umverteilungsmechanismen umfasst.
Hier finden Sie den Hintergrundartikel zu Gesundheitsreformen in Lateinamerika Soziale Sicherheit
Jens Holst, 20.6.2006
Kanada: Teure Diagnoseverfahren werden Oberschicht-Patienten häufiger verordnet
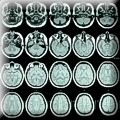 Eine Analyse von über 300.000 medizinischen Diagnose-Leistungen im kanadischen Winnipeg hat jetzt gezeigt: Bei Oberschicht-Angehörigen werden sehr viel häufer teure Diagnoseverfahren wie Computertomographie (CT) und Kernspintomographie (MRI) durchgeführt im Vergleich zu Unterschicht-Patienten (mit niedrigerem Einkommen und Bildungsniveau). Diese müssen sich oftmals mit eher "billigen" Verfahren begnügen. Berücksichtigt wurde dabei sowohl das Alter der Patienten als auch deren Morbidität (Gesundheitszustand).
Eine Analyse von über 300.000 medizinischen Diagnose-Leistungen im kanadischen Winnipeg hat jetzt gezeigt: Bei Oberschicht-Angehörigen werden sehr viel häufer teure Diagnoseverfahren wie Computertomographie (CT) und Kernspintomographie (MRI) durchgeführt im Vergleich zu Unterschicht-Patienten (mit niedrigerem Einkommen und Bildungsniveau). Diese müssen sich oftmals mit eher "billigen" Verfahren begnügen. Berücksichtigt wurde dabei sowohl das Alter der Patienten als auch deren Morbidität (Gesundheitszustand).
Bei insgesamt 21 von 36 Paarvergleichen (relative Häufigkeit der Anwendung von radiologischen Verfahren, Kernspintomographie, Computertomographie, Ultraschall u.a.) zeigten sich statistisch signifikante Unterschiede zwischen Oberschicht- und Unterschichtangehörigen mit jeweils vergleichbarem Gesundheitszustand und in derselben Altersgruppe. Diese Quote lag in acht Fällen sogar über dem Wert 2, was bedeutet, dass Angehörige der oberen Einkommensgruppen mehr als doppelt so häufig mit dem jeweiligen Verfahren untersucht wurden. Gerade bei schwer erkrankten Patienten fielen die Unterschiede am höchsten aus.
Ob die Ergebnisse der Studie übertragbar sind, wird von den Autoren (Sandor Demeter u.a., Winnipeg Regional Health Authority, Winnipeg) offen gelassen, in der Analyse wurden nur Daten aus Winnipeg, Hauptstadt der kanadischen Provinz Manitoba, aus dem Jahr 2002 verwendet.
In einem Interview mit Forum Gesundheitspolitik äußerte sich Dr. Sandor Demeter vom Health Sciences Centre in Winnipeg, Hauptautor der Studie, zu einigen Fragen:
Forum Gesundheitspolitik: Soweit man sehen kann, sind es keine finanziellen Anreize oder Zuverdienste, die das Verhalten der Ärzte erklären könnten?
Sandor Demeter: Richtig. In Manitoba sind alle diese von uns analysierten Diagnoseverfahren öffentlich finanziert und für Patienten kostenlos. Es gibt dort keine privaten Einrichtungen, die Computer- oder Kernspintomographien durchführen könnten. Zwar gibt es in einigen kanadischen Provinzen solche Einrichtungen, aber unsere Daten kommen nur aus Manitoba.
FG: Welche Erklärungen haben Sie für die Befunde, liegt es an den Ärzten, an Forderungen der Patienten?
SD: Im Augenblick können wir nur Hypothesen aufstellen und Soziologen dazu ermuntern, weiter zu forschen. Wir vermuten unter anderem, dass Oberschicht-Angehörige auch mehr Durchblick in medizinischen Fragen haben und dementsprechend höhere Ansprüche auch an die Diagnostik. Denkbar ist auch ein Entscheidungsverhalten der Ärzte, ohne dass Patienten "Druck machen". Allerdings glaube ich persönlich nicht, dass dies etwa aus Furcht vor Entschädigungsklagen von besser informierten Patienten aus der Oberschicht geschieht. Solche Klagen gegen Ärzte sind in Kanada im Gegensatz zu den USA ausgesprochen selten.
FG: Haben Sie eine Vermutung, ob die teureren Diagnoseverfahren auch bessere medizinische Effekte zeigen oder umgekehrt: Führt die ärztliche Diagnosepraxis zu schlechteren Therapiechancen für Unterschicht-Angehörige?
SD: Es ist ja hinlänglich bekannt, dass Morbidität [Erkrankungen und Gesundheitsbeschwerden] und Mortalität in Unterschichten schlechtere Werte zeigen. Mehr und aufwändigere Diagnoseverfahren bedeuten jedoch noch nicht, dass dies zu einem besseren Gesundheitszustand führt. Tatsächlich könnte ja die höhere Diagnosequote in Oberschichten auch zu mehr Falsch-Positiv-Befunden führen, Ergebnissen, die eine Erkrankung andeuten, ohne dass dies auch stimmt. Und solche Befunde wiederum könnte dann eine Kaskade weiterer Diagnostik in Gang setzen, wobei auch sehr invasive Verfahren mit hohen Gesundheitsrisiken Verwendung finden. Die Zusammenhänge hier sind wirklich sehr komplex. Von Einfluss sind da Faktoren wie: Wann geht ein Patient mit Beschwerden zum Arzt, gibt es da Sprachbarrieren, freien Zugang zu medizinischen Einrichtungen, Möglichkeiten der Notfallbehandlung und Hausbesuche, wie lange kennt der Arzt den Patienten usw.? In Anbetracht der Vielzahl von Einflussfaktoren, die man für den Zusammenhang von Armut und Gesundheit kennt, möchte ich nicht spekulieren, ob der von uns untersuchte schichtspezifische Einsatz von Diagnoseverfahren da eine zentrale Rolle spielt.
Der Aufsatz ist hier PDF-Datei verfügbar: Socioeconomic status and the utilization of diagnostic imaging in an urban setting
Gerd Marstedt, 14.11.2005
OECD-Gesundheitssystem-Reports: Beispiel Mexiko
 Auch die OECD dokumentiert und analysiert die Gesundheitssysteme ihrer Mitgliedsländer. In ihrer Studienreihe "OECD Reviews of Health Systems" ist gerade der 159 Seiten starke Bericht über Mexiko erschienen. Dort, wie in den anderen Länderberichten, werden die Stärken und Schwächen des mexikanischen Gesundheitssystems beim Zugang zur gesundheitlichen Versorgung, bei der Versorgungsqualität, der Effizienz der Dienstleistungen und der finanziellen Nachhaltigkeit beschrieben.
Auch die OECD dokumentiert und analysiert die Gesundheitssysteme ihrer Mitgliedsländer. In ihrer Studienreihe "OECD Reviews of Health Systems" ist gerade der 159 Seiten starke Bericht über Mexiko erschienen. Dort, wie in den anderen Länderberichten, werden die Stärken und Schwächen des mexikanischen Gesundheitssystems beim Zugang zur gesundheitlichen Versorgung, bei der Versorgungsqualität, der Effizienz der Dienstleistungen und der finanziellen Nachhaltigkeit beschrieben.
Der Bericht bewertet weiterhin die aktuellen Reformversuche des Gesundheitssystems wie z.B. das vor kurzem eingeführte "System of Social Protection in Health" ("Sistema de Protección Social en Salud"). Abgerundet wird der Bericht mit Informationen über die epidemiologischen, sozialen, demografischen und ökonomischen Bedingungen des mexikanischen Gesundheitssystems.
Hier finden Sie den kostenlosen OECD-Bericht Health System-Review Mexiko
Bernard Braun, 19.9.2005
Das Gesundheitssystem in Schweden im internationalen Vergleich
 Die Struktur und Leistungsfähigkeit des Sozialsystems in Schweden spielt in vielen sozialpolitischen Diskussionen die Rolle des leuchtenden Vorbilds oder auch des abschreckenden Beispiels. Beide Urteile sind aber häufig durch Unkenntnis der wirklichen oder der aktuellen Verhältnisse getrübt. Dies gilt alles auch speziell für das schwedische Gesundheitssystem.
Die Struktur und Leistungsfähigkeit des Sozialsystems in Schweden spielt in vielen sozialpolitischen Diskussionen die Rolle des leuchtenden Vorbilds oder auch des abschreckenden Beispiels. Beide Urteile sind aber häufig durch Unkenntnis der wirklichen oder der aktuellen Verhältnisse getrübt. Dies gilt alles auch speziell für das schwedische Gesundheitssystem.
Dies kann künftig anders sein: Auf knapp 50 Seiten mit 33 Abbildungen und 8 Tabellen gibt die im Juni 2005 erschienene und von der " Swedish Association of Local Authorities and Regions (SALAR)" in englischer Sprache herausgegebene Studie/Broschüre "Swedish Health Care in an International Context - a comparison of care needs, costs, and outcomes" einen auf den OECD-Länderdaten aufbauenden sehr knappen Überblick über die hoch dezentralisierten Strukturen und einen ausgezeichneten umfangreichen Überblick über die wesentlichen Leistungsmerkmale ("performance") des schwedischen Gesundheitssystems im Vergleich mit zahlreichen OECD-Staaten (EU 16 plus Norwegen und die USA).
"The aim of the present report is descriptive - to describe the performance of different health care systems in relation to their cost. It is not our intent to analyse the health care systems in these countries in order to explain their differences. This introductory section summarises our findings from comparing the health care systems. The next section includes a short presentation of the comparisons presented by institutes and researchers in Great Britain, Canada, the Netherlands, and France. The final section compares different countries, indicator by indicator. The Appendix presents brief profiles of key characteristics that describe the health care systems in twelve countries."(S. 3)
Ganz nebenbei erfährt man also auch noch etwas über die Performance der Gesundheitssysteme in anderen OECD-Ländern.
Hier finden Sie die PDF-Datei des Reports über das Gesundheitssystem in Schweden
Bernard Braun, 4.8.2005