



Home | Patienten | Gesundheitssystem | International | GKV | Prävention | Epidemiologie | Websites | Meilensteine | Impressum
Sämtliche Rubriken in
"Prävention"
Gesundheitsverhalten (Rauchen, Ernährung, Sport usw.) |
Alle Artikel aus:
Prävention
Gesundheitsverhalten (Rauchen, Ernährung, Sport usw.)
Alkoholmindestpreis senkt Alkoholkonsum
 Gesundheitswissenschaftlich ist gut belegt, dass die Schäden von Alkoholkonsum am effektivsten durch Maßnahmen reduziert werden, die auf den Preis, die Verfügbarkeit und das Marketing von Alkohol zielen. Nach bisherigen Erfahrungen führen Preiserhöhungen zu geringerem und Preissenkungen zu höherem Konsum (wir berichteten: Alkohol: höhere Preise - weniger Probleme). Gezielter soll der Mindestpreis für die Einheit Alkohol ("alcohol minimum unit pricing", MUP) wirken, der in erster Linie den Konsum riskant Konsumierender und Jugendlicher mindern soll. Die Englische Regierung hatte daher die Einführung des Mindestpreises beschlossen, war dann aber vor der Alkoholindustrie und den großen Lebensmittelketten eingeknickt (wir berichteten).
Gesundheitswissenschaftlich ist gut belegt, dass die Schäden von Alkoholkonsum am effektivsten durch Maßnahmen reduziert werden, die auf den Preis, die Verfügbarkeit und das Marketing von Alkohol zielen. Nach bisherigen Erfahrungen führen Preiserhöhungen zu geringerem und Preissenkungen zu höherem Konsum (wir berichteten: Alkohol: höhere Preise - weniger Probleme). Gezielter soll der Mindestpreis für die Einheit Alkohol ("alcohol minimum unit pricing", MUP) wirken, der in erster Linie den Konsum riskant Konsumierender und Jugendlicher mindern soll. Die Englische Regierung hatte daher die Einführung des Mindestpreises beschlossen, war dann aber vor der Alkoholindustrie und den großen Lebensmittelketten eingeknickt (wir berichteten).
Die schottische Regierung war mutiger und hat zum 1. Mai 2018 den Mindestpreis für die Einheit Alkohol eingeführt. Das entsprechende Gesetz war bereits 2012 verabschiedet worden. Die Verzögerung ergab sich daraus, dass sich erst der Europäische Gerichtshof mit dem Gesetz befassen musste und letztlich der UK Surpreme Court in seinem Urteil die Maßnahme für verhältnismäßig erklärte und damit eine Klage der Scotch Whisky Association abwies.
Infolge des Gesetzes wurde der Mindestpreis für eine Einheit Alkohol (in den UK 8 Gramm) zum 1.5.2018 auf 50 Pence (€ 0,55) festgesetzt.
Eine internationale Gruppe von Wissenschaftlern hat die ersten Auswirkungen auf das Konsumverhalten in Schottland in den 34 Wochen von Mai bis Ende Dezember 2018 untersucht. Die Daten lieferte eine Paneluntersuchung, in der das Einkaufsverhalten einer großen und repräsentativen Stichprobe von Haushalten erhoben wird. Für die Studie wurden 290.000 Alkoholeinkäufe von 5325 Haushalten in Schottland und zum Vergleich 2,83 Mio. Einkäufe in 54.807 Haushalten in Nordengland und 800.000. Einkäufe in 10.040 Haushalten in England für die Jahre 2015 bis 2018 ausgewertet. Nordengland wurde als Vergleich gewählt, weil die Bevölkerung der schottischen sozioökonomisch ähnlich ist.
Aufgrund der mehrfachen Erhebung der Daten in einem zeitlichen Längsschnitt und dem Vorhandensein von 2 Vergleichsregionen handelt es sich um eine sog. "controlled interrupted time series analysis".
Erfasst wurde Veränderungen der Alkoholpreise im Einzelhandel, die Mengen Alkohol, die im Einzelhandel gekauft wurden und die wöchentlichen Ausgaben für Alkoholeinkäufe.
Mit Einführung des Mindestpreises stieg der Preis um 6,4 Pence bzw. 7,9% für ein Gramm Alkohol. Der wöchentliche Einkauf sank um 9,5 g Alkohol pro Erwachsenen im Haushalt.
Die Ausgaben für Alkoholeinkäufe stiegen leicht, aber statistisch nicht signifikant. Der Anstieg der Ausgaben war höher in Haushalten mit niedrigerem Einkommen und in den Haushalten mit den größten Alkohol-Einkaufsmengen.
Der Einkauf von Bier, Spirituosen und Cider sank am stärksten, also von relativ billigen Getränken (Eigenmarken von Spirituosen, starkem Cider). Den größten Effekt zeigte die Preiserhöhungen in Haushalten mit gleichzeitig niedrigem Einkommen und hohen Ausgaben für Alkohol.
Die Autoren schlussfolgern, dass die Einführung des Mindestpreises erfolgreich darin war, die von schottischen Haushalten insgesamt gekaufte Alkoholmenge zu reduzieren. Die Nachfrage nach billigem Alkohol sank stärker. Die Haushalte mit den größten Einkaufsmengen reduzierten ihre Einkäufe am stärksten.
Dieser ersten vorläufigen Auswertung wird eine umfassende Evaluation durch NHS Health Scotland im Jahr 2023 folgen, in der neben Veränderungen des Alkoholkonsums auch Gesundheitsparameter erfasst werden.
Für diesen Bericht werden zahlreiche kleinere und insbesondere auch qualitative (befragende) Studien durchgeführt, für die erste Ergebnisse bereits verfügbar sind (Website Public Health Scotland - Overview of evaluation of MUP).
O'Donnell A, Anderson P, Jané-Llopis E, Manthey J, Kaner E, Rehm J. Immediate impact of minimum unit pricing on alcohol purchases in Scotland: controlled interrupted time series analysis for 2015-18. BMJ. 2019;366:l5274. Link
David Klemperer, 25.5.20
Hilft Vitamin C Lungenentzündungen zu verhindern oder zu behandeln? Nein, "insufficient" wie bei vielen anderen Erkrankungen!
 Da Lungenentzündungen auch ohne Coronaviren zu den häufigsten und schwersten Erkrankungsarten mit Todesfolge (weltweit die fünfthäufigste Todesursache) gehören, wundert es nicht, wenn auch für ihre Prävention und Behandlung Nahrungsergänzungsmittel und Vitamine ins Spiel gebracht werden. Dazu gehört auch das Vitamin C dessen Nutzen durch mehrere Beobachtungsstudien oder Erfahrungsberichte gestützt zu werden scheint.
Da Lungenentzündungen auch ohne Coronaviren zu den häufigsten und schwersten Erkrankungsarten mit Todesfolge (weltweit die fünfthäufigste Todesursache) gehören, wundert es nicht, wenn auch für ihre Prävention und Behandlung Nahrungsergänzungsmittel und Vitamine ins Spiel gebracht werden. Dazu gehört auch das Vitamin C dessen Nutzen durch mehrere Beobachtungsstudien oder Erfahrungsberichte gestützt zu werden scheint.
Ob es sich dabei ebenfalls um Effekte dieser ohne Randomisierung und ohne Kontrollgruppen durchgeführten und damit systematisch verzerrten und Fehlschlüsse begünstigende Art von "Studien" handelt, untersucht nun ein am 27. April 2020 veröffentlichter "Cochrane Systematic Review".
Dazu wurden gemäß den hohen methodischen Cochranestandards 5 randomisierte kontrollierte Studien (RCT) und 2 quasi-RCTS mit insgesamt 2.774 Teilnehmer*innen untersucht, die in Großbritannien, den USA und Chile aber auch in Bangladesh und Pakistan durchgeführt wurden.
Da einer der oft gehörten Einwände gegen die Ergebnisse vergleichbarer Studien die zu geringe Menge der Vitamingaben oder die Gabe nur einer Menge war, ist bemerkenswert, dass sowohl wenn es um die präventiven als auch die kurativen Wirkungen ging, unterschiedliche Dosen für längere Zeit verabreicht wurden.
Die wichtigsten, für Studien über therapeutische Wirkungen von Vitaminen und Nahrungsergänzungsmitteln typische Ergebnisse lauten:
• Vier der sieben Studien waren von Pharmafirmen bezahlt worden und die drei anderen Studien machten keine Angaben zu ihrer Finanzierung.
• "We judged the included studies to be at overall high or unclear risk of bias. We rated the quality of the evidence as very low due to study limitations, variations amongst the studies, small sample sizes and uncertainty of estimates."
• Detailliert: "Evidence was insufficient to determine the effect of vitamin C for preventing pneumonia." Und: "Evidence was insufficient to determine the effect of vitamin C for treating pneumonia."
• Positiv: Keine Anzeichen von unerwünschten Effekten. Und sicherlich wirkt sich Vitamin C und dann auch noch in natürlicher Form in vielerlei anderer Hinsicht positiv auf das Wohlbefinden und die Gesundheit aus - nur nicht auf Lungenentzündungen.
Der 44-seitige systematische Cochrane-Review Vitamin C supplementation for prevention and treatment of pneumonia. - Intervention von Zahra Ali Padhani et al. ist am 27. April 2020 erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 5.5.20
Übergewichtsprävention für jugendliche Risikogruppen erreicht diese nicht, sondern überwiegend deutschsprachige Eltern
 Wichtig und richtig ist es nach allem was über ihre altersspezifische Prävalenz bekannt ist, mit Hinweisen zum Abbau oder zur Prävention von Übergewicht und Fettleibigkeit bei jungen Ziel- oder Risikogruppen zu starten.
Wichtig und richtig ist es nach allem was über ihre altersspezifische Prävalenz bekannt ist, mit Hinweisen zum Abbau oder zur Prävention von Übergewicht und Fettleibigkeit bei jungen Ziel- oder Risikogruppen zu starten.
In welcher Weise dies für besondere und auch nicht einfach erreichbare Risikogruppen, d.h. für Kinder und Jugendliche aus Familien mit Migrationshintergrund und niedrigem Sozialstatus geschieht, versucht jetzt eine in Deutschland durchgeführte Studie genauer in Erfahrung zu bringen.
Dazu recherchierten die Wissenschaftler*innen mittels eines evidenzbasierten Kriterienkatalogs im Spätsommer 2017 mit einer der großen Suchmaschinen nach frei verfügbaren print- und webbasierten Materialien zur Gesundheitsförderung mit dem Schwerpunkt Übergewichtsprävention. Zusätzlich suchten sie in einem App-Store nach kostenfreien und ebenfalls ernährungs- und übergewichtsbezogenen Gesundheits-Apps.
Sie fanden 89 Printmedien, 58 Websites und 25 Apps.
Die qualitativ wichtigsten Ergebnisse lauten so:
• "Die meisten Websites richten sich an Eltern respektive Erwachsene (65,6%) und Fachkreise (62,5%). Von den untersuchten Websites waren nur 9,4% speziell für Kinder konzipiert."
• "Webbasierte Materialien sind zu 37,5% kultursensibel gestaltet. Bei 40,6% der Websites lassen sich entweder unterschiedliche Sprachen auswählen oder es stehen Dokumente in unterschiedlichen Sprachen zum Download zur Verfügung."
• "Bei 9,4% der Websites kann eine Version in leichter Sprache aufgerufen werden. Knapp ein Fünftel der Websites bietet eine Version in Gebärdensprache und 3,1% eine Hörfassung."
• "In der Gesamtschau erfüllen Printmedien zu 92,8% die formalen und zu 87,8% die inhaltlichen Kriterien. Risikogruppen für Übergewicht werden zu 53% berücksichtigt."
• "Websites erfüllen formale Kriterien zu 88,8% und inhaltliche Kriterien zu 91,7%. Risikogruppen wurden bei etwa der Hälfte der Websites berücksichtigt (48,8%)."
• "Von den getesteten Apps richten sich die wenigen qualitativ hochwertigen an Eltern und Schwangere, sind häufig textbasiert und ausschließlich in deutscher Sprache verfasst."
Alles in Allem ist es nicht verwunderlich, wenn die Resonanz all dieser inhaltlich überwiegend korrekten Aufklärungsmaterialien bei den genannten Risikogruppen gering ist bzw. diese Gruppen damit gar nicht erreicht werden.
Die Forderungen der Autor*innen für die (Weiter-)Entwicklung solcher Materialien lauten daher auch so: "Bei ihrer Entwicklung sollten Web- und App-Entwicklerinnen und Entwickler sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die diversen Ausprägungen der Gesundheitskompetenz von Nutzerinnen und Nutzern berücksichtigen. Die Informationen sollten alltagsnah sein und praktische Anregungen zu einem gesundheitsfördernden Verhalten im Alltag geben. Risikogruppen der Gesundheitsförderung profitieren von kurzen Texten in leichter Sprache respektive in ihrer Herkunftssprache."
Selbst wenn aber mehr textbasierte Informationsmaterial für die jungen Zielgruppen existieren, löst dies nicht das Problem, dass ein nicht geringer Teil von ihnen selbst dann, wenn sie an Informationen interessiert sind, diese nicht lesen und verstehen können. Laut der jüngsten PISA-Befragung 2018 - Ländernotiz Deutschland haben 21% aller 15-Jährigen eine Lesekompetenz auf dem Grundschulniveau und dürften damit selbst mit Texten in einfacher Sprache nichts anfangen können. Dass dies noch keineswegs der höchste Anteil von Jugendlichen mit objektivem Informations- und Handlungsbedarf sein dürfte, die eine geringe Lesekompetenz haben, zeigt folgende Überlegung: Übergewicht, schlechte Ernährung und auch Leseschwäche sind überdurchschnittlich bei Angehörigen unterer sozialer Schichten zu finden Ausgerechnet Jugendliche, die also besonders Aufklärung nötig hätten, sind daher auch zu mehr als 20% leseschwach. Konkret waren es laut der 18 Seiten umfassenden Zusammenfassung der Grundbildung im internationalen Vergleich der PISA-Studie 2018 von Kristina Reiss et al. bei 29,2% der in Deutschland in nichtgymnasialen Schularten lernenden Schüler*innen der Fall. Unter den Schüler*innen in Gymnasien betrug dieser Anteil 1,8%. Fügt man diesen 21%, 29,2% oder 1,8% noch den wahrscheinlich auch nicht geringen Anteil der an solchen Informationen aus verschiedenen Gründen nicht interessierten Jugendlichen hinzu, wird die sehr begrenzte Reichweite selbst der besten Aufklärungsmaterialien offenbar.
Der Aufsatz Gesundheitsförderung und Übergewichtsprävention - systematische Bewertung verfügbarer Informationsmaterialien mit Fokus auf Risikogruppen von Jana Brauchmann, Laura Hruschka, Nadja-Raphaela Baer, Birgit Jödicke, Marc Urlen, Susanna Wiegand und Liane Schenk ist in der Ausgabe 12/2019 der Zeitschrift "Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz" erschienen. Ein Abstract ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 6.12.19
Wo gute Ratschläge für gesunde Ernährung zu teuer sind - für rund 1,6 Milliarden Personen weltweit!
 Es vergeht kein Monat und keine Ausgabe großer Publikumsmedien ohne Ratschläge für eine zugleich individuell gesunde und neuerdings auch noch umwelt- bzw. klimaschonende Ernährung.
Es vergeht kein Monat und keine Ausgabe großer Publikumsmedien ohne Ratschläge für eine zugleich individuell gesunde und neuerdings auch noch umwelt- bzw. klimaschonende Ernährung.
Einer dieser wissenschaftlich exakt begründeten Ratschläge, die Ernährungsempfehlung der "EAT-Lancet Commission" der Fachzeitschrift "Lancet" wurde gerade daraufhin untersucht ob sie erschwinglich ist und wenn nein für wie viele Menschen.
Die Lancet-ExperInnen empfehlen, dass Früchte und Gemüse den relativ größten Teil der Ernährung darstellen sollten, gefolgt von Hülsenfrüchten und Nüssen, Fleisch, Eier und Fisch sowie Milch/Milchprodukten.
Eine Gruppe us-amerikanischer Gesundheitswissenschaftlern und Gesundheitsökonomen berechnete nun für das Jahr 2011 auf der Basis der Einzelhandelspreise von 744 dieser Nahrungsmittel in 159 Ländern die Kosten einer solchen Ernährung und kamen auf einen Medianbetrag von 2,84 US-Dollar pro Tag. Der erwartungsgemäß größte Anteil der Kosten entfällt mit 31,2% auf Früchte und Gemüse, Kostenanteile von 18,7%, 15,2% und 13,2% entfallen dann noch auf Hülsenfrüchte und Nüsse, Fleisch, Eier und Fisch sowie Milch/Milchprodukte.
Zur Erschwinglichkeit dieser Ernährungsweise liefert die Studie folgende Ergebnisse:
• In Ländern mit hohem Einkommen beträgt der Anteil des Pro-Kopfeinkommens, der für sie ausgegeben werden muss 6,1%. Dieser Anteil ist trotz gestiegener Qualität der Nahrungsmittel und ihrer Komposition zum Teil niedriger als der Anteil, den die Menschen für ihre derzeitige Ernährung ausgeben.
• In den Ländern mit niedrigem Einkommen müssten Menschen, die den Empfehlungen der EAT-Kommission folgen wollen, dafür bis zu 89,1 % ihres täglichen Haushaltseinkommens ausgeben.
• Zurückhaltend geschätzt können sich weltweit mindestens 1,58 Milliarden ErdbewohnerInnen die Empfehlungen der Kommission nicht leisten. Der Großteil dieser Menschen lebt in Südasien und in Ländern südlich der Sahara.
Die Studie Affordability of the EAT-Lancet reference diet: a global analysis. von Kalle Hirvonen, Yan Bai, Derek Headey und William A Masters ist bereits vor ihrem Erscheinen in gedruckter Form in der Zeitschrift "The Lancet Global Health" kostenlos und komplett erhältlich.
Bernard Braun, 11.11.19
Senkt wenig Joggen oder Walken überhaupt das Sterblichkeitsrisiko und sinken Sterberisiken mit Länge des Joggens? Ja, nein!
 Ein oft geäußertes Argument gegen den Ratschlag "doch öfter und intensiver" zu joggen oder zu walken ist der Mangel an Zeit oder besser gesagt dem Mangel an der Zeit, die man vermutlich braucht um sich so intensiv zu bewegen, dass es sich überhaupt lohnt: "5x die Woche 30 Minuten durch den Stadtpark schaff ich nicht und 1x bringt nichts".
Ein oft geäußertes Argument gegen den Ratschlag "doch öfter und intensiver" zu joggen oder zu walken ist der Mangel an Zeit oder besser gesagt dem Mangel an der Zeit, die man vermutlich braucht um sich so intensiv zu bewegen, dass es sich überhaupt lohnt: "5x die Woche 30 Minuten durch den Stadtpark schaff ich nicht und 1x bringt nichts".
Zu deutlich anderen Ergebnissen kommt ein im Oktober 2019 noch vor dem Druck veröffentlichter systematischer Review mit Meta-Analyse von sechs prospektiven Kohorten mit 232 149 TeilnehmerInnen und mit Follow-ups zwischen 5,5 und 35 Jahren.
Die zwei wichtigsten Ergebnisse lauten:
• Joggen oder Walken senkt das Gesamtsterblichkeitsrisiko, das Risiko an Krebs oder einem kardiovaskulären Ereignis zu sterben signifikant um 27%, 23% und 30%.
• Das verblüffende Ergebnis des Reviews lautet: "A meta-regression analysis combining results from three cohort studies showed no significant dose-response trends. Even the smallest doses of running that were examined in the available studies (i.e. ≤1 time a week, <50 min a week, <6 mph and <500 MET(metabolic equivalent)-min/week) were found to confer significant all-cause mortality benefits."
• Und: "We found no evidence that mortality benefits increase with greater amounts of running."
Dies sollte nun nicht dazu motivieren, egal wie viel Freizeit zur Verfügung steht weniger als 50 Minuten pro Woche zu joggen oder zu walken. Aber die Erwartung, seine Sterblichkeitsrisiken durch mehr als 50 Minuten Jogging oder Walk linear verringern zu können, scheint auch nicht ohne Weiteres einzutreffen.
Und sich regelmäßig zu bewegen verbessert auch Gesundheit wie Lebensqualität jenseits von Sterblichkeit.
Lesenswert sind zum Verständnis dieser Ergebnisse und für zukünftige Studien zum Thema die sieben von den Reviewern vorgestellten Limitationen ihres bereits methodisch hochwertigen Reviews.
Die Studie Is running associated with a lower risk of all-cause, cardiovascular and cancer mortality, and is the more the better? A systematic review and meta-analysis von Pedisic Z, Shrestha N, Kovalchik S et al. wird in der Fachzeitschrift "British Journal of Sports Medicine" erscheinen. Eine elektronische Version des Aufsatzes ist vorab komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 9.11.19
Vermittelt das Medizinstudium Kenntnisse über Ernährungsverhalten? Nein, oder wie Blinde Blinden das Sehen beibringen sollen!
 In ihrer Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Gesundheitsförderung und der Prävention (Präventionsgesetz - PrävG) - Regierungsentwurf vom 17.12. 2014 vom 19.01.2015 führt die Bundesärztekammer u.a. aus: "Prävention ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die über das Gesundheitswesen hin-ausreicht und sowohl die gesundheitsbezogene Veränderung von Lebenswelten als auch von Lebensweisen einschließt. Dabei spielen Ärztinnen und Ärzte eine zentrale Rolle, da sie Patienten aller gesellschaftlicher Schichten gleichermaßen erreichen und diese zum geeigneten Zeitpunkt auf eine Veränderung von Verhaltensweisen und zur Wahrnehmung gesundheitsförderlicher Angebote ansprechen und motivieren können. Zudem können sie an der Gestaltung von Lebenswelten durch ihr Wissen über Gesunderhaltung und Krankheits-entstehung mitwirken."
In ihrer Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Gesundheitsförderung und der Prävention (Präventionsgesetz - PrävG) - Regierungsentwurf vom 17.12. 2014 vom 19.01.2015 führt die Bundesärztekammer u.a. aus: "Prävention ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die über das Gesundheitswesen hin-ausreicht und sowohl die gesundheitsbezogene Veränderung von Lebenswelten als auch von Lebensweisen einschließt. Dabei spielen Ärztinnen und Ärzte eine zentrale Rolle, da sie Patienten aller gesellschaftlicher Schichten gleichermaßen erreichen und diese zum geeigneten Zeitpunkt auf eine Veränderung von Verhaltensweisen und zur Wahrnehmung gesundheitsförderlicher Angebote ansprechen und motivieren können. Zudem können sie an der Gestaltung von Lebenswelten durch ihr Wissen über Gesunderhaltung und Krankheits-entstehung mitwirken."
Dementsprechend bieten sich ÄrztInnen, die jährlich mindestens einmal Kontakt mit rund 80% der Bevölkerung haben, als Präventionslotsen an bzw. bekommen diese Aufgabe zugewiesen. Dies gilt auch für die Beratung von Individuen und Bevölkerung über gesundheitlich problematische bzw. gesunde Ernährungsgewohnheiten, also jenseits des "wir sollten vielleicht mal ein paar Pfund abnehmen".
Daran ob sie diese Aufgabe wirklich kompetent und wirksam erfüllen können, lassen nun die Ergebnisse einer aktuellen Studie zum Stellenwert von Kenntnissen über Ernährung, zur Vermittlung von Fertigkeiten für eine gesunde Ernährung und zum speziell für die Beratung und die Korrektur von Ernährungsverhalten notwendigen Know how in der Mediziner- und Arztausbildung zweifeln, und zwar weltweit.
Grundlage ist hauptsächlich ein systematischer Review der zwischen 2012 und 2018 erschienenen Studien über die Ernährungserziehung im Studium und während der Ausbildung von MedizinstudentInnen und JungärztInnen. Insgesamt gab es dazu 66 Studien von denen 24 für den Review geeignet waren. Von den 16 quantitativen und drei qualitativen Studien und den fünf Curricula-Initiativen stammten 11 aus den USA, 4 aus Europa, 7 aus Australien und dem asiatischen Raum, eine aus Afrika und eine aus dem Mittleren Osten.
Die Studien spiegeln die Ausbildungsqualität so wider:
• Ohne Ausnahme steht fest, "that nutrition is insufficiently incorporated into medical education, regardless of country, setting, or year of medical education."
• Dies führt zu Defiziten "in nutrition education affect students' knowledge, skills, and confidence to implement nutrition care into patient care."
• Dort wo es in der Medizinerausbildung Initiativen für spezielle Curricula zum Thema Ernährung und Ernährungsverhalten gibt, gibt es "modest positive effects".
Dass sich MedizinstudentInnen und approbierte ÄrztInnen natürlich in Eigeninitiative Kenntnisse und Fertigkeiten für diesen Bereich aneignen können, steht außer Frage und geschieht mit Sicherheit auch. Und natürlich fanden die AutorInnen des Reviews - mal wieder - keine systematische Studie(n) über die Verhältnisse im Medizinstudium an deutschen Hochschulen und in der Facharztausbildung in deutschen Kliniken, geschweige denn über den realen ernährungsbezogenen Inhalt von Arzt-Patientgesprächen im deutschen Gesundheitssystem.
Ob dies praktisch zur Folge haben sollte, das sowieso schon überladene Curriculum des Medizinstudium und der Facharztausbildung noch mit qualitativ hochwertigen Inhalten zur Ernährung anzureichern oder ob nicht ernsthafter und vorrangig die gleichrangige Integration von nichtärztlichen TherapeutInnen und Helfern - also z.B. auch von ÖkotrophologInnen in die ärztlich-medizinische Versorgung vorangetrieben werden sollte, ist für das deutsche Gesundheitsversorgungssystem längst überfällig.
Der systematische Review Nutrition in medical education: a systematic review von Jennifer Crowley, Lauren Ball und Gerrit Jan Hiddink ist im September 2019 in der Fachzeitschrift Lancet (Volume 3, ISSUE 9, Pe379-e389) erschienen und als Open Access-Text komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 2.11.19
18 Jahre Aufklärung über "gesunde und ungesunde Ernährung" hat in den USA nur wenig und dann oft nur sozial ungleich bewegt
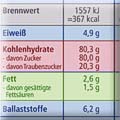 Weniger minderwertige Kohlenhydrate, mehr hochwertige, weniger Fett oder gesättigte Fettsäuren, mehr ungesättigte, Vorsicht vor verstecktem Zucker, und, und, und … zahllose Ratschläge, Kurse, Handbücher und jede Menge Ratgeber und Modellprojekte geben Tipps für gesunde oder warnen vor ungesunder Ernährung und deren möglichen Folgen.
Weniger minderwertige Kohlenhydrate, mehr hochwertige, weniger Fett oder gesättigte Fettsäuren, mehr ungesättigte, Vorsicht vor verstecktem Zucker, und, und, und … zahllose Ratschläge, Kurse, Handbücher und jede Menge Ratgeber und Modellprojekte geben Tipps für gesunde oder warnen vor ungesunder Ernährung und deren möglichen Folgen.
Viele dieser Aktivitäten haben in nur selten langjährigen Modellprojekten, Beobachtungsstudien aber auch einigen randomisierten kontrollierten Studien einen Nutzen nachgewiesen. Überlegt man sich aber, dass oft allein die mit Zuwendung, guter Information und Aufmerksamkeit verbundene Intervention in Projekten oder Modellversuchen und/oder die explizit oder implizit soziale Erwünschtheit von Effekten der jeweiligen Ernährungsvariante eine Wirkung fördert - selbst bei Angehörigen einer Kontrollgruppe mit "normaler" Ernährung ist dies oft so - , sind Erfolgsmeldungen nicht völlig überraschend.
Ob und wie sich daran etwas ändert, wenn Interventionsstudien zu Ende sind und mittel- bis langfristig so genannte "real world"-Bedingungen ohne ProjektleiterIn und Studienmeetings herrschen, ist weniger untersucht und bekannt.
Eine 2019 veröffentlichte Studie über die Ernährungsweise von 43.996 erwachsenen US-BürgerInnen in der Zeit zwischen 1999 und 2016, liefert hierzu nun bedenkenswerte Ergebnisse. Die eingangs beschriebene ständige Flut von Ernährungs-Ratgeber und -Ratschlägen ist einer der Pfeiler des in den USA weit verbreiteten und von Hagen Kühn ausgezeichnet analysierten Healthismus.
Nun hat ein ForscherInnenteam auf Basis von neun Befragungen des "National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES)", der "Food and Nutrition Database for Dietary Studies (FNDDS)" und mit Hilfe des "Healthy Eating Index (HEI)-2015" (misst wie sich die AmerikanerInnen an die für sie konzipierten und kommunizierten Ernährungsleitlinien halten.
Zu den wichtigsten Ergebnissen gehören folgende:
• Die Gesamtaufnahme von Kohlenhydraten sank um 2% und der Konsum von geringwertigen Kohlenhydraten ging um 3 % zurück. Der Konsum gesünderer, qualitativ hochwertiger Kohlenhydrate stieg nur um 1%.
• Der Anteil an Nahrungsmitteln aus geringwertigen Kohlenhydraten an der typischen Menge von Kalorien betrug 42%, der höherwertigen Kohlenhydrate wie z.B. in ganzen Früchten oder Körnern nur 9%.
• Die Gesamtaufnahme von Fetten stieg um 1%. Die Hälfte des Fettkonsums bestand aus Produkten mit gesättigten Fettsäuren.
- Gesättigte Fettsäuren lieferten 12% der täglich aufgenommenen Kalorien. Empfohlen wird durchweg, dass nur 10% aller Kalorien durch diese Art von Fettsäuren aufgenommen wird.
• Erwachsene mit höherem Einkommen haben ihren Konsum minderwertiger Kohlenhydrate mehr reduziert als Arme und Geringverdiener. In beiden Gruppen handelt es sich aber nicht um hohe Werte: Bei der ersten Gruppe sank der Anteil über die 17 Jahre um 4%, bei der zweiten um 2%.
• Die Adhärenz zu Ernährungs-Leitlinien verbesserte sich zwar für alle US-AmerikanerInnen. Keine Verbesserung gab es aber bei den über 50-Jährigen, bei den Menschen mit weniger als einem High-School-Abschluss und den BürgerInnen, die unter der Armutsgrenze leben mussten.
Einer der Studienleiter, Fang Fang Zhang Epidemiologe an der Tufts Universität, fasste die Ergebnisse so zusammen: "Although there are some encouraging signs that the American diet improved slightly over time, we are still a long way from getting an 'A' on this report card. Our study tells us where we need to improve for the future," und zog den Schluss "These findings also highlight the need for interventions to reduce socioeconomic differences in diet quality, so that all Americans can experience the health benefits of an improved diet."
Noch so erfolgreich erscheinende Modellprojekte, und natürlich auch die in Deutschland, sollten nach den Ergebnissen dieser Studie, nicht allzu selbstzufrieden sein, sondern die Nutzeffekte ihrer Interventionen und Empfehlungen unter Alltagsbedingungen über längere Zeit und differenziert (z.B. nach Einkommen, Bildung) untersuchen und ggfls. zusätzlich intervenieren. Über die Notwendigkeit einer Art Daueraufklärung und auch ihrer möglicherweise immer noch geringen Wirkung, sollte dann ebenfalls nachgedacht werden.
Die Studie Trends in dietary carbohydrate, protein, and fat intake and diet quality among US adults, 1999-2006 von Shan, Z., Rehm, C.D., Rogers, G., Ruan, M., Wang, D.D., Hu, F.B., Mozaffarian, D., Zhang, F.F. und Bhupathiraju, S. ist in der Fachzeitschrift JAMA im September 2019 (322(12), 1-10) erschienen. Ein Abstract ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 2.10.19
Senken langjährige Raucher ihr Herz-/Kreislauferkrankungsrisiko durch Nichtmehrrauchen? Jein, selbst nach 15 Jahren nicht völlig!
 Zu den wichtigen Überlegungen und Erwartungen von Personen, die ein potenzielles und nicht selten über Jahre ausgeübtes suchtartiges ungesundes Verhalten beenden wollen und für jene, die dies ständig empfehlen, gehört, wann der erhoffte Nutzen für die Gesundheit eintritt. Dies gilt in hohem Maße für die Beendigung von Rauchen und das mit dem Rauchen assoziierte Risiko von Herz-/Kreislauferkrankungen.
Zu den wichtigen Überlegungen und Erwartungen von Personen, die ein potenzielles und nicht selten über Jahre ausgeübtes suchtartiges ungesundes Verhalten beenden wollen und für jene, die dies ständig empfehlen, gehört, wann der erhoffte Nutzen für die Gesundheit eintritt. Dies gilt in hohem Maße für die Beendigung von Rauchen und das mit dem Rauchen assoziierte Risiko von Herz-/Kreislauferkrankungen.
Wenig hilfreich oder letztlich nicht vertrauenerweckend war aber die bisher durch Studien gestützte Spannbreite von 2 bis 20 Jahren, in denen dieses Risiko für Raucher nach Beendigung des Rauchens auf das von ständigen Nichtrauchern gesunken ist. Weit in ambulanten Praxen verbreitete Risikokalkulatoren kommen zum Ergebnis, dass frühere Raucher nur noch für 5 Jahre nach Beendigung des Tabakkonsums ein erhöhtes Herz-/Kreislauferkrankungsrisiko haben.
Die Ergebnisse einer aktuellen methodisch hochwertigen Teilstudie mit 8.770 TeilnehmerInnen der Framing Heart Study sind geeignet die Verbreitung zu optimistischer oder pessimistischer Erwartungen zu verhindern. Untersucht wurde deren Rauchverhalten und die Inzidenzen der Herz-/Kreislauferkrankungen für den Zeitraum 1971 bis 2015.
Bei zwei Risikovergleichen lauten die Ergebnisse unter Berücksichtigung einer Reihe von Confoundern folgendermaßen:
• Im Vergleich von Rauchern, die 20 oder mehr Jahre geraucht haben, ist das Herz-/Kreislauferkrankungs-Risiko der Personen, die das Rauchen aufgehört haben nach 5 Jahren deutlich geringer als das derjenigen Personen, die weiterrauchten (6,9 versus 11,6 Neuerkrankungen pro 1.000 Personenjahren).
• Beim Vergleich des Herz-/Kreislauferkrankungs-Risikos der Personen, die das Rauchen aufhörten mit den Personen, die nie geraucht haben, war aber das Risiko der ersteren auch nach 10 bis 15 Jahren höher (6,31 versus 5,09 Neuerkrankungen pro 1.000 Personenjahren), in einer Teilgruppe sogar auch noch nach 24 Jahren.
Auch wenn die Beendigung selbst mehrjährigen Rauchens sicherlich eine Entscheidung mit gesundheitlichem Nutzen ist, sollte dies weder von ÄrztInnen noch von Noch-Rauchern mit dem Argument oder der Erwartung eines sehr schnellen vollen Erfolgs verknüpft werden. Am besten ist, gar nicht mit dem Tabakrauchen anzufangen und dafür mit geeigneten Mitteln (z.B. vollkommenes Werbeverbot) zu sorgen.
Der Aufsatz Association of Smoking Cessation With Subsequent Risk of Cardiovascular Disease von "JAMA" (322(7):642-650) erschienen. Das Abstract ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 26.8.19
Senken Nahrungsergänzungsmittel das Risiko kardiovaskulärer Erkrankungen/Sterblichkeit? Mit wenigen Ausnahmen nicht!!!
 Allein in diesem Forum finden sich in den letzten Jahren Hinweise auf 24 Studien überwiegend hoher methodischer Güte (Suche mit dem Begriff "Nahrungsergänzungsmittel"), die den allgemeinen und krankheitsspezifischen Nutzen vieler Nahrungsergänzungsmittel inklusive Vitamine untersucht haben. Dabei überwogen Studien, die den jeweiligen spezifischen Nutzen nicht belegen konnten.
Allein in diesem Forum finden sich in den letzten Jahren Hinweise auf 24 Studien überwiegend hoher methodischer Güte (Suche mit dem Begriff "Nahrungsergänzungsmittel"), die den allgemeinen und krankheitsspezifischen Nutzen vieler Nahrungsergänzungsmittel inklusive Vitamine untersucht haben. Dabei überwogen Studien, die den jeweiligen spezifischen Nutzen nicht belegen konnten.
Einen noch wesentlich umfassenderen Überblick liefert nun ein im Juli 2019 veröffentlichter "umbrella review and evidence map", der die Ergebnisse von 9 systematischen Reviews mit insgesamt 277 Studien, 24 Interventionsstudien mit 992.129 TeilnehmerInnen, 4 neuen randomisierten kontrollierten Studien und insgesamt auf dieser Basis 105 erstellten Metaanalysen zusammenfasst. Untersucht wurden in allen Studien die Effekte von Nahrungsergänzungsmitteln und Hinweisen zur Nahrungsaufnahme auf die Gesamtsterblichkeit und kardiovaskuläre Outcomes (z.B. Herzinfarkt, Schlaganfall) bei Erwachsenen.
Die Ergebnisse:
• Dafür, dass die geringere Aufnahme von Salz bei TeilnehmerInnen mit normalem Blutdruck das Risiko der Gesamtsterblichkeit senkt, gibt es gemäßigte Evidenz. Das gleiche gilt für die kardiovaskuläre Sterblichkeit bei Personen mit erhöhtem Blutdruck.
• Niedrige Evidenz gibt es für den positiven Zusammenhang der Einnahme von Omega-3-Fettsäuren und einem geringeren Risiko einen Herzinfarkt zu erleiden oder an einer kardiovaskulären Krankheit zu erkranken.
• Folsäre war mit einer geringen Sicherheit mit dem Risiko eines Schlaganfalls assoziiert. Kalzium plus Vitamin D war dagegen mit moderater Sicherheit mit einem höheren Schlaganfallrisiko assoziiert.
• Andere Nahrungsergänzungsmittel wie die Vitamine B6, A oder Multivitaminpräparate, Antioxidantien, eisenhaltige Nahrungsmittel und andere Ernährungsweisen wie z.B. eine reduzierte Aufnahme von Fett, hatten mit sehr geringer bis moderater Evidenz keinen statistisch signifikanten Effekt auf die Sterblichkeit oder kardiovaskuläre Outcomes.
Dies bedeutet zum einen die von Herstellern und auf medialen Ratgeberseiten für eine Reihe von Ergänzungsmitteln und Ernährungsweisen verbreiteten Hoffnungen kardiovaskulär wirksam zu sein, erheblich zu reduzieren. Zum anderen bedeutet dies aber nicht, dass es nicht sinnvoll und hilfreich ist, Vitamine (hier aber nachgewiesenermaßen am wirkungsvollsten in Natur- [Fisch oder Orangen] statt in Pillen-/Kapselform) oder andere Mittel aufzunehmen und damit die Lebensqualität oder auch die nicht-kardiovaskuläre gesundheitliche Befindlichkeit zu verbessern.
Der systematische Review Effects of Nutritional Supplements and Dietary Interventions on Cardiovascular Outcomes: An Umbrella Review and Evidence Map von Khan SU, Khan MU, Riaz H, et al. ist im Juli 2019 in der Fachzeitschrift "Annals of Internal Medicine" erschienen. Das Abstract ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 4.8.19
Abbau oder Vermeidung von arbeitsbezogenem Stress beim Gesundheitspersonal durch Yoga und Qigong evident - andere aber nicht!
 Eine Fülle von Studien belegen immer wieder: Arbeitsbedingter Stress ist bei Beschäftigten im Gesundheitswesen außergewöhnlich hoch. Viele chronische Krankheiten von Pflegekräften, ÄrztInnen und anderen dort beschäftigten Berufsgruppen und auch Behandlungsfehler sind eine Folge dieses Stresses. Körperliche Aktivitäten werden im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) häufig als ein geeignetes Mittel diskutiert und entsprechende Maßnahmen angeboten, Stress zu reduzieren oder die unerwünschten Auswirkungen zu regulieren. Jedoch gibt es bisher keinen publizierten systematischen Review von Studien über die Effekte der vielfältigen körperlichen Aktivitäten auf die Gesundheit des Gesundheitspersonals.
Eine Fülle von Studien belegen immer wieder: Arbeitsbedingter Stress ist bei Beschäftigten im Gesundheitswesen außergewöhnlich hoch. Viele chronische Krankheiten von Pflegekräften, ÄrztInnen und anderen dort beschäftigten Berufsgruppen und auch Behandlungsfehler sind eine Folge dieses Stresses. Körperliche Aktivitäten werden im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) häufig als ein geeignetes Mittel diskutiert und entsprechende Maßnahmen angeboten, Stress zu reduzieren oder die unerwünschten Auswirkungen zu regulieren. Jedoch gibt es bisher keinen publizierten systematischen Review von Studien über die Effekte der vielfältigen körperlichen Aktivitäten auf die Gesundheit des Gesundheitspersonals.
Daran etwas zu verändern, also vor allem Evidenz für diesen Wirkungszusammenhang zu finden, war das Ziel einer Gruppe von Gesundheitsforscherinnen an der Universität Hamburg. Sie führten dazu in den Jahren 2018 und 2019 einen systematischen Review über Studien durch, die sich mit diesem Thema beschäftigten. Dabei wurde auch die methodische Qualität der Studien genauer untersucht.
In den Review gingen 18 experimentelle Studien ein, in denen u.a. drei sehr spezifische körperliche Aktivitäten, nämlich Yoga, Tai chi und Qigong, sowie verschiedene unspezifische arbeitsplatzbezogene Trainingsprogramme auf ihre Wirkungen untersucht wurden. In 9 Studien wurde eine Mehrkomponentenintervention durchgeführt bei der körperliche Aktivitäten den kleineren Anteil hatten. In den anderen 9 Studien wurde jeweils der Effekt einer Maßnahme/Intervention untersucht.
Alle untersuchten Studien waren von minderer Qualität und durch systematische Verzerrungen geprägt. Oft war nicht differenziert bekannt, von welchen körperlichen Aktivitäten Effekte gemessen wurden und wie lange und intensiv die Interventionen dauerten und durchgeführt wurden. Und nur in fünf der Studien wurde der Stress systematisch gemessen.
Mit diesen generellen methodischen Einschränkungen gibt es zwei Ergebnisse:
• Es gibt einen stressreduzierenden Effekt von Yoga und Qigong-Angeboten und zwar auch schon bei einer Dauer der Aktivitäten von 12 Stunden.
• Allgemeine Programme zu körperlichen Aktivitäten am Arbeitsplatz und Tai chi zeigten dagegen keine signifikanten Wirkungen auf Stress.
Die Autorinnen plädieren angesichts der vielfach schlechten Qualität derartiger Studien für weitere Forschungsprojekte. Diese sind auch deshalb wichtig, um zu klären welche der in Hülle und Fülle im BGM angebotenen, geforderten oder finanzierten Bewegungs-Maßnahmen wirklich Stress reduzieren und weitere positive gesundheitliche Effekte haben, also wirtschaftlich oder reine Verschwendung sind. Möglich ist natürlich auch, dass selbst dann, wenn der angestrebte Stressreduktions-Effekt nicht eintritt jede Bewegung gegenüber 8 Stunden Sitzarbeit etwas Positives an sich hat.
Der Aufsatz The effect of physical activity interventions on occupational stress for health personnel: A systematic review. von Bischoff LL, Otto AK, Hold C, et al. ist bzw. wird in der Septemberausgabe der Fachzeitschrift "International Journal of Nursing Studies" (2019. Volume 97: 94-104) erscheinen. Das Abstract ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 20.7.19
Ausgerechnet kurz vor Ostern: Eier wieder zurück auf der "Lieber-nicht-essen"-Liste! Schwierigkeiten der informierten Entscheidung
 Egal ob es um die Einnahme oder den Konsum von Aspirin, Kaffee, das Glas Rotwein, die Mittelmeer-Diät, Schokolade, Super-/Power-Beeren oder viele andere (Lebens-)Mittel geht: Nicht selten ändern sich die auf wissenschaftliche Studien gestützten Empfehlungen innerhalb weniger Jahre - zum Teil mehrfach. Dabei spielen unterschiedliche Methoden (von der Querschnitts- oder Beobachtungsstudie ohne Kontrollgruppe bis zu Kohortenstudien mit Metaanalyse), die Anzahl der Untersuchten, die Wahl der Endpunkte ("nur" Mortalität oder auch patientenbezogene Endpunkte wie Lebensqualität) oder die Dauer der Beobachtung eine Rolle. Wie damit die Mehrheit der Bevölkerung, egal ob sie zu den DauerleserInnen von Fachzeitschriften gehört, sich in Wochenzeitschriften, in Fernsehsendungen, bei "ihrem Arzt" oder "im Internet" informiert bzw.desinformiert, informierte Entscheidungen treffen kann, die ihr gesundheitlich nützen und wirtschaftlich sind, ist nicht einfach zu beantworten.
Egal ob es um die Einnahme oder den Konsum von Aspirin, Kaffee, das Glas Rotwein, die Mittelmeer-Diät, Schokolade, Super-/Power-Beeren oder viele andere (Lebens-)Mittel geht: Nicht selten ändern sich die auf wissenschaftliche Studien gestützten Empfehlungen innerhalb weniger Jahre - zum Teil mehrfach. Dabei spielen unterschiedliche Methoden (von der Querschnitts- oder Beobachtungsstudie ohne Kontrollgruppe bis zu Kohortenstudien mit Metaanalyse), die Anzahl der Untersuchten, die Wahl der Endpunkte ("nur" Mortalität oder auch patientenbezogene Endpunkte wie Lebensqualität) oder die Dauer der Beobachtung eine Rolle. Wie damit die Mehrheit der Bevölkerung, egal ob sie zu den DauerleserInnen von Fachzeitschriften gehört, sich in Wochenzeitschriften, in Fernsehsendungen, bei "ihrem Arzt" oder "im Internet" informiert bzw.desinformiert, informierte Entscheidungen treffen kann, die ihr gesundheitlich nützen und wirtschaftlich sind, ist nicht einfach zu beantworten.
Wer 2015 gestützt auf die Ergebnisse eines systematischen Reviews und einer Metaanalyse doch wieder genussvoll ein Frühstücksei aß und sich sicher war, dass das damit aufgenommene Cholesterin nicht das Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen und die damit assoziierte Mortalität erhöhte, könnte/sollte/müsste im Lichte der aktuellsten Studie rechtzeitig vor dem österlichen Eier-Speisegipfel ernsthaft über das Ende oder eine erhebliche Reduktion des Konsums von Eiern nachdenken.
Denn am Ende von sechs prospektiven Kohortenstudien mit nahezu 29.615 beteiligten Erwachsenen ohne anfängliche kardiovaskuläre Erkrankungen hatten nach durchschnittlich 17,5 Jahren Beobachtungszeit 5.400 ein kardiovaskuläres Ereignis und waren 6.100 tot.
Jede zusätzliche Aufnahme von 300 Milligramm des "bösen" Cholesterol über Eier und Fleisch war mit einem um 17% statistisch signifikant höheren Risiko eines neuen kardiovaskulären Ereignis und mit einem 18% höheren Sterberisiko assoziiert. Eier erklären diese Risikoerhöhungen nach Meinung der ForscherInnen deshalb, weil große Eier rund 190 Milligramm Cholesterol enthalten und auch schon ein halbes Ei ein gewichtiges Risiko darstellt. Dass die Assoziation zwischen Eierkonsum und der Inzidenz kardiovaskulärer Erkrankungen nach einer Adjustierung nach der Gesamtaufnahme von Cholesterol nicht mehr signifikant ist, stellt einen kleinen Hoffnungsschimmer zumindest für den Konsum des einen oder anderen Ostereis dar.
Ein Herausgeber der Zeitschrift JAMA schlussfolgerte in Kenntnis dieser Studie: "Considering the negative consequences of egg consumption and dietary cholesterol in the setting of heart-healthy dietary patterns, the importance of following evidence-based dietary recommendations, such as limiting intake of cholesterol-rich foods, should not be dismissed."
Von dem am 19. März 2019 in der Fachzeitschrift "JAMA" erschienenen Aufsatz Associations of Dietary Cholesterol or Egg Consumption With Incident Cardiovascular Disease and Mortality von Victor W. Zhoing et al. (JAMA. 2019; 321(11):1081-1095) ist das Abstract kostenlos erhältlich.
Die eingangs erwähnte Studie aus dem Jahr 2015 kam dagegen auf der Basis von 40 zwischen 1979 und 2013 Studien, darunter u.a. 17 Kohortenstudien mit 361.923 TeilnehmerInnen zu einem völlig anderen Ergebnis. Obwohl die Aufnahme von Cholesterol über Nahrungsmittel statistisch signifikant die Cholesterinwerte erhöhte, sah das Ergebnis so aus: "Dietary cholesterol was not statistically significantly associated with any coronary artery disease …, ischemic stroke … or hemorrhagic stroke. Mit dem Hinweis, dass noch methodisch bessere Studien durchgeführt warden sollten, um letzte Zweifel auszuräumen, leiten die AutorInnen die nächste Phase dieser Art von Achterbahn ein.
Die Studie Dietary cholesterol and cardiovascular disease: a systematic review and meta-analysis von Samantha Berger, Gowri Raman, Rohini Vishwanathan, Paul F Jacques und Elizabeth J Johnson ist am 1. August 2015 in der Zeitschrift "The American Journal of Clinical Nutrition" (Volume 102, Issue 2, 1 August 2015, Pages 276-294) erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Auf die möglichen Ursachen für diese wissenschafts- oder studiengeleitete Achterbahnfahrt der Basis für informierte Entscheidungen über Gesundheitsverhalten, weist der durch seine harsche Kritik an der methodischen Dürftigkeit vieler Studien und der Fragwürdigkeit ihrer Ergebnisse bekannt gewordene (laut British Medical Journal die "Geißel der schlampigen Wissenschaft") amerikanische Forscher John Ioannidis in einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" (SZ vom 4. April 2019 - leider ohne Abo nicht online zugänglich) auf die Frage, was er davon hielte, dass Eier "nun doch ungesund" seien, folgendermaßen hin: "Ja, das ist absolut sinnlos. Es gibt etwa eine Million Ernährungsstudien, Zehntausende Forscher arbeiten auf diesem Gebiet und veröffentlichen wie verrückt. Fast jeden Tag erscheint ein neues Paper, das mit sehr goßer Wahrscheinlichkeit nicht stimmt. Aber es geht immer so weiter, ad infitum. Es wird mit zweifelhaften Messmethoden gearbeitet, mit Beobachtungsstudien, die offen für eine Myriade verzerrender Einflüsse sind, mit Fragestellungen, die eine komplexe Sache übermäßig vereinfachen. Tatsächlich gibt eine fast unbegrenzte Zahl an Nahrungsmitteln, die sich in ihrer Zusammensetzung unterscheiden und mit unserem Lebensstil und anderen Einflüssen verwoben sind."
Und Studien, die methodisch hochwertig sind, mögen nach Meinung Ioannidis's "die meisten Ernährungsforscher ... nicht, weil bei diesen fast nie Nennenswertes herauskommt."
Bernard Braun, 8.4.19
Bewegung und Gesundheit: Es ist selten zu wenig und zu kurz, um positive gesundheitliche Wirkungen zu erzielen
 Fitness-Studios, die Verfasser mancher Ratgeber für möglichst viel, lange und anstrengende Joggingstrecken oder andere Bewegungsübungen und wahrscheinlich auch die Hersteller von Geräten zur Messung der Dauer, Intensität und Wirkungen, die nur Sinn machen, wenn sie täglich längere Zeit genutzt werden, sind sicherlich mit den Ergebnissen der am 19.März 2019 zuerst online veröffentlichten Studie über die Evidenz für Wirkungen von zeitlich sehr geringen oder sehr großen körperlichen Aktivitäten in der Freizeit auf das Risiko an einer kardiovaskulären Erkrankung oder an einer Krebserkrankung zu sterben.
Fitness-Studios, die Verfasser mancher Ratgeber für möglichst viel, lange und anstrengende Joggingstrecken oder andere Bewegungsübungen und wahrscheinlich auch die Hersteller von Geräten zur Messung der Dauer, Intensität und Wirkungen, die nur Sinn machen, wenn sie täglich längere Zeit genutzt werden, sind sicherlich mit den Ergebnissen der am 19.März 2019 zuerst online veröffentlichten Studie über die Evidenz für Wirkungen von zeitlich sehr geringen oder sehr großen körperlichen Aktivitäten in der Freizeit auf das Risiko an einer kardiovaskulären Erkrankung oder an einer Krebserkrankung zu sterben.
Einer der Ausgangspunkte dieser Studie ist, dass viele Menschen aus verschiedenen Gründen (vom "inneren Schweinehund", den Arbeitszeiten bis zu familiären Verpflichtungen) nicht in der Lage sind, den Standards der WHO oder ihrer Krankenkasse folgend sich regelmäßig täglich oder mindestens fünfmal die Woche längere Zeit durch ihren Stadtwald oder auf den Laufbändern des nächsten Fitnessstudios zu bewegen. In der Annahme oder durch die Übernahme der Zielwerte in Ratgebern etc., dass sie bei wenigeren und kürzeren Bewegungsmaßnahmen den gewünschten gesundheitlichen Effekt nicht mehr erreichen, verzichten viele Menschen dann auf sämtliche Bewegungsaktivitäten.
Eine Auswertung von 12 Wellen des "National Health Interview Surveys (1997-2008)" und des nationalen Sterblichkeitsindex der USA aus dem Jahr 2011, konnte sich auf die individuellen Daten zum Bewegungsverhalten und zur Sterblichkeit von 88.140 BürgerInnen im Alter von 40 bis 85 Jahren stützen. In der neunjährigen Beobachtungszeit starben 9% der Untersuchungspopulation.
Die wichtigsten adjustierten (nach Rauchstatus und anderen potenziellen Confoundern) Ergebnisse lauten:
• Im Vergleich mit bewegungsmäßig inaktiven Personen reduzierten die Personen, die sich 150 bis 299 Minuten pro Woche intensiver bewegten ihr Gesamtmortalitätsrisiko ("hazard ratio") um 31%.
• Im selben Vergleich stieg die Reduktion des Sterblichkeitsrisikos bei den Personen auf auf 46% und mehr, die sich 1.500 Minuten und mehr pro Woche aktiv bewegten.
• Diejenigen Personen, die sich nur 10 bis 59 Minuten pro Woche aktiv bewegten, also möglicherweise am gesundheitlichen Nutzen zweifeln, reduzieren das Risiko wegen irgendeiner Ursache zu sterben im Vergleich mit völlig inaktiven Personen immer noch um 18%.
• Ähnliche Ergebnisse gibt es für das Risiko wegen Kreislauferkrankungen oder Krebs zu sterben.
Die AutorInnen der Studie empfehlen daher die Motivation zu körperlicher Bewegung "of any intensity and amount is an important approach to reducing mortality risk in the general population."
Und selbstverständlich sollte jede/jeder die/der dann doch noch etwas mehr Zeit für Jogging oder einen intensiven Spaziergang mit oder ohne das Profi-Equipment findet, diese nutzen. Da selbst 10 bewegte Minuten pro Woche einen gesundheitlichen Nutzen haben, sollte schließlich das oben beschriebene Resignieren wegen "zu kurzen" Bewegungszeiten rasch vergessen werden.
Die Studie Beneficial associations of low and large doses of leisure time physical activity with all-cause, cardiovascular disease and cancer mortality: a national cohort study of 88.140 US adults von Min Zhao, Sreenivas P Veeranki, Shengxu Li, Lyn M Steffen, Bo Xi ist im März 2019 "online first" in der Fachzeitschrift "British Journal of Sports Medicine" erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 20.3.19
Gesundheitslegenden - Der Fall "Kochsalzreduktion"
 Ein Teil der Empfehlungen zu Dingen und Verhaltensweisen, die angeblich einen hohen präventiven oder kurativen Nutzen für die Gesundheit vieler Menschen haben oder dieser und diesen schaden, sind derartig plausibel, dass es relativ lange braucht bis sich Studien um sie kümmern. Dazu gehören etwa viele Vitamine und Nahrungsergänzungsmittel, das tägliche Gläschen Rotwein, die tägliche Einnahme einer oder auch mehrerer Aspirintabletten aber auch das Ersetzen von Butter durch Margarine oder die Reduktion von Kochsalz.
Ein Teil der Empfehlungen zu Dingen und Verhaltensweisen, die angeblich einen hohen präventiven oder kurativen Nutzen für die Gesundheit vieler Menschen haben oder dieser und diesen schaden, sind derartig plausibel, dass es relativ lange braucht bis sich Studien um sie kümmern. Dazu gehören etwa viele Vitamine und Nahrungsergänzungsmittel, das tägliche Gläschen Rotwein, die tägliche Einnahme einer oder auch mehrerer Aspirintabletten aber auch das Ersetzen von Butter durch Margarine oder die Reduktion von Kochsalz.
Das jüngste Beispiel dafür was dann bei gründlicher Überprüfung herauskommen kann, ist ein systematischer Review von neun randomisierten kontrollierten Studien an denen 479 PatientInnen mit Herzschwäche teilgenommen hatten, welcher der Frage nachging, ob die Reduktion oder gar der Verzicht auf Salz PatientInnen mit Herzschwäche gesundheitlich nutzt oder nicht.
Die am 5. November 2018 in der Fachzeitschrift "JAMA Internal Medicine" veröffentlichte Studie "found no clinically relevant data on whether reduced dietary salt intake affected outcomes such as cardiovascular associated or all-cause mortality, cardiovascular-associated events, hospitalization, or length of hospital stay." In drei Studien mit ambulant behandelten PatientInnen, die weniger Salz zu sich nahmen, fanden sich allerdings Verbesserungen einiger klinischer Werte und Symptome.
Alles in Allem existiert also Unsicherheit über die Robustheit und Evidenz der weit verbreiteten Ratschläge an PatientInnen mit Herzproblemen, ihre gesundheitlichen Risiken durch die Reduktion von Salz zu reduzieren.
Der renommierte Kardiologe Harlan Krumholz (u.a. Editor für kardiologische Studien in der Zeitschrift "New England Journal of Medicine") bewertet die Studie als "an important study for what it doesn't find, which is a lack of evidence to support salt restriction. For all the burden we have imposed on patients with this strategy, it turns out we have too little evidence to support the practice."
Sie ist ein guter Beleg dafür, dass der oft gehörte praktisch gemeinte Rat, doch nicht zu jeder Diagnostik oder Therapie eine aufwändige randomisierte kontrollierte Studie oder einen systematischen Review durchzuführen, die Fortexistenz von gesundheitlich unwirksamen Legenden oder Patentrezepten und mehr oder weniger große Einschränkungen des täglichen Lebens und der Lebensqualität von vielen PatientInnen bedeuten kann.
Diese Ergebnisse bedeuten nicht, dass sowohl PatientInnen mit Herzschwäche als auch Personen, die "nur" einen erhöhten Blutdruck haben, jetzt sorglos den Salzstreuer schütteln können oder sollten. Sie sollten aber weder vom Verzicht auf Salz noch vom Weitersalzen allein bedeutende positive oder negative gesundheitliche Wirkungen erwarten. Trotzdem sollten sich Liebhaber gewürzter Speisen nicht von der Suche nach geschmacklich besseren Würzalternativen abhalten lassen.
Die Studie Reduced Salt Intake for Heart Failure von K. Mahtani et al. ist am 5.11.2018 in der Onlineausgabe der Zeitschrift "JAMA Internal Medicine" erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 8.11.18
Was wissen Eltern über den Zuckergehalt einiger der Lieblingsspeisen ihrer Kinder? Enorm wenig.
 Auch wenn der vor wenigen Tagen feierlich gestartete Nationale Aktionsplan Gesundheitskompetenz nicht das Schicksal einiger anderer nationaler Aktionspläne erleidet, nämlich kurz nach dem Start in die Startlöcher zurück zu rutschen, zeigt eine nahezu gleichzeitig erschienene Studie des "Max Planck-Instituts für Bildungsforschung (MPIB)" über das Wissen von Eltern über die Zuckergehalte in der Ernährung ihrer Kinder, den Umfang von gesundheitsbezogenen Wissens- oder Kompetenzmängeln und die Anforderungen an Strategien, die daran etwas ändern wollen.
Auch wenn der vor wenigen Tagen feierlich gestartete Nationale Aktionsplan Gesundheitskompetenz nicht das Schicksal einiger anderer nationaler Aktionspläne erleidet, nämlich kurz nach dem Start in die Startlöcher zurück zu rutschen, zeigt eine nahezu gleichzeitig erschienene Studie des "Max Planck-Instituts für Bildungsforschung (MPIB)" über das Wissen von Eltern über die Zuckergehalte in der Ernährung ihrer Kinder, den Umfang von gesundheitsbezogenen Wissens- oder Kompetenzmängeln und die Anforderungen an Strategien, die daran etwas ändern wollen.
In dieser Studie sollten 305 Eltern-Kind-Paare mit Kindern zwischen 6 und 12 Jahren den Zuckergehalt von Orangensaft, Cola, Pizza, Joghurt, Müsliriegel und Ketchup schätzen.
Bei nahezu allen dieser durchaus bei Kindern beliebten Lebensmitteln unter- und überschätzten die Eltern den Zuckergehalt:
— "Es zeigte sich, dass 74 Prozent der Eltern den Zuckergehalt der meisten Nahrungsmittel und Getränke teils erheblich unterschätzten. Bei Joghurt zum Beispiel unterschätzten sogar 92 Prozent den Zuckergehalt - und das im Schnitt um sieben Würfel. Das entspricht 60 Prozent der Gesamtzuckermenge des Fruchtjoghurts… Besonders vertan haben sich die Eltern bei den Nahrungsmitteln und Getränken, die allgemein für gesund gehalten werden, wie Joghurt oder Orangensaft (84 Prozent).
— "Lediglich bei Müsliriegeln und Ketchup überschätzten mehr Eltern den tatsächlichen Zuckergehalt."
Dass die Unterschätzung des Zuckergehalts nicht ein lässlicher Wissensmangel ist, sondern gesundheitsrelevante Folgen für die Kinder haben kann, zeigt ein weiteres Ergebnis der Stufe: Nach Kontrolle des Bildungsstatus der Eltern und des BMI der Kinder, war das Risiko, dass Kinder der Eltern welche den Zuckergehalt unterschätzten übergewichtig oder fettsüchtig waren, signifikant um über das 2fache höher als bei Kinder von Eltern, die den Zuckergehalt richtig einschätzten. Die Studie liefert sogar kleine Hinweise auf einen Zusammenhang des Grades der Fehleinschätzung der Eltern und des BMI ihrer Kinder.
Was an dem schon so nicht unbedenklichen Ergebnis besonders nachdenklich macht, ist zweierlei. Eltern von Kindern in diesem Alter sind mit Sicherheit für Ernährungsrisiken sensibler als der Nicht-Elternteil der Bevölkerung. Das Un- oder Fehlwissen über eine relevante Quelle von Übergewicht und seinen gesundheitlichen Risiken dürfte dort sogar größer sein. Außerdem gehören Informationen über den Zuckergehalt mancher Lebensmittel und das damit verbundene Gesundheitsrisiko zu den am meisten in Medien jeglicher Art erwähnten Thematiken. Erwachsene Personen dürften also mehr als einmal darüber gelesen oder davon gehört und gesehen haben.
So richtig daher die auch von den StudienautorInnen geforderten plakativen Ampel-Hinweise auf den Zuckergehalt der Lebensmittel ist ("These findings suggest that providing easily accessible and practicable knowledge about sugar content through, for instance, nutritional labeling may improve parents' intuition about sugar."), so wichtig ist es, mehr darüber zu erfahren, warum derartige Informationen ausgerechnet auch noch bei Eltern nie angekommen oder wieder vergessen worden sind.
Nähere Informationen finden sich in einer Presseerklärung des MPIB vom 26. Februar 2018 und in dem online vorab veröffentlichten Aufsatz Parents' considerable underestimation of sugar and their child's risk of overweight von M. Dallacker, Hertwig, R. und Mata, J. in der Zeitschrift "International Journal of Obesity". Ein Abstract ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 27.2.18
"If Anyone Is Going to Take Away Our Business It Should Be Us" - Warum die Tabakindustrie beim "Aufhören" mit dem Rauchen hilft!
 Eines muss man der Tabakwarenindustrie lassen: Sie ist einfallsreich und nutzt jede Gelegenheit als Anbieterin in allen Situationen um das Rauchen herum präsent zu sein und damit auch zu verdienen. Dies gilt auch für Angebote, die scheinbar nicht zu ihrem traditionellen wirtschaftlichen Interesse zu passen scheinen, wie therapeutischen Produkten (z.B. Kaugummis), die helfen sollen auf das Rauchen bzw. die Aufnahme von Nikotin zu verzichten ("Nicotine replacement therapy (NRT)").
Eines muss man der Tabakwarenindustrie lassen: Sie ist einfallsreich und nutzt jede Gelegenheit als Anbieterin in allen Situationen um das Rauchen herum präsent zu sein und damit auch zu verdienen. Dies gilt auch für Angebote, die scheinbar nicht zu ihrem traditionellen wirtschaftlichen Interesse zu passen scheinen, wie therapeutischen Produkten (z.B. Kaugummis), die helfen sollen auf das Rauchen bzw. die Aufnahme von Nikotin zu verzichten ("Nicotine replacement therapy (NRT)").
Als derartige Stoffe in den 1980er Jahren auf den Markt kamen, gehörte die Tabakwarenindustrie zu den entschiedenen Gegnern. Die Kombination der Nutzung solcher Hilfsmittel mit gezielter Beratung schien auch nachweislich geeignet, mit dem Rauchen aufhören zu können. Trotzdem ändert sich seit 2016 die Position der Tabakwarenindustrie zu diesen Produkten und zwar so, dass sie jetzt selber NRT-Mittel anbietet. Wer jetzt denkt, die Industrie sähe die gesundheitlich schädlichen Wirkungen von Nikotin und Notwendigkeit, das Rauchen aufzuhören endlich ein, irrt sich gewaltig.
In einem am 13. September 2017 online veröffentlichten Aufsatz in der Fachzeitschrift "American Journal of Public Health" kommen die VerfasserInnen auf der Basis von internen Dokumenten der Zigarettenhersteller aus den Jahren 1960 bis 2010 nämlich zu folgenden Erkenntnissen:
— Die Industrie beschäftigte sich bereits seit den 1950er Jahren selber mit der Entwicklung von NRT-Stoffen.
— Nachdem die US Food and Drug Administration (FDA) 1984 diese Stoffe zugelassen hatte, betrachtete die Tabakindustrie dies als Bedrohung und übte auf die Hersteller aus der pharmazeutischen Industrie Druck aus, auf das explizite Marketingziel der völligen Raucherentwöhnung zu verzichten.
— 1996 gelang es den Herstellern der NRT-Mittel ihre Erhältlichkeit zu erleichtern, sie also zu so genannten ohne Verordnung frei erhältlichen Over-the-counter (OTC)-Produkte umzuwidmen.
— In den 1990er Jahren hatte die Tabakindustrie als ein wesentliches Ergebnis mehrerer Bevölkerungsstudien erkannt, dass NRT häufig nicht zur Beendigung des Rauchens führte und dies auch nicht das Ziel der NRT-Nutzer war, sondern eine Art Ergänzung zum Weiterrauchen von eventuell weniger Zigaretten war.
— Als 2009 die FDA damit begann den Tabakmarkt streng zu regulieren, versuchte die Tabakindustrie ihrerseits den tabakbasierten oder -assoziierten Nikotinmarkt möglichst komplett zu besetzen.
— Als gleichzeitig der Tabakindustrie ab dem Jahr 2009 gesetzlich erlaubt wurde, selber nikotinhaltige NRT-Stoffe frei zu verkaufen, begann sie diesen Markt mit Erfolg zu Lasten der pharmazeutischen Industrie zu erobern.
Der Aufsatz Tobacco Industry Research on Nicotine Replacement Therapy: "If Anyone Is Going to Take Away Our Business It Should Be Us von Dorie Apollonio und Stanton A. Glantz ist im "American Journal of Public Health" (107, no. 10: 1636 -1642) erschienen. Ein Abstract ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 20.2.18
Von den Grenzen der Lernfähigkeit oder "social responsibility" von Tabakkonzernen. Zulassung von iQOS in den USA und Deutschland
 Die großen Herstellerfirmen von Tabakwaren für den USA-Markt müssen zwischen November 2017 und März 2018 in den USA in 5 ganzseitigen Anzeigen in 50 Zeitungen und über 12 Monate fünfmal pro Woche in zahlreichen Fernsehsendungen aufgrund eines Gerichtsurteils aus dem Jahr 2006 und nach jahrelangen Versuchen dies zu verhindern erklären, dass ihre Produkte massive Gesundheitsrisiken hatten und haben, sie in der Regel davon wussten, auch die so genannten Light-Produkte nicht gesünder waren oder durch Veränderungen der Zusammensetzung von Zigaretten bewusst zusätzlich Sucht erzeugt wurde.
Die großen Herstellerfirmen von Tabakwaren für den USA-Markt müssen zwischen November 2017 und März 2018 in den USA in 5 ganzseitigen Anzeigen in 50 Zeitungen und über 12 Monate fünfmal pro Woche in zahlreichen Fernsehsendungen aufgrund eines Gerichtsurteils aus dem Jahr 2006 und nach jahrelangen Versuchen dies zu verhindern erklären, dass ihre Produkte massive Gesundheitsrisiken hatten und haben, sie in der Regel davon wussten, auch die so genannten Light-Produkte nicht gesünder waren oder durch Veränderungen der Zusammensetzung von Zigaretten bewusst zusätzlich Sucht erzeugt wurde.
Zu den so verbreiteten Wahrheiten gehören z.B. die folgenden: "Smoking is highly addictive. Nicotine is the addictive drug in tobacco.", "Cigarette companies control the impact and delivery of nicotine in many ways, including designing filters and selecting cigarette paper to maximise the ingestion of nicotine, adding ammonia to make the cigarette taste less harsh, and controlling the physical and chemical make-up of the tobacco blend.", "When you smoke, the nicotine actually changes the brain — that's why quitting is so hard." oder "More people die every year from smoking than from murder, AIDS, suicide, drugs, car crashes, and alcohol combined."
Gleichzeitig gibt es von denselben Konzernen neben der ja gesundheitsbezogen auch nicht unstrittigen Markteinführung von E-Zigaretten weltweit neue Produkte, bei denen erneut gesundheitliche Vorzüge hervorgehoben und mögliche Nachteile verschwiegen werden.
Aktuell versucht der Hersteller Philip Morris für den us-amerikanischen Markt die Zulassung von so genannten "Modified Risk Tobacco Product Applications" wie IQOS durch die "U.S. Food and Drug Administration (FDA)" zu erhalten und zwar vorrangig mit dem Hinweis, es handle sich um gesündere Produkte als die normalen Zigaretten. Der Herstellerwunsch beruht darauf, dass in IQOS zwar normaler Tabak enthalten ist, der aber nicht verbrannt, sondern nur erhitzt wird. Die Herstellerfirma kommt daher auch zu dem Schluss, dass "scientific studies have shown that switching completely from cigarettes to the IQOS system can reduce the risks of tobacco-related diseases."
Diese Firma hatte in einem 67 Seiten umfassenden Papier (The Science behind the Tobacco Heating System. A Summary of published scientific articles von Maurice Smith et al. bzw. von Philip Morris International) im altbewährten Stil versucht, mit meist industriefinanzierten Studien u.a. das gesundheitliche Risiko von IQOS kleinzureden und diese Bewertung der FDA schmackhaft zu machen.
Damit hat sich nun ein für die Beratungen des "Tobacco Products Scientific Advisory Committee (TPSAC)" am 24. und 25. Januar 2018 von Wissenschaftlern der FDA erarbeitetes 75 Seiten umfassendes Dokument (FDA Briefing Document. Meeting of the Tobacco Products Scientific Advisory Committee (TPSAC). Modified Risk Tobacco Product Applications (MRTPAs)) ausführlich beschäftigt.
Nach Beratung beider Dokumente am 24./25. Januar 2018 kommt das WissenschaftlerInnen-Komitee u.a. zu folgenden Empfehlungen an die letztlich entscheidende FDA-Administration:
• Mit 8 zu 1 stimmen sie zu, dass Philip Morris mit der Aussage werben darf, IQOS reduziere die Exposition gegenüber schädlichen oder potenziell schädlichen chemischen Stoffen.
• Mit 8 zu 1 lehnen sie es dann aber ab, dass Philip Morris für das neue Produkt IQOS mit dem Hinweis werben darf, es sei weniger gesundheitsschädlich als konventionelle Zigaretten.
• Mit 5 zu 4 lehnen sie auch die Nutzung der Werbungaussage ab, mit IQOS zu rauchen wäre weniger riskant als weiter normale Zigaretten zu rauchen.
Ob die FDA diesen Empfehlungen ihrer wissenschaftlichen Berater folgen wird, ist im Moment offen. Aber selbst, wenn sie ihnen folgt, liegt der FDA bereits ein Antrag B vor, das Produkt ohne die genannten Werbeaussagen zuzulassen. Wie in anderen Fällen auch, wird es damit wahrscheinlich zu einem jahrelangen gerichtlichen und außergerichtlichen Ringen um gesundheitspositive Formulierungen kommen.
Für Deutschland, wo die Firma Philip Morris auch seit einiger Zeit für IQOS wirbt, liegt bisher eine Vorläufige Risikobewertung von Tobacco Heating-Systemen als Tabakprodukte des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) vom 27. Juli 2017 vor. Danach plant das Institut "eigene Untersuchungen zu den Emissionen dieses Gerätes und gegebenenfalls anderer kommerziell erhältlicher THS", die "im Herbst 2017 beginnen werden".
Zu hoffen ist, dass sich das BfR seitdem auch intensiv mit dem in dem FDA-Dokument zusammengestellten Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse auseinandersetzt und nicht völlig eigene und möglicherweise problematische Quellen nutzt und Wege geht. Wie das Beispiel Glyphosat zeigt, wäre dies dem Institut durchaus zuzutrauen. Wie das BfR etwa "seine Bewertung des Totalherbizids Glyphosat über viele Seiten aus dem Zulassungsantrag von Monsanto abgeschrieben" hat - so eine bisher nicht widerlegte Kritik -, kann jedermann anhand der auf der Glyphosat-kritischen Website des Umweltinstituts München erhältlichen Originaldokumente selber klären.
Der FDA-Bericht wertet auch eine Reihe unabhängiger wissenschaftlicher Studien aus und kommt auf dieser Basis z.B. zu folgenden Aussagen:
• "In a December 8, 2017 amendment to the applications, the applicant (gemeint ist Philip Morris) identified between 53 and 62 compounds that are at higher levels in the aerosol of the HeatSticks compared to the smoke of the reference cigarette 3R4F."
• Und: "As summarized above, all the 54 measured HPHCs (harmful and potentially harmful constituents) produced by the three HeatSticks were substantially reduced compared to the 3R4F cigarette on a per-cigarette basis. However, based on the results, consuming 10 HeatSticks exposes users to levels of acetaldehyde, acetamide, acrylamide, ammonia, butyraldehyde, catechol, formaldehyde, mercury, propylene oxide, and pyridine that are comparable to smoking 1-3 cigarettes. … Using this model, any increased exposure increases cancer risk."
Der Vollständigkeit halber sei festgehalten, dass sich diese Erkenntnis auch in der Mitteilung des BfR findet: "Die Biomarker für einige Stoffe waren jedoch weniger stark reduziert als die entsprechenden Gehalte im Dampf der untersuchten Produkte. Verminderte Gehalte im Dampf führen somit nicht zwangsläufig zu einer im gleichen Maße verminderten Exposition des Verbrauchers gegenüber diesen gesundheitsschädlichen Stoffen."
Und außerdem stellt das BfR bereits in seiner Mitteilung im Juli 2017 fest, was die Hersteller durch geschickte Werbefloskeln (z.B. "Die neue Art, Tabak zu genießen.") zu verbergen suchen: "Die in den Dämpfen erreichbaren Nikotingehalte liegen in der gleichen Größenordnung wie bei herkömmlichen Tabakzigaretten. Daher muss von einem vergleichbaren Suchtpotential ausgegangen werden."
Bernard Braun, 1.2.18
"Kann eine einzige Zigarette denn noch nennenswert schädlich sein?" - Ja, und zwar deutlich mehr als erwartet!
 Zu den beliebtesten Selbstbeschwichtigungsmantras von Personen, die das Rauchen von Zigaretten eigentlich aufhören wollen, es aber nicht vollständig schaffen, gehört die gegenüber dem "großen" gesundheitlichen Risiko der zuvor täglich gerauchten 20 Zigaretten geschaffte Reduktion auf das vergleichsweise "winzige" gesundheitliche Risiko von einer Zigarette pro Tag.
Zu den beliebtesten Selbstbeschwichtigungsmantras von Personen, die das Rauchen von Zigaretten eigentlich aufhören wollen, es aber nicht vollständig schaffen, gehört die gegenüber dem "großen" gesundheitlichen Risiko der zuvor täglich gerauchten 20 Zigaretten geschaffte Reduktion auf das vergleichsweise "winzige" gesundheitliche Risiko von einer Zigarette pro Tag.
Dass dies ein gewaltiger Irrtum ist zeigt nun eine Metaanalyse von 141 prospektiven Studien zur Assoziation von Rauchen und kardiovaskulären Erkrankungen wie der koronaren Herzerkrankung oder des Schlaganfalls aus den Jahren 1946 und 2015.
Unter rechnerischer Berücksichtigung zahlreicher potenzieller Verzerrungsfaktoren oder Confounder (z.B. Cholesterinwerte, Blutdruck) lauten die wichtigsten Ergebnisse so:
• Frauen, die eine Zigarette pro Tag rauchten hatten gegenüber nichtrauchenden Frauen ein um 119% erhöhtes Risiko für koronare Herzerkrankungen und eine Risikoerhöhung für Schlaganfälle um 46%
• Bei Männern mit einer Zigarette pro Tag betrugen die Risikoerhöhungen 74% und 30%.
• Das Gesamtrisiko betrug beim Vergleich des täglichen Konsums von einer mit dem von 20 Zigaretten nicht etwa das selbstberuhigende Einzwanzigstel, sondern immer noch 64% für Männer und 36% für Frauen (adjustiertes relatives Risiko), ist also nach Ansicht der AutorInnen "much greater than expected".
Unter Hinweis auf andere Studien, in denen auch für "gelegentliche Raucher" keine nennenswerten Risikoreduktionen gefunden werden konnten, kommen die AutorInnen zu folgendem praktischen Schluss: "We show clearly that no safe level of smoking exists for cardiovascular disease at which light smokers can assume that continuing to smoke does not lead to harm. Smokers need to quit completely rather than cut down if they wish to avoid most of the risk associated with heart disease and stroke."
Der am 24. Januar 2018 erschienene Aufsatz Low cigarette consumption and risk of coronary heart disease and stroke: meta-analysis of 141 cohort studies in 55 study reports von Allan Hackshaw et al. ist in der Zeitschrift "British Medical Journal (BMJ)" (360: j3984) komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 25.1.18
"Stairway to health": Kleine Hinweise helfen bei der Entscheidung, die Treppe statt den Aufzug oder die Rolltreppe zu nutzen.
 Körperliche Bewegung wirkt sich mit Sicherheit auf die Gesundheit und die Lebensqualität aus - selbst wenn es sich nicht um kilometerlanges Joggen oder Marathons handelt. Ob und wie sich aber eine nennenswerte Anzahl von Personen selbst zu kleinen Veränderungen ihres Bewegungsverhaltens bewegen lässt, ist nicht so sicher.
Körperliche Bewegung wirkt sich mit Sicherheit auf die Gesundheit und die Lebensqualität aus - selbst wenn es sich nicht um kilometerlanges Joggen oder Marathons handelt. Ob und wie sich aber eine nennenswerte Anzahl von Personen selbst zu kleinen Veränderungen ihres Bewegungsverhaltens bewegen lässt, ist nicht so sicher.
Für eine der vielen kleinen bewegungsorientierten Veränderungen im Alltag, der Nutzung von Treppen statt der der oft attraktiveren Rolltreppen oder Fahrstühle, interessierten sich jetzt kalifornische Präventionsexperten in einer empirischen Studie am internationalen Flughafen von San Diego.
Sie beschrifteten dazu in einem Zeitraum von 10 Tagen markante Stellen an denen sich FlughafenbesucherInnen für eines der drei Fortbewegungsmittel entscheiden mussten mit folgenden Etiketten: "Please reserve the escalator for those who need it"; "Don't lose time, lose weight. Use the Stairs"; "Don't waste Time, trim your Waistline. Use the Stairs";-"You'll get more stares if you use the stairs"oder "If you want to feel younger, act younger. Step it up! Use the stairs."
Das Hauptergebnis: An den Tagen an denen diese Hinweiseangebracht waren, nahm rund die doppelte Anzahl der FlughafenbesucherInnen die Treppen als an den Tagen an denen die Zeichen entfernt waren. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse einer zusätzlichen differenzierten schriftlichen Befragung von rund 350 FlughafenbesucherInnen u.a. zu ihren soziodemografischen Charakteristika und ihrem sonstigem gesundheitsbezogenem Verhalten, und nach einer Adjustierung, erhöhen die Hinweise die Chance (odds ratio) der Nutzung der Treppen signifikant um das gut 3,7-Fache.
Wichtige Begleitergebnisse: Selbst Personen, die Koffer mit sich führten oder erkennbar in Eile waren, fühlten sich durch die Hinweise motiviert, die Treppen zu benutzen. Die Hinweise motivierten außerdem nicht nur die Flughafenbesucher, die auch sonst körperlich aktiv sind - ein oft beobachtbarer Effekt bei Präventionsangeboten -,sondern ebenfalls Personen, die sich nicht ständig bewegten. Beobachtet wurde schließlich, dass Personen ihre Entscheidung für den Gang über die Treppe auch nach dem Vorbild anderer Personen getroffen haben.
Die AutorInnen bewerten ihre Ergebnisse als Beleg dafür, dass die durch die Verleihung des diesjährigen Ökonomie-Nobelpreises an den Verhaltensökonomen Thaler etwas populärer gewordenen "nudges", d.h. Stupser oder Schubser auch im Gesundheitsberech etwas zu gesundheitlich positiven Entscheidungen beitragen können - und seien sie auch noch so klein.
Die am 21. September 2017 online veröffentlichte Studie And She's Buying a Stairway to Health: Signs and Participant Factors Influencing Stair Ascent at a Public Airport. von John Bellettiere et al. ist in der Zeitschrift "The Journal of Primary Prevention" erschienen. Ein Abstract ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 16.10.17
Es ist selten zu spät und selten zu wenig. Körperliche Aktivität, Mobilität, Behinderung und Unabhängigkeit von 70-89-Jährigen
 Körperliche Leistungsfähigkeit und funktionale Mobilität sowie die Freiheit von Behinderung sind wichtige Voraussetzungen für ein weitgehend selbständiges Leben älterer Personen in ihren "eigenen vier Wänden". Regelmäßige körperliche Aktivitäten sind geeignet, diese Ziele zu erreichen. Dass viele Angehörige dieser Altersgruppe noch nicht einmal beginnen, das Ziel erreichen zu wollen, liegt nur u.a. an Faulheit oder Bequemlichkeit, sondern an zwei gesichert erscheinenden Erwartungen oder Vorbehalten: Man sei zu alt für "mehr Sport" und er "bringe" in diesem Alter auch nichts mehr und die Leistungsziele mancher Bewegungsprogramme erreiche man nicht und habe daher auch nicht den versprochenen oder erwarteten Nutzen.
Körperliche Leistungsfähigkeit und funktionale Mobilität sowie die Freiheit von Behinderung sind wichtige Voraussetzungen für ein weitgehend selbständiges Leben älterer Personen in ihren "eigenen vier Wänden". Regelmäßige körperliche Aktivitäten sind geeignet, diese Ziele zu erreichen. Dass viele Angehörige dieser Altersgruppe noch nicht einmal beginnen, das Ziel erreichen zu wollen, liegt nur u.a. an Faulheit oder Bequemlichkeit, sondern an zwei gesichert erscheinenden Erwartungen oder Vorbehalten: Man sei zu alt für "mehr Sport" und er "bringe" in diesem Alter auch nichts mehr und die Leistungsziele mancher Bewegungsprogramme erreiche man nicht und habe daher auch nicht den versprochenen oder erwarteten Nutzen.
Eine jetzt veröffentlichte randomisierte, 2,6 Jahre laufende Studie (die so genannte "Lifestyle Interventions and Independence for Elders (LIFE)"-Studie) mit 1.635 Männer und Frauen im Alter zwischen 70 und 89 Jahren mit zu Beginn niedrigem Level körperlicher Aktivitäten relativiert beide Vorbehalte als weitgehend unbegründet.
In einem ersten Studienteil belegten die ForscherInnen zunächst, dass regelmäßige körperliche Aktivitäten auch in diesem Alter helfen können die körperliche Leistungsfähigkeit zu verbessern und einen Mobilitätsverlust oder Muskelschwund zu verhindern.
In dem jetzt veröffentlichten zweiten Teil, sollten die TeilnehmerInnen sich zum Erreichen der beiden Ziele 150 Minuten pro Woche spürbar bewegen. Die Folgeuntersuchungen nach 6, 12 und 24 Monaten haben aber gezeigt, dass der erhoffte Nutzen bereits eintrat, wenn sich die StudienteilnehmerInnen mindestens 48 Minuten pro Woche bewegten.
Die Studie Dose of physical activity, physical functioning and disability risk in mobility-limited older adults: Results from the LIFE study randomized trial. von Roger A. Fielding et al. ist am 18. August 2017 in der Fachzeitschrift "PLOS ONE" (12 (8): e0182155) erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 15.9.17
Vertrauen und Hoffen auf die dauerhafte Wirkung von Subventionen und Selbstverpflichtung ist gut, permanente Kontrolle aber besser
 In einer Reihe von Verfahren gegen die Tabakindustrie vor us-amerikanischen Gerichten wurde in den letzten Jahrzehnten u.a. durch hunderttausende im Internet zugänglich gemachte Dokumente und auch in Deutschland erstellte Dokumentationen nahezu lückenlos nachgewiesen, dass und wie die Hersteller gesundheitsgefährdende und suchtfördernde Inhaltsstoffe in ihren Produkten vorsätzlich platzierten und u.a. mit Hilfe abhängiger Wissenschaftler zu verbergen suchten. Auch wenn Tabakrauchen niemals uneingeschränkt gesund sein kann, hätte man angesichts der enormen finanziellen Strafen und des Verlustes an Glaubwürdigkeit erwarten können, dass die Tabakindustrie von sich aus alles tut, um möglichst viele bekannte gesundheitlich problematische Wirkungen ihrer Produkte zu vermeiden.
In einer Reihe von Verfahren gegen die Tabakindustrie vor us-amerikanischen Gerichten wurde in den letzten Jahrzehnten u.a. durch hunderttausende im Internet zugänglich gemachte Dokumente und auch in Deutschland erstellte Dokumentationen nahezu lückenlos nachgewiesen, dass und wie die Hersteller gesundheitsgefährdende und suchtfördernde Inhaltsstoffe in ihren Produkten vorsätzlich platzierten und u.a. mit Hilfe abhängiger Wissenschaftler zu verbergen suchten. Auch wenn Tabakrauchen niemals uneingeschränkt gesund sein kann, hätte man angesichts der enormen finanziellen Strafen und des Verlustes an Glaubwürdigkeit erwarten können, dass die Tabakindustrie von sich aus alles tut, um möglichst viele bekannte gesundheitlich problematische Wirkungen ihrer Produkte zu vermeiden.
Dass dies nicht so sein muss, zeigt eine jetzt veröffentlichte Studie kanadischer Wissenschaftler, die untersuchte wie sich der Gehalt von tabakspezifischen Nitrosaminen, einem potenten Karzinogen, in Tabakprodukten zwischen 2005 und 2011/12 verändert hat.
Diese Art von Nitrosaminen entsteht während des Produktionsprozesses von Tabakprodukten. Sie sind daher vermeidbar. In der kanadischen Provinz Ontario erhielten die Hersteller für dafür geeignete technische Anlagen sogar ab dem Beginn der 2000er-Jahre staatliche Unterstützung.
Die Wissenschaftler untersuchten nun die Entwicklung des Nitrosamingehalts der Zigaretten von Herstellern, die rund 90% der in Kanada produzierten Zigaretten produzieren.
Die wichtigsten Ergebnisse waren:
• Der Anteil der karzigonen Nitrosamine nahm nach der Subventionierung von Maßnahmen, die das Entstehen dieser Stoffe während der Herstellung verhinderten, zwischen 2005 und 2007 ab.
• Zwischen 2007 und 2011/12 nahm der Anteil aber wieder kontinuierlich zu.
• Obwohl die Werte 2011/12 unter dem historischen Allzeit-Hoch um das Jahr 2000 lagen, waren sie 2 bis 40 Mal höher als im Jahr 2007.
• Dass diese Entwicklung etwas mit bewussten Entscheidungen der Unternehmen zu tun hat, zeigt sich darin, dass sie nicht bei den Produkten aller Hersteller zu beobachten war.
Auch wenn die Autoren darauf hinweisen, dass sie nicht untersucht haben, ob diese Entwicklung gesundheitliche Risiken oder Krebserkrankungen beeinflusst hat, stellen sie ausdrücklich das bloße Vertrauen in die Selbstverpflichtung der Industrie in Frage, den möglicherweise durch Rauchen verursachten gesundheitlichen Schaden zu minimieren.
Und auch dem angesichts der Vielzahl gesundheitlich bedenklicher Inhaltsstoffe in Tabakprodukten beliebten Argument, die Reduktion eines Stoffes verringere das gesundheitliche Risiko praktisch nicht (salopp ausgedrückt ändere der Sturz aus dem 19. statt dem 20. Stockwerk an den Sturzfolgen nichts), widersprechen die Autoren vehement: "Nevertheless, companies bear a responsibility to reduce the levels of known carcinogens and other toxicants to the full extent possible even if the likelihood of lower harm is modest."
Ob dies bei den deutschen Herstellern von Tabakprodukten besser aussieht, ist im Zeitverlauf nicht untersucht. Darauf zu vertrauen oder den Selbstverpflichtungen der Hersteller zu glauben, könnte nach den Erfahrungen in Kanada falsch sein.
Die am 8. Juni 2017 in der Fachzeitschrift "Nicotine & Tobacco Research" erschienene Studie Trends Over Time in Tobacco-Specific Nitrosamines (TSNAs) in Whole Tobacco and Smoke Emissions From Cigarettes Sold in Canada von Christine D. Czoli und David Hammond ist komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 13.6.17
Das "Glas Rotwein" zum Abendessen - "gesunde Skepsis" gegen Nutzen für Herzgesundheit, eher gut für die Lebensqualität
 In zahlreichen Studien und zahllosen Abendessenrunden wurde und wird das "Glas Rotwein" oder auch vergleichbar geringe Mengen anderer alkoholischer Getränke als Schutz gegen Herzerkrankungen kommuniziert. Nur wenn es nicht bei dieser Menge bleibt, nähme das Risiko von Herz-Kreislauferkrankungen zu. Im Umkehrschluss: Personen, die dieses "Glas Rotwein" verschmähen, kämen nicht in den Genuss seiner protektiven Wirkung. Viele dieser Thesen werden auch durch einzelne Studien immerr wieder bestätigt.
In zahlreichen Studien und zahllosen Abendessenrunden wurde und wird das "Glas Rotwein" oder auch vergleichbar geringe Mengen anderer alkoholischer Getränke als Schutz gegen Herzerkrankungen kommuniziert. Nur wenn es nicht bei dieser Menge bleibt, nähme das Risiko von Herz-Kreislauferkrankungen zu. Im Umkehrschluss: Personen, die dieses "Glas Rotwein" verschmähen, kämen nicht in den Genuss seiner protektiven Wirkung. Viele dieser Thesen werden auch durch einzelne Studien immerr wieder bestätigt.
Ob die spezifische protektive Wirkung wirklich zutrifft und durch belastbare Studien gesichert ist, versuchte jetzt eine Gruppe us-amerikanischer/kanadischer WissenschaftlerInnen durch eine methodisch anspruchsvolle mehrfach adjustierte (Berücksichtigung von Faktoren, die das Ergebnis modifizieren könnten) Metaanalyse von 45 Querschnitts- und Kohorten-Studien herauszubekommen.
Die wichtigsten Ergebnisse lauten:
• Zunächst finden auch diese ForscherInnen eine Vielzahl von Studien, die bestätigen, dass moderate (bis zu zwei Gläser Wein oder anderer Alkoholika pro Tag) Trinker im Vergleich zu Nichttrinkern oder Abstinenzler geringere Herzerkrankungsraten haben.
• Betrachtet man sich die Ergebnisse und die ihnen zugrundeliegenden Annahmen näher, findet man als erstes, dass viele ältere Nichttrinker früher sehr wohl Alkohol in kleinen oder größeren Mengen getrunken haben und damit aus gesundheitlichen Gründen aufgehört haben. Ein Teil der Abstinenzler im höheren Lebensalter ist also kränker als diejenigen Älteren, die das "Glas Rotwein" trinken, was aber nicht daher rührt, dass sie nie Alkohol getrunken haben.
• Eine weitere Verzerrung entsteht dadurch, dass Senioren, die gesund sind oder sich gesund fühlen wahrscheinlich eher das "Glas Rotwein genießen" als ihre AltersgenossInnen mit Erkrankungen.
• Dies wird durch die genauere Betrachtung einer Teilgruppe der analysierten Studien bestätigt. Diese Studien begannen mit TeilnehmerInnen im Alter von 55 Jahren und jünger, untersuchten gründlich deren Herzgesundheit sowie ihre Trinkgewohnheiten und verfolgten dann die gesundheitliche Entwicklung und das Trinkverhalten bis ins höhere Lebensalter. In diesen Studien findet sich kein signifikanter Nutzen des moderaten Trinkens von Alkohol für die Herzgesundheit.
• Eine Langzeitstudie von 9.100 britischen Erwachsenen im Alter von 23 bis 55 Jahren unterstrich außerdem die skeptische Bewertung des Nutzens moderaten Alkoholgenusses noch aus einer anderen Perspektiven: Erstens waren nur sehr wenige Angehörige dieser Gruppe lebenslange Abstinenzler. Zweitens hatten fast alle 55-jährigen Nichttrinker in den Jahren davor das Trinken von Alkohol beendet. Und schließlich waren Nichttrinker selbst wenn sie erst 23 bis 29 Jahre alt waren körperlich und psychisch kränker als diejenigen, die moderat tranken und nicht rauchten. Nichttrinker waren im Durchschnitt auch weniger gebildet und damit bei einem wichtigen lebenslangen Einflussfaktor auf die gesamte Gesundheit benachteiligt.
• Darüber hinaus listen die ForscherInnen noch für 38 der 45 untersuchten Studien eine Fülle von nicht berücksichtigten verzerrenden Faktoren auf, darunter die fehlende Unterscheidung von heutigen, früheren und gelegentlichen Alkoholtrinkern und kontinuierlichen Abstinenzlern. In 16 Studien werden außerdem unangemessene Maßeinheiten für den Alkoholkonsum verwendet. Insgesamt finden sich hier interessante Einblicke in die Menge von Verzerrungsmöglichkeiten - auch wichtig für die Bewertung anderer Untersuchungen.
• Alles in Allem kommen die AutorInnen zu folgendem Schluss: "Our major conclusion is that the hypothesis that low-volume alcohol use can confer cardio-protection cannot be confirmed, because there remain plausible alternative explanations for the observed findings."
• Da die gesundheitlichen Risiken moderaten Alkoholkonsums klein sind, sollten aber die Personen, die dies als ein Stück ihrer Lebensqualität genießen nach Meinung der AutorInnen keinesfalls damit aufhören. Nur diejenigen, die dies nur wegen des erwarteten Gesundheitseffekts tun, sollten sich das überlegen.
Die Studie Alcohol Consumption and Mortality From Coronary Heart Disease: An Updated Meta-Analysis of Cohort Studies von Jinhui Zhao, Tim Stockwell, Audra Roemer, Timothy Naimi und Tanya Chikritzhs ist am 22. Mai 2017 in der Fachzeitschrift "Journal of Studies on Alcohol and Drugs" (78 (3): 375) veröffentlicht und komplett kostenlos erhältlich.
Insgesamt bestätigt diese Metaanalyse die Ergebnisse einer 2016 veröffentlichten Studie über die Auswirkungen moderaten Trinkens auf das Sterblichkeitsrisiko: Do "Moderate" Drinkers Have Reduced Mortality Risk? A Systematic Review and Meta-Analysis of Alcohol Consumption and All-Cause Mortality von Timm Stockwell et al. in "Journal of Studies on Alcohol and Drugs" (77(2), 185-198). Das Ergebnis zusammengefasst: "Estimates of mortality risk from alcohol are significantly altered by study design and characteristics. Meta-analyses adjusting for these factors find that low-volume alcohol consumption has no net mortality benefit compared with lifetime abstention or occasional drinking." Das Abstract ist kostenlos erhältlich
Bernard Braun, 24.5.17
Grafische Warnungen auf Zigarettenschachteln mindern den Tabakkonsum
 Bereits 1964 haben die USA als erstes Land der Welt Warnungen in Textform auf Zigarettenpackungen eingeführt. Nicht umgesetzt ist bislang der Aufdruck von Grafiken, welche gesundheitliche Folgen des Tabakkonsums darstellen. Dies wird zwar vom Rahmenübereinkommen der WHO zur Eindämmung des Tabakgebrauchs aus dem Jahr 2003 gefordert. Der Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act von 2009 sieht die Umsetzung vor. Die Umsetzung wurde vorübergehend von juristischen Schachzügen einiger der großen Tabakfirmen behindert, die den Standpunkt vertraten, die Bilder seien nicht mit der amerikanischen Verfassung zu vereinbaren.
Bereits 1964 haben die USA als erstes Land der Welt Warnungen in Textform auf Zigarettenpackungen eingeführt. Nicht umgesetzt ist bislang der Aufdruck von Grafiken, welche gesundheitliche Folgen des Tabakkonsums darstellen. Dies wird zwar vom Rahmenübereinkommen der WHO zur Eindämmung des Tabakgebrauchs aus dem Jahr 2003 gefordert. Der Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act von 2009 sieht die Umsetzung vor. Die Umsetzung wurde vorübergehend von juristischen Schachzügen einiger der großen Tabakfirmen behindert, die den Standpunkt vertraten, die Bilder seien nicht mit der amerikanischen Verfassung zu vereinbaren.
Wissenschaftler der University of North Carolina at Chapel Hill führten jetzt den Nachweis, dass die grafischen Warnungen effektiv sind. Für eine randomisierte kontrollierte Studie rekrutierten sie 2149 erwachsene Raucher in North Carolina und Kalifornien. Die Teilnehmer mussten 5 Mal im Abstand von einer Woche ein Studienzentrum aufsuchen und dabei jeweils - bis auf den letzten Termin - ihren Wochenvorrat an Zigaretten mitbringen. Mitarbeiter versahen die Packungen der Interventionsgruppe mit einer grafischen Warnung, die mindestens 50% der Vorder- und Rückseite einnahm. Die Kontrollgruppe erhielt eine textliche Warnung. Die Teilnehmern erhielten als finanziellen Anreiz etwa 200 Dollar. Beim letzten Termin erhielten alle Teilnehmern Informationen über örtliche Rauchstopp-Programme.
Das Erfolgskriterium Rauchstopp - definiert als mindestens ein Tag Tabakabstinenz während der 4-wöchigen Studienphase - erfüllten 40% der Grafikgruppe und 34% der Textgruppe. In mindestens 7 Tagen vor dem letzten Termin waren 5,7% der Grafikgruppe und 3,8% der Testgruppe abstinent.
Im Vergleich stärker ausgeprägt war der Verzicht auf eine Zigarette, die Absicht, mit dem Rauchen aufzuhören, die Nachdenklichkeit über die Warnung und über die Schäden des Rauchens, Angst, negativer Affekt, Gespräche über die Warnungen, die Gesundheitsrisiken und Rauchstopp. Keine Unterschiede war feststellbar für das wahrgenommene persönliche Risiko sowie die positive oder negative Haltung gegenüber dem Rauchen. Der Effekt war gleichmäßig über alle sozialen Gruppen ausgeprägt.
In der Diskussion heben die Autoren hervor, dass der Untersuchungszeitraum kurz sei und die Effekte der Grafikwarnungen prozentual klein erscheinen mögen, jedoch auf der Bevölkerungsebene zu hohen in absoluten Zahlen führen würden. Auch sollten Grafikwarnungen Teil umfassenderer Maßnahmen sein, zu denen insbesondere auch Öffentlichkeitskampagnen zählen. Die Autoren weisen auch darauf hin, dass viele der bisherigen Studien (die sie vor kurzem in einer Meta-Analyse zusammengefasst haben) die Reaktionen von Probanden z.B. bei Präsentation der Abbildungen am Computer gemessen hätten. Experimentelle Studien mit dem Endpunkt Rauchverhalten seien bislang jedoch rar.
Brewer NT, Hall MG, Noar SM, et al. Effect of pictorial cigarette pack warnings on changes in smoking behavior: A randomized clinical trial. JAMA Internal Medicine 2016. Abstract
Noar SM, Hall MG, Francis DB, et al. Pictorial cigarette pack warnings: a meta-analysis of experimental studies. Tob Control 2016;25(3):341-54. Volltext
David Klemperer, 11.7.16
Zwischen unter 20% bis 70%: Unterschiede der durch Verhaltensmodifikationen beeinflussbaren Krebsinzidenz und Mortalität
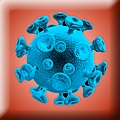 Eine 2015 in der Wissenschaftszeitschrift "Science" veröffentlichte Studie zur Ätiologie von Krebserkrankungen führte zwei Drittel von ihnen auf zufällige und damit nicht verhinderbare oder beeinflussbare Mutationen bei der DNA-Replikation zurück und nur ein Drittel auf Erb- oder Umwelteinflüsse, die aber samt ihren Folgen auch nur zum Teil beeinflussbar sind.
Eine 2015 in der Wissenschaftszeitschrift "Science" veröffentlichte Studie zur Ätiologie von Krebserkrankungen führte zwei Drittel von ihnen auf zufällige und damit nicht verhinderbare oder beeinflussbare Mutationen bei der DNA-Replikation zurück und nur ein Drittel auf Erb- oder Umwelteinflüsse, die aber samt ihren Folgen auch nur zum Teil beeinflussbar sind.
Nimmt oder nähme man dies ernst, schrumpften das Volumen der überhaupt sinnvollen präventiven Interventionen und der mögliche Erfolg einer Primärprävention von Krebserkrankungen gewaltig zusammen.
Eine andere, am 19. Mai 2016 online in der Fachzeitschrift JAMA Oncology" erschienene Studie kommt aber als Ergebnis einer prospektiven Kohortenstudien mit den Krebserkrankungs- und Lebensstildaten der "Nurses' Health Study"(16.531 Frauen) und der "Health Professionals Follow-up Study" (11.731 Männer), wieder zu einem deutlich höheren Anteil lebensstilassoziierter Krebserkrankungen und Krebsmortalität und damit einem höheren Erfolgspotenzial von Krebs-Primärprävention.
Unter gesundem gesundem Lebensstil wird Nichtrauchen, mäßiger Alkoholkonsum, ein gesundes Gewicht (BMI <27,5) und regelmäßige Bewegung verstanden.
Die altersstandardisierten Ergebnisse lauten u.a.:
• Das zusätzliche oder erhöhte bevölkerungsbezogene Risiko ("population-attributable risk" - PAR) für eine Neuerkrankung an allen Karzinomen war bei Männern mit einem gesunden Lebensstil bzw. einem niedrigen Verhaltensrisiko um 33% geringer als bei ihren Geschlechtsgenossen mit ungesünderem Gesundheitsverhalten. Bezogen auf die Mortalität aller Krebserkrankungen lag das zusätzliche Risiko bei den Männern mit gesundem Lebensstil um 44% unter dem der Mänbner mit ungesundem Lebensstil. Die PAR-Werte liegen bei den Frauen mit gesundem Lebensstil bei der Inzidenz aller Krebsarten um 25% und bei der Mortalität aller Krebsarten um 48% für unter den Werten der Frauen mit gesünderem Lebensstil.
• Beim Vergleich mit der gesamten weißen Bevölkerung in den USA, die einen deutlich schlechteren gesundheitsbezogenen Lebensstil als die Angehörigen der beiden Studienkohorten hat, steigen die Werte für Männer mit gesundem Lebensstil auf 63% (Inzidenz) und 67% (Mortalität) Abstand zu den Werten der ungesünderen Vergleichsgruppe. Bei den Frauen erhöhen sich die positiven Abstände auf 41% und 59%.
• Bei einzelnen Krebsarten wirkt sich ein gesunder Lebensstil zum Teil noch deutlich stärker positiv aus: So ist z.B. die Inzidenz von Lungenkarzinomen bei Frauen mit ungesundem Lebensstil um 82% und bei entsprechenden Männern um 78% höher als bei den sich gesund verhaltenden Angehörigen beider Geschlechter. Beim weiblichen Brustkrebs erhöht sich das PAR-Risiko um 4%, beim Prostatakrebs der Männer um 21%. Ähnliche Unterschiede gibt es auch bei der Mortalität.
• Zusammengefasst können bei den Angehörigen der beiden Kohorten potenziell 20% bis 40% aller Krebsfälle und rund die Hälfte aller Krebstodesfälle durch Modifikationen des Lebensstils verhindert werden. Rechnet man diese Ergebnisse auf die gesamte weiße Bevölkerung der USA hoch, steigt der Anteil präventiv verhinderbarer Krebsfälle auf 40% bis 70% an.
• Die für präventiv Tätige hoffnungsvolle Schlussfolgerung der StudienautorInnen lautet: "Primary prevention should remain a priority for cancer control."
Die Studie Variation in cancer risk among tissues can be explained by the number of stem cell divisions von Cristian Tomasetti und Bert Vogelstein erschien am 2. Januar 2015 in "Science" (Vol. 347, Issue 6217: 78-81). Das Abstract ist kostenlos erhältlich.
Die Studie Preventable Incidence and Mortality of Carcinoma Associated With Lifestyle Factors Among White Adults in the United States von Mingyang Song und Edward Giovannucci ist am 19. Mai 2016 in der Fachzeitschrift "JAMA Oncology" zunächst online erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
In dem ebenfalls kostenlos erhältlichen Editorial The Preventability of CancerStacking the Deck von Graham A. Colditz und Siobhan Sutcliffe werden die unterschiedlichen präventionsrelevanten Ergebnisse differenziert bewertet.
Bernard Braun, 23.5.16
Lange Telomere gleich längere Lebenserwartung und gesundes Altern dank Mittelmeer-Diät!?
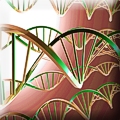 Telomere sind vereinfacht gesagt die Enden von Chromosomen. Wenn deren Länge unter ein bestimmtes Maß sinkt, kann sich die Zelle nicht mehr teilen, was wiederum dann, wenn diese Verkürzung zahlreich auftritt, zu vorzeitiger Alterung führt. Umgekehrt unterstützen und sichern längere Telomere gesundes Altern und längeres Leben - soweit die starken Annahmen.
Telomere sind vereinfacht gesagt die Enden von Chromosomen. Wenn deren Länge unter ein bestimmtes Maß sinkt, kann sich die Zelle nicht mehr teilen, was wiederum dann, wenn diese Verkürzung zahlreich auftritt, zu vorzeitiger Alterung führt. Umgekehrt unterstützen und sichern längere Telomere gesundes Altern und längeres Leben - soweit die starken Annahmen.
In einer Studie wurden nun die 4,676 gesunden mittelaltrigen Teilnehmerinnen an der "Nurses Health Study" in den USA sowohl umfassend nach ihren Essgewohnheiten gefragt als auch die Länge ihrer Telomere gemessen.
Nach dem Adjustieren von persönlichen Merkmalen (u.a. Alter, BMI, Rauchgewohnheiten und Bewegung), die als Einflussfaktoren für die Länge der Chromosomenenden gelten, stellten die ForscherInnen fest:
• Frauen, die sich bei ihrer Ernährung überwiegend an der so genannten Mittelmeer-Diät (vor allem viel Gemüse, Früchte, Nüsse, Vollkornprodukte, Fisch plus moderatem Alkoholkonsum) orientierten, hatten signifikant längere Telomere.
• Die damit erreichbare Verlängerung der Lebenserwartung berechneten die WissenschaftlerInnen mit durchschnittlich rund 4,5 Lebensjahre.
• Der Unterschied ist ähnlich groß wie der zwischen Nichtrauchern und Nichtrauchern, körperlich Aktiven und weniger Bewegten.
• Für die Erklärung dieser Assoziation und für die künftige Forschung interessant war, dass keine der einzelnen Komponenten der Mittelmeer-Diät mit der Länge von Telomeren korrespondierte, sondern offensichtlich nur das Gesamtkonzept.
Die Querschnitt-Studie Mediterranean diet and telomere length in Nurses' Health Study: population based cohort study von Immaculata de Vivo et al., online am 2. Dezember 2014 im "British Medical Journal" (349: g6674) veröffentlicht, ist komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 3.12.14
"Milch macht müde Männer munter", "Vorsicht Milch" oder Vorsicht Beobachtungsstudie?
 Eine im renommierten Medizinjournal "British Medical Journal (BMJ)" gerade veröffentlichte Studie zu möglichen Assoziationen zwischen einem hohen Milchkonsum und höherer Mortalität bei gleichzeitigem Fehlen des präventiven Nutzens von Milch gegen Knochenbrüche, erzeugt nicht nur Aufregung bei der Milchwirtschaft, sondern stellt auch ein Beispiel für mehrere in der Debatte über den gesundheitlichen Nutzen von Produkten und Dienstleistungen kritische Aspekte dar.
Eine im renommierten Medizinjournal "British Medical Journal (BMJ)" gerade veröffentlichte Studie zu möglichen Assoziationen zwischen einem hohen Milchkonsum und höherer Mortalität bei gleichzeitigem Fehlen des präventiven Nutzens von Milch gegen Knochenbrüche, erzeugt nicht nur Aufregung bei der Milchwirtschaft, sondern stellt auch ein Beispiel für mehrere in der Debatte über den gesundheitlichen Nutzen von Produkten und Dienstleistungen kritische Aspekte dar.
Doch zunächst zu den Ergebnissen der Studie: Bei den Angehörigen zweier großer Kohorten von 61.433 schwedischen Frauen, die im Startzeitraum 1987-90 39 bis 74 Jahre alt waren, und von 45.339 schwedischen Männer, die zum Startzeitpunkt 1997 45 bis 79 Jahree alt waren, wurden regelmäßig die Ernährungsgewohnheiten erhoben - darunter auch der Konsum von Milch. Nach einer durchschnittlichen Follow-up-Zeit von 20,1 Jahren waren 15.541 Frauen gestorben und 17.252 hatten einen Knochenbruch hinter sich, 4.259 eine Hüftfraktur. Nach durchschnittlich 11,2 Jahren Beobachtungszeit waren 10.112 der Männer tot und 5.066 hatten einen Knochenbruch, 1.166 einen Bruch der Hüfte.
Unter Berücksichtigung einer Reihe weiterer Faktoren berechneten die ForscherInnen, ob es eine statistische Assoziation zwischen der Menge des Milchkonsums, der generellen Sterblichkeit und von Knochenbrüchen gab. Aus bisherigen teils kleineren oder wesentlich kürzeren Studien war erwartet worden, dass sich Milch positiv auswirkt. Das Gegenteil war aber der Fall: Bei den Frauen, die drei oder mehr Gläser Milch pro Tag tranken, war das Sterblichkeitsrisiko fast doppelt so hoch wie bei Frauen, die nur ein Glas pro Tag tranken (hazard ratio 1,93). Bei den Männern war diese Assoziation mit einer hazard ratio von 1,10 kleiner aber immer noch signifikant. Hinzu kommt, dass zumindest bei Frauen das allgemeine Risiko einer Fraktur und das besondere einer Hüftfraktur mit dem Konsum von Milch zunahmen.
Vor jeder weiteren Diskussion sei erwähnt, dass die AutorInnen der Studie selber eine unabhängige Replikation ihrer Ergebnisse für notwendig halten "before they can be used for dietary recommendations."
Wenn aber ein Nahrungsmittel, das geradezu volkstümlich und fast von der Wiege bis zur Bahre als "gesund" betrachtet, verabreicht und in jeder Form zu sich genommen wird, plötzlich so an Glanz verliert und in zweifacher Hinsicht eher "ungesund" erscheint, stellt sich die Frage, wie damit umgegangen wird.
• Erstens könnten und sollten solche Ergebnisse die Sensibilität für die Möglichkeiten und Grenzen bzw. die Aussagekraft der gewählten Studienmethodik schärfen. Zu Recht monieren die Kritiker der Ergebnisse es handle sich um "eine reine Beobachtungsstudie, deren Ergebnisse immer sehr vorsichtig interpretiert werden müssen." Dass die im selben Atemzug dagegen gehaltene "allgemeine Studien- und Datenlage", die "klar den Gesundheitswert von Milch und Milchprodukten (belegt)" auch zum großen Teil aus Beobachtungsstudien oder Schlussfolgerungen von Inhaltsstoffen der Milch auf eine gesundheitliche Wirksamkeit und nicht aus randomisierten kontrollierten Studien bestehen, wird dabei lieber verschwiegen. So könnten also auch die beobachteten positiven gesundheitlichen Effekte der Milch in der von der Milchwirtschaft präferierten Studien die Wirkung anderer Nahrungsmittel oder Einwirkungen sein.
• Zweitens demonstrieren die Ergebnisse aber die Notwendigkeit, auch den Nutzen und die Schadensfreiheit vieler natürlicher und nahezu automatisch als "gesund" geltender Stoffe und Lebensmittel systematisch zu überprüfen.
Die am 28. Oktober 2014 im BMJ (349: g6015) publizierte Studie Milk intake and risk of mortality and fractures in women and men: cohort studies von Karl Michaëlsson et al. ist komplett kostenlos erhältlich uind enthält noch eine Fülle weiterer interessanter Hinweise auf mögliche Erklärungen für die gewonnenen Ergebnisse.
Eine kurze kritische Auseinandersetzung mit den Ergebnissen der schwedischen Studie lieferte z.B. die Landesvereinigung der Milchwirtschaft Niedersachsen e. V. unter der Überschrift Milchstudie sorgt für Aufregung am 31. Oktober 2014 und will die Studie weiter durchleuchten lassen.
Bernard Braun, 2.11.14
Viel Risiko, viel Aufklärung, wenig Wirkung - Sonnenschutz und Sonnenbankbesuche bei US-High-School-SchülerInnen 2001-2012
 Trotz jahre- oder jahrzehntelanger multimedialer Aufklärung über die Risiken mancher Verhaltensweisen und entsprechend "harter" Zahlen zur assoziierten Morbidität und Mortalität, gibt es zahlreiche Beispiele dafür, dass davon entweder wenig ankommt, wenig hängenbleibt, wenig verhaltensbestimmend wirkt und oftmals sogar erwünschte Verhaltensweisen abnehmen.
Trotz jahre- oder jahrzehntelanger multimedialer Aufklärung über die Risiken mancher Verhaltensweisen und entsprechend "harter" Zahlen zur assoziierten Morbidität und Mortalität, gibt es zahlreiche Beispiele dafür, dass davon entweder wenig ankommt, wenig hängenbleibt, wenig verhaltensbestimmend wirkt und oftmals sogar erwünschte Verhaltensweisen abnehmen.
Eine neue Studie aus den USA, die sich auf der Basis von Daten des repräsentativen "Youth Risk Behavior Surveillance System" mit der Nutzung von Sonnenschutz und dem Besuch von Sonnenbanken der Jugendlichen im High-School-Alter zwischen den Jahren 2001 und 2011 beschäftigte, also Jahre in denen vielfältige Berichte über die Hautkrebsrisiken langer ungeschützter Sonneneinstrahlung oder zu intensiver Nutzung von Sonnenbanken das Licht der Öffentlichkeit erblickten, kommt zu folgenden Ergebnissen:
• Der Anteil der Teeenager, die in den 12 Monaten vor der Befragung Sonnenschutz genutzt hatten, sank in dem Untersuchungszeitraum von 68% auf 56%. Mädchen oder junge Frauen schützten sich dabei mehr als junge Männer vor Sonneneinstrahlung.
• Der Anteil der Jugendlichen, die eine Sonnenbank besuchten, sank insgesamt von 16% im Jahr 2009 auf 13% im Jahr 2011. Dass dies aber immer noch weit überdurchschnittliche 29% aller weißen Frauen machten, zeigt die auch hier ungleiche Verteilung riskanter Verhaltensweisen und damnit die besonderen Herausforderungen für Aufklärungsaktionen.
Auch hier stellt sich die allgemeinere Frage nach der Wirksamkeit der Gesundheitserziehung in der heute üblichen Form oder die nach der möglicherweise notwendigen Daueraufklärung mit einem Hauch von permanenter Gesundheitserziehungsdiktatur. Dies ist auch für all diejenigen Akteure im Gesundheitssystem ein nachdenkenswertes Ergebnis, die "die Schule" als Hauptträgerin und -verantwortliche für ein nachhaltiges Gesundheitswissen oder "health literacy" und gesündere Verhaltensweisen betrachten.
Der Aufsatz Use of Sunscreen and Indoor Tanning Devices Among a Nationally Representative Sample of High School Students, 2001-2011 von Basch CH, Basch CE, Rajan S und Ruggles KV. ist im August 2014 in der Zeitschrift "Preventing Chronic Disease (11: E144) erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 26.8.14
"Mindestens 2x täglich", aber wie am besten ist unklar oder evidenzbasierte Zähneputztechnik Fehlanzeige!
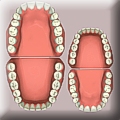 Wer hat nicht bereits seit Kindesbeinen an mit immer neuen und raffinierteren Techniken und mit von Zahnärzten, Gesundheitsratgebern und natürlich Herstellern empfohlenen Apparaten versucht, seine Zähne und Kiefer so gründlich zu reinigen, dass "Karius und Baktus" keine Chance hatten. Wie in kaum einem anderen gesundheitlichen Bereich gilt die richtige Eigenaktivität als entscheidende Voraussetzung fürs Gesundbleiben. Wer trotzdem an den Zähnen erkrankt oder sie gar verliert, hat sich dies selbst zuzuschreiben. Und folgerichtig sind weite Bereiche der gesundheitlichen Versorgung des Gebisses auch eine Art "GKV-freie" Zone, deren Finanzlücken durch private Zusatzversicherungen oder üppige, d.h. den GKV-Kassenzuschuss vielfach übertreffende "Zu"-Zahlungen gefüllt werden müssen.
Wer hat nicht bereits seit Kindesbeinen an mit immer neuen und raffinierteren Techniken und mit von Zahnärzten, Gesundheitsratgebern und natürlich Herstellern empfohlenen Apparaten versucht, seine Zähne und Kiefer so gründlich zu reinigen, dass "Karius und Baktus" keine Chance hatten. Wie in kaum einem anderen gesundheitlichen Bereich gilt die richtige Eigenaktivität als entscheidende Voraussetzung fürs Gesundbleiben. Wer trotzdem an den Zähnen erkrankt oder sie gar verliert, hat sich dies selbst zuzuschreiben. Und folgerichtig sind weite Bereiche der gesundheitlichen Versorgung des Gebisses auch eine Art "GKV-freie" Zone, deren Finanzlücken durch private Zusatzversicherungen oder üppige, d.h. den GKV-Kassenzuschuss vielfach übertreffende "Zu"-Zahlungen gefüllt werden müssen.
Eine am 8. August 2014 in der Onlineausgabe der Fachzeitschrift "British Dental Journal" veröffentlichte Studie zeigt nun aber, dass das weite Feld der händischen, elektrischen, vibrierenden, rotierenden, pulsierenden, kreisendenZahnputztechniken auch noch weitgehend evidenzfrei ist. Die meisten, oft aufwändigen und/oder teuren Techniken haben keinen nachgewiesenen gesundheitlichen Nutzen gegenüber einem einfachen, vorsichtigen horizontalen Bürsten. Die bunte Vielfalt der Empfehlungen ist durch ein großes Durcheinander sowie durch inter- und intranationale Widersprüche zwischen Fachgesellschaften, Putzgeräteherstellern oder Lehrbüchern geprägt.
Die Ergebnisse der britischen Dental-Gesundheitswissenschaftler basieren auf einer vergleichenden Untersuchung der von Zahnärzten oder sogar ihren "Ehefrauen" (so z.B. in einem im deutschen TV gezeigten Werbespot), Fachgesellschaften, Zahnbürstenherstellern und Lehrbuchautoren in 10 Ländern empfohlenen Zahnputztechniken.
Mit dem folgenden, in einem Artikel der "Süddeutschen Zeitung" über die britische Studie (Zähneputzen schwer gemacht von Werner Bartens am 11. August 2014) zitierten Votum eines Zahnmediziners handelt man wahrscheinlich nicht falsch: "Hauptsache gründlich. Nur dieses Wohlfühl-Putzen mit ein bisschen Schaum reicht nicht." Dies bedeutet freilich nicht, dass dies wissenschaftlich belegt ist.
Zum wiederholten Male stellt sich aber die Frage, warum die zahllosen und wortgewaltigen gesundheitsbezogenen Versprechen und geweckten Erwartungen auf Zahnbürsten und Geräten nicht erst dann zulässig sind, wenn sie belegt worden sind? Zu einem gesundheitsbezogenen Verbraucherschutz gehört es, dass dort wo "Gesundheit" draufsteht auch verlässlich und nachgewiesen "Gesundheit" bzw. Schadensfreiheit drin sein muss.
Wie viel patientenbezogene Fortschritte in diesem Gesundheitsversorgungsbereich noch gemacht werden können, verbirgt sich darin, dass ein Mensch mit durchschnittlicher Lebenserwartung sich mit jeder Menge Expertenhinweisen versehen zwar lebenslang rund 55.000mal (bei 2x täglich) oder noch öfter die Zähne putzt, ihm die Experten aber offensichtlich nicht eindeutig die richtige Methode empfehlen können.
Von dem Aufsatz An analysis of methods of toothbrushing recommended by dental associations, toothpaste and toothbrush companies and in dental texts von J. Wainwright und A. Sheiham, erschienen in der Zeitschrift "British Dental Journal" (217, E5) gibt es kostenlos ein kurzes Abstract.
Bernard Braun, 13.8.14
Wie viel kostet Unternehmen ein rauchender Mitarbeiter pro Jahr und was ist am teuersten?
 Seitdem in den meisten öffentlichen und privaten Unternehmen mit Publikumsbetrieb aber auch in vielen anderen Betrieben nicht mehr direkt am Arbeitsplatz geraucht werden darf, dies aber meist nicht heißt, dass die Mitarbeiter das Rauchen aufgegeben haben, stellt sich die Frage, ob und wie viel rauchende Mitarbeiter Unternehmen insgesamt kosten. Anders ausgedrückt: Wie hoch ist der finanzielle Anreiz für Unternehmen, Raucherentwöhnungsprogramme in ihr betriebliches Gesundheitsmanagement zu integrieren?
Seitdem in den meisten öffentlichen und privaten Unternehmen mit Publikumsbetrieb aber auch in vielen anderen Betrieben nicht mehr direkt am Arbeitsplatz geraucht werden darf, dies aber meist nicht heißt, dass die Mitarbeiter das Rauchen aufgegeben haben, stellt sich die Frage, ob und wie viel rauchende Mitarbeiter Unternehmen insgesamt kosten. Anders ausgedrückt: Wie hoch ist der finanzielle Anreiz für Unternehmen, Raucherentwöhnungsprogramme in ihr betriebliches Gesundheitsmanagement zu integrieren?
Eine Studie von Wissenschaftlern am "Ohio State University College of Public Health" untersuchte nun diese Fragen in einem unternehmensbezogenen Vergleich der Kosten für Raucher mit denen für Beschäftigte, die niemals geraucht haben.
Die Ergebnisse sehen so aus:
• Die für jeden Raucher zusätzlich anfallenden Kosten für Absentismus, verlorene Produktivität bei Präsentismus (Anwesenheit trotz Arbeitsunfähigkeit), Rauchpausen und Gesundheitsausgaben betrugen durchschnittlich 5.816 US-Dollar und schwankten je nach Unternehmen zwischen 2,885 US-Dollar und 10.125 US-Dollar.
• Für zusätzliche Arbeitsunfähigkeit mussten die US-Unternehmen (bei der in Deutschland geltenden Lohnfortzahlung ist dieser Betrag in Deutschland deutlich höher) 517$, für Präsentismus 462$, für zusätzliche Gesundheitsausgaben (wenn das Unternehmen eine betriebliche Krankenversicherungspolice anbietet) 2.056$ und schließlich für Rauchpausen den unerwartet höchsten Betrag von 3.077$ aufbringen.
• In der Studie wird auch der ökonomische Nutzen der durchschnittlich verkürzten Lebensdauer von Rauchern ("death-benefit") errechnet - ein immer wieder einmal bemühtes Argument gegen raucherbezogene Präventionsbemühungen. Dadurch, dass Raucher bei gleichen Rentenbeiträgen weniger Rente bekommen als Nichtraucher, haben wiederum Unternehmnen, die einen betrieblichen Rentenplan anbieten und organisieren eine jährliche Kostenersparnis von unerwartet wenigen 296$. Keine Raucherentwöhnungskurse anzubieten und auf einen "Todesnutzen" zu hoffen, rechnet sich also selbst jenseits aller humanen oder ethischen Erwägungen noch nicht einmal.
Auch wenn bei der Berechnung dieser Kosten eine ganze Reihe Besonderheiten der us-amerikanischen Unternehmen und des dortigen Versicherungssystems eine Rolle spielen, lassen sich die Ergebnisse zumindest qualitativ auch auf die bundesrepublikanische Unternehmenswirklichkeit übertragen.
Der bereits am 3. Juni 2013 Aufsatz Estimating the cost of a smoking employee von Micah Berman, Rob Crane, Eric Seiber und Mehmet Munur ist in der Zeitschrift "Tobacco Control" erschienen. Ein Abstract ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 29.7.14
"Ich habe das richtige Gewicht" - Selbstwahrnehmung vieler übergewichtiger und fetter Kinder in den USA anders als Messwerte
 Für den Erfolg jeder verhaltensbezogenen Intervention sind die Existenz wirksamer Maßnahmen, die Motivation und schließlich auch die Selbstwahrnehmung des Risikos entscheidend. Wer seinen Zustand für unproblematisch oder gar für ideal hält, wird weder verhältnisbezogene Maßnahmen begrüßen und nutzen noch sein Verhalten verändern.
Für den Erfolg jeder verhaltensbezogenen Intervention sind die Existenz wirksamer Maßnahmen, die Motivation und schließlich auch die Selbstwahrnehmung des Risikos entscheidend. Wer seinen Zustand für unproblematisch oder gar für ideal hält, wird weder verhältnisbezogene Maßnahmen begrüßen und nutzen noch sein Verhalten verändern.
Dass dies auch im Bereich von Übergewicht oder Fettsucht bei Kindern und Jugendlichen häufig der Fall sein könnte, zeigt jetzt eine aktuelle Auswertung des "National Health and Nutrition Examination Survey" für acht- bis fünfzehnjährige Kinder in den USA im Zeitraum 2005 bis 2012.
Diese Zielgruppe wird in dem für die USA repräsentativen Survey gebeten die folgende Frage zu beantworten: "Do you consider yourself now to be fat or overweight, too thin, or about the right weight?" Außerdem werden Körpergröße und Gewicht erhoben womit der Body Mass Index errechnet werden kann.
Die Ergebnisse sehen so aus:
• Rund 81% der nach ihrem alters- und geschlechtsspezischen BMI-Wert übergewichtigen Jungen und 71% der übergewichtigen Mädchen ("greater than or equal to the 85th and less than the 95th percentile" eines in den USA geltenden Zielwerts) halten ihr Gewicht für das richtige.
• Von den Kindern, die fettsüchtig waren ("greater than or equal to the 95th percentile" des genannten Zielwerts), sagten immer noch 48% der Jungen und 36% der Mädchen, sie hätten aus ihrer Sicht das richtige Gewicht.
• Kinder aus Familien mit niedrigem Einkommen und aus nichtweißen Familien misklassifizierten ihre Gewicht mit größerer Wahrscheinlichkeit als die aus Familien mit höherem Einkommen. Von den Kindern aus Familien mit einem Einkommen, das 350% und mehr über der so genannten "family income-to-poverty ratio (FIPR)" lag, nahmen 26,3% ihr Gewicht falsch war. In Familien, die 130% bis 349% der FIPR Einkünfte hatten, machten dies 30,7% und in den ärmsten Familien mit weniger als 130% der FIPR 32,5%. Dieser Trend war statistisch signifikant. Interessanterweise waren die Unterschiede bei Mädchen deutlich größer und auch signifikant unterschiedlich als bei Jungen.
Die Fehlwahrnehmung des eigenen Gewichts ist aber nicht nur im Bereich tatsächlichen Übergewicht und Fettsucht ein Problem, sondern tritt auch umgekehrt bei völlig normalgewichtigen Kindern und Jugendlichen auf. Angehörige dieser Gruppe halten sich nicht selten für zu dick oder gar fett, versuchen deshalb mit allen Mitteln abzunehmen und riskieren gesundheitsschädlich untergewichtig zu werden.
Der Aufsatz Perception of Weight Status in U.S. Children and Adolescents Aged 8-15 Years, 2005-2012 von Neda Sarafrazi et al. ist im Juli 2014 als Heft 158 des "National Center for Health Statistics data brief" erschienen und kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 24.7.14
Risikopyramide Tabakrauchen: Aktivrauchen, Passivrauchen und nun auch noch "third hand smoke"-Rauchen
 Besonders Ex-Raucher riechen sie schon immer und leiden auch gelegentlich mehr oder weniger heftig darunter: die olfaktorischen oder auch stofflichen Rückstände von Tabakrauch in Räumen, in denen aktuell niemand raucht: das so genannte "Rauchen aus dritter Hand". Auch nachdem die gesundheitlichen Risiken des Selberrauchens und des Passivrauchens umfassend analysiert wurden, gesetzliche Rauchverbote in öffentlichen Räumen und in weiten Teilen der Gastronomie verfügt und durchgesetzt wurden und deren positiven gesundheitlichen Effekte in enorm kurzer Sicht nachgewiesen werden konnten (siehe dazu mehrere Beiträge im forum-gesundheitspolitik), galt der "third hand tobacco smoke" lange Zeit vor allem als hygienisches Problem oder als "Anstellerei" von Ex-Rauchern.
Besonders Ex-Raucher riechen sie schon immer und leiden auch gelegentlich mehr oder weniger heftig darunter: die olfaktorischen oder auch stofflichen Rückstände von Tabakrauch in Räumen, in denen aktuell niemand raucht: das so genannte "Rauchen aus dritter Hand". Auch nachdem die gesundheitlichen Risiken des Selberrauchens und des Passivrauchens umfassend analysiert wurden, gesetzliche Rauchverbote in öffentlichen Räumen und in weiten Teilen der Gastronomie verfügt und durchgesetzt wurden und deren positiven gesundheitlichen Effekte in enorm kurzer Sicht nachgewiesen werden konnten (siehe dazu mehrere Beiträge im forum-gesundheitspolitik), galt der "third hand tobacco smoke" lange Zeit vor allem als hygienisches Problem oder als "Anstellerei" von Ex-Rauchern.
Eine jetzt veröffentlichte Studie in der 2011 und 2012 die Rückstände von Tabakrauch in 46 Innenräumen (in der Stadt Tarragona) ohne zum Zeitpunkt der Messung anwesende RaucherInnen in einem technisch aufwändigen Verfahren gemessen und deren gesundheitliches Risiko bestimmt wurde, warnt vor einer Unterschätzung dieser Risiken vor allem bei Kindern.
Die Kernergebnisse der Studie sahen so aus:
• Im Staub von 77% der Raucherwohnungen fanden sich weit über den dafür geltenden Grenzwerten liegende gesundheitsschädliche Konzentrationen von rauchspezifischen, d.h. bei der Verbrennung von Tabak entstehenden Nitrosaminen.
• Diese Nitrosamine werden über die Haut aufgenommen und verursachen bei Kindern bis zu sechs Jahgren einen zusätzlichen Krebsfall pro 1.000 Personen.
• Zunächst mysteriös ist, dass solche Nitrosamine auch im Staub und auf Oberflächen in 64% aller Nichtraucherwohnungen gemessen wurden. Als eine Erklärung bietet sich die extrem schnelle und weite Verbreitung von Tabakrauch durch Luftströme an.
Angesichts der Schätzung, dass 40% der Kinder bereits durch ihre rauchenden Eltern einem "second hand"-Rauchrisiko ausgesetzt sind und ein Teil der restlichen 60% außerdem einem "third hand"-Risiko, raten die AutorInnen der Studie folgendes: "This risk should not be overlooked and ist impact should be included in future educational programs and tobacco-related public health policies".
Was dies konkret bedeuten könnte oder müsste, erörtern die AutorInnen nicht weiter. Das immer beliebter werdende "Balkonrauchen" ist allerdings weder für "second-" noch für "third hand"-Raucher eine gesunde Lösung. Eine Beobachtung der Studie lautet nämlich eindeutig so: "The strong correlation between the concentrations of nicotine that were found in the house dust from smokers' homes and the number of cigarettes smoked by the members of the household outside their homes demonstrates that tobacco smoke components are released to indoor environments by additional pathways such as off-gassing from the smokers' clothing or exhaled toxins."
Praktische Schlussfolgerungen mit dem Hinweis auf die geringe Anzahl von untersuchten Räumen, das Untersuchungsland "Spanien" oder andere, auch von den AutorInnen genannten Limitationen auf die lange Bank zu schieben, dürfte allerdings mit Sicherheit falsch sein.
Die britisch-katalanische Studie Exposure to nitrosamines in thirdhand tobacco smoke increases cancer risk in non-smokers. von Noelia Ramírez, Mustafa Z. Özel, Alastair C. Lewis, Rosa M. Marcé, Francesc Borrull und Jacqueline F. Hamilton erscheint in der Oktoberausgabe der Fachzeitschrift "Environment International" (2014; Volume 71: 139-147). Ein Abstract ist kostenlos erhältlich. Der Link könnte sich nach der Druckveröffentlichung ändern. Dann bitte mit den bibliografischen Angaben selber suchen.
Bernard Braun, 17.7.14
Gute Zeiten, schlechte Zeiten oder wie entwickelt sich das Gesundheitsverhalten von jungen Menschen in den USA seit 1991?
 Der am 13. Juni 2014 veröffentlichte 172-seitige "Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR)" mit den Ergebnissen des "Youth Risk Behavior Surveillance Report" lieferte eine Reihe interessanter Ergebnisse zum aktuellen Gesundheitsverhalten bzw. riskanten Gesundheitsverhalten der High-School-Generation und vor allem auch zu seiner Entwicklung seit Beginn dieser Art von Survey zu Beginn der 1990er Jahre. Die Ergebnisse zeigen außerdem die inhaltliche Relevanz von Längsschnittanalysen zur Fundierung der vielen Debatten über die vermeintlich schlechter werdende Gesundheit oder das nachlässigere Gesundheitsverhalten von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen.
Der am 13. Juni 2014 veröffentlichte 172-seitige "Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR)" mit den Ergebnissen des "Youth Risk Behavior Surveillance Report" lieferte eine Reihe interessanter Ergebnisse zum aktuellen Gesundheitsverhalten bzw. riskanten Gesundheitsverhalten der High-School-Generation und vor allem auch zu seiner Entwicklung seit Beginn dieser Art von Survey zu Beginn der 1990er Jahre. Die Ergebnisse zeigen außerdem die inhaltliche Relevanz von Längsschnittanalysen zur Fundierung der vielen Debatten über die vermeintlich schlechter werdende Gesundheit oder das nachlässigere Gesundheitsverhalten von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen.
In dem zweijährig durchgeführten Survey werden repräsentativ für die gesamte USA und zusätzlich für 42 Bundesstaaten und 21 große städtische Schulbezirke Antworten auf Fragen nach 104 gesundheitsriskanten Verhaltensweisen, dem Sexualverhalten, dem Übergewicht und Adipositas sowie zum Auftreten von Asthma veröffentlicht.
Zur Fülle der Ergebnisse gehörten 2013/14 u.a. folgende Daten:
• In den 30 Tagen vor der Befragung schrieben 41,4% der Befragten, die ein Fahrzeug führten während der Fahrt eine Mail oder andere Texte,
• 34,9% hatten im selben Zeitraum Alkohol getrunken,
• 15,7% hatten Tabakwaren geraucht und 8,8% rauchlosen Tabak konsumiert,
• 23,4% nahmen Marijuana zu sich,
• 14,8% wurden elektronisch belästigt,
• von den sexuell aktiven SchülerInnen benutzten 59,1% ein Kondom,
• 88% der jungen RadfahrerInnen trugen nie oder nur sehr selten einen Helm,
• in den 7 Tagen vor der Befragung hatten 5% der High-School-BesucherInnen weder Obst gegessen noch Fruchtsäfte getrunken und 6,6% hatten kein Gemüse gegessen.
Was erste Kommentatoren des Surveys titeln ließen "the good news and the bad" waren die unterschiedlichen Ergebnisse des Vergleichs der Prävalenz verschiedener dieser Verhaltensweisen in den Jahren 1991 und 2013. Dieser Vergleich zeigte u.a. folgende zum Teil unerwartete Veränderungen:
• Der Anteil der tabakrauchenden Teens sank von 28% auf 16%
• Der Anteil AlkoholtrinkerInnen nahm von 51% auf 35% ab
• Der Anteil der Teens, der in Prügeleien oder körperliche Kämpfe verwickelt war, sank von 43% auf 25%
• Nahezu die Hälfte der Befragten versuchten 2013 Gewicht abzunehmen oder hatten versucht, das Rauchen aufzugeben
• Trotz all dieser Verbesserungen stieg der Anteil der sich nach dem öffentlichen Verständnis ungesund verhaltenden MarijuananutzerInnen im betrachteten Zeitraum von 15% auf 23%.
Was an den auch hier hierzulande meist elanvoll vertretenen pessimistisch gestimmten Annahmen über die Tendenz des Gesundheitsverhalten der jüngeren und restlichen deutschen Bevölkerung dran ist, lässt sich wegen der umgekehrt proportionalen Vernachlässigung von Längsschnittsanalysen leider nicht sagen. Dass es sich völlig anders entwickelt haben sollte als in den USA, ist aber eher unwahrscheinlich.
Der komplette Bericht Youth Risk Behavior Surveillance - United States, 2013 von Laura Kann et al. (Surveillance Summaries, Vol. 63, No. 4) ist am 13. Juni 2014 erschienen und kostenlos erhältlich. Er enthält u.a. 100 Seiten Tabellen mit Angaben zur regionalen, geschlechtsspezifischen und ethnischen Häufigkeit des Gesundheitsverhaltens.
Mehr zu dem diesem Report zugrundeliegenden "Youth Risk Behavior Surveillance System (YRBSS)" erfährt man auf der Website der für dieses System und den Report verantwortlichen staatlichen "Centers for Disease Control and Prevention".
Bernard Braun, 15.6.14
"Aktiv- und Passivrauchen gefährden Ihre Gesundheit" - weitere Belege aus Mehrjahresvergleichen in der Schweiz
 Auch wenn es bereits zahlreiche Belege für die unerwartet rasche erkrankungsbewahrende oder gesundheitsfördernde Wirkung von Rauchverboten gibt, verdienen weitere bevölkerungsbezogene Studienergebnisse aus möglichst vielen Ländern verbreitet zu werden. Und wenn sie dazu noch aus der Schweiz stammen, mögen sie den einen oder anderen Zweifler am Nutzen solcher Verbote überzeugen.
Auch wenn es bereits zahlreiche Belege für die unerwartet rasche erkrankungsbewahrende oder gesundheitsfördernde Wirkung von Rauchverboten gibt, verdienen weitere bevölkerungsbezogene Studienergebnisse aus möglichst vielen Ländern verbreitet zu werden. Und wenn sie dazu noch aus der Schweiz stammen, mögen sie den einen oder anderen Zweifler am Nutzen solcher Verbote überzeugen.
In der Schweiz wurde im Kanton Tessin im Jahr 2007 ein Rauchverbot an öffentlichen Plätzen eingeführt. Dies ermöglichte sowohl den langfristigen Vergleich der Inzidenz einer speziellen Form des Herzinfarkts (dem so genannten ST-Strecken-Erhebungs-Myokard Infarkt STEMI; die ST-Strecke ist ein Kurvenabschnitt des Elektrokardiogramms) innerhalb der Tessiner Bevölkerung drei Jahre vor und nach dem Rauchverbot und ferner den Vergleich mit der Inzidenz im Kanton Basel-Stadt, wo es noch kein Rauchverbot gab.
Die Ergebnisse sahen so aus:
• In jedem der drei Jahre nach dem Rauchverbot im Tessin war die Inzidenz signifikant niedriger (zwischen 89,6 und 101,6 stationären Einweisungen wegen STEMI pro 100.000 Einwohner) als in den drei Jahren davor (123,7 Einweisungen). Erneut zeigte sich also eine so nicht erwartete schnelle Wirkung des Verbots auf eine spezifische rauchassoziierte schwere Erkrankung.
• Die durchschnittliche Inzidenz von STEMI veränderte sich dagegen in Basel-Stadt im gesamten 6-Jahreszeitraum nicht signifikant.
• Die Studie liefert auch differenzierte Belege für Gesundheitswirkungen nach Alter und Geschlecht.
Die Schlussfolgerung der AutorInnen, dass "smoke-free policies … should be included in prevention programms worldwide" ist u.a. deshalb wichtig, weil es Anzeichen dafür gibt, dass sich die Tabakwarenindustrie zunehmend auf den Markt in der dritten Welt konzentriert.
Der Aufsatz Reduction of ST-elevation myocardial infarction in Canton Ticino (Switzerland) after smoking bans in enclosed public places - No Smoke Pub Study von Marcello Di Valentino et al. ist am 3. Juni 2014 vorab online als Beitrag im "European Journal of Public Health" erschienen. Das Abstract ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 8.6.14
Mythos "gesunde Ernährung ist teuer" oder "zu teuer" - Metaanalyse: Wie viel teuerer als ungesündeste ist sie wirklich?
 Eine der am häufigsten genannten Barrieren, die BürgerInnen und insbesondere solche mit niedrigerem Einkommen von einer gesünderen Ernährung abhält, ist deren zu hoher Preis. Darüber, ob dies stimmt und vor allem wie viel mehr für gesündere bzw. hochwertigere Nahrungsmittel gezahlt werden muss, gibt es interessanterweise relativ wenig und gesundheitspolitisch diskutiertes Wissen.
Eine der am häufigsten genannten Barrieren, die BürgerInnen und insbesondere solche mit niedrigerem Einkommen von einer gesünderen Ernährung abhält, ist deren zu hoher Preis. Darüber, ob dies stimmt und vor allem wie viel mehr für gesündere bzw. hochwertigere Nahrungsmittel gezahlt werden muss, gibt es interessanterweise relativ wenig und gesundheitspolitisch diskutiertes Wissen.
Eine am 5. Dezember 2013 in der Online-Ausgabe des "British Medical Journal Open" von EpidemiologInnen der "Harvard School of Public Health" veröffentlichte Metaanalyse von 27 Studien aus 10 Ländern (USA/Kanada, 6 europäische Länder, Südafrika/Australien etc.) mit im internationalen Vergleich höheren Durchschnittseinkommen schafft hierzu mehr Klarheit.
Auf den einfachsten finanziellen Nenner gebracht kostet die gesündeste Ernährung, also z.B. die mit Früchten, Gemüse, Fisch oder Nüssen insgesamt rund 1,50 US-Dollar pro Tag mehr als die am wenigsten gesunde Ernährung, bestehend aus Fertiggerichten, Fleisch oder raffinierten Samen bzw. Getreide. Dazu wurden sowohl die Kosten pro Essensportion als auch die bestimmter Kalorienmengen untersucht.
Rechnet man die unerwartet niedrigen absoluten Tageskosten einer gesunden Ernährung auf das Jahr hoch, kommt allerdings ein Betrag von rund 550 US-Dollar zusammen. Dies kann für eine Reihe von Familien eine zu hohe Kostenlast bedeuten, deren Gewicht politisch gesenkt werden muss. Dabei ist nach Ansicht der WissenschaftlerInnen hilfreich, dass die dafür erforderlichen Geldmittel im Vergleich zu den Kosten der Behandlung von ernährungsbedingten Krankheiten eher gering sind. Die Behandlungskosten würden außerdem durch gesunde Ernährung präventiv erheblich gesenkt werden.
Die WissenschaftlerInnen widmeten sich auch der Frage warum ungesündere Ernährung billiger ist. Dies liegt ihres Erachtens vor allem an einem komplexen Netzwerk von Produzenten, Vertreibern und Marketingakteure, die alle an dieser Art von Nahrungsmittel interessiert sind und daran auch gut verdienen. Sofern diese Erklärung stimmt, könnte also eine vergleichbare Infrastruktur für gesündere Nahrungsmittel sowohl deren Erreichbarkeit erhöhen als auch die Preise senken.
Auch wenn die in die Analyse eingegangenen Warenkörbe und deren Preisstruktur sich in mehrerlei Hinsicht je nach Land unterscheiden können dürfte sich an den Preisniveaus und -unterschieden in reicheren Ländern nichts Grundsätzliches ändern. Und damit auch nichts an den gesundheitspolitischen und -ökonomischen Schlussfolgerungen.
Der am 5. Dezember 2013 online veröffentlichte Aufsatz Do Healthier Foods and Diet Patterns Cost More Than Less Healthy Options? A Systematic Review and Meta-Analysis von Mayuree Rao, Ashkan Afshin, Gitanjali Singh und Dariush Mozaffarian ist in der Fachzeitschrift "BMJ Open" erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 30.12.13
Evidenz für den Nutzen von Gewichtsabnahme, Bewegungssport und Muskelaufbau als Methoden für Patienten mit Knie-/Hüft-Arthrose
 Eine Arthrose der Kniegelenke ist häufige Ursache von chronischen Schmerzen und eingeschränkter Gehfähigkeit. Durch eine insbesondere in Deutschland immer häufigere operative Lösung werden Teile oder das gesamte Kniegelenk durch eine Teile- oder Total-Endoprothese ersetzt. Es gibt Anzeichen dafür, dass eine Reihe von konservativen nichtoperativen Behandlungsmöglichkeiten mit dem Schwerpunkt auf Bewegungsübungen und Muskelaufbau relativ wenig genutzt werden. Dies hängt nicht zuletzt von Annahmen über die geringe Nützlichkeit für die Linderung von Schmerzen und Erleichterung der Beweglichkeit oder gar die Schädlichkeit z.B. von Bewegungs- oder Physiotherapien ab.
Eine Arthrose der Kniegelenke ist häufige Ursache von chronischen Schmerzen und eingeschränkter Gehfähigkeit. Durch eine insbesondere in Deutschland immer häufigere operative Lösung werden Teile oder das gesamte Kniegelenk durch eine Teile- oder Total-Endoprothese ersetzt. Es gibt Anzeichen dafür, dass eine Reihe von konservativen nichtoperativen Behandlungsmöglichkeiten mit dem Schwerpunkt auf Bewegungsübungen und Muskelaufbau relativ wenig genutzt werden. Dies hängt nicht zuletzt von Annahmen über die geringe Nützlichkeit für die Linderung von Schmerzen und Erleichterung der Beweglichkeit oder gar die Schädlichkeit z.B. von Bewegungs- oder Physiotherapien ab.
Ob diese Annahmen berechtigt sind oder das Gegenteil zutrifft, wurde in mehreren aktuellen wissenschaftlichen Studien genauer untersucht.
In einer in der Zeitschrift "Journal of the American Medical Association" im September 2013 veröffentlichten randomisierten Studie wurden die Auswirkungen einer gewichtsreduzierenden und damit belastungsreduzierenden Diät auf die Funktion der Kniegelenke und deren Entzündung untersucht.
Dazu wurden 454 übergewichtige (BMI 27-41) und über 55 Jahre alten Erwachsene, die an Schmerzen und einer eindeutig diagnostizierten Kniearthrose litten, zufällig drei Gruppen zugewiesen: einer Gruppe Intensivdiät plus Sport, einer Nur-Intensivdiät- sowie einer Nur-Sport-Gruppe.
Nach 18 Monaten hatten die Angehörige der ersten Gruppe am meisten (10,6 kg), die der dritten Gruppe am wenigsten abgenommen (1,8 kg), was zu einer mehr oder weniger starken Verringerung des messbaren Drucks auf die Kniegelenke führte. Ferner nahm die Konzentration von Entzündungsmarkern ab - in den beiden ersten Gruppen mehr als in der Sportgruppe. Bei den für den weiteren Umgang mit der Arthrose und darunter besonders für die Entscheidung für oder gegen eine Endoprothesen-Operation besonders wichtigen Knieschmerzen und die Beweglichkeit der Kniegelenke sah die Situation in der Diät-Sport-Gruppe signifikant besser aus als in den Mono-Maßnahmengruppen.
Eine Gewichtsreduktion von rund 10% des Körpergewichts durch Diät und Sport hat also zumindest für die 18 Monate Laufzeit der Studie gereicht, um die gesundheitsbezogene Lebensqualität zu verbessern und den subjektiven Druck in Richtung einer Operation zu mindern.
Auch wenn die AutorInnen dieser Studie keine Empfehlungen für wirksame Sportarten geben, ist davon auszugehen, dass dabei besonders kniebelastende Arten wie das Joggen gemieden und knieschonende wie das Radfahren bevorzugt werden sollten.
Ebenfalls im September 2013 veröffentlichte eine Autorengruppe aus Großbritannien einen systematischen Review samt einer Metaanalyse zu den Ergebnissen von 60 Studien über die Wirkung von sportlichen Übungen und Muskelaufbauprogrammen bei 8.218 PatientInnen mit einer Knie- (44 Studien), Hüft- (2 Studien) oder Knie- und Hüftgelenksarthrose (14 Studien). In diesen meist randomisierten und kontrollierten Studien wurden die positiven Effekte verschiedener konservativer Sport- und Aufbauprogramme auf Schmerzen und Funktion der arthrotisch erkrankten Gelenke mit den Effekten in einer Patientengruppe verglichen, die an keinem der Programme teilnahm.
In einer selten abschließenden Art und Weise ("further trials are unlikely to overturn this result") kommen die AutorInnen zu dem Ergebnis, es gäbe ausreichende Evidenz dafür, dass Patienten mit einer Hüft- und besonders mit einer Kniegelenksarthrose durch die Teilnahme an den genannten Programmen einen signifikanten gesundheitlichen Nutzen gegenüber Patienten ohne ein solches Programm haben. Dabei tragen Übungen zum Muskelaufbau, der Förderung von Beweglichkeit und Aerobic-Training besonders zur Schmerzlinderung und Wiederherstellung von Beweglichkeit bei. Eine Kombination dieser Maßnahmen scheint den Nutzen zu erhöhen.
Anstatt weiter am Nutzen dieser Art von Maßnahmen zu zweifeln, sollte nach Ansicht der AutorInnen der Schwerpunkt weiterer Debatten darauf liegen, wie PatientInnen für sie zu gewinnen sind bzw. ihre "Angstschwelle" zu überwinden ist und wie sie diese dauerhaft in Anspruch nehmen. Dies gilt mit Sicherheit auch für die PatientInnen, die mit einem Diätprogramm starten wollen und es durchhalten wollen.
Der Aufsatz Effects of Intensive Diet and Exercise on Knee Joint Loads, Inflammation, and Clinical Outcomes Among Overweight and Obese Adults With Knee Osteoarthritis: The IDEA Randomized Clinical Trial von Stephen P. Messier et al. ist am 25. September 2013 in JAMA (310(12): 1263-1273) erschienen - ein Abstract ist frei erhältlich.
Der Review Exercise for lower limb osteoarthritis: systematic review incorporating trial sequential analysis and network meta-analysis von Olalekan A Uthman et al. erschien am 20. September 2013 in der Fachzeitschrift BMJ {347: f5555) und ist komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 16.12.13
Fördert der Hinweis "Rauchen kann tödlich sein" auf Dauer den Verkauf oder stärken Warnhinweise die Produkt-Vertrauenswürdigkeit?
 Ohne damit die aktuellen Versuche der Tabakwarenindustrie rechtfertigen zu wollen, das Vergrößern und Verschärfen von Warnhinweisen à la Australien auf Zigarettenpackungen in der EU zu verhindern, lohnt es sich, über die Wirkungen drastischer Darstellungen der Folgen des Rauchens genau nachzudenken.
Ohne damit die aktuellen Versuche der Tabakwarenindustrie rechtfertigen zu wollen, das Vergrößern und Verschärfen von Warnhinweisen à la Australien auf Zigarettenpackungen in der EU zu verhindern, lohnt es sich, über die Wirkungen drastischer Darstellungen der Folgen des Rauchens genau nachzudenken.
Mehrere Studien haben gezeigt, dass solche Hinweise allein nicht die gewünschte Wirkung zeigen, dass insbesondere junge Menschen mit dem Rauchen aufhören (z.B. die zwischen 2008 und 2011 in Großbritannien durchgeführte und 2013 in der Zeitschrift "Tobacco Control" veröffentlichte Studie Adolescents' response to pictorial warnings on the reverse panel of cigarette packs: a repeat cross-sectional study oder gar nicht damit beginnen.
Dass solche Hinweise aber sogar genau die gegenteilige Wirkung erzielen können, nämlich einen vermehrten Konsum der Produkte mit als abschreckend gedachtem Hinweis, ist das Ergebnis einer kleinen experimentellen und kontrollierten Studie von Psychologen aus Singpore, Tel Aviv und New York.
Dazu bildeten die Wissenschaftler zwei Gruppen, denen sie entweder Zigaretten-, Süßstoff-, Haarwuchsmittel- und Potenzmittelpackungen mit oder ohne jeweils spezifische Warnhinweise vorstellten.
Unmittelbar nach dieser Vorstellung sollten die Testpersonen sich für den Kauf eines dieser Produkte entscheiden. Erwartungsgemäß kauften die Personen, die eine Packung mit Warnhinweisen gezeigt bekommen hatten, wesentlich seltener eines dieser Produkte als jene, die keinen Warnhinweis gesehen hatten.
Sollten die Studienteilnehmer zwei Wochen oder 3 Monate nach dem Erstkontakt mit der Verpackung eines dieser Mittel, es kaufen oder nicht, fanden die Forscher einen "ironic effect" der Warnhinweise. Die Testpersonen, die eine Packung gesehen hatten auf der neben dem möglichen Nutzen auch deutliche Warnhinweise standen, kauften sie häufiger als ihre Vergleichspersonen, die nur Packungen mit Beschreibungen des Nutzens ihres Inhalts gesehen hatten.
Die Psychologen erklären dies vor allem damit, dass mit der zeitlichen Distanz die zusätzliche Erwähnung von Risiken und Nebenwirkungen als Beleg für die Glaubwürdigkeit des Anbieters oder in den Worten der Forscher als "an indication of the firm's honesty and trustworthiness" gesehen wird.
Auch wenn diese Ergebnisse und die dahinter stehenden Beweggründe in weiteren Untersuchungen erhärtet werden müssen, sollte niemand glauben, dass mit noch so drastischen und größeren Hinweisen (in Australien und evtl. auch bald in der EU müssen 75% der Oberfläche mit Warnhinweisen bedeckt sein) allein die gewünschten Wirkungen zu erzielen sind.
Die Studie Warnings of Adverse Side Effects Can Backfire Over Time von Yael Steinhart et al. ist in der Septemberausgabe 2013 der Zeitschrift "Psychological Science" (vol. 24 no. 9 1842-1847) erschienen. Ein Abstract ist kostenlos erhältlich. Die Warnhinweise sind frei zugänglich.
Bernard Braun, 4.10.13
Wieder-Rauchen als Prävention? Mäßige Gewichtszunahme nach Rauchstopp erhöht das Risiko kardiovaskulärer Erkrankungen nicht.
 Ex-Raucher und Wieder-Raucher kennen das Problem: Kurz nachdem sie mit dem Rauchen aufhörten, stieg ihr Körpergewicht unabhängig vom schon zuvor vorhandenen Gewicht für eine Weile an. Dieser Anstieg konnte durchaus zweistellige Kilo-Werte erreichen, von denen herunterzukommen nicht oder nur schwer gelang. Spätestens dann erinnern sich manche daran, dass auch ein höheres Gewicht kardiovaskuläre Erkrankungen mitbedingen kann, das man gerade durch die Beendigung des Rauchens zu vermeiden oder abzusenken trachtete. Und für manche entzugsgeplagte Ex-Raucher ist dies der willkommene "gesundheitliche" Grund doch lieber wieder mit dem Rauchen "einiger Zigaretten" zu beginnen.
Ex-Raucher und Wieder-Raucher kennen das Problem: Kurz nachdem sie mit dem Rauchen aufhörten, stieg ihr Körpergewicht unabhängig vom schon zuvor vorhandenen Gewicht für eine Weile an. Dieser Anstieg konnte durchaus zweistellige Kilo-Werte erreichen, von denen herunterzukommen nicht oder nur schwer gelang. Spätestens dann erinnern sich manche daran, dass auch ein höheres Gewicht kardiovaskuläre Erkrankungen mitbedingen kann, das man gerade durch die Beendigung des Rauchens zu vermeiden oder abzusenken trachtete. Und für manche entzugsgeplagte Ex-Raucher ist dies der willkommene "gesundheitliche" Grund doch lieber wieder mit dem Rauchen "einiger Zigaretten" zu beginnen.
Die Ergebnisse einer am 13. März 2013 in der Medizin-Fachzeitschrift JAMA veröffentlichten Studie mit einer 3.251 Erwachsene umfassenden Kohorte aus der "Framingham Heart Study" (durchschnittlich 48 Jahre alt und einem BMI von 26) entzieht dieser Entschuldigung den sachlichen Boden.
Die StudienteilnehmerInnen wurden über einen durchschnittlichen Zeitraum von 25 Jahren alle vier Jahre umfassenden auf ihren kardiovaskulären Zustand und die Existenz potenzieller Risikofaktoren für derartige Erkrankungen untersucht.
Danach sank die Prävalenz der Raucher von 31% auf 13%. Zugleich gab es 631 kardiovaskuläre Ereignisse. Während eines 4-Jahreszyklus der Untersuchung nahmen die TeilnehmerInnen, die mit dem Rauchen aufhörten signifikant um 2,7 Kilogramm (Median) zu. Raucher nahmen im selben Zeitraum um 0,9 kg und Niemals-Raucher um 1,4 kg zu. Nach der Adjustierung nach Alter, Geschlecht und Herz-/Kreislauf-Risiokofaktoren war die Inzidenz unerwünschter kardiovaskulärer Ereignisse bei den Personen, die gerade mit dem Rauchen aufgehört hatten und den Personen, die nie geraucht hatten signifikant geringer als bei den Rauchern. Ex- und Niemals-Raucher hatten ein um 51% und 69% niedrigeres relatives Erkrankungsrisiko. Letzteres zeigt nach Meinung der Forschergruppe auch sehr konkret, dass der Verzicht auf Tabakrauchen in relativer kurzer Zeit quantitativ relevante erwünschte gesundheitliche Wirkungen hat.
Sofern also die Gewichtszunahme mäßig ausfällt überwiegt der Nutzen des Verzichts aufs Rauchen bei weitem den Nachteil der Gewichtszunahme und rechtfertigt nicht einen Neustart des Raucherdaseins. Zugleich darf der positive Effekt der Tabakabstinenz aber trotzdem nicht blind gegenüber den Risiken einer wesentlich höheren und vor allem dauerhaften Gewichtszunahme machen. Ab welchem post-nikotinären Übergewicht dessen kardiovaskuläres Risiko höher als das aus Zigaretten ist, sagt nämlich die JAMA-Studie nicht.
Den von Clair C et al. verfassten Aufsatz Association of smoking cessation and weight change with cardiovascular disease among adults with and without diabetes. in JAMA (309: 1014-21) gibt es komplett kostenlos.
Bernard Braun, 30.3.13
Mehrstufiges Rauchverbot in Belgien ist auch mit mehrstufigem Rückgang der Häufigkeit von Frühgeburten assoziiert.
 In einigen europäischen Ländern wird über die Lockerung der strengen Rauchverbote in öffentlichen Räumen und besonders in Restaurants nachgedacht, die Kontrolle der Lokale mit Raucherräumen wird oft lasch betrieben, die Abdichtung zwischen Raucher- und Nichtraucherzonen ist oft unwirksam oder die Nichtraucherbereiche werden nicht systematisch zum Schutz vor den immer noch unterschätzten Gesundheitsgefahren durch Passivrauchen ausgedehnt.
In einigen europäischen Ländern wird über die Lockerung der strengen Rauchverbote in öffentlichen Räumen und besonders in Restaurants nachgedacht, die Kontrolle der Lokale mit Raucherräumen wird oft lasch betrieben, die Abdichtung zwischen Raucher- und Nichtraucherzonen ist oft unwirksam oder die Nichtraucherbereiche werden nicht systematisch zum Schutz vor den immer noch unterschätzten Gesundheitsgefahren durch Passivrauchen ausgedehnt.
Gleichzeitig werden immer häufiger Untersuchungen zur Entwicklung von tabakassoziierten Erkrankungen und Schädigungen (z.B. Herz-/Kreislauferkrankungen) von vor und nach dem Rauchverbot veröffentlicht, die praktisch durchweg und nach kürzester Zeit positive Effekte belegen.
Die neueste Studie aus Belgien über den Verlauf von mehr als 606.000 Schwangerschaften und Geburten zwischen der 24. und 44. Schwangerschaftswoche im Zeitraum von 2002 und 2011, zeigt eine deutliche Assoziation zwischen der etappenweisen Einführung von Rauchverboten in verschiedenen Lokalitäten und der Häufigkeit von Frühgeburten. In einem ersten Anlauf wurde in Belgien im Januar 2006 das Rauchen in allen öffentlichen Orten und den meisten Arbeitsplätzen verboten. Im zweiten Anlauf wurde das Verbot im Januar 2007 auf Restaurants ausgedehnt und im dritten Anlauf im Januar 2010 wurden auch die Bars mit Essangeboten rauchfreie Zonen.
Die vor dem ersten Rauchverbot existierende Häufigkeit von spontanen Frühgeburten vor der 37. Schwangerschaftswoche lag nahezu konstant bei rund 7,4%. Die Rate sank nach jedem der drei Rauchverbotsinterventionen kräftig ab, insbesondere nach den Rauchverboten in Restaurants und Bars. Sie lag 2012 bei rund 6,7%. Die gesamte Abnahme der spontanen Frühgeburten in den fünf Jahren ab 2007 lässt sich auch als eine Reduktion um 6 Frühgeburten auf 1.000 Geburten ausdrücken.
Auch wenn die ForscherInnen einräumen, ihre Studie könne methodisch nicht die Kausalität von Passivrauchen der Mutter und ihres ungeborenen Kindes und dem Risiko einer Frühgeburt nachweisen, halten sie die Assoziation für zwingend. Die beobachteten Veränderungen lassen sich auch nicht als Einflüsse durch andere potenziell denkbare Bedingungen (z.B. Umweltverschmutzung oder Grippeepidemien) erklären.
Der am 14. Februar 2013 im "British Medical Journal (BMJ)" (346: f441) veröffentlichte Aufsatz Impact of a stepwise introduction of smoke-free legislation on the rate of preterm births: Analysis of routinely collected birth data. von Cox B et al. ist komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 11.3.13
Ein Hauch von Sisyphos: Vitamin C verhindert Erkältungen nicht und hat bescheidene Wirkungen auf ihre Dauer und Schwere.
 Wenn es nach den Herstellern von Vitamin C-Kapseln und zahllosen Gesundheitsfibeln wie Ratgeberseiten ginge, würden wir alle "für alle Fälle" im gesamten Winterhalbjahr zur Verhinderung von Erkältungen oder der Abkürzung von Dauer und Schwere ihrer Symptome Ascorbinsäure in allen natürlichen oder industriellen Formen oder Zubereitungen zu uns nehmen. Ob das wirklich hilft ist aber seit über 70 Jahren umstritten.
Wenn es nach den Herstellern von Vitamin C-Kapseln und zahllosen Gesundheitsfibeln wie Ratgeberseiten ginge, würden wir alle "für alle Fälle" im gesamten Winterhalbjahr zur Verhinderung von Erkältungen oder der Abkürzung von Dauer und Schwere ihrer Symptome Ascorbinsäure in allen natürlichen oder industriellen Formen oder Zubereitungen zu uns nehmen. Ob das wirklich hilft ist aber seit über 70 Jahren umstritten.
Um hier mehr Klarheit zu schaffen, durchkämmte eine Cochrane-Reviewergruppe jetzt alle Studien der letzten Jahrzehnte, in denen täglich mehr als 200 Milligramm Vitamin C aufgenommen wurden und in denen eine Kontrollgruppe ein Placebo eingenommen hatte. Die meisten Studien waren auch randomisiert und doppel-blind. In den Review gingen dann 29 Studien mit 11.306 TeilnehmerInnen ein.
Die Ergebnisse sahen so aus:
• Das relative Risiko, eine Erkältung zu bekommen, unterschied sich zwischen denjenigen, die Vitamin C oder ein Placebo zu sich nahmen bei den der Durchschnittsbevölkerung zuzurechnenden 10.708 TeilnehmerInnen nicht (RR=0,97).
• Anders war dies nur bei den 598 TeilnehmerInnen in 5 Studien, die Marathonläufer waren oder Skiläufer und Soldaten, deren Tätigkeit oder sportliche Betätigung kurzfristig unter schwersten klimatischen Bedingungen stattfand. Das relative Risiko eine Erkältung zu bekommen war für diesen Personenkreis deutlich geringer, wenn Vitamin C eingenommen wurde (RR=0,48).
• Die Dauer der Erkältung reduzierte sich bei Erwachsenen unter Vitamin C-Aufnahme um 8%, die von Kindern um 14%. Wenn Kinder zwischen 1 und 2 Gramm pro Tag an Vitamin C aufnahmen, sank die Erkrankungsdauer um 18%.
• Nachweisbare und signifikante Wirkungen von Vitamin C gibt es auch auf die Ernsthaftigkeit der Erkältungssymptome. Die Reviewer schränken dies aber mit dem Hinweis "it is modest in absolute terms" deutlich ein.
• Die therapeutischen Studien, d.h. Studien in denen nach Beginn einer Erkältung versucht wird, mittels hoher und sehr hohen Vitamin C-Dosen die Dauer und Schwere der Erkältung zu beeinflussen, "showed no consistent effect" auf beide Zielgrößen. Hier ist auf jeden Fall vor einer uneingeschränkten Empfehlungen z.B. 8 Gramm Vitamin C pro Tag aufzunehmen weitere Forschung notwendig.
• Etwas Gutes zum Schluss: In keiner Studie wurde über unerwünschte Nebenwirkungen der Vitamin C-Ein- oder Aufnahme berichtet.
Die Bewertung der Einnahme von Vitamin C zur Verhinderung von Erkältung ist eindeutig: "Routine vitamin C supplementation is not justified". Trotz teilweise geringen und auch nicht eindeutig zu replizierenden Wirkungen bewerten die Cochrane-Reviewer die Einnahme von Vitamin C zur Beeinflussung von Dauer und Schwere einer eingetretenen Erkältung etwas weniger ablehnend: "It may be worthwhile for common cold patients to test on an individual basis whether therapeutic vitamin C is beneficial for them."
Auch hier gilt natürlich, dass Orangen, Paprika oder andere Vitamin C-Träger aus vielen anderen und guten Gründen weiter verzehrt werden sollten - nur eben nicht mit der Erwartung Erkältungskrankheiten verhindern oder uneingeschränkt zu beeinflussen können.
Von dem am 31. Januar 2013 veröffentlichten Cochrane-Review Vitamin C for preventing and treating the common cold von Hemilä H. und Chalker E. gibt es kostenlos das gewohnt umfangreiche Abstract.
Wer Materialien für ein Lehrstück zur geringen Geschwindigkeit der Verbreitung und Translation wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Praxis sucht, wird auch beim Vitamin C fündig.
So gab es bereits innerhalb des letzten Jahrzehnts mehrere ähnlich lautende Ergebnisse verschiedener methodisch hochwertiger Reviews und Metaanalysen, die bisher offensichtlich kaum erkennbare Wirkungen auf die Werbung für die präventive und therapeutische Aufnahme von Vitamin C und natürlich auf deren wirkliche Aufnahme erzielten.
Zum Beispiel schrieb einer der Autoren des aktuellen Cochrane-Reviews, Hemilä, zusammen mit einem anderen Autoren bereits 2005 u.a.: "The lack of effect of prophylactic vitamin C supplementation on the incidence of common cold in normal populations throws doubt on the utility of this wide practice. The clinical significance of the minor reduction in duration of common cold episodes experienced during prophylaxis is questionable, although the consistency of these findings points to a genuine biological effect. In special circumstances, where people used prophylaxis prior to extreme physical exertion and/or exposure to significant cold stress, the collective evidence indicates that vitamin C supplementation may have a considerable beneficial effect." Der komplette Text dieses Aufsatzes Vitamin C for preventing and treating the common cold. von Douglas RM und Hemilä H ist 2005 in der Open Access-Zeitschrift PLoS Medicine (2(6): e168) erschienen und kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 21.2.13
"Frauen, die wie Männer rauchen sterben auch wie Männer" - 50-Jahre-Trends der nikotinassoziierten Sterblichkeit nach Geschlecht
 Die zahlreichen Berichte über den Zusammenhang von Zigarettenrauchen mit diversen schweren Erkrankungen oder auch mit einer erhöhten Sterblichkeit, die plakativen Hinweise auf diese Zusammenhänge auf Zigarettenpackungen sowie die in einigen Verfahren vor US-Gerichten bekannt gewordenen vorsätzlich gesundheitsgefährdenden Vermarktungsstrategien der Tabakindustrie haben insbesondere in Westeuropa und den USA einen Teil der RaucherInnen aufhören lassen.
Die zahlreichen Berichte über den Zusammenhang von Zigarettenrauchen mit diversen schweren Erkrankungen oder auch mit einer erhöhten Sterblichkeit, die plakativen Hinweise auf diese Zusammenhänge auf Zigarettenpackungen sowie die in einigen Verfahren vor US-Gerichten bekannt gewordenen vorsätzlich gesundheitsgefährdenden Vermarktungsstrategien der Tabakindustrie haben insbesondere in Westeuropa und den USA einen Teil der RaucherInnen aufhören lassen.
Bei denjenigen, die nicht zu rauchen aufhören spielen falsche oder unklare Annahmen über die Entwicklung des Risikos, Fehleinschätzungen über die Risikoreduktion durch den Verzicht auf Rauchen und auch schlichtweg fehlende Daten eine Rolle.
Eine jetzt für die USA durchgeführte Analyse der Mortalitätstrends für bevölkerungsrepräsentative RaucherInnen, die in den Jahren 1959-1965, 1982-1988 und 2000-2010 bei einem Follow-up 55 Jahre und älter geworden waren, liefert wichtige Daten für eine Entscheidung mit dem Rauchen aufzuhören.
Die wichtigsten Erkenntnisse der ForscherInnen lauten:
• Das relative Risiko von aktuell rauchenden Frauen an Lungenkrebs zu sterben nahm in den drei untersuchten Zeiträumen und im Vergleich mit Frauen, die nie rauchten stetig zu, und zwar von 2,73 über 12,65 auf 25,66.
• Anders als manchmal vermutet gleicht sich das Lungensterblichkeitsrisiko der rauchenden Frauen innerhalb des Untersuchungszeitraums dem der rauchenden Männer an. Deren relatives Risiko nahm von 12,22 über 23,81 auf 24,97 zu.
• In der zuletzt untersuchten Kohorte der Jahre 2000 bis 2010 ähnelten sich auch die geschlechtsspezifischen Sterberisiken der Raucher für COPD (25,61 für Männer und 22,35 für Frauen), ischämische Herzerkrankung (2,50/2,86), jegliche Form von Schlaganfall (1,92/2,1) und die Kombination aller Sterbeursachen (2,8/2,76).
• Die Sterblichkeit an der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) stieg bei männlichen Rauchern in den letzten Kohorten nahezu in allen Altersgruppen und innerhalb aller Dauerklassen sowie bei allen Intensitäten des Rauchens weiter an. Dies ist auch deshalb von großer Bedeutung weil dieses Risiko bei den Nie-Rauchern gleichzeitig deutlich gesunken ist.
• Bei den Männern im Alter von 55 bis 74 Jahren und den Frauen zwischen 60 und 74 Jahren war die Gesamtsterblichkeit wenigstens drei Mal so hoch wie bei den gleichaltrigen Nie-Rauchern.
• Aufzuhören mit dem Rauchen "at any age dramatically reduced death rates." Wer vor dem vierzigsten Lebensjahr aufhört, baut die erhöhten Sterblichkeitsrisiken im weiteren Lebensverlauf ständig und am Ende fast völlig ab. Diese Untersuchung bestätigt außerdem, dass das vollständige Aufhören mit Rauchen wesentlich wirksamer für die Reduktion von Risiken ist als eine Reduktion der Anzahl von Zigaretten. Um nicht als Plädoyer für risikofreies "Rauchen bis 40" missverstanden zu werden, merkt einer der Studienautoren an: "That's not to say; however, that it is safe to smoke until you are 40 and then stop. Former smokers still have a greater risk of dying sooner than people who never smoked. But the risk is small compared to the huge risk for those who continue to smoke."
Auch wenn diese Studie anders als die bisherigen RaucherInnenstudien (z.B. eine Untersuchung der RaucherInnen unter Pflegekräften) nicht nur relativ gesunde TeilnehmerInnen untersucht, räumen auch ihre VerfasserInnen ein, dass erst in künftigen Studien das Rauchverhalten und die Erkrankungs- wie Sterblichkeitsrisiken jüngerer Personen untersucht werden müsste.
Der materialreiche Aufsatz "50-Year Trends in Smoking-Related Mortality in the United States" von Michael J. Thun et al. ist am 24. Januar 2013 im "New England Journal of Medicine" (368: 351-36) erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 5.2.13
Auch "Halbgötter oder -engel in weiß und grün" sind Menschen: Gesundheitsverhalten und Lebensstil von Ärzten und Pflegekräften
 Wer regelmäßig Kontakt zu ÄrztInnen oder anderen im Gesundheitswesen Tätigen hat, konnte schon immer über einzelne "leuchtende Vorbilder" von rauchenden, übergewichtigen oder bewegungsfaulen Vertretern dieser Berufe berichten. Einzelne Studien haben ferner gezeigt, dass viele Ärzte weder selber bestimmte Untersuchungen oder Behandlungen in Anspruch nehmen noch eine Inanspruchnahme ihren Angehörigen empfehlen würden, die sie ihren PatientInnen mit geballter Fachautorität empfehlen.
Wer regelmäßig Kontakt zu ÄrztInnen oder anderen im Gesundheitswesen Tätigen hat, konnte schon immer über einzelne "leuchtende Vorbilder" von rauchenden, übergewichtigen oder bewegungsfaulen Vertretern dieser Berufe berichten. Einzelne Studien haben ferner gezeigt, dass viele Ärzte weder selber bestimmte Untersuchungen oder Behandlungen in Anspruch nehmen noch eine Inanspruchnahme ihren Angehörigen empfehlen würden, die sie ihren PatientInnen mit geballter Fachautorität empfehlen.
Eine repräsentative Umfrage der US-amerikanischen "Center for Disease Control and Prevention (CDC)" zu "healthcare and lifestyle practices of healthcare workers" zeigt nun, dass es sich dabei nicht um Einzelfälle, sondern um zum Teil um mehrheitliche Verhaltensweisen handelt.
Im Rahmen eines jährlich im Rahmen des "The Behavorial Risk Factor Surveillance System (BRFSS)" telefonisch durchgeführten Surveys wurden 2008 und 2010 insgesamt 260.558 Erwachsene zu ihrem Gesundheitsverhalten und ihrem Lebensstil befragt, darunter 21.380 so genannte "healthcare workers", also vor allem Ärzte und Pflegekräfte.
Die wichtigsten Ergebnisse:
• Standardisiert nach Alter, Geschlecht, Ethnie, Ausbildung, Region, Einkommen und Beschäftigungsstatus gaben die Angehörigen von Gesundheitsberufen im Vergleich zum Rest der Bevölkerung nur für einige gesundheitlich wünschenswerte Verhaltensweisen häufiger an, sich dementsprechend zu verhalten. So war bei den Gesundheitsberufen die Wahrscheinlichkeit, einen Hausarzt zu haben, rund 24% höher, die eines Gesundheitschecks in den letzten 2 Jahren um 12% höher, die von körperlichen Aktivitäten bzw. Sport in den letzten 30 Tagen um 17% höher und die Weigerung innerhalb des letzten Monats erheblich zu viel Alkohol zu trinken um 24% höher. Sämtliche dieser Unterschiede waren statistisch signifikant.
• Keinen statistisch signifikanten Unterschied zwischen Ärzten etc. und Nicht-Ärzten oder Pflegekräften gab es dagegen in einer Vielzahl von in Anspruch genommenen Gesundheitsuntersuchungen oder gesundheitsbezogenen Verhaltensweisen. Dies gilt z.B. für die Wahrscheinlichkeit eines regelmäßigen Tests auf Gebärmutterhalskrebs, regelmäßiger Zahnarztbesuche, der Durchführung einer Kolonoskopie oder anderer Untersuchungen des Darms. Angehörige von Gesundheitsberufen unterschieden sich außerdem auch nicht signifikant vom Rest der Bevölkerung beim Übergewicht oder der Fettleibigkeit, beim Autofahren unter Alkoholeinfluss, beim Anlegen des Sicherheitsgurts, Rauchen, regelmäßigen Alkoholgenuss, der Lebenszufriedenheit oder bei übermäßigen Sonnenbädern mit Sonnenbrand.
• Negativ unterschieden sich nur weibliche Gesundheitsbeschäftigte über 50 Jahre vom Rest der gleichaltrigen Bevölkerung bei der regelmäßigen Inanspruchnahme von Mammographien. Die Wahrscheinlichkeit dies nicht zu machen war um 13% höher.
Eine Schwachstelle der Ergebnisse könnte nach Ansicht der Verfasser die sein, dass es sich um selbst berichtete Aktivitäten handelt, die nicht "objektiviert" wurden.
Und natürlich handelt es sich um Ergebnisse von amerikanischen ÄrztInnen, Pflegekräften und BürgerInnen, die vor einer Replikation dieser Befragung bei deutschen ÄrztInnen natürlich "völlig anders"="besser" aussehen.
Der kurze "research letter" "Healthcare and Lifestyle Practices of Healthcare Workers: Do Healthcare Workers Practice What They Preach?" von Benjamin K. I. Helfand und Kenneth J. Mukamal ist am 17. Dezember 2012 "online first" in der Zeitschrift "Archives of Internal Medicine" erschienen und noch komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 23.1.13
Warnhinweis "Rauchen verursacht tödlichen Lungenkrebs" wirkt mit Tumorbild besser und mindert Kommunikationsungleichheit
 Während in Deutschland und Europa noch darüber diskutiert und daran gearbeitet wird, die Texte größer zu machen, die auf Zigarettenschachteln vor den gesundheitlichen Risiken des Rauchens warnen, zeigt eine am 14. Januar 2013 veröffentlichte Studie der Harvard School of Public Health aus den USA, dass Text allein vor allem bei bestimmten Risikogruppen wahrscheinlich nicht wirksam genug ist.
Während in Deutschland und Europa noch darüber diskutiert und daran gearbeitet wird, die Texte größer zu machen, die auf Zigarettenschachteln vor den gesundheitlichen Risiken des Rauchens warnen, zeigt eine am 14. Januar 2013 veröffentlichte Studie der Harvard School of Public Health aus den USA, dass Text allein vor allem bei bestimmten Risikogruppen wahrscheinlich nicht wirksam genug ist.
In einer web-basierten experimentellen Studie mit 3.371 erwachsenen RaucherInnen wurde diesen entweder die klassischen Textversionen der Warnungen ("Rauchen kann tödlich sein") oder Warnhinweise gezeigt, in deren Mittelpunkt drastische bildliche Darstellungen der möglichen Folgen von Rauchen standen.
Zu den wichtigsten Ergebnissen gehörten u.a.
• die signifikant höhere Glaubwürdigkeit der Bild-Hinweise (OR=1,41) und die bei den Betrachtern der grafischen Darstellung signifikant stärkere Absicht mit dem Rauchen aufzuhören (OR=1,30).
• Die Bestätigung einer sozialen Ungleichheit bei den Kommunikationsfähigkeiten, d.h. der Fähigkeit Informationen aufzunehmen und zu kommunizieren. Die Studie zeigt, dass es sich dabei um kein unvermeidliches Problem handelt. Sie belegt nämlich die wesentlich höhere Wirkung, die Bildbotschaften bei Nicht-Weißen oder Angehörigen unterer sozialer Schichten haben - also den Personengruppen, die meist überdurchschnittlich viel rauchen.
Die ForscherInnen kommen daher zu dem Schluss, dass bildliche Darstellungen der Risiken des Rauchens "may be one of the few tobacco control policies that have the potential to reduce communication inequalities across groups. As most smoking is now among low SES populations, the effectiveness of pictorial HWLs in these groups suggests an opening for effective strategies to communicate risk and promote cessation. Policies that establish strong pictorial HWLs on tobacco packaging may be instrumental in reducing the toll of the tobacco epidemic, particularly within vulnerable communities."
Die Studie "Impact of Tobacco-Related Health Warning Labels across Socioeconomic, Race and Ethnic Groups: Results from a Randomized Web-Based Experiment." von Cantrell J, Vallone DM, Thrasher JF, Nagler RH, Feirman SP, et al. ist in der Open access-Fachzeitschrift "PLoS ONE) (8(1)) erschienen und komplett kostenlos erhältlich. Im Text sind auch die im Experiment benutzten schonungslosen bildlichen Darstellungen dokumentiert.
Bernard Braun, 18.1.13
"Schluss mit dem Rauchen" - aber wie am besten und wirkungsvollsten?
 Gute Vorsätze sind mit dem Jahresende aufs Engste verbunden. Ein nicht seltener Vorsatz ist, "im nächsten Jahr" mit dem Rauchen aufzuhören. Eine praktische Frage ist dann, ob man die letzte Zigarette zusammen mit dem Silvesterfeuerwerk "genießt" oder die Tagesration Zigarette um Zigarette oder Pfeifenkopf um Pfeifenkopf bis Ostern verringert und am Karfreitag nikotinfrei zu leben beginnt. Viele Experten glauben, die zweite Methode sei der Beginn des Scheiterns des guten Vorsatzes. Andere Experten glauben dagegen, der plötzliche Nikotinentzug hätte nicht nur ebenso abrupt erwünschte wie unerwünschte Folgen, sondern berge häufig die Gefahr des Rückfalls in sich. Und weil das alles unklar ist und sowieso in beiden Varianten bald weitergeraucht werde, fangen viele Raucher gleich gar nicht mit dem Aufhören an.
Gute Vorsätze sind mit dem Jahresende aufs Engste verbunden. Ein nicht seltener Vorsatz ist, "im nächsten Jahr" mit dem Rauchen aufzuhören. Eine praktische Frage ist dann, ob man die letzte Zigarette zusammen mit dem Silvesterfeuerwerk "genießt" oder die Tagesration Zigarette um Zigarette oder Pfeifenkopf um Pfeifenkopf bis Ostern verringert und am Karfreitag nikotinfrei zu leben beginnt. Viele Experten glauben, die zweite Methode sei der Beginn des Scheiterns des guten Vorsatzes. Andere Experten glauben dagegen, der plötzliche Nikotinentzug hätte nicht nur ebenso abrupt erwünschte wie unerwünschte Folgen, sondern berge häufig die Gefahr des Rückfalls in sich. Und weil das alles unklar ist und sowieso in beiden Varianten bald weitergeraucht werde, fangen viele Raucher gleich gar nicht mit dem Aufhören an.
Eine Entscheidungshilfe könnte ein jetzt von der Cochrane Tobacco Addiction Review Group veröffentlichter Cochrane-Review darstellen, der u.a. untersuchte, was randomisierte kontrollierte Studien über den Erfolg beider Methoden bei aufhörwilligen Erwachsenen sagen. Als erfolgreich gelten Maßnahmen, nach denen die TeilnehmerInnen der Studien sechs Monate nach dem Aufhören noch abstinent waren. Außerdem verglich ein Teil der Studien die unerwünschten Wirkungen beider Methoden und ob und wie hilfreich dabei Arzneimittel sind.
Der Review und die Metaanalyse stützten sich auf 10 Studien mit 3.760 TeilnehmerInnen. In drei Studien waren Arzneimittel Teil der Intervention. 5 Studien stellten den TeilnehmerInnen zusätzliche Verhaltenshilfen zur Verfügung und vier schlossen Selbsthilfe-Therapien ein.
Die wichtigsten Ergebnisse lauteten:
• Alles in Allem war keine der beiden Methoden, also Abrupt- und Peu à peu-Methode, bei der Abstinenzrate gegenüber der anderen absolut überlegen, d.h. die Erfolgsraten waren ähnlich und die Unterschiede statistisch nicht signifikant (RR=0,94, 95% CI=0,79 bis 1,13).
• Auch zwischen den Therapien mit oder ohne Arzneimittelunterstützung gab es keine signifikanten Unterschiede bei der Abstinenzrate (RR= 0.87, 95% CI= 0.65 to 1.22).
• Schließlich unterscheidet sich auch der Erfolg der guten Vorsätze nicht zwischen Therapien mit oder ohne Verhaltensunterstützung (RR= 0.87, 95% CI= 0.64 to 1.17) oder mit oder ohne integrierte Selbsthilfe-Therapie (RR= 0.98, 95% CI= 0.78 to1.23).
• Die Reviewer sahen sich außerstande klare Erkenntnisse über die Art und den Grad unerwünschter Begleitumstände des Nikotinentzugs zu gewinnen. Einige der Studien zeigen aber, dass Nikotinersatztherapien (z.B. durch Nikotinpflaster) zu Beginn des Aufhörens die Wahrscheinlichkeit von Entzugserscheinungen nicht erhöhen.
• Für die Konzeption von Entwöhnungsprogrammen muss aber u.a. noch genauer untersucht werden, welche Typen von Rauchern von welcher Methode des Aufhörens und unterstützender Interventionen am meistens profitieren.
Was in jedem Fall für einen Erfolg notwendig ist, ist die unbedingte Festigkeit des Vorsatzes Aufzuhören für mehrere Monate und über eine Menge von physiologischen (z.B. wirken bestimmte nikotinaffine Mechanismen im Hirn noch mehrere Monate nach dem Aufhören) und sozialen Rückfallanreize hinweg.
Zu dem 44 Seiten umfassenden Cochrane-Review "Reduction versus abrupt cessation in smokers who want to quit." von Lindson-Hawley N, Aveyard P und Hughes JR. (Cochrane Database Syst Rev. 2012 Nov 14) gibt es das wie gewohnt umfangreiche Abstract kostenlos.
Bernard Braun, 25.12.12
Auch wer nur noch "ein paar Zigaretten zum Abgewöhnen" raucht hat ein hohes gesundheitliches Risiko für plötzlichen Herztod.
 Wenige prospektive Studien mit wirklich langen Beobachtungszeiten haben bisher die Assoziationen der Menge gerauchter Zigaretten mit dem Risiko des plötzlichen Herztodes untersucht.
Wenige prospektive Studien mit wirklich langen Beobachtungszeiten haben bisher die Assoziationen der Menge gerauchter Zigaretten mit dem Risiko des plötzlichen Herztodes untersucht.
Mit einer speziellen Auswertung der so genannten "Nurses Health Study" in den USA, einer Studie mit 101.018 Frauen, die zu Beginn der Studie im Jahr 1980 weder an einer koronaren Herzkrankheit, noch an Schlaganfall oder Krebs gelitten hatten, erlaubt nach 30 Jahren Laufzeit Einblicke in mögliche Zusammenhänge.
Die Ergebnisse untermauern bereits bekannte, aber auch einige neuen Zusammenhänge:
• Verglichen mit Teilnehmerinnen, die niemals rauchten, hatten heute noch rauchende Personen unter Kontrolle mehrerer Risikofaktoren für koronare Herzerkrankungen das um das 2,44fache höhere signifikante Risiko eines plötzlichen Herztodes.
• Nach multivariaten Analysen war die Anzahl der täglich gerauchten Zigaretten und die Dauer des Rauchens hochsignifikant und linear mit dem Risiko des plötzlichen Herztodes assoziiert.
• Personen, die als leichte bis mäßige Raucher klassifiziert wurden (1-14 Zigaretten pro Tag), hatten gegenüber Nichtrauchern das 1,84fache Herztodrisiko. Wer dagegen 25 und mehr Zigaretten pro Tag rauchte, dessen Herztodrisiko war um das 3,3fache so hoch wie das der Nichtraucher.
• Jede 5 Jahre in denen Teilnehmerinnen rauchten, waren mit einem achtprozentigen Anstieg des hier untersuchten Sterberisikos assoziiert.
• Nach 20 Jahren war das Risiko von Ex-Rauchern mit dem vergleichbar, das Personen hatten, die niemals geraucht hatten.
Der Aufsatz "Smoking, Smoking Cessation and Risk of Sudden Cardiac Death in Women" von Roopinder K. Sandhu et al. ist am 11. Dezember 2012 vorab online als Beitrag in der Fachzeitschrift "Circulation: Arrhythmia & Electrophysiology" veröffentlicht worden. Ein Abstract ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 12.12.12
Präventive Wirkung von materiellen Anreizen für Schulklassen mit 11- bis 14-Jährigen nicht mit dem Rauchen anzufangen = Null!
 Angesichts der gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnisse über die gesundheitlichen Risiken des Tabakrauchens für Aktiv- und Passivraucher muss ein Schwerpunkt präventiver Interventionen sein, insbesondere Kinder und Heranwachsende vom Rauchen abzuhalten.
Angesichts der gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnisse über die gesundheitlichen Risiken des Tabakrauchens für Aktiv- und Passivraucher muss ein Schwerpunkt präventiver Interventionen sein, insbesondere Kinder und Heranwachsende vom Rauchen abzuhalten.
Da Kinder und Jugendliche oft aufgrund eines bestehenden oder vermuteten Gruppendrucks mit dem Rauchen beginnen, wurden und werden u.a. gruppenbezogene Interventionen und Anreize zum Nichtrauchen als sehr gut geeignete Präventionsmethoden angesehen. Hierzu zählen in verschiedenen Ländern Europas Aktionen eines so genannten "Smokefree Class Competition (SFC)". Dieses Programm arbeitet mit Anreizen an ganze Schulklassen von 11- bis 14-Jährigen, die sich verpflichten auch nach 6 Monaten rauchfrei zu sein. Wenn dies mindestens 90% gelingt, kommt die Klasse in eine Art Lotterie-Wettbewerb in dem zahlreiche Preise von geringem bis mittelmäßigem Wert gewonnen werden können.
Ob diese Art von Programmen aber wirklich wirksam sind, war wie bei vielen anderen präventiven Interventionen lange Zeit gar nicht bezweifelt und auch nicht untersucht worden.
Für einen systematischen Cochrane-Review und eine Meta-Analyse betrachteten eine Reihe von australischen WissenschaftlerInnen nun die Ergebnisse von 5 randomisierten kontrollierten Studien mit 6.362 TeilnehmerInnen, die beim Start der Studien nicht rauchten. 3.466 waren in der Interventionsgruppe, also der TeilnehmerInnen an einem SFC-Programm und 2.896 Heranwachsende stellten die Kontrollgruppe. Eine der Studien war keine SFC- und auch keine randomisierte Studie. Ihren erfolgreichen, d.h. rauchfrei gebliebenen TeilnehmerInnen winkten am Ende des einjährigen Studienzeitraums ebenfalls Belohnungen.
Die Ergebnisse der Studien fassen die Reviewer so zusammen:
• Nur die nicht-randomisierte Studie konnte im ersten Anlauf einen statistisch signifikanten Effekt melden. Nach einigen nootwendigen Adjustierungen gab es aber keine statistisch signifikanten Unterschiede der Risikoraten zwischen Interventions- und Kontrollgruppe mehr. Außerdem wies die Studie auch zahlreiche Verzerrungsmöglichkeiten auf, die ihre Ergebnisse generell fragwürdig erscheinen lassen.
• Drei andere, methodisch hochwertigere Studien mit 3.056 TeilnehmerInnen zeigten beim Gruppenvergleich keinerlei signifikanten Effekt der mit Anreizen operierenden Interventionen bei der Prävention des Rauchens (Risikorate RR 1,00, Konfidenzintervall von 0,84 bis 1,19).
• Die ForscherInnen sehen nur wenig belastbare Evidenz dafür, dass die TeilnehmerInnen sie hinters Licht geführt haben oder rauchende Mitschüler bedroht haben, dies nicht zu berichten.
Die ForscherInnen schlagen trotz ihrer für Interventionen, die mit materiellen Anreizen arbeiten, entmutigenden Erkenntnissen vor, zusätzlich die Wirkung derartiger Anreize auf Einzelpersonen zu überprüfen.
Von dem am 17. Oktober 2012 veröffentlichten Cochrane-Review "Incentives for preventing smoking in children and adolescents" von Johnston V, Liberato S und Thomas D. gibt es kostenlos nur das traditionell ausführliche Abstract.
Bernard Braun, 14.11.12
Wenn das "Beste" mehr Schlechtes als Gutes bringt. Unerwartete Effekte der Reduktion von Salz.
 Die gesundheitliche Bedeutung des Über- und Unterschreitens zahlreicher Körperwerte (z.B. Blutdruck, Blutzucker, Cholesterinspiegel, Body Mass Index) und die meist lehrmeisterlich verkündeten Annahmen über die Linearität der damit verbundenen Zu- oder Abnahme von gesundheitlichen Risiken, wird in immer mehr hochwertigen Untersuchungen relativiert und in Frage gestellt. Wie problematisch die meist nur in Konsenskonferenzen und oft unter dem Einfluss von Leistungsanbietern festgelegten exakten Grenzwerte bei den Blutdruckwerten und dem Cholesterinspiegel sind, ist mehrfach belegt worden. Ebenfalls gut belegt ist mittlerweile die Tatsache, dass entgegen den jahrzehntelangen in allen Übergewichts- und Adipositas-Gesundheitskampagnen propagierten Risiken des BMI-Anstiegs über 25, ein BMI bis zum Wert 29/30 sogar einen protektiven Nutzen gegenüber schweren Krankheitsrisiken und Mortalität hat (siehe dazu den gerade in der "Süddeutschen Zeitung" vom 3. November 2012 erschienenen ausgezeichneten Überblick "Dicke leben länger" von Christa Berndt) und Werte unter 25 auch keineswegs immer Positiveres bedeuten.
Die gesundheitliche Bedeutung des Über- und Unterschreitens zahlreicher Körperwerte (z.B. Blutdruck, Blutzucker, Cholesterinspiegel, Body Mass Index) und die meist lehrmeisterlich verkündeten Annahmen über die Linearität der damit verbundenen Zu- oder Abnahme von gesundheitlichen Risiken, wird in immer mehr hochwertigen Untersuchungen relativiert und in Frage gestellt. Wie problematisch die meist nur in Konsenskonferenzen und oft unter dem Einfluss von Leistungsanbietern festgelegten exakten Grenzwerte bei den Blutdruckwerten und dem Cholesterinspiegel sind, ist mehrfach belegt worden. Ebenfalls gut belegt ist mittlerweile die Tatsache, dass entgegen den jahrzehntelangen in allen Übergewichts- und Adipositas-Gesundheitskampagnen propagierten Risiken des BMI-Anstiegs über 25, ein BMI bis zum Wert 29/30 sogar einen protektiven Nutzen gegenüber schweren Krankheitsrisiken und Mortalität hat (siehe dazu den gerade in der "Süddeutschen Zeitung" vom 3. November 2012 erschienenen ausgezeichneten Überblick "Dicke leben länger" von Christa Berndt) und Werte unter 25 auch keineswegs immer Positiveres bedeuten.
Dafür warum das Vorliegen bestimmter Risikofaktoren bzw. das Überschreiten bestimmter Grenzwerte nicht zu den prognostizierten unerwünschten Folgen führen und warum das "mehr" oder "weniger" von bestimmten Werten nicht im Gleichschritt und zwangsläufig zu "mehr" oder "weniger" Gesundheit etc. führt, gibt es meist nur wenige evidenten Erklärungen und auch nur relativ wackelige Mußmaßungen. Was aber auch ohne weitere Erklärung deutlich wird, ist, wie brüchig und unangemessen das hinter solch platten Zusammenhangsannahmen stehende gesundheits-, krankheits- oder heilungsbezogenen Modell des Menschen als "Maschine" ist.
Das u.a. in der Prävention des kardiovaskulären Risikofaktors Bluthockdruck mit dem Motto "je weniger desto gesünder und risikoarm" weit verbreitete und rigide propagierte Rezept, den Salzkonsum so weit wie möglich einzuschränken , erweist sich durch die am 21. August 2012 veröffentlichten Ergebnisse eines systematischen Reviews und einer Metaanalyse von sechs großen randomisierten kontrollierten Studien mit 2.747 TeilnehmerInnen als äußerst fragwürdig. An den Studien hatten Erwachsene teilgenommen, die an Herzversagen litten und entweder normale Portionen Sodium bzw. Natrium (2,8 Gramm pro Tag) aufnahmen oder sich sodiumarm (1,8 Gramm pro Tag) ernährten. Dabei ist zu beachten, dass Sodium/Natrium chemisch nicht Koch-/Speisesalz bzw. Natriumchlorid identisch ist. Das bedeutet vor allem, dass 1 Gramm Kochsalz 400 mg Sodium entspricht. Das von verschiedenen Fachgesellschaften aktuell empfohlene Maximum der täglichen Aufnahme von Sodium liegt bei 2.3 Gramm was 5,75 Gramm Salz entspricht. Die aktuellen Empfehlungen von medizinischen Fachgesellschaften schwanken aber zwischen 1,5 Gramm und 5 Gramm pro Tag.
Als Endpunkte in der hier dargestellten Studie wurden bei den Angehörigen beider Gruppen die Gesamtsterblichkeit, das Auftreten eines plötzlichen Herztods bzw. eines Todes, der mit Herzschwäche assoziiert war und die (Wieder-)Einweisungen in Krankenhäuser dokumentiert, deren Anlass Herzversagen war.
Beim Vergleich der Personen, deren Salzaufnahme nicht verringert war, mit denen, die sich salzarm ernährten, sahen die Ergebnisse aller RCTs anders aus als erwartet wurde: die Angehörigen der salzarmen Gruppe hatten fast ausnahmslos statistisch signifikant höhere Risikoraten (risk ratio oder RR) als die Angehörigen der normal salzenden Gruppe. So war das Risiko der Gesamtsterblichkeit in der salzreduzierenden Gruppe um 95%, das des plötzlichen (Herz-)Todes um 72%, das des Tods durch Herzversagen um 123% und das der Wiedereinweisung in ein Krankenhaus mit einem Herzproblem um 110% höher (!!!) als bei normal salzenden Personen.
Die kritischen Kommentare zu den Ergebnissen dieses systematischen Reviews gaben zunächst auch nur an, sie hätten das Ergebnis nicht bzw. ein diametral anderes erwartet. Danach wiesen sie auf den Mangel an Informationen über die Flüssigkeitsaufnahme und die Einnahme wasserabführenden Medikamente bei den RCT-TeilnehmerInnen hin und deuten an, dass es sich bei dem Effekt um die Folgen von Flüssigkeitsmangel handeln könnte. Ein anderer Kommentator wünscht sich Vergleiche zwischen Personen mit noch wesentlich höherem und denjenigen mit reduziertem Salzkonsum. Die Stoßrichtung von Prävention ginge dann dahin, Lebensmittel mit sehr hohem Salzanteil zu meiden.
Wie schwierig, interessant und möglicherweise folgenlos der weitere praktische Umgang mit den Reviewergebnissen sein dürfte zeigen die Präsentationen und Diskussionen auf dem Workshop "Should we put the salt shaker down?", der am 26. August 2012 im Rahmen des europäischen Kardiologenkongresses in München stattfand. Auf der einen Seite stand die Beobachtung, dass "both clinicians and patients may be confused about recommendations", auf der anderen das Festhalten an den alten Empfehlungen.
Um nicht missverstanden zu werden: Die Ergebnisse des Reviews rechtfertigen keinwegs, ab sofort wieder ohne ein Gericht überhaupt zu kosten "für alle Fälle" nachzusalzen. Sie rechtfertigen aber sehr wohl, vor allzu hohen, uneingeschränkten oder linearen Erwartungen zu warnen, die mit dem sparsamen Einsatz des Salzstreuers verknüpft werden. Wer glaubt einseitig auf eine salzarme oder -freie Ernährungsweise als Allheilmittel gegen Bluthochdruck und kardiovaskuläre Erkrankungen setzen zu können, dürfte sich ebenfalls täuschen.
Von dem Aufsatz "Low sodium versus normal sodium diets in systolic heart failure: systematic review and meta-analysis." von Dinicolantonio JJ, Pasquale PD, Taylor RS, et al - am 21. August 2012 in der Fachzeitschrift "Heart"erschienen - gibt es kostenlos das Abstract.
Bernard Braun, 11.11.12
Vorsicht Patentrezept: 11 Jahre Life-Style-Veränderung (Ernährung und Bewegung) von Diabetikern ohne "harten" Erfolg
 11 Jahre nach seinem Start beendeten die US-"National Institutes of Health (NIH)" vorzeitig ein intensives Ernährungs- und Bewegungsprogramm zur Gewichtsabnahme von 5.145 übergewichtigen oder fettsüchtigen Erwachsenenen mit einer Typ 2-Diabeteserkrankung.
11 Jahre nach seinem Start beendeten die US-"National Institutes of Health (NIH)" vorzeitig ein intensives Ernährungs- und Bewegungsprogramm zur Gewichtsabnahme von 5.145 übergewichtigen oder fettsüchtigen Erwachsenenen mit einer Typ 2-Diabeteserkrankung.
Der in einer Presseerklärung der NIH vom 19. Oktober 2012 veröffentlichte entscheidende Grund ist, dass diese gewaltige Life-Style-Intervention zwar das Ziel der Gewichtsreduktion und einige andere Ziele (z.B. Verringerung von nächtlichem Atemstillstand, Absenkung der Anzahl von Diabetes-Arzneimittel, Erhaltung der körperlichen Beweglichkeit und Verbesserung der Lebensqualität) erreichte, nicht aber das harte Ziel, die Anzahl der unerwünschten und zum Teil tödlichen kardiovaskulären Ereignisse wie Herzinfarkte und Schlaganfälle zu verringern.
Die so genannte Look AHEAD (Action for Health in Diabetes)-Studie lief mit den 5.145 TeilnehmerInnen im Alter von 45 bis 76 Jahren an 16 Diabetes-Behandlungszentren. Die TeilnehmerInnen wurden zufällig auf eine Interventionsgruppe mit intensiven ernährungs- und bewegungsbezogenen Life-Style-Interventionen und eine Kontrollgruppe aufgeteilt, die ein allgemeines Diabetes-Unterstützungs- und Bildungsprogramm erhielt. Die Angehörigen beider Gruppen erhielten von ihren gewohnten Behandlern die routinemäßige Behandlung von DiabetikerInnen. Das rigorose Interventionsprogramm umfasste je nach Gewicht die tägliche Aufnahme von Lebensmitteln mit 1.200 bis 1.500 oder 1.500 bis 1.800 Kalorien und ein moderates Bewegungsprogramm mit wenigstens 175 Minuten pro Woche.
Die Studie erreichte das Gewichtsreduktionsziel in der Interventionsgruppe über eine Reduktion von 8% des Startgewichts nach einem Jahr. Die TeilnehmerInnen der Vergleichsgruppe verloren in derselben Zeit nur 1% ihres Ausgangsgewichts. Nach vier Jahren betrug der Verlust an Startgewicht in der Interventionsgruppe immer noch 5%, was unter ExpertInnen als gute Voraussetzung für einen harten gesundheitlichen Nutzen gilt.
Dieser Nutzen stellte sich aber auch nach 11 Jahren Intervention nicht ein. Auch wenn es keine interventionsverursachten gesundheitlichen Schäden gab, war dies für die ForscherInnen und die NIH der Anlass, die Interventionsangebote von Look AHEAD zu stoppen. Die Verantwortlichen empfehlen aber, die gesundheitliche Entwicklung derTeilnehmerInnen weiter zu beobachten und mögliche längerfristige Effekte der Intervention identifizieren zu können ("because there was little chance of finding a difference"). Diese Hofffnung beruht u.a. darauf, dass die Angehörigen der Interventions- wie Vergleichsgruppe eine geringere Anzahl von kardiovaskulären Ereignissen hatten als die TeilnehmerInnen an früheren Diabetikerstudien.
Und auch die Tatsache, dass sich die üblichen Risikofaktoren Blutdruck, Cholesterin und Blutzucker bei den Personen beider Gruppen am Ende nicht unterschieden, die Interventionsgruppen-Angehörigen aber weniger Medikamente einnahmen, wird von Kommentaren als Basis für eine Wahlmöglichkeit der PatientInnen bewertet: "That may be the choice we are highlighting" so David Nathan, einer der Projektverantwortlichen zur "New York Times". Und weiter: "You can take more medications — and more, I should say, expensive medications — or you can choose a lifestyle intervention and use fewer drugs and come to the same cardiovascular disease risk." Er sagte nicht, welche Variante besser ist, aber "those are real choices."
Die angekündigte gründliche Analyse der Daten und ihre Veröffentlichung in einer Fachzeitschrift wird sicherlich noch weitere interessante Hinweise auf die Barrieren für manchmal unreflektiert propagierte Patentrezepte liefern.
Die NIH-Presserklärung "Weight loss does not lower heart disease risk from type 2 diabetes" ist komplett erhältlich.
Dies trifft auch für den in der "New York Times" vom 19. Oktober veröffentlichten Artikel "Diabetes Study Ends Early With a Surprising Result" von Gina Kolata zu.
Bernard Braun, 23.10.12
Guten Appetit beim regelmäßigen Fischmahl: Das Geld dafür kann man durch Verzicht auf Omega-3-Nahrungsergänzungsmittel ansparen.
 Trotz zahlreicher guter Untersuchungen über den nicht vorhandenen Nutzen oder sogar die gesundheitlich nachteilige Wirkung einer Vielzahl von zusätzlich zur normalen Ernährung aufgenommenen Nahrungsergänzungsmitteln bzw. Vitaminen für die Prävention oder gar Behandlung schwerer, d.h. oft tödlicher Herz-Kreislauf- oder Krebserkrankungen gelten einige von ihnen weiter als wahre "Wundermittel". Dazu gehören z.B. die u.a. in Fischen natürlich vorkommenden mehrfach ungesättigten Omega-3-Fettsäuren, die man daher am besten gleich in Kapseln oder durch eine Diät mit Lebensmitteln zu sich nehmen sollte, in denen diese Fettsäure enthalten ist. Ein systematischer Review und eine Metaanalyse von 20 randomisierten kontrollierten Studien mit 68.680 TeilnehmerInnen aus verschiedenen Ländern und Esskulturkreisen (z.B. Japan) sowie einem Zeitraum von vor 1989 bis heute kommt aber zu einem deutlich anderen Ergebnis: Mehrfach ungesättigte Omega-3-Fettsäuren als Nahrungsergänzungsmittel senken das Risiko der Gesamtsterblichkeit, des plötzlichen Todes, des Herztodes, Herzinfarkts oder des Schlaganfalls nicht signifikant. Ihre Einnahme als Nahrungsergänzungsmittel ist zwar nach den Daten dieser Studie auch nicht risikoerhöhend, aber auf Dauer eine vermeidbare Belastung der Haushaltskassen. Um sicher zu stellen, dass sich überhaupt Effekte der Fettsäure einstellen konnten, waren z.B. nur RCTs aufgenommen worden, in denen die Teilnehmer mindestens ein Jahr eine entsprechende Diät durchführten oder Nahrungsergänzungsmittel aufnahmen. Als Wirkungsindikatoren wurden das relative Risiko und die absolute Risikoreduktion bei den oben genannten Erkrankungs- bzw. Sterberisiken ermittelt. Die durchschnittliche tägliche Aufnahme der Fettsäure betrug 1,41 Gramm und dies im Durchschnitt 2 Jahre lang (Maximum 6,2 Jahre). Das häufigste Anwendungsgebiet von Omega-3-Fettsäuren war die Sekundärprävention bei kardiovaskulären Erkrankungen. Die Ergebnisse beziehen sich aber nur auf die fehlenden Wirkungen von Omega-3-Fettsäure-Nahrungsergänzungsmittel und -Diäten auf die untersuchten Erkrankungen und raten nicht vom Genuss von normalen Nahrungsmitteln mit einem spürbaren Gehalt an dieser Art von Fettsäuren ab. So sollten Fische also durchaus regelmäßig gegessen werden - weil sie schmackhaft und bekömmlich sind und auch die für das normale Leben notwendige Omega-3-Fettsäure enthalten. Im Kommentar setzen sich die AutorInnen dieser Studie auch ausführlich mit den Defiziten und Grenzen der Studien auseinander, die schon bisher und mit Sicherheit auch künftig von den Anbietern von Omega-3-Fettsäure-Kapseln und den Propagandisten entsprechender Diäten als Beleg für ihre Empfehlungen zitiert werden. Der Aufsatz "Association between omega-3 fatty acid supplementation and risk of major cardiovascular disease events: a systematic review and meta-analysis." von Rizos EC, Ntzani EE, Bika E, et al. ist am 12. September 2012 in der US-Fachzeitschrift "JAMA" (308(10):1024-33) erschienen. Das Abstract ist kostenlos erhältlich.
Trotz zahlreicher guter Untersuchungen über den nicht vorhandenen Nutzen oder sogar die gesundheitlich nachteilige Wirkung einer Vielzahl von zusätzlich zur normalen Ernährung aufgenommenen Nahrungsergänzungsmitteln bzw. Vitaminen für die Prävention oder gar Behandlung schwerer, d.h. oft tödlicher Herz-Kreislauf- oder Krebserkrankungen gelten einige von ihnen weiter als wahre "Wundermittel". Dazu gehören z.B. die u.a. in Fischen natürlich vorkommenden mehrfach ungesättigten Omega-3-Fettsäuren, die man daher am besten gleich in Kapseln oder durch eine Diät mit Lebensmitteln zu sich nehmen sollte, in denen diese Fettsäure enthalten ist. Ein systematischer Review und eine Metaanalyse von 20 randomisierten kontrollierten Studien mit 68.680 TeilnehmerInnen aus verschiedenen Ländern und Esskulturkreisen (z.B. Japan) sowie einem Zeitraum von vor 1989 bis heute kommt aber zu einem deutlich anderen Ergebnis: Mehrfach ungesättigte Omega-3-Fettsäuren als Nahrungsergänzungsmittel senken das Risiko der Gesamtsterblichkeit, des plötzlichen Todes, des Herztodes, Herzinfarkts oder des Schlaganfalls nicht signifikant. Ihre Einnahme als Nahrungsergänzungsmittel ist zwar nach den Daten dieser Studie auch nicht risikoerhöhend, aber auf Dauer eine vermeidbare Belastung der Haushaltskassen. Um sicher zu stellen, dass sich überhaupt Effekte der Fettsäure einstellen konnten, waren z.B. nur RCTs aufgenommen worden, in denen die Teilnehmer mindestens ein Jahr eine entsprechende Diät durchführten oder Nahrungsergänzungsmittel aufnahmen. Als Wirkungsindikatoren wurden das relative Risiko und die absolute Risikoreduktion bei den oben genannten Erkrankungs- bzw. Sterberisiken ermittelt. Die durchschnittliche tägliche Aufnahme der Fettsäure betrug 1,41 Gramm und dies im Durchschnitt 2 Jahre lang (Maximum 6,2 Jahre). Das häufigste Anwendungsgebiet von Omega-3-Fettsäuren war die Sekundärprävention bei kardiovaskulären Erkrankungen. Die Ergebnisse beziehen sich aber nur auf die fehlenden Wirkungen von Omega-3-Fettsäure-Nahrungsergänzungsmittel und -Diäten auf die untersuchten Erkrankungen und raten nicht vom Genuss von normalen Nahrungsmitteln mit einem spürbaren Gehalt an dieser Art von Fettsäuren ab. So sollten Fische also durchaus regelmäßig gegessen werden - weil sie schmackhaft und bekömmlich sind und auch die für das normale Leben notwendige Omega-3-Fettsäure enthalten. Im Kommentar setzen sich die AutorInnen dieser Studie auch ausführlich mit den Defiziten und Grenzen der Studien auseinander, die schon bisher und mit Sicherheit auch künftig von den Anbietern von Omega-3-Fettsäure-Kapseln und den Propagandisten entsprechender Diäten als Beleg für ihre Empfehlungen zitiert werden. Der Aufsatz "Association between omega-3 fatty acid supplementation and risk of major cardiovascular disease events: a systematic review and meta-analysis." von Rizos EC, Ntzani EE, Bika E, et al. ist am 12. September 2012 in der US-Fachzeitschrift "JAMA" (308(10):1024-33) erschienen. Das Abstract ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 27.9.12
Wer viel sitzt, ist länger tot
 Seit Langem bestehen nicht alleine der Verdacht, sondern auch vermehrt Hinweise darauf, dass langes Sitzen gesundheitsschädlich ist. So geht beispielsweise die WHO in ihrem Bericht Global health risks: mortality and burden of disease attributable to selected major risks davon aus, dass 6 % der weltweiten Sterbefälle auf Bewegungsmangel zurückzuführen sind. Belastbare empirische Belege für einen Zusammenhang zwischen täglicher Sitzdauer und Gesamtsterblichkeit standen allerdings bisher aus.
Seit Langem bestehen nicht alleine der Verdacht, sondern auch vermehrt Hinweise darauf, dass langes Sitzen gesundheitsschädlich ist. So geht beispielsweise die WHO in ihrem Bericht Global health risks: mortality and burden of disease attributable to selected major risks davon aus, dass 6 % der weltweiten Sterbefälle auf Bewegungsmangel zurückzuführen sind. Belastbare empirische Belege für einen Zusammenhang zwischen täglicher Sitzdauer und Gesamtsterblichkeit standen allerdings bisher aus.
Im März 2012 veröffentlichte die Fachzeitschrift Archives of Internal Medicine eine überaus große australische Kohortenstudie aus New South Wales. Dabei verglichen die WissenschaftlerInnen aus Sydney und Acton die im Rahmen einer prospektiven Kohortenstudie erfassten Befragungsergebnisse unter über 45-Jährigen mit Mortalitätsdaten des Geburts-, Todes- und Heiratsregisters Registry of Births, Deaths, and Marriages zwischen dem 1. Februar 2006 und dem 31. Dezember 2010 im entsprechenden Bundesstaat. In die Studie flossen die Angaben von 222.497 Personen ein, die zwischen Studienbeginn und dem 30. November 2008 den Ausgangsfragebogen ausgefüllt hatten.
Mittels proportionaler Hazardmodelle nach Cox ermittelten die UntersucherInnen die Gesamtsterblichkeit in Abhängigkeit von der durchschnittlichen täglichen Sitzdauer und adjustierten die Ergebnisse nach potentiellen Confoundern wie Geschlecht, Bildung, Wohnort (Stadt/Land), körperlicher Betätigung, Body-mass Index, Raucherstatus, subjektivem Gesundheitsempfinden und Behinderung. Während der Gesamtheit von 621.695 Personenjahren bei einer durchschnittlichen Follow-up-Zeit von 2,8 Jahren traten 5.405 registrierte Todesfälle auf. Bei einer täglichen Sitzdauer von vier bis unter acht Stunden war das Gesamtsterblichkeitsrisiko um 2 % (95 % Konfidenzintervall, 0,95-1,09), bei einer Sitzdauer zwischen acht und elf Stunden um 15 % (1,06-1,25) und bei täglicher Sitzdauer über elf Stunden sogar um 40 % (1,27-1,55) gegenüber kurzer täglicher Sitzdauer von weniger als vier Stunden erhöht, und zwar nach Adjustierung nach körperlicher Aktivität und den anderen genannten Confoundern. Die Assoziation zwischen durchschnittlicher täglicher Sitzdauer und Gesamtsterblichkeit war bei gesunden Personen gegenüber StudienteilnehmerInnen mit vorbestehenden kardiovaskulären Erkrankungen oder Diabetes mellitus konsistent gegenüber Geschlecht, Alter, Körperstatur und körperlicher Aktivität.
Aus ihren Untersuchungsergebnissen leiten die AutorInnen eine offenkundige Schlussfolgerung für eine krankheitsreduzierende Gesundheitspolitik ab: Our findings add to the mounting evidence that public health programs should focus not just on increasing population physical activity levels but also on reducing sitting time, especially in individuals who do not meet the physical activity recommendation."
Die Studie Sitting Time and All-Cause Mortality Risk in 222 497 Australian Adults von Hidde van der Ploeg, Tien Chey, Rosemary Korda, Emily Banks und Adrian Bauman steht als Volltext kostenfrei zum Download zur Verfügung.
Jens Holst, 13.9.12
"Use It or Lose It": Schützt ein kognitiv aktiver Lebensstil gegen Alzheimer? Ja, aber zum Teil anders als erwartet und gewünscht.
 Viele epidemiologische Studien liefern eine starke Evidenz für den Zusammenhang eines ausgeprägten kognitiven Lebensstils mit einem geringeren Risiko an Demenz zu erkranken. Unklar war bisher, welche Komponenten des kognitiven Lebensstils hierfür hauptverantwortlich sind und damit eine möglicherweise präventive Rolle spielen könnten.
Viele epidemiologische Studien liefern eine starke Evidenz für den Zusammenhang eines ausgeprägten kognitiven Lebensstils mit einem geringeren Risiko an Demenz zu erkranken. Unklar war bisher, welche Komponenten des kognitiven Lebensstils hierfür hauptverantwortlich sind und damit eine möglicherweise präventive Rolle spielen könnten.
Ebenso unklar war der Zusammenhang des Lebensstils mit neurodegenerativen Veränderungen und dem Alzheimer- und Demenzrisiko.
Zwei Untersuchungen mit den vielfältigen Daten der mit 13.004 Personen im Alter von 65 und mehr Jahren in England und Wales durchgeführten "Medical Research Council Cognitive Function and Ageing Study", sorgen für mehr Klarheit über beide Fragen. Zu den wichtigsten Daten dieser Studie gehört ein über die Studienzeit von 10 bis 14 Jahren mehrfach erhobener so genannter "Cognitive Lifestyle Score (CLS)". Dieser Wert setzt sich aus Angaben zur Ausbildung, zur Komplexität der ausgeübten beruflichen Tätigkeit und zum sozialen Engagement zusammen. Hinzu kommen Ergebnisse von pathologischen und neurophysiologischen Untersuchungen an 329 für diesen Zweck gespendeten Hirnen verstorbener TeilnehmerInnen der Studie.
Die erste Untersuchung belegte die statistisch signifikante protektive Wirkung eines höheren CLS-Wertes auf die Inzidenz von Demenz. Das Risiko dement zu werden war bei den Personen mit einer Kombination von guter Bildung, komplexer beruflicher Tätigkeit und sozialem Engagement im höheren Lebensalter geprägt um 40% niedriger als bei Personen ohne diese sozialen Werte. Das geringere Demenzrisiko war selbst dann noch zu beobachten, wenn nur eine Kombination von zweien dieser CLS-Komponenten vorlag. Dabei war aber keiner der Einzelfaktoren des CLS-Wertes mit der Demenz-Inzidenz assoziiert. Eine gute Ausbildung allein reicht also nicht aus, um das Risiko von Demenz zu verringern, sondern muss dafür erst durch ein aktives Merkmal ergänzt werden. Die Daten weisen darauf hin, dass für den protektiven Effekt des kognitiven Lebensstils vor allem eine längere Dauer der Ausbildung und die sowohl im mittleren als auch im höheren Alter anhaltenden stimulierenden sozialen Erfahrungen notwendig sind. Für die Wirkung eines hohen CLS-Wertes auf die Überlebenschance nach einer Demenz-Diagnose gibt es keine Evidenz.
In einer zweiten neurophysiologischen und -pathologischen Untersuchung wurde mittels einer Autopsie in verschiedenen Regionen (z.B. Hippocampus, Brodmann Aera 9) der Gehirne der bis August 2004 verstorbenen StudienteilnehmerInnen gründlich nach einer Reihe bekannter demenzspezifischen physiologischen Veränderungen gesucht. Die Verstorbenen mit hohem CLS-Wert unterschieden sich bei zahlreichen neuropathologischen Anzeichen für die Alzheimer-Erkrankung, also ihrer Pathogenität, nicht von Personen mit niedrigem CLS-Wert. Wenn also StudienteilnehmerInnen an Alzheimer erkrankten, unterschieden sich die Krankheitszeichen zwischen den Personen mit hohem oder niedrigem CLS-Wert nicht.
Ebenfalls keine CLS-spezifischen neuroprotektiven Effekte gab es für die neuronale Dichte im Hippocampus-Bereich - einem Wert, der bei Demenzkranken niedrig ist. Anders sieht es dagegen bei der neuronalen Dichte in anderen Hirnteilen, wie der Brodmann Aera 9, aus. Hier sind die protektiv relevante Dichte und einige weitere physiologischen Charakteristika bei den kognitiv aktiven Personen signifikant höher.
Die WissenschaftlerInnen untersuchten außerdem noch die Assoziation von aktivem kognitiven Lebensstil und dem Auftreten einer Reihe cerebrovaskulärer Erkrankungen bzw. Verletzungen und stießen auf ein paradoxes Geschehen. Diese Art von Lebensstil sorgte bei Männern auch nach einer Reihe von Adjustierungen nach Alter, Demenzstatus etc. für eine Reduktion dieser Risiken um 80%. Bei Frauen traten derartige Assoziationen dagegen überhaupt nicht auf. Genau umgekehrt sah es beim Hirngewicht aus: Hier hatten von den kognitiv aktiven Frauen 46% ein überdurchschnittliches Hirngewicht, von ihren kognitiv weniger aktiven Geschlechtsgenossinnen dagegen nur 20%. Der Unterschied war statistisch signifikant. Diese Art von Beziehung zwischen aktivem kognitiven Lebensstil und hirnphysiologischen Detail konnte bei Männern nicht beobachtet werden.
Schließlich bestimmten die WissenschaftlerInnen noch in einer multivariaten Analyse die "Chance" zum Todeszeitpunkt an Demenz zu leiden in Abhängigkeit von einer Reihe neuropathologischer Veränderungen und vom Niveau des kognitiven Lebensstils. Bei kognitiv aktiven Männern zeigte sich auch nach Berücksichtigung aller physiologischen Veränderungen eine um 80% geringere Demenz-"Chance" als bei Männern mit einem niedrigen CLS-Wert. Bei Frauen zeigte sich dieser Zusammenhang nicht.
Auch wenn die beschriebenen Wirkungs-Paradoxien zwischen Männern und Frauen und die hirnregional unterschiedliche Neuroprotektivität zunächst einmal unerklärt bleiben, liefert diese Studie drei wichtige Hinweise für die weitere Debatte und Forschung:
• Erstens bestätigt sie, dass es in einem quantitativ erheblichen Umfang möglich ist, das Risiko von Demenzerkrankungen durch soziale präventive Interventionen zu verringern oder den Eintritt der Erkrankung zu verschieben.
• Zweitens gibt es offensichtlich einen komplexen Zusammenhang zwischen neurobiologischen Dynamiken und sozial determinierten kognitiven Aktivitäten.
• Drittens ist die komplementäre Nutzung beider Sichtweisen machbar und auch für die Entwicklung und Überprüfung präventiver kognitiver Lebensstilprogramme für Demenzerkrankungen fruchtbar.
Die Ergebnisse der Studie finden sich in zwei Publikationen:
Valenzuela M, Brayne C, Sachdev P, Wilcock G, Matthews F. (2011): Cognitive lifestyle and long-term risk of dementia and survival after diagnosis in a multicenter population-based cohort, In: American Journal of Epidemiology; 173(9):1004-12. Das Abstract des Aufsatzes ist kostenlos erhältlich.
Valenzuela MJ et al. (2012): Multiple biological pathways link cognitive lifestyle to protection from dementia. In: Biological Psychiatry; 71:783. Das Abstract des Aufsatzes ebenfalls kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 9.9.12
Verkürzen Ängste und Depressionen das Leben?
 Einen Zusammenhang zwischen seelischer Belastung ("distress") und Sterblichkeit hat eine kürzlich veröffentlichte englische Studie ergeben.
Einen Zusammenhang zwischen seelischer Belastung ("distress") und Sterblichkeit hat eine kürzlich veröffentlichte englische Studie ergeben.
Mit einem einfachen, in etwa 5 Minuten ausfüllbaren und als ausreichend zuverlässig geltenden Fragebogen (General Health Questionnaire - GHQ-12) wurden 37.649 Frauen und 30.573 Männer im Alter von mindestens 35 Jahren von einem Interviewer in ihrer häuslichen Umgebung nach Zeichen von Angst und Depression befragt und in vier Gruppen eingeteilt - von keiner bis schwerer Symptomatik. Die Befragung wurde jährlich wiederholt, so dass für jede Teilnehmerin und jeden Teilnehmer Daten aus 11 Befragungen vorlagen. Die Studie war eingebettet in den Health Survey for England (Link). Dabei handelt es sich um eine seit 1991 in jährlichen Abständen durchgeführte Befragung einer repräsentativen Bevölkerungsstichprobe. Da umfangreiche Daten für jeden Teilnehmer erhoben wurden, konnten die Einflüsse von Gewicht, körperlicher Aktivität, Rauchen, Alkoholkonsum und Diabetes statistisch berücksichtigt werden. Dies ist erforderlich, weil die Auswirkungen der seelischen Belastung unabhängig vom Gesundheitsverhalten und anderen Einflussfaktoren gemessen werden sollten.
Zur Ermittlung der Sterblichkeit wurden die Mortalitätsdaten des National Health Service genutzt. Hier interessierten insbesondere die Todesursachen Herz-Kreislauf-Krankheiten, Krebs und externe Ursachen. Unter "externen Ursachen" werden Unfälle und Suizide gefasst.
Von den 68.222 Teilnehmern verstarben im Untersuchungszeitraum insgesamt 8.365, davon laut Todesbescheinigung 3.382 infolge einer koronaren Herzkrankheit, 2.552 an Krebs und 386 an einer externen Todesursache.
Die Gesamtsterblichkeit steigt mit dem Grad der seelischen Belastung. Im Bereich der geringen Belastung war die Mortalität um 20% erhöht im Vergleich zur Gruppe der nicht Nicht-Belasteten und zwar auch nach statistischer Berücksichtigung von sozialem Status, Alkoholkonsum und Rauchen. Im Sinne einer Dosis-Wirkungs-Beziehung steigt die Mortalität mit dem Belastungsgrad und zwar bis auf mehr als das Doppelte.
Ein vergleichbares Bild zeige die Sterblichkeit an der koronaren Herzkrankheit. Bei Krebs steigt die Mortalität erst bei hoher Belastung. Die Sterblichkeit an externen Todesursachen zeigt wieder das Bild einer Dosis-Wirkungs-Beziehung und zwar auch nach Berücksichtigung anderer Einflussfaktoren.
Zusammenfassend ergibt die Studie eine Beziehung zwischen seelischer Belastung und Gesamtsterblichkeit sowie der Sterblichkeit an koronarer Herzkrankheit, Krebs und externen Todesursachen. Bemerkenswert ist der Zusammenhang schon bei geringer Belastung bei der Gesamtsterblichkeit, der koronaren Herzkrankheit und externen Todesursachen und zwar unabhängig von einem breiten Spektrum anderer Einflussfaktoren auf die Sterblichkeit.
Sowohl die Autoren und auch Leserbriefschreiber (siehe Rapid responses) warnen vor voreiligen Schlüssen bezüglich der Ursächlichkeit. Da es sich um eine Beobachtungsstudie handelt, stellen die Ergebnisse statistische und nicht etwa kausale Zusammenhänge dar. Auch sind die Ergebnisse aufgrund der Studiengröße zwar statistisch signifikant, also eher nicht dem Zufall geschuldet. Die absoluten Unterschiede in den Belastungsgruppen sind aber gering und klinisch eher nicht relevant, wie die Autoren selbst feststellen.
Sozialmedizinisch erscheint die Studie interessant, weil anhaltende psychosoziale Belastungen über die physiologische Stressreaktion gesundheitsschädliche Wirkungen entfalten und zur sozialen Ungleichheit der Gesundheit beitragen können (Lehrbuch Sozialmedizin - Public Health, S.215 ff. Download, Kapitel 6: Soziale Ungleichheit der Gesundheit).
Konkrete präventive Zielsetzungen lassen sich aus dieser Studie jedoch noch nicht ableiten.
Russ TC, Stamatakis E, Hamer M, Starr JM, Kivimäki M, Batty GD. Association between psychological distress and mortality: individual participant pooled analysis of 10 prospective cohort studies. BMJ 2012;345. Volltext
David Klemperer, 21.8.12
Welches "Gewicht" haben sieben Verhaltens- und Risikofaktoren auf die kardiovaskuläre Gesundheit?
 Obwohl niedriger Blutdruck, Bewegung oder der Verzicht auf das Rauchen zusammen mit vier anderen so genannten Risikofaktoren seit Jahrzehnten als hilfreich bei der Prävention von Herz-/Kreislauferkrankungen empfohlen werden, schaffen es nur sehr wenige Personen, diese Ziele zu erreichen. Dieses kritische Bild der Präventionsbemühungen liefert eine gerade veröffentlichte und kommentierte Untersuchung der Entwicklung der sieben für die kardiovaskuläre Gesundheit relevant gehaltenen Verhaltens- und Körperwerten sowie der Gesamtsterblichkeit und kardiovaskulären Sterblichkeit bei 44.959 erwachsenen bevölkerungsrepräsentativen US-AmerikanerInnen.
Obwohl niedriger Blutdruck, Bewegung oder der Verzicht auf das Rauchen zusammen mit vier anderen so genannten Risikofaktoren seit Jahrzehnten als hilfreich bei der Prävention von Herz-/Kreislauferkrankungen empfohlen werden, schaffen es nur sehr wenige Personen, diese Ziele zu erreichen. Dieses kritische Bild der Präventionsbemühungen liefert eine gerade veröffentlichte und kommentierte Untersuchung der Entwicklung der sieben für die kardiovaskuläre Gesundheit relevant gehaltenen Verhaltens- und Körperwerten sowie der Gesamtsterblichkeit und kardiovaskulären Sterblichkeit bei 44.959 erwachsenen bevölkerungsrepräsentativen US-AmerikanerInnen.
Herz-/Kreislauferkrankungen gehören zu den häufigsten chronisch-degenerativen Krankheiten in entwickelten Gesellschaften und auch zu den Krankheiten, die seit Jahrzehnten im Mittelpunkt von Primär- und Sekundärprävention stehen. Entsprechend enthalten die Leitlinien medizinischer Fachgesellschaften und die diversen Ratgeber für Laien oder PatientInnen eine immer länger werdende Liste von Verhaltensweisen und gesundheitlichen Körperwerten, deren Ausübung und Erreichen gesundheitsförderlich sein sollen. Dazu gehören das Nichtrauchen, mindestens fünfmal pro Woche mäßige Bewegung, ein normaler Blutdruck-, Cholesterin- und Blutzuckerwert, ein niedriger Body Mass Index (BMI)-Werte und eine möglichst "gesunde"/vollwertige Ernährung. Gleichzeitig wurden die kritischen Schwellenwerte für alte und neue so genannte Risikofaktoren laufend verändert, d.h. fast durchweg abgesenkt und sollen auch weiter "schärfer" gestellt werden. Ob das Erreichen dieser Werte für alle möglicherweise gefährdeten Personen möglich ist, wie das möglich ist und ob der versprochene Nutzen wirklich erreicht wird, blieb aber weitgehend im Unklaren.
Die Hauptfacetten der Empirie dieser Präventionsbemühungen sind:
• Das Erreichen einer größeren Anzahl der genannten Gesundheitswerte war mit einem niedrigeren Risiko der gesamten sowie der kardiovaskulären Sterblichkeit assoziiert. So betrug nach der Alters- und Geschlechtsstandardisierung das Risiko der Gesamtsterblichkeit bei Personen, die eines oder keines der Ziele erreichten 14,8 Tote auf 1.000 Personenjahre und sank bei den Personen, die 6 und mehr der Ziele erreichten auf 5,4 Tote/1.000 Personenjahre. Die entsprechenden Risikowerte für die Herz-/Kreislaufsterblichkeit betrugen 6,5 und 1,5 und für das Risiko an einer ischämischen Herzerkrankung zu versterben 3,7 und 1,1 Tote/1.000 Personenjahre. Diejenigen, die 6 und mehr der Ziele erreichen haben anders ausgedrückt ein um 51% niedrigeres Gesamtsterblichkeitsrisiko, um 76% niedrigeres kardiovaskuläres Sterblichkeitsrisiko und ein um 70% niedrigeres Risiko an einer ischämischen Herzerkrankung zu sterben als die Personen, die nur eines oder keines der Ziele erreichen.
• Nur sehr wenige TeilnehmerInnen erreichten innerhalb des Untersuchungszeitraums alle sieben Werte oder Ziele. Die Anzahl derjenigen, die das schaffen, sinkt sogar von 2% in den Jahren 1988-1994 auf 1,2% in den Jahren 2005-2010. Die Gruppe der Personen, die keines oder nur eines der Ziele erreichen steigt dagegen im selben Zeitraum von 7,2% auf 8,8%.
Der Verfasser des Editorials zum Aufsatz hebt die Diskrepanz zwischen den von us-amerikanischen Kardiologen für den Zeitraum bis 2020 angekündigten neuen Grenzwerten und diesen Ergebnissen zum Status quo hervor und stellt sich die Frage nach den Ursachen für diesen Zustand. Dabei spielt seines Erachtens das für Erwartungen leitende Menschenbild eine große Rolle. Er charakterisiert das Menschenbild, das in den USA der Vorstellung zugrunde liegt, diese Zielwerte möglichst alle und auch leicht erreichen zu können, als das von einer jungen, gut ausgebildeten weißen Frau. Jede biologisch oder sozial bedingte Abweichung senkt die Wahrscheinlichkeit, die Ziele zu erreichen beträchtlich. Um die Diskrepanzen zwischen Notwendigkeit und Wirklichkeit vielleicht doch überwinden zu können, schlägt der Editor schließlich vor, die Grenzen der Gesundheitsversorgung und des Gesundheitssystems zu überwinden und daran zu arbeiten, die soziale Umgebung und den Zugang zu besseren Nahrungsmitteln und Aktivitäten zu verbessern. Seine weiteren Ausführungen wirken aber eher zwangsoptimistisch und voluntaristisch: "The nation can, and must, take one step forward toward improved cardiovascular health." Warum gesunde und auch bereits kranke Personen trotz gesichertem Wissen über das statistische und sogar ihr persönliches Erkrankungs- und Sterblichkeitsrisiko vieler ihrer Verhaltensweisen und Körperwerte nichts unternehmen, ist nach den beschriebenen empirischen Verhältnissen die nächste zu erkundende Frage.
Der Aufsatz "Trends in Cardiovascular Health Metrics and Associations With All-Cause and CVD Mortality Among US Adults" von Quanhe Yang et al., online veröffentlicht im "Journal of the American Medical Association (JAMA)" vom 16. März 2012, ist komplett kostenlos erhältlich.
Ebenfalls kostenlos erhält man das Editorial von Donald M. Lloyd-Jones: "Improving the Cardiovascular Health of the US Population".
Bernard Braun, 10.7.12
Macht nur konserviertes Fleisch krank - oder führt jede Art von Fleischkonsum zu höherer Sterblichkeit?
 Seit Längerem gibt es Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen dem Verzehr von Fleisch und dem Auftreten von koronarer Herzkrankheit (KHK), Schlaganfall und Diabetes mellitus (DM), was regelmäßig zu entsprechenden Ernährungsempfehlungen führt. Allerdings bestand bisher weitgehend Unklarheit, ob der Fleischkonsum insgesamt, der von rotem Fleisch oder der von haltbar gemachtem oder anderweitig verarbeitetem Fleisch pathogenetisch bedeutsam sind. Eine in Circulation, der Zeitschrift der American Heart Association (AHA - Amerikanische Herzvereinigung), erschienene Metaanalyse lieferte ein differenzierteres Bild von den Übeltätern: Demnach ist nur der Konsum von verarbeitetem Fleisch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit verbunden, an DM oder KHK zu leiden, nicht aber der Verzehr von "rotem Fleisch".
Seit Längerem gibt es Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen dem Verzehr von Fleisch und dem Auftreten von koronarer Herzkrankheit (KHK), Schlaganfall und Diabetes mellitus (DM), was regelmäßig zu entsprechenden Ernährungsempfehlungen führt. Allerdings bestand bisher weitgehend Unklarheit, ob der Fleischkonsum insgesamt, der von rotem Fleisch oder der von haltbar gemachtem oder anderweitig verarbeitetem Fleisch pathogenetisch bedeutsam sind. Eine in Circulation, der Zeitschrift der American Heart Association (AHA - Amerikanische Herzvereinigung), erschienene Metaanalyse lieferte ein differenzierteres Bild von den Übeltätern: Demnach ist nur der Konsum von verarbeitetem Fleisch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit verbunden, an DM oder KHK zu leiden, nicht aber der Verzehr von "rotem Fleisch".
Das legte jedenfalls die umfassende Untersuchung belegbarer Zusammenhänge zwischen dem Auftreten von Erkrankungen der Koronar- und Hirngefäße sowie Zuckerkrankheit und dem Verzehr von unverarbeitetem rotem, von verarbeitetem sowie von Fleisch insgesamt nahe, die drei WissenschaftlerInnen aus Harvard Renata Micha, Sarah Wallace und Dariush Mozaffarian bereits 2009 in Circulation publizierten. "Rotes Fleisch" ist definiert als unverarbeitetes bzw. nicht konserviertes Rinder-, Lamm-, Schweine- oder Wildfleisch außer Geflügel, Fisch oder Eiern; als "verarbeitet" gelten geräuchertes, gepökeltes, gesalzenes oder chemisch konserviertes Fleisch wie Schinken, Salami, Würste, Hot Dogs sowie anderweitig verarbeitet Feinkost- oder Fertiggerichte. Der Gesamtverzehr von Fleisch erfasst den Konsum sowohl unverarbeiteten als auch verarbeiteten Fleisches außer Geflügel und Fisch.
Bei ihrer systematischen Suche und Metaanalyse fahndeten die WissenschaftlerInnen nach sämtlichen Kohorten-, Fall-Kontroll- oder randomisierten Studien, die dem Zusammenhang zwischen Fleischkonsum und den drei chronischen Krankheiten bei ansonsten gesunden Erwachsenen auf den Grund gingen. Von den an Hand ihrer Abstracts thematisch identifizierten 1598 Studien erfüllten gerade einmal 20 die Einschlusskriterien; bei 17 handelte es sich um prospektive Kohorten- und bei drei um Fall-Kontrollstudien. Summa summarum erfassten die 20 Studien 1.218.380 Personen, von denen 23.889 an KHK und 10.797 an Diabetes mellitus erkrankt waren und 2.280 einen Schlaganfall erlitten.
Nach den Ergebnissen dieser Metaanalyse der WissenschaftlerInnen aus Harvard hat der Verzehr von rotem Fleisch weder einen erkennbaren Einfluss auf das Auftreten von KHK (die vier ausgewerteten Studien zeigten ein relatives Gesamtrisiko pro 100-Gramm Tageskonsum von 1.00; 95% Konfidenzinterval 0,81 bis 1,23; Heterogenitätswahrscheinlichkeit P = 0,36) und DM (insgesamt 5 Studien, relatives Risiko 1,16; 95% Konfidenzinterval, 0,92 biso 1,46; P = 0,25). Bei verarbeitetem Fleisch waren hingegen bereits bei vergleichsweise geringer Steigerung der täglich verzehrten Menge um 50 Gramm ein 42 Prozent höheres Risiko für eine KHK (n = 5, relatives Risiko pro 50-Gramm Tagesverzehr 1,42; 95% Konfidenzinterval 1,07 bis 1,89; P = 0,04). Lässt man eine große US-Studie mit mehr als einer halben Million TeilnehmerInnen außer Acht, deren Endpunkt nur die koronare Sterblichkeit, nicht aber das Auftreten von KHK insgesamt war, zeigte sich ein noch drastischeres Ergebnis: Der Verzehr von verarbeitetem Fleisch führt nahezu zu einer Verdoppelung des Risikos krankhafter Veränderungen der Koronarien RR = 1,90; 95% KI, 1,00 - 3,62. Jene US-Studie der AutorInnen Rashmi Sinha, Amanda Cross, Barry Graubard, Michael Leitzmann und Arthur Schatzkin erschien bereits 2009 unter dem Titel Meat intake and mortality: a prospective study of over half a million people in den Archives of Internal Medicine 169 (6), Seiten 562-571 war zu dem Ergebnis gekommen, der Verzehr von rotem und verarbeitetem Fleisch führe zu einem geringen Anstieg sowohl der Gesamt- als auch der Tumor-bedingten und kardiovaskulären Mortalität.
Bei DM ergab sich bei Sichtung aller einbezogenen Studien in Abhängigkeit vom Tagesverzehr an verarbeitetem Fleisch ein insgesamt um 19 Prozent erhöhtes Erkrankungsrisiko (n = 7; relatives Risiko 1,19; 95% Konfidenzinterval, 1,11 - 1,27; P = 0,001). Bemerkenswerterweise zeigten US-Studien allein sogar eine über 50-prozentige Risikosteigerung für das Auftreten eines DM (RR = 1,53; 95% KI, 1,37 - 1,71). Drei Studien unterschieden sogar zwischen verschiedenen Arten von verarbeitetem bzw. konserviertem Fleisch. Demnach erhöht der Konsum von zwei Scheiben Schinken pro Tag das Diabetes-Risiko auf mehr als das Doppelte (RR = 2,07; 95% KI, 1,40 - 3,04), von einem Hotdog auf knapp das Doppelte (RR = 1,92; 95% KI, 1,33 - 2.78) und von anderen Formen verarbeiteten Fleisches pro Stück um zwei Drittel (RR = 1,66; 95% KI, 1,13 - 2,42).
Zusammenhänge zwischen dem Verzehr von rotem bzw. verarbeitetem Fleisch und dem Auftreten von Schlaganfällen ließen sich nicht erkennen; allerdings lagen nur drei Studien vor, die dieser Frage nachgingen. Eine Ursache könnte darin liegen, dass hier keine Unterscheidung zwischen verschiedenen Arten von Schlaganfällen erfolgte; denn die einzige Studie, die dem Zusammenhang zwischen Fleischkonsum und hämorrhagischem Schlaganfall nachging, zeigt eine deutlichere Korrelation und einen Risikoanstieg um zwei Drittel in Abhängigkeit vom Tagesverzehr (RR pro Tagesdosis 1,64; 95% KI, 0,75 - 3,60). Nicht klar ist dabei, ob es sich um Hirnblutungen aufgrund von Gefäßmissbildungen oder um solche bei arteriosklerotisch veränderten Gefäßen handelte (checken bei He et al., BMJ!). Hier fallen einem etliche potenzielle Confounder ein, die nicht nur mit sonstigen Ernährungsgewohnheiten wie beispielsweise dem in jener Studie primär untersuchten Fettkonsum zusammenhängen, sondern auch mit ursächlich relevanten Erkrankungen wie arteriellem Hypertonus beim Entstehen hämorrhagischer Schlaganfälle des höheren Lebensalters. Insofern wäre es auch sehr interessant zu wissen, ob Art und Menge des Fleischkonsums das Entstehen von Bluthochdruck beeinflusst.
Insgesamt ist zum einen die Heterogenität der analysierten Studien als Einschränkung zu berücksichtigen, die vergleichend-vereinheitlichende Ergebnisse in ihrer Aussagekraft verringern können. Zum anderen können die AutorInnen mögliche qualitative Unterscheide zwischen den einzelnen Produkten der verschiedenen Fleischarten überhaupt nicht erfassen, beispielsweise die Kombination mit Fetten unterschiedlicher Schädlichkeit, der Art der Konservierungsmethode und damit verbundener Noxen, und ähnliche Faktoren, die im Zuge einer zunehmenden Industrialisierung der Nahrungsmittelproduktion bevölkerungsbezogen auch quantitativ relevante Auswirkungen haben kann. Und ganz grundsätzlich ist anzumerken, dass das Ausmaß der Adjustierung nach Kovariaten in den ausgewerteten Studien erheblich variierte und insbesondere vielfach keine Kontrolle sonstiger Ernährungsgewohnheiten und Lebensbedingungen der Personen sowie vor allem von sozialen Einflussfaktoren erfolgte.
Die drei Autoren betonen in ihrer Schlussfolgerung zum einen die Notwendigkeit, die ursächlichen Zusammenhänge und mögliche pathogenetische Effekte besser zu verstehen. Zum anderen fordern sie dazu auf, bei Diät- und Politikempfehlungen stärkeres Augenmerk auf verarbeitetes als auf rotes Fleisch oder den Fleischkonsum insgesamt zu legen. Dem ist uneingeschränkt zuzustimmen, allerdings nur dann, wenn sich diese Empfehlungen nicht auf übliche Normierungsvorgaben für das Individuum im Sinne der "Gesund-Leben"-Ideologie beschränken, sondern auch gesellschaftlich relevante Fragen der kapitalistischen Gewinnmaximierungsideologie in der Nahrungsmittelindustrie und der Vermarktung ihrer Produkte aufwirft.
Zu einem anderen Ergebnis kommt eine kürzlich in den Archives of Internal Medicine veröffentlichte Studie einer Gruppe von AutorInnen aus Harvard und einer anderen Klinik in Boston, aus Ohio sowie vom Deutschen Institut für Ernährungsforschung. An Pan, Qi Sun, Adam Bernstein, Matthias Schulze, JoAnn Manson, Meir Stampfer, Walter Willett, und Frank publizierten Ende März 2012 in Arch Intern Med 172 (7), Seiten 555-563, ihre große Untersuchung unter dem Titel Red Meat Consumption and Mortality. Results From 2 Prospective Cohort Studies.
Der prospektiven Beobachtungsstudie mit 37.698 männlichen Teilnehmern aus der Health Professionals Follow-up Study (1986-2008) und 83.644 Frauen der Nurses' Health Study (1980-2008), die zum Zeitpunkt des Studienbeginns weder einen KHK noch eine maligne Erkrankung aufwiesen, liegen vierjährlich aktualisierte Bewertungen des Ernährungsverhaltens mit Hilfe von validierten Nahrungshäufigkeitserhebungen zu Grunde.
Während de Beobachtungszeitraums mit 2,96 Millionen Personenjahren verstarben insgesamt 23.926 Personen aus dieser Kohorte, darunter 5.910 Todesfälle durch KHK und 9.464 afgrund bösartiger Neubildungen. Nach multivariater Adjustierung im Hinblick auf wichtige Lebensstil- und dietätische Risikofaktoren waren bei nicht behandeltem bzw. konserviertem Fleisch ein Anstieg des Gesamtsterblichkeitsrisikos pro täglichem Verzehr um 13 % [Hazard Ratio 1,13, Streuung 1,07 - 1,20] und bei verarbeitetem Fleisch sogar im ein Fünftel [HR (95 % KI) 1,20 (1,15 - 1,24)]. Bei der isolierten Betrachtung der KHK-bedingten Todesfälle belief sich der Anstieg der Sterblichkeitswahrscheinlichkeit bei unbehandeltem Fleisch auf 18 % [HR 1,18 (1,13 - 1,23] und bei konserviertem oder anderweitig verarbeiteten Fleisch bei 21 % [HR 1,21 (1,13 - 1,31)], während der Zusammenhang bei tumorbedingter Sterblichkeit mit einem nur 10- [HR 1,10 (1,06 - 1,14)] bzw. 16-prozentigen Anstieg der fleischkonsumassoziierten Sterblichkeit [HR 1.16 (1,09 - 1,23)] deutlich geringer ausfiel.
Die WissenschaftlerInnen aus den USA und Deutschland führten multivariate Analysien durch und kontrollierten ihre Ergebnisse dabei simultan nach einer Vielzahl von anderen relevanten Einflussfaktoren: Gesamtkalorienaufnahme, Verzehr von Vollkornprodukten, Obst und Gemüse sowie von anderen wichtigen Nahrungsvariablen wie dem Konsum von Fisch, Geflügel, Nüssen, Milchprodukten und verschiedenen Nahrungsbestandteilen wie Zucker, Balaststoffen, Magnesium und mehrfach ungesättigten bzw. Transfettsäuren. Zudem adkustierten sie nach anderen nicht-dietätischen potentiellen Confoundern, für die an Hand von zwei- bis vierjährigen Befragungsrunden aktualisierte Daten vorlagen. Zu diesen Variablen gehörten Alter, Body-Mass-Index, ethnische Zugehörigkeit, Raucherverhalten, Alkoholkonsum, physische Aktivität, Einnahme von Multivitaminpräparaten und Aspirin, familiäre Vorgeschichte von DM, Herzinfarkt oder Krebs sowie bestehender DM, Hypertonus oder Fettstoffwechselstörung bei Aufnahme in die Beobachtungsstudie. Bei Frauen erfolgte zusätzlich eine Adjustierung nach postmenopausalem Zustand und Hormonbehandlung.
Nach Schätzung der AutorInnen würde der Ersatz einer täglichen Verzehrdosis an rotem Fleisch durch andere Nahrungsmittel wie Fisch, Geflügel, Nüsse, Gemüse, fettarme Milchprodukte und Vollkornprodukte das Sterblichkeitsrisiko um 7 - 19 % senken. Gleichermaßen schätzen sie, dass in dieser Kohorte bis zum Ende des Beobachtungszeitraums 9,3 % der Todesfälle bei Männern und 7,6 % bei Frauen vermeidbar wären, wenn alle Beteiligten weniger als eine halbe tägliche Verzehrdosis - ungefähr 42 g - rotes Fleisch zu sich genommen hätten. Insgesamt kommen sie zu dem Schluss, dass der Verzehr von rotem Fleisch mit einer erhöhten Gesamt- sowie koronarer und tumorbedingter Sterblichkeit führt. Der Ersatz roten Fleisches durch andere gesunde Proteinquellen zu ersetzen scheint demnach mit einer geringeren Sterblichkeit assoziiert zu sein.
Den älteren, durch lesenswerten und datenreichen Artikel von Red and Processed Meat Consumption and Risk of Incident Coronary Heart Disease, Stroke, and Diabetes Mellitus von Renata Micha, Sarah Wallace und Dariush Mozaffarian in Circulation 121 (21), S. 2271-2283, können Sie hier in ganzer Länge herunterladen; zusätzlich stehen die gesamten Rohdaten dieser Metaanalyse zum Download zur Verfügung.
Auch den Artikel Red Meat Consumption and Mortality. Results From 2 Prospective Cohort Studies von An Pan, Qi Sun, Adam Bernstein, Matthias Schulze, JoAnn Manson, Meir Stampfer, Walter Willett und Frank Hu stellen die Archives of Internal Medicine [172 (7): 555-563. DOI:10.1001/archinternmed.2011.2287] kostenfrei zum Download zur Verfügung.
Jens Holst, 6.7.12
Ungleiche körperliche Leistungsfähigkeit im Alter durch diverse Nachteile im früheren Leben bedingt
 Ungleiche körperliche Leistungsfähigkeit hängt bei älteren Menschen verschiedener rassischer, ethnischer oder regionaler Herkunft zum größten Teil von gesundheitlichen und sozioökonomischen Nachteilen in sehr jungen Jahren und im weiteren Erwachsenenleben ab. Zu diesem Schluss führt eine Untersuchung der Daten von 14.564 seit 1947 an der für die USA repräsentativen "Health and Retirement Study (HRS)" teilnehmenden Personen.
Ungleiche körperliche Leistungsfähigkeit hängt bei älteren Menschen verschiedener rassischer, ethnischer oder regionaler Herkunft zum größten Teil von gesundheitlichen und sozioökonomischen Nachteilen in sehr jungen Jahren und im weiteren Erwachsenenleben ab. Zu diesem Schluss führt eine Untersuchung der Daten von 14.564 seit 1947 an der für die USA repräsentativen "Health and Retirement Study (HRS)" teilnehmenden Personen.
Unter deren TeilnehmerInnen finden sich sowohl in den USA als auch in anderen Ländern geborene Weiße, Schwarze und "Hispanics". Die körperliche Leistungsfähigkeit wurde für die meisten TeilnehmerInnen durch die Messung der Geschwindigkeit bestimmt mit der die Personen ausatmen, sowie durch die Festigkeit des Händedrucks und die Gehgeschwindigkeit. Das physische Leistungsvermögen gilt neben dem subjektiven Wohlbefinden als einer der wichtigsten Einflussfaktoren auf den selbst wahrgenommenen Gesundheitszustand älterer Menschen. Ein schlechter körperlicher Zustand spielt schließlich eine erhebliche Rolle bei der Entstehung von Behinderungen und deren Weiterentwicklung. Für jede Person wurden außerdem eine Reihe von sozioökonomischen Merkmalen (z.B. Ausbildung, Einkommen, frühere Beschäftigung) und Kennziffern des Gesundheitsverhaltens (z.B. Rauchverhalten, Gewicht) erhoben. Das besondere Augenmerk lag auf der Erhebung der sozioökonomischen und gesundheitlichen Situation vom Kindesalter an bis in das Erwachsenenalter hinein.
Die komplexe statistische Analyse der Daten lieferte signifikante Belege für drei sozial relevante Sachverhalte:
• In den USA gibt es im höheren Lebensalter zwischen den rassisch, ethnisch und vom Geburtsland her unterschiedenen Personen große Ungleichheiten bei der körperlichen Leistungsfähigkeit. Dabei gibt es auch nicht nur auf den ersten Blick paradoxe Ergebnisse: So haben z.B. die überwiegend in körperlich beanspruchenden Berufen arbeitenden "Hispanics" einen schwächeren Händedruck als ihre weißen Landsleute, die weit häufiger Bürotätigkeiten ausübten.
• Die gesundheitliche Situation und materielle Benachteiligungen im Kindesalter und die darauf aufbauende Gesundheit im Erwachsenenalter sowie die weitere sozioökonomische Situation erweisen sich in der Untersuchung als signifikante Prädiktoren für die Ungleichheiten der körperlichen Leistungsfähigkeit und spielen eine wichtige Rolle bei der Herausbildung dieser Ungleichheiten. Die Studie liefert aber auch Hinweise, dass gesundheitliche und sozioökonomische Nachteile im Kindesalter durch objektive und subjektive Bedingungen im Erwachsenenalter und damit auch ihre negativen Wirkungen abgeschwächt werden können.
• Auch wenn die ungleiche körperliche Leistungsfähigkeit von älteren Menschen mit unterschiedlicher Hautfarbe und unterschiedlichem Herkunftsland nur zum Teil alterungsbedingt und stattdessen durch das frühere Leben bestimmt ist, handelt es sich nicht um unveränderliche Zusammenhänge. Die AutorInnen der Studie empfehlen stattdessen mit der Evidenz für die positive Wirkung sowohl im Kindesalter als auch noch im Erwachsenenalter vielfältige Interventionen, die sich auf den Abbau von sozialen Nachteilen und auf die Umkehr einer "Abwärtsspirale" richten.
Von der Studie "Race/ethnic and nativity disparities in later life physical performance: the role of health and socioeconomic status over the life course." von Haas, S.A., Krueger, P.M. und Rohlfsen, L. in der Zeitschrift "The Journals of Gerontology" (2012; Series B: Psychological Sciences and Social Sciences, 67(2): 238-248) veröffentlicht, gibt es kostenlos nur das Abstract.
Bernard Braun, 11.6.12
Die Mär vom "guten" Cholesterin: Ursachen und Prävention des Herzinfarkt-Risikos sind komplexer.
 Komplexitätsreduktion bis auf eine einzige oder letzte Ursache oder die Dichotomisierung von Lösungen oder Lösungswegen in "gut" oder "schlecht" gehören zum Alltag gesundheitswissenschaftlicher oder -politischer Diskurse. So verständlich dies angesichts tausender Studien, des Gewimmels von "multifaktoriellen Ursachengefügen", dem Wunsch "zu helfen" und nicht zuletzt der Verkaufsinteressen von Unternehmen der Gesundheitswirtschaft sein mag, so problematisch erweist sich dies nicht selten, wenn die Richtigkeit der Annahmen für diese Vorgehensweisen überprüft werden.
Komplexitätsreduktion bis auf eine einzige oder letzte Ursache oder die Dichotomisierung von Lösungen oder Lösungswegen in "gut" oder "schlecht" gehören zum Alltag gesundheitswissenschaftlicher oder -politischer Diskurse. So verständlich dies angesichts tausender Studien, des Gewimmels von "multifaktoriellen Ursachengefügen", dem Wunsch "zu helfen" und nicht zuletzt der Verkaufsinteressen von Unternehmen der Gesundheitswirtschaft sein mag, so problematisch erweist sich dies nicht selten, wenn die Richtigkeit der Annahmen für diese Vorgehensweisen überprüft werden.
Das neueste Beispiel stammt aus der Forschung über die Bedeutung des Cholesterinspiegels für das Risiko einer Herz-/Kreislauferkrankung. Seit vielen Jahren wird dazu zwischen einem "bösen" (LDL-Wert=Low Density Lipoprotein) und einem "guten" (HDL-Wert=High Density Lipoprotein) Cholesterinwert unterschieden.
Bereits seit längerem wird allerdings am kausalen Zusammenhang eines hohen Gesamt-Cholesterinspiegels mit der Plaquebildung in Blutgefäßen als Einflussfaktor auf das Risiko von Herz-/Kreislauferkrankungen und damit am Nutzen cholesterinwertsenkender Interventionen durch spezielle Lebensmittel und Medikamente gezweifelt. Mit der Differenzierung nach HDL- und LDL-Werten schien ein Teil der Zweifel ausgeräumt zu sein und spezifischere risikovermeidende oder -senkende Interventionen doch möglich zu sein. Eine Senkung des "bösen" und eine Anhebung des "guten" Wertes versprach präventive Wunder.
Eine im Mai 2012 in der Fachzeitschrift "Lancet" veröffentlichte Studie zahlreicher internationaler WissenschaftlerInnen hält nun aber auch die Annahme, das "gute" Cholesterin und damit auch die Anhebung seines Werts durch Vitamine und andere Hilfsmittel wirkten kausal auf das Risiko kardiovaskulärer Erkrankungen, für zweifelhaft.
Sie stützen sich dabei u.a. darauf, dass es Personen gibt, die mit Genen ausgestattet sind, die ihnen lebenslänglich einen natürlich hohen Spiegel des "guten" Cholesterols verschaffen und umgekehrt Personen, deren genetische Ausstattung ebenfalls natürlich zu einem leicht niedrigeren Level des "guten" Cholesterols führen. Drei große, in den letzten Jahren abgeschlossene randomisierte Studien und weitere Analysen der Forschergruppe zeigen nun, dass die Personen mit dem natürlich höheren Niveau von "gutem" Cholesterol kein geringeres Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen wie einen Herzinfarkt haben.
Sie bestätigen ausdrücklich, "that genetically raised plasma HDL cholesterol is not associated with risk of myocardial infarction". Und jenseits der genetischen Disposition folgern sie auf der Basis der Gen- und Erkrankungsdaten von 53.500 Personen noch praktischer: "These results show that some ways of raising HDL cholesterol might not reduce risk of myocardial infarction in human beings. Therefore, if an intervention such as a drug raises HDL cholesterol, we cannot automatically assume that risk of myocardial infarction will be reduced."
Dabei bestreiten die VerfasserInnen nicht, dass das Niveau des LDL oder des HDL in vielen Beobachtungsstudien immer wieder im Zusammenhang mit dem Herzinfarktrisiko auftaucht und assoziiert erscheint. Der von der "New York Times" zu dieser Studie interviewte Direktor des staatlichen Instituts für kardiovaskuläre Erkrankungen, Michael Lauer", vergleicht den HDL-Wert mit dem "Stau-/Unfall-Voraus"-Warnschild bei Verkehrsunfällen. Nicht dieses Schild sei die Ursache für den Stau, sondern der Unfall und niemand käme auf die Idee, sich zur Staubeseitigung gegen das Schild zu wenden. Ebenso träten neben einem niedrigen HDL-Wert noch zahllose Faktoren auf, die überwiegend das erhöhte Infarktrisiko bedingten: "Our hypothesis ist hat much of the association may be due to these other factors."
Hinter die einfache, natürlich massiv von Herstellern und vielen Gesundheitsberatern erzeugte oder geförderte Vorstellung mittels Vitaminen (z.B. Niacin) oder Medikamenten den HDL-Spiegel heben und das Infarktrisiko senken zu können, müssen daher mehrere Fragezeichen gesetzt werden.
Ob und wie die sicherlich komplexen Ergebnisse der von den US National Institutes of Health, dem The Wellcome Trust, der European Union, der British Heart Foundation und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten in den Präventions- und Behandlungsalltag Eingang finden oder ob sich die Hersteller von "guten" HDL-erhöhenden Arzneimittel durchsetzen, verdient für die nächste Zeit besondere Aufmerksamkeit.
In dem in derselben Ausgabe des "Lancet" veröffentlichten Kommentar "Mendelian randomisation, lipids, and cardiovascular disease" von S. Harrison et al. unterstreichen dessen Autoren, die gewählte genetische Forschungsmethode "mendelian randomisation" der HDL-Wirkungsforscher sei "likely to yield insights that can both guide public health policy and prioritise potential therapeutic targets."
Der Aufsatz "Plasma HDL cholesterol and risk of myocardial infarction: a mendelian randomisation study" von Benjamin F Voight et al. ist am 17. Mai 2012 als "early online publication" der Zeitschrift "The Lancet" erschienen. Das Abstract ist kostenlos erhältlich.
Der Artikel "Doubt Cast on the 'Good' in 'Good Cholesterol'" von Gina Kolata ist in der "New York Times" vom 16. Mai 2012 erschienen und kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 17.5.12
Die Lebenserwartung selbst fitter älterer Erwachsenen hängt maßgeblich von der sozialen Verletzlichkeit oder sozialen Defiziten ab
 Dass nicht die stark mit dem biologischen Altern assoziierte körperliche Gebrechlichkeit alleine Einfluss auf die künftige Lebenserwartung hat, sondern darauf auch nicht-altersbedingte soziale Verhältnisse und Beziehungen Einfluss nehmen, ist weitgehend bekannt. Wie stark der Einfluss welcher sozialen Faktoren ist, aber weniger.
Dass nicht die stark mit dem biologischen Altern assoziierte körperliche Gebrechlichkeit alleine Einfluss auf die künftige Lebenserwartung hat, sondern darauf auch nicht-altersbedingte soziale Verhältnisse und Beziehungen Einfluss nehmen, ist weitgehend bekannt. Wie stark der Einfluss welcher sozialen Faktoren ist, aber weniger.
Eine Sekundäranalyse der Daten von 5.703 zum Start der "Canadian Study of Health and Aging" 70-jährigen und älteren TeilnehmerInnen zeigt nun für eine Untergruppe von 584 zu Hause lebenden Personen mit einem durchweg guten gesundheitlichen und funktionellen Zustand Folgendes:
Das Drittel dieser Personen mit großen Defiziten bei 40 sozialen Merkmalen hatte nach 5 Jahren eine gegenüber dem Drittel der am wenigsten sozial verletzlichen oder beeinträchtigten AltersgenossInnen eine um das 2,5-Fache erhöhte Sterbewahrscheinlichkeit. Bei den Personen mit einer insgesamt stabilen sozialen Situation belief sich die Fünfjahresmortalität auf 10,8% und erhöhte sich bei den Personen mit der höchsten sozialen Verletzlichkeit auf 32,5%. Die absolute Mortalitäts-Differenz betrug damit hochsignifikante 22%.
Dazu wurde mit 31 selbst berichteten Indikatoren für Gesundheitsdefizite wie etwa Krankheiten und funktionelle Defizite ein individueller Gebrechlichkeitsindex erstellt. Der Wert für die soziale Verletzlichkeit beruht auf Angaben zu 40 Items zu denen z.B. der Familienstand, soziales Engagement, soziale Unterstützung, das Gefühl sein eigener Herr zu sein oder der soziale Status gehören.
Für die 5-Jahresanalyse wurde nur die weitere Entwicklung der älteren Personen untersucht, die kein oder nur ein gesundheitliches Defizit von maximal 31 möglichen Defiziten hatten.
Von der Studie "The impact of social vulnerability on the survival of the fittest older adults" von Melissa K. Andrew et al. - erschienen in der Zeitschrift "Age and Ageing" vom 26. Januar 2012 gibt es kostelos nur das Abstract.
Bernard Braun, 23.4.12
Ärztliche "Überweisungen" von bewegungsarmen Personen in Bewegungsprogramme sind fast wirkungslos
 Die in Deutschland vorgedachte oder bevorstehende Einführung eines speziellen "Rezepts" mit dem niedergelassene Ärzte bewegungsarmen und übergewichtigen Patienten körperliche Aktivitäten "verordnen" können, ist mit der Hoffnung verbunden, dass damit mehr Wirkung erzielt werden kann als mit gar keiner speziellen Behandlung oder dem einfachen ärztlichen Ratschlag, sich doch mal mehr zu bewegen.
Die in Deutschland vorgedachte oder bevorstehende Einführung eines speziellen "Rezepts" mit dem niedergelassene Ärzte bewegungsarmen und übergewichtigen Patienten körperliche Aktivitäten "verordnen" können, ist mit der Hoffnung verbunden, dass damit mehr Wirkung erzielt werden kann als mit gar keiner speziellen Behandlung oder dem einfachen ärztlichen Ratschlag, sich doch mal mehr zu bewegen.
Die Ergebnisse eines systematischen Reviews und einer Metaanalyse von acht randomisierten kontrollierten Studien mit 5.190 TeilnehmerInnen dämpfen allerdings die Erwartungen gewaltig. In diesen Studien wurden die Effekte gezielter Beratung und "Überweisungen" zu professionellen Anbietern von Programmen zur Förderung der körperlichen Aktivität (überwiegend 10 bis 12 Wochen in der Freizeit laufende Programme) auf die Dauer der körperlichen Bewegung, die körperliche Fitness, das Übergewicht, den Blutdruck und ähnliche Körperwerte, das psychische Wohlbefinden ("well-being") oder die gesundheitsbezogene Lebensqualität bei überwiegend sitzend Arbeitenden untersucht.
Bei der Dauer von wenigstens mäßig intensiven körperlichen Aktivitäten von mindestens 90-150 Minuten pro Woche zeigte sich zunächst 6 und 12 Monate nach Beginn entsprechender Studien eine im Vergleich zu den wie gewohnt behandelten Personen um 16% höhere Chance für die überwiesenen Personen diese Marke zu erreichen. Nachdem aber bei den überwiesenen Personen der nicht geringe Anteil der Abbrecher mit berücksichtigt wurde, gab es keine signifikanten Unterschiede mehr. Dies gilt insgesamt auch für die körperliche Fitness und die genannten Körperwerte. Die Studien, welche die Wirkungen der "Bewegungsübungen auf Rezept" auf Ängste oder depressive Zustände untersuchten, zeigen kein einheitliches Bild. Die Heterogenität der Ergebnisse zu den Wirkungen auf die Lebensqualität war so groß, dass keine Metaanalyse durchgeführt werden konnte.
Beim Vergleich der Effekte von "Bewegung auf Rezept" mit einem aus motivierender Beratung und Trainer-Bewegungsprogramm bestehendem alternativen Angebot für körperliche Aktivitäten fanden die britischen Metaanalytiker bei keinem der ausgewählten Indikatoren signifikante Unterschiede. Dies gilt auch dann, wenn zusätzlich zur Überweisung noch verhaltensverändernde Angebote in Anspruch genommen werden.
Dass mit dem Thema "Bewegung auf Rezept" auch sachkundiger und seriöser als in Deutschland umgegangen werden kann, zeigt das Beispiel des britischen "National Health Service (NHS)". Dort hat das "National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)", eine Art "Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG)", dem NHS empfohlen, diese Leistung wegen der unzulänglichen Evidenz nicht oder lediglich probehalber innerhalb einer quantitativ begrenzten kontrollierten Nutzenstudie einzuführen.
Im Vergleich mit dem von den Reviewern als nahezu wirkungslos bewerteten einfachen ärztlichen Ratschlag empfiehlt der Verfasser eines Editorials den Allgemeinärzten trotzdem, den Patienten mit einem erhöhten Erkrankungsrisiko gezielt Bewegungsprogramme zu empfehlen und sie dort hin zu überweisen - wohlwissend, dass der erwartbare Nutzen gering ist. In jedem Fall empfiehlt es sich aber selbst dann, wenn man diesem Rat folgt, die vorhandenen Ressourcen hauptsächlich für die Entwicklung wirkungsvollerer Interventionen als für die "Bewegung auf Rezept" zu nutzen.
Von der Studie gibt es entweder das Abstract oder auch den gesamten Text kostenlos: Pavey TG et al. (2011): Effect of exercise referral schemes in primary care on physical activity and improving health outcomes: Systematic review and meta-analysis. BMJ 2011 Nov 6; 343:d6462.
Vom Editorial Promoting physical activity in primary care. von Williams NH. (BMJ 2011 Nov 6; 343:d6615) gibt es kostenlos lediglich das Abstract.
Bernard Braun, 18.4.12
Rolle der Schule und der dortigen Ernährung für die Übergewichtigkeit überschätzt
 Für eine repräsentative Gruppe von 21.410 us-amerikanischen Grund- und Mittelschülern zeigt eine jetzt veröffentlichte Längsschnittuntersuchung, dass das möglicherweise zusätzlich zum offiziellen schulischen Ernährungsangebot existierende inner- und zum Teil außerschulische Angebot von Fastfood-Nahrungsmitteln und Getränken sich nicht signifikant auf die Entwicklung des (Über-)Gewichts der Mittelschulkinder in der achten Klasse ausgewirkt hat.
Für eine repräsentative Gruppe von 21.410 us-amerikanischen Grund- und Mittelschülern zeigt eine jetzt veröffentlichte Längsschnittuntersuchung, dass das möglicherweise zusätzlich zum offiziellen schulischen Ernährungsangebot existierende inner- und zum Teil außerschulische Angebot von Fastfood-Nahrungsmitteln und Getränken sich nicht signifikant auf die Entwicklung des (Über-)Gewichts der Mittelschulkinder in der achten Klasse ausgewirkt hat.
TeilnehmerInnen dieser Teilstudie der "Early Childhood Longitudinal Study" waren Angehörige der Kindergartenklasse 1998/99, deren persönlichen und sozialen Lebensumstände oder Merkmale bis zum Erreichen der achten Schulklasse im Jahr 2006/2007 untersucht wurden. Die Kinder besuchten 1.000 zufällig ausgewählte öffentliche oder private Schulen in 100 Bezirken oder Gruppen von Bezirken quer durch die USA. Die Mindestanzahl der StudienteilnehmerInnen pro Schule betrug zu Beginn 23.
Die für alle 19.450 SchülerInnen, die in der fünften und achten Klasse noch dieselbe Schule besuchten, erhobenen Daten waren die Entwicklung ihres Body Mass Index (BMI), die technischen und sozialen Charakteristika ihrer Schule, die lokalen Einkommensverhältnisse, die sozialen Merkmale ihrer Familien und vor allem die Art oder Qualität der in der Schule angebotenen Nahrungsmittel und Getränke unter besonderer Berücksichtigung des Angebots von fett- und kalorienreichen festen oder flüssigen Nahrungsmitteln.
Nach einer sehr aufwändigen Datenaufbereitung förderte die Analyse einige Ergebnisse zu Tage, die auch von den beiden Autorinnen der Studie nicht erwartet worden waren:
• Eine Querschnittsanalyse der Daten zu Beginn der Verlaufsstudie zeigte zunächst die erwartbaren kräftigen Assoziationen des Gewichts der teilnehmenden Kinder mit der sozialen Situation der Familie (z.B. Beschäftigung der Eltern) oder ihren ethnischen Charakteristika.
• Eine Längsschnittanalyse zum Gewicht der Kinder zwischen dem 5. und 8. Schuljahr zeigte dann aber, dass sich in diesen drei Beobachtungsjahren weder diese sozialen Charakteristika noch vor allem die Art der in den Schulen angebotenen Nahrungsmittel signifikant auf die Entwicklung des Gewichts auswirkten. Auch Subgruppenanalysen nach dem sozioökonomischen Status, dem Geschlecht oder der Ethnie der Kinder oder ihrer Eltern identifizierten nur mehr oder weniger schwache Zusammenhänge, die sämtlich zufälliger Art waren.
Im Kern bestätigt diese Untersuchung auf der qualitativ hochwertigen Basis einer für diese Bevölkerungsgruppe langen Längsschnittanalyse die Ergebnisse einer Reihe von Querschnitts- oder kurzen Längsschnittuntersuchungen. In diesen hatten sich ausschließlich auf die Ernährung oder auch Bewegung in der Schule konzentrierten Interventionen als oft nicht erfolgreich bei der Reduktion des Übergewichts der Kinder und Jugendlichen erwiesen.
Zur Erklärung und richtigen Einordnung ihrer Funde nennen die Autorinnen mehrere Faktoren: Erstens geben sie zu bedenken, dass der Schulalltag so durchstrukturiert ist, dass er nur wenig Zeitfenster für ausgiebiges oder gar übermäßiges Essen bietet. Zweitens könnte das häusliche und sonstige außerschulische Umfeld der Schüler eine viel größere Bedeutung für die Entwicklung des Gewichts haben als in dieser aber auch mehreren anderen Studien zunächst angenommen wurde. Ausschließen mögen die WissenschaftlerInnen auch nicht, dass sich die weitere Aufnahme von Fast-Food-Produkten in der Schule nicht doch noch auf das Gewicht der älteren SchülerInnen auswirkt. Auch wenn sich Bedingungen und Interventionen in der Schule also nicht gravierend auf das Gewicht der hier untersuchten SchülerInnen auswirkten, halten die beiden Sozialwissenschaftlerinnen daran fest, dass in Schulen durchaus eine Wissens- und Verhaltensgrundlage gelegt werden kann, die im größeren Kontext auch positiv dazu beitragen, das Gewicht und andere gesundheitlich relevante Faktoren zu verändern.
Den 17-seitigen Aufsatz "Competitive Food Sales in Schools and Childhood Obesity: A Longitudinal Study" von Jennifer Van Hook und Claire E. Altman, erschienen in der Fachzeitschrift "Sociology of Education" (2012; 85(1): 23-39, ist komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 3.4.12
Zunehmende Fragwürdigkeit von Cholesterinwerten als Risikofaktoren und der Einnahme von Cholesterinsenkern bei älteren Menschen
 Die Annahme, ein hoher Gesamtcholesterinspiegel oder hohe Werte des "bösen" "Low Density Lipoprotein (LDL)-Cholesterins" in Kombination mit niedrigen Werten des "guten" "High Density Lipoprotein-(HDL)-Cholesterins" seien bedeutende Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Morbidität und -mortalität, führte nicht nur zu Milliarden von Laboruntersuchungen der Cholesterinwerte, sondern auch dazu, dass die Cholesterinsenker, und darunter besonders die Statine zu den Blockbustern der Pharmabranche gehören.
Die Annahme, ein hoher Gesamtcholesterinspiegel oder hohe Werte des "bösen" "Low Density Lipoprotein (LDL)-Cholesterins" in Kombination mit niedrigen Werten des "guten" "High Density Lipoprotein-(HDL)-Cholesterins" seien bedeutende Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Morbidität und -mortalität, führte nicht nur zu Milliarden von Laboruntersuchungen der Cholesterinwerte, sondern auch dazu, dass die Cholesterinsenker, und darunter besonders die Statine zu den Blockbustern der Pharmabranche gehören.
Seit mittlerweile Jahrzehnten stellen aber methodisch hochwertige Studien auch immer wieder die erwarteten negativen Effekte der "zu hohen" Cholesterinspiegel und damit auch den Nutzen von Veränderungen des Lebensstils oder der Ernährung sowie der medikamentösen Behandlung wenigstens für einen Teil der Bevölkerung in Frage.
Bereits 1994 kamen Krumholz et al. in einer prospektiven Kohortenstudie in den USA mit 997 über 70-jährigen TeilnehmerInnen zu folgendem Ergebnis: Die Hypothese, hohe Cholesterinspiegel oder niedrige HDL-Werte seien wichtige Risikofaktoren für die Gesamtsterblichkeit, das Risiko an koronaren Herzerkrankungen zu sterben, wegen eines Herzinfarkts ins Krankenhaus zu kommen oder an einer instabilen Angina pectoris zu leiden, wird für Personen dieses Alters eindeutig nicht unterstützt.
Eine im Herbst 2011 veröffentlichte prospektive Kohortenstudie aus den Niederlanden mit 5.750 TeilnehmerInnen im Alter von 55 bis 99 Jahren weist nach einer fast 14 Jahre währenden Untersuchungszeit sogar auf einen möglichen gesundheitlichen Nutzen eines hohen Gesamtcholesterinspiegels hin. So war ein höherer Gesamtcholesterinwert über alle Altersstufen hinweg signifikant mit einem geringeren Risiko assoziiert, an einer nicht-kardiovaskulären Erkrankung (vor allem Krebs) zu sterben. Mit jedem Millimol pro Liter Blut (mmol/L) mehr sank das genannte alters- und geschlechtsadjustierte Sterberisiko um rund 12%. Dabei gab es deutliche altersspezifische Unterschiede: Bei den 65- bis 74-jährigen TeilnehmerInnen sank dieses Risiko mit jedem Millimol/Liter mehr an Gesamtcholesterin ebenfalls um 12%, bei den 75- bis 84-Jährigen um 14% und schließlich bei den 85 Jahre alten und älteren Personen um 20%. Gleichzeitig fanden die holländischen ForscherInnen keine signifikanten Assoziationen zwischen dem Wert des "guten" Cholesterin und der Sterblichkeit an nicht-kardiovaskulären Krankheiten.
In einer zusätzlichen Untersuchung der Zusammenhänge von Cholesterinwerten und der kardiovaskulären Sterblichkeit (vor allem Herzinfarkt und Schlaganfall) zeigte sich nur in einer einzigen Altersgruppe signifikante Zusammenhänge zwischen diesem Risiko und den verschiedenen Cholesterinwerten: Einerseits reduzierte ein Anstieg des Gesamtcholesterinspiegels um 1-Millimol pro Liter bei Personen, die 85 Jahre alt und älter waren, die spezifische Sterblichkeit um 21%. Andererseits senkte aber ein vergleichbarer Anstieg des HDL-Wertes die Herz-Kreislaufmortalität um 59%.
Auch wenn die AutorInnen nach einer kritischen Auseinandersetzung mit anderen Untersuchungen weitere Forschungen über den genauen Mechanismus der identifizierten Assoziationen für notwendig halten, sprechen ihre Ergebnisse für zweierlei: Zumindest für über 55- oder 65-Jährige müssen hohe Gesamtcholesterin- und LDL-Werte entdramatisiert werden und positive Erwartungen an hohe HDL- oder niedrige LDL-Werte eingeschränkt werden. Der Nutzen der Einnahme von Cholesterinsenkern bei ansonsten gesunden Angehörigen dieser Altersgruppen und besonders bei hochaltrigen Personen über 80 Jahren sollte schließlich gründlich überlegt werden.
Zum Aufsatz "Lack of association between cholesterol and coronary heart disease mortality and morbidity and all-cause mortality in persons older than 70 years" von Krumholz HM, Seeman TE, Merrill SS, Mendes de Leon CF, Vaccarino V, Silverman DI, Tsukahara R, Ostfeld AM und Berkman LF. in "JAMA" (1994 Nov 2; 272(17): 1335-40) gibt es kostenlos das Abstract.
Zum Aufsatz "Association between serum cholesterol and noncardiovascular mortality in older age" von Newson RS, Felix JF, Heeringa J, Hofman A, Witteman JC und Tiemeier H., veröffentlicht im "Journal of American Geriatric Society" (2011; 59 (10): 1779-85) gibt es kostenlos ebenfalls das Abstract.
Bernard Braun, 2.4.12
Prävention von Übergewichtigkeit und Fettsucht ist bei 6-12-jährigen Kindern möglich - erfordert aber komplexe Maßnahmen
 Die systematische Auswertung aller 55 bis zum Jahr 2010 abgeschlossenen randomisierten kontrollierten Studien über den Nutzen und die Wirksamkeit präventiver Maßnahmen gegen Übergewicht oder Fettsucht bei Kindern (darunter 37 neuere Studien) in der aktuellen Fassung eines Cochrane-Reviews liefert ein zwiespältiges Ergebnis: Einerseits empfehlen die Reviewer einen vorsichtigen Umgang mit den Ergebnissen, wegen der Heterogenität der Studien und den Schwierigkeiten, die Wirkung einzelner Interventionen und Programme zu identifizieren. Andererseits nennen sie aber Maßnahmen, die sie als präventiv nützlich bewerten. Sie belegen dies u.a. durch eine Metaanalyse mit 37 Studien und 27.946 Kindern in der sich eine spürbare Verringerung des als Indikator weit verbreiteten Body Mass Index (BMI) zeigt.
Die systematische Auswertung aller 55 bis zum Jahr 2010 abgeschlossenen randomisierten kontrollierten Studien über den Nutzen und die Wirksamkeit präventiver Maßnahmen gegen Übergewicht oder Fettsucht bei Kindern (darunter 37 neuere Studien) in der aktuellen Fassung eines Cochrane-Reviews liefert ein zwiespältiges Ergebnis: Einerseits empfehlen die Reviewer einen vorsichtigen Umgang mit den Ergebnissen, wegen der Heterogenität der Studien und den Schwierigkeiten, die Wirkung einzelner Interventionen und Programme zu identifizieren. Andererseits nennen sie aber Maßnahmen, die sie als präventiv nützlich bewerten. Sie belegen dies u.a. durch eine Metaanalyse mit 37 Studien und 27.946 Kindern in der sich eine spürbare Verringerung des als Indikator weit verbreiteten Body Mass Index (BMI) zeigt.
In den als nützlich bewerteten Programmen spielten vor allem die folgenden Aktivitäten und Komponenten die zentrale Rolle:
• Ein Curriculum zur Prävention von kindlichem Übergewicht, das zum einen die Elemente gesunde Ernährung, körperliche Bewegung und Körperbild umfasste und zum anderen so weit wie möglich in den normalen schulischen Lehrplan integriert war.
• Mehr Angebote zur körperlichen Bewegung und zur Entwicklung fundamentaler Bewe-gungsfertigkeiten während der gesamten Schulwoche und nicht nur an einem einzigen Stundenplan-Platz.
• Eine verbesserte Qualität der Nahrungsmittel, welche die SchülerInnen in der Schule er-halten bzw. erwerben können.
• Die Entwicklung und Gestaltung einer Umgebung und Kultur, die Kinder dabei unterstützen, jeden Tag wie selbstverständlich nährstoffreiche Lebensmittel zu essen und aktiv zu bleiben.
• Die Unterstützung der LehrerInnen und anderem Schulpersonal bei ihren Versuchen, Gesundheitsförderungsstrategien und -Aktivitäten im Schulalltag zu implementieren (z.B. durch Weiterbildung und den Auf- und Ausbau von Informations- und Manage-mentressourcen)
• Gemeinsame gesundheitsfördernde Aktivitäten mit Eltern, um die Schüler auch zu Hause anzuhalten, aktiver zu sein, mehr nährstoffreiche Nahrung zu sich zu nehmen und weniger Zeit vor Bildschirmen zu verbringen.
Angesichts der Fülle der bisher veröffentlichten Studien und der Anzahl noch laufender Studien empfehlen die Reviewer ferner, keine weiteren Interventionsstudien mehr zu starten, die eine kurze Laufzeit haben und vorrangig auf das individuellen Verhalten von Schulkindern im Alter von sechs bis 12 Jahren gerichtet sind. Stattdessen sollten Studien mit mehr TeilnehmerInnen, längerer Laufzeit, Kosten-Nutzen-Analysen und einer Analyse der unerwünschten Wirkungen untersuchen, welche der vielen Einzelaktivitäten und Maßnahmenbündel ein optimales Angebot für Interventionen auf der Bevölkerungsebene darstellen. Zusätzlich sollten künftig mit Vorrang die Evidenzlücken für präventive Interventionen bei 0-3-jährigen Kindern und Heranwachsenden geschlossen werden.
Von dem 2011 aktualisierten Cochrane-Review "Interventions for preventing obesity in children" von Waters E, de Silva-Sanigorski A, Hall BJ, Brown T, Campbell KJ, Gao Y, Armstrong R, Prosser L, Summerbell CD. (Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 12.) gibt es kostenlos das gewohnt umfangreiche Abstract.
Bernard Braun, 7.3.12
Wodurch können Interventionen für mehr körperliche Aktivitäten von Schülerinnen wirksamer werden?
 Je früher Menschen die Bedeutung von körperlichen Aktivitäten für die Gesundheit und das Wohlbefinden erkennen und sie in ihr tägliches Leben integrieren, desto früher und möglicherweise auch nachhaltiger treten die erwünschten individuellen und gesellschaftlichen Wirkungen ein.
Je früher Menschen die Bedeutung von körperlichen Aktivitäten für die Gesundheit und das Wohlbefinden erkennen und sie in ihr tägliches Leben integrieren, desto früher und möglicherweise auch nachhaltiger treten die erwünschten individuellen und gesellschaftlichen Wirkungen ein.
Ob derartige Interventionen bereits bei 5 bis 18-jährigen Schulmädchen sinnvoll, möglich und dann auch noch wirksam sind, versuchte eine Gruppe von GesundheitswissenschaftlerInnen aus Spanien und den USA mittels eines systematischen Reviews genauer zu klären.
Dieser umfasste 29 zwischen 2000 und 2010 in englischer Sprache veröffentlichte Studien mit 21 verschiedenen Interventionsarten, deren primäre Zielgruppe die genannte Altersgruppe und deren körperliche Aktivitäten war. Etwas mehr als die Hälfte der Studien wurde von den ReviewerInnen als von hoher methodischer Qualität (z.B. randomisierte kontrollierte Studien), der Rest als von eher geringerer methodischer Qualität bewertet.
10 der 21 verschiedenen Interventionsarten wirkten sich beachtenswert positiv auf die Häufigkeit oder Intensität körperlicher Aktivitäten aus und bei 7 Studien handelte es sich um methodisch hochwertige. Alle wirksamen Interventionen umfassten mehrere inhaltlich verschiedenartige inhaltliche Inputs und Vermittlungsformen. Zu den erfolgreichen Programmen der Erziehung für mehr körperliche Aktivitäten gehören Angebotspakete oder ein sozioökologischer Rahmen ("socioecological framework"), die bzw. der gleichzeitig die einzigartigen körperbezogenen Bedürfnisse von Mädchen und jungen Frauen berücksichtigen, unterschiedlichste praktische Übungen inner- und außerhalb der Schulen und Angebote umfassen und in denen "Vorbilder" oder Personen eine Rolle spielen, die von den Mädchen besonders respektiert werden.
Zu den 11 Studien, deren Interventionen insgesamt unwirksam waren, gehören solche bei denen z.B. allein ein einwöchiges Trainingscamp oder eine mediengestützte Bildungswoche die zentrale Rolle spielten. Bei 8 unwirksamen Interventionen standen Instrumente im Vordergrund, mit denen die Unterstützung der Familie für die Bemühungen um mehr körperlicher Aktivitäten der Kinder und Jugendlichen mobilisiert werden sollte. Obwohl also "Vorbildpersonen" eine wirkungsfördernde Rolle spielen, gehören Familienmitglieder nicht notwendigerweise dazu.
Für den 2011 in der Zeitschrift "Health Education Research" ( 26 [6]: 1025-1049) erschienenen umfangreichen Aufsatz "Interventions to promote physical activity among young and adolescent girls: a systematic review" von Maria J. Camacho-Miñano et al. ist kostenlos das Abstract zugänglich.
Bernard Braun, 1.2.12
Aufwändigere Intervention für mehr körperliche Aktivitäten bei 75+Jährigen auch 1 ½ Jahre nach Interventionsende wirksam!
 Die Entwicklung wirksamer Interventionsformen zur Verbesserung der körperlichen Aktivität von älteren Erwachsenen und die u.a. dadurch angestrebte Prävention von Behinderung sind wichtige Public Health-Ziele. Zu den wichtigsten bekannten Hindernissen auf dem Weg zu diesen Zielen gehören die zeitliche Begrenztheit der erwünschten Effekte und die Gefahr, bestimmte Zielgruppen mit den gewählten Interventionsmethoden zu verfehlen. Vielfach scheuen daher Krankenkassen oder Anbieter derartiger Leistungen, diese für ältere Personen anzubieten.
Die Entwicklung wirksamer Interventionsformen zur Verbesserung der körperlichen Aktivität von älteren Erwachsenen und die u.a. dadurch angestrebte Prävention von Behinderung sind wichtige Public Health-Ziele. Zu den wichtigsten bekannten Hindernissen auf dem Weg zu diesen Zielen gehören die zeitliche Begrenztheit der erwünschten Effekte und die Gefahr, bestimmte Zielgruppen mit den gewählten Interventionsmethoden zu verfehlen. Vielfach scheuen daher Krankenkassen oder Anbieter derartiger Leistungen, diese für ältere Personen anzubieten.
Eine Gruppe finnischer GesundheitswissenschaftlerInnen hat sich dagegen in den Jahren 2003 bis 2005 mit einer 632 Personen umfassenden Gruppe im Alter von 75 bis 81 Jahren in einer randomisierten kontrollierten Studie die Wirkung einer mehrstufigen bewegungsbezogenen Intervention über zwei Jahre angeschaut. Die TeilnehmerInnen waren vor Studienbeginn noch relativ mobil, hatten keine schweren physischen oder psychischen Erkrankungen aber verhielten sich auch so immobil oder bewegungsarm, dass sie ein Risiko für damit assoziierte Beeinträchtigungen oder Behinderungen aufwiesen.
Die Intervention in der Interventionsgruppe bestand aus einem "face-to-face"- Treffen mit Physiotherapeuten und Bewegungsexperten und aus Telefonkontakten und -beratungen, die für 2 Jahre alle vier Monate stattfanden. Ziel der Beratungen war, die Beteiligung der TeilnehmerInnen an sportlichen Aktivitäten zu erhöhen und körperliche Bewegung zur Gewohnheit werden zu lassen.
Nach Ablauf der 2 Interventionsjahre war der Behandlungseffekt im Bereich von Wasser-Aerobic und Fitnesslauf in der Interventionsgruppe signifikant um das 1,5-Fache (odds ratio=2,49) oder um 58% (odds ratio=1,58) höher als in der Kontrollgruppe. Auch bei den Fitnessübungen und dem Gewichtetraining gab es absolute Vorteile für die TeilnehmerInnen aus der Interventionsgruppe, die aber statistisch nicht signifikant waren.
Eine weitere Untersuchung der Interventionswirkungen, die anderthalb Jahre nach Beendigung der zweijährigen Intervention stattfand, fand immer noch einen evidenten Interventionseffekt. Der Anteil aller TeilnehmerInnen, der weiter in einem der in der Studie ausgewählten Bereiche körperlich aktiv blieb, sank zwar, fiel aber nicht unter das Ausgangsniveau. Differenziert betrachtet, verschwand der Interventionseffekt aber lediglich bei den Personen, die Wasser Aerobic und Fitnesslaufen betrieben. Die Anzahl der StudienteilnehmerInnen, die Gewichtetraining betrieben oder sich gewohnheitsmäßig aktiver bewegten, war gegenüber den Kontrollgruppenangehörigen auch 18 Monate nach Beendigung der Telefonberatung etc. noch signifikant um das 1,3-Fache (OR 2,33) oder um 58% höher.
Subgruppenanalysen zeigten, dass Personen, die zu Beginn der Intervention körperlich mobil waren, eine höhere und länger anhaltende Wirkung der Intervention erfuhren. Ältere Personen mit manifesten Einschränkungen ihrer Mobilität brauchen wahrscheinlich mehr face-to-face-Beratungsgespräche als ihre mobileren AltersgenossInnen.
Von der Studie Effect of physical activity counseling on physical activity of older people in Finland von Minna Rasinaho et al., erschienen in der Fachzeitschrift "Health Promotion International" (online publiziert am 11. September 2011) ist ein Abstract kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 24.11.11
Kinder sind nicht nur "süß", sondern können ihre Väter auch vor dem Herztod bewahren - je mehr Kinder desto besser!
 Während der positive Zusammenhang zwischen der Fruchtbarkeit der Frauen und einigen Aspekte ihrer Gesundheit vielfach nachgewiesen ist, gab es bisher sehr wenige Untersuchungen, die ähnliche Zusammenhänge bei den Männern untersuchten oder gar nachwiesen.
Während der positive Zusammenhang zwischen der Fruchtbarkeit der Frauen und einigen Aspekte ihrer Gesundheit vielfach nachgewiesen ist, gab es bisher sehr wenige Untersuchungen, die ähnliche Zusammenhänge bei den Männern untersuchten oder gar nachwiesen.
Mit einer Auswertung der Gesundheits- und Sterbedaten von 137.903 US-Amerikanern im Alter zwischen 50 und 71 Jahren, die zu Beginn der Beobachtungszeit nicht an einer kardiovaskulären Erkrankung litten, liegen nun aber eine Reihe von Hinweisen vor, dass auch die Männer von ihrem bzw. ihrer "fertility potential and reproductive fitness" gesundheitlich profitieren. Die Daten wurden im Rahmen der "NIH-AARP Diet and Health Study" in den USA über eine Zeit von 10,2 Jahren erhoben.
92% der Studienteilnehmer hatten wenigstens ein Kind und 50% drei oder mehr Nachkommen. Das Durchschnittsalter der Männer betrug 62 Jahre und fast 95% waren Weiße.
Die Ergebnisse sahen so aus:
• Wenn man die Männer bzw. Väter nach Alter, Ausbildung, Rasse, Personenstand, Einkommen, nach diversen Gesundheitsverhaltensfaktoren und ihrem selbst wahrgenommen Gesundheitszustand adjustiert, also den möglichen Einfluss dieser Faktoren auf den untersuchten gesundheitlichen Effekt ausschließt, haben 50 Jahre und älteren Männer ohne Kinder eine im Vergleich mit Männern mit einem oder mehreren Kindern signifikant um 17% erhöhte Risikorate, wegen einer kardiovaskulären Erkrankung zu sterben.
• Die Untersuchungen zeigen auch, dass die protektive oder lebensverlängernde Wirkung von Kindern mit deren Anzahl zunimmt: Wenn kinderlose Männer mit Vätern von fünf oder mehr Kindern verglichenen werden, ist die genannte Risikorate um 21% erhöht. Das kardiovaskuläre Sterberisiko sinkt zwar stetig, aber nicht linear mit der Anzahl der Kinder.
Trotz einiger von den AutorInnen selber genannten Limitationen ihrer Studie (relativ geringe Dauer und Messprobleme für das reproduktive Potenzial), dürfte der beobachtete Zusammenhang bei künftigen Studien, die z.B. längere Beobachtungszeiten haben, aber eher noch deutlicher und größer werden.
Von dem am 26. September 2011 vorab veröffentlichten Aufsatz "Fatherhood and the risk of cardiovascular mortality in the NIH-AARP Diet and Health Study. von Michael L. Eisenberg et al. aus der Fachzeitschrift "Human Reproduction" ist ein Abstract kostenlos zugänglich.
Bernard Braun, 24.10.11
"No future" für Viele durch "Futures" für Wenige. Fakten zu den unerwünschten Wirkungen von Warentermingeschäften, OTC-Swaps etc.
 Investments im Rohstoff- und damit auch Nahrungsmittelhandel haben sich in den letzten Jahren zu einem Renner auf dem Markt für Kapitalanlagen entwickelt. Ein wachsender Teil der Ernährungsgrundlagen für Milliarden von Menschen wird also über Börsen gehandelt und das von Kapitalanlegern, die weder mit der Produktion noch mit der Verarbeitung von Nahrungsmitteln irgendeine Verbindung bzw. erklärtermaßen daran gar kein Interesse haben. Bei den beispielsweise noch relativ einfach zu verstehenden und weit verbreiteten "Futures" oder "Forwards, also "standardisierten Warentermingeschäfte, mit denen Käufer und Verkäufer anonym über eine Börse die Lieferung einer fixierten Menge an Rohstoffen zu einem bestimmten in der Zukunft liegenden Termin und einem festen Preis vereinbaren", steht am Endpunkt immer seltener ein Handel mit Weizen-, Mais- oder Reiskörnern, sondern nur noch monetäre Gewinne oder Verluste. Dies ermöglicht es auch, dass an den Rohstoffbörsen täglich ein Mehrfaches des gesamten Weltgetreideverbrauchs oder auch der Ölproduktion gehandelt wird.
Investments im Rohstoff- und damit auch Nahrungsmittelhandel haben sich in den letzten Jahren zu einem Renner auf dem Markt für Kapitalanlagen entwickelt. Ein wachsender Teil der Ernährungsgrundlagen für Milliarden von Menschen wird also über Börsen gehandelt und das von Kapitalanlegern, die weder mit der Produktion noch mit der Verarbeitung von Nahrungsmitteln irgendeine Verbindung bzw. erklärtermaßen daran gar kein Interesse haben. Bei den beispielsweise noch relativ einfach zu verstehenden und weit verbreiteten "Futures" oder "Forwards, also "standardisierten Warentermingeschäfte, mit denen Käufer und Verkäufer anonym über eine Börse die Lieferung einer fixierten Menge an Rohstoffen zu einem bestimmten in der Zukunft liegenden Termin und einem festen Preis vereinbaren", steht am Endpunkt immer seltener ein Handel mit Weizen-, Mais- oder Reiskörnern, sondern nur noch monetäre Gewinne oder Verluste. Dies ermöglicht es auch, dass an den Rohstoffbörsen täglich ein Mehrfaches des gesamten Weltgetreideverbrauchs oder auch der Ölproduktion gehandelt wird.
Da die Gewinne für diese Art von Geschäften letztlich nur vom Verbraucher bezahlt werden, stellt sich die Frage, ob "die massenhafte Spekulation auf den Rohstoffmärkten den Preisauftrieb und damit die Not von vielen Millionen Menschen zwar nicht verursacht, aber doch drastisch verschärft." Wenn die Preise für Grundnahrungsmittel wie Weizen, Mais oder Reis seit 2000 um rund 150% gestiegen sind, bedeutet dies für die paar Milliarden Einwohner von Entwicklungsländern, die ihr Einkommen sowieso fast vollständig für die Ernährung verwenden müssen, auch völlig unabhängig von Dürrekatastrophen etc. ein massives öffentliches Gesundheitsproblem.
Dieser Zusammenhang wird aber unter Hinweis auf eine Fülle anderer preistreibender Bedingungen (z.B. Vernachlässigung einer produktiven Landwirtschaft in der 3. Welt oder auch die steigende Nachfrage nach Bio-Treibstoff aus Nahrungsrohstoffen) von Ökonomen unterschiedlichster Provenienz bestritten.
Selbst wenn sich also eine öffentliche Diskussion nicht vom Finanzmarkt-Chinesisch abschrecken lässt, fehlen ihr noch elementare Informationen, die beiden Positionen zu verstehen und sich ein eigenes Urteil zu bilden.
An diesem Zustand will eine im Auftrag der unabhängigen Ernährungsorganisation "foodwatch" erstellte Expertise möglichst viel ändern. Ohne dass die Expertise und ihr Auftraggeber ihre kritische Bewertung der Finanzmarktgeschäfte mit Nahrungsmitteln und Rohstoffen verbergen und auf die Nennung der aus ihrer Sicht Hauptgewinner dieser Geschäfte verzichten, findet man dort eine Fülle systematischer und empirischer Informationen über die Instrumente, die Abläufe und die Effekte dieser Geschäfte.
Dazu gehören etwa folgende Fragen und Thesen:
• Was macht das Brot an der Börse?
• Das globale Rohstoff-Kasino
• Geld und Getreide - Eine lange Geschichte
• So funktioniert der Future-Handel und so funktionieren die Warentermin-(Futures -) Börsen
• Die Geburt der Rohstoff-Indexfonds und so funktionieren Investme nts in Rohst off-Indizes
• Preise und Beweise - Der Anteil der Spekulation am Rohstoffboom
• Futures-Märkte sind (k)ein Null-Summenspiel - Eine kritische Auseinandersetzung mit Lagerthese von Paul Krugman
• Äpfel und Birnen - Wie der Einfluss der Spekulation auf die Preise gemessen werden kann, und wie nicht
• Die Rohölpreise im Strudel der Kapitalmärkte
• Die Hungermacher
• Machtkampf um die Preishoheit - Wer zügelt die Rohstoffspekulanten?
• Instrumente gegen die Rohstoffspekulation
• EMIR, MiFID und die ESMA - Das Tauziehen um die Rohstoffmärkte im Dickicht der EU-Institutionen
Das Ganze wird durch eine kurze Liste weiterführender Literatur und durch vier politische und gesellschaftliche Forderungen von "foodwatch" ergänzt. Darin wird die Einführung von Positionslimits, also eine Begrenzung dieser Art von Spekulationsgeschäften, der Ausschluss institutioneller Investoren (z.B. Pensionsfonds) von derartigen Geschäften, das Verbot von Publikumsfonds und Rohstoffzertifikaten und der Verzicht der Banken auf solche Spekulationsgeschäfte verlangt.
Der trotz der herrschenden semantischen Vernebelung des Geschehens auch für Ökonomie-Laien verständlich geschriebene 88 Seiten umfassende Foodwatch-Report 2011: Die Hungermacher. Wie Deutsche Bank, Goldman Sachs & Co. auf Kosten der Ärmsten mit Lebensmitteln spekulieren kann komplett kostenlos heruntergeladen werden.
Bernard Braun, 18.10.11
Welche Eltern wollen hören, ihr Kind sei "voll fett"? Zur Bedeutung des "wording" von Ärzten für nicht normal gewichtige Kinder
 Eine Ursache für die Schwierigkeiten, objektiv übergewichtige oder adipöse Kinder und Jugendliche sowie ihre Eltern zu Gegenmaßnahmen zu bewegen, ist wahrscheinlich auch das "wording" der Ärzte und vermutlich auch anderer Experten über den Zustand der PatientInnen.
Eine Ursache für die Schwierigkeiten, objektiv übergewichtige oder adipöse Kinder und Jugendliche sowie ihre Eltern zu Gegenmaßnahmen zu bewegen, ist wahrscheinlich auch das "wording" der Ärzte und vermutlich auch anderer Experten über den Zustand der PatientInnen.
Das ist jedenfalls das Ergebnis einer Online-Befragung von 445 für die USA repräsentativen Gruppe von Eltern mit Kindern im Alter von 2 bis 18 Jahren zu 10 weit verbreiteten expertlichen und öffentlichen Bezeichnungen für übergewichtige Kinder und Jugendlichen. Die Wortliste reichte von gewichtig, ungesundes Gewicht, hoher BMI, Gewichtsproblem, übergewichtig, schwergewichtig, pummelig (chubby), fettleibig (obese), extrem fettleibig bis richtig/voll fett (fat).
Nach einer multivariaten Analyse der Antworten auf einer fünfstufigen Skala von erstrebenswert bis nicht erstrebenswert ergab sich Folgendes:
• Die Bezeichnungen gewichtig und ungesundes Gewicht waren für die Eltern am erstrebenswertesten.
• Ungesundes Gewicht und Gewichtsproblem wurden als die Bezeichnungen bewertet, die am meisten dazu motivieren, Gewicht zu verlieren.
• Die Bezeichnungen fettleibig, extrem fettleibig und richtig fett wurden als die am wenigsten erstrebenswerten Bezeichnungen eingestuft. Sie wurden außerdem als die am meisten stigmatisierenden, beschuldigenden und am geringsten motivierenden Bezeichnungen wahrgenommen.
• Die Einschätzungen der Eltern waren über eine Reihe von soziodemografischen Merkmale (z.B. Geschlecht, Alter, Einkommen, Rasse oder Bildung), ihr eigenes Gewicht und das ihrer Kinder hinweg konsistent.
• Die AutorInnen schließen auch nicht aus, dass stigmatisierendes "wording" zu unerwünschten Auswirkungen auf die gesundheitliche Versorgung führen kann: 35% der befragten Eltern gaben an, in einem solchen Fall einen neuen Arzt zu suchen und 24% würden zwar bei dem Arzt bleiben, aber künftig Gespräche vermeiden in denen ihr Kind erneut so bezeichnet werden könnte.
Auch wenn die Studie einige Grenzen aufweist (z.B. ihre hypothetische Fragestellung), die Liste der Bezeichnungen auch für us-amerikanische Verhältnisse bei weitem nicht vollständig ist und viele der Bezeich-nungen in Deutschland anders lauten müssten, sollten Kinder- oder Hausärzte und andere ExpertInnen bei ihrer Wortwahl für nicht normalgewichtige Kinder nach einer vergleichbaren Untersuchung auch in Deutschland sorgfältiger auf nichtstigmatisierende und motivierende Worte achten. Dies gilt im Übrigen auch für untergewichtige Kinder und Jugendliche.
Der Aufsatz "Parental Perceptions of weight terminology that providers use with youth" von Rebecca Puhl et al. ist online am 26. September 2011 in der Fachzeitschrift "Pediatrics" (Volume 128, Number 4: e786-e793) erschienen und komplett kostenlos herunterladbar.
Bernard Braun, 5.10.11
Alkoholmissbrauch bei Kindern und Jugendlichen trotz verschiedener Präventionsmaßnahmen auf hohem Niveau. Was hilft wirklich?
 Im letzten Drogen- und Suchtbericht der Bundesregierung aus dem Mai 2011 wird berichtet, dass der Anteil der 12- bis 17-jährigen Kinder und Jugendliche, die regelmäßig, d.h. mindestens einmal pro Woche Alkohol tranken zwischen 2004 und 2010 von 21,2% auf 12,9% gesunken ist. Auch wenn der Anteil dieser Kinder- und Jugendlichengruppe, der das so genannte Rausch- oder Komasaufen betrieb insgesamt auch leicht zurückging, praktizierte im Jahr 2010 fast jeder Fünfte von ihnen mindestens einmal im Monat diese extrem riskante Art des Alkoholkonsums. Der Bericht belegt außerdem: "Im Jahr 2009 wurden rund 26.400 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 10 und 20 Jahren aufgrund akuten Alkoholmissbrauchs stationär im Krankenhaus behandelt. Dies ist ein Anstieg von 2,8 % gegenüber 2008. Im Vergleich zum Jahr 2000 ist die Zahl um 178 % gestiegen; damals wurden rund 9.500 junge Patientinnen und Patienten mit der Diagnose "akute Alkoholintoxikation" stationär behandelt." Während die Anzahl der so behandlungsbedürftigen 10- bis 15-jährigen Kinder sank, stieg sie für die 15- bis 20-Jährigen an.
Im letzten Drogen- und Suchtbericht der Bundesregierung aus dem Mai 2011 wird berichtet, dass der Anteil der 12- bis 17-jährigen Kinder und Jugendliche, die regelmäßig, d.h. mindestens einmal pro Woche Alkohol tranken zwischen 2004 und 2010 von 21,2% auf 12,9% gesunken ist. Auch wenn der Anteil dieser Kinder- und Jugendlichengruppe, der das so genannte Rausch- oder Komasaufen betrieb insgesamt auch leicht zurückging, praktizierte im Jahr 2010 fast jeder Fünfte von ihnen mindestens einmal im Monat diese extrem riskante Art des Alkoholkonsums. Der Bericht belegt außerdem: "Im Jahr 2009 wurden rund 26.400 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 10 und 20 Jahren aufgrund akuten Alkoholmissbrauchs stationär im Krankenhaus behandelt. Dies ist ein Anstieg von 2,8 % gegenüber 2008. Im Vergleich zum Jahr 2000 ist die Zahl um 178 % gestiegen; damals wurden rund 9.500 junge Patientinnen und Patienten mit der Diagnose "akute Alkoholintoxikation" stationär behandelt." Während die Anzahl der so behandlungsbedürftigen 10- bis 15-jährigen Kinder sank, stieg sie für die 15- bis 20-Jährigen an.
Da die schlimmste Begleiterscheinung übermäßigen Alkoholkonsums, die Alkoholvergiftung, trotz verschiedener Aktivitäten zur Prävention des riskanten Alkoholkonsums anstieg, haben Wissenschaftler in einem so genannten "Health Technology Assessment(HTA)-Bericht untersucht, welche Präventionsmaßnahmen unter welchen Bedingungen Alkoholmissbrauch bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen vermindern oder gar verhindern können.
Als Datenbasis nutzten sie nach einer umfänglichen internationalen Literaturanalyse 59 aus 401 identifizierten Studien. Die überwiegende Zahl der betrachteten Studien stammt aus den USA, nur neun aus Deutschland.
Auch die ausgewählten Studien ermöglichten nicht, einen schlüssigen Überblick über wirksame Maßnahmen und Interventionen zu erlangen. Viele Studien wiesen fundamentale methodische Mängel auf. So wird der Begriff des "riskanten Konsums" in einer großen Bandbreite verwendet. Die Studien differenzieren Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene teilweise mit unterschiedlichen Altersgrenzen. Weiter fehlen Untersuchungen zu jungen Berufstätigen und Minderheiten.
In nicht wenigen Studien wird nicht präzise genug nach der Wirksamkeit der Maßnahmen gefragt bzw. wird sie nicht hinreichend dokumentiert. Keine Untersuchung benennt explizit den Grad der angestrebten Verhaltensänderung. Die Beurteilung der Effektivität der Maßnahmen erfolgt nur im Nachhinein über nachträglich festgelegte Parameter im Vergleich mit Kontrollgruppen.
Dass wirksame Präventionsmaßnahmen nicht einfach und unaufwändig sind, zeigen die in den Studien des HTA-Berichts genannten Erklärungen für den riskanten Alkoholkonsum. Sie umfassen Faktoren der sozialen Umwelt, personale und familiäre Faktoren, den Einfluss von Bezugspersonen/-gruppen sowie alkoholspezifische Wirksamkeitserwartungen und Normen. Nur eine Bündelung von Maßnahmen der Verhaltens- und Verhältnisprävention kann diese Faktoren beeinflussen - ist aber bekanntermaßen sehr schwer vorzunehmen.
Laut HTA-Bericht wirksam sind Familieninterventionsprogramme und personalisierte computergestützte Interventionen an Schulen, Colleges und Universitäten. Darüber hinaus auch kurze motivierende Interventionen und Elemente der Verhältnisprävention (z. B. die Erhöhung von Alkoholpreisen und Steuern). Die Wirksamkeit von massenmedialen Kampagnen ist nicht belegt, ebenso von nicht computergestützer schulischer Prävention. Der Bericht zeigt aber, dass nur wenige selbst dieser Maßnahmen die Häufigkeit oder Menge des Alkoholkonsums dauerhaft reduzieren. Anders als der eingangs zitierte Drogen- und Suchtbericht der Bundesregierung, der auf der Selbstauskunft der Kinder und Jugendlichen beruht, zeigen die von den HTA-AutorInnen untersuchten Studien trotz der Präventionsmaßnahmen sogar einen steigenden Alkoholkonsum mit steigendem Alter der Jugendlichen.
Das Fazit: Gegenwärtig sind Präventionsmaßnahmen zur Reduktion oder Verhinderung von riskantem Alkoholkonsum in Deutschland nicht ausreichend auf ihre nachhaltige Wirksamkeit hin evaluiert.
Die Autoren fordern spezifische und zielgruppenorientierte Präventionsmaßnahmen für den deutschen Kontext. Voraussetzung dafür sind feste Zielgrößen (z. B. Reduktion des Konsums, Änderung des Verhaltens) und eine verbindliche Definition und empirische Bestimmung des "riskanten Alkoholkonsums".
Deshalb empfehlen sie
• Eine stärkere Untersuchung der Bedeutung des Einflusses altersspezifischer Alkoholnormen für die Übergangsphase vom Jugend- zum Erwachsenenalter und deren Berücksichtigung in Präventionskonzepten,
• die Festlegung einer verbindlichen Definition für "riskanten Alkoholkonsum" für Jugendliche
• die Definition von prioritären Zielgruppen
• die Entwicklung von Präventionsmaßnahmen, die die Schulkultur und das Schulzugehörigkeitsgefühl fördern
• die Entwicklung und Durchführung spezieller Interventionsmaßnahmen für männliche 15- bis 17-jährige Jugendliche, für Jugendliche aus gut situierten Familien sowie für berufstätige Jugendliche und junge Erwachsene
• die Evaluation der deutschen Präventionsmaßnahmenund
• eine Preissteigerung für alle alkoholischen Getränke, die stärkere Kontrolle der Umsetzung des Jugendschutzgesetzes und die konsequente Sanktionierung von Verletzungen des Jugendschutzes.
Eine Übersicht und die Bewertung aktueller Präventionsmaßnahmen von riskanten Alkoholmustern und alkoholbezogenen Problemen bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland wird derzeit in einem separaten Berichtsteil erarbeitet.
Der 2011 erschienene 194-seitige HTA-Bericht 112 "Prävention des Alkoholmissbrauchs von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen von Dieter Korczak, Gerlinde Steinhauser und Marcus Dietl ist komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 28.7.11
14-Länder-Report: Warnhinweise auf Zigarettenpackungen sind den meisten Rauchern bekannt und viele von ihnen denken ans Aufhören!
 14 Länder der "Zweiten" (z.B. Russland, Ukraine) oder "Dritten Welt" (z.B. Indien), die sich in dem von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) geförderten "Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)" zusammengeschlossen haben, einigten sich vor mehreren Jahren darauf, Tabakwarenverpackungen mit spezifischen Warnhinweisen zu bedrucken. Diese Hinweise sollten die schädigenden Wirkungen des Tabakkonsums beschreiben, von den nationalen Behörden zugelassen sein, mindestens 30% und besser noch bis zu 50% der sichtbaren Packungsoberfläche bedecken, klar und eindeutig in der Landessprache formuliert sein, mehrere wechselnde Texte verbreiten und vorzugsweise Bilder oder Pictogramme benutzen.
14 Länder der "Zweiten" (z.B. Russland, Ukraine) oder "Dritten Welt" (z.B. Indien), die sich in dem von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) geförderten "Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)" zusammengeschlossen haben, einigten sich vor mehreren Jahren darauf, Tabakwarenverpackungen mit spezifischen Warnhinweisen zu bedrucken. Diese Hinweise sollten die schädigenden Wirkungen des Tabakkonsums beschreiben, von den nationalen Behörden zugelassen sein, mindestens 30% und besser noch bis zu 50% der sichtbaren Packungsoberfläche bedecken, klar und eindeutig in der Landessprache formuliert sein, mehrere wechselnde Texte verbreiten und vorzugsweise Bilder oder Pictogramme benutzen.
Um herauszubekommen, wie viele aktive RaucherInnen man mit diesen Hinweisen überhaupt erreicht und wie viele Personen sich dazu veranlasst fühlen, daran zu denken, das Rauchen aufzuhören, wurde in den 14 Ländern 2008 bis 2010 im Rahmen des "Global Adult Tobacco Survey (GATS)" Befragungen von heranwachsenden (15 Jahre und älter) und erwachsenen Rauchern maschinell produzierter Zigaretten durchgeführt.
Die Situation in diesen Ländern sah so aus:
• Die Raucherprävalenz betrug bei Männern zwischen 9,6% in Indien und 59,3% in Russland. Die Prävalenz des Rauchens von Frauen betrug in allen Ländern weniger als 25%, in Bangladesh, China, Ägypten, Indien, Thailand und Vietnam sogar unter 2%.
• In 12 der 14 Länder hatten 90% und mehr der Männer und in sieben Ländern 75% und mehr der Frauen innerhalb der letzten 30 Tage einen Warnhinweis auf der Zigarettenpackung bemerkt. In Indien und Mexiko hatten bei den Männern nur 78,4% oder 83,5% den Hinweis bemerkt.
• In sechs Ländern dachten darauf mehr als 50% über ein Ende ihres Raucherlebens nach. Mehr als 25% aller männlichen wie weiblichen Raucher taten dies in dreizehn der Länder. Und nur in Polen lag der Anteil unter der 25%-Marke.
• In Bangladesh, Mexiko, Phlippinen, Thailand und der Ukraine hatten Männer und Frauen oder beide im Alter von 65 und mehr Jahren die Warnhinweise wahrscheinlich deutlich weniger gelesen oder zur Kenntnis genommen. In zwei Ländern (Indien und Uruguay) dachten ältere Raucher am wenigsten über den Ausstieg aus dem Zigarettenkonsum nach.
Schade ist, dass auch hier nicht nachgefragt wird, ob aus dem Nachdenken übers Aufhören auch praktisch etwas geworden ist, also wirklich ein relevanter Teil Nichtmehrraucher herausgekommen ist.
Die Ergebnisse sind am 27. Mai 2011 unter dem Titel "Cigarette Package Health Warnings and Interest in Quitting Smoking - 14 Countries, 2008—2010" mit einem ausführlichen Tabellenanhang im "Morbidity and Mortality Weekly Report" (60(20);645-651) der us-amerikanischen CDC veröffentlicht worden und kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 31.5.11
Warum sich ältere Frauen nicht darauf verlassen sollten, ihr Risiko für Herzdefekte durch Grill- oder Backfisch senken zu können?
 Frauen nach den Wechseljahren, die fast jeden Tag gegrillten oder gebackenen Fisch essen, können ihr Risiko für Herzversagen senken, diejenigen, die ihren Fisch in der Pfanne braten, könnten dagegen dasselbe Risiko erhöhen - das sind die Quintessenzen einer Teilstudie in der wissenschaftlich anerkannten "Women's Health Initiative Observational Study (WHI-OS)" mit insgesamt 93.676 multiethnischen Teilnehmerinnen im Alter von 50-79 Jahren. Die gleichzeitig erfolgte Kontrolle von vergleichbaren Effekten von Omega-3-Fettsäure und anderen vergleichbaren Fetten auf die Inzidenz von Herzerkrankungen fand weder positive noch negative Auswirkungen.
Frauen nach den Wechseljahren, die fast jeden Tag gegrillten oder gebackenen Fisch essen, können ihr Risiko für Herzversagen senken, diejenigen, die ihren Fisch in der Pfanne braten, könnten dagegen dasselbe Risiko erhöhen - das sind die Quintessenzen einer Teilstudie in der wissenschaftlich anerkannten "Women's Health Initiative Observational Study (WHI-OS)" mit insgesamt 93.676 multiethnischen Teilnehmerinnen im Alter von 50-79 Jahren. Die gleichzeitig erfolgte Kontrolle von vergleichbaren Effekten von Omega-3-Fettsäure und anderen vergleichbaren Fetten auf die Inzidenz von Herzerkrankungen fand weder positive noch negative Auswirkungen.
Bevor wir einige Details der Studienergebnissen vorstellen, sei schon jetzt auf etwas nicht zum ersten und einzigen Mal Ärgerliches dieses Typs von Studien über die Auswirkungen einzelner Nahrungsmittel oder ihnen beigefügten Stoffe auf dioe Gesundheit der EsserInnen hingewiesen: Am Ende ihrer Ergebnisse entlassen die AutorInnen die LeserInnen nämlich mit dem Hinweis ins Ungewisse, der häufige Konsum gegrillten oder gebackenen Fisches könne auch nur ein Surrogatparameter für einen insgesamt gesünderen Lebensstil sein und damit wären einige Ausprägungen der Esskultur die Ursache für das geringere Herzerkrankungsrisiko. Diese Selbstzweifel sind zwar inhaltlich vollkommen korrekt, ärgerlich ist es trotzdem, weil dieselben AutorInnen diese systematischen Grenzen ihrer Studie eigentlich von Beginn an hätten wissen können oder gar müssen. Wäre es dann nicht besser, Studien dieser Methodik sein zu lassen oder alles zu tun, um Indikatoren für das "gesündere Leben" zu gewinnen und in solche Analysen einzubeziehen? Dies ist auch deshalb zu überlegen, weil die Ergebnisse solcher Studien in den Massenmedien meist auf Schlagzeilenformate wie "5x pro Woche Fisch verhindert Herzinfarkt" gebracht werden, Menschen über den zu erwartenden Nutzen täuschen und möglicherweise von wirklich präventiven Maßnahmen abgalten.
Nachdem die letztlich an dieser Studie teilnehmenden 84.493 postmenopausalen Frauen (Durchschnittsalter 63 Jahre) in mehrere Gruppen mit unterschiedlichem Fisch- und Fettsäurekonsum aufgeteilt wurden und ihre weitere Entwicklung nach dem Studienstart für 10 Jahre untersucht wurde, sahen die wesentlichen Ergebnisse so aus:
• Frauen, die zu Beginn der Studie mindestens 5mal pro Woche gebackenen oder gegrillten Fisch aßen hatten ein um 30% niedrigeres Herzschwächerisiko (hazard ratio 0,70) als andere Frauen, die den so zubereiteten Fisch weniger als einmal pro Monat zu sich nahmen.
• Frauen, die mindestens einmal pro Woche gebratenen Fisch aßen, hatten dagegen ein um 48% höheres Risiko für die Inzidenz einer Herzschwäche.
• Das Risiko einer Herzschwäche war bei denjenigen Frauen, die mindestens einmal in der Woche gegrillten oder gebackenen Lachs, Makrelen oder "bluefish" (ein dunkelfleischiger öliger Fisch) verzehrten, gerade noch auf dem 10%-Niveau der Irrtumswahrscheinlichkeit signifikant niedriger als bei den Esserinnen von weniger fetthaltigen Fische wie dem Snapper oder dem Cod-Fisch.
• Insgesamt trat bei 1.858 Teilnehmerinnen, dies entspricht 2,2% der Kohorte, ein neuer Fall von Herzdefekt oder -versagen auf. Die Vielesserinen von gebackenem oder gegrillten Fisch waren es 19,4 Fälle pro 10.000 Personenjahre, bei den Wenigesserinnen dieser Fischgerichte waren es dagegen 26,7 Fälle. Spitzenreiterinnen waren die Frauen, die mehr als einmal die Woche gebratenen Fisch aßen - mit 39,4 Fällen. Aßen die Frauen aber weniger als einmal im Monat gebratenen Fisch, sank ihr Herzversagens-Risiko auf 20,8 pro 10.000 Personenjahre.
Der Aufsatz "Fish intake and the risk of incident heart failure: The Women's Health Initiative" von Belin R. et al. erschien am 24.5. 2011 vor seiner Druckveröffentlichung in der Schwerpunktausgabe "Heart Failure" der US-Fachzeitschrift "Circulation" online und ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 29.5.11
Gläubig und/oder gesund oder wie weit sind die Kirchenführer von der Empfängnisverhütungspraxis ihrer Gläubigen entfernt?
 Egal ob sich "Pillen-Paul", "unser Papst" oder Teile der besonders in den USA ideologisch und politisch einflussreichen evangelikalen Sekten äußerten und äußern: Empfängnisverhütung durch Kontrazeptiva oder anderen hormonellen Methoden, eine Intrauterin-Spirale oder Sterilisation galt und gilt als mehr oder weniger offen gebrandmarkte Sünde für katholische aber auch eine Reihe protestantischer oder evangelikaler Gläubigen. Ginge es nach den Sexual- und Geburtsexperten in der vatikanischen Glaubenshierarchie sind die einzigen religiös zulässigen Methoden der Empfängnisplanung die meist unzuverlässigen natürlichen Mittel wie beispielsweise die Knaus-Ogino-Methode.
Egal ob sich "Pillen-Paul", "unser Papst" oder Teile der besonders in den USA ideologisch und politisch einflussreichen evangelikalen Sekten äußerten und äußern: Empfängnisverhütung durch Kontrazeptiva oder anderen hormonellen Methoden, eine Intrauterin-Spirale oder Sterilisation galt und gilt als mehr oder weniger offen gebrandmarkte Sünde für katholische aber auch eine Reihe protestantischer oder evangelikaler Gläubigen. Ginge es nach den Sexual- und Geburtsexperten in der vatikanischen Glaubenshierarchie sind die einzigen religiös zulässigen Methoden der Empfängnisplanung die meist unzuverlässigen natürlichen Mittel wie beispielsweise die Knaus-Ogino-Methode.
Egal ob es aber um das empirieresistente rigorose Verbot der präventiv sinnvollen und notwendigen Nutzung von Kondomen für die Bevölkerung im HIV/AIDS-bedrohten Afrika geht oder um die Verhinderung der meist ungewollten und sozialpolitisch seit Billy Clinton Sozialreformen schlecht abgepufferten Frühstschwangerschaften us-amerikanischer High-School-Schülerinnen, weiß man relativ wenig darüber, ob sich die gläubigen Frauen und ihre Männer von den Verboten überhaupt angesprochen fühlen und wie ihre Empfängnisverhütung wirklich aussieht.
Die 2006-2008 im Rahmen des "National Survey of Family Growth (NSFG)" des "National Center for Health Statistics" der USA durchgeführte gezielte Befragung von 7.356 nach eigenen Angaben aktiv religiösen Frauen zwischen 15 und 44 Jahren nach ihrer Nutzung von künstlichen empfängnisverhütenden Mitteln, zeigt daher zum ersten Mal, dass deren Einsatz in den USA die breite Norm und nicht die Ausnahme ist:
• Die Mehrheit der sexuell aktiven Frauen, die nicht gegen ihren Willen schwanger werden will, nutzt vorrangig künstliche kontrazeptive Methoden: 33% lassen sich sterilisieren, 31% nehmen die Anti-Baby-Pille oder setzen eine andere hormonelle Methode ein und 5% haben sich eine Intrauterin-Spirale einsetzen lassen.
• Selbst unter den verheirateten katholischen Frauen praktizieren in den USA nur 3% eine so genannte natürliche Empfängnisverhütung.
• Das Nebeneinander von strenger und praktizierter Religiosität samt entsprechenden Überzeugungen sowie künstlicher Empfängnisverhütung ist also im Alltag der Gläubigen keineswegs unversöhnlich oder zumindest nach den Ergebnissen dieser Studie nicht offensichtlich ethisch belastend.
Was leider in der Befragung nicht geklärt wird ist, wie sich die gegen die Gebote ihrer Glaubensführer empfängnisverhütenden Frauen und Männer bei ihrem "sündigen Tun" fühlen und ob ihr persönlicher Widerstand möglicherweise unerwünschte Folgen für ihre mentale oder psychische Gesundheit hat.
Mehr über die Ergebnisse der Befragung enthält der achtseitige Report "Countering Conventional Wisdom: New Evidence on Religion and Contraceptive Use von Jones RK and Dreweke J vom Guttmacher Institute, der im April 2011 erschienen und kostenlos erhältlich ist.
Bernard Braun, 30.4.11
Vitamin D: "Vitamin of the year" oder meist unnötiger Konsum mit Tendenz zur riskanten Über- und Fehlversorgung?
 Richtig ist, dass die menschliche Haut in den Wintermonaten wegen des geringeren Sonnenlichts weniger Vitamin D produziert. Und richtig ist auch, dass ein Mangel dieses Vitamins nach weiteren dadurch beeinflussten biochemischen Prozessen bei Kindern zu Rachitis bzw. Knochenverbiegungen führen und bei Erwachsenen u.a. zur Osteoporose beitragen kann.
Richtig ist, dass die menschliche Haut in den Wintermonaten wegen des geringeren Sonnenlichts weniger Vitamin D produziert. Und richtig ist auch, dass ein Mangel dieses Vitamins nach weiteren dadurch beeinflussten biochemischen Prozessen bei Kindern zu Rachitis bzw. Knochenverbiegungen führen und bei Erwachsenen u.a. zur Osteoporose beitragen kann.
Ob die von vielen traditionellen und alternativen GesundheitsexpertInnen und Dienstleistern als Gegenmittel empfohlene kräftige Zufuhr des Vitamins D und zusätzlich von Calcium auch noch richtig bzw. notwendig und nützlich ist, lässt sich nach den Erkenntnissen eines gerade veröffentlichten Consensus-Reports des "US-"Institute of Medicine (IOM)" in Zweifel ziehen. Und auch an der ebenfalls weit verbreiteten Annahme, die Einnahme natürlicher Stoffe sei prinzipiell harmlos und in keinem Fall schädlich, gibt es handfeste Zweifel.
Im Auftrag us-amerikanischer und kanadischer Public Health-Einrichtungen reviewte eine beim unabhängigen IOM eingerichtete Gruppe von 14 Wissenschaftlern mehr als 1.000 Studien über das Vitamin D und führte zusätztlich mit zahlreichen Experten Interviews zu verschiedenen Aspekten der Wirkung des Vitamins.
Die wesentlichen Ergebnisse lauteten folgendermaßen:
• Das Vitamin D spielt unbestritten eine positive und nützliche Rolle beim gesamten Stoffwechsel der Knochen und damit auch bei deren Stabilität. Die zusätzliche Zufuhr von Vitamin D kann daher bei spezifischen Mängeln der Knochendichte und einem dadurch erhöhten Osteoporoserisiko durchaus notwendig und sinnvoll sein.
• Nur unzureichende Evidenz gibt es aber für den gesundheitlichen Nutzen von Vitamin D bei Prozessen und Preoblemen außerhalb des Knochenbereichs wie etwa bei der Förderung des Immunverhaltens, dem Schutz gegen Krebs, vor Herz-/Kreislauferkrankungen oder Diabetes.
• Die IOM-Experten halten einen Vitamin-Spiegel von 20 Nanogramm pro Milliliter und damit, wenn nötig, auch wesentlich kleineren Dosen als immer wieder vorgeschlagen (600 bis 800 Internationale Einheiten [IU] pro Tag statt mehr als 4.000) für den Erhalt der Knochengesundheit als hinreichend.
• Obwohl die durchschnittliche Einnahme von Vitamin D in den USA unter den gerade genannten Werten liegt, fanden die Wissenschaftlern bei Sichtung der Studien, dass der durchschnittliche Vitamin D-Pegel über den 20 Ng/mL liegt und damit offensichtlich die normale Exposition gegenüber der Sonne allein bereits für eine angemessene Produktion des Vitamins sorgt. Durch die Sonneneinstrahlung werden rund 80 % der benötigten Vitaminmenge produziert.
• Selbst kurze Aufenthalte in der Natur und dann noch bei Sonnenschein reichen daher bereits für eine ausreichende Menge des Vitamins aus. In jedem Fall überwögen außerdem die Risiken eines Sonnenbank-Besuches den möglichen Nutzen, weshalb auch von dieser Versorgungsvariante abzuraten wäre.
• Das Komitee warnt schließlich auch vor dem Konsum hoher Vitamindosen, die wissenschaftlich gesichert zu einer Reihe von unerwünschten gesundheitlichen Effekten führen. Der zu hohe Vitaminspiegel treibt die Calciumwerten im Blut nach oben, was wiederum zu keineswegs harmlosen Erscheinungen wie Harnflut, Übelkeit und Erbrechen sowie Nierenverkalkungen führen kann.
• In der Ausgabe des von einem Wissenschaftlerkreis um das "New England Journal of Medicine" getragenen "Journal Watch Psychiatric" vom 3. Januar 2011" finden sich zusätzlich Ergebnisse mehrerer methodisch hochwertiger Studien, die zeigen, dass es zumindest noch einen positiven Zusammenhang eines normalen Vitamin D-Pegels mit einer Reihe neuropsychiatrischen Erkrankungen (z.B. Depressionen und multiple Sklerose) gibt. Auch in diesen Studien wird aber davor gewarnt, dass bei Werten von über 30 ng/mL kein zusätzlicher Nutzen mehr belegt worden wäre.
Den kompletten Bericht "Dietary Reference Intakes for Calcium and Vitamin D" gibt es zwar nicht kostenlos herunterzuladen und auszudrucken, aber wer Genaueres wissen will, hat zahlreiche andere Möglichkeiten. Über die Report-Website des IOM erhält man eine kostenlose vierseitige Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse. Außerdem erhält man hier den Zugang zu der 999 Seiten umfassenden online lesbaren Gesamtversion der Studie.
Zu einem Übersichtstext von Ross AC et al. mit dem Titel "The 2011 report on dietary reference intakes for calcium and vitamin D from the Institute of Medicine: What clinicians need to know" in der Fachzeitschrift "Journal of Clin Endocrinol Metab" gibt es kostenlos lediglich ein Abstract.
Bernard Braun, 10.2.11
IDEFICS - Ein EU-Projekt zur Prävention von Übergewicht bei Kindern geht 2011 zu Ende
 Die "IDEFICS"-Studie ist die derzeit größte europäische Studie zum Thema Übergewicht bei Kindern im Alter von 2-10 Jahren. "IDEFICS" steht für: "Identification and prevention of dietary- and lifestyle-induced health effects in children and infants" (sinngemäß übersetzt: Identifizierung und Prävention gesundheitlicher Effekte durch Ernährung und Lebensstil bei Kindern und Kleinkindern). 23 Forschungsinstitute und Unternehmen aus 11 europäischen Ländern sind an der Studie beteiligt. Die Koordination und Leitung wurde dem Bremer Institut für Präventionsforschung und Sozialmedizin (BIPS) an der Universität Bremen übertragen. Das Projekt wurde im Herbst 2006 begonnen und geht nun nach einer Laufzeit von 5 Jahren 2011 zu Ende. In Auftrag gegeben wurde IDEFICS von der Europäischen Kommission, ausgestattet war es mit einem Finanzvolumen von 13 Millionen Euro.
Die "IDEFICS"-Studie ist die derzeit größte europäische Studie zum Thema Übergewicht bei Kindern im Alter von 2-10 Jahren. "IDEFICS" steht für: "Identification and prevention of dietary- and lifestyle-induced health effects in children and infants" (sinngemäß übersetzt: Identifizierung und Prävention gesundheitlicher Effekte durch Ernährung und Lebensstil bei Kindern und Kleinkindern). 23 Forschungsinstitute und Unternehmen aus 11 europäischen Ländern sind an der Studie beteiligt. Die Koordination und Leitung wurde dem Bremer Institut für Präventionsforschung und Sozialmedizin (BIPS) an der Universität Bremen übertragen. Das Projekt wurde im Herbst 2006 begonnen und geht nun nach einer Laufzeit von 5 Jahren 2011 zu Ende. In Auftrag gegeben wurde IDEFICS von der Europäischen Kommission, ausgestattet war es mit einem Finanzvolumen von 13 Millionen Euro.
Das Projekt soll zum einen in epidemiologischer Perspektive Ernährung und Lebensstile der Kinder in Europa beschreiben und dabei auch umfassend regionale, soziale, biologische und geschlechtsspezifische Merkmale berücksichtigen. Auch geschmackliche Vorlieben und Ernährungspräferenzen werden erfasst. Damit sollen Risiken für die Entstehung von Übergewicht und Adipositas sowie gesundheitliche Langzeiteffekte aufgedeckt werden - auch im internationalen Vergleich.
Neben diesem epidemiologischen Schwerpunkt will die Studie aber auch neue und innovative Ansätze für eine gesündere Ernährung und für die körperliche Fitness von Kindern in Europa entwickeln. Angeboten werden dazu Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und Prävention in Kindergärten und Schulen. Diese umfassen unter anderem Bewegungsprogramme und Methoden zum Umgang mit psychosozialem Stress. Ebenso sind Aufklärung und Bewusstseinsschärfung bei Eltern und Kindern für das Problem Übergewicht Ziele der Studie.
Langfristig sollen die Ergebnisse in verschiedene Richtlinien für gesunde Ernährung und Alltagsverhalten einfließen sowie Grundlagen für neue Ethik-Richtlinien der teilnehmenden EU-Staaten bilden. Ein weiteres Ziel der IDEFICS Studie ist die Einbindung dieser Richtlinien in gesundheitspolitische Empfehlungen.
Insgesamt nehmen an der Studie knapp 17.000 Kinder Alter von zwei bis zehn Jahren teil, 8.000 in der Interventionsgruppe und 9.000 in der Kontrollgruppe. Pro Partnerland nehmen 500 Kindergarten-Kinder und 500 Grundschulkinder teil. In Deutschland sind etwa 2000 Kinder in Delmenhorst und Wilhelmshaven beteiligt. Alle teilnehmenden Kinder wurden zu Studienbeginn medizinisch untersucht, und es wurden gesundheitlich relevante Daten wie Alter, Geschlecht, Größe, Körpergewicht und Körperfettanteil erfasst.
Bei einer kleineren Stichprobe wurden überdies Blut- und Urinproben für medizinisch vertiefende Analysen genommen. Weiterhin wurden Kinder und auch ihre Eltern über das Freizeitverhalten, Kenntnisse über gesunde Ernährung sowie die zeitliche Intensität von Fernsehkonsum und Computerspielen des Spielens am Computer befragt. Etwa für die Hälfte der Teilnehmer/innen wurde in acht europäischen Ländern (Belgien, Zypern, Estland, Deutschland, Ungarn, Italien, Spanien, Schweden) ein Interventionsprogramm durchgeführt, bei dem gesunde Ernährung, körperliche Aktivität und Stressabbau dabei im Mittelpunkt stehen. In einer Kontrollregion (Griechenland) werden parallel dazu lediglich allgemeine Informationen angeboten um durch den Vergleich die Effekte der Intervention messen zu können.
Den Projektablauf muss man sich nach Auskunft von Prof. Dr. Wolfgang Ahrens, dem Leiter der IDEFICS-Studie im Bremer Institut für Präventionsforschung und Sozialmedizin (BIPS), so vorstellen, dass im Jahr 2007 Kontakt aufgenommen wurde "zu Schulen und zu Politikern und zu Kindergärten. Wir wenden uns dann an die Eltern der Kinder, die jetzt in die Schule kommen bzw. in die Kindergärten kommen und bitten die ums Einverständnis, an dieser Untersuchung teilzunehmen. Wir gehen dann in die Kindergärten mit einem Untersuchungsteam, laden die Kinder ein, die Eltern werden befragt, die Kinder werden untersucht. Nach einem halben Jahr wollen wir insgesamt 2.000 Kinder untersucht haben und in der Folgezeit werden wir mit verschiedenen Aktionen Maßnahmen vorschlagen, wie Kinder zu mehr Bewegung animiert werden können und wie wir es erreichen können, dass sowohl in der Schule als auch in den Familien sich vielleicht die Ernährungsgewohnheiten zu einer gesünderen Ernährungsgewohnheit verändern." (Interview mit Prof. Ahrens, BIPS, vom 26.09.2007)
Konkret wird in den Kindergärten und Schulen beispielsweise die Botschaft "Mehr Bewegung" durch Maßnahmen auf dem Pausenhof und im Freien umgesetzt. Diese Aktionen sind immer eingebettet in themenspezifische Gesundheitswochen. Dabei wird jeweils eine der sechs Schlüsselbotschaften und zugleich Präventionsziele des Projekts ("Mehr Wasser trinken", "Weniger Fernsehen", "Mehr Bewegung", "Mehr Obst und Gemüse essen", "mehr Zeit in der Familie", "ausreichend Schlaf") vertiefend behandelt. Alle Interventionen sind synchronisiert und vernetzt zwischen Kindergärten, Schulen, Stadtverwaltungen und beteiligten Familien. Daher wurden auch Schulen und Kindergärten in Runden-Tisch-Gesprächen einbezogen, um Inhalte und Umsetzung des Gesundheitsprogramms festzulegen. Das so genannte "Gemeinde-Forum", ein Gremium mit Politikern, Leitern von Kindergärten und Schulen sowie Vertretern der beteiligten Kommunen, unterstützt die Aktivitäten auf städtischer Ebene. Um auch die Eltern einzubeziehen, wurden Informationsveranstaltungen zu verschiedenen Themen durchgeführt (z.B. Kochabende, gesunder und ungesunder Fernsehkonsum, Infoabende über "Milchschnitte & Co"). Für die beteiligten Akteure wurde eine große Zahl unterschiedlicher Informations- und Interventionsmaterialien entwickelt, so für Lehrer und Erzieher IDEFICS das Aktivitäts- und Spieleposter, Spielkarten, ein Handbuch für alle Gesundheitswochen und ein Video mit guten Praxisbeispielen. Für die Gemeinden und Familien wurde ein Poster zu jeder Gesundheitswoche entworfen und ebenso ein Flyer für Eltern. Für Familien und Kinder steht ein Koch- und Aktivitätsbuch zur Verfügung, eine IDEFICS Handpuppe, ein Stundenplan und ein Checkbogen zum TV-Konsum.
Die Studie wird im August 2011 abgeschlossen. Derzeit liegt bereits eine große Zahl von Veröffentlichungen vor, in denen Zwischenergebnisse präsentiert werden. Bislang sind allerdings noch keine wissenschaftlichen Veröffentlichungen zugänglich, die über den Erfolg der Gesundheitsförderungsmaßnahmen informieren. An der Studie beteiligte Wissenschaftler und andere internationale Experten trafen sich vor kurzem im November 2010 in Zaragoza, um die bisherigen Ergebnisse und Strategien zu diskutieren.
In einer Mitteilung zu diesem Kongress wurde als besonders wichtige und zugleich in der Forschung bislang wenig beachtete Erkenntnis der Studie die Bedeutung von Schlafmangel hervorgehoben bzw. die enge Verbindung von Schlafdauer und Übergewicht. Kinder mit wenig Schlaf, so wurde deutlich, haben ein höheres Risiko für Übergewicht und Adipositas. Als wichtig wurde von den Wissenschaftlern aber auch hervorgehoben, dass die Eltern in Gesundheitsförderungs-Maßnahmen einzubeziehen sind, denn ernährungsbedingte Krankheiten seien nicht nur genetisch bestimmt, sonder hingen ganz wesentlich vom Alltagsverhalten ab. Die Ergebnisse der IDEFICS Studie würden zeigen, dass Bildung und Einkommen der Eltern einen hohen Einfluss sowohl auf die Qualität der Ernährung als auch auf das Körpergewicht der Kinder haben. Auch gesundheitspolitische Vorhaben stehen auf der Agenda der Forscher: "Unser Ziel ist es, die Politiker zu bewegen, sich zusammenzusetzen und bessere Umgebungen für die Gesundheit der Kinder zu schaffen." Die Referate werden in Kürze in einem Ergänzungsband der Zeitschrift "International Journal of Obesity " veröffentlicht. Der vorläufige Bericht zum Kongress ist hier zu finden: "Child health in Europe: The IDEFICS Study: towards a better understanding of obesity"
Die Liste der Veröffentlichungen zum Projekt IDEFICS, Informationen über Workshops und Veranstaltungen findet man hier:
• BIPS sowie hier:
• IDEFICS
• Hier ist eine differenzierte Beschreibung des Studienablaufs als Folienvortrag: "Antje Hebestreit: Übergewicht und Adipositas bei Kindern und Jugendlichen - die weltweite Situation und die IDEFICS Studie als Beispiel"
Bernard Braun, 5.2.11
Prävention von Übergewicht bei Kindern: Cochrane-Metaanalyse zeigt wenig spezifische Wirkungen
 Weder die Mehrheit von randomisierten kontrollierten Interventionsprojekten zur Prävention von Übergewicht bei Kindern mit einer längeren Interventionszeit, noch kürzer dauernde Interventionen erwiesen sich in der Metaanalyse einer Cochrane-Wissenschaftlergruppe als wirksam. Ausnahme war lediglich eine multimedial angelegte Studie.
Weder die Mehrheit von randomisierten kontrollierten Interventionsprojekten zur Prävention von Übergewicht bei Kindern mit einer längeren Interventionszeit, noch kürzer dauernde Interventionen erwiesen sich in der Metaanalyse einer Cochrane-Wissenschaftlergruppe als wirksam. Ausnahme war lediglich eine multimedial angelegte Studie.
Die Forschergruppe untersuchte bereits 2005 in einer Metaanalyse die Wirkung von 10 randomisierten kontrollierten Studien mit einer Interventionszeit von mindestens 12 Monaten als auch die von 12 weiteren Studien mit einer Einwirkungszeit zwischen 12 Wochen und 12 Monaten auf das Übergewicht von Kindern. Sämtliche Studien stammten aus den Zeitraum von 1990 bis 2005. 19 der Studien intervenierten präventiv im Vorschul- und Schulbereich, eine richtete sich auf kommunaler Ebene an Familien mit geringem Einkommen und zwei beinhalteten Interventionen in Familien, in denen die Eltern übergewichtig oder fettsüchtig sind.
Die wichtigsten Ergebnisse der Projekte mit längerer Einwirkungszeit lauteten:
• Sechs der zehn Langzeit-Studien kombinierten Maßnahmen der Ernährungserziehung mit solchen zur Förderung der körperlichen Aktivität. Bei fünf gab es beim Wirkungsindikator Gewichtszunahme keine Unterschiede zwischen Kindern in der Interventions- und Kontrollgruppe. In einer Studie gab es bei den beteiligten Mädchen Erfolge, nicht aber bei den Jungen.
• Zwei Studien, die allein auf die Ernährungserziehung fokussierten, zeigten keinen Erfolg bei der Prävention von Übergewicht oder Fettsucht.
• Bei einer der beiden Studien, die sich allein darum kümmerten, die körperlichen Aktivitäten der Kinder zu fördern, zeigte sich ebenfalls kein präventiver Erfolg. Die zweite Studie mit diesem Fokus war wirksam, verfolgte aber auch einen überaus aufwändigen multi-medialen Ansatz.
Die wichtigsten Ergebnisse der Projekte mit kürzerer Einwirkungszeit lauteten:
• Vier der zwölf Kurzzeitstudien fokussierten auf Interventionen, die das Niveau der körperlichen Aktivitäten zu erhöhen versuchten. Bei zwei von ihnen gab es eine kleine Abnahme des Übergewichts.
• Die acht restlichen Studien kombinierten gezielte Ratschläge für eine bessere Ernährung und körperliche Aktivität, erzielten aber keine signifikante Wirkung auf die Gewichtsentwicklung.
Die Autoren der Metaanalyse runden ihre Ergebnisse mit dem Hinweis ab, dass die Studiendesigns zum Teil zu heterogen sind, um aussagekräftige Vergleiche und integrierte Analysen der verstreuten kleinen Wirkeffekte machen zu können. In vielen Studien findet man schließlich keine gründlichen Hinweise auf soziale oder andere Kontextfaktoren und keine Angaben zur Kosteneffektivität der einzelnen Interventionsweise.
Kostenlos erhältlich ist zur Cochrane-Metaanalyse "Interventions for preventing obesity in children" von Carolyn D Summerbell, Elizabeth Waters, Laurel Edmunds, Sarah AM Kelly, Tamara Brown und Karen J Campbell (Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 3) lediglich ein etwas ausführlicheres Abstract
Bernard Braun, 26.1.11
Preiselbeerprodukte und die Prävention von Harnwegsinfekten: natürlich, erschwinglich, erhältlich ohne Rezept - aber wirksam????
 In den USA leiden rund 20 % aller Frauen mindestens einmal in ihrem Leben an einer Harnwegsinfektion. Von ihnen trat die Erkrankung bei 3 % mehrmals auf. Entsprechend erhielten Millionen von Frauen Arzneimittel und darunter mit Vorrang Antibiotika verordnet, die sowohl das erstmalige Auftreten der schmerzhaften Infektion als auch das wiederholte Auftreten verhindern sollten als auch wesentlich zur Behandlung der Infektion beitragen sollen.
In den USA leiden rund 20 % aller Frauen mindestens einmal in ihrem Leben an einer Harnwegsinfektion. Von ihnen trat die Erkrankung bei 3 % mehrmals auf. Entsprechend erhielten Millionen von Frauen Arzneimittel und darunter mit Vorrang Antibiotika verordnet, die sowohl das erstmalige Auftreten der schmerzhaften Infektion als auch das wiederholte Auftreten verhindern sollten als auch wesentlich zur Behandlung der Infektion beitragen sollen.
Um die Einnahme von zu viel Antibiotika zu vermeiden und damit deren gesicherten Nachteile, propagierten und propagieren Hersteller, "Omas" und diverse Naturheilmittel-Gesundheitsratgeber relativ regelmäßig "natürliche" Alternativen als nützlich, preisgünstiger, unaufwändiger zu beschaffen und "natürlich" nebenwirkungsfrei. Dabei spielten nahezu alle Zubereitungen (z.B. Bonbons, Saft) eine zentrale Rolle in denen Preiselbeeren verarbeitet wurden.
Die ebenfalls schon seit einiger Zeit angestellten Versuche, die Wirksamkeit valide nachzuweisen, hinterlassen einen mehrspältigen Eindruck und vermitteln im aktuellsten Fall tiefe und leicht ratlose Einblicke in die Schwierigkeiten, den Nutzen von Nahrungsergänzungsmitteln wasserdicht nachzuweisen oder zu widerlegen.
Bereits 2004 suchte der Cochrane-Review "Cranberries for treating urinary tract infections" von Jepson RG, Mihaljevic L, Craig J. vergebens nach randomisierten kontrollierten Studien über die Wirksamkeit von Preiselbeersaft zur Behandlung von Harnwegsinfekten. Jepson et al. zogen daraus den Schluss, dass es keine Evidenz gibt, den Einsatz des Saftes zu diesem Zweck zu unterstützen. Gleichzeitig waren andere Experten aber der Meinung, es fänden sich immerhin eine Menge von evidenzbasierten Informationen über den Nutzen von Preiselbeer-Produkten bei der Prophylaxe von Harnwegsinfekten.
Der Schlusskommentar eines in der Zeitschrift "American Family Physician" (70 (11): 2175-2177) 2004 erschienenen Übersichtsaufsatz resumierte den damaligen Stand der Kenntnisse über den prophylaktischen Nutzen von Preiselbeerprodukten so: "Cranberry appears to be a safe, herbal choice for UTI prophylaxis and has relatively good tolerability. The most recent studies have found that the use of cranberry for up to 12 months is safe and moderately effective. More evidence is necessary to recommend its use for clinical indications other than UTI prophylaxis."
Die wesentlichen Ergebnisse des Aufsatzes "Cranberry for Prevention of Urinary Tract Infections" von Darren Lynch in der Zeitschrift "American Family Physician" gibt es kostenlos.
In einer Zusammenfassung zum Stand der Forschung über die prophylaktischen Möglichkeiten das mit dem Alter zunehmende Risiko wiederholter Harnwegsinfektionen zu senken, kommen schließlich Sumukades et al. 2009 zu zwei weiteren Feststellungen:
• Die Einnahme niedrig dosierter Antibiotika hat zum einen nur bescheidene Erfolge und birgt die üblichen akuten und langfristigen unerwünschten Folgen der Einnahme von Antibiotika in sich. Die spezifischen Wirkungen der Antibiotikaeinnahme sind auf niedrigem Niveau nur geringfügig höher als die von Preiselbeer-Extrakten in Bonbonform.
• Mit der Feststellung, Preiselbeerprodukte seien "natural, affordable and available without prescription" verknüpfen die Autoren den Vorschlag, Ratschläge mit dem potenziellen Nutzen dieser Produkte zu erstellen und damit die Menschen zu befähigen "to make informed choices". Dies hält sie aber selber nicht davon ab, unmittelbar anschließend dann doch lieber weitere längerfristige und vergleichende Studien zu empfehlen, um grundlegend die Annehmbarkeit und die Wirkung der Preiselbeer-Zubereitungen gegenüber verschiedenen prophylaktisch wirkenwollenden Antibiotika zu untersuchen.
Wer diese Argumentations-Achterbahn noch etwas intensiver genießen will, kann dazu den Aufsatz "Recurrent urinary tract infections in older people: the role of cranberry products" von Deepa Sumukadas, Peter Davey und Marion E. T. McMurdo aus der Fachzeitschrift "Age Ageing" (38 (3): 255-257) vollständig und kostenlos herunterladen.
Die von Sumukades et al. 2009 veröffentlichte Forderung, in weiteren Studien mehr über die Wirksamkeit von Preiselbeerpräparaten zu erforschen, ging dann aber relativ zügig in Erfüllung.
War der prophylaktische Nutzen von Preiselbeeren für Menschen mit Harnwegsinfektionen bereits 2004 insgesamt eher bescheiden, weist eine aktuelle randomisierte kontrollierte Studie über ihren Nutzen bei der Prävention von Wiederholungsinfektionen der Harnwege nach, dass dieser Nutzen von Preiselbeersaft nicht höher ist als der von Placebos oder dass andersherum auch Placebos helfen.
In der doppelblinden RCT wurde dafür 155 gesunden jüngeren Frauen nach Abschluss einer Antibiotikabehandlung 6 Monate lang zweimal täglich rund ein Viertelliter kalorienarmer Preiselbeersaft verabreicht. 164 vergleichbare Frauen erhielten ein flüssiges Placebo, das dem Preiselbeersaft äußerlich ähnelte. Das Placebo enthielt lediglich nicht den Wirkstoff Proanthocyanidin, der als der eigentliche prophylaktische antibakterielle Wirkstoff galt. Dieser Stoff soll auf die Interaktion des Erregers Escherichia coli mit bestimmten menschlichen Zellen wirken bzw. diese unterbinden.
Nach 6 Monaten unterschieden sich die Wiedererkrankungsraten statistisch nicht signifikant und lagen bei 19 % in der Preiselbeer- und 15 % in der Placebogruppe. Damit waren aber beide Raten niedriger als die erwarteten 30 %. Unerwartet war angesichts der vermuteten Wirkung des bereits genannten Preiselbeerwirkstoffs auch, dass die Rate der Infektion mit Escherichia coli (diese verursachen 80 % aller Harnwegsinfektionen) in der Preiselbeergruppe höher (93 % aller Infektionen) als in der Placebogruppe (58 %) waren - also genau das Gegenteil, was man von einer Intervention mit Proanthocyanidin erwartete.
Wer glaubt, dass mit dieser erneut negativen Studie über einen auch bei der Prophylaxe von Harnwegsinfektionen fehlenden Nutzen des ansonsten natürlich durchaus bekömmlichen Beerensaftes, die Debatte ein vorläufiges Ende habe, irrt.
Was wäre nämlich - so ein offensichtlich mit den nicht endenvollenden Debatten über derartige Mittel erfahrene Kommentar eines Experten -, wenn der wirkliche und nützliche Wirkstoff nicht Proanthocyanidin, sondern ein anderer Stoff ist, der sowohl im Preisebeersaft als auch in der Placeboflüssigkeit enthalten war???
Solange dies möglich sein kann, wird es weiterhin Empfehlungen zum prophylaktischen Genuss von Preiselbeerprodukten gegen Harnwegsinfekte und andere Infektionserkrankungen geben und viele Gesunde und bereits einmal Erkrankte werden sie kaufen und konsumieren.
Den achtseitigen Aufsatz "Cranberry juice fails to prevent recurrent urinary tract infection: Results from a randomized placebo-controlled trial" von Barbosa-Cesnik C et al. aus der Zeitschrift "Clinical Infectious Diseases" (2011; 52: 23-30) gibt es komplett kostenlos.
Bernard Braun, 23.1.11
Sport zur Prävention von Osteoporose: Nur wirksam bei männlichen Jugendlichen
 Wie wirksam ist Sport zur Prävention von Osteoporose und anderen Erkrankungen, die mit der Knochendichte zusammenhängen? Mit dieser Frage beschäftigte sich eine finnisch-australische Forschungsgruppe. Die Forscherinnen und Forscher erstellten dazu ein systematisches Review und eine Metaanalyse über zehn randomisiert-kontrollierte Studien (RCT). Diese Studien bewerteten vor allem die Effekte körperlichen Trainings mit Belastungselementen auf die Gesamtstärkung der Knochenstärke.
Wie wirksam ist Sport zur Prävention von Osteoporose und anderen Erkrankungen, die mit der Knochendichte zusammenhängen? Mit dieser Frage beschäftigte sich eine finnisch-australische Forschungsgruppe. Die Forscherinnen und Forscher erstellten dazu ein systematisches Review und eine Metaanalyse über zehn randomisiert-kontrollierte Studien (RCT). Diese Studien bewerteten vor allem die Effekte körperlichen Trainings mit Belastungselementen auf die Gesamtstärkung der Knochenstärke.
Bisherige Empfehlungen zur Reduktion von Osteoporose, Stürzen und Knochenbrüchen beruhen oft auf der Verallgemeinerung von wissenschaftlichen Ergebnissen. Ob diese Verallgemeinerungen gerechtfertigt sind, sollte durch die Metaanalyse untersucht werden. Bisher blieb stets offen, wie sich körperliches Training auf die Robustheit der Knochen bei verschiedenen Bevölkerungs- oder Altersgruppen auswirkt. Obwohl viele Informationsanbieter oder Berater für ein lebenslanges Bewegungs- und Belastungsprogramm plädieren, war bisher keineswegs eindeutig geklärt, wie sich Trainingsstunden über einen längeren Zeitraum von sechs Monaten oder sogar ganzen Lebensabschnitten auf die Knochendichte der Probandinnen und Probanden auswirken.
Die nun durchgeführte Studie kam zu einem überraschenden Ergebnis: Nur für die Gruppe der jüngeren pubertierenden Jungen konnte ein kleiner und signifikanter Effekt eines längeren körperlichen Trainings auf die Festigkeit der Knochen im Bereich der unteren Extremitäten festgestellt werden. Bei den Angehörigen aller anderen Gruppen, von den gleichaltrigen Mädchen bis zu den Frauen vor und nach der Menopause, war kein signifikanter Effekt des Trainings zu entdecken. Wurden in den untersuchten Studien dennoch Verbesserungen festgestellt, könnten diese zufällig und unabhängig von der Intervention entstanden sein, so die Forschungsgruppe.
In den meisten Altersgruppen und für viele Interventionen ist also der als "wissenschaftlich gesichert" vorgetragene Schluss unzulässig, es handle sich um generell wirksame Präventionsmaßnahmen gegen das Auftreten der genannten Risikofaktoren und Erkrankungen.
Worin die Ursachen für die Verbesserungen in einem Teil der untersuchten RTCs zurückzuführen sind, soll in weiteren Studien mit möglichst größeren Gruppen von Teilnehmerinnen und Teilnehmern untersucht werden. Dadurch soll vermieden werden, dass Effekte lediglich auf Grund von sehr kleinen Interventionsgruppen oder zu kurzen Interventionszeiten zustande kommen.
Die jetzt vorliegenden Ergebnisse begründen auf jeden Fall Zweifel an der Wirksamkeit einfacher und unaufwändiger präventiver Standardmethoden. Wahrscheinlicher ist, dass die Prävention von Osteoporose und Stürzen einen deutlichen körperlichen Aufwand voraussetzt. Die Wissenschaftlergruppe zitiert hierzu z.B. epidemiologische Untersuchungen, die zeigen, dass sich Wirkungen auf das Auftreten von Knochenbrüchen bei erwachsenen Männern und Frauen erst ab einer körperlichen Aktivität zeigen, die über längere Zeiträume und drei- bis viermal pro Woche stattfindet.
Die Studie können Sie hier kostenlos herunterladen: Riku Nikander et al: Targeted exercise against osteoporosis: A systematic review and meta-analysis for optimising bone strength throughout life (BMC Medicine 2010, 8:47)
Bernard Braun, 20.1.11
Selbst in den harten norwegischen Wintern wirkte sich das Rauchverbot in Gaststätten nicht negativ auf ihre Einnahmen aus!
 Wer in den frostigen Tagen zum Jahreswechsel voller Mitleid frierende RaucherInnen vor Gaststättentüren stehen oder sitzen sah oder vielleicht irgendwo in Spanien einem Tapa-Restaurantbesitzer zuhörte, der sich über das am 1.1. 2011 in Kraft getretene EU-weit radikalste Rauchverbotsgesetz seines Landes existentiell erregte, neigt vielleicht leichter (wieder) dazu, die wirtschaftliche Zukunft des Gaststättengewerbes durch Rauchverbote und zumindest im Winter gefährdet zu sehen. Auch wenn die Rauchverbote immer deutlicher ihren gesundheitlichen Nutzen erkennen lassen (vgl. dazu einen von den Bremer Gesundheitswissenschaftlern Bernard Braun und Gerd Marstedt verfassten Überblick zum internationalen Forschungsstand Mitte des Jahres 2010 auf der Website der "Bundesvereinigung für Prävention und Gesundheitsförderung"), darf ein drohender Verlust von Arbeitsplätzen nicht a priori ignoriert werden. Er verdient zumindest empirisch untersucht und bestätigt oder verworfen werden.
Wer in den frostigen Tagen zum Jahreswechsel voller Mitleid frierende RaucherInnen vor Gaststättentüren stehen oder sitzen sah oder vielleicht irgendwo in Spanien einem Tapa-Restaurantbesitzer zuhörte, der sich über das am 1.1. 2011 in Kraft getretene EU-weit radikalste Rauchverbotsgesetz seines Landes existentiell erregte, neigt vielleicht leichter (wieder) dazu, die wirtschaftliche Zukunft des Gaststättengewerbes durch Rauchverbote und zumindest im Winter gefährdet zu sehen. Auch wenn die Rauchverbote immer deutlicher ihren gesundheitlichen Nutzen erkennen lassen (vgl. dazu einen von den Bremer Gesundheitswissenschaftlern Bernard Braun und Gerd Marstedt verfassten Überblick zum internationalen Forschungsstand Mitte des Jahres 2010 auf der Website der "Bundesvereinigung für Prävention und Gesundheitsförderung"), darf ein drohender Verlust von Arbeitsplätzen nicht a priori ignoriert werden. Er verdient zumindest empirisch untersucht und bestätigt oder verworfen werden.
Schon bisherige Studien u.a. für einige Bundesländer in Deutschland hatten gezeigt, dass die Verluste geringer waren als erwartet und öffentlich kommuniziert (vgl. dazu die ebenfalls von Bernard Braun und Gerd Marstedt Mitte 2010 verfasste "Zusammenfassung des Forschungsstandes in Deutschland: Wirtschaftliche Verluste im Gaststättengewerbe durch Rauchverbote geringer als befürchtet", die ebenfalls auf der Website der "Bundesvereinigung für Prävention und Gesundheitsförderung" kostenlos erhältlich ist).
Zwei norwegische Gesundheitsökonomen haben sich nun auf der Basis eines für Norwegen existierenden, zeitlich umfassendsten Datensätze (1999 bis 2007) über die wirtschaftliche Situation von Restaurants und Bars/Kneipen und eines seit Juni 2004 existierenden Rauchverbots ebenfalls mit den kurz- und vor allem auch langfristigen wirtschaftlichen Effekten eines Rauchverbots befasst. Angesichts der eingangs erwähnten rauhen Außenbedingungen muss hervorgehoben werden, dass es in Norwegen im Winter wie im Sommer deutlich kälter ist als in Deutschland, also die abschreckende Wirkung des Outdoor-Rauchenmüssens höher ist bzw. sein könnte. Diesen Faktor heben die Autoren auch als eine Besonderheit ihrer Studie hervor. In wärmeren Ländern gibt es nach ihren Angaben nämlich im Moment keine Untersuchung, die einen negativen oder positiven wirtschaftlichen Effekt von Rauchverboten im Gaststättengewerbe nachgewiesen hat - mit der möglichen Ausnahme von Spielhallen.
Die wesentlichen, methodisch aufwändig (siehe dazu den Aufsatztext) Ergebnisse der Wirkungsanalysen für die norwegische Gastronomie lauten:
• Ein Jahr nach der Einführung des Rauchverbots hatten die Einnahmen der Restaurants preisbereinigt und im Vergleich mit dem Jahr vor der Einführung um 2,5 % zugenommen. Dabei gaben allerdings die NorwegerInnen einen kleineren Anteil ihrer Konsumausgaben für Restaurantbesuche aus (Abnahme von 1,65 % auf 1,56 %).
• Beide Trends existierten inhaltlich auch in Bars und Kneipen (u.a. Zunahme der Einnahmen um 1,2 %). Auch wenn die Einnahmen von Restaurants und Bars weiter saisonal, d.h. überwiegend klimabedingt schwanken, lagen die Einnahmen langfristig und praktisch bei jeder der im Zweimonatsabstand durchgeführten Erhebungen über dem Niveau vor Einführung des Rauchverbots.
• Noch konkreter und trotz einiger methodischer Beschränkungen der Analyse: Trotz der unangenehmeren Bedingungen des zwangsweisen Outdoor-Rauchens lagen die Einnahmen der Gastbetriebe auch in den letzten harten norwegischen Wintern über dem immer schon niedrigeren Einnahmebetrag in früheren Wintern - obwohl die Raucher damals "gemütlich" an der Bar und an den Esstischen rauchen konnten.
Der Aufsatz "Do smoke-free laws affect revenues in pubs and restaurants?" von Hans Olav Melberg und Karl E. Lund ist gerade in der ökonomischen Fachzeitschrift "European Journal of Health Economics" (DOI 10.1007/s10198-010-0287-6) erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 5.1.11
"Der Mensch ist ein soziales Wesen" und zwar fast immer! Was hat dies mit erfolgloser Gesundheitsaufklärung zu tun?
 Informationskampagnen für oder gegen bestimmte gesundheitsbezogene Verhaltensweisen und Therapien sind weit verbreitete Methoden der präventiven Gesundheitsaufklärung und -kommunikation. Wie bei Kampagnen gegen das Rauchen oder gegen ungesunde Ernährung schon vor einiger Zeit erkannt wurde, reichen noch so abschreckende und anschauliche Informationen über Raucherlungen und eine "fit-statt-fett"-Aufklärung jedoch nicht aus oder bewirken sogar das Gegenteil. Woran dies möglicherweise auch liegen könnte und warum manche Kampagne zur Krebsvorsorge nicht deren Inanspruchnahme erhöht, untersuchten nun, gefördert durch die Deutsche Krebshilfe, Heidelberger GesundheitspsychologInnen in einer zweistufigen Längsschnittstudie, die der Theorie des "planned behavior" folgt.
Informationskampagnen für oder gegen bestimmte gesundheitsbezogene Verhaltensweisen und Therapien sind weit verbreitete Methoden der präventiven Gesundheitsaufklärung und -kommunikation. Wie bei Kampagnen gegen das Rauchen oder gegen ungesunde Ernährung schon vor einiger Zeit erkannt wurde, reichen noch so abschreckende und anschauliche Informationen über Raucherlungen und eine "fit-statt-fett"-Aufklärung jedoch nicht aus oder bewirken sogar das Gegenteil. Woran dies möglicherweise auch liegen könnte und warum manche Kampagne zur Krebsvorsorge nicht deren Inanspruchnahme erhöht, untersuchten nun, gefördert durch die Deutsche Krebshilfe, Heidelberger GesundheitspsychologInnen in einer zweistufigen Längsschnittstudie, die der Theorie des "planned behavior" folgt.
Sie fragten dafür 2.426 Männer im Alter von 45 bis 65 Jahren nach ihrer Inanspruchnahme der Krebsfrüherkennungsuntersuchung und außerdem, wie sie das entsprechende Verhalten anderer Männer einschätzen.
Im zweiten experimentellen Teil der Studie wurde ein Jahr nach der ersten Studie bei 185 Männern zwischen 45 und 70 Jahren überprüft, ob Informationen oder Annahmen über das Verhalten anderer Männer, von den ForscherInnen als "deskriptive Normen" bezeichnet, ihre Motivation beeinflusst, selber an einer Untersuchung zur Krebsfrüherkennung teilzunehmen. Dabei war z.B. von vornherein bekannt, dass höchstens 21% der Männer Krebs-Vorsorgeuntersuchungen in Anspruch nehmen, gegenüber immerhin durchschnittlich rund 47% der Frauen. Die Unterrepräsentanz der Männer findet man aber auch bei anderen Gesundheitskursen oder Raucherentwöhnungskursen.
Ihre Ergebnisse sind weit über ihr Thema hinaus von Bedeutung und sehen so aus:
• Gesundheitsverhalten wird nicht nur durch Sachinformationen beeinflusst, sondern maßgeblich durch Faktoren im sozialen Umfeld der Personen, die z.B. darüber informiert werden, dass die Inanspruchnahme der Krebsfrüherkennung wichtig ist. Diese Faktoren sind einerseits die Erwartungen wichtiger Bezugspersonen und andererseits das Verhalten "vergleichbarer" Menschen. Soziale Normen und daraus abgeleitete Einstellungen haben beim Gesundheitsverhalten auch eine höhere Bedeutung als die klassischen soziodemographischen Faktoren Einkommen und Bildung. Die Bedeutung dieser Faktoren ist auch bereits bei älteren Menschen nachgewiesen worden. Wenn diese trotz vieler "Zipperlein" oder auch Erkrankungen ihren Gesundheitszustand subjektiv als ganz gut bewerten, liegt dies u.a. daran, dass sie sich mit Gleichaltrigen und zum Teil auch älteren und kränkeren Personen in ihrem Umfeld vergleichen.
• In der ersten Befragung gingen die Männer, die noch nie an einer Früherkennungsuntersuchung teilgenommen hatten, also die Mehrheit, davon aus, dass nur wenige andere Männer zu dieser Untersuchung gingen. Sie schätzten den Anteil auf 28%. Die Befragten, die angaben, sie würden die Krebsvorsorgeuntersuchung unregelmäßig oder gar regelmäßig in Anspruch nehmen, schätzten den Anteil der Männer, die dies auch so machten auf 36% oder gar 45%. Egal, wie das eigene Verhalten und die Erwartung oder Einschätzung des Verhaltens Anderer zusammenhängen, spielt Letzteres eine wichtige Rolle.
• In der zweiten Befragung bestätigte sich das Grundmuster, d.h. Informationen über das Verhalten anderer männlicher Personen beeinflusst eindeutig die eigene Motivation.
• Es zeigte sich darüber hinaus aber noch, dass bei dieser Interaktion die Art der Information eine extrem wichtige und auch unerwartet fatale Rolle spielt: Wenn die Information über das Verhalten anderer eher negativ ist, d.h. gesagt wurde, dass nur knapp 20 % aller Männer zur Krebsvorsorgeuntersuchung gegangen waren, war die Inanspruchnahme-Bereitschaft bei den so informierten Männern ebenfalls gering (31% der Angehörigen dieser Gruppe wollten das Krebs-Screening nutzen) und unterschied sich statistisch signifikant von den Werten in beiden anderen Gruppen. Die Bereitschaft war bei jenen Studienteilnehmern höher, denen gesagt wurde, rund zwei Drittel aller Männer wären schon bei der Vorsorgeuntersuchung gewesen (46%) oder die zu der Kontrollgruppe gehörten, der überhaupt keine Daten zur Einjahresprävalenz der Untersuchungs-Inanspruchnahme gegeben wurde (48%).
• Die Leiterin der Studie, Monika Siverding, fasst das praktisch folgenreiche Ergebnis ihres Experiments so zusammen: "Die Information über eine geringe Nutzung hat somit keine motivierende, sondern tatsächlich eine demotivierende Wirkung. Nach dem Motto: Wenn so wenige Männer dort hingehen, dann wird das wohl auch seinen Grund haben".
Angesichts der Tatsache, dass viele der gut gemeinten und fachlich gut gemachten Informationen im Gesundheitswesen eine häufig geringere Wirkung haben als erwünscht oder notwendig, sollte auch in anderen Zusammenhängen untersucht werden, ob und wie stark auch dort deskriptive Normen bzw. das Verhalten von Verwandten, Nachbarn, Freunden oder Ärzten effekthemmend wirken. Ob solche Effekte auch bei Frauen auftauchen, wäre natürlich ebenfalls untersuchenswert.
Und nicht zuletzt stellt sich die Frage, ob und wie man die mit negativen oder defensiven Verhaltensweisen verbundenen quantitativ "mickrigen" Daten-Inputs anders oder gar nicht kommunizieren kann und darf. Und wenn man dieses Problem gelöst hat, sollten nicht allein die Einstellungen (z.B. Früherkennungsuntersuchungen sind nutzvoll-nutzlos) beachtet und Ziel von Interventionen sein, sondern auch die subjektiven (z.B. Mein Partner denkt, ich solle die Krebsvorsorge nutzen) und deskriptiven Normen (z.B. Wie viele Menschen aus Ihrer Umgebung gingen zur Krebsvorsorge?)
Die Untersuchungsergebnisse sind u.a. in einer kurzen Pressemitteilung zusammengefasst, die frei erhältlich ist.
Außerdem liegen zwei Aufsätze der WissenschaftlerInnen mit detaillierteren Ergebnissen vor:
• Zu dem kurzen Aufsatz "Information about low participation in cancer screening demotivates other people" von Sieverding M., Decker S. und Zimmermann, F., der sich mit der zweiten Studie befasst und in "Psychological Science" (2010, 21, No. 7, 941-943) erschienen ist, gibt es leider noch nicht einmal ein kostenloses Abstract.
• Dafür wird man dadurch etwas entschädigt, dass der 10-seitige Aufsatz "What role do social norms play in the context of men's cancer screening intention and behavior? Application of an extended theory of planned behavior" von Sieverding M., Matterne U. und Ciccarello, L. in "Health Psychology" (2010, 29, No. 1, 72-81) komplett und kostenlos als PDF-Datei erhältlich ist.
Bernard Braun, 5.11.10
Englische Kinderstudie: "Körperliche Passivität macht nicht dick, sondern Übergewicht führt zu Passivität"
 Das Henne-Ei-Problem in der Perspektive der Übergewichtsforschung lautet: Verursacht körperliche Passivität Übergewicht und Adipositas oder ist es genau umgekehrt, dass Übergewicht - aufgrund der größeren körperlichen Anstrengung - zu einem Mangel an Bewegung führt? Die Frage ist nicht ganz so akademisch und haarspalterisch, wie es zunächst scheint: Im ersten Fall wäre mehr Sport und Bewegung die Gesundheitsförderungs-Maxime erster Wahl, im zweiten Fall würde man eine gesündere Ernährung in den Vordergrund stellen. Eine Kohortenstudie, die jetzt in der Zeitschrift "Archives of Disease in Childhood" veröffentlicht wurde, gibt nun vor, das Problem gelöst zu haben. Unzureichende körperliche Aktivität, so konstatieren die Forscher aus dem United Kingdom, ist eine Folge des Übergewichts bei Kindern und nicht umgekehrt.
Das Henne-Ei-Problem in der Perspektive der Übergewichtsforschung lautet: Verursacht körperliche Passivität Übergewicht und Adipositas oder ist es genau umgekehrt, dass Übergewicht - aufgrund der größeren körperlichen Anstrengung - zu einem Mangel an Bewegung führt? Die Frage ist nicht ganz so akademisch und haarspalterisch, wie es zunächst scheint: Im ersten Fall wäre mehr Sport und Bewegung die Gesundheitsförderungs-Maxime erster Wahl, im zweiten Fall würde man eine gesündere Ernährung in den Vordergrund stellen. Eine Kohortenstudie, die jetzt in der Zeitschrift "Archives of Disease in Childhood" veröffentlicht wurde, gibt nun vor, das Problem gelöst zu haben. Unzureichende körperliche Aktivität, so konstatieren die Forscher aus dem United Kingdom, ist eine Folge des Übergewichts bei Kindern und nicht umgekehrt.
Die Wissenschaftler der Peninsula Medical School in Plymouth, United Kingdom, berufen sich mit ihrer These auf Datenanalysen aus der sogenannten "EarlyBird Study". Dabei handelt es sich um eine Längsschnittstudie ohne medizinische oder andere Interventionen, bei der lediglich in regelmäßigen jährlichen Abständen bestimmte gesundheitsrelevante Informationen erhoben werden. Aus 54 Grundschulen in Plymouth wurde im Jahr 2000/2001 eine Stichprobe von 307 Kindern im Alter von fünf Jahren ausgewählt, die in sozioökonomischer Hinsicht repräsentativ sein sollte für Plymouth und das United Kingdom. Ausgeschlossen wurden dabei auch Kinder, die an bestimmten Erkrankungen litten wie insbesondere Diabetes.
Daten wurden später in jährlichem Turnus erhoben, und zwar als die Kinder 7, 8, 9 und 10 Jahre alt waren. Dabei erfassten die Wissenschaftler das Ausmaß körperlicher Bewegung: Die Kinder mussten dazu jeweils an 7 aufeinander folgenden Tagen (5 Schultage, 2 Wochenend-Tage) ein Accelerometer (Aktigraph) tragen, das im Abstand von Zehntelsekunden die Intensität der Körperbewegung erfasste. Eltern sollten dem Forschungsteam die Zeit mitteilen, falls ein Kind tagsüber das Gerät ablegen sollte. Gemessen wurde zu diesen Zeitpunkten auch die Masse des Körperfetts, der Body-Mass-Index und der Hüftumfang der Kinder.
Für die Analysen berücksichtigt wurden 202 Kinder der Early-Bird-Stichprobe und zwar jene, für die Messergebnisse aus allen vier Jahren zur Verfügung standen. Darunter waren 53% Jungen, 25% hatten Übergewicht oder Diabetes. Zentrales Ergebnis der Datenanalysen war dann: Die Körperfettmasse zu einem bestimmten Zeitpunkt erlaubt eine Prognose für das Ausmaß an körperlicher Bewegung in den folgenden Jahren. Umgekehrt ist es nicht möglich, Veränderungen des Körperfetts für denselben Zeitraum nur auf der Basis der körperlichen Aktivität vorherzusagen.
Eine im Vergleich zu vorher um 10 Prozent höhere Körperfettmasse im Alter von 7 Jahren bewirkte nach diesen Daten in den folgenden drei Jahren, dass sich das Ausmaß (moderater und intensiver) körperlicher Bewegung um vier Minuten pro Tag reduzierte. Die hierzu errechnete Korrelation betrug -0,17 (p=0,02). Umgekehrt zeigte die körperliche Bewegung keinen Zusammenhang zur Veränderung der Körperfettmasse in den folgenden Jahren, die Korrelation war -0,01 (p=0,80). Zwar zeigten sich zwischen Jungen und Mädchen Unterschiede hinsichtlich des Ausmaßes körperlicher Bewegung und ebenso in Bezug auf das Körperfett. Die gemessenen Korrelations-Zusammenhänge jedoch waren bei beiden Geschlechtern gleich. Analysen, in denen statt des Körperfetts der Body-Mass-Index verwendet wurde, zeigten ganz überwiegend keine signifikanten Zusammenhänge.
Die Wissenschaftler referieren am Schluss ihrer Veröffentlichung noch einmal kurz andere Studien und auch Meta-Analysen, die ebenfalls versucht haben, die Richtung der Kausalbeziehungen zwischen körperlicher Bewegung einerseits und Körperfett bzw. Übergewicht andererseits zu bestimmen. Zwar bestätigen diese mit sehr großen Stichproben durchgeführten Studien (zum Teil 2500-5000 Teilnehmer) nicht ausnahmslos, aber größtenteils den Befund ihrer Early-Bird-Studie. Allerdings haben diese anderen Studien überwiegend methodische Schwächen, sei es, dass es sich um Querschnitt- und nicht um Längsschnitt-Erhebungen handelt oder dass die zentralen Variablen (Bewegung, Körperfett/BMI) nicht objektiv gemessen, sondern durch Befragung erfasst wurden.
Die zentrale Bedeutung der Studie liegt nach Ansicht der Wissenschaftler darin, dass ihre Ergebnisse das Scheitern vieler Präventionsmaßnahmen erklärt, bei denen über mehr Sport und körperliche Aktivität Übergewicht vermieden oder sogar abgebaut werden sollte. Die zumeist in solch gescheiterten Interventionsstudien abgegebene Erklärung, das Ausmaß an körperlicher Bewegung sei zu gering gewesen, müsste zunächst einmal in Frage gestellt werden, erklären die Epidemiologen aus Plymouth. Von daher müsse Prävention von Übergewicht bei Kindern das zentrale Augenmerk auf eine gesunde Ernährung lenken und nicht immer mehr Sport und körperliche Bewegung fordern. Dies sei zwar gesundheitlich sinnvoll, zur Prophylaxe von Übergewicht jedoch ungeeignet. Diskutiert werden abschließend auch noch mögliche Erklärungen, warum dickere Kinder sich weniger bewegen. Sowohl psychologische Gründe seien hier denkbar (Ängste, aufgrund der körperlichen Figur ausgelacht zu werden, demotivieren die Kinder), aber auch physiologische (Kurzatmigkeit, frühere Erschöpfung beim Sport).
Es bleibt abzuwarten, ob weitere Längsschnitt-Studien mit größeren Stichproben diese Ergebnisse in Zukunft bestätigen. Auch wäre es wünschenswert, wenn in dort dann auch mehr Informationen erfasst würden über die konkreten, alltagspraktischen Hintergründe der gefundenen Veränderungen, sowohl im Bereich des Ernährungsverhaltens, wie auch im Bereich Sport und Bewegung. Die hier referierte Early-Bird-Studie dokumentiert nur die nackten Zahlen. Man kann zwar im Sinne der zentralen These annehmen, dass die mit Daten belegte Reduzierung der körperlichen Bewegung im Zeitverlauf der 7- bis 10jährigen tatsächlich mit der (ebenfalls mit Daten belegten) Zunahme des Körperfetts zusammenhängt. Aber ob hier nicht noch andere Änderungen in den schulischen oder häuslichen Lebensumständen eine Rolle spielen, bleibt vollkommen unüberprüft. Und ein wenig zu sehr schwarz-weiß gemalt ist auch der Titel der Studie, dessen zweiter Teil ("inactivity does not lead to fatness") so generalisiert zweifellos nicht zutrifft und die gesundheitlichen Positiveffekte von Sport und Bewegung indirekt in Frage stellt.
Hier ist ein kostenloses Abstract der Studie: B S Metcalf et al: Fatness leads to inactivity, but inactivity does not lead to fatness: a longitudinal study in children (EarlyBird 45) (Arch Dis Child doi:10.1136 / adc.2009.175927)
Gerd Marstedt, 5.10.10
Fahrradfahren und Walking schützen Frauen (in gewissem Umfang) vor einer Gewichtszunahme
 In einer Studie im Rahmen der sogenannten "Nurses' Health Study II" mit über 18 Tausend Krankenpflegerinnen wurde im Zeitablauf 1989 bis 2005 überprüft, ob körperliche Aktivitäten (Walking, Fahrradfahren) davor schützen, dick zu werden. Zentrales Ergebnis ist einerseits: Alle Frauen nahmen im 16-Jahres-Zeitraum an Körpergewicht nicht unerheblich zu (Durchschnitt: 9,3 kg). Auch häufige Spaziergänge schützten davor nicht, wohl aber strammes Walking und auch Fahrradfahren. Bei Frauen, die diese Aktivitäten regelmäßig betrieben, fiel die Gewichtszunahme unterdurchschnittlich aus und lag etwa um 1,4 bis 1,8 kg niedriger.
In einer Studie im Rahmen der sogenannten "Nurses' Health Study II" mit über 18 Tausend Krankenpflegerinnen wurde im Zeitablauf 1989 bis 2005 überprüft, ob körperliche Aktivitäten (Walking, Fahrradfahren) davor schützen, dick zu werden. Zentrales Ergebnis ist einerseits: Alle Frauen nahmen im 16-Jahres-Zeitraum an Körpergewicht nicht unerheblich zu (Durchschnitt: 9,3 kg). Auch häufige Spaziergänge schützten davor nicht, wohl aber strammes Walking und auch Fahrradfahren. Bei Frauen, die diese Aktivitäten regelmäßig betrieben, fiel die Gewichtszunahme unterdurchschnittlich aus und lag etwa um 1,4 bis 1,8 kg niedriger.
Die "Nurses' Health Study II" ist eine US-amerikanische Längsschnittstudie, in der über 116.000 (weibliche) Krankenpflegerinnen im Alter von 25-42 Jahren beteiligt sind. Seit dem Jahr 1989 werden in unterschiedlichen zeitlichen Abständen schriftliche Befragungen durchgeführt, in denen Informationen erfasst werden zur Krankheitsgeschichte der Frauen und ihrem Gesundheitsverhalten. Auch Körpergewicht, Body Mass Index und das Ausmaß an Sport und Bewegung wird erfragt.
Für die jetzt in der Zeitschrift "Archives of Internal Medicine" veröffentlichte Studie wurde eine Teilstichprobe ausgewählt von insgesamt 18.414 Frauen, allesamt noch vor der Menopause. Aus der Stichprobe ausgeschlossen wurden Teilnehmerinnen mit einem extremen (hohen oder niedrigen) Körpergewicht oder BMI, und auch solche, bei denen Krankheiten wie Herzinfarkt, Schlaganfall, Diabetes oder Krebs diagnostiziert worden waren.
Aus zentrale Variablen für die Analysen berücksichtigt wurden zunächst die 1989 und 2005 gemachten Angaben über das Ausmaß körperlicher Bewegung pro Woche, wobei viele Aktivitäten explizit vorgegeben wurden: Walking, Jogging, Fahrradfahren, Laufen, Tennis, Aerobic, Schwimmen und andere mehr. Weiterhin erfasst wurde auch, ob und wie viele Treppenstufen im Alltag zu Fuß zu bewältigen waren und auch der Zeitumfang, den man mit sitzenden Tätigkeiten (Fernsehen, Lesen, Mahlzeiten) verbrachte. Ferner erfasst wurden auch Körpergewicht und Körpergröße zur Bestimmung des BMI.
Zentrale abhängige Variable, also jener Wert, den man als Effekt verschiedener Einflussgrößen definierte (darunter das Ausmaß an Sport und körperlicher Bewegung), war die Veränderung des Körpergewichts im Zeitraum 1989 bis 2005. Als wesentliche unabhängige Variablen, also potenzielle Einflussfaktoren für das Körpergewicht wurden neben Sport und Bewegung auch verschiedene andere Faktoren mitberücksichtigt, so unter anderem das Ernährungsverhalten (anhand eines detaillierten Fragebogens), Alkoholkonsum, Rauchen, Einnahme von oralen Verhütungsmitteln, Schwangerschaften sowie die Einnahme von Antidepressiva.
In den statistischen Analysen wurden dann "multivariate Verfahren" eingesetzt, die es erlauben, den Effekt all dieser potenziellen Einflussfaktoren gleichzeitig zu überprüfen. Zentrale Befunde dieser über einen Zeitraum von 16 Jahren reichenden Studie waren dann folgende.
• Alle Frauen nahmen im Zeitraum 1989 bis 2005 an Gewicht zu, und zwar im Durchschnitt um 9,3 Kilogramm.
• Zusätzliche körperliche Aktivitäten im Vergleich zum Studienbeginn 1989 im zeitlichen Umfang von 30 Minuten bewirkten jedoch, dass diese Zunahme des Körpergewichts geringer ausfiel - dies auch unter statistischer Berücksichtigung anderer Einflussfaktoren.
• Diese Differenz zur durchschnittlichen Gewichtszunahme betrug -1,81 kg für regelmäßiges forciertes, strammes Gehen (Walking), -1,59 kg für Fahrradfahren, -1,45 kg für andere sportliche Aktivitäten wie Jogging, schnelles Laufen, Schwimmen, Aerobic, Tennis, Treppensteigen.
• Moderates, also wenig anstrengendes Gehen war im Vergleich dazu nicht erfolgreich und keine Maßnahme, um die Gewichtszunahme in Grenzen zu halten (Durchschnittswert 1989-2005 +0,06 kg).
• Erfolgreich war es demgegenüber wiederum, wenn Frauen, die 1989 noch überhaupt nicht Fahrrad gefahren waren, 2005 zumindest fünf Minuten am Tag radelten. Im Vergleich zu anderen Frauen, die dieses Fortbewegungsmittel weder 1989 noch später nutzen, lag ihre Gewichtszunahme um 0,74 kg niedriger.
• Bei übergewichtigen Frauen zeigt sich eine Wirkung erst bei ca. 2-3 Stunden wöchentlicher Körperbewegung.
Fahrradfahren, so stellen die US-Wissenschaftler in der Bilanz ihrer Forschungsergebnisse fest, ist damit ebenso gut geeignet, um Gewichtszunahmen einzugrenzen wie strammes Walking oder das Ausüben anderer intensivere Sportarten. Ein wenig verwundert stellen sie zugleich fest, dass das Fahrradfahren in den USA noch wenig gebräuchlich ist, weder als Fortbewegungsmittel noch als Instrument zur Gewichtskontrolle: Während in Niederlanden 27% der Bevölkerung Fahrrad fahren, sind dies in den USA nur 0,5%. Gäbe es, so eine ihr Schlussbemerkungen, für Radfahrer eine komfortable Infrastruktur für dieses Fortbewegungsmittel, also sichere und bequem zu nutzende Fahrradwege, so wäre dies ein Schutz vor gesundheitlichen Risikofaktoren und könnte auch zu sinkenden Mortalitätsraten führen.
Die Studie dokumentiert unabsichtlich wohl auch die neue Bescheidenheit, die in der Forschung zur Prävention von Übergewicht nach anfänglich extrem überzogenen Erwartungen an die Effizienz von Gesundheitsförderungsmaßnahmen herrscht: Nicht mehr die Prävention von Übergewicht gilt jetzt als Erfolg, sondern schon ein Ergebnis, wenn bei einer durchschnittlichen Gewichtszunahme von 9,3 Kilogramm in 16 Jahren diese Zunahme bei einigen Gruppen aufgrund ihrer sportlichen Aktivitäten nur noch 7,5 Kilogramm beträgt.
Hier ist ein kostenloses Abstract: Anne C. Lusk et al: Bicycle Riding, Walking, and Weight Gain in Premenopausal Women (Arch Intern Med. 2010;170(12):1050-1056)
Bernard Braun, 5.10.10
Lebensmittel aus der Fernsehwerbung: Einfach nur ungesund
 Eine US-amerikanische Studie hat einen Monat lang knapp 100 Stunden lang Fernsehsendungen samt der eingestreuten TV-Werbespots aufgezeichnet und die dort präsentierte Werbung für Lebensmittel analysiert. Das Ergebnis war überaus erschreckend: Würde man eine Mahlzeit nur aus jenen Produkten zusammenstellen, für die im Fernsehen geworben wird, wäre dies in gesundheitlicher Hinsicht mehr als bedenklich. Für diese Mahlzeit wurden die Durchschnittswerte der in der Werbung gezeigten Nahrungsmittel errechnet. Heraus kam bei dieser Mahlzeit mit einem Brennwert von 2.000 kcal: Sie enthielte das 25fache der gesundheitlich empfohlenen Menge an Zucker und das 21fache an Fett-Anteilen. Auf der anderen Seite würde man aber nur 40 Prozent des empfohlenen Gemüse-Anteils und nur 27 Prozent der empfohlenen Obstmenge zu sich nehmen. Darüber hinaus wäre der Verbraucher hinsichtlich vieler Bestandteile der Ernährung deutlich überversorgt, bei anderen hingegen (wie Vitamine und Mineralien) deutlich unterversorgt.
Eine US-amerikanische Studie hat einen Monat lang knapp 100 Stunden lang Fernsehsendungen samt der eingestreuten TV-Werbespots aufgezeichnet und die dort präsentierte Werbung für Lebensmittel analysiert. Das Ergebnis war überaus erschreckend: Würde man eine Mahlzeit nur aus jenen Produkten zusammenstellen, für die im Fernsehen geworben wird, wäre dies in gesundheitlicher Hinsicht mehr als bedenklich. Für diese Mahlzeit wurden die Durchschnittswerte der in der Werbung gezeigten Nahrungsmittel errechnet. Heraus kam bei dieser Mahlzeit mit einem Brennwert von 2.000 kcal: Sie enthielte das 25fache der gesundheitlich empfohlenen Menge an Zucker und das 21fache an Fett-Anteilen. Auf der anderen Seite würde man aber nur 40 Prozent des empfohlenen Gemüse-Anteils und nur 27 Prozent der empfohlenen Obstmenge zu sich nehmen. Darüber hinaus wäre der Verbraucher hinsichtlich vieler Bestandteile der Ernährung deutlich überversorgt, bei anderen hingegen (wie Vitamine und Mineralien) deutlich unterversorgt.
Fernsehwerbung für Nahrungsmittel und Getränke ist eine der effektivsten Möglichkeiten, das Ernährungsverhalten von Erwachsenen wie Kindern zu beeinflussen. Im Alter von 65 Jahren, so hat eine Studie errechnet, hat der Durchschnitts-Verbraucher in den USA etwa 2 Millionen Werbespots über sich ergehen lassen, der größte Teil davon war für Nahrungsmittel und Getränke (Quelle: The Sourcebook for Teaching Science). Im Jahre 2004 gaben Lebensmittelhersteller in den USA etwa 11,2 Milliarden Dollar für Werbung aus, etwa 2 Prozent der Summe für Verbraucherinformationen zu gesunder Ernährung.
Eine Reihe von Studie hatte bereits gezeigt, dass die in der Fernsehwerbung gezeigten Speisen und Getränke überwiegend "ungesund" sind, weil sie zu hohe Anteile an Fett, Salz oder Zucker enthalten. Die bislang vorgestellten Ergebnisse dieser Studien sind jedoch methodisch angreifbar. Beispielsweise wurde in einigen Studien untersucht, wie viele Werbespots für Produkte mit zuviel Salz, Fett oder Zucker es gibt und wie viele Spots im Vergleich dazu für gesundheitlich empfehlenswerte Produkte. In der jetzt veröffentlichten Studie wurde jedoch nicht die Zahl der Werbesendungen miteinander verglichen, sondern bei den dort präsentierten Produkten wurde analysiert, welche Bestandteile im Einzelnen (Zucker, Fett, Fleisch, Gemüse, Milchprodukte, Obst, Gemüse, Ballaststoffe etc.) in einer Portion des beworbenen Produkts enthalten sind. Die dafür ermittelten Durchschnittswerte - die auch noch für andere Nahrungsbestandteile wie Vitamine, Spurenelemente usw. errechnet wurden - dienten dann als Basis für die Konstruktion einer Mahlzeit von 2.000 kcal., die ein fiktiver Konsument zu sich nimmt, wenn er sich einzig und allein mit Produkten ernährt, die er in der TV-Werbung gesehen hat.
Für die Auswahl der analysierten Lebensmittel, Speisen und Getränke zeichneten die Wissenschaftler im Herbst 2004 während eines 28tägigen Zeitraums Fernsehsendungen samt der dazu geschalteten Werbung auf, insgesamt 96 Stunden, die später analysiert wurden. Berücksichtigt wurden überwiegend Sendungen zur Hauptsendezeit, in begrenztem Umfang auch Kinder-Sendungen am Samstag vormittag. Jedes dort vorkommende Produkt wurde erfasst und mit Hilfe einer speziellen Computer-Software ("Nutritionist Pro") hinsichtlich der zentralen Nährstoffe und anderer Bestandteile analysiert.
Würde ein Verbraucher sich Mahlzeiten zusammenstellen und nur die in der Werbung gezeigten Produkte verwenden, so wäre dies überaus bedenklich. "In der Werbung gezeigte Lebensmittel," so der Leiter der Studie Prof. Michael Mink, "enthalten eine zu große Menge an Bestandteilen, die mit der Verursachung chronischer Erkrankungen im Zusammenhang stehen (u.a. gesättigte Fette, Cholesterin, Salz). Andererseits mangelt es an Substanzen, die vor Krankheiten schützen können wie Ballaststoffe, Vitamin A, E und D." In der Analyse einer solchen durchschnittlichen Essensmahlzeit nur aus Werbeprodukten zeigten sich folgende Befunde im Einzelnen.
• Sie enthält 2.560 % der täglich empfohlenen Menge an Zucker,
• 2.080 % der pro Tag empfohlenen Menge an Fett,
• aber nur 40 % des Anteils an Gemüse
• und nur 27 % der empfohlenen Tagesdosis für Obst.
• Die Mahlzeit enthielte weiterhin ein Überangebot an Eiweiß, Fett insgesamt, gesättigten Fettsäuren, Cholesterin und Natrium,
• während andererseits ein deutlicher Mangel herrscht in Bezug auf Kohlehydrate, Ballaststoffe, Vitamin A , E und D, Pantothensäure, Eisen, Phosphor, Kalzium, Magnesium, Kupfer und Kalium.
Zwar untersucht die Studie nicht, so räumen die Autoren ein, ob und in welchem Umfang nun Verbraucher ihren Speiseplan an den (oft so genannten "Einkaufs-Tipps") im Werbefernsehen ausrichten. Dies zu untersuchen, sei eine überaus wichtige zukünftige Forschungsaufgabe. Allerdings haben andere Studien schon gezeigt, dass beispielsweise schon 4-5jährige Vorschulkinder von McDonald's Werbebotschaften im Fernsehen beeinflusst werden. Und dass TV-Werbung durchaus geeignet ist, das Konsumentenverhalten zu steuern, zeigt die Höhe der Ausgaben für Werbung und Marketing.
Von der Studie ist kostenlos leider nur ein Abstract erhältlich: Michael Mink, Alexandra Evans, Charity G. Moore, Kristine S. Calderon, Shannon Cosgrove: Nutritional Imbalance Endorsed by Televised Food Advertisements (Journal of the American Dietetic Association, Volume 110, Issue 6, June 2010, Pages 904-910, doi:10.1016/j.jada.2010.03.020)
Gerd Marstedt, 1.8.10
"Kann denn das bisschen Rauch gefährlich sein?" - Kurzinformationen zum Gesundheitsrisiko "Passivrauchen"
 Auch wenn das Statistische Bundesamt gerade meldet, dass die Steuereinnahmen durch Zigaretten im zweiten Quartal 2010 u.a. wegen der gestiegenen Preise 10 % niedriger lagen als im Vergleichsquartal des Vorjahrs, stieg der Großteil der Raucher nicht aus, sondern nur auf selbstgedrehte Glimmstengel um.
Auch wenn das Statistische Bundesamt gerade meldet, dass die Steuereinnahmen durch Zigaretten im zweiten Quartal 2010 u.a. wegen der gestiegenen Preise 10 % niedriger lagen als im Vergleichsquartal des Vorjahrs, stieg der Großteil der Raucher nicht aus, sondern nur auf selbstgedrehte Glimmstengel um.
Damit tragen sie aber auch weiterhin zu einem immer besser beschriebenen Gesundheitsrisiko durch Aktiv- und Passivrauchen bei, dessen Dimensionen das Robert Koch Institut in der aktuellen Ausgabe Nr. 3 seines Info-Dienstes "GBE-kompakt" zum Thema Passivrauchen nochmals kurz und gut verständlich zusammenfasst:
• Demnach werden bei der Verbrennung von Tabakprodukten über 4.800 Stoffe freigesetzt. Bei 90 dieser Stoffe ist eine krebserregende Wirkung nachgewiesen oder wird vermutet.
• Das gesundheitsgefährdende Potenzial von Tabakrauch ist auch dann hoch, wenn dieser nicht direkt inhaliert, sondern indirekt über die Raumluft aufgenommen wird. Die Konzentration vieler schädlicher Inhaltsstoffe ist sogar in dem Rauch, der an die Umgebung abgegeben wird, höher als im aktiv inhalierten Tabakrauch.
Weitere Kernaussagen des Berichts, hauptsächlich Ergebnisse der RKI-Studie "Gesundheit in Deutschland (GEDA)" aus dem Jahr 2009, sind:
• Passivrauchen geht mit einem eindeutig erhöhten Krankheits- (Liungenkrebsrisiko ist um 20-30 % erhöht) und vorzeitigen Sterberisiko (geschätzt werden 3.300 Todesfälle pro Jahr) einher.
• Ein Drittel der Erwachsenen und die Mehrheit der Kinder und Jugendlichen in Deutschland, die selbst nicht rauchen, sind regelmäßig einer Passivrauchbelastung ausgesetzt.
• Personen mit niedrigem Sozialstatus sind besonders häufig mit Tabakrauch konfrontiert.
• In den letzten zehn Jahren hat die Passivrauchbelastung der Bevölkerung abgenommen.
• Maßgeblich daran beteiligt sind die in den letzten Jahren auch in Deutschland langsam realisierten Rauchverbote in öffentlichen Gebäuden, Kneipen, Verkehrsmitteln und Restarants. Eine Fülle von Studien aus Ländern, die bereits länger Rauchverbote erlassen und durchgesetzt hatten, zeigen, dass die positive Wirkung der Rauchverbote unmittelbar eintritt und die Inzidenz und Prävalenz einer Fülle von Erkrankungen in unerwartet kurzer Zeit signifikant und nachhhaltig senkt.
Die sechsseitige Broschüre "GBE-kompakt" 3/2010 zum Thema "Gesundheitsrisiko Passivrauchen" ist von Thomas Lampert und Sabine List vom RKI verfasst und kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 20.7.10
Aufwand an körperlicher Aktivität, um langfristig das Normalgewicht zu halten, ist höher als erwartet
 Regelmäßige körperliche Bewegung gilt neben einer "vernünftigen" Ernährung als ein wichtiger Einflussfaktor, um das Körpergewicht langfristig im Normalbereich zu halten und als Garant für einen substantiellen gesundheitlichen Nutzen. Mehrere Leitlinien empfehlen, sich dafür wenigstens 150 Minuten pro Woche moderat bis intensiv zu bewegen - dies entspricht 7,5 sogenannter "metabolic equivalent" ("MET") Stunden pro Woche. Reichen aber etwas mehr als täglich 20 Minuten dauerndes Walking, strammes Spazierengehen oder Joggen wirklich für den genannten Nutzen aus? Eine der ernüchternden Antworten aus einer gerade abgeschlossenen Studie in den USA lautet: Nein und es bedarf weiterer Voraussetzungen für den Erfolg.
Regelmäßige körperliche Bewegung gilt neben einer "vernünftigen" Ernährung als ein wichtiger Einflussfaktor, um das Körpergewicht langfristig im Normalbereich zu halten und als Garant für einen substantiellen gesundheitlichen Nutzen. Mehrere Leitlinien empfehlen, sich dafür wenigstens 150 Minuten pro Woche moderat bis intensiv zu bewegen - dies entspricht 7,5 sogenannter "metabolic equivalent" ("MET") Stunden pro Woche. Reichen aber etwas mehr als täglich 20 Minuten dauerndes Walking, strammes Spazierengehen oder Joggen wirklich für den genannten Nutzen aus? Eine der ernüchternden Antworten aus einer gerade abgeschlossenen Studie in den USA lautet: Nein und es bedarf weiterer Voraussetzungen für den Erfolg.
In dieser Studie, einer zwischen 1992 und 2007 durchgeführten Längsschnittstudie, wurde bei 34.079 gesunden US-Frauen, die im Durchschnitt 54 Jahre alt waren, etwas genauer und über einen längeren Zeitraum untersucht, welcher Aufwand an körperlicher Aktivität zu welchen Ergebnissen bei der Gewichtszunahme führte. Die Teilnehmerinnen ernährten sich im Untersuchungszeitraum normal, d.h. ohne eine bestimmte Diät.
Dazu wurde bei den Frauen zu Beginn der Studie und dann nach 3, 6, 8, 10, 12 und 13 Jahren der Umfang ihrer körperlichen Aktivitäten und ihr Körpergewicht erfasst. Die Studienteilnehmerinnen wurden in drei Gruppen mit unterschiedlichem Bewegungsniveau eingeteilt: Weniger als 7,5, 7,5 - 21, 21 und mehr MET-Stunden pro Woche. Dabei entsprechen 21,5 MET in etwa 60 Minuten körperlicher Bewegung pro Tag.
Die Ergebnisse der Kohortenstudie sehen folgendermaßen aus:
• Die Frauen nahmen durchschnittlich um 2,6 Kilogramm zu.
• Die einzige Teilgruppe, deren Gewicht in den 15 Jahren um weniger als 2,3 kg zugenommen hatte, waren 4.540 Frauen (13,3%), deren Gewicht beim Studienstart auf der BMI-Wertskala unter 25 lag und die sich während der gesamten Studienzeit durchschnittlich 60 Minuten pro Tag körperlich aktiv verhalten hatten - also deutlich länger als in den bisherigen Leitlinien auch zur Gewichtsregulierung empfohlen wird.
• Bei den Studienteilnehmerinnen mit einem BMI zwischen 25 und 29,9 und den Adipösen mit einem BMI von 30 und mehr Punkten gab es keine signifikanten Zusammenhänge zwischen Gewichtsveränderungen und zeitlichem Umfang körperlicher Aktivitäten.
Für den Einfluss der körperlichen Bewegung auf die Gewichtszunahme gab es zwar auch bei Zeiten unter 7,5 MET und zwischen 7,5 und 20,9 MET pro Woche unterscheidbare Wirkungen. Die Effekte in beiden Gruppen waren zwar gegenüber dem Effekt in der Gruppe mit mehr als 21 MET signifikant geringer und belegen damit eine Art Dosis-Wirkungsbeziehung. Die Unterschiede der Gewichtszunahme zwischen den beiden Gruppen mit geringerer körperlicher Bewegung waren aber zu gering, als dass der Unterschied zwischen ihnen als statistisch signifikant zu bewerten wäre.
Ein gewisses Maß an körperlicher Bewegung und vor allem die immer wieder in Leitlinien als wirkungsvoll empfohlene durchschnittliche Zeitdauer von 150 Minuten pro Woche ist nach den Ergebnissen dieser Studie zu gering, um bei sich normal ernährenden Personen eine langfristige Gewichtszunahme zu verhindern. Erfolge können mit einem rund dreifach höheren Aufwand pro Tag und dann auch nur bei normalgewichtigen Frauen erreicht werden. Bei Frauen mit einem BMI von über 25 muss für langfristige Wirkungen auf die Zunahme ihres Gewichts zusätzlich zur ebenfalls möglichst längeren Dauer körperlicher Bewegung eine Reduktion der Kalorienaufnahme erfolgen.
Ein kostenloses Abstract des Aufsatzes ist hier erhältlich: Lee IM, Djoussé L, Sesso HD, Wang L, Buring JE. (2010): Physical activity and weight gain prevention (JAMA 2010 Mar 24;303(12):1173-9).
Die Ergebnisse der Studie von Lee et al. bestätigen im Übrigen Ergebnisse einer anderen Untersuchung zur Wirkung einer Kombination körperlicher Aktivitäten mit kalorienreduzierter Diät auf übergewichtige Frauen aus dem Jahr 2008.
An ihr nahmen zwischen Ende 1999 und Ende 2003 insgesamt 201 übergewichtige bis adipöse junge bis mittelaltrige Frauen teil (BMI 27 bis 40). Eines der wichtigen Ergebnisse der Studie war dann, dass Kalorienreduktion allein nicht zu einer nachhaltigen Gewichtsabnahme der übergewichtigen Teilnehmer führte. Eine anhaltende Abnahme des Gewichts von mehr als 10% des Ausgangsgewichts zeigte sich am Ende des zweijährigen Interventionszeitraums nur bei den Teilnehmerinnen, die sich zusätzlich zu ihrer Diät noch mindestens 275 Minuten pro Woche körperlich bewegten. Auch bei durchweg übergewichtigen Frauen würde also der eingangs genannte Bewegungs-Aufwand von 20 Minuten pro Tag nicht zu der erhofften Wirkung führen.
Ein kostenloses Abstract ist hier erhältlich: John M. Jakicic; Bess H. Marcus; Wei Lang; Carol Janney: Effect of Exercise on 24-Month Weight Loss Maintenance in Overweight Women (Arch Intern Med, 2008;168[14]:1550-1559)
Ebenfalls kostenlos ehält man den kompletten Aufsatz
Bernard Braun, 3.6.10
Alkohol: höhere Preise - weniger Probleme
 Zwei "natürliche Experimente" hatten gezeigt, dass der Konsum von Alkohol und die alkoholassoziierten Todesfälle vom Alkoholpreis abhängig sind (wir berichteten): deutliche Preissenkungen in Finnland ab 2004 führten zur Erhöhung von Konsum und Mortalität, deutliche Preiserhöhungen in Alaska in den Jahren 1983 und 2002 zur Minderung.
Zwei "natürliche Experimente" hatten gezeigt, dass der Konsum von Alkohol und die alkoholassoziierten Todesfälle vom Alkoholpreis abhängig sind (wir berichteten): deutliche Preissenkungen in Finnland ab 2004 führten zur Erhöhung von Konsum und Mortalität, deutliche Preiserhöhungen in Alaska in den Jahren 1983 und 2002 zur Minderung.
Eine englische Untersuchung befasste sich jetzt mit der Frage, wie sich unterschiedliche Muster der Preisgestaltung auf den Konsum und die Gesundheit unterschiedlicher Gruppen innerhalb der englischen Bevölkerung auswirken. Gestaltbar ist der Preis über Steuererhöhungen, Festlegen eines Mindestpreises für eine "Alkoholeinheit" (10 ml Äthanol), Verbot von Sonderangeboten sowie Kombinationen dieser Elemente.
Daten über den Alkoholkonsum standen aus Haushaltsbefragungen zur Verfügung. Den Anteil, den Alkohol an der Verursachung von 47 Krankheiten ausmacht ("attributable Fraktion"), errechneten sie aus systematischen Übersichtsarbeiten und Meta-Analysen. Die Veränderungen des Alkoholkonsums für 18 Preisgestaltungen bestimmten sie mit dem Konzept der Preiselastizität. Als Preiselastizität wird "die prozentuale Veränderung der Nachfragemenge nach einem Gut, wenn eine Preisänderung bei diesem Gut um ein Prozent nach oben oder unten eintritt" bezeichnet (Duden Wirtschaft). Sie ist somit ein Maß für die Reaktion der Nachfrage auf Preisveränderungen. In England führt eine Erhöhung des Verkaufspreises um 10% zu einer Minderung des Konsums um 5% bei einem durchschnittlichen Konsumenten, entsprechend einer Preiselastizität von -0,5.
Aus den umfangreichen Ergebnissen seine hier Folgende genannt.
Allgemeine Preiserhöhungen bewirken eine Minderung des Konsums, der alkoholbedingten Mortalität und Morbidität sowie einen Gewinn an Lebensqualität (ausgedrückt in QALYs - quality adjusted life years).
Eine allgemeine Preiserhöhung in England um 10% mindert pro Jahr
• die Zahl der alkoholbedingten Todesfälle um 1.460,
• die chronische Morbidität um 20,5 Fälle pro 1.000 Personen,
• die akute Morbidität um 5,8 Ereignisse pro 1.000 Personen.
Ein Mindestpreis von 0,7 Engl. Pfund für eine Alkoholeinheit in Verbindung mit einem Verbot von Sonderangeboten verhindert pro Jahr 7.150 Todesfälle sowie 100,2 chronische und 23,3 akute Krankheitsereignisse pro 1.000 Personen.
Der Konsum in der Gruppe der 18- bis 24-Jährigen mit schädlichem Gebrauch wird durch Preiserhöhungen bei Niedrigpreis-Alkoholika stärker gesenkt als im Bevölkerungsdurchschnitt.
Die Berechnungen beruhen im Wesentlichen auf Daten, die zu einem bestimmten Zeitpunkt bzw. in einem bestimmte Zeitraum erhoben wurden ("Querschnittdaten"). Die Autoren weisen darauf hin, dass die Ergebnisse mit Längsschnittdaten überprüft werden sollten.
Zu vergleichbaren Ergebnissen gelangt eine systematische Übersichtsarbeit, die im Februar 2010 im American Journal of Preventive Medicine erschien. Insgesamt wurden 78 internationale Studien eingeschlossen, die sich mit Effekten von Preiserhöhungen für Alkohol auf Konsum und Gesundheit befassten. Hier einige Ergebnisse:
• Gesamtkonsum in einer Gesellschaft - fast alle Studien bestätigen den Zusammenhang einer Minderung des Gesamtkonsums bei einer Erhöhung der Preise.
• Konsum bei Jugendlichen - höhere Preise gehen mit niedrigerem Konsum einher
• Verkehrsunfälle - höhere Preise senken die Zahl der Unfälle und die Zahl der Personen, die unter Alkoholeinfluss motorisiert am Straßenverkehr teilnehmen.
• Sterblichkeit an alkoholassoziierten Krankheiten - höhere Alkoholpreise stehen in Zusammenhang mit niedrigerer Mortalität an Leberzirrhose und einigen anderen Todesursachen.
• Gewalt - höhere Alkoholsteuer geht mit niedrigeren Raten z.B. an Körperverletzung und Vergewaltigung sowie Gewalt gegen Kinder einher.
Die hier dargelegten (und viele weitere) Studien zeigen, dass der Staat sowohl durch Handeln als auch durch Nicht-Handeln über das Preisniveau von alkoholischen Getränken den Konsum in der Bevölkerung beeinflusst. Für wissenschaftlich begründete politische Entscheidungen zur Alkoholprävention über die Preise dürfte die Datenlage mehr als ausreichend sein. Wie allerdings Politik zu diesem Thema in Deutschland funktioniert, beleuchtet der Beitrag in der ZEIT "Die Gesetzeshüter".
Purshouse RC, Meier PS, Brennan A, Taylor KB, Rafia R. Estimated effect of alcohol pricing policies on health and health economic outcomes in England: an epidemiological model. The Lancet 2010;375(9723):1355-64. Abstract
Elder RW, Lawrence B, Ferguson A, Naimi TS, Brewer RD, Chattopadhyay SK, et al. The Effectiveness of Tax Policy Interventions for Reducing Excessive Alcohol Consumption and Related Harms. American Journal of Preventive Medicine 2010;38(2):217-29. Abstract
Die Gesetzeshüter. Wie die deutschen Bierbrauer neue Gesetze gegen Alkoholmissbrauch verhindern und die Drogenbeauftragte der Bundesregierung entmachten. Die ZEIT, 14.5.2009, S. 17
David Klemperer, 18.5.10
Irrtum korrigiert: Obst und Gemüse schützen kaum oder gar nicht vor Krebs
 Obst und Gemüse sind Teil einer gesunden Ernährung. Auch nach den neuesten Erkenntnissen senkt der Verzehr von Obst und Gemüse die Risiken für Herzinfarkte und Schlaganfälle.
Obst und Gemüse sind Teil einer gesunden Ernährung. Auch nach den neuesten Erkenntnissen senkt der Verzehr von Obst und Gemüse die Risiken für Herzinfarkte und Schlaganfälle.
Korrigiert werden muss aber - leider - die Vorstellung, damit auch das Risiko für Krebserkrankungen nennenswert zu mindern. Dies ist ein Ergebnis der Europäischen Ernährungsstudie (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC)-Studie). Mit 520.000 Teilnehmern ist es die größte jemals durchgeführte Studie zu Ernährung und Gesundheit. Beteiligt sind 23 Studienzentren in 10 westeuropäischen Ländern.
Für die Frage nach dem Zusammenhang von Ernährung und Krebs wurden die Daten von 142.605 Männern und 335.873 Frauen ausgewertet. Bei 9.604 Männern und 21.000 Frauen war bei einer mittleren Beobachtungszeit von 8,7 Jahren eine Krebserkrankung aufgetreten.
Die Ernährungsgewohnheiten und die Lebensgewohnheiten wurden detailliert zu Beginn der Studie erhoben. Geprüft wurde der Zusammenhang zwischen dem Konsum von Obst und Gemüse und der Krebsinzidenz (Neuauftreten von Krebs).
Ein um 200 g pro Tag erhöhter Verzehr von Obst und Gemüse verringerte das Risiko für Krebs um 3 %. 100 g mehr Gemüse pro Tag senkten das Krebsrisiko um 2 %, allerdings nur bei Frauen und zwar am stärksten solchen mit hohem Alkoholkonsum.
Die Autoren bezeichnen die gemessenen Effekte als sehr klein und daher unsicher und möglicherweise Folge von nicht vermeidbaren methodischen Ungenauigkeiten.
Lehrreich ist das Thema bezüglich der Art und Weise, wie Wissen zu einem Gesundheitsthema gewonnen wird. Im Jahr 1990 empfahl die Weltgesundheitsorganisation den Verzehr von 400 g Obst und Gemüse pro Tag in der Annahme, damit das Risiko für Krebs und chronische Krankheiten zu senken. Noch im Jahr 1997 sprach ein internationales Expertengremium, dem von mehr als 100 Experten zugearbeitet wurde, Ernährungsempfehlungen aus, mit denen man die Krebsinzidenz um 30 bis 40 % zu senken können glaubte, entsprechend 3 bis 4 Mio. verhinderter Krebserkrankungen pro Jahr. Leider hat der Herausgeber, der World Cancer Research Fund, diese Studie von der Website genommen. Im Internet verfügbar ist lediglich eine Zusammenfassung in der Zeitschrift "Nutrition".
Festzustellen bleibt, dass hier ein hochrangiges Expertengremium sich seiner Sache völlig sicher war, sich aber trotzdem grundlegend geirrt hat. Die Fehleinschätzung kam dadurch zustande, dass man sich weitgehend auf die Ergebnisse von Fall-Kontroll-Studien verließ. In Fall-Kontroll-Studien gaben bereits Erkrankte und Gesunde aus der Erinnerung ihre Ernährungsgewohnheiten an - dabei ergab sich zumeist ein Mehrkonsum von Obst und Gemüse bei den Gesundgebliebenen im Vergleich zu den an Krebs Erkrankten, was als Schutzfaktor vor Krebs interpretiert wurde. Die Fall-Kontroll-Studie ist jedoch fehleranfällig, weil die Erfassung der Ernährung über längere vergangene Zeiträume ungenau ist. In prospektiven, also in die Zukunft gerichteten Studien (Kohortenstudien) werden die Ernährung wie auch andere Aspekte des Gesundheitsverhaltens hingegen zu Beginn der Studie und ggf. in der Folge wiederholt durch persönliche Befragung oder Fragebögen erfasst, was zu sehr viel genaueren Ergebnissen führt. In den letzten Jahren wurden Ergebnisse von sechs Kohortenstudien mit insgesamt etwa 10.000 Teilnehmern veröffentlicht. Die Ergebnisse waren widersprüchlich, drei Studien zeigten eine Minderung der Krebsinzidenz, zwei fanden keine Unterschiede, eine zeigte eine Minderung der Krebssterblichkeit.
Die EPIC-Studie setzt mit fast 480.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, einer Beobachtungszeit von fast 9 Jahren und 30.000 Krebsfällen neue Maßstäbe.
Website der Epic-studie
Boffetta P, Couto E, Wichmann J, et al. Fruit and Vegetable Intake and Overall Cancer Risk in the European Prospective Investigation Into Cancer and Nutrition (EPIC). J. Natl. Cancer Inst. 2010:djq072. Abstract
World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research. Food, Nutrition, and the Prevention of Cancer: A Global Perspective. Nutrition 1999;15(6):523-26. (kein Abstract, Volltext kostenpflichtig)
David Klemperer, 14.4.10
Minderung des Softdrinkkonsums von Kindern und Jugendlichen - keine einfachen Lösungen
 Softdrinks wie Cola, Fanta und Sprite sind bei Kindern und Jugendlichen beliebt. Sie sind kalorienreich, verschaffen kein Sättigungsgefühl und tragen daher auch zum Übergewicht bei. Die Minderung des Konsums ist aus der Perspektive der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen erwünscht. In einer Studie der Mai-Ausgabe der Zeitschrift Health Affairs befassten sich die Autoren mit der Wirksamkeit von Maßnahmen zur Minderung des Softdrinkkonsums von Kindern und Jugendlichen. Dabei ging es um die Verfügbarkeit von Softdrinks über Getränkeautomaten in der Schule und um Steuern auf Softdrinks.
Softdrinks wie Cola, Fanta und Sprite sind bei Kindern und Jugendlichen beliebt. Sie sind kalorienreich, verschaffen kein Sättigungsgefühl und tragen daher auch zum Übergewicht bei. Die Minderung des Konsums ist aus der Perspektive der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen erwünscht. In einer Studie der Mai-Ausgabe der Zeitschrift Health Affairs befassten sich die Autoren mit der Wirksamkeit von Maßnahmen zur Minderung des Softdrinkkonsums von Kindern und Jugendlichen. Dabei ging es um die Verfügbarkeit von Softdrinks über Getränkeautomaten in der Schule und um Steuern auf Softdrinks.
Im Rahmen einer Kohortenstudie (Early Childhood Longitudinal Study-Kindergarten Cohort) wurden im Jahr 2004 bzw. 2007 die Kinder der 5. bzw. 8. Klasse gefragt, wie oft sie in der Schule einen Softdrink konsumiert und gekauft hatten. 27% der Fünftklässler und 60% der Achtklässler hatten in der Schule Zugang zu Softdrinks über Getränkeautomaten. 84 % aller Schüler gaben an, in der vorausgegangenen Woche Softdrinks (im Durchschnitt 6) konsumiert zu haben. 13% der Fünftklässler und 25% der Achtklässlergaben hatten Softdrinks in der Schule gekauft.
Bei Vorhandensein von Getränkeautomaten sind der Anteil der Schüler, die Softdrinks in der Schule konsumieren sowie die Anzahl der in der Schule konsumierten Softdrinks deutlich höher. Keine wesentlichen Unterschiede zeigten sich jedoch, wenn man den Konsum innerhalb und außerhalb der Schule aufaddiert. Dies bedeutet, dass Kinder aus Schulen ohne Getränkeautomaten den schulischen Minderkonsum durch Mehrkonsum außerhalb der Schule wieder ausgleichen.
Die Effekte von Softdrink-Steuern, die in einigen Bundesstaaten auf Softdrinks erhoben werden, auf den Konsum von Softdrinks und das Gewicht von Kindern und Jugendlichen untersuchten die Wissenschaftler mit den Daten des "National Health and Nutrition Examination Survey", einer großen amerikanischen Ernährungsstudie (Website Fragebögen).
Der Effekt von Softdrink-Steuern
Erfragt wurden die konsumierten Lebensmittel der letzten 24 Stunden. 54% der Kinder und Jugendlichen gaben an, einen Softdrink zu sich genommen zu haben, entsprechend durchschnittlich 205 Kalorien. Im Vergleich der Bundesstaaten mit und ohne Softdrink-Steuer zeigten sich jedoch keine wesentlichen Unterschiede im Konsum und im Körpergewicht. In Bundesstaaten mit Softdrinksteuer sind im Vergleich zu Bundesstaaten ohne Softdrinksteuer das Durchschnittsgewicht von Kindern und Jugendlichen, die durch Softdrinks zugeführte Kalorienmenge und auch das Gewicht etwas höher, der Anteil der Softdrinkkonsumenten entgegen den Erwartungen etwas geringer - keiner der Unterschiede erreicht jedoch statistische Signifikanz.
Die Autoren folgern, dass die gegenwärtige Praxis der Verkaufsrestriktion an Schulen und der Steuer in Bundesstaaten den Softdrinkkonsum nicht zu spürbaren Gewichtsminderungen bei Kindern und Jugendlichen führt. Restriktionen im Zugang müssten umfassender und Steuern auf Softdrinks höher sein, wenn diese Maßnahmen wirksam sein sollen.
Hier ist ein Abstract der Studie: Fletcher JM, Frisvold D, Tefft N.: Taxing Soft Drinks And Restricting Access To Vending Machines To Curb Child Obesity Health Aff 2010:hlthaff.2009.0725.
Ergänzend ist anzumerken, dass das Ernährungsverhalten von Kindern und Jugendlichen durch eine Vielzahl von Faktoren bestimmt wird. Die Beeinflussung eines Einzelaspektes lässt keine durchschlagenden Effekte erwarten. Erfolgversprechend sind eher bevölkerungsweite, multimodale Interventionen, wie sie der Sachverständigenrat Gesundheit in seinem Gutachten 2000/2001 umrissen hat: (SVR Band III.3, Ziffer 62-93)
Dabei werden drei Ebenen angesprochen:
1. Bevölkerungsweite Strategien, Streubotschaften und Anreize
2. Zielgruppen- und Setting-spezifische Kampagnen
3. Persönliche Kommunikation, Beratung und Behandlung
Hier eine Auswahl von Beiträgen im Forum Gesundheitspolitik zum Ernährungsverhalten:
• Steuer auf Junk Food: Gut für die Gesundheit
• Verbot der Fernsehwerbung von Fastfood-Restaurants würde die Verbreitung von Übergewicht bei Kindern senken
• Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm: Kinder imitieren auch gesundheitsriskante Ernährungsgewohnheiten ihrer Eltern,
• Viel zu viele Kalorien - Kindermenüs in Fastfoodketten
• McDonald's Werbebotschaften beeinflussen schon 4-5jährige Vorschulkinder
• Elterneinfluss auf das Essverhalten ihrer Kinder ist kleiner als erwartet
Weitere Beiträge in der Rubrik Prävention - Gesundheitsverhalten
David Klemperer, 11.4.10
Steuer auf Junk Food: gut für die Gesundheit
 Höhere Preise für Cola und Pizza senken den Konsum dieser Lebensmittel, lautet das Fazit einer amerikanischen Studie.
Höhere Preise für Cola und Pizza senken den Konsum dieser Lebensmittel, lautet das Fazit einer amerikanischen Studie.
Die CARDIA-Studie wurde im Jahr 1985 in den USA initiiert, um die Faktoren zu untersuchen, die zur Entwicklung von Herzkreislauferkrankungen beitragen. Aufgenommen wurden 5115 junge Männer und Frauen (Alter 18 bis 30 Jahre) unterschiedlicher Ethnien und unterschiedlichen Bildungsstandes. Das Ernährungsverhalten wurde über einen Zeitraum von 20 Jahren mehrfach per Fragebogen erfasst. Körpergröße und Gewicht sowie Glucose und Insulin wurden im Blut wurden gemessen. An soziodemographischen Merkmalen wurden der höchste Bildungsabschluss, das Jahreseinkommen und der Familienstatus erfragt.
Analysiert wurde die Preiselastizität, d.h. die prozentuale Änderung des Konsums eines Lebensmittels bei prozentualer Änderung des Preises dieses oder eines anderen Lebensmittels - so z.B. die Veränderung des Konsums zuckerhaltiger Limonade und auch des Milchkonsums bei Veränderungen des Limonadenpreises.
Preisänderungen von Limonade und Pizza wirkten sich spürbar auf deren Konsum aus. Ein Anstieg des Preises für Limonade um 10 Prozent ging mit einem Rückgang der durch Limonade aufgenommenen Kalorien um 7 Prozent einher. Bei Pizza führt die Verteuerung um 10 Prozent zu einer Minderung der Kalorien durch Pizzakonsum um 11,5 Prozent.
Dieser Studien zufolge werden 124 Kalorien weniger aufgenommen, wenn der Limonadenpreis um einen Dollar steigt, einhergehend mit einer Gewichtsabnahme von 1,1 kg und verbesserten Stoffwechselwerten. Preissteigerungen bei Pizza zeigten vergleichbare Effekte. Steigen die Preise für Limonade und Pizza addierten sich die Effekte.
Die für den Bundesstaat New York vorgeschlagene aber abgelehnte Besteuerung von Junk Food um 18 Prozent würde bei jungen Erwachsenen und Menschen im mittleren Lebensalter zu einer Minderung der Energiezufuhr um 56 Kalorien pro Tag und zu einer Gewichtsreduktion von 2,25 kg pro Jahr sowie einer Verbesserung der Stoffwechsellage führen.
Nach Meinung der Autoren könnte somit eine Besteuerung von Junkfood über die Minderung der Kalorienaufnahme und des Körpergewichts z.B. zu einer Reduktion der Neuerkrankungen an Diabetes führen.
Duffey KJ, Gordon-Larsen P, Shikany JM, Guilkey D, Jacobs DR, Jr, Popkin BM. Food Price and Diet and Health Outcomes: 20 Years of the CARDIA Study. Arch Intern Med 2010;170(5):420-426. Abstract der Studie
David Klemperer, 26.3.10
Körperliche Aktivität ist hilfreich zur Sturz-Prävention bei Älteren
 Zu den akut und oft auch auf Dauer mit negativen körperlichen und psychischen Folgen verbundenen gesundheitlichen Ereignissen von älteren, zu Hause wohnenden Menschen gehören Stürze. Zu den unerwünschten Folgen gehören lange Immobilität durch schlecht heilende Knochenbrüche, dauerhafte Einschränkungen der Mobilität aus Angst vor erneuten Stürzen und der Verlust des Vertrauens in die eigene Bewegungsfähigkeit bis hin zur häuslichen oder stationären Pflegebedürftigkeit. 30% der über 65-Jährigen zu Hause wohnenden Personen stürzen mindestens einmal pro Jahr. Auch wenn nur rund 10 % der Stürze zu einem Knochenbruch führen, benötigen rund ein Fünftel der gestürzten Personen medizinische Behandlung.
Zu den akut und oft auch auf Dauer mit negativen körperlichen und psychischen Folgen verbundenen gesundheitlichen Ereignissen von älteren, zu Hause wohnenden Menschen gehören Stürze. Zu den unerwünschten Folgen gehören lange Immobilität durch schlecht heilende Knochenbrüche, dauerhafte Einschränkungen der Mobilität aus Angst vor erneuten Stürzen und der Verlust des Vertrauens in die eigene Bewegungsfähigkeit bis hin zur häuslichen oder stationären Pflegebedürftigkeit. 30% der über 65-Jährigen zu Hause wohnenden Personen stürzen mindestens einmal pro Jahr. Auch wenn nur rund 10 % der Stürze zu einem Knochenbruch führen, benötigen rund ein Fünftel der gestürzten Personen medizinische Behandlung.
Ein 2009 aktualisiert veröffentlichter Cochrane Review untersuchte Studien über die Wirksamkeit verschiedener präventiver Interventionen. Dazu zählte u.a. die unspezifische normale Behandlung der Sturzfolgen verbunden mit Beratung, die Verordnung spezifischer Medikamente gegen eine Fülle möglicher körperlicher Ursachen (z. B. Drehschwindel bei zu niedrigem Blutdruck), Operationen zum Erhalt der Sehfähigkeit und gezielte Angebote körperlichen Trainings. Im Vergleich reduzierten nur die gezielten körperlichen Aktivitäten die Sturzrate und das Risiko zu stürzen. Je nach Trainingsform konnte das Risiko von Stürzen zwischen 17 und 35% reduziert werden. In mehreren kontrollierten Studien erwiesen sich aber auch Kataraktoperationen und das Absetzen psychotroper Medikamente noch als präventiv wirksam, wenngleich nur bei der Sturzhäufigkeit.
Dem Cochrane Review - einem Update eines erstmals 2003 veröffentlichten Review mit 62 randomisierten kontrollierten Studien (RCTs) - lagen insgesamt 111 RCTs mit 55.303 TeilnehmerInnen und mit einer oder mehrerer der genannten präventiven Interventionen zugrunde. Die ausgewählten primären Ergebnisindikatoren waren die Rate der Stürze und das Sturzrisiko.
Die Wirksamkeit einzelner Interventionen sah im Vergleich mit Placebos so aus:
• Kombinierte körperliche Gruppenübungen reduzierten die Sturzrate signifikant um 22 % und das Sturzrisiko um 17 %.
• Tai Chi reduzierte ebenfalls signifikant die Häufigkeit beider Outcomes um 37 % und 35 %.
• Individuell verordnete kombinierte häusliche Übungen führten zu einer signifikanten Reduktion beider Werte um 34 % und 23 %.
• Die Einnahme von Vitamin D reduzierte weder die Sturzrate noch das Sturzrisiko signifikant. Dies könnte aber bei Personen mit niedrigem Vitamin-Level anders aussehen.
• Für Interventionen zur allgemeinen Verbesserung der häuslichen Sicherheit finden die Reviewer keine belastbaren Wirksamkeitsnachweise. Anders sieht dies bei Personen mit schweren Einschränkungen der Sehfähigkeit und mit einem aus anderen Gründen erhöhten Sturzrisiko aus.
• Beim Absetzen von Medikamenten, die das Bewusstsein beeinträchtigen können, wird zwar die Sturzrate um 66 % gesenkt, nicht aber das Sturzrisiko. Ebenfalls nur die Sturzrate wurde dann um 39 % gesenkt, wenn die Hausärzte der betreffenden Personen an einem Programm zur Veränderung ihres Verordnungsverhaltens teilgenommen hatten. Ähnlich sieht es schließlich noch bei der präventiven Wirksamkeit von Antirutsch-Schuhen aus.
Insgesamt scheinen Sturzpräventionsprogramme auch kostensparend zu sein. Angesichts so überraschender Ergebnisse wie z. B. der geringen Wirksamkeit von Interventionen in die Sicherheit des häuslichen Umfeldes (z. B. Rutschbremsen für Teppiche und Beseitigung von Stolperfallen durch Übermöblierung), ist der Schlussfolgerung der Reviewer, über die Umstände solcher Interventionen müsse noch genauer geforscht werden, zuzustimmen.
Von der aktuellen Fassung der Cochrane-Reviews gibt es kostenlos ein längeres Abstract: Gillespie LD, Robertson MC, Gillespie WJ, et al: Interventions for preventing falls in older people living in the community (Cochrane Database Syst Rev 2009;(2):CD007146.)
In der Zeitschrift "Evidence based Medicine for Primary Care and Internal Medicine" (EBM Dezember 2009 Vol 14 No 6) gibt es zusätzlich eine kostenlose zweiseitige Übersicht samt Kommentar zu diesem Cochrane Review
Bernard Braun, 24.3.10
Sport und körperliche Bewegung: Studien belegen erneut die gesundheitsförderliche Wirkung bei Älteren
 Vier neue Studien, die in der Zeitschrift "Archives of Internal Medicine" veröffentlicht wurden, dokumentieren auf unterschiedliche Weise, welche positiven gesundheitlichen Effekte Sport und körperliche Bewegung bei Älteren haben. Die Untersuchungen zeigen positive Auswirkungen für verschiedene altersbedingte Erkrankungen, für den allgemeinen Gesundheitszustand im Alter und für einzelne Zusammenhänge zwischen körperlicher Bewegung, kognitiven Leistungen und Sturzrisiken.
Vier neue Studien, die in der Zeitschrift "Archives of Internal Medicine" veröffentlicht wurden, dokumentieren auf unterschiedliche Weise, welche positiven gesundheitlichen Effekte Sport und körperliche Bewegung bei Älteren haben. Die Untersuchungen zeigen positive Auswirkungen für verschiedene altersbedingte Erkrankungen, für den allgemeinen Gesundheitszustand im Alter und für einzelne Zusammenhänge zwischen körperlicher Bewegung, kognitiven Leistungen und Sturzrisiken.
Körperliche Bewegung im mittleren Lebensalter bewirkt bei älteren Frauen einen besseren Gesundheitszustand im Alter
Ein Forschungsteam der Harvard School of Public Health in Brigham und der Harvard Medical School in Boston analysierte Daten von 13.535 Teilnehmern an der "Nurses' Health Study", einer US-amerikanischen Längsschnittstudie, die Zusammenhänge zwischen Ernährung und Krebsrisiken bei Frauen untersucht. Schon seit 1976 werden alle zwei Jahre bei Krankenschwestern Befragungen und zum Teil auch klinischen Untersuchungen durchgeführt. Bei der jetzt realisierten Datenanalyse fand man heraus, dass Teilnehmerinnen im Alter von über 70 Jahren, die früher ein höheres Maß an körperlicher Aktivität an den Tag gelegt hatten, im Alter einen deutlich besseren Gesundheitszustand aufwiesen. Verglichen wurden dabei Fragebogen-Daten aus dem Jahr 1986, als die Krankenschwestern etwa 60 Jahre alt waren, und Gesundheitsdaten aus den Jahren 1995 bis 2001. Dabei zeigte sich: Je höher das frühere Ausmaß an Sport und Bewegung war, desto seltener hatten die Frauen später chronische Erkrankungen oder andere körperliche oder seelische Beschwerden.
Hier ist ein Abstract: Qi Sun et al: Physical Activity at Midlife in Relation to Successful Survival in Women at Age 70 Years or Older (Arch Intern Med. 2010;170[2]:194 -201)
Krafttraining bei älteren Frauen verbessert körperliche Fitness und kognitive Fähigkeiten
In einer zweiten Studie zeigte sich, dass 1-2 Stunden Krafttraining in der Woche in einer Studie nicht nur die körperliche Fitness von Seniorinnen verbesserten, sondern auch die Ergebnisse in kognitiven Tests. Dabei handelte es sich um eine so genannte "randomisierte Kontrollstudie", bei der die Teilnehmer nach dem Zufallsprinzip entweder einer Interventions- oder einer Kontrollgruppe zugeordnet wurden. Beteiligt waren 155 ältere, zuhause lebenden Frauen im Alter von 65 bis 75 Jahren. Frauen der Interventionsgruppe (N=106) wurden eingeladen, entweder einmal oder zweimal in der Woche unter Anleitung eine Stunde mit Hanteln und an Kraftmaschinen zu trainieren. In einer Kontrollgruppe wurde 49 gleichaltrigen Frauen zweimal wöchentlich ein Balancetraining angeboten. Die Frauen der Interventionsgruppe schnitten am Ende der Studie (nach etwa 12 Monaten) dann hinsichtlich der Fitness, aber auch in einer Reihe von kognitiven Tests erheblich besser ab.
Hier ist ein Abstract: Teresa Liu-Ambrose et al: Resistance Training and Executive Functions. A 12-Month Randomized Con-trolled Trial (Arch Intern Med. 2010;170(2):170-178)
Körperliche Bewegung bei Älteren reduziert das Risiko kognitiver Leistungseinschränkungen
In einer deutschen Studie untersuchte Thorleif Etgen (Technische Universität München) zusammen mit Kollegen Senioren über einen Zeitraum von zwei Jahren und fand heraus, dass mittlere oder intensive körperliche Aktivität das Risiko kognitiver Beeinträchtigungen reduzierte. Die Teilnehmer an der Studie waren allesamt älter als 55 Jahre. Zu Beginn wurden bei ihnen Tests durchgeführt zur Erfassung der kognitiven Funktionen, aber auch die körperliche Fitness wurde untersucht. Zu diesem Zeitpunkt stellte man bei 418 Teilnehmern, etwa 11% der Stichprobe, kognitive Funktionseinschränkungen fest, bei etwa 3.500 anderen Teilnehmern war dies nicht der Fall. Eine erneute Überprüfung nach zwei Jahren zeigte dann, dass zusätzlich jetzt 207 weitere Senioren kognitive Defizite aufwiesen. Befragungsdaten darüber, in welchem Ausmaß die Teilnehmern in den vergangenen zwei Jahren Sport oder andere körperliche Bewegung hatten, zeigten dann einen engen Zusammenhang mit dem Risiko für die Entwicklung kognitiver Beeinträchtigungen. Ohne jeden Sport betrug das Risiko 13,9%, mit mittlerer bzw. intensiver Aktivität betrug es nur 6,7% bzw. 5,1%.
Hier ist ein Abstract: Thorleif Etgen et al: Physical Activity and Incident Cognitive Impairment in Elderly Persons: the INVADE Study (Arch Intern Med. 2010;170[2]:186 -193)
Körperliche Bewegung senkt bei älteren Frauen das Risiko von Stürzen und Knochenbrüchen
Eine weitere deutsche Studie zeigte schließlich bei 246 Frauen im Alter über 65 Jahren, dass das Risiko von Stürzen und Knochenbrüchen durch Sport und Bewegung gesenkt werden kann. Die Teilnehmerinnen wurden nach dem Zufallsprinzip einer Interventions- oder Kontrollgruppe zugeordnet. Die Kontrollgruppe nahm 18 Monate lang an einem Wellness-Programm mit moderaten und wenig anstrengenden Bewegungsübungen teil, die Interventionsgruppe führte im selben Zeitraum viermal wöchentlich ein im Vergleich dazu sehr intensives und anstrengendes Bewegungsprogramm durch. Zum Studienende wurden bei allen Teilnehmerinnen unterschiedliche Gesundheits-Indikatoren erfasst. Dabei zeigte sich dann, dass zwischen Interventions- und Kontrollgruppe kein Unterschied erkennbar war, was Herz-Kreislauf-Erkrankungen anbetraf: In beiden Gruppen ging das Risiko zurück. Unterschiede zeigten sich jedoch bei anderen Vergleichswerten: Die Interventionsgruppe zeigte eine deutlich reduzierte Anzahl von Stürzen und Knochenbrüchen im Vergleich zur Kontrollgruppe. Die niedrigeren Risiken für Frakturen erklärten die Wissenschaftler mit einer höheren Knochendichte als Folge des Bewegungsprogramms.
Hier ist ein Abstract: Wolfgang Kemmler et al: Kalender Exercise Effects on Bone Mineral Density, Falls, Coronary Risk Factors, and Health Care Costs in Older Women: the Randomized Controlled Senior Fitness and Prevention (SEFIP) Study (Arch Intern Med. 2010;170[2]:179 -185)
Gerd Marstedt, 22.3.10
Ein gesunder Lebensstil ist zur Prävention von Diabetes effektiver als Medikamente
 Die Prävention von Diabetes mellitus Typ 2 (die meist erst nach dem 30. Lebensjahr auftritt) ist gesundheitspolitisch von großer Bedeutung, da eine Therapie (im Sinne von "Heilung") nur sehr begrenzt möglich ist und eine Vielzahl von Begleit- und Folgeerkrankungen beobachtet wurde - von Herzinfarkt und Niereninsuffizienz bis hin zur Erblindung und Fußamputation. Nach einer Diagnose erhöhter Blutzuckerwerte wird vom Arzt anfänglich recht häufig das Medikament Metformin verordnet, das die Neubildung von Glukose (Traubenzucker) in der Leber hemmt und auch die Aufnahme von Glukose im Darm verzögert. Nicht selten wird diese Arzneimittelverordnung dann auch über längere Zeit beibehalten.
Die Prävention von Diabetes mellitus Typ 2 (die meist erst nach dem 30. Lebensjahr auftritt) ist gesundheitspolitisch von großer Bedeutung, da eine Therapie (im Sinne von "Heilung") nur sehr begrenzt möglich ist und eine Vielzahl von Begleit- und Folgeerkrankungen beobachtet wurde - von Herzinfarkt und Niereninsuffizienz bis hin zur Erblindung und Fußamputation. Nach einer Diagnose erhöhter Blutzuckerwerte wird vom Arzt anfänglich recht häufig das Medikament Metformin verordnet, das die Neubildung von Glukose (Traubenzucker) in der Leber hemmt und auch die Aufnahme von Glukose im Darm verzögert. Nicht selten wird diese Arzneimittelverordnung dann auch über längere Zeit beibehalten.
Aus früheren Studien bekannt ist aber auch, dass eine Änderung des Lebensstils, insbesondere eine Umstellung der Ernährung und mehr körperliche Bewegung, zumindest dieselben, teilweise bessere Effekte erzielt und überdies nicht die Nebenwirkungen der Arzneimitteltherapie mit sich bringt. Die Dauertherapie mit Metformin wurde daher auch als unnötige "Medikalisierung" von Patienten kritisiert.
Eine internationale Forschungsgruppe, die "Diabetes Prevention Program Research Group" hat nun Ergebnisse einer Studie veröffentlicht, in der über einen Zeitraum von 10 Jahren kontrolliert wurde, was zur Prävention von Diabetes Typ 2 besser geeignet ist: Eine Änderung des Lebensstils oder die Einnahme von Metformin.
Dazu wurde im Zeitraum 1996-1999 eine Studie mit 2.766 Teilnehmern begonnen und zehn Jahre lang kontrolliert, ob eine Diabetes ärztlich diagnostiziert wurde. Die Teilnehmer wurden zu Beginn nach dem Zufallsprinzip einer von drei Gruppen zugeordnet: Einer Gruppe wurde die Einnahme von Metformin verordnet. Eine zweite Gruppe erhielt Informationen und soziale Unterstützung um eine Änderung des Lebensstils zu erreichen. Diese Beratung und Information konnte ausführlich zu Beginn und später alle drei Monate in Anspruch genommen werden. Ziel der Lebensstiländerung war eine Gewichtsreduzierung um etwa 7 Prozent und das regelmäßige Durchführen von Sport oder moderater körperlicher Aktivität, und zwar im Umfang von 150 Minuten pro Woche. Eine dritte Gruppe schließlich erhielt lediglich ein Scheinmedikament (Placebo).
Sichergestellt wurde zu Beginn, dass wesentliche medizinische Risikofaktoren wie unter anderem Body Mass Index, Körpergewicht, Blutzucker- und Cholesterinwerte, aber auch Faktoren wie Alter und Geschlecht in den drei Gruppen keine gravierenden Unterschiede aufwiesen.
In einer ersten Kontrolle nach knapp drei Jahren hatte sich gezeigt, dass bei Erwachsenen mit hohem Diabetes-Risiko das Neu-Auftreten dieser Erkrankung in der Lebensstilgruppe am stärksten abgesenkt werden konnte: Verglichen mit der Placebogruppe um 58 Prozent, in der Medikamentengruppe nur um 31 Prozent.
In einer weiteren Kontrolle nach 9,0 - 10,5 Jahren wurde nun überprüft, ob sich dieses bessere Abschneiden von Lebensstiländerungen als Intervention zur Diabetes-Prävention bestätigen ließ. Tatsächlich zeigten sich ähnliche, wenn gleich nun etwas niedrigere Zahlen: Seit Studienbeginn vor etwa 10 Jahren wurde das Neuauftreten von Diabetes in der Lebensstilgruppe (im Vergleich zur Placebo-Einnahme) um 34 Prozent gesenkt, in der Metformin-Gruppe um 18 Prozent. Oder mit anderen Werten ausgedrückt: Im Gesamtzeitraum der Studie wurde folgende Zahl an neuen Diabetes-Erkrankungen pro 100 Personen-Jahre beobachtet: 5,3 Fälle in der Lebensstilgruppe, 6,4 Fälle in der Metformin-Gruppe, 7,8 Fälle in der Placebo-Gruppe. Auf einer Zeitachse betrachtet, wird das Auftreten von Diabetes durch Lebensstiländerungen um etwa vier Jahre verzögert, bei Metformin sind es zwei Jahre.
Kostenlos verfügbar ist ein Abstract der Studie: Diabetes Prevention Program Research Group: 10-year follow-up of diabetes incidence and weight loss in the Diabetes Prevention Program Outcomes Study (The Lancet, Volume 374, Issue 9702, 14 November 2009-20 November 2009, Pages 1677-1686)
Gerd Marstedt, 21.2.10
Fragen zur Prävention: Mehrheit der Bevölkerung ist der Meinung "Damit belästigen wir nicht den Hausarzt"
 Prävention, so hat eine repräsentative Befragung des "Gesundheitsmonitor" der Bertelsmann-Stiftung gezeigt, ist keine Angelegenheit, mit der man den Arzt behelligen möchte. Zwar berichtet kaum jemand über konkrete Negativerfahrungen in der Arztpraxis, was das Rauchen, Sport oder Ernährungsfragen anbetrifft. Aber es dominiert bei Bürgerinnen und Bürgern hartnäckig das Urteil oder auch Vorurteil: Der Arzt ist zuständig für die Kuration, nicht für Prävention. Aber auch Ärzte, so ein weiteres Ergebnis der Studie, bemühen sich kaum, dieses Image zu ändern. Ein sehr großer Teil der Übergewichtigen oder Raucher ist noch nie vom Arzt auf die gesundheitlichen Risiken oder Verhaltensänderungen hingewiesen worden.
Prävention, so hat eine repräsentative Befragung des "Gesundheitsmonitor" der Bertelsmann-Stiftung gezeigt, ist keine Angelegenheit, mit der man den Arzt behelligen möchte. Zwar berichtet kaum jemand über konkrete Negativerfahrungen in der Arztpraxis, was das Rauchen, Sport oder Ernährungsfragen anbetrifft. Aber es dominiert bei Bürgerinnen und Bürgern hartnäckig das Urteil oder auch Vorurteil: Der Arzt ist zuständig für die Kuration, nicht für Prävention. Aber auch Ärzte, so ein weiteres Ergebnis der Studie, bemühen sich kaum, dieses Image zu ändern. Ein sehr großer Teil der Übergewichtigen oder Raucher ist noch nie vom Arzt auf die gesundheitlichen Risiken oder Verhaltensänderungen hingewiesen worden.
Bereits frühere Veröffentlichungen des Gesundheitsmonitor haben gezeigt, dass bei gesundheitsbezogenen Verhaltensänderungen (z.B. Rauchen, Sport und Bewegung) der Hausarzt in der Mehrzahl der Fälle nicht hinzugezogen wurde. Weiterhin zeigt sich, dass die befragten Ärzte eine unzureichende Vergütung und zu wenig verfügbare Zeit als Hauptgründe ihrer aktuell unzureichenden Wahrnehmung präventiver Aufgaben benennen (vgl. Prävention aus Sicht der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ...).
Wie sieht es auf der Seite der Patienten aus? Könnte nicht auch deren Verhalten in der Sprechstunde mit ein Grund sein für die Präventions-Zurückhaltung der Ärzte? In der jetzt veröffentlichten repräsentativen Umfrage (1.500 Teilnehmer 18-79 Jahre) zeigt sich, dass bei der Bevölkerungs-Mehrheit eher Skepsis vorherrscht. Auf die Frage "Einmal angenommen, Sie wollten Ihr Gesundheitsverhalten ändern und hätten gerne Informationen, wie dies am erfolgreichsten zu bewerkstelligen ist. Würden Sie, auch wenn Sie nicht krank sind, speziell dazu zum Arzt gehen und um Rat bitten?" antwortet die große Mehrheit mit "eher nein" (41%) oder "sicher nein" (18%).
Überraschend ist, dass fast drei Viertel aller Befragungsteilnehmer (71%) sagen, dass es eigentlich keinen Grund dafür gibt, den Hausarzt in solchen Fragen außen vor zu lassen. Deutlich wird aus den Begründungen, dass nicht konkrete Erfahrungen von Patienten maßgeblich sind. Zwei Interpretationen dominieren stattdessen. Die ärztliche Funktion wird zum einen ganz klar wahrgenommen als kurative oder therapeutische Tätigkeit (54% der Nennungen). Weiterhin vermuten Patienten: Präventive Fragen oder Probleme sind für den Arzt nicht vorrangig, insbesondere dann nicht, wenn das Wartezimmer voll ist mit Patienten, die akute Schmerzen oder Beschwerden haben. 55% sagen "Mein Arzt hat meist eine volle Praxis und zu wenig Zeit für solche Fragen".
Wie sieht es umgekehrt aus, wie viele Patienten sind schon einmal selbstständig vom Arzt auf Verhaltensmöglichkeiten aufmerksam gemacht worden, die in Anbetracht bestimmter gesundheitlicher Probleme recht nahe liegen würden? Übergewichtige (Body Mass Index 25-29,9), sagen zu 65%, sie seien noch nie vom Arzt darauf hingewiesen worden. Aber auch bei adipösen Patienten (BMI über 30) bleibt noch mehr als jeder vierte (28%) "unbehelligt" von ärztlichen Risikohinweisen oder Ratschlägen, obwohl auch ohne eingehende körperliche Untersuchung und medizinische Fachkenntnisse die Problematik erkennbar wird. Wie sieht es bei Rauchern aus? Nimmt man hier Gelegenheitsraucher einmal beiseite und betrachtet nur tägliche Raucher, dann wird deutlich, dass 44% aus dieser Gruppe sagen, sie seien vom Arzt noch auf die mit dem Rauchen verbundenen Risiken hingewiesen oder auf Entwöhnungsmöglichkeiten angesprochen worden. Unter dem Strich wird damit deutlich, dass Ärzte selbst bei recht offensichtlich erkennbaren Problemgruppen im Hinblick auf das Gesundheitsverhalten sehr häufig untätig bleiben und Patienten nicht auf Risiken und Präventionsmöglichkeiten hinweisen.
Weitere Fragestellungen die in der Befragung zur Prävention behandelt und in der Veröffentlichung diskutiert werden:
• Welche Einflussfaktoren gelten bei der Bevölkerungsmehrheit heute als besonders relevante Risikofaktoren für die Lebenserwartung?
• Zeigt sich in der Bevölkerung nach den zuletzt sehr umfassenden Maßnahmen zum Nichtraucherschutz und Nikotinverzicht ein Präventions-Überdruss, etwa in Form einer deutlichen Ablehnung weiterer Maßnahmen (ungesunde Nahrungsmittel, Alkohol, zu wenig Sport und körperliche Bewegung, Drogen)?
• Welchen Bekanntheitsgrad haben bevölkerungsweite Präventions-Kampagnen (wie: Fünf am Tag, Täglich 3.000 Schritte extra, Fit statt fett, Keine Macht den Drogen, Gib AIDS keine Chance?) und für wie effektiv schätzt man diese Kampagnen ein?
Hier ist ein Abstract: Gerd Marstedt, Rolf Rosenbrock: Verhaltensprävention: Guter Wille alleine reicht nicht
Gerd Marstedt, 9.2.10
10minütige Intervention gegen zu hohen Alkoholkonsum zeigt bei vielen Studenten Wirkung
 Eine überaus kurze, nur mit Emails und Internet-Informationen über Gesundheitsrisiken zu hohen Alkoholkonsums realisierte Präventionskampagne hat sich an einer australischen Universität als durchaus erfolgreich erwiesen: Im Vergleich zu einer Kontrollgruppe lag bei den Teilnehmern der Intervention die monatlich konsumierte Alkoholmenge nach einem Monat um 17%, nach 6 Monaten immerhin noch um 11% niedriger.
Eine überaus kurze, nur mit Emails und Internet-Informationen über Gesundheitsrisiken zu hohen Alkoholkonsums realisierte Präventionskampagne hat sich an einer australischen Universität als durchaus erfolgreich erwiesen: Im Vergleich zu einer Kontrollgruppe lag bei den Teilnehmern der Intervention die monatlich konsumierte Alkoholmenge nach einem Monat um 17%, nach 6 Monaten immerhin noch um 11% niedriger.
Anlass für die Studie mit über 7.000 Studenten/innen in Australien war die Erkenntnis, dass Studierende oft mehr Alkohol konsumieren als andere Gleichaltrige und dass sie die damit verbundenen gesundheitlichen Risiken massiv unterschätzen. Nach einem Test im Internet, der Häufigkeit und Intensität des Alkoholverzehrs prüfte, wurden in der Studie etwa 2.400 Teilnehmer als gefährdet eingestuft und per Zufall entweder einer Interventions- oder Kontrollgruppe zugeordnet. Die Interventionsgruppe bekam im Internet eine etwa 10minütige Instruktion zum Gesundheitsrisiko Alkohol. Zunächst nach einem Monat und später noch einmal nach sechs Monaten wurde dann erneut im Internet das Trinkverhalten erfasst. Für die Interventionsgruppe zeigte sich dabei eine geringfügige, aber im Vergleich zur Kontrollgruppe signifikante Senkung der Häufigkeit und Menge des Alkoholkonsums.
Auch in deutschen Studien hat sich gezeigt, dass Studenten weniger auf ihre Gesundheit achten als andere Gleichaltrige, etwa im Hinblick auf Alkohol und Nikotin. Zuletzt deutlich wurde dies in einer Befragung von über 1.100 Studenten der Universität Mannheim. In Australien lagen ähnliche empirische Befunde vor, so dass Wissenschaftler der University of Newcastle (New South Wales) beschlossen, sich in einer Studie speziell dieser Gruppe anzunehmen und zu überprüfen, inwieweit eine über das Internet realisierte Anti-Alkohol-Maßnahme wirksam ist.
Im Jahre 2007 wurden an etwa 13.000 Studenten unterer Semester (Alter 17-24 Jahre) Emails verschickt, in denen sie eingeladen wurden, sich an einem Test im Internet zu beteiligen, in dem es um "persönliche Erfahrungen mit Alkohol und Einstellungen zum Alkoholkonsum" gehen würde. Als Anreiz für eine Beteiligung wurde mitgeteilt, dass 40 Gutscheine im Wert von 100 australischen Dollar (umgerechnet etwa 60 Euro) unter allen Teilnehmern verlost würden. An dem Test, der neben sozialstatistischen Merkmalen und anderen Aspekten (Rauchen, Meinungen zum Alkoholgenuss) unter anderem auch die Intensität und Häufigkeit des individuellen Alkoholkonsums erfasste, beteiligten sich dann etwa 7.200 männliche und weibliche Studierende.
Bei 2.435 von ihnen, also etwa jedem Dritten, wurde der Alkoholkonsum aufgrund zuvor festgelegter Punktwerte ("AUDIT-Score") auf einer Skala als bedenklich eingestuft. Diese wurden nach dem Zufallsprinzip einer Interventions- oder Kontrollgruppe zugeordnet. In der Interventionsgruppe erhielten die Teilnehmer dann im Internet eine etwa 10minütige Instruktion. Dort wurden sie in sehr umfangreicher Weise informiert:
• Über ihren persönlichen AUDIT-Wert und die damit verbundenen Gesundheits-Risiken,
• den geschätzten Blutalkohol-Wert beim heftigsten in der Befragung genannten Alkoholkonsum in den letzten vier Wochen,
• Informationen über physiologische und soziale Risiken bei verschiedenen Promillewerten, •
• Berechnungen über monatliche und jährlichen Ausgaben für Alkohol,
• Grafiken, in denen ihr Alkoholkonsum verglichen wurde mit Werten anderer Bevölkerungsgruppen,
• Hinweise über Verhaltens-Möglichkeiten und psychologische Hilfen bei Alkoholproblemen.
• Weiterhin gab es eine Reihe von Links die weitere Informationsmöglichkeiten, medizinische und psychologische Hilfen boten.
Die Teilnehmer an der Kontrollgruppe bekamen keine weiteren Informationen, sondern wurden lediglich, ebenso wie die Studenten der Interventionsgruppe nach einem Monat und nach sechs Monaten gebeten, im Internet noch einmal Auskunft zu geben über ihre Einstellungen zu und Erfahrungen mit Alkohol. Die Teilnahmequoten bei diesen Follow-up-Erhebungen bewegten sich im Rahmen auch anderer Studien: Nach 1 Monaten nahmen 80% der Kontroll- und 77% der Interventionsgruppe teil, nach 6 Monaten waren noch 65% der Kontrollgruppe (N=767) und 65% (N=811) der Interventionsgruppe zur Teilnahme bereit.
Zentraler Vergleichswert waren dann bei diesen Nachfolge-Erhebungen die durchschnittlichen AUDIT-Werte in der Interventions- und Kontrollgruppe. Tatsächlich zeigte sich in der Interventionsgruppe ein Effekt der Instruktionen über alkholbedingte Risiken und Möglichkeiten der Veränderung. Nach einem Monat lag die Anzahl der Tage mit Alkoholkonsum, die Menge jeweils getrunkenen Alkohols und die im Gesamtzeitraum konsumierte Menge an Alkohol niedriger. Die insgesamt getrunkene Alkoholmenge lag in der Interventionsgruppe nach einem Monat um 17%, nach 6 Monaten um 11% niedriger als in der Kontrollgruppe.
In der Diskussion ihrer Befunde weisen die Wissenschaftler darauf hin, dass in Anbetracht des recht geringen Aufwands der Effekt der Maßnahme ihrer Meinung nach doch beachtlich ist. Sie verweisen darauf, dass sie ihr Internet-basiertes Instruktionsprogramm "electronic screening and brief intervention (e-SBI)" für nicht-kommerzielle Einrichtungen auch kostenlos zur Verfügung stellen würden.
Hier ist ein Abstract der Studie zu finden: Kypros Kypri et al: Randomized Controlled Trial of Proactive Web-Based Alcohol Screening and Brief Intervention for University Students (Arch Intern Med, 2009; 169 (16): 1508-1514)
Gerd Marstedt, 29.12.09
Verbindliche Alkoholtests für Berufskraftfahrer senken die Quote tödlicher Unfälle
 Eine Studie aus den USA hat für den Zeitraum von 1982 bis 2006 überprüft, welchen Einfluss die Einführung verbindlicher Alkoholtests bei Berufs-Kraftfahrern (Führer von Lkws und Bussen) auf Verkehrsunfälle mit tödlichem Ausgang hat. Im Untersuchungszeitraum wurden in einigen Bundesstaaten Programme und gesetzliche Regelungen eingeführt, aufgrund derer dann unregelmäßige und unangekündigte Alkoholtests für Berufskraftfahrer vorgeschrieben waren. In der Auswertung von Unfallstatistiken zeigt sich dann in der Studie, dass im Gefolge dieser Regelungen die Zahl tödlicher Unfälle - auch unter statistischer Berücksichtigung anderer Einflussfaktoren - um etwa ein Viertel (23%) gesunken ist.
Eine Studie aus den USA hat für den Zeitraum von 1982 bis 2006 überprüft, welchen Einfluss die Einführung verbindlicher Alkoholtests bei Berufs-Kraftfahrern (Führer von Lkws und Bussen) auf Verkehrsunfälle mit tödlichem Ausgang hat. Im Untersuchungszeitraum wurden in einigen Bundesstaaten Programme und gesetzliche Regelungen eingeführt, aufgrund derer dann unregelmäßige und unangekündigte Alkoholtests für Berufskraftfahrer vorgeschrieben waren. In der Auswertung von Unfallstatistiken zeigt sich dann in der Studie, dass im Gefolge dieser Regelungen die Zahl tödlicher Unfälle - auch unter statistischer Berücksichtigung anderer Einflussfaktoren - um etwa ein Viertel (23%) gesunken ist.
Am 1. Januar 1995 wurden in den USA gesetzliche Regelungen eingeführt, die für Berufskraftfahrer verbindliche Alkoholtests vorschrieben, sofern sie Fahrzeuge mit mehr als etwa 11,8 Tonnen Gewicht führen. Diese Tests wurden dann teilweise nach dem Zufallsprinzip und zu unvorhergesehenen Zeitpunkten durchgeführt, vor, während oder nach den Fahrten, darüber hinaus aber auch durchgängig nach Unfällen. Von den Alkoholkontrollen erfasst wurden im Zeitraum 1995-1997 etwa 25 Prozent und danach im Zeitraum 1998-2006 etwa 10 Prozent aller in Frage kommenden Berufskraftfahrer.
Zentrale Datenbasis der Studie ist das "Fatality Analysis Reporting System (FARS)", eine Datenbank, in der eine Vielzahl von Informationen gespeichert würde über nähere Umstände von Verkehrsunfällen mit tödlichem Ausgang: Am Unfall beteiligte Fahrzeugtypen und sozialstatistische Merkmale der Fahrer, Ergebnisse von Alkoholtests direkt nach dem Unfall und zu früheren Zeitpunkten sowie weitere Informationen etwa zum Straßenzustand, Wetter, Region usw.
Aus dieser Datenbank FARS wurden Daten für die Jahre 1982-2006 berücksichtigt. Eingeteilt wurden diese in den Zeitraum vor Einführung der verbindlichen Alkoholtests (13 Jahre, 1982-1994) und nach Einführung (12 Jahre, 1995-2006). Berücksichtigt wurden dann Daten für etwa 69 Tausend Berufskraftfahrer und 66 Tausend andere Personen, die allesamt in Unfälle mit tödlichem Ausgang verwickelt waren. Überprüft wurde von den Wissenschaftlern, ob bei den Unfallbeteiligten in den beiden Zeiträumen 1982-1994 und 1995-2006 Alkohol eine Rolle spielte, also ob bei ihnen eine erhöhte Blut-Alkohol-Konzentration festgestellt worden ist.
Zunächst zeigte sich, dass man bei etwa 2,7 Prozent der Berufskraftfahrer und 19,4 Prozent der übrigen Personen überhöhte Blutalkoholwerte gefunden hatte. Ein Vergleich der beiden Zeiträume ergab dann, dass erhöhte Alkoholwerte bei Berufskraftfahrern um 80 Prozent und bei anderen Personen um 41 Prozent zurückgegangen waren. Da aber neben Alkohol auch andere Faktoren für Unfälle und Unfälle mit tödlichem Ausgang ursächlich sein können, führten die Wissenschaftlern eine statistische Analyse durch, in der eine Vielzahl möglicher Einflussfaktoren gleichzeitig kontrolliert wird. Zu diesen Faktoren gehörten dann unter anderem Alter und Geschlecht des Fahrers, frühere Alkoholvergehen, Region und Jahr des Unfalls, Tageszeit und Monat.
Hier ergab sich dann, dass männliche Berufskraftfahrer, solche im Alter von 25-34 Jahren und solche mit früheren Alkoholvergehen ein höheres Risiko aufweisen und häufiger an Unfällen mit tödlichem Ausgang beteiligt sind. Darüber hinaus bestätigte sich jedoch, dass die Einführung der verbindlichen Alkoholtests einen nachhaltigen Effekt zeigt für die Verwicklung der Kraftfahrer in Unfälle mit tödlichem Ausgang: Die Quote dieser Unfälle sank um 23 Prozent.
Frei zugänglich ist ein Abstract der Studie: Joanne E. Brady et al: Effectiveness of Mandatory Alcohol Testing Programs in Reducing Alcohol Involvement in Fatal Motor Carrier Crashes ( American Journal of Epidemiology 2009 170(6):775-782; doi:10.1093/aje/kwp202)
Gerd Marstedt, 4.12.09
"Rauchende Colts" - Warum zerstörte "British American Tobacco" 1992 in den USA, Kanada und Australien 60 firmeneigene Dokumente?
 In einigen der großen Prozesse gegen die Tabakwarenindustrie vor us-amerikanischen Gerichten sind bereits Millionen Seiten interner Dokumente veröffentlicht worden, aus denen hervorging, dass die wirtschaftlich und wissenschaftlich Verantwortlichen in den angeklagten Konzernen und ihren direkt abhängigen oder oberflächlich unabhängigen Instituten relativ lückenlos wussten, dass Tabakrauchen vielfältig gesundheitsschädlich war und süchtig bzw. abhängig macht.
In einigen der großen Prozesse gegen die Tabakwarenindustrie vor us-amerikanischen Gerichten sind bereits Millionen Seiten interner Dokumente veröffentlicht worden, aus denen hervorging, dass die wirtschaftlich und wissenschaftlich Verantwortlichen in den angeklagten Konzernen und ihren direkt abhängigen oder oberflächlich unabhängigen Instituten relativ lückenlos wussten, dass Tabakrauchen vielfältig gesundheitsschädlich war und süchtig bzw. abhängig macht.
Dies reichte teilweise soweit, dass mit entsprechenden Zusatzstoffen und der Erhöhung der Nikotinmenge geradezu Abhängigkeit erzeugt wurde. Die hierfür bisher maßgebliche Informationsquelle waren die über 40 Millionen Seiten interner Dokumente von 7 Tabakkonzernen, die im Gefolge eines vom US-Bundesstaat Minnesota 1998 gewonnenen Verfahrens zusätzlich zu den ebenfalls zu zahlenden 200 Milliarden US-Dollar veröffentlicht werden mussten (vgl. dazu das Urteil Tobacco Documents - Judge Fitzpatrick's Order (November 1, 1995)).
Obwohl diese frei zugängliche Sammlung ("Tobacco documents online") 8.144.313 einzelne Dokumente enthält, war es insbesondere einem der damals und heute größten internationalen Tabakkonzerne, BAT, gelungen eine Reihe aus seiner Sicht "most sensitive" Dokumente zu verheimlichen und sie zu zerstören bevor sie auch in den Rechtsstreit vor dem US-Gericht einbezogen werden konnten. Im Rahmen dieser vorsätzlichen und offiziellen Zerstörungspolitik ließ BAT in den USA, Kanada und Australien gezielt Dokumente mit Ergebnissen wissenschaftlicher Untersuchungen zum Tabakrauchen zerstören. Und 1992 bestätigte ein damit befasster Rechtsvertreter der BAT-Tochter in Kanada dem Mutterkonzern schriftlich, man habe in Kanada gerade 60 derartige Dokumente zerstört. Obwohl dieses Schreiben an die Öffentlichkeit drang und klarmachte, dass offensichtlich evidente tabakkritische Informationen vernichtet wurden, konnten die Inhalte dieser Dokumente niemals analysiert werden. Und obwohl sich bereits in den 1990er Jahren dann doch noch Kopien der Dokumente in den Archiven der britischen Dependance von BAT fanden und in das Minnesota-Verfahren eingingen, blieben ihre Inhalte praktisch unveröffentlicht.
Erst ein am 10. November 2009 im "Canadian Medical Association Journal (CMAJ)" veröffentlichter Aufsatz verschafft jetzt einen vollständigen Einblick in die Inhalte, welche BAT am liebsten auf ewig verschwinden lassen wollte.
Auf durchweg hohem naturwissenschaftlichen und statistischen Niveau durchgeführt, enthielten die 60 Dokumente 11 Reviews zu interner Forschung oder Methodenentwicklung, 2 statistische Re-Analysen früherer Studien und die restlichen 47 Originalstudien enthielten Ergebnissen interner Forschung des Unternehmens BAT oder von ihm beauftragter ForscherInnen. Das älteste Dokument stammt aus dem Jahr 1967 und die meisten Dokumente aus der Zeit um 1984.
Die Inhalte, die mit dem Schreddern der Studien verborgen werden sollten, sind in folgenden Bereichen angesiedelt:
• 40 der 60 Dokumente lieferten ihren Auftraggebern und Besitzern eindeutige Evidenz für die krebserzeugende und biologische Aktivität von Zigaretten. Wegen der erschlagenden Fülle von Belegen für diese gesundheitsgefährdenden Effekte des Rauchens waren die konzerneigenen Wissenschaftler völlig überrascht, wenn sie die eine der wenigen Studien fanden, die solche Effekte nicht fand. Viele der Studien waren Bestandteil des industrieeigenen Langzeitforschungsprojekts Janus. In diesem Programm sollten in den Jahren 1965 bis 1978 die krebserzeugenden Komponenten des Tabakrauchs identifiziert werden.
• Verschiedene hier dokumentierte Untersuchungen zeigten BAT und dem Rest der Industrie eindeutig, dass es keine signifikanten Unterschiede der unerwünschten gesundheitlichen Folgen zwischen den verschiedenen Zigarettenmarken gab und auch Filterzigaretten niemals die "guten Zigaretten" waren. Gerade bei Filterzigaretten war den Herstellern sogar durch ihre eigenen Studien früh der durch sie bedingte Anstieg bestimmter Krebsarten bekannt, der wahrscheinlich mit den tieferen Zügen zu tun hat.
• Sechs der vernichteten Dokumente stellen ein ausgeklügeltes Forschungsprogramm über die Nikotinsucht bzw. -abhängigkeit dar. Dabei ging es dieser Forschung ausdrücklich nicht darum, etwas an dieser Abhängigkeit zu ändern, sondern lediglich darum, Mittel und Wege zu finden, den Rauchern ihr folgenreiches Rauchen subjektiv zu erleichtern.
• Elf der zerstörten Dokumente enthielten Forschungsergebnisse über die gesundheitlichen Folgen des Passivrauchens. Dabei schlussfolgerten die beteiligten Wissenschaftler relativ früh, dass unter bestimmten Bedingungen, darunter gerade die "Light"-Zigaretten, Passivrauchen sogar giftiger und folgenreicher ist als Aktivrauchen. Für die gerade wieder in Deutschland aufkeimenden Debatten über die technischen Mittel, die Raumluft zu ent"giften", ist zu vermerken, dass die Industrieforscher bereits vor über 10/15 Jahren nur einen sehr kleinen Effekt solcher Maßnahmen für erwiesen ansahen, der dem der Öffnung des Fensters entsprach.
• Wie bewusst, aktiv und offensiv führende Vertreter der Tabakindustrie die Öffentlichkeit angelogen haben, machen die kanadischen Wissenschaftlern auf dem Hintergrund der klaren Ergebnisse der 60 Dokumente an zwei Zitaten klar: 9 Jahre nach Abschluss des Projekt Janus erklärte der Vorstandsvorsitzende der BAT-Tochter in Kanada, Jean-Louis Mercier, den Mitgliedern eines Komitees des kanadischen Parlaments: "It is not the position of he industry that tobacco cause any disease …The role, if any, that tobacco or smoking plays in the initiation and the development of these diseases is still very uncertain." Und der BAT-Vorstand Martin Broughton erklärte 1996, d.h. vier Jahre nach der angeordneten Vernichtung schriftlicher Gegenbeweise: "We have not concealed (verheimlicht), we do not conceal and we will never conceal. … We have no internal research which proves that smoking causes lung cancer or other diseases or, indeed, that smoking is addictive."
Der faktische Vorsatz zur oder die Billigung der komplexen Schädigung von RaucherInnen wird im Lichte des Inhalts der 60 sensitiven Dokumente so zwingend, dass es jetzt auch in Kanada von Seiten der öffentlichen Träger der Krankenversicherung Klageankündigungen gibt, bei denen es um Milliarden Dollar an Behandlungskosten geht. Dass es hier ausnahmsweise einmal gelang, die "rauchenden Colts" wiederzufinden, ist für diese Klagen sicherlich hilfreich. Jemals wieder einem Vertreter der Tabakindustrie etwas zu glauben fällt einem aber nach Lektüre dieser Dokumente wirklich sehr schwer.
Der achtseitige Aufsatz "Destroyed documents: uncovering the science that Imperial Tobacco Canada sought to conceal" von David Hammond, Michael Chaiton, Alex Lee und Neil Collishaw ist im CMAJ (2009 10.1503/cmaj.080566) erschienen und wie meisten Aufsätze dieser Fachzeitschrift komplett kostenlos erhältlich.
Die Liste der 60 zerstörten Dokumente umfasst 5 Druckseiten und zeigt bereits, um welches Themenspektrum es bei der Zerstörung ging.
Wer sich genauer mit den Inhalten beschäftigen will, kann dies zuerst anhand der tabellarischen Darstellung der Dokumente und ihrer wesentlichen Inhalte tun und bei Bedarf und anhaltendem Interesse auch über Links auf die an unterschiedlichen Orten gespeicherten Originale zugreifen.
Bernard Braun, 2.12.09
Sind RaucherInnen unterm Strich doch volkswirtschaftlich nützlich? Klärendes aus Österreich
 In ehemaligen Raucherkneipen und in regelmäßigen Abständen auch in seriösen epidemiologischen Papers und Präsentationen steht nicht selten die These im Raum, Rauchen sei doch letztlich gar nicht nur oder so schädlich wie behauptet wird. Raucher würden beispielsweise gar nicht so lange leben und Rente in Anspruch wie Nichtraucher und zahlten außerdem erhebliche Beträge an Steuern.
In ehemaligen Raucherkneipen und in regelmäßigen Abständen auch in seriösen epidemiologischen Papers und Präsentationen steht nicht selten die These im Raum, Rauchen sei doch letztlich gar nicht nur oder so schädlich wie behauptet wird. Raucher würden beispielsweise gar nicht so lange leben und Rente in Anspruch wie Nichtraucher und zahlten außerdem erhebliche Beträge an Steuern.
Ob und wie weit diese These neben der Wirklichkeit liegt untersuchte jetzt eine Gruppe von WissenschaftlerInnen vom österreichischen "Institut für Höhere Studien" in Wien. Dazu bediente sie sich des "methodischen Konzepts der Rauchen-attributablen Anteile"". In ihm werden die volkswirtschaftlichen Kosten und fiskalischen Vorteile (Nutzen) des Rauchens gegenüberstellt. Dabei wird auch das epidemiologisch gesicherte erhöhte Gesundheitsrisiko von Aktiv-, Ex- sowie Passiv-RaucherInnen quantifiziert.
Die methodischen Vorzüge ihrer Analyse beschreiben sie zusammengefasst so: "Gängige, ein-periodige Modelle können dynamische Bevölkerungseffekte aufgrund niedrigerer Sterblichkeit der Nicht-Passiv-RaucherInnen nicht erfassen. Sie über- bzw. unterschätzen die medizinischen bzw. ökonomischen Kosten von Rauchern durch die Vernachlässigung der höheren Lebenserwartung von NichtraucherInnen, welche eine rauchfreie Bevölkerung wachsen lassen würde. Aus diesem Grund implementierten die AutorInnen "ein (diese Effekte mitberücksichtigendes) sogenanntes Lebenszyklus-Modell, welches als Basis die Bevölkerung im Jahr 2003 heranzieht und in den Szenarien "Status quo" bzw. "rauchfreie Gesellschaft" die Alterskohorten mit den jeweiligen Sterblichkeiten und Aufwendungen zu Ende leben lässt."
Die wesentlichen Ergebnisse dieser Art von Analysen lauten:
• Zuerst zu den Lebenszeitverlusten durch Rauchen und den verschiedenen Kosten des Rauchens: "Im Jahr 2003 starben 8.600 Männer und Frauen in Österreich ursächlich wegen ihres Tabakkonsums. Dies entspricht 11% der insgesamt Verstorbenen im Jahr 2003, oder einem Toten alle 60 Minuten. Das erhöhte Sterberisiko von Aktiv-RaucherInnen schlägt sich in einer reduzierten Lebenserwartung von im Schnitt 5 Jahren im Vergleich zu lebenslangen NichtraucherInnen nieder. Passiv-RaucherInnen verlieren rund 9 Monate an Lebenserwartung."
• Allein die höheren Pro-Kopf-Gesundheitsausgaben von RaucherInnen für die medizinischen Kosten von Rauchen belaufen sich jährlich auf 760 Mio. EUR, das sind 3,3% der Gesundheitsausgaben im Jahr 2003 (ohne Pflege und Investitionen). Berücksichtigt man zusätzlich die höhere Lebenserwartung von NichtraucherInnen, so errechnet das Lebenszyklus-Modell unter Berücksichtigung des Kohorteneffekts vermeidbare medizinische Kosten von jährlich EUR 53,7 Mio. bzw. 0,26% der Gesundheitsausgaben im Jahr 2003 (ohne Pflege und Investitionen). Die nicht-medizinischen Kosten wie Pflege- und Krankengelder sowie Invaliditätspensionen belaufen sich auf jährlich 40,9 bzw. 26 Mio. EUR. In Summe betragen die nicht-medizinischen Kosten jährlich 75 Mio. EUR. Die ökonomischen Kosten bedingt durch häufigere Krankenstände, Invalidität und vorzeitige Sterblichkeit von erwerbstätigen RaucherInnen errechnen sich aus den resultierenden Arbeitsausfällen. Die vorliegende Studie schätzt die Rauchen-attributablen Ausfälle mit rund 17.600 Vollzeitäquivalenten im Jahr 2003. Dadurch gehen der österreichischen Volkswirtschaft jährlich rund 1.430 Mio. EUR oder 0,63 % des Bruttoinlandprodukts (BIP) verloren.
• Im Rahmen dieser Studie wurde, "erstmals für Österreich, die unfreiwillige Verkürzung der Lebenserwartung von Passiv-RaucherInnen monetär bewertet. Die hypothetischen Kompensationszahlungen der RaucherInnen an Passiv-RaucherInnen belaufen sich jährlich auf 81 Mio. EUR. Dieser Betrag stellt eine Unterschätzung dar, da nur der Verlust an Lebensquantität und nicht an -qualität von Passiv-RaucherInnen berücksichtigt wurde."
• Nun zu den Kosten einer "Rauchfrei-Politik": Im Jahr 2003 gab es in Österreich insgesamt 9.821 vollzeitäquivalente Beschäftigten in der Tabakwarenproduktion und im Tabakhandel. Die damit verbundene volkswirtschaftliche Wertschöpfung von 645 Mio. Euro würde durch eine "Rauchfreipolitik" wegfallen. Ob diese Beschäftigten andere Arbeitsplätze finden und dort wiederum Wertschöpfung stattfindet, ist zwar wahrscheinlich, aber nicht sicher.
• Sicher ist aber der Verlust an fiskalischen Einnahmen aus dem Tabakwarenkonsum wie Umsatzsteuer, Arbeitnehmerabgaben und Körperschaftssteuer in Höhe von 1.328,7 Mio. Euro im Jahr 2003. Im Rahmen des Lebenszyklus-Modells entsprechen die Tabaksteuereinnahmen einem jährlichen Betrag von 1.087 Mio. EUR.
• Schließlich, und hier findet der eingangs erwähnte Kneipendialog seinen materiellen Grund, beliefe sich der Mehr-Aufwand der öffentlichen Hand in einer rauchfreien Gesellschaft im Bereich der Alters- und Hinterbliebenenpensionen (so genannter Witweneffekt) jährlich auf 45 Mio. EUR oder 0,18 % des Pensionsaufwands für Alters- und Witwen/er-Pensionen im Jahr 2003.
• "In der Gegenüberstellung von Kosten und Nutzen übersteigen die gesellschaftlichen Kosten des Rauchtabakkonsums dessen Nutzen jährlich um 511,4 Mio. EUR; diese Differenz entspricht 0,23% des BIPs. Von diesen Netto-Kosten sind knapp ein Viertel, nämlich 118,6 Mio., auf Effekte des Passivrauchens zurückzuführen. Dabei handelt es aber immer noch um eine Unterschätzung der wahren Kosten von Rauchen. So sind die Kosten Arbeits- und Verkehrsunfälle, Wohnungsbrände sowie Produktivitätsverluste aufgrund von Warte- und Wegzeiten für medizinische Behandlungen, Rauchpausen während der Arbeitszeit, unbezahlten Pflegeleistungen der Angehörigen, etc. schwer zu quantifizieren und daher nicht erfasst worden."
• Schlussfolgerungen für den ökonomischen Sinn einer Rauchfrei-Politik: "Aus sozioökonomischer Sicht ist … die gesellschaftliche Toleranz und die fiskalische Nutznießung des Konsums von Rauchtabakwaren nicht gerechtfertigt. Die Effekte des Passivrauchens schlagen sich mit knapp einem Viertel der Netto-Kosten von Rauchen monetär nieder."
Es gibt keinen theoretischen Grund, dass die Lebenszyklus-Effekte von Aktiv-, Passiv- und Nichtrauchen sich zwischen Österreich und Deutschland qualitativ und quantitativ erheblich unterscheiden und Deutschland oder einige seiner Bundesländer einen bayrischen oder hessischen Sonderweg schaffen könnten. Daher lohnt ein gründlicherer Blick in die schon etwas älteren 207 Seiten des Schlussberichts der Studie "Volkswirtschaftliche Effekte des Rauchens. Eine ökonomische Analyse für Österreich" von Markus Pock, Thomas Czypionka, Sandra Müllbacher und Alexander Schnabl (Endbericht, April 2008), die in Gänze kostenlos zu erhalten sind.
Zu einer abweichenden Bilanz war im Jahr 2008 eine niederländische Studie gekommen. Allerdings hatte diese gesundheitsökonomische Untersuchung auch nur die direkten Versorgungs-Kosten von Rauchern und Nichtrauchern (unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Lebenserwartung) verglichen. Nicht berücksichtigt - so schrieben die Wissenschaftler ausdrücklich in ihrem Artikel - waren mehrere Faktoren, die das Ergebnis möglicherweise verändert hätten: Höhere Krankenstände und Produktivitätsverluste durch rauchende Erwerbstätige, daraus resultierende volkswirtschaftliche Verluste, geringere Renteneinzahlungen, sinkende Tabaksteuereinnahmen. vgl.: Niederländische Studie rechnet vor: Prävention bringt keine direkten Kosteneinsparungen im Gesundheitssystem
Bernard Braun, 24.11.09
Nichtraucher-Programme an einer Krankenhaus-Rettungsstation: Erfolgreich bei motivierten Teilnehmern
 Kann man Raucher durch eine Kurzberatung oder ein motivierendes Interview im Rahmen eines Notfallstationsaufenthalts in Kombination mit zusätzlichen Beratungen per Telefon dazu bewegen, mit dem Rauchen aufzuhören? Die Antwort einer großen Studie lautet: Ja, dies ist möglich, aber mit geringerem Erfolg als wünschenswert - denn positive Effekte zeigen sich nur in jener Teilgruppe, die zu einem Nikotinverzicht schon vorher motiviert war. Dies ist das wesentliche Ergebnis einer Studie, in der ein Forscherteam der Charité - Universitätsmedizin Berlin, gefördert von der Deutschen Krebshilfe, die Wirksamkeit einer Tabakentwöhnung im Umfeld der Notfallstation auf dem Campus Charité Mitte überprüfte.
Kann man Raucher durch eine Kurzberatung oder ein motivierendes Interview im Rahmen eines Notfallstationsaufenthalts in Kombination mit zusätzlichen Beratungen per Telefon dazu bewegen, mit dem Rauchen aufzuhören? Die Antwort einer großen Studie lautet: Ja, dies ist möglich, aber mit geringerem Erfolg als wünschenswert - denn positive Effekte zeigen sich nur in jener Teilgruppe, die zu einem Nikotinverzicht schon vorher motiviert war. Dies ist das wesentliche Ergebnis einer Studie, in der ein Forscherteam der Charité - Universitätsmedizin Berlin, gefördert von der Deutschen Krebshilfe, die Wirksamkeit einer Tabakentwöhnung im Umfeld der Notfallstation auf dem Campus Charité Mitte überprüfte.
Insgesamt wurden 11.218 Patientinnen und Patienten in der Rettungsstelle zunächst nach ihrem Raucherstatus und der Eignung für die Studie befragt. Von 1.728 so erfassten Rauchern nahmen 1.044, also etwa 60 Prozent, an der Studie teil. Knapp 61 Prozent von ihnen waren Männer, das Durchschnittsalter war 30 Jahre (zwischen 18 und 81 Jahre) und die durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretten lag bei 15 und schwankte zwischen 1 und 60 Zigaretten.
Anders als in einigen anderen Studien nahm mehr als die Hälfte (55,6 Prozent) der TeilnehmerInnen an der Studie teil, obwohl sie von sich aus nicht stark für einen Rauchstopp motiviert waren, d.h. explizit nicht innerhalb der nächsten 6 Monate mit dem Rauchen aufhören wollten. 31,7 Prozent waren ambivalent und beantworteten die Frage nach ihrer zeitlichen Vorstellung vom Rauchstopp damit, dies innerhalb der nächsten 6 Monate, aber nicht innerhalb der nächsten vier Wochen schaffen zu wollen. Die restlichen 12,7 Prozent der StudienteilnehmerInnen waren motiviert, mit dem Rauchen innerhalb der nächsten vier Wochen aufzuhören.
Die Studie wurde dann "randomisiert", d.h. zur Teilnahme bereite Männer und Frauen wurden per Zufall einer Interventions- oder Kontrollgruppe zugeteilt. Die Interventionsgruppe erhielt auf der Notfall- oder Rettungsstation der Charité eine leitliniengerechte Beratung sowie ein motivierendes Interview und danach noch weitere telefonische Beratungen. Die RaucherInnen in der Kontrollgruppe erhielten keine gezielt motivierenden Maßnahmen, sondern das "normale" Behandlungsprogramm mit allgemeinen Hinweisen, das Rauchen sein zu lassen.
Nach 12 Monaten wurde mit dem Indikator der 7-Tage-Rauchabstinenz der Rauchstatus in beiden Gruppen überprüft. Dabei war die eingangs gemessene Motivation der zentrale Faktor dafür, dass sich überhaupt Effekte des gezielten Programms in der Interventionsgruppe finden ließen:
• In den Gruppen der nicht oder nur halbherzig motivierten RaucherInnen gab es kaum Unterschiede zwischen Interventions- und Kontrollgruppenmitgliedern.
• Einen Unterschied gab es nur bei jenen, die zum Nikotinverzicht motiviert waren: In der Interventionsgruppe waren beim 12-Monate-Follow up 32,8 Prozent abstinent, in der Kontrollgruppe lediglich 18,8%. Wegen der kleinen Stichprobengröße (nur jeder Achte, 12,7%, der rund 1000 Teilnehmer war zum Aufhören motiviert), war dieser Unterschied aber statistisch nicht signifikant.
In der Studie wird deutlich, dass man mit mehrdimensionalen Interventionen zwar positive Wirkungen auf das Rauchverhalten erzielen kann, dass die Effekte aber schwach sind und in starkem Maße auf vorher schon entwickelten Motiven und Einstellungen der TeinehmerInnen beruhen. In zukünftigen Studien sollte daher auch überlegt werden, wie man die Motivation, mit dem Rauchen aufzuhören, separat oder vorgängig erhöhen kann. Die in der Studie nicht abschließend geklärten Gründe für den Ausfall von fast 40% der ursprünglich angesprochenen Gruppe von Rauchern und von rund einem Drittel der TeilnehmerInnen für die Follow up-Erhebung des Rauchstatus könnten verzerrend gewirkt haben und sogar zu einer Überschätzung der wirklichen Verläufe und Ergebnisse beigetragen haben. Hier zeigt sich aber auch, wie schwer es ist, für solche Studien eine ausreichende Anzahl zufälliger TeilnehmerInnen zu finden.
Den Aufsatz ist komplett kostenlos erhältlich: Bruno Neuner, Edith Weiss-Gerlach, P. Miller, P. Martus, D. Hesse und Claudia Spies: Emergency department-initiated tobacco control: a randomised controlled trial in an inner-city university hospital (Zeitschrift Tobacco Control, 2009; doi:10.1136/tc.2008.028753: 283-292
Bernard Braun, 9.11.09
Körperliche Fitness stärkt die kognitiven Fähigkeiten älterer Menschen
 Auch wenn manche öffentlichen Debatten über Alter und Gesundheit den Eindruck vermitteln, Altern sei ein unvermeidbarer natürlicher Prozess des Verlusts kognitiver Fähigkeiten bis hin zur Demenz, scheint dies nicht uneingeschränkt zu stimmen. Vielmehr können körperliche Aktivitäten und daraus resultierende körperliche Fitness zu einer Entwicklung der kognitiven Fähigkeiten beitragen, so dass körperlich aktive ältere Menschen nicht nur körperlich leistungsfähiger, sondern auch kognitiv präsenter und mit sich zufriedener sind als ihre Altersgenossen, die nichts für ihre körperliche Leistungsfähigkeit tun. Dies zeigten bereits im Jahr 2006 die Ergebnisse einer mittelgroßen Studie mit 460 TeilnehmerInnen des "Scottish Mental Survey", die 1932 geboren wurden und noch lebten und bestätigte zum Teil ein 2008 erstellter systematischer Cochrane-Review.
Auch wenn manche öffentlichen Debatten über Alter und Gesundheit den Eindruck vermitteln, Altern sei ein unvermeidbarer natürlicher Prozess des Verlusts kognitiver Fähigkeiten bis hin zur Demenz, scheint dies nicht uneingeschränkt zu stimmen. Vielmehr können körperliche Aktivitäten und daraus resultierende körperliche Fitness zu einer Entwicklung der kognitiven Fähigkeiten beitragen, so dass körperlich aktive ältere Menschen nicht nur körperlich leistungsfähiger, sondern auch kognitiv präsenter und mit sich zufriedener sind als ihre Altersgenossen, die nichts für ihre körperliche Leistungsfähigkeit tun. Dies zeigten bereits im Jahr 2006 die Ergebnisse einer mittelgroßen Studie mit 460 TeilnehmerInnen des "Scottish Mental Survey", die 1932 geboren wurden und noch lebten und bestätigte zum Teil ein 2008 erstellter systematischer Cochrane-Review.
Die schottische (Kohorten-)Studie besteht aus zwei Untersuchungsmodulen: Erstens wurden ihre TeilnehmerInnen sowohl als sie 11 Jahre alt waren und erneut im Alter von 79 Jahren mit einem identischen Test für kognitive Fähigkeiten getestet. Zweitens wurden Merkmale körperlicher Leistungsfähigkeit, wie die Schrittlänge oder die Lungenfunktion im Alter von 79 Jahren gemessen.
Eine Analyse der Indikatoren für körperliche Fitness und erfolgreiches kognitives Altern zeigte unter Berücksichtigung des kognitiven Niveaus im Alter von 11 Jahren, des Geschlechts, der Zugehörigkeit zu einer sozialen Schicht und der Existenz des Alzheimer-Prädiktor-Gens APOE-4, eine enge Assoziation von Fitness und kognitiven Fähigkeiten. Eine daraus abgeleitete Empfehlung lautete: Interventionsstudien, die ältere Menschen insbesondere auch im kognitiven Bereich stärken wollen, sollten dies u.a. auch mit der Verbesserung der körperlichen Leistungsfähigkeit versuchen.
Die Autoren des Cochrane-"intervention review" aus dem Jahr 2008 stellen zum einen fest, aerobe körperliche Aktivität bewahre bzw. verbessere die kardiovaskuläre Gesundheit und stelle damit eine wichtige Bedingung für physisch gesundes Altern dar. Um erkennen zu können, ob es auch einen positiven Zusammenhang von körperlicher Aktivität und Fitness und kognitiven Fähigkeiten gibt, untersuchten sie sämtliche randomisierten kontrollierten Studien, die bis zum 15. Dezember 2005 Wirkungen von Interventionen eines Programm zur aeroben körperlichen Aktivität bei 55 Jahre alten und älteren Personen untersucht haben. Aerobes Training bezeichnet dabei ein gesundheitsorientiertes Ausdauertraining im Unterschied zum anaeroben Training, das kurzfristig besonders hohe Leistungen verlangt. Ein Teil der Studien intervenierte auch noch mit anderen Mitteln wie beispielsweise anderer Ernährung, ein Teil bestand nur aus aeroben Aktivitäten.
Die Ergebnisse der 11 Studien, die diese Einschlusskriterien erfüllten, zeigen Folgendes:
• Trotz einiger methodischer und konzeptioneller Mängel gibt es nach Ansicht der Reviewer "Evidenz, dass aerobes Training mit Verbesserung der kardiovaskulären Fitness für die kognitiven Fähigkeiten gesunder Älterer positiv ist".
• 8 dieser Studien bestätigten eine positive Wirkung des aeroben Trainings auf die maximale Sauerstoffaufnahmefähigkeit als einem der besten Einzelindikatoren für die Leistungsfähigkeit des Herz-/Kreislaufsystems. Dieser Wert wird um nahezu 14% erhöht.
• Wichtige Indikatoren für kognitive Leistungen stehen in engem Zusammenhang mit Verbesserungen dieses Indikators für physische Leistungsfähigkeit: Die stärksten Effekte finden sich bei der Koordination der groben und feinen Muskulatur (motor function), die in den Studien und von den Reviewern zu den kognitiven Funktionen gerechnet wird und der auditiven Aufmerksamkeit.
• Bei der kognitiven Geschwindigkeit, d.h. der Zeit in der Informationen verarbeitet werden und der visuellen Aufmerksamkeit gibt es moderate Effekte.
Die Aussagefähigkeit der Ergebnisse sehen die Cochrane-Reviewer jedoch dadurch eingeschränkt, dass die Mehrheit der Studien keine signifikanten Unterschiede zwischen den kognitiven Fähigkeiten von körperlich Aktiven und Inaktiven auf dem von ihnen vereinbarten Signifikanzniveau dokumentiert und außerdem in vielen Studien keine einheitlichen Indikatoren für die kognitive Leistungsfähigkeit untersucht wurden.
Ungeeignet sind die Studienergebnisse schließlich für den Nachweis, dass die durch körperliche Aktivität verbesserten kognitiven Fähigkeiten umgekehrt einen positiven Einfluss auf die kardiovaskulärer Fitness hätten. Wegen der Schwachstellen bisheriger Studien, plädieren die Reviewer für weitere, inhaltlich besser abgestimmte Studien.
Von der schottischen Studie ist kostenlos nur ein Abstrakt erhältlich: Physical fitness and lifetime cognitive change von Ian J. Deary, Lawrence J. Whalley, G. David Batty und John M. Starr, Neurology 2006;67:1195-1200
Auch für den Cochrane-Intervention-Review von Angevaren M, Aufdemkampe G, Verhaar HJJ, Aleman A, Vanhees L. gibt es kostenlos nur ein etwas längeres Abstract: Physical activity and enhanced fitness to improve cognitive function in older people without known cognitive impairment. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 3. Art. No.: CD005381. DOI: 10.1002/14651858.CD005381.pub3:
Bernard Braun, 5.11.09
Nützliche Helfer: Computer und Internet als Elemente von Nichtraucher-Programmen
 Eine Bilanz von insgesamt 22 Studien mit knapp 30 Tausend Teilnehmern an Nichtraucher-Programmen hat jetzt gezeigt: Sowohl die Nutzung von Personal Computern als auch der Einbezug des Internet erwiesen sich als effektive Einflussfaktoren und erhöhten die Wahrscheinlichkeit, dass die Teilnehmer tatsächlich mit dem Rauchen aufhören. Allerdings zeigte sich dieser Einfluss nicht für Jugendliche, sondern nur für Erwachsene.
Eine Bilanz von insgesamt 22 Studien mit knapp 30 Tausend Teilnehmern an Nichtraucher-Programmen hat jetzt gezeigt: Sowohl die Nutzung von Personal Computern als auch der Einbezug des Internet erwiesen sich als effektive Einflussfaktoren und erhöhten die Wahrscheinlichkeit, dass die Teilnehmer tatsächlich mit dem Rauchen aufhören. Allerdings zeigte sich dieser Einfluss nicht für Jugendliche, sondern nur für Erwachsene.
Können neue Medien wie das Internet oder Personal Computer bei der Durchführung von Nichtraucher-Programmen hilfreich sein? Die Möglichkeiten zu einer persönlich (etwa nach Bildungsniveau oder Lebensalter) zugeschnittenen Information und ebenso zu einem individuellen Feedback sind mit diesen Hilfsmitteln und entsprechenden Programmen recht einfach zu verwirklichen. Bisher veröffentlichte Studien zeigen hierzu allerdings ein widersprüchliches Bild: Während einige Untersuchungen einen positiven Effekt nachweisen, zeigen sich in anderen Studien kaum Unterschiede zwischen Untersuchungs- und Kontrollgruppen.
Eine Forschungsgruppe aus Südkorea hat daher jetzt eine sogenannte "Meta-Analyse" durchgeführt und in der renommierten Fachzeitschrift "Archives of Internal Medicine" veröffentlicht. In solchen Meta-Analysen werden Untersuchungsergebnisse unterschiedlicher Studien zu denselben medizinischen Maßnahmen oder Gesundheitsförderungs-Programmen, die oft auf kleineren Untersuchungsgruppen basieren, zusammengeführt und mit Hilfe statistischer Verfahren eine Gesamtbilanz gezogen.
Einbezogen wurden von den Wissenschaftlern 22 Studien zur Raucherentwöhnung, die alle eine Untersuchungsgruppe (mit Internet- oder PC-Einsatz) und eine Kontrollgruppe (ohne Internet/PC) gebildet und die Studienteilnehmer nach dem Zufallsprinzip diesen Gruppen zugeordnet hatten. 16.050 Männer und Frauen waren in den Untersuchungsgruppen beteiligt, 13.499 in den Kontrollgruppen. Berücksichtigt wurden Studien nur dann, wenn sie den Effekt ihrer Maßnahmen über einen Zeitraum von mindestens 3 Monaten kontrollierten. Als Indikatoren für den Erfolg wurde zumeist die Quote der Nichtraucher nach einem bestimmten Zeitraum (3 bis 12 Monate nach der Programmbeginn) berücksichtigt. Überprüft wurden auch Effekte bei unterschiedlichen Teilgruppen, differenziert nach den Rahmenbedingungen der Maßnahmen (Internet- oder PC-Einsatz, mit und ohne zusätzliche Nikotinersatz durch Kaugummi, Pflaster oder Medikamente).
Folgende Ergebnisse zeigten sich:
• Sowohl der Einsatz des Internet wie auch der von Personal Computern, die persönlich zugeschnittene Informationen, Beratungen und Unterstützungstexte präsentierten, erwies sich als effektiv im Vergleich zu Nichtraucher-Programmen ohne solche Hilfsmittel. Im Durchschnitt waren Teilnehmer der Untersuchungsgruppen etwa anderthalbmal so oft erfolgreich in Bezug auf den Nikotinverzicht wie Teilnehmer der Kontrollgruppen.
• Dabei zeigten sich keine Unterschiede zwischen der Verwendung von Computern oder dem Internet.
• In einigen Studien mit großer Teilnehmerzahl betrugen die Quoten der erfolgreichen Nichtraucher beispielsweise 4,1% (Untersuchungsgruppe) und 2,0% (Kontrollgruppe) oder auch bei 20,1% bzw. 15,9%. Im Durchschnitt aller Studien und Untersuchungsgruppen lagen diese Abstinenzquoten bei 9,9% bzw. 5,7%.
• Diese Zahlen deuten bereits an, dass die Erfolgsquoten in den einzelnen Studien erhebliche Unterschiede aufwiesen. Sie variierten in den Untersuchungsgruppen zwischen 3 Prozent und 28 Prozent. Damit wird auch deutlich, dass für ein erfolgreiches Programm zur Raucherentwöhnung die per Internet oder PC gelieferte Information und das Feedback nur ein Element von vielen ist, um eine Maßnahme zur Gesundheitsförderung erfolgreich durchzuführen.
• Der zusätzliche Einbezug von Nikotinersatztherapien erbrachte für die Untersuchungsgruppen keinen nennenswerten, also statistisch signifikanten zusätzlichen Positiveffekt.
• Für die Wissenschaftler überraschend war der Befund, dass die Hilfsmittel Computer und Internet nur für Erwachsene bei der Raucherentwöhnung positiv durchschlagen - bei Jugendlichen brachte dies keinen Vorteil. Ob dies an der speziellen Zusammensetzung der in nur drei Studien berücksichtigten jugendlichen Gruppen lag oder daran, dass Internet und Personal Computer ganz generell für Jugendliche keinen speziellen Anreiz bieten - die Beantwortung dieser Frage wird von den Wissenschaftlern als Aufgabe für zukünftige Forschungsprojekte definiert.
Kostenlos verfügbar ist ein Abstract der Studie Seung-Kwon Myung et al: Effects of Web- and Computer-Based Smoking Cessation Programs - Meta-analysis of Randomized Controlled Trials (Arch Intern Med. 2009;169(10):929-937)
Gerd Marstedt, 1.11.09
Frauen "ticken" anders als Männer: Auch beim Entschluss, mit dem Rauchen aufzuhören
 Die anfänglichen Motive Jugendlicher für das Rauchen sind überaus verschieden, darunter findet man Neugier ebenso wie den Wunsch nach sozialer Anerkennung durch eine Gruppe. Und ebenso findet man später bei Erwachsenen sehr unterschiedliche Motive, um wieder aufzuhören, von zunehmenden Unbequemlichkeiten im Raucher-Alltag bis hin zu gesundheitlichen Gründen. Eine internationale Studie mit männlichen und weiblichen Teilnehmern aus 16 Ländern hat nun gezeigt, dass es nicht nur Unterschiede zwischen Individuen gibt, sondern dass Männer und Frauen teilweise ganz unterschiedliche Motive haben, was das Rauchverhalten anbetrifft, sich ebenso aber auch bei den Motiven, um mit dem Rauchen aufzuhören, unterscheiden. Diese Geschlechtsunterschiede sind auch für Projekte zur Gesundheitsförderung bedeutsam, die einen Rauchstop zum Thema haben.
Die anfänglichen Motive Jugendlicher für das Rauchen sind überaus verschieden, darunter findet man Neugier ebenso wie den Wunsch nach sozialer Anerkennung durch eine Gruppe. Und ebenso findet man später bei Erwachsenen sehr unterschiedliche Motive, um wieder aufzuhören, von zunehmenden Unbequemlichkeiten im Raucher-Alltag bis hin zu gesundheitlichen Gründen. Eine internationale Studie mit männlichen und weiblichen Teilnehmern aus 16 Ländern hat nun gezeigt, dass es nicht nur Unterschiede zwischen Individuen gibt, sondern dass Männer und Frauen teilweise ganz unterschiedliche Motive haben, was das Rauchverhalten anbetrifft, sich ebenso aber auch bei den Motiven, um mit dem Rauchen aufzuhören, unterscheiden. Diese Geschlechtsunterschiede sind auch für Projekte zur Gesundheitsförderung bedeutsam, die einen Rauchstop zum Thema haben.
3.760 männliche und weibliche Raucher aus 16 Ländern, darunter Deutschland und weiteren EU-Ländern sowie Kanada und USA, wurden 2006/2007 in Telefoninterviews über ihr Rauchverhalten befragt. Diese Interviews waren Teil der sogenannten SUPPORT-Studie ("Smoking: Understanding People's Perceptions, Opinions, and Reactions to Tobacco"). Bei den Studienteilnehmern handelte es sich um eine Zufallsauswahl von Rauchern/innen im Alter über 25 Jahre.
In den Interviews wurden etwa 50 Fragen gestellt, wobei neben sozialstatistischen Angaben vier Themenkomplexe im Vordergrund standen: (1) Motive und Begründungen für das gegenwärtige Rauchverhalten, (2) Gründe, warum man schon einmal versucht hat, mit dem Rauchen aufzuhören, (3) Methoden, die man bei diesen erfolglosen Versuchen eingesetzt hat (Nikotin-Ersatztherapie, Akupunktur, "kalter Entzug" usw.). (4) Reaktionen des Hausarztes, sofern man ihn auf den Aspekt des Rauchens einmal angesprochen hat.
• Bei den Motiven und Begründungen für das gegenwärtige Rauchverhalten überwogen bei Männern wie Frauen zunächst sehr vordergründige Angaben. 60% (Männer) bzw. 66% (Frauen) gaben an, das Rauchen zu genießen, 74% bzw. 73% sprachen von "Gewohnheit". Ingesamt gaben Frauen mehr Gründe als Männer an und einige Punkte wurden von Frauen deutlich häufiger genannt, insbesondere "Andere Familienmitglieder rauchen auch", "Rauchen hilft bei der Bewältigung von Alltagsproblemen", "Rauchen zügelt den Appetit".
• Auch bei den Gründen, warum man schon einmal versucht hat, mit dem Rauchen aufzuhören, zeigen sich einige Geschlechtsunterschiede, auch wenn der am häufigsten genannte Grund ("langfristige Gesundheitsschäden") bei Männern und Frauen etwa gleich oft (60%, 57%) zu finden ist. Differenzen finden sich jedoch bei folgenden Begründungen: zu hohe finanzielle Kosten, wichtige Veränderungen im Leben wie Schwangerschaft oder Umzug, Sorge um die Gesundheit anderer, negative Auswirkungen des Rauchens auf die äußere Erscheinung.
• "Willenskraft" ist jene Methode, die von Männern wie Frauen gleichermaßen am häufigsten genannt wird. Darüber hinaus zeigt sich, dass Frauen häufiger auch andere Hilfen in Anspruch nehmen. Im Rahmen einer multivariaten Analyse unter Berücksichtigung auch des Alters und der Rauchintensität (Anzahl Zigaretten pro Tag) zeigt sich, dass Frauen sehr viel häufiger Hilfen in Anspruch nehmen wie Akupunktur, psychologische Beratung, selbst gekaufte oder vom Arzt verschriebene Mittel zur Nikotin-Ersatztherapie, andere ärztlich verordnete Medikamente.
• Für die Inanspruchnahme ärztlicher Hilfe und Beratung zeigen sich kaum Geschlechtsunterschiede, für etwa 70% aller Befragten trifft dies zu.
Die Wissenschaftler weisen darauf hin, dass die Ergebnisse ihrer Studie für die Praxis der Gesundheitsförderung im Bereich Nikotinverzicht recht bedeutsam sein können. Frauen haben abweichende Motive für frühere Versuche, mit dem Rauchen aufzuhören. Insbesondere der Verweis auf wichtige Veränderungen im Leben wie Schwangerschaft oder Umzug (von 32% der Frauen und 16% der Männer genannt) gibt Hinweise, dass unter Umständen auch andere Ereignisse in der ärztlichen Praxis als Gelegenheit nutzbar sind, um Frauen zum Rauchstop anzuregen wie zum Beispiel die Durchführung von Vorsorge- und Früherkennungsuntersuchungen oder Beratungen zur Schwangerschafts-Verhütung.
Auch die sehr viel größere Bereitschaft weiblicher Raucher, medizinische oder psychologische Hilfe sowie Medikamente und vergleichbare Mittel in Anspruch zu nehmen sollte zukünftig berücksichtigt werden, wenn Kurse oder Beratungen angeboten werden, um mit dem Rauchen aufzuhören.
Kostenloses Abstract: Robert D. Reid et al: Sex differences in attitudes and experiences concerning smoking and cessation: Results from an international survey (Patient Education and Counseling, Volume 76, Issue 1, July 2009, Pages 99-105)
Gerd Marstedt, 11.10.09
Wissenschaftliche Studien zeigen: Ampelkennzeichnung ist für Verbraucher am verständlichsten
 Mehrere wissenschaftliche Studien haben jetzt erneut gezeigt, dass bei der Kennzeichnung von Lebensmitteln eine Kombination von Ampelfarben und Text für Verbraucher am verständlichsten ist, um gesunde von weniger gesunden Produkten (z.B. zu salzhaltig, zu hoher Zuckergehalt) zu unterscheiden. Zu diesem Ergebnis kommt sowohl die bislang umfassendste Vergleichsstudie über die Verständlichkeit verschiedener Kennzeichnungssysteme, die in England durchgeführt wurde, als auch eine neue australische Studie.
Mehrere wissenschaftliche Studien haben jetzt erneut gezeigt, dass bei der Kennzeichnung von Lebensmitteln eine Kombination von Ampelfarben und Text für Verbraucher am verständlichsten ist, um gesunde von weniger gesunden Produkten (z.B. zu salzhaltig, zu hoher Zuckergehalt) zu unterscheiden. Zu diesem Ergebnis kommt sowohl die bislang umfassendste Vergleichsstudie über die Verständlichkeit verschiedener Kennzeichnungssysteme, die in England durchgeführt wurde, als auch eine neue australische Studie.
Beauftragt wurde die Studie im United Kingdom von der staatlichen britischen Lebensmittelbehörde FSA (Food Standards Agency). Ihr zufolge sind zwei Arten der Kennzeichnung verständlicher als andere Systeme:
• Eine Kombination aus Text (hoch/mittel/niedrig) und Ampelfarben (rot/gelb/grün) oder
• eine Kombination von Text, Ampelfarben und zusätzlichen GDA-Prozentwerten.
• Das von der Industrie bevorzugte Modell, bei dem lediglich Prozentwerte nach dem GDA-System genannt werden, fällt bei dem Vergleich durch. Die sogenannten "GDA-Werte" (Guideline Daily Amount, wörtlich: Leitlinie für die tägliche Menge") legen Richtwerte für eine gesunde Ernährung fest, genauer für die Tageszufuhr von Energie sowie bestimmten Stoffen wie Zucker, Fett, gesättigte Fettsäuren, Salz.
Im Mittelpunkt der Studie standen Befragungen bei insgesamt 2.932 Testpersonen, die 10 unterschiedliche Kennzeichnungen von Produkten (mit/ohne Text, mit/ohne Ampelfarben usw.) bewerten mussten. Diese subjektive Bewertung, basierend auf den Kennzeichnungen, bezog sich zum einen auf den Nährstoffgehalt des Produkts sowie zum anderen auf den gesundheitlichen Wert. Als Ergebnis zeigte sich unter anderem: "Die Kombination von Text, Ampelfarben und %-GDA-Angaben ist insgesamt die aussagekräftigste Kennzeichnung: Sie gehört zu den beliebtesten Kennzeichnungen und macht Verbrauchern die Nährwertinformationen im für sie am besten verständlichen Format zugänglich. Darüber hinaus hilft die zusätzliche Angabe der %-GDA-Werte dabei, den genauen Gehalt einzelner Nährstoffe im Produkt zu bestimmen." (Executive Summary der Studie, deutsche Übersetzung durch Foodwatch)
Die verbrauchernahe Organisation "Foodwatch" hat die Studie noch einmal von einer wissenschaftlichen Einrichtung aus Deutschland (Institute der Justus-Liebig-Universität Gießen) bewerten lassen, um mögliche Zweifel und Kritik an deren Seriosität und Aussagekraft aus dem Weg zu räumen. In diesem Gutachten wird die Studie als "herausragende wissenschaftliche Leistung" bewertet. Gleichwohl wird auch in diesem Feld noch ein Forschungsbedarf konstatiert, unter anderem sei "die Nutzung von Kennzeichnungssystemen auf Verpackungen im Alltag, wie zum Beispiel beim Einkauf im Lebensmitteleinzelhandel oder zu Hause für deutsche Konsumenten noch nicht erforscht."
• Food-Watch hat auf dieser Seite verschiedene Materialien zum Thema bereitgestellt: Wissenschaft spricht für Ampelfarben
• Die Studie aus dem United Kingdom: Comprehension and use of UK nutrition signpost labelling schemes, May 2009, Prepared for Food Standards Agency
• Das deutsche Gutachten: Institut für Ernährungswissenschaft, Prof. Dr. Ingrid-Ute Leonhäuser, Institut für Agrarsoziologie und Beratungswesen, Prof. Dr. Hermann Boland, Justus-Liebig-Universität Gießen: Wissenschaftliche Stellungnahme zur FSA-Studie Im Auftrag von foodwatch e.V. , Berlin, August 2009
Zu demselben Befund wie die englische Studie für die Food Standards Industry kam jetzt auch eine australische Untersuchung. Auch in dieser Studie gaben insgesamt 790 Verbraucher Bewertungen ab für unterschiedliche Lebensmittel-Kennzeichnungen, wobei in ähnlicher Weise wie im United Kingdom unter anderem Hinweise mit und ohne Ampelfarben vorgegeben waren. Die Studienteilnehmer bekamen jeweils paarweise ein eher gesundes und ein eher ungesundes Produkt zu sehen, bzw. 2 Produkt-Attrappen mit unterschiedlichen Kennzeichnungen. Die Produkte stammten aus den drei Lebensmittel-Bereichen: Frühstücks-Müsli, Knäckebrot, Tiefkühlkost (Lasagne). Sie mussten dann jeweils angeben, welches der beiden Produkte wohl gesundheitlich eher zu empfehlen sei.
Als Ergebnis zeigte sich: Die Ampelkennzeichnung ermöglichte es den allermeisten Verbrauchern, besser zu unterscheiden zwischen eher gesunden und eher ungesunden Produkten. Im Vergleich zu einer einfarbigen Kennzeichnung mit Angabe der GDA-Werte ermöglichte die Ampelkennzeichnung eine fünffach bessere Identifizierung.
Abstract der Studie: Bridget Kelly et al: Consumer testing of the acceptability and effectiveness of front-of-pack food labelling systems for the Australian grocery market (Health Promotion International, doi:10.1093/heapro/dap012)
Die genaue Art der Ampelkennzeichnung und auch das GDA-Modell werden bei Foodwatch detailliert vorgestellt, viele Informationen liefert aber auch die Verbraucherzentrale, Bundesverband.
Gerd Marstedt, 30.9.09
Bilanz von Interventionen zur Förderung von Sport und körperlicher Aktivität: Wie lange hält der Effekt?
 Maßnahmen und Interventionen zur Gesundheitsförderung sind fast ausnahmslos effektiv - große Unterschiede bestehen allerdings im Hinblick darauf, ob ihre Wirkung nur zwei Wochen anhält oder auch noch nach zwei Jahren beobachtbar ist. Neuere Evaluationsstudien bemühen sich auch aus diesem Grund darum, Kontrolluntersuchungen (sog. "Follow-up") auch noch nach einem längeren Zeitraum von 1-2 Jahren durchzuführen. Für Gesundheitsförderungsprojekte im Bereich Sport und körperlicher Aktivität hat jetzt eine systematische Literaturstudie anhand der Veröffentlichungen von 25 methodisch hochwertigen Untersuchungen ein überaus positives Ergebnis gefunden. Es wird nämlich deutlich, dass sich bei der Mehrzahl der einbezogenen Interventionen durchaus Langzeiteffekte einstellen und ein körperlich aktiveres Verhalten der Teilnehmer auch noch nach 12 oder 24 Monaten feststellbar ist.
Maßnahmen und Interventionen zur Gesundheitsförderung sind fast ausnahmslos effektiv - große Unterschiede bestehen allerdings im Hinblick darauf, ob ihre Wirkung nur zwei Wochen anhält oder auch noch nach zwei Jahren beobachtbar ist. Neuere Evaluationsstudien bemühen sich auch aus diesem Grund darum, Kontrolluntersuchungen (sog. "Follow-up") auch noch nach einem längeren Zeitraum von 1-2 Jahren durchzuführen. Für Gesundheitsförderungsprojekte im Bereich Sport und körperlicher Aktivität hat jetzt eine systematische Literaturstudie anhand der Veröffentlichungen von 25 methodisch hochwertigen Untersuchungen ein überaus positives Ergebnis gefunden. Es wird nämlich deutlich, dass sich bei der Mehrzahl der einbezogenen Interventionen durchaus Langzeiteffekte einstellen und ein körperlich aktiveres Verhalten der Teilnehmer auch noch nach 12 oder 24 Monaten feststellbar ist.
Aus ursprünglich über 5.500 Veröffentlichungen zur Förderung von Sport und körperlicher Bewegung filterte ein Wissenschaftler-Team des Instituts für Sozialmedizin, Epidemiologie und Gesundheitsökonomie an der Charité Berlin, dann 25 Artikel heraus, deren Befunde noch einmal bewertet und zusammengefasst wurden. Einschlusskriterien für die Analyse waren: Veröffentlichung zwischen 2001 und 2007 in englischer oder deutscher Sprache, Maßnahmen zur Förderung körperlicher Bewegung unabhängig vom Setting (Kommune, Betrieb usw.), nur "randomisierte Kontrollstudien" (d.h. Einbezug auch einer Kontrollgruppe ohne Intervention und zufällige Zuweisung der Teilnehmer zur Interventions- oder Kontrollgruppe), Messung von Ergebnis-Indikatoren (zeitlicher Umfang körperlicher Aktivität, Fitness), Follow-up-Untersuchung nach 12 Monaten oder später, Teilnehmer älter als 18 und ohne gesundheitliche Beeinträchtigungen.
Als Ergebnis der Analyse zeigte sich dann:
• Es gibt erhebliche Unterschiede, was die Effektivität der Maßnahmen anbetrifft. Der Prozentanteil von Teilnehmern, die das jeweils geplante Ideal-Ziel (z.B. ein bestimmter Kalorienverbrauch oder eine bestimmte Zeitdauer täglicher Bewegung) auch nach 12 oder 24 Monaten noch erreichten, variierte in den Projekten zwischen 5% und 81%.
• Nicht in allen, aber in der Mehrzahl der Projekte zeigen sich in den Interventionsgruppen signifikante Unterschiede zur jeweiligen Kontrollgruppe. In Zahlen ausgedrückt bedeutet dies: Teilnehmer an den Maßnahmen zur Gesundheitsförderung haben im Durchschnitt auch nach längerer Zeit noch einen höheren Kalorienverbrauch (+ 975 kcal in der Woche) oder weisen um 11% bessere Fitness-Werte auf.
• Insbesondere in jenen Studien, die als methodisch besonders fundiert bewertet wurden und die eine größere Teilnehmerzahl aufwiesen, zeigten sich deutliche Positiveffekte. Gemeinsam war den qualitativ hochwertigen, besonders erfolgreichen Studien, dass sie neben einer ärztlichen Beratung und schriftlichem Informationsmaterial den Teilnehmern auch exakte Trainingspläne in schriftlicher Form aushändigten.
• Es fanden sich Hinweise, die frühere Untersuchungsergebnisse bestätigten, dass nämlich ein sogenanntes "Tailoring", also ein inhaltliches Zuschneiden von Maßnahmen auf besondere Voraussetzungen der Teilnehmer (Alter, Geschlecht, Bildung, Vorerfahrung, Gesundheit usw.) ein wesentliches Element für den Projekterfolg ist.
Die Mehrzahl der erfolgreichen Studien setzte verschiedene Techniken ein, um die Teilnehmer auch langfristig "bei der Stange zu halten": Durch Telefonanrufe, Emails, Nachrichten auf Internet-Seiten oder Gruppensitzungen.
Wie es scheint, weitet sich der Erkenntnisstand über Erfolgskriterien für Gesundheitsförderung im Bereich Sport und Bewegung zwar nur langsam, aber doch erkennbar aus. Vor kurzem hatte eine Meta-Analyse Ogilvie D et al (2007): Interventions to promote walking: systematic review (British Medical Journal 2007; 334) deutlich gemacht: "targeting and tailoring", also eine gezielte Teilnehmer-Auswahl und konzeptionelle Orientierung an der Zielgruppe sind besonders wichtige Kriterien für den Erfolg von Gesundheitsförderungsmaßnahmen in diesem Bereich. Der erste Aspekt bedeutet, dass meist solche Studien erfolgreicher waren, die eine klare Zielgruppe angesprochen hatten und sich nicht diffus an die Bevölkerung wendeten. Günstig war es darüber hinaus, wenn bei dieser Zielgruppe bereits eine Motivation zur Verhaltensänderung vorlag. Der zweite Aspekte bedeutet, dass man sich bei den Informationsmaterialien, den organisatorischen Rahmenbedingungen usw. sehr genau auf die Voraussetzungen und Motive der jeweiligen Adressaten einlässt und das Interventions-Programm auf sie "zuschneidet".
Die jetzige Studie hat nun zu diesen Erkenntnissen weitere hinzugefügt: Interventionen zu mehr Sport und Bewegung scheinen dann besonders erfolgreich zu sein, wenn sie schriftliche Trainingspläne verwenden und Auffrischungs-Techniken zur Erinnerung und Aufrechterhaltung der Motivation einsetzen, wobei auch neuere Medien (Email, Internet) geeignet erscheinen.
Kostenlos verfügbar ist ein Abstract der Studie: Falk Müller-Riemenschneider, Thomas Reinhold, Marc Nocon, Stefan N. Willich: Long-term effectiveness of interventions promoting physical activity: A systematic review (Preventive Medicine, Vol 47, Issue 4, Oct 2008, 354-368, doi:10.1016/j.ypmed.2008.07.006)
Gerd Marstedt, 27.8.09
EU-Studie zum Alkoholkonsum: Der Preis für alkoholische Getränke hat auch Einfluss auf die Konsummenge
 Alkohol ist nach Erkenntnissen der EU-Kommission nach Tabak und Bluthochdruck der dritte maßgebliche Risikofaktor für eine erhöhte Mortalität und Behinderungen unter der EU-Bevölkerung. Die Kosten des Alkoholmissbrauchs wurden 2003 auf rund 125 Milliarden Euro geschätzt, was 1,3% des EU-Bruttoinlandsprodukts entspricht. Gleichzeitig ist die Produktion und der Vertrieb alkoholischer Getränke aber ein wichtiger Wirtschaftszweig, der für Arbeitsplätze und Steuereinnahmen sorgt.
Alkohol ist nach Erkenntnissen der EU-Kommission nach Tabak und Bluthochdruck der dritte maßgebliche Risikofaktor für eine erhöhte Mortalität und Behinderungen unter der EU-Bevölkerung. Die Kosten des Alkoholmissbrauchs wurden 2003 auf rund 125 Milliarden Euro geschätzt, was 1,3% des EU-Bruttoinlandsprodukts entspricht. Gleichzeitig ist die Produktion und der Vertrieb alkoholischer Getränke aber ein wichtiger Wirtschaftszweig, der für Arbeitsplätze und Steuereinnahmen sorgt.
Die EU-Kommission wollte nun in einer EU-weiten Studie über die Erschwinglichkeit von Alkohol die potenziellen Wirkungen der leichten Finanzierbarkeit eines schädlichen Alkoholkonsums und die Steuerungsmöglichkeiten über die Preisgestaltung prüfen lassen.
Zu den zentralen Befunde der Studie, die nicht nur epidemiologisch von Interesse sind, sondern auch in präventiver Hinsicht überaus große Bedeutung haben gehören:
• In den meisten Ländern der EU sind alkoholische Getränke seit Mitte der 90er Jahre sehr viel billiger geworden bzw. in Relation zur Einkommensentwicklung deutlich günstiger zu erstehen, in einigen Ländern um über die Hälfte
• Es gibt eine negative Beziehung zwischen dem Preis des Alkohols und seinem Konsum und eine positive Beziehung zwischen Einkommen und Alkoholkonsum. In der Summe besteht ein enger Zusammenhang zwischen dem Ausmaß des Alkoholkonsums und der Erschwinglichkeit alkoholischer Getränke in Europa: Langfristig führt eine Erhöhung der Erschwinglichkeit um 1% zu einer Erhöhung des Konsums um 0,32%. Verschlechtert sich die Erschwinglichkeit um denselben Prozentbetrag, sinkt auch der Konsum um den genannten Wert.
• Es gibt weiterhin einen engen Zusammenhang zwischen Alkoholkonsum und verschiedenen Negativeffekten: Zahl der Verkehrsunfälle, Zahl der Verkehrstoten, Auftreten von Leberzirrhosen. Dabei führt ein erhöhter Alkoholkonsum zu einem nur zu einer geringfügig niedrigeren Erhöhung der schädlichen Folgen: Wenn der Pro-Kopf-Alkoholkonsum um 1% zunimmt, steigt innerhalb des Folgejahres die Anzahl der Verkehrstoten um 0,85%, der Verkehrsunfällen um 0,61% und die Neuerkrankungsrate wegen Leberzirrhose um 0,37%.
• Der grenzüberschreitende Einkauf von Alkoholika kann zu einer Erhöhung des Alkoholkonsums und entsprechenden Folgeschäden führen, wenn die Preisunterschiede zwischen den Ländern größer sind.
Trotz dieser zum Teil auch bereits in der Vergangenheit vermuteten und diskutierten unerwünschten Effekte wurde in der Mehrzahl der EU-Mitgliedsländer Alkohol-Preispolitik vorrangig aus fiskalpolitischer und selten aus Public Health-Sicht verstanden und betrieben. Anzeichen dafür sind die bereits genannte EU-weite Verbilligung von alkoholischen Getränken, die Duldung von Alkoholpreisen unterhalb der Kostendeckungsgrenze oder solche Vermarktungsmethoden wie "two for one" oder "happy hours". Einige Gegenaktivitäten wie etwa das deutsche "Apfelsaft-Gesetz", nach dem in Gaststätten mindestens ein alkoholfreies Getränk billiger sein muss als das billigste alkoholische Getränk oder das Verbot von Niedrigpreisangeboten in Belgien gehen in die richtige Richtung, sind aber eher Ausnahmen.
Ihre eigene und viele andere Untersuchungen belegen nach Ansicht der RAND-Forscher, "that the price and affordability of alcohol do impact on levels of harmful and hazardous alcohol consumption" ("dass Preis und Erschwinglichkeit von Alkohol das Ausmaß von schädlichem und gesundheitsgefährlich Alkoholkonsum mitbeeinflussen") Daher empfehlen sie den politisch Verantwortlichen, um alkoholassoziierte Schäden wirksam zu verringern, ohne wenn und aber solche Maßnahmen durchzuführen, die den Preis beeinflussen und Alkohol weniger erschwinglich machen.
Trotz der großen Bedeutung einer gezielten und EU-weiten Preispolitik weisen die RAND-Gutachter darauf hin, dass schädlicher und gefährlicher Alkoholkonsum ein multifaktorielles Problem ist und eine Gegenstrategie einen Policy-Mix mehrerer Aspekte und evidenzbasierter Maßnahmearten sein muss. Dazu gehört, die Dichte der Verkaufsstellen von Alkohol zu verringern, das Mindestalter für den Einkauf von alkoholischen Getränken spürbar zu erhöhen und Maßnahmen gegen Alkohol im Straßenverkehr durchzuführen oder gegebenenfalls zu verschärfen.
Die Studie wurde im Auftrag der EU-Kommission von dem privaten Think-Tank RAND Europe durchgeführt. Die Studie basiert auf vier Informationsquellen: Eine Analyse der wissenschaftlichen Literatur, eine Sekundäranalyse quantitativer Daten über die Erreichbarkeit von Alkohol, Besteuerung, Konsum und unerwünschte Folgen, eine Online-Umfrage bei 293 Mitgliedern des "European Alcohol and Health Forum" und des "Committee on National Alcohol Policy and Action", und eine Diskussion der gewonnenen Ergebnisse in einem Experten-Workshop.
Quelle: Lila Rabinovich, Philipp-Bastian Brutscher, Han de Vries, Jan Tiessen, Jack Clift, Anais Reding: The affordability of alcoholic beverages in the European Union Understanding the link between alcohol affordability, consumption and harms, Prepared for the European Commission DG SANCO EUROPE, European Commission, 2009, PDF 1,9 MB, 145 Seiten
PDF-Datei verfügbar über die Download-Seite
PDF-Datei, direkter Link
Bernard Braun, 25.7.09
Elterneinfluss auf das Essverhalten ihrer Kinder ist kleiner als erwartet
 Die populäre und auch einigen präventiven Interventionskonzepten zugrundeliegende Annahme, ein "gesundes" Essverhalten hinge vom Elternhaus ab und beginne da und elterliches "Diät"verhalten hülfe den Kindern, ihre Ernährungsüberzeugungen oder -verhaltensweisen zu gewinnen, sollte nach den Ergebnissen einer Studie von ForscherInnen der Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health gründlich überdacht werden. Sie fanden nämlich in der ersten großen und repräsentativen Studie in den USA, dass schon die Ähnlichkeit der Essgewohnheiten von Eltern und Kindern derselben Familie gering ist und damit auch allein von den Eltern her kein langfristiger "gesunder" Effekt zu erwarten ist.
Die populäre und auch einigen präventiven Interventionskonzepten zugrundeliegende Annahme, ein "gesundes" Essverhalten hinge vom Elternhaus ab und beginne da und elterliches "Diät"verhalten hülfe den Kindern, ihre Ernährungsüberzeugungen oder -verhaltensweisen zu gewinnen, sollte nach den Ergebnissen einer Studie von ForscherInnen der Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health gründlich überdacht werden. Sie fanden nämlich in der ersten großen und repräsentativen Studie in den USA, dass schon die Ähnlichkeit der Essgewohnheiten von Eltern und Kindern derselben Familie gering ist und damit auch allein von den Eltern her kein langfristiger "gesunder" Effekt zu erwarten ist.
Die WissenschaftlerInnen untersuchten mit Hilfe der für die USA repräsentativen Daten des "Continuing Survey of Food Intake by Individuals" des "US Department of Agriculture (USDA)" aus den Jahren 1994-96 das gesunde Essverhalten von Eltern (1.061 Väter und 1.230 Mütter) im Alter von 20 bis 65 Jahren und das ihrer Kinder (1.370 Söhne und 1.322 Töchter) im Alter von 2 bis 18 Jahren. In dem Survey wurde von 16.103 Personen im Alter von 0-90 Jahren das Essverhalten an zwei kompletten Tagen gemessen, die 3 bis 10 Tage auseinanderlagen. Nach einer vielseitigen Adjustierung der Probanden wurden die Eltern-Kind- Korrelationen zahlreicher Komponenten des Essverhaltens mit dem neuen "USDA 2005 Healthy Eating Index score (HEIn)" gemessen.
Die wichtigsten Ergebnisse lauten:
• Für die meisten Essmaßstäbe war die Eltern-Kinder-Korrelation schwach oder mäßig (0,2-0,33). Die Enge der Beziehung variierte aber auf niedrigem Niveau zwischen einzelnen Lebensmitteln.
• Die Korrelationen beim Essverhalten waren zwischen Müttern und ihren Töchtern und auch Söhnen höher als die zwischen Vätern und ihren Kindern.
• Hispanische und andere nicht-weißen Familien hatten generell und bei Softdrinks eine größere Ähnlichkeiten der Ernährungsgewohnheiten als Weiße und Afro-Amerikaner.
• Je älter die Kinder waren desto höher war auf dem insgesamt nicht hohem Niveau die Ähnlichkeit ihres Essverhaltens mit dem ihrer Eltern. Umgekehrt war aber unter dem Fünftel der Befragten, welches die höchsten HEIn-Werte hatten, der Anteil älterer Kinder eher gering.
• Der Einfluss des Familieneinkommens und des Bildungsniveaus der Eltern hatte nur einen kleinen Einfluss auf Eltern-Kind-Ähnlichkeiten.
• Andere Faktoren als das elterliche Essverhalten scheinen bei der Herausbildung eines ausgewogenen Essverhaltens eine wichtige Rolle zu spielen.
Zum Aufsatz "Parent-child dietary intake resemblance in the United States: Evidence from a large representative survey" von May A. Beydoun und Youfa Wang, der 2009 in der Zeitschrift "Social Science & Medicine" (Volume 68, Issue 12, June 2009, Pages 2137-2144) erschienen ist, gibt es kostenlos lediglich das Abstract.
Bernard Braun, 14.7.09
Anleitungen zur Nikotin-Entwöhnung durch niedergelassene Ärzte: Erfolgreich und kostensparend
 In der Praxis niedergelassener Ärzte in Deutschland spielen Gesundheitsförderung und Primärprävention bislang nur eine sehr untergeordnete Rolle. In Umfragen benennen Ärzte meist eine mangelhafte Vergütung und zu wenig verfügbare Zeit als Hauptgründe für ihre auch aus eigener Sicht unzureichende Wahrnehmung präventiver Aufgaben. Eine in Deutschland durchgeführte Studie, die in der Zeitschrift "Archives of Internal Medicine" veröffentlicht wurde, hat nun gezeigt, das ein ärztlicher Einsatz zur Raucherentwöhnung von Patienten überaus erfolgreich und zugleich kostensparend sein kann, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden. Erprobt wurden in mehreren Untersuchungsgruppen verschiedene Vorgehensweisen und Rahmenbedingungen, wobei das erfolgreichste Konzept eine Erfolgsquote von 15% Nichtrauchern nach einem Jahr aufwies - fünfmal so viel wie in einer Kontrollgruppe.
In der Praxis niedergelassener Ärzte in Deutschland spielen Gesundheitsförderung und Primärprävention bislang nur eine sehr untergeordnete Rolle. In Umfragen benennen Ärzte meist eine mangelhafte Vergütung und zu wenig verfügbare Zeit als Hauptgründe für ihre auch aus eigener Sicht unzureichende Wahrnehmung präventiver Aufgaben. Eine in Deutschland durchgeführte Studie, die in der Zeitschrift "Archives of Internal Medicine" veröffentlicht wurde, hat nun gezeigt, das ein ärztlicher Einsatz zur Raucherentwöhnung von Patienten überaus erfolgreich und zugleich kostensparend sein kann, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden. Erprobt wurden in mehreren Untersuchungsgruppen verschiedene Vorgehensweisen und Rahmenbedingungen, wobei das erfolgreichste Konzept eine Erfolgsquote von 15% Nichtrauchern nach einem Jahr aufwies - fünfmal so viel wie in einer Kontrollgruppe.
An der Studie beteiligt waren 577 Patienten im Alter von 36-75 Jahren, die täglich 10 oder mehr 10 Zigaretten rauchten und insgesamt 94 niedergelassene Allgemeinärzte aus einer Region im Südwesten der Bundesrepublik. Alle teilnehmenden Ärzte erhielten eine kostenlose zweistündige Unterweisung in neueren Methoden der Nikotinentwöhnung. Die Patienten wurden nach dem Zufallsprinzip einer von vier Gruppen zugeordnet, innerhalb derer dann verschiedene Vorgehensweisen zur Raucherentwöhnung getestet wurden.
• Gruppe 1: War eine Kontrollgruppe
• Gruppe 2: Ärzte bekamen für jeden Patienten, die nach einem Jahr erfolgreich mit dem Rauchen aufgehört hatte, ein Zusatzhonorar von 130 Euro
• Gruppe 3: Ärzte konnten ihren Patienten kostenlos Medikamente zur Nikotin-Ersatztherapie verschreiben (bis zur Höhe von 130 Euro), also Arzneimittel, welche die Suchterscheinungen in der Anfangszeit mildern (Buproprion) oder Nikotin-Kaugummi oder Nikotinpflaster
• Gruppe 4: Hier wurde eine Kombination erprobt, in der das ärztliche Zusatzhonorar bei Erfolg bezahlt wurde und auch die für Patienten kostenlose Nikotin-Ersatztherapie.
In der Auswertung zeigte sich dann nach einem Jahr, dass weder die ärztliche Unterweisung allein noch das Erfolgshonorar die Quoten für einen erfolgreichen Nikotinverzicht der Patienten deutlich beeinflussten. Die durch Befragung und medizinische Analyse ermittelten Nichtraucherquoten betrugen nach einem Jahr: In Gruppe 1 (Kontrollgruppe) 2,7%, in Gruppe 2 (ärztliches Erfolgshonorar) 3,5%, in Gruppe 3 (kostenlose Nikotinersatztherapie) 12,1%, in Gruppe 4 (Arzthonorar und Ersatztherapie) 14,6%. Das heißt: Wenn Patienten kostenlos Nikotinersatzstoffe bekommen, ist die Erfolgsquote bereits recht hoch (etwa jeder achte schafft es) und Honorare für Ärzte erhöhen diesen Wert nur noch geringfügig.
Die Wissenschaftler untersuchten auch detailliert die Kosten für die verschiedenen Vorgehensweisen, worunter verschiedene Ausgaben fallen: Honorar für die Unterweisung der Patienten, Kosten für die ärztliche Fortbildung, Medikamente, ärztliches Erfolgshonorar. Um einen Patienten zusätzlich zum Nichtraucher zu machen, so rechnete man in der Studie aus, müsste man im Vergleich zur Kontrollgruppe (oder allgemeiner: im Vergleich zur gängigen ärztlichen Praxis) bei der Vorgehensweise in der 4.Gruppe 92,12 Euro, bei der in der 3.Gruppe jeweils 82,82 Euro ausgeben.
Diese Kosten, so stellen die Forscher des Zentralinstituts für Seelische Gesundheit in Mannheim fest, sind im Vergleich zu den durch das Rauchen verursachten Folgekosten ganz zweifellos eher "Peanuts". Von daher ist nicht erkennbar, was gegen eine Übernahme des wissenschaftlichen Untersuchungskonzepts - mit ärztlicher Unterweisung und Kostenübernahme der Nikotinersatztherapie - durch deutsche Krankenkassen sprechen würde. Da für die Studie nicht nur Teilnehmer zugelassen wurden, die schon seit längerem einen sehr festen Vorsatz zum Nikotinverzicht hatten, könnten diese Durchschnittskosten weiter gesenkt werden, wenn Krankenkassen und Ärzte gezielt Versicherte ansprechen, die bereits eine solche Motivation zur Nikotinentwöhnung aufweisen. Denn viele Studien haben gezeigt, dass die Erfolgsquoten in diesen Gruppen noch einmal deutlich höher ausfallen.
Kostenloses Abstract: Hans Joachim Salize et al: Cost-effective Primary Care-Based Strategies to Improve Smoking Cessation. More Value for Money (Arch Intern Med. 2009;169(3):230-235)
Gerd Marstedt, 10.7.09
Vom Elend der Versuche, sich "am Riemen zu reißen" und mit dem Rauchen aufzuhören: Sucht - und kein Life-Style
 Wer als Raucher, Nie- bzw. Ex-Raucher meint oder als Tabakproduzent verbreitet, Rauchen sei ein selbstbestimmtes Lifestyle-Phänomen und keine Suchterkrankung, irrt bzw. untertreibt das Risiko von Rauchen beträchtlich. Wie fremdbestimmt Rauchen ist und wie schwer es ist, ohne fremde Hilfe damit aufzuhören, zeigen die im "Deutschen Ärzteblatt" vom 3. Juli 2009 veröffentlichten Ergebnisse der bevölkerungsbezogenen ESTHER-Studie (Epidemiologische Studie zu Chancen der Verhütung, Früherkennung und optimierten Therapie chronischer Erkrankungen in der älteren Bevölkerung) im Saarland, in der von Mitte 2000 bis Ende 2002 knapp 10.000 Menschen im Alter von 50 bis 74 Jahren im Rahmen eines "Gesundheits-Checkups" rekrutiert und umfangreich nach ihren Gesundheitsbasiswerten, ihrem Gesundheitsverhalten und ihrer Krankheitsvorgeschichte befragt wurden. In dieser Gruppe waren 1.528 Personen, die bei Studienbeginn Raucher waren, 4.923 waren Niemals-Raucher, 3.130 frühere Raucher und bei 248 gab es keine genauen Angaben zum Rauchverhalten.
Wer als Raucher, Nie- bzw. Ex-Raucher meint oder als Tabakproduzent verbreitet, Rauchen sei ein selbstbestimmtes Lifestyle-Phänomen und keine Suchterkrankung, irrt bzw. untertreibt das Risiko von Rauchen beträchtlich. Wie fremdbestimmt Rauchen ist und wie schwer es ist, ohne fremde Hilfe damit aufzuhören, zeigen die im "Deutschen Ärzteblatt" vom 3. Juli 2009 veröffentlichten Ergebnisse der bevölkerungsbezogenen ESTHER-Studie (Epidemiologische Studie zu Chancen der Verhütung, Früherkennung und optimierten Therapie chronischer Erkrankungen in der älteren Bevölkerung) im Saarland, in der von Mitte 2000 bis Ende 2002 knapp 10.000 Menschen im Alter von 50 bis 74 Jahren im Rahmen eines "Gesundheits-Checkups" rekrutiert und umfangreich nach ihren Gesundheitsbasiswerten, ihrem Gesundheitsverhalten und ihrer Krankheitsvorgeschichte befragt wurden. In dieser Gruppe waren 1.528 Personen, die bei Studienbeginn Raucher waren, 4.923 waren Niemals-Raucher, 3.130 frühere Raucher und bei 248 gab es keine genauen Angaben zum Rauchverhalten.
Die 17% umfassende Raucherkohorte wurde im Studienverlauf ausführlich über ihr Rauchverhalten und vor allem über die Anzahl und den Erfolg ihrer Aufhörversuche und die dazu mobilisierten Motive befragt. Das Verhalten der Raucher wurde ferner auf dem Hintergrund vorbestehender Erkrankungen differenziert bestimmt.
Die Ergebnisse sahen folgendermaßen aus:
• Von den Rauchern berichteten 76%, also die weit überwiegende Mehrheit der älteren Raucher, von mindestens einem Rauchstoppversuch in der Vergangenheit. Darunter waren auch 792 Personen (52%), die mehrfach versucht hatten aufzuhören, und zwar in allen Altersgruppen in etwa gleich viel. Frauen waren im höheren Alter tendenziell weniger bereit, das Rauchen aufzugeben.
• Bei Personen mit einer vorher bestehenden, d.h. bekannten Herz-Kreislauferkrankung erreichte der Anteil der Aufhörwilligen 89%. Dass das Aufhören trotz des Problemdrucks einer schweren Erkrankung oft nicht klappte, "lässt (die AutorInnen) jede Behauptung, Rauchen sei vorwiegend ein Lifestyle-Phänomen, absurd erscheinen."
• Allgemeiner gefragt, zeigten sich nur 11% der Raucher mit ihrem Rauchverhalten zufrieden, 30% gaben an, weniger rauchen zu wollen und 59% erklärten, sie würden gerne ganz aufhören.
Aussagekräftige Studien haben gezeigt, dass einfache strukturelle Maßnahme wie z. B. die Erstattung der Kosten einer wirksamen medikamentösen Unterstützung der Entwöhnung durch Nikotinersatzpräparate die "spontanen" Aufhörquoten um das Vierfache steigern können. Daher plädieren die ForscherInnen für eine entsprechende Finanzierung aus Krankenkassenmitteln und halten die Annahme, Rauchen sei Lifestyle und doch jederzeit mit etwas Wille aufhörbar, "für zynisch".
Andere Studien haben außerdem gezeigt, dass nur etwa 5% der RaucherInnen, die ohne weitere und/oder fremde Hilfe versuchen aufzuhören, nach einem Jahr noch tabakabstinent leben. Auch vor diesem Hintergrund stellen die AutorInnen zur Diskussion, ob nicht Ärzte stärker in eine Behandlung der Tabakabhängigkeit mit Krankheitswert von Hochrisikopatienten einbezogen werden sollen und das gesetzliche Gesundheitssystem die Mittel für möglichst wirksame Aufhörversuche auch beitragsfinanziert zur Verfügung stellen sollte.
Zu den selber eingeräumten Grenzen z.B. der Aussagefähigkeit und Verallgemeinerbarkeit über die Grenzen des Saarlands hinaus (wahrscheinlich kein wirkliches Problem), wäre das Fehlen genauer merkmalsdifferenzierter Angaben zur Häufigkeit erfolgreicher Aufhörversuche hinzuzufügen.
Der 5-seitige Aufsatz "Aufhörversuche und -wille bei älteren Rauchern: Epidemiologische Beiträge zur Diskussion um "Lifestyle" versus "Sucht"" von Breitling, Lutz Ph.; Rothenbacher, Dietrich; Stegmaier, Christa; Raum, Elke und Brenner, Hermann ist im "Deutschen Ärzteblatt" (2009; Jg. 106 [ Heft 27]: 451-5) erschienen und kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 7.7.09
Der Tabak-Atlas Deutschland informiert über (fast) alles, was mit Tabak und dem Rauchen zusammenhängt
 Seit 2002 informiert die erste Ausgabe des "Tobacco Atlas" in englischer Sprache und als PDF kostenlos im Internet angeboten über die mit dem Rauchen verbundenen Gesundheitsrisiken, aber auch über (fast) alles, was mit dem Tabak zusammenhängt: Tabakanbau und Zigarettenherstellung, Marketing der Tabakindustrie und Kulturgeschichte des Rauchens, erfolgreiche Strategien zum Nikotinverzicht und internationale Maßnahmen zum Nichtraucherschutz. Jetzt hat das Deutsche Krebsforschungszentrum Heidelberg in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Gesundheit und dem Robert-Koch-Institut Berlin den "Tabakatlas Deutschland 2009" herausgegeben und sich dabei sehr eng das englischsprachige Vorbild angelehnt, das von der englischen Wissenschaftlerin Judith Longstaff Mackay entwickelt worden war.
Seit 2002 informiert die erste Ausgabe des "Tobacco Atlas" in englischer Sprache und als PDF kostenlos im Internet angeboten über die mit dem Rauchen verbundenen Gesundheitsrisiken, aber auch über (fast) alles, was mit dem Tabak zusammenhängt: Tabakanbau und Zigarettenherstellung, Marketing der Tabakindustrie und Kulturgeschichte des Rauchens, erfolgreiche Strategien zum Nikotinverzicht und internationale Maßnahmen zum Nichtraucherschutz. Jetzt hat das Deutsche Krebsforschungszentrum Heidelberg in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Gesundheit und dem Robert-Koch-Institut Berlin den "Tabakatlas Deutschland 2009" herausgegeben und sich dabei sehr eng das englischsprachige Vorbild angelehnt, das von der englischen Wissenschaftlerin Judith Longstaff Mackay entwickelt worden war.
Auf 130 Seiten informiert jetzt der Atlas (PDF-Datei mit 26,6 MB) auch in deutscher Sprache über eine Vielzahl von Themen, wobei zwar Gesundheitsrisiken und Todesfälle durch das Rauchen eine große Rolle spielen, aber ergänzt werden um andere wissenswerte Informationen. In der Rubrik "Tabakprodukte" etwa wird auch Kautabak vorgestellt, unter "Zusatzstoffe" erfährt man, dass Tabakwarenhersteller ihren Produkten bis zu 600 Zusatzstoffe hinzufügen, die über 10 % des Gesamtgewichts eines Produktes ausmachen, und dass Menthol, Zucker, Lakrize und Kakao zu den am häufigsten verwendeten Zusatzstoffen gehören. Natürlich werden auch ausgewählte gesundheitsgefährdende Substanzen im Tabakrauch vorgestellt und beschrieben, von Ammoniak und Arsen bis hin zu Styrol und Toluol.
Ein umfangreiches Kapitel "Tabakkonsum und gesundheitliche Folgen" informiert über physiologische Wirkungen des Rauchens und Tabakabhängigkeit, über Entwicklungstrends des Tabakkonsums und durch das Rauchen bedingte Todesfälle, wie unter anderem Lungenkrebs und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Im Schluss-Kapitel über die "Tabakkontrollpolitik" erfährt man einiges über Versuche zur Eindämmung der Einflussnahme der Tabakindustrie, über Tabaksteuererhöhungen und Tabakwerbeverbote.
Natürlich werden im Tabak-Atlas auch noch einmal Ergebnisse epidemiologischer Studien zum Rauchen vorgestellt. So erfährt man, dass in Norddeutschland mehr geraucht wird als im Süden und dass überdurchschnittlich hohe Raucheranteile in den Stadtstaaten Berlin und Bremen sowie in Mecklenburg-Vorpommern zu finden sind. Warum dies so ist, bleibt leider unbeantwortet - ebenso wie die dargestellten Abhängigkeit der Raucherquoten von der sozialen Schichtzugehörigkeit, also dem Bildungs- und Einkommensniveau. Auch bei der Darstellung unterschiedlicher Raucherquoten in verschiedenen Berufsgruppen bleibt die Information leider anekdotisch und oberflächlich. Die im Vorwort geäußerte Absicht, Daten zum Tabakproblem, die bislang für Nichtwissenschaftler schwer zugänglich sind, nun einem breiten Publikum vorzulegen, ist löblich. Aber dass ohne jegliche Erklärung von Hintergründen epidemiologische Daten in Diagrammform präsentiert werden, muss kritisch angemerkt werden. So gibt es keinen einzigen erklärenden Satz, warum nun - um nur ein einziges Beispiel zu nennen - Gebäudereiniger und Raumpfleger, Maler und Lackierer Berufsgruppen mit den höchsten Raucheranteilen (59% bzw. 56%) bei Männern sind.
• Tabakatlas Deutschland, Pressemitteilungen und Download: WHO-Kollaborationszentrum für Tabakkontrolle, Tabakatlas Deutschland 2009
• Tobacco Atlas, Download von der Website der American Cancer Society: Dr. Judith Mackay, Dr. Michael Eriksen, Dr. Omar Shafey: The Tobacco Atlas, 2nd Edition
Gerd Marstedt, 3.7.09
Programme zur Raucherentwöhnung für Jugendliche: Literaturstudie gibt Hinweise zur Optimierung der Prävention
 Die Raucherquote bei männlichen und weiblichen Jugendlichen und jungen Erwachsenen hat sich in Deutschland seit einigen Jahren auf 15% bzw. 16% verringert. Dies ist aber immer noch eine Quote, die verbesserungswürdig ist. Hinweise, wie dies am effektivsten zu erreichen ist, liefert jetzt eine in der Zeitschrift "Tobacco Induced Diseases" veröffentlichte Meta-Analyse. Dort werden die Ergebnisse aus insgesamt 64 internationalen Studien bilanziert, die im Zeitraum Januar 2000 bis November 2007 veröffentlicht worden sind.
Die Raucherquote bei männlichen und weiblichen Jugendlichen und jungen Erwachsenen hat sich in Deutschland seit einigen Jahren auf 15% bzw. 16% verringert. Dies ist aber immer noch eine Quote, die verbesserungswürdig ist. Hinweise, wie dies am effektivsten zu erreichen ist, liefert jetzt eine in der Zeitschrift "Tobacco Induced Diseases" veröffentlichte Meta-Analyse. Dort werden die Ergebnisse aus insgesamt 64 internationalen Studien bilanziert, die im Zeitraum Januar 2000 bis November 2007 veröffentlicht worden sind.
Berücksichtigt wurden nur Untersuchungen, die sich mit verschiedenen Strategien zur Raucherentwöhnung bei Jugendlichen beschäftigt haben und es wurden nur Studien einbezogen, in denen neben der Untersuchungsgruppe auch eine Kontrollgruppe einbezogen wurde. Bei dieser Kontrollgruppe, in der die jeweilige Strategie zur Raucherentwöhnung nicht zum Einsatz kam, wurde jedoch gleichfalls und über denselben Zeitraum kontrolliert, wie viele Jugendliche mit dem Rauchen aufgehört hatten.
Die Wissenschaftler vergleichen in ihrer Meta-Analyse unterschiedliche Einflussfaktoren und deren Effektivität. Dazu verwenden sie eine Maßzahl, welche die Effekt-Differenz (in Prozentpunkten) zwischen Jugendlichen in der Untersuchungsgruppe und Jugendlichen in der Kontrollgruppe angibt, die jeweils erfolgreich mit dem Rauchen aufgehört haben. Ein Effekt-Wert von "10" bedeutet, dass in der Untersuchungsgruppe zum Beispiel 40 Prozent mit dem Rauchen aufhörten, während dies in der Kontrollgruppe nur 30 Prozent waren. Die Wissenschaftler fassen die Bilanzierung der Studien dann folgendermaßen zusammen:
• Zunächst sollten Nichtraucher-Programme in einem für die Jugendlichen geeigneten Setting durchgeführt werden, in einer Einrichtung, die sie ohnehin des öfteren aufsuchen. Dies kann zum Beispiel die Schule oder ein Sportverein sein. Sinnvoll erscheint dies, da man bei Jugendlichen nicht davon ausgehen kann, dass sie Termine in fremden Einrichtungen ohne weiteres einhalten.
• Das Programm sollte dann 5-8 Sitzungen umfassen. Dies ist nach den vorliegenden empirischen Befunden die effektivste Anzahl, mehr Sitzungen bringen keine zusätzlichen Effektivitätsgewinne.
• Das Programm sollte den Jugendlichen soweit als möglich auch Spaß machen, d.h. auch Spiele, kurze Theaterstücke oder Rollenspiele für die Teilnehmer beinhalten.
• Es sollten kognitiv-verhaltensorientierte Elemente berücksichtigt werden, ebenso Bezüge zu Motivations-Theorien und sozialen Einflussfaktoren. So sollten auch Veränderungen bewusst gemacht werden, die sich einerseits durch längeres Rauchen einstellen (Verstärkung von Stress, Verschlechterung der Stimmung) und andererseits die Veränderungen, die sich nach dem Nikotinverzicht einstellen.
• Nützlich sind Hinweise darüber, wie soziale Situationen vermieden oder entschärft werden können, in denen man Stress erlebt. Hier sollten dann Alternativen aufgezeigt werden zur Zigarette als "Entspannungsmethode".
• Obwohl noch keine völlig überzeugende Evidenz vorliegt, scheint es doch so zu sein, dass die gleichzeitige Durchführung unterschiedlicher Programm-Elemente am erfolgversprechendsten ist: zum Beispiel Unterricht in Klassenräumen, unterstützt durch Computer-Programme, Elterngruppen, Informationskampagnen in Medien.
Inwieweit ein Einsatz von Medien die Erfolgsquote erhöhen kann, ist bislang noch unklar. Erprobt wurden bereits Telefonanrufe oder Emails zur Erinnerung oder auch Stärkung der Motivation, Einrichtung von Internet-Seiten mit Möglichkeiten zur Diskussion. Die Ergebnisse dazu sind jedoch widersprüchlich.
PDF mit Volltext der Studie: Steve Sussman, Ping Sun: Youth tobacco use cessation: 2008 update (Tobacco Induced Diseases 2009, 5:3 doi:10.1186/1617-9625-5-3)
Gerd Marstedt, 30.6.09
Sport und körperliche Aktivität bringt auch für Ältere und frühere "Couchpotatoes" noch gesundheitliche Vorteile
 Die Annahme, körperlich-sportliche Aktivitäten im Alter hätten insbesondere für Personen, die dies schon mehrere Jahre lang vernachlässigen, keinen gesundheitlichen Nutzen mehr, hat sich gerade in einer großen Kohortenstudie mit 2.205 Männern in Schweden als unzutreffend erwiesen. Die Studienteilnehmer waren zu Beginn der Studie 50 Jahre alt gewesen. Von ihnen wurde in regelmäßigen Abständen bis zum maximalen Alter von 82 Jahren erhoben, ob und wie intensiv sie körperlich aktiv waren und wie sich dies auf die Sterblichkeitsquoten auswirkte.
Die Annahme, körperlich-sportliche Aktivitäten im Alter hätten insbesondere für Personen, die dies schon mehrere Jahre lang vernachlässigen, keinen gesundheitlichen Nutzen mehr, hat sich gerade in einer großen Kohortenstudie mit 2.205 Männern in Schweden als unzutreffend erwiesen. Die Studienteilnehmer waren zu Beginn der Studie 50 Jahre alt gewesen. Von ihnen wurde in regelmäßigen Abständen bis zum maximalen Alter von 82 Jahren erhoben, ob und wie intensiv sie körperlich aktiv waren und wie sich dies auf die Sterblichkeitsquoten auswirkte.
Das Ergebnis war eindeutig: Männer, die ihr gesamtes Leben wenig körperlich aktiv waren, hatten eine hohe Sterberate von 27,1 Fällen pro 1.000 Personenjahre (PJ). Bei insgesamt mittlerer körperlicher Aktivität waren es noch 23,6 Tote pro 1.000 PJ und bei denjenigen, die schon immer intensiv Sport betrieben hatten, waren es 18,4 Tote pro 1.000 PJ. Die Sterberate liegt bei Personen mit intensiver körperlich-sportlicher Betätigung um 32 % unter der von Personen mit niedriger körperlicher Aktivität und um 22 % unter der von Personen mit mittlerer körperlicher Aktivität.
Welchen Nutzen hat nun aber ein 50-jähriger Mann mit bislang geringer körperlicher Aktivität wenn er nach Lektüre dieser Zahlen intensiv mit Bewegungsübungen beginnen will? Wenn man einen etwas längeren Atem hat, lohnt sich der Aufwand nach den Ergebnissen der schwedischen Studie: Das Sterberisiko der Männer, die sich ab dem Alter von 50 Jahren intensiver bewegen, verbessert sich im Vergleich mit ihren Altersgenossen, die schon immer körperlich aktiv waren, in den ersten 5 Jahren relativ wenig. Ihre adjustierte Risikorate ist mit 2,64 immer noch kräftig erhöht. Die Forscher vermuten aber, dass sich zwar nicht die Überlebensquote, zumindest aber die subjektive Lebensqualität dieser Männer verbessert.
Halten die "Spätberufenen" ihre sportlichen Aktivitäten aber 10 Jahre durch, liegt auch ihre adjustierte Sterblichkeitsrate mit 1,1 fast auf dem Niveau der schon in jungen Jahren Aktiven. Die schwedischen Forscher vergleichen den mit einem späten Beginn körperlicher Aktivität erzielbaren Lebensgewinn mit jenem, der nachweislich mit der Beendigung des Rauchens verbunden ist.
Ob diese Effekte auch für Frauen gelten, lässt sich dieser Studie leider nicht entnehmen. Ein vom Forscherteam selbst angesprochener Mangel ist die Messung der körperlichen Aktivität durch einen Fragebogen. Damit sind Fehleinschätzungen nicht auszuschließen. Allerdings sind auch objektive Verfahren (Messung durch Beschleunigungssensoren oder Pedometer) fehleranfällig, wie eine Studie unlängst gezeigt hat: Etwa, wenn Studienteilnehmer vergessen oder keine Lust haben, die Messgeräte anzulegen.
Eine komplette PDF-Fassung des achtseitigen Aufsatzes von Liisa Byberg, Hakan Melhus, Rolf Gedeborg, Johan Sundstrom, Anders Ahlbom, Bjorn Zethelius, Lars G Berglund, Alicja Wolk und Karl Michaelsson aus dem "British Medical Journal (BMJ)" (BMJ 2009;338:b688) ist kostenlos erhältlich: Total mortality after changes in leisure time physical activity in 50 year old men: 35 year follow-up of population based cohort
Bernard Braun, 20.6.09
Meta-Analyse zeigt: Mehr Sport in der Schule ist kein Garant zur Vermeidung von Übergewicht bei Kindern
 Die Forderung "Mehr Schulsport!" wird bisweilen als Königsweg zur Lösung der Übergewichts-Problematik wahrgenommen oder als Strategie, um Übergewicht und Adipositas zumindest bei Kindern und Jugendlichen zu vermeiden. Eine Metaanalyse von 18 methodisch fundierten Studien mit über 18 Tausend Schülerinnen und Schülern aus Grundschulen hat nun allerdings gezeigt, dass bislang durchgeführte Interventionen keinen Einfluss auf das Problem Übergewicht haben. Die Verfasser der Metaanalyse, die jetzt in der Zeitschrift "CMAJ Canadian Medical Association Journal" veröffentlicht wurde, empfehlen gleichwohl die Intensivierung des Schulsports, weil dies andere Positiveffekte bewirkt. Übrig bleibt allerdings auch die Einsicht, dass es offensichtlich kein Patentrezept und keine einfache Strategie zur Lösung der Übergewichts-Probleme gibt - auch nicht bei Kindern und Jugendlichen.
Die Forderung "Mehr Schulsport!" wird bisweilen als Königsweg zur Lösung der Übergewichts-Problematik wahrgenommen oder als Strategie, um Übergewicht und Adipositas zumindest bei Kindern und Jugendlichen zu vermeiden. Eine Metaanalyse von 18 methodisch fundierten Studien mit über 18 Tausend Schülerinnen und Schülern aus Grundschulen hat nun allerdings gezeigt, dass bislang durchgeführte Interventionen keinen Einfluss auf das Problem Übergewicht haben. Die Verfasser der Metaanalyse, die jetzt in der Zeitschrift "CMAJ Canadian Medical Association Journal" veröffentlicht wurde, empfehlen gleichwohl die Intensivierung des Schulsports, weil dies andere Positiveffekte bewirkt. Übrig bleibt allerdings auch die Einsicht, dass es offensichtlich kein Patentrezept und keine einfache Strategie zur Lösung der Übergewichts-Probleme gibt - auch nicht bei Kindern und Jugendlichen.
Die kanadischen Wissenschaftler bilanzierten in ihrer Meta-Analyse noch einmal alle schon veröffentlichten Studien, die in Grundschulen den Effekt von mehr körperlicher Bewegung auf den Body Mass Index (BMI) überprüft hatten. Einbezogen wurden überwiegend randomisierte Kontrollstudien, also Studien mit einer Interventions- und einer Kontrollgruppe mit zufälliger Aufteilung der Schüler. An diesen Studien beteiligt waren 18.141 Schülerinnen und Schüler, überwiegend aus der 3. bis 6.Klasse.
Die Interventionen waren unterschiedlicher Natur, gemeinsam war ihnen, dass Interventionen zur Erhöhung körperlicher Bewegung während der Schulstunden stattfanden. In einigen wurde die Intensität des Sports erhöht, in anderen die Zeitdauer bzw. Zahl der Schulstunden, einige erprobten neue Übungsformen. Als abhängige Variable wurde in allen Studien die Veränderung des Body Mass Index erfasst, darüber hinaus aber auch noch unterschiedliche andere Indikatoren (wie zum Beispiel Körperfett, Hüftumfang, Hüfte-Taille-Proportion).
Die berücksichtigten Studien dauerten mindestens 6 Monate, teilweise wurden die Effekte auch noch nach zwei Jahren geprüft. Als Ergebnis zeigte sich jedoch, dass in keiner einzigen Studie ein statistisch signifikanter Einfluss auf das Körpergewicht und den BMI zu finden war. Dasselbe galt auch für andere Übergewichts-Indikatoren. Die Wissenschaftler diskutieren zwei Möglichkeiten für diesen negativen Befund: Zum einen sei denkbar, dass das Ausmaß körperlicher Bewegung zu gering gewesen sei, um einen nachhaltigen Effekt zu bewirken. Zum anderen halten sie es auch für möglich, dass - so wie in einer unlängst veröffentlichten Studie angedeutet - eine Umstellung der Ernährung möglicherweise relevanter sei als die Erhöhung körperlicher Bewegung.
Studie im Volltext: Kevin C. Harris et al: Effect of school-based physical activ-ity interventions on body mass index in children: a meta-analysis (CMAJ 2009;180 719-726)
In einer Metaanalyse von Fogelholm/Kukkonen-Harju, in der 46 Studien ausgewertet wurden, die den Zusammenhang von körperlicher Bewegung und Gewichtsveränderung bzw. erneute Gewichtszunahme nach früherer Gewichtsabnahme untersucht hatten, war bereits deutlich geworden: Erst eine Erhöhung des Energieverbrauchs um ca. 1500-2000 kcal pro Woche bewirkt, dass Teilnehmer an Interventionen ihre Gewichtsabnahme über einen längeren Zeitraum beibehalten können. Dies bedeutet dann jedoch auch, dass vermutlich bei einem sehr großen Teil von Gesundheitsförderungs-Maßnahmen zwar signifikante Verhaltensänderungen erreicht wurden, nicht aber der für den Body Mass Index kritische Schwellenwert. vgl. Fogelholm M., Kukkonen-Harjula, K.: Does physical activity prevent weight gain - a systematic review The International Association for the Study of Obesity. Obesity reviews (2000) 1, 95-111
Dass die Ernährung für das Problem Übergewicht möglicherweise wichtiger ist als körperliche Bewegung, hat unlängst eine Studie angedeutet, wenngleich viele Fragen noch offen geblieben sind (vgl. Vermeidung und Abbau von Übergewicht: Ist die Ernährung weitaus wichtiger als körperliche Bewegung?)
Gerd Marstedt, 22.4.09
"Gesundes-Herz-Programme" zur Prävention haben für die allgemeine Bevölkerung deutlich weniger Nutzen als erwartet
 Angesichts der quantitativen und qualitativen Bedeutung von Herzerkrankungen für die Lebensqualität und die Sterblichkeit in entwickelten Ländern, wundert die Vielzahl und Vielfalt von primär- und sekundärpräventiven Programmen "rund ums Herz" nicht.
Angesichts der quantitativen und qualitativen Bedeutung von Herzerkrankungen für die Lebensqualität und die Sterblichkeit in entwickelten Ländern, wundert die Vielzahl und Vielfalt von primär- und sekundärpräventiven Programmen "rund ums Herz" nicht.
Dazu gehören auch die in vielen Ländern mit großer Phantasie entwickelten und verbreiteten "Gesundes-Herz-Programme", die durch ganze Bündel von beratenden und weiterbildenden Interventionen oder Angebote versuchen, Menschen dazu zu motivieren, ihre Risiken für die Entstehung von Herzerkrankungen zu reduzieren. Als Risikofaktoren gelten für gewöhnlich ein hoher Cholesterinspiegel, übermässiger Salzkonsum, hoher Blutdruck, starkes Übergewicht, fettreiche Ernährung, Rauchen, Diabetes und zu geringe Bewegung.
Die Programme bestehen aus mehr oder weniger umfangreichen und aufwändigen Vorschlägen zu Dingen und Maßnahmen, die zu unterlassen oder zu tun sind. Sie gelten als wirksam, kostengünstig und werden daher immer häufiger entwickelt und eingesetzt. Die Wirksamkeitserwartungen sind auch deshalb so hoch, weil andere Studien die begrenzte oder völlig fehlende Wirkung von isolierten Einzelmaßnahmen auf die kardiovaskuläre Morbidität belegt hatten und "multiple risk factor interventions" als aufwändige aber erfolgreichere Variante gelten. Ob diese Art von präventiver Interventionen für die allgemeine Bevölkerung aber überhaupt den erwarteten Nutzen haben, galt und gilt daher lange als eine unnötige Frage.
Sieht man sich aber die Ergebnisse des letzten, 2006 veröffentlichten systematischen Cochrane-Reviews von 39 randomisierten kontrollierten Studien (RCT) an, müssen diese Erwartungen deutlich gesenkt und andere spezifiziertere präventive Konzepte bevorzugt werden. Der Review stellt ein Update einer früheren Analyse (1999) der verfügbaren Forschungsarbeiten dar und umfasst Erkenntnisse über "Gesundes-Herz-Programme" aus drei Jahrzehnten.
Zunächst ist bemerkenswert, dass viele der Studien zwar positive Wirkungen auf die Sterblichkeit suggerieren oder sie ihnen zugeschrieben werden, nur in 10 der 39 RCT aber Angaben zur allgemeinen und Herzerkrankungssterblichkeit als Endpunkte existieren. Die in diesen Studien dann berichteten Sterbewahrscheinlichkeiten (odds ratio) für NutzerInnen dieser Programme betragen im Vergleich mit Kontrollgruppenangehörigen für die allgemeine Sterblichkeit 0,96 (Konfidenzintervall von 0,92 bis 1,01) und für die Wahrscheinlichkeit an einer Herzerkrankung zu versterben 0,96 (Konfidenzintervall 0,89 bis 1,04). Wie die Breite der Konfidenzintervalle zeigt, sind die Ergebnisse nicht nur sehr geringfügig, sondern auch statistisch insignifikant.
Nicht sehr viel größer sind die bei den TeilnehmerInnen solcher Programme gemessenen Veränderungen der Risikofaktoren: Der systolische und diastolische Blutdruck konnte während der Interventionszeiten um 3,6 mm und 2,8 mm Quecksilbersäule gesenkt werden, der des Cholesterinspiewgels um 0,07 mMol/l. Relativ am größten war die Wahrscheinlichkeit, dass TeilnehmerInnen aufhörten zu rauchen. Nach ihren eigenen Angaben waren es durchschnittlich 20 % mit einer Spannbreite von 8 bis 31 %.
Als mögliche Erklärungen für fehlende oder lediglich geringfügige Wirkungen bieten die Reviewer zweierlei an: Die Interventionen erfolgten nicht lang genug oder die Studien waren methodisch schwach.
Die Autoren des Cochrane Reviews weisen aber darauf hin, dass ein bloßes "weiter so" selbst mit einem noch erweiterten Multi-Risikofaktorenkonzept und diesem Typ des "Gesundes-Herz-Programms" nicht sinnvoll und wenig ertragreich ist: "Our methods of attempting behaviour change in the general population are very limited. Different approaches to behaviour change are needed and should be tested empirically before being widely promoted. For example, the availability of foods and better access to recreational and sporting facilities may have a greater impact on dietary and exercise patterns respectively, than health professional advice."
Erfolgreicher als die hier untersuchten, meist schriftlichen oder audiovisuellen Interventionen, erscheint den Reviewern speziell in der Hochdruckprävention eher die persönliche oder familiäre Beratung und Erziehung, die sich dann auch nicht mehr oder allein an die allgemeine Bevölkerung, sondern an ausgewählte Teilgruppen richtet.
Von dem Cochrane Review Multiple risk factor interventions for primary prevention of coronary heart disease von Ebrahim S, Beswick A, Burke M und Davey Smith G. aus dem Jahr 2006 gibt es kostenlos nur ein umfangreiches Abstract.
Bernard Braun, 5.4.09
Staatliches Gesundheitssystem Schottlands zahlt Rauchern, die ihr Laster aufgeben, wöchentliche Geldprämien
 In einem zweijährigen Pilotversuch will das Staatliche Gesundheitssystem des United Kingdom (National Health Service) in der schottischen Stadt Dundee erproben, ob man bei bislang hartnäckigen Rauchern mit Geldprämien erfolgreicher dabei ist, diesen einen dauerhaften Nikotinverzicht schmackhaft zu machen. Rund 12,50 englische Pfund (derzeit etwa 13 Euro) könnten Raucher wöchentlich erhalten, wenn sie innerhalb des "Quit4u"-Projekts auf Nikotin verzichten. Dabei richtet man sich primär an Einwohner von Dundee in besonders armen Stadtteilen, in denen die Raucherquoten besonders hoch und die bisherigen Präventionskonzepte wenig erfolgreich waren.
In einem zweijährigen Pilotversuch will das Staatliche Gesundheitssystem des United Kingdom (National Health Service) in der schottischen Stadt Dundee erproben, ob man bei bislang hartnäckigen Rauchern mit Geldprämien erfolgreicher dabei ist, diesen einen dauerhaften Nikotinverzicht schmackhaft zu machen. Rund 12,50 englische Pfund (derzeit etwa 13 Euro) könnten Raucher wöchentlich erhalten, wenn sie innerhalb des "Quit4u"-Projekts auf Nikotin verzichten. Dabei richtet man sich primär an Einwohner von Dundee in besonders armen Stadtteilen, in denen die Raucherquoten besonders hoch und die bisherigen Präventionskonzepte wenig erfolgreich waren.
Die Geldprämie wird auf einer Chipkarte verbucht, mit der man in Einzelhandels-Geschäften für den jeweils angesammelten Geldbetrag Lebensmittel bekommt. So soll ausgeschlossen werden, dass die Prämien für den Kauf von Tabak oder Alkohol genutzt werden. Die Geldprämie kann für Teilnehmer an der Pilotstudie 12 Wochen lang gezahlt werden. Zur Kontrolle müssen sie sich einmal wöchentlich in einer Apotheke einem Atemtest unterziehen, um festzustellen, ob sie tatsächlich nicht geraucht haben.
Man erwartet oder hofft zumindest, dass etwa 1.800 Raucher an der Studie teilnehmen und dass etwa die Hälfte erfolgreich das Rauchen aufgeben - zumindest für 12 Wochen während des Studienverlaufs. Bei dieser Teilnehmerzahl und Erfolgsquote würde die zweijährige Intervention etwa 540.000 englische Pfund kosten, das heißt für jeden erfolgreich bekehrten Raucher rund 600 Pfund (660 Euro), wobei die Geldprämien für die Teilnehmer nur einen Teil ausmachen.
• Artikel in der lokalen Dundee-Tageszeitung "The Courier": Marjory Inglis: Cash to help smokers quit (The Courier, 24 March 2009)
• Artikel im British Medical Journal: Bryan Christie: Scottish NHS offers cash to get smokers to quit (BMJ Published 27 March 2009, doi:10.1136/bmj.b1306)
Mit der Pilotstudie in der 175.000 Einwohner zählenden Stadt Dundee wird jetzt in die Praxis umgesetzt, was im Rahmen einer wissenschaftlichen Studie bereits vor kurzem bei knapp 900 Mitarbeitern eines US-Konzerns erprobt worden war, und zwar mit Erfolg. In der Interventionsgruppe erhielten dort Raucher, die aufhören wollten, Informationen über Vorteile eines Rauchverzichts sowie bei Interesse auch kostenlos ein Medikament, um Entzugserscheinungen zu dämpfen. Ferner wurden ihnen finanzielle Prämien zugesagt: Zunächst 100 Dollar für die Teilnahme an einer medizinischen Studie, 250 Dollar, falls sie nach 6 Monaten vollkommen nikotinabstinent waren und weitere 400 Dollar, falls dies auch 9 oder 12 Monate nach Teilnahmebeginn noch der Fall war. Der Nikotinverzicht wurde dabei durch einen Bluttest überprüft. Es zeigte sich dann bei der Auswertung der Daten im Vergleich der Interventions- mit einer Kontrollgruppe, die keine Geldprämien bekommen hatte: Auch noch nach 18 Monaten war die Interventionsgruppe erfolgreicher als die Kontrollgruppe - 9,4% bzw. 3,6% hatten mit dem Rauchen aufgehört.
vgl. 750 Dollar Prämie für Raucher, die ihr Laster aufgeben: Geldanreize für Nikotinverzicht zeigen in einer US-Studie Wirkung
Gerd Marstedt, 5.4.09
Schwangerschaft und Rauchen: Nützt es, noch während der Schwangerschaft mit dem Rauchen aufzuhören?
 Nicht selten werden riskante Verhaltensweisen nicht gestoppt, weil der Nutzen als ungesichert gilt oder man dadurch sogar unerwünschte Wirkungen befürchtet.
Nicht selten werden riskante Verhaltensweisen nicht gestoppt, weil der Nutzen als ungesichert gilt oder man dadurch sogar unerwünschte Wirkungen befürchtet.
Letzteres gilt für Raucherinnen, die schwanger werden und trotz der durchaus bewussten gesundheitlichen Risiken für sich und das ungeborene Kind aus Angst vor Entzugs-Stress, Angstattacken oder Depressionen weiter rauchen. Vor allem dann, wenn eine Schwangere bereits mehrere Wochen während ihrer Schwangerschaft weitergeraucht hat, wird ihr Verhalten nicht selten durch die Annahme gestützt, ein Aufhören würde letztlich auch nichts mehr an den möglichen Folgen ändern.
Diesem Argument ist jetzt durch eine Untersuchung mit 2.504 gesunden und erstschwangeren Teilnehmerinnen der "Screening for Pregnancy Endpoints (SCOPE) study" in Neuseeland und Australien ein wesentlicher Teil seiner Wirkkraft entzogen worden. 80 % der Gruppe waren schwangere Frauen, die niemals vor und während ihrer Schwangerschaft rauchten, 10 % der Teilnehmerinnen hörten in der 15. Schwangerschaftswoche mit dem Rauchen auf und 10 % der Frauen rauchten bis zum Ende der Schwangerschaft und darüberhinaus weiter.
Als mögliche Wirkungsergebnisse wurde die Häufigkeit einer spontanen Frühgeburt und ein nicht dem Schwangerschaftsstadium entsprechendes Größenwachstum des Kindes untersucht.
Die wichtigsten soziodemographisch und gesundheitlich adjustierten Ergebnisse lauten:
• Schwangere Frauen, die in der Schwangerschaftszeit weiter rauchten hatten gegenüber den Frauen, die bis spätestens bis zur 15. Schwangerschaftswoche mit dem Rauchen aufhörten, ein statistisch hochsignifikantes größeres Risiko einer Frühgeburt (10 % versus 4 %; OR=3,21) und ein höheres Risiko von Wachstumsstörungen des Kindes (17 % vs. 10 %; OR=1,76).
• Zwischen den Frauen, die bis zur 15. Schwangerschaftswoche aufhörten zu rauchen und den Nichtraucherinnen gab es keinen signifikanten Unterschied bei der Häufigkeit einer Frühgeburt (Odds Ratio [OR]=1,03) und einem inadäquaten Wachstum (OR=1,06).
• Die Frauen, die mit dem Rauchen aufhörten, litten nicht unter einem Anstieg von Stress, Angst oder Depressionen.
Der Schlussfolgerung der AutorInnen, "that these severe adverse effects of smoking may be reversible if smoking is stopped early in pregnancy" ist mit der Einschränkung zuzustimmen, dass dies nicht für andere mehr oder weniger negative Wirkungen (z.B. Suchtmerkmale) gelten könnte.
Zu dem im "British Medical Journal (BMJ)" am 26. März 2009 (BMJ 2009;338:b1081) veröffentlichten Aufsatz "Spontaneous preterm birth and small for gestational age infants in women who stop smoking early in pregnancy: prospective cohort study" von Lesley M E McCowan, Gustaaf A Dekker, Eliza Chan, Alistair Stewart, Misty Hunter, Rona Moss-Morris, Robyn A North und Lucy C Chappell gibt es ein Abstract und eine kostenlose komplette siebenseitige PDF-Fassung.
Bernard Braun, 27.3.09
Länder, in denen wenig Rad gefahren und zu Fuß gegangen wird, haben auch ein größeres Übergewichtsproblem
 Ein zu geringes Ausmaß an körperlicher Bewegung, durch Jogging oder Radfahren, Gartenarbeit oder Sport, wirkt sich oft negativ auf das Körpergewicht aus und erhöht das Risiko von Übergewicht und Adipositas. So viel ist aus einer Reihe von Studien bereits bekannt, bei denen man die körperliche Aktivität und den Body-Mass-Index von Kindern oder auch Erwachsenen miteinander in Beziehung gesetzt hat. Eine neuere, jetzt in der Zeitschrift "Journal of Physical Activity and Health" veröffentlichte Studie hat nun noch einmal untersucht, ob dieser Zusammenhang nicht nur auf der Ebene von Individuen, sondern auch auf Länder-Ebene feststellbar ist. Konkret stand die Frage im Raum: Zeigt sich auch im Vergleich nordamerikanischer und europäischer Länder, dass dort, wo Bürger/innen in ihrem Alltag viele Erledigungen und Wege zu Fuß oder mit dem Fahrrad bewältigen, sich dies auch in einem niedrigeren Vorkommen von Übergewicht niederschlägt?
Ein zu geringes Ausmaß an körperlicher Bewegung, durch Jogging oder Radfahren, Gartenarbeit oder Sport, wirkt sich oft negativ auf das Körpergewicht aus und erhöht das Risiko von Übergewicht und Adipositas. So viel ist aus einer Reihe von Studien bereits bekannt, bei denen man die körperliche Aktivität und den Body-Mass-Index von Kindern oder auch Erwachsenen miteinander in Beziehung gesetzt hat. Eine neuere, jetzt in der Zeitschrift "Journal of Physical Activity and Health" veröffentlichte Studie hat nun noch einmal untersucht, ob dieser Zusammenhang nicht nur auf der Ebene von Individuen, sondern auch auf Länder-Ebene feststellbar ist. Konkret stand die Frage im Raum: Zeigt sich auch im Vergleich nordamerikanischer und europäischer Länder, dass dort, wo Bürger/innen in ihrem Alltag viele Erledigungen und Wege zu Fuß oder mit dem Fahrrad bewältigen, sich dies auch in einem niedrigeren Vorkommen von Übergewicht niederschlägt?
Die US-amerikanische Forschungsgruppe hat dazu eine Vielzahl nationaler Studien herangezogen und die dort gefundenen Ergebnisse für einen internationalen Vergleich aufbereitet. In Deutschland war dies die Studie "Mobilität in Deutschland (MiD)", eine bundesweite Befragung von 50.000 Haushalten zu ihrem alltäglichen Verkehrsverhalten im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung. Die Umfrage wurde erstmals im Jahr 2002 durchgeführt und wird im Jahr 2008/2009 wiederholt. (vgl: Mobilität in Deutschland) Insgesamt konnten die Wissenschaftler dann Daten aus 15 Ländern in Europa, Nordamerika und Australien berücksichtigen.
Um einen Indikator zu bekommen, der das Ausmaß körperlicher Bewegung studienübergreifend benennt, verwendeten sie die Angabe: Wie viele der alltäglichen Wegstrecken (zur Arbeit, zum Einkaufen, zum Arzt usw.) werden im Landesdurchschnitt zu Fuß, mit dem Rad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln bestritten in Relation zu allen Wegen, also auch den mit dem Auto zurück gelegten. Öffentliche Verkehrsmittel wurden einbezogen, da man zu den Haltestellen ja auch in der Regel zu Fuß oder mit dem Rad gelangt. Zugleich verwendeten sie auch Studien, in denen die Verbreitung von Adipositas (Body-Mass-Index >= 30) erfasst worden ist, sei es durch objektive Messungen, sei es durch Befragungen und Selbstangaben. Alle Studien stammten aus den Jahren 1994 bis 2006. 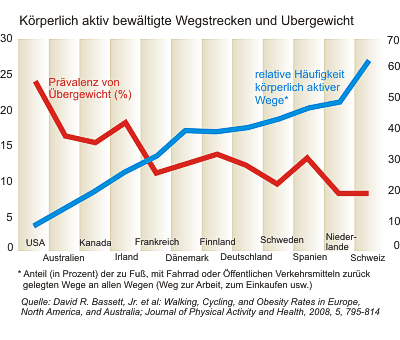
Als Ergebnis zeigte sich dann: Länder mit dem höchsten Anteil adipöser Bürger/innen wiesen auch nur ein sehr geringes Maß an aktiv bewältigten Wegstrecken auf. Besonders deutlich gilt dies etwa für die USA, Kanada und Australien. In der Grafik zeigt die rote Kurve die prozentuale Häufigkeit adipöser Bürger/innen, die blaue Kurve das Ausmaß körperlicher Aktivität durch zu Fuß zurück gelegte Kurzstrecken. In dieser Grafik abgebildet sind Adipositas-Daten aus Umfragen. In einer zweiten Analyse verwendeten die Wissenschaftler auch BMI-Daten auf der Basis objektiver Gewichtsmessungen, um Fehlerquellen auszuschließen. Das Ergebnis war jedoch dasselbe.
In der Studie wurde dann auch noch einmal berechnet, wie viele Kilometer Bürger/innen für die Bewältigung von Kurzstrecken zurücklegen. Hier wurde ebenfalls große Unterschiede deutlich: Während US-Amerikaner im Jahr nur etwa 181 km zu Fuß oder mit dem Rad zurücklegen, sind dies bei Niederländern 1225 km, bei Dänen immerhin noch 1014 km. Deutschland rangiert hier mit 663 km im Mittelfeld.
Quelle: David R. Bassett, Jr., John Pucher, Ralph Buehler, Dixie L. Thompson, and Scott E. Crouter: Walking, Cycling, and Obesity Rates in Europe, North America, and Australia; Journal of Physical Activity and Health, 2008, 5, 795-814
• Hier ist ein Abstract der Studie auf der Website von "Journal of Physical Activity and Health"
• Hier ist eine PDF-Datei mit dem Volltext der Studie auf der Website der Edward J. Bloustein School of Planning and Public Policy, Rutgers, The State University of New Jersey
Gerd Marstedt, 17.3.09
Alkoholgenuss in Spielfilmen und Werbespots regt Zuschauer vermehrt zum Konsum alkoholischer Getränke an
 Jugendliche, denen man Filme oder auch Werbespots zeigt, in denen Schauspieler genüsslich alkoholische Getränke zu sich nehmen, greifen in dieser Situation selbst auch lieber zu Bier oder Wein als zu Erfrischungsgetränken oder Mineralwasser. Dies hat jetzt eine experimentelle Studie gezeigt, die an der niederländischen Radboud University in Nijmegen durchgeführt wurde. Und zugleich wurde jetzt eine Meta-Analyse von 7 Längsschnitt- Studien veröffentlicht, die anhand der Daten von rund 13.000 Jugendlichen und jüngeren Erwachsenen zeigt: Je häufiger diese im Fernsehen, im Kino oder in Zeitschriften Werbung für alkoholische Getränke sehen, desto mehr nehmen sie im Zeitverlauf auch selber alkoholische Getränke zu sich.
Jugendliche, denen man Filme oder auch Werbespots zeigt, in denen Schauspieler genüsslich alkoholische Getränke zu sich nehmen, greifen in dieser Situation selbst auch lieber zu Bier oder Wein als zu Erfrischungsgetränken oder Mineralwasser. Dies hat jetzt eine experimentelle Studie gezeigt, die an der niederländischen Radboud University in Nijmegen durchgeführt wurde. Und zugleich wurde jetzt eine Meta-Analyse von 7 Längsschnitt- Studien veröffentlicht, die anhand der Daten von rund 13.000 Jugendlichen und jüngeren Erwachsenen zeigt: Je häufiger diese im Fernsehen, im Kino oder in Zeitschriften Werbung für alkoholische Getränke sehen, desto mehr nehmen sie im Zeitverlauf auch selber alkoholische Getränke zu sich.
In der experimentellen Studie der Universität Nijmegen wurden 80 männliche Studenten im Alter von 18-29 Jahren gebeten, an einem Experiment teilzunehmen. Sie wurden dazu in einen Raum der Universität gebeten, dessen Einrichtung einer Bar glich. Dort sollten sie sich auf einem großen TV-Bildschirm einen Film anschauen und später, so wurde ihnen gesagt, einige Angaben machen über ihre Fernsehgewohnheiten zuhause. Während des Films konnten sie sich, so wurde ausdrücklich gesagt, aus einem Kühlschrank Getränke nehmen: Bier, Wein, Cola oder Orangensaft.
Tatsächlich ging es jedoch nicht um Fernsehgewohnheiten, sondern die Wissenschaftler wollten das Trinkverhalten beobachten, genauer: die Wahl alkoholischer oder nicht-alkoholischer Getränke. Dazu wurden die 80 Teilnehmer per Zufall einer von vier Gruppen zugeteilt, in denen unterschiedliches Filmmaterial dargeboten wurde. Gezeigt wurde entweder ein Spielfilm, in dem sehr viele oder auch sehr wenig Szenen zu sehen waren, in denen Darsteller Alkohol tranken. Es handelte sich um "American Pie 2" (mit vielen Alkohol-Szenen) und um "40 Days and 40 Nights", ein Film mit sehr wenig Alkohol-Szenen. Weiterhin wurde der Spielfilm zweimal für Werbung unterbrochen, wobei in ähnlicher Weise in zwei Gruppen Werbeclips für alkoholische Getränke gezeigt wurden und in zwei anderen Gruppen solche mit neutralem Inhalt.
Protokolliert wurde, welche Getränke und wie viele die Studenten in den vier Präsentationsgruppen zu sich genommen hatten. In der Auswertung zeigte sich dann: Die Präsentation des "Alkohol-Films" zusammen mit Werbespots für alkoholische Getränke führte dazu dass in dieser Gruppe doppelt so viel Bier oder Wein getrunken wurde (im Durchschnitt 3 alkoholische Getränke) wie in der anderen Extremgruppe, die den Film mit sehr wenig Alkohol-Szenen und neutraler Werbung gesehen hatte (1,5). Dieses Ergebnis bestätigte sich auch, wenn in einer multivariaten Analyse andere potentielle Einflussfaktoren kontrolliert wurden, wie zum Beispiel generelle Trinkgewohnheiten der Teilnehmer. Die Wissenschaftler heben hervor, dass damit zum ersten Mal im Rahmen einer experimentellen Studie der Imitations-Effekt für den Alkohol-Konsum nachgewiesen wurde.
Die Studie ist hier kostenlos im Volltext verfügbar: Rutger C. M. E. Engels u.a.: Alcohol Portrayal on Television Affects Actual Drinking Behaviour (Alcohol and Alcoholism, doi:10.1093/alcalc/agp003. This version published online on March 4, 2009)
In einer Meta-Analyse schon veröffentlichter Studien untersuchten zwei englische Wissenschaftler in ähnlicher Weise den Einfluss von Alkohol-Werbung in verschiedenen Medien auf das Trinkverhalten von Jugendlichen. In den sieben einbezogenen Längsschnittstudien waren Daten von insgesamt 13.000 Jugendlichen und jüngeren Erwachsenen im Alter von 10-26 Jahren erfasst worden. Anhand von Befragungen wurde einerseits festgehalten, wie oft die Teilnehmer aufgrund ihres Fernseh- oder Leseverhaltens auch Alkoholwerbung sahen. Andererseits wurde auch das Trinkverhalten und der Alkoholkonsum erfasst. Als übereinstimmendes Ergebnis der Studien zeigte sich: Auch dann, wenn die Teilnehmer zu Beginn der verschiedenen Längsschnittuntersuchungen nur wenig Alkohol tranken, so erhöhte sich die Menge im Zeitverlauf und zwar parallel zur Anzahl der wahrgenommenen Inserate, Filme oder TV-Spots mit Alkohol-Werbung.
Auch diese Studie ist im Volltext frei verfügbar: Lesley A Smith, David R Foxcroft: The effect of alcohol advertising, marketing and portrayal on drinking behaviour in young people: systematic review of prospective cohort studies (BMC Public Health 2009, 9:51doi:10.1186/1471-2458-9-51)
Hier ist ein Abstract der Studie
Gerd Marstedt, 9.3.09
"Deutschland bewegt sich!" ... oder auch nicht. Verspeist aber etliche Kalorien zusätzlich
 Werbebotschaften, die Bürgerinnen und Bürger zu Sport und Bewegung motivieren sollen, verführen möglicherweise nur sehr wenige dazu, den Fernsehsessel zu verlassen und sich aufs Fahrrad zu schwingen oder auf die Jogging-Runde zu begeben. Die Aufforderung zu körperlicher Bewegung könnte jedoch bei sehr vielen Empfängern dazu führen, dass sie etliche Kalorien zusätzlich verspeisen. Eine experimentelle Studie an der University of Illinois hat jetzt gezeigt: Studenten, denen man Texte und dazugehörige Bilder mit einer Aufforderung zu Sport und körperlicher Bewegung zeigte, vernaschten während dieser Vorführung sehr viel mehr Knabbergebäck und Nüsse als eine andere Gruppe von Studenten, denen man neutrale Texte und Bilder gezeigt hatte.
Werbebotschaften, die Bürgerinnen und Bürger zu Sport und Bewegung motivieren sollen, verführen möglicherweise nur sehr wenige dazu, den Fernsehsessel zu verlassen und sich aufs Fahrrad zu schwingen oder auf die Jogging-Runde zu begeben. Die Aufforderung zu körperlicher Bewegung könnte jedoch bei sehr vielen Empfängern dazu führen, dass sie etliche Kalorien zusätzlich verspeisen. Eine experimentelle Studie an der University of Illinois hat jetzt gezeigt: Studenten, denen man Texte und dazugehörige Bilder mit einer Aufforderung zu Sport und körperlicher Bewegung zeigte, vernaschten während dieser Vorführung sehr viel mehr Knabbergebäck und Nüsse als eine andere Gruppe von Studenten, denen man neutrale Texte und Bilder gezeigt hatte.
Wissenschaftler des Albert Einstein College of Medicine hatten unlängst in einem Aufsatz in der Zeitschrift "American Journal of Preventive Medicine" eine sehr harsche Kritik an U.S.-Behörden formuliert. Die aktuelle Übergewichts-Problematik in den USA ist nach ihrer Argumentation zu einem erheblichen Anteil verursacht worden durch Empfehlungen in nationalen Leitlinien, fettreiche Nahrungsmittel auf dem Speiseplan massiv einzuschränken oder ganz darauf zu verzichten. Medien haben diese Empfehlungen dann immer wieder in ihre Schlagzeilen gebracht und als Effekt davon war der Anteil von Nahrungsmitteln mit einem besonders hohen Anteil von Kohlenhydraten und Kalorien angestiegen - was zu Übergewicht und Fettleibigkeit bei vielen Bevölkerungsgruppen führte. Es werden immer wieder Leitlinien aufgestellt und über die Medien Verhaltensratschläge verbreitet, so kritisieren die Wissenschaftler, in der Annahme, dass diese Empfehlungen zwar nicht 100prozentig abgesichert sind, aber zumindest nicht schaden können. (vgl.: Wissenschaftler kritisieren: Leitlinien und Ratschläge zur gesunden Ernährung verursachen oft mehr Schaden als Nutzen)
Eine experimentelle Studie hat jetzt Hinweise erbracht, dass auch die vielfältigen Werbebotschaften zu mehr Sport und körperlicher Bewegung ("Deutschland bewegt sich!", "3.000 Schritte extra", "Kinder in Bewegung", "FahrRad!") in ähnlicher Weise unbedachte und kontraproduktive Nebenwirkungen (zusätzlicher Kalorienverzehr) haben könnten, ohne dass die Hauptwirkung (mehr Kalorienverbrauch durch Sport) entfaltet wird. Am Psychologischen Institut der University of Illinois wurden etwa 50 Studenten/innen darum gebeten, Bilder und Texte von Werbe-Anzeigen zu betrachten und diese dann hinsichtlich ihrer Wirkung zu bewerten. Dabei wurden einmal Anzeigen geboten, die Aufforderungen zu körperlicher Bewegung enthielten ("go for a walk","walk three times a week", "play basketball" usw.) und einmal bewegungs-neutrale Inhalte ("make friends", "be together", "be in a group" usw.) Während der Präsentation konnten die Versuchspersonen auch Nüsse, Knabbergebäck, Rosinen und ähnliches naschen. Tatsächlich ging es den Forschern nicht um die Bewertung der Werbewirkung, sondern exakt um das Ausmaß der Nascherei in Abhängigkeit vom dargebotenen Bild- und Textmaterial.
So wie von den Psychologen vermutet, war die Kalorienaufnahme deutlich höher bei Sport- und Bewegungs-Material (im Durchschnitt 18 kcal) als bei neutralen Texten und Bildern (12 kcal). In einer zweiten Testreihe zeigte sich dann, dass auch bei einer unterschwelligen oder vorbewussten Aufnahme von Werbebotschaften (erzielt durch eine extrem kurze Darbietungszeit von 15 Millisekunden) derselbe Effekt zu beobachten war (109 vs. 87 kcal). Die Wissenschaftler erklären, dass ihre Studie zwar einige Einschränkungen hat: So wurden nur Studenten mit normalem Body Mass Index eingesetzt und die Menge der zusätzlich verzehrten Kalorien war gering. Sollte sich ihr Befund allerdings auch außerhalb des Labors bestätigen, dann wäre dies erneut ein Hinweis auf unbedachte Risiken und Nebenwirkungen (gut gemeinter) Kampagnen zur Gesundheitsförderung.
Albarracin, D., Wang, W., & Leeper, J. (2009). Immediate increase in food intake following exercise messages. Obesity. Obesity advance online publication. February 26, 2009; doi:10.1038/oby.2009.16
• Abstract der Studie auf der Website von "Obesity"
• PDF der kompletten Studie auf der Website von Dolores Albarracin
• Word-Datei mit Details des Experiments
Gerd Marstedt, 2.3.09
Egal, ob Atkins- oder Ornish-Diät, Weight Watchers oder Mittelmeerkost: Wichtig ist allein eine kalorien-reduzierte Ernährung
 Die Zeitschrift Focus hat unlängst nicht weniger als 50 verschiedene Diäten zum Abnehmen einzeln beschrieben und in der wissenschaftlichen Diskussion ist man sich in der Bewertung der Erfolge verschiedener Diäten uneins. Es herrschte lediglich die Einsicht vor, dass Diäten zwar kurzfristig effektiv sind, langfristig aber zur Gewichtsabnahme wenig taugen. Vermutlich werden sich die Diät-Empfehlungen in Frauenzeitschriften auch in der nächsten Zeit kaum ändern, die wissenschaftliche Diskussion allerdings sollte durch das Ergebnis einer jetzt im "New England Journal of Medicine" veröffentlichten Studie neue Akzente bekommen.
Die Zeitschrift Focus hat unlängst nicht weniger als 50 verschiedene Diäten zum Abnehmen einzeln beschrieben und in der wissenschaftlichen Diskussion ist man sich in der Bewertung der Erfolge verschiedener Diäten uneins. Es herrschte lediglich die Einsicht vor, dass Diäten zwar kurzfristig effektiv sind, langfristig aber zur Gewichtsabnahme wenig taugen. Vermutlich werden sich die Diät-Empfehlungen in Frauenzeitschriften auch in der nächsten Zeit kaum ändern, die wissenschaftliche Diskussion allerdings sollte durch das Ergebnis einer jetzt im "New England Journal of Medicine" veröffentlichten Studie neue Akzente bekommen.
Die mit 811 Männern und Frauen im Alter über 50 Jahre durchgeführte Längsschnitt-Studie hat nämlich gezeigt: Die Diskussionen über die Zusammensetzung unterschiedlicher Diäten aus Fetten, Kohlenhydraten und Proteinen sind überflüssig. Denn im Vergleich von vier Gruppen, die über einen Zeitraum von zwei Jahren jeweils unterschiedliche Diäten befolgten, zeigte sich: Effektiv kann jede Ernährungsumstellung für eine Gewichtsabnahme und Vermeidung von Adipositas und ihren Folgen sein, wenn sie nur das Prinzip befolgt, dass die Kalorienzahl dauerhaft gesenkt wird.
Alle Teilnehmer an der Studie hatten Übergewicht oder sogar Adipositas. Nach dem Zufallsprinzip wurden sie einer von vier Diätgruppen mit unterschiedlicher Zusammensetzung der Speisen zugeordnet:
• In einer Gruppe war der Fettgehalt auf 20% reduziert,
• in einer anderen Gruppe zusätzlich auch noch der Anteil der Proteine auf 25 Prozent erhöht,
• in einer Gruppe wiederum waren 40% Fett in den Speisen erlaubt,
• und in der letzten Gruppe waren auch noch Kohlehydrate deutlich reduziert.
Die jeweilige Zusammensetzung der Ernährung war in den vier Gruppen also folgendermaßen organisiert:
Fett-Proteine-Kohlenhydrate: 20-15-65%, 20-25-55%, 40-15-45%, 40-25-35%.
In allen vier Diäten wurde bei jedem Teilnehmer die Gesamtenergiezufuhr im Vergleich zu vorherigen Ernährungsgewohnheiten um 750 kcal reduziert, das Minimum der Energieaufnahme waren aber 1.200 kcal am Tag. Die Ernährung sollte darüber hinaus Leitlinien zur Prävention von Herz-Kreislauferkrankungen beachten (wenig gesättigte Fettsäuren, wenig Cholesterin, hoher Anteil von Ballaststoffen). Und schließlich wurdem Teilnehmer im gesamten Untersuchungszeitraum auf Wunsch beraten und sollten anderthalb Stunden Sport oder anstrengende Bewegung pro Woche durchführen.
Als Ergebnis zeigte sich dann während des Studienverlaufs der bekannte "Jojo"-Effekt: Nach 6 Monaten hatten die Teilnehmer in allen Gruppen im Durchschnitt etwa 6 Kilogramm an Gewicht verloren, also etwa 7 Prozent des Körpergewichts. Später, nach 2 Jahren dann, hatten die meisten jedoch wieder einiges an Gewicht zugelegt. Die gegenüber dem Ausgangsgewicht verlorenen Pfunde machten nur noch 4 Kilogramm aus, und dies auch nur bei jenen 80 Prozent der Studienteilnehmer, die nicht vorher abgebrochen hatten und aus der Studie ausgestiegen waren. Immerhin etwa 14-15% hatten ihr Körpergewicht sogar um 10 Prozent reduziert.
Die durchschnittliche Gewichtsabnahme in den vier Gruppen schwankte nach zwei Jahren zwischen 2,9 und 3,6 kg. Da diese Werte jedoch keine statistisch signifikanten Unterschiede darstellen, heißt ein Fazit der Studie: Wichtig ist die Senkung der Kalorienzahl und das Durchhalten. Dass die Zusammensetzung der Speisen unterschiedlich sein kann, erscheint den Forschern als Chance, weil Abnehmwillige so eher Speisepläne nach ihrem persönlichen Geschmack gestalten können.
Die Studie ist hier im Volltext zu finden: Frank M. Sacks u.a.: Comparison of Weight-Loss Diets with Different Compositions of Fat, Protein, and Carbohydrates (NEJM, Volume 360:859-873, February 26, 2009, Number 9)
Gerd Marstedt, 28.2.09
750 Dollar Prämie für Raucher, die ihr Laster aufgeben: Geldanreize für Nikotinverzicht zeigen in einer US-Studie Wirkung
 Die Bestrafung eines ungesunden Lebensstils wurde schon vor langer Zeit propagiert: "Raucherpfennig" für Nikotinsünder, "Speck-Steuer" für Adipöse waren (erfolglose) Vorschläge aus den 90er Jahren. Der umgekehrte Weg, nämlich finanzielle Belohnungen zu verteilen für die Veränderung eines gesundheitsriskanten Alltagsverhaltens, wurde seltener begangen. In einer US-amerikanischen Studie, die jetzt in der renommierten Fachzeitschrift "New England Journal of Medicine" veröffentlicht wurde, zeigte sich: Mitarbeiter eines US-Konzerns, denen eine nicht unerhebliche finanzielle Prämie in Aussicht gestellt wurde, falls sie das Rauchen aufgeben würden, schafften den Ausstieg erheblich öfter und waren auch nach 9 oder 12 Monaten öfter abstinent als andere Mitarbeiter ohne solchen Anreiz.
Die Bestrafung eines ungesunden Lebensstils wurde schon vor langer Zeit propagiert: "Raucherpfennig" für Nikotinsünder, "Speck-Steuer" für Adipöse waren (erfolglose) Vorschläge aus den 90er Jahren. Der umgekehrte Weg, nämlich finanzielle Belohnungen zu verteilen für die Veränderung eines gesundheitsriskanten Alltagsverhaltens, wurde seltener begangen. In einer US-amerikanischen Studie, die jetzt in der renommierten Fachzeitschrift "New England Journal of Medicine" veröffentlicht wurde, zeigte sich: Mitarbeiter eines US-Konzerns, denen eine nicht unerhebliche finanzielle Prämie in Aussicht gestellt wurde, falls sie das Rauchen aufgeben würden, schafften den Ausstieg erheblich öfter und waren auch nach 9 oder 12 Monaten öfter abstinent als andere Mitarbeiter ohne solchen Anreiz.
Prof. Kevin Volpp, Leiter des "gesundheitsökonomischen Zentrums für gesundheitliche Anreize" (Leonard Davis Institute, Health Economics Center for Health Incentives) an der University of Pennsylvania hatte vor kurzem bereits untersucht, ob man übergewichtige und adipöse Bürger mit Geldanreizen mehr als bislang dazu bewegen kann, etwas gegen ihre Leibesfülle zu unternehmen, sei es durch eine andere Ernährung, sei es durch mehr Sport und Bewegung. Die Studie zeigte allerdings zeitlich nur sehr begrenzte Erfolge für derlei Maßnahmen. (vgl. Dollar gegen Pfunde)
In einer neuen Studie, die sich jetzt nicht mehr der Problematik "Übergewicht" widmete, sondern stattdessen das Gesundheitsrisiko "Rauchen" aufs Korn nahm, hatte Prof. Volpp mehr Erfolg. 878 Mitarbeiter eines US-Konzern, allesamt Raucher und allesamt zumindest gedanklich an einem Nikotinverzicht interessiert, wurden für die Mitarbeit an der Studie gewonnen. Nach dem Zufallsprinzip wurden sie einer von zwei Gruppen zugeteilt: In einer Kontrollgruppe erhielten sie Informationen über Risiken des Rauchens und Vorteile eines Rauchverzichts sowie bei Interesse auch kostenlos ein Medikament, um Entzugserscheinungen zu dämpfen. In der Interventionsgruppe wurden den Teilnehmern darüber hinaus finanzielle Prämien zugesagt: Zunächst 100 Dollar für die Teilnahme an einer medizinischen Studie, 250 Dollar, falls sie nach 6 Monaten vollkommen nikotinabstinent waren und weitere 400 Dollar, falls dies auch 9 oder 12 Monate nach Teilnahmebeginn noch der Fall war. Der Nikotinverzicht wurde dabei durch einen Bluttest überprüft.
Es zeigte sich dann bei der Auswertung der Daten:
• Die Interventionsgruppe (mit Prämien) war durchweg erfolgreicher, allerdings sank hier ebenso wie in der Kontrollgruppe der Anteil erfolgreicher Ex-Raucher kontinuierlich, von 21% (nach 6 Monaten) auf 15% (nach 9-12 Monaten) und dann auf 9% (nach 15-18 Monaten).
• Nach 9 bzw. 12 Monaten gab es dreimal so viele Nichtraucher in der Gruppe mit finanziellen Prämien im Vergleich zur Kontrollgruppe (14,7% bzw. 5,0%)
• Auch noch nach 15 bzw. 18 Monaten war dieser Unterschied feststellbar (9,4% bzw. 3,6%).
In multivariaten Analysen wurde auch geprüft, ob noch andere Faktoren für dieses Ergebnis maßgeblich sein könnten. In diese Analyse einbezogen waren unter anderem Gesundheitszustand, Geschlecht, Alter, Bildungsniveau, Einkommen, Rasse, Anzahl gerauchter Zigaretten. Es zeigte sich dann, dass die Zugehörigkeit zur Interventionsgruppe mit finanziellen Prämien der stärkste Einflussfaktor war. Nicht ganz unerheblich war allerdings auch das Einkommen: Teilnehmer mit einem mittleren Einkommensniveau waren sehr viel weniger erfolgreich als andere mit sehr hohem oder sehr niedrigem Einkommen.
Dass eine Cochrane-Studie aus dem Jahr 2005 (Cahill K., Perera R.: Competitions and incentives for smoking cessation) keine Evidenz gefunden hatte für die Wirksamkeit finanzieller Anreize, erklären die Forscher daraus, dass erstmals in ihrer Studie eine wirklich nennenswerte finanzielle Prämie geboten wurde.
Hier ist ein Abstract der Studie: Volpp, Kevin G. u.a.: A Randomized, Controlled Trial of Financial Incentives for Smoking Cessation(New England Journal Medicinek, Volume 360, Number 7, pp 699-709, February 12, 2009)
Gerd Marstedt, 13.2.09
Verbot der Fernsehwerbung von Fastfood-Restaurants würde die Verbreitung von Übergewicht bei Kindern senken
 Der Anteil übergewichtiger Kinder und Jugendlicher hat sich in den USA in den letzten Jahrzehnten verdreifacht und vermutlich sind die USA auch eines der führenden Länder, was den Fernsehkonsum jüngerer Generationen anbetrifft. Dass es einen Zusammenhang zwischen Fernsehen als Freizeitbeschäftigung und Körpergewicht gibt, ist augenscheinlich: Wer viel fernsieht, hat zwangsläufig weniger körperliche Bewegung. Es gibt indes auch noch einen anderen Mechanismus, dem jetzt ein US-amerikanisches Forschungsteam nachgegangen ist. Kinder und Jugendliche, die viel fernsehen, so ihre durch Datenanalysen später auch bestätigte Hypothese, sehen auch mehr TV-Werbespots von Fastfood-Restaurants, gehen dort häufiger (sehr kalorienreich) essen und haben dann öfter auch einen Body Mass Index (BMI), der über dem Normalgewicht liegt.
Der Anteil übergewichtiger Kinder und Jugendlicher hat sich in den USA in den letzten Jahrzehnten verdreifacht und vermutlich sind die USA auch eines der führenden Länder, was den Fernsehkonsum jüngerer Generationen anbetrifft. Dass es einen Zusammenhang zwischen Fernsehen als Freizeitbeschäftigung und Körpergewicht gibt, ist augenscheinlich: Wer viel fernsieht, hat zwangsläufig weniger körperliche Bewegung. Es gibt indes auch noch einen anderen Mechanismus, dem jetzt ein US-amerikanisches Forschungsteam nachgegangen ist. Kinder und Jugendliche, die viel fernsehen, so ihre durch Datenanalysen später auch bestätigte Hypothese, sehen auch mehr TV-Werbespots von Fastfood-Restaurants, gehen dort häufiger (sehr kalorienreich) essen und haben dann öfter auch einen Body Mass Index (BMI), der über dem Normalgewicht liegt.
Basis der Studie sind einerseits zwei Datensätze, in denen sehr viele sozialstatistische, aber auch gesundheitliche und freizeitbezogene Aspekte von Kindern und Jugendlichen erfasst sind. Dabei handelt es sich um den "National Longitudinal Survey of Youth" für Jugendliche im Alter von 12-18 Jahren und den "Child-Young Adult National Longitudinal Survey of Youth", an dem Kinder von 3-11 Jahren teilnahmen. Erfasst wurden in diesen Erhebungen unter anderem Aspekte wie Alter, Rasse, Geschlecht, Einkommen und Bildungsniveau der Eltern, BMI des Kindes bzw. Jugendlichen und der Mutter, Dauer des täglichen Fernsehkonsums.
Die zweite zentrale Datenquelle waren Informationen über den zeitlichen Umfang der TV-Werbespots von Fastfood-Ketten, die diese in bestimmten Regionen, sogenannten "designated market areas (DMA)" geschaltet hatten. Die nicht überprüfte, aber mehr als plausible Annahme der Forscher war: Wer viel fernsieht, wird auch zwangsläufig mehr Werbespots gewollt oder ungewollt zur Kenntnis nehmen. In sehr komplizierten Analysen, in die auch viele der sozialstatistischen und gesundheitlichen Variablen zur Kontrolle einflossen, errechneten sie dann, in welchem Umfang der TV-Konsum (und damit auch Werbespot-Konsum für Fastfood-Restaurants) Übergewicht mitbewirkt.
Als Ergebnis fand man dann, dass zum Beispiel bei 3-11jährigen Jungen 30 Minuten zusätzliche Werbung für Fastfoodketten die Wahrscheinlichkeit für eine Zunahme des Übergewichts bei den Kindern der Region um 2,2 Prozent erhöht. Umgekehrt würde dies bedeuten: Ein vollständiges TV-Werbeverbot für Fastfood-Restaurants würde die Anzahl der übergewichtigen Kinder (Alter 3-11) um 18 Prozent senken, die Zahl der übergewichtigen Jugendlichen (Alter 12-18) um 14 Prozent. Eine etwas weniger scharfe gesetzliche Regelung, in der Fastfoodketten lediglich die Möglichkeit genommen würde, die Kosten für ihre an Kinder gerichtete TV-Werbung auch noch steuerlich abzusetzen, hätte nicht ganz so positive Effekte, würde den Anteil der Übergewichtigen in jüngeren Generationen aber immer noch um 5-7% senken.
Hier ist ein Abstract der Studie: Shin-Yi Chou, Inas Rashad, Michael Grossman: Fast-Food Restaurant Advertising on Television and Its Influence on Childhood Obesity (Journal of Law and Economics, vol. 51, November 2008, p 599-618)
Diese Analysen erscheinen nicht zuletzt deshalb bedeutsam, weil erst vor kurzem eine Studie des Center for Science in the Public Interest herausgefunden hatte, dass 93 Prozent der Kindermenüs in den großen Fastfoodketten zu viele Kalorien enthalten. 13 der 19 kontaktierten Unternehmen stellten im Juni 2008 die Angaben zur Zusammensetzung ihrer Speisen zur Verfügung. Für die Bewertung dieser Speisen wurden dann nationale Ernährungsstandards herangezogen, die sich auf die Kalorienzahl, den Gesamtfettgehalt, den Anteil gesättigter Fette und Transfette, Zuckerzusatz, Kochsalz und Nährstoffgehalt beziehen. Es zeigte sich dann:
• Statt maximal 430 Kalorien (ein Drittel der für 4-8jährige am Tag empfohlenen Kalorienzahl) enthält ein Kindermenü der Kette Chili's aus frittierten Hühnchenteilen ("country-fried chicken crispers"), Zimtäpfeln und Schokoladenmilch 1.020 Kalorien - der höchste erzielte Wert der Untersuchung.
• Auch die Kombinationen von McDonalds (Happy meal), Burger King und Wendy's lagen zu mehr als 90 Prozent über der empfohlenen Grenze, Kentucky Fried Chicken zu 89 Prozent.
• 45 Prozent der Kindermenüs enthalten zudem einen zu hohen Anteil von gesättigten Fetten und Transfetten, 86 Prozent zu viel Kochsalz.
• Gute Noten erhielt nur die Kette Subway's, von deren Kindermenüs die 430-Kalorien-Grenze nur um 33 Prozent überschreiten. Subway ist zudem die einzige Kette, die keine Softdrinks in Verbindung mit den Kindermenüs anbietet.
Die Autoren geben auch verschiedene Empfehlungen ab: Da Erwachsene den Kaloriengehalt von Fastfood-Angeboten häufig falsch einschätzen, raten sie zu einer Angabe der Kalorienzahl auf den Speisekarten bzw. auf dem Menüboard über der Verkaufstheke. Bei Subway's führte dies im Rahmen einer Studie zu einer Minderung pro Bestellung von 53 Kalorien. Weitere Empfehlungen sind: Gemüse und Obst anstelle von Pommes frites als Beilage, fettarme Milch und Wasser anstelle von zuckerhaltiger Limonade. Gibt es solche Auswahl-Optionen, dann bestellen 70 Prozent der Eltern die gesündere Mahlzeit für ihre Kinder.
• Die Studie ist hier im Volltext herunterzuladen: Center for Science in the Public Interest: Kids' Meals: Obesity on the Menu
• Hier eine Kurzfassung der Befunde: Obesity on the Kids' Menus at Top Chains
Gerd Marstedt, 9.2.09
Schlafstörungen und zu wenig Schlaf erhöhen das Risiko für Erkältungskrankheiten um das 3-5fache
 Dass Vitamin C überaus hilfreich ist zur Vorbeugung und Therapie von Erkältungskrankheiten, glaubt zwar eine große Mehrheit der Bevölkerung (vgl. PISA-Test für Erwachsene). Nichtsdestotrotz ist dies eine klassische medizinische Fehlannahme, wie eine Cochrane-Studie erst unlängst gezeigt hat (Vitamin C gegen Erkältungen). Nur sehr wenig bekannt ist andererseits jedoch, dass Schlafstörungen und ein unruhiger Schlaf ebenso wie eine sehr kurze nächtliche Schlafdauer, ein mehrfach erhöhtes Risiko für Erkältungskrankheiten mit sich bringen.
Dass Vitamin C überaus hilfreich ist zur Vorbeugung und Therapie von Erkältungskrankheiten, glaubt zwar eine große Mehrheit der Bevölkerung (vgl. PISA-Test für Erwachsene). Nichtsdestotrotz ist dies eine klassische medizinische Fehlannahme, wie eine Cochrane-Studie erst unlängst gezeigt hat (Vitamin C gegen Erkältungen). Nur sehr wenig bekannt ist andererseits jedoch, dass Schlafstörungen und ein unruhiger Schlaf ebenso wie eine sehr kurze nächtliche Schlafdauer, ein mehrfach erhöhtes Risiko für Erkältungskrankheiten mit sich bringen.
Dies hat eine jetzt in der Zeitschrift "Archives of Internal Medicine" veröffentlichte experimentelle Studie gezeigt. Insgesamt 153 gesunde Personen, etwa gleich viele Männer und Frauen im Alter von 21-55 Jahren (Durchschnitt: 37 Jahre) nahmen an der Studie teil, die in den Jahren 2000-2004 durchgeführt wurde. Im Kern bestand das Experiment darin, den Teilnehmern durch die Nase eine Flüssigkeit zu verabreichen, die auch Viren für eine Erkältungskrankheit enthielt. Mit Nasenspülungen wurde zusätzlich versucht, die Viren zu vermehren.
Dann wurde mehrfach mit medizinischen Untersuchungen, aber auch durch Befragung der Teilnehmer überprüft, ob sich eine Erkältung entwickelt hatte oder ob das Immunsystem des Körpers die Viren erfolgreich bekämpfen konnte. Um zu analysieren, welchen Einfluss die Schlafgewohnheiten der Teilnehmer auf das Erkältungsrisiko haben, wurden schon einige Zeit vor Beginn des Experiments, aber auch mehrfach während des Experiments Befragungen durchgeführt zum Schlaf: Zeitliche Dauer in Stunden, Zeitanteil vom Zubettgehen bis zum Aufstehen ohne richtigen Schlaf, Gefühle des Erholtseins oder der Müdigkeit am frühen Morgen nach dem Aufstehen und anderes mehr. Darüber hinaus wurden umfängliche Kontrolluntersuchungen zum Gesundheitszustand vor, während und nach dem Experiment durchgeführt und viele Angaben erfragt zum Gesundheitsverhalten (Rauchen, Bewegung, Alkoholkonsum) und zum psychologischen Befinden (Stress, Lebensqualität usw.).
Als Ergebnis zeigte sich dann:
• Etwa 35 Prozent der Teilnehmer bekamen eine Erkältungskrankheit, festgestellt anhand einer objektiv nachgewiesenen Infektion mit dem Virus und weiterer medizinischer Kriterien (Beschaffenheit des Nasenschleims). Noch ein wenig mehr Teilnehmer (43 Prozent) hatten eine Erkältung, festgestellt anhand einer Infektion und subjektiver Wahrnehmungen und Empfindungen.
• Sowohl die nächtliche Schlafdauer als auch die Schlaf-Intensität (Schlafstörungen, Aufwachphasen, Zeit vom Zubettgehen bis zum Einschlafen) zeigten dann deutliche Einflüsse auf das Erkältungs-Risiko. Diese Effekte bestätigten sich dann auch in multivariaten Analysen, wenn eine Vielzahl anderer Faktoren (Alter, Gesundheitszustand, Gesundheitsverhalten, Wohlbefinden usw.) in die Analyse einbezogen wurde.
• Teilnehmer mit einer durchschnittlichen Schlafzeit von weniger als 7 Stunden waren in der Studie dreimal so oft (OR: 2,94) von einer Erkältung betroffen im Vergleich zu anderen mit 8 und mehr Stunden Schlaf.
• Ein noch deutlicherer Effekt zeigte sich für die Schlafintensität, also die Zeitanteile zwischen Zubettgehen und Aufstehen, die tatsächlich mit Schlaf verbracht wurden und nicht mit Umherwälzen oder Wachliegen. Hier zeigte sich: Personen, die maximal 92% ihrer nächtlichen Ruhezeit auch tatsächlich schlafen, haben ein 5,5mal so hohes Risiko für Erkältungen, verglichen mit effektiven Schläfern, die 98% oder mehr der nächtlichen Ruhe auch tatsächlich im Schlaf verbringen.
Abstract der Studie: Sheldon Cohen u.a.: Sleep Habits and Susceptibility to the Common Cold (Arch Intern Med. 2009;169(1):62-67)
Gerd Marstedt, 13.1.09
Mehr Sport und körperliche Bewegung ist auch langfristig erreichbar - durch ärztliche Verordnung und persönliche Betreuung
 Das Bemühen vieler Projekte zur Gesundheitsförderung, Bewegungsmuffel zu mehr Sport und körperlicher Aktivität zu motivieren, war bislang durchaus erfolgreich. Mit einer kleinen Einschränkung allerdings: Die bewirkten Verhaltensänderungen hielten oftmals nur wenige Monate an, dann kehrten die Teilnehmer zu ihrem alten Trott zurück. Eine jetzt im Januar 2009 im "British Medical Journal" veröffentlichte Langzeitstudie aus Neuseeland hat nun gezeigt, dass bei einem erheblichen Teil der Studienteilnehmer (etwa 40 Prozent) auch noch nach zwei Jahren ein deutlich gesteigertes Maß an Bewegung erreichbar ist. Maßgeblich dafür scheint einerseits eine längerfristige persönliche Betreuung der Teilnehmer durch Krankenpfleger/innen zu sein, zum anderen eine ärztliche Verordnung der Bewegungsübungen, die den Teilnehmern deutlich zu machen scheint: Dies ist nicht allein Freizeitspaß, sondern auch Therapie.
Das Bemühen vieler Projekte zur Gesundheitsförderung, Bewegungsmuffel zu mehr Sport und körperlicher Aktivität zu motivieren, war bislang durchaus erfolgreich. Mit einer kleinen Einschränkung allerdings: Die bewirkten Verhaltensänderungen hielten oftmals nur wenige Monate an, dann kehrten die Teilnehmer zu ihrem alten Trott zurück. Eine jetzt im Januar 2009 im "British Medical Journal" veröffentlichte Langzeitstudie aus Neuseeland hat nun gezeigt, dass bei einem erheblichen Teil der Studienteilnehmer (etwa 40 Prozent) auch noch nach zwei Jahren ein deutlich gesteigertes Maß an Bewegung erreichbar ist. Maßgeblich dafür scheint einerseits eine längerfristige persönliche Betreuung der Teilnehmer durch Krankenpfleger/innen zu sein, zum anderen eine ärztliche Verordnung der Bewegungsübungen, die den Teilnehmern deutlich zu machen scheint: Dies ist nicht allein Freizeitspaß, sondern auch Therapie.
Teilnehmerinnen der Studie waren 1.089 Frauen im Alter von 40 bis 74 Jahren. Sie wurden zur Mitarbeit gewonnen, indem man ärztliche Praxen in Wellington, Neuseelandn darum bat, geeignete Patientinnen anzusprechen. Kriterium für eine Teilnahme an der Studie war neben dem Alter lediglich, ob die Frauen aufgrund ihres Gesundheitszustands mehr körperliche Bewegung durchführen könnten und im Augenblick aber eher bewegungsfaul waren (weniger als 30 Minuten Bewegung an 5 Tagen in der Woche). Die Frauen wurden dann nach dem Zufallsprinzip entweder der Kontroll- oder Interventionsgruppe zugeordnet.
In der Interventionsgruppe wurde mit allen Frauen zu Beginn ein etwa 10minütiges Gespräch geführt, in dem sie meist von einem Arzt, zum Teil aber auch von einer Pflekraft zu mehr Bewegung motiviert wurden. Daüber hinaus bekamen sie aber auch praktische Tipps und Hinweise dafür. Die Details der vorgeschlagenen Übungen sowie angestrebte gesundheitliche Ziele wurden auf einem besonderen, grünen Bogen Papier vermerkt, der einer ärztlichen Verordnung ähnelte. In der Folgezeit wurden die Mitglieder der Interventionsgruppe dann telefonisch von einer Pflegekraft betreut, die sie motivierte, Tipps zum Durchhalten gab, und darüber hinaus auch nach 6 Monaten körperlich untersuchte (Blutdruck, BMI usw.) Im Durchschnitt gab es in den ersten neun Monaten etwa 5 Telefongespräche pro Teilnehmer mit einer etwa 15minütigen Dauer, später waren es weniger Telefonate.
Kontrolluntersuchungen der Teilnehmer wurden dann nach 12 Monaten sowie zum Studienende nach 24 Monaten durchgeführt und mit den Daten zum Studienbeginn verglichen. Die Ausfallquote zum Studienende war dabei erfreulich niedrig, immerhin waren nach zwei Jahren in der Interventionsgruppe noch 89% dabei. Als Ergebnis der Gesundheitsförderungs-Maßnahme zeigte sich dann:
• Während zu Beginn der Studie nur 10% in der Interventionsgruppe mindestens 150 Minuten körperliche Bewegung mittlerer Intensität pro Woche hatten, waren es nach einem Jahr dann 43% und nach zwei Jahren noch 39%.
• Die Werte der Kontrollgruppe lagen darunter. Allerdings überrascht, dass auch in der Kontrollgruppe der Anteil körperlich aktiver Teilnehmer von 11% auf 33% nach zwei Jahren gestiegen ist. Da diese Gruppe keine persönliche Betreuung durch Krankenpfleger/innen erhielt, muss die ärztliche Ansprache einen sehr hohen Motivations-Effekt gehabt haben.
• Die Teilnehmer der Interventionsgruppe zeigte zum Studienende auch bessere Werte, was Wohlbefinden und psychische Gesundheit anbetrifft, sowohl im Vergleich zum Studienbeginn als auch im Vergleich zur Kontrollgruppe.
• Hinsichtlich einer Reihe klinischer Indikatoren , die ebenfalls erfasst worden waren (Blutdruck, BMI, Messwerte aufgrund von Blutanalysen) zeigten sich keine Unterschiede.
• Negativ ins Gewicht fiel, dass die Interventionsgruppe mehr Stürze und Verletzungen aufzuweisen hatte, die allerdings nicht schwerwiegender Natur waren.
In der Veröffentlichung zur Studie ist leider nicht genau geklärt, welche Selektionsmechanismen nun bei der ärztlichen Ansprache am Werk waren, und in welchem Umfang nun ohnehin schon hochmotivierte Frauen teilnahmen. Gleichwohl zeigt die Studie, dass unter bestimmten Voraussetzungen (wie insbesondere ärztliche Ansprache und längerfristige persönliche Betreuung durch Pflegekräfte) auch langfristige Effekte erzielt werden können, wenn es darum geht, Menschen zu mehr körperlicher Aktivität zu motivieren.
Die Studie ist im Volltext kostenlos verfügbar: Beverley A Lawton u.a.: Exercise on prescription for women aged 40-74 recruited through primary care: two year randomised controlled trial (BMJ 2008;337:a2509, Published 11 December 2008, doi:10.1136/bmj.a2509)
Gerd Marstedt, 11.1.09
Vermeidung und Abbau von Übergewicht: Ist die Ernährung weitaus wichtiger als körperliche Bewegung?
 Eine gesündere Ernährung und zugleich mehr Sport und körperliche Bewegung - dies gilt seit einiger Zeit als Königsweg zur Gewichtsreduktion oder Vermeidung von Übergewicht. Nach Befunden einer jetzt veröffentlichten Studie könnte es jedoch sein, dass eine gesunde und kalorienarme Ernährung eine wesentlich größere Rolle zur Vermeidung ebenso wie zum Abbau von Übergewicht spielt als die andere empfohlene Komponente "Bewegung und Energieverbrauch". Wissenschaftler verglichen in ihrer Studie verschiedene Merkmale von 149 Frauen aus ländlichen Gegenden Nigerias und von 172 afro-amerikanischen Frauen aus dem Großraum Chicago, alle im Alter von 18-59 Jahren. Im Durchschnitt wogen die Chicagoer Frauen 184 Pfund (83,5 kg), die Frauen aus Nigeria im Vergleich dazu sehr viel weniger, nämlich nur 127 Pfund (57,7 kg).
Eine gesündere Ernährung und zugleich mehr Sport und körperliche Bewegung - dies gilt seit einiger Zeit als Königsweg zur Gewichtsreduktion oder Vermeidung von Übergewicht. Nach Befunden einer jetzt veröffentlichten Studie könnte es jedoch sein, dass eine gesunde und kalorienarme Ernährung eine wesentlich größere Rolle zur Vermeidung ebenso wie zum Abbau von Übergewicht spielt als die andere empfohlene Komponente "Bewegung und Energieverbrauch". Wissenschaftler verglichen in ihrer Studie verschiedene Merkmale von 149 Frauen aus ländlichen Gegenden Nigerias und von 172 afro-amerikanischen Frauen aus dem Großraum Chicago, alle im Alter von 18-59 Jahren. Im Durchschnitt wogen die Chicagoer Frauen 184 Pfund (83,5 kg), die Frauen aus Nigeria im Vergleich dazu sehr viel weniger, nämlich nur 127 Pfund (57,7 kg).
Die Forscher hatten erwartet, dass sie bei den deutlich schlankeren nigerianischen Frauen ein sehr viel höheres Maß an körperlicher Aktivität und Bewegung feststellen würden. Zu ihrer Überraschung fanden sie jedoch keinen signifikanten Unterschied zwischen den beiden Gruppen, was den Kalorienverbrauch durch körperliche Bewegung anbetrifft. Von daher fasste die Ernährungswissenschaftlerin Amy Luke, ein Mitglied des Forschungsteams, ihre Ergebnisse recht deutlich zusammen: "Die in vielen Gesellschaften heute deutlich niedrigere Intensität und Dauer körperlicher Bewegung ist vermutlich nicht primäre Ursache der zu beobachtenden Übergewichts-Epidemie."
"Menschen verbrennen mehr Kalorien, wenn sie sich körperlich betätigen. Aber dies gleichen sie dadurch aus, dass sie dann auch mehr essen. Wir würden uns freuen, wenn körperliche Aktivität einen positiven Effekt für das Körpergewicht hat. Aber leider scheint das nicht der Fall zu sein," erklärte Richard Cooper, Ko-Autor der Studie und Vorsitzender der Abteilung für Präventiv-Medizin und Epidemiologie.
Ernährung ist nach Ansicht des Forschungsteams wahrscheinlich eine relevantere Ursache von Übergewicht als körperliche Aktivität. Die Chicagoer Frauen wiegen deutlich mehr als die nigerianischen Frauen, obwohl sie sich im Ausmaß körperlicher Bewegung und im Kalorienverbrauch nicht unterscheiden. Andererseits gibt es jedoch deutliche Unterschiede in der Ernährung. Die nigerianische Ernährung ist reich an Ballaststoffen und Kohlenhydraten und arm an Fetten und tierischem Eiweiß. Im Gegensatz dazu enthält die Chicagoer Ernährung im Durchschnitt oft 40-45 Prozent Fett und viele Fast-Food-Artikel und Fertignahrung.
Allerdings scheinen mehr Forschungsanstrengungen nötig, um die Frage der Übergewichtsursachen genauer zu klären und den Anteil von genetischen sowie verhaltensbedingten Ursachen zu bestimmen. Das Ergebnis der Forschungsgruppe steht auch in gewissem Widerspruch zu einem früheren Befund: Eine Studie in der September-Ausgabe der Zeitschrift Archives of Internal Medicine (Physical Activity and the Association of Common FTO Gene Variants With Body Mass Index and Obesity) hatte festgestellt, dass ältere Mitglieder der Amish-Religionsgemeinschaft zwar ein Gen aufweisen, das mit Übergewicht in Verbindung gebracht wird. Gleichwohl weisen die Gruppenmitglieder jedoch fast immer ein Normalgewicht auf, und zwar deshalb, weil sie viel Sport und Bewegung haben.
Hier ist ein kostenloses Abtract: Kara E. Ebersole1 u.a.: Energy Expenditure and Adiposity in Nigerian and African-American Women (Obesity (2008) 16 9, 2148-2154. doi:10.1038/oby.2008.330)
Gerd Marstedt, 8.1.09
Dollar gegen Pfunde - Finanzielle Prämien motivieren Menschen dazu, gegen ihr Übergewicht anzugehen (zumindest vorübergehend)
 Zuerst die gute Nachricht: In einer randomisierten Kontrollstudie ist es US-Wissenschaftlern gelungen, Patienten mit relativ einfachen Mitteln dazu zu bewegen, etwas gegen ihr Übergewicht zu unternehmen. Die deutlich übergewichtigen Studienteilnehmer mit einem Body-Mass-Index zwischen 30 und 40 bekamen Geldprämien, wenn sie das Ziel der Studie "16 Pfund in 16 Wochen verlieren" zumindest teilweise erreichten. Tatsächlich schafften es die Teilnehmer von zwei Untersuchungsgruppen mit unterschiedlichen Anreizen während der 16wöchigen Untersuchungsdauer im Durchschnitt 13-14 Pfund (etwa 6 Kilogramm) abzunehmen, während die durchschnittliche Gewichtsabnahme in einer Kontrollgruppe nur knapp 4 Pfund betrug (1 Pfund = 0,454 kg).
Zuerst die gute Nachricht: In einer randomisierten Kontrollstudie ist es US-Wissenschaftlern gelungen, Patienten mit relativ einfachen Mitteln dazu zu bewegen, etwas gegen ihr Übergewicht zu unternehmen. Die deutlich übergewichtigen Studienteilnehmer mit einem Body-Mass-Index zwischen 30 und 40 bekamen Geldprämien, wenn sie das Ziel der Studie "16 Pfund in 16 Wochen verlieren" zumindest teilweise erreichten. Tatsächlich schafften es die Teilnehmer von zwei Untersuchungsgruppen mit unterschiedlichen Anreizen während der 16wöchigen Untersuchungsdauer im Durchschnitt 13-14 Pfund (etwa 6 Kilogramm) abzunehmen, während die durchschnittliche Gewichtsabnahme in einer Kontrollgruppe nur knapp 4 Pfund betrug (1 Pfund = 0,454 kg).
An der Studie nahmen 57 Männer und Frauen unterschiedlicher Hautfarbe im Alter von 30-70 Jahren teil. Sie wurden im Sommer 2007 als Patienten/innen eines medizinischen Versorgungszentrums in Philadelphia telefonisch um ihre Mitarbeit gebeten. Angesprochen wurden nur gesunde Patienten/innen, die lediglich wegen eines hohen BMI (über 30) aufgefallen waren. Freiwillige wurden dann nach dem Zufallsprinzip einer von drei Gruppen zugeordnet:
• eine Kontrollgruppe, in der lediglich das Ziel aller Studienteilnehmer mitgeteilt wurde "16 Pfund in 16 Wochen abnehmen" und in der wie auch in den anderen Gruppen eine Ernährungsberaterin Tipps und Hilfen gab.
• eine Untersuchungsgruppe mit einer täglichen Lotterie-Veranstaltung. Teilnehmen durften alle, die ihr zuvor mitgeteiltes tägliches Ziel zum Abnehmen erreicht hatten, also ein geringeres Körpergewicht als zu Studienbeginn. Jeder, der dies geschafft hatte, zog dann ein Los mit einer Zahl zwischen 10 und 99 und es wurde dann eine zweistellige Gewinnzahl gezogen. Enthielt die Teilnehmerzahl zumindest eine der Gewinnziffern (z.B. eine "2" aus der Zahl "28", wenn "72" Gewinnzahl war), bekam er 10 Dollar, hatte er die exakte Gewinnzahl, bekam er 100 Dollar.
• Eine zweite Untersuchungsgruppe bot ebenfalls finanzielle Anreize. Alle Teilnehmer, die ein bestimmtes Körpergewicht durch Abnehmen erreichten, bekamen dann die Möglichkeit, auf ein Gelddepot etwas einzuzahlen, und zwar täglich eine Summe zwischen 1 Cent und 3 Dollar. Sofern sie am Ende eines Monats tatsächlich ihr Zielgewicht erreichten, würden die Wissenschaftler diesen Betrag dann verdoppeln und noch einen Bonusbetrag dazulegen. Insgesamt waren so am Ende eines Monats maximal 252 Dollar zu gewinnen, sofern man tatsächlich sein Abspeckziel erreichte.
Am Ende des 16wöchigen Versuchs zeigte sich dann, dass beide Untersuchungsgruppen tatsächlich im Durchschnitt massiv abgenommen hatten: 14 Pfund in der Gelddepot-Gruppe, 13 Pfund in der Lotterie-Gruppe. In der Kontrollgruppe hingegen betrug die Gewichtsabnahme nur knapp 4 Pfund. Während jeder zweite Teilnehmer in den beiden Untersuchungsgruppen auch das Radikal-Ziel "16 Pfund in 16 Wochen abnehmen" erreichte, schaffte dies in der Kontrollgruppe nur jeder zehnte.
Leider müssen wir hier am Schluss nun auch noch die schlechte Nachricht mitteilen: Das Prinzip des "Homo oeconomicus", der sein Verhalten allein nach dem finanziellen Vorteil ausrichtet, funktioniert auch in der Philadelphia-Abnehm-Studie nur kurzzeitig. Eine Kontroll-Untersuchung nach 7 Monaten ergab, dass die Teilnehmer der Lotterie- und Gelddepotgruppe zwar immer noch weniger Pfunde auf die Waage brachten als zu Versuchsbeginn, jedoch zeigte sich kein statistisch signifikanter Unterschied mehr zu den Teilnehmern der Kontrollgruppe.
Hier ist ein Abstract: Kevin G. Volpp u.a.: Financial Incentive-Based Approaches for Weight Loss. A Randomized Trial (JAMA. 2008;300(22):2631-2637)
Gerd Marstedt, 4.1.09
Abnehmen durch Einwerfen!? Gewichtsreduktion mit Medikamenten zwischen Euphorie, schweren Nebenwirkungen und Verbot.
 Während einer der seit Jahren wegen erheblicher Nebenwirkungen kritisierten Appetithemmer, nämlich der anfänglich euphorisch zum bequemen Ersatz für Verhaltensänderungen gegen schweres Übergewicht erkorene Cannabis-Antagonist Rimonabant (Acomplia®) im Oktober 2008 wegen starker psychiatrischer Nebenwirkungen vom Markt genommen werden musste und auch der Serotonin- und Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer Sibutramin (Reductil®) aufgrund unerwünschter Wirkungen (wie Blutdruckanstieg, kardiovaskuläre Komplikationen) von der Markteinführung in den USA an schon immer umstritten war - vgl. dazu eine Zusammenfassung im "Arznei-Telegramm" im September 2003, steht der nächste Wunderstoff - ebenfalls ein Hemmer der Wiederaufnahme von bestimmten körpereigenen Boten- und Regulierungsmitteln - vor der Tür.
Während einer der seit Jahren wegen erheblicher Nebenwirkungen kritisierten Appetithemmer, nämlich der anfänglich euphorisch zum bequemen Ersatz für Verhaltensänderungen gegen schweres Übergewicht erkorene Cannabis-Antagonist Rimonabant (Acomplia®) im Oktober 2008 wegen starker psychiatrischer Nebenwirkungen vom Markt genommen werden musste und auch der Serotonin- und Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer Sibutramin (Reductil®) aufgrund unerwünschter Wirkungen (wie Blutdruckanstieg, kardiovaskuläre Komplikationen) von der Markteinführung in den USA an schon immer umstritten war - vgl. dazu eine Zusammenfassung im "Arznei-Telegramm" im September 2003, steht der nächste Wunderstoff - ebenfalls ein Hemmer der Wiederaufnahme von bestimmten körpereigenen Boten- und Regulierungsmitteln - vor der Tür.
Noch nicht als Arzneimittel zugelassen, d.h. noch vor der gesetzlich vorgeschriebenen Phase III der klinischen Versuche vor einer Zulassungsentscheidung, beflügeln die ersten seiner im wissenschaftlich anerkannten britischen Medizinjournal "The Lancet" veröffentlichten Wirksamkeitsdaten aus Dänemark die diversen Begehrlichkeiten.
Nach den Ergebnissen des Studienaufsatzes "Effect of tesofensine on bodyweight loss, body composition, and quality of life in obese patients: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial" von Arne Astrup, Sten Madsbad, Leif Breum, Thomas J Jensen, Jens Peter Kroustrupund Thomas Meinert Larsen (The Lancet, Volume 372, Issue 9653: 1906 - 1913, 29. November 2008) soll der Wirkstoff Tesofensin bei Übergewichtigen mit einem Body Mass Index (BMI) zwischen 30 und 40 einen doppelt so hohen Gewichtsverlust verursachen wie die bisherigen Appetitzügler.
In einer randomisierten, doppelt-blinden und placebo-kontrollierten Phase-II-Studie in fünf dänischen Adipositas-Management-Zentren wurde der Wirkstoff bei zu Beginn 203 und am Ende noch 161 teilnehmenden schwer übergewichtigen Personen 24 Wochen lang gegen Placebos getestet. Außerdem variierte noch die Menge des Wirkstoffs. Alle TeilnehmerInnen erhielten schließlich nach einer zweiwöchigen Vorbereitungsphase eine kalorienreduzierte Diät. Nach den 24 Wochen hatten die Patienten, die Tesofensin erhielten, nicht nur doppelt so viel Gewicht abgebaut wie die Einnehmer von Sibutramin (Reductil) und Rimonabant (Acomplia). Je mehr vom neuen Wirkstoff eingenommen wurde desto höher waren außerdem die Gewichtsverluste: ¼ mg des Wirkstoffs führte zu einem Verlust von 6,7 kg und 1 mg zu einem von 12,8 kg Körpergewicht.
In der Studiengruppe, die lediglich die kalorienreduzierte Diät und ein Placebo erhielt, verringerte sich das Gewicht nach 24 Wochen zwar auch, aber "nur" um 2 %.
Abgesehen davon, dass vor einer möglichen Zulassung noch Phase-III-Studien durchgeführt werden müssen, gibt es aber auch in den bisherigen Ergebnissen eine Reihe frühzeitiger Hinweise auf Schattenseiten auch dieses Ersatzmittels für unbequemere und individuell aufwändigere Methoden, Fettsüchtigkeit zu reduzieren.
So werden in dem Aufsatz als unerwünschte Nebenwirkungen trockener Mund, Übelkeit, Obstipation, harte Stuhlgänge, Durchfall und Schlaflosigkeit berichtet. In einer Kombination erhöhte sich auch die Anzahl der Herzschläge. Über Langzeit-Nebenwirkungen und deren Folgeeffekte lassen sich nach der kurzen Untersuchungszeit keine belastbaren Angaben gewinnen. Unklar bleibt auch, warum 21 % der ursprünglichen TeilnehmerInnen die Studie bereits innerhalb des Zeitraums von 24 Wochen verlassen haben. Wichtig wird außerdem noch sein, ob sich der vergleichsweise hohe Gewichtsverlust auch über mehr als 6 Monate hält, ein Jo-Jo-Effekt einen Teil der Wunderwirkungen zurückholt oder gar weitere Nebenwirkungen auftreten.
Ob gegen alle diese euphoriebremsenden Hinweise schließlich doch die Einstellung gewinnt, man müsse gegen die "Volksseuche Übergewicht" auch medikamentös vorgehen, kann jedermann durch die aufmerksame Lektüre von Fachjournalen aber vor allem auch der publikumswirksamen und werbeeinnahmenabhängigen Gesundheits-Yellow-Press-Blätter selbst ab sofort erkunden.
Von dem Aufsatz "Effect of tesofensine on bodyweight loss, body composition, and quality of life in obese patients: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial" gibt es kostenlos lediglich ein Abstract.
Bernard Braun, 15.12.08
Vitamine C und E, Selen und vermutlich viele antioxidative Stoffe ohne präventive Wirkung bei Prostatakrebs. PSA-Testprobleme!
 Männer, die Sorge haben, an einer der häufigsten Krebsarten bei Männern, dem Prostatakrebs zu erkranken und glauben, eine drohende Erkrankung durch den so genannten PSA-Test frühstmöglich entdecken zu können oder gar aktiv etwas mit Nahrungsergänzungsmitteln tun zu können, um ihr Risiko zu vermindern, haben es in diesen Tagen schwer. Unabhängig von den Details dreier dafür verantwortlichen Studien zeigen sich bei dieser Gelegenheit eine Reihe von Dilemmata seriöser Versorgungsforschung.
Männer, die Sorge haben, an einer der häufigsten Krebsarten bei Männern, dem Prostatakrebs zu erkranken und glauben, eine drohende Erkrankung durch den so genannten PSA-Test frühstmöglich entdecken zu können oder gar aktiv etwas mit Nahrungsergänzungsmitteln tun zu können, um ihr Risiko zu vermindern, haben es in diesen Tagen schwer. Unabhängig von den Details dreier dafür verantwortlichen Studien zeigen sich bei dieser Gelegenheit eine Reihe von Dilemmata seriöser Versorgungsforschung.
Zum einen geht es um die seit einiger Zeit in die Öffentlichkeit gelangenden Ergebnisse der zur Zeit weltweit größten Prostatakrebs-Studie "SELECT" (Selenium and Vitamin E Cancer Prevention Trial), an der in den USA, Puerto Rico und Kanada 35.534 55-jährige und ältere Männer (unter den rund 15 % der Gruppe umfassenden afroamerikanischen Teilnehmern waren auch schon 50-Jährige, da das Prostatarisiko in dieser Subgruppe früher und häufiger auftritt) teilnehmen. Ausgangspunkt der Studie und daher auch der Namensgeber und die Ausgangspunkte für das Akronym, waren zwei Studien aus 1998 und 1996, die zeigten, dass mit der gezielten Ein- oder Aufnahme der beiden Ernährungsergänzungsmittel Selen und Vitamin E das Risiko, an Prostatkrebs zu erkranken um bis zu 32 oder gar sagenhafte 52 % Prozent gesenkt werden konnte.
Diese Ergebnisse wurden so ernst genommen, dass sie in einer seit 2001 wesentlich größeren und gezielt (in der 1998 in Finnland durchgeführten Studie bei 29.133 männlichen Rauchern sollte eigentlich nach der Präventivkraft von Vitamin E gegen Lungenkrebs geforscht werden; heraus kam u.a. die 32%-Reduktion von Prostatakrebs) gebildeten Studiengruppe und mit besserer Methodik im Rahmen der SELECT-Studie überprüft werden sollten. Diese Studie ist im Wesentlichen vom National Cancer Institute (NCI), einem der U.S. National Institutes of Health finanziert und wird von der international vernetzten Forschungsgruppe Southwest Oncology Group (SWOG) durchgeführt.
Das erste (Zwischen-)Ergebnis der Wirkungskontrolle der beiden einzeln oder kombiniert aufgenommenen Stoffe gegen verschiedene Placebogruppen gleicht daher einer sehr harten Landung auf dem Boden der Wirklichkeit. Es lautet: Für keinen der Stoffe gibt es im Vergleich mit Placebos einen nachweisbaren bzw. statistisch signifikanten Nutzen. Da es zusätzlich statistisch ebenfalls nicht signifikante Hinweise auf möglicherweise unerwünschte Effekte gibt, empfehlen die SELECT-Verantwortlichen ihren Teilnehmern, künftig auf den systematischen Verzehr dieser Stoffe zu verzichten. Zu den allerdings bisher durchweg nicht statistisch signifikanten unerwünschten Wirkungen zählt eine leichte Erhöhung des Prostatakrebsrisikos bei den Personen, die ausschließlich Vitamin E einnahmen und eine ebenfalls leichte Erhöhung eines neu auftretenden Diabetesrisikos in der nur Selen einnehmenden Teilnehmergruppe.
Die Wissenschaftler versandten darauf deutlich vor dem geplanten Ende der Studie eine schriftliche Mitteilung an die Studienteilnehmer, in der sie diese Ergebnisse erläuterten, ihnen rieten die Einnahme von Selen und Vitamin E zu stoppen und ihnen trotzdem die Teilnahme an weiteren Prostatauntersuchungen und PSA-Tests anboten.
Einer der Studienleiter, Eric Klein, fasste den nunmehr neu fokussierten Nutzen des Fortgangs der Studie so zusammen: "As we continue to monitor the health of these 35.000 men, this information may help us understand why two nutrients that showed strong initial evidence to be able to prevent prostate cancer did not do so."
In zwei großen peer-reviewten Publikationen in der neuesten Ausgabe des Medizinjournals JAMA vom 9. Dezember 2008 werden diese Ergebnisse zum einen voll bestätigt und inhaltlich noch beträchtlich erweitert.
Das kostenlos erhältliche Abstract des Aufsatzes "Effect of Selenium and Vitamin E on Risk of Prostate Cancer and Other Cancers: The Selenium and Vitamin E Cancer Prevention Trial (SELECT)" von Scott M. Lippman; Eric A. Klein; Phyllis J. Goodman; M. Scott Lucia; Ian M. Thompson; Leslie G. Ford; Howard L. Parnes; Lori M. Minasian; J. Michael Gaziano; Jo Ann Hartline; J. Kellogg Parsons; James D. Bearden III; E. David Crawford; Gary E. Goodman; Jaime Claudio; Eric Winquist; Elise D. Cook; Daniel D. Karp; Philip Walther; Michael M. Lieber; Alan R. Kristal; Amy K. Darke; Kathryn B. Arnold; Patricia A. Ganz; Regina M. Santella; Demetrius Albanes; Philip R. Taylor; Jeffrey L. Probstfield; T. J. Jagpal; John J. Crowley; Frank L. Meyskens Jr; Laurence H. Baker und Charles A. Coltman Jr. endet eindeutig: "Selenium or vitamin E, alone or in combination at the doses and formulations used, did not prevent prostate cancer in this population of relatively healthy men."
Zusätzlich zum Ende eines vermuteteten Nutzens von Selen und Vitamin E erweisen sich aber auch weitere antioxidative und damit als präventiv wirkend anmutende und beworbene Vitamine als nutzlos für die Prävention von Prostatakrebs. Dies ist jedenfalls das ebenso klare wie eindeutige Ergebnisse einer Untersuchung im Rahmen einer der großen Mänbnergesundheitsuntersuchungen in den USA, der Phycisian Health Study II" zur präventiven Wirkung der Vitamine E und C.
Die Schlussfolgerung des ebenfalls kostenlosen Abstracts zum Aufsatz "Vitamins E and C in the Prevention of Prostate and Total Cancer in Men: The Physicians' Health Study II Randomized Controlled Trial" von J. Michael Gaziano; Robert J. Glynn; William G. Christen; Tobias Kurth; Charlene Belanger; Jean MacFadyen; Vadim Bubes; JoAnn E. Manson; Howard D. Sesso und Julie E. Buring lautet unmissverständlich: "In this large, long-term trial of male physicians, neither vitamin E nor C supplementation reduced the risk of prostate or total cancer. These data provide no support for the use of these supplements for the prevention of cancer in middle-aged and older men."
In einem Kommentat der JAMA-Herausgeber heißt es zusammenfassend daher auch "physicians should not recommend selenium or vitamin E — or any other antioxidant supplements — to their patients for preventing prostate cancer."
Da in der Frühdiagnose der gut- oder bösartigen Veränderungen von Prostatakrebs die Messung des PSA-Wertes (Prostate specific antigen) eine große Rolle spielt und ein Screening mit dieser Messung immer wieder gefordert wird, sind die im Oktober 2008 im "Journal of the National Cancer Institute" der USA veröffentlichten Ergebnissen einer Beobachtungsstudie über die Effekte der Einnahme von Statinen auf die PSA-Werte geeignet, die auch schon zuvor im Forum-Gesundheitspolitik dokumentierten Zweifel an der Aussagefähigkeit und Sicherheit des PSA-Tests noch mehr zu schüren und entsprechende Verhaltensunsicherheiten zu fördern.
In dieser Studie wurden die PSA-Werte von rund 1.214 Männern, die alle in einem Gesundheitszentrum der Veteranen-Krankenversicherung in North Carolina behandelt wurden, und eine gesunde Prostata hatten, in den zwei Jahren vor der Verordnung von Statinen und ein Jahr nach nach dem Beginn der Einnahme dieses omnipotenten Wirkstoffs zur Reduktion von Herzkreiserkrankungen, Schlaganfällen, Lungenentzündungen, Thrombosen und Alzheimer ("the world's top-selling drugs") gemessen. Der PSA-Wert sank nach Beginn der Statineinnahme um rund 4%. Bevor nun Statine zum neuesten Wundermittel auch gegen das Risiko von Prostatakrebs erkoren werden, wiesen die Forscher darauf hin, dass ihr Ergebnis nicht kläre, ob Statine eine präventive oder therapeutische Wirkung auf dieses Risiko besäßen oder nur einfach auf unbekannte aber folgenreiche Weise den PSA-Wert beeinflussten.
Eines der mit diesem Ergebnis verbundenen praktischen Risiken fasste einer der Wissenschaftler so zusammen: "In a good proportion of these men, the PSA levels declined sufficiently to a point where physicians might not recommend a biopsy (dient zur Bestätigung des durch den PSA-Wert indizierten Krebsverdachts), so it's really important that we understand what's at work here, so we can be sure we're not missing cancers because of deceptively low PSA levels."
Erst eine randomisierte kontrollierte Studie mit histologischen Endpunkten könne klären, welche Zusammenhänge wirklich bestünden. Trotzdem müssen sich Männer, die Statine einnehmen und gleichzeitig einen PSA-Test durchführen fragen, was ihnen und ihrem behandelnden Arzt ein bestimmter PSA-Wert nun wirklich zu ihrem Prostatakrebsrisiko sagen.
Ausführliche Fragen und Antworten zur SELECT-Studie gibt es kostenlos auf der Projekt-Homepage.
Die aktuellen Ergebnisse der Studie finden sich in der NCI-Meldung "Review of Prostate Cancer Prevention Study Shows No Benefit for Use of Selenium and Vitamin E Supplements", die kostenfrei erhältlich ist.
Eine komplette Version des 13-Seiten-JAMA-Aufsatzes "Vitamins E and C in the Prevention of Prostate and Total Cancer in Men. The Physicians' Health Study II Randomized Controlled Trial ist auch kostenlos erhältlich.
Die komplette Version des 14-seitigen JAMA-Aufsatzes "Effect of Selenium and Vitamin E on Risk of Prostate Cancer and Other Cancers. The Selenium and Vitamin E Cancer Prevention Trial (SELECT)" ist genauso wie das umfangreiche Editorial "Randomized Trials of Antioxidant Supplementation for Cancer Prevention First Bias, Now Chance—Next, Cause" zu den beiden Aufsätzen kostenlos zu erhalten
Über die ungeklärten Effekte der Einnahme von Statinen auf den Prostatakrebs-Risikowert PSA gibt es kostenfrei lediglich ein Abstract des Aufsatzes von Robert J. Hamilton, Kenneth C. Goldberg, Elizabeth A. Platz und Stephen J. Freedland The Influence of Statin Medications on Prostate-specific Antigen Levels im "Journal of the National Cancer Institute"
Bernard Braun, 10.12.08
Gesunde oder ungesunde Ernährung: Maßgeblich ist auch die Angebotsstruktur der Lebensmittelgeschäfte und Restaurants
 Das Ernährungsverhalten ist nicht nur abhängig von erlernten Vorlieben und Gewohnheiten, sondern wird auch davon beeinflusst, welches Angebot an Nahrungsmitteln und Speisen es in Lebensmittelgeschäften und Restaurants des Wohnbezirks gibt - dies hat jetzt eine US-amerikanische Meta-Analyse von 54 Studien aufgezeigt. Alle Untersuchungen wurden im Zeitraum 1985-2008 veröffentlicht und behandelten in unterschiedlicher Form das Thema "Struktur der Lebensmittelgeschäfte und Restaurants im Stadtteil bzw. Wohnort und Zusammenhänge zum Ernährungsverhalten und Vorkommen von Übergewicht".
Das Ernährungsverhalten ist nicht nur abhängig von erlernten Vorlieben und Gewohnheiten, sondern wird auch davon beeinflusst, welches Angebot an Nahrungsmitteln und Speisen es in Lebensmittelgeschäften und Restaurants des Wohnbezirks gibt - dies hat jetzt eine US-amerikanische Meta-Analyse von 54 Studien aufgezeigt. Alle Untersuchungen wurden im Zeitraum 1985-2008 veröffentlicht und behandelten in unterschiedlicher Form das Thema "Struktur der Lebensmittelgeschäfte und Restaurants im Stadtteil bzw. Wohnort und Zusammenhänge zum Ernährungsverhalten und Vorkommen von Übergewicht".
Folgende Einzelergebnisse werden hervorgehoben, was Einkaufsmöglichkeiten für Lebensmittel anbetrifft:
• Supermärkte bieten (zumindest in den USA) im Unterschied zu kleineren Lebensmittelläden eine größere Auswahl an qualitativ guten und auch frischen Lebensmitteln an. Kleinere Lebensmittelgeschäfte sind nach Untersuchungen mehrerer US-Studien im Durchschnitt teurer, haben häufiger sehr kalorienreiche Lebensmittel im Angebot und weniger frische Produkte (Obst, Salat, Gemüse). Diese Befunde erklären dann auch teilweise, warum in anderen Studien mehrfach festgestellt wurde, dass die räumliche Nähe zu Supermärkten bzw. vergleichbaren Einkaufseinrichtungen im Wohnort oder Stadtteil auch mit einem gesünderen Ernährungsverhalten in Zusammenhang steht.
• Besonders deutlich gilt dies für ethnische Minderheiten. Eine Studie fand heraus, dass bei einer größeren Zahl von Supermärkten im Stadtteil oder Wohnort das Ernährungsverhalten bei Schwarzen deutlich häufiger als bei Weißen gesünder ist und Ernährungsleitlinien näher kommt.
• Der Zugang zu Supermärkten zeigt nicht nur Zusammenhänge zum Ernährungsverhalten, sondern auch zur Prävalenz von Übergewicht in der untersuchten Region. So fand eine große Studie mit 10.000 Teilnehmern in vier verschiedenen Bundesstaaten einen deutlichen Zusammenhang zwischen der Struktur der Lebensmittelgeschäfte (Anteil der Supermärkte) und dem Anteil Übergewichtiger in der jeweiligen Region. Dieser Befund hatte auch Bestand nach einer statistischen Kontrolle vieler anderer potentieller Einflussfaktoren (Rasse, Alter, Geschlecht, Einkommen, körperliche Bewegung usw.)
• Problematisch muss in diesem Zusammenhang dann erscheinen, dass sich kleinere Lebensmittelgeschäfte mit fehlendem oder schwachem Angebot an frischen Lebensmitteln, Gemüse und Obst häufiger in problematischen Stadtteilen niederlassen: in Gegenden mit sozial benachteiligten Bewohnern oder hohem Anteil Schwarzer. Ebenso fand man solche Läden sehr häufig in der Nähe von Schulen.
Auch die Studien zum Einfluss des jeweiligen Gastronomie-Angebots zeigten einige überraschende Befunde:
• Mehrere Untersuchungen haben belegt, dass ein häufiger Besuch von Restaurants (statt zu Hause zu essen) im Durchschnitt mit einer weniger gesunden Zusammensetzung der Speisen (Anteile von Fett, Salz, Ballaststoffen, Gemüse usw.) einhergeht.
• Dabei spielt auch der Preis eine Rolle: In einer sehr großen Studie mit über 70.000 Befragten wurde ermittelt, dass ein um 10 Prozent höherer Preis von Fast-Food-Mahlzeiten bedeutet, dass der Verzehr von frischem Gemüse und Obst um 3 Prozent höher ausfällt.
• Die Frage, ob die Zahl der Fast-Food-Restaurants in einem Bezirk auch verantwortlich ist für eine höhere Prävalenz von Übergewicht, ließ sich bislang nicht eindeutig beantworten. Einige Studien fanden solche Zusammenhänge, andere nicht.
• Ähnlich wie bei Lebensmittelgeschäften zeigt sich auch für Restaurants und Fast-Food-Restaurants im Besonderen, dass sie sich die Lage sehr genau aussuchen und dabei oft Gegenden mit hohem Anteil von Unterschicht-Angehörigen, bevorzugen die ohnehin schon höhere Erkrankungsrisiken aufweisen - aufgrund von Verhaltensweisen wie Rauchen, aber auch aufgrund schlechterer Wohn-, Arbeits- und Umgebungsbedingungen.
• Eine Studie im Großraum Los Angeles hat die Speisen von fast 700 Restaurants überprüft. Es zeigte sich, dass der Anteil an gesunden Speiseangeboten sehr viel größer in jenen Gegenden war, in denen mehr Oberschicht-Angehörige lebten.
• Problematisch erscheint auch, dass Fast-Food-Restaurants sich sehr häufig in der Nähe von Schulen niederlassen. 37 Prozent aller Schulen in den USA befinden sich in unmittelbarer Nachbarschaft zumindest eines Fast-Food-Restaurants. Und dabei lässt sich auch wiederum zeigen, dass diese sich sehr viel häufiger in Bezirken mit hohem Anteil von Unterschicht-Angehörigen befinden.
Die referierten Studien sind teilweise sicherlich beschränkt auf US-amerikanische Verhältnisse, und eine direkte Übertragung der Befunde auf Deutschland oder Europa fällt teilweise schwer. So kann man sicherlich die in der Veröffentlichung immer wieder genannten Gleichungen "Supermarkt = Angebot preisgünstiger frischer und gesunder Lebensmittel" versus "kleines Lebensmittelgeschäft = Angebot teurer, kalorienreicher Lebensmittel und Fertiggerichte" nicht übernehmen. Ein weiteres Problem ist darin zu sehen, dass die ausgewerteten Beobachtungs-Studien keinen Hinweis geben auf Kausalzusammenhänge: Schafft das Angebot an Lebensmitteln oder Restaurant-Speisen erst die jeweilige Nachfrage an ungesunden Speisen oder ist es eher umgekehrt?
Auch wenn Kommunalpolitiker nicht oder nur sehr begrenzt darüber befinden können, wo sich Restaurants oder Lebensmittelgeschäfte niederlassen, bleibt als Fazit der Meta-Analyse festzuhalten, dass die Verursachungszusammenhänge für eine ungesunde Ernährung und Übergewicht nicht nur an "schlechten Gewohnheiten" der Individuen festzumachen sind, sondern teilweise massiv verstärkt werden durch die lokale Infrastruktur der Anbieter von Lebensmitteln und Speisen.
Hier ist ein Abstract zur Studie: Nicole I. Larson u.a.: Neighborhood Environments: Disparities in Access to Healthy Foods in the U.S (American Journal of Preventive Medicine, Article in Press, Corrected Proof, Available online 1 November 2008)
Gerd Marstedt, 3.12.08
Steigt der Alkoholpreis, sinken Konsum und alkoholbedingte Todesfälle - und umgekehrt
 Der Preis für alkoholische Getränke, der von staatlicher Seite ja über die Alkoholsteuer (in Deutschland die "Branntweinsteuer") sehr einfach nach oben oder unten geschraubt werden kann, ist Steuerungsinstrument für den Konsum. Und dass nicht nur der Alkoholkonsum, sondern auch die davon beeinflussten Erkrankungen und Todesfälle beeinflussbar sind, haben jetzt zwei neue Studien gezeigt. Dabei wurden in den beiden Gebieten, in denen die Daten erfasst wurden - Finnland und der US-Staat Alaska - zwei konträre Trends beobachtet. Während in Finnland erhebliche Preissenkungen für Alkohol ab 2004 einen Anstieg der alkoholbedingten Mortalität bewirkten, sorgten in Alaska zwei deutliche Erhöhungen der Alkoholsteuer in den Jahren 1983 und 2002 für ein Absinken dieser Todesfälle.
Der Preis für alkoholische Getränke, der von staatlicher Seite ja über die Alkoholsteuer (in Deutschland die "Branntweinsteuer") sehr einfach nach oben oder unten geschraubt werden kann, ist Steuerungsinstrument für den Konsum. Und dass nicht nur der Alkoholkonsum, sondern auch die davon beeinflussten Erkrankungen und Todesfälle beeinflussbar sind, haben jetzt zwei neue Studien gezeigt. Dabei wurden in den beiden Gebieten, in denen die Daten erfasst wurden - Finnland und der US-Staat Alaska - zwei konträre Trends beobachtet. Während in Finnland erhebliche Preissenkungen für Alkohol ab 2004 einen Anstieg der alkoholbedingten Mortalität bewirkten, sorgten in Alaska zwei deutliche Erhöhungen der Alkoholsteuer in den Jahren 1983 und 2002 für ein Absinken dieser Todesfälle.
Eine epidemiologische Studie, die sämtliche Einwohner Finnlands im Alter über 14 Jahren einbezog, hat gezeigt, dass die dort im Jahr 2004 umgesetzte deutliche Senkung der Preise für alkoholische Getränke zu einem Anstieg der alkoholbedingten Todesfälle geführt hat. Dieser Anstieg betrug 16 Prozent bei Männern und 31 Prozent bei Frauen. Die Autoren der Studie analysierten Mortalitäts-Daten von über 4 Millionen Finnen, und zwar in zwei Zeiträumen: 2001-2003 und 2004-2005. Anfang 2004 war in Finnland zu beobachten, dass die Preise für alkoholische Getränke merklich billiger wurden. Zum einen war es den Finnen jetzt erlaubt, sich aus anderen EU-Ländern in unbegrenztem Umfang alkoholische Getränke für den persönlichen Bedarf zu beschaffen und die Preise hierfür lagen in Nachbarländern wie insbesondere Estland ganz erheblich unter dem finnischen Niveau. Zum anderen wurden im März 2004 die Alkoholsteuern um durchschnittlich etwa 33% gesenkt. Dies bewirkte sinkende Preise für beispielsweise Wein um 3%, Bier um 13% und andere alkoholische Getränke um 17-25%. Beide Änderungen führten zu einem nicht unerheblichen Anstieg des Alkoholkonsums in Finnland um etwa 10-12 Prozent.
Die Wissenschaftler analysierten dann Daten für alkoholbedingte Todesfälle, worunter sowohl akute wie auch chronische Krankheiten (u.a. Leberzirrhose) fielen. Es zeigte sich dann im Vergleich der Zeiträume 2001-2003 und 2004-2005, dass diese Todesfälle um 16% bei Männern und um 31% bei Frauen angestiegen waren. Besonders deutliche Steigerungsraten ergaben sich für Todesfälle durch Leberzirrhose. Dieser Anstieg betrug bei Männern 38 Prozent und bei Frauen 41 Prozent. Weiterhin zeigten sich besonders große Anstiege bei Langzeitarbeitslosen und Rentnern.
Gegen das Argument, dass eine Leberzirrhose erst nach einem langjährigen Zeitraum des Alkoholmissbrauchs entsteht und ihre kurzen Beobachtungszeiträume nicht beweiskräftig sind, führen sie ins Feld, dass andere Studien bereits gezeigt haben, dass sich auch eine kurzfristige Erhöhung der Alkoholmenge bemerkbar macht: "Man kann hierfür das Bild des Wasserglases verwenden. Bei jenen, die an Leberzirrhose während des kurzen Zeitraums nach der Preissenkung starben, war das Wasserglas schon fast randvoll und die dann höhere Verzehrmenge brachte es sehr schnell zum Überlaufen."
In der zweiten Studie analysierten Wissenschaftler der Universität von Florida Effekte für die alkoholbedingte Mortalität, die sich aus genau gegenläufigen Veränderungen ergaben. Im US-Bundesstaat Alaska waren nämlich in den Jahren 1983 und 2002 die Alkoholsteuern deutlich erhöht worden, und zwar von 46 auf 63 Cent pro Gallone im Jahr 1983 (ein Plus von etwa 33%) und von 63 Cent auf 1,20 Dollar im Jahr 2002, also nahezu eine Verdopplung.
Die Wissenschaftler ermittelten dann für den Zeitraum von 1976 bis 2004 Mortalitätsquoten in Alaska, die mit übermäßigem Alkoholkonsum in Zusammenhang stehen. Diese für jedes Vierteljahr ermittelten Quoten zeigten dann auffällige Kurvenverläufe, und zwar Abwärtstendenzen bereits kurze Zeit nach den Erhöhungen der Alkoholsteuer in den beiden Jahren 1983 und 2004. Der Verteuerung von Wein, Bier und Spirituosen im Jahr 1983 folgte relativ bald eine Senkung der (alkoholbedingten) Mortalität um 29 Prozent, was konkret bedeutet: 23 Todesfälle waren pro Jahr weniger zu verzeichnen. Die Steuererhöhung 2002 schlug sich nieder in einer Senkung der Mortalität um 11 Prozent oder 21 vermiedenen Todesfällen pro Jahr.
Der beobachtete Effekt war nicht nur kurzfristig wirksam, sondern blieb auch über einen längeren Zeitraum bestehen. Die Forscher heben in ihrer Zusammenfassung der Befunde hervor, dass sie selbst überrascht waren, wie schnell und quantitativ deutlich sich die Erhöhungen der Alkoholsteuer niederschlagen. Im Vergleich zu den Effekten anderer Maßnahmen zur Senkung des Alkoholkonsums wie beispielsweise Schulprogramme oder Medienkampagnen seien damit Steuererhöhungen etwa 2-4mal so effektiv.
Hier ist ein Abstract der finnischen Studie: Kimmo Herttua u.a.: Changes in Alcohol-Related Mortality and its Socioeconomic Differences After a Large Reduction in Alcohol Prices: A Natural Experiment Based on Register Data (American Journal of Epidemiology, published online on August 20, 2008, doi:10.1093/aje/kwn216)
Ein Abstract der Alaska-Studie: Alexander C. Wagenaar u.a.: Effects of Alcohol Tax Increases on Alcohol-Related Disease Mortality in Alaska: Time-Series Analyses from 1976 to 2004 (American Journal of Public Health, 10.2105/AJPH.2007.131326)
Gerd Marstedt, 28.11.08
Tabakentwöhnung anlässlich eines Klinikaufenthalts: Die Erfolgsquoten sind beachtlich
 In fast allen Krankenhäusern in Deutschland gilt heute ein Rauchverbot, oftmals sogar im Außenbereich. Raucher müssen zumindest vorübergehend auf ihr Laster verzichten, was jedoch oftmals aufgrund körperlicher Schwächen oder Beschwerden nicht besonders schwer fällt. Von daher scheint es im Grunde naheliegend, den vorübergehend erzwungenen Rauchstopp in einen freiwilligen und dauerhaften Nikotinverzicht zu überführen. Ärzte oder anderes medizinisches Personal könnte dazu Hilfe leisten. In den USA gilt die Beratung von Rauchern unter den Klinikpatienten zur Tabakentwöhnung inzwischen sogar als Indikator der Versorgungsqualität.
In fast allen Krankenhäusern in Deutschland gilt heute ein Rauchverbot, oftmals sogar im Außenbereich. Raucher müssen zumindest vorübergehend auf ihr Laster verzichten, was jedoch oftmals aufgrund körperlicher Schwächen oder Beschwerden nicht besonders schwer fällt. Von daher scheint es im Grunde naheliegend, den vorübergehend erzwungenen Rauchstopp in einen freiwilligen und dauerhaften Nikotinverzicht zu überführen. Ärzte oder anderes medizinisches Personal könnte dazu Hilfe leisten. In den USA gilt die Beratung von Rauchern unter den Klinikpatienten zur Tabakentwöhnung inzwischen sogar als Indikator der Versorgungsqualität.
Doch wie erfolgreich sind solche Interventionen? Ist mit der Entlassung aus dem Krankenhaus und der Wiederherstellung der Gesundheit womöglich auch der Wille zum Tabakverzicht schnell vergessen? Eine Meta-Analyse von insgesamt 33 Interventionsstudien, überwiegend aus Ländern in Nordamerika und Europa, hat jetzt deren Erfolg oder Misserfolg noch einmal näher unter die Lupe genommen. Alle Studien waren zwischen 1990 und 2007 durchgeführt worden. Einschlusskriterium war eine Randomisierung der Teilnehmer, also eine zufällige Zuweisung zu einer Interventions- oder Kontrollgruppe sowie eine Verlaufskontrolle über mindestens 6 Monate.
Die Dauer der ersten Beratung variierte erheblich und lag zwischen 5 und 60 Minuten. In den allermeisten Fällen wurde diese Beratung durch einen Krankenpfleger oder eine Pflegerin oder einen speziell ausgebildeten Trainer durchgeführt, in jeder dritten Studie war zumindest kurzfristig auch ein Arzt beteiligt. Einige Studien boten nur diese einmalige Beratung, in anderen Projekten wurde bis zu 6 Monate nach der Entlassung aus dem Krankenhaus noch Unterstützung gewährt. In insgesamt sechs Projekten wurde auch der Erfolg einer medikamentösen Therapie, und zwar ganz unabhängig von Informations- und Beratungsmaßnahmen geprüft. Bei diesen Nikotinersatztherapien kamen die Wirkstoffe NRT oder Bupropion zum Einsatz.
Zur Überprüfung des Erfolgs der verschiedenen Interventionen wurden diese zunächst nach der Intensität der Beratung in vier Gruppen eingeteilt:
• (1) Einmalige Beratung im Krankenhaus von maximal 15 Minuten, nach Entlassung keine Unterstützung
• (2) Ein- oder mehrmalige Beratung im Krankenhaus von mehr als 15 Minuten Dauer, nach Entlassung keine Unterstützung
• (3) Beliebige Häufigkeit und Dauer der Klinikberatung, nach Entlassung weitere Unterstützung bis zu einem Monat
• (4) Beliebige Häufigkeit und Dauer der Klinikberatung, nach Entlassung auch länger als ein Monat weitere Unterstützung
Für die Typen 1-3 fand sich kein positiver Effekt im Vergleich zu Kontrollgruppen, d.h. diese Minimalformen der Beratung zur Tabakentwöhnung sind nicht wirksam. Insgesamt 17 Studien, die dem Typus 4 zuzuordnen waren, zeigten hinsichtlich des Erfolgs dann jedoch einen sehr deutlichen Positiveffekt. Die Wahrscheinlichkeit, dass Teilnehmer der Interventionsgruppe mit längerfristiger Unterstützung auch nach mindestens 6 Monaten (überwiegend sogar nach 12 Monaten) noch rauchfrei sind, lag zwischen 1,14 und 5,73 (Odds-Ratio). Gewichtet man diese Studien nach der Zahl der Teilnehmer, dann liegt die Erfolgswahrscheinlichkeit im Mittel bei 1,65. Liegt die Erfolgsquote in einer Studie in der Kontrollgruppe zum Beispiel bei 20% und beträgt die Odds-Ratio 1,65 dann wäre die Erfolgsquote in der Interventionsgruppe 33%.
Detaillierte Angaben, wie viel Prozent der Teilnehmer nach 6 oder 12 Monaten noch nikotinfrei sind, findet man in der Meta-Analyse leider nicht. Ruft man dazu die Originalstudien auf, so finden sich hierzu sehr unterschiedliche Quoten, die in vielen Fällen in der Interventionsgruppe bei 20-40 Prozent liegen.
Da in einem Teil der Interventionsstudien parallel zur Beratung auch eine medikamentöse Therapie (NRT, Bupropion) eingesetzt wurde, überprüften die Wissenschaftler auch den Beitrag dieser Nikotinersatztherapie. Dazu wurden die Effekte jener Studien gesondert betrachtet, die allein mit Beratung gearbeitet hatten. Hier zeigte sich dann, dass der Effekt ein wenig geringer ausfiel, aber immer noch statistisch signifikant war. Die Odds-Ratio lag nun bei 1,36. Das heißt, dass eine zusätzlich zur Beratung und sozialen Unterstützung eingesetzte Nikotin-Ersatztherapie nicht unbedingt erforderlich ist, aber die Erfolgswahrscheinlichkeit noch ein wenig erhöht.
Die positiven Befunde für die Effekte der Beratung bestätigten sich auch, wenn man die Studien nach verschiedenen Merkmalen unterschied (medizinische Kontrolle des Nikotinverzichts, Entschlossenheit zur Tabakentwöhnung usw.) Die Wissenschaftler überprüften schließlich auch noch, ob die jeweiligen Erkrankungen, aufgrund derer die Teilnehmer in der Klinik waren, einen Einfluss hatten. Im Vergleich aller Patienten mit der Teilgruppe nur jener, die von Herz-Kreislauf-Erkrankungen betroffen waren, zeigte sich dann: Die Erfolgwahrscheinlichkeit einer Intensivberatung (wie oben Typus 4) war bei Herz-Kreislauf-Patienten noch höher: Die Ausstiegswahrscheinlichkeit war nach 6 Monaten oder noch später 1,8mal so hoch wie in der Kontrollgruppe.
Kostenlos verfügbar ist ein Abstract der Studie:
Nancy A. Rigotti u.a.: Smoking Cessation Interventions for Hospitalized Smokers. A Systematic Review (Archives of Internal Medicine 2008;168(18):1950-1960)
Gerd Marstedt, 27.11.08
Hohe Preise für Obst und frisches Gemüse machen sich schon bei US-Schulkindern am Körpergewicht bemerkbar
 Eine staatlich finanzierte Studie hatte in den USA im Jahre 2004 die Preise von frischen Früchten, Gemüse und anderen Lebensmitteln mit wenig Kalorien untersucht ebenso wie die Preise von kalorienreichen Lebensmitteln mit verfeinertem Mehl, Zucker- und Fettzusätzen. Während die Preise der Nahrungsmittel mit hoher Kalorienzahl nahezu unverändert blieben, stiegen die der kalorienarmen Lebensmittel in diesem Zeitraum um 19,5% an. Für den Leiter der Studie, Adam Drewnowski, zeigen diese Befunde, dass die Problematik von Übergewicht und Adipositas in den USA (in viel nachhaltigerer Weise als häufig erkannt) auch mit unterschiedlichen finanziellen Ressourcen von Haushalten zu tun hat: Arme Familien können sich gesunde und wenig kalorienreiche Lebensmittel oftmals nicht leisten. (vgl. "Overfed but undernourished" - Die Rolle von Preisniveau- und -entwicklung der Nahrungsmittel für Ernährungsprobleme)
Eine staatlich finanzierte Studie hatte in den USA im Jahre 2004 die Preise von frischen Früchten, Gemüse und anderen Lebensmitteln mit wenig Kalorien untersucht ebenso wie die Preise von kalorienreichen Lebensmitteln mit verfeinertem Mehl, Zucker- und Fettzusätzen. Während die Preise der Nahrungsmittel mit hoher Kalorienzahl nahezu unverändert blieben, stiegen die der kalorienarmen Lebensmittel in diesem Zeitraum um 19,5% an. Für den Leiter der Studie, Adam Drewnowski, zeigen diese Befunde, dass die Problematik von Übergewicht und Adipositas in den USA (in viel nachhaltigerer Weise als häufig erkannt) auch mit unterschiedlichen finanziellen Ressourcen von Haushalten zu tun hat: Arme Familien können sich gesunde und wenig kalorienreiche Lebensmittel oftmals nicht leisten. (vgl. "Overfed but undernourished" - Die Rolle von Preisniveau- und -entwicklung der Nahrungsmittel für Ernährungsprobleme)
Eine andere US-Studie hat für diese Schlussfolgerung dann auch empirische Hinweise erbracht. Gezeigt hatte sich in einer repräsentativen Studie, dass Haushalte mit niedrigem Gesamteinkommen bei ihren Lebensmittel-Einkäufen durchweg weniger Geld ausgeben für Obst und frisches Gemüse als Bezieher hoher Einkommen. Dies heißt beispielsweise, dass 19 Prozent der Haushalte mit niedrigem Einkommen, aber nur halb so viele mit hohem Einkommen (10%) in einer Woche kein einziges Mal Obst und Gemüse einkaufen. (vgl. Blisard N, Stewart H, Joliffe D.: Low-income households' expenditures on fruits and vegetables Washington, DC: ERS Research Brief. US Department of Agriculture)
Eine weitere Studie hat jetzt deutlich gemacht: Die in US-amerikanischen Städten und Bezirken teilweise sehr unterschiedlichen Preise für kalorienarme Lebensmittel wie Obst und Gemüse machen sich schon bei Schulkindern am Körpergewicht bemerkbar: Wo die Preise besonders hoch ausfallen, zeigt sich bei Schulkindern im Längsschnittvergleich zwischen Kindergarten und 5. Schuljahr, dass der Body Mass Index (BMI) der Kinder sehr viel höher ausfällt, auch wenn man andere Einflussfaktoren wie zum Beispiel Haushaltseinkommen und Bildungsniveau der Eltern, Geburtsgewicht der Kinder, Ausmaß an Sport und Bewegung statistisch kontrolliert.
Erste Ergebnisse der Studie waren bereits 2005 veröffentlicht worden. Damals umfasste der Längsschnittvergleich den Zeitraum vom Kindergarten bis zum 3.Schuljahr und einbezogen waren etwa 4.500 Kinder. In einem Update der Studie war jetzt ein noch längerer Untersuchungszeitraum berücksichtigt worden und auch die Zahl der einbezogenen Kinder war auf knapp 7.000 gestiegen. Die bereits in der ersten Studie gefundenen Einflüsse des Preisniveaus bestätigten sich jetzt erneut. In Städten und Bezirken mit besonders hohen Preisen für frisches Obst und Gemüse liegt der durchschnittliche BMI der Kinder erheblich höher als dort, wo diese Lebensmittel weniger kosten. In den multivariaten Analysen wurde eine Vielzahl von Faktoren kontrolliert, die ebenfalls von Bedeutung sein können für BMI und Übergewicht.
Zum jetzt in der Zeitschrift "Public Health" veröffentlichten Update gibt es leider keine kostenlosen Informationen. Man muss schon Abonnent von "Science Direct" sein. R. Sturm, A. Datar: Food prices and weight gain during elementary school: 5-year update (Public Health, Volume 122, Issue 11, November 2008, Pages 1140-1143)
Zu den bereits 2005 veröffentlichten ersten Ergebnissen findet man hier ein Abstract: R. Sturm, A. Datar: Body mass index in elementary school children, metropolitan area food prices and food outlet density (Public Health, Volume 119, Issue 12, December 2005, Pages 1059-1068)
Hier findet man die Studie im Volltext (PDF)
Gerd Marstedt, 11.11.08
Viel zu viele Kalorien - Kindermenüs in Fastfoodketten
 93 Prozent der Kindermenüs in den großen Fastfoodketten enthalten zu viele Kalorien. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung des Center for Science in the Public Interest, in der die Ernährungsqualität von Kindermenüs der umsatzstärksten Fastfoodketten analysiert wurden. 13 der 19 kontaktierten Unternehmen stellten im Juni 2008 die Angaben zur Zusammensetzung ihrer Speisen zur Verfügung. Grundlage der Bewertung waren nationale Ernährungsstandards, die sich auf die Kalorienzahl, den Gesamtfettgehalt, den Anteil gesättigter Fette und Transfette, Zuckerzusatz, Kochsalz und Nährstoffgehalt beziehen.
93 Prozent der Kindermenüs in den großen Fastfoodketten enthalten zu viele Kalorien. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung des Center for Science in the Public Interest, in der die Ernährungsqualität von Kindermenüs der umsatzstärksten Fastfoodketten analysiert wurden. 13 der 19 kontaktierten Unternehmen stellten im Juni 2008 die Angaben zur Zusammensetzung ihrer Speisen zur Verfügung. Grundlage der Bewertung waren nationale Ernährungsstandards, die sich auf die Kalorienzahl, den Gesamtfettgehalt, den Anteil gesättigter Fette und Transfette, Zuckerzusatz, Kochsalz und Nährstoffgehalt beziehen.
Statt der empfohlenen maximal 430 Kalorien enthält ein Kindermenü der Kette Chili's aus frittierten Hühnchenteilen ("country-fried chicken crispers"), Zimtäpfeln und Schokoladenmilch 1.020 Kalorien - der höchste erzielte Wert der Untersuchung.
Auch die Kombinationen von McDonalds (Happy meal), Burger King und Wendy's lagen zu mehr als 90 Prozent über der empfohlenen Grenze, Kentucky Fried Chicken zu 89 Prozent. 45 Prozent der Kindermenüs enthalten zudem einen zu hohen Anteil von gesättigten Fetten und Transfetten, 86 Prozent zu viel Kochsalz.
Gute Noten erhielt nur die Kette Subway's, von deren Kindermenüs nur 33 Prozent die 430-Kalorien-Grenze überschreiten. Subway ist zudem die einzige Kette, die keine Softdrinks in Verbindung mit den Kindermenüs anbietet.
Erwachsene schätzen den Kaloriengehalt von Fastfoodangeboten häufig falsch ein. Die Autoren empfehlen daher die Angabe der Kalorienzahl auf den Speisekarten bzw. den Menüboards über den Verkaufstresen. Bei Subway's führte dies im Rahmen einer Studie zu einer Minderung pro Bestellung von 53 Kalorien. Weitere Empfehlungen lauten: Gemüse und Obst anstelle von Pommes frittes als Beilage, fettarme Milch und Wasser anstelle von zuckerhaltiger Limonade. Bestehen derartige Optionen bestellen 70 Prozent der Eltern die gesündere Mahlzeit für ihre Kinder.
Ein Drittel der täglichen Kalorien nehmen Kinder in den USA außer Haus auf, doppelt so viel wie vor 30 Jahren. Eine Mahlzeit außer Haus enthält etwa doppelt so viele Kalorien im Vergleich zur Mahlzeit zu Hause.
• Studie zum Download Kids' Meals: Obesity on the Menu
• Centers for Science in the Public Interest
• Mehr zur Kennzeichnung von Mahlzeiten
David Klemperer, 9.11.08
Autofahren ist "cool", zu Fuß gehen gefährlich. Einstellungen von Eltern und Kindern zu unterschiedlichen Fortbewegungsmitteln
 Körperliche Aktivität, nicht nur im Rahmen von Sport oder Gartenarbeit, sondern auch als Mittel der Fortbewegung, wird zunehmend als eine Chance zu gesundheitsförderlichem Alltagsverhalten begriffen. Aber welches Image hat Fahrrad fahren und zu Fuß gehen, gibt es hier womöglich schon psychologische Barrieren? Eine Meta-Analyse hat die Ergebnisse vorliegender Studien hierzu zusammengefasst und sich insbesondere auf Studien konzentriert, die Einstellungen von Kindern und ihren Eltern untersucht haben.
Körperliche Aktivität, nicht nur im Rahmen von Sport oder Gartenarbeit, sondern auch als Mittel der Fortbewegung, wird zunehmend als eine Chance zu gesundheitsförderlichem Alltagsverhalten begriffen. Aber welches Image hat Fahrrad fahren und zu Fuß gehen, gibt es hier womöglich schon psychologische Barrieren? Eine Meta-Analyse hat die Ergebnisse vorliegender Studien hierzu zusammengefasst und sich insbesondere auf Studien konzentriert, die Einstellungen von Kindern und ihren Eltern untersucht haben.
Das Fazit heißt: Radfahren und zu Fuß gehen wird von Kindern und ihren Eltern im Vergleich zum Autofahren als weitaus weniger bequem wahrgenommen, und vor allem als erheblich gefährlicher und riskanter durch Unfallrisiken im Straßenverkehr und Kriminalität. Zwar hätten Kinder und Jugendliche durchaus öfter das Bedürfnis, sich allein und unabhängig vom Auto der Eltern zu bewegen, aber ihre eigene Sorge und die der Eltern ist ein überaus bedeutsamer Hinderungsgrund. Kampagnen zur Gesundheitsförderung, die den Aspekt körperlicher Bewegung in den Vordergrund stellen, könnten sehr viel erfolgreicher sein, wenn sie diese Grundeinstellung mit berücksichtigen und Eltern darauf hinweisen, dass die Entwicklung von Autonomie und Entscheidungskompetenz bei ihren Kindern erheblich beeinträchtigt werden kann durch ein Übermaß an Behütung und Sicherheitsdenken.
Dies sind die wesentlichen Befunde eines Forschungsberichts, der schon veröffentlichte Studien noch einmal ausgewertet hat, in denen das Thema "Einstellungen und Meinungen zum Fahrrad fahren und zu Fuß gehen" im Vordergrund standen. Berücksichtigt wurden Studien, die im United Kingdom zwischen 1995 und 2005 veröffentlicht worden sind. Einbezogen wurden vom Londoner Forschungsteam dann für die Meta-Analyse 34 Studien, die einerseits nach ihrer methodischen Qualität bewertet, zum anderen insbesondere nach den dort gefundenen Ergebnissen bilanziert wurden.
Die Wissenschaftler heben fünf Leitmotive oder Kerngedanken hervor, die mehr oder minder in allen Studien auftauchen. Dabei geht es um:
• Die automobil-fixierte Alltagskultur: Das Auto als Transportmittel hat einen sehr viel höheren Stellenwert als das Fahrrad fahren oder zu Fuß gehen. Autofahren gilt als "cool", ist bequemer und schneller. Das Auto ist auch ein Statussymbol. Diese Sichtweisen finden sich häufig auch schon bei jüngeren Kindern.
• Furcht und Unbehagen gegenüber den unmittelbaren Lebensräumen: Viele Kinder, aber auch Eltern empfinden gegenüber ihrem Stadtteil oder Quartier ein Unbehagen. Begründet ist dies vor allem in Ängsten vor Verkehrsunfällen, Diebstählen oder körperlicher Gewalt.
• Selbstbestimmungsinteressen der Kinder: Kinder geben in vielen Studien an (oft in krassem Widerspruch zur Meinung ihrer Eltern), dass sie des öfteren durchaus das Bedürfnis hätten, allein und selbst verantwortlich zu entscheiden, ob sie nun zu Fuß zu einem Ziel gehen, mit dem Fahrrad fahren oder im Auto der Eltern dort hingebracht werden möchten. Sie sind oft trotz widriger Bedingungen (Regen, Hitze, unbequeme Wege) an körperlicher Bewegung interessiert.
• Die Ambivalenz der elterlichen Verantwortung: Eltern betonen häufig, dass sie nun einmal für die Sicherheit ihrer Kinder im Straßenverkehr, aber auch für den Schutz vor Kriminalität verantwortlich seien und daher sehr oft das Auto als Transportmittel auch für ihre Kinder bevorzugen. Kinder erkennen dies auch an, machen aber auch geltend, dass "Sicherheit" oft ein Vorwand ist, um ihre Unabhängigkeit und Selbstbestimmung einzuschränken und sie unter Kontrolle zu halten.
• Meinungsvielfalt: Die Sichtweisen sowohl der Eltern wie auch der Kinder zeigen teilweise große Unterschiede, die je nach Alter, Geschlecht oder auch Lebensraum (Stadt, Vorstadt, Land) von einander abweichen. Maßnahmen zur Gesundheitsförderung sollten diese Unterschiede unbedingt berücksichtigen, um Erfolg zu haben.
Die Forscher versuchen auch, ein Fazit zu ziehen, was gesundheitspolitische Konsequenzen anbetrifft und Kriterien für eine praktische Umsetzung von Veränderungsvorhaben. Dabei wird eine Vielzahl von Aspekten diskutiert. Besonders erwähnenswert erscheint, dass Interventionen erfolgreicher sind, wenn sie nicht allein danach trachten, Meinungen und Einstellungen zu ändern, sondern parallel dazu auch verhältnispräventive Maßnahmen in Gang setzen: Verbesserungen der Verkehrs-Infrastruktur für Fußgänger und Radfahrer, Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit.
Allerdings gibt es auch subkulturelle Normen und Orientierungen, die gegenüber realen Veränderungen sehr resistent sind. So haben Studien gezeigt, dass trotz objektiv sinkender Kriminalitäts- oder Unfallquoten in Stadtteilen das Bewusstsein einer Gefährdung bei bestimmten Bevölkerungsgruppen davon unberührt bleibt.
Hier ist ein kostenloses Abstract der Studie: T Lorenc, G Brunton, S Oliver, K Oliver, A Oakley: Attitudes to walking and cycling among children, young people and parents: a systematic review (Journal of Epidemiology and Community Health 2008;62:852-857; doi:10.1136/jech.2007.070250)
Gerd Marstedt, 7.11.08
Finnische Verlaufsstudie: Rauchen im höheren Lebensalter senkt Lebensqualität und Lebenserwartung nachhaltig
 Wie bei vielen anderen gesundheitlichen Phänomenen offenbart oft erst eine personenbezogene Längsschnittsanalyse das tatsächliche Volumen und die Artbreite der gesundheitlichen Risiken bestimmter Handlungen. Dies gilt auch für die Auswirkungen des Tabakkonsums, die in einer Gruppe von 1.658 weißen und männlichen finnischen Bürgern, die zu Beginn der Studie rund 48 Jahre alt waren und im Lauf der Jahre öfter befragt wurden ob sie rauchten oder nicht und wie es ihnen gesundheitlich, über 26 Jahre hinweg gemessen wurden. Die Teilnehmer der Studie waren sich sozioökonomisch relativ ähnlich, da sie alle auch Teilnehmer in der "Helsinki Businessmen Study" waren.
Wie bei vielen anderen gesundheitlichen Phänomenen offenbart oft erst eine personenbezogene Längsschnittsanalyse das tatsächliche Volumen und die Artbreite der gesundheitlichen Risiken bestimmter Handlungen. Dies gilt auch für die Auswirkungen des Tabakkonsums, die in einer Gruppe von 1.658 weißen und männlichen finnischen Bürgern, die zu Beginn der Studie rund 48 Jahre alt waren und im Lauf der Jahre öfter befragt wurden ob sie rauchten oder nicht und wie es ihnen gesundheitlich, über 26 Jahre hinweg gemessen wurden. Die Teilnehmer der Studie waren sich sozioökonomisch relativ ähnlich, da sie alle auch Teilnehmer in der "Helsinki Businessmen Study" waren.
Die in der Ausgabe der us-amerikanischen Fachzeitschrift "Archives of Internal Medicine" (Arch Intern Med. 2008;168(18):1968-1974) unter dem Titel "The Effect of Smoking in Midlife on Health-Related Quality of Life in Old Age. A 26-Year Prospective Study" veröffentlichten Ergebnisse zeigen folgende Effekte im weiteren Lebensverlauf der Raucher und Nichtraucher:
• Rund ein Fünftel der Gruppe starben während der follow-up-Zeit, d.h. vor ihrem vierundsiebzigsten Lebensjahr.
• Diejenigen, die nie geraucht hatten (n=614), lebten über 10 Jahre länger als ihre MitbürgerInnen, die mehr als eine Packung Zigaretten pro Tag rauchten (n=188).
• Unter denjenigen, die die 26 Jahre überlebten (n=1.131), standen die Niemals-Raucher bei den wichtigsten Indikatoren der Lebensqualität (die so genannte "health-related quality of life [HRQoL]", die mit dem Instrument des "RAND 36-Item Health Survey" erhoben wurde, die dem Instrument des "Medical Outcomes Study Short-Form Health Survey") wie beispielsweise dem physischen Zustand oder körperliche Schmerzen, signifikant besser da. Dies relativiert oder widerlegt sogar eine bisher oft gehegte Befürchtung, länger lebende Nicht(mehr)raucher wären in der Überlebenszeit kränker und hätten eine schlechte Lebensqualität.
• Die Lebensqualität hing direkt mit der Anzahl der gerauchten Zigaretten, d.h. der Dosis zusammen: Die Lebensqualität sank umso stärker wie die Anzahl der Zigaretten anstieg.
• Letzteres stützt die fast schon verständnisvoll auf die Abhängigkeitsprobleme von Rauchern reagierende Position der ForscherInnen, auch ein "cutting back" der Zigarettenmenge wäre schon nützlich.
Ein Abstract des 10-Seiten-Aufsatzes "The Effect of Smoking in Midlife on Health-Related Quality of Life in Old Age. A 26-Year Prospective Study" von Arto Y. Strandberg, Timo E. Strandberg, Kaisu Pitkälä, Veikko V. Salomaa, Reijo S. Tilvis und Tatu A. Miettinen ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 23.10.08
Antioxidative Nahrungsergänzungsmittel fast sämtlich nicht zur Prävention von Darmkrebs tauglich oder sogar potenziell gefährlich
 Oxidativer Stress, d.h. ein unterdurchschnittlicher Gehalt antioxidativer Stoffe im Blutplasma, in dessen Folge die Wahrscheinlichkeit toxischer Effekte auf gesunde Zellen z. B. durch freie Radikale wächst, gilt u.a. als eine Ursache von Krebserkrankungen des Verdauungssystems. Parallel zu dieser Erkenntnis verbreitet sich die natürlich durch die Hersteller dieser zum Teil hochpreisigen Mittel genährte Hoffnung, gastrointestinale Krebserkrankungen durch die Auf- oder Einnahme antioxidativer Nahrungsergänzungsmittel verhindern zu können. Einzelne Studien hatten aber bereits in der Vergangenheit immer wieder Zweifel an dieser Art von Wirksamkeit geäußert und außerdem auf mögliche unerwünschte und gefährliche Nebenwirkungen ihrer Einnahme hingewiesen.
Oxidativer Stress, d.h. ein unterdurchschnittlicher Gehalt antioxidativer Stoffe im Blutplasma, in dessen Folge die Wahrscheinlichkeit toxischer Effekte auf gesunde Zellen z. B. durch freie Radikale wächst, gilt u.a. als eine Ursache von Krebserkrankungen des Verdauungssystems. Parallel zu dieser Erkenntnis verbreitet sich die natürlich durch die Hersteller dieser zum Teil hochpreisigen Mittel genährte Hoffnung, gastrointestinale Krebserkrankungen durch die Auf- oder Einnahme antioxidativer Nahrungsergänzungsmittel verhindern zu können. Einzelne Studien hatten aber bereits in der Vergangenheit immer wieder Zweifel an dieser Art von Wirksamkeit geäußert und außerdem auf mögliche unerwünschte und gefährliche Nebenwirkungen ihrer Einnahme hingewiesen.
Um dies gesichert bewerten zu können, führte eine internationale Forschergruppe bzw. Cochrane-Gruppe im Rahmen alle bisher dazu vorliegenden randomisierten kontrollierten Studien aus verschiedenen Forschungsregistern und -dokumentationen zusammen und erstellte Mitte diesen Jahres einen der qualitativ höchstwertigsten Cochrane-Reviews, der jetzt unter dem Titel "Antioxidant supplements for preventing gastrointestinal cancer" in der Cochrane Library (Cochrane Database Syst Rev. 2008 16. Juli; (3): CD004183) erhältlich ist.
Im Mittelpunkt des Interesses standen 20 durchweg qualitativ hochwertige RCT-Studien mit 211.818 TeilnehmerInnen, in denen die Effekte der Einnahme der als antioxidativ angesehenen Stoffe Beta-Karotin, Vitamin A, Vitamin C, Vitamin E und Selen im Vergleich zu Placebos gemessen wurden. Zu den Effekten gehören Krebserkrankungen des Magen-Darmtraktes, die Gesamtsterblichkeit der Untersuchten und das Auftreten unerwünschter Wirkungen. Gemessen wurde jeweils das relative Risiko (RR) des Auftretens.
Die Ergebnisse sahen folgendermaßen aus:
• Insgesamt hatten antioxidative Nahrungszusätze keinen statistisch signifikanten Effekt der untersuchten Stoffe auf die Krebserkrankungen des Magen-Darmtrakts (RR 0,94, 95 % Konfidenzintervall 0,83 bis 1,06).
• Wie das Konfidenzintervall bereits anzeigt, gibt es aber je nach Stoff eine gewisse Heterogenität der Effekte: So erhöht sich unter der Einnahme von Beta-Karotin potenziell das spezifische Krebsrisiko während es durch Selen potenziell abnimmt.
• In einem von mehreren Wirkungsmodellen hatten alle Zusatzstoffe einen signifikant erhöhenden Effekt auf die Gesamtmortalität. Betakarotin erhöht (RR 1,16) in Kombination mit Vitamin das allgemeine Mortalitätsrisiko, was ebenfalls für die alleinige Einnahme von Vitamin E festgestellt wurde (RR 1,06). Insgesamt starben 17.114 der 122.501 TeilnehmerInnen an den Studien (14.0%), die per Zufall der Antioxidantien-Einnahmegruppe zugewiesen wurden und 8.799 der 78.693 TeilnehmerInnen (11.2%), die per Zufall in der Placebogruppe war.
• Zu den unerwünschten Effekten gehören außerdem eher harmlose Erscheinungen wie z. B. die Gelbverfärbung der Haut nach der Zuführung von Betakarotin. - In 5 Studien, die allerdings alle mit dem Risiko starker Verzerrungen behaftet sind, trug allerdings Selen schließlich signifikant zur Senkung des Auftretens von Magen-Darm-Krebserkrankungen bei (RR 0,59).
Die Cochrane-Forschergruppe fasst ihre Einzelergebnisse so zusammen: "We could not find convincing evidence that antioxidant supplements prevent gastrointestinal cancers. On the contrary, antioxidant supplements seem to increase overall mortality. The potential cancer preventive effect of selenium should be tested in adequately conducted randomised trials." Dies bedeutet nicht, dass sämtliche oder einzelne dieser Stoffe nicht gegen die eine oder andere Erkrankung oder Befindlichkeitsstörung präventiv hilfreich sein können, nur als Mittel, um Magen-Darmkrebs zu verhindern, sollten sie weder angepriesen noch eingenommen werden.
Eine Zusammenfassung der Ergebnisse des Intervention Review "Antioxidant supplements for preventing gastrointestinal cancers" von Goran Bjelakovic, Dimitrinka Nikolova, Rosa G Simonetti und Christian Gluud ist kostenlos in der Cochrane Library erhältlich. Wer entsprechende Zugriffsrechte besitzt, kann von der Seite des Abstracts auch auf den gesamten Inhalt des Review zugreifen.
Bernard Braun, 19.10.08
Teerlunge, Kehlkopfkrebs, Metastasen im Rachen: Nach Belgien zeigen jetzt auch Zigarettenpackungen in England Horrorbilder
 Nachdem Belgien Anfang 2007 Schockfotos auf Zigarettenpackungen zur Pflicht machte, müssen seit 1.Oktober 2008 jetzt auch im United Kingdom Zigarettenpackungen neben den schon gängigen Textwarnungen nun bestimmte Horrorbilder zeigen, die von der Europäischen Kommission vorgelegt wurden: Eine Teerlunge, ein abstoßend großer Kehlkopftumor, faulende Zähne in einer von Metastasen entstellten Mundhöhle. Das Department of Health hofft, dass durch diese Warnungen etwa 10.000 Raucher abgeschreckt und 2.500 Menschenleben gerettet werden. "Diese Bilder zeigen Rauchern unverstellt die Folgen, die Rauchen für ihre Gesundheit haben kann", sagte der Chef der britischen Gesundheitsdienste, Sir Liam Donaldson. "Schriftliche Warnungen haben schon viele Raucher zum Aufhören veranlasst. Ich hoffe, dass diese Bilder noch mehr Raucher dazu bewegen, gründlich darüber nachzudenken, ob sie nicht aufhören wollen und ich hoffe auch, sie bekommen die dazu nötige Hilfe." (vgl. Department of Health: Smokers forced to face their demons - stark picture warnings on tobacco packets from 1st Oct).
Nachdem Belgien Anfang 2007 Schockfotos auf Zigarettenpackungen zur Pflicht machte, müssen seit 1.Oktober 2008 jetzt auch im United Kingdom Zigarettenpackungen neben den schon gängigen Textwarnungen nun bestimmte Horrorbilder zeigen, die von der Europäischen Kommission vorgelegt wurden: Eine Teerlunge, ein abstoßend großer Kehlkopftumor, faulende Zähne in einer von Metastasen entstellten Mundhöhle. Das Department of Health hofft, dass durch diese Warnungen etwa 10.000 Raucher abgeschreckt und 2.500 Menschenleben gerettet werden. "Diese Bilder zeigen Rauchern unverstellt die Folgen, die Rauchen für ihre Gesundheit haben kann", sagte der Chef der britischen Gesundheitsdienste, Sir Liam Donaldson. "Schriftliche Warnungen haben schon viele Raucher zum Aufhören veranlasst. Ich hoffe, dass diese Bilder noch mehr Raucher dazu bewegen, gründlich darüber nachzudenken, ob sie nicht aufhören wollen und ich hoffe auch, sie bekommen die dazu nötige Hilfe." (vgl. Department of Health: Smokers forced to face their demons - stark picture warnings on tobacco packets from 1st Oct).
Insgesamt 42 Bilder wurden bereits im Mai 2005 von der Europäischen Kommission ausgewählt und in 25 Sprachen mit dazugehörigen Warnhinweisen verknüpft (vgl. European Commission: Pictorial health warnings - Background information), wie unter anderem die Aussagen "Raucher sterben früher" oder "Rauchen verursacht tödlichen Lungenkrebs". Im Prinzip könnte auch Deutschland per Gesetz dem Beispiel Belgiens und Englands folgen. Die Schockbilder und dazu gehörige Textwarnungen stehen bereits in einer PDF-Datei in deutscher Sprache bereit: Europäische Kommission: Kombinierte Warnhinweise für Zigarettenpackungen in Deutschland
Dass Fotos mit schockierenden Krankheitssymptomen und Schockbilder auf Zigarettenpackungen sehr viel eindringlicher sind als die in vielen Ländern verwendeten Textwarnungen in kleinerem Format, wurde unlängst in einer kanadischen Studie gezeigt. Die Wissenschaftler hatten zwischen 2002 und 2005 mehrmals Telefoninterviews mit insgesamt 15.000 Rauchern aus vier Ländern durchgeführt: Kanada, USA, Großbritannien und Australien. In diesen Ländern sind sehr unterschiedliche Formen von Warnungen auf Zigarettenschachteln gebräuchlich. Es zeigte sich: 44% der Befragten gaben an, dass die großen abstoßenden Krebsbilder bei ihnen Ängste hinterlassen, bei 58% auch Ekelgefühle. Etwa die Hälfte hat deshalb über Gesundheitsrisiken nachgedacht, bei jedem Dritten hat sich der Vorsatz gefestigt, mit dem Rauchen aufzuhören, und etwa jeder Fünfte hat daraufhin weniger Zigaretten geraucht als zuvor. (vgl.: Schockierende Fotos auf Zigarettenpackungen werden von Rauchern eher wahrgenommen)
Gerd Marstedt, 15.10.2008
Das Passivraucherbein: Neues zu den Gefäßerkrankungsrisiken des Passivrauchens.
 In der Debatte über rauchfreie öffentliche Räume oder Restaurants und Kneipen spielte das gesundheitliche Risiko des Passivrauchens zwar eine wichtige Rolle, doch immer wieder wurde es auch als ein vorrangig hygienisches oder olfaktorisches Problem dargestellt oder gering geredet.
In der Debatte über rauchfreie öffentliche Räume oder Restaurants und Kneipen spielte das gesundheitliche Risiko des Passivrauchens zwar eine wichtige Rolle, doch immer wieder wurde es auch als ein vorrangig hygienisches oder olfaktorisches Problem dargestellt oder gering geredet.
Da noch nicht definitiv feststeht, wo und wie wirksam nicht mehr in Gegenwart von NichtraucherInnen geraucht werden darf, sind wissenschaftlich gesicherte Nachweise für tabakrauchassoziierte, schwere gesundheitliche Risiken gerade auch für NichtraucherInnen sehr wichtig.
Deshalb verdient eine am 22.9. 2008 zunächst nur online in der Zeitschrift "Circulation" (doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.108.784801) veröffentlichte Querschnittsstudie chinesischer WissenschaftlerInnen besondere Aufmerksamkeit. Sie bestätigt zunächst unter dem Titel "Passive Smoking and Risk of Peripheral Arterial Disease and Ischemic Stroke in Chinese Women Who Never Smoked" das bereits bekannte Risiko, dass eine Exposition mit Tabakrauch in der Raumluft Schlaganfälle und Herzinfarkte begünstigt, und fügt dieser Erkenntnis den erstmaligen Nachweis des Risikos einer peripheren arteriellen Verschlusskrankheit bei Passivrauchern hinzu. Damit ist eine der härtesten Folgen des Rauchens, das Raucherbein, auch als Folge von Passivrauchen nachgewiesen oder höchst wahrscheinlich.
Dazu untersuchten die ForscherInnen das Auftreten von kardiovaskulären Erkrankungen wie beispielsweise des Schlaganfalls aber auch der peripheren artiellen Erkrankungen (artielle Verschlusskrankheit) wie dem Raucherbein bei 1.209 Pekinger Frauen, die älter als 60 Jahre waren und selber nie geraucht hatten, aber möglicherweise eine so genannte "secondhand smoke"-Exposition hatten. Diese galt dann als gesichert, wenn eine Person dem Tabakrauch einer anderen Person mindestens täglich 15 Minuten ausgesetzt war und zwar mindestens einen Tag in der Woche und dies in zwei Jahren während der letzten 10 Jahre.
Von der genannten Gruppe von Frauen waren 39,5 % zuhause oder am Arbeitsplatz passiv Tabakrauch ausgesetzt.
Die so exponierten Passivraucherinnen hatten gegenüber den Frauen, die niemals exponiert waren und nach der Adjustierung nach 13 potenziellen Risikofaktoren ein signifikant erhöhtes
• Risiko für koronare Herzerkrankungen (odds ratio 1,69),
• Risiko für Schlaganfall (odds ratio 1,56) und
• Risiko für unterschiedliche Stadien oder Symptomatiken der artiellen Verschlusskrankheit in den unteren Extremitäten (OR zwischen 1,87 und 1,47).
Nachgewiesen werden konnten sogar dosisabhängige Effekte zwischen der Anzahl der passiv gerauchten Zigaretten pro Tag, der Expositionsdauer in Minuten und einer erhöhten Prävalenz von koronaren Herzerkrankungen, Schlaganfällen und artiellen Verschlusskrankheiten.
Auch wenn es sich bei der hier gewählten Methode der bevölkerungsbezogenen Querschnittsstudie um einen Studientyp eher geringerer Evidenz handelt und auch nur Frauen untersucht wurden, kann es als evident angesehen werden, dass die tabakassoziierte Gefäßschädigung nicht nur in koronaren Gefäßen, sondern auch in anderen Gefäßen in anderen Körperteilen eintritt und es auch bei Männer keine völlig anderen Wirkungen des Passivrauchens geben dürfte.
Von dem Aufsatz "Passive Smoking and Risk of Peripheral Arterial Disease and Ischemic Stroke in Chinese Women Who Never Smoked" gibt es kostenlos nur ein Abstract zu lesen.
Eine etwas längere Zusammenfassung der Ergebnisse gibt es unter der Überschrift "Secondhand smoke linked to peripheral artery disease in women" zusätzlich auf der aktuellen "News"-Seite der "American Heart Association".
Bernard Braun, 29.9.2008
Übergewicht und Fettleibigkeit bei jungen Erwachsenen in Großbritannien: So früh wie möglich in der Kindheit intervenieren.
 Trotz aller Kenntnisse über die Häufigkeit und das Neuauftreten von Fettleibigkeit in weiten Teilen Europas und Nordamerikas, weiß man relativ wenig über ihre Entstehungspfade. Da die Mehrheit der leicht bis mittel (BMI 25-30) oder stark Übergewichtigen (BMI über 30) dies nicht ab Geburt ist, lautet die vor allem auch für präventive Interventionen wichtige Frage, in welchem Alter der Übergang vom Normal- zum Übergewicht eigentlich erfolgt.
Trotz aller Kenntnisse über die Häufigkeit und das Neuauftreten von Fettleibigkeit in weiten Teilen Europas und Nordamerikas, weiß man relativ wenig über ihre Entstehungspfade. Da die Mehrheit der leicht bis mittel (BMI 25-30) oder stark Übergewichtigen (BMI über 30) dies nicht ab Geburt ist, lautet die vor allem auch für präventive Interventionen wichtige Frage, in welchem Alter der Übergang vom Normal- zum Übergewicht eigentlich erfolgt.
Hierzu gibt eine in Großbritannien bereits vor einigen Jahren durchgeführte 5-Jahres-Längsschnittstudie, die so genannte "Health and behaviour in teenagers study (HABITS)", differenzierte Auskunft.
In dieser 1999 gestarteten Studie wurde eine Gruppe von 5.863 zufällig an 36 Londoner Schulen ausgesuchten Schüler im Alter von 11-12 Jahren für 5 Jahre hinsichtlich ihrer Lebensumstände und ihrer Gewichtsentwicklung beobachtet.
Die wichtigsten Ergebnisse geben wichtige Einblicke in die Art und Dynamik der Entstehungspfade von Übergewichtsproblemen:
• Im Alter von 11-12 Jahren waren fast 25 % der untersuchten Schüler übergewichtig oder fettleibig. Der Anteil der Mädchen war mit 29 % höher, der von Schülern aus unteren sozialen Schichten mit 31 % noch etwas höher. Schwarze Mädchen wiesen mit 38 % den höchsten Anteil von nicht Normalgewichtigen aus.
• In der Zeit der Adoleszenz fanden sich in der Londoner Studie nur noch wenige neu auftretende Fälle von Übergewicht, genauso wenig wie es übergewichtigen Heranwachsenden in nennenswertem Umfang gelang wieder ein Normalgewicht zu erreichen.
• Was zunahm war der Anteil von Fettleibigen auf Kosten des Anteils der Übergewichtigen.
• Auch die soziale Ungleichverteilung der Gewichtsprobleme nahm während der Phase des Heranwachsens nicht mehr zu, blieb aber auch eindeutig erhalten.
• Schwarze Mädchen wiesen auch nach Durchlaufen der Adoleszenz die höchsten Häufigkeiten an Übergewicht und Fettleibigkeit auf. Der Wert war zweimal so hoch wie bei weißen Mädchen bzw. jungen Frauen. Die Studie bestätigte auch das bisher kaum erklärte Phänomen, dass schwarze Jungen oder junge Männer eine wesentlich geringere Übergewichtshäufigkeit aufweisen als schwarze Mädchen bzw. junge Frauen.
Trotz einiger methodischer Begrenztheiten der Studie (z.B. lediglich Schüler aus der Großstadt) zeigen die Ergebnisse der Studie nach Meinung der ForscherInnen, dass sich hartnäckiges Übergewicht oder Fettleibigkeit bereits im Alter unter 11 Jahren etabliert. Erfolgreiche Präventionsstrategien sollten daher schon in diesem Altersbereich ansetzen.
Der gesamte Aufsatz "Development of adiposity in adolescence: five year longitudinal study of an ethnically and socioeconomically diverse sample of young people in Britain" von Jane Wardle, Naomi Henning Brodersen, Martin J Jarvis und David R Boniface ist 2006 (5. Mai 2006) im "British Medical Journal (BMJ)" erschienen und als PDF-Datei kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 14.7.2008
Weight Watchers versus Fitness Center: Welche Maßnahme zum Abnehmen ist effektiver und gesünder?
 In einer recht ungewöhnlichen Studie versuchten Wissenschaftler der University of Missouri jetzt die Frage zu beantworten, welche Maßnahme denn nun effektiver ist, um abzuspecken und ein gesünderes Körpergewicht zu erreichen. Verglichen wurden dabei die unterschiedlichen Erfolge, die 43 übergewichtige Frauen innerhalb von zwölf Wochen erzielt hatten. Eine Gruppe hatte intensiv in einem Fitness-Center trainiert, die andere nahm an Ernährungskursen der Weight Watchers teil und achtete besonders streng auf ein kalorienarmes Essen. Das Ergebnis war ein Unentschieden, beide Methoden zeigten Vor- und Nachteile und in gesundheitlicher Hinsicht am besten ist nach Ansicht der Wissenschaftler eine Kombination beider Maßnahmen.
In einer recht ungewöhnlichen Studie versuchten Wissenschaftler der University of Missouri jetzt die Frage zu beantworten, welche Maßnahme denn nun effektiver ist, um abzuspecken und ein gesünderes Körpergewicht zu erreichen. Verglichen wurden dabei die unterschiedlichen Erfolge, die 43 übergewichtige Frauen innerhalb von zwölf Wochen erzielt hatten. Eine Gruppe hatte intensiv in einem Fitness-Center trainiert, die andere nahm an Ernährungskursen der Weight Watchers teil und achtete besonders streng auf ein kalorienarmes Essen. Das Ergebnis war ein Unentschieden, beide Methoden zeigten Vor- und Nachteile und in gesundheitlicher Hinsicht am besten ist nach Ansicht der Wissenschaftler eine Kombination beider Maßnahmen.
Das Besondere der Studie lag unter anderem auch darin, dass bei der Prüfung der Ergebnisse nach drei Monaten nicht nur das Körpergewicht erfasst wurde, sonder mit Hilfe von Computertomographie auch der genaue Fett- und Muskelanteil im Körper. Steve Ball, Studienleiter und Professor für Sportphysiologie, fasste die Ergebnisse so zusamen:
• Mit dem Diätprogramm von Weight-Watchers verliert man zwar an Körpergewicht, leider aber nicht so sehr an Fett, sondern sehr viel mehr an Muskelmasse. Etwa 4,5 Kilogramm verloren die hier teilnehmenden Frauen im Schnitt. Insbesondere der "Speckgürtel", also die Fettmasse im Bauchbereich, die vermutlich das Risiko für spätere Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöht, wird durch die Weight Watchers Diät kaum beeinflusst. Positiv festzuhalten ist jedoch, dass die Studienteilnehmer in dieser Gruppe aufgrund der wöchentlichen Treffen und Gespräche ihrem Vorhaben zur Gewichts-Abnahme eher treu bleiben und die Motivation nicht so schnell verlieren.
• Die Frauen im Fitness Center andererseits zeigten nach der dreimonatigen Studiendauer, in der sie unter Anleitung von Fitness-Trainern mindestens dreimal die Woche trainieren sollten, kaum eine Veränderung ihres Körpergewichts. Computertomographien zeigten dann allerdings: Ein Großteil der Fettpartien auch im Bauchbereich war in Muskelmasse umgewandelt worden, so dass sich auf der Waage kaum eine Veränderung zeigte. Dieser Verlust von Fett und der Zugewinn an Muskeln ist jedoch gesundheitlich sehr positiv zu bewerten. Als Nachteil des Fitness-Trainings wurde allerdings auch deutlich, dass das Durchhaltevermögen vieler Teilnehmer bei dieser Maßnahme sehr gering ist: Andere Studien haben gezeigt, dass etwa die Hälfte der Teilnehmer nach sechs Wochen wieder aufhört.
Ideal wäre daher nach Meinung der Forscher, in einer Gruppe, die das Zusammengehörigkeitsgefühl und das Durchhaltenvermögen steigert, eine Kombination beider Maßnahmen umzusetzen: Diät und Körpertraining.
Hier ist eine kostenlose PDF-Datei der Veröffentlichung: Stephen Ball, Anne Bolhofner:Comparison of a Commercial Weight Loss Program to a Fitness Center (Journal of Exercise Physiology online, Volume 11 Number 3 June 2008)
Gerd Marstedt, 6.7.2008
Primärprävention: Nur das Rauchen verursacht heute ein schlechtes Gewissen, andere Verhaltensrisiken werden eher verdrängt
 Glaubt man einigen Umfrageergebnissen, so scheint sich in der Bevölkerung zunehmend eine starke Präventionsorientierung durchzusetzen. So meldet etwa das Institut für Demoskopie Allensbach im August 2007: "Die Zahl der Menschen, die sehr auf ihre Gesundheit achten, ist in den letzten Jahren Schritt für Schritt größer geworden. Anfang des Jahrzehnts betonten erst 27 Prozent, dass sie sehr gesundheitsbewusst leben, inzwischen sagen das 33 Prozent." (Mehr Gesundheitsbewusstsein in der Bevölkerung). Und nach einer Bevölkerungsumfrage im Auftrag der Zeitschrift "Focus" zeigt sich: "Gesundheit und die Notwendigkeit, dafür selbst mehr Verantwortung zu übernehmen, rücken immer stärker ins Bewusstsein: Mehr als die Hälfte der Deutschen (58 Prozent) sind heute äußerst oder sehr am Thema Gesundheit interessiert. Vor drei Jahren waren es noch 40 Prozent." (Vorbeugen statt Schlucken).
Glaubt man einigen Umfrageergebnissen, so scheint sich in der Bevölkerung zunehmend eine starke Präventionsorientierung durchzusetzen. So meldet etwa das Institut für Demoskopie Allensbach im August 2007: "Die Zahl der Menschen, die sehr auf ihre Gesundheit achten, ist in den letzten Jahren Schritt für Schritt größer geworden. Anfang des Jahrzehnts betonten erst 27 Prozent, dass sie sehr gesundheitsbewusst leben, inzwischen sagen das 33 Prozent." (Mehr Gesundheitsbewusstsein in der Bevölkerung). Und nach einer Bevölkerungsumfrage im Auftrag der Zeitschrift "Focus" zeigt sich: "Gesundheit und die Notwendigkeit, dafür selbst mehr Verantwortung zu übernehmen, rücken immer stärker ins Bewusstsein: Mehr als die Hälfte der Deutschen (58 Prozent) sind heute äußerst oder sehr am Thema Gesundheit interessiert. Vor drei Jahren waren es noch 40 Prozent." (Vorbeugen statt Schlucken).
Dass solchen Meldungen eher mit Skepsis zu begegnen ist, zeigen jetzt veröffentlichte Daten aus dem Gesundheitsmonitor der Bertelsmann-Stiftung. Auf die Frage "Wie stark achten Sie im Allgemeinen auf Ihre Gesundheit" antworten in halbjährlichem Turnus seit dem Jahr 2002 konstant etwa 50 Prozent der Bevölkerung mit "sehr stark" oder "stark". Beim Indikator "Adipositas", definiert über einen Body-Mass-Index von 30 oder mehr zeigt sich seit 2002 eine zwar geringfügige, aber statistisch signifikante Zunahme von 17 Prozent im Frühjahr 2002 auf 23 Prozent im Herbst 2007. Für den Anteil täglicher Raucher zeigt sich mit Ausnahme der ersten Erhebung 2002 ein nahezu konstanter Wert. Und schließlich ist auch für das seit 2005 erhobene Verhaltensmerkmal "Sport und körperliche Bewegung" kein Trend erkennbar, der auf vermehrte Aktivitäten in der Bevölkerung hindeutet. Unter dem Strich lassen sich damit in den Daten des Gesundheitsmonitors keine Hinweise auf eine Trendwende finden. "Gesundheit ist nach unseren Befunden im Jahre 2007 keine Wertorientierung, die sich deutlich stärker als fünf Jahre zuvor auch im Alltagsverhalten der Bevölkerung niederschlägt", heißt es in der Veröffentlichung.
In der Studie wurde allerdings auch untersucht, ob ein gesundheitsriskantes Alltagsverhalten, etwa durch Rauchen, fehlende körperliche Bewegung oder ungesunde Ernährung, auch als tatsächliches Gesundheitsrisiko wahrgenommen wird und unter Umständen ein schlechtes Gewissen hinterlässt. Im Rahmen einer multivariaten Analyse wurde dann deutlich, dass das Merkmal Rauchen am aller stärksten zu einer Selbstkritik (oder einem schlechten Gewissen) führt. Die Wahrscheinlichkeit einer solcherart negativen Bewertung des eigenen Verhaltens liegt bei Rauchern viermal so hoch wie bei Nichtrauchern. Im Vergleich dazu sind die Effekte anderer gesundheitsriskanter Verhaltensweisen eher gering: Bei unzureichender körperlicher Bewegung und wenig Sport ist die Wahrscheinlichkeit für eine Selbstkritik des Gesundheitsverhaltens nur 1,5mal so hoch, für Alkoholkonsum und ungesunde Ernährung ist der Wert lediglich 1,3. Ein wenig höher (2,2) fällt der Einflussfaktor für den Body-Mass-Index aus.
Unter dem Strich bedeuten diese Befunde: Die Botschaften zu den vielfältigen Gesundheitsrisiken des Rauchens sind in der Bevölkerung angekommen. Wer heute noch raucht, tut dies ganz überwiegend mit schlechtem Gewissen oder zumindest begleitet von der Einsicht, dass es sich um ein im Prinzip veränderungsbedürftiges Verhalten handelt. Für die Bewertung des Alkoholkonsums andererseits, aber auch für den Risikofaktor ungesunde Ernährung, sei es durch zu seltenen Genuss von Salat, Obst, Gemüse oder durch zu häufigen Verzehr von Fast Food, Tiefkühlkost und Snacks, gilt jedoch: Diese Verhaltensweisen führen kaum einmal zu einer Selbstkritik des eigenen Gesundheitsverhaltens und gelten demzufolge auch kaum als besonders gesundheitsriskante Merkmale.
Auf die Frage, warum im Wesentlichen nur das Rauchen derzeit in der Bevölkerung als besonders problematisch wahrgenommen wird, erwähnen die Wissenschaftler mehrere Faktoren:
• Zum einen wird hervorgehoben, dass die Informationen über gesundheitliche Risiken des Tabakkonsums bis heute kein "Wenn und Aber" enthalten, die Befunde über Lungenkrebs und Herz-Kreislauf-Erkrankungen durch Tabak sind eindeutig und durch viele Studien belegt. Diese Unmissverständlichkeit und Eindeutigkeit der in epidemiologischen Studien wie Medienberichten mitgeteilten Risiken gilt für andere Aspekte des Gesundheitsverhaltens kaum. So folgten bei den Themen Übergewicht oder Alkohol zuletzt Entwarnungen auf Warnungen, Relativierungen auf Risikobotschaften.
• Ein zumindest ebenso wichtiger Hintergrund wird darin gesehen, dass die präventiven Maßnahmen gegen das Rauchen in den letzten Jahren sehr konsequent waren. Zwar wurden Rauchverbote in öffentlichen Gebäuden, Verkehrsmitteln und in der Gastronomie als Nichtraucherschutz begründet, körperlich spürbar sind sie jedoch jetzt auch für Raucher. Und parallel dazu nimmt die Bevölkerung weitere Interventionen wahr: Warnhinweise auf Tabakpackungen, Einschränkungen des Tabakerwerbs für Jugendliche an Automaten, Verbot der Tabakwerbung in vielen Medien. In Kombination mit Informationskampagnen und Präventionsmaßnahmen in verschiedenen Settings (rauchfreie Schulen, Betriebe, Krankenhäuser) resultierte daraus ein komplexer und weit gestreuter Interventionsmix aus verhaltens- und verhältnisorientierten Ansätzen, der aufgrund seiner Vielschichtigkeit und fast allerorts erfahrbaren Präsenz ein hohes Maß an Glaubwürdigkeit und Überzeugungskraft bekam.
Perspektivisch wird vor allzu großem Optimismus gewarnt, was weitere Erfolge von Präventionskampagnen zum Rauchen und auch zu anderen Themen anbetrifft. "Von daher sollten die auch in unseren Analysen feststellbaren Veränderungsbarrieren bei vielen gesundheitsriskanten Verhaltensweisen vor allzu großem Optimismus warnen, was eine rasche und nachhaltige Änderung des Status quo in der Gesamtbevölkerung anbetrifft. Die unterschiedliche Bewertung von Verhaltensrisiken in der Bevölkerung - Rauchen einerseits, Ernährung, Bewegung, Alkohol andererseits - macht aber auch deutlich, dass vor allem breit angelegte Präventionskampagnen und -programme unter Einbeziehung einer großen Zahl von verhaltens-wie verhältnispräventiven Maßnahmen Erfolg haben."
Der Newsletter mit dem Artikel ist hier im Volltext kostenlos herunterzuladen: Prävention: Verhaltensrisiken werden erkannt, Verhaltensänderungen sind eher die Ausnahme (Gesundheitsmonitor, Newsletter 2/2008)
Gerd Marstedt, 13.6.2008
Gesundheit steckt an - Nichtrauchen kein einsamer Entschluss
 In einer im New England Journal of Medicine veröffentlichten Studie untersuchten Nicholas Christakis und James Fowler die Frage, wie sich Personen in ihrem Raucherverhalten gegenseitig beeinflussen.
In einer im New England Journal of Medicine veröffentlichten Studie untersuchten Nicholas Christakis und James Fowler die Frage, wie sich Personen in ihrem Raucherverhalten gegenseitig beeinflussen.
Ihre Daten gewannen sie aus der Framingham-Studie, einer prospektiven Kohortenstudie, die im Jahr 1948 initiiert wurde und unter Einschluss neuer Gruppen bis heute fortgeführt wird.
Die Forscher erhoben Daten von 12.067 Erwachsenen im Alter von 21 bis 70 Jahren. Die Teilnehmer wurden zwischen 1973 und 1999 alle 3 Jahre nach ihren Rauchgewohnheiten und ihren sozialen Kontakten befragt, erhoben wurden auch Bildung und geographische Nähe zu den Kontakten. Für die Studie wurden letztlich die Angaben von 5.124 Personen ausgewertet, die insgesamt 53.228 soziale Verbindungen angaben, entsprechend 10,4 Verbindungen pro Person.
Es zeigte sich, dass Raucher und Nichtraucher Cluster bilden, d.h. dass Raucher mit höherer Wahrscheinlichkeit Kontakte zu Rauchern haben und Nichtraucher eher zu Nichtrauchern.
Die Änderung des Rauchverhaltens steht in engem Verhältnis zu dem Verhalten der Mitglieder des sozialen Netzwerks. Hörte ein Ehepartner mit dem Rauchen auf, nahm die Wahrscheinlichkeit, dass der andere weiterrauchte um 67 Prozent ab. Hörte ein Bruder oder eine Schwester auf betrug diese Wahrscheinlichkeit 25 Prozent, bei einem Freund 36 Prozent und bei Arbeitskollegen in Kleinfirmen 34 Prozent. Für Freunde gilt, dass eine höhere Bildung mit einem stärkeren Einfluss einhergeht. Zu beobachten war auch, dass im Untersuchungszeitraum die Verbindungen zwischen den Netzwerken von Rauchern und Nichtrauchern abnahmen und die Personen, die weiter rauchten eher an den Rand des Netzwerkes gerieten.
Die Forscher schließen daraus, dass der Entschluss zum Nichtrauchen keine einsame Entscheidung isolierter Personen ist sondern im Sinne gruppendynamischer Prozesse sich von einer Person auf die andere überträgt und in sozialen Gruppen bzw. Netzwerken kaskadenförmig erfolgt. Dieses Phänomen wurde insbesondere innerhalb von Familien und Betrieben beobachtet, wobei der Effekt in kleinen Betrieben mit engeren Kontakten stärker als in großen Betrieben ist.
Für Sozialwissenschaftler und Sozialpsychologen mögen diese Ergebnisse nicht überraschend sein. Offensichtlich erscheint jedoch, dass dieses Wissen um die soziale Dynamik von Gesundheitsverhalten in Konzepten der Prävention und Gesundheitsförderung noch nicht ausreichend genutzt und in Interventionen und Kampagnen umgesetzt wird. Die damit zu erzielenden Gesundheitsgewinne dürften erheblich sein.
Die soziale Dynamik gilt nicht nur für das Rauchverhalten - in einer im Juli 2007 veröffentlichten Studie hatten die selben Autoren durch Untersuchung der selben Kohorte bereits gezeigt, dass sich auch die Zunahme des Übergewichts innerhalb von sozialen Netzwerken ausgebreitet hat (Bericht im Forum Gesundheitspolitik).
Abstract der Studie "The Collective Dynamics of Smoking in a Large Social Network". New England Journal of Medicine 22. Mai 2008
Bericht über die Studie im NHS Knowledge Service (englisch)
Abstract der Studie über die Ausbreitung des Übergewichts (The Spread of Obesity in a Large Social Network over 32 Years). New England Journal of Medicine vom 26. Juli 2007.
David Klemperer, 28.5.2008
"Zu viel Salz ist gesundheitsschädlich!" Schon wieder ein Ernährungsirrtum aufgedeckt?
 Die Liste der Irrtümer und falschen Ratschläge zur gesunden Ernährung ist lang und wie es scheint, wird sie ständig aktualisiert. Unlängst hatte eine Literaturstudie gezeigt, dass es keinerlei Belege gibt für den Ratschlag:
Die Liste der Irrtümer und falschen Ratschläge zur gesunden Ernährung ist lang und wie es scheint, wird sie ständig aktualisiert. Unlängst hatte eine Literaturstudie gezeigt, dass es keinerlei Belege gibt für den Ratschlag:
"Täglich 1,5-2 Liter Wasser trinken!". Erst kurz zuvor hatten US-Wissenschaftler kritisiert: "Leitlinien und Ratschläge zur gesunden Ernährung verursachen oft mehr Schaden als Nutzen". Jetzt hat eine Beobachtungsstudie bei US-Bürgern im Alter über 30 Jahren festgestellt, dass wahrscheinlich nicht ein zu hoher, sondern eher ein zu niedriger Konsum von Salz gesundheitsschädlich ist.
Der Studie lag ursprünglich die Annahme zugrunde, dass ein hoher Verzehr von Salz zu hohem Blutdruck und daher auch vermehrt zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen führt und gesundheitsschädlich ist. Für die Studie wurden dann zwischen den Jahren 1988-1994 knapp 8.700 US-Bürger/innen gewonnen. Befragt wurden sie anfangs zur Einnahme von Salz bei ihren Mahlzeiten (auf der Basis eines 24 Stunden lang geführten Ernährungstagebuchs), zu ihren weiteren Ernährungsgewohnheiten, zu vorliegenden Erkrankungen und Risikofaktoren, ihrem Gesundheitsverhalten (Rauchen, Alkohol usw.) sowie zu vielen sozialstatistischen Angaben. Diese Teilnehmer wurden dann bis zum Jahr 2000 weiter beobachtet, Sterbefälle wurden anhand des "National Death Index" registriert und die entsprechenden Angaben und Todesursachen in den Datensatz eingefügt.
Zur Analyse dieser Daten wurden vier Gruppen gebildet, entsprechend der jeweils eingenommenen Menge an Salz. In der Analyse selbst zeigte sich dann:
• Die Intensität der Salzaufnahme variierte recht stark zwischen den Teilnehmern, auch sozialstatistische Merkmale spielen dabei eine Rolle. Männer zum Beispiel neigen sehr viel stärker zu einem hohen Salz-Konsum.
• Aufgrund dieser Variation wurden dann multivariate Analysen durchgeführt, in der eine Vielzahl von Faktoren (Alter, Geschlecht, Rasse, Bildung, Erkrankungen, Risikofaktoren, Gesundheitsverhalten) statistisch kontrolliert wurde.
• Das Risiko für das Auftreten von Sterbefällen durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen lag für die Gruppe mit sehr niedriger Salzaufnahme (unteres Quartil) 1.8mal so hoch im Vergleich zu der Gruppe mit sehr hoher Salzaufnahme (oberes Quartil).
• Nicht ganz so stark fielen die Unterschiede aus für das Mortalitätsrisiko insgesamt, also aufgrund aller Todesursachen. Auch hier war aber die Tendenz dieselbe. Die Gruppe mit niedrigem Salzkonsum wies ein 1.25mal so hohes Mortalitätsrisiko auf.
• Diese Ergebnisse bestätigen sich in der Tendenz auch bei einer sehr unterschiedlichen Konstruktion von Indikatoren zur Salzaufnahme.
Die Wissenschaftler des Albert Einstein College of Medicine in New York weisen einerseits darauf hin, dass ihre Studie eine gewisse methodische Schwäche aufweist, da der Salzkonsum nur einmal erfasst wurde. Andererseits sind ihre an einer sehr großen und repräsentativen US-Stichprobe gewonnenen Befunde so eindeutig, dass sie eine Überprüfung der tradierten und immer noch verbreiteten Ernährungsratschläge zum Salzverzehr und damit zur Vermeidung von kardiovaskulären Erkrankungen dringend nahe legen.
Hier ist ein Abstract der Studie: Hillel W. Cohen u.a.: Sodium Intake and Mortality Follow-Up in the Third National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES III) (Journal of General Internal Medicine, doi: 10.1007/s11606-008-0645-6, Published online: 9 May 2008)
Gerd Marstedt, 17.5.2008
Strikte Rauchverbote in US-Gaststätten und Restaurants hemmen bei Jugendlichen die Entwicklung zum Gewohnheitsraucher
 Im US-Bundesstaat Massachusetts gibt es - ähnlich wie auch in vielen anderen Bundesstaaten und Counties der USA - keine einheitliche Regelung zum Rauchverbot in Gaststätten und Restaurants. Aufgrund dieser Voraussetzung konnten Wissenschaftler der Boston University School of Public Health vor kurzem eine Beobachtungsstudie durchführen, die bei Jugendlichen im Alter von 12 bis 17 Jahren das Rauchverhalten überprüfte. Die jetzt in der Zeitschrift "Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine" veröffentlichte Studie konnte zeigen: Ein striktes Rauchverbot für die Gastronomie verhindert bei Teenagern zwar nicht, dass sie das Rauchen auch ausprobieren. Aber der Übergang von dieser Phase in den Status des Gewohnheitsrauchers wird durch konsequente Rauchverbote nachhaltig beeinflusst. Jugendliche, die sich in ihrer Freizeit nur in rauchfreien Kneipen, Bars und Bistros treffen können, zeigten bei Erhebungen nach mehreren Jahren deutlich niedrigere Raucherquoten.
Im US-Bundesstaat Massachusetts gibt es - ähnlich wie auch in vielen anderen Bundesstaaten und Counties der USA - keine einheitliche Regelung zum Rauchverbot in Gaststätten und Restaurants. Aufgrund dieser Voraussetzung konnten Wissenschaftler der Boston University School of Public Health vor kurzem eine Beobachtungsstudie durchführen, die bei Jugendlichen im Alter von 12 bis 17 Jahren das Rauchverhalten überprüfte. Die jetzt in der Zeitschrift "Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine" veröffentlichte Studie konnte zeigen: Ein striktes Rauchverbot für die Gastronomie verhindert bei Teenagern zwar nicht, dass sie das Rauchen auch ausprobieren. Aber der Übergang von dieser Phase in den Status des Gewohnheitsrauchers wird durch konsequente Rauchverbote nachhaltig beeinflusst. Jugendliche, die sich in ihrer Freizeit nur in rauchfreien Kneipen, Bars und Bistros treffen können, zeigten bei Erhebungen nach mehreren Jahren deutlich niedrigere Raucherquoten.
In der vierjährigen Beobachtungsstudie wurden zunächst die einzelnen Städte und Bezirke in Massachusetts in drei Kategorien unterteilt, je nachdem, ob dort a) ein striktes Rauchverbot für alle Gaststätten und Restaurants herrscht, b) Ausnahmeregelungen für Raucher zu finden sind oder c) nur schwache oder keinerlei Rauchverbote herrschen.
Eine repräsentative Zufallsauswahl von 3.834 Jugendlichen im Alter von 12 bis 17 Jahren aus 301 Orten wurde dann zum ersten Mal im Jahr 2001/2002 telefonisch interviewt und zu ihrem Rauchverhalten befragt. Zwei und vier Jahre später wurden Wiederholungsbefragungen durchgeführt, an denen allerdings nicht mehr alle Jugendlichen teilnahmen. Erfasst wurden nach 2 Jahren noch etwa 72% und nach 4 Jahren noch etwa 58% der Erststichprobe.
In der Analyse zeigte sich dann: In Orten oder Bezirken mit sehr konsequentem Rauchverbot betrug die Quote der jugendlichen Raucher nur 60% im Vergleich zu jenen Zonen, in denen es kein Rauchverbot oder sehr schwache Regelungen gibt. Dieser Effekt war ganz wesentlich darauf zurück zu führen, dass Jugendliche zwar in allen Bezirken in etwa gleichem Umfang auch mal das Rauchen ausprobiert hatten. Der Übergang von dieser Probierphase zum täglichen Rauchen war dann jedoch deutlich schwächer, wenn Kneipen und Cafes des Wohnorts ein rauchfreies Ambiente innehatten. Die Wissenschaftler führen diesen Effekte auf die Wahrnehmung einer geringen Akzeptanz des Rauchens in häufig besuchten Räumen zurück und eingeschränkte Möglichkeiten zur Routinisierung des Rauchens.
Hier ist ein Abstract der Studie: Michael Siegel u.a.: Local Restaurant Smoking Regulations and the Adolescent Smoking Initiation Process. Results of a Multilevel Contextual Analysis Among Massachusetts Youth (Arch Pediatr Adolesc Med. 2008;162(5):477-483)
Gerd Marstedt, 8.5.2008
Neuigkeiten von der Rauchverbots-Front: Unerwünschte Nebenwirkungen, Tricks und Theaterdonnern
 Zugegeben: In Deutschland gibt es bei den gesetzlichen Rauchverboten viele Ausnahmen und in fast jedem Bundesland sieht es ein wenig anders aus. Dies als "Flickenteppich" zu bezeichnen, wie in einem Rechtsgutachten im Auftrag des DKFZ geschehen, ist jedoch eine grobe Übertreibung, betrachtet man etwa die USA. Jeder Bundesstaat, jeder Verwaltungsbezirk und auch viele große Kommunen haben dort eigene und von den Nachbarn oft abweichende Reglungen. In manchen Bezirken ist das Rauchen in Kneipen und Bars noch ausnahmslos erlaubt, in anderen dagegen gelten schon erweiterte Rauchverbots-Zonen, die auch den kompletten Fußweg vor und neben der Gaststätte umfassen und das Rauchen auch dort mit Geldstrafen ahnden.
Zugegeben: In Deutschland gibt es bei den gesetzlichen Rauchverboten viele Ausnahmen und in fast jedem Bundesland sieht es ein wenig anders aus. Dies als "Flickenteppich" zu bezeichnen, wie in einem Rechtsgutachten im Auftrag des DKFZ geschehen, ist jedoch eine grobe Übertreibung, betrachtet man etwa die USA. Jeder Bundesstaat, jeder Verwaltungsbezirk und auch viele große Kommunen haben dort eigene und von den Nachbarn oft abweichende Reglungen. In manchen Bezirken ist das Rauchen in Kneipen und Bars noch ausnahmslos erlaubt, in anderen dagegen gelten schon erweiterte Rauchverbots-Zonen, die auch den kompletten Fußweg vor und neben der Gaststätte umfassen und das Rauchen auch dort mit Geldstrafen ahnden.
Zu welch unvorhergesehenen und wenig erfreulichen Nebenwirkungen diese völlig uneinheitlichen Regelungen führen, hat jetzt eine Studie gezeigt, die in der Zeitschrift "Journal of Public Economics" veröffentlicht wurde. Die beiden Wissenschaftler Scott Adams und Chad Cotti hatten Statistiken über Autounfälle der Jahre 2000 bis 2005 aus den gesamten USA analysiert und dabei Informationen ausgewertet, wann und in welchem Bezirk der Unfall geschah, ob der Fahrer Alkohol getrunken hatte und welche Personenschäden es gab. Ihr besonderes Augenmerk richteten sie dabei auf Unfälle unter Alkoholeinfluss des Fahrers mit tödlichen Folgen für Unfallbeteiligte. Diese Daten verglichen sie dann mit den im jeweiligen Bezirk gültigen Rauchverbots-Gesetzen.
Das überraschende Ergebnis: Bezirke oder Kommunen mit einem strikten Rauchverbot verzeichnen nach Einführung dieser Gesetze eine Zunahme tödlicher Autounfälle um etwa 13 Prozent oder 2.5 zusätzliche Todesfälle im Jahr für einen durchschnittlich großen Bezirk. In der Studie berücksichtigen die Forscher eine Vielzahl von Faktoren, die das Ergebnis auch hätten beeinflussen können. Ihr Befund ist jedoch nach eigener Aussage überaus "robust". Ihre Erklärung für das Phänomen: Einerseits legen passionierte Raucher innerhalb ihres Bezirks mit dem Auto zusätzliche Meilen zurück, um eine Kneipe zu finden, in der sie noch rauchen dürfen. Andererseits gibt es viele, die nach den Rauchverboten in ihrer Umgebung dann eine andere, weiter entfernte Kneipe oder Bar in einem benachbarten Bezirk mit dem Auto aufsuchen. Die zusätzlichen Meilen unter Alkoholeinfluss sind der Hintergrund für die Zunahme der tödlichen Unfälle. Die Wissenschaftler plädieren daher für eine einheitliche Lösung in den gesamten USA. Hier ist ein Abstract der Studie: Scott Adams, Chad Cotti: Drunk driving after the passage of smoking bans in bars (Journal of Public Economics, Volume 92, Issues 5-6, June 2008, Pages 1288-1305)
Wie unterschiedlich streng die Regelungen einzelner Counties und Bundesstaaten in den USA sind, wurde jetzt auch deutlich an einem erbitterten Rechtsstreit in Colorado. Seit dem 1.Juli 2006 gilt dort ein überaus strenges Rauchverbot in allen öffentlichen Einrichtungen. Dass diese Regelung auch für Theateraufführungen und die Bühne gilt, mochten viele Theater nicht akzeptieren. Viele Bühnenstücke wie z.B. Adward Albees "Wer hat Angst vor Virginia Woolf?", so ihre Argument, erfordern zwingend, dass die Darsteller auf der Bühne auch trinken und rauchen. Oder sie verwiesen auf das Drama von Dan Dietz "tempOdyssey", in dem das Rauchen eine Metapher für das Leben ist. Sobald ein Darsteller nicht mehr den eingeatmeten Tabakrauch ausbläst, stirbt er. Und so klagten dann insgesamt 444 Bühnen, um eine Ausnahmegenehmigung für das theatralische Rauchen zu bekommen. Nach anfänglichem Erfolg kam jetzt jedoch das Urteil in letzter Instanz. Wie die Zeitung "The Seattle Times" berichtet ("Smoking ban hamstrings stage productions"), wurde die Klage abgelehnt. Die Richter gaben sich dabei als intime Kenner des Theaters zu erkennen, denn ihre Begründung lautete: Das Theater arbeitet viel mit optischen und akustischen Täuschungen, Erschießungen und Pistolenschüsse werden ja auch nur vorgetäuscht. Also ist dieses Kunststück auch mit dem Rauchen möglich, Darsteller könnten ja in der Hand verstecktes Talkum-Puder wegblasen.
In Colorado ist jetzt also sogar das Rauchen auf der Bühne endgültig verboten. In anderen US-Bundesstaaten noch nicht. In Minnesota etwa kamen Gastwirte daher auf die Idee, ihre Kneipen einfach als Theater und den Schankraum als Bühne auszuweisen. Wie die Nachrichtenagentur AFP mitteilt ("Patrons become actors as bars evade smoking ban"), haben seit kurzem über 100 Bars und Kneipen sich zu Theatern erklärt und erlauben ihren Gästen jetzt wieder ohne Einschränkung das Rauchen. Ein vielerorts aufgeführtes Stück nennt sich (in Anlehnung an die "Vagina-Monologe") "Tabak-Monologe". Jeder Gast ist Schauspieler, Aschenbecher und Barhocker sind Teil des Bühnenbildes, die Texte werden frei improvisiert, im Dialog von Raucher zu Raucher. Ob die bloße Umbenennung von Kneipen in Theaterstätten auch langfristig hilft, das Rauchverbot zu umgehen, scheint fraglich. Denn nach einigen Beschwerden von nichtrauchenden "Theater-Besuchern" hat die Regierung des Bundesstaats jetzt reagiert und erklärt, dass die "Aufführungen" nicht mit den gesetzlichen Bestimmungen im Einklang sind und es an künstlerischen Merkmalen vermissen lassen. Den Wirten wurde ein Bußgeld bis zu 10.000 Dollar angedroht, falls sie weiterhin das Rauchen in ihren Räumen erlauben.
Was in Minnesota die Theater, sind in München die neu eingerichteten "Clubs". Wie der STERN jetzt berichtet ("Rudolf Stumberger: Raucher-Anarchie in Bayern"), wird das in Bayern überaus scharfe Rauchverbot mittlerweile vielerorts ausgehebelt: "Bei einer jüngsten Kontrolle vor zwei Wochen haben die Kontrolleure festgestellt, dass von 1000 gastronomischen Betrieben mittlerweile 300 zu 'Raucherclubs' wurden. Wird dort ein Gast angetroffen wird, ohne Mitglied zu sein, zieht das ein Bußgeld für den Wirt nach sich. Doch die Clubmitgliedschaft ist keine große Hürde: Name und Adresse auf einen Zettel gekritzelt und zur Zigarette gibt's das Bier. 'Nein, bisher wurde noch kein Bußgeld verhängt', ist dann auch die Bilanz des Kreisverwaltungsreferats."
Gerd Marstedt, 8.4.2008
"Täglich 1,5-2 Liter Wasser trinken!" Für diesen Ratschlag zur gesunden Lebensweise gibt es keine wissenschaftlichen Belege
 Es gibt wohl nur wenig Ratschläge zur gesunden Ernährung, die dermaßen oft und fast gebetsmühlenartig wiederholt werden wie dieser: "Täglich benötigen wir deshalb etwa 2 bis 2,5 Liter Wasser und etwa die gleiche Menge scheidet unser Körper an einem Tag wieder aus. Da heißt es: viel trinken!" (Wieviel Wasser braucht der Mensch? WDR, Quarks&Co, Sendung vom 12. Juli 2005). Anderthalb Liter Wasser am Tag sind die in Deutschland gängige Ernährungsempfehlung, in den USA lautet die griffigere Formel "8 mal 8", was bedeutet: Acht Gläser Wasser mit acht Unzen Inhalt, also knapp zwei Liter.
Es gibt wohl nur wenig Ratschläge zur gesunden Ernährung, die dermaßen oft und fast gebetsmühlenartig wiederholt werden wie dieser: "Täglich benötigen wir deshalb etwa 2 bis 2,5 Liter Wasser und etwa die gleiche Menge scheidet unser Körper an einem Tag wieder aus. Da heißt es: viel trinken!" (Wieviel Wasser braucht der Mensch? WDR, Quarks&Co, Sendung vom 12. Juli 2005). Anderthalb Liter Wasser am Tag sind die in Deutschland gängige Ernährungsempfehlung, in den USA lautet die griffigere Formel "8 mal 8", was bedeutet: Acht Gläser Wasser mit acht Unzen Inhalt, also knapp zwei Liter.
Zwei US-Wissenschaftler, Dan Negoianu und Stanley Goldfarb von der University of Pennsylvania School of Medicine in Philadelphia, haben sich jetzt einmal die Mühe gemacht, nach der wissenschaftlichen Evidenz für diese Präventionsempfehlung zu suchen. Ihr Aufsatz, der jetzt in der Zeitschrift "Journal of the American Society of Nephrology (JASN)" veröffentlicht wurde, präsentiert die Ergebnisse ihrer systematischen Literatursuche. Fundierte Belege für die Nützlichkeit größer Mengen an Trinkwasser fanden die beiden Wissenschaftler, die Experten für Nierenerkrankungen sind, nur für Sportler, für Situationen mit großer trockener Hitze und für einigen Erkrankungen. Für gesunde Menschen jedoch, die außerhalb von Wüstenzonen leben, fanden sie keine positiven Effekte.
Ihr Artikel endet mit dem Fazit: "Es gibt keinerlei wissenschaftliche Belege für einen gesundheitlichen Nutzen, wenn man mehr Wasser trinkt. Andererseits: Obwohl wir sehr gerne all die Mythen im Internet zerstört hätten, die diesen Nutzen beschreiben, müssen wir auch einräumen: Es gibt keinerlei wissenschaftliche Belege, dass eine zusätzliche Aufnahme von Wasser nun keinerlei Nutzen hat. Es ist schlichtweg so, dass es generell an Evidenz mangelt, was die Menge aufgenommener Flüssigkeit und die gesundheitlichen Effekte anbetrifft."
Negoianu and Stanley Goldfarb überprüfen im Rahmen ihrer Literatursuche auch eine Reihe von theoretischen Erklärungen, die oft angeführt werden, um die Empfehlungen für die hohe tägliche Trinkmenge zu begründen. Die Theorie der Nierenspülung und Reinigung von Giften und Schadstoffen ließ sich nicht bestätigen. Zwar hilft Flüssigkeit durchaus dabei, die Nieren zu durchspülen und giftige Stoffe auszuscheiden. Ob größere Mengen an Wasser einen zusätzlichen gesundheitlichen Effekt haben, ist jedoch unklar. Ähnliche Befunde fand man auch für andere Körperorgane, keine Studie konnte belegen, dass die Blase oder andere Organe des Uro-Genital-Traktes besser funktionieren mit mehr Wasserzufuhr.
Eine andere Theorie unterstellt, dass alle Körperorgane eine bestimmte Menge an Flüssigkeit aufbewahren und diese Flüssigkeitsreserve zum einwandfreien Funktionieren benötigen. Für diese Erklärung fanden sich jedoch ebenso wenig fundierte Studien wie für ein anderes ebenso populäres Konzept, dass große Mengen an Trinkwasser satt machen, daher die Aufnahme fester Nahrung reduzieren und Übergewicht verhindern. Also wissenschaftlich ebenso unbelegt stellten sich auch Theorien heraus, die große Flüssigkeitsmengen in Verbindung bringen mit einer besseren Blutzirkulation in den feinen Hautkapillaren oder mit einem schnellen körperlichen Abbau von Kopfschmerzen.
Die beiden Wissenschaftler bestätigen mit ihrer Veröffentlichung noch einmal die Befunde einer anderen Studie aus dem Jahr 2002, die ebenfalls keinerlei Evidenz gefunden hatte für die These eines gesundheitlich positiven Effekts von 8x8 Glas Wasser am Tag, vgl. den Artikel im Volltext (kostenlos): Heinz Valtin: Drink at least eight glasses of water a day. Really? Is there scientific evidence for "8 × 8"? (Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol 283: R993-R1004, 2002. doi:10.1152/ajpregu.00365.2002)
Zur Studie von Dan Negoianu and Stanley Goldfarb "Just Add Water" (J. Am. Soc. Nephrol., first published on April 2, 2008 as doi:10.1681/ASN.2008030274) gibt es leider kein kostenloses Abstract. Hier ist die kostenpflichtige Vollversion. Eine Zusammenfassung der Befunde ist hier: BBC News: Lots of water 'is little benefit'
Dass im Bereich der gesunden Ernährung mehr Mythen und Irrtümer im Umlauf sind als wissenschaftlich fundierte Empfehlungen haben zuletzt US-Wissenschaftler am Beispiel der (falschen) These "Fett macht fett" dargelegt. Die Übergewichts-Problematik ist danach mitverursacht worden durch Ratschläge von Ernährungswissenschaftlern, fettreiche Nahrungsmittel auf dem Speiseplan massiv einzuschränken oder ganz darauf zu verzichten. Diese Empfehlung habe in der Bevölkerung zu der Überzeugung geführt, dass es für eine gesunde Ernährung schon ausreiche, wenn man nur fettarme und fettfreie Produkte zu sich nähme. Als Effekt davon war der Anteil von Nahrungsmitteln deutlich angestiegen, die einen besonders hohen Anteil von Kohlenhydraten und Kalorien aufweisen - was wiederum zu Übergewicht und Fettleibigkeit bei vielen Bevölkerungsgruppen führte. vgl.: Wissenschaftler kritisieren: Leitlinien und Ratschläge zur gesunden Ernährung verursachen oft mehr Schaden als Nutzen
Gerd Marstedt, 7.4.2008
"Gesundheits-Hysterie!" - Englische Medien stellen Empfehlungen zum Gesundheitsverhalten massiv in Frage
 Lange Zeit hatten die englischen Medien nur kommentarlos berichtet über die stets neuen Gesundheits-Ratschläge von Wissenschaftlern und Ärzteverbänden. Nun scheint das Fass übergelaufen zu sein. Nachdem die Forschungs- und Informationsstelle "World Cancer Research Fund (WCRF)" im November letzten Jahres ihre neuen Ratschläge zum Gesundheitsverhalten und zur Prävention von Krebserkrankungen veröffentlicht hatte, schlugen die Medien in seltener Geschlossenheit zurück und attackierten die aus ihrer Sicht immer unverschämtere "Gesundheits-Hysterie" von Wissenschaftlern und Medizinern. Ausschlaggebend dafür war unter anderem, dass man englischen Bürgern den zum Frühstück ebenso wie auf Hamburgern ach so geliebten Speck verbieten wolle - unter Verweis auf darin verborgene Krebsrisiken.
Lange Zeit hatten die englischen Medien nur kommentarlos berichtet über die stets neuen Gesundheits-Ratschläge von Wissenschaftlern und Ärzteverbänden. Nun scheint das Fass übergelaufen zu sein. Nachdem die Forschungs- und Informationsstelle "World Cancer Research Fund (WCRF)" im November letzten Jahres ihre neuen Ratschläge zum Gesundheitsverhalten und zur Prävention von Krebserkrankungen veröffentlicht hatte, schlugen die Medien in seltener Geschlossenheit zurück und attackierten die aus ihrer Sicht immer unverschämtere "Gesundheits-Hysterie" von Wissenschaftlern und Medizinern. Ausschlaggebend dafür war unter anderem, dass man englischen Bürgern den zum Frühstück ebenso wie auf Hamburgern ach so geliebten Speck verbieten wolle - unter Verweis auf darin verborgene Krebsrisiken.
Rund 7.000 Studien zur Prävention von Krebserkrankungen hatte eine Expertenkommission gesichtet und in einem umfassenden Bericht "Food, Nutrition, Physical Activity and the Prevention of Cancer: A Global Perspective" die Ergebnisse zusammengefasst. Auf der Basis dieses Expertenberichts wurden dann zehn Empfehlungen zum Gesundheitsverhalten formuliert, um Krebserkrankungen vorzubeugen. Die Liste liest sich wie ein kleiner Katechismus zum gesunden Leben:
"1. Sei so dünn wie möglich - ohne Untergewicht zu bekommen
2. Sei jeden Tag mindestens 30 Minuten körperlich aktiv.
3. Vermeide gezuckerte Getränke. Schränke den Verzehr besonders energiereicher Nahrungsmittel ein (insbesondere weiter verarbeitete Produkte mit hohem Zuckerzusatz, wenig Ballaststoffen oder hohem Fettanteil).
4. Iß mehr Gemüse, Obst, Früchte, Körner und sei dabei abwechslungsreich.
5. Schränke den Verzehr von rotem Fleisch ein (Rind, Schwein, Lamm) und vermeide weiter verarbeitetes Fleisch (Speck, Schinken, Salami, Würstchen) möglichst ganz.
6. Wenn überhaupt, dann trinke nur mäßig Alkohol, Männer höchstens 2, Frauen 1 Getränk am Tag,
7. Schränke den Verzehr stark salzhaltiger Nahrungsmittel ein und solcher Produkte, die mit Salz angereichert wurden.
8. Nimm keine Nahrungsergänzungsmittel zur Krebsvorbeugung zu Dir.
Empfehlungen für einzelne Bevölkerungsgruppen:
9. Für Mütter ist es das Beste, das neugeborene Kind bis zu 6 Monate nur zu stillen und erst danach auch andere Flüssigkeiten und Nahrungsmittel zu geben.
10. Krebspatienten sollten nach der Therapie die Ratschläge zur Vorbeugung beherzigen.
Und - denke immer daran! - nicht rauchen oder Kautabak konsumieren."
(vgl.: World Cancer Research Fund 2007: WCRF UK's recommendations for cancer prevention).
Hatten die englischen Medien zuvor meist ebenso kommentar- wie schnörkellos über ähnliche wissenschaftliche Ratschläge berichtet oder über Maßnahmen der Regierung (Rauchverbot in Pubs, Interventionen für ein gesünderes Schulessen, Einführung der Lebensmittelampel), so formierte sich nun in seltener Einmütigkeit Widerstand.
• Das Boulevardblatt "The Sun" zitierte den Radio- und TV-Prominenten Antony Worrall Thompson, der die medizinischen Ratschläge überaus harsch abkanzelte: "Sie testen Mäuse und Ratten, geben ihnen eine Zwangsernährung und sie bekommen Krebs. Wir Menschen werden nicht zwangsernährt. Es ist überhaupt nicht verkehrt, in der Woche auch mal ein Speck-Sandwich zu essen. Wenn es nach ihnen geht, werden wir noch alle Vegetarier." Und auch ein Krebsspezialist des London Imperial College School of Medicine kam zu Wort: "Rotes Fleisch und Speck im Maßen gegessen ist nicht schädlich,. Dies zu behaupten ist schlicht falsch." vgl.: The Sun: Save our bacon: Butty battle
• In einer Meldung der Nachrichtagentur Reuters kommt ein Repräsentant der Nahrungsmittelindustrie zu Wort: "Sie können 20 oder 30 Jahre lang auf Speck verzichten, keinen Spaß am Leben haben, und dann erwischt Sie im Straßenverkehr ein Auto. Ich meine: Alles in Maßen!" vgl.: Reuters: Bacon munchers defy cancer scare
• In der "Daily Mail" nennt der Krebsspezialist Prof. Karol Sikora die Empfehlungen "ebenso banal wie dogmatisch" und fügt hinzu: "Niemand wird sich daran halten. Ich jedenfalls werden nicht auf sonntägliches Roastbeef und mein Glas Wein verzichten." vgl.: Daily Mail: Is anything safe to eat? Cancer report adds bacon, ham and drink to danger list
• Im "Guardian" ist davon die Rede, dass der "Hysterie-Bazillus" nun endgültig die Mediziner befallen hat. Der Redakteur Mark Lawson beklagt: "Die aktuelle Aufregung über Speck und Fettsäuren zeigt, dass die Probleme der öffentlichen Übertreibung und Hysterie nun bei den Ärzten angekommen sind. Die allgemeine Steigerung der Rhetorik im heutigen Leben hat die Wissenschaft erreicht. Gierig nach Publicity und Geldern behandeln Forscher nun einzelne Getränke und Nahrungsmittel so, als ob sie Osama bin Ladens der Ernährung wären, während es in Wirklichkeit doch so ist, dass Krebserkrankungen von einer komplexen Kette unterschiedlicher Faktoren abhängen: Gene, Umgebungsbedingungen, Lebensstil und auch Glück." vgl.: Guardian Unlimited: Blame it on the bacon - The latest commotion over diet and cancer suggests the hysteria bug has now infected doctors
• In einem anderen Artikel des "Daily Mail" schließlich gerät die in wissenschaftlichen Studien gängige Übertreibung durch Angabe relativer Risiken und Verschweigen der absoluten Risiken unter Beschuss. Vorgerechnet wird hier, was es tatsächlich heißt, wenn durch den Verzehr von rotem Fleisch das Risiko einer Darmkrebserkrankung um 9 Prozent steigt. Es ist für den Einzelnen eine absolut minimale Risikoerhöhung. vgl.: Daily Mail: 'Ignore these scaremongers - I'm not giving up my bacon butties!'
Für die heftige Gegenreaktion der englischen Massenmedien dürfte sicher eine Rolle gespielt haben, dass Mediziner eine Lieblingsspeise der Nation ins Visier nahmen: Bacon. Gleichwohl ist überraschend, dass mit der Tradition einer kommentarlosen Übernahme von Schlussfolgerungen aus wissenschaftlichen Studien zur Prävention im November 2007 gebrochen wurde. Es bleibt abzuwarten, ob dies erste Hinweise auf einen öffentlichen Meinungswechsel sind, der nicht mehr klaglos Belehrungen und Gebote für das individuelle Gesundheitsverhalten akzeptiert. Möglicherweise gab es in den Medien zuletzt ein Übermaß davon. Oder man vermisst Glaubwürdigkeit, wenn stets nur das Verhalten des Individuums auf der Anklagebank steht, nicht aber Versäumnisse der Politik, krankmachende Umweltbedingungen oder gesundheitsschädigende Praktiken der Nahrungsmittelindustrie, wie sie zuletzt etwa im Film "Super Size Me" (auf sehr humorvolle Art) angeprangert wurden.
Gerd Marstedt, 13.1.2008
Bewegung und moderater Alkoholkonsum zusammen sind mit niedrigem Gesamt- und Herzerkrankungs-Sterberisiko assoziiert!
 Erhöht oder senkt die Kombination einer Reihe von Verhaltensweisen, von denen die einen für "gesund" gelten, die anderen aber auch zu den eher "ungesunden" Verhaltensweisen gehören, die für viele Menschen zwar zum "guten Leben" und damit auch zum schwer Verzichtbaren gehören, das Risiko an einer ischämischen Herzerkrankung zu sterben bzw. aus irgend einem Grund zu sterben?
Erhöht oder senkt die Kombination einer Reihe von Verhaltensweisen, von denen die einen für "gesund" gelten, die anderen aber auch zu den eher "ungesunden" Verhaltensweisen gehören, die für viele Menschen zwar zum "guten Leben" und damit auch zum schwer Verzichtbaren gehören, das Risiko an einer ischämischen Herzerkrankung zu sterben bzw. aus irgend einem Grund zu sterben?
Dieser Fragestellung liegt eine Reihe von prospektiven Studien zugrunde, die sowohl für die körperliche Bewegung als auch für leichten bis mäßigen (1 bis 14 Drinks pro Woche; wer unter einem Drink pro Woche angibt, wird als Nichttrinker und wer 15 und mehr Drinks pro Woche zu sich nimmt als eine Person mit hohem Alkoholkonsum klassifiziert) Alkoholkonsum eine Minderung des Sterberisikos durch Herzerkrankungen aber auch der Gesamtsterblichkeit identifiziert haben. Da sich diese Studien jeweils nur um die Wirkung der einen Verhaltensweise kümmerten, blieb bisher unklar, ob das wirkliche Nebeneinander beider Verhaltensweisen unter Umständen die positiven Wirkungen neutralisiert oder gar zu einem insgesamt negativen Effekt führt.
Eine dänische Forschergruppe - Jane Pederson, Berit Heitmann, Peter Schnohr und Morten Gronbäk - veröffentlicht nun die Ergebnisse einer großen und langlaufenden prospektiven Kohortenstudie mit anfangs 11.914 DänInnen (5.272 Männer und 6.642 Frauen), die 20 Jahre alt und älter waren, vorher an keiner ischämischen Herzerkrankung litten und durchschnittlich nach 20 Jahren (2001 auf ihre Herzsterblichkeit und 2004 für die Gesamtsterblichkeit) erneut untersucht wurden.
Insgesamt starben in dieser Zeit 5.901 Personen an irgendeiner Ursache. Bei 1.242 Personen, d.h. rund 20% aller Gestorbenen, war eine Herzerkrankung die Ursache.
Nach einer umfangreichen Adjustierung der so genannten Confounder wie etwa dem Alter oder dem Rauchverhalten, ergaben sich für die Ausgangsfragestellung folgende Ergebnisse:
• Zunächst isoliert betrachtet bestätigen sich die Analysen, dass in ihrer Freizeit körperlich aktive Personen ein eindeutig niedrigeres Risiko haben an einer Herzerkrankung zu versterben oder auch sonst zu sterben als inaktive Individuen und dies auch für moderate Alkoholkonsumenten im Vergleich mit Nichttrinkern gilt.
• Die Personengruppe, die sich weder regelmäßig körperlich bewegt noch einen moderaten Alkoholkonsum hatte, hatte insgesamt und speziell ein hohes Sterberisiko. Dies gilt aber auch für die Personen mit hohem Alkohol-Konsumniveau.
• Umgekehrt hatten körperlich aktive Personen, die mindestens einen und höchstens 14 alkoholische Drinks pro Woche konsumierten ein um die Hälfte niedrigeres Herz-Sterberisiko und ein um ein Drittel niedrigeres Gesamtsterberisiko.
Auch wenn die Forscher selber auf eine Reihe von Einschränkungen der Qualität ihrer Studie hinweisen, sind sie sich aber sicher, dass dies nichts an den Grunderkenntnissen verändert.
Der neunseitige Aufsatz "The combined influence of leisure-time physical activity and weekly alcohol intake on fatal ischaemic heart disease and all-cause mortality" wird in der ersten 2008er-Ausgabe des "European Heart Journal" veröffentlicht und kann komplett und kostenfrei als PDF-Datei heruntergeladen werden.
Bernard Braun, 10.1.2008
Körperliche Bewegung + Nichtrauchen + mäßig Alkohol + gesunde Ernährung = Gewinn an 14 Jahren Lebenserwartung
 Eine kaum mehr überschaubare Vielzahl epidemiologischer Studien hat in den letzten Jahren aufgezeigt, wie hoch die Risiken durch Rauchen oder Alkoholkonsum für eine reduzierte Lebenserwartung sind oder wie stark ein gesundheitsbewusstes Alltagsverhalten, etwa durch gesunde Ernährung und körperliche Bewegung, vor chronischen Erkrankungen schützt. Ein gravierendes Defizit der allermeisten Studien war jedoch, dass sie nur einzelne Faktoren des Risikoverhaltens in den Analysen berücksichtigten.
Eine kaum mehr überschaubare Vielzahl epidemiologischer Studien hat in den letzten Jahren aufgezeigt, wie hoch die Risiken durch Rauchen oder Alkoholkonsum für eine reduzierte Lebenserwartung sind oder wie stark ein gesundheitsbewusstes Alltagsverhalten, etwa durch gesunde Ernährung und körperliche Bewegung, vor chronischen Erkrankungen schützt. Ein gravierendes Defizit der allermeisten Studien war jedoch, dass sie nur einzelne Faktoren des Risikoverhaltens in den Analysen berücksichtigten.
Ein Forschungsteam aus Cambridge, England, hat nun Ergebnisse einer Längsschnittstudie veröffentlicht, in der vier bekannte Risikofaktoren gleichzeitig einbezogen wurden und deren kombinierter Einfluss auf die Sterblichkeit analysiert wurde. Zentrales Ergebnis der Analyse war: Eine besonders gesunde Lebensweise bedeutet im Vergleich zu einem besonders riskanten Gesundheitsverhalten einen Unterschied von 14 Jahren Lebenserwartung. Die "gesunde Lebensweise" war dabei definiert über vier Verhaltensaspekte:
1.) Nichtrauchen
2.) Nur mäßiger Alkoholkonsum, maximal 14 Einheiten pro Woche, wobei eine Einheit definiert war als 1 Glas Wein, 1 Schnaps oder 1 Glas Bier (etwa 0,3 Liter)
3.) körperliche Bewegung bei der Arbeit oder in der Freizeit (dies wurde mit 4 Fragen erfasst)
4.) eine Ernährung mit mindestens 5 Portionen Obst und Gemüse am Tag (hier wurde der Vitamin C-Spiegel im Blutplasma gemessen und vercodet, ob dieser die Marke erreichte, die den Ernährungsempfehlungen zum Obst- und Gemüseverzehr entspricht)
Für jeden Aspekt eines gesunden Lebensstils wurde dann 1 Punkt vergeben, so dass hieraus Gruppen mit 0, 1, 2, 3 und 4 Punkten resultierten.
Die Daten stammen aus der sogenannten "EPIC-Norfolk Prospective Population Study", einer Gemeindestudie aus Norfolk in England. Aus dieser Stichprobe wurden insgesamt 20.244 Männer und Frauen im Alter von 45-79 Jahren berücksichtigt, die zu Beginn nicht von einer Krebs- oder Herz-Kreislauf-Erkrankung betroffen waren. Die Studie begann in den Jahren 1993-1997 und verfolgte den gesundheitlichen Werdegang der Studienteilnehmer bis zum Jahr 2006. Erhoben wurden neben den genannten Aspekten des Gesundheitsverhaltens auch viele sozialstatistische Daten, ferner wurden die Teilnehmer auch von Krankenschwestern körperlich untersucht und dabei der Body-Mass-Index ermittelt.
Bis zum Jahre 2006 waren dann 1.987 Studienteilnehmer verstorben. Die Wissenschaftler überprüften dann, wie sich das Gesundheitsverhalten auf die Lebenserwartung ausgewirkt hatte. In dieser multivariaten Analyse wurden neben dem Gesundheitsverhalten gleichzeitig auch noch sozialstatistische und andere Einflussfaktoren (Alter, Geschlecht, soziale Schichtzugehörigkeit, Body-Mass-Index) mitberücksichtigt. Aus der Analyse ausgeschlossen wurden solche Fälle, wenn Teilnehmer schon innerhalb von zwei Jahren nach Studienbeginn verstorben waren.
Es zeigte sich dann:
• Im Vergleich zu jener Gruppe mit insgesamt 4 Punkten (= Elementen eine gesundheitsbewussten Verhaltens) lag das Sterblichkeitsrisiko in den anderen Gruppen: bei 3 Punkten bei 1.39, bei 2 Punkten bei 1.95, bei 1 Punkt bei 2.52 und bei null Punkten bei 4.04. Das heißt: In der Gruppe mit extrem gesundheitsriskantem Verhalten ist das Mortalitätsrisiko viermal so hoch.
• Der Effekt war am stärksten ausgeprägt für Todesursachen, die mit kardio-vaskulären Erkrankungen zusammenhängen.
• Die Einflüsse blieben auch in etwa derselben Größenordnung nachweisbar, wenn Männer und Frauen getrennt betrachtet wurden.
• Als bedeutsamster Risikofaktor erwies sich das Rauchverhalten.
• Die Forscher errechneten dann auch, was die Risiken bedeuten im Hinblick auf den Gewinn oder Verlust von Lebensjahren. Es zeigte sich, dass ein Unterschied von 0 und 4 Punkten im Rahmen des Gesundheitsverhaltens insgesamt 14 Lebensjahre ausmacht.
• Deutlich wurde auch, dass ein konsequent gesundheitsbewusstes Verhalten (4 Punkte) nur bei einer Minderheit von 21% der Männer und 39% der Frauen vorzufinden ist. Umgekehrt findet sich ein extrem gesundheitsriskantes Verhalten (0 Punkte) allerdings bei einer noch kleineren Gruppe von 1.2% der Männer und 0.7% der Frauen.
Die Studie steht hier kostenlos im Volltext der Open-Access-Zeitschrift "PLOS Medicine" zur Verfügung:
Kay-Tee Khaw u.a.: Combined Impact of Health Behaviours and Mortality in Men and Women: The EPIC-Norfolk Prospective Population Study
Gerd Marstedt, 8.1.2008
Schwarze Schokolade schützt vor Herzinfarkt? Im Prinzip ja. Aber leider ...
 Der Genuss schwarzer Schokolade mit einem hohen Kakao-Anteil wurde in letzter Zeit in vielen Medien als überaus gesundheitsförderlich gepriesen. Die dort enthaltenen sogenannten "antioxidativen Flavonoide" wirken kardiovaskulären Risikofaktoren mehrfach entgegen, unter anderem, indem sie den Blutdruck reduzieren und ein Protein im Blut (HDL) vermehren, das für den Transport überschüssigen Cholesterins aus den Arterienwänden zurück zur Leber zuständig ist. So veröffentlichte das Journal of the American Medical Association (JAMA) Anfang Juli 2007 die Ergebnisse einer Arbeitsgruppe an der Pharmakologischen Abteilung des Universitätsklinikums Köln. An 44 gesunden Probanden zwischen 56 und 73 Jahren konnten die Wissenschaftler die genannten positiven Wirkungen dunkler Schokolade auf Herz und Kreislauf belegen und kommen zu einem überaus positiven Fazit: "We demonstrated that intake of low habitual amounts of dark chocolate caused progressive reductions of systolic and diastolic BP in older subjects with prehypertension or stage 1 hypertension without inducing weight gain or other adverse effects." Zumindest das Abstract dieser Studie ist kostenfrei herunterzuladen: Cocoa-Trial JAMA.
Der Genuss schwarzer Schokolade mit einem hohen Kakao-Anteil wurde in letzter Zeit in vielen Medien als überaus gesundheitsförderlich gepriesen. Die dort enthaltenen sogenannten "antioxidativen Flavonoide" wirken kardiovaskulären Risikofaktoren mehrfach entgegen, unter anderem, indem sie den Blutdruck reduzieren und ein Protein im Blut (HDL) vermehren, das für den Transport überschüssigen Cholesterins aus den Arterienwänden zurück zur Leber zuständig ist. So veröffentlichte das Journal of the American Medical Association (JAMA) Anfang Juli 2007 die Ergebnisse einer Arbeitsgruppe an der Pharmakologischen Abteilung des Universitätsklinikums Köln. An 44 gesunden Probanden zwischen 56 und 73 Jahren konnten die Wissenschaftler die genannten positiven Wirkungen dunkler Schokolade auf Herz und Kreislauf belegen und kommen zu einem überaus positiven Fazit: "We demonstrated that intake of low habitual amounts of dark chocolate caused progressive reductions of systolic and diastolic BP in older subjects with prehypertension or stage 1 hypertension without inducing weight gain or other adverse effects." Zumindest das Abstract dieser Studie ist kostenfrei herunterzuladen: Cocoa-Trial JAMA.
Der Ratschlag "häufiger schwarze Schokolade essen" stößt in der Praxis jedoch auf einige Probleme und Widrigkeiten, berichtet jetzt ein Artikel in der Zeitschrift "The Lancet".
Der Grund: Die Flavonoide sind zwar gesundheitsförderlich, schmecken aber leider auch sehr bitter, was vielen Konsumenten missfällt. Von daher werden sie von vielen Schokoladen-Herstellern bei der Produktion gänzlich oder überwiegend entfernt. Leider gibt es hierüber jedoch auf den Produkten keinerlei Hinweise, so dass der Käufer im Unklaren bleibt: Enthält diese Tafel Schokolade noch Flavonoide oder ist sie einfach nur dunkel und ohne jeden gesundheitlichen Wert?
Die Nachricht über den gesundheitsförderlichen Wert der schwarzen Schokolade tauchte vor kurzem in den Schlagzeilen vieler Medien auf. "Kakao als Herz-Kreislauf-Medikament? Kardiologen schwärmen von dunkler Schokolade" berichtete etwa die Online-Zeitschrift "Medical Tribune Österreich". Und andernorts hieß es "Schwarze Schokolade vermindert Herzinfarkt-Risiko". Eine Schweizer Studie, veröffentlicht im Januar 2006 in der Zeitschrift "Heart" hatte herausgefunden, dass der regelmäßige Konsum schwarzer Schokolade das Risiko eines Herzinfarktes vermindert, der von weißer Schokolade jedoch nicht (vgl.: Dark chocolate improves endothelial and platelet function).
Der Artikel im "Lancet" weist nun auf die Probleme hin, die durch die Herstellungstechnik und die fehlende Kennzeichnung der Nahrungsmittel-Bestandteile entstehen. Er zeigt überdies, dass Konsumenten, wenn sie schwarze Schokolade als Schutz vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen regelmäßig zu sich nehmen, überaus gewitzt sein müssen. Der sehr Kalorien, Fett- und bisweilen auch Zuckeranteil in diesem Produkt ist so hoch, dass sie dies bei der Kalkulation ihres Speiseplans exakt berücksichtigen müssen. Ansonsten drohen Übergewicht und Diabetes.
Hier ist der Artikel: The devil in the dark chocolate (The Lancet 2007; 370:2070; DOI:10.1016/S0140-6736(07)61873-X), das allerdings nur Abonnenten (kostenfrei) zur Verfügung steht.
Gerd Marstedt, 31.12.2007
"Aber der Brad Pitt raucht doch auch" - Rauchfreie Hollywood-Schauspieler nur "political correctness" oder Verhaltens-Vorbilder?
 In der Debatte darüber, warum Kinder oder heranwachsende Jugendliche anfangen zu rauchen, spielen Vorbilder in ihren Familien, der soziale Druck bzw. die Coolness in peer-groups oder auch die kommerzielle Werbung wichtige Rollen.
In der Debatte darüber, warum Kinder oder heranwachsende Jugendliche anfangen zu rauchen, spielen Vorbilder in ihren Familien, der soziale Druck bzw. die Coolness in peer-groups oder auch die kommerzielle Werbung wichtige Rollen.
Obwohl seit den Zeiten des Kettenrauchers Humphrey Bogart (der starb dann aber auch an Lungenkrebs) deutlich weniger in Filmen geraucht wird, wurde auch bei der Besinnung der Filmemacher auf mögliche Vorbildfunktionen über die Art und den Umfang der Wirkung der Schauspielervorbilder meist nur spekuliert. Je nach Interessenslage wurde die Wirkung über- oder untertrieben.
Bereits seit 2005 war aber der quantitative Einfluss des Rauchens in Filmen genauer bekannt.
In einer ersten umfangreichen Studie, deren Ergebnisse im November 2005 in der US-Zeitschrift "Pediatrics" veröffentlicht wurden, untersuchten James Sargent und weitere Forscher vom Dartmouth-Hitchcock Medical Center in Lebanon, N.H., zweierlei:
• Erstens analysierten sie in 500 der populärsten Filme der Jahre 1998 bis 2002 und 32 der umsatzstärksten Filme der ersten vier Monate des Jahres 2003, ob und wie intensiv dort geraucht wurde. In 74% aller untersuchten Filme wurde in irgendeiner Form geraucht, wobei die Forscher nach geringem und starkem Vorkommen von Rauchen oder eher nebensächlichem Auftreten unterschieden.
• Als zweites befragten die Forscher eine repräsentative Stichprobe von 6.522 Jugendlichen im Alter von 10 bis 14 Jahren telefonisch, ob sie einen oder mehrere von 50 zufällig aus den 532 klassifizierten Filmen ausgewählten Filmen gesehen hatten. Sie hatten im Durchschnitt 13 der Filme angeschaut und dabei durchschnittlich 61 ausgeprägte Raucherszenen gesehen. Die Hispanics und Afroamerikaner unter den befragten Jugendlichen hatten signifikant mehr Raucherszenen gesehen als gleichaltrige weiße Heranwachsende. Außerdem wurden sie gefragt, ob sie jemals schon versucht hatten, eine Zigarette zu rauchen oder zumindest mal einen Zug gewagt. Wer dies bejahte wurde als RaucherIn bewertet.
Nach Zusammenführung der Daten ergab sich folgendes Bild: Je mehr Filme mit Raucherszenen Heranwachsende gesehen hatten desto höher war der Anteil von Rauchern unter ihnen. Die Jugendlichen, die die meisten Filme mit Raucherszenen gesehen hatten, hatten 2,6fache Wahrscheinlichkeit RaucherIn zu sein als die Angehörigen ihrer peer-groups, die am wenigsten in solchen Filmen saßen. Dabei wurde der mögliche Einfluss anderer Faktoren wie das Alter, Eltern, Geschwister oder der von rauchenden Freunden kontrolliert, d.h. als erklärender Faktor ausgeschlossen. Das erhöhte Raucherrisiko zeigte sich im Übrigen bei Jugendlichen aus unterschiedlichen rassischen oder ethnischen Gruppen und in allen geographischen Regionen der USA.
In einer Folgestudie, deren Ergebnisse am 4. September 2007 in der US-Fachzeitschrift "Archives of Pediatric Adolescent Medicine" erschienen, beschäftigten sich Sargent et al. mit einer wesentlich ernsteren Verhaltensänderung bei dieser Altersgruppe, dem etablierten Rauchen. Zu den "established smokers" wurden die Heranwachsenden gerechnet, die angaben, in ihrem bisherigen Leben schon mehr als 100 Zigaretten geraucht zu haben und auch erste Abhängigkeitszeichen angaben. Die Befragten, welche am meisten Filme mit Raucherszenen angeschaut hatten, hatten gegenüber den Gleichaltrigen mit der geringsten "Exposition" gegenüber Raucherszenen-Filmen eine doppelt so hohe Wahrscheinlichkeit etablierter Raucher zu sein. Dieser Effekt war unabhängig vom Alter, den Eltern, Geschwistern und rauchenden Freunden. Die Studie unterstrich auch die vergleichbare Animationswirkung zum jugendlichen Rauchen durch Eltern und Geschwister oder durch Filmhelden.
Mit Appellen an Eltern oder rauchfreie Schulen und Einschränkungen der kommerziellen und jugendorientierten ("Rauchen gleich Abenteuer") Zigarettenwerbung alleine, erreicht man nach den Erkenntnissen dieser beiden Studien nur einen Teil der Einflussmechanismen und Vorbilder. Will man verhindern, dass in den USA bereits die Mehrheit der Jugendlichen unter 18 Jahren zu rauchen beginnt und nahezu 4.000 junge US-Amerikaner pro Tag ihre erste Zigarette rauchen, dürfen wohl auch Brad Pitt oder Kate Winslet nicht mehr bei jeder Gelegenheit zur Zigarette greifen.
Die vom "National Cancer Institute" der USA geförderte 2005er-Studie "Exposure to Movie Smoking: Its Relation to Smoking Initiation Among US Adolescents" von Sargent et al. ("Pediatrics", Vol. 116, No. 5, November 2005: 1183-1191) kann man hier komplett und kostenfrei herunterladen.
Vom 2007er-Aufsatz "Exposure to Smoking Depictions in Movies Its Association With Established Adolescent Smoking" von Sargent et al., der in der Zeitschrift "Archives of Pediatric Adolescent Medicine" (2007;161:849-856) erschien, gibt es ebenfalls eine kostenfreie Möglichkeit, den kompletten Text herunterzuladen (einfach PDF wählen).
Wem dies zu "amerikanisch" oder hollywoodesk erscheint, kann seit Frühjahr 2007 vergleichbare Ergebnisse mehrerer kontinentaleuropäischer Studien sogar in deutscher Sprache finden.
Die von Reiner Hanewinkel und erneut James D. Sargent sowie einer REihe weiterer deutscher AutorInnen verfasste 44-seitigen Expertise "Rauchen in Film und Fernsehen. Wirkungen auf Kinder und Jugendliche" kommt zu folgendem Ergebnis: "Der Effekt der Exposition mit Tabakrauchszenen in Filmen blieb sowohl in der Querschnitt- als auch in der Kohortenuntersuchung statistisch bedeutsam, selbst wenn eine Fülle weiterer Risikofaktoren der Initiierung des Rauchens wie das Lebensalter, das Geschlecht, die besuchte Schulart, der Rauchstatus der Eltern, Geschwister, Freunde, Persönlichkeitsvariablen wie "Sensation Seeking" und Renitenz, der elterliche Erziehungsstil, die Schulleistung und die Empfänglichkeit für Tabakreklame statistisch kontrolliert wurden. Dieser stabile Befund rechtfertigt die Schlussfolgerung, dass das Rauchen in Filmen als ein eigenständiger Risikofaktor für die Initiierung des Rauchens im Jugendalter angesehen werden muss."
Den kompletten materialreichen Text der Studie kann man kostenlos von einer Website des Bundesministeriums für Gesundheit herunterladen.
Bernard Braun, 27.12.2007
"Overfed but undernourished": Gesunde Ernährung wird auch durch hohe Preise für kalorienarme Lebensmittel beeinträchtigt
 In Debatten über "gesunde oder hochwertige Ernährung" spielt oft deren höherer Preis eine Rolle, was dazu führt, dass häufig die Angehörigen unterer sozialer Schichten mit oft erhöhten Erkrankungsrisiken sich nur die gesundheitlich "schlechteren" Nahrungsmittel leisten können.
In Debatten über "gesunde oder hochwertige Ernährung" spielt oft deren höherer Preis eine Rolle, was dazu führt, dass häufig die Angehörigen unterer sozialer Schichten mit oft erhöhten Erkrankungsrisiken sich nur die gesundheitlich "schlechteren" Nahrungsmittel leisten können.
Dass die Preiseffekte und damit die Anreize gegen "gesunde" und für "ungesunde" Ernährung in Wirklichkeit noch viel drastischer sind, zeigt - zumindest für die USA - eine jetzt gerade am "Center for Public Health Nutrition" der Universität des Bundesstaates Washington durchgeführte Untersuchung.
Die Ernährungswissenschaftler erhoben im Großraum Seattle im Jahre 2004 die Preise von frischen Früchten, Gemüse und anderen niederkalorischen Lebensmitteln ebenso wie die Preise von hochkalorischen Lebensmitteln mit verfeinertem Mehl, Zucker- und Fettzusätzen. Schon damals stellten sie durchweg niedrigere Preise der hochenergetischen Lebensmittel fest. Energiereiche Lebensmittel gelten u.a. deshalb als gesundheitlich problematisch, weil man mit ihnen, ohne dies richtig zu merken, mehr Kalorien konsumiert als man eigentlich bräuchte.
Als sie im Jahr 2006 dieselbe Preiserhebung ein zweites Mal durchführten und die Entwicklung der Preise untersuchten, fanden sie, dass sich die Unterschiede der Preise dieser Lebensmittelgruppen in diesem Zeit deutlich vergrößert hatten. Während die Preise der hochkalorischen Nahrungsmittel nahezu unverändert blieben, stiegen die der niedrigkalorischen Lebensmittel in diesem Zeitraum um 19,5% an. Dieser Anstieg lag deutlich über der Inflationsrate für Lebensmittel, die 5% betrug.
Der Leiter der Studie, Drewnowski, schlussfolgert daher auch zu Recht: "The gap between what we say people should eat and what they can afford is becoming unacceptably wide. If grains, sugars and fats are the only affordable foods left, how are we to handle the obesity epidemic?" Übergewicht und Fettsucht sind also in viel umfassenderer Weise als dies Querschnittsvergleiche der Lebensmittelpreise bisher zeigten auch ein ökonomisches Problem.
Was mit dieser Untersuchung aber auch klar wurde ist, dass die typische statistische Untersuchung des durchschnittlichen "Nahrungsmittelkorbs" gerade den besonderen Anstieg der Preise der gesündesten Nahrungsmittel drastisch unterschätzt.
Ein Abstract der Studie ist hier zu finden: Pablo Monsivais, Adam Drewnowski: The Rising Cost of Low-Energy-Density Foods (Journal of the American Dietetic Association, Volume 107, Issue 12, December 2007, Pages 2071-2076)
Bernard Braun, 10.12.2007
Manche mögens nur mit Bildern lassen - Schädigungen der Lungen von Passivrauchern erstmalig im Bild erkennbar.
 Zu der gerade nach der gesetzlichen Einführung der ersten rauchfreien öffentlichen Bereiche in Deutschland gebetsmühlenhaft bemühten "Argumentation" für ein letztlich doch friedliches Nebeneinander von Rauchern und Nichtrauchern gehört, zwar die Geruchsbelästigung anzuerkennen, aber die gesundheitlichen Risiken der passiven Inhalation des Zigarettenrauchs zu leugnen oder kleinzureden.
Zu der gerade nach der gesetzlichen Einführung der ersten rauchfreien öffentlichen Bereiche in Deutschland gebetsmühlenhaft bemühten "Argumentation" für ein letztlich doch friedliches Nebeneinander von Rauchern und Nichtrauchern gehört, zwar die Geruchsbelästigung anzuerkennen, aber die gesundheitlichen Risiken der passiven Inhalation des Zigarettenrauchs zu leugnen oder kleinzureden.
Diejenigen, die dies gegen alle Plausibilität und Evidenz vertreten, taten sich bisher insofern leicht, als dass es bisher anders als bei Raucherlungen und -beinen keinen bildhaften Beleg für vom Zigarettenrauch verursachte strukturzerstörende Schädigungen im Lungengewebe von Passivraucher gab.
Dies hat nun nach dem Einsatz eines speziellen bildgebenden "Stoffes" (einem Isotop von Helium, dem sog. Helium-3) im Rahmen der normalen Magnetresonanz-(MRI)Diagnostik) am Departement of Radiology des "The Children’s Hospital" von Philadelphia und der Universität von Virginia ein Ende.
Die Forschergruppe um Chengbo Wang untersuchte mit diesem Verfahren die Lungen von 60 Erwachsenen im Alter von 41 bis 79 Jahren, von denen 45 niemals aktiv geraucht hatten. Die Niemals-Rauchergruppe wurde in zwei Untergruppen aufgeteilt, die Personen mit niedriger und hoher Exposition gegenüber Passivrauchern zusammenfassten. Hochexponierte Personen hatten mindestens 10 Jahre mit einem rauchenden Partner zusammengelebt, oft seit ihrer Kindheit.
Die Forscher fanden, dass beinahe ein Drittel der Nichtraucher mit einer hohen Passivrauchexposition strukturelle Veränderungen in ihrem Lungengewebe hatten, die denen von Rauchern ähnlich waren. Für den Studienleiter Wang Anlass genug zu folgender Anmerkung: "We interpreted those changes as early signs of lung damage, representing very mild forms of emphysema", einer der häufigsten tödlichen Lungenerkrankungen von schweren Rauchern.
Scheinbar paradox war eine weitere Entdeckung: Die restlichen zwei Drittel der Personen, die gegenüber Zigarettenrauch hoch passiv exponiert waren, zeigten weniger strukturelle Schädigungen als die niedrig exponierten Vergleichspersonen. Auch vor weiteren Untersuchungen dieses Phänomens formulierten die Forscher die Hypothese, dass hier das Frühstadium einer anderen Lungenerkrankung, der chronischen Bronchitis, wahrscheinlich durch die Verengung der Atemwege, eine zumindest vorübergehende protektive Gegenwirkung entfaltet.
Auch wenn die Untersuchungsgruppe nur Erwachsene umfasst, gehen die Forscher davon aus, dass solche Schädigungen auch bei mehrjähriger Rauchexposition von Kindern in Raucherhaushalten auftreten und nachweisbar wären. Wer die jahrelangen Anti-Antiraucherdiskurse kennt, hätte sich natürlich auch noch gewünscht, dass erfasst oder veröffentlicht worden wäre, ob die Passivraucher nicht alle gegenüber irgendwelchen anderen lungenstrukturzerstörenden Stoffen exponiert gewesen waren, die dann das ja schlicht nicht zu leugnende Zerstörungswerk anrichten hätten können.
Auch wenn alle Raucher und Ex-Raucher wissen, dass Bilder von Schädigungen nur eine kurze oder gar keine verhaltenssteuernde Wirkung haben, können die Unterschiede des Zustands von Angehörigen aller drei untersuchten Gruppen in der Veröffentlichung in Farbe betrachtet werden. Die Studie wurde vom US-amerikanischen National Heart, Lung and Blood Institute, dem Flight Attendant Medical Research Institute, dem Commonwealth of Virginia Technology Research Fund und Siemens Medical Solutions als Herstellerfirma der Magnetresonanzgeräte gefördert.
Die wesentlichen Inhalte und drei MRI-Bilder zu der Studie "Secondhand Smoke Damages Lungs, MRIs Show" des Children's Hospital of Philadelphia sind am 27. November 2007 im Wissenschaftsportal "Sciencedaily" veröffentlicht und herunterladbar.
Bernard Braun, 27.11.2007
Treppen-Steigen statt Rolltreppen-Fahren - Wie man körperliche Bewegung fördern kann
 Eine englische Forschungsgruppe hat unlängst deutlich gemacht, dass unzureichende körperliche Bewegung (als eine der Ursachen von Übergewicht) nicht allein der Bequemlichkeit von Individuen angelastet werden darf, sondern auch aus "ungesunden Lebensräumen" resultiert, einer Architektur zum Beispiel, die durch allerorten installierte Rolltreppen und Fahrstühle von körperlicher Bewegung abhält (vgl.: "Übergewicht ist nicht allein individuell verschuldet, sondern auch Effekt ungesunder Lebensräume"). Wie man das oft als lästig oder sogar körperlich zu anstrengend empfundene Treppensteigen in öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen steigern kann, haben einige Studien beschrieben, die in den letzten Monaten in der Zeitschrift "American Journal of Health Promotion" veröffentlicht wurden. Dabei zeigte sich, dass es recht einfache Maßnahmen gibt, die die Quote der notorischen Rolltreppenfahrer ganz erheblich senken und die Quote der Treppensteiger entsprechend erhöhen.
Eine englische Forschungsgruppe hat unlängst deutlich gemacht, dass unzureichende körperliche Bewegung (als eine der Ursachen von Übergewicht) nicht allein der Bequemlichkeit von Individuen angelastet werden darf, sondern auch aus "ungesunden Lebensräumen" resultiert, einer Architektur zum Beispiel, die durch allerorten installierte Rolltreppen und Fahrstühle von körperlicher Bewegung abhält (vgl.: "Übergewicht ist nicht allein individuell verschuldet, sondern auch Effekt ungesunder Lebensräume"). Wie man das oft als lästig oder sogar körperlich zu anstrengend empfundene Treppensteigen in öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen steigern kann, haben einige Studien beschrieben, die in den letzten Monaten in der Zeitschrift "American Journal of Health Promotion" veröffentlicht wurden. Dabei zeigte sich, dass es recht einfache Maßnahmen gibt, die die Quote der notorischen Rolltreppenfahrer ganz erheblich senken und die Quote der Treppensteiger entsprechend erhöhen.
In einem großen englischen Einkaufszentrum wurden 4 Monate lang in Nähe der Treppen Plakate gezeigt, die auf die gesundheitsförderlichen Aspekte des Treppensteigens aufmerksam machen, etwa ("Treppensteigen ist gut für Ihr Herz", "...fördert Ihren Kreislauf" etc.). Vor Beginn der Maßnahme wurde an zwei Treppen jeweils die Zahl der Passanten gemessen, die die Treppe auch zu Fuß benutzen. An einer Treppe wurden dann die Hinweise (mit wechselnden Texten) gezeigt, die andere, etwa 25 Meter entfernte Treppe ohne Meldungen diente zur Kontrolle. Es zeigte sich dann, auch noch 5 Wochen später, nachdem man die Hinweisschilder nicht mehr darbot, dass die Zahl der Treppenbenutzer erheblich gestiegen war, an der Treppe mit Gesundheits-Plakaten um 161%, an der anderen Treppe um 143%. Dass auch an dieser Stelle die Treppe mehr benutzt wurde, lässt sich wohl durch einen Erinnerungs-Effekt erklären. Viele Besucher nahmen die Poster wahr und folgten der Aufforderung dann an einer Stelle, die sie erst ein wenig später erreichten. Insgesamt wurden knapp 70.000 Passanten gezählt.
Oliver J. Webb, Frank F. Eves: Promoting Stair Climbing: Intervention Effects Generalize to a Subsequent Stair Ascent (American Journal of Health Promotion, Volume 22, Issue 2 (November 2007), 114-119)
In einer anderen Studie mit über 80.000 Passanten in einem Einkaufszentrum wurde überprüft, inwieweit die optische Gestaltung von Treppen dazu verführen kann, auf Fahrstühle und Rolltreppen zu verzichten und Treppen zu Fuß zu besteigen. Dazu wurden einerseits Treppenstufen farbig sehr intensiv und schnell wahrnehmbar gestaltet, andererseits zu einem späteren Zeitpunkt auf diese farbigen Treppenstufen kurze Meldungen aufgemalt, wie zum Beispiel "7 Minuten Treppensteigen am Tag schützt Ihr Herz". (vgl. auch das Foto hiervon bei MSNBC "Stairs may be key in tool in battle of the bulge"). Ein Vergleich der Treppenbenutzungs-Zahlen vor Beginn der Intervention und am Ende zeigte dann: Ein einfache optische Aufbesserung der Treppen durch kräftige Farben zeigte keinen Effekt, wohl aber die Anbringung der Gesundheits-Mahnungen. Hier ergab sich eine Steigerung der Benutzerquote um 190%, also nahezu eine Verdoppelung. Die Zahl derjenigen, die die Treppe auch abwärts benutzten (von wo aus man die Meldungen nicht sehen konnte) stieg zwar auch ein wenig, lag aber mit einer Quote von +25% deutlich niedriger.
Oliver J. Webb, Frank F. Eves: Effects of Environmental Changes in a Stair Climbing Intervention: Generalization to Stair Descent (American Journal of Health Promotion, Volume 22, Issue 1 (September 2007), 38-44)
In einer weiteren, bereits im November 2006 veröffentlichten Studie, wurden etwa 16.000 Passanten gefilmt, die den Flughafen von San Diego in Kalifornien benutzten. Das Filmmaterial wurde dann darauf hin ausgewertet, ob es so etwas wie einen Nachahmungseffekt gibt. Tatsächlich zeigte sich, dass immer dann, wenn andere Fluggäste Treppen anstatt der überall verfügbaren Rolltreppen benutzten, auch die Quote derjenigen anstieg, die es ihnen nachmachte. Dabei wurden von Seiten der Forscher (als Experiment) auch Personen eingesetzt mit dem gezielten Auftrag, Treppen statt Rolltreppen zu benutzen. Die Quote der Treppensteiger stieg dabei um etwa das 2-3fache je nach Art und Anzahl der gerade aktiven "Vorbilder". Eine Umsetzung der aus dieser Studie gewonnenen Erkenntnisse fällt allerdings nicht ganz leicht. Man könnte allerdings über den berufsmäßigen "Treppensteiger" nachdenken, der auf Flughäfen und in Einkaufszentren eingesetzt wird - natürlich auf der Basis eines 1-Euro-Jobs.
Marc A. Adams u.a.: Promoting Stair Use by Modeling: An Experimental Application of the Behavioral Ecological Model (American Journal of Health Promotion, Volume 21, Issue 2 (November 2006), 101-109)
Gerd Marstedt, 15.11.2007
Die nächste Runde im Kampf gegen das Rauchen ist in den USA schon eingeläutet: Rauchverbote in Parks und Privatwohnungen
 Deutsche Gesundheitspolitiker, die die jetzt beschlossenen Rauchverbote in Gaststätten und öffentlichen Einrichtungen noch als viel zu lasche Maßnahmen zum Schutz von Nichtrauchern bewerten, könnten neidisch werden: In den USA gibt es bereits gesetzliche Regelungen, die beispielsweise in öffentlichen Parks und an Gemeinde-Stränden das Rauchen unter Strafe stellen. Und einige Kommunen und größere Immobilien-Gesellschaften haben auch schon in den von ihnen vermieteten Objekten in größeren Wohnblocks das Rauchen strikt untersagt.
Deutsche Gesundheitspolitiker, die die jetzt beschlossenen Rauchverbote in Gaststätten und öffentlichen Einrichtungen noch als viel zu lasche Maßnahmen zum Schutz von Nichtrauchern bewerten, könnten neidisch werden: In den USA gibt es bereits gesetzliche Regelungen, die beispielsweise in öffentlichen Parks und an Gemeinde-Stränden das Rauchen unter Strafe stellen. Und einige Kommunen und größere Immobilien-Gesellschaften haben auch schon in den von ihnen vermieteten Objekten in größeren Wohnblocks das Rauchen strikt untersagt.
Einer Reihe von Vorstößen deutscher Politiker, um noch strengere Rauchverbote in der Öffentlichkeit durchzusetzen, blieb (bislang) der Erfolg versagt. Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Sabine Bätzing, hatte ein Rauchverbot am Steuer auch privater Pkws verlangt - die Verkehrssicherheit würde einen solchen Eingriff in die Privatsphäre rechtfertigen. Ohne Erfolg. (Focus: "Streit um Rauchverbot in Autos") Dann forderte die Europa-Abgeordnete der Grünen, Hiltrud Beyer, ein generelles Rauchverbot auch in Biergärten und Festzelten (SPIEGEL Online: "Grüne wollen Rauchen im Biergarten verbieten"). Dem Verlangen nach einem uneingeschränkten Rauchverbot in sämtlichen Arbeitsstätten, einschließlich der Innen- und Außenbereiche der Gastronomie, war ebenfalls bislang kein Erfolg beschieden. Dabei hätte man sich auf eine Studie berufen können, die Wissenschaftler der Stanford-Universität in Kalifornien jetzt veröffentlicht haben: Sie hatten untersucht, wie sich Tabakqualm auf die Luft in Straßencafes oder rund um Parkbänke auswirkt, wo sich Raucher gern versammeln, um ihrer Sucht zu frönen. Überraschendes Ergebnis: Die Schadstoffbelastung in der Nähe eines Rauchers hält zwar im Freien nur kurze Zeit an, ist aber kaum weniger intensiv als in geschlossenen Räumen. Erst bei einem Abstand von Rauchern von etwa zwei Metern sei man vor den Folgen des Passivrauchens hinreichend geschützt. (vgl. "Real-Time Measurement Of Outdoor Tobacco Smoke Particles").
Nicht zuletzt diese Studienergebnisse haben in den USA Entscheidungen mitbewirkt, die das Rauchen auch im Freien untersagen. In den USA haben jetzt schon über 700 staatliche und kommunale Verwaltungen ein Rauchverbot für Spielplätze ausgesprochen oder Eingangsbereiche öffentlicher Gebäude. In Kalifornien ist man besonders bedacht auf den Nichtraucherschutz. In der Kommune Santa Monica, am Pazifik gelegen, gilt bereits ein generelles Rauchverbot auch in Parks und an den Stränden der Gemeinde. Aber auch vor Geldautomaten oder in Warteschlangen vor Kino- und Theaterkassen sind Glimmstängel streng untersagt. Ähnlich strenge Regeln gelten in San Fransicisco, wo auch in den Touristen-Attraktionen Golden Gate Park oder am legendären Union Square im Stadtzentrum ein absolutes Rauchverbot gilt - bei einer Strafandrohung von 100 Dollar. (NTV: "Frische Luft auch draußen - Rauchverbot in San Francisco").
Noch einen Schritt weiter ging unlängst, wie der SPIEGEL berichtete, die kalifornische Gemeinde Belmont. "Einem Beschluss des Stadtrats zufolge ist das Qualmen in den eigenen vier Wänden in Zukunft verboten. (...) Von der neuen Vorschrift betroffen sind die Bewohner von Appartementhäusern, in denen sich Anwohner über eine Rauchbelästigung beschweren könnten. Auch Parks, Freiluft-Restaurants und andere öffentliche Plätze sollen in die Verbotszonen eingeschlossen werden. Schwacher Trost für Nikotin-Liebhaber: In Einfamilienhäusern, Tabakläden und Motel-Zimmern sowie im eigenen Auto soll das Schmöken weiterhin erlaubt sein. Und: Sogar auf dem Bürgersteig darf geraucht werden - allerdings nur, solange der Flaneur einen Sicherheitsabstand von 6,6 Metern zum nächsten Hauseingang oder Fenster einhält." (SPIEGEL Online: "US-Stadt verbietet Rauchen im eigenen Heim")
Dass das verschlafene Belmont womöglich Vorreiter ist für eine neue Runde gesetzlicher Maßnahmen gegen das Rauchen, hat jetzt ein Artikel in der New York Times angedeutet. Danach mehrt sich die Zahl der Wohnungsbau- und Wohnungs-Vermietungs-Gesellschaften, die keinerlei Raucher mehr in ihren Mietobjekten dulden. Im Bundesstaat Michigan hat sich in den letzten drei Jahren die Zahl der großen Vermieter-Gesellschaften, die ihre Wohnungen nur noch an konsequente Nichtraucher vermieten, versechsfacht, von 10 auf 60. "Guardian Management", eine der großen Wohnungsbau-Gesellschaften mit Sitz in Oregon, hat jetzt im August 2007 insgesamt 8.000 Wohneinheiten in Idaho, Montana, Oregon, Texas und Washington für Raucher gesperrt. (NYT: "A New Arena in the Fight Over Smoking: The Home")
Gerd Marstedt, 5.11.2007
Studie kritisiert fehlende wissenschaftliche Grundlagen und unzureichende Evaluation der Prävention in Deutschland
 Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und Präventionsprogramme in Deutschland werden derzeit eher nach Gutdünken der Veranstalter oder Lust und Laune der finanzierenden Einrichtungen durchgeführt, nicht aber nach wissenschaftlich fundierten Kriterien, die eine Bewertung der Erfolgschancen und Effektivität erlauben. Zu dieser zentralen Aussage kommen Wissenschaftler des Instituts für Gesundheitsökonomie und klinische Epidemiologie (IGKE) an der Universität zu Köln auf der Grundlage einer Literaturauswertung von Evaluationsstudien zu Präventionsmaßnahmen.
Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und Präventionsprogramme in Deutschland werden derzeit eher nach Gutdünken der Veranstalter oder Lust und Laune der finanzierenden Einrichtungen durchgeführt, nicht aber nach wissenschaftlich fundierten Kriterien, die eine Bewertung der Erfolgschancen und Effektivität erlauben. Zu dieser zentralen Aussage kommen Wissenschaftler des Instituts für Gesundheitsökonomie und klinische Epidemiologie (IGKE) an der Universität zu Köln auf der Grundlage einer Literaturauswertung von Evaluationsstudien zu Präventionsmaßnahmen.
Die Kritik der Forscher, Prof. Dr. Karl Lauterbach und PD Dr. Markus Lüngen, gilt einerseits der unzureichenden Diskussion darüber, welche Zielsetzungen im Bereich der Prävention vorrangig verfolgt werden sollten, woraus eine weitgehend ungesteuerte Ausgabe von Fördergeldern resultiert, deren Ertrag ungewiss ist. Problematisch erscheint ihnen allerdings ebenso der Forschungsstand - nach wie vor sei es so, dass Evaluationen von Präventions- und Gesundheitsförderungs-Maßnahmen methodisch äußerst dürftig seien, auf einem Wissensstand, wie ihn die Medizin vor einem Vierteljahrhundert aufwies: "In Deutschland konzentriert sich die Diskussion in der Prävention und Gesundheitsförderung derzeit wesentlich auf die Mittelherkunft, also darum, welche Beteiligten welche Summen aufbringen müssen. Kaum eine Diskussion gibt es um die entscheidendere Frage, für welche Projekte die Mittel ausgegeben werden sollten. (...) Unsere Studie hat gezeigt, dass die Situation zum Nachweis von Effektivität in Prävention und Gesundheitsförderung auch im internationalen Umfeld in etwa den Stand der kurativen Medizin von vor 25 Jahren aufweist. Belastbare und ausreichend erprobte Kataloge zur Bewertung und anschließenden Priorisierung von Präventionsangeboten fehlen weitgehend."
Die Kölner Gesundheitsökonomen werteten anhand eines umfassenden Kriterienkatalogs rund 120 Evaluations-Studien aus, die wiederum Präventionsprogramme aus 13 Staaten bewerteten. Die Untersuchung bezieht Studien aus den USA, Kanada, Australien, Neuseeland, Großbritannien, Frankreich, den Niederlanden, den nordischen Ländern, Österreich und der Schweiz ein. Ihre Fragestellung ist: Lassen sich im Ausland Präventions-Konzepte identifizieren, die einer systematischen, methodisch anspruchsvollen wissenschaftlichen Prüfung unterzogen wurden und sich in dieser Evaluation als wirkungsvoll erwiesen? Angesichts von mehreren tausend Präventionsprogrammen konzentrierten sich die Forscher dazu exemplarisch auf vier Themen: Bewegungsprogramme im Betrieb und speziell für Mädchen und Frauen; Depressions-Prävention in der Schule; gute Ernährung für Schüler sowie Raucherentwöhnung bei Schwangeren.
Zusammenfassend heben sie hervor, dass trotz der massiven methodischen Defizite der meisten Evaluationsstudien und ebenso der mangelhaften Konzepte von Gesundheitsförderungs-Programmen gleichwohl einige Tendenzen erkennbar seien, auf denen man aufbauen könne. Dies betrifft zunächst Erkenntnisse über die Unwirksamkeit einer Reihe von Maßnahmen: "So sind zur Förderung der Bewegung Plakate mit der Aufforderung zum Gebrauch der Treppe statt des Aufzugs in Betrieben nicht effektiv. Bei Jugendlichen kann eine Zunahme der Bewegung nur mit kombinierten Angeboten, welche Schule und/oder Eltern einbeziehen, erreicht werden, nicht mit Programmen, die rein edukativ ansetzen. Die Änderung des Ernährungsverhaltens konnte von isolierten Programmen kaum nachgewiesen werden, lediglich die Kombination mit verstärkter Bewegung unter Einbeziehung der Familien / Eltern zeigt vermehrt Effektivität. Die Änderung des Rauchverhaltens bei Schwangeren wird am ehesten dann erreicht, wenn als Autoritäts- oder Fachpersonen wahrgenommene Gruppen im Programm beteiligt werden, etwa Ärzte oder Hebammen. Auch im Bereich Depression scheint sich zu zeigen, dass rein edukative Ansätze kaum Wirkung zeigen, jedoch Programme mit verhaltenstherapeutischen Ansätzen eher effektiv sind."
Auf der anderen Seite erkennen sie aber auch einige wenige erfolgversprechende Konzepte, etwa im Bereich Bewegung. Im Handlungsfeld Frauen und Mädchen und Bewegung existieren zwei zumindest teilweise effektive Studien, die von ihnen als " stark empfehlenswert" eingestuft werden. Diese Studien schlossen eine vorherige Befragung der Zielgruppe ein und integrierten möglichst alle Beteiligten wie Schule, Gemeinde etc. Auch für andere Maßnahmefelder (Ernährung, Ernährung und Bewegung, Rauchen, Prävention von Depressionen) finden sie einige hoffnungsvolle Ansätze.
Für dringend erforderlich halten sie gesetzliche Vorgaben, damit endlich eine wissenschaftlich fundierte Bewertung von Präventions- und Gesundheitsförderungsmaßnahmen erfolgen kann: "Auf Grund der Heterogenität der Erhebungsmethoden und der Effektparameter sollte der Gesetzgeber dafür Sorge tragen, dass bundesweit einheitliche Evaluationsstandards erarbeitet werden. Nach dem Ablauf einer genügend großen Zahl von Interventionen und nachfolgender Evaluation können dann Empfehlungen ausgearbeitet werden, welche Interventionstypen Erfolg versprechend sind. Der Gesetzgeber sollte daher auch vorsehen, dass in einem angemessenen Zeitraum eine umfassende Zusammenführung der durchgeführten Interventionen beziehungsweise ihrer Evaluationen erfolgt."
• Pressemitteilung der Hans-Böckler-Stiftung "Studie von Gesundheitsökonomen der Uni Köln: Qualitätssicherung von Präventionsprogrammen hat international große Defizite
• Zusammenfassung der Studienergebnisse: International erfolgreiche Interventionen der Prävention und ihre Übertragbarkeit auf Deutschland
• Die komplette Studie (PDF, 208 Seiten): G. Klever-Deichert, A. Gerber, MA Schröer, E. Plamper: International erfolgreiche Interventionen der Prävention und Gesundheitsförderung und ihre Übertragbarkeit auf Deutschland. Entwicklung und exemplarische Anwendung eines Bewertungsinstruments
Gerd Marstedt, 23.10.2007
Preis, gesundheitsbezogene Qualität und Komfort von Laufschuhen: Keine Spur von Zusammenhang.
 Egal, ob drei Streifen, gar keine Streifen, wasser- oder edelgasgepuffert oder mit und ohne Super-Torsion: "Richten Sie sich ja nicht nach dem Preis, wenn es um die Wahl von möglichst gesunden Sportschuhen geht!", so könnte salopp die Schlussfolgerung aus einer kleinen Studie in Großbritannien lauten.
Egal, ob drei Streifen, gar keine Streifen, wasser- oder edelgasgepuffert oder mit und ohne Super-Torsion: "Richten Sie sich ja nicht nach dem Preis, wenn es um die Wahl von möglichst gesunden Sportschuhen geht!", so könnte salopp die Schlussfolgerung aus einer kleinen Studie in Großbritannien lauten.
Unter der Überschrift "Do you get value for money when you buy an expensive pair of running shoes?" berichten Richard Thomas Clinghan, Graham P Arnold, Tim S Drew, Lynda Cochrane und Rami J Abboud vom Institute of Motion Analysis & Research der University of Dundee in der im Verbund mit dem BMJ erscheinenden Fachzeitschrift "British Journal of Sports Medicines" (Online first 11. Oktober 2007) von einer Untersuchung des Zusammenhangs von messbarer Qualität sowie subjektiv empfundenem Komfort von Sportschuhen mit den extrem unterschiedlichen Preisen.
In ihr wurden von 43 Testpersonen drei Paar Laufschuhe von drei verschiedenen Herstellern aus drei Preiskategorien, nämlich 40-45, 60-65 und 70-75 britischen Pfund gekauft und getestet. Die Tests bestanden in einer Messung der für die Sport- und Gesundheitsfunktion wichtigen Druckverteilung und damit Abfederung von Stößen gegenüber dem Gelenk- und Skelettsystem des Läufers auf der gesamten Fußsohle mit Hilfe des so genannten PEDAR-Systems. Der Komfort der Schuhe konnte auf einer validierten Skala bewertet werden. Diese Messungen erfolgten sowohl während Übungen auf einem Lauf-Heimtrainer und beim Outdoor-Walking, wobei sich keine großen Unterschiede bei der Leistungsfähigkeit der Schuhe zeigten.
Die weiteren Ergebnisse lauteten:
• Niedrig- und mittelpreisige Laufschuhe derselben Marke lieferten dieselbe, wenn nicht sogar eine bessere Federungswirkung wie die hochpreisigen Produkte. Insgesamt gab es aber weder zwischen den unterschiedlich teuren Exemplaren derselben Marke noch zwischen Marken nennenswerte Unterschiede.
• Die Bewertung des Komforts hängt offensichtlich stark von individuellen Präferenzen ab und hing weder mit der gemessenen Druckverteilung noch dem Preis der Schuhe zusammen. Hier muss angemerkt werden, dass den Testpersonen der Preis und die Marke der Schuhe unbekannt war, d.h. auch eindeutige Erkennungsmerkmale verdeckt wurden.
• Der Preis war kein Indikator oder Prädiktor für Federungsleistung oder Komfort.
Von dem Aufsatz "Do you get value for money when you buy an expensive pair of running shoes?" gibt es kostenfrei lediglich ein Abstract.
Bernard Braun, 15.10.2007
Interventionen für mehr körperliche Aktivität bei Kindern und Jugendlichen: Schlichte Erziehungsmaßnahmen bringen nichts
 Körperliche Aktivität, Sport und Bewegung gelten neben einer gesunden Ernährung als zentrale Ansatzpunkte zur Prävention chronischer Erkrankungen wie Diabetes und als erfolgversprechende Strategie zum Abbau von Übergewicht. In den USA und Großbritannien herrscht beim Thema Übergewicht im Kindes- und Jugendalter Alarmstimmung, aber auch in Deutschland hat die KiGGs-Studie erst vor kurzem besorgniserregende Zahlen zutage gebracht. Von daher ist die Frage gesundheitspolitisch von erheblicher Bedeutung, mit welchen Maßnahmen man Jüngere zu mehr Sport und Bewegung aktivieren kann.
Körperliche Aktivität, Sport und Bewegung gelten neben einer gesunden Ernährung als zentrale Ansatzpunkte zur Prävention chronischer Erkrankungen wie Diabetes und als erfolgversprechende Strategie zum Abbau von Übergewicht. In den USA und Großbritannien herrscht beim Thema Übergewicht im Kindes- und Jugendalter Alarmstimmung, aber auch in Deutschland hat die KiGGs-Studie erst vor kurzem besorgniserregende Zahlen zutage gebracht. Von daher ist die Frage gesundheitspolitisch von erheblicher Bedeutung, mit welchen Maßnahmen man Jüngere zu mehr Sport und Bewegung aktivieren kann.
Eine jetzt im "British Medical Journal" veröffentlichte Übersichts-Studie hat dazu einige Antworten vorgelegt. Ausgewertet wurden insgesamt 57 Studien, die über Interventionen und ihre Effektivität teils bei Jugendlichen, teils bei Kindern berichtet haben. 24 dieser Studien waren nach Ansicht der Wissenschaftler von hoher methodischer Qualität (Kontrollgruppe, zufällige Zuweisung zur Interventions- bzw. Kontrollgruppe, große Stichproben, Effektkontrolle nach mindestens 6 Monaten usw.) Die durchgeführten Interventionen umfassten sehr unterschiedliche Vorgehensweisen, von Erziehungs- und Aufklärungs-Maßnahmen über eine Umgestaltung von Schulhöfen bis hin zu komplexen Strategien unter Einbeziehung auch von Schulen, Familien oder Gemeinden. In der Zusammenfassung heben die Forscher mehrere Ergebnisse heraus.
• Es gibt keinerlei Belege, dass reine Erziehungs- und Aufklärungsmaßnahmen erfolgreich sein könnten. Von den 36 Studien, die sich auf diese Art der Intervention beschränken, zeigen nur sehr wenige statistisch signifikante Effekte, viele Studien weisen überdies methodische Defizite auf. Die durchgeführten Maßnahmen betreffen sehr vielfältige Themen, u.a. zusätzlichen schulischen Unterricht zu Gesundheitsrisiken und Ernährung, Unterrichtsmaterialien zur Senkung des Fernsehkonsums, Durchführung von Sommer-Camps, Freizeitgruppen usw.
• Für Umwelt- und Umgebungsveränderungen findet sich gleichfalls keine Evidenz, dass diese erfolgreich sind, die Ergebnisse der hierzu bewerteten 5 Studien sind uneinheitlich. In diesen Studien wurden beispielsweise Schulklassen mit zusätzlichen Sportgeräten ausgestattet, Schüler bekamen Informationsmaterial mit Anregungen für körperbetonte Spiele, auf Schulhöfen wurden Spielfelder renoviert und durch Malerarbeiten farblich noch einmal besonders deutlich hervorgehoben, um zum Spielen anzuregen.
• Für komplexe Interventionen mit mehreren Komponenten finden sich hingegen recht deutliche Hinweise ihrer Effektivität. Ganz eindeutig gilt dies zumindest bei Jugendlichen , bei Kindern sind die Ergebnisse uneinheitlich. Ähnlich zeigt sich auch, dass bei Jugendlichen ein Einbezug der Familie oder Gemeinde positive Ergebnisse begünstigt, also auch nach einem längeren Zeitraum noch zu mehr körperlicher Betätigung führt. Die überwiegend in Schulen durchgeführten Studien, umfassten jeweils mehrere Komponenten, wie z.B. vermehrter Sport, zusätzliche Unterrichtsstunden zu Gesundheitsthemen, Verbannung von "Junk-Food" aus der Schule, Gymnastik und Übungen im Klassenraum, Beratung für die Eltern, Training und Weiterbildung der Lehrer usw.
Unter dem Strich zeigt sich, dass Interventionen bei Kindern weniger erfolgreich sind als solche bei Jugendlichen, was möglicherweise ein schlichter Effekt des bei Kindern noch sehr viel höheren, ganz natürlichen Bewegungsdrangs ist, der auch ausgelebt wird und daher bei zusätzlichen Interventionen wenig Steigerungsmöglichkeiten eröffnet. Ob Interventionen, die sich speziell an bestimmte Gruppen richten (wie ethnische Minderheiten, Kinder aus unteren Sozialschichten), nun effektiv sind, ist nach Meinung des Forschungsteams unklar. Die zuletzt vermehrt zu beobachtende Zielsetzung, sich speziell diesen Gruppen zuzuwenden, ist jedenfalls durch den aktuellen Forschungsstand keineswegs als sinnvoll belegt.
Die Übersichtsstudie ist hier im Volltext nachzulesen: Esther M F van Sluijs u.a.: Effectiveness of interventions to promote physical activity in children and adolescents: systematic review of controlled trials (BMJ 2007;335:703, 6 October)
Gerd Marstedt, 10.10.2007
"Rama mal halblang!" Oder "Hast du heute morgen schön gammelige Fischabfälle aufs Brot geschmiert?" - Omega 3-Fettsäuren
 Mit diesen etwas launigen Sprüchen startet in der aktuellen Ausgabe der sonst durchaus ernsthaften Zeitschrift "Gehirn&Geist" ein lockerer Disput über die nicht nur vom "Rama"-Hersteller entdeckten und verkaufsfördernd beworbenen gesundheitlichen Wunderwirkungen der Omega 3-Fettsäuren gegen Herz-Kreislauferkrankungen und Schlaganfälle und überhaupt die gesamte Sterblichkeit. "Streich Dich gesund" beim Frühstück oder doch nur ein Stück geschickte Ausbeutung des "Gesundheitsmarktes" oder von Publikumsängsten?
Mit diesen etwas launigen Sprüchen startet in der aktuellen Ausgabe der sonst durchaus ernsthaften Zeitschrift "Gehirn&Geist" ein lockerer Disput über die nicht nur vom "Rama"-Hersteller entdeckten und verkaufsfördernd beworbenen gesundheitlichen Wunderwirkungen der Omega 3-Fettsäuren gegen Herz-Kreislauferkrankungen und Schlaganfälle und überhaupt die gesamte Sterblichkeit. "Streich Dich gesund" beim Frühstück oder doch nur ein Stück geschickte Ausbeutung des "Gesundheitsmarktes" oder von Publikumsängsten?
Wie bereits eine 2006 im renommierten "British Medical Journal (BMJ)" (BMJ 2006; 332: 752-760) erschienene Analyse der Ergebnisse von 48 RCTs (randomised controlled trials) mit 36.913 TeilnehmerInnen und 41 Kohortenstudien über die Wirkungen der gezielten über sechsmonatigen Aufnahme von Omega 3-Fettsäuren durch Erwachsene zeigte, ist hier gesunde Skepsis angebracht.
Der Aufsatz "Risks and benefits of omega 3 fats for mortality, cardiovascular disease, and cancer: systematic review" einer Gruppe britischer Epidemiologen und Gesundheitsforscher um Lee Hooper, extrahierte aus den genannten wissenschaftlichen Studien folgende Ergebnisse:
• Weder die Aufnahme von lang- noch von kurzkettigen Omega 3-Fettsäuren hat eine klare reduzierende Wirkung ("found no evidence of a clear benefit of omega 3 on health") auf die Gesamtsterblichkeit oder das Auftreten einer Reihe von Ereignissen im Zusammenhang mit Herz-/Kreislauferkrankungen und
• Anders von einigen Wissenschaftlern befürchtet, weist keine der Studien ein erhöhtes Risiko von Krebserkrankungen im Zusammenhang mit einer höheren Aufnahme der Omega 3-Säuren nach. Trotzdem kommen die Forscher zum skeptischen Schluss: "clinically important harm could not be excluded."
In der Auseinandersetzung mit einem anderen, 2002 veröffentlichten Review, der für Personen mit koronarer Herzkrankheit eine Reduktion der Sterblichkeit durch die Ernährung mit langkettigen Omega-Fettsäuren als gesichert ansah, weisen Hooper et al. darauf hin, dass dort noch nicht eine der langfristigsten aktuellen Studien berücksichtigt wurde, die maßgeblich zum hier dargestellten Ergebnis beitrug. Die Einzelheiten können in dem Hooper-Aufsatz und in der dort nachgewiesenen weiteren Literatur nachgelesen werden. Ohne selber sagen zu können, ob und wie die Debatte ein Ende findet, soll hier lediglich auf die bisher mangelhafte wissenschaftliche Evidenz und merkantile Wunschwelt der "streich Dich gesund"-Kampagnen hingewiesen werden.
Der BMJ-Aufsatz von Hooper et al. "Risks and benefits of omega 3 fats for mortality, cardiovascular disease, and cancer: systematic review" ist hier komplett und kostenlos als PDF-Datei herunterladbar.
Bernard Braun, 6.8.2007
UK: Ein übergewichtiger Überblick über Prävention, Identifikation, Bewertung und Management von Übergewicht/Adipositas.
 829 Seiten Text und einschließlich der 18 Anhänge insgesamt 2.590 Seiten umfasst die vom britischen "National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)" und "National Collaborating Centre for Primary Care" im Dezember 2006 vorgelegte (vorläufig) letzte Fassung der "Clinical Guideline No. 43" zum Thema "obesity".
829 Seiten Text und einschließlich der 18 Anhänge insgesamt 2.590 Seiten umfasst die vom britischen "National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)" und "National Collaborating Centre for Primary Care" im Dezember 2006 vorgelegte (vorläufig) letzte Fassung der "Clinical Guideline No. 43" zum Thema "obesity".
Die für England und Wales sowie wahrscheinlich auch weltweit in dieser Fülle erst- und einmalige Leitlinie ist in folgende große Abschnitte aufgeteilt:
• Section 1: Executive summary, introduction and methods,
• Section 2: Identification and classification,
• Section 3: Prevention (z. B. determinants of weight gain and weight maintenance; interventions to raise awareness; intervention for pre-school children and family-based interventions; school-based interventions; workplace interventions; interventions led by health professionals; broader community interventions; interventions aimed at black and minority ethnic groups, vulnerable groups and vulnerable life stages)
• Section 4: Management of obesity 1 (in non-clinical settings)
• Section 5a: Management of obesity 2 Kinder/Jugendliche (in clinical settings)
• Section 5b: Management of obesity 2 Erwachsene (in clinical settings)
• Section 6: Health Economics (Cost Effectiveness of clinical interventions; CE of public health interventions)
• Section 7: Research recommendations
• Appendices (18 Teile)
Da es unmöglich ist, hier selbst oberflächlich auf die Fülle von Funden, Literaturhinweisen und Hinweisen einzugehen, sei nur auf die Darstellungsweise hingewiesen, welche die Verfasser der Leitlinie wählten, die Fülle des Materials darzustellen.
Zu Beginn der unterschiedlichen Abschnitte finden sich tabellarische Übersichten, in denen die Richtigkeit oder Evidenz der mehr oder weniger verbreiteten Thesen und Fragen auf der Basis von überwiegend angelsächsischer Forschungsliteratur aufgelistet wird. Die zeitliche Spannweite der Literaturrecherche reicht von 2005 teilweise viele Jahre und Jahrzehnte zurück. Dabei ordnen sie den Forschungserkenntnissen Evidenzgrade zu, die sich an den Evidenzgraduierungen und -kriterien der Cochrane-Reviews orientieren. Dies bedeutet die Verwendung von insgesamt acht Evidenzlevels, die von Level 1++ für "high quality meta-analyses, systemativ reviews of RCTs, or RCTs with a very low risk of bias" bis zu Level 4 für "expert opinion, formal consensus" reicht. In einer gesonderten Spalte werden die Studien genannt, welche die Einstufung begründen und nachvollziehen helfen. Die am Ende jeden Abschnitts stehenden Literaturverzeichnisse sind entsprechend umfangreich.
Im Abschnitt, der den Kenntnisstand im Bereich der klinischen Identifikation und Klassifikation von Übergewicht und Adipositas bei Kindern und Erwachsenen darstellt, lauten die aufgelisteten Evidenzstatements und ihre Einstufung beispielsweise so:
• "BMI is a widely accepted and practical estimate of general adiposity in children" bekommt das Level 2++,
• "Waist circumference is a useful measure of central adiposity in adults" bekommt das Evidenzlevel 3 und
• "There is no accepted definition for classification using BMI in older people" gleich Level 2++.
Trotz dieser komfortablen Übersicht, sollten Interessenten in jedem Fall noch die ausführlichen Fließtext-Darstellungen von Studien und ihre Bewertung lesen, in denen sich eine Fülle methodischer Hinweise und nicht zuletzt auch Empfehlungen für den Umgang mit den aufbereiteten Informationen und praktischen Schlussfolgerungen finden.
Auffällig ist auch hier das immer wieder angesprochene Fehlen gesicherter Evidenz für mehr als die Hälfte der Konzepte, Programme, Mess- und Interventionstypen für den Umgang mit Übergewicht und Adipositas und die schwache Evidenz für viele weitere Maßnahmen etc. (z. B. "What is striking is that we lack good evidence of the effectiveness of a number of key interventions, particulary in children"). Umgekehrt existieren nur wenige Interventionen, die in allen Studien und in verschiedenen Ländern und zu unterschiedlichen Zeitpunkten eine ausreichende Evidenz für ihre Wirksamkeit und Effizienz besaßen.
Für die Kosteneffizienz der nicht-pharmakologischen Interventionen stellen die NICE-Autoren etwa fest, dass "a number of caveats must be attached to using these results as unequivocal evidence of cost effectiveness of these kinds of interventions." Der Mangel an ausreichend großen Studien und weitere suboptimale Merkmale der vorliegenden Studien lassen die "generalisability of the results...questionable" erscheinen. Sie sollten als "corroborative (zu untermauernde/erhärtende) evidence, rather than definite proof of the cost effectiveness of non-pharmacological interventions" eingestuft und damit zurückhaltend genutzt werden.
Bei aller Anerkennung für diese Übersicht bleiben allein angesichts des Umfangs der Leitlinie Zweifel daran, ob sich die zusammengetragenen und gewonnenen Erkenntnisse wirklich in absehbarer Zeit und vor allem gegen die Alltagsplausibilität der zahllosen Interventionen und Angebote behaupten oder gar durchsetzen kann. Schon wesentlich umfangärmere und weniger differenzierte NICE-Leitlinien haben nämlich nachweisbar geringe oder gar keine Praxiswirkungen.
Die gesamte Guideline von "National Institute for Health and Clinical Excellence und National Collaborating Centre for Primary Care (Ed.) (2006): Clinical Guideline No. 43 (CG43): Obesity: the prevention, identification, assessment and management of overweight and obesity in adults and children. Full guidance Final Version vom December 2006" steht aufgeteilt nach den thematischen Blöcken und den einzelnen Anhängen im Wordformat sowie als PDF-Datei zum Herunterladen auf der Homepage des NHS National Institute for Health and Clinical Excellence" zur Verfügung. Interessenten mit langsameren technischen Möglichkeiten sollten sich allerdings genau die Downloadzeiten der mehrfach viele MBs großen Dateien ansehen.
Bernard Braun, 22.7.2007
Vom Verplempern von Zeit und Geld in bekannt wirkungslosen Anti-Übergewichtsprogrammen - Der Aufwand wirksamer Programme
 "Offensichtlich ist gerade bei den jüngsten Schülern zwischen sechs und zehn Jahren der Einfluss ihrer außerschulischen Umwelt, von Eltern, Großeltern und Freunden, deutlich größer als der der Schule. Die Zeit, die die Kinder in der Schule verbringen, reicht zur Prävention von Übergewicht allein nicht aus" - so die Zusammenfassung der Ergebnisse einer vier Jahre lang von der Techniker Krankenkasse (TK) und ihrem wissenschaftlichen Kooperationspartner, der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW) durchgeführten schulbasierten Studie durch die Leiterin des Gesundheitsmanagements der TK.
"Offensichtlich ist gerade bei den jüngsten Schülern zwischen sechs und zehn Jahren der Einfluss ihrer außerschulischen Umwelt, von Eltern, Großeltern und Freunden, deutlich größer als der der Schule. Die Zeit, die die Kinder in der Schule verbringen, reicht zur Prävention von Übergewicht allein nicht aus" - so die Zusammenfassung der Ergebnisse einer vier Jahre lang von der Techniker Krankenkasse (TK) und ihrem wissenschaftlichen Kooperationspartner, der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW) durchgeführten schulbasierten Studie durch die Leiterin des Gesundheitsmanagements der TK.
In der Studie "primakids" nahmen 600 Kinder an 14 Hamburger Grundschulen teil. Die Studienfrage lautete, ob Kinder, bei denen Gesundheit vom ersten Schultag an auf dem Stundenplan steht, ein anderes Gesundheitsverhalten und (Über-)Gewicht zeigen als Kinder, die keinen Gesundheitsunterricht haben.
Die Studie zeigt, dass die Zahl der übergewichtigen Kinder in den Schulen mit Gesundheitsunterricht am Ende der vierten Klasse nicht kleiner ist als in den Kontrollklassen.
Auch wenn im Nachhinein verschiedene Beteiligte trotzdem einige "insgesamt" positiven Effekte des Gesundheitsunterrichts benennen, ändert dies nichts an der nachgewiesenen Nichtwirkung auf den Leitindikator Übergewicht. Zugänglich sind die Ergebnisse des TK-Modellversuchs im Moment nur in einer Tagungs-Presseerklärung.
Auch wenn die Beteiligten an solchen Einfachinterventionen überrascht sind, hätten sie streng genommen das Ergebnis voraussehen können. Und zwar dann, wenn sie die seit Jahren und Jahrzehnten weltweit gemachten Erfahrungen aus wissenschaftlich begleiteten Modellversuchen zur Reduktion des Übergewichts von Erwachsenen und Kindern zur Kenntnis und ernst(er) nehmen genommen hätten.
So bewertet beispielsweise ein systematischer 123-seitiger Review "Interventions to Prevent Obesity" des schwedischen "Council on Technology Assessment in Health Care" in seiner aktualisierten Fassung von 2005 die ebenfalls kargen Ergebnisse von zwei Dritteln der reviewten internationalen Studien zur Prävention des Übergewichts von Kindern und Jugendlichen so: "The fact that two thirds of the studies fail to demonstrate an positive effect may reflect the difficulty of achieving lifestyle changes in children and adolescents with school-based interventions alone that do not include the home environment, free time, and the community at large."
Bevor jetzt aber überstürzt nur ein etwas komplexeres "super-primakids"-Programm gestartet wird, lohnt ein Blick auf den Aufwand, den nachgewiesen wirksame oder zumindest wirksamere Programme betrieben haben und die damit wirklich erreichte Wirkung.
Die in der Fachzeitschrift "JAMA" (JAMA, June 27, 2007-Vol. 297, No. 24: 2697-2704) im Juni 2007 veröffentlichten Ergebnisse der einjährigen, randomisierten kontrollierten Studie "Effects of a Weight Management Program on Body Composition and Metabolic Parameters in Overweight Children" von Savoye, M.; Shaw, M.; Dziura, J.; Tamborlane, W.; Rose,P.; Guandalini, C.; Goldberg-Gell, R.; Burgert, T.; Cali, A.; Weiss, MD, R; Caprio, S. bestätigt auf Basis der eigenen Studie nochmals knapp das bereits Erkannte über eindimensional und unaufwändig gestrickte Programme: "As illustrated by the outcomes in the control group in this study, simple education about health risks of obesity and routine counseling regarding diet and exercise are insufficient to prevent the seemingly inexorable increases in BMI, body weight, and body fat observed in traditionally treated overweight children."
Das in der Studie untersuchte stark familienbasierte "Yale Bright Bodies Weight Management Program" wurde an einer wiederum relativ kleinen Gruppe von 209 übergewichtigen Kindern im Alter zwischen 8 und 16 Jahren unterschiedlicher ethnischer Zugehörigkeit durchgeführt. Diese Kinder wurden während eines Aufenthaltes an der "Yale Pediatric Obesity Clinic" in New Haven für die Teilnahme gewonnen und während des Programms auch dort untersucht. 71 % der Interventionsgruppe erreichte das Ziel, 12 Monate an diesem Programm teilzunehmen. Interessanterweise war die Dropout-Quote in der Kontrollgruppe sogar höher.
Das Interventionsprogramm hatte folgende Bestandteile: In den ersten 6 Monaten gab es zwei komplexe körperliche Trainingsübungen pro Woche von jeweils 50 Minuten, hinzu kam noch einmal pro Woche ein 40-minütiger Kurz zur Veränderung des Ernährungsverhaltens. In den zweiten 6 Monaten findet dieses Programm nur noch jede zweite Woche statt. An fast allen Veranstaltungen nehmen die TeilnehmerInnen zusammen mit den sie betreuenden Personen (z. B. Krankenschwester und Eltern) teil. Ausnahme sind die Kurse zur Verhaltensveränderung. Die TeilnehmerInnen werden in den ersten 6 Monaten alle 1 oder 2 Wochen gewogen, in den zweiten 6 Monaten nur noch alle 2 Wochen. Die Veranstaltungen zur Verhaltensmodifikation werden von Diätfachkräften und Sozialarbeitern durchgeführt und umfassen z. B. auch Module zur Stärkung der Selbstwirksamkeitsüberzeugung und zum Umgang mit ungewissen Situationen. Die TeilnehmerInnen werden auch ermutigt, ihre körperlichen Übungen an 3 zusätzlichen Tagen zu machen.
Die TeilnehmerInnen in der Kontrollgruppe besuchten alle 6 Monate die New Havener Übergewichts-Klinik, erhielten dort Tipps für gesunde Ernährung und Ratschläge für einen körperlich aktiveren Alltag, die durch kurze psychosoziale Beratungen oder Ratschläge ergänzt wurden.
Die Ergebnisse in der Gewichtsmanagementgruppe sahen im Vergleich mit denen in der Kontrollgruppe so aus:
• Die Gewichtsabnahme betrug in der Interventionsgruppe nach 6 Monaten 2,6 kg gegen eine Gewichtszunahme von 5 kg. In der Kontrollgruppe.
• Nach 12 Monaten gab es bei der Interventionsgruppe einen kleinen Zuwachs an Gewicht von 0,3 kg, in der Kontrollgruppe aber um 7,7 kg.
• Die Werte lagen beim BMI nach 12 Monaten bei -1,7 und +1,6.
• Beim Körperfettanteil in Prozent war der Unterschied nach 12 Monaten mit -4 % zu +2 % am deutlichsten.
• Sieht man die Spanne zwischen Interventions- und Kontrollgruppenwert an (so genannter "treatment effect") beträgt dieser beim Gewicht nach 12 Monaten 7,4, beim BMI 3,3 und beim prozentualen Körperfettanteil 6 Punkte. Beim Körperfettanteil in Kilogramm war der Unterschied mit 9,2 kg zu Gunsten der Kinder in der Interventionsgruppe am größten.
• Positiv verändert haben sich auch eine Reihe weiterer Parameter wie der Cholesterinspiegel.
Trotz manch großer Zahl demonstriert aber auch diese Studie, dass man bei Wirkungen von Programmen eher bescheidene Erwartungen hegen und erzeugen sollte.
Die ForscherInnen heben als die wichtigste Bedingung des Erfolgs ihres Programms ("undoubtedly relates") die regelmäßigen und häufigen Kontakte zwischen Familien und professionellen Akteuren hervor.
Und auch den kritischsten Punkt für die Verallgemeinerbarkeit solch in kognitiver und sozialer Hinsicht komplexer Programme sprechen sie am Ende ihres Aufsatzes an: "While the program was very successful in treating overweight children, the expense incurred in operating such a program is substantial."
Wer keinen freien Zugang zu Aufsätzen in JAMA nutzen kann, findet den umfangreichsten kostenlosen Text zu der Studie "Effects of a Weight Management Program on Body Composition and Metabolic Parameters in Overweight Children" auf der Website "Science daily". Ansonsten gibt es natürlich noch das kostenlose Abstract der Studie.
Bernard Braun, 14.7.2007
Erkenntnisse der Krebsforschung über die Risiken des Aktiv- und Passivrauchens - Auch nach dem 1.9.2007 wichtig!
 Ab dem 1. September 2007 herrscht in allen öffentlichen Einrichtungen Deutschlands, in den meisten öffentlichen Verkehrsmitteln und im deutschen Gaststättengewerbe ein mit diversen Ausnahmen und Gestaltungsspielräumen versehenes Rauchverbot. Da damit aber keineswegs alle Probleme des Aktiv- und Passivrauchens verschwunden sind, ist es weiterhin hilfreich, sich umfassend die Risikopalette des Rauchens im Gedächtnis zu halten und sie kontinuierlich aufzufrischen.
Ab dem 1. September 2007 herrscht in allen öffentlichen Einrichtungen Deutschlands, in den meisten öffentlichen Verkehrsmitteln und im deutschen Gaststättengewerbe ein mit diversen Ausnahmen und Gestaltungsspielräumen versehenes Rauchverbot. Da damit aber keineswegs alle Probleme des Aktiv- und Passivrauchens verschwunden sind, ist es weiterhin hilfreich, sich umfassend die Risikopalette des Rauchens im Gedächtnis zu halten und sie kontinuierlich aufzufrischen.
Dabei hilft ein von deutschen, an deutschen Universitäten und in der IARC (International Agency for Research on Cancer) in Lyon forschenden Krebsexperten und Epidemiologen Ende 2006 veröffentlichter Überblick zum aktuellen Stand des Wissens.
Danach ist
• Tabakrauchen die wichtigste vermeidbare Ursache für Krebs.
• Etwa ein Drittel aller Krebssterbefälle in westlichen Ländern können auf das Rauchen zurückgeführt werden. Das Bronchialkarzinom steht dabei an führender Stelle. In Europa werden ca. 90 % aller Lungenkrebssterbefälle bei Männern und 60% bei Frauen durch Rauchen verursacht. Das Risiko wird am stärksten durch die Dauer des Rauchens beeinflusst, aber auch die Anzahl der gerauchten Zigaretten spielt eine Rolle.
• Mit dem Rauchen aufzuhören reduziert das Risiko, und zwar um so mehr, in je jüngerem Alter man aufhört.
• Nach der neuesten Bewertung epidemiologischer Studien durch die IARC werden neben Tumoren der Lunge, Mundhöhle, Rachen, Kehlkopf, Speiseröhre (Plattenepithelkarzinom), Bauchspeicheldrüse, Nierenbecken und Harnblase zusätzlich Tumoren der Nasen-(neben)höhle, Nasenrachenraum, Speiseröhre (Adenokarzinom), Magen, Leber, Niere, Gebärmutterhals und myeloische Leukämie durch Rauchen verursacht.
• Abgeschlossen wird die Risikokette mit den in der Antirauchen-Politik zentralen Risiken des Passivrauchens. Bei lebenslangen Nichtrauchern ist danach Passivrauchen ein nachgewiesener kausaler Risikofaktor für Lungenkrebs.
Der komplette Aufsatz von Kreuzer, M; Jöckel, KH; Wichmann, HE und Straif, K. zum Thema "Rauchen, Passivrauchen und Krebserkrankungen. Aktuelle Studien aus Deutschland und ihr Beitrag zu IARC-Monographie" in der Zeitschrift "Der Onkologe" (Volume 12, Number 11, November 2006 , pp. 1094-1105) ist leider nicht kostenlos und dann auch nur zu einem sehr hohen Preis erhältlich.
Ein Abstract des Aufsatzes kann aber hier kostenlos gelesen oder heruntergeladen werden.
Bernard Braun, 13.7.2007
Interventionen gegen Übergewicht im Kindesalter: Der Kampf gegen die Macht der Gewohnheit
 Übergewicht und Adipositas schon im Kindesalter werden seit kurzem in vielen westlichen Staaten aufgrund der damit verbundenen späteren Erkrankungsrisiken (z.B. Diabetes, Herz-Kreislauf) als gravierendes Problem wahrgenommen. Unlängst hatte die KIGGS-Studie gezeigt, dass etwa 15 % der Kinder und Jugendlichen in Deutschland im Alter von 3 bis 17 Jahren übergewichtig oder sogar adipös sind. In einer Vielzahl von Organisationen und staatlichen Einrichtungen bemüht man sich jetzt, effektive Präventionsmaßnahmen zu finden. Dass dabei noch ein weiter Weg zu beschreiten ist und mehr Ressourcen, Einfallsreichtum und Organisationstalent erforderlich sind als bislang für nötig gehalten wurde, zeigt eine jetzt im der Zeitschrift "Public Health" veröffentlichte Meta-Analyse schon veröffentlichter Artikel zu solch präventiven Interventionen.
Übergewicht und Adipositas schon im Kindesalter werden seit kurzem in vielen westlichen Staaten aufgrund der damit verbundenen späteren Erkrankungsrisiken (z.B. Diabetes, Herz-Kreislauf) als gravierendes Problem wahrgenommen. Unlängst hatte die KIGGS-Studie gezeigt, dass etwa 15 % der Kinder und Jugendlichen in Deutschland im Alter von 3 bis 17 Jahren übergewichtig oder sogar adipös sind. In einer Vielzahl von Organisationen und staatlichen Einrichtungen bemüht man sich jetzt, effektive Präventionsmaßnahmen zu finden. Dass dabei noch ein weiter Weg zu beschreiten ist und mehr Ressourcen, Einfallsreichtum und Organisationstalent erforderlich sind als bislang für nötig gehalten wurde, zeigt eine jetzt im der Zeitschrift "Public Health" veröffentlichte Meta-Analyse schon veröffentlichter Artikel zu solch präventiven Interventionen.
Die Forscher bezogen auf der Basis einer umfassenden Literatur-Recherche insgesamt 28 Veröffentlichungen in ihre Auswertung ein. Die Studien betrafen unterschiedlichste Settings (Schule, Klinik, Gemeinde) und Altersgruppen, aber auch sehr verschiedenartige Maßnahmen, von Ernährungsberatung und Sport-Unterricht über Informationsmaterialien zur Reduzierung des TV-Konsums bis hin zu Maßnahmen mit Trainern, Gruppensitzungen und verpflichtender körperlicher Bewegung.
Folgende Ergebnisse werden in dem Aufsatz hervorgehoben:
• In den 28 berücksichtigten Interventionen erwiesen sich nur 11 als effektiv hinsichtlich einer Reduzierung des Körpergewichts (definiert über den Body-Mass-Index), zumindest in einem kurzfristigen Zeitfenster. 17 Studien, also die Mehrheit, blieb ohne Erfolg.
• Der Versuch, herauszufinden, aufgrund welcher Faktoren eine Intervention nun erfolgreich oder nicht erfolgreich ist, blieb zunächst ohne Ergebnis. Weder die Intensität oder Zeitdauer der Maßnahmen, noch die direkte Beteiligung der jeweiligen Forschungsgruppe an der Intervention, noch die Art der Beratung oder Information, noch die Breite der Lernziele (nur Ernährung, nur Sport, sowohl Ernährung wie Bewegung usw.) konnten den Erfolg oder Misserfolg eindeutig erklären.
• Ein deutlicher Zusammenhang zeigte sich dann jedoch für den Aspekt "verpflichtender Charakter der Teilnahme an Bewegungsübungen oder Sport". Alle fünf Studien, bei denen die Teilnehmer gezwungen waren, sich an sportlichen Aktivitäten oder Bewegungsübungen zu beteiligen, waren auch erfolgreich.
Aufgrund der geringen Zahl der Studien betrachten die Wissenschaftler ihren Befund allerdings nur als vorläufiges Ergebnis, das weiterer Überprüfung bedarf. Hier ist ein Abstract der Meta-Analyse nachzulesen: A systematic review of controlled trials of interventions to prevent childhood obesity and overweight: A realistic synthesis of the evidence (Public Health, Volume 121, Issue 7, July 2007, Pages 510-517)
Zu diesem Ergebnis, das auf die Schwierigkeit hinweist, langjährig erworbene und liebgewonnene Verhaltensgewohnheiten abzustreifen, passt allerdings das Fazit einer neuen niederländischen Studie. Diese hat bei Schulkindern gezeigt, dass ein etwa 9 Monate dauerndes, umfassendes Interventionsprogramm für übergewichtige Schüler durchaus positive Effekte bewirken kann, was Ernährungsgewohnheiten und körperliche Bewegung der Teilnehmer anbetraf. Auch objektive Indikatoren (Body-Mass-Index, Ergebnisse von Fitness-Test, Blutzucker) zeigten solche positiven Ergebnisse. Das Problem war nur: Unmittelbar nach Ende der dreimonatigen Schulferien waren sämtliche Positiv-Veränderungen wieder verschwunden.
Hier ist ein Abstract der Studie: School-Based Fitness Changes Are Lost During the Summer Vacation (Arch Pediatr Adolesc Med. 2007;161:561-564)
Gerd Marstedt, 10.7.2007
Mobil zu immobil - Erhöhen lange Flugzeiten das Thromboserisiko? Ergebnisse eines WHO-Reports
 Gerade in den Hauptreise- und Urlaubszeiten wird immer wieder über damit verknüpfte gesundheitliche Risiken von mehr oder weniger großer Bedeutung berichtet. Zu den größeren, weil potenziell tödlichen Risiken gehören venöse Thrombosen oder Gefäßverschlüsse von Fluggästen auf etwas längeren Flügen, die immer schon dem langen Bewegungsmangel von Passagieren zugeschrieben wurden. Eine Reihe von Ratgeberliteratur und auch die Fluggesellschaften versuchen, durch empfohlene oder sogar angeleitete Bewegungsübungen die Blutzirkulation in den unteren Extremitäten in Schwung zu bringen. Reisenden mit bekannten Durchblutungsstörungen der Beine wird auch schon davon abgeraten, mit dem Flugzeug in Urlaub zu fahren und lieber mit anderen Fahrzeugen zu verreisen.
Gerade in den Hauptreise- und Urlaubszeiten wird immer wieder über damit verknüpfte gesundheitliche Risiken von mehr oder weniger großer Bedeutung berichtet. Zu den größeren, weil potenziell tödlichen Risiken gehören venöse Thrombosen oder Gefäßverschlüsse von Fluggästen auf etwas längeren Flügen, die immer schon dem langen Bewegungsmangel von Passagieren zugeschrieben wurden. Eine Reihe von Ratgeberliteratur und auch die Fluggesellschaften versuchen, durch empfohlene oder sogar angeleitete Bewegungsübungen die Blutzirkulation in den unteren Extremitäten in Schwung zu bringen. Reisenden mit bekannten Durchblutungsstörungen der Beine wird auch schon davon abgeraten, mit dem Flugzeug in Urlaub zu fahren und lieber mit anderen Fahrzeugen zu verreisen.
Was häufig in den geballt auftretenden Risikoszenarien vergessen wird, ist eine genaue Analyse des tatsächlichen Risikoumfangs, eine Thrombose zu erleiden. Insofern steht das nun zu diesem Risiko von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) vorgestellte so genannte WRIGHT-Projekt (WHO Research Into Global Hazards of Travel) exemplarisch für den wünschenswert kritischen Umgang mit Art und Umfang anderer Risiken.
Auf der Basis von drei großen epidemiologischen Studien und mehreren pathophysiologischen Studien kommt die WHO in der Phase I dieses Projekts zu folgenden Eckzifern für dieses Risiko:
• Auch bei anderen Reiseformen, wie beispielsweise mit dem PKW, einem Bus oder dem Zug, steigt das Risiko einer Thrombose an, wenn die Fahrzeuginsassen zu lange bewegungslos sitzen. Das einfache Umsteigen vom Flugzeug ins Auto trägt also nicht grundsätzlich zu einem Verschwinden dieses Risikos bei.
• Das Risiko bleibt für rund 2 Monate nach der Reise erhöht.
• Auch eine Reihe weiterer Faktoren, wie etwa Übergewicht oder die Einnahme der "Pille" erhöhen das Thromboserisiko von Reisenden oder auch Nicht-Reisenden.
• Schließlich aber wird das absolute Risiko einer Thrombose während eines Fluges erheblich überschätzt: Es verdoppelt sich in einer Gruppe oder Kohorte von gesunden Individuen zwar nach einem Flug von mindestens 4 Stunden, ist aber mit einem ungefähren Auftreten von einem Fall unter 6.000 Personen noch niedrig bzw. gering. Der wesentliche risikoerhöhende Faktor ist die Immobilität von Passagieren.
• Pathophysiologische Studien zeigen bei gesunden Versuchspersonen keine Zusammenhänge von Flugbedingungen und dem körpereigenen Drucksystem. Gezeigt wird aber das risikoerhöhende Zusammenwirken von bestimmten vorher existierenden individuellen Bedingungen mit den Flugbedingungen auf eine Erhöhung des Thromboserisikos.
• Eine angemessene Darstellung der generellen Thromboserisiken für Personen mit lang immobilen Reisezeiten sollte jedem Passagier zur Verfügung stehen. Über die präventiven Gegenmaßnahmen sollte nach Meinung der WHO aber auch nochmals gründlich geforscht werden.
Wer sich die Ergebnisse und die Quellen des WHO-Reports "WHO Research Into Global Hazards of Travel (WRIGHT) Project final report of phase I" noch genauer ansehen will, kann dies über den "Executive Summary oder durch die Lektüre des kostenlos als PDF-Datei erhältlichen, 29 Seiten umfassenden WHO-Report.
Bernard Braun, 3.7.2007
"Vollkorn gegen Herzinfarkt!?" - Studien zeigen ein bisschen Evidenz und hinterlassen jede Menge Mängel und Zweifel
 Auch wenn die "Professor-Bankhofer"-Ratgeber dieser Republik, manche Bäckerinnung sowie Krankenkassenkampagnen es anders und mit gewissem Ton verkünden: Hinter die Erwartung, die Ernährung mit Vollkorn-Müslis, Haferflocken und Weizenvollkornbroten habe nachweisbare positive Wirkungen auf die Risikofaktoren der koronaren Herzerkrankungen oder gar auf die Erkrankung selber, muss ein dickes Fragezeichen gesetzt werden. Wer nur auf die Strategie des "iss Dich gesund" setzt, könnte vergebens auf positive Effekte warten.
Auch wenn die "Professor-Bankhofer"-Ratgeber dieser Republik, manche Bäckerinnung sowie Krankenkassenkampagnen es anders und mit gewissem Ton verkünden: Hinter die Erwartung, die Ernährung mit Vollkorn-Müslis, Haferflocken und Weizenvollkornbroten habe nachweisbare positive Wirkungen auf die Risikofaktoren der koronaren Herzerkrankungen oder gar auf die Erkrankung selber, muss ein dickes Fragezeichen gesetzt werden. Wer nur auf die Strategie des "iss Dich gesund" setzt, könnte vergebens auf positive Effekte warten.
Das ist jedenfalls das Ergebnis eines gerade in der "Cochrane Library" erschienenen "Cochrane Reviews", der die Ergebnisse von 10 randomisierten kontrollierten Studien (RCTs) zu dieser Frage vergleichend analysiert hat. Die Reviewer weisen zu Anfang darauf hin, dass die Mehrheit der verbreiteten Hinweise auf und Belege von vermeintlich gesundheitlichen Wirkungen von Vollkornprodukten aus Beobachtungsstudien stammt.
Im Konzept der evidenzbasierten Medizin liefern aber primär RCTs gesicherte wissenschaftliche Hinweise und Wahrscheinlichkeiten für die Wirkungen von medizinischen oder auch anderen, meist gesundheitsbezogenen Interventionen. Wer also ernsthaft erforschen will, ob seine Diagnose, Therapie oder Verhaltenshinweise wirklich den behaupteten oder erhofften gesundheitlichen Nutzen hat, fördert derartige Studien auf methodisch möglichst hohem Niveau und steht Beobachtungsergebnissen skeptisch gegenüber.
Die 10 überhaupt dem Einschlusskriterium RCT genügenden Studien weisen in 7 von 8 Studien zu Vollkornprodukten aus Hafer leichte positive und statistisch signifikante Effekte bei der Senkung des Cholesterinspiegels nach. Trotzdem kommen die Reviewer aber angesichts vieler Mängel oder Unterlassungen praktisch aller dieser Studien zum Schluss: "the positive findings should be interpreted cautiously".
Zu den Mängeln gehören z. B.:
• dass keine der Studien über Effekte von Vollkornernährung oder -Diäten auf die Sterblichkeit oder auf Erkrankungsereignisse der koronaren Herzerkrankung berichtet und sich alle lediglich um die Wirkungen auf Risikofaktoren kümmern,
• dass der Beobachtungszeitraum zwar mindestens 4 Wochen ist, sich aber auf höchstens 8 Wochen erstreckt,
• dass sich die meisten der überhaupt zu gesundheitlichen Wirkungen der genannten Art durchgeführten Studien (8 von 10) mit Hafervollkorn befassten und die Wirkungen vieler anderer Vollkornprodukte oder gar von vollkornbasierten Diätprogrammen bisher nicht vergleichbar untersucht wurden,
• dass bisher auch nur die Wirkungen auf einen Risikofaktor der koronaren Herzerkrankung, das LDL, untersucht wurde und schließlich
• dass die meisten Studien durch Hersteller von Vollkornprodukten und damit unmittelbar materiell interessierten und jedenfalls nicht unabhängigen Akteuren finanziert wurden.
Um kein Missverständnis aufkommen zu lassen: Die vielen anderen durchaus angenehmen und vielleicht auch gesunden Seiten von Vollkornbrot oder -gerichten begründen, warum es bei aller begründeten Skepsis gegen die propagierten krankheitsrelevanten Wirkungen von Vollkornprodukten nicht egal ist, ob jemand Weißbrot-Toast oder Vollkornbrot isst.
Die Zusammenfassung des Reviews "Wholegrain cereals for coronary heart disease" von Kelly, Summerbell, Brynes, Whittaker und Frost" in der Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 2 (Art. No.: CD005051. DOI: 10.1002/14651858.CD005051.pub2) kann man hier kostenlos erhalten.
Die Komplettversion des Reviews ist dagegen nicht kostenlos erhältlich. Ein 24-Stundenzugang zur Cochrane Library kostet derzeit 25 US-Dollar.
Bernard Braun, 29.6.2007
"Teuer, meist überflüssig - und trotzdem gekauft" - Angst von Kerngesunden vor Cholesterin versus mündiger Verbraucher
 Auch wenn ab dem 1. Juli 2007 die so genannte EU-Health-Claims-Verordnung den Herstellern von Lebensmitteln vorschreibt, nur mit wissenschaftlich belegten Ergebnissen zu werben, ist ein anderes finanzielles und vielleicht sogar gesundheitliches Problem des freien aber intransparenten Angebots "gesunder Lebensmittel" und ihres "Für-alle-Fälle-Konsums" durch Menschen, die kerngesund sind, noch nicht vom Tisch.
Auch wenn ab dem 1. Juli 2007 die so genannte EU-Health-Claims-Verordnung den Herstellern von Lebensmitteln vorschreibt, nur mit wissenschaftlich belegten Ergebnissen zu werben, ist ein anderes finanzielles und vielleicht sogar gesundheitliches Problem des freien aber intransparenten Angebots "gesunder Lebensmittel" und ihres "Für-alle-Fälle-Konsums" durch Menschen, die kerngesund sind, noch nicht vom Tisch.
Dass es derartigen Fehlkonsum gar nicht selten gibt, zeigt eine jetzt veröffentlichte Studie des "Verbraucherzentrale Bundesverbandes (VZBV)" und des "Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR)" über das Angebot und den Verzehr von Lebensmitteln, die mit Pflanzensterinen angereichert sind. Diese Lebensmittel sollen dazu beitragen, erhöhte Cholesterinspiegel zu senken. Das derzeitige Angebot im Handel umfasst Margarine, aber auch Milchprodukte, Käse und Brot. In Deutschland startete diese Art "gesunder" Lebensmittel im Jahre 2000 mit der Margarine "becel pro-activ". Die Europäische Kommission hat den Zusatz von Pflanzensterinen nun auch für Fruchtgetränke auf Milchbasis, Sojagetränke, Gewürze und Salatsoßen zugelassen. Der Zusatz der Pflanzensterine muss auf der Packung gekennzeichnet sein. Der Gehalt an Sterinen ist begrenzt, damit die tägliche Aufnahme aus solchen Produkten drei Gramm nicht überschreitet und mögliche unerwünschte gesundheitliche Wirkungen ausgeschlossen sind. Weil Pflanzensterine die Aufnahme von Vitaminen einschränken können, wird auf den Packungen empfohlen, entsprechend mehr Obst und Gemüse zu essen. Kinder unter fünf Jahren, Schwangere und Stillende sollten die angereicherten Lebensmittel trotzdem nicht essen. Wer schon Cholesterin senkende Medikamente einnimmt, sollte den Verzehr mit dem Arzt abstimmen.
Ob die Hinweise auf den Packungen von den Verbrauchern wahrgenommen und befolgt werden und ob die mit Pflanzensterinen angereicherten Lebensmittel ihre eigentliche Zielgruppe - Personen mit erhöhten Cholesterinwerten - erreichen, haben BfR und vzbv gemeinsam mit den Verbraucherzentralen der Länder durch eine vermutlich nicht repräsentative aber dennoch aussagekräftige schriftliche Befragung von 1.002 Verbrauchern in 33 Lebensmittelgeschäften, die alle zu den Käufern von mit Pflanzensterinen angereicherten Lebensmitteln gehören, untersuchen lassen. Die Befragung wurde vom Institut für Markt und Gesellschaft (imug) Ende 2006 durchgeführt.
Die wichtigsten Ergebnisse lauten:
• Fast die Hälfte der Käufer (46 %) von Lebensmitteln mit Pflanzensterinen hat sich ohne spezielle Kaufempfehlung und 9 % haben sich durch Hinweise von Verwandten bzw. Bekannten für den Kauf der Produkte entschieden. Auf ärztliches Anraten haben 13 % der Käufer zu den Produkten gegriffen und 2 % folgten dem Rat von Apothekern oder Ernährungsberatern. Auf die Produktwerbung in den Medien haben 24 % und auf aktive Präsentation in Geschäften hat 1 % der Käufer reagiert.
• Die Befragten haben sich zu 80 % für den Verzehr der Produkte entschieden und zu 20 % verzehren sie die Produkte innerhalb familiärer und partnerschaftlicher Verhältnisse einfach mit. Ihr Verzehrsgrund ist zu 55 % ein erhöhter Cholesterinspiegel, dessen sie sich zu 48 % sicher sind. RUnd die Hälfte der befragten Käufer verzehrt damit ohne Grund regelmäßig Lebensmittel, die ihre Blutwerte beeinflussen. Zu 25 % hat er andere Verzehrsgründe, die überwiegend gesundheitlicher Art, jedoch nicht objektiviert sind.
• Die Befragten, die sich bewusst für den Verzehr entschieden haben, haben dies zu 21 % mit dem Arzt besprochen, obwohl das auf den Packungen ausdrücklich jedem angeraten wird. Sie riskieren damit unerwünschte gesundheitliche Wirkungen.
• Sie können zu 0,5 % alle zusätzlichen Gebrauchshinweise korrekt wiedergeben und zu 1 % die drei wichtigsten. Zu 27 % ist ihnen bekannt, dass diese Lebensmittel nicht von allen Menschen gegessen werden sollten und zu 21 %, dass bei den Produkten auf die Verzehrmengen zu achten ist. Außerdem wissen sie zu 8 %, dass die Pflanzensterine den Lebensmitteln zugesetzt wurden, kennen zu 4 % den empfohlenen Maximalverzehr von Pflanzensterinen und wissen zu 4 %, dass auch die Aufnahme von Carotinoiden und fettlöslichen Vitaminen durch den Verzehr der Produkte reduziert wird.
• Sie sind zu 83 % regelmäßige Verzehrer, die mindestens ein Produkt täglich verwendet und neigen zu 11 % zum täglichen Verzehr mehrerer Produkte. Ihr Potenzial zur Überschreitung der empfohlenen Höchstmenge an Pflanzensterinen durch Mehrfachverzehr liegt zurzeit um 2,3 %.
Die von den Auftraggebern der Studie geforderte bessere und eindeutige Kennzeichnung solcher Lebensmittel (klare und eindeutige Pflichtkennzeichnung von Lebensmitteln mit Pflanzensterinzusatz als für die Zielgruppe "für Menschen mit nachweislich erhöhtem Cholesterinspiegel" geeignet), erscheint im Lichte anderer im Bericht zitierten Forschungsergebnisse nicht unbedingt erfolgversprechend:
• Zwar geben 52 % bis 54 % der Verbraucher an, fast immer oder häufig das Zutatenverzeichnis, die Nährwertangaben oder die Angaben über Zusatzstoffe auf Lebensmitteln zu beachten.
• In der Dissertationsschrift "Qualitätswahrnehmung bei Lebensmitteln - Das Verbraucherbild in Rechtssprechung und Wissenschaft" von A. Engelage aus dem Jahr 2002 wird auch berichtet, dass 65 % der Verbraucher nach eigenen Angaben die gesetzlichen Kennzeichnungselemente von Lebensmitteln häufig nutzen.
• Sie arbeitete aber heraus, dass einzelne Kennzeichnungselemente unterschiedlich gewichtet und am häufigsten Informationen zur Haltbarkeit abgefragt werden. Zutatenverzeichnisse sowie Nährwertangaben werden zwar von zwei Dritteln der Verbraucher für nützlich gehalten, ihr bewusstes Lesen wird aber vor allem gesundheitsbewussten Verbrauchern zugeschrieben.
• Diese Informationen werden jedoch von den Verbrauchern nur zum Teil richtig verstanden und nur zu 20-30 % als besonders wichtige Informationen eingestuft.
Dabei bleibt die noch grundlegendere Frage unangesprochen, ob wirklich jeder Cholesterinspiegel so hoch ist, dass er etwa zur Verhinderung von Herz-Kreislauferkrankungen durch Medikamente und/oder "gesunde" und meist auch etwas teurere Lebensmittel gesenkt werden muss. Gegen die Behandlungsnotwendigkeit eines nicht geringen Teil des erhöhten Cholesterinspiegels gibt es nämlich seit längerem eine Reihe epidemiologischer Einwände.
Eine "Gemeinsame Presseerklärung des VZBV und des BfR" erhalten Sie hier.
Hier können Sie den 63-seitigen Projektbericht "Lebensmittel mit Pflanzensterinzusatz in der Wahrnehmung der Verbraucher. Projektbericht über ein Gemeinschaftsprojekt der Verbraucherzentralen und des BfR", herausgegeben von Birgit Niemann, Christine Sommerfeld, Angelika Hembeck und Christa Bergmann erhalten.
Bernard Braun, 28.6.2007
Gesundheitsverhalten von Erstsemestern: Selbst unter Medizinstudenten finden sich kaum Vorbilder
 Viel Sport betreiben, häufig Obst und Gemüse essen, Alkohol meiden und nicht rauchen: An diese vier Regeln für eine gesunde Lebensweise halten sich gerade einmal zwei Prozent der Studierenden im ersten Semester an deutschen Universitäten. Bei 18 Prozent hingegen findet man alle Risikofaktoren. Dies ist das Ergebnis einer repräsentativen Studie bei über 1.200 Marburger Studentinnen und Studenten im ersten Semester, beteiligt waren angehende Juristen, Lehrer und Mediziner. 62 Prozent der Befragten bekannten sich zu regelmäßigen "Saufgelagen" (jeder zehnte hatte in den letzten dreißig Tagen sogar sechs oder mehr "binge drinking episodes"), 31% waren Raucher. Nur etwa 40% gaben an, mindestens dreimal in der Woche jeweils zwanzig Minuten lang intensiv Sport zu betreiben und nur 5% hielten sich an die Gesundheitsregel, fünf Mal am Tag Obst oder Gemüse zu sich zu nehmen.
Viel Sport betreiben, häufig Obst und Gemüse essen, Alkohol meiden und nicht rauchen: An diese vier Regeln für eine gesunde Lebensweise halten sich gerade einmal zwei Prozent der Studierenden im ersten Semester an deutschen Universitäten. Bei 18 Prozent hingegen findet man alle Risikofaktoren. Dies ist das Ergebnis einer repräsentativen Studie bei über 1.200 Marburger Studentinnen und Studenten im ersten Semester, beteiligt waren angehende Juristen, Lehrer und Mediziner. 62 Prozent der Befragten bekannten sich zu regelmäßigen "Saufgelagen" (jeder zehnte hatte in den letzten dreißig Tagen sogar sechs oder mehr "binge drinking episodes"), 31% waren Raucher. Nur etwa 40% gaben an, mindestens dreimal in der Woche jeweils zwanzig Minuten lang intensiv Sport zu betreiben und nur 5% hielten sich an die Gesundheitsregel, fünf Mal am Tag Obst oder Gemüse zu sich zu nehmen.
Selbst Mediziner, die ja eigentlich die schädlichen Folgen vor Augen haben müssten und zudem als gesellschaftliches Vorbild gelten sollten, leben nicht wesentlich gesünder als die Vergleichsgruppen, auch wenn sie im Vergleich zu Lehrern und Juristen weniger rauchten und tranken. Doch gesundheitliche Vorbilder sind auch in dieser Gruppe selten: 57% betreiben wenig Sport (weniger als 3 mal wöchentlich 20 Minuten), etwa jeder Vierte raucht, jeder Zweite nahm in den letzten 30 Tagen zumindest einmal an einem Saufgelage teil. Jurastudenten haben dagegen die größte Alkoholneigung der drei Gruppen bei geringster körperlicher Betätigung. Lehramtskandidaten traten durch die höchste Raucherrate und den niedrigsten Verzehr von Obst und Gemüse hervor.
Eine Häufung unterschiedlicher gesundheitsriskanter Verhaltensweisen fand sich überaus oft: Bei jedem Fünften (18%) fand man alle vier, bei weiteren 34% drei Risikofaktoren. "Bereitschaft zum Umdenken gibt es wenig", so der Marburger Medizinpsychologe Professor Dr. Heinz-Dieter Basler, der auch dieses Merkmal untersuchte. "Insbesondere jene, bei denen mehrere Risikofaktoren vorliegen, haben selten vor, ihr Verhalten zu ändern." Rund zwei Drittel der Befragungsteilnehmer waren nach eigener Aussage nicht bereit, auch nur einen der bei ihnen vorliegenden Risikofaktor (Rauchen, Alkohol, Ernährung, Sport) zu verändern.
Insbesondere das Rauchen, so ein weiteres Ergebnis der Studie, hängt offenbar eng mit der Neigung zu gesundheitsschädlichem Verhalten zusammen: Bei 94 Prozent aller Raucher waren mindestens zwei weitere Risikofaktoren anzutreffen. Doch nicht nur das Rauchen macht riskantes Verhalten wahrscheinlicher. Während Indikatoren wie Religion, Alter, Geschlecht, die Zugehörigkeit zu einer Burschenschaft oder die Tatsache, den Wehrdienst abgeleistet zu haben, "keinen systematischen Zusammenhang mit dem Vorliegen mehrerer Risikofaktoren bei einem Individuum" nahe legen, ist es vielmehr eine bestimmte Wohnform, die mit einer Häufung von Risiken einhergeht: "Wer in einer Wohngemeinschaft lebt, hat statistisch gesehen die ungesündeste Lebensweise", so Basler.
"Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass der Prävention ein viel höheres Gewicht zukommen muss", folgert der Medizinpsychologe nun. Allerdings gebe es für Deutschland kaum Studien, die sich zum einen der Frage der Mehrfachrisiken widmen und zum anderen die Veränderungsbereitschaft hinsichtlich mehrerer, voneinander abhängiger Faktoren untersucht. "Wer das Rauchen aufgibt", sagt Basler, "um stattdessen mehr zu trinken, hat nichts gewonnen." Er fordert darum weitere Studien, die genau diese Wechselwirkungen untersuchen: "Erst dann können wir maßgeschneiderte Präventionsmaßnahmen entwickeln, die den Bedürfnissen von Personen mit mehreren Risikofaktoren entsprechen."
• Eine kurze Pressemitteilung der Universität Marburg ist hier zu finden: Studie über Erstsemester: Trinkgelage statt Obst und Gemüse
• Ein Abstract der Studie ist hier: S. Keller u.a.: Multiple health risk behaviors in German first year university students (Preventive Medicine, Volume 46, Issue 3, March 2008, Pages 189-195)
Gerd Marstedt, 30.5.2007
Vorsicht vor der Verharmlosung von Alltagsdrogen - "Drogen- und Suchtbericht 2007"
 Wer meint, das "Kampf- oder Rauschtrinken" oder gar das "Flatrate-Saufen" von meist jugendlichen Personen sei der "Eisberg" des problematischen Umgangs mit völlig legalen Genuss- oder eben auch Suchtmitteln, irrt gewaltig. Unter dieser publizistisch thematisierten und skandalisierten "Spitze" schwimmen gleich mehrere Eisberge. Um welche es sich handelt und wie umfangreich die dadurch verursachten Probleme sind, findet sich in der aktuellen Ausgabe des von der Drogenbeauftragten der Bundesregierung herausgegebenen "Drogen- und Suchtberichts 2007".
Wer meint, das "Kampf- oder Rauschtrinken" oder gar das "Flatrate-Saufen" von meist jugendlichen Personen sei der "Eisberg" des problematischen Umgangs mit völlig legalen Genuss- oder eben auch Suchtmitteln, irrt gewaltig. Unter dieser publizistisch thematisierten und skandalisierten "Spitze" schwimmen gleich mehrere Eisberge. Um welche es sich handelt und wie umfangreich die dadurch verursachten Probleme sind, findet sich in der aktuellen Ausgabe des von der Drogenbeauftragten der Bundesregierung herausgegebenen "Drogen- und Suchtberichts 2007".
Ursprünglich durch die Dokumentation der Nutzung illegaler Drogen und der Drogentoten bekannt geworden, konzentriert sich der Bericht nunmehr auf das wesentlich umfangreichere und nicht risikoärmere Suchtpotenzial legaler so genannter Genussmittel oder auch Alltagsdrogen wie Alkohol, Tabakwaren oder auch Medikamente. Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Sabine Bätzing, warnt bei der Vorstellung des Berichts ausdrücklich vor der verbreiteten "gesellschaftlichen Verharmlosung von Alltagsdrogen".
Was dies beispielsweise im Bereich des Alkoholkonsums bedeutet und dass es sich beim Missbrauch von Alltagsdrogen um kein Randgruppenphänomen handelt, lässt sich an den folgenden Daten ermessen: Mehr als 10 Millionen Menschen trinken Alkohol in riskanter Weise. 1,6 Millionen Menschen gelten als alkoholabhängig, weitere 1,7 Millionen praktizieren einen gesundheitsschädigenden, missbräuchlichen Alkoholkonsum. Von den 12- bis 25-Jährigen greift dem Bericht zufolge jeder Fünfte regelmäßig zum Glas oder zur Flasche. In Deutschland sterben jährlich 40.000 Menschen an den Folgen ihres Alkoholkonsums. Nach einer Analyse der Kaufmännischen Krankenkassen wurden im vergangenen Jahr 40 Prozent mehr 15- bis 20-Jährige mit Alkoholvergiftungen ins Krankenhaus eingeliefert als noch 2001. Der Pro-Kopf-Konsum von mehr als 10 Litern reinen Alkohols pro Jahr sei in Deutschland im internationalen Vergleich weiterhin hoch.
Auch der ärztlich verordnete oder selbstbestimmte Missbrauch von Medikamenten ist kein Geschehen bei wenigen "schwarzen Schafen" oder "labilen Personen": Insgesamt sind mindestens 1,4 Millionen Menschen in Deutschland medikamentenabhängig. Zwei Drittel davon sind Frauen. Von der Sonderform des Medikamentenmissbrauchs, dem regelmäßigen Doping, sind schätzungsweise mehr als meist männliche 200.000 Sportler, darunter rund 200.000 Freizeitsportler betroffen.
Nicht vernachlässigt, aber quantitativ richtig eingeordnet werden sollte, dass es nach wie vor den Konsum illegaler Drogen und dadurch getötete Personen gibt: In Deutschland verstarben 2006 1.296 Menschen infolge ihres Rauschgiftkonsums. Die Zahl der Todesfälle infolge des Konsums illegaler Drogen ist damit im Vergleich zum Vorjahr um 2,3 % gesunken und seit dem Jahr 2000 rückläufig (2000: 2.030, 2001: 1.835, 2002: 1.513, 2003: 1.477, 2004: 1.385, 2005: 1.326). Sie befindet sich auf dem niedrigsten Stand seit 1989. Auch die Zahl der polizeilich aufgefallenen Erstkonsumenten von "harten Drogen" ist gesunken. Im Bereich der Drogentoten liefert der Bericht auch noch einen wichtigen Hinweis zur Richtung präventiver Maßnahmen. Unter den Drogentoten stellten Aussiedler mit 10 % die größte Gruppe. Sie sind damit überproportional betroffen.
Zu den am meisten verbreiteten Suchtmitteln gehören Tabakwaren: Trotz einer in den letzten Jahren zunehmenden öffentlichen Diskussion über die Risiken des Tabakkonsums und den bevorstehenden Maßnahmen zum Schutz vor den Folgen des Passivrauchens rauchten 2006 33 % der deutschen Bevölkerung, die älter als 18 Jahre waren, 74 % davon täglich. Rund 140.000 Menschen sterben laut Bätzing jährlich an den Folgen des Tabaks.
Hier können Sie den 88 Seiten umfassenden "Drogen- und Suchtbericht 2007" als PDF-Datei herunterladen.
Bernard Braun, 22.5.2007
Alkoholkonsum in 30 OECD-Ländern: Je liberaler die gesetzlichen Vorschriften, desto mehr wird gesoffen
 Vor allem Beobachtungen über den exzessiven Alkoholkonsum Jugendlicher haben zuletzt in mehreren europäischen Ländern Rufe nach einer Verschärfung gesetzlicher Regelungen und nach mehr Kontrolle und Prävention auf den Plan gerufen. Eine Initiative der EU-Kommission, nach der fortan auf Flaschen oder Dosen mit alkoholischen Getränken Warnhinweise platziert werden müssen, ist allerdings zunächst einmal auf Eis gelegt. Es scheint allerdings absehbar, dass nach den Kampagnen zum Nichtraucherschutz und den aktuellen Diskussionen zu gesünderer Ernährung und mehr Bewegung (im Kampf gegen das Übergewicht) schon in naher Zukunft das Thema Alkohol wieder auf der gesundheitspolitischen Agenda stehen wird.
Vor allem Beobachtungen über den exzessiven Alkoholkonsum Jugendlicher haben zuletzt in mehreren europäischen Ländern Rufe nach einer Verschärfung gesetzlicher Regelungen und nach mehr Kontrolle und Prävention auf den Plan gerufen. Eine Initiative der EU-Kommission, nach der fortan auf Flaschen oder Dosen mit alkoholischen Getränken Warnhinweise platziert werden müssen, ist allerdings zunächst einmal auf Eis gelegt. Es scheint allerdings absehbar, dass nach den Kampagnen zum Nichtraucherschutz und den aktuellen Diskussionen zu gesünderer Ernährung und mehr Bewegung (im Kampf gegen das Übergewicht) schon in naher Zukunft das Thema Alkohol wieder auf der gesundheitspolitischen Agenda stehen wird.
Eine Vielzahl von Hinweisen, wie einem zu hohen Alkoholkonsum durch gesetzliche Regelungen entgegenzuwirken ist, könnte eine jetzt in der Zeitschrift "PloS Medicine" veröffentlichte Studie liefern. Die Wissenschaftler aus Italien und New York haben untersucht, ob sich die unterschiedlich liberalen Regelungen in Bezug auf den Alkoholkonsum in 30 Staaten der OECD auch darauf auswirken, welche Menge an Bier, Wein oder Spirituosen in den einzelnen Ländern getrunken wird. Das Ergebnis der Studie war eindeutig: Je liberaler die Vorschriften sind, desto höher ist der Pro-Kopf-Konsum an Alkohol.
Zur Charakterisierung der länderspezifischen Vorschriften im Umgang mit Alkohol griffen sie auf detaillierte Informationen der WHO in Datenbanken für einzelne Länder zurück. Diese Informationen sind im Internet frei zugänglich: WHO Global Status Report: Alcohol Policy. Sodann entwickelten sie ein Kategorienschema, um die einzelnen Regelungen danach zu bewerten, wie liberal oder restriktiv diese sind. Einschränkungen und Verbote bekamen dann in jedem Land eine hohe Punktzahl, wobei maximal 100 Punkte zu erreichen waren.
Aspekte, die dabei berücksichtigt wurden, waren folgende:
• Verfügbarkeit von Alkohol (maximal 34 Punkte): Bewertet wurde hier unter anderem, welche Altersbeschränkungen für die Abgabe von Alkohol es gibt, wie dicht das Netz an Läden und Verkaufsstellen für Alkohol ist oder ob es zeitliche Beschränkungen für den Verkauf gibt
• "Trinkkultur" ("Drinking Context") (maximal 8 Punkte): Hier wurde berücksichtigt, ob es öffentliche Kampagnen gibt, um auf Risiken des Alkoholkonsums aufmerksam zu machen oder verpflichtende Schulungsprogramme für Verkäufer, um Aggressionen im Zusammenhang mit Alkohol zu vermeiden
• Alkoholpreise (max. 24 Punkte): Bewertet wurden hier die Preise für Bier, Wein und Spirituosen nach einem für alle Länder gleichen Raster
• Werbung (max. 3 Punkte): Hier wurde die Anzahl der Medien berücksicht (Printmedien, TV/Rundfunk, Werbeflächen im öffentlichen Raum), für die ein Werbeverbot gilt
• Straßenverkehr (max. 34 Punkte): In dieser Kategorie wurden gesetzliche Regelungen und Kontrollen bewertet für den Umgang mit Alkohol im Straßenverkehr: Ob es Alkoholkontrollen gibt, wie hoch die Promillegrenze für Jugendliche bzw. Erwachsene angesetzt ist, wie hoch die verhängten Strafen sind.
Für jedes Land wurde so ein Punktwert errechnet. Die Länder mit den restriktivsten Vorschriften waren Norwegen, Polen, Island, Schweden und Australien mit Punktwerten von etwa 63-67. Am unteren der Skala waren die Länder mit den liberalsten Regelungen aufgeführt, die nur auf etwa 15-27 Punkte kamen. An drittletzter Stelle findet sich Deutschland, gleichauf mit der Schweiz. Nur Luxemburg weist noch weichere Vorschriften auf.
Als die Wissenschaftler dann einen Zusammenhang herstellten zwischen Liberalität-Restriktivität der Regelungen zum Alkoholkonsum und der in einem Jahr getrunkenen Menge (umgerechnet in Liter reiner Alkohol pro Kopf ), zeigte sich eine Korrelation von etwa 0.60, was einen sehr starken Zusammenhang bedeutet. (Anmerkung: Korrelationen sind ein statistisches Maß dafür, wie stark zwei Merkmale zusammenhängen. Der Wert kann zwischen -1 und +1 liegen.)
Hinsichtlich des Effektes der verschiedenen Maßnahmebereiche wurde deutlich, dass der Preis für Bier, Wein oder Schnaps den geringsten Einfluss auf den Alkoholkonsum hat. Das Ergebnis der Studie ist nicht sonderlich überraschend. Gleichwohl könnte die große Zahl der vorgestellten und in der Analyse berücksichtigten Maßnahmen die Phantasie von Gesundheitspolitikern ein wenig beflügeln, denen oftmals nur eine Erhöhung der Alkoholsteuer und damit der Preise als Maßnahme einfällt.
Die Studie ist hier im Volltext verfügbar: Comparative Analysis of Alcohol Control Policies in 30 Countries (PLoS Med 4(4): e151)
Gerd Marstedt, 30.4.2007
Steuerung des Alkoholkonsums von Jugendlichen: Höhere Steuern oder Heraufsetzung des Mindestalters?
 Der exzessive Alkoholkonsum in einigen Subkulturen von Jugendlichen ist zuletzt mehrfach in die Schlagzeilen geraten, durch Flat-Rate-Parties oder Todesfälle nach alkoholbedingten Komata. Eine Vielzahl von Maßnahmen wurde seither diskutiert, um hier effektive Maßnahmen zum Gesundheitsschutz durchzuführen. Zwei Maßnahmebündel haben sich in der Vergangenheit als wirkungsvoll erwiesen, um den Alkoholkonsum und auch alkoholbedingte tödliche Verkehrsunfälle zu reduzieren: Eine Heraufsetzung des Mindestalters für den Verkauf alkoholischer Getränke und eine Erhöhung des Preises über die Alkoholsteuer. Eine jetzt in der Zeitschrift "Alcoholism: Clinical & Experimental Research" veröffentlichte Studie hat nun gezeigt, dass die Wirksamkeit der Maßnahmen auch davon abhängt, welche anderen Rahmenbedingungen schon gegeben sind.
Der exzessive Alkoholkonsum in einigen Subkulturen von Jugendlichen ist zuletzt mehrfach in die Schlagzeilen geraten, durch Flat-Rate-Parties oder Todesfälle nach alkoholbedingten Komata. Eine Vielzahl von Maßnahmen wurde seither diskutiert, um hier effektive Maßnahmen zum Gesundheitsschutz durchzuführen. Zwei Maßnahmebündel haben sich in der Vergangenheit als wirkungsvoll erwiesen, um den Alkoholkonsum und auch alkoholbedingte tödliche Verkehrsunfälle zu reduzieren: Eine Heraufsetzung des Mindestalters für den Verkauf alkoholischer Getränke und eine Erhöhung des Preises über die Alkoholsteuer. Eine jetzt in der Zeitschrift "Alcoholism: Clinical & Experimental Research" veröffentlichte Studie hat nun gezeigt, dass die Wirksamkeit der Maßnahmen auch davon abhängt, welche anderen Rahmenbedingungen schon gegeben sind.
William R. Ponicki, Wissenschaftler am Prevention Research Center an der Universität von Berkeley in Kalifornier, erklärte dazu: "Die meisten früheren Studien haben bereits gezeigt, dass sowohl die Heraufsetzung des Mindestalters für die Abgabe alkoholischer Getränke als auch eine Erhöhung des Preises über die Steuern wirkungsvolle Maßnahmen sind. Leider unterscheiden sich die Forschungsergebnisse ganz massiv darin, welche Stärke diese Interventionen haben. Und es gibt darüber hinaus unterschiedliche Effekte je nach Zeitraum oder Region, in der die staatlichen Eingriffe verordnet wurden."
In einer neuen Studie untersuchte nun Ponicki zusammen mit Douglas Young von der Montana State University Daten, die für den Zeitraum 1975-2001 für insgesamt 48 verschiedene US-Bundesstaaten vorlagen, darauf hin, welche Kombinationen von unterschiedlichen Regelungen zur Alkoholkontrolle vorlagen und wie sich diese auswirkten. In den Ergebnissen zeigte sich dann ein Effekt des Zusammenwirkens der verschiedenen Interventionen: Die Heraufsetzung des Mindestalters war im Großen und Ganzen nur dann wirksam, wenn die Preise etwa für Bier recht niedrig lagen. Und umgekehrt wirkte sich eine Erhöhung der Alkoholsteuer insbesondere dann nachhaltig aus, wenn das Mindestalter für den Erwerb und Konsum von Alkohol in einem Bundesstatt recht niedrig lag.
Eine isolierte Betrachtung einzelner Maßnahmebündel ist daher für gesundheitspolitische Entscheidungsträger wenig sinnvoll und erfolgversprechend. Wenn Alkohol in einer Region bereits durch Steuerbelastungen sehr teuer ist, bringt es kaum noch zusätzliche Effekte, weiter an der Preisschraube zu drehen. In diesen Fällen wäre es sinnvoller, über eine weitere Heraufsetzung des Mindestalters nachzudenken - sofern dies noch gangbar ist. Denn inzwischen gilt in den meisten US-Bundesstaaten ein Mindestalter von 21 Jahren. Für eine Reihe von Bundesstatten zeichnet sich damit allerdings auch ab, dass die beiden beschriebenen Maßnahmen ausgereizt sind: Wo Steuerbelastungen für Alkohol schon extrem hoch sind (etwa im Vergleich zu Nachbarstaaten) und das Mindestalter von 21 Jahren gilt, muss über andere Wege nachgedacht werden oder über schärfere Kontrollen.
Trotz dieser Einschränkungen halten die Forscher ihre Ergebnisse auch politisch für überaus relevant. Einerseits zeigen sie auf, dass der Meinungsstreit, welche Maßnahmen zum Schutz Jugendlicher wirkungsvoller seien, beendet werden kann. Denn die bisher teilweise widersprüchlichen Forschungsergebnisse basieren auf einer zu isolierten Betrachtung einzelner Interventionen. Zum anderen ist diese Erkenntnis auch übertragbar auf andere gesundheitspolitische Felder: Anstelle einer Betrachtung nur einzelner gesetzlicher Regelungen oder anderer Faktoren kommt es darauf an, die Gesamtheit der für ein gesundheitliches Problem bedeutsamen Rahmenbedingungen zu betrachten.
Ein Abstract der Studie ist hier nachzulesen: Joint Impacts of Minimum Legal Drinking Age and Beer Taxes on US Youth Traffic Fatalities, 1975 to 2001 (Alcoholism: Clinical and Experimental Research 31 (5), 804-813)
Eine Pressemitteilung mit den wichtigsten Ergebnissen ist hier: When Are Minimum-Legal-Drinking-Age And Beer-Tax Policies The Most Effective? (Medical News Today, 28 Apr 2007)
Gerd Marstedt, 28.4.2007
Wissenschaftler sind sich einig: Alkohol und Tabak sind schädlicher als Cannabis
 Eine Veröffentlichung in der renommierten medizinischen Fachzeitschrift "The Lancet" hat jetzt gezeigt, dass eine große Zahl von Wissenschaftlern, darunter auch Mediziner und Spezialisten im Bereich Sucht, die Risiken und Gesundheitsgefahren der ganz legalen Drogen Tabak und Alkohol sehr viel höher einstufen als beispielsweise die in vielen Ländern illegale Droge Cannabis (Haschisch, Marihuana). In der Studie wurde der Versuch unternommen, endlich zu einer wissenschaftlich fundierten Bewertung der Schädlichkeit von Drogen und Betäubungsmitteln zu kommen und dabei mit Vorurteilen und irrationalen Einschätzungen aufzuräumen. Ausgangspunkt der Arbeit war die in Großbritannien in einem Gesetz ("Misuse of Drugs Act of 1971") festgelegte Klassifizierung von Betäubungsmitteln in drei Gruppen, wobei in der Gruppe A (überaus schädlich) beispielsweise Ecstasy, LSD und Heroin zu finden sind, in der unteren Gruppe C (weniger schädlich) Tranquilizer wie Valium und Librium, aber auch Cannabis. Tabak und Alkohol sind in der gesetzlichen Vorlage nicht erwähnt.
Eine Veröffentlichung in der renommierten medizinischen Fachzeitschrift "The Lancet" hat jetzt gezeigt, dass eine große Zahl von Wissenschaftlern, darunter auch Mediziner und Spezialisten im Bereich Sucht, die Risiken und Gesundheitsgefahren der ganz legalen Drogen Tabak und Alkohol sehr viel höher einstufen als beispielsweise die in vielen Ländern illegale Droge Cannabis (Haschisch, Marihuana). In der Studie wurde der Versuch unternommen, endlich zu einer wissenschaftlich fundierten Bewertung der Schädlichkeit von Drogen und Betäubungsmitteln zu kommen und dabei mit Vorurteilen und irrationalen Einschätzungen aufzuräumen. Ausgangspunkt der Arbeit war die in Großbritannien in einem Gesetz ("Misuse of Drugs Act of 1971") festgelegte Klassifizierung von Betäubungsmitteln in drei Gruppen, wobei in der Gruppe A (überaus schädlich) beispielsweise Ecstasy, LSD und Heroin zu finden sind, in der unteren Gruppe C (weniger schädlich) Tranquilizer wie Valium und Librium, aber auch Cannabis. Tabak und Alkohol sind in der gesetzlichen Vorlage nicht erwähnt.
Die Wissenschaftler unternahmen zunächst den Versuch, ein neues Bewertungsschema für die Einstufung der "Schädlichkeit" von Drogen zu entwerfen. Dabei unterschieden sie drei theoretische Dimensionen:
• Das Risiko körperlicher Schäden und Erkrankungen: Dabei werden kurzfristige, aber auch langfristige Folgen berücksichtigt, wie sie beispielsweise für Tabak oder Alkohol durch viele Studien belegt sind. Eingeschlossen wird hier auch das Risiko psychischer Störungen.
• Das Risiko von Sucht und Abhängigkeit: Berücksichtigt werden in dieser Dimension sowohl die psychische als auch die körperliche Abhängigkeit.
• Soziale Gefahren: Hierbei werden Risiken eingeschlossen, die sich durch den Drogengebrauch auf soziale Kontakte und die Familie auswirken, aber auch finanzielle Belastungen, die sich für die gesundheitliche Versorgung und soziale Fürsorge Abhängiger ergeben.
In einem ersten Schritt ließen die Wissenschaftler dann 14 verschiedene Drogen, von Heroin und Kokain über Amphetamine und Barbiturate bis hin zu Tabak und Alkohol von 29 Medizinern bewerten. Alle Mediziner waren Spezialisten im Bereich "Sucht" und Mitglieder des "Royal College of Psychiatrists". Die Bewertung erfolgte für jede Droge innerhalb der drei neu entwickelten Dimensionen (körperliche Schäden, Abhängigkeit, soziale Risiken) mit einem Urteil 1, 2 oder 3 für die jeweilige Schädlichkeit.
Nachdem so sicher gestellt war, dass die Bewertungstabelle mit 3 Dimensionen und 3 Schädlichkeitsstufen überhaupt von medizinischen Wissenschaftlern als seriös und praxistauglich akzeptiert wird, folgte in einem zweiten Schritt eine noch fundiertere Bewertung von Drogen. Die Forscher führten dazu ein sog. "Delphi-Experiment" durch, eine Befragung von Experten, bei der in mehreren Stufen Einschätzungen zu wissenschaftlich ungeklärten Fragen durchgeführt werden. Die Teilnehmer bekommen dabei in jeder Stufe neue Informationen zur Fragestellung und können ihre vorherigen Aussagen aufgrund des neuen Informationsstandes korrigieren.
Konkret bedeutete dies, dass in einer Reihe von Gruppensitzungen mit jeweils 8-16 Experten, darunter Pharmakologen und Mediziner, Suchtexperten und Psychiater, insgesamt 20 verschiedene Drogen jeweils einzeln bewertet wurden. In allen Gruppensitzungen wurden neue Forschungsergebnisse zu den Drogen vorgestellt, die zugrunde liegenden Studien diskutiert und ein Meinungsbild erstellt. Abschließend gab dann, teilweise erst nach mehreren Sitzungen, jeder Teilnehmer eine Drogenbewertung innerhalb des neuen Bewertungsschemas ab.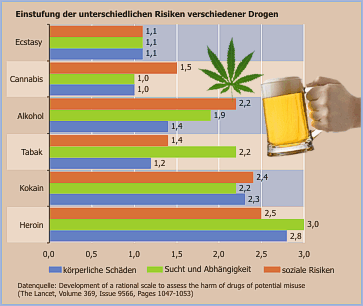
Das Ergebnis war überraschend: Einige der im englischen Gesetz in der höchsten Schädlichkeitsklasse zu findenden Drogen (wie LSD und Ecstasy) wurden in der neuen wissenschaftlichen Bewertung eher in eine mittlere bis untere Risiko-Gruppe eingestuft. Und umgekehrt bekamen die im Gesetz überhaupt nicht berücksichtigten Drogen Alkohol und Tabak jetzt eine Einstufung im mittleren bis oberen Risikobereich. In der Skala der schädlichsten Drogen rangieren in der neuen wissenschaftlichen Bewertung Heroin, Kokain, Barbiturate an vorderster Stelle, dicht gefolgt von Alkohol, Amphetaminen und Tabak. Cannabis liegt erst auf Platz 11, LSD auf Platz 14 und Ecstasy auf Platz 18.
Für einzelnen Drogen gaben die Wissenschaftler unterschiedliche Einstufungen auf drei Risiko-Skalen an: Risiko körperlicher Schäden, Sucht- und Abhängigkeits-Gefahren, soziale Risiken. Dabei stellt der Wert 3 ein maximales Risiko dar, der Wert 0 keinerlei Risiko. Die Grafik verdeutlicht die Bewertungs-Ergebnisse.
Ein Abstract der Studie ist hier nachzulesen: Development of a rational scale to assess the harm of drugs of potential misuse (The Lancet, Volume 369, Issue 9566, 24 March 2007-30 March 2007, Pages 1047-1053)
Hier findet man den (kostenpflichtigen) Volltext der Studie
Gerd Marstedt, 23.3.2007
Befragung zu Frühstücks-Gewohnheiten: Jüngere haben keine Zeit für die erste Mahlzeit
 Die DAK und die Zeitschrift "healthy living" haben ein repräsentative Umfrage über die Frühstücksgewohnheiten in Deutschland durchgeführt. Für alle Befragten ab 18 Jahren zeigt sich: 17 Prozent verzichten auf die erste Mahlzeit des Tages, jeder Zehnte isst morgens immerhin ab und zu etwas. Für fast drei Viertel der Bundesbürger gehört das Frühstück werktags dazu. Besonders bemerkenswert sind die in der Studie gefundenen Altersunterschiede. Während über 90 Prozent der 60jährigen und älteren täglich frühstückt, fällt die erste Mahlzeit am Tag bei Jüngeren meist aus. Von den 18- bis 29Jährigen frühstückt nur noch gut jeder Zweite täglich, knapp 20 Prozent nur ab und zu und fast 30 Prozent der jungen Deutschen essen morgens gar nichts. Hauptgrund: Zeitmangel.
Die DAK und die Zeitschrift "healthy living" haben ein repräsentative Umfrage über die Frühstücksgewohnheiten in Deutschland durchgeführt. Für alle Befragten ab 18 Jahren zeigt sich: 17 Prozent verzichten auf die erste Mahlzeit des Tages, jeder Zehnte isst morgens immerhin ab und zu etwas. Für fast drei Viertel der Bundesbürger gehört das Frühstück werktags dazu. Besonders bemerkenswert sind die in der Studie gefundenen Altersunterschiede. Während über 90 Prozent der 60jährigen und älteren täglich frühstückt, fällt die erste Mahlzeit am Tag bei Jüngeren meist aus. Von den 18- bis 29Jährigen frühstückt nur noch gut jeder Zweite täglich, knapp 20 Prozent nur ab und zu und fast 30 Prozent der jungen Deutschen essen morgens gar nichts. Hauptgrund: Zeitmangel.
53 Prozent - vor allem die unter 30-Jährigen - verzichten aus Zeitmangel immer oder zumindest ab und zu auf ein Frühstück. 51 Prozent lassen das Frühstück wegen fehlendem Hunger bzw. Appetit ausfallen. Nur wenige verzichten jedoch auf ihr Frühstück, weil sie auf diese Weise Kalorien einsparen wollen. DAK-Ernährungswissenschaftlerin Hanna-Kathrin Kraaibeek sieht diese Entwicklung kritisch: "Das Frühstück ist das Sprungbrett in den Tag. Wer sich im Job oder Studium konzentrieren muss, braucht Startenergie in Form von Kohlenhydraten, Eiweiß, Vitaminen und Mineralstoffen - kurz: ein ausgewogenes Frühstück."
Die Hitliste der Frühstückszutaten führen Vollkornbrot, -toast und -brötchen bei 63 Prozent der Bundesbürger an. Die Brotvarianten aus Weißmehl sind immerhin noch bei 47 Prozent der Befragten beliebt. Süßes wie Marmelade, Nussnougatcreme und Honig gehört ebenso wie Käse mit 55 Prozent zum typisch deutschen Frühstück. Nur jeder Vierte mag morgens lieber Müsli - das gilt vor allem für jüngere Frauen. Gesundes Obst verspeisen 40 Prozent schon zum Frühstück, mit fett- und zuckerhaltigem Gebäck wie Croissants oder Donuts beginnen dagegen nur neun Prozent den Tag. Was ein gesundes Frühstück aus ernährungsphysiologischer Sicht enthalten sollte, erklärt die DAK-Expertin Kraaibeek: "Den Trend zu Vollkornprodukten sehe ich positiv: Sie enthalten mehr Ballaststoffe als Weißmehlbrot und machen länger satt. Wer bei Käse auf die fettarmen Varianten setzt und sein Frühstück öfter mal durch Obst ergänzt, startet bestens in den Tag."
Was das Gesundheitsbarometer außerdem offenbart: Die meisten (38 Prozent) frühstücken allein. 28 Prozent decken für ihren Partner mit und jeder Fünfte nimmt sein Frühstück im Kreis der Familie ein. Allerdings gab es auch hier große Unterschiede in den verschiedenen Altersgruppen. Von den jungen Deutschen im Alter von 18 bis 29 Jahren frühstückt fast jeder Zweite allein, nur sechs Prozent mit dem Partner, dafür 19 Prozent mit den Kollegen. Zwischen 15 und 30 Minuten Zeit nehmen sich gut 80 Prozent der Erwerbstätigen für die erste - und wichtigste - Mahlzeit des Tages.
Eine Kurzfassung der wichtigsten Ergebnisse ist hier. Studie: Wie frühstücken die Deutschen?
Die komplette Studie ist hier nachzulesen (PDF, 6 Seiten): Forsa Umfrage "Frühstück"
Finnische Wissenschaftler fanden unlängst heraus, dass der Verzicht auf das morgendliche Frühstück ein deutliches Indiz ist für ein ungesundes Alltagsverhalten auch in anderen Bereichen. Über 5.500 Jugendliche und ihre Eltern wurden nach ihrem Frühstücksverhalten, ihrem Körpergewicht und ihren Trinkgewohnheiten befragt. Es zeigte sich, dass "Frühstücksmuffel" häufiger als andere rauchen und Alkohol konsumieren. Überdies neigten diejenigen, die morgens nichts aßen, dazu, dann am späten Vormittag ungesunde Snacks zu sich zu nehmen. Die Eltern waren oftmals ein schlechtes Vorbild: Wenn sie kein Frühstück zu sich nahmen, verzichteten auch die Kinder zumeist darauf. Ein Abstract der finnischen Studie ist hier zu finden: Breakfast skipping and health-compromising behaviors in adolescents and adults
Gerd Marstedt, 21.3.2007
Raucher-Entwöhnung: Schon kurze sportliche Betätigung hilft, das Verlangen nach Nikotin zu überwinden
 Wer mit dem Rauchen aufhören möchte, sollte anstelle des Nikotinpflasters oder der Akupunkturnadeln einmal ein ganz schlichtes Mittel einsetzen: Körperliche Aktivität und Bewegung. Wie eine wissenschaftliche Bilanzierung von insgesamt 14 bereits veröffentlichten Studien gezeigt hat, helfen bereits ein fünfminütiger strammer Spaziergang, Gymnastik oder leichtes Fitnesstraining dabei, Entzugserscheinungen und die "Schmacht" nach der Zigarette zu überwinden. In allen Studien empfanden die Teilnehmer nach dem Sport oder der Bewegung ein deutlich geringeres Verlangen nach Nikotin und hielten bis zu viermal länger ohne Zigarette aus als Teilnehmer aus Vergleichsgruppen ohne sportliche Betätigung. Die Entzugserscheinungen wurden geringer, sobald die körperliche Betätigung eingesetzt hatte. Das Verlangen nach der nächsten Zigarette blieb bis zu 50 Minuten auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau. "Wenn in einer Studie ein Medikament denselben Effekt gezeigt hätte", so kommentierte Prof. Adrian H. Taylor die Befunde, "würde man garantiert für dieses Arzneimittel als erfolgreiche Hilfe zur Raucherentwöhnung massive Werbung betreiben."
Wer mit dem Rauchen aufhören möchte, sollte anstelle des Nikotinpflasters oder der Akupunkturnadeln einmal ein ganz schlichtes Mittel einsetzen: Körperliche Aktivität und Bewegung. Wie eine wissenschaftliche Bilanzierung von insgesamt 14 bereits veröffentlichten Studien gezeigt hat, helfen bereits ein fünfminütiger strammer Spaziergang, Gymnastik oder leichtes Fitnesstraining dabei, Entzugserscheinungen und die "Schmacht" nach der Zigarette zu überwinden. In allen Studien empfanden die Teilnehmer nach dem Sport oder der Bewegung ein deutlich geringeres Verlangen nach Nikotin und hielten bis zu viermal länger ohne Zigarette aus als Teilnehmer aus Vergleichsgruppen ohne sportliche Betätigung. Die Entzugserscheinungen wurden geringer, sobald die körperliche Betätigung eingesetzt hatte. Das Verlangen nach der nächsten Zigarette blieb bis zu 50 Minuten auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau. "Wenn in einer Studie ein Medikament denselben Effekt gezeigt hätte", so kommentierte Prof. Adrian H. Taylor die Befunde, "würde man garantiert für dieses Arzneimittel als erfolgreiche Hilfe zur Raucherentwöhnung massive Werbung betreiben."
Die Wissenschaftler aus London, Exeter und Toronto hatten eine größere Zahl wissenschaftlicher Veröffentlichungen neu analysiert, in denen der Einfluss von sportlicher Betätigung auf das psychische Verlangen nach einer Zigarette, Entzugserscheinungen oder die Stimmung untersucht worden waren. Einbezogen waren in allen Studien Personen, die gerade mit dem Rauchen aufgehört hatten oder dies fest vorhatten. Im Einzelnen zeigte sich bei der Auswertung:
• Das Verlangen nach einer Zigarette verringerte sich direkt zu Beginn der körperlichen Betätigung oder unmittelbar danach. Am längsten hielt dieser Effekt in einer Studie an, in der Teilnehmer etwa 1 Meile (1,6 km) zu Fuß gegangen waren.
• In mehreren Studien, die überprüft hatten, ob die Dauer von Sport und Bewegung einen Einfluss hat, zeigte sich, dass bereits eine vergleichsweise kurze Zeitdauer ausreicht, um das psychische Verlangen zu reduzieren und eine längere Aktivität keine zusätzlichen Effekte mit sich bringt.
• Acht von neun Studien zeigten, dass Entzugerscheinungen mit Empfindungen wie Stress, innere Anspannung, Konzentrationsschwächen, Reizbarkeit und Unruhe, deutlich abnehmen.
• Die Zeitdauer, die Raucher es problemlos ohne Zigarette nach der sportlichen Aktivität aushielten, war in den Studien unterschiedlich lang. Bis zu dem Punkt, an dem sie um jeden Preis "eine rauchen wollten", vergingen zwischen 10 und 60 Minuten. Dieser Zeitraum ließ sich in einer Studie auch nicht nennenswert vergrößern, wenn die Intensität der körperlichen Betätigung gesteigert wurde.
Noch weitgehend ungeklärt ist nach Auffassung der Forscher, warum sportliche Betätigung zumindest kurzfristig in der Lage ist, Suchterscheinungen bei Rauchern abzuwehren oder zu mildern. Eine bündige Erklärung fällt auch deshalb schwer, weil das Verlangen nach einer Zigarette durch ein körperliches Bedürfnis nach Entspannung ausgelöst werden kann, aber auch durch ein Bedürfnis zur Aktivierung von Körperkräften. Die Wissenschaftler weisen auch darauf hin, dass nicht nur die zugrunde liegenden psychischen und biologischen Mechanismen des Effekts ungeklärt sind, sondern die sehr unterschiedlichen methodischen Konzepte und Messmethoden der verschiedenen Studien eine Reihe weiterer Fragen aufwerfen.
Ein Abstract der Studie, veröffentlicht in der April-Ausgabe der Zeitschrift "Addiction" (Sucht) ist hier nachzulesen: The acute effects of exercise on cigarette cravings, withdrawal symptoms, affect and smoking behaviour: a systematic review (Addiction 102 (4), 534-543, 2007)
Gerd Marstedt, 14.3.2007
Schnupf- und Kautabak sind keine "gesunden" oder harmlosen Varianten des Rauchens.
 Der manchmal unter Rauchern, die sich des Krankheitsrisikos ihres Verhaltens durchaus bewusst sind, für "gesünder" gehaltene "Genuss" von Kautabak ("spit tobacco") oder Schnupftabak ("Snuff"), ist eine gefährliche Selbsttäuschung. Dies ist jedenfalls das Ergebnis eines erstmals durchgeführten Vergleichs der tabak- und nikotinassoziierten Sterberisiken zwischen Personen, die früher inhalative Zigarettenraucher waren und damit völlig aufhörten mit den so genannten "Switchern" zu den beiden Alternativen.
Der manchmal unter Rauchern, die sich des Krankheitsrisikos ihres Verhaltens durchaus bewusst sind, für "gesünder" gehaltene "Genuss" von Kautabak ("spit tobacco") oder Schnupftabak ("Snuff"), ist eine gefährliche Selbsttäuschung. Dies ist jedenfalls das Ergebnis eines erstmals durchgeführten Vergleichs der tabak- und nikotinassoziierten Sterberisiken zwischen Personen, die früher inhalative Zigarettenraucher waren und damit völlig aufhörten mit den so genannten "Switchern" zu den beiden Alternativen.
In der Untersuchungskohorte der "US American Cancer Society Cancer Prevention Study II" von 116.395 Männern fanden sich 4.442 "Switcher" und 111.952 Männer, die mit jeglichem Tabak"genuss" aufgehört hatten. Für die Studie "Tobacco-related disease mortality among men who switched from cigarettes to spit tobacco" von Henley et al. in der Zeitschrift "Tobacco Control" (2007; Heft 16;22-28) wurden die im Zeitraum 1982 bis Ende 2002 verstorbenen Gruppenmitglieder nach Krankheiten und Zugehörigkeit zu den verschiedenen Tabakkonsumgruppen untersucht.
Die Ergebnisse sind eindeutig:
• "Our findings supplement other data from this cohort showing that men who exclusively used spit tobacco had higher death rates for lung cancer (Hazard ratios [HR] 2.0), coronary heart disease (HR 1.3), stroke (HR 1.4) and all causes combined (HR 1.2) than those who had never used any tobacco product."
• Aber auch der Vergleich von Ex-Rauchern und Kau- wie Schnupftabak-Konsumenten fällt zum deutlichen Nachteil der letzteren aus: "Together, our studies suggest that using spit tobacco compares unfavourably with both complete tobacco cessation and complete abstinence from all tobacco products. In summary, we found that men who switched from smoking cigarettes to using spit tobacco had a higher rate of death from all causes, lung cancer, coronary heart disease and stroke than those who had never used tobacco or those who were former cigarette smokers and quit using tobacco entirely."
Das für Kau- und Schnupftabakkonsumenten vor allem unterschätzte Risiko von Lungenkrebs beruht für die Wissenschaftler auf dem Nitrosamingehalt des Tabaks.
Angesichts ihrer Ergebnissen warnen sie vor allen Formen des Umstiegs zu angeblich risikoschwächeren Tabakkonsumformen und halten allein den kontrollierten und unterstützten Ausstieg aus allen Tabakkonsumformen für das geeignete Mittel, den erhöhten Sterberisiken zu entgehen.
Die PDF-Version des kompletten Aufsatzes "Tobacco-related disease mortality among men who switched from cigarettes to spit tobacco" von Henley et al. in der Zeitschrift Tobacco Control kann hier heruntergeladen werden.
Bernard Braun, 14.2.2007
Schockierende Fotos auf Zigarettenpackungen werden von Rauchern eher wahrgenommen
 Will man Raucher auf die gesundheitlichen Risiken ihrer Sucht hinweisen, um eine Verhaltensänderung zu bewirken, so sollte das Prinzip gelten: Große und unübersehbare Warnhinweise! Bilder und nicht nur Text! Fotos mit schockierenden Krankheitssymptomen! Solche Hinweise wirken sehr viel eindringlicher als die in vielen Ländern verwendeten Textwarnungen in kleinerem Format. Dies ist das Ergebnis einer vierjährigen kanadischen Studie, die jetzt im American Journal of Preventive Medicine veröffentlicht wurde. Die Wissenschaftler hatten zwischen 2002 und 2005 mehrmals Telefoninterviews mit insgesamt 15.000 Rauchern aus vier Ländern durchgeführt: Kanada, USA, Großbritannien und Australien.
Will man Raucher auf die gesundheitlichen Risiken ihrer Sucht hinweisen, um eine Verhaltensänderung zu bewirken, so sollte das Prinzip gelten: Große und unübersehbare Warnhinweise! Bilder und nicht nur Text! Fotos mit schockierenden Krankheitssymptomen! Solche Hinweise wirken sehr viel eindringlicher als die in vielen Ländern verwendeten Textwarnungen in kleinerem Format. Dies ist das Ergebnis einer vierjährigen kanadischen Studie, die jetzt im American Journal of Preventive Medicine veröffentlicht wurde. Die Wissenschaftler hatten zwischen 2002 und 2005 mehrmals Telefoninterviews mit insgesamt 15.000 Rauchern aus vier Ländern durchgeführt: Kanada, USA, Großbritannien und Australien.
Diese Länder waren ausgewählt worden, weil dort sehr unterschiedliche Formen von Warnhinweisen auf Zigarettenpackungen zu finden sind. In Großbritannien fand man zu Beginn der Studie eher unauffällige Warnungen, die nur etwa 6 Prozent der gesamten Oberfläche einer Zigarettenschachtel bedeckten. In den USA waren die Hinweise noch mehr verdeckt, nur kurze Texte auf der Rückseite der Packungen. In Kanada andererseits ist es schon seit 2000 gesetzlich vorgeschrieben, sehr große Hinweise auf der Vorderseite zu drucken und dazu auch abschreckende Fotos, eine von Krebsmetastasen entstellte Mundhöhle oder eine von Krebs gezeichnete Lunge. Kanada war weltweit das erste Land das vorschrieb, Texte wie z.B. "Rauchen verursacht Krebs" auf der Vorder- und Rückseite zu drücken, Warnhinweise und Fotos etwa halb so groß wie eine Zigarettenschachtel.
Schon in einer ersten Befragung im Jahr 2003 hatten die Forscher der University of Waterloo in Ontario/Kanada, dann festgestellt, dass die Warnhinweise von 60 Prozent der Kanadier, 52 Prozent der Australier, 44 Prozent der Briten und nur 30 Prozent der Amerikaner wahrgenommen wurden - exakt übereinstimmend mit der Größe und drastischen Gestaltung der Warnungen. Änderungen gesetzlicher Vorschriften in Großbritannien mit der Pflicht zu größeren Warnhinweisen machten sich dann in einer späteren Befragung im Jahr 2005 derart bemerkbar, dass nun 82 Prozent der Briten, also fast doppelt so viel wie zuvor, die Mahnungen zur Kenntnis nahmen. Diese Quote war damit so hoch wie bei den Kanadiern. Die Studie ist im American Journal of Preventive Medicine veröffentlicht: David Hammond et al: Text and Graphic Warnings on Cigarette Packages: Findings from the International Tobacco Control Four Country Study (American Journal of Preventive Medicine, Volume 32, Issue 3, March 2007, Pages 202-209 ).
In welchem Umfang die Warnhinweise auch dazu führen, dass Betroffene mit dem Rauchen tatsächlich aufhören, haben die Wissenschaftler leider nicht untersucht. Immerhin konnten sie aber in einer schon zuvor veröffentlichten Studie aus dem Jahr 2004 feststellen, dass die Hinweise zumindest auch emotionale Spuren hinterlassen. 44% der Befragten gaben an, dass die großen abstoßenden Krebsbilder bei ihnen Ängste hinterlassen, bei 58% auch Ekelgefühle. Etwa die Hälfte hat deshalb über Gesundheitsrisiken nachgedacht, bei jedem Dritten hat sich der Vorsatz gefestigt, mit dem Rauchen aufzuhören, und etwa jeder Fünfte hat daraufhin weniger Zigaretten geraucht als zuvor. Je größer unangenehme Empfindungen waren, desto häufiger wurde auch von Versuchen berichtet, mit dem Rauchen aufzuhören oder es zumindest einzuschränken. Die Studie ist im Volltext hier nachzulesen: Graphic Canadian Cigarette Warning Labels and Adverse Outcomes: Evidence from Canadian Smokers (American Journal of Public Health, August 2004, Vol 94, No. 8, 1442-1445)
Belgien wird in Kürze dem kanadischen Beispiel folgen. Ab Mitte 2007 dürfen dort nur noch Zigarettenpackungen verkauft werden, die große Warnhinweise mit Fotos von den gesundheitlichen Folgen des Rauchens auf Zigarettenpäckchen zeigen, vom Zahnausfall über das Krebsgeschwür im Mund bis zur schwarzen Raucherlunge. Die ersten Päckchen sind bereits jetzt im Handel, die alten mit eher dezenten Warnungen dürfen dann ab Juni 2007 nicht mehr verkauft werden.
Gerd Marstedt, 9.2.2007
Studie im Auftrag des BMG beklagt zu viele "Tabakrauchereignisse" in Film und Fernsehen
 Eine Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit hat Kinofilme und Fernsehsendungen darauf hin untersucht, wie oft dort (auch im Vergleich zu ausländischen Produktionen) Episoden mit rauchenden Heldinnen und Helden zu sehen sind. 409 Kinofilme und 352 Stunden Fernsehprogramm wurden gesichtet und inhaltsanalytisch auf das Vorkommen von "Tabakrauchereignissen" überprüft. Ein Ergebnis: "Tabakrauchereignisse kommen besonders häufig in Dramen (83%) und Actionfilmen (83%) vor. Auch in Fantasy-Filmen (73%) sowie Komödien (71%) sind Tabakrauchereignisse eher die Regel denn die Ausnahme. Seltener treten sie in Animations- und Zeichentrickfilmen (44%) auf."
Eine Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit hat Kinofilme und Fernsehsendungen darauf hin untersucht, wie oft dort (auch im Vergleich zu ausländischen Produktionen) Episoden mit rauchenden Heldinnen und Helden zu sehen sind. 409 Kinofilme und 352 Stunden Fernsehprogramm wurden gesichtet und inhaltsanalytisch auf das Vorkommen von "Tabakrauchereignissen" überprüft. Ein Ergebnis: "Tabakrauchereignisse kommen besonders häufig in Dramen (83%) und Actionfilmen (83%) vor. Auch in Fantasy-Filmen (73%) sowie Komödien (71%) sind Tabakrauchereignisse eher die Regel denn die Ausnahme. Seltener treten sie in Animations- und Zeichentrickfilmen (44%) auf."
Die Wissenschaftler klären in der Studie zunächst auf über ihr Untersuchungsobjekt: "Tabakrauchereignisse sind definiert als aktives Rauchen oder Hantieren mit Tabakprodukten. Sie setzten sich aus Tabakrauchepisoden und Tabakrauchvorkommnissen zusammen." (S.7) Weitere Ergebnisse der Untersuchung sind dann unter anderem:
• In deutschen Kinofilmen wird häufiger als in europäischen oder US-amerikanischen Tabakqualm verblasen
• im "Ersten" treten in 31% der Sendungen, in RTL in 41%, in Pro7 in 54% der Sendungen und im ZDF in 56% der Sendungen Tabakrauchereignisse auf. (Anmerkung der Autoren: "Diese zusammenfassende Statistik sollte nicht überbewertet werden, da sich das Profil der einzelnen Sender in der Programmgestaltung unterscheidet.")
• Trotz der häufigen Qualmerei im ZDF findet die Studie auch lobende Worte für diesen Sender: "Ein positives Beispiel für die Unterhaltungssparte liefert das ZDF, das dem Münsteraner Privatdetektiv Wilsberg, der in früheren Folgen der Serie noch geraucht hatte, das Rauchen untersagt hat." (S.30)
• Morgens und abends wird recht viel, nachmittags kaum geraucht: "Das Ausmaß der Tabakrauchexposition im Fernsehen kovariiert auch mit der Tageszeit der Ausstrahlung der Sendung. Erwartungsgemäß ist der Anteil an Sendungen mit Tabakrauchereignissen in den Abendstunden am höchsten (53%), aber auch am Vorabend mit 47% recht hoch. Seltener werden Sendungen mit Tabakrauchereignissen nachmittags ausgestrahlt (35%)."
Da in TV-Magazinen (wie "Leute heute", "Spiegel TV", "Panorama") recht viel geraucht wird (in der Hälfte aller Magazin-Sendungen fanden die Wissenschaftler Tabakrauchereignisse), wird in der Studie auch auf die von Autoren und Regisseuren womöglich nicht überdachten pädagogischen Folgen hingewiesen: "Wenn also beispielsweise Politiker wie die Altbundeskanzler Helmut Schmidt oder Gerhard Schröder im Fernsehen rauchend gezeigt werden, kann dies von Kindern und Jugendlichen durchaus derart interpretiert werden, dass (politische) Macht mit dem Rauchstatus kovariiert." (S.30)
Die Studie von Reiner Hanewinkel, Gudrun Wiborg, James D. Sargent ist hier als PDF-Datei verfügbar: Verbreitung des Rauchens im deutschen Fernsehen und in deutschen Kinofilmen
Gerd Marstedt, 16.1.2007
Mit Rotwein und Kaffee, Walnuss und Olivenöl ein bißchen Gesundheit naschen
 Wer für 2007 Vorsätze gefasst hatte wie "Nicht mehr so viel Kaffee trinken" oder "Weniger Alkohol!" wurde gleich zu Beginn des Neuen Jahrs verunsichert. Denn er fand Presse-Meldungen, deren Botschaft war: Alles gar nicht so schlimm für die Gesundheit, eher im Gegenteil! Da meldet das Deutsche Ärzteblatt: "Hypertonie: Mäßiger Alkoholkonsum senkt Herzinfarktrisiko": "Boston - Das neue Jahr beginnt mit einer angenehmen Nachricht für Hypertoniker. Nach einer neuen Auswertung der Health Professionals Follow-Up Study brauchen sie entgegen bisherigen Empfehlungen ihrer Ärzte alkoholischen Getränken nicht völlig abzuschwören. Die neue Analyse der prospektiven Beobachtungsstudie kommt in den Annals of Internal Medicine zu dem Ergebnis, dass täglich ein oder zwei Gläser eines alkoholischen Getränks das Herzinfarktrisiko senken."
Wer für 2007 Vorsätze gefasst hatte wie "Nicht mehr so viel Kaffee trinken" oder "Weniger Alkohol!" wurde gleich zu Beginn des Neuen Jahrs verunsichert. Denn er fand Presse-Meldungen, deren Botschaft war: Alles gar nicht so schlimm für die Gesundheit, eher im Gegenteil! Da meldet das Deutsche Ärzteblatt: "Hypertonie: Mäßiger Alkoholkonsum senkt Herzinfarktrisiko": "Boston - Das neue Jahr beginnt mit einer angenehmen Nachricht für Hypertoniker. Nach einer neuen Auswertung der Health Professionals Follow-Up Study brauchen sie entgegen bisherigen Empfehlungen ihrer Ärzte alkoholischen Getränken nicht völlig abzuschwören. Die neue Analyse der prospektiven Beobachtungsstudie kommt in den Annals of Internal Medicine zu dem Ergebnis, dass täglich ein oder zwei Gläser eines alkoholischen Getränks das Herzinfarktrisiko senken."
Und eingeschworene Kaffeetrinker konnten im Online-Magazin "Medizinauskunft" lesen: Kaffee: Manchmal Medizin: "Inzwischen sind die meisten Mediziner davon überzeugt, dass Kaffee eher Gutes tut. In manchen Fällen kann er sogar Medizin sein. Nach einer neueren Studie erkranken Menschen, die täglich vier bis sechs Tassen trinken, zu 30 Prozent seltener an Diabetes. Obwohl einigen Menschen nach zu starkem Kaffee schon einmal die Hand zittert, erkranken nach einer anderen Studie Vieltrinker seltener an der Parkinsonschen Schüttellähmung."
Die Serie der in den Medien kolportierten Forschungsergebnisse über gesundheitsförderliche Einflüsse von Rotwein und Olivenöl, Knoblauch, Tomaten und Walnüssen scheint ebenso endlos wie die der Sudoku-Rätsel. Und es sind nicht nur die vielfältigen Fitness-und-Diät-Magazine, die hier jedweden Befund von Forschungsprojekten nachdrucken, sondern auch seriöse Online-Zeitschriften wie FAZ, Focus, Welt.
Nach wie vor auf Platz 1 steht natürlich der Rotwein, der (in Maßen genossen!) gegen unterschiedlichste Erkrankungsrisiken vorbeugen soll: Ein Glas Rotwein am Tag halbiert das Risiko, an bösartigen Tumoren der Prostata zu erkranken, meldet Focus Online. Im Rotwein enthaltene Polyphenole wirken entzündungshemmend und beugen Krebs und Herzerkrankungen vor, meldet die "Welt", aber Achtung: Dabei kommt es auf hohe Konzentrationen an, und die haben vor allem Weine aus Südwestfrankreich oder Sardinien. Und französischer Rotwein beugt natürlich auch noch der Arterienverkalkung vor, meldet die FAZ. Zwar steht Rotwein unangefochten ganz oben, aber die Liste gesunder Nahrungsmittel scheint beliebig fortsetzbar. Ein Schnelldurchgang: Eine Hand voll Walnüsse täglich beugt verengten Gefäßen und Herzleiden vor. Regelmäßiger Konsum von Olivenöl schützt vor Krebserkrankungen. Schwarzer Tee beschleunigt Stressabbau. Bier hemmt Entzündungen und Omega-3-Fettsäuren schützen nicht nur Herz und Gefäße, sie beeinflussen auch die Stimmung. Tomaten und Brokkoli gemeinsam verzehrt dienen zur Vorbeugung gegen Krebs. Alkohol verlängert das Leben älterer Frauen und Joghurt ist gut für die Immunstärkung.
Man kann es Forschungsprojekten wohl nicht verdenken, wenn sie zur Legitimation ihrer Arbeit auch ihre epidemiologischen Befunde über eine 25%ige Senkung von Erkrankungsrisiken für die Krankheit X bei täglichem Verzehr von 20 Gramm des Nahrungsmittels Y veröffentlichen, wie wenig dies auch tatsächlich zu einem gesunden Lebensstil beiträgt. Denn: "Ernährung ist und war schon immer eingebettet in kulturelle Kontexte. Neben der Funktion des Hunger-Stillens hat das Essen mannigfaltige soziale und symbolische Bedeutungen. Diese Bedeutungs-Dimensionen von Ernährung werden in der wissenschaftlichen Ernährungskommunikation zu sehr vernachlässigt." (Claudia Empacher: Was kommt auf den Teller? Lebensstile und nachhaltige Ernährung).
Die Problematik der täglichen Berichterstattung über "gesunde" oder "risikosenkende" Nahrungs- und Genussmittel ist aber noch eine andere. Die isolierte Betrachtung einzelner Verhaltens- oder Ernährungsgewohnheiten und daraus abgeleitete Ratschläge sind ebenso einfältig wie verantwortungslos. Sie suggerieren dem Leser: Damit tust Du was für Deine Gesundheit. Gesundheitsrelevant sind jedoch komplexere Änderungen des Lebensstils und des gesamten Ernährungsverhaltens und nicht das vermehrte Naschen von Walnüssen oder der gehäufte Konsum von Omega-3-Fettsäuren. Medien verstärken durch ihre Meldungen den Eindruck: Gesundheit ist konsumierbar, durch Olivenöl, Rotwein oder Vitaminpillen. Dahinter steht wohl keine bewusste Ideologie-Produktion. Das tumbe Denkmuster "Ich kann mir Gesundheit in der Apotheke, im Reformhaus oder auf dem Öko-Bauernmarkt kaufen" wird jedoch weiter verfestigt.
Und schließlich: Viele Medien-Berichte übernehmen Meldungen von Forschungsergebnissen ohne jede Kontrolle und Nachprüfung der Hintergründe, der Datenbasis und ihrer wissenschaftlichen Seriosität. Wie wenig fundiert die Ergebnisse solcher Studien über den Einfluss bestimmter Nahrungsmittel auf Gesundheit und Lebenserwartung sind, hat unlängst Prof. Ingrid Mühlhauser auf dem Herbstkongress des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen dargelegt: Ob Diäten mit niedrigem Fettanteil, Folsäure und B-Vitamine, Omega-3-Fettsäuren und Fisch, moderater Alkoholkonsum oder Calcium- und Vitamin-D-Konsum - wissenschaftliche fundierte ("evidenzbasierte") Studien haben deutlich gemacht, dass die versprochenen Effekte zur Krebsprävention oder Senkung des kardiovaskulären Risikos in keinem Fall zutrafen. Der Foliensatz ist hier als PDF-Datei verfügbar: Ist vorbeugen besser als heilen?
Gerd Marstedt, 4.1.2007
Reduktion des Zigarettenkonsums hat keinen gesundheitlichen Nutzen
 Für alle Propagandisten von Grenzwerten oder "Light"-Werten unter denen gesundheitsgefährdende Stoffe angeblich ohne Bedenken genutzt werden könnten, dürften die in der wissenschaftlichen Zeitschrift "Tobacco Control" (Heft 15: 472-480) veröffentlichten Ergebnisse der norwegischen Studie "Health consequences of reduced daily cigarette consumption" von Tverdal und Bjartveit Unruhe auslösen.
Für alle Propagandisten von Grenzwerten oder "Light"-Werten unter denen gesundheitsgefährdende Stoffe angeblich ohne Bedenken genutzt werden könnten, dürften die in der wissenschaftlichen Zeitschrift "Tobacco Control" (Heft 15: 472-480) veröffentlichten Ergebnisse der norwegischen Studie "Health consequences of reduced daily cigarette consumption" von Tverdal und Bjartveit Unruhe auslösen.
24.959 Männern und 26.251 Frauen im Alter zwischen 20 und 49 Jahren wurden in längeren zeitlichen Abständen zwischen 3 und 13 Jahren auf die Veränderungen von Erkrankungs- und Sterblichkeitsrisiken untersucht, die mit dem Rauchen von Zigaretten assoziiert werden. Dadurch konnten die Forscher nachweisen: Wenn starke Raucher (wenigstens 15 Zigaretten pro Tag) nicht völlig aufhören zu rauchen, sondern ihren Zigarettenkonsum lediglich um rund die Hälfte senken, hat dies keinen signifikanten positiven Einfluss auf die Sterblichkeit dieser Personen gegenüber den Weiter-Rauchern.
Wenn in Angeboten der Gesundheitserziehung ein gesundheitlich günstiger Effekt des "Ab-und-zu"-Rauchens behauptet wird, erweckt dies völlig falsche unberechtigte Erwartungen.
Hier finden Sie die PDF-Datei des Aufsatzes.
Bernard Braun, 29.11.2006
Wer das Rauchen aufgibt, ist weniger alkoholgefährdet
 Ein öffentliches Rauchverbot in Deutschland könnte nicht nur zu weniger Rauchen führen, sondern auch den Alkoholkonsum verringern. Wie eine aktuelle Studie des RWI Essen zeigt, reduziert sich insbesondere bei Männern mit dem Tabak- auch der Alkoholkonsum. Zudem hat das Rauch- und Trinkverhalten der Eltern einen erkennbaren Einfluss auf das ihrer Kinder - je mehr die Eltern rauchen und trinken, desto mehr tut es auch der Nachwuchs. Würde in Deutschland ein öffentliches Rauchverbot eingeführt, könnte dies auch dazu führen, dass weniger Alkohol getrunken wird. Das lässt sich aus einer aktuellen Studie des RWI Essen ableiten. In ihr wurde untersucht, wie es sich auf den Alkoholkonsum auswirkt, wenn um ein bestimmtes Maß weniger geraucht wird. Dabei gab es keine Hinweise darauf, dass ein Weniger an Zigaretten durch ein Mehr an Alkohol ersetzt wird. Vielmehr reduzierte sich insbesondere bei Männern mit dem Tabak- auch der Alkoholkonsum.
Ein öffentliches Rauchverbot in Deutschland könnte nicht nur zu weniger Rauchen führen, sondern auch den Alkoholkonsum verringern. Wie eine aktuelle Studie des RWI Essen zeigt, reduziert sich insbesondere bei Männern mit dem Tabak- auch der Alkoholkonsum. Zudem hat das Rauch- und Trinkverhalten der Eltern einen erkennbaren Einfluss auf das ihrer Kinder - je mehr die Eltern rauchen und trinken, desto mehr tut es auch der Nachwuchs. Würde in Deutschland ein öffentliches Rauchverbot eingeführt, könnte dies auch dazu führen, dass weniger Alkohol getrunken wird. Das lässt sich aus einer aktuellen Studie des RWI Essen ableiten. In ihr wurde untersucht, wie es sich auf den Alkoholkonsum auswirkt, wenn um ein bestimmtes Maß weniger geraucht wird. Dabei gab es keine Hinweise darauf, dass ein Weniger an Zigaretten durch ein Mehr an Alkohol ersetzt wird. Vielmehr reduzierte sich insbesondere bei Männern mit dem Tabak- auch der Alkoholkonsum.
Für die Untersuchung wurden Daten der bundesweiten "Repräsentativerhebung zum Gebrauch psychoaktiver Substanzen in Deutschland" des Münchner Instituts für Therapieforschung ausgewertet. Insgesamt flossen mehr als 25.000 Beobachtungen aus den Jahren 1980 bis 1992 in die Untersuchung ein. Dabei wurde erstmals ein Ansatz auf die Fragestellung angewendet, der nicht mit Preisen arbeitet, sondern mathematisch ein klinisches Experiment imitiert. Dies ist sinnvoll, weil innerhalb Deutschlands die Preise für Alkohol und Tabak im Untersuchungszeitraum nur wenig variierten, die Reaktion der Konsumenten auf Preisänderungen sich also nur schwer untersuchen lässt.
In die Auswertung einbezogen wurden unter anderem auch Geschlecht, Alter, Familienstand, Bildungsgrad der Eltern, Rauch- und Trinkgewohnheiten der Eltern sowie der soziale Hintergrund der Herkunftsfamilie der Befragten. Dabei zeigte sich, dass das Rauch- und Trinkverhalten der Eltern einen erkennbaren Einfluss auf die Konsumgewohnheiten ihrer Kinder hat - rauchen und trinken die Eltern viel, tun dies auch deren Kinder. Die Untersuchung zeigt auch, dass Männer und Frauen sich in ihren Rauch- und Trinkgewohnheiten unterscheiden. Frauen haben allgemein eine geringere Neigung zum Tabak- und Alkoholkonsum als Männer. Zudem gilt auch der Zusammenhang, dass weniger Rauchen zu weniger Trinken führt, für Frauen nur in sehr abgeschwächter Form.
Die (englischsprachige) Veröffentlichung der Studie ist als PDF-Datei (37 Seiten) verfügbar: RWI Discussion Paper: Tobacco and Alcohol: Complements or Substitutes
Gerd Marstedt, 24.11.2006
Gesunde Ernährung und gesunder Lebensstil sind zwei verschiedene Dinge
 Ein gesunder Ernährungsstil, der auf Ballaststoffe, Obst und Gemüse setzt und Fastfood verabscheut, so nahm man bislang an, ist zumeist auch eingebettet in andere "gesundheitsbewußte" Verhaltensweisen wie Sport und Bewegung, Alkohol- und Tabakverzicht. Eine neuere Studie, erstellt im Auftrag des Bundesministeriums für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft (BMVEL), hat nun gezeigt, dass dies keineswegs als durchgängige Regel gelten kann.
Ein gesunder Ernährungsstil, der auf Ballaststoffe, Obst und Gemüse setzt und Fastfood verabscheut, so nahm man bislang an, ist zumeist auch eingebettet in andere "gesundheitsbewußte" Verhaltensweisen wie Sport und Bewegung, Alkohol- und Tabakverzicht. Eine neuere Studie, erstellt im Auftrag des Bundesministeriums für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft (BMVEL), hat nun gezeigt, dass dies keineswegs als durchgängige Regel gelten kann.
Erkannt wurde im Rahmen einer repräsentativen Erhebung 2004, dass es sehr unterschiedliche Ernährungsstile gibt. Befragt wurden Personen ab 18 Jahren, die in einem eigenen Haushalt leben; die Größe der Stichprobe betrug 2.039 Personen. In die Typologie der Ernährungsstile flossen Orientierungen im Hinblick auf Ernährung und Gesundheit ein, sowie Orientierungen in Bezug auf Einkauf, Zubereitung und Mahlzeiten sowie auf ausgewählte Produkte und Produktqualitäten. In Bezug auf das Ernährungsverhalten wurden u.a. Gewohnheiten beim Einkauf, der Zubereitung und bei den Mahlzeiten erhoben. Außerdem wurde das Verhalten bezogen auf Außer-Haus-Verpflegung und Verzehr ausgewählter Produktgruppen sowie ernährungsbezogenes Informationsverhalten und Veränderungen der Ernährungsweise erfragt. Als Ergebnis zeigten sich sieben verschiedene Typen des Ernährungsverhaltens:
• Die desinteressierten Fast Fooder (12 %)
• Die Billig- und Fleisch-Esser (13 %)
• Die freudlosen Gewohnheitsköche und -köchinnen (17 %)
• Die fitnessorientierten Ambitionierten (9 %)
• Die gestressten Alltagsmanagerinnen (16 %)
• Die ernährungsbewussten Anspruchsvollen (13 %)
• Die konventionellen Gesundheitsorientierten (20 %)
Deutlich wurde weiterhin, dass Ernährungs- und Gesundheitsverhalten nicht notwendig miteinander übereinstimmen. Bei den ernährungsbewussten Anspruchsvollen hat Essen und Ernährung einen ganz zentralen Stellenwert im Lebensstil. Dies geht nicht unbedingt mit einer ausgeprägten Umwelt- und Naturorientierung einher, jedoch mit einer ganzheitlichen Gesundheitsorientierung. Bei den drei Ernährungsstilen desinteressierte Fast Fooder, Billig- und Fleisch-Esser und freudlose Gewohnheitsköche und -köchinnen, bei denen Essen und Ernährung einen sehr geringen Stellenwert im Lebensstil hat, sind weder Gesundheits- noch Umweltorientierungen ausgeprägt. Essen wird nicht mit Genuss, Sinnlichkeit und Freude verbunden, sondern pragmatisch-convenient bzw. routiniert-gewohnheitsmäßig abgewickelt.
Die Ergebnisse zeigen ferner, dass eine ausgeprägte Gesundheitsorientierung nicht automatisch eine Wertschätzung sowie den Verzehr von Bio-Lebensmittel im Rahmen des Ernährungsstils bedeutet. Im Gegenteil, bei den fitnessorientierten Ambitionierten und den gestressten Alltagsmanagerinnen zeigt sich eine ausgeprägte funktionale Gesundheitsorientierung bzw. eine deutliche Orientierung an Kindergesundheit. Bei beiden wird Functional Food selbstverständlich in den Ernährungsalltag integriert. Auffallend ist darüber hinaus, dass bei allen sieben Ernährungsstilen Natur- und Umweltorientierungen wenig ausgeprägt sind. Dies ist ein deutliches Indiz dafür, dass die Verbindung von Ernährung und Umwelt, aber auch Ernährung und Natur(schutz) bei der Entwicklung von Handlungsstrategien zur Verbesserung des Ernährungsverhaltens stärker berücksichtigt werden muss.
Ein Abstract der Studie ist hier zu finden: Ernährung und Lebensstile
Die komplette Studie von Doris Hayn und Irmgard Schulte ist hier als PDF-Datei: Ernährung und Lebensstile in der sozial-ökologischen Forschung - Einsichten in die motivationalen Hintergründe des alltäglichen Ernährungshandelns
Gerd Marstedt, 20.1.2006
Ernährung mit vielen Ballaststoffen ist kein Garant gegen Darmkrebs
 In vielen Broschüren und auf vielen Internetseiten zur Ernährungsberatung findet man diesen Tipp: Eine ballaststoffreiche Ernährung ist nicht nur gesund, sondern mindert auch das Risiko einer Darmkrebserkrankung. So heißt es zum Beispiel auf "medizin.de": "Durch welche Mechanismen können Ballaststoffe zur Krebsprävention beitragen? - Dr. Strunz: Beim Abbau von Ballaststoffen durch Darmbakterien entstehen unter anderem kurzkettige Fettsäuren, die ein protektives Potenzial auf die Darmzellen ausüben. Zum anderen wird durch die Ballaststoffe eine Erhöhung des Stuhlvolumens und eine erhöhte Passagezeit erreicht, die eine Verminderung der Kontaktzeit potentieller Karzinogene mit der Darmwand bewirken."
In vielen Broschüren und auf vielen Internetseiten zur Ernährungsberatung findet man diesen Tipp: Eine ballaststoffreiche Ernährung ist nicht nur gesund, sondern mindert auch das Risiko einer Darmkrebserkrankung. So heißt es zum Beispiel auf "medizin.de": "Durch welche Mechanismen können Ballaststoffe zur Krebsprävention beitragen? - Dr. Strunz: Beim Abbau von Ballaststoffen durch Darmbakterien entstehen unter anderem kurzkettige Fettsäuren, die ein protektives Potenzial auf die Darmzellen ausüben. Zum anderen wird durch die Ballaststoffe eine Erhöhung des Stuhlvolumens und eine erhöhte Passagezeit erreicht, die eine Verminderung der Kontaktzeit potentieller Karzinogene mit der Darmwand bewirken."
Eine neuere Studie hat jetzt jedoch aufgezeigt, dass dieser Ernährungstipp allein keine Sicherheit bietet. Daten aus rund 13 Längsschnittstudien mit einer Beobachtungsdauer zwischen 6 und 20 Jahren und insgesamt über 700.000 Teilnehmern wurden noch einmal neu aufbereitet. Zwar zeigt sich zunächst und bei einer ersten Betrachtung der Zusammenhänge auch ein deutlicher statistischer Zusammenhang zwischen ballaststoffreicher Ernährung (durch Getreide, Obst, Gemüse) und späteren Krebserkrankungen. Sobals jedoch auch andere Risikofaktoren in die Analyse einbezogen werden, wie z.B. Ernährungsgewohnheiten in Bezug auf rotes Fleisch, Milch oder Alkohol, sind solche Zusammenhänge nicht mehr nachweisbar. Im Kurztext heißt dies, dass Krankheitsrisiken auch im Rahmen der Ernährung von vielen Faktoren beeinflusst sind und nicht allein davon, ob jemand viele oder wenig Ballaststoffe zu sich nimmt.
Noch weiter geht die Interpretation der Ergebnisse durch Professor Hans Konrad Biesalski von der Deutschen Krebsgesellschaft. Seiner Meinung nach wird der Einfluß der Ernährung bei der Krebsprävention überbewertet. Entscheidend seien vielmehr ein gesunder Lebensstil mit viel Bewegung und ein normales Körpergewicht. Ein hoher Obst und Gemüsekonsum trage zu einem normalen Körpergewicht bei, so Biesalski in einem Interview mit der "Ärzte Zeitung" - der Rat, viel Obst und Gemüse zu essen, ist also nicht überholt.
Ein Abstract der Originalstudie ist hier: Dietary Fiber Intake and Risk of Colorectal Cancer
Gerd Marstedt, 19.1.2006
Neues Themenheft zur Gesundheitsberichterstattung: "Körperliche Aktivität"
 Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat ein neues Heft zum Thema "Körperliche Aktivität" in der Reihe "Gesundheitsberichterstattung des Bundes" herausgeben und zum Download bereit gestellt. Auf 26 Seiten wird der aktuelle Forschungsstand auf der Basis deutscher und internationaler Studien dargestellt. Für Deutschland liegen neuere Daten zugrunde, die auf dem telefonischen Gesundheitssurvey 2003 basieren.
Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat ein neues Heft zum Thema "Körperliche Aktivität" in der Reihe "Gesundheitsberichterstattung des Bundes" herausgeben und zum Download bereit gestellt. Auf 26 Seiten wird der aktuelle Forschungsstand auf der Basis deutscher und internationaler Studien dargestellt. Für Deutschland liegen neuere Daten zugrunde, die auf dem telefonischen Gesundheitssurvey 2003 basieren.
Berichtet wird beispielsweise
• über gesundheitliche Risiken körperlicher Inaktivität,
• über die Verbreitung von körperlicher und sportlicher Aktivität in Deutschland, auch differenziert nach Schichtzugehörigkeit, Alter und Geschlecht,
• über Häufigkeit und Dauer sportlicher Aktivitäten im europäischen Vergleich,
• über verfügbare Ressourcen in Deutschland (Sportstätten, Fitness-Studios).
In der Studie wird sehr nachdrücklich unterschieden zwischen "Sport" und "körperlicher Aktivität", die sehr viel umfassender ist und zum Beispiel auch Haus- und Berufsarbeit, Treppensteigen, Fahrradfahren oder Gartenarbeit umfasst. Unter Berücksichtigung dieser Unterscheidung zeigt sich dann, dass Deutsche im europäischen Vergleich körperlich überdurchschnittlich oft aktiv sind (Platz 2 hinter den Niederlanden), während sie gleichzeitig nur durchschnittlich oft Sport betreiben (Platz 9). Allerdings sind Spanier, Belgier und Italiener noch sportfauler als Deutsche.
Heft 26 des RKI "Körperliche Aktivität"
Gerd Marstedt, 28.8.2005
Ökonomische Folgen des Rauchens in den USA
 Der durch Rauchen verursachte Tod von Hunderttausenden von US-Bürgern führte im Zeitraum 1997-2001 zu einem Produktivitätsverlust von jährlich rund 92 Milliarden $. Fügt man die Ausgaben für die Behandlung von gesundheitlichen Folgen des Rauchens hinzu, steigt dieser Betrag auf 192 Mrd. $ pro Jahr. Dies sind zwei der ökonomischen Ergebnisse einer Studie des "Center for Disease Control and Prevention (CDC)". Hinzu kommt aber für lebenslange Raucher noch der Verlust von durchschnittlich 14 Lebensjahren was sich in jährlich rund 440.000 durch das Rauchen bedingten Todesfällen niederschlägt.
Der durch Rauchen verursachte Tod von Hunderttausenden von US-Bürgern führte im Zeitraum 1997-2001 zu einem Produktivitätsverlust von jährlich rund 92 Milliarden $. Fügt man die Ausgaben für die Behandlung von gesundheitlichen Folgen des Rauchens hinzu, steigt dieser Betrag auf 192 Mrd. $ pro Jahr. Dies sind zwei der ökonomischen Ergebnisse einer Studie des "Center for Disease Control and Prevention (CDC)". Hinzu kommt aber für lebenslange Raucher noch der Verlust von durchschnittlich 14 Lebensjahren was sich in jährlich rund 440.000 durch das Rauchen bedingten Todesfällen niederschlägt.
Ausführlichere Informationen über Ökonomische Verluste durch Rauchen
Bernard Braun, 26.7.2005