



Home | Patienten | Gesundheitssystem | International | GKV | Prävention | Epidemiologie | Websites | Meilensteine | Impressum
Sämtliche Rubriken in
"GKV"
Umfragen, Bevölkerungsmeinungen |
Alle Artikel aus:
GKV
Umfragen, Bevölkerungsmeinungen
Sieglein, Sieglein an der Wand - wer ist die beste Krankenkasse im Land oder welches Siegel darf's denn sein und wer liefert!?
 Mit einem beachtlichen, aber gut in den Verwaltungsausgaben versteckten Betrag lässt ein Großteil der 113 Anfang 2017 noch existierenden Gesetzlichen Krankenkassen jahraus, jahrein von einer Hand von Instituten und Experten erkunden, ob oder dass sie die beliebtesten, unbürokratischsten, versichertennächsten, zuverlässigsten, schnellsten oder sonstwie herausragendste Kasse sind - Hauptsache, es springt ein buntes Siegel heraus.
Mit einem beachtlichen, aber gut in den Verwaltungsausgaben versteckten Betrag lässt ein Großteil der 113 Anfang 2017 noch existierenden Gesetzlichen Krankenkassen jahraus, jahrein von einer Hand von Instituten und Experten erkunden, ob oder dass sie die beliebtesten, unbürokratischsten, versichertennächsten, zuverlässigsten, schnellsten oder sonstwie herausragendste Kasse sind - Hauptsache, es springt ein buntes Siegel heraus.
Da es somit kaum eine Kasse ohne mindestens ein Siegel zu was auch immer gibt, stellte sich schon immer die Frage wie die verschiedenen natürlich völlig unabhängigen Siegel-Verleiher und Rater dies schaffen.
Anlässlich einer aktuellen Pressemitteilung vom 29. Mai 2017 der Siemens Betriebskrankenkasse (SBK), die sich unter der Überschrift "Service- und Beratungsqualität zahlen sich aus" auf Basis einer "aktuellen Befragung des "Deutschen Instituts für Service-Qualität (DISQ)" zur "beliebtesten gesetzlichen Krankenkasse Deutschlands [sic]" erklärt, soll einmal ein kritischer Blick auf die Seriosität der Siegelverleiher und Glaubwürdigkeit der Siegelträger geworfen werden.
Im Falle der SBK hat DISQ eine Onlinebefragung der "Kunden" von 19 (!) gesetzlichen Krankenkassen mit Parametern wie Service, Leistungsangebot und Zuverlässigkeit, Weiterempfehlungsbereitschaft und Kundenärgernisse durchgeführt. Warum Ergebnisse von 94 anderen gesetzlichen Krankenkassen nicht erhoben oder nicht in die Berechnungen einflossen oder wer die 19 befragten Kassen sind und auf welchem Platz welche Kasse steht, wird in der Pressemitteilung nicht erwähnt - Hauptsache man wird die beliebteste Kasse Deutschlands.
Einen Teil der Antworten auf diese Fragen erhält man nur auf der Website des DISQ. Auf den weiteren Medaillenrängen liegen danach die Techniker Krankenkasse und die AOK Plus. Die Barmer liegt zum Vergleich schon deutlich abgeschlagen auf Platz 13.
Ganz anders sieht das Qualitätsrating des Deutsches Finanz-Service Instituts (DFSI) 2016/17 aus. Dafür wurden die Leistungsfähigkeit der untersuchten Kassen in den Bereichen Leistung, Kundenservice und Finanzkraft umfassend analysiert und bewertet und zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dies ist auch etwas ausführlicher beschrieben. Untersucht wurden aber auch vom DFSI nicht die Leistungsindikatoren aller 113 oder 115 Kassen, sondern die von 29. Auf den Medaillenrängen stehen von gold bis bronze die Techniker Krankenkasse, die Hanseatische Krankenkasse und die AOK Baden-Württemberg. Auf Platz 4 folgt in diesem Rating die AOK Plus und auf Platz 15 schließlich die Barmer. Die SBK sucht man hier vergebens.
Dafür, dass aber auch die Barmer in ihrer Eigenwerbung nicht darauf verzichten muss, sich zu den "besten gesetzlichen Krankenkassen Deutschlands" zählen zu können, sorgt eine wahre Flut von Siegeln und Siegerurkunden, geballt auf ihrer Mitglieder-Webseite dokumentiert. Da findet sich Exzellenz bei der "Leistung für junge Leute" und die Barmer ist die "TOP Krankenkasse für Familien" - alles Ratings des DFSI. Und wem dies noch nicht genügt, erfährt, dass die Barmer von Focus Money für "ausgezeichnete Leistungen" oder ihren "hervorragenden Service" topgeratet wird. Ein "Experten"team der Tageszeitung WELT, von nicht näher bezeichneten Mitarbeitern der Universität Frankfurt und von ServiceValue krönt die Barmer außerdem und unübertreffbar zum "goldenen Service-Champion 2016" und Focus Money adelt die Kasse schließlich noch zum "besten Ausbildungsbetrieb" 2017.
Bereits diese wenigen Vergleiche kassenindividueller Ratings zeigen eine Reihe offenkundiger methodischer Mängel, sogar auf den ersten Blick erkennbare Tricksereien u.a. bei der Sampleauswahl und undurchsichtige aber fast immer den Vermarktungsinteressen der Auftraggeber dienende Ergebnisse. Es gibt keinen Grund zu glauben, dass es bei den Siegeln etc. vieler anderer Kassen besser aussieht, d.h. GKV-Mitglieder durch sie für die Suche nach einer ihrem Bedarf entsprechenden gesetzlichen Krankenkasse wirklich seriös informiert werden. Verantwortlich dafür ist die unheilige Allianz von auftraggeberfrommen Marketingfirmen, anderen Kopflangern und nach Alleinstellungsmerkmalen im Wettbewerb gierenden Krankenkassenmanager.
Vielleicht sollten sich aber auch die auf das Marketing mit bunten Siegeln setzenden Kassen im Jahr der Sozialwahlen mal alternativ durch den Kopf gehen lassen, dass sie mit der damit verbundenen "Kunden"-Rhetorik den sozialen Status ihrer Mitglieder und Versicherten ignorieren, reduzieren und missachten. Ignoriert wird, dass die gesetzlichen Krankenkassen seit 134 Jahren bewusst keine von zahlungsfähigen Käufern oder Bestellern abhängigen Wirtschaftsunternehmen, sondern selbstverwaltete Körperschaften öffentlichen Rechts mit beitragszahlenden Pflicht- und freiwilligen Mitgliedern und Mitversicherten sind. Es sind also nicht nur "stake-", sondern auch "share-holder", die auch ohne die Bezeichnung als "Kunde" bei Kontakten zu ihrer Krankenkasse so behandelt werden sollten wie die Kunden von Karstadt, VW oder Alnatura. Die Übernahme und intensive Nutzung von privatwirtschaftlichen Marketinginstrumenten wie u.a. den Siegeln dient natürlich auch dazu, diese besondere soziale Konstellation in der GKV zu verschleiern. Nicht vorzustellen was passierte, wenn sich die Beitragszahler der GKV fragen würden, wem ihre Kassen eigentlich gehören.
Bernard Braun, 4.6.17
Welche Methode ist die Beste: Face-to-Face-Interview oder Fragebogenbefragung?
 Viele Studien über die Bewertung von Gesundheitssystemen, der Gesundheitspolitik und der gesundheitlichen Versorgung beruhen auf standardisierten Surveys bei für die gesamte Bevölkerung oder spezifische Gruppen repräsentativen Personen. Dabei stellt sich die Frage mit welchen Erhebungsmethoden valide und reliable Ergebnisse gewonnen werden können und von welcher Methode es besser wäre bei bestimmten Fragen die Finger zu lassen. Dabei werden oft standardisierte mündliche Erhebungen durch Interviewer (face-to-face interviews) als Goldstandard gepriesen, während schriftlich standardisierte Erhebungen mit einem persönlich auszufüllenden Fragebogen oft lediglich aus Kosten- oder Komfortgründen für akzeptabel gehalten werden.
Viele Studien über die Bewertung von Gesundheitssystemen, der Gesundheitspolitik und der gesundheitlichen Versorgung beruhen auf standardisierten Surveys bei für die gesamte Bevölkerung oder spezifische Gruppen repräsentativen Personen. Dabei stellt sich die Frage mit welchen Erhebungsmethoden valide und reliable Ergebnisse gewonnen werden können und von welcher Methode es besser wäre bei bestimmten Fragen die Finger zu lassen. Dabei werden oft standardisierte mündliche Erhebungen durch Interviewer (face-to-face interviews) als Goldstandard gepriesen, während schriftlich standardisierte Erhebungen mit einem persönlich auszufüllenden Fragebogen oft lediglich aus Kosten- oder Komfortgründen für akzeptabel gehalten werden.
Eine dänische WissenschaftlerInnengruppe hat nun durch den Vergleich der Antworten auf inhaltlich identische Fragen in einem 2010 durchgeführten "face-to-face"-Gesundheitssurvey" in Süd-Dänemark und in dem ebenfalls 2010 erhobenen "self-administered"-Danish Health and Morbidity Survey untersucht, welche Unterschiede es wirklich gibt. Das Besondere dieses Vergleichs war, dass den Ergebnissen auf individueller Ebene eine Reihe von administrativen Daten zugeordnet wurde und insofern "subjektive" durch "objektive" Daten überprüft werden konnten.
Die Ergebnisse sahen so aus:
• Während die Non-Responserate in der Fragebogenbefragung 37,9% betrug, lag sie bei mündlichen Befragungen bei 23,7%. In beiden Befragungstypen waren die wesentlichen Einflussraten auf die Nichtbeantwortung der Familienstand, der ethnische Hintergrund und der höchste Bildungsabschluss. Das Geschlecht und das Alter wirkten sich nur in der Fragebogenbefragung aus.
• Bei den Angaben zur Nutzung von Gesundheitsdiensten (z.B. die Rate der 3-Monats-Wiedereinweisung ins Krankenhaus) gab es keine signifikanten Unterschiede.
• Anders sah es bei den Angaben zur selbst wahrgenommenen gesundheitsbezogenen Lebensqualität, zum Gesundheitsverhalten, zu sozialen Beziehungen und zur Morbidität mit langanhaltenden Erkrankungen aus. Je nach Indikator gab es signifikante Unterschiede zugunsten von Interview- (z.B. mehr Lebensqualität, mehr Übergewicht und Rauchen und langandauernde Morbidität) oder Fragebogen- (z.B. bessere soziale Beziehungen)Befragten. In face-to-face-Befragungen stellen die Befragten häufig ihren Gesundheitszustand positiver dar als in Fragebögen, sind aber was ihr Gesundheitsverhalten angeht, "ehrlicher" als Fragebogenbeantworter. Sicherlich spielt hier die äußerliche Erkennbarkeit bestimmter Verhaltensweisen eine Rolle.
Wegen der teilweise gegenläufigen Methodenwirkungen empfehlen die Autoren, bei mehrmaligen Erhebungen bei einer Methode zu bleiben und bei der Auswahl der Methodik nicht nur die Kriterien Kosten und Effizienz anzuwenden.
Der Aufsatz Effect of survey mode on response patterns: comparison of face-to-face and self-administered modes in health surveys von Anne Illemann Christensen et al. ist 2014 in der Zeitschrift "European Journal of Public Health" (Vol. 24, No. 2) erschienen´. Das Abstract ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 5.4.14
"Hoch zufrieden" und als hilfreich geschätzt, nur womit und wofür? Mammografie-PR statt Argumente für informierte Teilnahme
 Folgt man den Ausführungen der Parlamentarischen Staatssekretärin im Bundesgesundheitsministerium, Annette Widmann-Mauz, zeigt eine von ihr am 18. Februar 2013 mit vorgestellte und vom Ministerium geförderte Studie eine "hohe Zufriedenheit der Frauen mit dem Mammographie-Screening. Die Ergebnisse zeigen, dass organisierte Krebsfrüherkennungsprogramme von den Menschen in Deutschland angenommen werden." Und weil alles so gut und wegweisend zu sein scheint, fährt sie fort: "Daher werden mit dem Krebsfrüherkennungs- und -registergesetz vergleichbare Programme für die Früherkennung des Gebärmutterhalskrebses und des Darmkrebses eingeführt." Was sie dabei immerhin auch für wichtig hält, ist, dass "die Menschen fundiert über die Vor- und Nachteile der jeweiligen Krebsfrüherkennungsuntersuchung informiert werden (müssen)."
Folgt man den Ausführungen der Parlamentarischen Staatssekretärin im Bundesgesundheitsministerium, Annette Widmann-Mauz, zeigt eine von ihr am 18. Februar 2013 mit vorgestellte und vom Ministerium geförderte Studie eine "hohe Zufriedenheit der Frauen mit dem Mammographie-Screening. Die Ergebnisse zeigen, dass organisierte Krebsfrüherkennungsprogramme von den Menschen in Deutschland angenommen werden." Und weil alles so gut und wegweisend zu sein scheint, fährt sie fort: "Daher werden mit dem Krebsfrüherkennungs- und -registergesetz vergleichbare Programme für die Früherkennung des Gebärmutterhalskrebses und des Darmkrebses eingeführt." Was sie dabei immerhin auch für wichtig hält, ist, dass "die Menschen fundiert über die Vor- und Nachteile der jeweiligen Krebsfrüherkennungsuntersuchung informiert werden (müssen)."
Und auf den ersten Blick sind die Ergebnisse der 2012 durchgeführten Follow-up-Befragung von 4.663 aus 13.517 ursprünglich angeschriebenen Frauen im Alter von 50 bis 69 (Rücklaufquote von 34,9%), denen das Mammografiescreening in Deutschland zumindest dem Namen nach bekannt war, und darunter 3.811, die mindestens schon einmal an dem Mammografiescreening teilgenommen haben, auch beeindruckend:
• Von den 3.811 Befragten, die bereits ein oder mehrere Male an einem Mammografie-Screening teilgenommen haben, "wird das qualitätsgesicherte Mammographie-Screening Programm überwiegend positiv beurteilt. Die Aspekte Termintreue (95,7%), Hygiene (95,1%), Kompetenz (92,7%) und Freundlichkeit (91,6%) des Personals sowie die Modernität der Geräte (90,2%) werden von fast allen teilnehmenden Frauen als positiv wahrgenommen." Bemerkenswert ist, dass sich unter den von einer großen Mehrheit positiv bewerteten Faktoren keiner aus dem harten Kern von gesundheitlichem Nutzen oder Qualität befindet.
• Rund 94 Prozent der eingeladenen Teilnehmerinnen würden erneut am Screening teilnehmen.
• Fast 95 Prozent würden Freundinnen und Bekannten das Mammographie-Screening weiterempfehlen.
Zu den Schattenseiten des Programms liefert diese Studie aber auch wichtige Ergebnisse, die jedoch leicht und (un)beabsichtigt hinter der Schlagzeilen-Zufriedenheit verschwinden.
Bereits allgemein macht die Beobachtung nachdenklich, dass sich an vielen der seit der ersten vergleichbaren Befragung im Jahr 2008 bekannten Schwachstellen trotz zahlreicher öffentlicher und kontroverser Debatten und Aufklärungskampagnen "nur geringe Veränderungen" ergeben haben.
Dabei handelt es sich um z. B. um "Wissensdefizite …, die (sich) insbesondere auf den Zusammenhang zwischen Lebensalter und Brustkrebsrisiko sowie auf eine überhöhte Erwartungshaltung an den Nutzen des Mammographie-Screening Programms im Sinne eines größtmöglichen Schutzes vor und einer Verhinderung von Brustkrebs (beziehen). Weiterer Informationsbedarf besteht vor allem hinsichtlich der Themen Sicherheit des Befundes, gesundheitliche Risiken, Unterschied zur bisherigen Mammographie und Verwendung der persönlichen Daten." Insgesamt existiert eine "Überschätzung des Nutzens" der Untersuchung.
Konkret listet die Studie dazu Folgendes auf: "Vor allem die Teilnehmerinnen neigen zu einer Überschätzung des Nutzens und gehen (fälschlicherweise - Anmerkung bb) davon aus, dass das Mammographie-Screening Brustkrebs verhindern kann (57,1%) und größtmöglichen Schutz vor Brustkrebs bietet (73,5%). Dahingegen weisen die Nicht-Teilnehmerinnen eine rationalere Einschätzung auf: nur 33,0% glauben, dass Brustkrebs durch das Screening Programm verhindert werden kann und 42,5% erwarten sich größtmöglichen Schutz durch die Teilnahme am Screening-Programm. Beide Substichproben sind skeptisch im Hinblick auf die Weiterverwendung ihrer Daten (Teilnehmerinnen: 25,5%, Nicht-Teilnehmerinnen: 31,1%) und die Möglichkeit, mit Hilfe des Screenings alle Brustkrebsarten erkennen zu können (Teilnehmerinnen: 22,5%, Nicht-Teilnehmerinnen: 31,9%)."
Trotz des offiziellen, allerdings nach Meinung von KritikerInnen zu uneingeschränkt positiven und affirmativen Einladungsschreibens fanden die StudienautorInnen zahlreiche Informationslücken und -bedürfnisse bei den potenziellen TeilnehmerInnen: "Die Teilnehmerinnen sind vor allem auf der Suche nach Informationen, die ihnen eine Rückbestätigung für ihr eigenes Verhalten liefern. Sie geben an, mehr Informationen über die Sicherheit des Befundes (67,7%), gesundheitliche Risiken (60,9%) und die Verwendung der persönlichen Daten (41,7%) haben zu wollen. Die Nicht-Teilnehmerinnen hingegen interessieren sich für Argumente, die für eine Teilnahme am Mammographie-Screening sprechen, wie die Sicherheit des Befundes (63,4%), den Unterschied zur bisherigen Mammographie (62,0%), den persönlichen Nutzen einer Teilnahme (21,3%) sowie für Informationen zum Ablauf des Screenings (16,6%)."
Angesichts der immer noch zu niedrigen Beteiligungsrate von 56% am Mammografiescreening (um wissenschaftlich belastbare Aussagen zum Nutzen des Screenings machen zu können, müssen sich nach den eigenen Kriterien der Organisatoren mindestens 70% der anspruchsberechtigten Frauen am Screening beteiligen) stellt sich u.a. die Frage, welche Einstellung die Nicht-Beteiligten zum Mammografiescreening haben.
Wie die Studie zeigt, unterscheiden sich die beiden Gruppen beträchtlich. Die Frauen, die sich an der Befragung nicht beteiligen, betrachten "die "Teilnahme an Vorsorge- und Früherkennungsmaßnahmen eher als Belastung. Die Nicht-Teilnehmerinnen haben eine negativere Einstellung zum qualitätsgesicherten Mammographie-Screening Programm und nehmen die Inhibitoren für eine Teilnahme wie Risiken und das Gefühl der Bevormundung deutlich eher wahr als die Teilnehmerinnen. Darüber hinaus sind Verdrängung und Angst bei den Nicht-Teilnehmerinnen weitere Faktoren, die eine Teilnahme am Mammographie-Screening verhindern. Innerhalb der Gruppe der Nicht-Teilnehmerinnen hat ein deutlich geringerer Anteil der Frauen mit einem Arzt über das Mammographie-Screening Programm gesprochen. Diejenigen, bei denen das Thema im Arztgespräch diskutiert wurde, haben signifikant häufiger eine neutrale Reaktion des Arztes erfahren als die Teilnehmerinnen. Im Vergleich der beiden Erhebungswellen zeigt sich, dass die kritische Haltung der eingeladenen Nicht-Teilnehmerinnen deutlich zugenommen hat, so dass eine Manifestierung der negativen Einstellung anzunehmen ist. Dies spiegelt sich auch in der Abnahme der Bereitschaft zur Teilnahme bei erneuter Einladung und der sinkenden Wahrscheinlichkeit der Weiterempfehlung einer Teilnahme wider."
Ein weiterer interessanter Teil der Studie beschäftigt sich schließlich auch noch damit, ob und wie stark die Befragten den fünf anerkannten Einstellungstypen Befürworterinnen (Anteil: 33,7%), Risikobewusste (26,0%), Ambivalente (26,3%), Verdrängerinnen (7,5%) und Ablehnerinnen (6,6%) zuzuordnen sind und wie sich diese Gruppen voneinander unterscheiden.
Mustergültig ist schließlich die Dokumentation des Fragebogens im Anhang des Berichts.
Der bereits auf den 22. Oktober 2012 datierte aber erst am 18. Februar veröffentlichte 70-seitige wissenschaftliche Bericht "Inanspruchnahme des qualitätsgesicherten Mammographie-Screenings - Follow-Up Studie 2012" von den Koordinatorinnen Hilde Schulte,Irmgard Nass-Griegoleit sowie den WissenschaftlerInnen Ute-Susann Albert und Sabine Fischbeck, kann kostenlos über die Website des BMG heruntergeladen werden.
Bernard Braun, 19.2.13
Gesundheitspolitik und Sterben - Sterben zwar kein Tabu mehr, aber Wissens- und Zugangshürden vor Hospiz- und Palliativleistungen.
 Auch wenn viele kurativen oder gar präventiven Angebote im Gesundheitswesen den Eindruck erwecken, mit ihrem Erwerb sei die Möglichkeit eines immer besseren und längeren Lebens verbunden, sterben die meisten Menschen immer noch deutlich vor der 90- oder 100-Jahregrenze. Und die Ergebnisse einer gezielten Frage nach dem gewünschten Lebens-/Sterbealter (siehe dazu ausführlich "Was wir in unsere Gesundheit investieren und mit welchen Motiven wir es tun." von Klaus Koch und Andreas Waltering im Gesundheitsmonitor Newsletter 1/2012) im Rahmen der bevölkerungsrepräsentativen Gesundheitsmonitor-Befragung 2011 zeigten, dass dies auch den subjektiven Erwartungen oder Zielwerten in der Bevölkerung entspricht. So gaben 44% der Befragten an, mindestens 80 Jahre alt zu werden. 23% wollten mindestens 90 Jahre alt werden, 8% mindestens 100. 16% war das Sterbealter egal oder sie wussten nicht, für was sie sich entscheiden sollten. Zu den interessanten Unterschieden der Erwartungen des Sterbealters gehörte, dass mehr Männer als Frauen mindestens 90 Jahre alt werden. Und von den Rauchern wollten nur 13 % mindestens 90 werden, während es unter den Nichtrauchern immerhin 25% wollten. Als eine zum Teil weit von der Wirklichkeit entfernte weitere Erwartung der Bevölkerung ans Sterben gehört seit außerdem schon immer, dass die Mehrheit von ihr zu Hause sterben möchte.
Auch wenn viele kurativen oder gar präventiven Angebote im Gesundheitswesen den Eindruck erwecken, mit ihrem Erwerb sei die Möglichkeit eines immer besseren und längeren Lebens verbunden, sterben die meisten Menschen immer noch deutlich vor der 90- oder 100-Jahregrenze. Und die Ergebnisse einer gezielten Frage nach dem gewünschten Lebens-/Sterbealter (siehe dazu ausführlich "Was wir in unsere Gesundheit investieren und mit welchen Motiven wir es tun." von Klaus Koch und Andreas Waltering im Gesundheitsmonitor Newsletter 1/2012) im Rahmen der bevölkerungsrepräsentativen Gesundheitsmonitor-Befragung 2011 zeigten, dass dies auch den subjektiven Erwartungen oder Zielwerten in der Bevölkerung entspricht. So gaben 44% der Befragten an, mindestens 80 Jahre alt zu werden. 23% wollten mindestens 90 Jahre alt werden, 8% mindestens 100. 16% war das Sterbealter egal oder sie wussten nicht, für was sie sich entscheiden sollten. Zu den interessanten Unterschieden der Erwartungen des Sterbealters gehörte, dass mehr Männer als Frauen mindestens 90 Jahre alt werden. Und von den Rauchern wollten nur 13 % mindestens 90 werden, während es unter den Nichtrauchern immerhin 25% wollten. Als eine zum Teil weit von der Wirklichkeit entfernte weitere Erwartung der Bevölkerung ans Sterben gehört seit außerdem schon immer, dass die Mehrheit von ihr zu Hause sterben möchte.
Trotzdem erscheint Sterben immer noch tabulisiert zu sein oder wird, wenn es ein öffentliches Thema ist, ein massenmedial inszenziertes und zelebriertes Großereignis. Wie aktuell die Einstellungen und Erwartungen zum Sterben jenseits von Großereignissen in der Bevölkerung aussehen, wollte nun der "Deutsche Hospiz- und PalliativVerband" im dreißigsten Jahr seines Bestehens etwas genauer wissen. In seinem Auftrag befragte dazu die Forschungsgruppe Wahlen Telefonfeld in Auftrag zwischen dem 25. und 28. Juni 2012 1044 Deutsche ab 18 Jahren.
Die Hauptergebnisse der im August 2012 der Öffentlichkeit vorgestellten Studie lauteten:
• 58 % der Befragten geben an, dass sich die Gesellschaft mit dem Thema Sterben und Tod zu wenig befasst.
• 66 % der Befragten wollen zuhause sterben. Zur Wirklichkeit gibt die aktuelle Studie aber an: "Abhängig von dem regional jeweils unterschiedlichen Stand des Ausbaus der Versorgungsstrukturen sterben - so Daten aus anderen Erhebungen - in der Regel die meisten Menschen (über 40 %) nach wie vor im Krankenhaus, rund 30 % in der stationären Pflegeeinrichtung und etwa 25 % zuhause."
• 89 % der Befragten geben an, vom Begriff Hospiz gehört zu haben und 66 % können den Begriff richtig einordnen. Anders sieht es aber beim Begriff palliativ aus. 89 %, die bereits vom Begriff Hospiz gehört haben, stehen nur 49 % gegenüber, die vom Begriff palliativ gehört haben. Und während 66 % den Begriff Hospiz richtig zuordnen konnten, sind es im Vergleich dazu bei dem Begriff palliativ nur 32 %.
• Der Mehrheit der Bevölkerung war trotz den seit Jahren geltenden gesetzlichen Vorschriften aber unbekannt, dass die Versorgung in einem Hospiz oder eine Hospizbegleitung zuhause kostenlos ist: Nur 11 % der Befragten waren darüber informiert.So gibt es seit 1997 mit dem § 39a SGB V stationäre und ambulante Hospizleistungen als GKV-Leistung und seit 2007 mit dem § 132d SGB V das Recht auf die Leistung einer spezialisierten ambulanten Palliativversorgung. Trotz aller Bekanntheit stellen solche Wissensdefizite mit Sicherheit massive Barrieren für die Inanspruchnahme der entsprechenden Leistungen dar.
• Menschen fühlen sich von der Gesellschaft getragen und aufgehoben, auch wenn sie krank sind. 90 % der Befragten und immerhin 76 % der allein lebenden Menschen haben geantwortet, dass sich jemand aus ihrer Familie, ihrem Freundeskreis oder aus der Nachbarschaft um sie kümmert, wenn sie krank sind. 72 % aller Befragten sowie 66 % der 60-jährigen und älteren Befragten gehen davon aus, dass sich jemand aus Familie, Freundeskreis oder Nachbarschaft um sie kümmern wird, wenn Pflegebedürftigkeit vorliegt. Auch wenn damit die verbreitete Vorstellung, Pflegebedürftige würden relativ häufig ins Heim abgeschoben, deutlich relativiert wird, sehen sich immerhin zwischen 25% und 33% der Befragten je nach Lebenssituation ohne Unterstützung aus ihrem unmittelbaren sozialen Netzwerk.
• 72 % der Befragten schätzen die Schmerztherapie eines ihnen nahe stehenden Menschen zu Hause als gut ein; im Vergleich dazu haben aber nur 49 % der Befragten die Schmerztherapie im Krankenhaus als gut wahrgenommen, als ein ihnen nahestehender Mensch an starken Schmerzen litt und dort betreut wurde.
• Das Abfassen einer Patientenverfügung ist wichtiges Thema in der Bevölkerung: 26 % der Befragten haben eine Patientenverfügung verfasst, 43 % haben schon einmal ernsthaft darüber nachgedacht.
• Die Befragten würden sich am häufigsten (33 % bzw. 21 %) bei der Suche nach einem Platz in einer Palliativeinrichtung bzw. Hospizeinrichtung an ihre Hausärztin / ihren Hausarzt wenden. Ob dies wirklich den Zugang zu diesen Leistungen gewährleistet ist solange nicht klar, wie auch unter Hausärzten falsche oder unvollständige Kenntnisse über die Hospiz- und Palliativleistungen existieren.
Die "Ergebnisse einer repräsentativen Bevölkerungsbefragung zum Thema "Sterben in Deutschland - Wissen und Einstellungen zum Sterben". Sterben und Tod kein Tabu mehr - Die Bevölkerung fordert eine intensivere Auseinandersetzung mit diesen Themen" sind kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 20.8.12
Windchill-Effekt auch bei der Bürokratie wirksam
 Nun haben wir es endlich schwarz auf weiß: Die gefühlte Bürokratie-Belastung niedergelassener ÄrztInnen in Deutschland ist hoch, sehr hoch sogar, und allemal zu hoch. Das ist das einzige verwertbare Ergebnis einer im Dezember 2011 mit großem Brimborium lancierten Untersuchung "Deutsches Gesundheitssystem auf dem Prüfstand. Kostenfalle Komplexität" der Unternehmensberatungsfirma A.T. Kearney.
Nun haben wir es endlich schwarz auf weiß: Die gefühlte Bürokratie-Belastung niedergelassener ÄrztInnen in Deutschland ist hoch, sehr hoch sogar, und allemal zu hoch. Das ist das einzige verwertbare Ergebnis einer im Dezember 2011 mit großem Brimborium lancierten Untersuchung "Deutsches Gesundheitssystem auf dem Prüfstand. Kostenfalle Komplexität" der Unternehmensberatungsfirma A.T. Kearney.
Die einschlägige Presse griff die Botschaften der Unternehmensberater dankbar auf. Der Spiegel titelt am 31. Dezember Im Gesundheitssystem versickern Milliarden und legt am 2. Januar mit Bürokratie treibt Kosten nach. Die Welt übernimmt ebenfalls am Silvestertag in ihrem Beitrag Bürokratie macht Viertel der Gesundheitskosten aus unreflektiert die Aussagen der Unternehmensberater-Agentur, und das Handelsblatt zieht den überraschenden Schluss Gesundheitswesen kostet mehr als gedacht, der sich nur daraus erklären lässt, dass mensch entweder vorher falsch gedacht hat oder die von A.T. Kearney angeführten Zahlen glaubt, die beiden Gesamtausgaben interessanterweise etwa 25 Milliarden über denen des Gesundheitsministerium liegen. Die Ärztezeitung widmet sich dem Thema erstmalig zum Neujahrstag mit ihrem Beitrag Lebt das Bürokratie-Monster in der GKV? und legte am 5. Januar in Bürokratie im Orkus nach, wo auch Bundesärztekammerpräsident Montgomery die Möglichkeit zu einer überflüssigen Stellungnahme im Dienste der Standesorganisationen und -vertreterInnen erhält: "Wir begrüßen es außerordentlich, dass einmal mehr auf die absoluten Missstände der Bürokratisierung des Gesundheitswesens hingewiesen wird".
Was war geschehen? Was war der Grund für einen derartigen Presserummel? Eigentlich nichts, außer vielleicht ein wenig heiße Luft. Eine Unternehmensberatungsfirma, die bisher nicht im Verdacht steht, über nennenswerte Expertise im Bereich Gesundheit zu verfügen, hatte im Auftrag einer ganz bestimmten Gruppe niedergelassener ÄrztInnen eine Umfrage gestartet, um herauszufinden, wie viel bürokratischen Aufwand die Leistungserbringer im deutschen Gesundheitswesen zu bewältigen haben bzw. zu bewältigen haben fühlen. Zwischen Juni und August 2011 führte A.T. Kearney mit Unterstützung des Online-Portals facharzt.de des Ärztenachrichtendienste eine deutschlandweite Umfrage unter 6.000 LeistungserbringerInnen durch, die in unmittelbarem Kontakt mit PatientInnen stehen. Zur Validierung der Befragungsergebnisse erfolgten "vertiefende Arbeitsverteilungsanalysen" und die pekuniäre Quantifizierung des Verwaltungsaufwandes.
Nach den Berechnungen von A.T. Kearney hätten 2010 die Gesamtausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland einschließlich der Patientenzuzahlungen insgesamt 181 Milliarden Euro betragen; nach Abzug der GKV-Nettoverwaltungskosten und sonstiger Ausgaben seien nach Angabe von A.T. Kearney 165, aber unter Einbeziehung der im Übrigen mit nicht unerheblichem Verwaltungsaufwand behafteten Selbstbeteiligungen 170 Milliarden Euro angefallen. Das von A.T. Kearney ermittelte Datenmaterial habe zusätzlich ergeben, dass abweichend von offiziellen Zahlen über die genannten" 9,5 Milliarden Euro Verwaltungsausgaben der Krankenkassen hinaus "durch die GKV verursachte Verwaltungsaufwände bei den Leistungserbringern" entstünden und insgesamt von einem Gesamtverwaltungskostenaufwand von 40,4 Milliarden Euro auszugehen sei. Denn der Anteil des GKV-induzierten Verwaltungsaufwands auf Seiten der Leistungserbringer belaufe sich auf insgesamt 18 Milliarden Euro.
Nach Selbsteinschätzungen der von A.T. Kearney befragten Leistungserbringer könnte man mindestens 50 % ihrer durch die gesetzlichen Krankenkassen induzierten Verwaltungsaufwände und -kosten durch eine "gezielte Verschlankung des Gesundheitssystems" einsparen. Bezogen auf die zuvor durch A.T. Kearney ermittelten gesamten "GKV-induzierten Verwaltungskosten" kam das Beratungsunternehmen auf ein effektives "Kostenreduktionspotenzial" von 13 Milliarden Euro alleine für 2010. Schuld an all der gefühlten Verschwendung sind die so genannten "Komplexitätstreiber" im Gesundheitswesen, was immer das sein mag.
Die "Studie" von A.T. Kearney beglückt das geneigte Publikum und überrascht die Fachleute schließlich mit "Optimierungsvorschlägen", die so neu sind wie die Gesetzliche Krankenversicherung in Deutschland, so phantasievoll wie man es eben von primär betriebswirtschaftlich denkenden BeraterInnen erwarten kann, so praxisrelevant wie die Steinzeitmedizin oder so unklar wie die Weltformel:
•Anzahl der Akteure: Reduzierung der Anzahl gesetzlicher Krankenkassen und Kassenärztlicher Vereinigungen
•Anzahl der Produkte und Dienstleistungen: Zweckmäßige Reduzierung der Anzahl von Produkten
•Nicht aufeinander abgestimmte Prozesse: Zielgenaue Verwaltung und Begleitung von Prozessen
•Mangelhafte Organisationsstrukturen: Verschlankung von Kommunikationsprozessen
Unterschiedlichste IT-Systeme: Vereinheitlichung im Rahmen gesetzlicher Maßgaben
•Indirekte Kommunikation zwischen den Akteuren: Einführung direkter, verbindlicher Kommunikationsabläufe
•Erhöhte Patientenanforderungen durch erhöhtes Alter und Lebensumstände: Abwägung individuelle Zuwendungsmedizin vs. Standardmedizin
•Reduzierung formalistischer Betrachtungsweisen der Wissenschaft
•Beeinflussung der Gesetzgebung durch Lobby- und Interessengruppen: Dezentralisierung des Gesundheitssystems und Förderung von Interessenskongruenz
•Ständig wechselnde Reformen und Gesetze: Reduzierung von "quick-fixes" und Förderung nachhaltiger Veränderung.
Spätestens diese Aufzählung von Lösungsvorschlägen zeigt eindrücklich, dass die vermeintlichen Fachleute von A.T. Kearney weder etwas von Gesundheitsversorgung noch von Gesundheitspolitik verstehen. Ihre Vorstellungen von Organisation des Gesundheitswesens sind ausgesprochen naiv. Klaus Jacobs vom Wissenschaftlichen Institut der AOK bezweifelt zwar nicht, dass es Potenzial zur Verringerung des Bürokratieaufwands gibt, weist aber darauf hin, dies sei keineswegs allein ein Problem in der GKV, sondern auch in der PKV. Darüber hinaus schaffe die von A.T. Kearney geforderte Transparenz wiederum neue bürokratische Anforderungen. In einem nur für Abonnenten dieses Forums zugänglichen Interview mit dem ärztlichen Nachrichtendienst änd ergänzt er: "Wir sollten außerdem erst einmal fragen, worüber genau wir hier sprechen. Verwaltung hört sich immer gleich so negativ an. Warum sagen wir nicht Versorgungskoordination? Oder besser noch: Management? Letztendlich handelt es sich häufig auch um Maßnahmen, die Transparenz herstellen sollen, wie sie ja in der Studie auch vermehrt gefordert wird". Für jedermann einsehbar ist allerdings die weitaus differenziertere und inhaltsreichere Stellungnahme von Klaus Jacobs im Reformblock; der Beitrag Bürokratiekosten-Studie voller ordnungspolitischem Unverständnis ist ausgesprochen empfehlenswert.
Wirtschafts- und Gesundheitsredakteur Andreas Mihm zeigt in seinem leider für Nicht-Abonnenten nicht kostenfrei erhältlichen Artikel Der Complexity Funnel der Krankenversicherung in der FAZ mühelos ein paar intrinsische Widersprüche der Empfehlungen auf: "Doch die Rezepte der Berater für eine Schlankheitskur fallen mager aus. Sie bestehen aus viel einerseits und andererseits. So soll die Zahl der Kassen weiter sinken, doch dürften "wünschenswerte Elemente des Wettbewerbs" nicht außer Kraft gesetzt werden. Einerseits sollen medizinische Produkte und Dienstleistungen begrenzt werden, aber ohne dem Patienten die erste Entscheidung darüber zu nehmen, "welchen Bedarf er zu seiner Gesundheitsversorgung für wünschenswert hält". Kommunikationsstrukturen und IT-Systeme sollten einerseits vereinheitlicht werden, doch werde andererseits "eine schrankenlose Vernetzung von Datenbänken ... auf weite Sicht realistisch nicht durchzusetzen sein"."
Und der Essener Gesundheitsökonom Jürgen Wasem bemängelte, die A.T. Kearney-Analyse basiere gar nicht auf offiziellen Zahlen und sei allein deshalb nicht mit anderen Untersuchungen vergleichbar. Auch sei die Methodik der Verwaltungskostenzurechnung auf die GKV problematisch, denn Versorgung organisierende oder Qualität sichernde Maßnahmen seien eben kein vermeidbarer Mehraufwand. Zudem spricht er der Analyse jegliche Repräsentativität ab, da die TeilnehmerInnen ganz überwiegend selbstrekrutiert sind und man überhaupt nicht nachvollziehen könne, inwieweit die Stichprobe das Gesundheitswesen abbildet.
Wie selektiv und tendenziös die Erhebung des gefühlten Bürokratieaufwands einzelner Leistungserbringer ist, davon vermittelt der Beitrag eines fleißigen Hippokranet-Nutzers im Online-Portal facharzt.de einen viel sagenden Einblick. Denn er erklärt, was die an der Umfrage beteiligten Niedergelassenen üblicherweise alles unter "Bürokratie" verstanden haben dürften: "Informationsbeschaffung elektronische Gesundheitskarte, Aussortieren der "Ambulanten Kodierrichtlinien" und Weiterleitung in die Rundablage, Beantwortung von Kassenanfragen, Ausfüllen von Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen, Teilnahme an EBM-Fortbildungsveranstaltungen (um endlich einmal zu verstehen wie sich RLV und QZV errechnen), Studium der neusten Richtlinien zur Ausfüllung von Heilmittelanträgen (72 Seiten), Bearbeitung des letzten Widerspruchs zum Arzneimittelregress, Telefonat mit dem Rechtsanwalt in derselben Angelegenheit, Beantwortung von Anfragen der Ärztekammer, Studium der neusten sieben DMP-Verträge und der Verträge für eine mögliche überörtliche Berufsausübungsgemeinschaft, Ausarbeitung der TOP für die nächste Sitzung des Qualitätszirkels, Studium der reichhaltigen Fortbildungsangebote in verschiedenen Ärztezeitschriften und Erstellung eines persönlichen Fortbildungsprogramms, Beantwortung diverser Anfragen des Versorgungsamts (seit mehr als zwanzig Jahren unverändert für ein mieses Honorar von 20 Euro), dann die tägliche Papierflut aus Wiederholungsrezepten, Hilfsmittelverordnungen, Krankenhauseinweisungen, Krankentransportscheinen, Verlängerungen für häusliche Krankenpflege, Anträge auf Kostenübernahme, Ärztliche Bescheinigungen für alles Mögliche…" Dieser kleine Überblick zeigt nicht nur die ganze Unschärfe der Untersuchung von A. T. Kearney, sondern umfasst auch etliche Tätigkeiten, die - ob man sie mag oder nicht -typischerweise von MedizinerInnen zu erbringen sind, wie das Erstellen von Gutachten, Rezeptausstellungen, Krankenhauseinweisungen und die eigene Fortbildung. Das würde spätestens dann sichtbar, wenn plötzlich andere Berufsgruppen diese ur-ärztlichen Tätigkeiten übernehmen sollten: Spätestens wenn medizinische Fachangestellte PatientInnen ins Krankenhaus einweisen oder Rezepte ausstellen dürften, käme es zu einem ähnlichen Proteststurm wie bei der Diskussion über die Verlagerung ärztlicher Tätigkeit auf OperationstechnikerInnen oder Gemeindepflegekräfte.
Eine andere Meinungsäußerung im Hippokranet-Forum spiegelt - vermutlich unbewusst - das Dilemma wider: "Hier ist es beeindruckend gelungen, mit einer überzeugend angelegte Studie das Vorfeld so vorzubereiten, dass das Meinungsbild offensichtlich länger anhaltend mitbestimmt. Die Lehre ergibt sich für die Zukunft, dass auch im polit. Bereich auf sensiblen Streitfeldern der sozial- und wirtschaftswissenschaftliche Standard auf seiten der Ärzteschaft angehoben werden muss, will man denn Einfluss der GKV-Verwaltungsdominanz zurückdrängen." Nur der unzureichende " sozial- und wirtschaftswissenschaftliche Standard auf seiten der Ärzteschaft" erklärt, wie man angesichts dieser inhaltlich bedenklichen, argumentativ mehr als dünnen und auffällig im Sinne der InitiatorInnen ausgefallenen "Studie" von "beeindruckend" und "überzeugt angelegt" sprechen und von einer nachhaltigen Beeinflussung der öffentlichen Meinung ausgehen kann.
Bei der nahezu uneingeschränkten Zustimmung zu den Ergebnissen der A.T. Kearny-Publikation zur gefühlten Bürokratie-Belastung überrascht, dass die Nutzer der Online-Plattform kein Wort zu der Unbeschlagenheit der engagierten Unternehmensberatung auf dem Gebiet des Gesundheitswesens verlieren. In einem Forum selbsternannter Fachleute von der ambulanten Versorgungsfront, deren Wortführer ansonsten hemmungslos jede vom Mainstream abweichende Äußerung aggressiv verbal niederknüppeln und vor allem deren Urhebern sowie allen anders Denkenden jegliche gesundheitsbezogene Kompetenz und jeden "Realitätsbezug" absprechen, ist das mehr als verwunderlich.
Weniger überraschend ist die grundsätzlich unkritische Aufnahme der so sehnlich erwünschten Ergebnisse dieser vermeintlichen "Studie", die … endlich mal … oder so. Das Verständnis von Untersuchungsverfahren, Studiendesigns, statistischer Auswertung und vor allem zulässiger und unzulässiger Schlussfolgerungen ist in der Ärzteschaft generell unterentwickelt, wie nicht zuletzt systematische Aufklärungs- und Nachbildungsbemühungen des Deutschen Ärzteblatts mit der 2009 begonnene Serie über Statistische Verfahren in der medizinischen Forschung belegen. Auf den aufschlussreichen Artikel Helping Doctors and Patients Make Sense of Health Statistics verwiesen wir bereits im Forum Gesundheitspolitik bereits nach dessen Erscheinen Ende 2008.
Ernüchterung wird sich in der zurzeit begeisterten Ärzteschaft spätestens dann breit machen, wenn A.T. Kearney mit den Ergebnissen anderer Untersuchungen im Auftrag anderer Player ankommt. Denn die sich selbst in aller Bescheidenheit als "eines der führenden internationalen Top-Management-Beratungsunternehmen" anpreisende Firma kann auch anders und hat auch schon anders. In unübersehbarem Widerspruch zu den Kernaussagen und -forderungen der aktuellen Arbeit von A.T. Kearney enthalten frühere Publikationen Empfehlungen, die mit spürbarem Bürokratieaufbau verbunden sein müssen, um zu funktionieren. So empfahl A.T. Kearney 2009 in der Publikation Wie sich die gesetzlichen Kassen weiterentwickeln müssen auf S. 2 den Auf- und Ausbau der Abrechnungsprüfung, verstärktes Fallmanagement, striktere Prüfung der Leistungsgewährung, Überprüfung aller Verträge auf ihren Nutzen sowie Versorgungsmanagement bzw. neue Verträge, was schwerlich zum Abbau von Bürokratie beitragen kann, und empfahl zwei Seitenweiter "zum Beispiel attraktive Wahltarife, Zahlung von Behandlungen, die noch nicht Teil der Kassenleistung sind …" - also nichts von wegen "Anzahl der Produkte und Dienstleistungen".
Einen Vorabdruck der "Studie" von A.T. Kearney bietet der ärztliche Nachrichtendienst änd für eingeschriebene Nutzer. Für Jederman/frau kostenlos zugänglich ist ein Auszug der "Studie" bestehend aus Inhaltsverzeichnis, Zusammenfassung, Einleitung, Danksagung, Abbildungsverzeichnis und Literaturverzeichnis. Die zugehörige Presseerklärung von A.T. Kearney steht ebenfalls auf der Website der Unternehmensberatung kostenlos zum Download zur Verfügung. Für den beachtlichen Preis von 49,- EUR können Sie die Studie hier auch beim Erzeuger als Druckversion bestellen.
Eine etwas differenziertere Darstellung des "Bürokratiemonsters", das "vielen Ärztinnen und Ärzten die Freude an der Arbeit" verderbe und ihnen Zeit stehle, findet sich in der Ausgabe vom 30.3.2012 des Deutschen Ärzteblatts. Der Artikel Bürokratie in Praxen und Krankenhäusern: Vom Versuch, den Alltag in Ziffern zu pressen geht aus Sicht der MedizinerInnen auf die verschiedenen Arbeitsbereiche ein, die zumindest in der Wahrnehmung unter den Bereich Bürokratie fallen, lässt aber beispielsweise nicht unerwähnt, dass die meisten ÄrztInnen nicht das Verfassen von Arztbriefen als Verwaltungsuafwand empfinden, wohl aber deren Eingabe in einen Computer.
Und noch etwas: Erdrückende, teure und sinnlose Bürokratie zeichnet das gesetzliche deutsche Krankenkassenwesen seit seiner Entstehung aus. Davon legt ein Buch beredtes Zeugnis ab, dessen Autor nicht nur den gleichen Nachnamen trägt wie Peter Hartz, sondern viele seiner Ideen schon Jahrzehnte vorher gedacht und zu Papier gebracht hat, wie der Kölner Armutsforscher Christoph Butterwegge in seinem Essay Hartz in Weimar darlegte. Der deutschnationale Kaufmann und kurzzeitige DNVP-Reichstagsabgeordnete Gustav Hartz geißelte 1928 in seinem lesenswerten Buch "Irrwege der deutschen Sozialpolitik" wortreich genau dieselben Fehler und Schwächen des GKV-Systems wie mehr als 80 Jahre später die meisten NutzerInnen des ärztlichen Nachrichtendienstes. Zur Erbauung stellen wir den LeserInnen des Forum Gesundheitspolitik hier auszugsweise sechs Seiten des Buches zur Einsicht zur Verfügung, in denen es auch um überbordenden Bürokratismus geht.
Jens Holst, 1.2.12
Gesundheitsbericht-Ramsch: "Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker" lieber nicht nach "Erinnerungen" zur Gesundheitsentwicklung!
 Es vergeht kaum eine Woche ohne dass ein neuer Report einer Krankenkasse, eines Ärzte- oder Apothekerverbandes über meist "dramatische" Veränderungen der Gesundheit irgendeiner Bevölkerungsgruppe innerhalb der letzten 5, 10 oder 20 Jahren erscheint. Ein Teil dieser Berichte stützt sich immerhin noch auf "objektive", kontinuierlich und nicht nur für den jeweiligen Berichts erfasste Routinedaten von Krankenkassen oder methodisch erprobte repräsentative Bevölkerungsumfragen. Deren mögliche oder gesicherte Verzerrungen oder Schwachstellen wie z.B. die Untererfassung von Angehörigen vulnerabler Gruppen in repräsentativen Umfragen oder die Verkürzung auf die Behandlungsmorbidität in den GKV-Routinedaten sind weitgehend bekannt und kalkulierbar.
Es vergeht kaum eine Woche ohne dass ein neuer Report einer Krankenkasse, eines Ärzte- oder Apothekerverbandes über meist "dramatische" Veränderungen der Gesundheit irgendeiner Bevölkerungsgruppe innerhalb der letzten 5, 10 oder 20 Jahren erscheint. Ein Teil dieser Berichte stützt sich immerhin noch auf "objektive", kontinuierlich und nicht nur für den jeweiligen Berichts erfasste Routinedaten von Krankenkassen oder methodisch erprobte repräsentative Bevölkerungsumfragen. Deren mögliche oder gesicherte Verzerrungen oder Schwachstellen wie z.B. die Untererfassung von Angehörigen vulnerabler Gruppen in repräsentativen Umfragen oder die Verkürzung auf die Behandlungsmorbidität in den GKV-Routinedaten sind weitgehend bekannt und kalkulierbar.
Mittlerweile nimmt allerdings ein Typ der Informationsgenerierung durch Querschnittsbefragungen von "Praktiker-Experten" zu, der schnell und preisgünstig ist, inhaltlich aber hinsichtlich seiner Aussagen über Entwicklungstrends äußerst fragwürdig.
Jüngstes Beispiel ist das "Vivesco Gesundheitsbarometer 2011". Vivesco ist nach eigenen Angaben eine Kooperation aus rund 1.100 Apotheken mit 9.000 Mitarbeitern und eine 100-prozentige Tochter des Pharmagroßhändlers Andreae-Noris Zahn AG (ANZAG). Die Verantwortlichen des "Gesundheitsbarometers" und ihre wissenschaftliche Gallionsfigur, der schon als Finanzwissenschaftler nicht unumstrittene Bernd Raffelhüschen haben natürlich auch das Recht so viel Unsinn zu produzieren und zu publizieren wie ihnen einfällt. Wozu aber dann doch ein Kommentar nötig ist, ist die ihrer "Studie" exemplarisch eigene, durch "Erinnerungen" gestützte Sorgen- oder Panikmache über die weitere Entwicklung der Bevölkerungsgesundheit und ihrer Bewältigung durch das jetzige solidarische Krankenversicherungssystem. Und bevor das Strickmuster der Prognose noch weiter Schule macht - die Herausgeber kündigen eine jährliche Aktualisierung an -, verdient die dabei dominierende Unseriosität mehr Transparenz.
Die selbstbewusste Kernaussage der Studie lautet: "Erstmalig" sei "ausgehend von den zehn wichtigsten Krankheitsbildern … gezeigt (worden), wie sich der Gesundheitszustand der Deutschen in den vergangenen zehn Jahren entwickelt hat…: Wir sind heute weniger gesund als noch vor zehn Jahren. … Das ist ein Grund zur Besorgnis - und ein Anlass zum Handeln. … Aktueller als jede andere Studie bietet das Gesundheitsbarometer … eine klare Orientierung, wohin sich Deutschlands Gesundheit entwickelt."
Um all dies liefern zu können, werteten die Autoren weder Daten einer Gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung noch Daten aus Arztpraxen aus - wie viele andere Gesundheitsreports. Sie fragten auch nicht mit den dazu vorhandenen wissenschaftlich validierten Fragen Patienten oder eine repräsentative Stichprobe der Bevölkerung nach ihrem selbst wahrgenommenen Gesundheitszustand und verglichen dies mit ähnlichen Informationen aus der Vergangenheit.
Stattdessen rührten Vivesco und der gesundheitswissenschaftlich oder epidemiologisch wirklich unbedarfte Finanzwissenschaftler Raffelhüschen einen bunten Cocktail zusammen, dessen Ingredenzien so aussehen:
• Zunächst wird der Gesundheitszustand im Jahr 2001 für die "zehn wichtigsten Krankheitsbilder" Depression, Schlafstörungen, Sodbrennen, Osteoporose oder Bluthochdruck auf der Basis von Angaben der WHO zur Krankheitslast (Indikator sind so genannte "disability adjusted life years" oder DALY [1 DALY entspricht einem verlorenen gesunden Lebensjahr]) gebildet und in einem Index auf 100 gesetzt.
• Im Frühjahr 2011 wurden dann 444 ApothekerInnen aus den 1.100 Apotheken gefragt, wie sich ihrer Ansicht nach der Gesundheitszustand im Bereich der genannten 10 Krankheiten verändert habe. Dazu sollten sich diese u.a. auf ihre "Kompetenz" und die "hautnah" an "vorderster Front im Gesundheitswesen" gewonnenen Eindrücke über die Anzahl der Erkrankungsfälle stützen. So werden die Häufigkeit des Klingelns der Ladentür und die Anzahl der Personen, die den Apotheker fragen, ob "Renni" wirklich "den Magen aufräumt" (gleich Sodbrennen) zum neuesten epidemiologischen Maß. Und man fragt sich, warum es eigentlich noch der ganzen epidemiologischen Expertise in der Gesundheitsberichterstattung bedarf.
• Die so gewonnenen Erkenntnisse werden noch "entsprechend der WHO-Einschätzung zur Krankheitsbelastung der einzelnen Krankheitsbilder gewichtet" und erfahren schließlich noch eine "abschließende Validierung". Dafür werden "sowohl Medikamenten-Verkaufsstatistiken der GESDAT als auch Fallzahlenstatistiken der WHO verwendet".
• Mittels einer hübsch kompliziert anmutenden Formel wird schließlich noch der jeweilige Indexwert berechnet - für 2011 also der Wert 141. Zwar "signalisiert" dieser "keine dramatische Verschlechterung", aber "es geht uns heute schlechter". Und 4 von 10 ApothekerInnen wissen sogar noch mehr und "gehen davon aus, dass sich der allgemeine Gesundheitszustand … in Zukunft weiter verschlechtern wird."
Wie schnell eine Längsschnitt-Gesundheitsberichterstattung, die sich auf die subjektiv wahrgenommene Häufigkeit öffnender Apothekentüren oder auf die Anzahl besetzter Stühle in Arztpraxen stützt, Schule macht, zeigt die jüngste Studie der DAK. Sie kommt zu dem - was auch sonst - "alarmierenden Ergebnis", dass sich der Gesundheitszustand der in Deutschland lebenden Kinder in den vergangenen zehn Jahren verschlechtert hat. Die empirische Basis dieser Feststellung ist eine Umfrage unter hundert Kinderärzten, die u.a. gebeten wurden, sich zu erinnern (!), ob der Gesundheitszustand ihrer jungen PatientInnen sich seit 2000 verschlechtert oder verbessert hat. Die Ärzte werden also noch nicht einmal gebeten, einen Blick in ihre Praxis-Dokumentation oder EDV zu werfen und relativ objektiv vergleichen zu können, wie viele ihrer jungen Patienten beispielsweise 2000 und 2010 wegen der einen oder anderen Erkrankung bei ihnen in Behandlung waren. Zum Wert von Erinnerungen für die Identifizierung zeitlicher Verläufe und Trendanalysen gibt es aber gesicherte Erkenntnisse der empirischen Sozialforschung. Ohne den 100 Kinderärzten zu nahe treten zu wollen: Die Methode der retrospektiven Tatsachenerhebung wird durch eine Fülle von normalen Erinnerungsschwierigkeiten bestimmt und führt meist systematisch zur Über- und Unterschätzungen der Prävalenzen gesundheitlicher Zustände. Da aktuelle Phänomene oder Häufigkeiten am besten erinnert werden, wirken sie größer als dieselben Phänomene in der ferneren Vergangenheit. Die so erhobenen Phänomene nehmen daher fast immer in der Zeit zu.
Das Elend dieser Art von Untersuchungen und die Fragwürdigkeit und/oder den einzigen Zweck der ihnen eigenen Dramatisierung, brachte der Medizinhistoriker Roy Porter bereits gegen Ende seines Standardwerk "Die Kunst des Heilens" für die entwickelten Länder auf den folgenden Punkt: "Ängste und Eingriffe schrauben sich immer höher wie eine außer Kurs geratene Rakete. … Es ist Teil eines Systems, in dem ein wachsendes medizinisches Establishment angesichts einer immer gesünderen Bevölkerung dazu getrieben wird, normale Ereignisse … zu medikalisieren, Risiken zu Krankheiten zu machen und einfache Beschwerden mit ausgefallenen Prozeduren zu behandeln. Ärzte und 'Konsumenten' erliegen zunehmend der Vorstellung, dass jeder irgendetwas hat, dass jeder und alles behandelt werden kann."(Roy Porter [2000]: Die Kunst des Heilens; Heidelberg/Berlin: 717)
Und wer dasselbe aktueller, auf deutlich weniger als 700 Seiten und speziell für die "dramatisch zunehmenden Volkskrankheiten" Depression und Alzheimer nachlesen will, kann dies in dem Aufsatz "Geldmacherei mit Patienten. Die Krankheitserfinder" von Werner Bartens tun, der in der Wochenendausgabe der "Süddeutschen Zeitung" vom 16. Juli 2011 erschienen und kostenlos erhältlich ist.
Wer nun noch wissen will oder Demonstrationsmaterial braucht, um zu zeigen wie man längsschnittliche Gesundheitsberichterstattung nicht betreiben sollte, findet den Originaltext der beiden hier exemplarisch vorgestellten "Studien" kostenlos im Internet:
Das "vivesco-Gesundheitsbarometer" umfasst 19 Seiten.
Die Ergebnisse des DAK-Reports "Meinungen zur Gesundheit der Kinder in Deutschland" sind in einer vierseitigen Zusammenfassung des Forsa-Instituts zu sehen.
Bernard Braun, 16.7.11
Wenig Wissen über Radiologen, mehr Kontakte gewünscht aber hochzufrieden - "Blindes Arzt-Vertrauen" oder "health illiteracy"?
 75% der dazu befragten 1.001 Bürgern waren schon einmal Patient bei einem Radiologen, nur 18% hatten Angst vor Strahlung bei einer radiologischen Untersuchung, 94% halten die Radiologie für wichtig oder sehr wichtig und 70% waren mit ihrem Radiologen zufrieden oder gar sehr zufrieden - aber nur 37% derselben Personen wussten auf Befragen, dass Radiologen Röntgenaufnahmen erstellen und noch viel weniger von ihnen wussten, was diese Fachärzte sonst noch leisten. 66% aller Befragten gaben aber unabhängig davon an, sie hätten ein hohes oder sehr hohes Interesse an medizinischen Themen.
75% der dazu befragten 1.001 Bürgern waren schon einmal Patient bei einem Radiologen, nur 18% hatten Angst vor Strahlung bei einer radiologischen Untersuchung, 94% halten die Radiologie für wichtig oder sehr wichtig und 70% waren mit ihrem Radiologen zufrieden oder gar sehr zufrieden - aber nur 37% derselben Personen wussten auf Befragen, dass Radiologen Röntgenaufnahmen erstellen und noch viel weniger von ihnen wussten, was diese Fachärzte sonst noch leisten. 66% aller Befragten gaben aber unabhängig davon an, sie hätten ein hohes oder sehr hohes Interesse an medizinischen Themen.
Dies sind die paradoxen Ergebnisse einer von der Deutschen Röntgengesellschaft in Auftrag gegebenen, im Herbst 2010 durchgeführten und jetzt veröffentlichten repräsentativen telefonischen Bevölkerungsumfrage.
Auch weitere Teilergebnisse der Befragung lassen eher Verwunderung und Zweifel über die insgesamt hohe Zufriedenheit zurück als klare Erkenntnisse: So wünschen sich 69% der Befragten beispielsweise eine bessere Aufklärung hinsichtlich der Risiken der Untersuchung und 67% wünschen sich dies auch hinsichtlich des Nutzens der Untersuchung. 83 % gaben an, dass ihnen beim Besuch des Radiologen, als einem Facharzt mit "Technik-Image" das Arzt-Patienten- Gespräch wichtig sei. Nur 39 % der Befragten, die schon einmal beim Radiologen waren, gaben aber an, dass dieser den Befund mit ihnen besprochen hätte. Diese Besprechungen erfolgten dagegen bei 47% der privat Versicherten.
Ähnlich hin- und hergerissen wirken die Befragten auch beim Thema Nukearmedizin und Strahlentherapie: Einerseits ist die Strahlentherapie in hohem Maße akzeptiert. 75 % und mehr der Befragten halten die Strahlentherapie für eine wichtige Behandlungsoption bei Krebserkrankungen, 74 % halten den Einsatz der Strahlentherapie für die Heilung vieler Tumoren für unverzichtbar. Trotzdem würden 37 % der Befragten einem Freund/Familienangehörigen eine medizinisch indizierte Strahlentherapie nur mit Bedenken empfehlen und lediglich 35 % würden keine Bedenken äußern. Woran dies liegen könnte zeigen die Antworten auf die Frage, welche Gefühle bei der Nutzung von Strahlung in der Medizin überwiegen würden. 51 % der Befragten sagten, dass der therapeutische Nutzen überwiegen würde; 42 % gaben aber an, dass die Angst vor Nebenwirkung oder Spätfolgen der Strahlentherapie überwiegen würde.
Hier bestätigt sich zum Teil die in den Befragungen des "Gesundheitsmonitors" der Bertelsmann Stiftung in früheren Befragungswellen zum Vertrauen in die Ärzte und zu einer Reihe ihrer Eigenschaften und Tätigkeiten wiederholt identifizierte eigenartige Diskrepanz zwischen hohem Vertrauen in "den" Arzt und erheblich vermindertem Vertrauen in nahezu alle Tätigkeiten derselben Ärzte.
Neu und unerwartet ist, dass derartig wenige Personen mit dem selbst berichteten Interesse an und der Erfahrung mit dem medizinischen Bereich so wenig spezifische Kenntnisse haben, was denn der "Radiologe" zu dem sie ihr Hausarzt überweist, eigentlich konkret macht. Wenn die Erklärung nicht eine rein sprachliches Unverständnis der Fachbezeichnung Radiologe, also ein Befragungsfehler ist, gibt es in der Befragung auch einige Hinweise, was für PatientInnen jenseits von genauen Kenntnissen über die Tätigkeit des Arztes und seiner Aufklärungsleistungen bei Beurteilungen von Ärzten wichtig ist: Die schmerzlose Untersuchung durch Apparate und natürlich fachkundiges Personal!
Weitere Untersuchungen müssten klären, auf welcher kognitiven, emotionalen und verhaltensmäßigen Grundlage Patienten sich bei der Suche und Bewertung von Ärzten bewegen und ob die Annahmen über die dominant rational bestimmte subjektive Basis stimmen, von der die immer zahlreicher werdenden Informations- und Entscheidungshilfe-Angebote Patienten "abholen" wollen.
Fachgesellschaftliche Quintessenzen der Art, dass "die Radiologie (die strahlenden Fächer) als ärztliche Disziplinen wahrgenommen und hoch geschätzt (werden) oder dass "die Apparatemedizin positiv belegt" ist und "als sinnvoll erachtet" wird, machen es sich zu einfach.
Sowohl die Kurzfassung der Präsentation als auch die etwas längere Langfassung gibt es kostenlos. Auf 110 Seiten eines ebenfalls kostenlos erhältlichen Tabellenbandes findet der Interessierte noch eine Fülle von detaillierteren Informationen zum Thema und Ansatzpunkte für die weitere Beschäftigung mit dem Thema.
Zur weiteren Irritation über scheinbar gesicherte Wissensbestände zur ambulanten Versorgung tragen einige Daten auch noch bei: So geben die Befragten ähnlich wie in einigen anderen Befragungsstudien als Anzahl aller Arztbesuche in den letzten Monaten 6 und nicht die immer wieder aus Routinedaten einer einzigen Krankenkasse ausgezählten, geschätzten und heftig kommunizierten 18 Besuche.
Bernard Braun, 3.6.11
"Gesundheit in Deutschland aktuell 2009" - Ein Gesundheitssurvey des Robert-Koch-Instituts
 In der Studie "Gesundheit in Deutschland aktuell 2009" beantworteten 21.262 Menschen im Alter ab 18 Jahren zwischen Juli 2008 und Juni 2009 telefonisch etwa 200 Fragen zur Gesundheit und zur Lebenssituation. Die Ergebnisse des vom Robert-Koch-Institut (RKI) durchgeführten Gesundheitssurveys sind repräsentativ für die erwachsene, deutschsprachige Wohnbevölkerung. Für ausgewählte Gesundheitsindikatoren, die auch im Jahr 2003 erhoben wurden, lassen sich zeitliche Vergleiche ziehen.
In der Studie "Gesundheit in Deutschland aktuell 2009" beantworteten 21.262 Menschen im Alter ab 18 Jahren zwischen Juli 2008 und Juni 2009 telefonisch etwa 200 Fragen zur Gesundheit und zur Lebenssituation. Die Ergebnisse des vom Robert-Koch-Institut (RKI) durchgeführten Gesundheitssurveys sind repräsentativ für die erwachsene, deutschsprachige Wohnbevölkerung. Für ausgewählte Gesundheitsindikatoren, die auch im Jahr 2003 erhoben wurden, lassen sich zeitliche Vergleiche ziehen.
Auf 33 so genannten "Faktenblättern" liefert der Survey z.B. Angaben zur subjektiven Gesundheit, Prävalenz chronischen Krankseins, 12-Monats-Prävalenz von Depression, Übergewicht und Adipositas, der körperlichen Aktivität, den Obstverzehr, die soziale Unterstützung, das Rauchen, gesundheitsschädigende Arbeitsbedingungen, die Inanspruchnahme der Grippeschutzimpfung in der Wintersaison 2007/2008, die Arztbesuche in den letzten 12 Monaten, oder die Anzahl der Krankenhausaufenthalte in den letzten 12 Monaten.
Folgende gesundheitswissenschaftlich wie -politisch interessanten Ergebnisse sind u.v.a. zu finden:
• Eine große Mehrheit der Bevölkerung erfreut sich guter Gesundheit. 68 Prozent der Frauen und 73 Prozent der Männer bewerten ihre Gesundheit als sehr gut oder gut. Bei den über 65-Jährigen geht es noch 46 Prozent der Frauen und 52 Prozent der Männer sehr gut oder gut. Im Vergleich zu 2003 ist der allgemeine Gesundheitszustand im Wesentlichen gleich geblieben; einen Gewinn an Gesundheit kann die Gruppe der über 65-jährigen Frauen verbuchen.
• Gut ein Zehntel der Befragten ist gesundheitlich erheblich eingeschränkt. Der Anteil der erheblich Eingeschränkten variiert nach dem Bildungsstatus. Frauen und Männer mit niedrigen Bildungsabschlüssen geben deutlich häufiger gesundheitliche Beeinträchtigungen an als diejenigen mit hohen Bildungsabschlüssen. Ab dem Alter von 65 Jahren ist ein Viertel der Frauen und ein Fünftel der Männer erheblich gesundheitlich eingeschränkt.
• Der Anteil der Sporttreibenden steigt. Fast zwei Drittel der Frauen und Männer treiben Sport. Mehr als vier Stunden sportliche Aktivität berichten ein Fünftel der Frauen und ein gutes Viertel der Männer. Der Anteil dieser stark sportlich Aktiven hat bei Frauen und Männern seit 2003 um vier Prozentpunkte zugenommen. Ab dem Alter von 45 Jahren treiben mehr Frau¬en als Männer Sport. Die Empfehlung, mindestens an fünf Tagen der Woche für jeweils mindestens 30 Minuten körperlich aktiv zu sein, erfüllen 20 Prozent der Frauen und 23 Prozent der Männer.
• Bei den über 65-Jährigen sind noch knapp die Hälfte der Frauen und etwas mehr als die Hälfte der Männer bei guter oder sehr guter Gesundheit, etwa die Hälfte der Befragten treibt Sport. Bezüglich einiger chronischer Krankheiten und gesundheitlicher Risikofaktoren (Diabetes, Asthma, Bluthochdruck, Adipositas) ist aber beim Vergleich zu den Daten von 2003 ein Anstieg der Häufigkeit bei den über 65-Jährigen zu beobachten. In wieweit dieser Anstieg durch die Alterung der Bevölkerung oder aber durch eine erhöhte Wachsamkeit und bessere Früherkennung bedingt ist, muss durch weitere Analysen geklärt werden.
Der 139 Seiten starke Beitrag zur Gesundheitsberichterstattung des Bundes "Daten und Fakten: Ergebnisse der Studie 'Gesundheit in Deutschland aktuell 2009' des Robert-Koch-Instituts gibt es als Vorabdruck aus dem September 2010 komplett kostenlos.
Bernard Braun, 16.1.11
Wie bürgernah sind Selbstverwaltung und Sozialwahlen (noch)? - Aktuelle Ergebnisse des Gesundheitsmonitors!
 "2011 finden Sozialwahlen für die Selbstverwaltungsorgane, die Verwaltungsräte, in den gesetzlichen Krankenkassen statt" - "Sagt mir nichts!" oder "Was soll das schon wieder?" Macht nichts: Mit dieser oder vergleichbaren Reaktionen befinden sie sich in bester Gesellschaft der Mehrheit der GKV-Mitglieder.
"2011 finden Sozialwahlen für die Selbstverwaltungsorgane, die Verwaltungsräte, in den gesetzlichen Krankenkassen statt" - "Sagt mir nichts!" oder "Was soll das schon wieder?" Macht nichts: Mit dieser oder vergleichbaren Reaktionen befinden sie sich in bester Gesellschaft der Mehrheit der GKV-Mitglieder.
Dabei handelt es sich bei der Selbstverwaltung um eines der konstitutiven Elemente der deutschen GKV als einer weder durch Ministerialbeamte noch durch Privateigentümer und "den Markt" bestimmten Form der sozialen Absicherung gegen Erkrankungsrisiken.
Sämtliche Träger der Sozialversicherung "sind rechtsfähige Körperschaften des öffentlichen Rechts mit Selbstverwaltung", die ehrenamtlich "durch die Versicherten und die Arbeitgeber ausgeübt" wird (§ 29 SGB IV). Und: "Die Versicherungsträger erfüllen im Rahmen des Gesetzes und des sonstigen für sie maßgebenden Rechts ihre Aufgaben in eigener Verantwortung" (§ 29 SGB IV). Zu den Aufgaben gehören neben der regelmäßigen Bestimmung des hauptamtlichen Vorstands jeder Krankenkasse "alle Entscheidungen …, die für die Krankenkasse von grundsätzlicher Bedeutung sind" (/§ 197 SGB V). Die Mitglieder der Selbstverwaltungsorgane werden in besonderen, alle sechs Jahre stattfindenden "freien und geheimen Wahlen", die so genannten Sozialwahlen gewählt und legitimiert. Dass diese durch Absprachen zwischen den Verbänden und Vereinigungen über die Anzahl der Kandidaten legal verhindert werden können, also seit Jahrzehnten und überwiegend so genannte "Friedenswahlen" stattfinden, gehört zu den Besonderheiten der Wirklichkeit sozialer Mitbestimmung im GKV-System und erklärt auch einen Teil der eingangs offenbar gewordenen Ahnungslosigkeit.
Wie bekannt und anerkannt das Selbstverwaltungsprinzip, die Selbstverwalter, ihre Tätigkeit und die Sozialwahlen bei den Versicherten der GKV sind, wollten die Bertelsmann Stiftung und Wissenschaftler des Zentrums für Sozialpolitik der Universität Bremen im Rahmen der 17. Befragungswelle des "Gesundheitsmonitors" im Sommer 2010 von 1.520 repräsentativ ausgewählten GKV-Versicherten genauer wissen.
Zu den wichtigsten Ergebnissen gehören:
• 37 Prozent der in einer GKV-Kasse versicherten Bürger war bekannt, dass es in ihrer Krankenkasse einen Verwaltungsrat gibt.
• 32 Prozent derjenigen, die überhaupt von einem Verwaltungsrat in ihrer Krankenkasse wussten, gaben an, ihnen seien schon einmal nähere Einzelheiten aus dessen Arbeit bekannt geworden. Bezieht man diesen Anteil auf alle GKV-Versicherten, hatten lediglich 12 Prozent schon einmal etwas über ihre Selbstverwaltung gehört.
• Unter allen Befragten sind unabhängig von ihrem Kenntnisstand 54 Prozent "sehr" oder "eher" für Sozialwahlen und Selbstverwaltung. Bei denen, die immerhin von der Existenz des Verwaltungsrates wissen, steigt die Zustimmungsrate schon auf 71 Prozent. Von denen schließlich, die schon einmal etwas über die Arbeit dieses Verwaltungsrates gehört haben, sprechen sich 83 Prozent dafür aus.
• Nachdem die befragten GKV-Versicherten in der Fragestellung in knapper Form über die weitverbreitete Praxis der Friedenswahlen informiert wurden, stimmten zunächst 38 Prozent aller Befragten der Position zu, die Wahlen seien generell überflüssig, weil der Verwaltungsrat nichts bewirken könne. 47 Prozent aller Befragten halten aber "Friedenswahlen" nicht für gut, weil eine Wahl ohne Wahlmöglichkeit undemokratisch sei. Nur etwas weniger, nämlich 45 Prozent der Befragten, halten die "Friedenswahlen" "für akzeptabel, weil es ja schließlich nur wenig Wahlalternativen gibt und man damit Ausgaben spart." Für die weitere Debatte ist festzuhalten: Fast zwei Drittel der GKV-Versicherten halten Sozialwahlen "irgendwie" nicht für überflüssig.
• 29 Prozent der Befragten wissen nicht mehr, ob sie an der letzten Sozialwahl im Jahr 2005 teilgenommen haben. 25 Prozent erinnern sich, dass sie gewählt, und 45 Prozent, dass sie nicht gewählt haben.
• Trotz aller Informationslücken und der eingeschränkten Beteiligungsmöglichkeiten bewerten durchweg mehr als 50 Prozent und bis hin zu 70 Prozent der GKV-Versicherten sie positiv, weil sie (68 %) in der Selbstverwaltung ein demokratisches Grundrecht sehen, weil sie (70 %) meinen, über die Selbstverwaltung bei der Verwendung ihrer Beiträge mitbestimmen zu können, und weil sie (56 %) annehmen, dass sie über die Selbstverwaltung schließlich auch Einfluss auf das Leistungsangebot nehmen können.
• 62 Prozent halten aber die realen Mitbestimmungsmöglichkeiten für zu gering, und immer noch die Hälfte der GKV-Versicherten (50 %) sehen dort "bisher" ihre Interessen nicht repräsentiert.
• 42 Prozent meinen aber schließlich doch noch, der Verwaltungsrat sei überflüssig, "weil die wichtigen Entscheidungen über die Krankenkassen an anderer Stelle fallen", 35 Prozent glauben, ihre Interessen gingen "in der Bürokratie der Krankenkasse sowieso" unter. 25 Prozent meinen, die Krankenkasse sei "als Wirtschaftsunternehmen sowieso gezwungen ihr Angebot an den Interessen der Versicherten auszurichten".
• 20 Prozent schließlich sagen, sie würden ihre Interessen gegenüber der Krankenkasse "auf anderem Wege (z. B. durch die Ankündigung oder Realisierung eines Kassenwechsels) durchsetzen".
Angesichts der komplexen faktischen organisatorischen Mängel und normativen Schwachstellen betonen die Wissenschaftler in ihrem Fazit, dass an mehreren Stellschrauben gleichzeitig gedreht werden müsse, wenn man diese traditionelle Legitimierungs- und Beteiligungsform in eine modernere zivilgesellschaftliche Gestalt transformieren wolle.
Dazu gehörte u.a.:
• Eine umfangreichere, bessere (z. B. weg von der Mitteilungs-Berichterstattung hin zu modernen Reportagen), vielfältigere (z. B. stärkere Nutzung des Internets) und vor allem kontinuierliche Transparenz über das Prinzip, die normativen Möglichkeiten und die tatsächliche Arbeit der Selbstverwaltungssräte.
• Gearbeitet werden muss auch an einer Reaktivierung der Urwahlen. Sie sollten die Regel sein, denn sie verschaffen der Selbstverwaltung nachhaltige Legitimation.
• Gleichzeitig muss der durch den sozialstrukturellen Wandel (Veränderungen der Anteile erwerbstätiger und nichterwerbstätiger Versicherter) schon lange gebotene Paradigmenwechsel von der Beitragszahler- und Arbeitsweltorientierung zu einer Betroffenenorientierung praktisch angegangen werden. Dies sorgte auch u. a. für die Schaffung von Wahlalternativen und die Repräsentanz der Interessen bisher vernachlässigter Versichertengruppen (z. B. nicht erwerbstätige Jugendliche oder Ehegatten).
In weiteren Abschnitten finden sich z.B. durchaus überraschende Angaben über die Eigenschaften, die Versicherte von Selbstverwaltern erwarten.
In einem umfangreichen Interview gibt der Bundeswahlbeauftragte für die Sozialversicherungswahlen Gerald Weiß Auskunft über seine Vorstellungen über Sozialwahlen und die Möglichkeit jetzt Urwahlen zu erzwingen. (Überschrift: ""Hier muss sicher der Gesetzgeber ran").
Alle zitierten und zahlreiche weitere Ergebnisse, ein kleiner Ausflug in die Ergebnisse vergleichbarer Befragungen aus den letzten 30 Jahren sowie das Interview mit Herrn Weiß finden sich in dem von den Bremer Gesundheitswissenschaftlern Bernard Braun und Gerd Marstedt verfassten Newsletter 3/2010 des "Gesundheitsmonitors" der Bertelsmann Stiftung unter der Überschrift "Wie bürgernah sind Selbstverwaltung und Sozialwahlen?", der kostenlos erhältlich ist.
Bernard Braun, 17.10.10
9 Jahre ambulante Versorgung und Gesundheitspolitik aus Versichertensicht: "Gesundheitsmonitor"-Daten frei zugänglich!
 Hat sich die Bewertung der Zukunft der sozialen Krankenversicherung im Laufe der letzten 9 Jahre verändert und wirkten sich die großen Gesundheitsreformgesetze daraif aus? Gibt es Ost-West-Unterschiede, wenn es darum geht, ob die Solidarausgleiche im GKV-System für gerecht gehalten werden? Wo informieren sich Angehörige unterer sozialen Geschichten vorrangig über gesundheitsbezogene Angelegenheiten? Wie schnell verbreitet sich Informationen zum Inhalt der Gesundheitsreformen in der Bevölkerung und gibt es Gruppen, bei denen davon nichts ankommt?
Hat sich die Bewertung der Zukunft der sozialen Krankenversicherung im Laufe der letzten 9 Jahre verändert und wirkten sich die großen Gesundheitsreformgesetze daraif aus? Gibt es Ost-West-Unterschiede, wenn es darum geht, ob die Solidarausgleiche im GKV-System für gerecht gehalten werden? Wo informieren sich Angehörige unterer sozialen Geschichten vorrangig über gesundheitsbezogene Angelegenheiten? Wie schnell verbreitet sich Informationen zum Inhalt der Gesundheitsreformen in der Bevölkerung und gibt es Gruppen, bei denen davon nichts ankommt?
Wer nach bevölkerungsrepräsentativen Antworten auf diese oder eine Vielzahl ähnlicher Fragen sucht, die etwas mit der Inanspruchnahme ambulanter Versorgung im Gesundheitssystem, der Zukunft des sozialen Krankenversicherungssystem und der Bewertung von Reformoptionen im Gesundheitssystem zu tun haben, und wer dann noch wissen will, ob sich an den Antworten und Bewertungen in den letzten Jahren etwas verändert hat, findet seit Jahren in den jährlichen Buchausgaben des "Gesundheitsmonitors" der Bertelsmann Stiftung und den regelmäßig veröffentlichten "Newsletter"-Ausgaben eine Menge theoretisch aufbereitete und empirisch fundierte Antworten.
Die einmalige Wissensquelle sind die Ergebnisse einer seit dem November 2001 halbjährlich stattfindende Befragung einer bevölkerungsrepräsentativen Gruppe von rund 1.500 Personen. Die vorläufig letzte sechzehnte Welle fand im Frühjahr 2009 statt. Die Fragebögen werden von Beginn an u.a. von Sozialforschern des Zentrums für Sozialpolitik (ZeS) der Universität Bremen entwickelt, enthalten einen inhaltlich identischen Teil über die Inanspruchnahme der ambulanten Versorgung, eine Fülle von soziodemografischen Angaben und inhaltlich variable Teile zu jeweils aktuellen Fragestellungen.
Trotz der zahlreichen Veröffentlichungen gibt es nicht wenige Fragen, die niemals oder nur relativ einfach ausgewertet worden sind oder deren Auswertung im Zeitverlauf nur partiell erfolgte. Wer dies für seine aktuellen wissenschaftlichen Arbeiten oder gesundheitspolitische Debatten nachholen will, ältere Auswertungen selbst nachvollziehen, anders gewichtet oder zeitlich ergänzen will oder für eigene primären Forschungsarbeiten nach repräsentativen Referenzgrößen sucht, der kann dies nun - Sachkunde vorausgesetzt - mit Hilfe der als "public use file" zugänglichen Daten aller Befragungswellen des "Gesundheitsmonitors" nachholen.
Dazu liegen die Umfragedaten für jede der 16 Befragungswellen für die sozialwissenschaftlichen Statistikprogramme SPSS und SAS vor. Die Daten der einzelnen Wellen sind unter Angabe der Feldzeit zusammen mit den jeweiligen Datensatzbeschreibungen nach Jahren sortiert. Zusätzlich liegen die Daten für Fragen, die mehrfach gestellt wurden, also Zeitreihen-Analysen erlauben, als Zeitreihendatensatz vor.
Zusätzlich stehen nicht nur sämtliche Originalfragebögen zur Verfügung, sondern es gibt auch einen groben Überblick über alle abgefragten Themenfelder sowie Erläuterungen zur Bildung des Sozialschichtindex und methodische Hintergrundinformationen zur Stichprobenbildung, Erhebungsmethode (Access Panel) und einigen Qualitätsaspekten der Ergebnisse, die auch zum gründlichen Studium heruntergeladen werden können. Lohnenswert ist sicherlich auch ein Blick in die Details zur Handhabung. Dort finden sich unter anderem Angaben zu unterstützten Programmversionen sowie ein Hinweis auf den Gewichtungsfaktor, der für bestimmte Auswertungsprozeduren eingeschaltet werden muss.
Da weder für die letzten Jahre eine inhaltlich vergleichbare Wissensquelle vorliegt noch Initiativen bekannt sind, solche oder ähnliche Daten auch künftig zu generieren, sollte der "public use file" noch genutzt werden solange seine Inhalte "warm" sind und damit neben dem konkreten wissenschaftlichen oder politischen Nutzen auch der Nutzen einer Fortsetzung illustriert werden.
Alle Daten-Dateien und die genannten Erläuterungen des "Gesundheitsmonitor-Public use file" sind online kostenlos zugänglich.
Bernard Braun, 19.5.10
Qualitätssicherung in der medizinischen Versorgung: Was denken Patienten und Versicherte?
 Das Konzept der Qualitätssicherung wird in Deutschland nicht selten mit Argwohn betrachtet, zumindest dann, wenn es nicht um die Qualität von Hi-tec-Geräten oder Produkten der Automobilindustrie geht, sondern um die medizinische Versorgung. Minister Rösler: "Ich habe angefangen Medizin zu studieren, weil ich mit Menschen zu tun haben wollte. Als ich fertig war, hatte ich mehr mit Qualitätssicherungsbögen zu tun. Also mehr Zeit für Bürokratie als für Behandlung. Da habe ich mir gesagt: Jetzt kannst du gleich selber in die Politik gehen und solche unsinnigen Gesetze abschaffen. Wenn es ein gutes Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patienten gibt, wenn Ärzte und Pfleger Zeit für ihr berufliches Ethos bekommen, brauchen Sie auch keine Qualitätssicherungsbögen."
Das Konzept der Qualitätssicherung wird in Deutschland nicht selten mit Argwohn betrachtet, zumindest dann, wenn es nicht um die Qualität von Hi-tec-Geräten oder Produkten der Automobilindustrie geht, sondern um die medizinische Versorgung. Minister Rösler: "Ich habe angefangen Medizin zu studieren, weil ich mit Menschen zu tun haben wollte. Als ich fertig war, hatte ich mehr mit Qualitätssicherungsbögen zu tun. Also mehr Zeit für Bürokratie als für Behandlung. Da habe ich mir gesagt: Jetzt kannst du gleich selber in die Politik gehen und solche unsinnigen Gesetze abschaffen. Wenn es ein gutes Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patienten gibt, wenn Ärzte und Pfleger Zeit für ihr berufliches Ethos bekommen, brauchen Sie auch keine Qualitätssicherungsbögen."
Diese Aussage des neuen Bundesgesundheitsministers Philipp Rösler in einem Interview mit der Bild-Zeitung charakterisiert ein durchaus gängiges Verständnis von Qualitätssicherung in der medizinischen Versorgung, in dem das allerorten verhasste Merkmal der Bürokratisierung und Gängelung ärztlichen Handelns im Vordergrund steht. Neue und ungewohnte Dokumentationspflichten werden weniger als Qualitätskontrolle zum Nutzen von Patienten, sondern eher als stupide Verwaltungsarbeit wahrgenommen, die von genuin ärztlichen Tätigkeiten abhält.
Dass diese genuin ärztlichen Tätigkeiten nicht selten auf veralteten Kenntnissen beruhen, überholte Behandlungsmethoden einsetzen und in manchen Fällen Patienten mehr schaden als nutzen, wird dabei gerne übersehen, obwohl es für diese Defizite durch medizinische Über-, Unter- und Fehlversorgung eine Vielzahl seriöser Belege gibt. Und wie sieht es aus auf Seiten der Bevölkerung? Erkennen Patienten und Versicherte solche Defizite im Versorgungssystem, dass deshalb Veränderungen in der Qualitätssicherung nötig sind? Inwieweit werden ärztliche Fortbildungsmaßnahmen und Praktiken der Zulassung als Arzt als sinnvolle Qualitätssicherungs-Maßnahmen bewertet und welche Einstellungen gibt es zum sogenannten "Ärzte-TÜV" und zu Arztbewertungsportalen? Der "Gesundheitsmonitor" der Bertelsmann-Stiftung hat dazu Daten veröffentlicht, die aus Erhebungen im Herbst 2008 und Frühjahr 2009 stammen, wobei jeweils eine repräsentative Stichprobe von ca. 1.500 Männern und Frauen im Alter von 18-79 Jahren befragt wurde. Wesentliche Befunde der Befragung waren folgende:
• Es zeigt sich eine überaus starke Kritik an der Versorgung, etwa, wenn fast 60 Prozent sagen, es gäbe einige gute Dinge in unserem Gesundheitswesen, aber einschneidende Maßnahmen seien nötig, um es zu verbessern. Und ein ähnlich großer Anteil der Bevölkerung erwartet Verschlechterungen im Hinblick auf die Qualität der medizinischen Leistungen, die Zeitdauer für das Arzt-Patient-Gespräch und Wartezeiten auf Praxis-Termine.
• Vor diesem Hintergrund werden dann auch umfassende Forderungen zur Qualitätssicherung laut (vgl. Grafik). Durchweg alle in der Befragung genannten Vorschläge werden mehrheitlich befürwortet, mit Zustimmungsquoten zwischen 55 und 83 Prozent. Eindeutige konzeptuelle Präferenzen sind dabei nicht erkennbar: Kontrollmaßnahmen (wie der "Ärzte-TÜV") stoßen ebenso auf große Zustimmung wie veränderte Regelungen bei der beruflichen Fortbildung, Kriterien der Zulassung als Arzt oder auch eine Ausweitung von Informationen über die Behandlungsqualität von Arztpraxen. 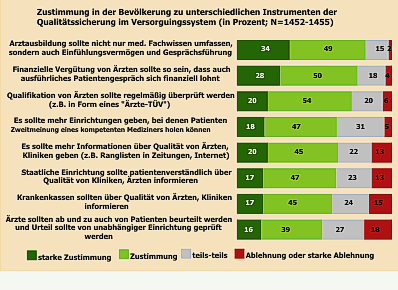
• Überraschend ist, dass in diesem Zusammenhang ärztliche Kommunikation als Qualitätsmerkmal ganz besonders hervor gehoben wird: Die von Patienten am meisten unterstützten Maßnahmen betonen eine Berufsausbildung mit mehr sozial-kommunikativen Inhalten und Ansätze eines Pay for Performance, die das ausführliche Gespräch mit Patienten honorieren. Und auch bei der Zulassung als Arzt sollen nach Patientenmeinung Aspekte wie Gesprächsführung oder Einfühlungsvermögen stärker berücksichtigt werden.
• Eine differenzierte Analyse, ob dabei bestimmte Bevölkerungsgruppen besonders lautstark ihre Stimme erheben, ergibt einen ebenso überraschenden wie nachdenklich stimmenden Befund: GKV-Versicherte erheben in diesem Zusammenhang sehr viel nachdrücklicher Forderungen zur Qualitätssicherung als dies bei privat Versicherten der Fall ist. Es liegt nahe, dass dies auch ein Reflex auf Medienberichte über eine "Zwei-Klassen-Medizin" ist, deren Wahrheitsgehalt zwar von Gesundheitspolitikern bestritten, von Ärzteverbänden jedoch immer wieder unterstrichen worden ist.
Der Aufsatz steht hier im Volltext zur Verfügung Gerd Marstedt, Juliane Landmann: Qualitätssicherung im Versorgungssystem: Patienten fordern weit reichende Veränderungen (Gesundheitsmonitor Newsletter 4/2009)
Gerd Marstedt, 6.1.10
Große Mehrheit der Bevölkerung erkennt im Gesundheitssystem Merkmale einer "Zwei-Klassen-Medizin" - nicht nur bei Wartezeiten
 Eine jetzt veröffentlichte repräsentative Bevölkerungsumfrage des "Gesundheitsmonitor" der Bertelsmann-Stiftung hat gezeigt, dass in der Bevölkerung eine unterschiedliche Behandlung von Kassen- und Privatpatienten sehr deutlich wahrgenommen wird. Diese "Zwei-Klassen-Medizin" wird nicht nur bei den als "Service- und Komfort-Merkmal" definierten Wartezeiten, sondern auch bei der Versorgung selbst wahrgenommen: Genannt werden die Zeit, die sich Ärzte für Patienten nehmen, die Berücksichtigung neuester medizinischer Erkenntnisse bei Untersuchungen und Therapien sowie die Verschreibung von Medikamenten mit größerer Wirksamkeit und weniger Nebenwirkungen.
Eine jetzt veröffentlichte repräsentative Bevölkerungsumfrage des "Gesundheitsmonitor" der Bertelsmann-Stiftung hat gezeigt, dass in der Bevölkerung eine unterschiedliche Behandlung von Kassen- und Privatpatienten sehr deutlich wahrgenommen wird. Diese "Zwei-Klassen-Medizin" wird nicht nur bei den als "Service- und Komfort-Merkmal" definierten Wartezeiten, sondern auch bei der Versorgung selbst wahrgenommen: Genannt werden die Zeit, die sich Ärzte für Patienten nehmen, die Berücksichtigung neuester medizinischer Erkenntnisse bei Untersuchungen und Therapien sowie die Verschreibung von Medikamenten mit größerer Wirksamkeit und weniger Nebenwirkungen.
Gefragt wurde in der Studie, an der eine repräsentative Stichprobe von rund 1.500 Versicherten im Alter von 18-79 Jahren beteiligt war, bei welchen Versorgungsaspekten sie eine "Zwei-Klassen-Medizin" wahrnehmen. (vgl. Grafik) 90 Prozent aller Befragten nennen in diesem Zusammenhang Wartezeiten für einen Termin und 84 Prozent Wartezeiten in der Praxis. Aber auch in Bezug auf andere Aspekte sagt eine Mehrheit, dass Privatpatienten besser gestellt seien. Dies gilt für die Zeit, die sich Ärzte für Patienten nehmen, ebenso wie für die Berücksichtigung neuester medizinischer Erkenntnisse bei Untersuchungen und Therapien oder die Verschreibung von Medikamenten mit größerer Wirksamkeit und weniger Nebenwirkungen. Am seltensten wird Ärzten ein unterschiedliches Maß an Freundlichkeit unterstellt. 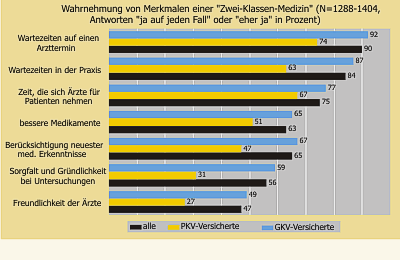
Fast ein Drittel der Befragten (32%) erkennt bei allen sieben abgefragten Aspekten eine Ungleichbehandlung, 72 Prozent sehen dies bei vier oder mehr Aspekten gegeben. Damit zeigt sich, die Bevölkerung nimmt nicht nur eine Ungleichbehandlung bei den oft als "Service- und Komfort- Merkmal" definierten Wartezeiten wahr. Diese Wahrnehmung erstreckt sich auch auf Aspekte, die die medizinische Versorgung selbst betreffen.
Es ist anzunehmen, dass durch die große Verbreitung der Denkfigur "In Deutschland gibt es eine Zwei-Klassen-Medizin" auch ganz unabhängig von persönlichen Erfahrungen erhebliche Vorbehalte und Vorurteile gegenüber dem Versorgungssystem entstanden sind - die sich vermutlich auch im Vertrauensverhältnis zu praktizierenden Ärzten niederschlagen. Die Wahrnehmung einer Zwei-Klassen- Medizin könnte sich auch in generalisierender Weise negativ auf das Gesamtvertrauen in unserem Gesundheitssystem auswirken. Die Aussage "Im Großen und Ganzen funktioniert unser Gesundheitswesen gut, nur kleinere Verbesserungen sind notwendig" findet bei knapp 60 Prozent derjenigen Zustimmung, die keinerlei Merkmale einer Ungleichbehandlung von Kassen- und Privatpatienten erkennen. Bei denjenigen, die durchgängig Zwei-Klassen-Strukturen erkennen, zeigt sich ein solches Grundvertrauen in das Gesundheitssystem nur noch bei jedem Vierten (26%).
Weitere Ergebnisse der Befragung:
• Die Aufgliederung des Gesundheitssystems in GKV und PKV ist in Europa eine deutsche Besonderheit. Tendenzen zur Aufhebung dieses zweigliedrigen Systems treffen nur in der Variante auf mehrheitliche Zustimmung, in der die Private Krankenversicherung aufgelöst wird. Die Forderung der FDP nach einer Umwandlung auch der GKV-Kassen in private Versicherungen wird selbst bei PKV-Versicherten nur von einer Minderheit (29%) unterstützt. Auch weniger radikale Modelle zur Veränderung stoßen auf wenig Gegenliebe bei den Versicherten. Dies gilt vor allem für die Modelle, die auf sehr unterschiedliche Art zwischen Elementen einer "Grundsicherung" und "Komfortleistungen" differenzieren.
• Jegliche Veränderung lehnen die Versicherten jedoch nicht ab. Einige Vorschläge stoßen auf sehr hohe Zustimmung: Zum Beispiel die schärfere Kontrolle der Notwendigkeit medizinischer Leistungen oder staatliche Zuschüsse für das Gesundheitssystem durch Einsparungen in anderen Bereichen.
• Von allen eindeutig abgelehnt werden allgemeine Leistungskürzungen, Leistungskürzungen für Ältere, eine Anhebung der Kassenbeiträge sowie eine stärkere private Finanzierung einzelner medizinischer Leistungen. Hier finden sich Zustimmungsquoten in der Höhe von nur 5 bis 23 Prozent.
• Drei Vorschläge finden mit Zustimmungsquoten zwischen 62 Prozent und 82 Prozent sehr breite Resonanz: Eine schärfere Kontrolle der Notwendigkeit medizinischer Leistungen (Wissenschaftler würden sagen: der Evidenz), staatliche Zuschüsse für das Gesundheitssystem und Leistungseinschränkungen bei Versicherten, die höhere Gesundheitsrisiken aufweisen.
Fazit der Wissenschaftler: "Der in unserer Befragung am positivsten bewertete Vorschlag: 'mehr Kontrollen, ob alle verordneten medizinischen Leistungen, Medikamente usw. auch tatsächlich nötig sind', sollte die Entscheidungsträger im Politikfeld Gesundheit aufhorchen lassen. Vielleicht sind die Rationalisierungsreserven doch noch nicht erschöpft? Wissenschaftliche Meta-Analysen und Cochrane-Reviews, die sich mit Teilaspekten der medizinischen Versorgung beschäftigen, sprechen jedenfalls dafür. Immer wieder ist hier, auch im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, Überversorgung festgestellt worden. Zum Beispiel beim Einsatz bildgebender Verfahren bei Rückenschmerzen, bei der Verschreibung von Antibiotika bei Erkältungen und Nasennebenhöhlenentzündungen, bei Knochendichtemessungen und vielem anderem mehr."
Die Studie ist hier im Volltext verfügbar: Gesundheitsmonitor 3/2009: GKV-Reformen im Urteil der Versicherten: Erst einmal Systemdefizite beheben!
Gerd Marstedt, 24.10.09
Gesundheitspolitische Differenzen zwischen Parteien werden von Wählern nicht geteilt, dort herrscht in vielen Fragen Konsens
 Bei Bevölkerungsumfragen, in denen das Thema "Gesundheitsreform" angesprochen wird, ist heftige Kritik vorhersehbar, und zwar bei Wählern aus allen politischen Lagern. Ungeachtet der jeweiligen Parteipräferenz nimmt man die Vorhaben der jeweiligen Gesundheitsreform nur noch als "Hick-Hack" wahr. Doch gilt dies durchgängig, sind sich Wähler der Linken, der Grünen und der FDP, der SPD und der CDU/CSU tatsächlich in den allermeisten Punkten, die unser Gesundheitssystem und Reformoptionen betreffen, einig? Dieser Frage ist der aktuelle Newsletter des "Gesundheitsmonitor" (Nr. 4/2008) nachgegangen.
Bei Bevölkerungsumfragen, in denen das Thema "Gesundheitsreform" angesprochen wird, ist heftige Kritik vorhersehbar, und zwar bei Wählern aus allen politischen Lagern. Ungeachtet der jeweiligen Parteipräferenz nimmt man die Vorhaben der jeweiligen Gesundheitsreform nur noch als "Hick-Hack" wahr. Doch gilt dies durchgängig, sind sich Wähler der Linken, der Grünen und der FDP, der SPD und der CDU/CSU tatsächlich in den allermeisten Punkten, die unser Gesundheitssystem und Reformoptionen betreffen, einig? Dieser Frage ist der aktuelle Newsletter des "Gesundheitsmonitor" (Nr. 4/2008) nachgegangen.
Hinweise, dass parteipolitische Sympathien auch sehr viel aussagen können über gesundheitspolitische Sichtweisen, kamen unlängst aus den USA. Anhänger der Republikaner, so hieß es im März 2008, halten zu 68 Prozent das US-Gesundheitssystem für das beste der Welt - ganz im Unterschied zu den Anhängern der oppositionellen Demokraten, bei denen nur 32 Prozent dieser Meinung waren. Bei derselben Umfrage sagten lediglich 19 Prozent der Republikaner, aber dreimal so viele Demokraten (56%), sie würden bei der kommenden Präsidentschaftswahl auch für einen Kandidaten stimmen, der das US-amerikanische Gesundheitssystem umgestalten und an das anderer Länder wie Kanada, Großbritannien oder Frankreich angleichen will.
Spielt die gesundheitspolitische Programmatik der Parteien überhaupt eine Rolle für die Wahlentscheidung von Bürgern? Dass die Gesundheitspolitik die eigene Wahlentscheidung beeinflusst, sagen in einer Forsa-Umfrage fast 90 Prozent der Befragten. Deutlich wird in der Umfrage allerdings auch: Nur wenige Personen kennen tatsächlich die gesundheitspolitischen Konzepte der Parteien (vgl. Präventionsinitiative Gesundheitsbox: Gesundheitspolitik: Kosten - Leistungen - Vorsorge. Wie würden die Bürger entscheiden?).
Anhand der Daten des Gesundheitsmonitor aus den Jahren 2001-2008 lassen sich nun folgende Befunde aufzeigen :
• Hohe Zustimmung zum Solidarprinzip: 59 Prozent der Befragten bewerten alle Aspekte des Solidarprinzips zumindest als "überwiegend gerecht", teilweise aber auch als "vollkommen gerecht". Überprüft man, ob sich für diese Gesamtbewertung des Solidarprinzips Unterschiede finden je nach Parteipräferenz, dann zeigt sich mit einer Ausnahme eine sehr hohe Übereinstimmung. Lediglich FDP-Anhänger weichen nach unten ab. Bei den Sympathisanten der übrigen Parteien schwankt die positive Gesamtbewertung des Solidarprinzips nur geringfügig. Diese Quote beträgt für die Anhänger der Parteien: Bündnis90/Grüne 68 Prozent, SPD 66 Prozent, CDU/CSU 62 Prozent, PDS/Linke 60 Prozent, FDP 52 Prozent.
• Die beiden großen Parteien in Deutschland, SPD und CDU/CSU, waren mit überaus konträren Konzepten zur Gesundheitsreform und Finanzierung der GKV in den Bundestagswahlkampf 2005 gezogen. Die CDU/CSU favorisierte die sogenannte Kopfpauschale (später auch "Gesundheitsprämie" genannt) mit einem für alle Versicherten einheitlichen Beitrag, zu dem es unterhalb eines bestimmten Einkommens einen staatlichen Zuschuss geben sollte. Die SPD andererseits warb für ihr Modell der "Bürgerversicherung". Die Differenzierung nach Parteipräferenz macht deutlich, dass die Kopfpauschale selbst bei CDU-Sympathisanten keine Mehrheit findet und nur von 46 Prozent als gerecht beurteilt wird. Bemerkenswert ist auch, dass 68 Prozent der CDU/CSU-Anhänger und 62 Prozent der FDP-Anhänger es befürworten würden, wenn Selbstständige und Beamte in die Gesetzliche Krankenversicherung eintreten müssten.
• Die Forderung der FDP nach einer Auflösung der GKV und Einführung einer privaten Risikoabsicherung aller Bürger
ist auch in einer Erhebungswelle des Gesundheitsmonitors zur Diskussion gestellt worden, und zwar im Frühjahr 2006. Lediglich 9 Prozent aller Befragten (N=1.426) stimmen hier jedoch zu, 76 Prozent sind dagegen, 15 Prozent unentschlossen. Betrachtet man die Zustimmungsquoten nach Parteipräferenz, dann ändert sich das Bild nicht nachhaltig. Die Quote der Zustimmung ist bei Sympathisanten fast aller Parteien sehr niedrig, sie schwankt zwischen 4 Prozent (PDS/Linke) und 13 Prozent (CDU/CSU). Bei Nichtwählern und Unentschlossenen liegt die Quote mit 6 Prozent unter dem Gesamtdurchschnitt. Lediglich in der FDP fällt sie wie vorhersehbar mit 29 Prozent höher aus. Deutlich wird damit zugleich aber auch, dass selbst bei den Anhängern der FDP nicht einmal jeder Dritte eine Kernforderung "seiner" Partei persönlich unterstützt.
Unter dem Strich zeigt sich damit: "Insgesamt haben wir es mit einer Bewertung des Gesundheitssystems auf zwei unterschiedlichen Ebenen zu tun, die über alle Parteigrenzen hinaus vorzufinden ist. Einerseits besteht eine überaus hohe Zustimmung zum gegenwärtigen Krankenversicherungssystem mit dem Solidarprinzip. Große Teile der Bevölkerung würden sogar einen Einbezug von Selbstständigen und Beamten in die GKV nach dem Modell der Bürgerversicherung befürworten. Andererseits findet sich jedoch auch ein hohes Maß an Unzufriedenheit und Kritik, die die Ausgestaltung dieses Prinzips (z. B. Zuzahlungen) und die Strukturen im Versorgungssystem (z. B. Wartezeiten) betreffen."
Der Newsletter 4/2008 ist hier kostenlos verfügbar: Gesundheitspolitische Positionen und Parteipräferenzen der Wähler
Gerd Marstedt, 18.11.08
Bevölkerungsumfrage: Pharma-Unternehmen haben sehr großen Einfluss in der Gesundheitspolitik, genießen aber nur wenig Vertrauen
 Eine repräsentative Bevölkerungsumfrage in Auftrag der Techniker Krankenkasse (TK) bei 2.000 erwachsenen Deutschen hat jetzt eine Reihe von Kritikpunkten der Bevölkerung im Hinblick auf das Gesundheitssystem und beschlossene Reformen zutage gebracht. Bei der Frage, welche Einrichtungen großen Einfluss auf Reformprozesse im Gesundheitswesen haben, wird die Pharmaindustrie am häufigsten genannt (54%), noch weit vor der Bundesregierung (33%), Krankenkassen (19%) oder Ärzteverbänden (15%), wobei Interessenvertretungen der Patienten mit 4 Prozent der Nennungen ganz am Schluss liegen. Der als überaus stark wahrgenommene Einfluss von Pharma-Unternehmen steht jedoch in deutlich Widerspruch zum Vertrauen, das die Bevölkerung in die Arzneimittel-Hersteller haben. Lediglich 10 Prozent sagen, "dass diese in der politischen Diskussion um die Gesundheitsreform das Richtige tun." Allerdings genießen auch andere Akteure und Einrichtungen nur wenig Vertrauen, noch am häufigsten wird hier die eigene Krankenkasse genannt (26%).
Eine repräsentative Bevölkerungsumfrage in Auftrag der Techniker Krankenkasse (TK) bei 2.000 erwachsenen Deutschen hat jetzt eine Reihe von Kritikpunkten der Bevölkerung im Hinblick auf das Gesundheitssystem und beschlossene Reformen zutage gebracht. Bei der Frage, welche Einrichtungen großen Einfluss auf Reformprozesse im Gesundheitswesen haben, wird die Pharmaindustrie am häufigsten genannt (54%), noch weit vor der Bundesregierung (33%), Krankenkassen (19%) oder Ärzteverbänden (15%), wobei Interessenvertretungen der Patienten mit 4 Prozent der Nennungen ganz am Schluss liegen. Der als überaus stark wahrgenommene Einfluss von Pharma-Unternehmen steht jedoch in deutlich Widerspruch zum Vertrauen, das die Bevölkerung in die Arzneimittel-Hersteller haben. Lediglich 10 Prozent sagen, "dass diese in der politischen Diskussion um die Gesundheitsreform das Richtige tun." Allerdings genießen auch andere Akteure und Einrichtungen nur wenig Vertrauen, noch am häufigsten wird hier die eigene Krankenkasse genannt (26%).
Weitere Ergebnisse der Befragung:
• Es gibt ein klares Mitgliedervotum für die Krankenkassen, sich aktiv an der Reformdiskussion zu beteiligen. 76% der Bevölkerung wünschen sich eine aktivere Rolle der Krankenkasse bzw. Krankenversicherung, wenn es um die aktuelle Gesundheitsreform geht.
• Gegenüber diesen Reformen besteht eher Skepsis und Kritik. Auf die Frage: "Zur Zeit wird in den Medien viel über die aktuelle Gesundheitsreform berichtet, die seit rund einem Jahr in Kraft ist. Wenn Sie einmal an all das denken, was Sie in der letzten Zeit darüber gehört, gesehen oder gelesen haben, z.B. zum Gesundheitsfonds, Rabatt auf Arzneimittel oder Wahltarifen: Wie sehr stimmen Sie der Aussage zu: 'Ich bin davon überzeugt, dass diese Reformen positive Auswirkungen auf das Gesundheitssystem hier in Deutschland haben werden'?" antworten 66% mit "stimme eher nicht / stimme überhaupt nicht zu".
• Fragen zum Gesundheitsfonds erbringen überwiegend negative und ablehnende Antworten, was allerdings teilweise auch an suggestiven Fragenformulierungen der von FORSA durchgeführten Befragung beruhen könnte wie z.B.: "Wirtschaftlich handelnde Unternehmen können ihre Ein- und Ausgaben üblicherweise selbst steuern. Folge des zentralen Gesundheitsfonds wäre unter anderem, dass die gesetzlichen Krankenkassen keinen Einfluss mehr auf die Höhe ihrer Beitragseinnahmen haben, da ihnen diese ja als Pauschalbetrag vom Gesundheitsfonds zugewiesen würden. Meinen Sie, dass dies ein wirtschaftliches Handeln der Krankenkassen eher fördert oder eher behindert?" (72% antworten hier mit "eher behindert")
• Wie es scheint, würde ein größerer Teil der Versicherten auch höhere Beiträge akzeptieren, wenn dies bedeutet, dass die Kassen zukünftig teurere Versorgungsleistungen (durch den medizinischen Fortschritt) übernehmen. 64% sagen "ich möchte auch weiterhin am medizinischen Fortschritt teilhaben und akzeptiere dafür auch höhere Beiträge".
• Das Solidarprinzip wird nach wie vor positiv bewertet (ca. 80% finden die Idee sehr gut oder gut). Allerdings ist der Anteil der "sehr gut" Bewertungen seit 2004 zurück gegangen von 30% auf 19%.
• Bei der Einschätzung der zukünftigen Entwicklungen herrscht unter dem Strich eher Pessimismus: 92% befürchten steigende Beitragssätze, 66% weitere Einschränkungen im GKV-Leistungskatalog, 41% ein Sinken der Versorgungsqualität.
• Das Meinungsbild zu den Rabattverträgen der Kassen mit Arzneimittelherstellern zeigt überwiegend Zustimmung zu den Sparmaßnahmen. 62% sagen: "Ich finde es gut, wenn meine KK solche Rabattverträge abschließt, denn das hilft, die Kosten im Gesundheitssystem zu dämpfen - dafür nehme ich den Wechsel von einem gewohnten zu einem anderen wirkstoffgleichen Arzneimittel in Kauf." Nur 37% votieren dagegen: "Ich bin durchaus dafür, dass die Krankenkassen Kosten einsparen, aber wenn ich deshalb von einem gewohnten Arzneimittel auf ein anderes wechseln müsste, dann ist mir das zu unsicher, auch wenn beide die gleichen Wirkstoffe haben."
• Pressemitteilung der TK: Umfrage: Schlechte Noten für den Gesundheitsfonds
• Befragungsergebnisse (PDF, 27 Seiten) TK-Meinungspuls Gesundheit 2008. Ein Jahr GKV-WSG: Eine Bilanz
Gerd Marstedt, 17.4.2008
Mehrheit der Bevölkerung nimmt Gesundheitsreform nur noch als "Hick-Hack" wahr
 Die geplante Gesundheitsreform ist für die meisten Bundesbürger undurchschaubar. Nicht nur die Details des Gesetzesentwurfes stoßen auf Unverständnis. Auch die grundsätzliche Zielrichtung bleibt den meisten Bürgern verborgen. Sehr viele Menschen würden die politische Diskussion über die Gesundheitsreform nur noch als "Hick-Hack" zwischen den Parteien ohne erkennbares Konzept empfinden, erklärte Manfred Güllner, Chef des Meinungsforschungsinstituts FORSA, das die Befragung im Auftrag des Deutschen Beamtenbundes durchgeführt hat.
Die geplante Gesundheitsreform ist für die meisten Bundesbürger undurchschaubar. Nicht nur die Details des Gesetzesentwurfes stoßen auf Unverständnis. Auch die grundsätzliche Zielrichtung bleibt den meisten Bürgern verborgen. Sehr viele Menschen würden die politische Diskussion über die Gesundheitsreform nur noch als "Hick-Hack" zwischen den Parteien ohne erkennbares Konzept empfinden, erklärte Manfred Güllner, Chef des Meinungsforschungsinstituts FORSA, das die Befragung im Auftrag des Deutschen Beamtenbundes durchgeführt hat.
Problematisch sei dies, so Güllner, weil 38% der insgesamt 1000 Befragten angaben, sie würden die Berichterstattung regelmäßig verfolgen und weitere 46% sagten, sie würden dies zumindest gelegentlich tun. Die Befragung habe gezeigt, dass die Bürger die Diskussion zur Gesundheitsreform durchaus in den Medien verfolgen und auch zu Veränderungen bereit seien. Sie unterstellen der Regierung jedoch Konzeptlosigkeit und befürchten eine Verschlechterung der medizinischen Versorgung.
Einige weitere Ergebnisse der Umfrage:
• Das Unverständnis geht quer durch alle Parteien und alle Schichten: 88% der Arbeiter können den Regierungsplänen nicht mehr folgen, aber auch 74% der Selbstständigen, Angestellten und Beamten nicht. 86% sehen nur noch ein Hick-Hack, aber kein erkennbares Konzept mehr.
• Die Zufriedenheit mit der Gesundheitsversorgung hat drastisch nachgelassen. Zeigten sich 2001 noch 66% mit dem System zufrieden, so sind es 2007 nur noch 45%. Und für die Zukunft werden von 71% weitere Verschlechterungen in den nächsten fünf Jahren befürchtet.
• Bei der Frage, wem man bei der Gesundheitsreform noch vertraut, liegen die Ärzte mit 62% weit vorn. Den Kassen trauen nur neun Prozent der Bürger, den Politikern sogar nur sechs Prozent.
• Die Hälfte der Befragten erkennt durchaus, dass es "im System der Gesundheitsversorgung grundlegende Veränderungen" geben muss. Allerdings meint ebenfalls die Hälfte, dass sich seit der letzten Reform 2004 die Gesundheitsversorgung in Deutschland verschlechtert habe. Ein Detailaspekt: 72% halten die seinerzeit eingeführte Praxisgebühr für überflüssig oder wenig sinnvoll.
• Auf die Frage, was das vermutete Ziel der Gesundheitsreform sei - die Versorgung der Patienten auf heutigem Niveau oder die zukünftige Finanzierung - antworteten 55% "die zukünftige Finanzierung". Nur 38 Prozent gaben die Versorgung der Patienten an. Dazu Güllner: Die Menschen sehen den fachlichen Sinn der Reform nicht mehr", sie werde überwiegend als "Haushaltsplan-Gestaltung" wahrgenommen.
Die Folien mit den Umfrageergebnissen sind auf der Website des Auftraggebers Deutscher Beamtenbund verfügbar:
Die Bürger und die Gesundheitsreform: Wahrnehmung und Einschätzungen
Gerd Marstedt, 10.1.2007
Bevölkerung befürchtet Zuspitzung der Zwei-Klassen-Medizin durch Gesundheitsreform
 Zum sechsten Mal in Folge ermittelte die Continentale Krankenversicherung a.G. in Zusammenarbeit mit dem Meinungsforschungsinstitut TNS Infratest in einer repräsentativen Befragung von 1.250 Deutschen die grundsätzliche Haltung der Bevölkerung zu diesem Thema. Die Deutschen haben auch vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussionen um eine Reform des Gesundheitswesen kaum Hoffnung auf eine Verbesserung der Situation in der Zukunft. Obwohl bereits bei der Befragung des vergangenen Jahres der Anteil der Skeptiker in einigen Bereichen nahe 100 Prozent lag und schwerlich Steigerungen möglich waren, sind die Menschen 2006 insgesamt noch negativer eingestellt.
Zum sechsten Mal in Folge ermittelte die Continentale Krankenversicherung a.G. in Zusammenarbeit mit dem Meinungsforschungsinstitut TNS Infratest in einer repräsentativen Befragung von 1.250 Deutschen die grundsätzliche Haltung der Bevölkerung zu diesem Thema. Die Deutschen haben auch vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussionen um eine Reform des Gesundheitswesen kaum Hoffnung auf eine Verbesserung der Situation in der Zukunft. Obwohl bereits bei der Befragung des vergangenen Jahres der Anteil der Skeptiker in einigen Bereichen nahe 100 Prozent lag und schwerlich Steigerungen möglich waren, sind die Menschen 2006 insgesamt noch negativer eingestellt.
Ein Großteil der gesetzlich Versicherten glaubt weiterhin nicht an eine langfristig gesicherte gute medizinische Versorgung. So sind 79% (76% in 2005) der Meinung, eine ausreichende medizinische Versorgung durch das gesetzliche System gebe es bereits heute nicht mehr oder werde es in Zukunft nicht mehr geben. 90% sagen, dass gute Vorsorgung nur durch private Vorsorge möglich sei. Sogar 95% sind der Ansicht, jetzt oder in Zukunft für eine gute medizinische Versorgung über die Kassenbeiträge hinaus viel Geld bezahlen zu müssen.
54% der Befragten geben die Einschätzung ab, dass ein Großteil der Bevölkerung zukünftig nicht mehr vom medizinischen Fortschritt profitieren wird und weitere 31% meine, dass dies schon jetzt der Fall ist. Damit urteilen insgesamt 85%, dass das Gesundheitssystem bereits jetzt oder zumindest in Zukunft Merkmale einer Zwei-Klassen-Medizin aufweist.
Im Vergleich zum Vorjahr konstant geblieben ist die Zahl der Bürger, die sich von Leistungseinschränkungen im Gesundheitswesen betroffen sieht. Wie schon 2005 gaben auch 2006 insgesamt 43% der gesetzlich Versicherten an, Ärzte hätten bei Behandlungen oder Rezepten Einschränkungen vorgenommen oder diese in Rechnung stellen wollen.
• Die wichtigsten Ergebnisse der Studie sind zusamnmengefasst in einem Pressetext zur Befragung
• Die komplette Studie kann auf der Website der Continentale Krankenversicherung a.G. als PDF-Datei heruntergeladen werden: Continentale-Studie 2006: Gesundheitsreform - Die Meinung der Bevölkerung
Gerd Marstedt, 1.12.2006
Jeder zweite GKV-Versicherte hat bereits seine Krankenkasse gewechselt
 Zehn Jahre Wettbewerb zwischen den gesetzlichen Krankenkassen haben zu einer erheblichen Wechselbereitschaft bei den Versicherten geführt. Vor allem besserverdienende und gebildete Mitglieder wechseln ihre Krankenkasse. Insbesondere dann, wenn Krankenkassenbeiträge als zu hoch wahrgenommen werden, steigt das Interesse an einem Kassenwechsel. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO).
Zehn Jahre Wettbewerb zwischen den gesetzlichen Krankenkassen haben zu einer erheblichen Wechselbereitschaft bei den Versicherten geführt. Vor allem besserverdienende und gebildete Mitglieder wechseln ihre Krankenkasse. Insbesondere dann, wenn Krankenkassenbeiträge als zu hoch wahrgenommen werden, steigt das Interesse an einem Kassenwechsel. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO).
Eine Analyse von Wechselbereitschaft und Beitragssatzkenntnis bei Mitgliedern der GKV zeigt, dass die Bereitschaft zum Kassenwechsel im GKV-System seit 1996 zugenommen hat, nahezu jeder Zweite hat sich bereits für eine andere Kasse entschieden. Aktuell denken 18 Prozent der Mitglieder über einen Kassenwechsel nach. "Dabei zeigt sich ein deutlicher Zusammenhang zwischen der größeren Wechselbereitschaft und dem höheren Einkommen und der Bildung der Versicherten", stellt der Autor der Studie, Klaus Zok, fest.
Bei der Frage nach den Gründen für den Wechsel spielt der monatliche Krankenkassenbeitrag eine wichtige Rolle. Für Mitglieder, die sich für eine andere Kasse entschieden haben, war vor allem der Beitragssatz ausschlaggebend. "Diejenigen, die sich aktuell für einen Wechsel interessieren, legen neben dem Beitragssatz auch Wert auf bessere Leistungen und guten Service", stellt Zok fest. Zugleich reagieren aber GKV-Mitglieder auf einen vergleichsweise hohen Beitragssatz der eigenen Krankenkasse und denken dann vermehrt über einen Wechsel nach - die Kassenbindung nimmt mit steigendem Beitragssatz deutlich ab.
Bei der Frage nach den Kriterien für die Wahl einer Krankenkassen sind auch externe Einflussfaktoren von Bedeutung. Die Mitglieder, die gewechselt haben, geben dabei am häufigsten an, dass der Arbeitgeber bzw. die Firma ihre Kassenwahl beeinflusst hat (36,0 %). An zweiter Stelle werden Personen aus dem Familien- und Bekanntenkreis genannt (32,7 %). Für 17,5 % der Wechsler waren die Medien, wie Zeitungen, Fernsehen und Internet, ein relevanter Faktor bei der Kassenwahl.
Dabei ist die genaue Kenntnis des eigenen Krankenkassenbeitrages eher mäßig. Zwar hat sich die Kenntnis des Beitragssatzes im GKV-Markt im Zeitverlauf insgesamt verbessert, jedoch können rund 42 % der Mitglieder auch heute keine Beitragssatzangabe machen, lediglich 46,0 % aller GKV-Mitglieder machen halbwegs realistische Angaben. Wie schon beim Krankenkassenwechsel steigt die Kenntnis des Beitragssatzes mit höherem Einkommen und höherem Bildungsniveau.
Download der PDF-Datei: K. Zok: Beitragssatzkenntnis und Wechselbereitschaft in der GKV. Ergebnisse von Repräsentativ-Umfragen bei GKV-Mitgliedern im Zeitverlauf, in: WIdO-monitor, Ausgabe 2/2006, 8 Seiten
Gerd Marstedt, 25.10.2006
Bevölkerungsmehrheit wünscht Einbeziehung auch Selbständiger, Beamter und Besserverdienender in die GKV
 Die große Koalition will 2006 über eine grundlegende Reform zur Finanzierung der GKV entscheiden. Dabei sind unterschiedliche Optionen in der Diskussion, unter anderem die Erweiterung des Versichertenkreises auf alle Bürger (nach einer Übergangszeit auch auf Beamte, Selbstständige und Besserverdienende) und die Ausweitung der Beitragserhebung auf alle Einkunftsarten (neben Erwerbseinkommen auch Erträge aus Mieten, Kapitalanlagen, selbstständiger Arbeit). Ebenfalls diskutiert werden die Aufhebung der Versicherungspflichtgrenze, die Anhebung der Beitragsbemessungsgrundlage auf das Niveau der gesetzlichen Rentenversicherung (derzeit 5100 Euro) und das Angebot von privaten Zusatzversicherungen für medizinisch nicht notwendige Leistungen.
Die große Koalition will 2006 über eine grundlegende Reform zur Finanzierung der GKV entscheiden. Dabei sind unterschiedliche Optionen in der Diskussion, unter anderem die Erweiterung des Versichertenkreises auf alle Bürger (nach einer Übergangszeit auch auf Beamte, Selbstständige und Besserverdienende) und die Ausweitung der Beitragserhebung auf alle Einkunftsarten (neben Erwerbseinkommen auch Erträge aus Mieten, Kapitalanlagen, selbstständiger Arbeit). Ebenfalls diskutiert werden die Aufhebung der Versicherungspflichtgrenze, die Anhebung der Beitragsbemessungsgrundlage auf das Niveau der gesetzlichen Rentenversicherung (derzeit 5100 Euro) und das Angebot von privaten Zusatzversicherungen für medizinisch nicht notwendige Leistungen.
Im "Gesundheitsmonitor" der Bertelsmann-Stiftung wurde eine repräsentative Bevölkerungsstichprobe (N=1.500 Bürger/innen im Alter von 18-79 Jahren) gefragt, welche dieser Reformoptionen sie am meisten zustimmen. Als Ergebnis zeigt sich:
• Zwei Drittel der Bevölkerung halten es für gerecht, wenn sich zukünftig auch Beamte, Selbständige und Besserverdienende in der GKV versichern müssten,
• Mit Abstand folgt an zweiter Stelle die Einbeziehung aller Einkommensarten (also auch Mieten, Zinsen, Aktiengewinne) für die Berechnung des Krankenkassenbeitrages. 45 Prozent halten das für gerecht.
• Ähnlich hohe Unterstützung findet schließlich ein einheitlicher Pro-Kopf-Beitrag.
Im Aufsatz "Finanzierungsoptionen des Gesundheitswesens aus Bevölkerungssicht" aus der Neuveröffentlichung des "Gesundheitsmonitor 2005" werden viele weitere Befragungsergebnisse vorgestellt. Dabei zeigt sich auch, dass die Umverteilungs-Prinzipien des Solidarprinzips in der GKV (Gesunde unterstützen Kranke, Junge unterstützen Alte, Gutverdiener unterstützen Schlechtverdiener, Alleinstehende unterstützen Familien) mit Ausnahme der Familienversicherung in der Bevölkerung sehr große Unterstützung finden. Mehr als zwei Drittel finden diese Regelungen gerecht, nur die Familienversicherung fällt mit 61% Zustimmung ab.
Der Aufsatz kann als PDF-Datei kostenlos heruntergeladen werden: Jan Böcken, Robert Amhoff: Finanzierungsoptionen des Gesundheitswesens aus Bevölkerungssicht
Gerd Marstedt, 31.12.2005
Versicherungsvergleich versus Versicherungsberater: gute Zeiten für "Herrn Kaiser"
 Das private Unternehmen "Continentale Krankenversicherung a.G." führte seit mit wissenschaftlicher Unterstützung seit mehreren Jahren repräsentative Bevölkerungsumfragen über wichtige Einstellungen zum deutschen Gesundheitssystem und einigen seiner Strukturmerkmale durch. Sämtliche Studien oder auch allein die Grafiken sind als PDF-Dateien auf der Website des Unternehmens erhältlich.
Das private Unternehmen "Continentale Krankenversicherung a.G." führte seit mit wissenschaftlicher Unterstützung seit mehreren Jahren repräsentative Bevölkerungsumfragen über wichtige Einstellungen zum deutschen Gesundheitssystem und einigen seiner Strukturmerkmale durch. Sämtliche Studien oder auch allein die Grafiken sind als PDF-Dateien auf der Website des Unternehmens erhältlich.
Gestartet wurde die Reihe im Jahr 2000 mit einer Umfrage zur "Informiertheit und Kriterien zur PKV und GKV".
Im Jahre 2002 stand das Thema "Zusatzversicherung und GKV - die Einstellung der Bevölkerung" auf der Agenda.
Die am 3.11. 2005 veröffentlichte 2005-Studie beschäftigt sich mit dem Thema "Versicherungsvergleiche - Anhänger und Kritiker". Egal ob es sich um den Wechsel von einer gesetzlichen Krankenkasse in eine private Krankenversicherung handelt oder um einen Wechsel zwischen zwei gesetzlichen Krankenkassen: Eine immer größer werdende Anzahl von Tests, Rankings und anderen Beratungsangebote stehen den Wechselinteressierten auf Papier oder im Internet für ihre Entscheidung zur Verfügung. Scheinbar "altmodisch" gibt es aber bei allen Versicherungen und Kassen immer noch den "guten alten Herr Kaiser".
Die Mitte 2005 durchgeführte Befragung von 1.090 gesetzlich und 154 privat krankenversicherten Personen nach der Bedeutung von Versicherungsvergleichen bei einer Überlegung, die Versicherung zu wechseln, förderte Verblüffendes zu Tage:
• Nur für 45 Prozent spielen Vergleiche eine große oder sehr große Bedeutung, für 49 Prozent dagegen nur eine geringe oder gar keine Bedeutung.
• Selbst den Personen, denen Vergleiche wichtig sind, vertrauen Vergleichen nicht (63 Prozent) oder sind skeptisch, dass in Zeitschriften publizierte Vergleiche nur dazu dienen, deren Auflage zu erhöhen.
• Für eine knappe Mehrheit der Befragten (47 Prozent) ist statt aller Vergleiche der Versicherungsvermittler entscheidend. Für 46 Prozent aber auch der nicht.
• Interessant ist, dass für 52 Prozent der Krankenversicherten, denen Vergleiche überhaupt wichtig sind, letztlich der Rat eines Vermittlers entscheidend ist.
Einer Einstellungswelle von "vielen, vielen Herrn Kaisers" steht also nichts im Wege!?
Interessante Entdeckung am Rande: Bei der in jeder Studie gestellten Frage nach der "Alles-in-Allem"-Zufriedenheit mit dem Gesundheitswesen hat sich diese nach langem Tiefststand zum erste Mal wieder verbessert.
Bernard Braun, 6.11.2005
Solidarität und Eigenverantwortung: Unser Gesundheitssystem im Urteil der Bürger
 Forderung nach einer radikalen Veränderung in der Finanzierung unseres Gesundheitssystems finden sich derzeit zuhauf in Parteiprogrammen, aber auch Stellungnahmen etwa von Arbeitgeberverbänden. Diejenigen, die es betrifft, Versicherte in der GKV, kommen recht selten zu Wort. Eine repräsentative Bevölkerungsumfrage des "Gesundheitsmonitor" hat zu diesem Thema jedoch überaus interessante Ergebnisse zutage gebracht.
Forderung nach einer radikalen Veränderung in der Finanzierung unseres Gesundheitssystems finden sich derzeit zuhauf in Parteiprogrammen, aber auch Stellungnahmen etwa von Arbeitgeberverbänden. Diejenigen, die es betrifft, Versicherte in der GKV, kommen recht selten zu Wort. Eine repräsentative Bevölkerungsumfrage des "Gesundheitsmonitor" hat zu diesem Thema jedoch überaus interessante Ergebnisse zutage gebracht.
Ein zentrales Ergebnis der Studie (Verfasser: Gerd Marstedt) ist, "dass es in der Bevölkerung nach wie vor einen breiten Konsens für das Solidarprinzip gibt. Radikale marktwirtschaftliche Positionen, die eine flächendeckende Einführung privater Risikovorsorge in der Krankenversicherung wünschen, finden nur bei einer sehr kleinen Minderheit der Versicherten Zustimmung. Ebenso findet die zuletzt vielfach diskutierte und in Wahlprogrammen angekündigte Einführung von Grund- und Wahlleistungen nur etwa bei jedem Dritten Sympathie." Die mit dem Solidarprinzip verbundenen finanziellen Umverteilungsmechanismen, von denen man nicht voraussetzen kann, dass sie zum elementaren Wissensbestand aller Versicherten zählen, werden gleichwohl auch bei expliziter Benennung dieser Umverteilungsströme von der großen Mehrheit als durchweg gerecht empfunden."
Bemerkenswert ist auch ein anderer Befund: Je höher der soziale Status ist, gemessen am Bildungsniveau oder auch Einkommen, umso häufiger werden Interessen an Wahl- und Zusatztarifen innerhalb der GKV artikuliert. Interpretiert wird dies so, dass das Votum für Grund- und Wahlleistungen den Wunsch nach mehr "Supermarkt"-Charakter in der Krankenversicherung beinhaltet: Mehr Auswahlmöglichkeiten, eine größere Angebotsvielfalt, allerdings bei staatlich kontrollierter Qualität - denn die Alternative der Privaten Krankenversicherung, die diese Vielfalt schon jetzt offeriert, wird ja von nur sehr wenigen Befragten befürwortet.
Ergebnisse einer Bevölkerungsumfrage zur GKV: Solidarität und Eigenverantwortung
Gerd Marstedt, 13.8.2005
Effekte der Gesundheitsreform: Die Bürger sparen auch an ihrer Gesundheit
 Die Deutschen haben ihr Gesundheitsverhalten in den vergangenen zwölf Monaten infolge der Gesundheitsreform deutlich verändert und mit großer Mehrheit (77%) eine oder mehrere "Sparmaßnahmen" ergriffen. Nach eigenen Angaben verzichteten 40 Prozent der Bevölkerung im Krankheitsfall auf Medikamente und griffen stattdessen auf altbewährte "Hausmittel" zurück. 15 Prozent nahmen weniger rezeptpflichtige Medikamente ein, um Zuzahlungen einzusparen; 21 Prozent kauften weniger rezeptfreie Medikamente. 23 Prozent haben ihr Medikamenten-Einnahmevolumen zwar nicht grundsätzlich reduziert, aber auf preisgünstigere Arzneimittel zurückgegriffen.
Die Deutschen haben ihr Gesundheitsverhalten in den vergangenen zwölf Monaten infolge der Gesundheitsreform deutlich verändert und mit großer Mehrheit (77%) eine oder mehrere "Sparmaßnahmen" ergriffen. Nach eigenen Angaben verzichteten 40 Prozent der Bevölkerung im Krankheitsfall auf Medikamente und griffen stattdessen auf altbewährte "Hausmittel" zurück. 15 Prozent nahmen weniger rezeptpflichtige Medikamente ein, um Zuzahlungen einzusparen; 21 Prozent kauften weniger rezeptfreie Medikamente. 23 Prozent haben ihr Medikamenten-Einnahmevolumen zwar nicht grundsätzlich reduziert, aber auf preisgünstigere Arzneimittel zurückgegriffen.
Gleichzeitig setzt sich die in Deutschland seit Jahren rückläufige Tendenz zum Arztbesuch unvermindert fort: Gaben 1998 noch 56 Prozent der Deutschen an, gleich zum Arzt zu gehen, wenn sie sich unwohl fühlen oder spüren, dass sie krank werden, so sind dies aktuell nur noch 29 Prozent (Vorjahr: 35%). Rund 20 Prozent der Bundesbürger verschoben auf Grund der Praxisgebühr eigentlich sinnvolle Arztbesuche oder unterließen diese ganz. Insgesamt sind die Bundesbürger bezüglich der Entwicklungen im Gesundheitswesen nach wie vor stark verunsichert und erleben ein turbulentes Durcheinander der verschiedenen Reformansätze und Beteiligten.
Dies ergab jetzt die groß angelegte Studie "Health Care Monitoring 2005" des Kölner Marktforschungs- und Beratungsinstituts psychonomics AG zum deutschen Gesundheitsmarkt. 1.504 Bundesbürger ab 16 Jahren wurden dazu repräsentativ befragt. Die Selbstmedikationsbereitschaft der Deutschen liegt auf hohem Niveau: 56 Prozent versuchen sich, wann immer es geht, zunächst mit rezeptfreien Medikamenten selbst zu helfen. Die monatlichen Ausgaben für rezeptfreie Medikamente (OTC-Präparate) haben sich im vergangenen Jahr durchschnittlich um 10% erhöht. Der Apotheker schlüpft zunehmend in eine beratende Rolle und der Gang in die Apotheke wird zum "kleinen Arztbesuch zwischendurch".
Quelle und weitere Informationen zur Studie: psychonomics.de
Gerd Marstedt, 6.7.2005