



Home | Patienten | Gesundheitssystem | International | GKV | Prävention | Epidemiologie | Websites | Meilensteine | Impressum
Sämtliche Rubriken in
"Prävention"
Präventionspolitik, Präventionsprogramme |
Alle Artikel aus:
Prävention
Präventionspolitik, Präventionsprogramme
Soziale Ungleichheit macht psychisch krank
 Sozioökonomische Ungleichheit, gekennzeichnet durch die ungleiche Verteilung von Einkommen und Vermögen in einer Gesellschaft, hat bekanntermaßen Auswirkungen auf die psychische Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen, die sich nicht alleine durch das individuelle Haushaltseinkommens erklären lassen. Von besonderer Relevanz ist dies in der Pubertätsphase, einer sehr dynamischen neurologischen Entwicklungsphase, in der das Gehirn eine rasante Reifung durchläuft und in der auch oftmals psychische Störungen manifest werden. So kann selbst kurzfristige Ungleichheit physiologische Stressreaktionen auslöst. Die neurobiologische Forschung hat gezeigt, dass Stress Nervenbahnen beeinflusst, die an der Regulierung von Emotionen und der kognitiven Kontrolle beteiligt sind. Erhöhte Stresslevel könnten den gut dokumentierten Zusammenhang zwischen Ungleichheit und psychischer Gesundheit erklären.
Sozioökonomische Ungleichheit, gekennzeichnet durch die ungleiche Verteilung von Einkommen und Vermögen in einer Gesellschaft, hat bekanntermaßen Auswirkungen auf die psychische Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen, die sich nicht alleine durch das individuelle Haushaltseinkommens erklären lassen. Von besonderer Relevanz ist dies in der Pubertätsphase, einer sehr dynamischen neurologischen Entwicklungsphase, in der das Gehirn eine rasante Reifung durchläuft und in der auch oftmals psychische Störungen manifest werden. So kann selbst kurzfristige Ungleichheit physiologische Stressreaktionen auslöst. Die neurobiologische Forschung hat gezeigt, dass Stress Nervenbahnen beeinflusst, die an der Regulierung von Emotionen und der kognitiven Kontrolle beteiligt sind. Erhöhte Stresslevel könnten den gut dokumentierten Zusammenhang zwischen Ungleichheit und psychischer Gesundheit erklären.
W√§hrend fr√ľhere Untersuchungen prim√§r dem Einfluss individueller sozio√∂konomischer Faktoren auf die Struktur und Funktion des Gehirns nachgingen, waren die neurobiologischen Mechanismen, die strukturelle Ungleichheit mit psychischen Gesundheitsunterschieden verbinden, noch weitgehend unverstanden. Ein britisch-us-amerikanisches Forscher*innenteam hat k√ľrzlich anhand von Daten aus der Adolescent-Brain-Cognitive-Development-Studie Zusammenh√§nge zwischen regionaler Einkommensungleichheit auf der einen und der Gehirnstruktur und funktionellen Konnektivit√§t auf der anderen Seite untersucht. Dabei konnten sie auf Daten von mehr als 8.000 Kindern im Alter von 9 bis 10 Jahren aus 17 US-Bundesstaaten zugreifen, deren Einkommensungleichheit sie anhand des jeweiligen regionalen Gini-Koeffizienten analysierten. Sie erfassten die kortikale Dicke und Oberfl√§che des gesamten Gehirns sowie volumen- und regionsspezifische Ma√üe f√ľr Dicke und Oberfl√§che sowie die funktionelle Konnektivit√§t innerhalb und zwischen 12 Hirnarealen. Dabei kontrollierten sie verschiedene Confounder sowohl auf individueller als auch auf bundesstaatlicher Ebene wie Haushaltseinkommen, Bildungsniveau, Inhaftierungsrate auf Bundesstaatsebene und Anteil der Versicherten in der Armenkrankenkasse Medicaid.
Dabei zeigte sich, dass eine gr√∂√üere Einkommensungleichheit signifikant mit einem geringeren Gesamtvolumen der Gro√ühirnrinde (beta = -2,93, SF 0,49, t = -6,04, P < 0,001), einer geringeren durchschnittlichen Dicke der Gro√ühirnrinde (beta = -1,33, SF 0,55, t = -2,41, P = 0,016) und der Gesamtoberfl√§che verbunden war (beta = -2,99, SF 0,49, t = -6,06, P < 0,001). Dar√ľber hinaus war eine h√∂here Einkommensungleichheit mit einer geringeren kortikalen Dicke und Oberfl√§che in den frontalen, temporalen, parietalen und okzipitalen Hirnregionen verbunden (n = 48 Variablen). Nur in einzelnen Regionen war Ungleichheit mit einer h√∂heren Dicke und Oberfl√§che verbunden, darunter der oberen Falte im Schl√§fenlappen, der supramarginalen Windung im Scheitellappen sowie im Bereich neben dem Hippocampus, allesamt relevante Hirnbezirke f√ľr die mentale Gesundheit.
Au√üerdem war eine gr√∂√üere sozio√∂konomische Ungleichheit mit Ver√§nderungen der Konnektivit√§t innerhalb und zwischen Netzwerken assoziiert, die an h√∂heren kognitiven Funktionen und der Aufmerksamkeit beteiligt sind, wie dem Salienznetzwerk, dem dorsalen Aufmerksamkeitsnetzwerk, dem Default Mode Network, dem frontoparietalen Netzwerk und dem ventralen Aufmerksamkeitsnetzwerk. Ein Zusammenhang zur bestehenden Ungleichheit in einem Bundesstaat lie√ü sich auch f√ľr die Konnektivit√§t in Netzwerken nachweisen, die mit motorischen und sensorischen Funktionen in Verbindung stehen, darunter das auditive, das sensomotorische und das visuelle System.
Mit Hilfe von Strukturgleichungsmodelle zur √úberpr√ľfung und Absch√§tzung komplexer Beziehungen zwischen Variablen unter Ber√ľcksichtigung multipler Regressionsverfahren, Faktoren- und Pfadanalysen gingen die Forscher*innen der Frage nach, ob und inwieweit die beobachteten bzw. gemessenen Hirnvariationen den Zusammenhang zwischen sozialer Ungleichheit und den gesamten psychischen Gesundheitsproblemen begr√ľnden. Bei der Nachuntersuchung nach 18 Monaten zeigte sich ein signifikanter Gesamteffekt der Ungleichheit auf die psychische Gesundheit, der bei der Nachuntersuchung nach 6 Monaten noch nicht zu beobachten war. Die gemessenen Hirnvariablen erwiesen sich jedoch bereits zu diesem fr√ľhen Zeitpunkt als Pr√§diktoren f√ľr den nachweislichen Zusammenhang zwischen Ungleichheit und psychischen Problemen. Konkret war eine gr√∂√üere Ungleichheit mit einer geringeren Oberfl√§che und einem geringeren Volumen sowie einer h√∂heren (d. h. weniger negativen) Konnektivit√§t zwischen dem Default Mode Network und dem dorsalen Aufmerksamkeitsnetzwerk verbunden, was wiederum mit h√§ufigeren psychischen Problemen einherging.
Die Studie Macroeconomic income inequality, brain structure and function, and mental health erg√§nzt die umfangreichen vorliegenden gesundheits- und sozialwissenschaftliche empirischen Belege f√ľr die Bedeutung von Einkommensungleichheit als gesellschaftliche Determinante f√ľr die neurologische Entwicklung und die psychische Gesundheit ist, unabh√§ngig vom individuellen sozio√∂konomischen Status. Damit unterstreicht sie die Forderung nach politischen Ma√ünahmen zur Verringerung sozialer Ungleichheit und zur St√§rkung des sozialen Zusammenhalts. Diese Studie vertieft unser Verst√§ndnis dar√ľber, wie Einkommensungleichheit die Struktur und Funktion des kindlichen Gehirns sowie die psychische Gesundheit beeinflusst. Dabei zeigt sie auch, wie sich strukturelle Ungleichheit biologisch verankert und auf die psychische Gesundheit auswirkt.
Erschienen ist die Studie von Rakesh et al. im Springer Journal Nature Mental Health und steht hier zum Download zur Verf√ľgung.
Jens Holst, 20.10.25
Medizinische Prävention ist nicht genug
 Man kann es ja nicht oft genug betonen: Gesundheit erfordert mehr als Medizin. Entgegen landl√§ufiger Wahrnehmung unter Lai*innen wie unter politischen Entscheidungstr√§ger*innen hat der Gesundheitszustand einer Bev√∂lkerung nur wenig mit dem Krankenversorgungssystem zu tun. Die durchschnittliche Lebenserwartung stieg in Europa vor allem in Folge von umfassenden Hygienema√ünahmen, die lange vor der Einf√ľhrung von Antibiotika ma√ügeblich zum deutlichen R√ľckgang von Infektionskrankheiten beitrugen. Die Verbesserung der allgemeinen Lebens- sowie der Arbeits- und Einkommensbedingungen hat gr√∂√üere Wirkung auf die Lebenserwartung der Gesamtbev√∂lkerung. Sch√§dlich wirken sich hingegen soziale Benachteiligung und gesellschaftliche Ungleichheiten auch einem Land wie Deutschland mit umfangreicher sozialer Absicherung. Wer die Krankheitslast einer Bev√∂lkerung verringern und ihre Gesundheit verbessern will, darf sich nicht nur um das Medizinsystem k√ľmmern. Darauf weist auch die Deutsche Gesellschaft f√ľr Public Health in der gemeinsam mit der Deutschen Gesellschaft f√ľr Sozialmedizin und Pr√§vention verfassten Erkl√§rung hin, die hier auch zum direkten Download zur Verf√ľgung steht.
Man kann es ja nicht oft genug betonen: Gesundheit erfordert mehr als Medizin. Entgegen landl√§ufiger Wahrnehmung unter Lai*innen wie unter politischen Entscheidungstr√§ger*innen hat der Gesundheitszustand einer Bev√∂lkerung nur wenig mit dem Krankenversorgungssystem zu tun. Die durchschnittliche Lebenserwartung stieg in Europa vor allem in Folge von umfassenden Hygienema√ünahmen, die lange vor der Einf√ľhrung von Antibiotika ma√ügeblich zum deutlichen R√ľckgang von Infektionskrankheiten beitrugen. Die Verbesserung der allgemeinen Lebens- sowie der Arbeits- und Einkommensbedingungen hat gr√∂√üere Wirkung auf die Lebenserwartung der Gesamtbev√∂lkerung. Sch√§dlich wirken sich hingegen soziale Benachteiligung und gesellschaftliche Ungleichheiten auch einem Land wie Deutschland mit umfangreicher sozialer Absicherung. Wer die Krankheitslast einer Bev√∂lkerung verringern und ihre Gesundheit verbessern will, darf sich nicht nur um das Medizinsystem k√ľmmern. Darauf weist auch die Deutsche Gesellschaft f√ľr Public Health in der gemeinsam mit der Deutschen Gesellschaft f√ľr Sozialmedizin und Pr√§vention verfassten Erkl√§rung hin, die hier auch zum direkten Download zur Verf√ľgung steht.
Zurzeit zeichnet sich aber ab, dass die von Gesundheitsminister Karl Lauterbach geplante, grunds√§tzlich begr√ľ√üenswerte St√§rkung der Pr√§vention durch die Schaffung eines Bundesinstituts f√ľr Pr√§vention und Aufkl√§rung in der Medizin als Pr√§ventions-Institut im Aufbau eher die bestehende biomedizinische Einengung von Gesundheit als einen komplexeren Public-Health oder gar die Idee von Gesundheit in allen Politikbereichen bef√∂rdert. Wer die Gesundheit einer Bev√∂lkerung erhalten und verbessern will, kann Pr√§vention nicht nur "in der Medizin" verorten, wie es der Name des neuen Instituts nahelegt, sondern muss sich der Ursachen gesundheitlicher Herausforderungen widmen. Das Gesundheitswesen allein wird schwerlich die Folgen von sozialer und wirtschaftlicher Ungleichheit auffangen k√∂nnen. Diese Erkenntnis hat sich indes nicht nur in Deutschland unzureichend durchgesetzt, auch in der globalen Gesundheitspolitik besteht eine un√ľbersehbare Tendenz zu medizin-technologischen L√∂sungen. Dies verdeutlich auch der im Rahmen des j√§hrlich stattfindenden World Health Summit vergebene Virchow-Preis f√ľr globale Gesundheit. Das gleichnamige Komitee hat den von der Friede-Springer-Stiftung gestifteten Preis nun zum zweiten Mal f√ľr prim√§r infektionsmedizinische Leistungen vergeben und damit das Erbe des gro√üen Sozialmediziners Rudolf Virchow konterkariert, der Satz pr√§gte: Die Medizin ist eine soziale Wissenschaft, und die Politik ist weiter nichts als Medizin im Gro√üen.
Auf diese verbreitete, grunds√§tzlich Schieflage in der nationalen wie globalen Gesundheitspolitik weist der Kommentar Perspektivwechsel: Gesundheit braucht mehr als Medizin von Jens Holst hin, der am 14. Oktober 2014 im Tagesspiegel erschien. Dieser Artikel steht auch als PDF zur Verf√ľgung.
Bernard Braun, 25.10.23
Alkoholmindestpreis senkt Alkoholkonsum
 Gesundheitswissenschaftlich ist gut belegt, dass die Schäden von Alkoholkonsum am effektivsten durch Maßnahmen reduziert werden, die auf den Preis, die Verfügbarkeit und das Marketing von Alkohol zielen. Nach bisherigen Erfahrungen führen Preiserhöhungen zu geringerem und Preissenkungen zu höherem Konsum (wir berichteten: Alkohol: höhere Preise - weniger Probleme). Gezielter soll der Mindestpreis für die Einheit Alkohol ("alcohol minimum unit pricing", MUP) wirken, der in erster Linie den Konsum riskant Konsumierender und Jugendlicher mindern soll. Die Englische Regierung hatte daher die Einführung des Mindestpreises beschlossen, war dann aber vor der Alkoholindustrie und den großen Lebensmittelketten eingeknickt (wir berichteten).
Gesundheitswissenschaftlich ist gut belegt, dass die Schäden von Alkoholkonsum am effektivsten durch Maßnahmen reduziert werden, die auf den Preis, die Verfügbarkeit und das Marketing von Alkohol zielen. Nach bisherigen Erfahrungen führen Preiserhöhungen zu geringerem und Preissenkungen zu höherem Konsum (wir berichteten: Alkohol: höhere Preise - weniger Probleme). Gezielter soll der Mindestpreis für die Einheit Alkohol ("alcohol minimum unit pricing", MUP) wirken, der in erster Linie den Konsum riskant Konsumierender und Jugendlicher mindern soll. Die Englische Regierung hatte daher die Einführung des Mindestpreises beschlossen, war dann aber vor der Alkoholindustrie und den großen Lebensmittelketten eingeknickt (wir berichteten).
Die schottische Regierung war mutiger und hat zum 1. Mai 2018 den Mindestpreis für die Einheit Alkohol eingeführt. Das entsprechende Gesetz war bereits 2012 verabschiedet worden. Die Verzögerung ergab sich daraus, dass sich erst der Europäische Gerichtshof mit dem Gesetz befassen musste und letztlich der UK Surpreme Court in seinem Urteil die Maßnahme für verhältnismäßig erklärte und damit eine Klage der Scotch Whisky Association abwies.
Infolge des Gesetzes wurde der Mindestpreis für eine Einheit Alkohol (in den UK 8 Gramm) zum 1.5.2018 auf 50 Pence (€ 0,55) festgesetzt.
Eine internationale Gruppe von Wissenschaftlern hat die ersten Auswirkungen auf das Konsumverhalten in Schottland in den 34 Wochen von Mai bis Ende Dezember 2018 untersucht. Die Daten lieferte eine Paneluntersuchung, in der das Einkaufsverhalten einer großen und repräsentativen Stichprobe von Haushalten erhoben wird. Für die Studie wurden 290.000 Alkoholeinkäufe von 5325 Haushalten in Schottland und zum Vergleich 2,83 Mio. Einkäufe in 54.807 Haushalten in Nordengland und 800.000. Einkäufe in 10.040 Haushalten in England für die Jahre 2015 bis 2018 ausgewertet. Nordengland wurde als Vergleich gewählt, weil die Bevölkerung der schottischen sozioökonomisch ähnlich ist.
Aufgrund der mehrfachen Erhebung der Daten in einem zeitlichen Längsschnitt und dem Vorhandensein von 2 Vergleichsregionen handelt es sich um eine sog. "controlled interrupted time series analysis".
Erfasst wurde Veränderungen der Alkoholpreise im Einzelhandel, die Mengen Alkohol, die im Einzelhandel gekauft wurden und die wöchentlichen Ausgaben für Alkoholeinkäufe.
Mit Einführung des Mindestpreises stieg der Preis um 6,4 Pence bzw. 7,9% für ein Gramm Alkohol. Der wöchentliche Einkauf sank um 9,5 g Alkohol pro Erwachsenen im Haushalt.
Die Ausgaben für Alkoholeinkäufe stiegen leicht, aber statistisch nicht signifikant. Der Anstieg der Ausgaben war höher in Haushalten mit niedrigerem Einkommen und in den Haushalten mit den größten Alkohol-Einkaufsmengen.
Der Einkauf von Bier, Spirituosen und Cider sank am stärksten, also von relativ billigen Getränken (Eigenmarken von Spirituosen, starkem Cider). Den größten Effekt zeigte die Preiserhöhungen in Haushalten mit gleichzeitig niedrigem Einkommen und hohen Ausgaben für Alkohol.
Die Autoren schlussfolgern, dass die Einführung des Mindestpreises erfolgreich darin war, die von schottischen Haushalten insgesamt gekaufte Alkoholmenge zu reduzieren. Die Nachfrage nach billigem Alkohol sank stärker. Die Haushalte mit den größten Einkaufsmengen reduzierten ihre Einkäufe am stärksten.
Dieser ersten vorläufigen Auswertung wird eine umfassende Evaluation durch NHS Health Scotland im Jahr 2023 folgen, in der neben Veränderungen des Alkoholkonsums auch Gesundheitsparameter erfasst werden.
Für diesen Bericht werden zahlreiche kleinere und insbesondere auch qualitative (befragende) Studien durchgeführt, für die erste Ergebnisse bereits verfügbar sind (Website Public Health Scotland - Overview of evaluation of MUP).
O'Donnell A, Anderson P, Janť-Llopis E, Manthey J, Kaner E, Rehm J. Immediate impact of minimum unit pricing on alcohol purchases in Scotland: controlled interrupted time series analysis for 2015-18. BMJ. 2019;366:l5274. Link
David Klemperer, 25.5.20
Mangelnde Lese- und Schreibfähigkeiten und Demenz: Ein Zusammenhang, der oft vergessen wird!
 Auch wenn die "Demenz-Epidemie" als ständig steigendes individuelles Risiko, dement zu werden ins Reich der Mythen gehört, ist eine drängende Frage für die trotzdem große Anzahl von Demenzkranken, ob und wodurch die Erkrankung zu vermeiden ist.
Auch wenn die "Demenz-Epidemie" als ständig steigendes individuelles Risiko, dement zu werden ins Reich der Mythen gehört, ist eine drängende Frage für die trotzdem große Anzahl von Demenzkranken, ob und wodurch die Erkrankung zu vermeiden ist.
Eine am 13. November 2019 erschienene Studie weist nun darauf hin, dass Menschen die nicht oder nicht richtig lesen und schreiben können, ein dreimal so hohes Risiko haben dement zu werden wie eine nach anderen sozialen Merkmalen vergleichbare Gruppe von voll alphabetisierten Personen.
Dies ist das Ergebnis einer über vierjährigen Untersuchung der Inzidenz und Prävalenz von Demenz in einer Gruppe von insgesamt 983 erwachsenen Personen größer/gleich 65 Jahre alt, Durchschnittsalter 77 Jahre, kleiner/gleich 4 Jahre Schulbesuch, ein Teil der TeilnehmerInnen sind Immigranten aus Ländern mit schlechter Bildungsinfrastruktur) aus einem Stadtteil New Yorks.
Zu Beginn der Studie konnten 237 Personen nicht lesen und schreiben, 746 konnten dies. Von den 237 Analphabeten oder illiteraten Personen waren zu diesem Zeitpunkt 83 oder 35% dement, von den Nicht-Analphabeten waren dies 134 oder 18%. Nach der Adjustierung mehrerer sozialer und medizinischer Merkmale war das Demenzrisiko der illiteraten Personen nahezu dreimal höher als das der Personen, die lesen und schreiben konnten.
In den vier Folgejahren werden alle TeilnehmerInnen der Studie regelmäßig medizinisch untersucht ebenso ihre Gedächtnisleistung und ihre Fähigkeiten zu lesen und zu schreiben.
Nach den vier Jahren waren 114 der 237 Analphabeten oder 48% dement. Von den Nicht-Analphabeten waren es 134 von 746 oder 18%. Nach der erneuten Adjustierung mussten die ForscherInnen feststellen, dass das Risiko während der Studienlaufzeit dement zu werden, bei den Analphabeten immer noch doppelt so hoch war wie bei den Nicht-Analphabeten.
Einschränkend weisen die ForscherInnen u.a. darauf hin, dass die Feststellung, ob jemand lesen und schreiben gelernt hat, auf Selbsteinschätzungen beruht. Sie wünschen sich weiter, dass in künftigen Studien untersucht wird, welchen Einfluss auf die Inzidenz von Demenz verstärkte Investitionen im Schulbereich aber auch gezielt in die Erwachsenenweiterbildung haben.
Dass man den Zusammenhang von Lese- und Schreibfähigkeiten und Demenz durchaus auch anders beurteilen kann, zeigen erste Kommentare zu der Veröffentlichung der Studienergebnisse im "Deutschen Ärzteblatt" vom 15. November. Unter der Überschrift "Schöpfungsziel verfehlt" schreibt etwa ein eifriger Kommentator "Oh Gott, Affen sind dement!"
Um es nicht zu vergessen: In Deutschland besaßen 2011 7,5 Millionen Erwachsene mit Deutsch als Muttersprache (14,5% der Erwachsenenbevölkerung) keine oder nur sehr geringe Lese- und Schreibfähigkeiten bzw. waren funktionale Analphabeten. 2018 sank die Anzahl auf 6,2 Millionen (7,2% der Erwachsenenbevölkerung). Die Schulabbrecherquote und damit möglicherweise sowohl eine Ursache wie Folge von Schreib-Leseschwäche stieg von 5,7% im Jahr 2017 auf 6,3 Prozent im Jahr 2018 - unter Ausländern sogar von 14,2 auf 18,1 Prozent.
Ein nicht unbeträchtlicher Teil der Neuerkrankungen an Demenz wäre also durch gezielte und im Prinzip inhaltlich als wirksam bekannte bildungspolitische Interventionen zu vermeiden.
Die Studie Illiteracy, dementia risk, and cognitive trajectories among older adults with low education. von Miguel Arce RenterŪa et al. ist online vorab vor dem Druck in der Fachzeitschrift "Neurology" erschienen und das Abstract ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 16.11.19
18 Jahre Aufklärung über "gesunde und ungesunde Ernährung" hat in den USA nur wenig und dann oft nur sozial ungleich bewegt
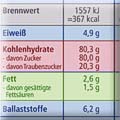 Weniger minderwertige Kohlenhydrate, mehr hochwertige, weniger Fett oder gesättigte Fettsäuren, mehr ungesättigte, Vorsicht vor verstecktem Zucker, und, und, und Ö zahllose Ratschläge, Kurse, Handbücher und jede Menge Ratgeber und Modellprojekte geben Tipps für gesunde oder warnen vor ungesunder Ernährung und deren möglichen Folgen.
Weniger minderwertige Kohlenhydrate, mehr hochwertige, weniger Fett oder gesättigte Fettsäuren, mehr ungesättigte, Vorsicht vor verstecktem Zucker, und, und, und Ö zahllose Ratschläge, Kurse, Handbücher und jede Menge Ratgeber und Modellprojekte geben Tipps für gesunde oder warnen vor ungesunder Ernährung und deren möglichen Folgen.
Viele dieser Aktivitäten haben in nur selten langjährigen Modellprojekten, Beobachtungsstudien aber auch einigen randomisierten kontrollierten Studien einen Nutzen nachgewiesen. Überlegt man sich aber, dass oft allein die mit Zuwendung, guter Information und Aufmerksamkeit verbundene Intervention in Projekten oder Modellversuchen und/oder die explizit oder implizit soziale Erwünschtheit von Effekten der jeweiligen Ernährungsvariante eine Wirkung fördert - selbst bei Angehörigen einer Kontrollgruppe mit "normaler" Ernährung ist dies oft so - , sind Erfolgsmeldungen nicht völlig überraschend.
Ob und wie sich daran etwas ändert, wenn Interventionsstudien zu Ende sind und mittel- bis langfristig so genannte "real world"-Bedingungen ohne ProjektleiterIn und Studienmeetings herrschen, ist weniger untersucht und bekannt.
Eine 2019 veröffentlichte Studie über die Ernährungsweise von 43.996 erwachsenen US-BürgerInnen in der Zeit zwischen 1999 und 2016, liefert hierzu nun bedenkenswerte Ergebnisse. Die eingangs beschriebene ständige Flut von Ernährungs-Ratgeber und -Ratschlägen ist einer der Pfeiler des in den USA weit verbreiteten und von Hagen Kühn ausgezeichnet analysierten Healthismus.
Nun hat ein ForscherInnenteam auf Basis von neun Befragungen des "National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES)", der "Food and Nutrition Database for Dietary Studies (FNDDS)" und mit Hilfe des "Healthy Eating Index (HEI)-2015" (misst wie sich die AmerikanerInnen an die für sie konzipierten und kommunizierten Ernährungsleitlinien halten.
Zu den wichtigsten Ergebnissen gehören folgende:
• Die Gesamtaufnahme von Kohlenhydraten sank um 2% und der Konsum von geringwertigen Kohlenhydraten ging um 3 % zurück. Der Konsum gesünderer, qualitativ hochwertiger Kohlenhydrate stieg nur um 1%.
• Der Anteil an Nahrungsmitteln aus geringwertigen Kohlenhydraten an der typischen Menge von Kalorien betrug 42%, der höherwertigen Kohlenhydrate wie z.B. in ganzen Früchten oder Körnern nur 9%.
• Die Gesamtaufnahme von Fetten stieg um 1%. Die Hälfte des Fettkonsums bestand aus Produkten mit gesättigten Fettsäuren.
- Gesättigte Fettsäuren lieferten 12% der täglich aufgenommenen Kalorien. Empfohlen wird durchweg, dass nur 10% aller Kalorien durch diese Art von Fettsäuren aufgenommen wird.
• Erwachsene mit höherem Einkommen haben ihren Konsum minderwertiger Kohlenhydrate mehr reduziert als Arme und Geringverdiener. In beiden Gruppen handelt es sich aber nicht um hohe Werte: Bei der ersten Gruppe sank der Anteil über die 17 Jahre um 4%, bei der zweiten um 2%.
• Die Adhärenz zu Ernährungs-Leitlinien verbesserte sich zwar für alle US-AmerikanerInnen. Keine Verbesserung gab es aber bei den über 50-Jährigen, bei den Menschen mit weniger als einem High-School-Abschluss und den BürgerInnen, die unter der Armutsgrenze leben mussten.
Einer der Studienleiter, Fang Fang Zhang Epidemiologe an der Tufts Universität, fasste die Ergebnisse so zusammen: "Although there are some encouraging signs that the American diet improved slightly over time, we are still a long way from getting an 'A' on this report card. Our study tells us where we need to improve for the future," und zog den Schluss "These findings also highlight the need for interventions to reduce socioeconomic differences in diet quality, so that all Americans can experience the health benefits of an improved diet."
Noch so erfolgreich erscheinende Modellprojekte, und natürlich auch die in Deutschland, sollten nach den Ergebnissen dieser Studie, nicht allzu selbstzufrieden sein, sondern die Nutzeffekte ihrer Interventionen und Empfehlungen unter Alltagsbedingungen über längere Zeit und differenziert (z.B. nach Einkommen, Bildung) untersuchen und ggfls. zusätzlich intervenieren. Über die Notwendigkeit einer Art Daueraufklärung und auch ihrer möglicherweise immer noch geringen Wirkung, sollte dann ebenfalls nachgedacht werden.
Die Studie Trends in dietary carbohydrate, protein, and fat intake and diet quality among US adults, 1999-2006 von Shan, Z., Rehm, C.D., Rogers, G., Ruan, M., Wang, D.D., Hu, F.B., Mozaffarian, D., Zhang, F.F. und Bhupathiraju, S. ist in der Fachzeitschrift JAMA im September 2019 (322(12), 1-10) erschienen. Ein Abstract ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 2.10.19
"Was kümmern uns Antibiotikaeinnahme und resistente Bakterien in Rufisque (Senegal)?": Warum vielleicht doch!
 Auch wenn es kaum einen europäischen Leser geben dürfte, dem der Ort um den es in einer Ende 2018 veröffentlichten Studie geht bekannt ist, gehört das Wissen seiner EinwohnerInnen über Antibiotika bzw. das Wissen über den richtigen Umgang mit Antibiotika unbedingt zu "unserem" Wissen über die Triebkräfte der Globalisierung von Gesundheitsrisiken und der Notwendigkeit ihrer globalen Prävention.
Auch wenn es kaum einen europäischen Leser geben dürfte, dem der Ort um den es in einer Ende 2018 veröffentlichten Studie geht bekannt ist, gehört das Wissen seiner EinwohnerInnen über Antibiotika bzw. das Wissen über den richtigen Umgang mit Antibiotika unbedingt zu "unserem" Wissen über die Triebkräfte der Globalisierung von Gesundheitsrisiken und der Notwendigkeit ihrer globalen Prävention.
In einer mit EinwohnerInnen der Stadt Rufisque im Senegal durchgeführten Studie ging es einer Gruppe senegalesischer Mediziner und GesundheitswissenschaftlerInnen um deren Wissen über die Zweckmäßigkeit oder Notwendigkeit der Einnahme von Antibiotika überhaupt und die Art und Weise der Einnahme und das Wissen darüber, dass die gesundheitlich nicht notwendige oder z.B. eine zu kurze Einnahme von Antibiotika zu Resistenzbildungen von Bakterien gegenüber immer mehr Antibiotika führt und sich auch derartige Bakterien dank der weltweiten Mobilität länder- und kontinentübergreifend verbreiten können. Das aus der Chaostheorie bekannte Bild, dass und wie sich ein umfallender Reissack in China auf wesentlich bedeutendere Ereignisse in Europa auswirken kann, gilt also im übertragenen Sinn auch für durch irrationale Einnahme von Antibiotika verursachte resistente Bakterien.
Die Bildung von Resistenzen findet weltweit statt, also auch unter bestimmten Bedingungen im Senegal. Dass diese Bedingungen existieren zeigen die Ergebnisse einer mündlichen Befragung von 400 in der senegalesischen Stadt wohnenden und für die dortige erwachsene Bevölkerung repräsentativen Personen.
Zu den wichtigsten Ergebnissen gehören die folgenden:
• Die meisten Befragten, zwischen 64,4% und 72,3%, glaubten Antibiotika würden gegen eine Reihe von Erkrankungen der oberen Atemwege helfen, obwohl die Mehrzahl dieser Erkrankungen auch im Senegal Viruserkrankungen sind gegen die Antibiotika wirkungslos sind.
• 42,8% der Befragten waren sich sicher, dass die Antibiotikatherapie sofort gestoppt werden könne, wenn die Symptome verschwunden sind, was u.a. die Bildung von Resistenzen fördert.
• Nur 8,8% und 41,8% der Befragten wussten von der präventiven Bedeutung von Händewaschen und Impfen gegen eine Reihe von Erkrankungen, die unsinnigerweise mit Antibiotika behandelt werden.
• Insgesamt hatten nur 7% aller Befragten ein insgesamt gutes Wissen über die Bedeutung und richtige Einnahme von Antibiotika sowie das Risiko der bakteriellen Resistenzen, und zwar unabhängig von soziodemografischen Merkmalen. Dies schloss nicht aus, dass mehr als 7% der Befragten bei Einzelaspekten über mehr Wissen verfügten.
• Ähnlich wie in Befragungsstudien in europäischen Ländern, dachten auch 78,3% der im Senegal Befragten, dass die Bevölkerung zu viele Antibiotika verordnet bekommt und einnimmt.
• Zwischen 28% und 53,5% der Befragten fühlten sich auch nicht genug während Arztbesuchen informiert. 45% dachten außerdem, dass sie keine große Rolle beim Kampf gegen resistente Bakterien spielten.
Daran durch geeignete Public Health-Aktionen sowohl im Senegal als auch nn vielen vergleichbaren Regionen etwas zu ändern und im Sinne der dort lebenden Menschen auch bei uns, gehört dazu, wenn es um die Zusammenhänge von Globalisierung und Gesundheit geht.
Die Studie Assessment of General Public's Knowledge and Opinions towards Antibiotic Use and Bacterial Resistance: A Cross-Sectional Study in an Urban Setting, Rufisque, Senegal von Oumar Bassoum et al. ist im September 2018 in der Zeitschrift "Pharmacy" (6(4), 103) erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 20.2.19
"Want a healthier population? Spend less on health care and more on social services" - in Kanada und anderswo
 Eigentlich ist das im Titel zugespitzte Ergebnis einer großen aktuellen Studie in Kanada über den Beitrag von medizinischer Versorgung und Sozialausgaben zur Gesundheit der Bevölkerung seit den Studien von Thomas McKeown (vgl. dazu als einen knappen Überblick zu den Positionen McKeown und ihre Debatte das komplett kostenlos erhältliche International Journal of Epidemiology, Volume 34, Issue 3, 1 June 2005), Michael Marmot (vgl. u.v.a. als Überblick den 2010 veröffentlichten 242-Seiten-Report The Marmot review final report: Fair society, healthy lives oder Richard Wilkinson (u.a. die WHO-Publikation Social determinants of health: the solid facts) ein sozialepidemiologisch "alter Hut".
Eigentlich ist das im Titel zugespitzte Ergebnis einer großen aktuellen Studie in Kanada über den Beitrag von medizinischer Versorgung und Sozialausgaben zur Gesundheit der Bevölkerung seit den Studien von Thomas McKeown (vgl. dazu als einen knappen Überblick zu den Positionen McKeown und ihre Debatte das komplett kostenlos erhältliche International Journal of Epidemiology, Volume 34, Issue 3, 1 June 2005), Michael Marmot (vgl. u.v.a. als Überblick den 2010 veröffentlichten 242-Seiten-Report The Marmot review final report: Fair society, healthy lives oder Richard Wilkinson (u.a. die WHO-Publikation Social determinants of health: the solid facts) ein sozialepidemiologisch "alter Hut".
Das Krankenversorgungssystem trägt danach nur mit deutlich unter 50% oder gar 30% zum gesundheitlichen Outcome entwickelter Gesellschaften bei. Da aber die geballte Macht der gesamten Gesundheitswirtschaft von niedergelassenen Ärzten über Kliniken und deren gesamtem Personal bis zu den Herstellern von gesundheitsbezogenen Produkten und Dienstleistungen diese Ergebnisse bewusst oder unbewusst ignoriert oder ganz simpel mit dem Hinweis auf individuelle Behandlungserfolge kranker Menschen das Gegenteil suggeriert und immer mehr "Geld ins System" zur Lösung gesundheitlicher Probleme als richtig propagiert, sind Replikationen auf aktueller empirischer Basis notwendig und hilfreich.
Die kanadische Studie ist eine retrospektive Längsschnittstudie über die Ausgaben für die traditionelle Gesundheitsversorgung und für soziale Maßnahmen für die BewohnerInnen von 9 der 10 kanadischen Provinzen über den Zeitraum von 1981 bis 2011. Als anerkannte abhängige Indikatoren für den gesundheitsbezogenen Outcome bzw. die Performanz von Gesundheitssystemen und der Bevölkerungsgesundheit wurden die potenziell vermeidbare Sterblichkeit (altersstandardisiert pro 100.000 EinwohnerInnen), die Kindersterblichkeit (pro 1.000 Lebendgeborene) und die Lebenserwartung zum Zeitpunkt der Geburt (in Jahren) untersucht.
Zu den zahlreichen nachdenkenswerten Ergebnissen (die differenzierten Berechnungen können in drei kostenlos erhältlichen zahlenmächtigen Anhängen im Detail nachvollzogen werden) der Vergleiche der Effekte beider Ausgabenarten gehört folgendes: Ein Anstieg der Sozialausgaben ist mit einer Abnahme der vermeidbaren Sterblichkeit um 0,034% und einer Zunahme der Lebenserwartung um 0,006% verbunden. Steigen die Gesundheitsausgaben um 1% steigt (!) die vermeidbare Sterblichkeit um 0,064% und gibt es keinen Effekt bei der Lebenserwartung.
Trotz einiger selbst referierten Einschränkungen zu der Möglichkeit kausaler Aussagen auf der Basis der benutzten Daten ("reverse causality" ist aber ausgeschlossen) und zur Verallgemeinerbarkeit für ein gesamtes Land halten die AutorInnen zweierlei fest:
• "Our sensitivity analysis Ö showed that social spending is associated with improvements in the population health variables, evidence of the notion that further spending on health may not improve population health outcomes as effectively as social spending. If social spending addresses the social determinants of health, then it is a form of preventive health spending and changes the risk distribution for the entire population rather than treating those who present with disease."
• Und die politische Empfehlung lautet daher konsequent: "Redirecting resources from health to social services, at the margin, is an efficient way to improve health outcomes." Was dies bedeutet zeigen die Angaben zu den jährlichen Prokopfausgaben von 930 CA-Dollar für soziale Leistungen und 2.900 CA-Dollar für Gesundheitsausgaben im Jahr 2011. Die Gesundheitsausgaben hatten im Untersuchungszeitraum zehnmal mehr zugenommen wie die Sozialausgaben.
Ob die Ergebnisse dieser Studie zumindest in Kanada die Prioritätensetzung bei öffentlichen Leistungen zur Verbesserung der Bevölkerungsgesundheit beeinflussen bleibt abzuwarten. In Deutschland ist dagegen der Lärm von Kassenärztlicher Bundesvereinigung oder Deutscher Krankenhausgesellschaft nach "mehr Geld ins System" oder Aufhebung der Budgetierung bestimmter ambulanter Leistungen dominant, gab die Gesetzliche Krankenversicherung im letzten Jahr noch nicht mal alle gesetzlich vorgeschriebenen Euros für Verhältnis/Setting-Prävention aus (1,63 Euro pro Versicherten statt der vorgeschriebenen 2 Euro) und sind viele Kommunen nicht (mehr) in der Lage den Status quo ihrer Sozialausgaben zu halten, geschweige denn ihn kräftig auszubauen.
Und wenn man ganz böse werden will, stehen in der GKV den knapp 500 Millionen Euro für Prävention (laut Präventionsbericht 2017) die rund 700 Millionen Euro gegenüber, welche die GKV in diesem Jahr für die scheinbar never-ending "Vorbereitung" der digitalen Infrastruktur für die elektronische Gesundheitskarte bezahlt.
Der Aufsatz Effect of provincial spending on social services and health care on health outcomes in Canada: an observational longitudinal study von Daniel J. Dutton, Pierre-Gerlier Forest, Ronald D. Kneebone und Jennifer D. Zwicker ist in der anerkannten Fachzeitschrift "Canadian Medical Association Journal (CMAJ)" vom 22. Januar 2018 erschienen (Volume 190, Issue 3: E66-E71) und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 23.1.18
Prävention von kardiovaskulären Risikofaktoren in den mittleren Jahren bringt viel für ein längeres und gesünderes Alter
 Zu den oft gestellten Fragen zum Nutzen von Prävention für Gesunde im jüngeren und mittleren Lebensalter gehört die nach dem gesundheitlichen und finanziellen Nutzen für den Nutzer von Prävention und ihre Krankenversicherung. Konkrete Antworten scheitern oft daran, dass nur wenige prospektive personenbezogene Analysen der gesundheitlichen Entwicklung im weiteren Lebenslauf existieren.
Zu den oft gestellten Fragen zum Nutzen von Prävention für Gesunde im jüngeren und mittleren Lebensalter gehört die nach dem gesundheitlichen und finanziellen Nutzen für den Nutzer von Prävention und ihre Krankenversicherung. Konkrete Antworten scheitern oft daran, dass nur wenige prospektive personenbezogene Analysen der gesundheitlichen Entwicklung im weiteren Lebenslauf existieren.
Daran ändern die Ergebnisse aus zwei Studien mit TeilnehmerInnen an der seit rund 40 Jahren laufenden "Chicago Health Association Study" einiges.
In den späten 1960er und frühen 1970er Jahren wurden die durchweg mittelalten (durchschnittlich 44 Jahre alt) 25.804 TeilnehmerInnen in Gruppen ohne und mit einem oder mehreren kardiovaskulären Risikofaktoren (z.B. Raucher, Diabetiker, Übergewicht und erhöhter Blutdruck) eingeteilt.
Betrachtet man die 25.804 Personen, die 2010 65 oder älter geworden sind nach ihrem Risikofaktorenstatus in ihren mittleren Lebensjahren, wird folgendes deutlich:
• Wer in jüngeren Jahren bei keinem der Risikofaktoren erhöhte Werte hatte, lebte durchschnittlich vier Jahre länger.
• Der Tod durch alle Ursachen und durch kardiovaskuläre Erkrankungen wurde um 4,5 bzw. 7 Jahre verschoben.
• Dies war auch mit einer deutlichen absoluten und relativen "compression of morbidity" verbunden
• Alles zusammen waren die Behandlungskosten zu Lasten von Medicare bei diesen Personen um rund 18.000 US-Dollar signifikant geringer.
Die Verfasser fassen ihre Ergebnisse insgesamt so zusammen: "These findings provide strong support for prevention efforts earlier in life aimed at preserving cardiovascular health and reducing the burden of disease in older ages."
Von der Studie Favorable Cardiovascular Health, Compression of Morbidity, and Healthcare Costs. Clinical Perspective von Norrina B. Allen et al., erschienen in der Fachzeitschrift "Circulation" (2017; 135 (18): 1693) ist nur das Abstract kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 3.5.17
Mammografie-Screening: Häufige Überdiagnosen als gravierender Kollateralschaden
 Gilbert Welch vom Dartmouth Institute for Health Policy and Clinical Practiceund Kollegen haben jetzt die Frage untersucht, wie sich das Brustkrebs-Screening durch Mammographie bei Frauen ab 40 Jahren auf die Zahl und die Größe der gefundenen Tumoren auswirkt.
Gilbert Welch vom Dartmouth Institute for Health Policy and Clinical Practiceund Kollegen haben jetzt die Frage untersucht, wie sich das Brustkrebs-Screening durch Mammographie bei Frauen ab 40 Jahren auf die Zahl und die Größe der gefundenen Tumoren auswirkt.
Dafür haben sie für einen Zeitraum vor (1975-1979) und nach (2000-2002) Einführung der Brustkrebsfrüherkennung die jährlich neu aufgetretenen Fälle (Inzidenz), die Tumorgröße und die Sterblichkeit verglichen.
Die erforderlichen Daten entnahmen sie dem amerikanischen Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) program . SEER ist eine Einrichtung des National Cancer Institute, das epidemiologische Informationen über Krebs in den USA sammelt und zur Verfügung stellt.
Das Fazit der Studie lautet:
Auf der Nutzenseite mindert das Brustkrebs-Screening die Sterblichkeit an Brustkrebs durch Minderung der Zahl großer Tumoren und der früher einsetzender Therapie (8 Brustkrebs-Todesfälle pro 100.000 Frauen weniger also ohne Screening).
Größer ist die Minderung der Sterblichkeit durch verbesserte Therapie bei gegebener Tumorgröße (17 Brustkrebs-Todesfälle pro 100.000 Frauen weniger als bei Therapiestandard 1975-1980).
Auf der Schadenseite beträgt die Überdiagnose 132 kleine Tumoren pro 100.000 Frauen - da bislang die Tumoren, die schnell, langsam oder gar nicht wachsen, nicht unterschieden werden können, dürften die meisten Patientinnen eine letztlich überflüssige Behandlung erhalten. erhalten.
Ebenfalls auf der Schadenseite stehen die - wenig beachteten -psychologischen Folgen der Krebsdiagnose wie auch der falsch-positiven Screening-Ergebnisse (wir berichteten).
Im Einzelnen lauten die wichtigsten Ergebnisse:
• Die Inzidenz großer Tumoren (ab 2 cm) sank von 145 (1975-1979) auf 115 (2000-2002) pro 100.000 Frauen, also um 30 Fälle pro 100.000 Frauen
• Die Inzidenz kleiner Tumoren (unter 2 cm) stieg von 82 (1975-1979) auf 244 (2000-2002) pro 100.000 Frauen, also um um 162 Fälle pro 100.000 Frauen
Die Häufigkeit pro 100.000 Frauen von Tumoren einer Größe sank
• ab 5 cm von 29 auf 25
• von 3,0 bis 4,9 cm von 56 auf 38
• von 2,0 bis 2,9 cm von 60 auf 52
Dem steht gegenüber der Anstieg der Häufigkeit pro 100.000 Frauen von Tumoren einer Größe
• von 1,0 bis 1,9 cm von 59 auf 99
• weniger als 1 cm von 13 auf 66
• In-situ-Karzinom von 10 auf 79
Daraus folgt: Das Screening hat
• die Zahl großer Tumoren gesenkt (um 30 pro 100.000 Frauen) und
• die Zahl kleiner Tumoren erhöht (um 162 pro 100.00).
Konstante Bedingungen angenommen, lässt sich daraus folgern, dass nur 30 der 162 zusätzlichen kleinen Tumoren zu großen Tumoren werden - 132 kleine Tumoren stellen Überdiagnosen dar - sie bleiben klein und würden nie auffällig werden.
Die Minderung der Zahl großer Tumoren ist eine notwendige aber nicht hinreichende - also allein nicht ausreichende - Bedingung für den Erfolg von Screening, denn es geht ja um die Senkung der Brustkrebstodesfälle (und um die Senkung der Gesamtmortalität). Ein weiteres notwendiges Erfolgskriterium ist daher die höhere Effektivität bei früher - durch Screening - diagnostizierten Tumoren im Vergleich zu später - bei Auftreten von Symptomen - diagnostizierten Tumoren.
Bei der verminderten Mortalität ist zu bedenken, inwieweit sie effektiverer Behandlung geschuldet ist.
Hinweise auf eine verbesserte Effektivität bei gegebener Tumorgröße gibt die jeweilige Sterblichkeitsrate ("Size-specific case fatality rate") für eine Nachbeobachtungszeit von 10 Jahren, die tatsächlichin den Jahren 2000-2002 niedriger ist als 1970-1975.
Die Sterblichkeit pro 100.000 Frauen betrug für Tumoren einer Größe
• ab 5 cm vor Einführung des Screenings 55%, danach 43%%
• von 3,0 bis 4,9 cm vor Einführung des Screenings 39%, danach 27%
• von 2,0 bis 2,9 cm vor Einführung des Screenings 28%, danach 16%.
Die Autoren kalkulieren, dass pro 100.000 Frauen vermieden werden:
• 8 Todesfälle durch das Screening
• 17 Todesfälle durch die effektivere Therapie.
Somit sind 2/3 der Minderung der Sterblichkeit auf die verbesserte Therapie und 1/3 auf das Screening zurückzuführen.
Die 10-Jahresüberlensrate für Patientinnen mit einem Tumor von weniger als 1 cm oder einem In-situ-Tumor ist interessanterweise höher als die von gleichaltrigen Frauen ohne Krebserkrankung.
Welch HG, Prorok PC, O'Malley AJ, Kramer BS: Breast-Cancer Tumor Size, Overdiagnosis, and Mammography Screening Effectiveness. New England Journal of Medicine 2016, 375(15):1438-1447. Abstract
siehe auch im Forum Gesundheitspolitik:
Mammografie-Screening 1: Nutzen fraglich, wenn dann bestenfalls gering Link
Mammografie-Screening 2: Gynäkologen schlecht informiert über Nutzen und Risiken Link
Mammografie-Screening 3: Frauen schlecht informiert über Nutzen und Risiken Link
David Klemperer, 3.11.16
Gesundheit durch Impfen - Der unbeirrbare Glaube an biomedizinische Lösungen
 Effizienzdruck und Marktmechanismen bestimmen in zunehmendem Maße auch die entwicklungspolitische Agenda. Selbstverständlich ist es gerechtfertigt, die Ressourcen möglichst wirksam und zielgenau dahin zu lenken, wo sie am besten zur Entwicklung und Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen beitragen. In Anbetracht der Komplexität der Gegebenheiten und Herausforderungen ist das allerdings leichter gesagt als getan. Nicht alles, was gut gemeint ist, entwickelt auch die gewünschte Wirkung. Hinzu kommt das relativ neue Phänomen des Wohltätigkeitskapitalismus von Unternehmen bzw. UnternehmerInnen, die nicht mehr wissen, wie sie ihre unermesslichen Renditen investieren sollen und sich massiv in der Entwicklungsagenda mitmischen. Ein anschauliches Beispiel für die neuen Herrschaftsverhältnisse und die wachsende Einmischung privater GeberInnen in die Entwicklungspolitik ist die 1999 entstandene Globale Allianz für Impfungen und Immunisierungen GAVI. In der Oktoberausgabe 2015 (Seiten 32-36) widmete das Magazin Gesundheit und Gesellschaft des AOK-Bundesverbands der internationalen Impfallianz eine ausführliche Betrachtung.
Effizienzdruck und Marktmechanismen bestimmen in zunehmendem Maße auch die entwicklungspolitische Agenda. Selbstverständlich ist es gerechtfertigt, die Ressourcen möglichst wirksam und zielgenau dahin zu lenken, wo sie am besten zur Entwicklung und Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen beitragen. In Anbetracht der Komplexität der Gegebenheiten und Herausforderungen ist das allerdings leichter gesagt als getan. Nicht alles, was gut gemeint ist, entwickelt auch die gewünschte Wirkung. Hinzu kommt das relativ neue Phänomen des Wohltätigkeitskapitalismus von Unternehmen bzw. UnternehmerInnen, die nicht mehr wissen, wie sie ihre unermesslichen Renditen investieren sollen und sich massiv in der Entwicklungsagenda mitmischen. Ein anschauliches Beispiel für die neuen Herrschaftsverhältnisse und die wachsende Einmischung privater GeberInnen in die Entwicklungspolitik ist die 1999 entstandene Globale Allianz für Impfungen und Immunisierungen GAVI. In der Oktoberausgabe 2015 (Seiten 32-36) widmete das Magazin Gesundheit und Gesellschaft des AOK-Bundesverbands der internationalen Impfallianz eine ausführliche Betrachtung.
Mit Impfungen lassen sich viele Leben retten, sie schützen nicht nur den Einzelnen, sondern auch die Allgemeinheit, und können dazu beitragen, die Ausbreitung von Krankheitserregern einzudämmen und Seuchen auszurotten. 1999 entstand GAVI als öffentlich-private Partnerschaft, um die weltweiten Anstrengungen zum Schutz vor ansteckenden Krankheiten zu bündeln. Heute ist die Impfallianz der wichtigste Financier von Impfstoffen in armen Ländern. Für den Schutz vor Infektionskrankheiten zeichnet eigentlich die Weltgesundheitsorganisation verantwortlich, da aber ihre Finanzkraft sinkt, springen private Geldgeber in die Bresche.
Impfungen eignen sich besonders gut für das Konzept des zunehmenden Wohltätigkeitskapitalismus, der sich streng an unternehmerischen Grundsätzen orientiert. Entwicklungsprogramme und -projekte müssen definierte Zielvorgaben sowie klare Kosten-Nutzen-Analysen erfüllen und messbare Resultate liefern. Doch zugleich entsteht ein Sammelsurium von Einzelprojekten nach Gutdünken der Sponsoren, das sich jeder demokratischen Legitimierung entzieht und Governance-Bestrebungen sowohl in der nationalen als auch globalen Gesundheitspolitik zuwiderläuft. Das erklärte Ziel von GAVI, die Impfstoffpreise für arme Länder erschwinglich zu halten, führt nur zu relativen Preissenkungen: die Kosten für einige neuere Substanzen überfordern viele Länder und garantieren den Herstellern in jedem Fall hinreichende Gewinne.
Vor allem fließen durch vertikale Programme wie GAVI erhebliche finanzielle Mittel in die Entwicklungsländer, die nationale Prioritäten und politische Vorgaben beeinflussen können. Die enge Ausrichtung auf die Vermeidung von Infektionskrankheiten drängt andere Gesundheitsprobleme in den Hintergrund und schwächt die Bemühungen der Länder um die allseits geforderte Stärkung ihrer Gesundheitssysteme. Und sie setzt ausschließlich auf biomedizinische Ansätze zur Lösung grundlegender Gesundheitsprobleme. Dabei hängt die Gesundheit weit stärker von anderen Einflussfaktoren als von Mikroben und dem medizinischen Versorgungssystem ab. Das Fazit des Artikels über GAVI ist deutlich: "Am wirksamsten wären "Impfungen" gegen Armut, Unterernährung, geringe Bildung und gesundheitsschädliche Arbeitsbedingungen. Ein solches Wundermittel wird aber nicht aus medizinischen oder mikrobiologischen Labors kommen. Dafür bedarf es einer Änderung der herrschenden Verhältnisse und einer Teilhabe aller Menschen am weltweit wachsenden Wohlstand.
Solche Aspekte kommen auch in der soeben erschienenen Februar-2016-Ausgabe von Health Affairs nicht zur Sprache. Vielmehr belegen verschiedene Artikel in der Medizinerzeitschrift die Erfolge von Impfprogrammen und deren bisher sogar unterschätzte Kosteneffektivität. Das ware nicht die erste von klaren Interessen geleitete oder gar gesponsorte Ausgabe von Health Affairs.
Der Artikel Große Spender für den kleinen Pieks steht kostenfrei zum Download zur Verfügung.
Bernard Braun, 29.2.16
Klimawandel - auch ein Thema für den Gesundheitssektor
 Für das deutsche Gesundheitswesen und seine AkteurInnen spielt die Debatte über den Klimawandel und seine Auswirkungen auf die Gesundheit bisher offenbar keine nennenswerte Rolle. Anders als in angelsächsischen Ländern wie Großbritannien, Kanada und Australien ist die Erkenntnis von WHO Generaldirektorin Margaret Chan, der Klimawandel sei "die Herausforderung unseres Jahrhunderts" bisher nicht hinreichend in das Bewusstsein einer kritischen Zahl von ÄrztInnen, Pflegenden und anderen Gesundheitsprofessionen vorgedrungen. Das ist aus zwei Gründen bemerkenswert: Zum einen ist der Gesundheitssektor selber für einen nicht unerheblichen Teil der CO2-Emissionen verantwortlich (in den USA bis zu 8 %) und zweitens stellen die gesundheitlichen Auswirkungen von Umweltverschmutzung und Klimawandel eine erhebliche Gefährdung dar.
Für das deutsche Gesundheitswesen und seine AkteurInnen spielt die Debatte über den Klimawandel und seine Auswirkungen auf die Gesundheit bisher offenbar keine nennenswerte Rolle. Anders als in angelsächsischen Ländern wie Großbritannien, Kanada und Australien ist die Erkenntnis von WHO Generaldirektorin Margaret Chan, der Klimawandel sei "die Herausforderung unseres Jahrhunderts" bisher nicht hinreichend in das Bewusstsein einer kritischen Zahl von ÄrztInnen, Pflegenden und anderen Gesundheitsprofessionen vorgedrungen. Das ist aus zwei Gründen bemerkenswert: Zum einen ist der Gesundheitssektor selber für einen nicht unerheblichen Teil der CO2-Emissionen verantwortlich (in den USA bis zu 8 %) und zweitens stellen die gesundheitlichen Auswirkungen von Umweltverschmutzung und Klimawandel eine erhebliche Gefährdung dar.
Doch die Gefahr scheint für zu viele noch zu weit weg und das Gefährdungspotenzial zu gering zu sein - anders ist das Schweigen kaum zu erklären. In der Tat mag die Bedrohung in Deutschland auch bisher nicht so groß erscheinen, aber zum einen gibt es auch hierzulande Ansatzmöglichkeiten zur Verringerung der CO2- und anderer Emissionen, und zum anderen sind die nationalen und globalen Lebensbedingungen und -chancen viel enger miteinander verknüpft, als dass man die Augen vor der weltweiten Realität verschließen dürfte.
Auf den unmittelbaren Zusammenhang zwischen nationaler und globaler Klima- und Gesundheitspolitik macht ein Positionspapier der Deutschen Plattform für Globale Gesundheit aufmerksam und fordert die Angehörigen des deutschen Gesundheitswesens zum Umdenken auf. Es verweist dabei nicht nur auf Gesundheitsrisiken und -gefahren in Folge der Erderwärmung und auf die sichtbare Häufung von Naturkatastrophen in verschiedenen Weltregionen, sondern auch auf die drohende Wüstenbildung in heute bewohnten Regionen, Wasser- und Nahrungsknappheit und eine zunehmende klimabedingte Migration, die auch Europa mit der neuen Kategorie von Klimaflüchtlingen konfrontieren wird.
Kernproblem ist die weiterhin ungebremste Verbrennung fossiler Energieträger. Das primär wachstums- und vor allem profitorientierte Wirtschaftssystem befördert den rücksichtslosen Abbau und die Verbrennung klimaschädlicher Rohstoffe, und die Politik der öffentlichen Hand subventioniert dieses unverantwortliche Handeln, anstatt es durch angemessene Besteuerung und Sanktionierung einzudämmen: Die staatlichen Subventionen für fossile Brennstoffe sind genauso hoch wie die weltweiten Gesundheitsausgaben! Mittlerweile rufen auch der Internationale Währungsfonds (IWF) und die Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) zum Abbau dieser Subventionen auf.
Ein konkreter Ansatz, potenzielle InvestorInnen in fossile Brennstoffe zum Umdenken zu bringen, ist die Divest/Reinvest-Strategie für nachhaltigen Klimaschutz: fossile Brennstoffe im Boden belassen und Investitionen aus Kohle-, Öl- und Gasunternehmen abziehen. Diesen Ansatz verfolgen schon jetzt einige finanzstarke Institutionen wie der Norwegische Staatsfonds, zwei kalifornische und der niederländische Staatsfonds, die Rockefeller Stiftung und die beiden größten europäischen Versicherungskonzerne Allianz und Axa.
So wie andere Angehörige des Gesundheitswesens sollte sich die deutsche Ärzteschaft, so eine zentrale Forderung des Positionspapiers, dem Forderungskatalog ihrer britischen KollegInnen anschließen, so wie es bereits die Medizinerorganisationen anderer Länder getan haben:
• Stärkeres Augenmerk auf den Zusammenhang zwischen Klimawandel und Gesundheit lenken,
• Investitionen in die fossile Brennstoffindustrie beenden, beispielsweise durch entsprechende Umschichtung der Einlagen der Versorgungswerke,
• Reduzierung von Emissionen im und um den Gesundheitssektor.
Die Deutsche Plattform für Globale Gesundheit stellt das Positionspapier Klimawandel und Gesundheit: Ein Weck- und Aufruf für den Gesundheitssektor mit vielen relevanten Informationen und wertvollen Literaturverweisen kostenfrei zum Download zur Verfügung.
Jens Holst, 10.12.15
Public Health als Weg zur Optimierung des Menschen im Sinne besserer Resilienz
 Mitte Juni legte die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina gemeinsam mit der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften e. V. und der Union der deutschen Akademien der Wissenschaften e. V. ihre Stellungnahme Public Health in Deutschland (2015) vor. Das Papie mit dem Untertitel Strukturen, Entwicklungen und globale Herausforderungen geht erklärtermaßen der Frage nach, ob Deutschland sein Potenzial im Bereich Public Health in Hinblick auf nationale und globale Herausforderungen ausschöpft. Dazu hat "eine internationale Arbeitsgruppe aus hochrangigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern die bestehenden Grundlagen von Public Health in Deutschland untersucht und die zukünftigen Anforderungen an die Förderung und Weiterentwicklung des Gebietes ausgelotet" (S. 3).
Mitte Juni legte die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina gemeinsam mit der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften e. V. und der Union der deutschen Akademien der Wissenschaften e. V. ihre Stellungnahme Public Health in Deutschland (2015) vor. Das Papie mit dem Untertitel Strukturen, Entwicklungen und globale Herausforderungen geht erklärtermaßen der Frage nach, ob Deutschland sein Potenzial im Bereich Public Health in Hinblick auf nationale und globale Herausforderungen ausschöpft. Dazu hat "eine internationale Arbeitsgruppe aus hochrangigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern die bestehenden Grundlagen von Public Health in Deutschland untersucht und die zukünftigen Anforderungen an die Förderung und Weiterentwicklung des Gebietes ausgelotet" (S. 3).
Die Stellungnahme umfasst eine Vielzahl unterschiedlicher Aspekte von Public und Global Health und geht im Einzelnen auf die folgenden Themenbereiche ein: Ziele und Funktionen von Public Health, Herausforderungen, Fortschritte und Aussichten von Public Health, Globale Herausforderungen bewältigen: Erfolgreiche globale Gesundheitspolitik beginnt zu Hause, Geschichte und aktuelle Situation von Public Health in Forschung und Lehre in Deutschland und europäischer Hintergrund, und leitet daraus einschlägige Folgerungen und Empfehlungen für die Zukunft von Public Health in Deutschland ab.
Die mit der Stellungnahme unterstrichene Forderung nach stärkerer Beachtung und Bedeutung von Public Health in der Wissenschaft ist grundsätzlich begrüßenswert und könnte eine wichtige Weichenstellung in diese Richtung darstellen. Auch erscheint die einleitende Verortung dieses Wissenschaftszweigs plausibel, nachvollziehbar und korrekt: "Public Health ist mehr als Medizin" (S. 13) und "Public Health ist eine wichtige integrative Wissenschaft, die Ergebnisse der Grundlagenforschung in praktische Maßnahmen für die Gesundheit der Bevölkerung umsetzt" (S. 6). Auch der Forderung, Public-Health-Forschung müsse dazu beitragen, "effektive politische Maßnahmen, Programme und Strategien zur Verbesserung der Gesundheit, auch im nichtmedizinischen Bereich, zu entwickeln und Gesundheitssysteme zu stärken" (S. 9), ist nicht zu widersprechen.
Die Überlegungen der beteiligten WissenschaftlerInnen beruhen nicht zuletzt auf der beklagenswerten Situation, dass deutsche Forschungsergebnisse und praktische Erfahrungen nur geringen Einfluss auf die internationale Debatte und globale Gesundheitsansätze haben. Daher fordern sie: "Hier kann sich Deutschland verstärkt in die internationale Zusammenarbeit einbringen, vor allem da, wo es über einen reichen Erfahrungsschatz verfügt, beispielsweise in den Bereichen Forschung, Innovation, flächendeckende Gesundheitsversorgung und soziale Sicherheit" (S. 7) und kommen zu der Analyse: "Letztlich ist festzustellen, dass die in Deutschland erzielten Forschungsergebnisse und praktischen Erfahrungen zu Public Health bisher nicht in dem ihnen angemessenen Umfang in die Debatte zu Global Health eingeflossen sind" (ibid.). Das wiederholt in dem Papier eingeforderte Mehr an Forschung lässt sich aus dieser Formulierung allerdings schwerlich ablesen, hapert es doch vielmehr an der richtigen Vermarktung in der merkantilisierten Welt der Wissenschaft. Dieses Dilemma ist in erster Linie Folge des sprachlich, inhaltlich und machtbedingten Publikationsbias der internationalen wissenschaftlichen Publikationsszene und zum anderen dem in Deutschland vielfach zu beobachtenden gesundheitswissenschaftlichen und -politischen Germano- oder zumindest Eurozentrismus geschuldet. Dies zu ändern, erfordert eher Publikations- als Wissenschaftsförderung. Doch davon steht in dem Papier nichts, ebenso wenig wie von den möglichen Ursachen der aufgeführten unterschiedlichen nationalen Publikationsumfänge (S. 48ff).
Eine Kernforderung des Leopoldina-Papiers ist die nach "Entwicklung einer innovativen Forschungsagenda für die Bereiche Public Health und Global Health, die die globale, sich wandelnde Krankheitslast widerspiegelt" (S. 9, 61). Dieser Satz spiegelt unübersehbar den überwiegend medizinisch-naturwissenschaftlichen Hintergrund der AutorInnen wider und entlarvt gleichzeitig ihre eigentliche Absicht. Wer Public Health primär als Antwort auf die "Krankheitslast" begreift und funktionalisiert, degradiert sie zu einem verlängerten Arm von Medizin und Biowissenschaften. Dazu passt der ausgesprochen beschränkte Präventionsbegriff der Leopoldina-AutorInnen (S. 30; wenngleich nachgehend wieder etwas aufgeweitet, s. S. 44). Die Verkürzung von Prävention auf Impfungen und Früherkennung entspricht dem Verständnis von BiologInnen, MedizinerInnen und anderen NaturforscherInnen - einem gesundheitswissenschaftlichen Ansatz wird sie aber ebenso wenig gerecht wie dem tatsächlichen Umfang von Krankheitsvorbeugung bzw. -vermeidung und dem Bedarf an gesund erhaltenden Maßnahmen. Der Leopoldina-Standpunkt ist nicht nur biomedizinisch geprägt ("Wie verbessern wir den Beitrag von Forschung und Wissenschaft, um die Gesundheit der Bevölkerung zu verbessern?" (S. 7)), sondern erkennbar selbstreferenziell: "Inwiefern könnte eine Reform der wissenschaftlichen Einrichtungen im Bereich Public Health in Deutschland die Rolle Deutschlands auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene stärken? (S. 7f). Zwar enthält die Stellungnahme auch Empfehlungen für die Rückbesinnung auf die öffentliche Hand ("Ein starker Öffentlicher Gesundheitsdienst (ÖGD) und eine angemessene Ausbildung sind wichtige Voraussetzungen für ein funktionierendes Public-Health-System" (S. 8) - was auch immer ein "Public-Health-System" sein soll). Aber die Betonung vertikaler Ansätze wie der Bekämpfung von HIV/AIDS und chronischer Krankheiten (NCD, s. S. 6) weckt gleichzeitig Zweifel an der Komplexität und Integralität des Public-Health-Verständnisses der Leopoldina.
Insgesamt wappnen sich die AutorInnen des Papiers durch die stetige Verwendung genereller Begrifflichkeiten, gängiger Allgemeinplätze und unspezifischer Worthülsen gegen den Vorwurf einer inakzeptablen Einengung und der Auslassung relevanter Aspekte. Bedenklich ist dabei zugleich die Gewichtung bzw. wiederholte selektive Hervorhebung einzelner Gesichtspunkte, die zwar durchaus ihre Bedeutung haben mögen, deren grundlegende gesundheitswissenschaftliche Relevanz man allerdings in Frage stellen muss. So heißt es in der Zusammenfassung des Papiers: "Darüber hinaus müssen mehr Mittel für Sozial- und Verhaltenswissenschaften sowie für Genomik und andere, auf Omics-Technologien basierende Forschungsansätze und deren systematische Verbindung untereinander bereitgestellt werden" (S. 9; s. auch S. 33, 61, 66). Schön ist, dass auch Sozial- und Verhaltenswissenschaften benannt sind; schade ist dabei, dass viele andere Teile der Gesundheitswissenschaften keine zusätzlichen Mittel erhalten sollen; und besorgniserregend die einseitige Betonung von Genomik und Omics-Technologien. Die auf den ersten Blick willkürlich erscheinende, bei genaueren Hinsehen erkennbar interessensgeleitete Fokussierung auf einen bio-technokratischen Ansatz verdeutlicht den kaum verhohlenen Versuch, die Gesundheits- im Dienste der Krankheitswissenschaften zu instrumentalisieren und zu Hilfswissenschaften der Biomedizin zu degradieren.
Die grundlegenden und hinlänglich bekannten, in dem Papier ja zumindest auch benannten Auswirkungen sozialer Determinanten auf die Gesundheit der Bevölkerung lassen sich aber weder durch Genforschung noch durch Omics beseitigen oder kompensieren - erst recht nicht, wenn gleichzeitig soziale Ungleichheit und Depravation weltweit zunehmen. Ohne die Probleme aufgrund bestehender Patentregelungen zu benennen - das Wort Patent taucht nicht ein einziges Mal auf -, entbehrt die Forderung nach Forschungsförderung in Gentechnologie und sonstigen Bereichen der Biomedizin nicht nur einer überzeugenden Grundlage, sondern ist grob fahrlässig: Unter den bestehenden Bedingungen der Renditeorientierung und Gewinnmaximierung werden innovative biomedizinische Erkenntnisse bestehende soziale und gesundheitliche Ungleichheiten verstärken und eben nicht dazu beitragen, die Gesundheit der Bevölkerung zu verbessern.
Vor diesem Hintergrund entlarven sich die Verweise der mit ihrem traditionellen Namen Nationale Akademie der Naturforscher wesentlich treffender beschriebenen Leopoldina auf soziale Determinanten als Alibi, wenn nicht gar als Ablenkungsmanöver. "Weitere Forschungsanstrengungen sind erforderlich, um diese bereichsübergreifenden Themen zu verstehen; dazu zählt das breite Feld der Ungleichheit und der die Gesundheit beeinflussenden sozialen Determinanten" (S. 9). Hier ist deutlicher Widerspruch angezeigt: Es braucht nicht mehr und immer mehr Forschung, um die Zusammenhänge immer wieder aufs Neue zu belegen, die seit Jahrzehnten und letztlich spätestens seit Rudolf Virchow in diesem Land hinlänglich bewiesen sind. Die Beforschung sozialer Bedingungen und Ungleichheiten bleibt Selbstzweck, solange die Ergebnisse keine hinreichende Berücksichtigung in einer nationalen und globalen Health-in-All-Politik finden. Und so lange wie realitätsferne Modellbetrachtungen aus der Ökonomie erheblich größeren Einfluss auf gesundheitspolitische Entscheidungen nehmen als tausendfach belegte Zusammenhänge zwischen Lebensbedingungen und Gesundheit.
Auf den ersten Blick erscheint die Stellungnahme der Leopoldina zu Public Health als hervorragend gelungene Komposition aus Wort- und Begriffshülsen, die praktisch alle Aspekte benennen, aber kaum etwas davon mit Inhalt hinterlegen. Das Ganze ist garniert von wiederholten abrupten und inhaltlich nicht nachvollziehbaren Aneinanderreihungen (z.B. S. 30, linke Spalte Mitte und re. Spalte oben). Aus diesem dahin plätschernden Sammelsurium fallen allein biomedizinisch-naturwissenschaftliche Einzelaspekte heraus, die ein armseliges Verständnis von "Public Health" offenbaren, dabei aber klar die Stoßrichtung der angestrebten Neuausrichtung dieser Wissenschaft in Deutschland vorgeben.
Das lässt nichts Gutes ahnen. Tatsächlich ist die eigentliche Botschaft bedrohlich. Auch wenn der Begriff an keiner Stelle auftaucht, kann die Omics-Forschung - zumal bei ihrer bisher (?) ausschließlich individualmedizinischen Ausrichtung - letztlich doch eher auf die menschliche Resilienz, also die Widerstandsfähigkeit der Spezies Mensch gegenüber den herrschenden Umwelt- und Lebensbedingungen Einfluss nehmen als "die Umgebung und Gesellschaft so zu ändern, dass sie zum menschlichen Körper passen" (S. 33), wie das Leopoldina-Papier vollmundig behauptet. Mit dieser Logik lässt sich nicht nur die Forderung nach Änderung der krank machenden Verhältnisse aushebeln und damit die Auseinandersetzung mit machtvollen Strukturen vermeiden. Sie ist zynisch, bahnt sie doch bisher ungeahnte Möglichkeiten zur sozialen Selektion: Only the fittest survive - wer nicht genügend Resilienz erwerben kann, muss mit den katastrophalen Verhältnissen leben und sterben.
Die Leopoldina-NaturforscherInnen stellen ihre Stellungnahme als Volltext kostenfrei zum Download zur Verfügung.
Jens Holst, 28.6.15
Korruption sowie private Finanzierung von Gesundheitsleistungen - wichtigste Ursachen für zunehmende Antibiotikaresistenzen
 Antibiotika sind gehören zweifelsohne zu den wichtigsten Medikamenten. Sie erlauben die wirksame und ursächliche Therapie bakterieller Infektionen und tragen erheblich dazu bei, früher lebensbedrohliche Krankheiten zu beherrschen. Mittlerweile warnen ExpertInnen weltweit vor der Ausbreitung von Antibiotika-Resistenzen und ihren Folgen für die moderne Medizin. Zunehmende Antibiotikaresistenzen von Krankheitserregern haben auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) auf den Plan gerufen, die vor einer "postantibiotischen Ära" warnt, in der einfache Infektionen wieder zur tödlichen Gefahr werden können, nachzulesen beispielsweise in dem Artikel WHO warns against 'post-antibiotic' era von Sara Reardon in der angesehenen Zeitschrift Nature. Im vergangenen Jahr legte die WHO den Bericht Antimicrobial resistance: global report on surveillance 2014, in dem sie die Resistenzentwicklung in verschiedenen Weltregionen und bei bestimmten Bakterien detailliert darstellt.
Antibiotika sind gehören zweifelsohne zu den wichtigsten Medikamenten. Sie erlauben die wirksame und ursächliche Therapie bakterieller Infektionen und tragen erheblich dazu bei, früher lebensbedrohliche Krankheiten zu beherrschen. Mittlerweile warnen ExpertInnen weltweit vor der Ausbreitung von Antibiotika-Resistenzen und ihren Folgen für die moderne Medizin. Zunehmende Antibiotikaresistenzen von Krankheitserregern haben auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) auf den Plan gerufen, die vor einer "postantibiotischen Ära" warnt, in der einfache Infektionen wieder zur tödlichen Gefahr werden können, nachzulesen beispielsweise in dem Artikel WHO warns against 'post-antibiotic' era von Sara Reardon in der angesehenen Zeitschrift Nature. Im vergangenen Jahr legte die WHO den Bericht Antimicrobial resistance: global report on surveillance 2014, in dem sie die Resistenzentwicklung in verschiedenen Weltregionen und bei bestimmten Bakterien detailliert darstellt.
Mittlerweile haben beispielsweise die us-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention und der National Health Service explizite Warnung vor Antiobiotika-Resistenzen herausgegeben: Antimicrobial resistance und Antibiotic Resistance Threats in the US.
Auch in Deutschland stehen multiresistente Keime und zunehmende Resistenzentwicklungen zunehmend auf der Tagesordnung. Die DAK führt die zunehmende Resistenzentwicklung in ihrem Antibiotika-Report 2014 auf die bestehende Über- und Fehlversorgung im Gesundheitswesen zurück. Eine Umfrage zeigte, dass ein Drittel der BürgerInnen in den letzten zwölf Monaten mindestens einmal ein Rezept für ein Antibiotikum erhielt, bei Frauen sogar zwei von fünf Befragten. Dabei sind die Indikationen vielfach mehr als fragwürdig.
Ende März 2015 legte Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe einen 10-Punkte-Plan zur Bekämpfung resistenter Erreger: 10-Punkte-Plan zur Vermeidung behandlungsassoziierter Infektionen und Antibiotika-Resistenzen vor. Er beginnt mit dieser Analyse: "In Deutschland treten jährlich zwischen 400.000 bis 600.000 behandlungsassoziierte Infektionen auf. Diese können im Zusammenhang mit einer stationären oder ambulanten Behandlung stehen. Die demographische Entwicklung, eine Zunahme an komplizierten medizinischen Eingriffen und der Anstieg an resistenten Infektionserregern tragen zu einer Verstärkung des Problems bei. Ein Drittel dieser Infektionen ist durch geeignete Maßnahmen vermeidbar. Durch eine enge Zusammenarbeit von Bund und Ländern, aber auch von Krankenhäusern und ihren Trägern muss dieser hohen Zahl von Infektionen mit jährlich 10.000 bis 15.000 Todesfällen entgegengewirkt werden."
Den hier erkennbaren, eingeengten Blick des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) auf die wachsenden Problematik multiresistenter Krankheitserreger zeigen auch die zehn Punkte des Plans:
1. Ausbreitung multiresistenter Erreger verhindern
2. Hygienestandards in allen Einrichtungen weiter ausbauen
3. Bessere Informationen zur Hygienequalität in Krankenhäusern
4. Meldepflichten zur Früherkennung resistenter Erreger verschärfen
5. Verpflichtende Fortbildung des medizinischen Personals
6. Versorgungsforschung zur Vermeidung nosokomialer Infektionen verbessern
7. "One-Health"-Gedanken stärken: Aktualisierung der Deutschen Antibiotika-Resistenzstrategie
8. Forschung und Entwicklung neuer Antibiotika ermöglichen (Pharmadialog)
9. Deutsche globale Gesundheitspolitik zur Bekämpfung von Antibiotika-Resistenzen nutzen
10. Antibiotika-Resistenzen durch Kooperation der G7 bekämpfen
Die Pharma-Hersteller wittern bereits Morgenluft: Der Verband forschender Arzneimittelhersteller (vfa) stellt sich in seinem Positionspapier "Antibiotika und Resistenzen" eine vielversprechende Zukunft vor: "Neue Antibiotika gegen Problemkeime werden dringend gebraucht. Forschende Pharma-Unternehmen arbeiten weltweit wieder verstärkt an solchen Präparaten", und fordert bei dieser Gelegenheit "angemessene frühe Nutzenbewertungen und Vergütungen für neu entwickelte, auch gegen resistente Bakterien wirksame Antibiotika". Offenbar sieht auch die Bundesregierung das Heil in der Technologie, sei es durch Verbesserung der Hygiene, Erfassung, Fortbildung oder Pharma-Forschung; aus diesem fokussierten Mehr-vom-Gleichen hebt sich allein die "One-Health"-Idee ab, also der Förderung und Erhaltung der Gesundheit im Human-, Tier- und Umweltbereich - aber so richtig sie ist, auch sie lässt die gebotene Komplexität vermissen.
Über den deutschen Tellerrand hinaus will die Bundesregierung mit dem Multiresistenz-Problem nun auch in die globale Gesundheitspolitik eingreifen. Diese Art des zuletzt so oft geforderten verstärkten Engagements Deutschlands in der Welt ist grundsätzlich zu begrüßen. Aber der 10-Punkte-Plan und bisherige Verlautbarungen lassen befürchten, dass die gesundheitspolitische Prioritätensetzung für den nächsten, von Deutschland ausgerichteten G7-Gipfel Stückwerk bleiben. Das Problem zunehmender Antibiotika-Resistenzen verdeutlicht nachdrücklich die enge Verknüpfung von nationaler und globaler Gesundheitspolitik sowie die Komplexität wirksamer Gesundheitspolitik. Antibiotika-Resistenzen erfordern nicht nur Maßnahmen in der ärztlichen Versorgung - z. B. Verminderung des Verschreibungsverhalten durch geeignete Leitlinien, Honorierungsformen und Anreize -, und in der Veterinärmedizin - u. a. zurückhaltende Antibiotika-Gaben, Trennung von Verordnung und Gewinn, sondern auch grundlegende Änderungen in der Marketing- und Verkaufspolitik der Pharmaunternehmen und der landwirtschaftlichen Produktion: Solange die krank machenden Mastbedingungen in der Geflügel-, Schweine-, Rinder und Fischzucht die ständige Verabreichung von Medikamenten gegen Bakterien und Pilze erfordern, ist wenig Änderung zu erwarten. Hinzu kommt die Verabreichung bestimmter Antibiotika nicht aus medizinischen Gründen, sondern zur Mastbeschleunigung im Dienste purer Profitgier.
Soeben legte der Wissenschaftliche Beirat für Agrarpolitik beim Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft sein aktuelles Gutachten zum Thema über Wege zu einer gesellschaftlich akzeptierten Nutztierhaltung vor. Darin widmet sich der Rat auch ausführlich dem Thema der Antibiotikaresistenzen und möglicher Einflüsse aus bzw. Effekte auf die Landwirtschaft und konstatiert unter anderem "erhebliches Potenzial zur Reduktion des Antibiotikaeinsatzes beim Masthuhn ohne Einbußen bei der Tiergesundheit" (S. 147). Es bleibt zu hoffen, dass diese Erkenntnisse hinreichende Berücksichtigung in der globalen Gesundheitspolitik der Bundesregierung und auf bei den entsprechenden Verhandlungen auf dem G7-Gipfel im Juni auf dem bayerischen Schloss Elmau findet.
Mittlerweile deutet zudem einiges darauf hin, dass ein Erfolg versprechendes Vorgehen gegen zunehmende Antibiotikaresistenzen ein noch komplexeres Vorgehen erfordert. Galten bisher die zu häufige und falsche Verschreibung sowie der intensive Gebrauch von Antibiotika in der Landwirtschaft als wesentliche Verursacher der weltweiten Resistenzzunahme, weisen nun australische WissenschaftlerInnen auf andere Faktoren hin. In dem kürzlich in der OpenóSource-Zeitschrift PLOS one erschienenen Artikel Antimicrobial Resistance: The Major Contribution of Poor Governance and Corruption to This Growing Problem kommen die AutorInnen Peter Collignon, Prema-chandra Athukorala, Sanjaya Senanayake und Fahad Khan zu dem Ergebnis, dass Regierungsführung (bzw. "Governance" und Korruption entscheidende Triebfedern bei der Entstehung von Multiresistenzen sind; zudem korreliert die Resistenzentwicklung mit dem Ausmaß der privaten Gesundheitsfinanzierung.
In ihrer retrospektiven multivariaten Analyse der Antibiotikaresistenzvariabilität in Europa berücksichtigten die australischen ForscherInnen nicht nur den Gebrauch von Antibiotika in der Humanmedizin, sondern auch den Anteil privater Gesundheitsausgaben, die berufliche Bildung, die Wirtschaftsentwicklung (gemessen am Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt) und der Güte der Regierungsführung bzw. dem Ausmaß von Korruption. Die Ergebnisse beruhen auf zwischen 1998 und 2010 erhobenen Daten aus 28 europäischen Ländern, die Vergleiche zwischen Ländern wie innerhalb der Staaten erlauben. Grundlage der Modellrechnungen war ein Paneldatensatz aus menschlichen Blutproben, bei denen ein Screening nach sieben pathogenen Klassen aus Erregern und Resistenzen gegenüber bestimmten Antibiotika und die Messung der entsprechenden Antibiotikaresistenzraten erfolgte.
Die Ergebnisse der Forschergruppe aus Australien lassen sich folgendermaßen zusammenfassen:
• Nur 28 % der ermittelten Länderunterschiede bei der Antibiotikaresistenz sind auf Antibiotika-Gebrauch zurückzuführen; rechnet man Einmaleffekte hinzu, steigt die Erklärungskraft auf 33 %.
• Berücksichtigt man in der Regressionsanalyse jedoch den Indikator Korruptionskontrolle als zusätzliche Variable, lässt sich die Gesamtvariation in der Antibiotikaresistenz zu fast zwei Dritteln (63 %) erklären.
• Da komplette multivariate Regressionsanalyse dieses Ergebnis nur um 7 % ändert, stellt Korruption den wichtigsten sozioökonomischen Faktor der Antibiotikaresistenz dar; die Korruptionseffekte waren statistisch signifikant (P < 0,01); eine Verbesserung des Korruptionsindikators um eine Einheit reduziert der Antibiotikaresistenz um etwa 0,7 Einheiten.
•Das Einkommensniveau eines Landes scheint keine Auswirkungen auf die Resistenzraten zu haben, wohl aber der Anteil der privaten Gesundheitsausgaben am Nationaleinkommen: Je höher der Anteil der Privatausgaben in der Gesundheitsfinanzierung, desto größer ist das Risiko für Antibiotikaresistenzen.
Die AutorInnen verweisen auf die bedeutsamen (gesundheits)politischen Implikationen ihrer Untersuchungsergebnisse und kommen zu dem Schluss: "These findings support the hypothesis that poor governance and corruption contributes to levels of antibiotic resistance and correlate better than antibiotic usage volumes with resistance rates. We conclude that addressing corruption and improving governance will lead to a reduction in antibiotic resistance." Sie bezweifeln nicht die Bedeutung der Human- und Veterinärmedizin und der Umwelt für die Entstehung von Resistenzen gegen Antibiotika und sind sich der Vielschichtigkeit dieses Problems bewusst. Aber sie zeigen in eindrücklicher Weise auf, dass die gängigen nationalen wie globalen, rein gesundheitspolitischen Ansätze zur Beherrschung der Resistenzentwicklung unzureichend für eine Überwindung dieses Problems sind.
Der Artikel ist kostenfrei verfügbar und steht auch als PDF-Datei zum Download zur Verfügung.
Jens Holst, 30.3.15
Wie sich öffentlich organisierte und finanzierte Familienplanung und Sexualberatung in den USA auszahlt!
 Auch wenn man orthodox-katholisch ist und z.B. den erleichterten Zugang zu empfängnisverhütenden Mitteln und zur Beratung für einen Schwangerschaftsabbruch für junge Frauen ablehnt, gehört eine gute kurative wie präventive Beratung über Geschlechtskrankheiten, HIV, Unfruchtbarkeit, Problemschwangerschaften, Frühgeburten und die Geburt eines Kindes mit geringem Gewicht zu den anerkannten Leistungen öffentlicher Familienplanung mit Schwerpunkt bei Frauen und Männern aus niedrigen sozialen Schichten. Aber auch diese oft aus Steuermitteln finanzierten Leistungen müssen sich bei aller nachgewiesenen Wirksamkeit bei der Vermeidung ungewünschter Schwangerschaften/Geburten oder Geschlechtskrankheiten auch nach ihrem ökonomischen Nutzen fragen lassen.
Auch wenn man orthodox-katholisch ist und z.B. den erleichterten Zugang zu empfängnisverhütenden Mitteln und zur Beratung für einen Schwangerschaftsabbruch für junge Frauen ablehnt, gehört eine gute kurative wie präventive Beratung über Geschlechtskrankheiten, HIV, Unfruchtbarkeit, Problemschwangerschaften, Frühgeburten und die Geburt eines Kindes mit geringem Gewicht zu den anerkannten Leistungen öffentlicher Familienplanung mit Schwerpunkt bei Frauen und Männern aus niedrigen sozialen Schichten. Aber auch diese oft aus Steuermitteln finanzierten Leistungen müssen sich bei aller nachgewiesenen Wirksamkeit bei der Vermeidung ungewünschter Schwangerschaften/Geburten oder Geschlechtskrankheiten auch nach ihrem ökonomischen Nutzen fragen lassen.
Diesen hat nun eine WissenschaftlerInnengruppe des us-amerikanischen Think-Tanks "Guttmacher Institute" erstmals für die USA genauer untersucht.
Dazu berechneten die ForscherInnen zum einen die gesamten öffentlichen Ausgaben für die weiter oben genannten Leistungen der Familienplanung und stellten ihnen die Ersparnisse durch vermiedene ungewünschte Schwangerschaften, Geschlechtskrankheiten oder Folgen unzureichender Impfungen gegenüber. Den im Jahr 2010 anfallenden Kosten von 2,2 Milliarden US-Dollar standen öffentliche Ersparnisse von rund 15,8 Milliarden US-Dollar - darunter rund 15,7 Milliarden US-Dollar durch die Verhinderung ungewünschter Geburten - gegenüber. Die durch die Angebote öffentlicher Familienplanung und -beratung erzielte öffentliche Nettoersparnis betrug also rund 13,6 Milliarden US-Dollar oder 7,09 US-Dollar pro aus öffentlichen Mitteln aufgebrachten Dollar. Wer meint, dies sei ein enormer Nutzen, den weisen die ForscherInnen darauf hin, dass sie dabei nur den medizinischen Nutzen im engeren Sinne berücksichtigt haben. Der soziale und individualökonomische Nutzen für die Teeenager und dessen zum Teil wieder volkswirtschaftlich positive ökonomische Auswirkungen müsste streng genommen noch hinzugefügt werden.
Der Schluss der AutorInnen lautet so: "In sum, our estimates provide new evidence of the national-level and state-level value of public programs that support family planning and related preventive services. These programs and providers not only help women and couples avoid unintended pregnancy but also make valuable contributions to reducing the incidence and impact of cervical cancer, STIs, infertility, and preterm and LBW births. And by supporting these vital preventive care services, the government also ends up saving many billions of public dollars."
Der 2014 in der renommierten multidisziplinären Zeitschrift für Bevölkerungsgesundheit und Gesundheitspolitik "The Milbank Quarterly" erschienene Aufsatz Return on Investment: A Fuller Assessment of the Benefits and Cost Savings of the US Publicly Funded Family Planning Program von Jennifer Frost et al. ist komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 11.11.14
Mammografie-Screening 3: Frauen schlecht informiert über Nutzen und Risiken
 Der Nutzen des Mammografie-Screenings ist fraglich (wir berichteten). Gynäkologen scheinen nicht dazu in der Lage, über Nutzen und Risiken zu informieren und die gesetzlich geforderte informierte Entscheidung der Betroffenen zu ermöglichen (wir berichteten).
Der Nutzen des Mammografie-Screenings ist fraglich (wir berichteten). Gynäkologen scheinen nicht dazu in der Lage, über Nutzen und Risiken zu informieren und die gesetzlich geforderte informierte Entscheidung der Betroffenen zu ermöglichen (wir berichteten).
Norbert Schmacke und Marie-Luise Dierks testeten in Untersuchung für den Bertelsmann Gesundheitsmonitor einige Aspekte des Brustkrebs- und Screening-Wissens von 1852 Frauen, die in der BARMER GEK versichert sind und aktuell oder in naher Zukunft einen Anspruch auf die Screening-Mammografie haben.
Als grundlegende und notwendige Informationen für eine informierte Entscheidung zur Früherkennung gelten entsprechend der "Guten Praxis Gesundheitsinformation":
1. Das Risiko für das Vorliegen der jeweiligen Krebserkrankung (Prävalenz).
2. Der Nutzen der Früherkennung dieser Krebserkrankung.
3. Die Risiken der Früherkennung.
Die anspruchsberechtigten Frauen hatten mit dem Einladungsschreiben ein Merkblatt des Gemeinsamen Bundesausschusses zum Mammografie-Screening erhalten, das zuletzt 2010 überarbeitet wurde und über Vor- und Nachteile des Programms aufklären soll (Website, Download).
Zu diesem Merkblatt sei ausdrücklich angemerkt, dass es - im Gegensatz zu vielen anderen Informationsmaterialien - einen großen Fortschritt darstellt, weil die darin enthaltenen Informationen zutreffend sind und keinen werbenden Charakter haben (wir berichteten).
Trotzdem ist das Wissen der Frauen, die das Merkblatt erhalten haben, nicht besser als das Wissen derjenigen, die es noch nicht erhalten haben. Dies dürfte im Wesentlichen darauf zurückzuführen sein, dass zugesandte Informationsmaterialien nur von einer Minderheit überhaupt gelesen werden. Darüber hinaus dürfte aber auch die Verständlichkeit des Merkblatts verbesserungsfähig sein.
Aktuelles Brustkrebsrisiko: Das Risiko für das Vorliegen von Brustkrebs wird im Merkblatt eher unklar ausgedrückt: eine von 20 Frauen erkranke im Alter zwischen 50 und 69 Jahre an Brustkrebs (S. 4). Das Sterberisiko verbirgt sich in folgendem Satz: "Rund 17.500 Frauen sterben jährlich an Brustkrebs, im Alter zwischen 50 und 69 Jahren etwa eine von 80 Frauen." (S. 4) Aus diesen Angaben das individuelle Risiko abzuleiten, dürfte den meisten Frauen Schwierigkeiten bereiten (dem Autor dieses Beitrags auch).
Da in der Studie nicht nach dem Wissen um die Brustkrebsprävalenz gefragt wird, ist der Wissensstand um dieses Grundrisiko nicht beurteilbar.
Nutzen des Mammografie-Screenings: Die Senkung der Brustkrebssterblichkeit lässt sich im Merkblatt aus folgender Aussage ableiten (S. 11): "1 von 200 Frauen wird dank ihrer regelmäßigen Teilnahme [über 20 Jahre] vor dem Tod durch Brustkrebs bewahrt." Gerade einmal 4% nennen diese Zahl (bzw. 5 von 1000). Die Antworten liegen zwischen 0 und 999 bei einem Median von 100. 30% sind hingegen der sachlich falschen Meinung, dass die Screening-Untersuchung vor Brustkrebs schützt.
Das Nutzenkriterium Minderung der Gesamtsterblichkeit wird im Merkblatt nicht genannt und in der vorliegenden Studie nicht angesprochen. Ein Nachweis für die Senkung der Gesamtsterblichkeit ist bislang für das Mammografie-Screening - wie auch für andere Krebsscreenings - nicht erbracht.
Risiken des Mammografie-Screenings: Zu dem Problem der falsch positiven Befunde nennt das Merkblatt keine konkrete Zahl. Aus den Angaben (S. 10) lässt sich die Zahl 50 falsch positive Befunde für 200 Frauen in 20 Jahren ableiten. Auf die Frage nach dem Vorkommen eines "falschen Verdachts" antworten 32% mit "häufig oder manchmal", 36% mit "selten", 4% mit "nie" und 28% mit "weiß nicht".
Das Merkblatt enthält keine Zahlenangabe zu falsch negativen Befunden, die in der Studie als "vorhandene Krankheit übersehen" bezeichnet werden. Nach Meinung von 4% kommen falsch negative Befunde überhaupt nicht vor, 36% antworten mit "selten", 32% mit "häufig/manchmal" und 28% mit "weiß nicht".
Die Frage nach Überdiagnose und Übertherapie ("Durch eine Früherkennung wird eine Krankheit entdeckt, die niemals ausbrechen würde") beantworten 3% mit häufig, 13% mit "manchmal", 19% mit "selten", 19% mit "nie" und 46 % mit "weiß nicht".
Die Studie zeigt, dass das Wissen von Frauen, auch wenn sie bereits am Screening teilgenommen haben, Minimalanforderungen für eine informierte Entscheidung nicht entspricht. Das Basisrisiko wird nicht vermittelt und entsprechend falsch und überhöht eingeschätzt ebenso wie die Minderung des Brustkrebssterberisikos durch das Mammografie-Screening.
Die Einschätzungen und Entscheidungen der Frauen gründen daher auf falschen Zahlen, unrealistischen Annahmen und falschen Hoffnungen - ein allein aus ethischen Gründen unhaltbarer Zustand. Auch wird die gesetzliche Anforderung nach informierter Entscheidung offensichtlich in keiner Weise erfüllt.
2 Ansatzpunkte zur Verbesserung dürften deutlich sein.
• Die Ärzte müssen lernen, die grundlegenden Informationen über Screening zu vermitteln. Dafür müssen sie diese Grundkenntnisse erst einmal selbst erwerben.
• Das Merkblatt des Gemeinsamen Bundesausschusses muss so überarbeitet werden, dass die grundlegenden Informationen, die zur Entscheidung für oder gegen das Screening erforderlich sind, bei den Leserinnen ankommen.
Notwendig dürfte aber an erster Stelle sein, dass die Verantwortlichen - Politik, gemeinsame Selbstverwaltung/Gemeinsamer Bundesausschuss und die ärztliche Selbstverwaltung/Ärztekammern - ihre Verantwortung erkennen und entsprechend handeln.
Schmacke N, Dierks ML. Mammografie-Screening und informierte Entscheidung - mehr Fragen als Antworten. Gesundheitsmonitor Bertelsmann-Stiftung. 2014 Download
Merkblatt des zum Mammografie-Screening Download
Forum Gesundheitspolitik. Mammografie-Screening 1: Nutzen fraglich, wenn dann bestenfalls gering Link
Forum Gesundheitspolitik. Mammografie-Screening 2 Link
David Klemperer, 21.4.14
Mammografie-Screening 2: Gynäkologen schlecht informiert über Nutzen und Risiken
 Durch das Krebsfrüherkennungs- und -registergesetz - KFRG (Text), das am 9.4.2013 in Kraft getreten ist, haben die in der gesetzlichen Krankenversicherung Versicherten das Anrecht auf "umfassende
Durch das Krebsfrüherkennungs- und -registergesetz - KFRG (Text), das am 9.4.2013 in Kraft getreten ist, haben die in der gesetzlichen Krankenversicherung Versicherten das Anrecht auf "umfassende
und verständliche Information (...) über Nutzen und Risiken der jeweiligen
[Früherkennungs-]Untersuchung".
Diese Formulierung aus dem neuen ß 25a SGB V (Text) stellt ein Art Zeitenwende dar, denn die Politik anerkannte hiermit die Erkenntnis, dass Krankheitsfrüherkennung stets mit Nutzen und Risiken verbunden ist. Sie folgte damit einmütigen Empfehlungen von zwei Arbeitsgruppen des Nationalen Krebsplans (Ziel 1 Inanspruchnahme Krebsfrüherkennung, Ziel 11a Verbesserung der Informationsangebote).
In der Begründung zum Gesetzentwurf der Bundesregierung (Download, S.36) wurde die problematische Seite der Früherkennung - falsch positive Befunde sowie Überdiagnose und Übertherapie -klar benannt:
"Denn auch bevölkerungsmedizinisch sinnvolle und empfehlenswerte Krebsfrüherkennungsmaßnahmen beinhalten für die gesunde bzw. beschwerdefreie Person ein Risiko. Hierzu gehören neben den Risiken der Untersuchung selbst die Konsequenzen falsch-negativer oder falsch-positiver Testbefunde, invasive Abklärungsuntersuchungen (z. B. die Entnahme von Gewebeproben) sowie die mögliche Diagnose und Behandlung von Krebserkrankungen, von denen die Person ohne die Früherkennung in ihrem Leben nie etwas gemerkt hätte."
Daher sollen die Betroffenen neutral und unabhängig informiert und beraten werden, so dass sie eine ihren Präferenzen entsprechende Entscheidung treffen können. Das Ziel einer informierten individuellen Entscheidung sei dem Ziel einer möglichst hohen Teilnahmerate übergeordnet.
Voraussetzung für die Erfüllung der Anforderungen, die das Gesetz stellt, sind gut informierte Ärzte und Patienten.
Als grundlegende Informationen für eine informierte Entscheidung zur Früherkennung gelten entsprechend der "Guten Praxis Gesundheitsinformation":
1. Das Risiko für das Vorliegen der jeweiligen Krebserkrankung (Prävalenz).
2. Der Nutzen der Früherkennung dieser Krebserkrankung.
3. Die Risiken der Früherkennung.
Odette Wegwarth und Gerd Gigerenzer vom Harding Center for Risk Literacy untersuchten kürzlich die Qualität ärztlicher Beratung zur Brustkrebsfrüherkennung.
20 Gynäkologen wurden in einer realen telefonischen Beratungssituation getestet. Die Anruferin gab sich als besorgte Tochter aus, ihre 55-jährige Mutter habe eine Einladung zum Mammografie-Screening erhalten. Die Situation war also im Sinne einer Hidden-Client-Untersuchung gestaltet, die Ärzte wussten nicht, dass es sich um einen Test handelt. Im Folgenden werden die nach aktuellem Wissensstand zutreffenden Informationen für 55-jährige Frauen, die über 10 Jahre regelmäßig am Mammografie-Screening teilnehmen genannt. Dem werden die Angaben der Gynäkologen gegenübergestellt.
Aktuelles Brustkrebsrisiko 55-jähriger Frauen: 1,5% , d.h. von 1000 haben 15 Brustkrebs und 985 keinen Brustkrebs.
9 der 20 Gynäkologen machten dazu Angaben. 3 machten die qualitative Angabe, es handele sich um den häufigsten Krebs der Frau. 6 nannten Zahlen. Ein Gynäkologe nannte die Zahl 25,4%, die anderen 10%. Während die Herkunft der Angabe 25,4% im Dunklen bleiben dürfte, beziehen sich die 10% auf das Lebenszeitrisiko
Nutzen des Mammografie-Screenings: 4 statt 5 von 1000 Frauen sterben an Brustkrebs. Die Gesamtsterblichkeit ist nicht gemindert.
17 der 20 Gynäkologen rieten ausdrücklich zur Mammographie als sichere und wissenschaftliche begründete Intervention. Die Zahlenangaben zum Nutzen lagen zwischen 20 und 50% der Brustkrebssterblichkeit, mehrheitlich bei 25%, entsprechend einer früheren Berechnung der Sterblichkeitssenkung von 4 auf 3 pro 1000 Frauen.
Ein Gynäkologe behauptete, die Inzidenz könne durch Screening gesenkt werden. Nur einer der 20 Gynäkologen wies darauf hin, dass es unbewiesen sei, ob das Screening die Gesamtmortalität senke.
Risiken des Mammografie-Screenings: zwischen 50 und 200 Frauen erhalten einen falsch positiven Befund ("falscher Alarm"); 5 Frauen erhalten eine Überdiagnose (Tumor wäre nie symptomatisch geworden) mit Übertherapie; 1 bis 2 Frauen erhalten einen falsch negativen Befund (Brustkrebs wird nicht erkannt). Das Risiko für Brustkrebs durch die Röntgenstrahlen liegt unter 1 Fall von 1000 Frauen.
8 Gynäkologen bezeichneten das Mammografie-Screening ohne weiteren Kommentar als harmlos, 5 sprachen das Strahlenrisiko an, 3 bezeichneten es als vernachlässigbar. 8 nannten falsch positive Ergebnisse, deren Bedeutung 5 von ihnen ohne Zahlenangabe als vernachlässigbar bezeichneten, 3 nannten falsch negative Ergebnisse, deren Rate sie zwischen 10 und 60% angaben. Keiner der 20 Gynäkologen erwähnte das Risiko der Überdiagnose und der Überbehandlung.
Risikokommunikation: Die Prävalenz sowie den Nutzen und die Risiken stellten nur eine Minderheit der Gynäkologen in Form von Zahlen dar. 7 der 20 Gynäkologen kommunizierten den Nutzen und 3 die Risiken numerisch. Dabei wurde der Nutzen als relatives Risiko und die Risiken als absolutes Risiko dargestellt, was das Verhältnis von Nutzen und Risiken sehr viel günstiger erscheinen lässt, als bei einheitlicher Darstellung von Nutzen und Risiken als absolutes Risiko.
Das Fazit dieser Untersuchung kann nur lauten: Die beratenden Gynäkologen zeigten sich ausgesprochen schlecht informiert. Die Nicht-Erwähnung gravierender Risiken erscheint bedenklich. Die Fähigkeiten, Wahrscheinlichkeiten bzw. Risiken zu kommunizieren sind nicht entwickelt. Einschränkend ist anzumerken, dass die Untersuchung nicht repräsentativ ist. Es dürfte aber eher unwahrscheinlich ein, dass eine größere Studie grundlegend bessere Ergebnisse erzielen würde. Es erscheint müßig, die Gynäkologen bezüglich ihrer Unwissenheit zu beschuldigen. In der Verantwortung steht vielmehr die ärztliche Selbstverwaltung, deren Auftrag auch darin besteht, die Einhaltung der Berufspflichten sicherzustellen. Auch die medizinischen Fachgesellschaften sollten sich angesprochen fühlen.
Diese Studie ergänzt das Wissen um die Unwissenheit und das Unverständnis vieler Ärzte bezüglich der Grundlagen von Screening, wie bereits im Forum berichtet ("Dramatische Wissenslücken: Ärzte und Früherkennung").
Das Ergebnis der Unwissenheit der Ärzte über die Grunddaten des Mammografie-Screenings ist Unwissenheit auf Seiten der Patientinnen, wie Norbert Schmacke und Marie-Luise Dierks in einer Untersuchung für den Bertelsmann Gesundheitsmonitor dargestellt haben. Dazu erscheint in Kürze ein eigener Forum-Beitrag.
Wegwarth O, Gigerenzer G. "There is nothing to worry about": Gynecologists' counseling on mammography. Patient Education and Counseling 2011;84:251-6. Abstract
Wegwarth O, Gigerenzer G. Risikokommunikation: Risiken und Unsicherheiten richtig verstehen lernen. Dtsch Arztebl 2011;108:A-448 / B-360
Welch HG, Black WC. Overdiagnosis in Cancer. Journal of the National Cancer Institute 2010;102:605-13.
Schmacke N, Dierks ML. Mammografie-Screening und informierte Entscheidung - mehr Fragen als Antworten. Gesundheitsmonitor Bertelsmann-Stiftung. 2014 Download
Forum Gesundheitspolitik. Mammografie-Screening 1: Nutzen fraglich, wenn dann bestenfalls gering Link
Forum Gesundheitspolitik. Mammografie-Screening 3: Frauen schlecht informiert über Nutzen und Risiken Link
David Klemperer, 20.4.14
Mammografie-Screening 1: Nutzen fraglich, wenn dann bestenfalls gering
 Die Früherkennung von Brustkrebs steht immer wieder in der Diskussion und wurde auch im Forum mehrfach angesprochen (Link). Grund dafür sind widersprüchliche Studienergebnisse. Das aktuelle Fazit lautet: Studien von höherer methodischer Qualität und damit niedrigerer Wahrscheinlichkeit der Verfälschung der Ergebnisse zeigen keinen Vorteil für die Früherkennung von Brustkrebs. Die Studien, welche eine Minderung der Brustkrebssterblichkeit berichten, weisen durchweg methodische Mängel auf, so dass die Ergebnisse fragwürdig sind.
Die Früherkennung von Brustkrebs steht immer wieder in der Diskussion und wurde auch im Forum mehrfach angesprochen (Link). Grund dafür sind widersprüchliche Studienergebnisse. Das aktuelle Fazit lautet: Studien von höherer methodischer Qualität und damit niedrigerer Wahrscheinlichkeit der Verfälschung der Ergebnisse zeigen keinen Vorteil für die Früherkennung von Brustkrebs. Die Studien, welche eine Minderung der Brustkrebssterblichkeit berichten, weisen durchweg methodische Mängel auf, so dass die Ergebnisse fragwürdig sind.
Dazu einige im Forum noch nicht dargestellte Informationen.
Eine im Juni 2013 erschienen aktualisierte Cochrane Review zum Brustkrebsscreening mit Mammografie wertete die Daten von 7 randomisierten kontrollierten Studie mit insgesamt etwa 500.000 Frauen aus (Abstract, Volltext).
3 dieser Studien, denen die Autoren geringes Verzerrungsrisiko bescheinigen, ergaben nach 13 Jahren Nachbeobachtung eine Minderung der Brustkrebssterblichkeit um 10%, ein Wert der statistisch nicht signifikant ist, also möglicherweise dem Zufall geschuldet ist. 4 Studien mit methodischen Mängeln, die zur Verfälschung der Ergebnisse führen können, zeigten eine Minderung der Brustkrebssterblichkeit um 25%. Zählt man die Ergebnisse der 7 Studien ungeachtet der Qualitätsprobleme zusammen, ergibt sich eine Minderung der Brustkrebssterblichkeit durch Früherkennung um 19%.
Die Rate der brusterhaltenden Operationen (Lumpektomie) war in der Früherkennungsgruppe um ein knappes Drittel höher (31%), die Rate für die operative Entfernung der Brust (Mastektomie) war um 20% höher als in der Vergleichsgruppe ohne Früherkennung. Der Anteil von Frauen, die Chemotherapie erhielten war hingegen in beiden Gruppen gleich.
Auf Grundlage der Annahme, dass Screening die Brustkrebssterblichkeit um 15% senkt und die Überdiagnose und Überbehandlung 30% betragen, kommen die Autoren zu folgendem Ergebnis.
Wenn 2000 Frauen 10 Jahre an einem Screening-Programm teilnehmen
• vermeidet eine Frau den Tod an Brustkrebs
• erhalten 10 gesunde Frauen die Diagnose Brustkrebs für einen Tumor, der sich nie bemerkbar gemacht hätte (Überdiagnose) und werden unnötig behandelt (Übertherapie)
• erhalten 200 Frauen einen falsch positiven Screening-Befund, d.h. die Mammographie zeigt eine Verdichtung, die sich bei der Abklärung als gutartig erweist.
Die Studien reichen bis in die 1960er-Jahre zurück. Die Autoren weisen darauf hin, dass seitdem erhebliche Fortschritte in der Behandlung von Brustkrebs erzielt worden seien und daher der - wenn überhaupt vorhanden geringe - Nutzen der Früherkennung noch geschrumpft sein dürfte.
Zur Nachdenklichkeit Anlass geben auch die im Februar 2014 veröffentlichten aktualisierten Ergebnisse der Kanadischen National Breast Screening Study, einer der 3 methodisch hochwertigen Studien, die in die oben genannte Cochrane Review eingegangen ist. In dieser randomisierten kontrollierten Studie wurden im Jahr 1980 knapp 90.000 Frauen im Alter von 40 bis 59 Jahren in zwei Gruppen aufgeteilt. In 25 Jahren wurde bei 3250 Frauen in der Mammografie-Screeninggruppe Brustkrebs diagnostiziert, und bei 3133 Frauen in der Kontrollgruppe. 500 Frauen in der Screeninggruppe und 505 Frauen in der Kontrollgruppe starben an Brustkrebs. In der Screeninggruppe wurden 106 Brustkrebsfälle mehr gezählt als in der Kontrollgruppe, somit sind 22% aller Brustkrebsfälle in der Screeninggruppe Überdiagnosen. Eine Minderung der Brustkrebssterblichkeit wurde weder in der Gruppe der 40- bis 49-Jährigen noch in der Gruppe der 50- bis 59-Jährigen festgestellt.
Angemerkt sei noch Folgendes: Früherkennung von Krebs soll bewirken, dass weniger Menschen am jeweiligen Krebs sterben und dass dadurch insgesamt weniger Menschen in einem definierten Zeitraum sterben. Letzteres, also die Verbesserung des Gesamtüberlebens und somit eine Verbesserung der Lebenserwartung durch Krebsfrüherkennung, hat bislang keine Studie belegen können.
Noch vor Erscheinen der aktualisierten Ergebnisse aus Kanada hatte das Fachgremium im Swiss Medical Board Nutzen und Risiken der Brustkrebs-Früherkennung in einem 83-seitigen Bericht bilanziert und schlussfolgernd von der Einführung systematischer Mammographie-Screening-Programme abgeraten und zur Befristung bestehender Programme geraten.
GÝtzsche PC, JÝrgensen KJ. Screening for breast cancer with mammography. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 6. Art. No.: CD001877. DOI: 10.1002/14651858.CD001877.pub5. Abstract Volltext
Informationsbroschüre der Autoren zum Mammografie-Screening Link
Miller AB, Wall C, Baines CJ, Sun P, To T, Narod SA. Twenty five year follow-up for breast cancer incidence and mortality of the Canadian National Breast Screening Study: randomised screening trial. BMJ 2014;348. Abstract Volltext
New York Times 11.2.2014 Vast Study Casts Doubts on Value of Mammograms Link
Swiss Medical Board. Systematisches Mammographie-Screening. Download Bericht, Download Pressemitteilung
Dazu eine Veröffentlichung im New England Journal of Medicine
Biller-Andorno N, Jüni P. Abolishing Mammography Screening Programs? A View from the Swiss Medical Board April 16, 2014 Link
Im Bereich "Comments" eine erwartbare lebhafte Diskussion.
Forum Gesundheitspolitik. Mammografie-Screening 2: Gynäkologen schlecht informiert über Nutzen und Risiken Link
Forum Gesundheitspolitik. Mammografie-Screening 3: Frauen schlecht informiert über Nutzen und Risiken Link
David Klemperer, 16.4.14
Vorsicht Grenzwert! Welches gesundheitliche Risiko birgt die EU-Richtlinie für Feinstaub in sich?
 Per staatlicher Verordnung oder Selbstverpflichtung von Herstellern und Anwendern festgelegte Grenzwerte von Stoffen, die als gesundheitliche Risikofaktoren gelten, haben oft nichts oder nur eingeschränkt mit ihrer wirklichen Gefährlichkeit zu tun, sondern sind das Ergebnis von politisch und ökonomisch bestimmten Aushandlungsprozessen.
Per staatlicher Verordnung oder Selbstverpflichtung von Herstellern und Anwendern festgelegte Grenzwerte von Stoffen, die als gesundheitliche Risikofaktoren gelten, haben oft nichts oder nur eingeschränkt mit ihrer wirklichen Gefährlichkeit zu tun, sondern sind das Ergebnis von politisch und ökonomisch bestimmten Aushandlungsprozessen.
Dies gilt offensichtlich auch für die EU-Richtlinie 1999/30/EG zu dem gesundheitliche Unbedenklichkeit suggerierenden Feinstaub-Grenzwert von 25 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Unabhängig von der hier vorgestellten aktuellen Studie liegt der EU-Grenzwert schon immer deutlich über dem von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) bei als gesundheitlich unbedenklich festgelegten Maximalwert von 10 Mikrogramm.
Eine internationale ForscherInnengruppe um den Niederländer Rob Beelen vom "Institute for Risk Assessment Sciences" an der Universität Utrecht hat nun im Rahmen der multizentrischen "European Study of Cohorts for Air Pollution Effects (ESCAPE)" untersucht, ob und welche gesundheitlich unerwünschten Auswirkungen der EU-Grenzwert hat. Dazu untersuchten die WissenschaftlerInnen die Daten von 22 europäischen Kohortenstudien, von denen 19 auch Feinstaubdaten enthielten. Die Gesamtstudienpopulation umfasste 367.251 überwiegend um 1990 für die Langzeituntersuchungen gewonnene TeilnehmerInnen mit insgesamt 5.118.039 Personenjahren. Folgeuntersuchungen wurden durchschnittlich nach 13,9 Jahren gemacht. Dabei fanden sich 29.076 Todesfälle. Nach Ausschluss des möglichen Einflusses des Konsums von Alkohol und Tabak, der sozialen Stellung sowie von Übergewicht und Bluthochdruck ergab sich ein signifikanter Zusammenhang zwischen der Feinstaubbelastung und der Wahrscheinlichkeit, während des Follow-up zu sterben.
Die ForscherInnen konzentrierten sich dabei vor allem auf die jährlich durchschnittlichen Konzentrationen von besonders feinem Feinstaub bis zu einer maximalen Größe von 10 Mikrometer. Diese Partikel sind seit Ende der 1990er Jahre als besonders gesundheitsgefährdend bekannt, da sie bis weit in das Lungengewebe vordringen und vermutlich sogar in den Blutkreislauf gelangen können.
Dabei hatten nicht nur Personen mit einer Partikelkonzentration oberhalb des EU-Grenzwerts eine signifikant geringere Lebenserwartung wegen des erhöhten Risikos von Lungenkrebs und Schlaganfall, sondern auch Personen, die einer Konzentration von Partikeln mit einer Größe von bis zu 2,5 Mikrometer ausgesetzt waren, die unterhalb des EU-Grenzwerts von 25 Mikrogramm pro Kubikmeter lag. Dies galt sogar auch dann, wenn die Partikelkonzentration unter der Marke von 20 Mikrogramm/Kubikmeter lag. Ob auch das Erkrankungs- und Sterblichkeitsrisiko für andere schwere Krankheiten der Atemwege und des Kreislaufs höher liegt, wird noch untersucht.
Statt der immer öfter insbesondere aus deutschen Städten mit ständigen Überschreitungen des aktuellen EU-Grenzwerts zu hörenden Forderung, diesen Wert noch zu erhöhen, wäre aus gesundheitlich-präventiver Sicht eigentlich eine Absenkung des Grenzwerts auf den WHO-Wert angemessen.
Die Studie Effects of long-term exposure to air pollution on natural-cause mortality: an analysis of 22 European cohorts within the multicentre ESCAPE project von Rob Beelen et al. ist am 9. Dezember 2013 im Fachjournal "The Lancet" als "eary online publication" erschienen. Ein Abstract ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 31.12.13
"Wer hat noch nicht, wer will noch mal": Ist die "Statinisierung" der Weltbevölkerung zwingend, sinnvoll oder vermeidbar?
 Nach der im November 2013 erfolgten Veröffentlichung einer neuen, von zahlreichen renommierten Experten erarbeiteten Leitlinie der beiden seriösen US-Fachgesellschaften "American College of Cardiology" und "American Heart Association" zur Bewertung des individuellen kardiovaskulären Risikos und zur Senkung erhöhter "böser" oder LDL-Cholesterinwerte (low-density lipoprotein cholesterol) insbesondere mit Statinen merkt die interessierte Öffentlichkeit erst langsam deren quantitative und qualitative Bedeutung.
Nach der im November 2013 erfolgten Veröffentlichung einer neuen, von zahlreichen renommierten Experten erarbeiteten Leitlinie der beiden seriösen US-Fachgesellschaften "American College of Cardiology" und "American Heart Association" zur Bewertung des individuellen kardiovaskulären Risikos und zur Senkung erhöhter "böser" oder LDL-Cholesterinwerte (low-density lipoprotein cholesterol) insbesondere mit Statinen merkt die interessierte Öffentlichkeit erst langsam deren quantitative und qualitative Bedeutung.
Im Mittelpunkt dieser Leitlinie steht eine selbst nach Meinung der Leitlinienkritiker monumentale Aufarbeitung der wissenschaftlichen Evidenz für einen Nutzen der Statintherapie. So taucht allein der Begriff "evidence" im Teil der Leitlinien über die Bewertung des kardiovaskulären Risikos 346 mal und im Teil, in dem es um die Behandlung geht sogar 522 mal auf. Die Anzahl der zitierten randomisierten kontrollierten Studien, die den Sinn und Nutzen einer Senkung des "bösen" Cholesterins und die Möglichkeiten der Prävention von Herzinfarkt und Schlaganfall untersucht haben, ist entsprechend groß.
Die Problematik der Leitlinie und ihrer praktischen Konsequenzen spitzt der Präventionsexperte J. Ioannidis vom "Stanford Prevention Research Center" in einem Kommentar ("viewpoint") in der Ausgabe des "Journal of the American Medical Association" vom 2. Dezember 2013 so zu: "It is uncertain whether this would be one oft he greatest achievements or one oft the worst disasters of medical history".
Die für ihn dabei leitenden Folgen und Umstände der Leitlinie und ihres Risikoberechnungsmodells sind u.a. folgende:
• Von den 101 Millionen Angehörigen der Bevölkerung in den USA, die aktuell an keiner kardiovaskulären Erkrankung leiden und zwischen 40 und 79 Jahre alt sind, hätten 33 Millionen nach dem Modell für die folgenden 10 Jahre ein Risiko für einen Herzinfarkt, Schlaganfall etc. von 7,5% und höher. Ihre intensive Behandlung mit Statinen wäre nach der Leitlinie in höchstem Maße empfehlenswert. Für 13 Millionen mit einem Risiko zwischen 5% und 7,4% empfiehlt die Leitlinie, die Einnahme von Statinen zu erwägen. Fast die Hälfte der aktuell kardiovaskulär gesunden Bevölkerung müsste bzw. könnte also dauerhaft mit Stationen behandelt werden.
• Der Autor berechnet schließlich nach demselben Modell und mit eher zurückhaltenden Annahmen, dass weltweit mindestens 920 Millionen kardiovaskulär gesunder Menschen mit Statinen behandlungsbedürftig wären. Berücksichtigt man dann noch, dass weltweit auch ein paar hundert Millionen kardiovaskulär kranker oder Menschen mit extrem hohen Cholesterinwerten schon mit Statinen behandelt werden, wird die quantitative Wirkung der Leitlinie und deren qualitative Relevanz für die Dauermedikation von weltweit mindestens anderthalb Milliarden Personen noch deutlicher.
• Die Kritik des Kommentators richtet sich vor allem auf die wissenschaftliche Qualität des der Leitlinie zu Grunde liegenden Modells der Risikovorhersage sowie die Unabhängigkeit eines Teils ihrer Verfasser. So hatten laut eines 2013 im "British Medical Journal" erschienenen Aufsatzes 8 der 15 Leitlinienautoren Beziehungen zu Pharmaunternehmen.
• Die Kritik am Modell richtet sich vor allem darauf, dass es zwar randomisierte kontrollierte Studien zur Wirkung von Statinen auf das LDL gibt, aber "no randomized evidence that this particular risk model, rather than any of its predecessors built with the same, similar, or other predictors, would identify the patients who benefit most from statin therapy and that the optimal treatment threshold is 5%, 7,5%, or even 2,5% or 15%." Zwischen jedem dieser Risiko-Schwellenwerte liegen mehrere hundert Millionen behandelter oder unbehandelter gesunder Menschen und natürlich mindestens genauso hohe Summen erzielter oder nicht erzielter Umsätze der Statinhersteller.
• Nicht zuletzt müssten nach Ansicht des Autors bei den Schwellenwerten für die Behandlungsnotwendigkeit aber auch die bekannten unerwünschten Wirkungen bei Statinen (stärker) berücksichtigt werden.
• Der Kommentar endet mit dem Appell, es müsse angesichts der bisherigen und künftigen Umsätze mit Statinen doch möglich sein, einen im Verhältnis kleinen Betrag einzusetzen um das beste Modell zur Prädiktion und der Behandlungsschwellenwerten von kardiovaskulären Erkrankungen zu erforschen und dafür genügend StudienteilnehmerInnen zu finden.
Die rund 50-seitige Leitlinie 2013 ACC/AHA Guideline on the Assessment of Cardiovascular Risk. A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines von Goff Jr DC, Lloyd-Jones DM, Bennett G, O'Donnell CJ, Coady S, Robinson J, D'Agostino Sr RB, Schwartz JS, Gibbons R, Shero ST, Greenland P, Smith Jr SC, Lackland DT, Sorlie P, Levy D, Stone NJ, Wilson PWF ist am 12. November 2013 online und komplett kostenlos in der Zeitschrift "Journal of the American College of Cardiology" und in der Zeitschrift "Circulation" erschienen.
Die jüngste und mit Sicherheit nicht letzte kritische Auseinandersetzung mit der Leitlinie More Than a Billion People Taking Statins?Potential Implications of the New Cardiovascular Guidelines von John Ioannidis ist am 2. Dezember 2013 online und ebenfalls kostenlos im "Journal of the American Medical Association" erschienen. Der Autor verweist auf eine Reihe für die weitere Debatte lehr- und hilfreiche Veröffentlichungen.
Bernard Braun, 3.12.13
ÔŅĹ"rztetag, Armut und Gesundheit: Kleinkariert, selbstbezogen und beschr√§nkt
 So schlimm sind die deutschen √"rzte doch gar nicht, k√∂nnte man im Anschluss an den 116. √"rztetag vom 28. - 31. Mai 2013 in Hannover denken. Nach Organspendeskandalen, Abkassiererei durch Individuelle Gesundheitsleistungen (IGeL) und parallel zum Bekenntnis zur regressiven Kopfpauschale in der Krankenkassenfinanzierung - das Forum berichtet in dem Beitrag Auf r√ľckw√§rtsgewandten Pfaden weiter zur Zweiklassenmedizin - beschlossen die Delegierten des √"rztetags, die gesundheitliche F√∂rderung sozial Benachteiligter zu st√§rken: "Als √"rzteschaft sehen wir unsere Verantwortung vor allem darin, auf eine Verringerung schichtenspezifischer Unterschiede in den Zugangsm√∂glichkeiten, in der Inanspruchnahme und Verf√ľgbarkeit gesundheitlicher Leistungen einzuwirken", hei√üt es in dem angenommen Antrag laut einer Meldung des Deutschen √"rzteblatts.
So schlimm sind die deutschen √"rzte doch gar nicht, k√∂nnte man im Anschluss an den 116. √"rztetag vom 28. - 31. Mai 2013 in Hannover denken. Nach Organspendeskandalen, Abkassiererei durch Individuelle Gesundheitsleistungen (IGeL) und parallel zum Bekenntnis zur regressiven Kopfpauschale in der Krankenkassenfinanzierung - das Forum berichtet in dem Beitrag Auf r√ľckw√§rtsgewandten Pfaden weiter zur Zweiklassenmedizin - beschlossen die Delegierten des √"rztetags, die gesundheitliche F√∂rderung sozial Benachteiligter zu st√§rken: "Als √"rzteschaft sehen wir unsere Verantwortung vor allem darin, auf eine Verringerung schichtenspezifischer Unterschiede in den Zugangsm√∂glichkeiten, in der Inanspruchnahme und Verf√ľgbarkeit gesundheitlicher Leistungen einzuwirken", hei√üt es in dem angenommen Antrag laut einer Meldung des Deutschen √"rzteblatts.
N√§heres geht aus der Pressemitteilung der Bundes√§rztekammer hervor. Richten soll es demn√§chst der ansonsten eher stiefm√ľtterlich behandelte √∂ffentliche Gesundheitsdienst (√īGD). Zwar hatte das Deutsche √"rzteblatt im M√§rz 2012 in dem Beitrag Der √∂ffentliche Gesundheitsdienst: Standortbestimmung mit hoffnungsvollem Ausblick ein interessantes Schlaglicht auf den √īGD und dessen Ann√§herung an Public Health geworfen, aber auch der ?-GD spiegelt nur einen kleineren Ausschnitt der Gesundheitswissenschaften wider.
In der deutschen √"rzteschaft herrscht offenkundig ein sehr enges Verst√§ndnis vom Zusammenhang zwischen Armut und Gesundheit vor, wie eine online verf√ľgbare Umfrage des Deutschen √"rzteblatts eindr√ľcklich belegt. MedizinerInnen denken zuallererst oder ausschlie√ülich an Ursachen und Ans√§tze innerhalb Krankenversorgungssystems, wenn es um Armut und Gesundheit geht. Das ist weder verwunderlich noch illegitim - aber eben nur ein Teil einer √ľberaus komplexen Wirklichkeit.
Dem eingeschr√§nkten Mediziner-Denken sitzen auch deutsche Medien auf, wenn sie aus Anlass des 116. Deutschen √"rztetags √Öber den Zusammenhang zwischen Armut und Gesundheit berichten. Zwar ist es zweifelsohne begr√ľ√üenswert, dass beispielsweise die S√ľddeutsche Zeitung diesem Thema einen l√§ngeren Beitrag dem Titel Arme sterben fr√ľher widmet. Allerdings ist die enge Ausrichtung auf pr√§ventiv-medizinische Ans√§tze wie √§rztliche Beratung, Zahnvorsorge, Schwangerenvorsorge doch etwas ern√ľchternd angesichts der internationalen und teilweise auch nationalen Debatte √ľber Soziale Determinanten von Gesundheit.
Ebenso wie eine Vielzahl fr√ľherer Untersuchungen zeigt auch der j√ľngste umfangreiche Bericht der WHO Kommission zu Sozialen Determinanten von Gesundheit mit dem Titel Closing the gap in a generation, dass die Gesundheit einer Bev√∂lkerung von weitaus mehr gesellschaftlichen Faktoren abh√§ngt als die Deutsche √"rzteschaft zu erkennen scheint. Bildung, Einkommen, soziale Einbindung, Lebens- und Arbeitsverh√§ltnisse, L√§rm- und Umweltbelastungen und andere soziale Determinanten bestimmen die Gesundheit der Bev√∂lkerung weitaus mehr als das √ľblicherweise als Gesundheitswesen bezeichnete Krankenversorgungssystem, dessen Einfluss bei etwa 20 % liegen d√ľrfte. Wer sp√ľrbare Auswirkungen von den auf dem √"rztetag 2013 vorgeschlagenen Ma√ünahmen erwartet, √ľbersch√§tzt massiv die Einflussm√∂glichkeiten des Medizinsystems und verkennt die gro√üe Bedeutung indirekter Gesundheitspolitik auf allen gesellschaftlichen Ebenen.
Auf die vielfach belegten Zusammenhänge zwischen Armut, sozialer Ungleichheit und Gesundheit hat das Forum Gesundheitspolitik wiederholt hingewiesen, so bereits 2005 in dem Beitrag Soziale Ungleichheit, Armut und Gesundheit Soziale Ungleichheit, Armut und Gesundheit oder im Mai 2012 in dem Beitrag Soziale Ungleichheiten der Gesundheit - Erfahrungen und Lehren aus 13 Jahren Labour-Regierung
Wer sich ernsthaft mit dem Thema Sozialer Determinanten von Gesundheit auseinandersetzen will, findet anderswo relevantere Erkenntnisse als auf dem √"rztetag, beispielsweise auf der Homepage vom 18. Kongress Armut und Gesundheit. Eine kleine Minderheit der niedergelassenen √"rzteschaft mag diese Veranstaltung als Ausdruck der vermeintlich linken Dominanz im Gesundheitswesen betrachten, wie es ein Beitrag auf der Homepage des radikalen Niedergelassenen-Netzwerks aend mit dem Titel Herr Montgomery spielt √ľber Bande nahelegt. Nicht nur dieser wahrlich bemerkenswerte Kommentar belegt, dass sich Teile der deutschen √"rzteschaft mittlerweile meilenweit von den Gedanken eines Rudolf Virchow entfernt hat, der den Arzt noch als quasi nat√ľrlichen Sachwalter der Armen betrachtete.
Wer sich ein umfassenderes Bild von der aktuellen Debatte √ľber soziale Determinanten machen m√∂chte, findet neben der oben genannten WHO-Publikation wichtige Hinweise unter den Unterlagen des 18. Kongresse Armut und Gesundheit, der am 6. und 7. M√§rz 2013 mit mehr als 2.000 Teilnehmer*innen unter Motto "Br√ľcken bauen zwischen Wissen und Handeln - Strategien der Gesundheitsf√∂rderung" in Berlin stattfand. Eine umfangreiche Dokumentation der Thematiken des Kongresses steht kostenfrei zum Download zur Verf√ľgung.
Jens Holst, 31.5.13
Metaanalyse zeigt: Vitamine und antioxidative Nahrungsergänzungsmittel nützen nichts gegen Herz-Kreislaufkrankheiten.
 In der Fülle der zum Teil auch bereits im "forum-Gesundheitspolitik" vorgestellten Studien über den präventiven und therapeutischen Nutzen einer Reihe von industriell gefertigten Vitaminen und antioxidativen Nahrungsergänzungsmittel, überwiegen hochwertige Studien, die keine Evidenz dafür fanden, dass diese Produkte das Risiko einer Herz-Kreislauferkrankung signifikant verringern oder sich auf die Sterblichkeit auswirken. Es gab aber auch einige andere hochwertige Studien, die bei dem einen oder anderen Vitamin oder Nahrungsergänzungsmittel einen signifikanten Nutzen für die Prävention von Herz-Kreislauferkrankungen behaupteten. Was für die weitere Bewertung dieser Produkte und entsprechende praktische Schlussfolgerungen für die Prävention und die Versorgung von Kranken bisher fehlte, war eine umfassende Metaanalyse, die gleichzeitig die Ergebnisse möglichst aller hochwertigen aber inhaltlich uneinigen Studien zu diesem Bereich insgesamt berechnet.
In der Fülle der zum Teil auch bereits im "forum-Gesundheitspolitik" vorgestellten Studien über den präventiven und therapeutischen Nutzen einer Reihe von industriell gefertigten Vitaminen und antioxidativen Nahrungsergänzungsmittel, überwiegen hochwertige Studien, die keine Evidenz dafür fanden, dass diese Produkte das Risiko einer Herz-Kreislauferkrankung signifikant verringern oder sich auf die Sterblichkeit auswirken. Es gab aber auch einige andere hochwertige Studien, die bei dem einen oder anderen Vitamin oder Nahrungsergänzungsmittel einen signifikanten Nutzen für die Prävention von Herz-Kreislauferkrankungen behaupteten. Was für die weitere Bewertung dieser Produkte und entsprechende praktische Schlussfolgerungen für die Prävention und die Versorgung von Kranken bisher fehlte, war eine umfassende Metaanalyse, die gleichzeitig die Ergebnisse möglichst aller hochwertigen aber inhaltlich uneinigen Studien zu diesem Bereich insgesamt berechnet.
Hieran versuchte sich jetzt eine ForscherInnengruppe aus Südkorea und schuf sich dazu aus insgesamt 2.240 bis zum November 2012 veröffentlichten wissenschaftlichen Beiträgen zur primär- oder sekundärpräventiven Wirksamkeit von Vitaminen und antioxidativen Ergänzungsmitteln (z.B. Vitamin A, B-6, B-12, C, D, E, Betacarotin, Selen, Folsäure) eine Basis von 50 randomisierten kontrollierten Studie mit insgesamt 294.478 TeilnehmerInnen (156.663 TeilnehmerInnen in den Interventionsgruppen und 137.815 TeilnehmerInnen in Kontrollgruppen).
Die damit durchgeführte umfassende Metaanalyse einschließlich einiger Subgruppen-Metaanalysen, kommt zu folgenden Erkenntnissen:
• Die zusätzlich zur Aufnahme über die Nahrung konsumierten industriell gefertigten Vitamine und Antioxidantien waren nicht mit einem niedrigeren Risiko großer kardiovaskulärer Ereignisse (z.B. Herzinfarkt) assoziiert (relatives Risiko 1,00).
• Auch Subgruppen-Metaanalysen in denen z.B. der Typ der Prävention, einzelne Vitamine oder Ergänzungsmittel, der Typ des kardiovaskulären Ereignisses, das Design der Studie, die methodische Qualität, die Behandlungsdauer, der Finanzier der Studie jeweils gesondert berücksichtigt wurde, konnten keinen statistisch signifikanten Nutzeneffekt der untersuchten Produkte belegen.
• Bei Metaanalysen mit einigen kleineren Studien zeigten sich sowohl unerwünschte wie erwünschte Effekte: So stieg mit der Einnahme einiger Vitamine das Risiko einer Angina pectoris marginal an. Die Aufnahme niedriger Dosen von Vitamin B-6 war mit einem leicht niedrigeren Risiko schwererer Herz-Kreislauferkrankungen assoziiert. Sowohl nützliche wie schädliche Effekte verschwanden aber fast immer dann, wenn die Analysen mit den Daten von qualitativ hochwertigen RCTs wiederholt wurden.
• Wenn dann doch die Metaanalyse hochwertiger Studien z.B. eine Assoziation der Einnahme von Vitamin B-6 mit einem niedrigeren Risiko der kardiovaskulären Sterblichkeit oder eine Assoziation der Einnahme von Vitamin E mit einem niedrigeren Herzinfarktrisiko zeigte, handelte es sich immer und ausschließlich um Studien, in denen die Ergänzungsmittel von Pharmaherstellern bereitgestellt worden waren. Diese Effekte tauchten aber markant in RCTs nicht auf, die nicht von Herstellern oder mit deren Unterstützung durchgeführt worden waren. In den Worten der ForscherInnen zeigten sich die genannten nützlichen Effekte "only in trials with supplements provided by the pharmaceutical industry." Und der vorsichtige Versuch, dieses Phänomen zu erklären, lautet so: "So we cannot completely exclude the possibility that this might have influenced the respective trial design, results, or interpretations."
• Die WissenschaftlerInnen lassen keinen Zweifel daran aufkommen, dass sie ihre Ergebnisse und die einer Reihe anderer im Text zitierten AutorInnen für so gesichert und ernst halten, dass sie eigentlich zu gesetzgeberischen Schlussfolgerungen für den Konsumentenschutz führen müssten: "Most countries permit the pharmaceutical or food industry to sell these supplements under the name of functional food or medical food, and many people take vitamin or antioxidant supplements in the belief that they improve their health. Based on recent meta-analyses of randomised controlled trials, including the current study, however, governments and regulating agencies for food and drugs should consider vitamin and antioxidant supplements as medicinal products and strictly evaluate their efficacy and safety before marketing."
• Abschließend halten die WissenschaftlerInnen aber dennoch weitere Studien für notwendig, um zum Beispiel zu klären, ob die ergänzende Zufuhr von Vitaminen zumindest den Personen hilft, die zu Beginn einer solchen Studie eine mangelhafte Versorgung mit dem einen oder anderen Vitamin hatten.
• Und hier der obligatorische Hinweis: Auch diese Ergebnisse sind kein Plädoyer gegen den Nutzen von Obst. Nur besteht er nicht in der Prävention von Herzinfarkten!
Warum aber nimmt man die Hersteller zahlreicher "Gesundheits"Produkte der boomenden Gesundheitswirtschaft nicht beim Wort und verlangt von ihnen alles das an Nutzennachweis und Nachweis der Schädigungsfreiheit, was die Hersteller eines Teils der Gesundheits- und Medizinprodukte des ersten Gesundheitsmarktes immer mehr erbringen müssen, wenn sie mit dem Begriff "Gesundheit" Konsumenten zu gewinnen versuchen?!
Die Ergebnisse der umfassenden Metaanalysen von Myung SK, Ju W, Cho B, et al. sind am 18. Januar 2013 unter dem Titel Efficacy of vitamin and antioxidant supplements in prevention of cardiovascular disease: systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. im renommierten "British Medical Journal" (2013; 346: f10) veröffentlicht worden und im Rahmen der "open access"-Politik dieser Zeitschrift komplett kostenlos zugänglich. Als wahre Fundgruppe für zahlreiche weitere interessante Ergebnisse erweisen sich die umfänglichen Tabellen im Anhang zu diesem Aufsatz.
Bernard Braun, 1.2.13
Sinkende Ausgaben = "hoher Stellenwert" der Prävention für die GKV!? Wenn nicht jetzt, wann denn dann "mehr Prävention"?
 Es kann nicht am Geldmangel der GKV liegen und auch nicht an mangelnden Er- und Bekenntnissen über und zur Notwendigkeit und zum Nutzen der Prävention, dass die Ausgaben der GKV für Prävention im Jahr 2011 spürbar geringer waren als im Jahr 2010 - und damit einen Trend der Vorjahre fortsetzten.
Es kann nicht am Geldmangel der GKV liegen und auch nicht an mangelnden Er- und Bekenntnissen über und zur Notwendigkeit und zum Nutzen der Prävention, dass die Ausgaben der GKV für Prävention im Jahr 2011 spürbar geringer waren als im Jahr 2010 - und damit einen Trend der Vorjahre fortsetzten.
Schon anlässlich der Veröffentlichung des Präventionsberichts 2011 des Medizinischen Dienstes des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen (MDS) zeigte sich nämlich, dass die Pro-Kopfausgaben der GKV für Prävention von 4,83 Euro im Jahr 2008 auf 4,33 Euro im Jahr 2011 gesunken waren (vgl. dazu den Forumsbeitrag GKV-Präventionsbericht 2011: Nimmt man ein Glas, das klein genug ist, kann man davon reden es sei halb voll...). Der entsprechende Betrag betrug 2011 nur noch 3,87 Euro. Die Gesamtausgaben für Prävention sind damit von 339,8 Millionen Euro im Jahr 2008 auf 270 Millionen Euro im Jahr 2011 gefallen.
Auch wenn Prävention nicht ausschließlich auf ihre Ausgaben reduziert werden sollte, verstärkt sich mit dem kontinuierlichen Schrumpfen der Ausgaben für Prävention im Millionenbereich die Diskrepanz zum kontinuierlichen Wachstum der kurativen Ausgaben im Milliardenbereich, zur vollmundigen Krisenrhetorik über die Bedrohungen der Folgen der demografischen Alterung (Stichwort: "demografische Katastrophe"), die wenigstens zum Teil durch Prävention vermieden werden könne und schließlich auch zu den Absichten der unendlichen Geschichte einer "Nationalen Präventionsstrategie".
Daran √§ndert leider auch der Versuch nichts, dem Zustand im Jahr 2011 etwas Gutes abzugewinnen: "Damit wurde der gesetzlich vorgesehene Orientierungs-/Ausgabenrichtwert für das Jahr 2011 von 2,86 Euro je Versicherten um 35% übertroffen. Dies zeigt, dass die Krankenkassen der Prävention und Gesundheitsförderung einen hohen Stellenwert beimessen."
Der Präventionsbericht 2012 enthält auch wieder ausführliche und zum Teil auch erfreuliche Übersichten zur Anzahl der mit Präventionsaktivitäten erreichten Personen und die Art der Präventionsmaßnahmen.
So wurden 2011 u.a.
• insgesamt 4,9 Millionen Personen erreicht,
• die GKV-Kassen beteiligten sich in 22.000 Settings mit Gesundheitsförderungsaktivitäten und erreichten damit direkt 2,4 Mio. Menschen.
• 44% der Setting-Maßnahmen fanden in Kindertagesst√§tten und 18% in Grundschulen statt. In diesen Settings erreichen die Präventionsangebote Kinder aller sozialen Schichten. Die krankenkassengeförderte Gesundheitsförderung und Prävention erfasste 43% aller Kitas in Deutschland. Insgesamt lagen 25% aller Settings in "sozialen Brennpunkten", also Stadtteilen oder Kommunen, in denen Bewohner stark von Einkommensarmut, Integrationsproblemen und Arbeitslosigkeit betroffen sind."
• "Die Maßnahmen (der betrieblichen Gesundheitsförderung) erreichten 6.800 Betriebe, was einer Steigerung um 5% entspricht. Die Zahl der in der betrieblichen Gesundheitsförderung erreichten Beschäftigten steigerte sich um 19% auf 800.000."
• Die Zahl der eingerichteten Gesundheitszirkel hat "um gut ein Drittel zugenommen. Mittlerweile kommen bei 25% der Projekte Gesundheitszirkel zur Anwendung."
• "Als Inhalte der Gesundheitsförderung standen die Reduktion körperlicher Belastungen mit 76%, das Stressmanagement mit 47% und die gesundheitsgerechte Mitarbeiterführung mit 35% im Vordergrund. Bei den beiden letztgenannten war eine Zunahme zu verzeichnen."
• Seit 2008 hat sich die "Zahl der drei- bis sechsjährigen Kinder, die über Interventionen erreicht wurden, welche sowohl an den Verhältnissen im Setting als auch am Verhalten der Menschen ansetzten und mehrere Themen gleichzeitig bearbeiteten, verdreifacht. In der betrieblichen Gesundheitsförderung stieg z. B. die Zahl der Präventionsmaßnahmen zu Stressbewältigung/Stressmanagement um 100%."
Den 128 Seiten umfassenden Präventionsbericht 2012. Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung: Primärprävention und betriebliche Gesundheitsförderung. Berichtsjahr 2011 der MDS-Autoren Nadine Schempp, Caroline Jung, Jan Seidel und Harald Strippel gibt es komplett kostenlos.
Bernard Braun, 11.1.13
Verkürzen Ängste und Depressionen das Leben?
 Einen Zusammenhang zwischen seelischer Belastung ("distress") und Sterblichkeit hat eine kürzlich veröffentlichte englische Studie ergeben.
Einen Zusammenhang zwischen seelischer Belastung ("distress") und Sterblichkeit hat eine kürzlich veröffentlichte englische Studie ergeben.
Mit einem einfachen, in etwa 5 Minuten ausfüllbaren und als ausreichend zuverlässig geltenden Fragebogen (General Health Questionnaire - GHQ-12) wurden 37.649 Frauen und 30.573 Männer im Alter von mindestens 35 Jahren von einem Interviewer in ihrer häuslichen Umgebung nach Zeichen von Angst und Depression befragt und in vier Gruppen eingeteilt - von keiner bis schwerer Symptomatik. Die Befragung wurde jährlich wiederholt, so dass für jede Teilnehmerin und jeden Teilnehmer Daten aus 11 Befragungen vorlagen. Die Studie war eingebettet in den Health Survey for England (Link). Dabei handelt es sich um eine seit 1991 in jährlichen Abständen durchgeführte Befragung einer repräsentativen Bevölkerungsstichprobe. Da umfangreiche Daten für jeden Teilnehmer erhoben wurden, konnten die Einflüsse von Gewicht, körperlicher Aktivität, Rauchen, Alkoholkonsum und Diabetes statistisch berücksichtigt werden. Dies ist erforderlich, weil die Auswirkungen der seelischen Belastung unabhängig vom Gesundheitsverhalten und anderen Einflussfaktoren gemessen werden sollten.
Zur Ermittlung der Sterblichkeit wurden die Mortalitätsdaten des National Health Service genutzt. Hier interessierten insbesondere die Todesursachen Herz-Kreislauf-Krankheiten, Krebs und externe Ursachen. Unter "externen Ursachen" werden Unfälle und Suizide gefasst.
Von den 68.222 Teilnehmern verstarben im Untersuchungszeitraum insgesamt 8.365, davon laut Todesbescheinigung 3.382 infolge einer koronaren Herzkrankheit, 2.552 an Krebs und 386 an einer externen Todesursache.
Die Gesamtsterblichkeit steigt mit dem Grad der seelischen Belastung. Im Bereich der geringen Belastung war die Mortalität um 20% erhöht im Vergleich zur Gruppe der nicht Nicht-Belasteten und zwar auch nach statistischer Berücksichtigung von sozialem Status, Alkoholkonsum und Rauchen. Im Sinne einer Dosis-Wirkungs-Beziehung steigt die Mortalität mit dem Belastungsgrad und zwar bis auf mehr als das Doppelte.
Ein vergleichbares Bild zeige die Sterblichkeit an der koronaren Herzkrankheit. Bei Krebs steigt die Mortalität erst bei hoher Belastung. Die Sterblichkeit an externen Todesursachen zeigt wieder das Bild einer Dosis-Wirkungs-Beziehung und zwar auch nach Berücksichtigung anderer Einflussfaktoren.
Zusammenfassend ergibt die Studie eine Beziehung zwischen seelischer Belastung und Gesamtsterblichkeit sowie der Sterblichkeit an koronarer Herzkrankheit, Krebs und externen Todesursachen. Bemerkenswert ist der Zusammenhang schon bei geringer Belastung bei der Gesamtsterblichkeit, der koronaren Herzkrankheit und externen Todesursachen und zwar unabhängig von einem breiten Spektrum anderer Einflussfaktoren auf die Sterblichkeit.
Sowohl die Autoren und auch Leserbriefschreiber (siehe Rapid responses) warnen vor voreiligen Schlüssen bezüglich der Ursächlichkeit. Da es sich um eine Beobachtungsstudie handelt, stellen die Ergebnisse statistische und nicht etwa kausale Zusammenhänge dar. Auch sind die Ergebnisse aufgrund der Studiengröße zwar statistisch signifikant, also eher nicht dem Zufall geschuldet. Die absoluten Unterschiede in den Belastungsgruppen sind aber gering und klinisch eher nicht relevant, wie die Autoren selbst feststellen.
Sozialmedizinisch erscheint die Studie interessant, weil anhaltende psychosoziale Belastungen über die physiologische Stressreaktion gesundheitsschädliche Wirkungen entfalten und zur sozialen Ungleichheit der Gesundheit beitragen können (Lehrbuch Sozialmedizin - Public Health, S.215 ff. Download, Kapitel 6: Soziale Ungleichheit der Gesundheit).
Konkrete präventive Zielsetzungen lassen sich aus dieser Studie jedoch noch nicht ableiten.
Russ TC, Stamatakis E, Hamer M, Starr JM, Kivimäki M, Batty GD. Association between psychological distress and mortality: individual participant pooled analysis of 10 prospective cohort studies. BMJ 2012;345. Volltext
David Klemperer, 21.8.12
Welches "Gewicht" haben sieben Verhaltens- und Risikofaktoren auf die kardiovaskuläre Gesundheit?
 Obwohl niedriger Blutdruck, Bewegung oder der Verzicht auf das Rauchen zusammen mit vier anderen so genannten Risikofaktoren seit Jahrzehnten als hilfreich bei der Prävention von Herz-/Kreislauferkrankungen empfohlen werden, schaffen es nur sehr wenige Personen, diese Ziele zu erreichen. Dieses kritische Bild der Präventionsbemühungen liefert eine gerade veröffentlichte und kommentierte Untersuchung der Entwicklung der sieben für die kardiovaskuläre Gesundheit relevant gehaltenen Verhaltens- und Körperwerten sowie der Gesamtsterblichkeit und kardiovaskulären Sterblichkeit bei 44.959 erwachsenen bevölkerungsrepräsentativen US-AmerikanerInnen.
Obwohl niedriger Blutdruck, Bewegung oder der Verzicht auf das Rauchen zusammen mit vier anderen so genannten Risikofaktoren seit Jahrzehnten als hilfreich bei der Prävention von Herz-/Kreislauferkrankungen empfohlen werden, schaffen es nur sehr wenige Personen, diese Ziele zu erreichen. Dieses kritische Bild der Präventionsbemühungen liefert eine gerade veröffentlichte und kommentierte Untersuchung der Entwicklung der sieben für die kardiovaskuläre Gesundheit relevant gehaltenen Verhaltens- und Körperwerten sowie der Gesamtsterblichkeit und kardiovaskulären Sterblichkeit bei 44.959 erwachsenen bevölkerungsrepräsentativen US-AmerikanerInnen.
Herz-/Kreislauferkrankungen gehören zu den häufigsten chronisch-degenerativen Krankheiten in entwickelten Gesellschaften und auch zu den Krankheiten, die seit Jahrzehnten im Mittelpunkt von Primär- und Sekundärprävention stehen. Entsprechend enthalten die Leitlinien medizinischer Fachgesellschaften und die diversen Ratgeber für Laien oder PatientInnen eine immer länger werdende Liste von Verhaltensweisen und gesundheitlichen Körperwerten, deren Ausübung und Erreichen gesundheitsförderlich sein sollen. Dazu gehören das Nichtrauchen, mindestens fünfmal pro Woche mäßige Bewegung, ein normaler Blutdruck-, Cholesterin- und Blutzuckerwert, ein niedriger Body Mass Index (BMI)-Werte und eine möglichst "gesunde"/vollwertige Ernährung. Gleichzeitig wurden die kritischen Schwellenwerte für alte und neue so genannte Risikofaktoren laufend verändert, d.h. fast durchweg abgesenkt und sollen auch weiter "schärfer" gestellt werden. Ob das Erreichen dieser Werte für alle möglicherweise gefährdeten Personen möglich ist, wie das möglich ist und ob der versprochene Nutzen wirklich erreicht wird, blieb aber weitgehend im Unklaren.
Die Hauptfacetten der Empirie dieser Präventionsbemühungen sind:
• Das Erreichen einer größeren Anzahl der genannten Gesundheitswerte war mit einem niedrigeren Risiko der gesamten sowie der kardiovaskulären Sterblichkeit assoziiert. So betrug nach der Alters- und Geschlechtsstandardisierung das Risiko der Gesamtsterblichkeit bei Personen, die eines oder keines der Ziele erreichten 14,8 Tote auf 1.000 Personenjahre und sank bei den Personen, die 6 und mehr der Ziele erreichten auf 5,4 Tote/1.000 Personenjahre. Die entsprechenden Risikowerte für die Herz-/Kreislaufsterblichkeit betrugen 6,5 und 1,5 und für das Risiko an einer ischämischen Herzerkrankung zu versterben 3,7 und 1,1 Tote/1.000 Personenjahre. Diejenigen, die 6 und mehr der Ziele erreichen haben anders ausgedrückt ein um 51% niedrigeres Gesamtsterblichkeitsrisiko, um 76% niedrigeres kardiovaskuläres Sterblichkeitsrisiko und ein um 70% niedrigeres Risiko an einer ischämischen Herzerkrankung zu sterben als die Personen, die nur eines oder keines der Ziele erreichen.
• Nur sehr wenige TeilnehmerInnen erreichten innerhalb des Untersuchungszeitraums alle sieben Werte oder Ziele. Die Anzahl derjenigen, die das schaffen, sinkt sogar von 2% in den Jahren 1988-1994 auf 1,2% in den Jahren 2005-2010. Die Gruppe der Personen, die keines oder nur eines der Ziele erreichen steigt dagegen im selben Zeitraum von 7,2% auf 8,8%.
Der Verfasser des Editorials zum Aufsatz hebt die Diskrepanz zwischen den von us-amerikanischen Kardiologen für den Zeitraum bis 2020 angekündigten neuen Grenzwerten und diesen Ergebnissen zum Status quo hervor und stellt sich die Frage nach den Ursachen für diesen Zustand. Dabei spielt seines Erachtens das für Erwartungen leitende Menschenbild eine große Rolle. Er charakterisiert das Menschenbild, das in den USA der Vorstellung zugrunde liegt, diese Zielwerte möglichst alle und auch leicht erreichen zu können, als das von einer jungen, gut ausgebildeten weißen Frau. Jede biologisch oder sozial bedingte Abweichung senkt die Wahrscheinlichkeit, die Ziele zu erreichen beträchtlich. Um die Diskrepanzen zwischen Notwendigkeit und Wirklichkeit vielleicht doch überwinden zu können, schlägt der Editor schließlich vor, die Grenzen der Gesundheitsversorgung und des Gesundheitssystems zu überwinden und daran zu arbeiten, die soziale Umgebung und den Zugang zu besseren Nahrungsmitteln und Aktivitäten zu verbessern. Seine weiteren Ausführungen wirken aber eher zwangsoptimistisch und voluntaristisch: "The nation can, and must, take one step forward toward improved cardiovascular health." Warum gesunde und auch bereits kranke Personen trotz gesichertem Wissen über das statistische und sogar ihr persönliches Erkrankungs- und Sterblichkeitsrisiko vieler ihrer Verhaltensweisen und Körperwerte nichts unternehmen, ist nach den beschriebenen empirischen Verhältnissen die nächste zu erkundende Frage.
Der Aufsatz "Trends in Cardiovascular Health Metrics and Associations With All-Cause and CVD Mortality Among US Adults" von Quanhe Yang et al., online veröffentlicht im "Journal of the American Medical Association (JAMA)" vom 16. März 2012, ist komplett kostenlos erhältlich.
Ebenfalls kostenlos erhält man das Editorial von Donald M. Lloyd-Jones: "Improving the Cardiovascular Health of the US Population".
Bernard Braun, 10.7.12
Macht nur konserviertes Fleisch krank - oder führt jede Art von Fleischkonsum zu höherer Sterblichkeit?
 Seit Längerem gibt es Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen dem Verzehr von Fleisch und dem Auftreten von koronarer Herzkrankheit (KHK), Schlaganfall und Diabetes mellitus (DM), was regelmäßig zu entsprechenden Ernährungsempfehlungen führt. Allerdings bestand bisher weitgehend Unklarheit, ob der Fleischkonsum insgesamt, der von rotem Fleisch oder der von haltbar gemachtem oder anderweitig verarbeitetem Fleisch pathogenetisch bedeutsam sind. Eine in Circulation, der Zeitschrift der American Heart Association (AHA - Amerikanische Herzvereinigung), erschienene Metaanalyse lieferte ein differenzierteres Bild von den Übeltätern: Demnach ist nur der Konsum von verarbeitetem Fleisch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit verbunden, an DM oder KHK zu leiden, nicht aber der Verzehr von "rotem Fleisch".
Seit Längerem gibt es Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen dem Verzehr von Fleisch und dem Auftreten von koronarer Herzkrankheit (KHK), Schlaganfall und Diabetes mellitus (DM), was regelmäßig zu entsprechenden Ernährungsempfehlungen führt. Allerdings bestand bisher weitgehend Unklarheit, ob der Fleischkonsum insgesamt, der von rotem Fleisch oder der von haltbar gemachtem oder anderweitig verarbeitetem Fleisch pathogenetisch bedeutsam sind. Eine in Circulation, der Zeitschrift der American Heart Association (AHA - Amerikanische Herzvereinigung), erschienene Metaanalyse lieferte ein differenzierteres Bild von den Übeltätern: Demnach ist nur der Konsum von verarbeitetem Fleisch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit verbunden, an DM oder KHK zu leiden, nicht aber der Verzehr von "rotem Fleisch".
Das legte jedenfalls die umfassende Untersuchung belegbarer Zusammenhänge zwischen dem Auftreten von Erkrankungen der Koronar- und Hirngefäße sowie Zuckerkrankheit und dem Verzehr von unverarbeitetem rotem, von verarbeitetem sowie von Fleisch insgesamt nahe, die drei WissenschaftlerInnen aus Harvard Renata Micha, Sarah Wallace und Dariush Mozaffarian bereits 2009 in Circulation publizierten. "Rotes Fleisch" ist definiert als unverarbeitetes bzw. nicht konserviertes Rinder-, Lamm-, Schweine- oder Wildfleisch außer Geflügel, Fisch oder Eiern; als "verarbeitet" gelten geräuchertes, gepökeltes, gesalzenes oder chemisch konserviertes Fleisch wie Schinken, Salami, Würste, Hot Dogs sowie anderweitig verarbeitet Feinkost- oder Fertiggerichte. Der Gesamtverzehr von Fleisch erfasst den Konsum sowohl unverarbeiteten als auch verarbeiteten Fleisches außer Geflügel und Fisch.
Bei ihrer systematischen Suche und Metaanalyse fahndeten die WissenschaftlerInnen nach sämtlichen Kohorten-, Fall-Kontroll- oder randomisierten Studien, die dem Zusammenhang zwischen Fleischkonsum und den drei chronischen Krankheiten bei ansonsten gesunden Erwachsenen auf den Grund gingen. Von den an Hand ihrer Abstracts thematisch identifizierten 1598 Studien erfüllten gerade einmal 20 die Einschlusskriterien; bei 17 handelte es sich um prospektive Kohorten- und bei drei um Fall-Kontrollstudien. Summa summarum erfassten die 20 Studien 1.218.380 Personen, von denen 23.889 an KHK und 10.797 an Diabetes mellitus erkrankt waren und 2.280 einen Schlaganfall erlitten.
Nach den Ergebnissen dieser Metaanalyse der WissenschaftlerInnen aus Harvard hat der Verzehr von rotem Fleisch weder einen erkennbaren Einfluss auf das Auftreten von KHK (die vier ausgewerteten Studien zeigten ein relatives Gesamtrisiko pro 100-Gramm Tageskonsum von 1.00; 95% Konfidenzinterval 0,81 bis 1,23; Heterogenitätswahrscheinlichkeit P = 0,36) und DM (insgesamt 5 Studien, relatives Risiko 1,16; 95% Konfidenzinterval, 0,92 biso 1,46; P = 0,25). Bei verarbeitetem Fleisch waren hingegen bereits bei vergleichsweise geringer Steigerung der täglich verzehrten Menge um 50 Gramm ein 42 Prozent höheres Risiko für eine KHK (n = 5, relatives Risiko pro 50-Gramm Tagesverzehr 1,42; 95% Konfidenzinterval 1,07 bis 1,89; P = 0,04). Lässt man eine große US-Studie mit mehr als einer halben Million TeilnehmerInnen außer Acht, deren Endpunkt nur die koronare Sterblichkeit, nicht aber das Auftreten von KHK insgesamt war, zeigte sich ein noch drastischeres Ergebnis: Der Verzehr von verarbeitetem Fleisch führt nahezu zu einer Verdoppelung des Risikos krankhafter Veränderungen der Koronarien RR = 1,90; 95% KI, 1,00 - 3,62. Jene US-Studie der AutorInnen Rashmi Sinha, Amanda Cross, Barry Graubard, Michael Leitzmann und Arthur Schatzkin erschien bereits 2009 unter dem Titel Meat intake and mortality: a prospective study of over half a million people in den Archives of Internal Medicine 169 (6), Seiten 562-571 war zu dem Ergebnis gekommen, der Verzehr von rotem und verarbeitetem Fleisch führe zu einem geringen Anstieg sowohl der Gesamt- als auch der Tumor-bedingten und kardiovaskulären Mortalität.
Bei DM ergab sich bei Sichtung aller einbezogenen Studien in Abhängigkeit vom Tagesverzehr an verarbeitetem Fleisch ein insgesamt um 19 Prozent erhöhtes Erkrankungsrisiko (n = 7; relatives Risiko 1,19; 95% Konfidenzinterval, 1,11 - 1,27; P = 0,001). Bemerkenswerterweise zeigten US-Studien allein sogar eine über 50-prozentige Risikosteigerung für das Auftreten eines DM (RR = 1,53; 95% KI, 1,37 - 1,71). Drei Studien unterschieden sogar zwischen verschiedenen Arten von verarbeitetem bzw. konserviertem Fleisch. Demnach erhöht der Konsum von zwei Scheiben Schinken pro Tag das Diabetes-Risiko auf mehr als das Doppelte (RR = 2,07; 95% KI, 1,40 - 3,04), von einem Hotdog auf knapp das Doppelte (RR = 1,92; 95% KI, 1,33 - 2.78) und von anderen Formen verarbeiteten Fleisches pro Stück um zwei Drittel (RR = 1,66; 95% KI, 1,13 - 2,42).
Zusammenhänge zwischen dem Verzehr von rotem bzw. verarbeitetem Fleisch und dem Auftreten von Schlaganfällen ließen sich nicht erkennen; allerdings lagen nur drei Studien vor, die dieser Frage nachgingen. Eine Ursache könnte darin liegen, dass hier keine Unterscheidung zwischen verschiedenen Arten von Schlaganfällen erfolgte; denn die einzige Studie, die dem Zusammenhang zwischen Fleischkonsum und hämorrhagischem Schlaganfall nachging, zeigt eine deutlichere Korrelation und einen Risikoanstieg um zwei Drittel in Abhängigkeit vom Tagesverzehr (RR pro Tagesdosis 1,64; 95% KI, 0,75 - 3,60). Nicht klar ist dabei, ob es sich um Hirnblutungen aufgrund von Gefäßmissbildungen oder um solche bei arteriosklerotisch veränderten Gefäßen handelte (checken bei He et al., BMJ!). Hier fallen einem etliche potenzielle Confounder ein, die nicht nur mit sonstigen Ernährungsgewohnheiten wie beispielsweise dem in jener Studie primär untersuchten Fettkonsum zusammenhängen, sondern auch mit ursächlich relevanten Erkrankungen wie arteriellem Hypertonus beim Entstehen hämorrhagischer Schlaganfälle des höheren Lebensalters. Insofern wäre es auch sehr interessant zu wissen, ob Art und Menge des Fleischkonsums das Entstehen von Bluthochdruck beeinflusst.
Insgesamt ist zum einen die Heterogenität der analysierten Studien als Einschränkung zu berücksichtigen, die vergleichend-vereinheitlichende Ergebnisse in ihrer Aussagekraft verringern können. Zum anderen können die AutorInnen mögliche qualitative Unterscheide zwischen den einzelnen Produkten der verschiedenen Fleischarten überhaupt nicht erfassen, beispielsweise die Kombination mit Fetten unterschiedlicher Schädlichkeit, der Art der Konservierungsmethode und damit verbundener Noxen, und ähnliche Faktoren, die im Zuge einer zunehmenden Industrialisierung der Nahrungsmittelproduktion bevölkerungsbezogen auch quantitativ relevante Auswirkungen haben kann. Und ganz grundsätzlich ist anzumerken, dass das Ausmaß der Adjustierung nach Kovariaten in den ausgewerteten Studien erheblich variierte und insbesondere vielfach keine Kontrolle sonstiger Ernährungsgewohnheiten und Lebensbedingungen der Personen sowie vor allem von sozialen Einflussfaktoren erfolgte.
Die drei Autoren betonen in ihrer Schlussfolgerung zum einen die Notwendigkeit, die ursächlichen Zusammenhänge und mögliche pathogenetische Effekte besser zu verstehen. Zum anderen fordern sie dazu auf, bei Diät- und Politikempfehlungen stärkeres Augenmerk auf verarbeitetes als auf rotes Fleisch oder den Fleischkonsum insgesamt zu legen. Dem ist uneingeschränkt zuzustimmen, allerdings nur dann, wenn sich diese Empfehlungen nicht auf übliche Normierungsvorgaben für das Individuum im Sinne der "Gesund-Leben"-Ideologie beschränken, sondern auch gesellschaftlich relevante Fragen der kapitalistischen Gewinnmaximierungsideologie in der Nahrungsmittelindustrie und der Vermarktung ihrer Produkte aufwirft.
Zu einem anderen Ergebnis kommt eine kürzlich in den Archives of Internal Medicine veröffentlichte Studie einer Gruppe von AutorInnen aus Harvard und einer anderen Klinik in Boston, aus Ohio sowie vom Deutschen Institut für Ernährungsforschung. An Pan, Qi Sun, Adam Bernstein, Matthias Schulze, JoAnn Manson, Meir Stampfer, Walter Willett, und Frank publizierten Ende März 2012 in Arch Intern Med 172 (7), Seiten 555-563, ihre große Untersuchung unter dem Titel Red Meat Consumption and Mortality. Results From 2 Prospective Cohort Studies.
Der prospektiven Beobachtungsstudie mit 37.698 männlichen Teilnehmern aus der Health Professionals Follow-up Study (1986-2008) und 83.644 Frauen der Nurses' Health Study (1980-2008), die zum Zeitpunkt des Studienbeginns weder einen KHK noch eine maligne Erkrankung aufwiesen, liegen vierjährlich aktualisierte Bewertungen des Ernährungsverhaltens mit Hilfe von validierten Nahrungshäufigkeitserhebungen zu Grunde.
Während de Beobachtungszeitraums mit 2,96 Millionen Personenjahren verstarben insgesamt 23.926 Personen aus dieser Kohorte, darunter 5.910 Todesfälle durch KHK und 9.464 afgrund bösartiger Neubildungen. Nach multivariater Adjustierung im Hinblick auf wichtige Lebensstil- und dietätische Risikofaktoren waren bei nicht behandeltem bzw. konserviertem Fleisch ein Anstieg des Gesamtsterblichkeitsrisikos pro täglichem Verzehr um 13 % [Hazard Ratio 1,13, Streuung 1,07 - 1,20] und bei verarbeitetem Fleisch sogar im ein Fünftel [HR (95 % KI) 1,20 (1,15 - 1,24)]. Bei der isolierten Betrachtung der KHK-bedingten Todesfälle belief sich der Anstieg der Sterblichkeitswahrscheinlichkeit bei unbehandeltem Fleisch auf 18 % [HR 1,18 (1,13 - 1,23] und bei konserviertem oder anderweitig verarbeiteten Fleisch bei 21 % [HR 1,21 (1,13 - 1,31)], während der Zusammenhang bei tumorbedingter Sterblichkeit mit einem nur 10- [HR 1,10 (1,06 - 1,14)] bzw. 16-prozentigen Anstieg der fleischkonsumassoziierten Sterblichkeit [HR 1.16 (1,09 - 1,23)] deutlich geringer ausfiel.
Die WissenschaftlerInnen aus den USA und Deutschland führten multivariate Analysien durch und kontrollierten ihre Ergebnisse dabei simultan nach einer Vielzahl von anderen relevanten Einflussfaktoren: Gesamtkalorienaufnahme, Verzehr von Vollkornprodukten, Obst und Gemüse sowie von anderen wichtigen Nahrungsvariablen wie dem Konsum von Fisch, Geflügel, Nüssen, Milchprodukten und verschiedenen Nahrungsbestandteilen wie Zucker, Balaststoffen, Magnesium und mehrfach ungesättigten bzw. Transfettsäuren. Zudem adkustierten sie nach anderen nicht-dietätischen potentiellen Confoundern, für die an Hand von zwei- bis vierjährigen Befragungsrunden aktualisierte Daten vorlagen. Zu diesen Variablen gehörten Alter, Body-Mass-Index, ethnische Zugehörigkeit, Raucherverhalten, Alkoholkonsum, physische Aktivität, Einnahme von Multivitaminpräparaten und Aspirin, familiäre Vorgeschichte von DM, Herzinfarkt oder Krebs sowie bestehender DM, Hypertonus oder Fettstoffwechselstörung bei Aufnahme in die Beobachtungsstudie. Bei Frauen erfolgte zusätzlich eine Adjustierung nach postmenopausalem Zustand und Hormonbehandlung.
Nach Schätzung der AutorInnen würde der Ersatz einer täglichen Verzehrdosis an rotem Fleisch durch andere Nahrungsmittel wie Fisch, Geflügel, Nüsse, Gemüse, fettarme Milchprodukte und Vollkornprodukte das Sterblichkeitsrisiko um 7 - 19 % senken. Gleichermaßen schätzen sie, dass in dieser Kohorte bis zum Ende des Beobachtungszeitraums 9,3 % der Todesfälle bei Männern und 7,6 % bei Frauen vermeidbar wären, wenn alle Beteiligten weniger als eine halbe tägliche Verzehrdosis - ungefähr 42 g - rotes Fleisch zu sich genommen hätten. Insgesamt kommen sie zu dem Schluss, dass der Verzehr von rotem Fleisch mit einer erhöhten Gesamt- sowie koronarer und tumorbedingter Sterblichkeit führt. Der Ersatz roten Fleisches durch andere gesunde Proteinquellen zu ersetzen scheint demnach mit einer geringeren Sterblichkeit assoziiert zu sein.
Den älteren, durch lesenswerten und datenreichen Artikel von Red and Processed Meat Consumption and Risk of Incident Coronary Heart Disease, Stroke, and Diabetes Mellitus von Renata Micha, Sarah Wallace und Dariush Mozaffarian in Circulation 121 (21), S. 2271-2283, können Sie hier in ganzer Länge herunterladen; zusätzlich stehen die gesamten Rohdaten dieser Metaanalyse zum Download zur Verfügung.
Auch den Artikel Red Meat Consumption and Mortality. Results From 2 Prospective Cohort Studies von An Pan, Qi Sun, Adam Bernstein, Matthias Schulze, JoAnn Manson, Meir Stampfer, Walter Willett und Frank Hu stellen die Archives of Internal Medicine [172 (7): 555-563. DOI:10.1001/archinternmed.2011.2287] kostenfrei zum Download zur Verfügung.
Jens Holst, 6.7.12
Soziale Ungleichheiten der Gesundheit - Erfahrungen und Lehren aus 13 Jahren Labour-Regierung
 13 Jahre hatte die Labour-Regierung Zeit, die selbst gesteckten Gesundheitsziele zu erreichen: die Gesundheit der in der Gesellschaft am schlechtesten Gestellten verbessern und die Gesundheitslücke ("health gap") verkleinern - dies erklärte die 1997 gewählte Labor-Regierung zu einem Schlüsselelement ihrer Gesundheitsstrategie.
13 Jahre hatte die Labour-Regierung Zeit, die selbst gesteckten Gesundheitsziele zu erreichen: die Gesundheit der in der Gesellschaft am schlechtesten Gestellten verbessern und die Gesundheitslücke ("health gap") verkleinern - dies erklärte die 1997 gewählte Labor-Regierung zu einem Schlüsselelement ihrer Gesundheitsstrategie.
Eine Reihe von Publikationen (siehe Literaturverzeichnis) setzte sich in letzter Zeit mit der Bilanz der Strategie auseinander, teils im Zusammenhang mit der Marmot-Review, in der eine erneuerte Strategie für die Jahre nach 2010 vorgestellt wird (auf die hier allerdings nicht eingegangen werden kann).
Als die Labour Party im Jahr 1997 nach 27 Jahren konservativer Vorherrschaft wieder die Regierung übernahm, schienen die Vorzeichen für eine erfolgreiche Strategie zur Minderung der sozialen Ungleichheiten der Gesundheit günstig, denn England war in vielen Belangen Vorreiter in der Befassung mit Fragen von sozialer Lage und Gesundheit gewesen.
Wegweisendes wurde geleistet
• in der Aufarbeitung von Daten zur Abbildung der sozialen Ungleichheiten der Gesundheit
• in der Durchführung von Studien (z.B. Geburtskohorten 1946, 1958, 1970, Whitehall-Studien)
• in der Aufarbeitung des Wissens in Berichten für die Politik (Black Report 1980, Acheson Report 1998 und - gegen Ende der 13 Jahre Regierung - Marmot Review 2010)
Die konservative Regierung hatte im Jahr 1980 den wegweisenden Black-Report regelrecht in der Schublade verschwinden lassen, ihm dadurch aber paradoxerweise eine hohe Publizität im öffentlichen Raum verschafft.
Die Labour-Regierung ließ sich 1998 durch den Acheson Report mit frischen Informationen und Vorschlägen versorgen und gründete darauf ihre Strategie, die sie in 2 Berichten darlegte:
• 1999 Reducing health inequalities: an action report
• 2002 Cross Cutting Review of Health Inequalities.
Die konkreteste Form erhielt die Strategie 2003 in dem Bericht "Tackling health inequalities: A Programme for Action". Hier legte die Regierung den Ministerien Zuständigkeitsgrenzen hinweg 82 Verpflichtungen auf ("departmental commitments"), die insgesamt mit mehr als 30 Milliarden Pfund Haushaltsmitteln hinterlegt waren.
Die Strategie baute auf 2 übergeordnete Ziele,
• Minderung der Lücke ("gap") in der Lebenserwartung zwischen den Regionen um 10%
• Minderung der Ungleichheit in der Kindersterblichkeit zwischen den Klassen um 10%.
Für das Monitoring wurden 12 nationale Indikatoren ("National Headline Indicators") gebildet, die sich auf Ernährung, Bildung, Obdachlosigkeit, Wohnen, Grippeimpfung, Schulsport, Rauchen, Teenageschwangerschaften und Mortalität an den "major killer diseases" beziehen (Annex C, S. 65-67).
Die vier großen Überschriften zu den 82 Verpflichtungen lauteten:
• Supporting families, mothers and children
• Engaging communities and individuals
• Preventing illness and providing effective treatment and care
• Addressing the underlying determinants of health
Die darunter gefassten Aufgabenbereiche sind im Annex B des Papiers im Einzelnen benannt (S. 58-64). Viele der Maßnahmen zielten auf die einkommensschwache Gruppen oder auf benachteiligte Regionen.
Der Verlauf bzw. die Ergebnisse wurden in mehreren Berichten festgehalten:
• Zwischenberichte zum Stand der Entwicklung 2005 und 2007 sowie eine 10-Jahresbilanz ("Tackling health inequalities: 10 years on"), die im Sinne "halbvolles Glas" zu einer eher positiven Bewertung gelangte
• Bericht des Gesundheitsausschusses des Unterhauses, der im Sinne von "halbleeres Glas" die selben Daten eher negativ bewertete mit einer Reihe berechtigter kritischer Anmerkungen.
Hier einige kurz gefasste Ergebnisse, Erfahrungen, und Lehren:
• Die Lebenserwartung stieg im Landesdurchschnitt im Vergleich der Zeiträume 1995-1997 und 2005-2007 um 3,1 Jahre für Männer sowie 2,1 Jahre für Frauen. In den benachteiligten Regionen (sog. "spearhead group" von lokalen Verwaltungseinheiten) stieg die Lebenserwartung der Männer um 2,9 und der Frauen um 1,9 Jahre.
• Die Kindersterblichkeit fiel landesweit von 5,6 auf 4,7 pro Tausend, in den benachteiligten Regionen von 6,3 auf 5,4.
Auf diese Ergebnisse gibt es zwei zutreffende Sichtweisen:
• Die Ziele zur Minderung der sozialen Ungleichheit der Gesundheit wuden verfehlt.
• Die Gesundheit der Bevölkerung hat sich in diesem 10-Jahreszeitraum deutlich verbessert. Auch die benachteiligten Gruppen haben deutlich gewonnen, bei der Lebenserwartung allerdings etwas weniger als der Bevölkerungsdurchschnitt. Ohne die Strategie dürfte die Gesundheit eher noch weiter auseinandergedriftet sein.
Unabhängig davon, welche Sichtweise man bevorzugt, ist festzuhalten, dass die Strategie einige grundlegende Schwächen hatte.
Die Fokussierung auf zwei Ziele im Zusammenhang mit der Mortalität führt dazu, dass Determinanten und Maßnahmen in Bereichen wie Obdachlosigkeit, Kinderarmut und Brennstoffmangel wegen ihrer geringen Auswirkungen auf die Mortalität für den Erfolg der Strategie nicht zählen. Insgesamt kritisiert insbesondere Mackenbach, dass der Abgleich von Zielen und Maßnahmen (policies) bei weitem nicht optimal gewesen sei. Dies sei ein Ergebnis davon, dass das Programm ein Kompromiss aus Wissenschaft und politischer Opportunität gewesen sei; die Politik habe die 39 Empfehlungen und 123 Unterpunkten des Acheson Report als eine Art Einkaufsliste betrachtet, aus der heraus sie die Punkte auswählte, die am besten in ihre bereits vorhandenen Konzepte passten.
Viele der 82 Verpflichtungen sind zwar erfüllt worden - eine eindrucksvolle Darstellung findet sich im Zwischenbericht 2007 (Tackling Health Inequalities: 2007 Status Report on the Programme for Action) auf den Seiten 64-69. Offensichtlich hätten die Maßnahmen jedoch (noch) effektiver, intensiver und zielgenauer sein müssen. Zur Zielerreichung sind grundlegende Veränderungen in der Verteilung von Ressourcen erforderlich. Hierfür reichten die 82 Verpflichtungen und die 20 Milliarden Pfund nicht aus.
Ausgeblieben ist insbesondere eine gerechtere Verteilung der materiellen Ressourcen. Einkommensungleichheit gilt als eine der wesentlichen Determinanten für die Ungleichheit der Gesundheit. Eine radikale Umverteilung der Einkommen zugunsten der schlechter Gestellten war aber nicht Teil des Wahlprogramms der Labour Party.
Insgesamt konnte die Strategie nicht umfassend auf wissenschaftliche Evidenz gegründet werden, weil diese für die meisten Maßnahmen nicht vorlag. Auch während der 13 Jahre wurden die Gelegenheiten, hochwertige Evidenz zu generieren, nicht konsequent genutzt.
Zusammenfassend ist festzuhalten:
In England wurde die bislang umfassendste Strategie zur Minderung der sozialen Ungleichheit der Gesundheit in Form eines Regierungsprogramms implementiert und über einen Zeitraum von 13 Jahren durchgeführt.
Im Ergebnis wurden (Teil-) Erfolge erzielt. Die "Gesundheitslücke" zu verkleinern ist aber offensichtlich sehr viel schwieriger, als es sich die meisten Wissenschaftler und Politiker bis dahin vorgestellt hatten. Für stärkere Effekte sind zumindest erforderlich: ein noch höheres Maß an politischer Entschlossenheit, als es die Labour-Regierung gezeigt hat, eine bessere Abstimmung von Zielen und Maßnahmen, mehr Wissen über das was funktioniert, also mehr Evidenz und ein Mandat des Wählers an die Regierung, das weiterreichende Maßnahmen erlaubt, wie z.B., eine Minderung der Einkommensungleichheit.
Dies erfordert, wie im Marmot-Bericht ("Fair Society, Healthy Lives") festgestellt wird, eine starke soziale Bewegung, die sich für soziale Gerechtigkeit einsetzt. Für weniger ist eine Minderung der sozialen Ungleichheit der Gesundheit offensichtlich nicht zu haben.
Berichte des Department of Health (Auswahl)
1999 Reducing health inequalities: an action report Website
2002 Tackling health inequalities - cross-cutting review Website
2003 Tackling health inequalities: A Programme for Action Website
2008 Tackling health inequalities: 2007 Status Report on the Programme for Action Website
2009 Tackling health inequalities: 10 years on Website
Berichte zur Politikberatung
• 1980 Inequalities in Health: Report of a Research Working Group. (The Black Report) Website
• 1998 Independent Inquiry into Inequalities in Health Report (Acheson Report) Website
• 2010 Fair Society, Healthy Lives. A Strategic Review of Health Inequalities in England Post-2010 (The Marmot Review) Link
Bericht des Unterhauses
House of Commons. Health Committee - Third Report. Health Inequalities Website, Bericht als PDF Donnload
Erwiderung der Regierung Website
Mackenbach JP. Can we reduce health inequalities? An analysis of the English strategy (1997-2010). Journal of Epidemiology and Community Health 2011;65:568-75 Abstract
Eine Interessante Diskussion über die Marmot Review und die Politik der Labour-Regierung mit insgesamt 9 Beiträgen findet sich in der Oktober-Ausgabe 2011 der Zeitschrift Social Science and Medicine. Link
Hierzu auch ein 12-minütiges Videostatement von Michael Marmot auf YouTube Link
David Klemperer, 16.5.12
Bis zu 10 Überdiagnosen auf einen durch Früherkennung verhinderten Tod an Brustkrebs
 Durch Brustkrebs-Früherkennungs-Untersuchungen werden 2 Arten von Brustkrebs frühzeitig entdeckt: zum einen Tumoren, die später, nach Auftreten von Beschwerden, diagnostiziert worden wären, zum anderen Tumoren, die sich nie im weiteren Leben bemerkbar gemacht hätten. Letzteres ist dann der Fall, wenn der Tumor nicht soweit wächst, dass er Beschwerden verursacht oder aber wenn die betroffene Frau stirbt, bevor sich der Tumor klinisch bemerkbar macht.
Durch Brustkrebs-Früherkennungs-Untersuchungen werden 2 Arten von Brustkrebs frühzeitig entdeckt: zum einen Tumoren, die später, nach Auftreten von Beschwerden, diagnostiziert worden wären, zum anderen Tumoren, die sich nie im weiteren Leben bemerkbar gemacht hätten. Letzteres ist dann der Fall, wenn der Tumor nicht soweit wächst, dass er Beschwerden verursacht oder aber wenn die betroffene Frau stirbt, bevor sich der Tumor klinisch bemerkbar macht.
Über dieses als Überdiagnose bezeichnete Phänomen haben wir berichtet (Link). Überdiagnose stellt ein gravierendes Problem dar, weil die überdiagnostizierten Tumoren von "normalen" Tumoren bisher nicht unterschieden werden können und somit zur Übertherapie führen. Frauen erhalten überflüssigerweise eine belastende und eingreifende Therapie.
Eine präzise Quantifizierung der Überdiagnose ist methodisch schwierig, weil zeitliche Trends in der Brustkrebsinzidenz berücksichtigt werden müssen. Zusätzlich tritt bei Neueinführung eines Screening-Programms stets eine Inzidenzerhöhung auf, weil die bislang asymptomatischen Tumoren entdeckt werden. Nach Ablauf der sog. lead time, also der Zeitspanne, um die die Diagnose durch Früherkennung vorverlegt wird, sollte die Inzidenz insgesamt auf das Niveau vor Einführung der Früherkennung zurückgehen, bei älteren Frauen jedoch abnehmen, weil ihre Diagnose durch das Screening ja früher gestellt wurde.
Präzisere Daten können nur Langzeit-Vergleiche einer gescreenten mit einer nicht gescreenten Gruppe im Rahmen einer randomisierten kontrollierten Studie erbringen. Von diesen Studien gibt es nur wenige und auch hier treten methodische Probleme auf. So werden auch nicht-randomisierte Formen des Vergleichs durchgeführt mit entsprechend unpräzisen und weit streuenden Ergebnissen - je nach Datengrundlage wird die Überdiagnose bislang auf 0 bis 54% geschätzt.
Genauere und zuverlässigere Ergebnisse erbrachte eine kürzlich veröffentlichte norwegische Studie. Das staatliche Gesundheitssystem mit einem annähernd vollständigen nationalen Krebsregister liefert zuverlässige Diagnosedaten. Da das Brustkrebs-Screening-Programm zwischen 1996 und 2005 schrittweise in die 6 norwegischen Regionen eingeführt wurde, konnte die Brustkrebsinzidenz in den Regionen mit und ohne Screening-Programm verglichen werden. Zusätzlich wurden die zeitlichen Trends erfasst, indem der jeweilige 10-Jahreszeitraum vor Einführung des Screenings mit einbezogen wurde. Dies ist erforderlich, weil auch in den Jahren vor Einführung des Screenings die Inzidenz bereits angestiegen ist, vermutlich infolge erhöhter Aufmerksamkeit und vermehrter Untersuchungen sowie dem starken Anstieg der Hormongabe in den Wechseljahren in den 1990er-Jahren. Die Teilnahme am Screening-Programm ist mit 77% hoch. In den Regionen ohne Screening war die Inanspruchnahme der Mammographie hingegen niedrig.
Die Forscher beschränkten die Untersuchung auf die Inzidenz von invasivem, also die Gewebsgrenzen durchbrechendem Brustkrebs. Nicht betrachtet wurde das sog. duktale Karzinom in situ, ein Tumor in den Milchgängen der weiblichen Brust, der den Milchgang (noch) nicht durchbrochen hat. Auch für diesen Tumor gibt es Überdiagnose, die Forscher wollten jedoch die zwei unterschiedlichen Arten von Brustkrebs nicht vermischen.
In den ersten 10 Jahren des Brustkrebs-Screening-Programms, also von 1996 bis 2005, wurden etwa 500.000 Frauen zur Mammographie eingeladen. Bei 7.793 wurde ein invasiver Brustkrebs diagnostiziert. Unter Berücksichtigung der Inzidenz im Zehnjahreszeitraum vor der Einführung des Programms sowie der Inzidenz in den Regionen, die nach 1995 noch nicht im Programm waren, errechnen die Forscher für die Frauen im Screening-Programm eine Überdiagnose von 15 bis 25%.
Darauf folgt, dass von den 7.793 Frauen mit invasivem Brustkrebs zwischen 1.169 (15% von 7.793) und 1.948 (25% von 7.793) nie die Diagnose erhalten hätten, wenn sie nicht gescreent worden wären, also eine Überdiagnose erhalten haben.
Bezogen auf 2.500 Frauen wird ein Tod an Brustkrebs verhindert, 20 Diagnosen sind keine Überdiagnose und 6 bis 10 sind eine Überdiagnose.
Die Zahlen sind etwas niedriger als frühere Berechnungen aus Norwegen und Dänemark. Dies begründen die Wissenschaftler mit unterschiedlichen Annahmen für die zeitlichen Trends und die lead time (Norwegen) sowie mit der Einbeziehung des duktalen Karzinoms in situ (Dänemark).
Diese Studie stellt einen weiteren deutlichen Beleg für den Sachverhalt dar, dass Krebsfrüherkennung entgegen verbreiteten intuitiven Vorstellungen sowohl Nutzen als auch Schaden bewirken kann. Der Schaden kann erheblich sein. Die Schadensrisiken sollten den Frauen, die zur Screening-Untersuchung eingeladen werden, in aller Klarheit vermittelt werden, fordern die Autoren.
Zu lösen ist das Problem der Überdiagnose allein durch Methoden, mit denen fortschreitende Tumoren von nicht bzw. nur langsam wachsenden Tumoren unterschieden werden können. Diese Methoden gibt es bislang nicht.
In einer Studie, die am 18. April 2012 im Wissenschaftsjournal NATURE erschienen ist, berichten Forscher über die neu geschaffene Unterteilung von Tumoren der weiblichen Brust in 10 nach genetischen Merkmalen definierte Untergruppen. Inwieweit diese genetischen Merkmale eine Prognose über das Wachstumsverhalten erlauben, ist noch nicht bekannt.
Kalager M, Adami H-O, Bretthauer M, Tamimi RM. Overdiagnosis of Invasive Breast Cancer Due to Mammography Screening: Results From the Norwegian Screening Program. Annals of Internal Medicine 2012;156(7):491-99 Abstract
Curtis C, Shah SP, Chin S-F, Turashvili G, Rueda OM, Dunning MJ, et al. The genomic and transcriptomic architecture of 2,000 breast tumours reveals novel subgroups. Nature 2012;advance online publication. Abstract
David Klemperer, 21.4.12
GKV-Präventionsbericht 2011: Nimmt man ein Glas, das klein genug ist, kann man davon reden es sei halb voll Ö
 Die Tatsache, dass die GKV auch 2010 mehr als 300.000.000 Euro für präventive Leistungen ausgegeben hat und dabei auch immer mehr sinnvolle und evidenzbasiert nützliche Angebote finanziert wurden, ist gut.
Die Tatsache, dass die GKV auch 2010 mehr als 300.000.000 Euro für präventive Leistungen ausgegeben hat und dabei auch immer mehr sinnvolle und evidenzbasiert nützliche Angebote finanziert wurden, ist gut.
Gut ist im Detail,
• dass für Maßnahmen, die sich an das Gesundheitsverhalten einzelner Menschen richteten, nur noch ca. 240 Mio. Euro für 2 Mio. Kursteilnahmen investiert wurden. Die Ausgaben gingen im Vergleich zum Vorjahr parallel zu der Zahl der Inanspruchnehmer um 6% zurück.
• dass die Krankenkassen fast 23 Millionen Euro für Settingprojekte (z.B. in Kindergärten und Schulen) bezahlten. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Ausgabensteigerung um 22%. Sie führten Gesundheitsförderungsmaßnahmen in insgesamt 30.000 Settings durch. Das entspricht im Vergleich zum Vorjahr einem Zuwachs von 49%. 2,4 Mio. überwiegend junge Menschen wurden mit den Maßnahmen direkt erreicht.
• dass die Krankenkassen für Maßnahmen in der betrieblichen Gesundheitsförderung insgesamt über 42 Millionen Euro ausgaben. Hierdurch konnten fast 6.500 Betriebe - 21% mehr als im Vorjahr und 660.000 Beschäftigte erreicht werden.
• und wegen der Aufgabe von Gesundheitsförderung auch etwas zum Ausgleich sozialer Ungleichheit beizutragen, ist es besonders gut, dass 7% der betreuten Betriebe, in denen die Krankenkassen die betriebliche Gesundheitsförderung unterstützten, einen hohen Anteil an "Ungelernten" aufweisen.
Bei der Lektüre der Mitteilung, dass in fast drei Vierteln der gemeldeten Projekte eine Evaluation der Maßnahmen durchgeführt wurde, stellt sich allerdings die Frage, ob die dabei am häufigsten gewählte Form der Zufriedenheitserhebung in den Zielgruppen eine wirklich verlässliche Messgröße ist. Andere Erhebungen z.B. zur Ergebnisqualität wären wünschenswert und sind auch möglich.
Dass die seit 2008 kontinuierlich von 339,8 Millionen Euro auf 302,5 Millionen Euro sinkende Summe aller Ausgaben und der Rückgang der Ausgaben je Versicherten von 4,83 Euro auf 4,33 Euro auch noch als Zeichen dafür bewertet werden, "dass die Krankenkassen der Prävention einen hohen Stellenwert beimessen", wirkt bei der im Vergleich zu den sonstigen Ausgaben der GKV schon immer mickrigen Summe aber weniger gut oder sogar ärgerlich. Man muss schon etwas suchen, wenn man Leistungen finden will für die vergleichbar "hohe" Beträge ausgegeben werden. Zur Erinnerung ein paar Posten aus dieser Preisklasse: Von den 2010 insgesamt 175,6 Mrd. Euro schweren Ausgaben der GKV flossen etwas weniger als in den Präventionsbereich, nämlich 290 Millionen Euro in Kuren für Mütter und Väter und etwas mehr, nämlich 370 Millionen Euro in den Medizinischen Dienst der GKV und Gutachterhonorare. Allein für das teuerste Arzneimittel, das monoklonale Antikörper-Präparat Humira, das u.a. zur Behandlung der rheumatoiden Arthritis und von Morbus Crohn eingesetzt wird, gab die GKV 2010 mit 414,4 Millionen Euro weit mehr aus als für die gesamte Prävention. Und allein der Zuwachs der Ausgaben für einige Arzneimittelgruppen war von 2009 auf 2010 höher als alle Ausgaben für Prävention.
Und wenn im Bericht stolz und zu Recht hervorgehoben wird, dass die GKV pro Kopf für Prävention mit 4,33 Euro mehr als den gesetzlich vorgesehenen Orientierungswert/Ausgabenrichtwert für das Jahr 2010 von 2,86 Euro je Versicherten ausgab, fragt sich doch, warum die Kassenvorstände und ihre Verwaltungsräte nicht angesichts des 2012 angehäuften Berges von Versichertenbeiträge nicht noch etwas mutiger den Stellenwert von Prävention erhöhen!? Wann, wenn nicht jetzt sind die Bedingungen dafür eigentlich gut?
Den vom Medizinischen Dienst des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen e.V. (MDS) herausgegebenen 124-seitigen Präventionsbericht 2011: Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung: Primärprävention und betriebliche Gesundheitsförderung Berichtsjahr 2010 von Nadine Schempp, Katja Zelen und Harald Strippel gibt es komplett kostenlos.
Bernard Braun, 17.3.12
Entsprechend qualifizierte Familienangehörige verringern das Risiko von Rückfällen bei depressiven Patienten beträchtlich!
 Der positive Einfluss von mit entsprechenden Fertigkeiten ausgestatteten Familienmitgliedern auf die durch emotionalen Stress in der Familie verursachten Rückfälle bei an Schizophrenie erkrankten Angehörigen ist belegt. Und auch bei Personen mit bipolaren psychischen Störungen erwies sich die Psychoedukation der Familienangehörigen als geeignet, emotionallen Stress und Rückfälle zu verhindern oder stark zu verzögern. Umso verwunderlicher ist, dass vergleichbare Effekte bei den an einer großen Depression erkrankten Personen, also der relativ größten Gruppe psychisch Erkrankter, zwar für plausibel gehalten wurden, nicht aber methodisch hochwertig nachgewiesen wurden.
Der positive Einfluss von mit entsprechenden Fertigkeiten ausgestatteten Familienmitgliedern auf die durch emotionalen Stress in der Familie verursachten Rückfälle bei an Schizophrenie erkrankten Angehörigen ist belegt. Und auch bei Personen mit bipolaren psychischen Störungen erwies sich die Psychoedukation der Familienangehörigen als geeignet, emotionallen Stress und Rückfälle zu verhindern oder stark zu verzögern. Umso verwunderlicher ist, dass vergleichbare Effekte bei den an einer großen Depression erkrankten Personen, also der relativ größten Gruppe psychisch Erkrankter, zwar für plausibel gehalten wurden, nicht aber methodisch hochwertig nachgewiesen wurden.
Eine kleine, gerade veröffentlichte randomisierte kontrollierte Studie mit 103 japanischen Teilnehmern zwischen 18 und 85 Jahren sowie mit der Diagnose einer "major depressive disorder" beendet diesen Zustand.
Sowohl die Teilnehmer in der Interventions- als auch die in der Kontrollgruppe erhielten die übliche medikamentöse und psychotherapeutische Behandlung weiter. Die primären Partner der Erkrankten in der Interventionsgruppe besuchten zusätzlich vier so genannte psychoedukative Sitzungen, in denen zum einen gründlich über die Charakteristika und Symptome Depressionserkrankung aufgeklärt wurde. Hinzu kamen Gruppenübungen für problemlösendes Verhalten, die helfen sollten mit relativ einfachen Mitteln und Fertigkeiten hochemotional zugespitzte und stressvolle Interaktionen zu bewältigen. Patienten nahmen an diesen Kursen und Übungen nicht teil.
Der Gradmesser für die Wirksamkeit war das Auftreten von Rückfällen der Erkrankung.
Die wichtigsten Ergebnisse lauteten:
• Die Zeit bis zum Auftreten eines Rückfalls war in der Interventionsgruppe mit psychoedukativem Empowerment statistisch signifikant länger als in der Kontrollgruppe ohne derartigen Support der Familienmitglieder.
• Die Rückfallraten unterschieden sich nach 9 Monaten erheblich: Den 50% in der Normalgruppe standen 8% in der Interventionsgruppe mit psychoedukativ geschulten Familienangehörigen gegenüber (Risikorate 0,17 und numbers to treat 2,4).
Auch wenn die ForscherInnen selber u.a. auf das Problem der geringen Anzahl ihrer StudienteilnehmerInnen hinweisen, kann die Einbeziehung der Familien die Wirksamkeit der Therapie von depressiv Erkrankten beträchtlich erhöhen und sollte daher alternativ, substitutiv oder auch komplementär weiter verfolgt werden.
Von der Studie "Family psychoeducation for major depression: Randomised controlled trial" von Shimazu K et al., erschienen im British Journal of Psychiatry" (2011; 198: 385-390), gibt es lediglich das Abstract kostenlos.
Bernard Braun, 20.7.11
Prävention von Übergewicht bei Kleinkindern: Erfolgreich nur mit langem Atem
 Ein australisches Projekt zur Prävention von Übergewicht bei Kleinkindern hat jetzt Erfolge gezeigt, allerdings sind Voraussetzungen für solche Erfolge nach Meinung der Wissenschaftler recht umfangreich: Notwendig sind ein langer Atem, veränderte kommunale Angebotsstrukturen und eine Vielzahl von Partnern und Interventionen. Zutreffend charakterisiert eine Gruppe australischer Wissenschaftler aus dem "WHO Collaborating Centre for Obesity Prevention" an der Deakin University ihr Projekt zur Prävention und Bekämpfung von Übergewicht bei Kleinkindern als die "erste erfolgreiche präventive Intervention auf Gemeindeebene".
Ein australisches Projekt zur Prävention von Übergewicht bei Kleinkindern hat jetzt Erfolge gezeigt, allerdings sind Voraussetzungen für solche Erfolge nach Meinung der Wissenschaftler recht umfangreich: Notwendig sind ein langer Atem, veränderte kommunale Angebotsstrukturen und eine Vielzahl von Partnern und Interventionen. Zutreffend charakterisiert eine Gruppe australischer Wissenschaftler aus dem "WHO Collaborating Centre for Obesity Prevention" an der Deakin University ihr Projekt zur Prävention und Bekämpfung von Übergewicht bei Kleinkindern als die "erste erfolgreiche präventive Intervention auf Gemeindeebene".
Das so genannte "Romp & Chomp"-Projekt (benannt nach den Comicfiguren Mr. Romp und Mrs. Chomp) erzielte diesen Erfolg zwischen 2004 und 2008 in der australischen Stadt Geelong bei einer Zielgruppe von rund 12.000 Kindern im Alter von 0 bis 5 Jahren. Die Interventionen strebten zum einen den Auf- oder Umbau dauerhafter kommunaler Strukturen und Angebote in Kindergärten, Schulen und anderen örtlichen Einrichtungen an. Dazu waren die Träger und Akteure dieser Einrichtungen fest in die Projektentwicklung eingebunden. Zum anderen zielten die Interventionen sowohl auf politische, soziokulturelle und physische Veränderungen beim Essverhalten und auf die aktive spielerische Bewegung der Kleinkinder.
Die untersuchten Ergebnisindikatoren waren vor allem das Durchschnittsgewicht, der einfache und standardisierte Body Mass Index, die Prävalenz von Übergewicht und Fettsucht und die Prävalenz eines Verhaltens in den Untergruppen der zwei- und dreieinhalbjährigen Kleinkinder, das Übergewicht und Fettsucht fördert oder verhindert.
Der Vergleich der ausgewählten Zielgrößen der Kinder in Interventions- und Kontrollgruppen zeigte unter anderem folgende statistisch signifikanten Ergebnisse der Intervention:
• Sämtliche Gewichts-Maßzahlen waren in der Gruppe der 3Ĺ-jährigen TeilnehmerInnen in der Interventionsgruppe niedriger.
• Die Prävalenz von Übergewicht und Fettsucht war bei den 2- und 3Ĺ-jährigen Kindern in der Interventionsgruppe um 2,5 und 3,4 Prozentpunkte niedriger als bei ihren Altersgenossinnen in der Kontrollgruppe. Dies ist erst richtig zu würdigen, wenn mit beachtet wird, dass die Prävalenzraten sich üblicherweise etwa zwischen 15 und 19 % bewegen.
• Der Konsum von abgepackten Snacks oder gesüßten Fruchtsäften war in der Interventionsgruppe signifikant geringer, die Häufigkeit des Verzehrs von Gemüse signifikant höher als in der Vergleichsgruppe.
• In zahlreichen Bildungs- und Erziehungseinrichtungen wurden gesüßte Lebensmittel aus dem Angebot entfernt oder Programme zur gesunden Ernährung eingeführt. Auch in Einrichtungen, in denen Eltern für die Organisation des Essens zuständig waren, wurden verstärkt Leitlinien für gesundes Essen eingeführt und beachtet. Diese Veränderungen gab es allerdings häufig sowohl in Interventionsgruppen- als auch in Kontrollgruppen-Einrichtungen.
Der Aufsatz "Reducing obesity in early childhood: results from Romp & Chomp, an Australian community-wide intervention program" von Andrea M de Silva-Sanigorski, A Colin Bell, Peter Kremer, Melanie Nichols, Maree Crellin, Michael Smith, Sharon Sharp, Florentine de Groot, Lauren Carpenter, Rachel Boak, Narelle Robertson und Boyd A Swinburn ist 2010 in der Fachzeitschrift "American Journal of Clinical Nutrition" (91: 831-840) erschienen. Kostenlos ist lediglich ein Abstract erhältlich.
Wer zusätzliches Interesse an kostenlosen Projektinformationen hat, erhält sie in den von den Hauptautoren des Aufsatzes verfassten vier Seiten umfassenden "Preliminary Findings - Summary Report. Outcome and Impact Evaluation of Romp & Chomp" aus dem September 2009
Bernard Braun, 10.2.11
IDEFICS - Ein EU-Projekt zur Prävention von Übergewicht bei Kindern geht 2011 zu Ende
 Die "IDEFICS"-Studie ist die derzeit größte europäische Studie zum Thema Übergewicht bei Kindern im Alter von 2-10 Jahren. "IDEFICS" steht für: "Identification and prevention of dietary- and lifestyle-induced health effects in children and infants" (sinngemäß übersetzt: Identifizierung und Prävention gesundheitlicher Effekte durch Ernährung und Lebensstil bei Kindern und Kleinkindern). 23 Forschungsinstitute und Unternehmen aus 11 europäischen Ländern sind an der Studie beteiligt. Die Koordination und Leitung wurde dem Bremer Institut für Präventionsforschung und Sozialmedizin (BIPS) an der Universität Bremen übertragen. Das Projekt wurde im Herbst 2006 begonnen und geht nun nach einer Laufzeit von 5 Jahren 2011 zu Ende. In Auftrag gegeben wurde IDEFICS von der Europäischen Kommission, ausgestattet war es mit einem Finanzvolumen von 13 Millionen Euro.
Die "IDEFICS"-Studie ist die derzeit größte europäische Studie zum Thema Übergewicht bei Kindern im Alter von 2-10 Jahren. "IDEFICS" steht für: "Identification and prevention of dietary- and lifestyle-induced health effects in children and infants" (sinngemäß übersetzt: Identifizierung und Prävention gesundheitlicher Effekte durch Ernährung und Lebensstil bei Kindern und Kleinkindern). 23 Forschungsinstitute und Unternehmen aus 11 europäischen Ländern sind an der Studie beteiligt. Die Koordination und Leitung wurde dem Bremer Institut für Präventionsforschung und Sozialmedizin (BIPS) an der Universität Bremen übertragen. Das Projekt wurde im Herbst 2006 begonnen und geht nun nach einer Laufzeit von 5 Jahren 2011 zu Ende. In Auftrag gegeben wurde IDEFICS von der Europäischen Kommission, ausgestattet war es mit einem Finanzvolumen von 13 Millionen Euro.
Das Projekt soll zum einen in epidemiologischer Perspektive Ernährung und Lebensstile der Kinder in Europa beschreiben und dabei auch umfassend regionale, soziale, biologische und geschlechtsspezifische Merkmale berücksichtigen. Auch geschmackliche Vorlieben und Ernährungspräferenzen werden erfasst. Damit sollen Risiken für die Entstehung von Übergewicht und Adipositas sowie gesundheitliche Langzeiteffekte aufgedeckt werden - auch im internationalen Vergleich.
Neben diesem epidemiologischen Schwerpunkt will die Studie aber auch neue und innovative Ansätze für eine gesündere Ernährung und für die körperliche Fitness von Kindern in Europa entwickeln. Angeboten werden dazu Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und Prävention in Kindergärten und Schulen. Diese umfassen unter anderem Bewegungsprogramme und Methoden zum Umgang mit psychosozialem Stress. Ebenso sind Aufklärung und Bewusstseinsschärfung bei Eltern und Kindern für das Problem Übergewicht Ziele der Studie.
Langfristig sollen die Ergebnisse in verschiedene Richtlinien für gesunde Ernährung und Alltagsverhalten einfließen sowie Grundlagen für neue Ethik-Richtlinien der teilnehmenden EU-Staaten bilden. Ein weiteres Ziel der IDEFICS Studie ist die Einbindung dieser Richtlinien in gesundheitspolitische Empfehlungen.
Insgesamt nehmen an der Studie knapp 17.000 Kinder Alter von zwei bis zehn Jahren teil, 8.000 in der Interventionsgruppe und 9.000 in der Kontrollgruppe. Pro Partnerland nehmen 500 Kindergarten-Kinder und 500 Grundschulkinder teil. In Deutschland sind etwa 2000 Kinder in Delmenhorst und Wilhelmshaven beteiligt. Alle teilnehmenden Kinder wurden zu Studienbeginn medizinisch untersucht, und es wurden gesundheitlich relevante Daten wie Alter, Geschlecht, Größe, Körpergewicht und Körperfettanteil erfasst.
Bei einer kleineren Stichprobe wurden überdies Blut- und Urinproben für medizinisch vertiefende Analysen genommen. Weiterhin wurden Kinder und auch ihre Eltern über das Freizeitverhalten, Kenntnisse über gesunde Ernährung sowie die zeitliche Intensität von Fernsehkonsum und Computerspielen des Spielens am Computer befragt. Etwa für die Hälfte der Teilnehmer/innen wurde in acht europäischen Ländern (Belgien, Zypern, Estland, Deutschland, Ungarn, Italien, Spanien, Schweden) ein Interventionsprogramm durchgeführt, bei dem gesunde Ernährung, körperliche Aktivität und Stressabbau dabei im Mittelpunkt stehen. In einer Kontrollregion (Griechenland) werden parallel dazu lediglich allgemeine Informationen angeboten um durch den Vergleich die Effekte der Intervention messen zu können.
Den Projektablauf muss man sich nach Auskunft von Prof. Dr. Wolfgang Ahrens, dem Leiter der IDEFICS-Studie im Bremer Institut für Präventionsforschung und Sozialmedizin (BIPS), so vorstellen, dass im Jahr 2007 Kontakt aufgenommen wurde "zu Schulen und zu Politikern und zu Kindergärten. Wir wenden uns dann an die Eltern der Kinder, die jetzt in die Schule kommen bzw. in die Kindergärten kommen und bitten die ums Einverständnis, an dieser Untersuchung teilzunehmen. Wir gehen dann in die Kindergärten mit einem Untersuchungsteam, laden die Kinder ein, die Eltern werden befragt, die Kinder werden untersucht. Nach einem halben Jahr wollen wir insgesamt 2.000 Kinder untersucht haben und in der Folgezeit werden wir mit verschiedenen Aktionen Maßnahmen vorschlagen, wie Kinder zu mehr Bewegung animiert werden können und wie wir es erreichen können, dass sowohl in der Schule als auch in den Familien sich vielleicht die Ernährungsgewohnheiten zu einer gesünderen Ernährungsgewohnheit verändern." (Interview mit Prof. Ahrens, BIPS, vom 26.09.2007)
Konkret wird in den Kindergärten und Schulen beispielsweise die Botschaft "Mehr Bewegung" durch Maßnahmen auf dem Pausenhof und im Freien umgesetzt. Diese Aktionen sind immer eingebettet in themenspezifische Gesundheitswochen. Dabei wird jeweils eine der sechs Schlüsselbotschaften und zugleich Präventionsziele des Projekts ("Mehr Wasser trinken", "Weniger Fernsehen", "Mehr Bewegung", "Mehr Obst und Gemüse essen", "mehr Zeit in der Familie", "ausreichend Schlaf") vertiefend behandelt. Alle Interventionen sind synchronisiert und vernetzt zwischen Kindergärten, Schulen, Stadtverwaltungen und beteiligten Familien. Daher wurden auch Schulen und Kindergärten in Runden-Tisch-Gesprächen einbezogen, um Inhalte und Umsetzung des Gesundheitsprogramms festzulegen. Das so genannte "Gemeinde-Forum", ein Gremium mit Politikern, Leitern von Kindergärten und Schulen sowie Vertretern der beteiligten Kommunen, unterstützt die Aktivitäten auf städtischer Ebene. Um auch die Eltern einzubeziehen, wurden Informationsveranstaltungen zu verschiedenen Themen durchgeführt (z.B. Kochabende, gesunder und ungesunder Fernsehkonsum, Infoabende über "Milchschnitte & Co"). Für die beteiligten Akteure wurde eine große Zahl unterschiedlicher Informations- und Interventionsmaterialien entwickelt, so für Lehrer und Erzieher IDEFICS das Aktivitäts- und Spieleposter, Spielkarten, ein Handbuch für alle Gesundheitswochen und ein Video mit guten Praxisbeispielen. Für die Gemeinden und Familien wurde ein Poster zu jeder Gesundheitswoche entworfen und ebenso ein Flyer für Eltern. Für Familien und Kinder steht ein Koch- und Aktivitätsbuch zur Verfügung, eine IDEFICS Handpuppe, ein Stundenplan und ein Checkbogen zum TV-Konsum.
Die Studie wird im August 2011 abgeschlossen. Derzeit liegt bereits eine große Zahl von Veröffentlichungen vor, in denen Zwischenergebnisse präsentiert werden. Bislang sind allerdings noch keine wissenschaftlichen Veröffentlichungen zugänglich, die über den Erfolg der Gesundheitsförderungsmaßnahmen informieren. An der Studie beteiligte Wissenschaftler und andere internationale Experten trafen sich vor kurzem im November 2010 in Zaragoza, um die bisherigen Ergebnisse und Strategien zu diskutieren.
In einer Mitteilung zu diesem Kongress wurde als besonders wichtige und zugleich in der Forschung bislang wenig beachtete Erkenntnis der Studie die Bedeutung von Schlafmangel hervorgehoben bzw. die enge Verbindung von Schlafdauer und Übergewicht. Kinder mit wenig Schlaf, so wurde deutlich, haben ein höheres Risiko für Übergewicht und Adipositas. Als wichtig wurde von den Wissenschaftlern aber auch hervorgehoben, dass die Eltern in Gesundheitsförderungs-Maßnahmen einzubeziehen sind, denn ernährungsbedingte Krankheiten seien nicht nur genetisch bestimmt, sonder hingen ganz wesentlich vom Alltagsverhalten ab. Die Ergebnisse der IDEFICS Studie würden zeigen, dass Bildung und Einkommen der Eltern einen hohen Einfluss sowohl auf die Qualität der Ernährung als auch auf das Körpergewicht der Kinder haben. Auch gesundheitspolitische Vorhaben stehen auf der Agenda der Forscher: "Unser Ziel ist es, die Politiker zu bewegen, sich zusammenzusetzen und bessere Umgebungen für die Gesundheit der Kinder zu schaffen." Die Referate werden in Kürze in einem Ergänzungsband der Zeitschrift "International Journal of Obesity " veröffentlicht. Der vorläufige Bericht zum Kongress ist hier zu finden: "Child health in Europe: The IDEFICS Study: towards a better understanding of obesity"
Die Liste der Veröffentlichungen zum Projekt IDEFICS, Informationen über Workshops und Veranstaltungen findet man hier:
• BIPS sowie hier:
• IDEFICS
• Hier ist eine differenzierte Beschreibung des Studienablaufs als Folienvortrag: "Antje Hebestreit: Übergewicht und Adipositas bei Kindern und Jugendlichen - die weltweite Situation und die IDEFICS Studie als Beispiel"
Bernard Braun, 5.2.11
Prävention von Übergewicht bei Kindern: Cochrane-Metaanalyse zeigt wenig spezifische Wirkungen
 Weder die Mehrheit von randomisierten kontrollierten Interventionsprojekten zur Prävention von Übergewicht bei Kindern mit einer längeren Interventionszeit, noch kürzer dauernde Interventionen erwiesen sich in der Metaanalyse einer Cochrane-Wissenschaftlergruppe als wirksam. Ausnahme war lediglich eine multimedial angelegte Studie.
Weder die Mehrheit von randomisierten kontrollierten Interventionsprojekten zur Prävention von Übergewicht bei Kindern mit einer längeren Interventionszeit, noch kürzer dauernde Interventionen erwiesen sich in der Metaanalyse einer Cochrane-Wissenschaftlergruppe als wirksam. Ausnahme war lediglich eine multimedial angelegte Studie.
Die Forschergruppe untersuchte bereits 2005 in einer Metaanalyse die Wirkung von 10 randomisierten kontrollierten Studien mit einer Interventionszeit von mindestens 12 Monaten als auch die von 12 weiteren Studien mit einer Einwirkungszeit zwischen 12 Wochen und 12 Monaten auf das Übergewicht von Kindern. Sämtliche Studien stammten aus den Zeitraum von 1990 bis 2005. 19 der Studien intervenierten präventiv im Vorschul- und Schulbereich, eine richtete sich auf kommunaler Ebene an Familien mit geringem Einkommen und zwei beinhalteten Interventionen in Familien, in denen die Eltern übergewichtig oder fettsüchtig sind.
Die wichtigsten Ergebnisse der Projekte mit längerer Einwirkungszeit lauteten:
• Sechs der zehn Langzeit-Studien kombinierten Maßnahmen der Ernährungserziehung mit solchen zur Förderung der körperlichen Aktivität. Bei fünf gab es beim Wirkungsindikator Gewichtszunahme keine Unterschiede zwischen Kindern in der Interventions- und Kontrollgruppe. In einer Studie gab es bei den beteiligten Mädchen Erfolge, nicht aber bei den Jungen.
• Zwei Studien, die allein auf die Ernährungserziehung fokussierten, zeigten keinen Erfolg bei der Prävention von Übergewicht oder Fettsucht.
• Bei einer der beiden Studien, die sich allein darum kümmerten, die körperlichen Aktivitäten der Kinder zu fördern, zeigte sich ebenfalls kein präventiver Erfolg. Die zweite Studie mit diesem Fokus war wirksam, verfolgte aber auch einen überaus aufwändigen multi-medialen Ansatz.
Die wichtigsten Ergebnisse der Projekte mit kürzerer Einwirkungszeit lauteten:
• Vier der zwölf Kurzzeitstudien fokussierten auf Interventionen, die das Niveau der körperlichen Aktivitäten zu erhöhen versuchten. Bei zwei von ihnen gab es eine kleine Abnahme des Übergewichts.
• Die acht restlichen Studien kombinierten gezielte Ratschläge für eine bessere Ernährung und körperliche Aktivität, erzielten aber keine signifikante Wirkung auf die Gewichtsentwicklung.
Die Autoren der Metaanalyse runden ihre Ergebnisse mit dem Hinweis ab, dass die Studiendesigns zum Teil zu heterogen sind, um aussagekräftige Vergleiche und integrierte Analysen der verstreuten kleinen Wirkeffekte machen zu können. In vielen Studien findet man schließlich keine gründlichen Hinweise auf soziale oder andere Kontextfaktoren und keine Angaben zur Kosteneffektivität der einzelnen Interventionsweise.
Kostenlos erhältlich ist zur Cochrane-Metaanalyse "Interventions for preventing obesity in children" von Carolyn D Summerbell, Elizabeth Waters, Laurel Edmunds, Sarah AM Kelly, Tamara Brown und Karen J Campbell (Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 3) lediglich ein etwas ausführlicheres Abstract
Bernard Braun, 26.1.11
Gesundheitsförderung an deutschen Schulen: Positiveffekte setzen hohen Einsatz voraus
 Das Gesundheitsförderungs-Projekt "gesund leben lernen" wird seit dem Jahr 2003 an insgesamt 62 Schulen und zwei Kitas in Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt durchgeführt. In einer Veröffentlichung in der Zeitschrift "Prävention und Gesundheitsförderung" zieht die Forschungsgruppe "Versorgung und Qualität in der Prävention", angesiedelt am Institut und der Poliklinik für Medizinische Psychologie, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE), eine erste Bilanz. Zentraler Befund dieser Evaluation ist: "Wo das Projekt mit mehr Zeit und multimodalem Vorgehen umgesetzt wurde und auf günstige Rahmenbedingungen traf, verbesserten sich gesundheitsbezogene Strukturen und Prozesse, Schüler- und Lehrergesundheit. Im Mittel gewannen aber nur wenige Dimensionen signifikant, mit schwacher bis mittlerer Effektgröße." (S. 3)
Das Gesundheitsförderungs-Projekt "gesund leben lernen" wird seit dem Jahr 2003 an insgesamt 62 Schulen und zwei Kitas in Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt durchgeführt. In einer Veröffentlichung in der Zeitschrift "Prävention und Gesundheitsförderung" zieht die Forschungsgruppe "Versorgung und Qualität in der Prävention", angesiedelt am Institut und der Poliklinik für Medizinische Psychologie, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE), eine erste Bilanz. Zentraler Befund dieser Evaluation ist: "Wo das Projekt mit mehr Zeit und multimodalem Vorgehen umgesetzt wurde und auf günstige Rahmenbedingungen traf, verbesserten sich gesundheitsbezogene Strukturen und Prozesse, Schüler- und Lehrergesundheit. Im Mittel gewannen aber nur wenige Dimensionen signifikant, mit schwacher bis mittlerer Effektgröße." (S. 3)
Zu Projektbeginn wurde eine Bestandsaufnahme durchgeführt, danach konnte jede Schule ihren eigenen Weg gehen und aus dem Spektrum möglicher Maßnahmen zur Gesundheitsförderung auswählen: Verhaltens- und verhältnispräventive Maßnahmen, Gesundheitstage, Umgestaltung des Schulgeländes, Fortbildungen für das Lehrerkollegium, Angebote zur Sucht- oder Übergewichtsprävention oder zur Stressbewältigung. Für das Projekt wurden zu Beginn keine konkreten und differenzierten Ergebnisindikatoren festgelegt. Die spätere Evaluation sollte jedoch überprüfen, ob Verbesserungen auf drei Ebenen erzielt wurden: (1) Organisations-Strukturen und Prozesse im Schulalltag (z.B. Partizipation, Ausstattung und Qualitätssicherung der Gesundheitsförderung), (2) Arbeitsbelastungen, Gesundheit und Gesundheitsverhalten, Ressourcen (Selbstwirksamkeit) der Lehrer, (3) vergleichbare gesundheitsbezogene Indikatoren bei Schülern.
"Das wünschenswerte Design einer cluster-randomisierten Studie", so erklären die Wissenschaftler, "war aus mehreren Gründen nicht durchführbar." Hierfür genannt werden unter anderem der höhere Kosten- und Zeitaufwand für die Einbeziehung von Kontrollgruppen sowie die befürchtete ablehnende Haltung von Schulen, die nur als Kontrollgruppe dienen sollten. Stattdessen wurde eine Beobachtungsstudie durchgeführt. Die Schulen wurden nach dem Zufallsprinzip ausgewählt, um eine Überrepräsentierung von Schulen auszuschließen, die eine besonders hohe Motivation und Erfolgsaussicht aufweisen.
Die Studie begann 2003 mit 67 Schulen, 15 davon brachen aber in den ersten beiden Jahren ab. Schriftliche Fragebogen-Erhebungen fanden dann ab Ende 2004, ab Ende 2006 und schließlich ab Januar 2008 statt. Eingesetzt wurden 4 Fragebögen zur Abschätzung der Wirkungen. Darunter waren ein Instrument zur Erfassung gesund¨heitsförderlicher Strukturen und Pro¨zesse, ein Fragebogen für Lehrer, der unter anderem Alter, Geschlecht, Arbeitszufrieden¨heit, Ar¨beitsplatzbelastungen, soziale Unterstützung, Le¨bensqualität, psychisches Wohlbefinden, Tabak- und Alkoholkonsum und Selbstwirksamkeitserwar¨tung erfasste. Der Fragebogen für Schüler war ähnlich differenziert und umfangreich und thematisierte vergleichbare Indikatoren. Schließlich wurde auch ein Dokumentationsbogen für die durchgeführten Maßnahmen zur Gesundheitsförderung eingesetzt.
Es zeigte sich, dass die Schulen erhebliche Ressourcen einsetzten. Im Durchschnitt wurden 160 Arbeitsstunden investiert und 18 Maßnahmen in knapp 3 Jahren durchgeführt. Allerdings wurde dabei eine große Heterogenität deutlich, die Streuweite variierte zwischen 0 und 711 Stunden sowie 1 bis 63 Maßnahmen. Die wesentlichen Ergebnisse der Evaluation waren folgende.
• "Ohne Fleiß kein Preis": Schulen mit deutlichen strukturellen Verbesserungen und auch gesundheitlichen Positiveffekten bei der Lehrergesundheit investierten im Mittel etwa doppelt so viel Zeit in das Projekt, führten erheblich mehr Einzelmaßnahmen durch und gestalteten diese differenzierter. Schulen, an denen sich speziell die gesundheitsbezogene Lebensqualität der Lehrer verbesserte, hatten mehr als doppelt so viel Zeit investiert im Vergleich zu Schulen, wo dieser Indikator sich verschlechterte (276 versus 137 Stunden).
• Verbesserungen, was die Gesundheit der Schüler anbetraf, blieben aus oder waren überaus geringfügig, zum Beispiel stieg die Schulzufriedenheit um etwa 5%, körperliches Wohlbefinden und Selbstwerterleben lediglich um etwa 3%.
• Die Lehrer berichteten über eine deutliche Zunahme ihrer erlebten Arbeitsbelastung um 12% im Projektzeitraum.
• Die drei untersuchten Wirkungsebenen zeigten unterschiedlich große Effekte: Strukturverbesserungen zeigten sich deutlicher als Veränderungen des Gesundheitszustands. Die maximal erreichten Verbesserungen betrugen 35% für Strukturveränderungen, 12% für Verbesserungen der Lehrergesundheit, 3% für Verbesserungen der Schülergesundheit.
• Die Effekte waren in den einzelnen Schulen extrem unterschiedlich: Nur eine Schule erreichte Verbesserungen auf allen drei Ebenen. an 10 von 22 Schulen (45%) traten Erfolge auf mindestens 2 Ebenen ein, an ebenso vielen gingen Erfolge auf einer Ebene mit Rückgängen auf einer anderen einher.
Das "Projektziel einer Verringerung sozi¨al bedingter gesundheitlicher Ungleichheit" wurde nach Aussage des Forschungsteams erreicht. Wie groß ist dieser Effekt ist, wird in der Veröffentlichung jedoch leider nicht dargestellt.
Unter dem Strich lautet das Fazit: "Ein Fünftel der Schulen (n=15) gab das Projekt kurz nach Beginn auf, nur etwa ein Drittel der verbleibenden profitierte klar, und davon etwa die Hälfte auf mehr als einer Ebene (Strukturen, Lehrer- oder Schülergesundheit). Das Programm bot also kein für alle Einrichtungen mit Sicherheit erfolgreiches Vorgehen. Seine Wirksamkeit war von Rahmenbedingungen und einer intensiven Durchführung abhängig. Wo ungünstige Ausgangslagen bestanden (schlechte Ausstattung, geringes soziales Kapital im Schulumfeld, besonders hohe Eingangsbelastung), wo das Projekt mit geringem Einsatz durchgeführt wurde (punktuelle Maßnahmen relativ geringer Dosis) und wo die Veränderungen der Arbeitswelt Schule (erhöhte subjektive Arbeitsbelastung der Lehrkräfte) zusammentrafen, konnte das Projekt Gesundheitsverschlechterungen nicht aufhalten." (S. 10)
Das Forschungsteam weist in der Diskussion der Befunde noch einmal darauf hin, dass die weithin vermisste systematische und methodisch fundierte Evaluation von Gesundheitsförderungsmaßnahmen in der Schule nicht nur in wissenschaftlicher Perspektive ein Problem ist. Enttäuschungen der Schüler wie Lehrer, Verluste von Zeit und finanziellen Ressourcen stellen sich gehäuft dann ein, wenn in der Evaluation von Maßnahmen nicht unterschiedliche Ausgangsbedingungen und Vorgehensweisen unterschieden und stattdessen "gelungene und ungeeignete Interventionen 'in einen Topf geworfen' und zusammen beurteilt werden." (S. 11)
Von der Studie ist kostenlos leider nur ein Abstract verfügbar: T. Kliche, D. Hart, U. Kiehl, M. Wehmhöner, U. Koch: (Wie) wirkt gesundheitsfördernde Schule? Effekte des Kooperationsprojekts "gesund leben lernen" (Prävention und Gesundheitsförderung, Online First, DOI 10.1007/s11553-010-0243-4)
Gerd Marstedt, 10.9.10
"Kann denn das bisschen Rauch gefährlich sein?" - Kurzinformationen zum Gesundheitsrisiko "Passivrauchen"
 Auch wenn das Statistische Bundesamt gerade meldet, dass die Steuereinnahmen durch Zigaretten im zweiten Quartal 2010 u.a. wegen der gestiegenen Preise 10 % niedriger lagen als im Vergleichsquartal des Vorjahrs, stieg der Großteil der Raucher nicht aus, sondern nur auf selbstgedrehte Glimmstengel um.
Auch wenn das Statistische Bundesamt gerade meldet, dass die Steuereinnahmen durch Zigaretten im zweiten Quartal 2010 u.a. wegen der gestiegenen Preise 10 % niedriger lagen als im Vergleichsquartal des Vorjahrs, stieg der Großteil der Raucher nicht aus, sondern nur auf selbstgedrehte Glimmstengel um.
Damit tragen sie aber auch weiterhin zu einem immer besser beschriebenen Gesundheitsrisiko durch Aktiv- und Passivrauchen bei, dessen Dimensionen das Robert Koch Institut in der aktuellen Ausgabe Nr. 3 seines Info-Dienstes "GBE-kompakt" zum Thema Passivrauchen nochmals kurz und gut verständlich zusammenfasst:
• Demnach werden bei der Verbrennung von Tabakprodukten über 4.800 Stoffe freigesetzt. Bei 90 dieser Stoffe ist eine krebserregende Wirkung nachgewiesen oder wird vermutet.
• Das gesundheitsgefährdende Potenzial von Tabakrauch ist auch dann hoch, wenn dieser nicht direkt inhaliert, sondern indirekt über die Raumluft aufgenommen wird. Die Konzentration vieler schädlicher Inhaltsstoffe ist sogar in dem Rauch, der an die Umgebung abgegeben wird, höher als im aktiv inhalierten Tabakrauch.
Weitere Kernaussagen des Berichts, hauptsächlich Ergebnisse der RKI-Studie "Gesundheit in Deutschland (GEDA)" aus dem Jahr 2009, sind:
• Passivrauchen geht mit einem eindeutig erhöhten Krankheits- (Liungenkrebsrisiko ist um 20-30 % erhöht) und vorzeitigen Sterberisiko (geschätzt werden 3.300 Todesfälle pro Jahr) einher.
• Ein Drittel der Erwachsenen und die Mehrheit der Kinder und Jugendlichen in Deutschland, die selbst nicht rauchen, sind regelmäßig einer Passivrauchbelastung ausgesetzt.
• Personen mit niedrigem Sozialstatus sind besonders häufig mit Tabakrauch konfrontiert.
• In den letzten zehn Jahren hat die Passivrauchbelastung der Bevölkerung abgenommen.
• Maßgeblich daran beteiligt sind die in den letzten Jahren auch in Deutschland langsam realisierten Rauchverbote in öffentlichen Gebäuden, Kneipen, Verkehrsmitteln und Restarants. Eine Fülle von Studien aus Ländern, die bereits länger Rauchverbote erlassen und durchgesetzt hatten, zeigen, dass die positive Wirkung der Rauchverbote unmittelbar eintritt und die Inzidenz und Prävalenz einer Fülle von Erkrankungen in unerwartet kurzer Zeit signifikant und nachhhaltig senkt.
Die sechsseitige Broschüre "GBE-kompakt" 3/2010 zum Thema "Gesundheitsrisiko Passivrauchen" ist von Thomas Lampert und Sabine List vom RKI verfasst und kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 20.7.10
Wirtschaftliche Verluste im Gastgewerbe durch Rauchverbote geringer als befürchtet
 Die Bevölkerung Bayerns hat sich in einem Volksentscheid für ein konsequentes und strenges Rauchverbot entschieden. Fast zwei Drittel der Wähler (61%) stimmten dafür, das Rauchen in Kneipen, Gaststätten und Bierzelten zu verbieten und dies ohne jede Ausnahme. Dass die ab 1.8.2010 geltende Regelung nachhaltige ökonomische Negativeffekte für die bayerische Gastronomie mit sich bringen könnte, ist allerdings unwahrscheinlich. Mehrere Studien haben gezeigt, dass die in der Vergangenheit mit dem Rauchverbot zusammenhängenden Umsatzeinbußen deutlich geringer ausfielen als vorhergesagt.
Die Bevölkerung Bayerns hat sich in einem Volksentscheid für ein konsequentes und strenges Rauchverbot entschieden. Fast zwei Drittel der Wähler (61%) stimmten dafür, das Rauchen in Kneipen, Gaststätten und Bierzelten zu verbieten und dies ohne jede Ausnahme. Dass die ab 1.8.2010 geltende Regelung nachhaltige ökonomische Negativeffekte für die bayerische Gastronomie mit sich bringen könnte, ist allerdings unwahrscheinlich. Mehrere Studien haben gezeigt, dass die in der Vergangenheit mit dem Rauchverbot zusammenhängenden Umsatzeinbußen deutlich geringer ausfielen als vorhergesagt.
Die in den deutschen Bundesländern eingeführten Rauchverbote haben kurzfristig und anders als in anderen Ländern (z.B. den USA mit einer allerdings geringeren Raucherquote) zu Umsatzeinbußen im Gastgewerbe geführt. Diese fielen jedoch schwächer aus als von vielen Gastwirten befürchtet. Die 2007 zusätzlich für Zigarettenautomaten eingeführte elektronische Alterskennung sorgte für sinkende Umsätze. Zu diesen Ergebnissen kommen drei Untersuchungen des "Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung (RWI)" in Essen rund um das Thema Rauchen auf Grundlage unterschiedlicher Daten.
Die zwischen August 2007 und Juli 2008 auf Bundesländerebene eingeführten Rauchverbote im Gastgewerbe haben dort zu einem durchschnittlichen Umsatzrückgang von rund zwei Prozent geführt (Kvasnicka/Tauchmann: Much ado about nothing). Dieser Wert bleibt auch bei einer Variation der Modellannahmen der statistischen Analyse fast unverändert. Vor allem kurz nach Inkrafttreten der Rauchverbote kam es zu Umsatzeinbußen. Diese scheinen sich jedoch mit der Zeit abgeschwächt zu haben. In Bayern und Nordrhein-Westfalen, wo das Rauchverbot durch die Gründung so genannter "Raucherclubs" umgangen werden konnte, kam es zu keinem nachweisbaren Umsatzrückgang. Dort wo es "Raucherklubs" gab, stieg der Umsatz sogar signifikant an. Auswertungen von Gewerbeabmeldungen im Gastgewerbe lieferten keine belastbaren Hinweis darauf, dass die Rauchverbote zu vermehrten Betriebsaufgaben führten.
Für die Untersuchung wurden Gewerbeanzeigen in den Ländern und die auf Bundesländerebene zusammengefassten monatlichen Umsatzdaten von rund 10.000 Betrieben im Gastgewerbe zwischen Januar 2007 und September 2008 ausgewertet. Wegen der in amtlichen Statistiken zur Umsatzentwicklung in der Regel nicht erfassten Betriebe mit einer Gesamtbelegschaft von unter 20 Personen, könnten die Auswirkungen der Rauchverbote auf die Umsätze in dieser Studie unterschätzt worden sein. Da aber 14 % der Gastgewerbebetriebe, deren Entwicklung in der Studie näher betrachtet wurde, zu der Kategorie Bars und Pubs gehören, sind mit Sicherheit auch Betriebe mit 20 oder etwas mehr Beschäftigten und nicht nur deutlich größere Betriebe vertreten. Ganz nebenbei zeigen die Analysen aber auch, dass Umsätze noch spürbar auf eine Reihe anderer Einflussfaktoren reagieren. So führt etwa ein zusätzlicher Liter Regen pro Quadratmeter und Monat zu einem signifikanten Umsatzanstieg von 0,02 %.
Ob und um wie viel Studien auf der Basis amtlicher Statistiken die wirtschaftlichen Folgen des Rauchverbots für die Gesamtheit aller Gastgewerbebetriebe möglicherweise unterschätzen, zeigt eine weitere Studie (Kvasnicka/Tauchmann: Eine Befragung von Gastronomiebetrieben zur Einführung von Rauchverboten im Gastgewerbe) des RWI in Zusammenarbeit mit der Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Essen und mit Unterstützung durch die IHK Nürnberg im Juni 2008. In ihr wurden insgesamt 7.900 Betriebe, davon 2.900 in Nordrhein-Westfalen, 2.839 in Bayern und 2.161 in Berlin, angeschrieben und gebeten, einen sehr kurzen Fragebogen zum Thema zu beantworten. Für Essen und Nürnberg entspricht dies praktisch einer Vollerhebung, was sichern sollte, dass auch kleinste und kleine gastgewerbliche Betriebe angesprochen wurden und antworten konnten. Der Rücklauf von 617 ausgefüllten Fragebögen - 181 aus Bayern, 241 aus Berlin, 195 aus NRW war aber extrem gering und führt mit Sicherheit ebenfalls zu verzerrten Ergebnissen.
Zu vermuten ist, dass Gastwirte, die sich besonders vom Rauchverbot betroffen fühlen, überproportional antworten, es sich dabei um eher kleine Bars oder Kneipen handelt und die Ergebnisse daher die tatsächlichen Effekte überzeichnen. In Bayern, also einem Bundesland, das zum Befragungszeitpunkt das schärfste Rauchverbot praktizierte, war zum Beispiel unter den stärker betroffenen Bars und Kneipen die Teilnahmebereitschaft etwa zweieinhalb mal höher war als in der vergleichsweise gering betroffenen speisegeprägten Gastronomie. Wenn man die Ergebnisse entsprechend korrigiert, berichten in Bayern noch 44% und nicht 70 % von sinkenden Umsätzen, in NRW erwarten 55% statt 80 % Einbußen.
Der Vergleich zwischen den Bundesländern zeigt zudem, dass die Effekte der Rauchverbote im Vorfeld systematisch überschätzt wurden. In Bayern, wo das Rauchverbot zum Zeitpunkt der Befragung bereits galt, berichteten wie gerade schon erwähnt etwa 70 % der Gastwirte von erlittenen Umsatzeinbußen. In NRW, wo das Rauchverbot erst nach der Befragung in Kraft trat, erwarteten hingegen nahezu 80% der Gastwirte einen Rückgang der Umsätze. Auch die Ablehnung des Rauchverbots durch die Gäste fiel in NRW mit 63% höher aus als in Bayern mit 54%, wo schon Erfahrungen mit einem realen Rauchverbot vorlagen.
Die paradoxe Situation, dass in Bayern, also einem Bundesland mit tatsächlichem Verbot die Zustimmung zum Verbot noch am größten ausfällt, in Nordrhein-Westfalen dagegen, als dem Bundesland, in dem es zum damaligen Zeitpunkt noch gar kein Verbot gab, am geringsten, kann nach Meinung der Forscher "als Hinweis darauf gedeutet werden, dass sich die Gäste trotz anfänglichen Unmuts mit der Zeit an Rauchverbote in der Gastronomie gewöhnen werden und ihnen eventuell auch positive Seiten abgewinnen können." Schließlich gibt es auch Hinweise, dass ein Teil des Rückgangs beim Besuch von Bars oder Restaurants auch etwas mit der im Befragungszeitraum schlechter werdenden wirtschaftlichen Lage der BesucherInnen zu tun hat. Die aus Sicht der Gastronomen beste Lösung zum Nichtraucherschutz ist mit weitem Abstand die Wahlfreiheit zwischen Raucher- und Nichtraucherbetrieb, gefolgt vom Rauchverbot ohne Ausnahmen und den bestehenden Nichtraucherschutzgesetzen.
Eine dritte RWI-Studie (Kvasnicka: Public Smoking Bans ...) zu den Auswirkungen der Rauchverbote auf Länderebene zeigt, dass diese in der Gastronomie zu einem Umsatzrückgang auch an Zigarettenautomaten geführt haben. Zu weitaus stärkeren Umsatzrückgängen an Zigarettenautomaten führte jedoch die Einführung der elektronischen Alterskennung im Januar 2007. Sie hält offenbar nicht nur Jugendliche, sondern auch Erwachsene vom Zigarettenkauf an Automaten ab. Am stärksten fielen die Umsatzeinbußen an im Freien aufgestellten Automaten aus. Insgesamt sank der Zigarettenkonsum in Deutschland in der gleichen Zeit deutlich weniger stark, verlagerte sich also offenbar hin zu anderen Verkaufspunkten. Die Anhebung des Mindestalters für den Erwerb und Konsum von Zigaretten von 16 auf 18 Jahre sowie das bundesweite Rauchverbot in Einrichtungen des Bundes im September 2007 führten zu nur schwach oder überhaupt nicht nachweisbaren Umsatzveränderungen.
Grundlage dieser Untersuchung ist eine Analyse der monatlichen Umsatzdaten von Januar 2006 bis August 2008 eines führenden Zigarettenautomaten-Aufstellers in Deutschland auf Bundesländerebene. Damit wurden erstmalig umfassende Umsatzdaten von Zigarettenautomaten wissenschaftlich ausgewertet. Diese Daten ermöglichten eine erste Wirkungsanalyse der Alterskennung an Automaten, des bundesweiten Rauchverbots in Einrichtungen des Bundes und der jüngsten Erhöhung des Mindestalters für den Erwerb und Konsum von Zigaretten in Deutschland.
Alle Studien sind auf der RWI-Homepage kostenlos erhältlich:
• Kvasnicka Michael, Harald Tauchmann: Much Ado About Nothing? - Smoking Bans and Germany's Hospitality Industry Ruhr Economic Papers #172, Bochum, Essen 2010
• Kvasnicka Michael: Public Smoking Bans, Youth Access Laws, and Cigarette Sales at Vending Machines Ruhr Economic Papers #173. Bochum, Essen 2010
• Kvasnicka Michael, Harald Tauchmann: Eine Befragung von Gastronomiebetrieben zur Einführung von Rauchverboten im Gastgewerbe: deskriptive Ergebnisse RWI : Materialien, Heft 58, 2010
Bernard Braun, 5.7.10
Alkohol: höhere Preise - weniger Probleme
 Zwei "natürliche Experimente" hatten gezeigt, dass der Konsum von Alkohol und die alkoholassoziierten Todesfälle vom Alkoholpreis abhängig sind (wir berichteten): deutliche Preissenkungen in Finnland ab 2004 führten zur Erhöhung von Konsum und Mortalität, deutliche Preiserhöhungen in Alaska in den Jahren 1983 und 2002 zur Minderung.
Zwei "natürliche Experimente" hatten gezeigt, dass der Konsum von Alkohol und die alkoholassoziierten Todesfälle vom Alkoholpreis abhängig sind (wir berichteten): deutliche Preissenkungen in Finnland ab 2004 führten zur Erhöhung von Konsum und Mortalität, deutliche Preiserhöhungen in Alaska in den Jahren 1983 und 2002 zur Minderung.
Eine englische Untersuchung befasste sich jetzt mit der Frage, wie sich unterschiedliche Muster der Preisgestaltung auf den Konsum und die Gesundheit unterschiedlicher Gruppen innerhalb der englischen Bevölkerung auswirken. Gestaltbar ist der Preis über Steuererhöhungen, Festlegen eines Mindestpreises für eine "Alkoholeinheit" (10 ml Äthanol), Verbot von Sonderangeboten sowie Kombinationen dieser Elemente.
Daten über den Alkoholkonsum standen aus Haushaltsbefragungen zur Verfügung. Den Anteil, den Alkohol an der Verursachung von 47 Krankheiten ausmacht ("attributable Fraktion"), errechneten sie aus systematischen Übersichtsarbeiten und Meta-Analysen. Die Veränderungen des Alkoholkonsums für 18 Preisgestaltungen bestimmten sie mit dem Konzept der Preiselastizität. Als Preiselastizität wird "die prozentuale Veränderung der Nachfragemenge nach einem Gut, wenn eine Preisänderung bei diesem Gut um ein Prozent nach oben oder unten eintritt" bezeichnet (Duden Wirtschaft). Sie ist somit ein Maß für die Reaktion der Nachfrage auf Preisveränderungen. In England führt eine Erhöhung des Verkaufspreises um 10% zu einer Minderung des Konsums um 5% bei einem durchschnittlichen Konsumenten, entsprechend einer Preiselastizität von -0,5.
Aus den umfangreichen Ergebnissen seine hier Folgende genannt.
Allgemeine Preiserhöhungen bewirken eine Minderung des Konsums, der alkoholbedingten Mortalität und Morbidität sowie einen Gewinn an Lebensqualität (ausgedrückt in QALYs - quality adjusted life years).
Eine allgemeine Preiserhöhung in England um 10% mindert pro Jahr
• die Zahl der alkoholbedingten Todesfälle um 1.460,
• die chronische Morbidität um 20,5 Fälle pro 1.000 Personen,
• die akute Morbidität um 5,8 Ereignisse pro 1.000 Personen.
Ein Mindestpreis von 0,7 Engl. Pfund für eine Alkoholeinheit in Verbindung mit einem Verbot von Sonderangeboten verhindert pro Jahr 7.150 Todesfälle sowie 100,2 chronische und 23,3 akute Krankheitsereignisse pro 1.000 Personen.
Der Konsum in der Gruppe der 18- bis 24-Jährigen mit schädlichem Gebrauch wird durch Preiserhöhungen bei Niedrigpreis-Alkoholika stärker gesenkt als im Bevölkerungsdurchschnitt.
Die Berechnungen beruhen im Wesentlichen auf Daten, die zu einem bestimmten Zeitpunkt bzw. in einem bestimmte Zeitraum erhoben wurden ("Querschnittdaten"). Die Autoren weisen darauf hin, dass die Ergebnisse mit Längsschnittdaten überprüft werden sollten.
Zu vergleichbaren Ergebnissen gelangt eine systematische Übersichtsarbeit, die im Februar 2010 im American Journal of Preventive Medicine erschien. Insgesamt wurden 78 internationale Studien eingeschlossen, die sich mit Effekten von Preiserhöhungen für Alkohol auf Konsum und Gesundheit befassten. Hier einige Ergebnisse:
• Gesamtkonsum in einer Gesellschaft - fast alle Studien bestätigen den Zusammenhang einer Minderung des Gesamtkonsums bei einer Erhöhung der Preise.
• Konsum bei Jugendlichen - höhere Preise gehen mit niedrigerem Konsum einher
• Verkehrsunfälle - höhere Preise senken die Zahl der Unfälle und die Zahl der Personen, die unter Alkoholeinfluss motorisiert am Straßenverkehr teilnehmen.
• Sterblichkeit an alkoholassoziierten Krankheiten - höhere Alkoholpreise stehen in Zusammenhang mit niedrigerer Mortalität an Leberzirrhose und einigen anderen Todesursachen.
• Gewalt - höhere Alkoholsteuer geht mit niedrigeren Raten z.B. an Körperverletzung und Vergewaltigung sowie Gewalt gegen Kinder einher.
Die hier dargelegten (und viele weitere) Studien zeigen, dass der Staat sowohl durch Handeln als auch durch Nicht-Handeln über das Preisniveau von alkoholischen Getränken den Konsum in der Bevölkerung beeinflusst. Für wissenschaftlich begründete politische Entscheidungen zur Alkoholprävention über die Preise dürfte die Datenlage mehr als ausreichend sein. Wie allerdings Politik zu diesem Thema in Deutschland funktioniert, beleuchtet der Beitrag in der ZEIT "Die Gesetzeshüter".
Purshouse RC, Meier PS, Brennan A, Taylor KB, Rafia R. Estimated effect of alcohol pricing policies on health and health economic outcomes in England: an epidemiological model. The Lancet 2010;375(9723):1355-64. Abstract
Elder RW, Lawrence B, Ferguson A, Naimi TS, Brewer RD, Chattopadhyay SK, et al. The Effectiveness of Tax Policy Interventions for Reducing Excessive Alcohol Consumption and Related Harms. American Journal of Preventive Medicine 2010;38(2):217-29. Abstract
Die Gesetzeshüter. Wie die deutschen Bierbrauer neue Gesetze gegen Alkoholmissbrauch verhindern und die Drogenbeauftragte der Bundesregierung entmachten. Die ZEIT, 14.5.2009, S. 17
David Klemperer, 18.5.10
Irrtum korrigiert: Obst und Gemüse schützen kaum oder gar nicht vor Krebs
 Obst und Gemüse sind Teil einer gesunden Ernährung. Auch nach den neuesten Erkenntnissen senkt der Verzehr von Obst und Gemüse die Risiken für Herzinfarkte und Schlaganfälle.
Obst und Gemüse sind Teil einer gesunden Ernährung. Auch nach den neuesten Erkenntnissen senkt der Verzehr von Obst und Gemüse die Risiken für Herzinfarkte und Schlaganfälle.
Korrigiert werden muss aber - leider - die Vorstellung, damit auch das Risiko für Krebserkrankungen nennenswert zu mindern. Dies ist ein Ergebnis der Europäischen Ernährungsstudie (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC)-Studie). Mit 520.000 Teilnehmern ist es die größte jemals durchgeführte Studie zu Ernährung und Gesundheit. Beteiligt sind 23 Studienzentren in 10 westeuropäischen Ländern.
Für die Frage nach dem Zusammenhang von Ernährung und Krebs wurden die Daten von 142.605 Männern und 335.873 Frauen ausgewertet. Bei 9.604 Männern und 21.000 Frauen war bei einer mittleren Beobachtungszeit von 8,7 Jahren eine Krebserkrankung aufgetreten.
Die Ernährungsgewohnheiten und die Lebensgewohnheiten wurden detailliert zu Beginn der Studie erhoben. Geprüft wurde der Zusammenhang zwischen dem Konsum von Obst und Gemüse und der Krebsinzidenz (Neuauftreten von Krebs).
Ein um 200 g pro Tag erhöhter Verzehr von Obst und Gemüse verringerte das Risiko für Krebs um 3 %. 100 g mehr Gemüse pro Tag senkten das Krebsrisiko um 2 %, allerdings nur bei Frauen und zwar am stärksten solchen mit hohem Alkoholkonsum.
Die Autoren bezeichnen die gemessenen Effekte als sehr klein und daher unsicher und möglicherweise Folge von nicht vermeidbaren methodischen Ungenauigkeiten.
Lehrreich ist das Thema bezüglich der Art und Weise, wie Wissen zu einem Gesundheitsthema gewonnen wird. Im Jahr 1990 empfahl die Weltgesundheitsorganisation den Verzehr von 400 g Obst und Gemüse pro Tag in der Annahme, damit das Risiko für Krebs und chronische Krankheiten zu senken. Noch im Jahr 1997 sprach ein internationales Expertengremium, dem von mehr als 100 Experten zugearbeitet wurde, Ernährungsempfehlungen aus, mit denen man die Krebsinzidenz um 30 bis 40 % zu senken können glaubte, entsprechend 3 bis 4 Mio. verhinderter Krebserkrankungen pro Jahr. Leider hat der Herausgeber, der World Cancer Research Fund, diese Studie von der Website genommen. Im Internet verfügbar ist lediglich eine Zusammenfassung in der Zeitschrift "Nutrition".
Festzustellen bleibt, dass hier ein hochrangiges Expertengremium sich seiner Sache völlig sicher war, sich aber trotzdem grundlegend geirrt hat. Die Fehleinschätzung kam dadurch zustande, dass man sich weitgehend auf die Ergebnisse von Fall-Kontroll-Studien verließ. In Fall-Kontroll-Studien gaben bereits Erkrankte und Gesunde aus der Erinnerung ihre Ernährungsgewohnheiten an - dabei ergab sich zumeist ein Mehrkonsum von Obst und Gemüse bei den Gesundgebliebenen im Vergleich zu den an Krebs Erkrankten, was als Schutzfaktor vor Krebs interpretiert wurde. Die Fall-Kontroll-Studie ist jedoch fehleranfällig, weil die Erfassung der Ernährung über längere vergangene Zeiträume ungenau ist. In prospektiven, also in die Zukunft gerichteten Studien (Kohortenstudien) werden die Ernährung wie auch andere Aspekte des Gesundheitsverhaltens hingegen zu Beginn der Studie und ggf. in der Folge wiederholt durch persönliche Befragung oder Fragebögen erfasst, was zu sehr viel genaueren Ergebnissen führt. In den letzten Jahren wurden Ergebnisse von sechs Kohortenstudien mit insgesamt etwa 10.000 Teilnehmern veröffentlicht. Die Ergebnisse waren widersprüchlich, drei Studien zeigten eine Minderung der Krebsinzidenz, zwei fanden keine Unterschiede, eine zeigte eine Minderung der Krebssterblichkeit.
Die EPIC-Studie setzt mit fast 480.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, einer Beobachtungszeit von fast 9 Jahren und 30.000 Krebsfällen neue Maßstäbe.
Website der Epic-studie
Boffetta P, Couto E, Wichmann J, et al. Fruit and Vegetable Intake and Overall Cancer Risk in the European Prospective Investigation Into Cancer and Nutrition (EPIC). J. Natl. Cancer Inst. 2010:djq072. Abstract
World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research. Food, Nutrition, and the Prevention of Cancer: A Global Perspective. Nutrition 1999;15(6):523-26. (kein Abstract, Volltext kostenpflichtig)
David Klemperer, 14.4.10
Minderung des Softdrinkkonsums von Kindern und Jugendlichen - keine einfachen Lösungen
 Softdrinks wie Cola, Fanta und Sprite sind bei Kindern und Jugendlichen beliebt. Sie sind kalorienreich, verschaffen kein Sättigungsgefühl und tragen daher auch zum Übergewicht bei. Die Minderung des Konsums ist aus der Perspektive der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen erwünscht. In einer Studie der Mai-Ausgabe der Zeitschrift Health Affairs befassten sich die Autoren mit der Wirksamkeit von Maßnahmen zur Minderung des Softdrinkkonsums von Kindern und Jugendlichen. Dabei ging es um die Verfügbarkeit von Softdrinks über Getränkeautomaten in der Schule und um Steuern auf Softdrinks.
Softdrinks wie Cola, Fanta und Sprite sind bei Kindern und Jugendlichen beliebt. Sie sind kalorienreich, verschaffen kein Sättigungsgefühl und tragen daher auch zum Übergewicht bei. Die Minderung des Konsums ist aus der Perspektive der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen erwünscht. In einer Studie der Mai-Ausgabe der Zeitschrift Health Affairs befassten sich die Autoren mit der Wirksamkeit von Maßnahmen zur Minderung des Softdrinkkonsums von Kindern und Jugendlichen. Dabei ging es um die Verfügbarkeit von Softdrinks über Getränkeautomaten in der Schule und um Steuern auf Softdrinks.
Im Rahmen einer Kohortenstudie (Early Childhood Longitudinal Study-Kindergarten Cohort) wurden im Jahr 2004 bzw. 2007 die Kinder der 5. bzw. 8. Klasse gefragt, wie oft sie in der Schule einen Softdrink konsumiert und gekauft hatten. 27% der Fünftklässler und 60% der Achtklässler hatten in der Schule Zugang zu Softdrinks über Getränkeautomaten. 84 % aller Schüler gaben an, in der vorausgegangenen Woche Softdrinks (im Durchschnitt 6) konsumiert zu haben. 13% der Fünftklässler und 25% der Achtklässlergaben hatten Softdrinks in der Schule gekauft.
Bei Vorhandensein von Getränkeautomaten sind der Anteil der Schüler, die Softdrinks in der Schule konsumieren sowie die Anzahl der in der Schule konsumierten Softdrinks deutlich höher. Keine wesentlichen Unterschiede zeigten sich jedoch, wenn man den Konsum innerhalb und außerhalb der Schule aufaddiert. Dies bedeutet, dass Kinder aus Schulen ohne Getränkeautomaten den schulischen Minderkonsum durch Mehrkonsum außerhalb der Schule wieder ausgleichen.
Die Effekte von Softdrink-Steuern, die in einigen Bundesstaaten auf Softdrinks erhoben werden, auf den Konsum von Softdrinks und das Gewicht von Kindern und Jugendlichen untersuchten die Wissenschaftler mit den Daten des "National Health and Nutrition Examination Survey", einer großen amerikanischen Ernährungsstudie (Website Fragebögen).
Der Effekt von Softdrink-Steuern
Erfragt wurden die konsumierten Lebensmittel der letzten 24 Stunden. 54% der Kinder und Jugendlichen gaben an, einen Softdrink zu sich genommen zu haben, entsprechend durchschnittlich 205 Kalorien. Im Vergleich der Bundesstaaten mit und ohne Softdrink-Steuer zeigten sich jedoch keine wesentlichen Unterschiede im Konsum und im Körpergewicht. In Bundesstaaten mit Softdrinksteuer sind im Vergleich zu Bundesstaaten ohne Softdrinksteuer das Durchschnittsgewicht von Kindern und Jugendlichen, die durch Softdrinks zugeführte Kalorienmenge und auch das Gewicht etwas höher, der Anteil der Softdrinkkonsumenten entgegen den Erwartungen etwas geringer - keiner der Unterschiede erreicht jedoch statistische Signifikanz.
Die Autoren folgern, dass die gegenwärtige Praxis der Verkaufsrestriktion an Schulen und der Steuer in Bundesstaaten den Softdrinkkonsum nicht zu spürbaren Gewichtsminderungen bei Kindern und Jugendlichen führt. Restriktionen im Zugang müssten umfassender und Steuern auf Softdrinks höher sein, wenn diese Maßnahmen wirksam sein sollen.
Hier ist ein Abstract der Studie: Fletcher JM, Frisvold D, Tefft N.: Taxing Soft Drinks And Restricting Access To Vending Machines To Curb Child Obesity Health Aff 2010:hlthaff.2009.0725.
Ergänzend ist anzumerken, dass das Ernährungsverhalten von Kindern und Jugendlichen durch eine Vielzahl von Faktoren bestimmt wird. Die Beeinflussung eines Einzelaspektes lässt keine durchschlagenden Effekte erwarten. Erfolgversprechend sind eher bevölkerungsweite, multimodale Interventionen, wie sie der Sachverständigenrat Gesundheit in seinem Gutachten 2000/2001 umrissen hat: (SVR Band III.3, Ziffer 62-93)
Dabei werden drei Ebenen angesprochen:
1. Bevölkerungsweite Strategien, Streubotschaften und Anreize
2. Zielgruppen- und Setting-spezifische Kampagnen
3. Persönliche Kommunikation, Beratung und Behandlung
Hier eine Auswahl von Beiträgen im Forum Gesundheitspolitik zum Ernährungsverhalten:
• Steuer auf Junk Food: Gut für die Gesundheit
• Verbot der Fernsehwerbung von Fastfood-Restaurants würde die Verbreitung von Übergewicht bei Kindern senken
• Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm: Kinder imitieren auch gesundheitsriskante Ernährungsgewohnheiten ihrer Eltern,
• Viel zu viele Kalorien - Kindermenüs in Fastfoodketten
• McDonald's Werbebotschaften beeinflussen schon 4-5jährige Vorschulkinder
• Elterneinfluss auf das Essverhalten ihrer Kinder ist kleiner als erwartet
Weitere Beiträge in der Rubrik Prävention - Gesundheitsverhalten
David Klemperer, 11.4.10
Steuer auf Junk Food: gut für die Gesundheit
 Höhere Preise für Cola und Pizza senken den Konsum dieser Lebensmittel, lautet das Fazit einer amerikanischen Studie.
Höhere Preise für Cola und Pizza senken den Konsum dieser Lebensmittel, lautet das Fazit einer amerikanischen Studie.
Die CARDIA-Studie wurde im Jahr 1985 in den USA initiiert, um die Faktoren zu untersuchen, die zur Entwicklung von Herzkreislauferkrankungen beitragen. Aufgenommen wurden 5115 junge Männer und Frauen (Alter 18 bis 30 Jahre) unterschiedlicher Ethnien und unterschiedlichen Bildungsstandes. Das Ernährungsverhalten wurde über einen Zeitraum von 20 Jahren mehrfach per Fragebogen erfasst. Körpergröße und Gewicht sowie Glucose und Insulin wurden im Blut wurden gemessen. An soziodemographischen Merkmalen wurden der höchste Bildungsabschluss, das Jahreseinkommen und der Familienstatus erfragt.
Analysiert wurde die Preiselastizität, d.h. die prozentuale Änderung des Konsums eines Lebensmittels bei prozentualer Änderung des Preises dieses oder eines anderen Lebensmittels - so z.B. die Veränderung des Konsums zuckerhaltiger Limonade und auch des Milchkonsums bei Veränderungen des Limonadenpreises.
Preisänderungen von Limonade und Pizza wirkten sich spürbar auf deren Konsum aus. Ein Anstieg des Preises für Limonade um 10 Prozent ging mit einem Rückgang der durch Limonade aufgenommenen Kalorien um 7 Prozent einher. Bei Pizza führt die Verteuerung um 10 Prozent zu einer Minderung der Kalorien durch Pizzakonsum um 11,5 Prozent.
Dieser Studien zufolge werden 124 Kalorien weniger aufgenommen, wenn der Limonadenpreis um einen Dollar steigt, einhergehend mit einer Gewichtsabnahme von 1,1 kg und verbesserten Stoffwechselwerten. Preissteigerungen bei Pizza zeigten vergleichbare Effekte. Steigen die Preise für Limonade und Pizza addierten sich die Effekte.
Die für den Bundesstaat New York vorgeschlagene aber abgelehnte Besteuerung von Junk Food um 18 Prozent würde bei jungen Erwachsenen und Menschen im mittleren Lebensalter zu einer Minderung der Energiezufuhr um 56 Kalorien pro Tag und zu einer Gewichtsreduktion von 2,25 kg pro Jahr sowie einer Verbesserung der Stoffwechsellage führen.
Nach Meinung der Autoren könnte somit eine Besteuerung von Junkfood über die Minderung der Kalorienaufnahme und des Körpergewichts z.B. zu einer Reduktion der Neuerkrankungen an Diabetes führen.
Duffey KJ, Gordon-Larsen P, Shikany JM, Guilkey D, Jacobs DR, Jr, Popkin BM. Food Price and Diet and Health Outcomes: 20 Years of the CARDIA Study. Arch Intern Med 2010;170(5):420-426. Abstract der Studie
David Klemperer, 26.3.10
Wirksamkeit von Brustkrebs-Screening überaus fraglich
 Ein beachtenswerter Artikel zur Frage von Sinn und Unsinn des Brustkrebs-Screenings erschien Ende März 2010 in der angesehenen Medizinerzeitschrift British Medical Journal (BMJ). Ein dreiköpfiges Forscherteam bestehend aus Karsten Juhl JÝrgensen und Peter GÝtzsche vom Nordic Cochrane Centre in Kopenhagen sowie Per-Henrik Zahl vom Folkehelseinstitut in Oslo untersuchten die Auswirkung von flächendeckenden Früherkennungsprogrammen auf die Sterblichkeit an Mamma-Karzinom. Dabei kamen sie zu ernüchternden Ergebnissen für Anhänger von Screening-Kampagnen.
Ein beachtenswerter Artikel zur Frage von Sinn und Unsinn des Brustkrebs-Screenings erschien Ende März 2010 in der angesehenen Medizinerzeitschrift British Medical Journal (BMJ). Ein dreiköpfiges Forscherteam bestehend aus Karsten Juhl JÝrgensen und Peter GÝtzsche vom Nordic Cochrane Centre in Kopenhagen sowie Per-Henrik Zahl vom Folkehelseinstitut in Oslo untersuchten die Auswirkung von flächendeckenden Früherkennungsprogrammen auf die Sterblichkeit an Mamma-Karzinom. Dabei kamen sie zu ernüchternden Ergebnissen für Anhänger von Screening-Kampagnen.
Die Widersprüchlichkeit der Untersuchungsergebnisse und vor allem der daraus abgeleiteten Empfehlungen waren bereits wiederholt Thema im Forum Gesundheitspolitik, so z.B. in den Beiträgen
• Brustkrebs: EU fordert Staaten zu mehr Anstrengungen bei der Früherkennung auf
• Neue Studien schüren weiteren Zweifel am Nutzen des Mammographie-Screening und zuletzt
• Nutzen von Krebsfrüherkennung wird von Patienten deutlich überschätzt - Deutsche besonders schlecht informiert.
Auch der Spiegel griff das Thema wiederholt auf, so z.B. im April 2009 in dem Beitrag Umstrittene Früherkennung - "Ärzte schüren falsche Hoffnungen" und zuletzt mit Brustkrebs-Früherkennung - Forscher streiten über Mammografie-Studie. Die ZEIT hingegen publizierte im September 2009 in dem Artikel Mammografie-Screening ermöglicht frühzeitige Krebserkennung eine grundsätzlich positivere Haltung zur Frage von Reihenuntersuchungen zur Früherkennung von Mamma-Karzinomen. Ganz im Sinne des "medizinisch-industriellen Komplexes" und einer zunehmenden Technologisierung der Gesundheitsversorgung propagieren unter anderem deutsche Mediziner mittlerweile den Einsatz von Kernspintomographen anstelle der traditionellen Mammographie zur Früherkennung von Brustkrebs. Soeben erschienen die in diese Richtung weisenden Ergebnisse einer multizentrischen Studie aus Deutschland dem so genannten EVA-Trial: "Prospective Multicenter Cohort Study to Refine Management Recommendations for Women at Elevated Familial Risk of Breast Cancer".
Während der Deutsche Bundestag erst 2002 ein Brustkrebs-Screening-Programm ins Leben gerufen hatte, begannen in Teilen Dänemarks Reihenuntersuchungen zur Früherkennung von Mammakarzinomen bereits Anfang der 1990er Jahre. Aber was 1991 in Kopenhagen und 1993 auf der Insel Fünen begann, blieb dem Rest des Landes viele Jahre vorbehalten. So besteht in dem skandinavischen Land die einzigartige Situation, dass über 17 Jahre lang nur etwa ein Fünftel der Bevölkerung Zugang zu solchen Früherkennungsprogrammen hatte und sich die Bevölkerungsmehrheit als Kontrollgruppe anbietet.
Zentraler Ergebnisindikator der nun im BMJ erschienen Untersuchung war die jährliche anteilige Änderung der Brustkrebs-Mortalität in Regionen mit und ohne Screening-Programm. Dabei zeigte sich während des zehnjährigen Beobachtungszeitraums zwischen 1997 und 2006 bei Frauen zwischen 55 und 74 Jahren, die potenziell von der Früherkennung profitieren könnten, in den Screening-Gebieten ein jährlicher Rückgang der Krebssterblichkeit um 1 % (relatives Risiko (RR) 0.99, 95% Konfidenzintervall (KI) 0.96-1.01). Bei gleichaltrigen Frauen in den Gebieten, wo kein systematisches Screening erfolgte, ging im gleichen Zeitraum die Brustkrebs-Mortalität allerdings um 2 % und damit doppelt zu stark zurück wie unter Screening-Bedingungen (RR 0.98, 95% CI 0.97-0.99).
Bei jüngeren Frauen zwischen 35 und 55, bei denen aufgrund des jungen Alters kein positiver Effekt durch Früherkennungsprogramme zu erwarten ist, sank die Sterblichkeit aufgrund von Mammakarzinomen im gleichen Zeitraum um jährlich 5 % (RR 0.95, KI 0.92-0.98) in Regionen mit Screening-Programmen und sogar um 6 % in solchen ohne systematische Früherkennung (RR 0.94, KI 0.92-0.95). In den höheren Altersgruppen zwischen 75 und 84 Jahren zeigte sich sowohl in Gebieten mit als auch ohne Screening-Programm zwischen 1997 und 2006 nur eine geringfügige Änderung der jährlichen Sterblichkeit aufgrund von Brustkrebs.
Folgerichtig kommen die Autoren zu dem Schluss, dass sie keinen Effekt des dänischen Screening-Programm auf die Brustkrebsmortatiltät feststellen können, da die Verringerung der Sterblichkeit in Regionen mit und ohne Früherkennungsprogramm sehr ähnlich ausfiel und in Screening-Gebieten sogar tendenziell geringer war. Diese Ergebnisse sind nach ihrer Auffassung eher eine Änderung von Risikofaktoren und auf verbesserte Behandlungsmöglichkeiten zurückzuführen als auf Früherkennungsmaßnahmen.
Diese Ergebnisse widersprechen denen einer früheren Kohortenstudie aus Kopenhagen, die ebenfalls im BMJ erschien und kostenfrei als Volltext erhältlich ist: Breast cancer mortality in Copenhagen after introduction of mammography screening: cohort study. Damals hatte ein Forscherteam vom Institut of Public Health und der Universitätsklinik Kopenhagen einen sage und schreibe 25-prozentigen Rückgang der Mammakarzinom-Mortalität nach Einführung des Screening-Programms beobachtet, der bei tatsächlich teilnehmenden Frauen sogar bei 37 % lag. Solche Ergebnisse, für die im Übrigen auch keine Kontrollgruppe vorlag, sind nach Auffassung von JÝrgensen und Kollegen in erster Linie Ausdruck des "healthy-Screenee-Effekts", denn an Früherkenungsprogrammen nehmen bekanntermaßen vor allem gebildete, gesündere und vor allem gesünder lebende Personen teil.
Das BMJ stellt den Artikel Breast cancer mortality in organised mammography screening in Denmark: comparative study von Karsten Juhl JÝrgensen, Per-Henrik Zahl und Peter GÝtzsche kostenfrei zum Download zur Verfügung.
Jens Holst, 24.3.10
Meta-Analyse: Vermeidung von Übergewicht bei Schulkindern ist durch Interventionen möglich, Abbau von Übergewicht bislang nicht
 Übergewicht und Fettsucht treten immer häufiger bereits bei Kindern und Jugendlichen auf und haben große Aussagekraft auch für das Fortbestehen dieser gesundheitlich riskanten Bedingungen im Erwachsenenalter. Daher haben schulbasierte Interventionsprogramme gegen Adipositas eine wachsende Bedeutung für die Prävention und das Management der beiden Risikofaktoren. Die Ergebnisse der jüngsten Meta-Analyse von methodisch fundierten Studien aus den Jahren 1995 bis 2007, die sich mit schulbasierten Interventionen gegen das kindliche oder jugendliche Übergewicht beschäftigten, wurden jetzt veröffentlicht.
Übergewicht und Fettsucht treten immer häufiger bereits bei Kindern und Jugendlichen auf und haben große Aussagekraft auch für das Fortbestehen dieser gesundheitlich riskanten Bedingungen im Erwachsenenalter. Daher haben schulbasierte Interventionsprogramme gegen Adipositas eine wachsende Bedeutung für die Prävention und das Management der beiden Risikofaktoren. Die Ergebnisse der jüngsten Meta-Analyse von methodisch fundierten Studien aus den Jahren 1995 bis 2007, die sich mit schulbasierten Interventionen gegen das kindliche oder jugendliche Übergewicht beschäftigten, wurden jetzt veröffentlicht.
Sie sehen zusammengefasst so aus:
• (1) Programme, die weniger als 6 Monate liefen, brachten für die TeilnehmerInnen gegenüber den NichtteilnehmerInnen keinen statistisch signifikant höheren Nutzen. Dauerten sie länger als 6 Monate, waren schulische Interventionen aber durchaus erfolgreich bei der Prävention von Übergewicht,
• (2) Längerfristig angelegte Maßnahmen (über ein Jahr) sind deutlich effektiver als kurzfristige.
• (3) Während die Vermeidung von Übergewicht teilweise gelingt, ist ein solcher Erfolg leider nicht feststellbar für eine deutliche Reduktion von bereits eingetretener und mit dem Body Mass Index (BMI) gemessener Fettleibigkeit.
• (4) Sofern analysierbar, senken Kombinationen von Maßnahmen, wie etwa verstärkte körperliche Aktivitäten zusammen mit Lehreinheiten über das Übergewicht im Schulunterricht, die Prävalenz kindlichen Übergewichts signifikant.
Von den zunächst 41 Studien, welche die WissenschaftlerInnen gefunden hatten, wurden am Ende 19 in die Metaanalyse einbezogen. Drei Studien waren Follow-up-Studien. Die einbezogenen Studien umfassten allgemein drei Ziele: Verringerung des Übergewichts durch die Zunahme körperlicher Aktivitäten, Verringerung der sitzenden Tätigkeiten und eine Verringerung der Aufnahme fett- und zuckerhaltiger Nahrungsmittel. Die Interventionen erfolgten in der Regel mehrgleisig. Neben dem Angebot gesünderer Lebensmittel in den Schulen oder einer intensiveren Form des Schulsports spielten Veränderungen in der Umgebung der Schulen und die Einbeziehung von Eltern wichtige ergänzende Rollen. Die Interventionsprogramme dauerten teilweise weniger als 6 Monaten und reichten bis zu mehr als 2 Jahren.
Nachteilig wirkt sich auf die Aussagekraft und die Möglichkeit, künftige Interventionen noch wirksamer zu machen, die nicht ohne weiteres mögliche Kontrolle weiterer Faktoren wie des Alters der teilnehmenden Schulkinder, des Engagements der Eltern, der Schulkulturen oder der Compliance gegenüber der Intervention aus.
Hier ist ein Abstract: Consuelo Gonzalez-Suarez et al: School-Based Interventions on Childhood Obesity: A Meta-Analysis (American Journal of Preventive Medicine, 2009; 37 (5): 418-427)
Bernard Braun, 11.2.10
Fragen zur Prävention: Mehrheit der Bevölkerung ist der Meinung "Damit belästigen wir nicht den Hausarzt"
 Prävention, so hat eine repräsentative Befragung des "Gesundheitsmonitor" der Bertelsmann-Stiftung gezeigt, ist keine Angelegenheit, mit der man den Arzt behelligen möchte. Zwar berichtet kaum jemand über konkrete Negativerfahrungen in der Arztpraxis, was das Rauchen, Sport oder Ernährungsfragen anbetrifft. Aber es dominiert bei Bürgerinnen und Bürgern hartnäckig das Urteil oder auch Vorurteil: Der Arzt ist zuständig für die Kuration, nicht für Prävention. Aber auch Ärzte, so ein weiteres Ergebnis der Studie, bemühen sich kaum, dieses Image zu ändern. Ein sehr großer Teil der Übergewichtigen oder Raucher ist noch nie vom Arzt auf die gesundheitlichen Risiken oder Verhaltensänderungen hingewiesen worden.
Prävention, so hat eine repräsentative Befragung des "Gesundheitsmonitor" der Bertelsmann-Stiftung gezeigt, ist keine Angelegenheit, mit der man den Arzt behelligen möchte. Zwar berichtet kaum jemand über konkrete Negativerfahrungen in der Arztpraxis, was das Rauchen, Sport oder Ernährungsfragen anbetrifft. Aber es dominiert bei Bürgerinnen und Bürgern hartnäckig das Urteil oder auch Vorurteil: Der Arzt ist zuständig für die Kuration, nicht für Prävention. Aber auch Ärzte, so ein weiteres Ergebnis der Studie, bemühen sich kaum, dieses Image zu ändern. Ein sehr großer Teil der Übergewichtigen oder Raucher ist noch nie vom Arzt auf die gesundheitlichen Risiken oder Verhaltensänderungen hingewiesen worden.
Bereits frühere Veröffentlichungen des Gesundheitsmonitor haben gezeigt, dass bei gesundheitsbezogenen Verhaltensänderungen (z.B. Rauchen, Sport und Bewegung) der Hausarzt in der Mehrzahl der Fälle nicht hinzugezogen wurde. Weiterhin zeigt sich, dass die befragten Ärzte eine unzureichende Vergütung und zu wenig verfügbare Zeit als Hauptgründe ihrer aktuell unzureichenden Wahrnehmung präventiver Aufgaben benennen (vgl. Prävention aus Sicht der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ...).
Wie sieht es auf der Seite der Patienten aus? Könnte nicht auch deren Verhalten in der Sprechstunde mit ein Grund sein für die Präventions-Zurückhaltung der Ärzte? In der jetzt veröffentlichten repräsentativen Umfrage (1.500 Teilnehmer 18-79 Jahre) zeigt sich, dass bei der Bevölkerungs-Mehrheit eher Skepsis vorherrscht. Auf die Frage "Einmal angenommen, Sie wollten Ihr Gesundheitsverhalten ändern und hätten gerne Informationen, wie dies am erfolgreichsten zu bewerkstelligen ist. Würden Sie, auch wenn Sie nicht krank sind, speziell dazu zum Arzt gehen und um Rat bitten?" antwortet die große Mehrheit mit "eher nein" (41%) oder "sicher nein" (18%).
Überraschend ist, dass fast drei Viertel aller Befragungsteilnehmer (71%) sagen, dass es eigentlich keinen Grund dafür gibt, den Hausarzt in solchen Fragen außen vor zu lassen. Deutlich wird aus den Begründungen, dass nicht konkrete Erfahrungen von Patienten maßgeblich sind. Zwei Interpretationen dominieren stattdessen. Die ärztliche Funktion wird zum einen ganz klar wahrgenommen als kurative oder therapeutische Tätigkeit (54% der Nennungen). Weiterhin vermuten Patienten: Präventive Fragen oder Probleme sind für den Arzt nicht vorrangig, insbesondere dann nicht, wenn das Wartezimmer voll ist mit Patienten, die akute Schmerzen oder Beschwerden haben. 55% sagen "Mein Arzt hat meist eine volle Praxis und zu wenig Zeit für solche Fragen".
Wie sieht es umgekehrt aus, wie viele Patienten sind schon einmal selbstständig vom Arzt auf Verhaltensmöglichkeiten aufmerksam gemacht worden, die in Anbetracht bestimmter gesundheitlicher Probleme recht nahe liegen würden? Übergewichtige (Body Mass Index 25-29,9), sagen zu 65%, sie seien noch nie vom Arzt darauf hingewiesen worden. Aber auch bei adipösen Patienten (BMI über 30) bleibt noch mehr als jeder vierte (28%) "unbehelligt" von ärztlichen Risikohinweisen oder Ratschlägen, obwohl auch ohne eingehende körperliche Untersuchung und medizinische Fachkenntnisse die Problematik erkennbar wird. Wie sieht es bei Rauchern aus? Nimmt man hier Gelegenheitsraucher einmal beiseite und betrachtet nur tägliche Raucher, dann wird deutlich, dass 44% aus dieser Gruppe sagen, sie seien vom Arzt noch auf die mit dem Rauchen verbundenen Risiken hingewiesen oder auf Entwöhnungsmöglichkeiten angesprochen worden. Unter dem Strich wird damit deutlich, dass Ärzte selbst bei recht offensichtlich erkennbaren Problemgruppen im Hinblick auf das Gesundheitsverhalten sehr häufig untätig bleiben und Patienten nicht auf Risiken und Präventionsmöglichkeiten hinweisen.
Weitere Fragestellungen die in der Befragung zur Prävention behandelt und in der Veröffentlichung diskutiert werden:
• Welche Einflussfaktoren gelten bei der Bevölkerungsmehrheit heute als besonders relevante Risikofaktoren für die Lebenserwartung?
• Zeigt sich in der Bevölkerung nach den zuletzt sehr umfassenden Maßnahmen zum Nichtraucherschutz und Nikotinverzicht ein Präventions-Überdruss, etwa in Form einer deutlichen Ablehnung weiterer Maßnahmen (ungesunde Nahrungsmittel, Alkohol, zu wenig Sport und körperliche Bewegung, Drogen)?
• Welchen Bekanntheitsgrad haben bevölkerungsweite Präventions-Kampagnen (wie: Fünf am Tag, Täglich 3.000 Schritte extra, Fit statt fett, Keine Macht den Drogen, Gib AIDS keine Chance?) und für wie effektiv schätzt man diese Kampagnen ein?
Hier ist ein Abstract: Gerd Marstedt, Rolf Rosenbrock: Verhaltensprävention: Guter Wille alleine reicht nicht
Gerd Marstedt, 9.2.10
Wären Präventionskampagnen erfolgreicher, wenn mehr Prinzipien der Werbepsychologie berücksichtigt würden?
 In einer Literaturstudie der "Initiative Gesundheit und Arbeit (iga)" wurde der Frage nachgegangen: Lassen sich Erkenntnisse zur Werbewirkung übertragen und für Präventionsmedien nutzen? Die Antwort der Autorin Marlen Hupke, Mitarbeiterin am Leibnitz Institut für Arbeitsforschung an der Universität Dortmund, lautet: "Ja, wenn man einige spezielle Anforderungen der Prävention berücksichtigt." In einem 36seitigen Bericht werden aktuelle Forschungsergebnisse zur Wirksamkeit von Präventionsmedien analysiert und darüber hinaus auch Gestaltungsvorschläge präsentiert, die sich aus empirischen Studien ableiten lassen.
In einer Literaturstudie der "Initiative Gesundheit und Arbeit (iga)" wurde der Frage nachgegangen: Lassen sich Erkenntnisse zur Werbewirkung übertragen und für Präventionsmedien nutzen? Die Antwort der Autorin Marlen Hupke, Mitarbeiterin am Leibnitz Institut für Arbeitsforschung an der Universität Dortmund, lautet: "Ja, wenn man einige spezielle Anforderungen der Prävention berücksichtigt." In einem 36seitigen Bericht werden aktuelle Forschungsergebnisse zur Wirksamkeit von Präventionsmedien analysiert und darüber hinaus auch Gestaltungsvorschläge präsentiert, die sich aus empirischen Studien ableiten lassen.
Diese auf drei Seiten tabellarisch präsentierten Empfehlungen der Werbepsychologie betreffen sehr unterschiedliche Aspekte der Gestaltung von Medien: Wie sollte Text beschaffen sein? Erzeugen Bilder mehr Aufmerksamkeit? Wie effektiv sind Wiederholungen? Bei der Präsentation dieser Empfehlungen wäre allerdings etwas mehr Präzision und Konzentration der Erkenntnisse sinnvoll gewesen. Teilweise sind Vorschläge eher banal ("Sätze müssen kurz und klar sein und Wesentliches wiedergeben", "Bei Fernsehen und Radio kommt eine Aufmerksamkeit erregende Akustik dazu"), teilweise hinterlassen sie mehr Fragen als Antworten ("Für die Anzahl der Wiederholungen einer Werbung gibt es keine genaue Zahl. Mit zunehmender Anzahl von Wiederholungen (produkt- bzw. situationsspezifisch) werden oftmals mehr Gegenargumente zum Produkt entwickelt."), teilweise so speziell, dass sie für die Adressaten der Broschüre überflüssig sind ("Bei Werbung mit bewegten Bildern erweist sich das Mitsprechen als zusätzlich nützlich (Chanellising)." Positiv hervorzuheben ist allerdings, dass in der Zusammenfassung der Studie die auch für den Bereich Prävention und Gesundheitsförderung zentralen Aspekte noch einmal benannt werden.
Neben dieser tabellarischen Darstellung finden sich in der Studie:
• Hinweise für den Planungsprozess beim Erstellen einer Werbemaßnahme und Empfehlungen für die Gestaltung von Präventionsmedien und -kampagnen
• Empirische Ergebnisse aus Forschungsstudien, die eine Evaluation von Maßnahmen im Bereich des Arbeits- und Gesundheitsschutzes durchgeführt haben, zum Beispiel bei einer Vergleichsstudie zur Verminderung des Alkoholkonsums in vier Städten Australiens oder bei der Evaluation einer Anti-Rauch-Kampagne in der Schweiz mit Fernsehspots und Anzeigen
• Ergebnisse aus Interviews mit Werbe- und Präventionsexperten mit Fragen zu Zielen, Vorgehensweisen und Erfolgsfaktoren von Werbung einerseits und Präventionsmedien andererseits im tabellarischen Vergleich
• Konkrete Beispiele für erfolgreiche Werbemaßnahmen und Präventionsmedien
Im zusammenfassenden Fazit der Studie werden dann noch einmal speziell für Medienkampagnen im Bereich Prävention konkretere Empfehlungen gegeben, so unter anderem:
• "Speziell für den Präventionsbereich gilt, dass den Adressaten konkrete Anleitungen gegeben werden sollten, wie sie ihr Verhalten ändern können. Das ist in der Werbung meist nicht nötig."
• "Eine wesentliche Erkenntnis der vorliegenden Studie ist, dass auch Präventionsinhalte genau wie Werbeinhalte attraktiv und unterhaltsam dargestellt werden sollten, vor allem wenn Zielgruppen erreicht werden sollen, die sich nicht mit voller Aufmerksamkeit mit dem jeweiligen Präventionsthema beschäftigen."
• "Zur Erzeugung von Aufmerksamkeit gibt es noch eine Reihe weiterer Erkenntnisse, so zum Beispiel zum Einsatz von emotionalen Elementen wie Humor oder Erotik, die aus der Werbeforschung stammen und auch auf die Gestaltung von Präventionsmedien übertragen werden können."
• "Weiterhin wird deutlich, dass Präventionsthemen ebenso wie Werbung dann erfolgreich medial unterstützt werden können, wenn verschiedene Medien und Kanäle gleichzeitig und in großem Umfang genutzt werden. Beispielhaft dafür stehen vor allem die AIDS-Kampagne der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, an die sich die Adressaten am häufigsten erinnerten, oder die Kampagne zur Darmkrebs-Prävention des Burda-Verlags."
Die Broschüre ist sicherlich recht nützlich für Initiatoren von Gesundheitsförderungsmaßnahmen, die sich überlegen, wie sie ihrer geplanten Kampagne oder ihrem Programm zu mehr öffentlicher Aufmerksamkeit und Resonanz verhelfen können. Nur sehr wenig eingegangen wird in der Studie leider auf die grundlegende Fragestellung, ob Werbe- und Informationskampagnen für gesunde Ernährung oder Nikotinverzicht sich auf ähnliche Mechanismen der Verführung und Suggestion verlassen können (und dürfen), die etwa bei der TV-Werbung für Snacks oder Big Macs funktionalisiert werden. Und auch die Frage, ob eine konsequente Berücksichtigung von Erkenntnissen der Werbepsychologie dem Präventionsgedanken tatsächlich zu mehr Akzeptanz und Nachfrage verhelfen würde, wird leider nur sehr begrenzt anhand von Forschungsstudien aufgegriffen.
Die Studie ist kostenlos herunterzuladen: Marlen Hupke: Werbewirkung für die Prävention. Lassen sich Erkenntnisse zur Werbewirkung übertragen und für Präventionsmedien nutzen? iga-Report 18 (Hrsg.: BKK Bundesverband, BGAG - Institut Arbeit und Gesundheit der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, AOK-Bundesverband, Arbeiter-Ersatzkassen-Verband)
Hier sind weitere iga-Reporte der Initiative Gesundheit und Arbeit
Gerd Marstedt, 16.12.09
Ökonomie der Aufmerksamkeit: Täglich 13.000 tote Kinder und Mütter in Afrika und weltweit 6.250 Schweinegrippetote in 7 Monaten
 Während in Deutschland mit dem Tod von 16 Personen (Stand vom 13.11.2009) die Notwendigkeit des mehrere Hundert Millionen Euro schweren Schweinegrippe-Impfprogramms gerechtfertigt oder bestritten wird und der Fall des bisher einzigen Menschens, der nach Inanspruchnahme dieser Impfung mutmaßlich daran gestorben ist, wahrscheinlich erneut erbitterte Debatten über ihren Nutzen und mögliche Alternativen auslöst, sterben in anderen Ländern oder Regionen der Erde eine vielfache Anzahl von Menschen, ohne dass dies auch nur irgendjemand außerhalb dieser Regionen interessiert, aufregt oder über Gegenmaßnahmen nachdenken lässt.
Während in Deutschland mit dem Tod von 16 Personen (Stand vom 13.11.2009) die Notwendigkeit des mehrere Hundert Millionen Euro schweren Schweinegrippe-Impfprogramms gerechtfertigt oder bestritten wird und der Fall des bisher einzigen Menschens, der nach Inanspruchnahme dieser Impfung mutmaßlich daran gestorben ist, wahrscheinlich erneut erbitterte Debatten über ihren Nutzen und mögliche Alternativen auslöst, sterben in anderen Ländern oder Regionen der Erde eine vielfache Anzahl von Menschen, ohne dass dies auch nur irgendjemand außerhalb dieser Regionen interessiert, aufregt oder über Gegenmaßnahmen nachdenken lässt.
Aktuell gemeint ist die Tatsache, dass in der so genannten Sub-Sahara-Zone Afrikas jährlich 265.000 Mütter an Komplikationen während einer Schwangerschaft und einer Geburt sterben, 1.243.000 Babies innerhalb ihres ersten Lebensmonats sterben und 3.157.000 Kinder, die den ersten Lebensmonat überlebt haben, vor ihrem fünften Geburtstag sterben. Dies bedeutet, dass in dieser Region jeden Tag mehr als 13.000 Kinder und Mütter sterben - rund die Hälfte aller weltweit sterbenden Kinder und Mütter. 880.000 totgeborene Kinder wurden dabei noch nicht einmal berücksichtigt.
Nur um noch einen weiteren Einblick in die Ökonomie oder Priorisierung der Aufmerksamkeit gewinnen zu können: In der gesamten WHO-Region Afrika sind nach WHO-Angaben bis Anfang November 2009, also in ca. 7 Monaten Schweinegrippe-Pandemie, 103 Menschen an ihr gestorben.
Die aktuellen Zahlen zur Kinder- und Müttersterblichkeit im ärmsten Teil Afrikas und die Behauptung, das Leben von beinahe 4 Millionen Frauen, Neugeborenen und Kinder in dieser Region könne gerettet werden, wenn eine Reihe wissenschaftlich evidenter, erprobter und finanziell erschwinglicher Gesundheitsinterventionen 90% der Familien erreichen würden, gehören zu den wesentlichen Aussagen eines Reports, den die nationalen wissenschaftlichen Akademien von sieben afrikanischen Ländern am 9. November 2009 auf der jährlichen Konferenz der "African Science Academy Development Initiative" in Accra, Ghana, vorgestellt haben.
Zu den für wirksam gehaltenen Interventionen gehören die Erhältlichkeit von Verhütungsmitteln, gut ausgebildete GeburtshelferInnen, Belebungsprogramme für Neugeborene und insgesamt verbesserte Versorgung von Neugeborenen, ein Fallmanagement für Lungenentzündungen, die Förderung des Stillens, die Malariaprävention und die Durchführung ausgewählter Impfungen. Den enormen maximalen Wirkungsgrad dieser Interventionen berechneten die afrikanischen WissenschaftlerInnen mittels des Analyseprogramms "Lives Saved Tool (LiST)".
Die Einführung dieser Interventionen in den neun für die Berechnungen ausgewählten Ländern der Region (Ghana, Kenia, Senegal, Tansania, Uganda, Kamerun, Südafrika, Nigeria und Äthiopien) würde in zwei Jahren 2 US-$ pro Kopf der Bevölkerung kosten.
Der Bericht enthält über die Anzahl von Toten hinaus zahlreiche statistische Angaben zu den Gesundheitsverhältnissen in dieser Region der Welt, zu den dort existierenden Gesundheitssystemen und auch eine Anzahl von Beispielen für die Machbarkeit und den Erfolg derartiger Programme.
Das Aufwiegen und -rechnen von Toten ist natürlich keine wissenschaftlich und moralisch zulässige Methode. Trotzdem ist dem folgenden Satz aus einem Kommentar zum Nebeneinander der Vernachlässigung der ebenfalls für ein Sechstel der Weltbevölkerung potenziell tödlichen Unternährung und des mit Milliardenaufwand geführten Kampfes gegen die Schweinegrippe im renommierten Medizin-Journal "Lancet" vom 31. Oktober 2009 uneingeschränkt zuzustimmen: "Es ist schwierig, sich eine andere Situation vorzustellen, die gegenwärtig mehr als ein Sechstel der Weltbevölkerung beeinträchtigt. Eine, die durch reichlich vorhandene Hinweise auf negative gesundheitliche Spätfolgen gekennzeichnet ist, und die durch einfache Maßnahmen - nämlich Nahrung - behoben werden könnte, und bei der Vorbeugung elementar ist - ausreichend Nahrung muss verzehrt werden (bevorzugt unverarbeitete Kost, die vor Ort gekocht und zubereitet werden kann). Wäre die Unterernährung eine Krankheit wie H1N1, und wären unverarbeitete Lebensmittel Medikamente oder Impfstoffe, dann genössen beide die volle Aufmerksamkeit der gesamten internationalen Gemeinschaft."
Der 23 Seiten umfassende und trotz seiner Kürze sehr materialreiche Report "SCIENCE IN ACTION. Saving the lives of Africa's mothers, newborns, and children ist kostenlos erhältlich.
Den kompletten Text des Kommentars "The undernutrition epidemic: an urgent health priority" in The Lancet, Volume 374, Issue 9700, Page 1473, 31 October 2009 erhält man komplett und kostenlos nur (also nicht ärgern, dass dieser Link nicht zum kompletten Text führt), wenn man sich ebenfalls kostenlos für den Service für teilweise freien Zugang dieser Zeitschrift anmeldet. Macht man dies braucht man keine Belästigung durch Werbung etc. zu befürchten.
Bernard Braun, 14.11.09
Prävention von Übergewicht bei Kindern: Die bisherige Bilanz erkennt sehr viele Defizite
 Die Bilanz von Interventionen zur Prävention von Übergewicht und Adipositas bei Kindern und Jugendlichen fällt sehr uneinheitlich aus. Neben positiven Befunden gelungener Prävention werden viele Defizite und Mängel hervorgehoben und darüber hinaus auch Aspekte aufgezeigt (strukturelle Rahmenbedingungen wie etwa die Erhältlichkeit von Lebensmitteln), die zukünftig stärker berücksichtigt werden sollten.
Die Bilanz von Interventionen zur Prävention von Übergewicht und Adipositas bei Kindern und Jugendlichen fällt sehr uneinheitlich aus. Neben positiven Befunden gelungener Prävention werden viele Defizite und Mängel hervorgehoben und darüber hinaus auch Aspekte aufgezeigt (strukturelle Rahmenbedingungen wie etwa die Erhältlichkeit von Lebensmitteln), die zukünftig stärker berücksichtigt werden sollten.
Der bereits 2005 veröffentlichte systematische Cochrane-Review über die Ergebnisse von 22 randomisierten kontrollierten Studien mit einer Mindest-Interventionsdauer von 12 Wochen bei unter 18-jährigen Kindern und Jugendlichen aus Asien, Süd- und Nordamerika sowie Europa im Zeitraum seit 1990, präsentiert ein durchwachsenes Bild. Einer Reihe von Studien, deren unterschiedliche Interventionen wirksam die Entstehung oder die Weiterentwicklung von Übergewicht verhindern konnten, stehen andere gegenüber, in denen keinerlei präventiven Wirkungen beobachtet wurden. 10 der Studien hatten eine Mindestdauer von 12 Monaten (Langzeitstudien) und 12 eine Dauer von 12 Wochen bis 12 Monaten (Kurzzeitstudien). Das Maximum der Studiendauer lag bei 3 Jahren.
• 19 Studien umfassten Interventionen im Schul- und Vorschulbereich, eine war eine Community-Studie bei Familien mit niedrigem Einkommen und zwei Studien zielten auf nicht-übergewichtige Kinder von übergewichtigen Eltern. Die Interventions-Konzepte und die Ergebnisse variierten zwischen den folgenden Polen:
• 6 der 10 Langzeitstudien kombinierten Ernährungserziehung und körperliche Aktivitäten. Von diesen Studien zeigten 5 keine Unterschiede beim Übergewichtsstatus gegenüber den Kontrollgruppenangehörigen. In einer Studie gab es Verbesserungen, aber allein bei Mädchen.
• 2 Studien fokussierten allein auf körperliche Aktivität. Allein die Studie mit einem Multi-Media-Ansatz war aber bei der Verhinderung von Übergewicht wirksam.
• 2 andere Studien, die allein auf Ernährungserziehung fokussierten, waren beide unwirksam bei der Prävention von Übergewicht.
• 4 der 12 Kurzzeitstudien zielten allein darauf, die Niveaus der körperlichen Aktivität zu erhöhen. Zwei dieser 4 Studien führten zu geringfügigen Verringerungen des Übergewichts.
• Die restlichen 8 Kurzzeitstudien kombinierten Ratschläge zur Ernährung und körperlicher Aktivität, ohne damit irgendeinen signifikanten Effekt zu erzielen.
• Keine der Studien liefert Daten zur Kosteneffektivität der Interventionen.
Auch wenn diese Interventionen nicht wirksam bei der Prävention von Gewichtszunahmen sind, können sie wirksam bei der Förderung einer gesunden Ernährung und erhöhter körperlicher Bewegung und Aktivität sein, die ihrerseits zukünftig unerwünschte Wirkungen von Übergewicht mindern können. Der in einer früheren Arbeit der Reviewer bereits konstatierte Mangel an Langzeitstudien besteht trotz einer zwischen 2000 und 2004 erkennbaren Zunahme dieses Studientyps fort. Die Autoren zeigen aber an einem neueren Beispiel, dass derartige Studien keineswegs zwangsläufig bessere Ergebnisse zeitigen, d.h. einen höheren präventiven Nutzen der Interventionen zeigen als die kürzeren Interventionen. So zeigte auch eine umfassende multizentrische und auf viele Verhaltensaspekte gerichtete Intervention über drei Jahre trotz einer signifikanten Verbesserung des Wissens und Verhaltens der StudienteilnehmerInnen keine Veränderung ihres Gewichts.
Trotz einiger Verbesserungen bei epidemiologischen Studien fehlen weiterhin gute Interventions-Studien, welche die soziale Ungleichheit bei der Prävalenz von Übergewicht beachten. Dies gilt auch für Studien, welche so genannte "upstream factors" wie die Erhältlichkeit von Nahrungsmitteln, die Finanzierungsmöglichkeit gesünderer Lebensmittel und Bewegungsformen, sichere Spielplätze oder Partnerschaften zwischen Gemeinden und Schulen berücksichtigen. So bleibt den Reviewern nur ein nachdenkliches Fazit übrig: "Diese Bilanz zeigt eine paradoxe Situation. Zu einer Zeit, in der die Prävention von Übergewicht als vorrangige Aufgabe von Public Health genannt wird, gibt es nur eine sehr begrenzte Zahl von Studien, deren Ergebnisse überprüfbar wären."
Wodurch die unbefriedigend paradoxe Erkenntnislage und damit auch eine gewisse praktische Lähmung möglicherweise überwunden werden könnte, fassen sie so zusammen: "Wir empfehlen, dass Betroffene (Familien, Schulen usw.) in die Entscheidungen darüber einbezogen werden, welche Maßnahmen und Strategien gewählt werden sollen. Eine Maßnahme, die bessere Umgebungsbedingungen und Verhaltensänderungen im Bereich körperlicher Bewegung, dauerhaftes Sitzen und Ernährung bewirken soll, sollte auch größere Effekte bewirken als die in dieser Bilanz erfassten Interventionen - zumindest sollte die Wahrscheinlichkeit dafür größer sein."
Kostenlos erhält man von diesem Review eine dreiseitige Zusammenfassung: Summerbell CD, Waters E., Edmunds LD, Kelly S, Brown T., Campbell KJ: Interventions for preventing obesity in children (The Cochrane Library 2009, Issue 2. 71 Seiten)
Bernard Braun, 31.8.09
Programme für Jugendliche zur Sexualerziehung zeigen in England sehr unerwünschte Effekte
 Die englische Boulevard-Presse war im Juli 2009 voller Häme: "Effekt eines 6 Millionen Pfund teuren Programms gegen Schwangerschaften bei Teenagern: Doppelt so viele Schwangerschaften!" (6 million pounds drive to cut teen pregnancies sees them DOUBLE") Tatsächlich hatte die wissenschaftliche Evaluation eines groß angelegten Programms zur Jugendarbeit in problematischen Stadtteilen mit benachteiligten Jungen und Mädchen ergeben, dass die angestrebten Ziele (etwa im Umgang mit Alkohol und Drogen) gar nicht erreicht wurden, wenn man Vergleiche mit Kontrollgruppen anstellte. Oder, noch schlimmer: In den Interventionsgruppen, in denen auch ein verantwortungsbewusstes Sexualverhalten vermittelt werden sollte, zeigten sich 18 Monate nach Beginn deutlich höhere Quoten für sehr frühe Sexualkontakte und Teenager -Schwangerschaften.
Die englische Boulevard-Presse war im Juli 2009 voller Häme: "Effekt eines 6 Millionen Pfund teuren Programms gegen Schwangerschaften bei Teenagern: Doppelt so viele Schwangerschaften!" (6 million pounds drive to cut teen pregnancies sees them DOUBLE") Tatsächlich hatte die wissenschaftliche Evaluation eines groß angelegten Programms zur Jugendarbeit in problematischen Stadtteilen mit benachteiligten Jungen und Mädchen ergeben, dass die angestrebten Ziele (etwa im Umgang mit Alkohol und Drogen) gar nicht erreicht wurden, wenn man Vergleiche mit Kontrollgruppen anstellte. Oder, noch schlimmer: In den Interventionsgruppen, in denen auch ein verantwortungsbewusstes Sexualverhalten vermittelt werden sollte, zeigten sich 18 Monate nach Beginn deutlich höhere Quoten für sehr frühe Sexualkontakte und Teenager -Schwangerschaften.
Das "Young People's Development Programme (YPDP)" verfolgt in England sehr ambitionierte Ziele: Männliche und weibliche Jugendliche im Alter von 13-15 Jahren aus problematischen Stadtteilen (mit hohen Arbeitslosen- und Ausländeranteilen) sollen in ihrer Freizeit durch Teilnahme an Veranstaltungen und Schulungen gesellschaftlich stärker integriert werden. Die Liste der Erziehungs-Ziele ist lang: Eine verantwortungsbewusstes Sexualverhalten (mit weniger ungewollten Schwangerschaften, weniger Geschlechtskrankheiten), ein geringerer Alkohol- und Drogenkonsum, eine bessere psychische Gesundheit und ein gestärktes Selbstwertgefühl, weniger Schulverweise, selteneres Schulschwänzen, weniger Kriminalität und Gewalt, bessere Fertigkeiten zur Bewerbung auf Arbeits- oder Lehrstellen sind nur einige der erhofften Veränderungen.
Zur Teilnahme gewonnen wurden die Jungen und Mädchen über Multiplikatoren, die man in den Stadtteilen ansprach: Lehrer in Schulen, Sozialarbeiter und Sozialpädagogen, Übungsleiter in Sportvereinen. Gesagt wurde den Multiplikatoren, man suche verhaltensauffällige Jugendliche "at risk", also mit hohem Risiko für Gewalttaten oder Problemlagen. Versprochen wurden diesen dann spannende Freizeitaktivitäten, aber auch eine Vermittlung von Kenntnissen und Fertigkeiten , die ihnen später helfen würden, eine Lehr- oder Arbeitsstelle zu bekommen. In etwa 6-10 Stunden pro Woche sollten sie trainieren, wie man sich bewirbt, eine Gesundheits- und Sexualerziehung erhalten, aber auch Kunstunterricht und Sport.
Insgesamt 54 kommunale Projekte mit etwa 2.700 Teilnehmern, in denen das YPDP umgesetzt wurde, waren jetzt Gegenstand einer wissenschaftlichen Evaluation, in der die angestrebten mit den tatsächlich erreichten Zielen verglichen wurde. In diese Evaluation einbezogen waren auch Kontrollgruppen Jugendlicher, die nicht an dem Programm teilgenommen hatten.
Das Ergebnis der Evaluation war mehr als ernüchternd:
• Im Vergleich von Interventions- und Kontrollgruppen zeigten sich keinerlei Unterschiede, was den Alkohol- und Drogenkonsum anbetraf, Kontakte mit der Polizei oder Schulverweise. Auch hinsichtlich des Gebrauchs von Kondomen bei Sexualkontakten waren die Jugend-Maßnahmen erfolglos.
• Für einige Indikatoren zeigten sich dann aber sogar Ergebnisse, die die pädagogischen Absichten auf den Kopf stellten. In der Interventionsgruppe berichteten nach 18 Monaten 16% der Mädchen über eine Schwangerschaft (Kontrollgruppe: 6%), sehr frühe sexuelle Erfahrungen mit Jungen hatten 58% (Kontrollgruppe 33%) und 34% gaben an, dass sie in Kürze Mutter werden würden (Kontrollgruppe 24%).
Die Wissenschaftler erklären sich diese in pädagogischer Hinsicht katastrophalen Befunde unter anderem durch die Gruppenbildung. In den Projekten waren teilweise auch einige Jugendliche mit überaus promiskuitiven Einstellungen und sexuell freizügigen Verhaltensweisen vertreten. Deren Verhaltensweisen und Orientierungen wurden von anderen Jugendlichen dann übernommen und kopiert. Dieser aus peer-groups durchaus bekannte Mechanismus konnte auch durch den Unterricht zur Sexualkunde nicht gebremst werden.
Meg Wiggins et al: Health outcomes of youth development programme in England: prospective matched comparison study, British Medical Journal (BMJ) 2009;339:b2534, doi:10.1136/bmj.b2534)
• PDF-Datei des BMJ-Artikels
• HTML-Seite im BMJ
• Beschreibung des "Young People's Development Programme (YPDP)" und detaillierte Evaluation (PDF, 114 Seiten): Meg Wiggins et al:Young People's Development Programme evaluation - Final report Social Science Research Unit, Institute of Education, University of London with the London School of Hygiene and Tropical Medicine
Gerd Marstedt, 23.8.09
Adhärenz bei Drogenabhängigen - und es geht doch
 NutzerInnen illegaler Drogen gelten gemeinhin als schwieriges Klientel, auch in der medizinischen Versorgung. Seit 20 Jahren unterstützt ein interdisziplinäres Team aus Pflegenden, Ärzten, Zahnärzten, Zahnarzthelfern und Sozialarbeitern in Berlin-Kreuzberg intravenös applizierende Drogenkonsumenten mit einem speziell auf diese Zielgruppe zugeschnittenen niedrigschwelligen, aufsuchenden und Sucht begleitenden Angebot. Nun erfuhr das Gesundheitsteam des eingetragenen Verein Fixpunkt e.V. eine besondere Auszeichnung für die langjährige, teilweise mühevolle Arbeit mit chronisch Drogenkranken und erhielt den mit 10.000 Euro dotierten Ehrenpreis des Berliner Gesundheitspreises.
NutzerInnen illegaler Drogen gelten gemeinhin als schwieriges Klientel, auch in der medizinischen Versorgung. Seit 20 Jahren unterstützt ein interdisziplinäres Team aus Pflegenden, Ärzten, Zahnärzten, Zahnarzthelfern und Sozialarbeitern in Berlin-Kreuzberg intravenös applizierende Drogenkonsumenten mit einem speziell auf diese Zielgruppe zugeschnittenen niedrigschwelligen, aufsuchenden und Sucht begleitenden Angebot. Nun erfuhr das Gesundheitsteam des eingetragenen Verein Fixpunkt e.V. eine besondere Auszeichnung für die langjährige, teilweise mühevolle Arbeit mit chronisch Drogenkranken und erhielt den mit 10.000 Euro dotierten Ehrenpreis des Berliner Gesundheitspreises.
Der vom AOK-Bundesverband und der Berliner Ärztekammer gemeinsam ausgelobte Berliner Gesundheitspreis 2008 stand unter dem Motto "Gesagt ist nicht getan" und widmete sich dem Thema der Adherence. Nach der Formulierung des AOK-Bundesverbandes beschreibt Adhärenz das Maß der Übereinstimmung des Patientenverhaltens der mit den gemeinsam mit Arzt oder Ärztin beschlossenen Behandlungszielen. Der Begriff Adherence trägt dem veränderten Rollenverständnis zwischen A(e)rztIn und PatientIn Rechnung, indem er eine partnerschaftliche Verständigung über Art und Umfang der Therapie voraussetzt und den PatientInnen eine aktive und eigenverantwortliche Rolle in der Therapie zubilligt. Der Begriff ersetzt zunehmend den herkömmlichen Ansatz der Compliance, dem eine asymmetrische Arzt-Patienten-Beziehung zugrunde liegt.
Der Arbeitsansatz des Fixpunkt-Gesundheitsmobils basiert auf den Prinzipien der Suchtakzeptanz und Hilfe zur Selbsthilfe, Gesundheitsförderung und Stärkung des Gesundheitsbewusstseins der Konsumenten illegaler Drogen stehen in den Mittelpunkt. Seit 2007 erfolgt im Rahmen eines niedrigschwelligen Angebots für intravenös applizierende Drogengebraucher in Berlin die Behandlung chronischer Wunden mit Methoden des "modernen Wundmanagement" nach ICW an (Initiative chronische Wunden). Chronisch-venöse Hautveränderungen spielen nämlich bei Langzeitgebrauchern illegaler Drogen eine zunehmende Rolle. Biomedizinische und psychosoziale Besonderheiten dieser Gruppe erschweren die angemessene Behandlung chronischer Wunden und erfordern einen speziellen Therapieansatz.
Primäre Zielgruppe dieses neuartigen Therapieangebots sind Drogenabhängige mit chronischen Hautulcera, die mindestens 10-mal in einem Jahr zur Behandlung kommen. Dieses neue, patientenorientierte Verfahren, das aufgrund begrenzter Ressourcen nur ausgewählten Patienten zur Verfügung steht, ergänzt oder ersetzt bisherige Therapieansätze. Nach Einführung des Wundmanagement nach ICW zeigte sich ein signifikanter Zuwachs der medizinischen Kontakte drogenabhängiger Patienten aufgrund von chronischen Hautgeschwüren. Insgesamt stiegen die Behandlungszahl chronischer Ulcera seit Einführung des Wundmanagement um über 60 Prozent gegenüber den Durchschnittswerten der vorangegangenen vier Jahre und ihr Anteil an den Behandlungen insgesamt um 38 Prozent. Die verbesserte Adherence bei Anwendung des Wundmanagement nach ICW ermöglicht bei dieser speziellen Patientengruppe die wirksame Prophylaxe von Superinfektionen und anderen Komplikationen sowie insgesamt eine verbesserte Heilungstendenz bei chronischen Wunden.
Adherence ist eine wichtige Voraussetzung, um Patienten in speziellen gesundheitlichen und sozialen Bedingungen eine langwierige und belastende Behandlung zu ermöglichen. Angepasstes Wundmanagement nach ICW verbessert bei der Behandlung chronischer Wunden intravenös applizierender Drogengebraucher die Adherence und damit die Voraussetzungen für einen Therapieerfolg. Auch wenn der ursächliche Zusammenhang zwischen neuartigen Wundauflagen und Behandlungsergebnis bisher unbewiesen ist, zeigt sich vermutlich aufgrund begleitender Maßnahmen eine Überlegenheit dieses Behandlungskonzepts bei der speziellen Zielgruppe Drogenabhängiger. Auf der Website des AOK-Bundesverbandes findet sich eine kurze Darstellung der Arbeit von Fixpunkt e.V.. Die G+G-Sonderausgabe zum Thema Gesagt ist nicht getan - Adherence Arzt und Patient in gemeinsamer Verantwortung stellt neben den beiden Hauptpreisträgern auch die Gesundheitsarbeit von Fixpunkt vor.
So weit, so gut. Neben der allgemeinen Anerkennung für die Arbeit des Gesundheitsteam von Fixpunkt e.V. brachte die Verleihung des Berliner Gesundheitspreises 2008 aber auch etwas ganz anderes zum Vorschein. Offenbar ist die Geschäftsleitung des mittlerweile auf über 30 MitarbeiterInnen angewachsenen Vereins weder mit grundlegenden Fragen des Personalmanagements vertraut noch den Anforderungen an die Personalführung bei einer solchen Zahl von Beschäftigten gewachsen. Der Vereinsvorstand, teilweise durch enge verwandtschaftliche Beziehungen zur Geschäftsführung befangen, erweist sich als uninformiert über die Auswirkungen der verfehlten Personalführung auf das Versorgungsangebot und als nachhaltig unfähig, seiner Verantwortlichkeit sowohl für den Verein als auch für dessen MitarbeiterInnen nachzukommen und Schaden von dem Verein abzuwenden. So fördert er den Druck der Geschäftsführung auf einzelne MitarbeiterInnen, sich in der Gehaltsgruppe zurückstufen zu lassen, deckt das unverhohlen Mobbing gegenüber solchen Angestellten, die sich dagegen zur Wehr setzen, und deckt das autoritäre Gebaren der Geschäftsführung.
Außenstehende bekommen unweigerlich den Eindruck, bei Fixpunkt herrschten Arbeitsverhältnisse wie bei Lidl. In der Tat empfinden etliche Mitarbeiter die Arbeitsbedingungen als bedrückend, Maßnahmen der Geschäftsführung als willkürlich und die Beschäftigungssituation bei Fixpunkt e.V. als demotivierend. Mobbing, Willkür und fehlende Transparenz und Partizipationsfähigkeit führen zunehmend zum Abwandern langjähriger, verdienter MitarbeiterInnen. Geäußerte Kritik hat nur dazu geführt, dass die Beschäftigten einen Maulkorb umgehängt bekommen und ihnen bei Zuwiderhandlung Abmahnung oder gar Entlassung drohen. Die Folgen einer derart unprofessionellen Personalpolitik erscheinen geeignet, eine wichtige Selbstverpflichtung von Fixpunkt e.V. in Frage zu stellen, nämlich die Aussage "Wir arbeiten verbindlich, kontinuierlich und kompetent", die ebenso im Leitbild des Vereins nachzulesen ist wie der Satz: "Wir pflegen Strukturen, die für jedeN MitarbeiterIn persönliche Entfaltungsmöglichkeiten schaffen", gegen den Vorstand wie Geschäftsführung ganz offensichtlich verstoßen. Auch die Aussage "Wir entwickeln und realisieren effektiv, zuverlässig und wirtschaftlich Angebote zur Verbesserung der Lebenssituation und der gesundheitlichen Situation von Konsumenten illegaler Drogen" (Hervorhebung Forum Gesundheitspolitik) bedarf sicherlich unter den aktuellen Umständen einer angemessenen Überprüfung.
Deren menschenverachtendes Verhalten, die völlige Kritikunfähigkeit und die Weigerung, den unhaltbaren Zuständen mit professioneller Hilfe zu begegnen, haben mittlerweile dazu geführt, dass ein ärztlicher Mitarbeiter wegen fristloser Kündigung die Arbeit auf dem Gesundheitsmobil einstellen musste und drei ÄrztInnen ihre Mitarbeit aufgekündigt haben. Deswegen und in Folge zusätzlicher, teilweise längerer Krankheitsausfälle des Pflegepersonals konnte Fixpunkt e.V. phasenweise eine Grundvoraussetzung für Adhärenz, nämlich die Kontinuität des Versorgungsangebots, nicht oder nur mit fachlich nicht adäquat vorbereitetem Personal aufrechterhalten. So fordert beispielsweise das britische Royal College of Nursing nicht nur eine regelmäßige Begutachtung der Wunden und ihrer Entwicklung, sondern empfiehlt auch, diese Kontrollen möglichst in der Hand eines hinreichend qualifizierten Behandlers zu belassen. Doch die unprofessionelle Personalpolitik von Fixpunkt e.V. hat erstens in der Wundbehandlung sehr erfahrene Experten herausgedrängt bzw. durch MitarbeiterInnen ohne gleichwertige Qualifikation ersetzt und zweitens das zuverlässige Aufrechterhalten der kontinuierlichen medizinischen Versorgung phasenweise unmöglich gemacht. Im ersten Halbjahr 2009 hat die soeben ausgezeichnete besondere Arbeit des Fixpunkt-Gesundheitsteams schweren Schaden genommen und die Träger des Vereins billigend eventuelle Befundverschlechterungen und Gefährdungen der PatientInnen in Kauf genommen. Das lässt sich aus den ausführlichen Guidelines des Royal College of Nursing ableiten, die hier kostenlos zum Download zur Verfügung stehen: The nursing management of patients with venous leg ulcers.
Auch die Träger des Berliner Gesundheitspreises 2008 weigerten sich, diese Problematik angemessen zur Kenntnis zu nehmen, obwohl die AOK erneut in Ausgabe 03 ihres Medienservices vom 12.6.2009 in dem Beitrag Krankheit durch Stress am Arbeitsplatz muss nicht sein ausdrücklich auf die krankmachenden Effekte von Distress und Kommunikationsproblemen m Arbeitsplatz hinweist. So erfolgte die Preisverleihung trotz der unübersehbaren Schwierigkeiten und die Berichterstattung in der entsprechenden Presseerklärung ließ diese Problematik unerwähnt. Auch die übrige mediale Berichterstattung stand eher im Zeichen von Friede, Freude und Eierkuchen denn im Dienste einer angemessenen Aufklärung der Öffentlichkeit. So berichtete der Berliner Tagesspiegel am 21.4.2009 anlässlich der Preisverleihung in dem Artikel Drogenbus am Kotti bekommt Gesundheitspreis über die Arbeit des Gesundheitsmobil vor Ort. Die grundlegenden Probleme in dem Verein und bei der Nachhaltigkeit des Angebots fanden in dem Beitrag Wunder Punkt ebenfalls keine Erwähnung.
Hier können die LeserInnen des Forum Gesundheitspolitik exklusiv die Präsentation als Volltext heruterladen, mit der sich das Team des Fixpunkt-Gesundheitsmobils erfolgreich um den Berliner Gesundheitspreis 2008 bewarb: Behandlung intravenös injizierender Drogengebraucher mit chronischen Wunden im Rahmen eines niedrigschwelligen Angebots nach Leitlinien des modernen Wundmanagements gemäß ICW.
Jens Holst, 17.6.09
Cochrane-Review von 34 Studien zeigt, dass Gewaltpräventionsprogramme an Schulen wirksam sind
 Egal, ob Schulen wegen der an ihnen vorherrschenden Gewalttätigkeiten zu "no-go-aereas" werden, ob in einigen Landtagswahlkämpfen der letzten Jahre Gewalttaten von ausländischen Jugendlichen thematisiert werden: Nach jeder öffentlichen Gewalttat von Jugendlichen oder jungen Erwachsenen kommt rasch die Frage auf, ob und wie derartige Ereignisse jenseits des Strafrechts vermieden werden können und ebenso schnell werden sekundärpräventive Gewaltpräventionsprojekte in Schulen als Patentrezept entdeckt.
Egal, ob Schulen wegen der an ihnen vorherrschenden Gewalttätigkeiten zu "no-go-aereas" werden, ob in einigen Landtagswahlkämpfen der letzten Jahre Gewalttaten von ausländischen Jugendlichen thematisiert werden: Nach jeder öffentlichen Gewalttat von Jugendlichen oder jungen Erwachsenen kommt rasch die Frage auf, ob und wie derartige Ereignisse jenseits des Strafrechts vermieden werden können und ebenso schnell werden sekundärpräventive Gewaltpräventionsprojekte in Schulen als Patentrezept entdeckt.
Solche Programme existieren seit über 20 Jahren an einer Reihe von Schulen und gehen von der Annahme aus, dass frühes aggressives Verhalten von Kindern ein Risiko für spätere Gewaltttätigkeiten und kriminelles Verhalten ist. Ob und wie die unterschiedlichen Ansätze aber dazu geeignet sind, gewalttätiges Verhalten wirksam und auf Dauer zu verhindern, war lange Zeit nicht eindeutig geklärt.
Ein 2006 veröffentlichter "Cochrane Review" über 56 randomisierte und vor allem kontrollierte Studien über die Wirksamkeit von Gewaltpräventionsprogrammen an meist us-amerikanischen Pflichtschulen verringerte diese Unklarheiten erheblich. Die Wirksamkeit wurde unmittelbar nach der präventiven Intervention und in einigen Studien auch noch zusätzlich nach 12 Monate gemessen. Dabei wurde die Wirkung unterschiedlicher Präventionsprogramme gegen Schulen ohne Intervention und einige Schulen mit Placebointerventionen gemessen. Dies erfolgte durch mehrere standardisierte Tests und unter Zuhilfenahme von Schuldokumenten über Gewalttätigkeiten. Studien, in denen allgemeine Verhaltensprobleme von Kindern und Jugendlichen beeinflusst werden sollten oder positive Verhaltensweisen trainiert wurden, waren ausgeschlossen.
• In 34 Studien mit 2.939 SchülerInnen konnte aggressives Verhalten in der Interventionsgruppe unmittelbar nach der Intervention signifikant reduziert werden (standardisierte Mittelwertunterschiede [standardised Mean Difference=SMD] = -0,41).
• Dieser Unterschied blieb auch in den 7 Studien erhalten, die den Effekt der Wirksamkeit auf aggressives Verhalten ein weiteres Mal 12 Monate nach der Intervention erhoben hatten (SMD = -0,40).
• Die Erfolge der Interventionen lassen sich auch daran bemessen, dass die Häufigkeit von Disziplinarmaßnahmen der Schule oder der Schulbehörden wegen aggressiven Verhaltens von Schülern nach den 9 Studien, die dazu Daten liefern, in den Interventionsschulen deutlich (SMD = -0,48) reduziert werden konnte. Das Gewicht dieser Effekte wird nur dadurch etwas gemindert, dass 2 dieser Studien lediglich Follow-ups nach zwei bis vier Monaten durchführten.
Weitere differenzierte Analysen in Untergruppen zeigten auch programmbezogene Unterschiede der messbaren Wirksamkeit. Die Reviewer heben hervor, dass Interventionen, die darauf abzielen, die Beziehungsfähigkeit oder die sozialen Fähigkeiten ("social skills") zu verbessern, wirksamer sein können als Maßnahmen, die den Schülern beizubringen versuchen, nicht auf Provokationen von Mitschülern oder Umständen zu antworten. So betrug der SMD-Wert in Programmen, die sich allein um die Beziehungsfähigkeit und soziale Fähigkeiten bemühten -0,61, der von Programmen mit dem Fokus auf Fähigkeiten, sich nicht zu Gewalttätigkeiten provozieren zu lassen -0,39.
Die reviewten Studien zeigten schließlich keine Wirksamkeitsunterschiede zwischen den Schulformen und damit auch den biographischen Interventionszeitpunkten: Der nachweisbare Nutzen der Interventionen war ähnlich, unabhängig davon, ob sie in Primar- oder Sekundarschulen erbracht wurden. Keinen Unterschied beim Nutzen gibt es auch zwischen koedukativen und reinen Jungenklassen.
Nach Ansicht der Wissenschaftler muss die in diesem Review u.a. wegen des Mangels an Studien ausgeklammerte Inzidenz von gewaltbedingten Verletzungen und die Wirksamkeit der Interventionen nach mehr als 12 Monaten noch untersucht werden.
Von dem 77 Seiten umfassenden Cochrane Review ist kostenlos ein umfangreiches Abstract zugänglich: Mytton J., DiGuiseppi C., Gough D., Taylor R., Logan S.: School-based secondary prevention programmes for preventing violence (2007 online publiziert im Cochrane Review Journal "Evidence-Based Child Health" 2: 814-891)
Bernard Braun, 24.4.09
Verbesserung von Prävention wirkt sich stärker auf Lebenserwartung aus als erhöhte Ausgaben für medizinische Versorgung
 Angesichts der weltweit geführten Debatten über die Finanzierbarkeit oder die Wirtschaftlichkeit einer wirksamen gesundheitlichen Versorgung durchleuchten nationale und international vergleichende Studien vermehrt die Rolle der medizinischen Versorgung bei einer Verbesserung des Gesundheitszustands von Bevölkerungen. Dabei untersuchen sie auch die mögliche Bedeutung anderer gesundheitsbezogener Interventionen und fragen, ob der Nutzen von Medizin und anderen Faktoren in allen Ländern gleich ist oder gravierende Unterschiede zu beobachten sind. Die aktuellste empirische Analyse zu diesen Themen legte nun die OECD im August 2008 für 30 ihrer Mitgliedsländer, darunter auch Deutschland vor und stützt sich dabei hauptsächlich auf die von ihr jährlich aktualisierte "OECD-Health Data"-Sammlung.
Angesichts der weltweit geführten Debatten über die Finanzierbarkeit oder die Wirtschaftlichkeit einer wirksamen gesundheitlichen Versorgung durchleuchten nationale und international vergleichende Studien vermehrt die Rolle der medizinischen Versorgung bei einer Verbesserung des Gesundheitszustands von Bevölkerungen. Dabei untersuchen sie auch die mögliche Bedeutung anderer gesundheitsbezogener Interventionen und fragen, ob der Nutzen von Medizin und anderen Faktoren in allen Ländern gleich ist oder gravierende Unterschiede zu beobachten sind. Die aktuellste empirische Analyse zu diesen Themen legte nun die OECD im August 2008 für 30 ihrer Mitgliedsländer, darunter auch Deutschland vor und stützt sich dabei hauptsächlich auf die von ihr jährlich aktualisierte "OECD-Health Data"-Sammlung.
Die wichtigsten methodischen und inhaltlichen Erkenntnisse lauteten:
• Auch wenn Sterblichkeitsindikatoren keine optimalen Indikatoren für den Gesundheitszustand einer Bevölkerung sind, stellen sie (vor allem Kindersterblichkeit oder auch die Lebenserwartung zu bestimmten Lebenszeitpunkten) speziell für international vergleichende Studien die besten verfügbaren Kennziffern dar.
• Ausgaben für die gesundheitliche Versorgung spielen eine wichtige Rolle bei der Erklärung von Veränderungen des Gesundheitszustandes im Zeitverlauf und zwischen verschiedenen Ländern. Die OECD-weit zwischen 1991 und 2003 um 50 % zugenommenen Pro-Kopfausgaben für Gesundheitsversorgung trugen zu einer Verlängerung der Lebenserwartung bei Geburt um 1,25 Jahre bei.
• Das Ergebnis zweier statistischer Analysen der Gesundheitsdaten, einer Panelregression und der speziell für solche Analysen geeigneten "Data Envelopement Analysis (DEA)", lautet, dass ein und dasselbe Volumen an Gesundheitsausgaben nicht in jedem Land zum selben Ergebnis führt. Wie die Verbesserung des Gesundheitszustandes in einigen Ländern zeigt, ist dies auch ohne zusätzliche Ausgaben oder vergleichbare Inputs möglich.
• Allein die potenziellen Zugewinne an Effizienz durch Veränderungen des sozialökonomischen und kulturellen Umfeldes und des Lebensstiles sind danach groß genug, um die Lebenserwartung in allen OECD-Ländern bei Geburt um beinahe 3 Jahre zu verlängern. Eine Erhöhung der gesamten Gesundheitsausgaben um 10 % würde die Lebenserwartung bei Geburt dagegen um drei bis vier Monate verlängern. Allein eine Zunahme der Anzahl von Allgemeinärzten würde dazu mit 2 Monaten beitragen.
• Seit den frühen 1990er Jahren nahm die Lebenserwartung ab Geburt in allen OECD-Ländern um 2,5 Jahre für Frauen und 3,5 Jahre für Männer zu. 1,25 Jahre davon beruhen auf den im selben Zeitraum erheblich angewachsenen Gesundheitsausgaben: Zunahme der Pro-Kopfausgaben für Gesundheit + 50%. Der größere Teil der gewonnenen Lebensjahre, also zwischen 55% und 61% des Gesamtgewinns an Lebenszeit für Frauen oder Männer, beruht auf verhaltensbezogenen Veränderungen wie der Reduktion des Tabak- und Alkoholkonsums sowie der Gewichtsreduktion und verhältnisbezogenen Veränderungen wie beispielsweise einer Reduktion der Luftverschmutzung, einer höheren Bildung und des Wachstums der Wirtschaftsleistung. Dieses Grundmuster zeigt sich auch, wenn man die Determinanten der weiteren Lebenserwartung im Alter von 65 Jahren betrachtet.
Auch wenn man manchen von der OECD und anderen internationalen Institutionen erhobenen Daten und den damit erstellten Vergleichen im Detail inhaltlich wie methodisch distanziert gegenüber steht, ändert sich dadurch nichts an den Grundproportionen der hier vorgestellten Ergebnisse.
Einzelheiten zur Methodik und weitere Ergebnisse für die hier untersuchten OECD-Länder finden sich in dem kostenlos erhältlichen 74-Seitenreport Health Status Determinants: Lifestyle, Environment, Health Care Resources and Efficiency (OECD Economics Department Working. Papers, No. 627) von Isabelle Joumard, Christophe Andrť, Chantal Nicq, Olivier Chatal Joumard, I. et al. aus dem Jahr 2008)
Bernard Braun, 24.2.09
750 Dollar Prämie für Raucher, die ihr Laster aufgeben: Geldanreize für Nikotinverzicht zeigen in einer US-Studie Wirkung
 Die Bestrafung eines ungesunden Lebensstils wurde schon vor langer Zeit propagiert: "Raucherpfennig" für Nikotinsünder, "Speck-Steuer" für Adipöse waren (erfolglose) Vorschläge aus den 90er Jahren. Der umgekehrte Weg, nämlich finanzielle Belohnungen zu verteilen für die Veränderung eines gesundheitsriskanten Alltagsverhaltens, wurde seltener begangen. In einer US-amerikanischen Studie, die jetzt in der renommierten Fachzeitschrift "New England Journal of Medicine" veröffentlicht wurde, zeigte sich: Mitarbeiter eines US-Konzerns, denen eine nicht unerhebliche finanzielle Prämie in Aussicht gestellt wurde, falls sie das Rauchen aufgeben würden, schafften den Ausstieg erheblich öfter und waren auch nach 9 oder 12 Monaten öfter abstinent als andere Mitarbeiter ohne solchen Anreiz.
Die Bestrafung eines ungesunden Lebensstils wurde schon vor langer Zeit propagiert: "Raucherpfennig" für Nikotinsünder, "Speck-Steuer" für Adipöse waren (erfolglose) Vorschläge aus den 90er Jahren. Der umgekehrte Weg, nämlich finanzielle Belohnungen zu verteilen für die Veränderung eines gesundheitsriskanten Alltagsverhaltens, wurde seltener begangen. In einer US-amerikanischen Studie, die jetzt in der renommierten Fachzeitschrift "New England Journal of Medicine" veröffentlicht wurde, zeigte sich: Mitarbeiter eines US-Konzerns, denen eine nicht unerhebliche finanzielle Prämie in Aussicht gestellt wurde, falls sie das Rauchen aufgeben würden, schafften den Ausstieg erheblich öfter und waren auch nach 9 oder 12 Monaten öfter abstinent als andere Mitarbeiter ohne solchen Anreiz.
Prof. Kevin Volpp, Leiter des "gesundheitsökonomischen Zentrums für gesundheitliche Anreize" (Leonard Davis Institute, Health Economics Center for Health Incentives) an der University of Pennsylvania hatte vor kurzem bereits untersucht, ob man übergewichtige und adipöse Bürger mit Geldanreizen mehr als bislang dazu bewegen kann, etwas gegen ihre Leibesfülle zu unternehmen, sei es durch eine andere Ernährung, sei es durch mehr Sport und Bewegung. Die Studie zeigte allerdings zeitlich nur sehr begrenzte Erfolge für derlei Maßnahmen. (vgl. Dollar gegen Pfunde)
In einer neuen Studie, die sich jetzt nicht mehr der Problematik "Übergewicht" widmete, sondern stattdessen das Gesundheitsrisiko "Rauchen" aufs Korn nahm, hatte Prof. Volpp mehr Erfolg. 878 Mitarbeiter eines US-Konzern, allesamt Raucher und allesamt zumindest gedanklich an einem Nikotinverzicht interessiert, wurden für die Mitarbeit an der Studie gewonnen. Nach dem Zufallsprinzip wurden sie einer von zwei Gruppen zugeteilt: In einer Kontrollgruppe erhielten sie Informationen über Risiken des Rauchens und Vorteile eines Rauchverzichts sowie bei Interesse auch kostenlos ein Medikament, um Entzugserscheinungen zu dämpfen. In der Interventionsgruppe wurden den Teilnehmern darüber hinaus finanzielle Prämien zugesagt: Zunächst 100 Dollar für die Teilnahme an einer medizinischen Studie, 250 Dollar, falls sie nach 6 Monaten vollkommen nikotinabstinent waren und weitere 400 Dollar, falls dies auch 9 oder 12 Monate nach Teilnahmebeginn noch der Fall war. Der Nikotinverzicht wurde dabei durch einen Bluttest überprüft.
Es zeigte sich dann bei der Auswertung der Daten:
• Die Interventionsgruppe (mit Prämien) war durchweg erfolgreicher, allerdings sank hier ebenso wie in der Kontrollgruppe der Anteil erfolgreicher Ex-Raucher kontinuierlich, von 21% (nach 6 Monaten) auf 15% (nach 9-12 Monaten) und dann auf 9% (nach 15-18 Monaten).
• Nach 9 bzw. 12 Monaten gab es dreimal so viele Nichtraucher in der Gruppe mit finanziellen Prämien im Vergleich zur Kontrollgruppe (14,7% bzw. 5,0%)
• Auch noch nach 15 bzw. 18 Monaten war dieser Unterschied feststellbar (9,4% bzw. 3,6%).
In multivariaten Analysen wurde auch geprüft, ob noch andere Faktoren für dieses Ergebnis maßgeblich sein könnten. In diese Analyse einbezogen waren unter anderem Gesundheitszustand, Geschlecht, Alter, Bildungsniveau, Einkommen, Rasse, Anzahl gerauchter Zigaretten. Es zeigte sich dann, dass die Zugehörigkeit zur Interventionsgruppe mit finanziellen Prämien der stärkste Einflussfaktor war. Nicht ganz unerheblich war allerdings auch das Einkommen: Teilnehmer mit einem mittleren Einkommensniveau waren sehr viel weniger erfolgreich als andere mit sehr hohem oder sehr niedrigem Einkommen.
Dass eine Cochrane-Studie aus dem Jahr 2005 (Cahill K., Perera R.: Competitions and incentives for smoking cessation) keine Evidenz gefunden hatte für die Wirksamkeit finanzieller Anreize, erklären die Forscher daraus, dass erstmals in ihrer Studie eine wirklich nennenswerte finanzielle Prämie geboten wurde.
Hier ist ein Abstract der Studie: Volpp, Kevin G. u.a.: A Randomized, Controlled Trial of Financial Incentives for Smoking Cessation(New England Journal Medicinek, Volume 360, Number 7, pp 699-709, February 12, 2009)
Gerd Marstedt, 13.2.09
Verbot der Fernsehwerbung von Fastfood-Restaurants würde die Verbreitung von Übergewicht bei Kindern senken
 Der Anteil übergewichtiger Kinder und Jugendlicher hat sich in den USA in den letzten Jahrzehnten verdreifacht und vermutlich sind die USA auch eines der führenden Länder, was den Fernsehkonsum jüngerer Generationen anbetrifft. Dass es einen Zusammenhang zwischen Fernsehen als Freizeitbeschäftigung und Körpergewicht gibt, ist augenscheinlich: Wer viel fernsieht, hat zwangsläufig weniger körperliche Bewegung. Es gibt indes auch noch einen anderen Mechanismus, dem jetzt ein US-amerikanisches Forschungsteam nachgegangen ist. Kinder und Jugendliche, die viel fernsehen, so ihre durch Datenanalysen später auch bestätigte Hypothese, sehen auch mehr TV-Werbespots von Fastfood-Restaurants, gehen dort häufiger (sehr kalorienreich) essen und haben dann öfter auch einen Body Mass Index (BMI), der über dem Normalgewicht liegt.
Der Anteil übergewichtiger Kinder und Jugendlicher hat sich in den USA in den letzten Jahrzehnten verdreifacht und vermutlich sind die USA auch eines der führenden Länder, was den Fernsehkonsum jüngerer Generationen anbetrifft. Dass es einen Zusammenhang zwischen Fernsehen als Freizeitbeschäftigung und Körpergewicht gibt, ist augenscheinlich: Wer viel fernsieht, hat zwangsläufig weniger körperliche Bewegung. Es gibt indes auch noch einen anderen Mechanismus, dem jetzt ein US-amerikanisches Forschungsteam nachgegangen ist. Kinder und Jugendliche, die viel fernsehen, so ihre durch Datenanalysen später auch bestätigte Hypothese, sehen auch mehr TV-Werbespots von Fastfood-Restaurants, gehen dort häufiger (sehr kalorienreich) essen und haben dann öfter auch einen Body Mass Index (BMI), der über dem Normalgewicht liegt.
Basis der Studie sind einerseits zwei Datensätze, in denen sehr viele sozialstatistische, aber auch gesundheitliche und freizeitbezogene Aspekte von Kindern und Jugendlichen erfasst sind. Dabei handelt es sich um den "National Longitudinal Survey of Youth" für Jugendliche im Alter von 12-18 Jahren und den "Child-Young Adult National Longitudinal Survey of Youth", an dem Kinder von 3-11 Jahren teilnahmen. Erfasst wurden in diesen Erhebungen unter anderem Aspekte wie Alter, Rasse, Geschlecht, Einkommen und Bildungsniveau der Eltern, BMI des Kindes bzw. Jugendlichen und der Mutter, Dauer des täglichen Fernsehkonsums.
Die zweite zentrale Datenquelle waren Informationen über den zeitlichen Umfang der TV-Werbespots von Fastfood-Ketten, die diese in bestimmten Regionen, sogenannten "designated market areas (DMA)" geschaltet hatten. Die nicht überprüfte, aber mehr als plausible Annahme der Forscher war: Wer viel fernsieht, wird auch zwangsläufig mehr Werbespots gewollt oder ungewollt zur Kenntnis nehmen. In sehr komplizierten Analysen, in die auch viele der sozialstatistischen und gesundheitlichen Variablen zur Kontrolle einflossen, errechneten sie dann, in welchem Umfang der TV-Konsum (und damit auch Werbespot-Konsum für Fastfood-Restaurants) Übergewicht mitbewirkt.
Als Ergebnis fand man dann, dass zum Beispiel bei 3-11jährigen Jungen 30 Minuten zusätzliche Werbung für Fastfoodketten die Wahrscheinlichkeit für eine Zunahme des Übergewichts bei den Kindern der Region um 2,2 Prozent erhöht. Umgekehrt würde dies bedeuten: Ein vollständiges TV-Werbeverbot für Fastfood-Restaurants würde die Anzahl der übergewichtigen Kinder (Alter 3-11) um 18 Prozent senken, die Zahl der übergewichtigen Jugendlichen (Alter 12-18) um 14 Prozent. Eine etwas weniger scharfe gesetzliche Regelung, in der Fastfoodketten lediglich die Möglichkeit genommen würde, die Kosten für ihre an Kinder gerichtete TV-Werbung auch noch steuerlich abzusetzen, hätte nicht ganz so positive Effekte, würde den Anteil der Übergewichtigen in jüngeren Generationen aber immer noch um 5-7% senken.
Hier ist ein Abstract der Studie: Shin-Yi Chou, Inas Rashad, Michael Grossman: Fast-Food Restaurant Advertising on Television and Its Influence on Childhood Obesity (Journal of Law and Economics, vol. 51, November 2008, p 599-618)
Diese Analysen erscheinen nicht zuletzt deshalb bedeutsam, weil erst vor kurzem eine Studie des Center for Science in the Public Interest herausgefunden hatte, dass 93 Prozent der Kindermenüs in den großen Fastfoodketten zu viele Kalorien enthalten. 13 der 19 kontaktierten Unternehmen stellten im Juni 2008 die Angaben zur Zusammensetzung ihrer Speisen zur Verfügung. Für die Bewertung dieser Speisen wurden dann nationale Ernährungsstandards herangezogen, die sich auf die Kalorienzahl, den Gesamtfettgehalt, den Anteil gesättigter Fette und Transfette, Zuckerzusatz, Kochsalz und Nährstoffgehalt beziehen. Es zeigte sich dann:
• Statt maximal 430 Kalorien (ein Drittel der für 4-8jährige am Tag empfohlenen Kalorienzahl) enthält ein Kindermenü der Kette Chili's aus frittierten Hühnchenteilen ("country-fried chicken crispers"), Zimtäpfeln und Schokoladenmilch 1.020 Kalorien - der höchste erzielte Wert der Untersuchung.
• Auch die Kombinationen von McDonalds (Happy meal), Burger King und Wendy's lagen zu mehr als 90 Prozent über der empfohlenen Grenze, Kentucky Fried Chicken zu 89 Prozent.
• 45 Prozent der Kindermenüs enthalten zudem einen zu hohen Anteil von gesättigten Fetten und Transfetten, 86 Prozent zu viel Kochsalz.
• Gute Noten erhielt nur die Kette Subway's, von deren Kindermenüs die 430-Kalorien-Grenze nur um 33 Prozent überschreiten. Subway ist zudem die einzige Kette, die keine Softdrinks in Verbindung mit den Kindermenüs anbietet.
Die Autoren geben auch verschiedene Empfehlungen ab: Da Erwachsene den Kaloriengehalt von Fastfood-Angeboten häufig falsch einschätzen, raten sie zu einer Angabe der Kalorienzahl auf den Speisekarten bzw. auf dem Menüboard über der Verkaufstheke. Bei Subway's führte dies im Rahmen einer Studie zu einer Minderung pro Bestellung von 53 Kalorien. Weitere Empfehlungen sind: Gemüse und Obst anstelle von Pommes frites als Beilage, fettarme Milch und Wasser anstelle von zuckerhaltiger Limonade. Gibt es solche Auswahl-Optionen, dann bestellen 70 Prozent der Eltern die gesündere Mahlzeit für ihre Kinder.
• Die Studie ist hier im Volltext herunterzuladen: Center for Science in the Public Interest: Kids' Meals: Obesity on the Menu
• Hier eine Kurzfassung der Befunde: Obesity on the Kids' Menus at Top Chains
Gerd Marstedt, 9.2.09
Weniger Feinstaub - weniger Herzinfarkte
 Eine Minderung der Feinstaubkonzentration verlängert die Lebenserwartung, lautet das Fazit einer kürzlich im New England Journal of Medicine veröffentlichten Studie. Der Epidemiologe Arden Pope von der Brigham Young University in Boston wertete die Daten über die Verbesserung der Luftqualität in 51 US-amerikanischen Städten in den Jahren 1980 bis 2000 aus und korrelierte sie mit der Sterblichkeit der Bewohner. Die Lebenserwartung stieg im Untersuchungszeitraum insgesamt um 2,72 Jahre. 5 Monate davon sind nach den Berechnungen der Wissenschaftler auf die verbesserte Luftqualität zurückzuführen. Die Minderung der Feinstaub-Konzentration um 10 Mikrogramm pro Kubikmeter ging mit einer Verbesserung der Lebenserwartung um 0,77 Jahre einher. Andere Einflussfaktoren auf die Lebenserwartung, wie sozioökonomischer Status, demographische Entwicklung und Tabakkonsum, wurden in den Berechnungen berücksichtigt.
Eine Minderung der Feinstaubkonzentration verlängert die Lebenserwartung, lautet das Fazit einer kürzlich im New England Journal of Medicine veröffentlichten Studie. Der Epidemiologe Arden Pope von der Brigham Young University in Boston wertete die Daten über die Verbesserung der Luftqualität in 51 US-amerikanischen Städten in den Jahren 1980 bis 2000 aus und korrelierte sie mit der Sterblichkeit der Bewohner. Die Lebenserwartung stieg im Untersuchungszeitraum insgesamt um 2,72 Jahre. 5 Monate davon sind nach den Berechnungen der Wissenschaftler auf die verbesserte Luftqualität zurückzuführen. Die Minderung der Feinstaub-Konzentration um 10 Mikrogramm pro Kubikmeter ging mit einer Verbesserung der Lebenserwartung um 0,77 Jahre einher. Andere Einflussfaktoren auf die Lebenserwartung, wie sozioökonomischer Status, demographische Entwicklung und Tabakkonsum, wurden in den Berechnungen berücksichtigt.
Der ursächliche Zusammenhang zwischen einer Umweltbelastung und der Sterblichkeit ist durch eine Bevölkerungsstudie wegen der Vielzahl einwirkender Faktoren nicht direkt zu erbringen. In der gemeinsamen Bewertung mit anderen Studien erscheint die Evidenz für Kausalität jedoch deutlich. Frühere Studien aus den Niederlanden, Finnland und Kanada hatten einen Zusammenhang von steigender Mortalität bei steigender Feinstoffkonzentration festgestellt. Pope hat jetzt erstmals den umgekehrten Sachverhalt sinkender Sterblichkeit bei Verbesserung der Luftqualität erhoben.
Die Weltgesundheitsorganisation hatte auf Grund der damaligen Datenlage bereits im Weltgesundheitsbericht 2002 den Anteil der Todesfälle, die auf Feinstaubbelastung zurückzuführen sind, auf 1,4 Prozent geschätzt.
Die biologischen Mechanismen der Schädigung beschreibt Brooks in einem kürzlich in Clinical Science erschienen Aufsatz. Luftverschmutzung besteht aus Gasen, Flüssigkeiten und Partikeln. Partikel mit einem Durchmesser von weniger als 2,5 Mikrometern werden als Feinstaub (engl. particulate matter, PM2,5) bezeichnet. Feinstaub entsteht in städtischen Regionen überwiegend bei der Verbrennung von fossilen Energieträgern. Die Partikel werden über die Atemwege in den Organismus aufgenommen. Bezüglich der Gesundheitsschäden steht aber - entgegen intuitiven Annahmen - nicht die Lunge sondern das Herz-Kreislauf-System im Vordergrund. Seit Mitte der 1990er Jahre ist bekannt, dass die Veränderungen der Morbidität (Krankheitsgeschehen) und Mortalität (Sterblichkeit) in erster Linie auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen zurückzuführen sind.
Kurz- und langfristige Exposition steht in Verbindung mit Herzinfarkt, Durchblutungsstörungen, Herzrhythmusstörungen, Herzschwäche und Schlaganfall. Feinstaubpartikel werden ins Blut aufgenommen und können akut eine Vasokonstriktion (Verkrampfung der Blutgefäße), Herzrhythmusstörungen und eine Erhöhung der Gerinnungsfähigkeit mit der Folge einer Thrombose (Bildung eines Blutpfropfes) auslösen. Die kurzzeitige Erhöhung der Konzentration steigert die Sterblichkeit um 0,2 bis 0,6 Prozent pro 10 Mikrogramm Feinstaub.
Bei chronischer Belastung bewirken die Partikel entzündliche Vorgänge im Gesamtorganismus, insbesondere in den Atemwegen und am Endothel (Innenhaut) der Arterien. Dadurch wird langfristig die Arteriosklerose (Arterienverkalkung) gefördert und die Morbidität und Mortalität für die koronare Herzkrankheit erhöht. Bei vorhandener Vorschädigung kann ein Herzinfarkt ausgelöst werden.
Anzumerken ist, dass die Risikoerhöhung für Einzelpersonen gering ist. Ein relevantes Gesundheitsproblem ist Feinstaub, weil durch die Belastung großer Teile der Bevölkerung die Zahl der geschädigten trotz geringem individuellen Risikos hoch ist.
Studie im NEJM, Volltext: Pope CA, III, Ezzati M, Dockery DW. Fine-Particulate Air Pollution and Life Expectancy in the United States. N Engl J Med 2009;360(4):376-386
Weltgesundheitsbericht 2002. Reducing Risks, Promoting Healthy Life. S. 68. Download Full report
Aufsatz über die biologischen Mechanismen und Effekte (Volltext): Brook RD. Cardiovascular effects of air pollution. Clinical Science 2008;115(6):175-187.
David Klemperer, 9.2.09
Umverteilung verbessert die Gesundheit - Vergleich der Sozialpolitik von 18 OECD-Ländern
 Welche Bedeutung haben Prinzipien des Wohlfahrtsstaats für die Bevölkerungsgesundheit? Dies ist das Thema einer kürzlich im LANCET veröffentlichten Studie. Die aus Schweden, Dänemark, Finnland und Norwegen stammenden Wissenschaftler untersuchten dafür die Familienpolitik der Jahre 1950 bis 2000 und die Rentenpolitik von 1930 bis 2000 in 18 OECD-Ländern. Sie analysierten das Ausmaß der materiellen Umverteilung an Familien und an alte Menschen.
Welche Bedeutung haben Prinzipien des Wohlfahrtsstaats für die Bevölkerungsgesundheit? Dies ist das Thema einer kürzlich im LANCET veröffentlichten Studie. Die aus Schweden, Dänemark, Finnland und Norwegen stammenden Wissenschaftler untersuchten dafür die Familienpolitik der Jahre 1950 bis 2000 und die Rentenpolitik von 1930 bis 2000 in 18 OECD-Ländern. Sie analysierten das Ausmaß der materiellen Umverteilung an Familien und an alte Menschen.
Die Sozialpolitik wurde mit Hilfe des Social Citizenship Indicator Program analysiert, einer Datenbank, welche anhand von Sozialindikatoren die Sozialpolitik von 18 Ländern seit 1930 abbildet.
Bestimmt wurde der Anteil der Umverteilung am Durchschnittseinkommen eines Arbeitnehmers bzw. eines Haushaltes ("replacement rate"). Die Forscher gingen davon aus, dass der Umfang der finanziellen Umverteilung (im Bericht als "generosity" - Großzügigkeit bezeichnet) ihre Wirkung über die Vermehrung der materiellen und der nicht-materiellen Ressourcen entfaltet. Materielle Umverteilung erfolgt in den untersuchten Ländern u.a. über die Sozialversicherungen, die Unterstützung von Familien, die Kinderbetreuung und die Versorgung von alten Menschen.
Drei Arten von Familienpolitik wurden unterschieden.
• Eine universale Sozialpolitik mit dem expliziten Ziel der Chancengleichheit, wie sie von den nordischen Länder (Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden) verfolgt wird. Diese Politik geht mit ausgeprägter Umverteilung einher und finanziert sich mit hohen Steuern, sie bietet öffentliche Dienstleistungen wie Kinderbetreuung an und unterhält einen großen öffentlichen Sektor. Familienpolitisch unterstützen diese Länder die Zweiverdiener-Familien mit gleichberechtigter Aufteilung von Erwerbs- und Familienarbeit zwischen Frau und Mann ("dual-earner model").
• Ein zweiter Typ von Familienpolitik("market-oriented model") beschränkt sich im Wesentlichen auf die Unterstützung derjenigen, die arm sind. Dies gilt z.B. für die USA, England, Australien und Japan.
• Eine dritte Form der Sozialpolitik fokussiert auf die soziale Unterstützung der traditionellen Familie mit dem Mann als Einkommenserzieler ("general family model") und gilt u.a. für Deutschland, Österreich, Frankreich und Italien.
Die Auswertung für die Familienpolitik ergibt das höchste Ausmaß an materieller Umverteilung für die Länder mit dem Zwei-Einkommenmodell. Eine Mittelstellung nehmen die Länder mit dem allgemeinen Familienmodell ein. Die geringste Umverteilung erbringt das Markt-orientierte Modell.
Die Kindergesundheit steht in enger Verbindung mit dem Ausmaß der Umverteilung - je höher der Transfer, desto niedriger die Kindersterblichkeit. Die weltweit niedrigste Kindersterblichkeit besteht neben Japan in Schweden, Finnland und Norwegen. Hier hatte die Politik Mitte bis Ende der 1960-er Jahre für einen schnellen Anstieg der Umverteilung in Richtung von Familien mit zwei berufstätigen Eltern gesorgt, hauptsächlich durch Elternzeiten mit einkommensabhängigem Elterngeld. Dies sicherte die beiden Einkommen und senkte die Armutsquoten bei Familien mit Kindern. Ein Zusammenhang zwischen Kindersterblichkeit und Bruttoinlandsprodukt konnte für die untersuchten Länder nicht festgestellt werden.
Bezüglich der Rentenpolitik werden ebenfalls drei Typen unterschieden, je nach Ausprägung der staatlich gewährleisteten Absicherung. Diese ist in Finnland, Norwegen und Schweden umfassend ("encompassing"). Länder wie Deutschland, Österreich, Belgien, Italien und Japan nehmen eine Zwischenstellung ein ("corporatist"). In den USA, England, Kanada, Australien und herrscht die private finanzielle Altersabsicherung vor ("targeted").
Bei der Rentenpolitik geht ein höheres Maß an Umverteilung bezüglich der Grundrente mit niedrigerer Sterblichkeit einher. Dies dürfte daran liegen, dass hauptsächlich die Bezieherinnen einer niedrigen Rente von der Umverteilung profitieren und damit die Altersarmut gemindert wird.
Die Autoren schlussfolgern, dass die Sozialpolitik eines Landes über das Ausmaß der materiellen Umverteilung wesentlichen Einfluss auf die Bevölkerungsgesundheit hat. Ein Mangel an Ressourcen führt zu erhöhten Morbiditäts- und Mortalitätsrisiken. Ökonomische Ressourcen sind am wichtigsten, weil sie leicht in andere Formen von Ressourcen umgewandelt werden können, die den Menschen helfen, ihre Lebensbedingungen zu kontrollieren und zu lenken. Daher sei die Sozialpolitik von großer Bedeutung für die Minderung der sozialen Ungleichheit der Gesundheit.
Die Studie ist kostenlos als Abstract und nach Anmeldung ebenfalls kostenlos herunterladbar.
Lundberg et al. The role of welfare state principles and generosity in social policy programmes for public health: an international comparative study. The Lancet 8. November 2008
David Klemperer, 29.11.08
"Raucherpfennig" für Nikotinsünder, "Speck-Steuer" für Adipöse: Werden die alten Malus-Vorschläge der 90er Jahre jetzt Realität?
 Der US-Bundesstaat Alabama, auf Platz 2 der amerikanischen Rangliste für die Quote übergewichtiger Einwohner zu finden, will zumindest bei seinen Angestellten etwas unternehmen, um das Problem der Fettleibigkeit mitsamt ihren gesundheitlichen Negativfolgen anzugehen: Alle Beschäftigten des Bundesstaates mit einem Body Mass Index (BMI) von aktuell 35 oder mehr (das entspricht bei einer Körpergröße von 180 cm einem Gewicht von etwa 114 kg oder mehr) müssen demnächst nachweisen, dass sie diesen BMI deutlich unterschreiten oder dass sie erhebliche Anstrengungen dazu unternommen haben. Wie diese Prüfung im Detail aussehen soll und wie viele Pfunde die Staatsdiener abspecken müssen, wird derzeit noch beraten. Entschieden ist jedoch schon: Wer keinerlei Anstrengungen oder Fortschritte nachweisen kann, wird dann ab 2011 höhere Beiträge zur Krankenversicherung zahlen müssen, rund 25 Dollar im Monat. Die Zeitschrift TIME berichtete jetzt auch, dass Alabama bereits 24 Dollar im Monat von jenen Arbeitnehmern als Strafprämie kassiert, die allen Angeboten für Nichtraucherkurse zum Trotz immer noch nikotinabhängig sind. (vgl. Alabama to Charge Obese State Workers)
Der US-Bundesstaat Alabama, auf Platz 2 der amerikanischen Rangliste für die Quote übergewichtiger Einwohner zu finden, will zumindest bei seinen Angestellten etwas unternehmen, um das Problem der Fettleibigkeit mitsamt ihren gesundheitlichen Negativfolgen anzugehen: Alle Beschäftigten des Bundesstaates mit einem Body Mass Index (BMI) von aktuell 35 oder mehr (das entspricht bei einer Körpergröße von 180 cm einem Gewicht von etwa 114 kg oder mehr) müssen demnächst nachweisen, dass sie diesen BMI deutlich unterschreiten oder dass sie erhebliche Anstrengungen dazu unternommen haben. Wie diese Prüfung im Detail aussehen soll und wie viele Pfunde die Staatsdiener abspecken müssen, wird derzeit noch beraten. Entschieden ist jedoch schon: Wer keinerlei Anstrengungen oder Fortschritte nachweisen kann, wird dann ab 2011 höhere Beiträge zur Krankenversicherung zahlen müssen, rund 25 Dollar im Monat. Die Zeitschrift TIME berichtete jetzt auch, dass Alabama bereits 24 Dollar im Monat von jenen Arbeitnehmern als Strafprämie kassiert, die allen Angeboten für Nichtraucherkurse zum Trotz immer noch nikotinabhängig sind. (vgl. Alabama to Charge Obese State Workers)
Finanzielle Strafen für Raucher oder auch Prämien für jene, die das Rauchen aufgeben, sind in US-amerikanischen Betrieben und Einrichtungen nicht ganz so neu. Ein wenig überraschend ist jedoch, dass jetzt das Thema "Übergewicht und Adipositas" ins Visier der Strafverfolgung gerät, zu einem Zeitpunkt, da in wissenschaftlichen Studien immer öfter auf genetische Aspekte des Problems hingewiesen wird und auch die Aussagekraft des Body Mass Index zunehmend infrage gestellt wird. Dass Raucher schon seit längerem in den USA mit erheblichen Sanktionen rechnen müssen, hatte 2005 Roland Lindner in einem Artikel in der FAZ deutlich gemacht (vgl. Neuer Warnhinweis: Rauchen kostet den Arbeitsplatz). Immer mehr Unternehmen in den USA und insbesondere solche, die ihren Beschäftigten einen Krankenversicherungsschutz bieten, "wollen ihre Gesundheitskosten eindämmen und greifen dabei zu immer drastischeren Methoden. Einige Unternehmen drohen Rauchern jetzt sogar mit der Kündigung - selbst dann, wenn sie nur außerhalb des Arbeitsplatzes zur Zigarette greifen."
Beispiele aus dem FAZ-Artikel:
• Der Hersteller von Gartenprodukten Scotts Miracle-Gro hat den Rauchern unter seinen 6.000 Mitarbeitern das Ultimatum gestellt, innerhalb weniger Monate mit dem Rauchen aufzuhören, ansonsten droht eine Kündigung.
• Der Nahrungsmittelproduzent General Mills verlangt von Rauchern in seiner Belegschaft eine monatliche Zusatzprämie von 20 Dollar für die Krankenversicherung, ein anderer Betrieb, der Verlag Gannett sogar 50 Dollar.
• Der Gesundheitsdienstleister Weyco aus Michigan hatte schon 2003 ein völliges Rauchverbot verhängt - und dies nicht nur im Betrieb, sondern auch in der Freizeit. Mitarbeiter, denen in einem medizinischen Test Nikotinkonsum nachgewiesen werden konnte oder die den Test verweigerten, wurden gekündigt.
Ideen zu Bonus- und Malus-Regelungen in der Krankenversicherung, um Versicherte zu einer gesundheitsbewussteren Lebensweise zu veranlassen (oder zumindest, um zusätzliche Einnahmen für die medizinische Versorgung zu sichern), sind auch hierzulande nicht ganz so abwegig, wie die US-amerikanischen Beispiele vermuten lassen könnten. Inzwischen bieten fast allen gesetzlichen Krankenkassen sogenannte "Bonus-Programme" an. Die von Kassen gewährten Gegenleistungen für die Teilnahme an Bonus-Programmen sind sehr unterschiedlich und reichen von Sachprämien (z.B. Sportgeräte) über Geldprämien bis hin zur Erstattung oder der Ermäßigung von Zuzahlungen. In einigen Fällen werden auch recht hohe Geldprämien gewährt, wenn parallel zur Teilnahme an den Bonusprogrammen keine medizinischen Versorgungsleistungen in Anspruch genommen werden oder wenn zugleich eine Selbstbeteiligung an Arzt- und Klinikkosten vereinbart wurde. Diese Prämien sind teilweise recht namhaft und betragen - unter den genannten Voraussetzungen - nach einer Recherche der "Stiftung Finanztest" bei einzelnen Kassen zwischen 200 und 500 Euro, je nach Dauer der Leistungsfreiheit. ("Wechseln lohnt sich immer noch", Finanztest 5, 2006, S. 65-79)
Aber auch Malus-Regelungen waren hierzulande schon des öfteren in der Diskussion. Ende 1987 wollte der damalige Umweltminister Klaus Töpfer einen sogenannten "Raucherpfennig" einführen, damit Raucher sich durch eine zusätzliche Prämie an jenen Kosten beteiligen, die sie durch ihr Suchtverhalten mit bewirken. Indes war die Kritik an Töpfers Vorschlag so heftig, dass er diesen schon bald wieder zurücknahm mit dem Hinweis, seine Idee sei "offenbar politisch nicht mehrheitsfähig". (vgl. Endlose Geschichte, Der Tagesspiegel, 31.7.2008)
Noch heftiger als CDU-Umweltminister Töpfer engagierte sich jedoch der frühere Präsident der Bundesärztekammer, Karsten Vilmar, immer wieder in Reden und Pressemitteilungen für Malus-Regelungen und zog gegen fast jede nur denkbare Form eines ungesunden Lebenswandels ins Feld. In einem bissig-satirischen Artikel im SPIEGEL mokierte sich hierüber der Mediziner Dr. med. Hans Halter: "Im Saarländischen Rundfunk hatte Vilmar ganz ungeschützt über die bedrückende "Kostenentwicklung in der gesetzlichen Krankenversicherung" geplaudert, und was ihm dazu so durch den Kopf geht. Zum Beispiel: Es 'ist nicht einzusehen, daß bestimmte Menschen ohne Rücksicht auf die Folgen sich unvernünftig, leichtsinnig, leichtfertig verhalten dürfen und dann mit den Folgen eben die Solidargemeinschaft belasten.' Also müsse man 'nachdenken, warum muß ein Drei-Zentner-Mensch genauso krankenversichert sein mit einer Prämie wie jeder andere, wie jemand, der sich vernünftig verhält'. Vilmars Lösung: 'Hier könnte man sagen, gut, 70 oder 80 Kilo wären frei, und darüber gibt es Kiloprämien.' Und weil er gerade so schön in Fahrt war, forderte der Ärztepräsident gleich noch für die anderen Unvernünftigen einen Zuschlag, 'ob sie rauchen, trinken, Motorrad fahren, Ski fahren oder Drachen fliegen'. Irgend jemanden vergessen? Macht nichts. Vilmar ist offen für weitere Kandidaten, die unsere 'Solidargemeinschaft' schädigen." (vgl. Dr. med. Hans Halter: Ein Schaf im Schafspelz? Standeswidrige Nachrede auf meinen Ärztepräsidenten Vilmar (DER SPIEGEL 30/1991 vom 22.07.1991, Seite 173-174a)
Vilmars Vorschlag, vom Spiegel-Autor respektlos "Specksteuer" genannt, war indes damals wie heute nicht mehrheitsfähig. Bundesbürger sprachen sich zwar in einer repräsentativen Umfrage zu 47 Prozent dafür aus, dass Raucher auch höhere Krankenkassenbeiträge zahlen. Zugleich lehnte es jedoch eine große Mehrheit (68 Prozent) ab, Krankenkassenbeiträge auch für Versicherte mit starkem Übergewicht zu erhöhen. (vgl. Claudia Ehrenstein: Höhere Kassenbeiträge für Raucher, Die Welt, 30. Dezember 2005)
Wenn man sich erinnert, dass noch in den 90er Jahren die in den USA vielerorts schon gültigen Rauchverbote in öffentlichen Räumen hier bei uns in Deutschland eher belächelt wurden, könnte man zu der Auffassung kommen, dass auch in der Frage höherer Krankenkassenbeiträge für Raucher und Übergewichtige das letzte Wort noch nicht gesprochen ist und die vielfältigen, seinerzeit aber gescheiterten Bemühungen von Bundesärztekammer-Präsident Karsten Vilmar womöglich doch noch Realität werden.
Gerd Marstedt, 8.9.2008
Kinderrücken nehmen schweren Ranzen nicht krumm
 Jeden Morgen das Gleiche: Der Schulranzen der Kinder ist viel zu schwer. Wenn die Kleinen gebückt unter der Last der Bücher, Atlanten und Hefte das Haus verlassen, meint man die Wirbelsäule förmlich ächzen zu hören. Auch die Empfehlung von Ärzten, Schulbehörden und Ministerien lauten, dass der Ranzen nicht mehr als ein Zehntel des Kindes wiegen soll. Doch Schulleiter und Lehrer setzen sich bei der Gestaltung von Stundeplan und Unterricht nonchalant über die Empfehlungen zur Gewichtsbegrenzung hinweg - und wie es scheint, haben sie offenbar recht damit: Die Untersuchung "Kidcheck" zeigte jetzt, dass selbst beim Tragen viel schwererer Ranzen keine Schäden zu erwarten sind.
Jeden Morgen das Gleiche: Der Schulranzen der Kinder ist viel zu schwer. Wenn die Kleinen gebückt unter der Last der Bücher, Atlanten und Hefte das Haus verlassen, meint man die Wirbelsäule förmlich ächzen zu hören. Auch die Empfehlung von Ärzten, Schulbehörden und Ministerien lauten, dass der Ranzen nicht mehr als ein Zehntel des Kindes wiegen soll. Doch Schulleiter und Lehrer setzen sich bei der Gestaltung von Stundeplan und Unterricht nonchalant über die Empfehlungen zur Gewichtsbegrenzung hinweg - und wie es scheint, haben sie offenbar recht damit: Die Untersuchung "Kidcheck" zeigte jetzt, dass selbst beim Tragen viel schwererer Ranzen keine Schäden zu erwarten sind.
Wissenschaftler des interdisziplinären Kidcheck-Teams der Universität des Saarlandes, das seit 1999 Haltungsschwächen und -schäden nachgeht, untersuchten für die Ranzenstudie 60 Kinder aus zweiten und dritten Grundschulklassen. Im Durchschnitt brachten die Ranzen 17,2 Prozent des Gewichtes der Kinder auf die Waage. Beim Vermessen der Körperhaltung mittels Laserstrahl zeigte sich, dass bepackte Kinder beim Stehen das Gewicht leicht nach vorne verlagern und so den Körper praktisch ohne Energieaufwand und Muskelanstrengung ausbalancieren.
Selbst nachdem die Kinder einen anspruchsvollen 15-minütigen Parcours samt Ranzen auf dem Rücken bewältigt hatten, zeigte die Muskulatur, wie per Elektroden ermittelt wurde, kaum Ermüdungserscheinungen. Erst bei einem Ranzengewicht von einem Drittel des Körpergewichts ließ sich eine nennenswerte Muskelaktivität zur Entlastung der Wirbelsäule messen - und selbst das werten die Forscher als willkommene Kräftigung der Muskeln. Schließlich ist die Rückenmuskulatur von Stubenhockern, von immerhin fast jedem zweiten Kind, so schwach ausgeprägt, dass sie sich nicht auf Dauer gerade halten können. Aufgrund der Testergebnisse und der relativ kurzen Tragedauer hält Studienleiter Oliver Ludwig schwere Ranzen schlichtweg für unbedenklich.
Doch woher stammt die so verbreitete 10 Prozent-Regel dann? Bei ihren Recherchen stießen die Forscher auf einen Erlass vor dem ersten Weltkrieg. Mit der Empfehlung sollte verhindert werden, dass Rekruten nach Märschen von über 20 Kilometern müde Muskeln bekommen.
Christian Weymayr, 20.8.2008
Keine oder nur geringe Wirkungen von Sexualerziehungsprogrammen für Teens in den USA auf ihr Sexualwissen und -verhalten
 Die fast reflexhaft auf nahezu alle Unzulänglichkeiten der Einstellung und des Verhaltens von Menschen mit traditionellen Aus- und Weiterbildungsangeboten reagierenden Akteure mögen es nicht gerne hören: Die Wirkung derartiger Interventionen und zahlreicher anderer schriftlicher und mündlicher Methoden der Wissensverbreitung und des Verhaltenstrainings ist meist bescheiden oder nicht vorhanden.
Die fast reflexhaft auf nahezu alle Unzulänglichkeiten der Einstellung und des Verhaltens von Menschen mit traditionellen Aus- und Weiterbildungsangeboten reagierenden Akteure mögen es nicht gerne hören: Die Wirkung derartiger Interventionen und zahlreicher anderer schriftlicher und mündlicher Methoden der Wissensverbreitung und des Verhaltenstrainings ist meist bescheiden oder nicht vorhanden.
Genaueres findet man für eine Vielzahl von Konzepten und Modellen nachwievor in der einzigartigen vom "Centre of Reviews and Dissemination" an der Universität York im Auftrag des NHS gepflegten Datenbank "Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE)", in der laufend (aktuell ca. 5.000 Dokumente) die zur Wirkung der erschiedenartigsten Transfer- und Verbreitungsmethoden im Gesundheits- und Sozialbereich gemachten seriösen Untersuchungen und Evaluationen dokumentiert sind.
Ein ganz aktuelles und unerwartetes Beispiel für die praktische Wirkungs- und Nutzlosigkeit immer wieder eingesetzter Methoden und Programme zur Einstellungs- und Verhaltensveränderung liegt nun aus den USA vor. Angesichts der insbesondere im weiten ländlichen Bereich der USA vorherrschenden äußerst prüden Sexualmoral (zumindest nach außen) und dem großen Problem der zahlreichen Teenagermütter, gibt es in den USA ein gesetzlich geordnetes Erziehungsangebot (Title V, Section 510 Abstinence Education Program) für heranwachsende junge Menschen. In den zahlreich angebotenen Erziehungsprogrammen sollen die jungen Menschen am besten noch vor ihren ersten ernsthaften sexuellen Aktivitäten umfänglich über Risiken von früher Schwangerschaft und durch ungeschützten Geschlechtsverkehr übertragbare Geschlechtskrankheiten informiert werden. Ein übergreifendes Ziel der Programme ist auch, die Zielgruppe vom Sinn und Nutzen sexueller Abstinenz oder Zurückhaltung in sehr jungen Jahren zu überzeugen.
Eine Gruppe von Gesundheitswissenschaftlern untersuchte nun vier, in unterschiedlichen Bundesstaaten der USA angebotene Abstinenzprogramme auf ihre Wirkung. Bei den Programmen handelt es sich um My Choice, My Future! in Powhatan, Virginia, um ReCapturing the Vision in Miami, Florida, um Families United to Prevent Teen Pregnancy (FUPTP) in Milwaukee, Wisconsin und um Teens in Control in Clarksdale, Mississippi.
Die Wirkung wurde in einem experimentellen Design überprüft, das Surveydaten zum Sexualwissen und -verhalten aus den Jahren 2005 und 2006 von 2.057 Heranwachsenden nutzte, die vier bis sechs Jahre zuvor eines dieser Programme besucht hatte oder auch gar nichts damit zu tun hatte. Die Teenager wurde per Zufallsauswahl entweder in eine Gruppe mit Programmteilnahme (n=1.209) oder ohne aufgeteilt. Die Responserate der zu ihrem aktuellen Verhalten und Wissen Befragten betrug insgesamt erfreulich hohe 82 %.
Die Ergebnisse der gerade im "Journal of Policy Analysis and Management" ( Volume 27, Issue 2: 255-276) publizierten Studie "Impacts of Abstinence Education on Teen Sexual Activity, Risk of Pregnancy, and Risk of Sexually Transmitted Diseases" von Christopher Trenholm, Barbara Devaney, Kenneth Fortson, Melissa Clark, Lisa Quay und Justin Wheeler sind knapp und deutlich:
• Es finden sich keinerlei signifikante Wirkungen der Sexualerziehungsprogramme auf das sexuelle Verhalten der Teens, d.h. beispielsweise auf die Häufigkeit sexueller Kontakte.
• Bei den Raten ungeschützten Geschlechtsverkehrs gibt es keine Unterschiede zwischen Programmnutzern und Nichtnutzern.
• Lediglich beim Wissen über ansteckende Geschlechtskrankheiten, dem erwarteten Nutzen von Kondomen und Anti-Babypillen gibt es einige auch statistisch signifikante Wirkungen einiger Programme.
• Erfreut stellten die ForscherInnen aber fest, dass die Befürchtungen Politiker und Pädagogen, die Programme würden sogar das Risiko von Teenagerschwangerschaften und ansteckender Geschlechtskrankheiten erhöhen, nicht zutreffen.
• Bei den Heranwachsender beider Untersuchungsgruppen existieren aber immer noch wichtige Wissenslücken über Geschlechtskrankheiten.
• Insgesamt zeigt die Studie, dass die Hoffnung auf Wirkungen durch die Nutzung derartiger Programme in sehr jungen Jahren weitgehend nicht erfüllt wird.
• Auch wenn die WissenschaftlerInnen darauf hinweisen, dass sie nur die Wirkungen von wenigen der zahllosen Programmen untersucht haben, gibt es kaum Grund zur Annahme, dass andere Programme völlig andere Wirkungen bzw. Nichtwirkungen haben.
Der komplette, 20 Seiten umfassende Aufsatz "Impacts of Abstinence Education on Teen Sexual Activity, Risk of Pregnancy, and Risk of Sexually Transmitted Diseases" über die Studienergebnisse ist kostenlos erhältlich
Bernard Braun, 19.7.2008
Rechtsgutachten im Auftrag des DKFZ argumentiert: Bundesweit einheitlicher Nichtraucherschutz wäre doch möglich
 Die Bundesregierung könnte gesetzliche Regelungen zum Rauchverbot in Gaststätten erlassen, so dass auch eine in allen Bundesländern einheitliche Regelung zum Nichtraucherschutz möglich wäre. Dies stellt ein aktuelles Rechtsgutachtens fest, das im Auftrag des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) vom Kölner Staatsrechtler Prof. Klaus Stern und seinem Mitarbeiter Dr. Jörg Geerlings erstellt wurde. Danach geht die Bundeskompetenz wesentlich weiter als bisher angenommen und erfasst auch das Gaststättenwesen.
Die Bundesregierung könnte gesetzliche Regelungen zum Rauchverbot in Gaststätten erlassen, so dass auch eine in allen Bundesländern einheitliche Regelung zum Nichtraucherschutz möglich wäre. Dies stellt ein aktuelles Rechtsgutachtens fest, das im Auftrag des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) vom Kölner Staatsrechtler Prof. Klaus Stern und seinem Mitarbeiter Dr. Jörg Geerlings erstellt wurde. Danach geht die Bundeskompetenz wesentlich weiter als bisher angenommen und erfasst auch das Gaststättenwesen.
Seit der Föderalismusreform fällt das Gaststättenrecht zwar in den Kompetenzbereich der Länder, so dass argumentiert wurde, der Bund könne keine Regelungen für gastronomische Betriebe treffen. Diese Auffassung ist aber nur insofern richtig, wird im Gutachten festgestellt, als die wirtschaftlichen Aspekte des Gaststättenrechts nur durch die Bundesländer geregelt werden dürfen. Dazu gehören etwa Regelungen über Genehmigungsvoraussetzungen, Sperrstunde, Kontrollbefugnisse usw. Diese fallen in die Länderkompetenzen. Demgegenüber betrifft ein auch für Gaststätten geltendes Rauchverbot primär den Schutz der Gesundheit der Arbeitnehmer und Besucher der Gaststätten, jedoch nicht die wirtschaftlichen Belange des Gaststättenwesens. Beim Rauchverbot geht es jedoch nicht um das Gaststättenwesen, sondern um die gesundheitliche Gefährdung durch das Rauchen.
Kritisiert wird im Gutachten, dass die Bundesregierung ihre rechtliche Zuständigkeit nicht ausgenutzt habe, "obwohl die vorgenannten Zuständigkeitsvorschriften auch den Gaststättenbereich (...) erfasst hätten. Dies hat dazu geführt, dass das Rauchen in Gaststätten von den Ländern unterschiedlich geregelt worden ist. Entstanden ist ein "Flickenteppich". Rauchverbote für Gaststätten ohne Ausnahmeklausel gibt es nicht. In der Regel ist Rauchen nur in abgetrennten Räumen (Nebenräume, die als solche gekennzeichnet werden müssen) mit oder ohne besondere Abzugseinrichtungen erlaubt. Das Saarland geht sogar so weit, das Rauchen in inhabergeführten Gaststätten generell zu erlauben."
Vom Vorstandsvorsitzender des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) wird die Vielzahl der Ausnahmeregelungen scharf kritisiert: "Die Bestimmungen zum Gesundheitsschutz gelten nicht für die Raucherräume, nicht für die Veranstaltung geschlossener Gesellschaften, sie gelten nicht für Vereinsheime und nicht für Bier-, Wein- und Festzelte. Abgesehen von der Frage, wie all diese Sonderregelungen kontrolliert werden sollen, drängt sich der Eindruck auf: Die Ausnahmen sind zur Regel geworden."
In einer Pressemitteilung des DKFZ wird weiterhin darauf hingewiesen, dass sich in einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage vom Februar 2008 die Mehrheit der Deutschen, nämlich 65 Prozent, rauchfreie Gaststätten wünscht. Die Zustimmungsquote bei Nichtrauchern liegt sogar bei 86 Prozent. Die allgemeine Zustimmungsquote ist dabei deutlich angestiegen, von 53 Prozent im Februar 2005 auf 65 Prozent drei Jahre später. 70 Prozent stimmen in dieser Umfrage für eine bundesweit einheitliche Lösung.
• Prof. Dr. Klaus Stern: Präsentation der rechtsgutachtlichen Untersuchung "Nichtraucherschutz in Deutschland" (Kurzfassung des Gutachtens)
• Stellungnahme zum Schutz vor den Gefahren des Passivrauchens in der deutschen Gastronomie von Prof. Dr. Otmar D. Wiestler (Vorstandsvorsitzender des Deutschen Krebsforschungszentrums)
• Rauchfreie Gaststätten in Deutschland 2008: Mehr als zwei Drittel der Bevölkerung für eine bundesweit einheitliche Regelung (Deutsches Krebsforschungszentrum, Heidelberg: Aus der Wissenschaft - für die Politik, Ergebnisse einer Bevölkerungsumfrage)
Gerd Marstedt, 28.3.2008
Spart Prävention Geld?
 Hillary Clinton, Barack Obama, Mike Huckabee - alle noch verbliebenen KandidatInnen für die amerikanische Präsidentschaft sind sich darüber einig, dass Prävention die Bevölkerung gesünder macht und gleichzeitig Geld im Gesundheitswesen spart. Joshua Cohen und Kollegen haben dies zum Anlass genommen, die Frage der Kosteneffizienz von Prävention anhand einer systematischen Übersichtsarbeit zu prüfen.
Hillary Clinton, Barack Obama, Mike Huckabee - alle noch verbliebenen KandidatInnen für die amerikanische Präsidentschaft sind sich darüber einig, dass Prävention die Bevölkerung gesünder macht und gleichzeitig Geld im Gesundheitswesen spart. Joshua Cohen und Kollegen haben dies zum Anlass genommen, die Frage der Kosteneffizienz von Prävention anhand einer systematischen Übersichtsarbeit zu prüfen.
Eine Analyse von 599 Aufsätzen aus den Jahren 2000 bis 2005 erbrachte 1500 Kosten-Nutzen-Relationen, von denen sich 279 auf primärpräventive Interventionen (Verhinderung von Krankheiten) und 1221 auf kurative Interventionen (Behandlung von Krankheiten) bezogen. Für jede Intervention wurden die Kosten (in U.S. Dollar) berechnet und mit dem Gesundheitsgewinn (als QUALYs - quality-adjusted life-years, ein Maß für Lebenszeitgewinn und Lebensqualität) ins Verhältnis gesetzt. Als kostensparend wurden Interventionen klassifiziert, die gleichzeitig die Gesundheit verbessern und Kosten sparen.
Im Ergebnis unterscheiden sich die Kosten-Nutzen-Relationen von primärpräventiven und kurativen Interventionen nicht grundsätzlich- vergleichbare Anteile der untersuchten Interventionen sind kostensparend, kostengünstig, teuer oder nutzlos. (Abbildung).
Prävention:
•Kostensparend ist die einmalige Dickdarmspiegelung als Screening auf Darmkrebs für 60-64-jährige Männer.
•Ein intensives Tabakpräventionsprogramm für Schüler der 7. und 8.Klasse kostet 23.000 Dollar pro QUALY.
•Ein Screening der Gesamtheit der 65-Jährigen auf Diabetes kostet 590.000 Dollar pro QUALY im Vergleich zu einem Diabetes-Screening das sich auf 65-Jährige mit Hypertonie beschränkt.
•Eine Prophylaxe mit einem Antibiotikum für Kinder mit einem leichten Herzfehler vor einer Katheterisierung der Harnröhre erhöht die Kosten und verschlechtert die Gesundheit.
Kuration:
• Kostensparend ist eine kognitive Verhaltensintervention bei Morbus Alzheimer für Patienten und Familie.
• Eine Lebertransplantation für Patienten mit primär sklerosierender Cholangitis (Autoimmunerkrankung mit Zerstörung der Gallengänge die zu Leberversagen führt) kostet 41.000 Dollar pro QUALY.
• Die Operation eines 70-Jährigen mit neu diagnostiziertem Prostatakrebs erhöht die Kosten und verschlechtert die Gesundheit im Vergleich zu beobachtendem Abwarten. (Abbildung).
Die Autoren folgern, dass verallgemeinernde Aussagen über Kosten und Nutzen von Prävention nicht angezeigt sind sondern jede einzelne Präventionsmaßnahme für sich zu beurteilen ist.
New England Journal of Medicine Volltext (kostenlos)
David Klemperer, 14.2.2008
Niederländische Studie rechnet vor: Prävention bringt keine direkten Kosteneinsparungen im Gesundheitssystem
 Die in den letzten Jahren zu beobachtenden vermehrten Bemühungen und Interventionen zur Prävention und Gesundheitsförderung, durch Regelungen zum Nichtraucherschutz, Kampagnen wie "1000 Schritte extra" oder die geplante Kennzeichnung von Lebensmitteln zielen zwar vorrangig auf eine längere Lebenserwartung der Bürger ohne Gesundheitsbeeinträchtigungen. Aber direkt oder indirekt waren stets auch Hoffnungen auf damit verbundene Kosteneinsparungen mit im Spiel. Dass diese Hoffnung trügerisch sein könnte, hat nun eine gesundheitsökonomische Analyse niederländischer Wissenschaftler nahegelegt. Ihr Fazit: Gesunde Bürger ohne Übergewicht sind für das Gesundheitssystem teurer als Raucher und Fettleibige, denn aufgrund der längeren Lebenserwartung der Gesunden entstehen langfristig höhere Kosten.
Die in den letzten Jahren zu beobachtenden vermehrten Bemühungen und Interventionen zur Prävention und Gesundheitsförderung, durch Regelungen zum Nichtraucherschutz, Kampagnen wie "1000 Schritte extra" oder die geplante Kennzeichnung von Lebensmitteln zielen zwar vorrangig auf eine längere Lebenserwartung der Bürger ohne Gesundheitsbeeinträchtigungen. Aber direkt oder indirekt waren stets auch Hoffnungen auf damit verbundene Kosteneinsparungen mit im Spiel. Dass diese Hoffnung trügerisch sein könnte, hat nun eine gesundheitsökonomische Analyse niederländischer Wissenschaftler nahegelegt. Ihr Fazit: Gesunde Bürger ohne Übergewicht sind für das Gesundheitssystem teurer als Raucher und Fettleibige, denn aufgrund der längeren Lebenserwartung der Gesunden entstehen langfristig höhere Kosten.
Die Kosten für die medizinische Versorgung von Rauchern wurden unlängst in England mit 1,9 bis 2,3 Milliarden Euro jährlich beziffert (BBC: The real cost of smoking). Übergewicht und Adipositas, so eine US-amerikanische Studie, ziehen medizinische Versorgungskosten in Höhe von 55-60 Milliarden Euro in den USA in jedem Jahr nach sich (Overweight and Obesity: Economic Consequences). Verlockend erscheint es angesichts dieser Zahlen, Gesundheitspolitik systematischer und umfassender als bislang auf das Feld der Prävention zu lenken, um die knappen Kassen der Gesundheitssysteme zu entlasten. Und auch in Deutschland sprachen einige Wissenschaftler und Politiker es ganz direkt aus: "Vorbeugung statt Reparatur: Prävention senkt die Kosten im Gesundheitssystem".
Dem widersprachen nun holländische Wissenschaftler. Sie verwendeten Modellrechnungen zu den Überlebensraten, Erkrankungen und Versorgungskosten für drei (hypothetische) Gruppen von Bürgern, und zwar für eine Zeitspanne vom 20.Lebensjahr bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie aufgrund der Modellrechnung sterben würden. Diese drei Gruppen waren: Stark übergewichtige Nichtraucher (BMI über 30), "Gesunde", die nicht rauchten und ein Normalgewicht hatten, sowie lebenslange Raucher mit einem Normalgewicht. Für diese drei Gruppen berechneten sie auf der Basis offizieller Statistiken aus den Niederlanden die Lebenserwartung, die Häufigkeit des Auftretens bestimmter Krankheiten und die Kosten für die medizinische Behandlung dieser Erkrankungen.
Ihre Berechnungen zeigten dann, dass bis zum Alter von 56 Jahren die medizinischen Kosten für die Übergewichts-Gruppe am höchsten ausfallen und für die Bürger mit gesunder Lebensweise am niedrigsten. In den Lebensjahren danach verursachten die Raucher die höchsten Kosten. Die Forscher berücksichtigten dann allerdings auch noch die unterschiedliche Lebnenserwartung der drei Gruppen. Diese Lebenserwartung fällt - nach derzeitigem Wissensstand - bei 20jährigen Übergewichtigen um 5 Jahre und bei 20jährigen Rauchern um 8 Jahre niedriger aus als bei den Gesunden. Da gleichwohl auch Personen mit gesundem Lebensstil (Normalgewicht, Nichtrauchen) im Alter nicht völlig von Krankheiten verschont bleiben, fallen aufgrund der höheren Lebenserwartung und der medizinischen Kosten für diese auch Mehrausgaben an. Die medizinischen Versorgungskosten, so das Fazit der Wissenschaftler, fallen für die Gruppe mit gesunder Lebensweise am höchsten aus, für Raucher am niedrigsten und für die Übergewichtigen mittel.
Nicht berücksichtigt in den Modellrechnungen, dies schreiben die Niederländer ausdrücklich in ihrem Artikel, sind allerdings eine Reihe von Faktoren, die das Ergebnis verändern könnten: Höhere Krankenstände und Produktivitätsverluste durch rauchende und fettleibige Erwerbstätige, daraus resultierende volkswirtschaftlichen Verluste, geringere Renteneinzahlungen, sinkende Tabaksteuereinnahmen. "Aber", so schreiben sie zum Schluss, "das Ziel des Gesundheitssystems ist es nicht, Kosten zu senken, sondern den Menschen vermeidbares Leiden und Sterben zu ersparen. Wenn darüber auch noch Kosteneinsparungen möglich sind, wäre dies nicht viel mehr als ein I-Tüpfelchen."
Die Studie ist hier kostenlos im Volltext zu lesen: Pieter H. M. van Baal u.a: Lifetime Medical Costs of Obesity: Prevention No Cure for Increasing Health Expenditure (PLoS Med 5(2): e29 doi:10.1371/journal.pmed.0050029)
Gerd Marstedt, 8.2.2008
Indonesien und Bangladesch: Kinder mit besserer Schulbildung haben weniger wahrscheinlich unterernährte Nachkommen
 Erneut zeigt eine große Studie in einem Entwicklungs- bzw. Schwellenland den wichtigen Einfluss von Bildung auf die Entwicklungschancen vieler Individuen und des Landes insgesamt.
Erneut zeigt eine große Studie in einem Entwicklungs- bzw. Schwellenland den wichtigen Einfluss von Bildung auf die Entwicklungschancen vieler Individuen und des Landes insgesamt.
In der von Richard Semba und weiteren WissenschaftlerInnen der "Johns Hopkins School of Medicine in Baltimore, Maryland" durchgeführten Untersuchung bei 590.570 Familien in Indonesien und 395.122 Familien in Bangladesch, deren Daten von großen Gesundheits- und Ernährungsüberwachungsprogrammen zusammengetragen worden waren, ging es um den Einfluss der Ausbildungsdauer der Eltern eines Kindes für die Verringerung von Unterernährung ihrer Kinder.
Unterernährung von Kindern ist gerade in der frühen Kindheit mit einer schlechten kognitiven, motorischen und sozioemotionalen Entwicklung, erhöhter Sterblichkeit oder irreversiblen Schädigungen einschließlich einer geringeren Körpergröße als Erwachsener, schlechterem Schulabschluss, einem geringeren Einkommen im Erwachsenenleben und praktisch als Schlussglied der intergenerativen Verkettung auch oft mit einem geringerem Geburtsgewicht der nächsten Nachkommen assoziiert.
Ob und welchen Zusammenhang es zwischen dem kindlichen Wachstum, dem Bildungsstand der Eltern und deren sozioökonomischen Status gibt, untersuchten die us-amerikanischen ForscherInnen.
Die Forscher stellten fest, dass die Häufigkeit für verzögertes Wachstum bei Kindern im Alter zwischen 0 und 59 Monaten in Indonesien bei 33,2% lag. Eine bessere Schulbildung der Mutter führte pro zusätzlichem Ausbildungsjahr ("extra year of education [EYE]") zu einer Reduktion des Risikos für Wachstumsverzögerung beim Kind zwischen 4,4% (in Städten) und 5% (in ländlichen Gegenden) In Bangladesch (wo die Häufigkeit von Kindern mit Wachstumsstörung über 50% lag), führte jedes EYE der Mutter zu einer 4-prozentigen Reduktion des Risikos für ein Kind mit Wachstumsverzögerung. Interessanterweise reduzierte jedes EYE des Vaters das Risiko "nur" um 2,9% (in ländlichen Gegenden) und 5,4% (in den Städten). In Indonesien war eine gute Ausbildung beider Elternteile mit einem deutlich erhöhten protektivem Verhalten gegenüber ihren Kindern assoziiert. Dies umfasste die Verabreichung von Vitamin-A-Kapseln, eine komplette Grundimpfung, bessere sanitäre Verhältnissen und die Verwendung jodierten Speisesalzes.
Auch unter den manchmal durch zivile Unruhen und Naturkatastrophen geprägten Bedingungen von Entwicklungsländern gibt es also realistische und erfolgreiche politische oder soziale Interventionen im Bildungsbereich und der gezielten Förderung von Frauen, mit denen die gesundheitliche und soziale Zukunft zahlreicher Angehöriger der nächsten Generationen und ihrer Länder verbessert werden kann. Hier zu intervenieren schließt nicht aus, über die hier existierenden komplexen Wechselwirkungen mehr zu forschen. Dazu würde auch die Erforschung der Zusammenhänge im Längsschnitt gehören.
Zu dem in der neuesten Ausgabe der Fachzeitschrift "The Lancet" (2008; 371: 322) erschienenen Aufsatz "Effect of parental formal education on risk of child stunting in Indonesia and Bangladesh: a cross-sectional study" von Richard Semba et al. gibt es kostenfrei ein Abstract. Nach einer kurzen kostenlosen Anmeldung, die keine Werbeflut o.ä. nach sich zieht, erhält man auch eine komplette Fassung kostenfrei.
Bernard Braun, 28.1.2008
Wissenschaftler kritisieren: Leitlinien und Ratschläge zur gesunden Ernährung verursachen oft mehr Schaden als Nutzen
 Die Propagierung von Ernährungsrichtlinien basiert nur selten auf wissenschaftlich gesicherten Erkenntnissen, so wie dies in der medizinischen Forschung der Fall ist. Gleichwohl werden immer wieder Leitlinien aufgestellt und über die Medien Verhaltensratschläge verbreitet - in der Annahme, dass diese Empfehlungen zwar nicht 100prozentig abgesichert sind, aber zumindest nicht schaden können. Dass diese Informationspolitik sehr wohl großen Schaden anrichten kann, versuchen Wissenschaftler des Albert Einstein College of Medicine und der Yeshiva University (beide New York) in einem Aufsatz darzulegen, der jetzt in der Zeitschrift "American Journal of Preventive Medicine" veröffentlicht wurde.
Die Propagierung von Ernährungsrichtlinien basiert nur selten auf wissenschaftlich gesicherten Erkenntnissen, so wie dies in der medizinischen Forschung der Fall ist. Gleichwohl werden immer wieder Leitlinien aufgestellt und über die Medien Verhaltensratschläge verbreitet - in der Annahme, dass diese Empfehlungen zwar nicht 100prozentig abgesichert sind, aber zumindest nicht schaden können. Dass diese Informationspolitik sehr wohl großen Schaden anrichten kann, versuchen Wissenschaftler des Albert Einstein College of Medicine und der Yeshiva University (beide New York) in einem Aufsatz darzulegen, der jetzt in der Zeitschrift "American Journal of Preventive Medicine" veröffentlicht wurde.
Die aktuelle Übergewichts-Problematik, von der neben England in überdurchschnittlich starkem Maße auch die USA betroffen sind, ist nach der Argumentation der Forscher zu einem erheblichen Anteil verursacht worden durch Ratschläge von Ernährungswissenschaftlern, fettreiche Nahrungsmittel auf dem Speiseplan massiv einzuschränken oder ganz darauf zu verzichten. In den nationalen Richtlinien der USA, herausgegeben vom U.S. Department of Agriculture und dem U.S. Department of Health and Human Services war seit den 70er-Jahren immer betont worden, der Fettanteil in der Nahrung müsse reduziert werden, um länger und gesünder zu leben. Medien haben diese Empfehlungen dann immer wieder in ihre Schlagzeilen gebracht.
Ab dem Jahr 2000 korrigierte man dann die im Turnus von 5 Jahren jeweils überarbeiten Empfehlungen und attestierte, dass der Hinweis auf eine Reduktion des Fettanteils wohl unklug gewesen sei. Diese Empfehlung habe in der Bevölkerung zu der Überzeugung geführt, dass es für eine gesunde Ernährung schon ausreiche, wenn man nur fettarme und fettfreie Produkte zu sich nähme. Als Effekt davon war der Anteil von Nahrungsmitteln deutlich angestiegen, die einen besonders hohen Anteil von Kohlenhydraten und Kalorien aufweisen - was wiederum zu Übergewicht und Fettleibigkeit bei vielen Bevölkerungsgruppen führte.
Die Wissenschaftler dokumentieren diesen Prozess des Rückgangs fettreicher Nahrungsmittel an der Ernährung der US-Amerikaner und des gleichzeitigen Anstiegs von kohlehydratreichen Produkten mit exakten statistischen Daten im Zeitraum 1971 bis 2001. Deutlich wird aus den Abbildungen, dass der Konsum fettreicher Produkte abnahm, während sich die aufgenommene Kalorienmenge in diesem Zeitraum bei Männern wie Frauen deutlich erhöht hat. Hingewiesen wird darauf, dass hier die Ernährungswissenschaftler und Gesundheitsexperten in den nationalen Komitees einigen Missverständnissen aufgesessen sind. Zwar sei zu fettreiche Nahrung tatsächlich nicht gesund und ein Risikofaktor für viele Erkrankungen. Aber es sei zum ersten ein Unterschied, ob man sich bei Ernährungs-Empfehlungen pauschal an die Gesamtbevölkerung richtet oder ob Ärzte dies unter genauer Betrachtung des individuellen Gesundheitszustands für einen einzelnen Patienten formulieren. Und zum zweiten sei zu fettreiche Ernährung eben nur ein Risikofaktor, ein direkter Zusammenhang als alleinige Ursache etwa von Herz-Kreislauf-Erkrankungen sei bislang nicht belegt.
Zum zweiten sei es problematisch nur Empfehlungen auszusprechen, die einen einzelnen Aspekt des Ernährungsverhaltens bzw. einen einzelnen Risikofaktor betreffen. Hierbei sei immer unklar, wie sich die Bevölkerung daraufhin verhalte und ob dies nicht andere Verhaltensrisiken bewirkt, die unter Umständen noch gravierendere Negativfolgen mit sich bringen. Die Warnung vor zu fettreicher Ernährung und in der Folge die Berücksichtigung dieser Warnung, aber die gleichzeitig ungehemmte Aufnahme extrem kalorienreicher Kohlehydrat-Produkte habe diese Gefahr deutlich gemacht.
Der Netto-Effekt der Ernährungsrichtlinie sei in diesem Fall also eindeutig negativ. Wenn es jedoch nur ungenügende wissenschaftliche Belege für den Netto-Effekt von Leitlinien zur Ernährung gibt - und dies sei fast durchweg der Fall - sei es besser zu schweigen und keine pauschalen Verhaltensempfehlungen für die Bevölkerung auszusprechen. Dass das Beispiel "zu fettreiche Nahrung" keineswegs ein Einzelfall oder eine Ausnahme ist, zeigen die Wissenschaftler noch einmal am Schluss ihres Artikels am Beispiel der "Transfette", die besonders intensiv in Pommes frites, Chips und industriellen Backwaren zu finden sind. Zwar gibt es tatsächlich statistische Zusammenhänge zu Risikofaktoren für koronare Herzerkrankungen. Die in den Medien zuletzt gehäuft zu findenden Warnungen vor diesen Transfetten hat jetzt jedoch zu einem Rückgang des Konsums geführt. Dabei ist jedoch völlig unklar, wodurch diese ersetzt werden und ob dies einen positiven Netto-Effekt für gesunde Ernährung mit sich bringt.
Ein Abstract der Studie ist hier zu finden: Paul R. Marantz u.a.: A Call for Higher Standards of Evidence for Dietary Guidelines (Am J Prev Med 2008, Volume 34, Issue 3, March 2008, Pages 234-240; DOI: 1016/j.amepre.2007.11.017)
Eine ausführlichere Zusammenfassung ist hier: medpage today: Dietary Guidelines May Have a Downside
Zur Botschaft des Artikels passt recht gut die erst vor wenigen Tagen veröffentlichte Warnung aus dem Institut für Pharmazeutische und Medizinische Chemie der Universität Münster, Olivenöl sei weitaus weniger gesund als landläufig angenommen. Arteriosklerose würde nicht verhindert, sondern womöglich ganz im Gegenteil sogar begünstigt. Die Wissenschaftler hatten Meerschweinchen (deren Grundnahrungsmittel ganz überwiegend Heu ist) 4 Monate lang mit einer ölsäurereichen Diät gefüttert. Am Ende konnten sie zwar keine Arteriosklerose bei den Versuchstieren finden. Um keine Antwort verlegen erklärte der leitende Forscher Prof. Krieglstein: "Das kann aber auch daran liegen, dass Meerschweinchen grundsätzlich nur selten Arteriosklerose entwickeln." Zumindest hatten die Meerschweinchen jedoch am Ende des Versuchs etwas kleinere und leichtere Herzen als die Kontrollgruppe. Dieses Ergebnis reichte dann schon aus, um die in den Medien massenhaft kolportierte Warnung zu liefern: Olivenöl kann zu Arteriosklerose beitragen
Gerd Marstedt, 26.1.2008
Kochen als Schulfach, Fahrradfahren in "gesunden Städten": England beschließt 500 Millionen Euro Programm gegen Übergewicht
 Im Herbst 2007 erregte der Bericht des englischen Foresight-Instituts "Tackling Obesities: Future Choices" das Aufsehen der Nation. Wenn nicht augenblicklich Maßnahmen für eine gesündere Lebensweise ergriffen werden, so der Bericht, dann drohe England schon bald eine dramatische "Übergewichts-Epidemie". Mit den bislang üblichen Appellen allein an das Individuum, gesünder zu leben, sei es bei weitem nicht getan. Notwendig seien vielmehr Anstrengungen in einer Vielzahl politischer Felder, von der Stadtplanung über das Bildungswesen und die Verbraucherinformation bis hin zur Verkehrspolitik. (vgl.: Übergewicht ist nicht allein individuell verschuldet, sondern auch Effekt ungesunder Lebensräume).
Im Herbst 2007 erregte der Bericht des englischen Foresight-Instituts "Tackling Obesities: Future Choices" das Aufsehen der Nation. Wenn nicht augenblicklich Maßnahmen für eine gesündere Lebensweise ergriffen werden, so der Bericht, dann drohe England schon bald eine dramatische "Übergewichts-Epidemie". Mit den bislang üblichen Appellen allein an das Individuum, gesünder zu leben, sei es bei weitem nicht getan. Notwendig seien vielmehr Anstrengungen in einer Vielzahl politischer Felder, von der Stadtplanung über das Bildungswesen und die Verbraucherinformation bis hin zur Verkehrspolitik. (vgl.: Übergewicht ist nicht allein individuell verschuldet, sondern auch Effekt ungesunder Lebensräume).
Überraschend schnell hat nun die britische Regierung reagiert und ein umfassendes Aktionsprogramm gegen Übergewicht und zur Förderung einer gesünderen Lebensweise vorgelegt. Rund 372 Millionen Pfund (etwa 520 Millionen Euro) will man in den Jahren 2008-2011 hierzu ausgeben, und zwar zusätzlich zu schon beschlossenen 1,8 Milliarden Euro für Schulsport und Schulernährung und knapp 200 Millionen Euro für ein Programm zur Förderung des Fahrradfahrens. Die vorgesehenen Maßnahmen sind allesamt keineswegs neu und revolutionär und viele Maßnahmen wurden bereits von den Oppositionsparteien oder auch Patientenverbänden als viel zu halbherzig kritisiert. Gleichwohl bleibt festzuhalten, auch wenn man das Programm etwa mit den überwiegend sehr vagen deutschen "Nationalen Gesundheitszielen" vergleicht, dass hier erstmals eine Bündelung sehr konkreter Maßnahmen und Interventionen in einer Vielzahl gesellschaftlicher Handlungsfelder definiert wurden - und dies nicht nur als Absichtserklärung, sondern mit konkreten Umsetzungsvorgaben und finanziellen Etats.
Im 56seitigen Strategie-Papier "Healthy Weight, Healthy Lives - A Cross Government Strategy for England" werden beispielsweise folgende Maßnahmen beschlossen und auch detailliert Vorgehensweisen zur Umsetzung erörtert:
• "Gesundes Kochen", also das Zubereiten von Speisen auf der Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse zur gesunden Ernährung, wird Pflichtfach in allen Schulen für 11-14jährige Schüler, und auch dann, wenn in den Schulen selbst keine Küche zur Verfügung steht.
• In mehreren Städten sollen Pilotprojekte (mit einem Etat von rund 40 Millionen Euro) durchgeführt werden, die das Fahrradfahren und Zu-Fuss-Gehen fördern und das Autofahren einschränken sollen.
• Eine Ausweitung der Kennzeichnung von Nahrungsmitteln mit der "Lebensmittel-Ampel" ist geplant. Derzeit sperren sich noch große Hersteller und Händler dagegen und favorisieren ein anderes Kennzeichnungs-System.
• Mit einer "aggressiven Marketing-Kampagne" (100 Millionen Euro) sollen Eltern dazu angehalten werden, stärker auf eine gesunde Ernährung und körperliche Bewegung bei ihren Kindern zu achten.
• In Forschungsprojekten soll geprüft werden, ob man Übergewichtige mit materiellen Anreizen (Geld, Sachprämien, Gutscheine) zu mehr körperlicher Aktivität bewegen kann.
• In der unmittelbaren Umgebung von Schulen sollen Fast-Food-Einrichtungen, Imbisstände und dergleichen verboten werden.
• Die Website des National Health Service soll ausgebaut werden und sehr viel umfassendere Informationen zur "gesunden Lebensweise" enthalten.
• Fernsehwerbung für Fast Food und "Junk Food" soll weiter eingeschränkt werden.
Das Programm enthält noch eine Vielzahl weiterer Maßnahmen, die zusätzliche Aufgaben der Ärzte im Nationalen Gesundheitssystem beschreiben, Forschungs- und Modellvorhaben sowie Informationsangebote beinhalten.
• Die Pressemitteilung der Regierung: Government announces first steps in strategy to help people maintain healthy weight and live healthier lives
• Das Maßnahme-Programm (PDF, 56 Seiten): Healthy Weight, Healthy Lives - A Cross Government Strategy for England
• Ein FAQ der BBC: Questions and Answers: Anti-obesity strategy
Gerd Marstedt, 24.1.2008
Interventionen zur Erhöhung der körperlichen Aktivität zeigen bei chronisch Erkrankten Erfolg
 Körperliche Bewegung gilt neben gesunder Ernährung als eine zentrale Voraussetzung zur Prävention vieler Gesundheitsbeschwerden und chronischer Erkrankungen. Doch Interventionen, um die Zahl der Bewegungsmuffel in der Bevölkerung nachhaltig zu senken, zeigen nach bislang vorliegenden Studien nur sehr beschränkten und meist kurzzeitigen Erfolg. Etwas optimistischer stimmen Befunde, wenn man nicht die Gesamtbevölkerung, sondern nur chronisch Erkrankte betrachtet. Hier hat jetzt eine Meta-Analyse schon veröffentlichter Studien gezeigt, dass Interventionen zum Teil durchaus beachtliche Erfolge aufweisen können und das Ausmaß körperlicher Bewegung auch im Vergleich zu Kontrollgruppen fast verdoppeln.
Körperliche Bewegung gilt neben gesunder Ernährung als eine zentrale Voraussetzung zur Prävention vieler Gesundheitsbeschwerden und chronischer Erkrankungen. Doch Interventionen, um die Zahl der Bewegungsmuffel in der Bevölkerung nachhaltig zu senken, zeigen nach bislang vorliegenden Studien nur sehr beschränkten und meist kurzzeitigen Erfolg. Etwas optimistischer stimmen Befunde, wenn man nicht die Gesamtbevölkerung, sondern nur chronisch Erkrankte betrachtet. Hier hat jetzt eine Meta-Analyse schon veröffentlichter Studien gezeigt, dass Interventionen zum Teil durchaus beachtliche Erfolge aufweisen können und das Ausmaß körperlicher Bewegung auch im Vergleich zu Kontrollgruppen fast verdoppeln.
In der Studie wurden insgesamt 153 Veröffentlichungen berücksichtigt, die über den Erfolg ganz unterschiedlicher Maßnahme zur Erhöhung der körperlichen Aktivität berichtet hatten. Die Daten aus diesen Studien umfassten über 23.000 Teilnehmer. Die jeweils durchgeführten Interventionen umfassten eine breite Palette von Maßnahmen, angefangen von Sportangeboten mit Unterstützung durch Pädagogen und Sportmediziner, über psychologische Schulungen und Gruppensitzungen bis hin zu Kursen, in denen Techniken zum Feedback oder zur Selbstbelohnung erlernt wurden. In einigen Interventionen wurde überdies mit Erfolgsprämien und Belohnungen gearbeitet.
Die chronischen Erkrankungen der Teilnehmer zeigen ebenfalls eine große Streuweite, beteiligt waren Patienten mit Bluthochdruck, Diabetes, Herzinfarkt, Arthritis, Asthma Parkinson und noch vielen anderen Krankheiten.
Die Wissenschaftler werteten alle 153 Studien auch quantitativ aus, indem sie einen "Effektwert" berechneten: Das Ausmaß, indem sich Teilnehmer an den Interventionen später hinsichtlich ihrer körperlichen Bewegung von Kontrollgruppen unterschieden, sei es gemessen in Zeiteinheiten oder auch im Hinblick auf täglich absolvierte Kilometer. Unter dem Strich und im Durchschnitt aller Interventionen zeigte sich, dass die erprobten Maßnahmen einen im Vergleich zu Kontrollgruppen etwa doppelt so großen Effekt erzielten. Praktisch bedeutet dies eine Differenz von 48 Minuten Sport oder körperlicher Bewegung in der Woche oder 945 Schritte am Tag.
Bei detaillierterer Betrachtung ergab sich für einige Rahmenbedingungen, dass sie besonders förderlich oder auch hinderlich sind:
• Die stärksten Effekte ergaben sich für Maßnahmen, die nicht eine Vielzahl von Verhaltensweisen im Fokus hatten (z.B. Rauchen und Alkohol und Sport), sondern einzig und allein den Bereich körperlicher Bewegung avisierten. Die Wissenschaftler weisen hier ausdrücklich darauf hin, dass man diesen Befund bei chronisch Erkrankten erzielt hat und möglicherweise nicht auf Gesunde übertragen kann.
• Wenn man die Maßnahmen danach unterschied, welche Bevölkerungsgruppen beteiligt waren (Ältere oder Jüngere, Männer oder Frauen oder beide, Angehörige unterer oder oberer Sozialschichten usw.) dann zeigte sich, dass diese sozialstatistischen Faktoren keinerlei Einfluss auf den Erfolg hatten.
• Bei den Interventionen fand man am häufigsten sportliche Übungen, die von einem Mediziner oder Sportlehrer begleitet wurden. Dieser besonders häufige Interventions-Typus war jedoch nicht erfolgreicher als andere Maßnahmen.
• Vorteile ergaben sich jedoch für Interventionen, wenn ein Monitoring des Verhaltens erfolgte, also wenn Teilnehmer über ihre Fortschritte informiert wurden und darüber Protokoll geführt wurde oder auch Hilfsmittel dazu (Pedometer) verwendet wurden.
• Kognitive Strategien, die über psychologische Übungen versuchten, eine bessere Teilnehmer-Motivation und stärkere Autonomie zu erzielen, waren eher weniger erfolgreich als Maßnahmen, in denen konkrete Sport- und Bewegungsangebote gemacht wurden.
Hier ist ein Abstract der Studie: Vicki S. Conn u.a.: Meta-analysis of patient education interventions to increase physical activity among chronically ill adults (Patient Education and Counseling, Volume 70, Issue 2, February 2008, Pages 157-172)
Gerd Marstedt, 23.1.2008
Verbraucherzentrale fordert Kennzeichnung von Lebensmitteln mit Ampel-Symbolen nach dem Vorbild Englands
 Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) hat jetzt eine obligatorische, verständliche und auf den ersten Blick vergleichbare Nährwertkennzeichnung für zusammengesetzte und verarbeitete Lebensmittel nach dem Vorbild der englischen "Lebensmittelampel" gefordert. "Eine Kalorienbombe muss als solche direkt erkennbar sein", erklärte vzbv-Vorstand Gerd Billen. Wie eine solche Ampel-Kennzeichnung in der Praxis aussehen würde, demonstrierte der Verband anhand konkreter Produktbeispiele.
Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) hat jetzt eine obligatorische, verständliche und auf den ersten Blick vergleichbare Nährwertkennzeichnung für zusammengesetzte und verarbeitete Lebensmittel nach dem Vorbild der englischen "Lebensmittelampel" gefordert. "Eine Kalorienbombe muss als solche direkt erkennbar sein", erklärte vzbv-Vorstand Gerd Billen. Wie eine solche Ampel-Kennzeichnung in der Praxis aussehen würde, demonstrierte der Verband anhand konkreter Produktbeispiele.
Die Forderung des Verbandes richtet sich an die EU-Kommission, die in Kürze einen entsprechenden Verordnungsvorschlag präsentieren wird. Enttäuscht ist man von Verbraucherminister Seehofer. Dieser hatte sich lediglich für eine freiwillige Kennzeichnung und gegen die Ampel ausgesprochen. Eine vom vzbv veröffentlichte Gegenüberstellung der Ampel-Kennzeichnung mit der gegenwärtigen Kennzeichnung und der vom Bundesverbraucherministerium vorgeschlagenen Variante zeigt: Mit Chips liegt man für Fett und Salz fast immer im roten Bereich. Die Flasche Limonade ist der reinste Zuckerschock. Kinderjoghurts pendeln zwischen "Gelb" und "Rot".
Nach Veröffentlichungen des Bundesverbraucherministeriums sind in Deutschland circa 37 Millionen Erwachsene und rund zwei Millionen Kinder und Jugendliche übergewichtig oder adipös. Ein Viertel der Erwachsenen leidet an Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Bluthochdruck. Mehr als jedes fünfte Kind weist Symptome einer Essstörung auf. Die Folgekosten, die durch ernährungsbedingte Krankheiten entstehen, werden mit 30 Prozent aller Gesundheitskosten kalkuliert und betragen damit jährlich mehr als 70 Milliarden Euro. Mangelnde und unverständliche Nährwertkennzeichnungen sind eine Hauptursache ernährungsbedingten Krankheiten wie Fettleibigkeit und Diabetes.
Für Verbraucher entwickelt sich die Suche nach dem Nährwert bei zusammengesetzten Lebensmitteln zur komplizierten Denksportaufgabe. Unterschiedliche Tabellen, Angaben und Bezugsgrößen erschweren den Vergleich. Wenn dann noch süße Müslis als "leicht" deklariert werden oder die Natrium-Angaben auf Chips-Tüten nichts über den tatsächlichen Salzgehalt verraten, ist die Verwirrung komplett. Bei der Nährwert-Ampel sieht der Verbraucher demgegenüber auf den ersten Blick, wie er das Produkt einzuordnen hat: Auf der Vorderseite der Verpackung wird der Gehalt an Nährstoffen wie Fett, gesättigte Fettsäuren, Zucker und Salz jeweils durch eine der drei Ampelfarben angezeigt. Rot steht dabei für einen hohen Nährstoffgehalt, gelb für einen mittleren und grün für einen geringen Anteil. Die Ampel kommt auch bei den Verbrauchern gut an. Das ergab eine Verbraucherbefragung der britischen Verbraucherorganisation "Which?" im Sommer 2006. Im Vergleich zu anderen Kennzeichnungsformen wurde die Ampel von über 90 Prozent der Befragten als leicht und schnell verständlich bewertet.
"Studien zeigen, dass viele Verbraucher beim Einkaufen die Rückseite von Produkten einfach ignorieren", unterstützt Entscheidungspsychologin Jutta Mata vom Berliner Max-Planck-Institut für Bildungsforschung die Forderung des vzbv. "Wenn ein Produkt ein rotes Licht bekommt, kann es nicht durchweg gesund sein." Viele Verbraucher wissen zwar, dass zu viele Chips oder süße Limonaden nicht gesund sind - aber was ist ein "zu viel"?
Die von der Industrie zum Teil schon praktizierte Form der Nährwertkennzeichnung entpuppt sich bei genauer Analyse zum Teil als gezielte Desinformation der Verbraucher. Durch die Angabe von Miniportionen und die Annahme eines zu hohen Tagesbedarfs wird der Zucker-, Fett- und Salzgehalt eines Produktes relativiert. Mit realistischen Portionsgrößen und offiziell empfohlenen Tageszufuhr würde sich der jeweilige Nährwertanteil pro Portion bezogen auf den Tagesbedarf in vielen Fällen verdoppeln, zum Teil verdreifachen. Beispiel-Rechnungen der Verbraucherzentrale Hamburg belegen: Wer einen halben Liter Limonade und eine Tüte Chips konsumiert, hat sein Soll an Zucker, Fett und Salz schon übererfüllt.
Hier sind PDF-Dokumente der Verbraucherzentrale zur Lebensmittel-Kennzeichnung:
• Was ist die Ampel?
• Kennzeichnungsvorschlag des BMELV
• Beispiele Produkte Nährwertkennzeichnung
• vzbv-Positionspapier Nährwertkennzeichnung
Gerd Marstedt, 23.12.2007
Studie kritisiert fehlende wissenschaftliche Grundlagen und unzureichende Evaluation der Prävention in Deutschland
 Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und Präventionsprogramme in Deutschland werden derzeit eher nach Gutdünken der Veranstalter oder Lust und Laune der finanzierenden Einrichtungen durchgeführt, nicht aber nach wissenschaftlich fundierten Kriterien, die eine Bewertung der Erfolgschancen und Effektivität erlauben. Zu dieser zentralen Aussage kommen Wissenschaftler des Instituts für Gesundheitsökonomie und klinische Epidemiologie (IGKE) an der Universität zu Köln auf der Grundlage einer Literaturauswertung von Evaluationsstudien zu Präventionsmaßnahmen.
Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und Präventionsprogramme in Deutschland werden derzeit eher nach Gutdünken der Veranstalter oder Lust und Laune der finanzierenden Einrichtungen durchgeführt, nicht aber nach wissenschaftlich fundierten Kriterien, die eine Bewertung der Erfolgschancen und Effektivität erlauben. Zu dieser zentralen Aussage kommen Wissenschaftler des Instituts für Gesundheitsökonomie und klinische Epidemiologie (IGKE) an der Universität zu Köln auf der Grundlage einer Literaturauswertung von Evaluationsstudien zu Präventionsmaßnahmen.
Die Kritik der Forscher, Prof. Dr. Karl Lauterbach und PD Dr. Markus Lüngen, gilt einerseits der unzureichenden Diskussion darüber, welche Zielsetzungen im Bereich der Prävention vorrangig verfolgt werden sollten, woraus eine weitgehend ungesteuerte Ausgabe von Fördergeldern resultiert, deren Ertrag ungewiss ist. Problematisch erscheint ihnen allerdings ebenso der Forschungsstand - nach wie vor sei es so, dass Evaluationen von Präventions- und Gesundheitsförderungs-Maßnahmen methodisch äußerst dürftig seien, auf einem Wissensstand, wie ihn die Medizin vor einem Vierteljahrhundert aufwies: "In Deutschland konzentriert sich die Diskussion in der Prävention und Gesundheitsförderung derzeit wesentlich auf die Mittelherkunft, also darum, welche Beteiligten welche Summen aufbringen müssen. Kaum eine Diskussion gibt es um die entscheidendere Frage, für welche Projekte die Mittel ausgegeben werden sollten. (...) Unsere Studie hat gezeigt, dass die Situation zum Nachweis von Effektivität in Prävention und Gesundheitsförderung auch im internationalen Umfeld in etwa den Stand der kurativen Medizin von vor 25 Jahren aufweist. Belastbare und ausreichend erprobte Kataloge zur Bewertung und anschließenden Priorisierung von Präventionsangeboten fehlen weitgehend."
Die Kölner Gesundheitsökonomen werteten anhand eines umfassenden Kriterienkatalogs rund 120 Evaluations-Studien aus, die wiederum Präventionsprogramme aus 13 Staaten bewerteten. Die Untersuchung bezieht Studien aus den USA, Kanada, Australien, Neuseeland, Großbritannien, Frankreich, den Niederlanden, den nordischen Ländern, Österreich und der Schweiz ein. Ihre Fragestellung ist: Lassen sich im Ausland Präventions-Konzepte identifizieren, die einer systematischen, methodisch anspruchsvollen wissenschaftlichen Prüfung unterzogen wurden und sich in dieser Evaluation als wirkungsvoll erwiesen? Angesichts von mehreren tausend Präventionsprogrammen konzentrierten sich die Forscher dazu exemplarisch auf vier Themen: Bewegungsprogramme im Betrieb und speziell für Mädchen und Frauen; Depressions-Prävention in der Schule; gute Ernährung für Schüler sowie Raucherentwöhnung bei Schwangeren.
Zusammenfassend heben sie hervor, dass trotz der massiven methodischen Defizite der meisten Evaluationsstudien und ebenso der mangelhaften Konzepte von Gesundheitsförderungs-Programmen gleichwohl einige Tendenzen erkennbar seien, auf denen man aufbauen könne. Dies betrifft zunächst Erkenntnisse über die Unwirksamkeit einer Reihe von Maßnahmen: "So sind zur Förderung der Bewegung Plakate mit der Aufforderung zum Gebrauch der Treppe statt des Aufzugs in Betrieben nicht effektiv. Bei Jugendlichen kann eine Zunahme der Bewegung nur mit kombinierten Angeboten, welche Schule und/oder Eltern einbeziehen, erreicht werden, nicht mit Programmen, die rein edukativ ansetzen. Die Änderung des Ernährungsverhaltens konnte von isolierten Programmen kaum nachgewiesen werden, lediglich die Kombination mit verstärkter Bewegung unter Einbeziehung der Familien / Eltern zeigt vermehrt Effektivität. Die Änderung des Rauchverhaltens bei Schwangeren wird am ehesten dann erreicht, wenn als Autoritäts- oder Fachpersonen wahrgenommene Gruppen im Programm beteiligt werden, etwa Ärzte oder Hebammen. Auch im Bereich Depression scheint sich zu zeigen, dass rein edukative Ansätze kaum Wirkung zeigen, jedoch Programme mit verhaltenstherapeutischen Ansätzen eher effektiv sind."
Auf der anderen Seite erkennen sie aber auch einige wenige erfolgversprechende Konzepte, etwa im Bereich Bewegung. Im Handlungsfeld Frauen und Mädchen und Bewegung existieren zwei zumindest teilweise effektive Studien, die von ihnen als " stark empfehlenswert" eingestuft werden. Diese Studien schlossen eine vorherige Befragung der Zielgruppe ein und integrierten möglichst alle Beteiligten wie Schule, Gemeinde etc. Auch für andere Maßnahmefelder (Ernährung, Ernährung und Bewegung, Rauchen, Prävention von Depressionen) finden sie einige hoffnungsvolle Ansätze.
Für dringend erforderlich halten sie gesetzliche Vorgaben, damit endlich eine wissenschaftlich fundierte Bewertung von Präventions- und Gesundheitsförderungsmaßnahmen erfolgen kann: "Auf Grund der Heterogenität der Erhebungsmethoden und der Effektparameter sollte der Gesetzgeber dafür Sorge tragen, dass bundesweit einheitliche Evaluationsstandards erarbeitet werden. Nach dem Ablauf einer genügend großen Zahl von Interventionen und nachfolgender Evaluation können dann Empfehlungen ausgearbeitet werden, welche Interventionstypen Erfolg versprechend sind. Der Gesetzgeber sollte daher auch vorsehen, dass in einem angemessenen Zeitraum eine umfassende Zusammenführung der durchgeführten Interventionen beziehungsweise ihrer Evaluationen erfolgt."
• Pressemitteilung der Hans-Böckler-Stiftung "Studie von Gesundheitsökonomen der Uni Köln: Qualitätssicherung von Präventionsprogrammen hat international große Defizite
• Zusammenfassung der Studienergebnisse: International erfolgreiche Interventionen der Prävention und ihre Übertragbarkeit auf Deutschland
• Die komplette Studie (PDF, 208 Seiten): G. Klever-Deichert, A. Gerber, MA Schröer, E. Plamper: International erfolgreiche Interventionen der Prävention und Gesundheitsförderung und ihre Übertragbarkeit auf Deutschland. Entwicklung und exemplarische Anwendung eines Bewertungsinstruments
Gerd Marstedt, 23.10.2007
Stringentere Geschwindigkeitskontrollen sind zur Unfall-Prävention überaus effektiv, Bußgelderhöhungen eher fragwürdig
 Verkehrssünder sollen künftig tiefer in die Tasche greifen. Das Bundesverkehrsministerium kündigte an, dass Bußgelder bei Verkehrsverstößen ab 2008 drastisch angehoben werden - in einigen Fällen um bis zu 100 Prozent. Die Maßnahme ist nach Aussage von Bundesverkehrsminister Tiefensee präventionsorientiert und soll dazu dienen, dass "Verkehrsrowdys ihr Verhalten ändern". Kritik meldeten jedoch der Auto-Club Europa (ACE) an ("reine Geldscheffelei") und der ADAC an: "Höhere Bußgelder bedeuten in erster Linie Mehreinnahmen für den Staat, aber noch nicht mehr Verkehrssicherheit. Das zeigt der Vergleich mit dem europäischen Ausland, wo trotz drastischer Strafen oftmals höhere Unfallzahlen zu beklagen sind," erklärte Ulrich Klaus Becker, ADAC-Vizepräsident für Verkehr. "Verkehrssicherheit erhöht man nicht allein durch einen tieferen Griff in den Geldbeutel des Autofahrers." Nötig seien intensivere Verkehrskontrollen an Gefahrenstellen und eine Strafverschärfungen bei gefährlichen Vergehen wie Alkohol- und Drogenfahrten und hohen Geschwindigkeitsüberschreitungen.
Verkehrssünder sollen künftig tiefer in die Tasche greifen. Das Bundesverkehrsministerium kündigte an, dass Bußgelder bei Verkehrsverstößen ab 2008 drastisch angehoben werden - in einigen Fällen um bis zu 100 Prozent. Die Maßnahme ist nach Aussage von Bundesverkehrsminister Tiefensee präventionsorientiert und soll dazu dienen, dass "Verkehrsrowdys ihr Verhalten ändern". Kritik meldeten jedoch der Auto-Club Europa (ACE) an ("reine Geldscheffelei") und der ADAC an: "Höhere Bußgelder bedeuten in erster Linie Mehreinnahmen für den Staat, aber noch nicht mehr Verkehrssicherheit. Das zeigt der Vergleich mit dem europäischen Ausland, wo trotz drastischer Strafen oftmals höhere Unfallzahlen zu beklagen sind," erklärte Ulrich Klaus Becker, ADAC-Vizepräsident für Verkehr. "Verkehrssicherheit erhöht man nicht allein durch einen tieferen Griff in den Geldbeutel des Autofahrers." Nötig seien intensivere Verkehrskontrollen an Gefahrenstellen und eine Strafverschärfungen bei gefährlichen Vergehen wie Alkohol- und Drogenfahrten und hohen Geschwindigkeitsüberschreitungen.
Tatsächlich weckt das Vorhaben, das allein auf finanzielle Sanktionen setzt und auf eine stringentere Verkehrsüberwachung und systematischere Geschwindigkeitskontrollen verzichtet, den Verdacht, dass hier weniger Unfall-Prävention als sehr viel eher Haushalts-Mehreinnahmen als Zielsetzung im Vordergrund stehen. Eine Reihe internationaler Studien hat andererseits in den letzten Jahren gezeigt, dass Geschwindigkeitskontrollen durch Kamera-Überwachung ("Radarfallen") eine überaus effektive Maßnahme zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und Reduzierung von Unfällen sind.
Im Großraum Barcelona fand im Zeitraum 2001-2005 eine mehrjährige Beobachtungsstudie statt, deren Ergebnisse jetzt in der Zeitschrift "American Journal of Public Health" veröffentlicht wurden. Auf dem etwa 24 km langen Autobahnring rund um die Stadt wurden 8 Kameras zur Geschwindigkeitskontrolle verwendet, die an unterschiedlichen und wechselnden Standorten aufgestellt wurden. Autofahrer wurden über die Medien ausführlich über diese Maßnahme informiert, und auch auf der Autobahn selbst wies eine große Zahl von Warnschildern ("Radarkontrolle") auf die Überwachung des Tempolimits von zumeist 80 km/h hin. Unfälle wurden über einen mehrjährigen Zeitraum - vor, während und noch zwei Jahre nach der neuen Geschwindigkeitskontrolle - minutiös protokolliert. Als Ergebnis zeigte sich, dass die Unfallzahl am Ende auf 75% des vorherigen Niveaus gesunken war. Für die als Vergleich herangezogene Stadtautobahn (ohne Kamera-Überwachung) zeigte sich keine Veränderung. Im Einzelnen bedeutete dies auf dem Autobahnring eine jährliche Reduktion von
• 638 auf 486 Zusammenstösse,
• 946 auf 696 Verletzungen von Personen,
• 1466 auf 1108 beteiligte Unfallfahrzeuge.
Ein Abstract der Studie ist hier nachzulesen: Katherine Pťrez u.a.: Reducing Road Traffic Injuries: Effectiveness of Speed Cameras in an Urban Setting (American Journal of Public Health, September 2007, Vol 97, No. 9, 1632-1637)
Bereits zwei Jahre zuvor hatte eine Übersichtsstudie, veröffentlicht in der Zeitschrift "British Medical Journal (BMJ)" insgesamt 14 Studien ausgewertet und war zu einem ähnlichen Ergebnis gekommen. Mit einer Ausnahme zeigten alle Untersuchungen, dass die Zahl der Verkehrsunfälle nach der Einführung verschärfter Geschwindigkeitskontrollen gesunken war, teilweise über einen Zeitraum von 4,6 Jahren nach Beginn der Maßnahmen. Die Zahl der Unfälle sank in den einzelnen Studien um 5%-69%, die Zahl der Verletzungen von Personen um 12%-65% und die Zahl der unfallbedingten Todesfälle um 17-71%.
Die Studie ist hier im Volltext nachzulesen: Paul Pilkington, Sanjay Kinra: Effectiveness of speed cameras in preventing road traffic collisions and related casualties: systematic review (BMJ 2005;330:331-334)
Gerd Marstedt, 8.10.2007
Pro und Contra zu Nutzen und Implementation der HPV-Impfung: Schwerpunkt-Thema im Canadian Medical Association Journal
 Mit der Wirksamkeit und möglichen Alternativen zu der von einer Allianz aus Impfstoffherstellern, Ärzten und Krankenkassen zum "Durchbruch in der Krebsprävention" hochstilisierten Impfung gegen den Humanen Papillom Virus (HPV) als Leistung der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) hat sich das Forum bereits umfangreich und kritisch beschäftigt.
Mit der Wirksamkeit und möglichen Alternativen zu der von einer Allianz aus Impfstoffherstellern, Ärzten und Krankenkassen zum "Durchbruch in der Krebsprävention" hochstilisierten Impfung gegen den Humanen Papillom Virus (HPV) als Leistung der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) hat sich das Forum bereits umfangreich und kritisch beschäftigt.
Mittlerweile bezahlen praktisch alle gesetzlichen Krankenkassen aus Wettbewerbsgründen ihren jungen weiblichen Mitgliedern die Impfung und auch die Gynäkologen bieten bei jeder sich bietenden Gelegenheit die Impfung an und dies ohne weitere Abwägung der z. B. bei älteren jungen Frauen mit langjährigem Geschlechtsleben möglichen Unwirksamkeit oder wesentlich geringeren Wirksamkeit der Impfung - so jedenfalls persönliche Berichte.
Trotzdem geht die kritische Debatte im In- und Ausland weiter.
Ein ausländisches Beispiel findet sich in mehreren Pro- und Contra-Aufsätzen und Kommentaren einer Schwerpunktnummer der neuesten Ausgabe (28 August 2007; Vol. 177, No. 5) des "Canadian Medical Association Journal (CMAJ)" zur HPV-Impfung, die sämtliche kostenfrei zugänglich sind.
In dem Editorial (CMAJ 2007;177 433) "Human papillomavirus vaccine: waiting for a miracle" weisen Noni MacDonald und Paul C. Hťbert neben der Anerkennung, dass Forscher und Industrie ein derartiges Impfprodukt entwickelt haben (in der Tat gelten Impfstoffe in der Pharmaindustrie nicht unbedingt als so genannte "blockbusters" und werden daher vielfach vernachlässigt), auf die Vielzahl der erst zu klärenden Fragen hin: "There is still a lot to do. Despite a great beginning, there are many unanswered questions pertaining to long-term efficacy, optimal dosing, overall effectiveness against HPV in the real world and optimal delivery modalities in high-risk and impoverished populations."
In ihrem Aufsatz (CMAJ 2007;177 464-468) "Estimating the number needed to vaccinate to prevent diseases and death related to human papillomavirus infection" schätzen Marc Brisson; Nicolas Van de Velde, Philippe De Wals und Marie-Claude Boily die Anzahl von Frauen, die geimpft werden müssen (number needed to vaccinate) , um einige der erwarteten Erfolge erreichen zu können.
Es sind 8, um eine Episode mit Genitalwarzen zu verhindern und 324 um einen Fall von Zervikalkrebs zu verhindern. Ob diese Anzahl nun hoch oder niedrig ist, hängt von der tatsächlichen Wirkungsdauer der Impfung und weiteren Trends ab, die noch lange nicht geklärt sind.
Brisson et al. formulieren dies so: "When vaccine protection is assumed to be lifelong, the predicted numbers needed to vaccinate are low. This prediction reflects the high efficacy of prophylactic HPV vaccination reported in the clinical trials and the fact that the annual incidence of HPV-related diseases remains high in Canada despite current screening programs. However, if the mean duration of protection conferred by HPV vaccination is less than 30 years, the efficacy of the vaccine at preventing cervical cancer is predicted to be limited, unless booster doses are given."
Und abschließend: "However, the benefits (particularly in terms of cervical cancer reduction) are highly dependent on the duration of vaccine protection, on which evidence is currently limited. Recommendations regarding HPV vaccination should take into account the uncertainty regarding long-term vaccine efficacy. If mass HPV vaccination is implemented, cervical cancer screening must continue among vaccinated women, and careful long-term post-vaccination surveillance of vaccine fficacy will be essential."
In einem weiteren Aufsatz (CMAJ 2007;177 469-479) "Prophylactic vaccination against human papillomavirus infection and disease in women: a systematic review of randomized controlled trials" zeigen Lisa Rambout, Laura Hopkins, Brian Hutton und Dean Fergusson, dass eine prophylaktische HPV-Impfung hochwirksam zur Prävention impfstoffspezifischer HPV-Infektionen und Gebärmutterhalserkrankungen beiträgt.
In der Interpretation der von ihnen reviewten RCT-Studien zur HPV-Impfung formulieren sie aber mehrere Einschränkungen und Vorbedingungen für diese hohe Wirksamkeit: "Among women aged 15-25 years not previously infected with vaccine-type HPV strains, prophylactic HPV vaccination appears to be highly efficacious in preventing HPV infection and precancerous cervical disease. Long-term follow-up is needed to substantiate reductions in cervical cancer incidence and mortality" und "In summary, our systematic review demonstrates that prophylactic HPV vaccination is highly efficacious in preventing vaccine type-specific HPV infection and precancerous cervical disease, particularly among women aged 15-25 years with no prior abnormal results from Pap screening and no more than 6 lifetime sexual partners."
In dem Kommentar (CMAJ 2007;177 484-487) "Human papillomavirus, vaccines and women's health: questions and cautions" stellen Abby Lippman, Ryan Melnychuk, Carolyn Shimmin und Madeline Boscoe einige generelle Fragen und erheben Warnungen gegen ein überstürztes flächendeckendes Angebot derartiger Impfungen.
Dabei betonen sie, dass es im Moment keine Zervixkarzinom-Epidemie oder eine bedrohliche Situation gäbe, die es notwendig machen würde, ein Massen-Impfprogramm aufzubauen: "There is no epidemic of cervical cancer in Canada to warrant the sense of urgency for a vaccination program initiated by the federal finance minister's announcement. According to 2006 Canadian cancer statistics,4 cervical cancer is the 11th most frequent cancer affecting Canadian women and the 13th most common cause of cancer-related deaths, accounting for approximately 400 deaths per year. Both the incidence and mortality of cervical cancer have been declining in Canada, as in other resource-rich countries, although recently at a somewhat slower rate than has been observed in previous decades."
Die Autorinnen weisen auf erhebliche Erkenntnislücken - zwar nur in Kanada, aber ist das in Deutschland besser!? - über die Prävalenz des HPV bei Kindern und jungen Frauen hin. In Kanada fehlt auch noch jegliche Verständigung über die konkreten Ziele, die man mit der Impfung erreichen will. Je nachdem, ob man die Ausrottung des Virus erreichen will oder die Anzahl der mit Gebärmutterhalskrebs gestorbenen Frauen senken, muss ein Programm anders aussehen.
Ihre Kritik an der öffentlichen Debatte und an anderen Autoren dieser Ausgabe gipfelt in mehreren Feststellung, die wegen ihrer Bedeutung und Hintergründigkeit ausnahmsweise sehr ausführlich im Original zitiert werden: "Information about the efficacy of Gardasil (einer der Impfstoffe auf dem kanadischen Markt) remains uncertain. Its real-world effectiveness is even less clear. To date, only a handful of randomized controlled trials of sufficient quality to qualify for systematic review have been reported. Interestingly, each of the reported HPV vaccine trials, whether of Gardasil or its potential competitor Cervarix, was funded in whole or in part by the vaccine's manufacturer."
Der nächste Satz ist der Auftakt zu einem Hinweis, der tiefe Einblicke in die Vermarktungsstrategie dieses Impfstoffs zulässt. Er lautet: "Furthermore, we lack data on the effectiveness of the HPV vaccine when co-administered with other immunizations, as may occur in real practice. As well, will such factors as a person's nourishment, smoking status and general health (e.g., comorbidities) influence the safety or usefulness of the HPV vaccine? Perhaps more importantly, might misunderstandings about what the vaccine does and does not do lead to reductions in safer sex practices and Pap screening rates?"
Der angekündigte Einblick gelingt, wenn man der Bemerkung von Lippman et al. Glauben schenkt, dass diese Fragen in Kanada bereits "at the Research Priorities Workshop in Quebec City in November 2005," gestellt worden sind. Aber: "they remain pertinent ó and unanswered."
Drei weitere Aufsätze runden das interessante Informations- und Analysenangebot dieser CMAJ-Ausgabe ab: Es handelt sich um den Aufsatz "Feasibility of self-collection of specimens for human papillomavirus testing in hard-to-reach women" von Gina Ogilvie et al. (CMAJ 2007;177 480-483) , der zeigt, dass es möglich ist an die hoch gefährdete Gruppe sozial randständiger Frauen mit dem Ziel heranzukommen, sie dazu zu bringen, selbst Proben für HPV-Tests einzusammeln.
Außerdem wird ein Informationsblatt für PatientInnen vorgestellt: "Patient information about HPV and the HPV vaccine" von Tave van Zyl et al. (CMAJ 2007;177 462) . In diesem Blatt findet sich im übrigen eine sehr zurückhaltend geschätzte Schutzdauer durch die Impfung von 5,5 Jahren.
In dem Aufsatz (CMAJ 2007;177 456-461) "Human papillomavirus vaccines launch a new era in cervical cancer prevention" stellen die Autoren um Meenakshi Dawar zum einen auch eine Vielzahl von "knowledge gaps" besonders über die langfristige Wirksamkeit fest, halten dies aber jedem neuen Impfprogramm für üblich. Ihr Fazit: "We strongly recommend a universal publicly funded vaccination program aimed at immunizing adolescent females before they are at risk of HPV infection."
Bernard Braun, 29.8.2007
Förderprogramme für Kinder aus unterprivilegierten Familien verhelfen zu besseren Bildungschancen und Lebensbedingungen
 Vorschulkinder aus Familien mit Niedrigeinkommen, die im Alter von 3-4 Jahren an speziellen Schulprogrammen teilgenommen haben, zeigen rund 20 Jahre später im Vergleich zu Kontrollgruppen, dass sie erheblich besser im Leben zurechtkommen. Sie weisen öfter einen höheren Schulabschluss auf, waren seltener inhaftiert, haben häufiger eine feste Arbeitsstelle und zeigen in geringerem Ausmaß Symptome depressiver Erkrankungen. Eine jetzt in der Zeitschrift "Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine" veröffentlichte Studie hat Daten von insgesamt 1.500 Männern und Frauen im Alter von etwa 25 Jahren miteinander verglichen. Etwa 1.000 von ihnen hatten als 3-4jährige Vorschulkinder vor etwa 20 Jahren an einem speziell Förderprogramm teilgenommen, rund 550 wurden als Kontrollgruppe verwendet, die im selben Alter lediglich eine ganztätige Kindergarten-Betreuung erfahren hatten.
Vorschulkinder aus Familien mit Niedrigeinkommen, die im Alter von 3-4 Jahren an speziellen Schulprogrammen teilgenommen haben, zeigen rund 20 Jahre später im Vergleich zu Kontrollgruppen, dass sie erheblich besser im Leben zurechtkommen. Sie weisen öfter einen höheren Schulabschluss auf, waren seltener inhaftiert, haben häufiger eine feste Arbeitsstelle und zeigen in geringerem Ausmaß Symptome depressiver Erkrankungen. Eine jetzt in der Zeitschrift "Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine" veröffentlichte Studie hat Daten von insgesamt 1.500 Männern und Frauen im Alter von etwa 25 Jahren miteinander verglichen. Etwa 1.000 von ihnen hatten als 3-4jährige Vorschulkinder vor etwa 20 Jahren an einem speziell Förderprogramm teilgenommen, rund 550 wurden als Kontrollgruppe verwendet, die im selben Alter lediglich eine ganztätige Kindergarten-Betreuung erfahren hatten.
Während der gesamten Laufzeit der Studie, der sogenannten "Chicago Longitudinal Study" waren von allen Teilnehmern kontinuierlich Daten erhoben worden, über Befragungen oder auch aus verfügbaren offiziellen Statistiken. So sammelte man Hinweise über den Gesundheitszustand, über Verhaftungen und Verurteilungen, über Bildungsabschlüsse und den beruflichen Werdegang. Im Vergleich der beiden Gruppen im Alter von 24 Jahren zeigte sich dann, dass die zwei Jahrzehnte zurück liegenden vorschulischen Fördermaßnahmen gleichwohl nicht unbeträchtliche Erfolge aufwiesen.
• 71.4% der speziell geförderten Kinder hatten den Abschluss einer High School geschafft (12.Klasse) im Vergleich zu 63.7% der Kontrollgruppe
• 70.2% konnten sich eine Krankenversicherung leisten (Kontrollgruppe: 61.5%)
• 16.5% waren schon einmal wegen eines Verbrechens verhaftet worden (Kontrollgruppe: 21.1%)
• 12.8% hatten schon einmal Symptome einer Depression gezeigt (Kontrollgruppe: 17.4%)
• 42.7% hatten einen Vollzeit-Arbeitsplatz (Kontrollgruppe: 36.4%)
• 13.8% waren schon einmal aufgrund von Gewalt-Delikten inhaftiert worden (Kontrollgruppe: 17.9%)
• 4.4% erhielten finanzielle staatliche Unterstützung aufgrund einer Behinderung (Kontrollgruppe: 7%)
Einige der Studienteilnehmer hatten an den vorschulischen Förderprogrammen nicht nur zwei, sondern sogar fünf oder sechs Jahre lang teilgenommen. Bei ihnen zeigte sich, wie zu vermuten, dass sie noch deutlich höhere Erfolgsquoten aufwiesen, etwa was den Bildungsabschluss oder auch die Erwerbstätigkeit anbetraf.
Die Förderprogramme fanden in speziellen Schulzentren statt, die Lehrer waren pädagogisch besonders ausgebildet, darüber hinaus bekamen die Eltern der Kinder bei Bedarf auch besondere Unterstützung durch Pädagogen, Krankenschwestern oder auch Lehrer. Das Vorschulprogramm fand an fünf Tagen in der Woche für jeweils drei Stunden statt und umfasste auch eine sechswöchige Sommerphase mit vielfältigen Veranstaltungen.
Die Wissenschaftler aus Minneapolis erörtern in ihrem Aufsatz, dass vermutlich vier unterschiedliche Faktoren für diesen Erfolg maßgeblich waren. Erstens: Der frühe Beginn der Förderung im Alter von nur 3 Jahren, der den Kindern zu emotionaler Stabilität verhilft, so dass sie den Übergang zur Schule besser bewältigen. Zweitens: Die besondere pädagogische Qualifikation der Lehrer. Drittens: Die Unterrichtsinhalte, die das Verstehen von Zusammenhängen besonders fördern und auch andere, in der Schule verlangte Kompetenzen. Viertens: Die zusätzlichen Unterstützungen für die Familien.
Die Unterschiede zwischen den geförderten Kindern und jenen, die nur eine Ganztags-Betreuung im Kindergarten hatten, mögen zwar eher moderat erscheinen. Allerdings, so argumentieren die Forscher abschließend in ihrem Artikel, verursachen diese Differenzen hochgerechnet auf die unterprivilegierten Kinder in den USA ganz erhebliche Kosten: Im Bereich der Sozialhilfe, im Gesundheitswesen und im Strafvollzug. Und auf der anderen Seite werden die zusätzlichen Kosten für die Förderprogramme allemal aufgewogen durch Einsparungen in eben diesen genannten Sektoren.
Hier ist das Abstract der Studie: Effects of a School-Based, Early Childhood Intervention on Adult Health and Well-being: A 19-Year Follow-up of Low-Income Families Free (Arch Pediatr Adolesc Med. 2007;161(8):730-739)
Kostenlos verfügbar ist auch der Volltext der Studie
Gerd Marstedt, 7.8.2007
Gewalt unter Schulkindern: Viele Studien belegen den (zumindest kurzfristigen) Erfolg von Präventionsprogrammen
 Gewalt unter Schulkindern, in Form von Mobbing, Schlägereien oder Diebstahl, kann durch spezielle Präventionsprogramme durchaus erfolgreich bekämpft werden. Eine Meta-Analyse von 56 veröffentlichten Studien zum Thema der Gewaltprävention bei Kindern und Jugendlichen, die noch schulpflichtig sind, hat jetzt gezeigt, dass "gewisse Erfolge" nachweisbar sind, zumindest für einen Zeitraum von etwa einem Jahr nach Beginn der Intervention. Die in der jetzt veröffentlichten Cochrane-Studie einbezogenen Präventionsmaßnahmen waren dabei zumeist erfolgreicher, wenn sie das Sozialverhalten der Schülerinnen und Schüler insgesamt ansprachen, durch Übungen oder Spiele zur Verbesserung der Sozialkontakte und der persönlichen Sozialtechniken (Kommunikation, Konfliktlösung usw.) Nicht ganz so erfolgreich waren Interventionen, in denen nur gelernt wurde, auf Provokationen und Aggressionen mit Nicht-Beachtung zu reagieren.
Gewalt unter Schulkindern, in Form von Mobbing, Schlägereien oder Diebstahl, kann durch spezielle Präventionsprogramme durchaus erfolgreich bekämpft werden. Eine Meta-Analyse von 56 veröffentlichten Studien zum Thema der Gewaltprävention bei Kindern und Jugendlichen, die noch schulpflichtig sind, hat jetzt gezeigt, dass "gewisse Erfolge" nachweisbar sind, zumindest für einen Zeitraum von etwa einem Jahr nach Beginn der Intervention. Die in der jetzt veröffentlichten Cochrane-Studie einbezogenen Präventionsmaßnahmen waren dabei zumeist erfolgreicher, wenn sie das Sozialverhalten der Schülerinnen und Schüler insgesamt ansprachen, durch Übungen oder Spiele zur Verbesserung der Sozialkontakte und der persönlichen Sozialtechniken (Kommunikation, Konfliktlösung usw.) Nicht ganz so erfolgreich waren Interventionen, in denen nur gelernt wurde, auf Provokationen und Aggressionen mit Nicht-Beachtung zu reagieren.
Gewalt in der Schule ist nicht nur in den USA ein Thema, das immer wieder aufgrund eines tödlichen Schusswaffengebrauchs von Schülern und Studenten in den Medien-Schlagzeilen auftaucht. Auch in Deutschland ist seit dem Amoklauf am Gutenberg-Gymnasium in Erfurt mit 17 Toten im April 2002 das Thema Gewalt an Schulen aus der vermeintlichen Banalität des Mobbens und "Abziehens" entrückt. Weltweit, so hat eine Studie hochgerechnet, sterben jährlich 565 Kinder und Jugendliche an den Folgen gewalttätiger Übergriffe durch Gleichaltrige. Mehr als jeder dritte Student in den USA gab in einer jüngeren Umfrage an, dass er in den letzten 12 Monaten in eine körperliche Auseinandersetzung verwickelt war. In Großbritannien waren sich 25% der befragten 14-15jährigen Schüler sicher, dass ein Teil ihrer Freunde Waffen mit in die Schule mitbringt. (Literaturhinweise hierzu in der Cochrane-Studie) Nach einer Studie der Ruhr-Universität Bochum 2004 unter 4.000 Schülern der achten Klassen sämtlicher Schulformen in Bochum hat "jeder fünfte Hauptschüler einen anderen Jugendlichen schon einmal so brutal verprügelt, dass dieser zum Arzt musste." (Wikipedia: Gewalt an Schulen) Mittlerweile gibt es in Deutschland schon Websites, die sich nur diesem Thema widmen, wie zum Beispiel Gewalt in der Schule oder Gewalt an Schulen.
Die Cochrane-Studie analysierte eine Vielzahl schon veröffentlichter Berichte über Präventionsmaßnahmen, die sich explizit zum Ziel gesetzt hatten, Aggression, Gewalt, Mobbing oder häufige Konflikte und Streitigkeiten bei schulpflichtigen Kindern zu reduzieren. Insgesamt 56 Studien erfüllten die methodischen Anforderungen der Wissenschaftler. Dabei zeigte sich eine erhebliche Bandbreite sowohl der jeweils einbezogenen Schülerzahl als auch der Vorgehensweisen. Diese reichten von einer einmaligen, etwa zweistündigen Diskussionsrunde bis hin zu regelmäßigen Übungen und Unterrichtsstunden, die über Zeitraum von zwei Jahren verteilt waren. Auch hinsichtlich der Konzepte variierten die Interventionen, die teilweise eine generelle Gewaltprävention unter Teilnahme aller Schüler anzielten, teilweise aber auch nur Maßnahmen für solche Kinder und Jugendliche erprobten, die bereits verhaltensauffällig geworden waren.
Ein Manko der Cochrane-Studie ist wohl darin zu sehen, dass trotz dieser im Detail beschrieben sehr großen Variation der unterschiedlichen Maßnahmen kein Versuch unternommen wird, die Bedeutung dieser unterschiedlichen Vorgehensweisen für den jeweils erzielten Erfolg oder Misserfolg näher zu diskutieren. Berichtet werden stattdessen nur relativ allgemeine Befunde und Schlussfolgerungen:
• In 34 der 56 Studien konnte das aggressive Verhalten von Studienteilnehmern signifikant reduziert werden.
• In 7 Studien, die das Verhalten der Schüler über einen längeren Beobachtungszeitraum (von 12 Monaten) kontrollierten, blieb dieser Effekt auch zum Ende der Studienphase so bestehen.
• Interventionen, die eine allgemeinere und komplexere Zielsetzung verfolgten, nämlich Verbesserungen im Sozialverhalten der Schüler generell durch Aneignung unterschiedlicher Sozialfertigkeiten, waren zumeist erfolgreicher als Maßnahmen, die nur darauf abzielten, eine spezielle Technik (Nicht-Beachtung) im Umgang mit Aggressionen und Provokationen zu üben.
Ein kostenloses Abstract der Studie ist hier zu finden: Cochrane review: School-based secondary prevention programmes for preventing violence
Gerd Marstedt, 6.8.2007
Gesundheitsexperten: Ausgaben für Prävention sind wichtiger als solche für Kuration
 Die jetzige und auch alle früheren Gesundheitsreformen haben die massiven Interessenkonflikte um Finanzierungsströme im Gesundheitssystem zwischen Fach- und Hausärzten, Krankenhäusern, Pharmaindustrie und Apotheken verdeutlicht. Der Anteil am GKV-Ausgabenkuchen für die einzelnen Leistungsanbieter wird sehr viel eher bestimmt von der Durchschlagskraft ihrer Lobbyisten als von Effizienz- und Nutzenberechnungen oder Patienteninteressen. Doch wie sähe es aus, wenn man dieses politische Hintertür-Gerangel außer Kraft setzt und Mediziner und Gesundheitsexperten frei entscheiden ließe, welche medizinischen und pflegerischen Leistungen vorrangig und welche mit eher nachgeordneter Priorität zu finanzieren sind?
Die jetzige und auch alle früheren Gesundheitsreformen haben die massiven Interessenkonflikte um Finanzierungsströme im Gesundheitssystem zwischen Fach- und Hausärzten, Krankenhäusern, Pharmaindustrie und Apotheken verdeutlicht. Der Anteil am GKV-Ausgabenkuchen für die einzelnen Leistungsanbieter wird sehr viel eher bestimmt von der Durchschlagskraft ihrer Lobbyisten als von Effizienz- und Nutzenberechnungen oder Patienteninteressen. Doch wie sähe es aus, wenn man dieses politische Hintertür-Gerangel außer Kraft setzt und Mediziner und Gesundheitsexperten frei entscheiden ließe, welche medizinischen und pflegerischen Leistungen vorrangig und welche mit eher nachgeordneter Priorität zu finanzieren sind?
Diese Fragestellung (nach Kriterien der Priorisierung in der Bevölkerung) hat ein Forscherteam aus England und Australien im Rahmen eines u.a. von der WHO finanzierten Projektes aufgegriffen. Sie befragten dazu rund 250 Teilnehmer an einem WHO-Kongress, allesamt Mediziner, Pharmazeuten oder Gesundheitswissenschaftler in unterschiedlicher beruflicher Position, tätig im Öffentlichen Gesundheitswesen oder auch bei Pharmaunternehmen, allesamt maßgebliche Entscheidungsträger in den Gesundheitssystemen ihrer Länder. Die Forscher wählten Teilnehmer aus Ländern mit einem mittleren Lebensstandard aus (Indonesien, Bulgarien, Iran, Indien, Südafrika, Thailand). Sie alle bekamen einen Fragebogen, auf dem 10 verschiedene Maßnahmen der Gesundheitsversorgung aufgelistet waren und sollten diese in eine Rangfolge von 1-10 bringen, je nachdem, für wie wichtig sie die einzelnen Leistungen hielten. Die 10 Maßnahmen waren:
1.) Krankheitsverhütung bei Kindern (z.B. Impfungen)
2.) Nichtraucher-Kampagnen für Kinder
3.) Hausärztliche medizinische Versorgung bei alltäglichen Erkrankungen
4.) Brustkrebs-Früherkennungsuntersuchungen (Screening)
5.) Intensivpflege für Säuglinge nach der Geburt
6.) Unterstützung für pflegende Angehörige
7.) Behandlung schizophrener Patienten
8.) Versorgung mit künstlichen Hüftgelenken
9.) Herztransplantationen
10.) Krebstherapien für Raucher
Die Maßnahmen waren in einer völlig anderen Reihenfolge als in der obigen Liste vorgegeben. Diese Liste gibt jedoch wieder, in welcher Reihenfolge die Befragungsteilnehmer die einzelnen Leistungen nach ihrer Wichtigkeit einstuften. Danach zeigt sich also unter dem Strich, dass präventive Maßnahmen und insbesondere Leistungen für Kinder ganz vorne rangieren. Weit hinten finden sich Therapien zur Verlängerung des Lebens oder zur Verbesserung der Lebensqualität. Zwischen den beteiligten Ländern fanden sich auch einige Unterschiede, etwa, was die Einstufung der Maßnahmen zur Therapie schizophrener Patienten anbetraf. Unter dem Strich fanden die Wissenschaftler jedoch eine sehr hohe Übereinstimmung. Überraschend war für das Forscherteam auch, dass sich die aus Südafrika stammenden Teilnehmer aus dem Öffentlichen Gesundheitswesen und solche aus Pharma-Unternehmen in ihren Bewertungen kaum unterschieden.
Zur gesundheitspolitischen Bedeutung ihrer Studie hoben die Wissenschaftler hervor, dass die Prioritätensetzung der befragten Experten in krassem Widerspruch steht zu den tatsächlich zu beobachtenden Finanzierungsströmen für die Gesundheitsversorgung: "Diese starke und übereinstimmend höhere Gewichtung präventiver gegenüber kurativen Leistungen steht in erheblichem Widerspruch zu den tatsächlichen Finanzierungsprioritäten in den meisten Ländern der Welt. Im Jahre 2004 entfielen bei den OECD-Mitgliedsstaaten lediglich 2.8 Prozent der öffentlichen und privaten Gesundheitsausgaben auf Präventionsprogramme."
Die Studie ist hier im Volltext in der Zeitschrift "PLOS Medicine" (February 20, 2007) nachzulesen: What Drives Health-Care Spending Priorities? An International Survey of Health-Care Professionals
Die Meinung der hier befragten ausländischen Gesundheitsexperten untermauert noch einmal die Kritik an der übergewichtigen Rolle von Kuration im Vergleich zur Prävention, die auch in Deutschland schon mehrfach geäußert worden ist. Diese Kritik findet sich beispielsweise im Gutachten des Sachverständigenrats zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen 2000/2001 "Bedarfsgerechtigkeit und Wirtschaftlichkeit - Bd. I: Zielbildung, Prävention, Nutzerorientierung und Partizipation". In einer Zusammenfassung der dort hervorgehobenen Defizite äußern sich auch Stefan Greß, Stephanie Maas und Jürgen Wasem in ihrer Expertise für die Hans-Böckler-Stiftung Effektivitäts-, Effizienz- und Qualitätsreserven im deutschen Gesundheitssystem wie folgt: "Vernachlässigung von Prävention. Da die Heilungschancen bei chronischen Krankheiten gering sind, sei eine frühzeitige Prävention wichtig. Gerade für chronische Krankheiten bestehe eine deutliche Unterversorgung im Bereich der Primärprävention. Der SVR sieht ein starkes Missverhältnis zwischen der Überversorgung im Bereich der kurativen Behandlung und der Unterversorgung im Bereich der Prävention und Rehabilitation von chronisch Kranken."
Gerd Marstedt, 21.2.2007
Fußgängerfreundliche Stadtplanung fördert körperliche Bewegung und verhindert Übergewicht
 Fußgängerfreundlich gestaltete Stadtteile sind überaus gesundheitsförderlich: Bürger, die das Glück oder Geld haben, um in Wohngegenden mit Parks und Restaurants, mit Geschäften und Spazierwegen zu leben, sind aufgrund dieser Infrastruktur auch körperlich mehr in Bewegung und sind seltener von Übergewicht betroffen. Dies zeigten jetzt drei unabhängig voneinander durchgeführte Studien aus unterschiedlichen Regionen der USA.
Fußgängerfreundlich gestaltete Stadtteile sind überaus gesundheitsförderlich: Bürger, die das Glück oder Geld haben, um in Wohngegenden mit Parks und Restaurants, mit Geschäften und Spazierwegen zu leben, sind aufgrund dieser Infrastruktur auch körperlich mehr in Bewegung und sind seltener von Übergewicht betroffen. Dies zeigten jetzt drei unabhängig voneinander durchgeführte Studien aus unterschiedlichen Regionen der USA.
Eine Studie der University of Washington untersuchte bei über 900 Senioren (Alter 65-93) aus dem Staat Washington im Nordwesten der USA einerseits anhand von Angabe der älteren Bürger, wann und wie oft sich diese körperlich bewegen, zum Einkaufen oder auch bei Spaziergängen. Diese Angaben wurden dann verglichen mit Daten zur jeweiligen Wohngegend, wobei Indikatoren herangezogen wurden wie Zahl der Geschäfte und Restaurants, Intensität des Straßenverkehrs, Ausdehnung der Wohnblocks, Fußgänger- und Fahrradwege. Die Wohnquartiere wurden dann entsprechend ihrer "Fußgängerfreundlichkeit" in verschiedene Gruppen unterteilt. Es zeigte sich, dass die Quote für körperliche Bewegung bei den älteren Bürgern zwischen 30 und 600 Prozent schwankte, je nachdem, stark die Infrastruktur des Quartiers zum Gehen einlädt oder davon abhält. Die Studie wird in der März-Ausgabe des American Journal of Public Health veröffentlicht. Einen Vorab-Bericht findet man hier: 'Walkable' Communities May Make Elders Healthier
Zu denselben Ergebnissen kam auch ein Forschungsprojekt aus North Carolina, das bei knapp 7.000 Erwachsenen das Ausmaß körperlicher Aktivität durch Spaziergänge oder Fahrradfahren erfasste und diese Daten mit Angaben zur Wohngegend verglich. Dazu verwendeten sie Karten von 67 Distrikten des Bundesstaates und befragten Stadtplaner danach, ob und in welchem Maße in den Gegenden bewegungsfreundliche Infrastrukturen zu finden sind, in Form von Fußgänger- und Fahrradwegen, Grünflächen und Parks. Entsprechend diesen Angaben wurden die Wohnquartiere dann auf einer Skala von 1-4 eingestuft, von bewegungsfeindlich bis bewegungsfreundlich. Und auch hier zeigte sich ein deutlicher Zusammenhang zur körperlichen Aktivität der Bewohner. In bewegungsfreundlichen Stadtteilen lag der Anteil von Bürgern mit intensiver körperlicher Bewegung fast doppelt so hoch. Die Studie wird in der März/April-Ausgabe des American Journal of Health Promotion veröffentlicht. Hier ist ein Zeitungsbericht mit den wichtigsten Befunden: Urban Planners Wield Influence On Physical Activity Levels.
In einer weiteren Studie schließlich, durchgeführt in New York City, fanden Wissenschaftler heraus, dass Einwohner von New York, die in fussgängerfreundlichen Stadtteilen leben, deutlich seltener an Übergewicht leiden. Bei insgesamt etwa 13.000 Erwachsenen erfassten die Forscher des Columbia University Medical Center unterschiedliche sozialstatistische und gesundheitsbezogene Angaben, wie Einkommen, Bildungsniveau, Körpergröße und Gewicht sowie die Wohnadresse. Es zeigte sich dann, dass in gemischten Wohngegenden (mit Wohnungen, Geschäften und Betrieben) der Anteil übergewichtiger Bürger am niedrigsten war, verglichen mit reinen Wohngegenden und Quartieren mit rein kommerzieller Nutzung. Grundsätzlich ist ein solcher Zusammenhang plausibel, erklärten die Wissenschaftler. Dass er jedoch auch in einer Millionenstadt mit so großer Bevölkerungsdichte wie New York gefunden wurde, sei schon ein wenig überraschend. Und sie fügten hinzu: "Eine Mischung aus Wohnungen und Geschäften, bei der solche Möglichkeiten, einzukaufen oder etwas essen oder trinken zu gehen, ganz in der Nähe liegen, fördern die körperliche Bewegung. Man verlässt ja die Couch zu Hause nur dann für einen Einkauf zu Fuß, wenn es auch ein Geschäft in Reichweite gibt." Die wichtigsten Ergebnisse der Studie, die ebenfalls im März/April im American Journal of Health Promotion veröffentlicht wird (Rundle A, et al.: The urban built environment and obesity in New York City: A multilevel analysis, Am J Health Promot 21(4S), 2007) sind hier nachzulesen: Living Near Shops, Subways Linked To Lower BMI In New York City
Gerd Marstedt, 19.2.2007
Grippeschutzimpfungen: Kein stichhaltiger Beleg für ihren Nutzen?
 Alljährlich im Frühjahr rufen Ärzte wieder dazu auf, dass zumindest Ältere und Kinder, Patienten mit einem Grundleiden, Bewohner von Alten- und Pflegeheimen vorsorglich zur Grippeschutzimpfung gehen sollten. Die Impfung soll das Risiko der Influenza für Folgekrankheiten - Lungenentzündungen, Infektionen des Herzens oder Gehirns - und auch für Todesfälle nachhaltig reduzieren. Jetzt behauptet ein Wissenschafter im renommierten British Medical Journal jedoch: Es gibt keinerlei stichhalte Belege für die Wirksamkeit dieser Impfung.
Alljährlich im Frühjahr rufen Ärzte wieder dazu auf, dass zumindest Ältere und Kinder, Patienten mit einem Grundleiden, Bewohner von Alten- und Pflegeheimen vorsorglich zur Grippeschutzimpfung gehen sollten. Die Impfung soll das Risiko der Influenza für Folgekrankheiten - Lungenentzündungen, Infektionen des Herzens oder Gehirns - und auch für Todesfälle nachhaltig reduzieren. Jetzt behauptet ein Wissenschafter im renommierten British Medical Journal jedoch: Es gibt keinerlei stichhalte Belege für die Wirksamkeit dieser Impfung.
Tom Jefferson ist Immunologe am "Cochrane Vaccines Field" in Rom, eine immunologisch ausgerichtete Mitgliedsgesellschaft der berühmten Cochrane Collaboration, die die wissenschaftliche medizinische Literatur systematisch auswertet und bilanziert, und so das Vorgehen der Ärzte auf ihre wissenschaftliche Fundierung ("Evidenz") überprüft. Er hat eine Vielzahl wissenschaftlicher Veröffentlichungen zu Schutzimpfungen gegen die Influenza noch einmal genau unter die Lupe genommen und zweierlei festgestellt. Zum einen weist eine große Zahl der Untersuchungen so große methodische Mängel auf, dass die Befunde für ihn keine "Evidenz" (hieb- und stichfeste wissenschaftliche Beweise) für die behauptete Wirksamkeit der Impfung haben. Zum anderen werden Studien, die keine Effekte oder sogar negative Effekte zeigen, oftmals verschwiegen.
Im Einzelnen weist er auf viele Probleme hin, die das gesellschaftlich meist einhellige Urteil "Impfen schützt" zumindest bei der Influenza in Frage stellen. Das erste Problem besteht darin, dass es kaum "randomisierte" Studien gibt, also Versuchspläne, nach denen Patienten nach dem Zufallsprinzip einer Gruppe zugewiesen werden, mit und ohne Schutzimpfung, und bei ihnen dann später die Wirkung überprüft wird. Von daher ist eine Interpretation der Ergebnisse der methodisch weniger fundierten Studien schwierig. So fand Jefferson, dass nur 26 von 40 Berichten über den jeweils vorherrschenden Influenza-Typ informierten und nur 21 von 40 über den verwendeten Impfstoff. Da die Influenza-Erreger jedoch jedes Jahr anders ausfallen, ist dies eine zwingend notwendige Information zur Bewertung der Effekte. Andernfalls vergleicht man Äpfel mit Birnen.
Überdies zeigt er auf, dass eine der am häufigsten zitierten Studien über die Grippeimpfung bei Älteren ausschließlich unter Heimbewohnern durchgeführt wurde. Dass jedoch Erkenntnisse aus dem Krankheitsverlauf von Pflegepatienten nicht ohne Weiteres auf ältere Menschen schlechthin übertragen werden können, bedarf für Jefferson keiner weiteren Erläuterung. Bei keiner Studie, so führt er weiterhin aus, werde exakt zwischen Influenza und grippeartigen Erkrankungen unterschieden, weil die Symptome teilweise recht ähnlich ausfallen. Manche Untersuchungen legten auch nahe, dass ein Todesfall oft nachträglich als grippe-verursacht eingestuft wird.
Und auch vergleichende Studien zwischen Geimpften und nicht Geimpften seien wenig aussagekräftig. Denn wer sich impfen lasse, habe meist auch einen gesundheitsbewussteren, präventiven Lebensstil und oftmals auch sozial und materiell günstigere Lebensumstände. Die Zusammenhänge zwischen Präventionsneigung und Schichtzugehörigkeit sind hinlänglich bekannt. Von daher sei es jedoch auch denkbar, dass Geimpfte einfach weniger krankheitsanfällig sind. Methodisch schwach bis mangelhaft seien auch mehrere Studien über die Wirksamkeit der Impfung bei Kindern. Hierzu liegen insgesamt 10 Studien vor. Bei keiner konnte das Ausmaß der Wirksamkeit aufgrund methodischer Unzulänglichkeiten jedoch exakt belegt werden.
Auf der anderen Seite berichtet Jefferson über Studien, deren Ergebnisse oftmals unterdrückt werden. So hatten Impfungen bei einer Gruppe von Kleinkindern keine bessere Wirkung als in einer Vergleichsgruppe, die jedoch lediglich mit einem Placebo (Scheinmedikament ohne medizinische Wirkstoffe) geimpft wurden. Und eine weitere Studie unter älteren, aber gesunden Patienten über 65 hat gezeigt, dass in zwei Gruppen mit und ohne Schutzimpfung mehrere Indikatoren (Krankheitstage, Aufenthaltstage im Krankenhaus, Todesfälle durch Grippe oder Komplikationen durch Grippe) keinerlei Unterschiede aufwiesen. Problematisch erscheint dem Wissenschaftler auch, dass es kaum fundierte Informationen zur Sicherheit der Impfung und über mögliche Nebenwirkungen oder Komplikationen gibt.
Jefferson äußert in seinem Artikel keine grundsätzlichen Einwände gegen die Schutzimpfung, insbesondere nicht bei älteren und kranken Personen. Er möchte darauf hinwirken, dass die wissenschaftlichen Erkenntnisse über die Schutzimpfung nicht mehr auf so tönernen Füssen wie derzeit steht. Aktuell sei es so, dass Gesundheitspolitiker dazu neigen, das zu propagieren, was gerade machbar ist - eben Schutzimpfungen. Und sie würden argumentieren, man könne nicht darauf warten, bis wir perfekte Datensammlungen haben. Diese Position erscheint Jefferson jedoch problematisch, und er möchte, dass "amerikanische und europäische Steuerzahler alarmiert werden und anfangen, Fragen zu stellen", äußerte er sich in einem Bericht der Zeitschrift "Forbes", da Schutzimpfungen ja in ganz erheblichem Maße öffentliche Gelder kosten.
Der Artikel von Jefferson ist hier im Volltext nachzulesen: Influenza vaccination: policy versus evidence (British Medical Journal, BMJ 2006;333:912-915, 28 October)
Gerd Marstedt, 16.2.2007
Agression im Kindergartenalter - Eine Studie zeigt: Es geht auch ohne Medikamente
 Die Neigung, "Problemkinder" mit einem "Zappelphilipp-Syndrom" mit Medikamenten zu behandeln (wie z.B. Ritalin) verbreitet sich zunehmend. Hintergrund dafür ist eine Diagnose, die in den letzten zehn Jahren einen wahren Boom erlebt hat: Das sogenannte "Aufmerksamkeits-Defizit- Hyperaktivitäts-Syndrom" (ADHS). Etwa 10-15 % aller Kinder entwickeln Verhaltensauffälligkeiten, die mit dieser Diagnose versehen werden. In Deutschland sind ca. 400.000 Kinder davon betroffen und innerhalb nur weniger Jahre ist die Anzahl der medikamentös behandelt Kinder weltweit auf ca. 8 Millionen gestiegen, 80 % davon in den USA. Doch es geht auch ohne Medikamente, erklärte jetzt die Psychoanalytikerin Prof. Leuzinger-Bohleber vom Sigmund-Freud-Institut in Frankfurt anlässlich der Vorstellung von Ergebnissen aus einer Studie mit rund 800 Kindergartenkindern. Aggressives oder störendes Verhalten von Kindern, und damit auch die Gewaltbereitschaft der Jüngsten, lässt sich mit "präventiven" erzieherischen Maßnahmen und ohne Medikamente verändern.
Die Neigung, "Problemkinder" mit einem "Zappelphilipp-Syndrom" mit Medikamenten zu behandeln (wie z.B. Ritalin) verbreitet sich zunehmend. Hintergrund dafür ist eine Diagnose, die in den letzten zehn Jahren einen wahren Boom erlebt hat: Das sogenannte "Aufmerksamkeits-Defizit- Hyperaktivitäts-Syndrom" (ADHS). Etwa 10-15 % aller Kinder entwickeln Verhaltensauffälligkeiten, die mit dieser Diagnose versehen werden. In Deutschland sind ca. 400.000 Kinder davon betroffen und innerhalb nur weniger Jahre ist die Anzahl der medikamentös behandelt Kinder weltweit auf ca. 8 Millionen gestiegen, 80 % davon in den USA. Doch es geht auch ohne Medikamente, erklärte jetzt die Psychoanalytikerin Prof. Leuzinger-Bohleber vom Sigmund-Freud-Institut in Frankfurt anlässlich der Vorstellung von Ergebnissen aus einer Studie mit rund 800 Kindergartenkindern. Aggressives oder störendes Verhalten von Kindern, und damit auch die Gewaltbereitschaft der Jüngsten, lässt sich mit "präventiven" erzieherischen Maßnahmen und ohne Medikamente verändern.
In Deutschland nehmen etwa 150.000 Kinder regelmäßig Medikamente, teilweise ohne vorhergehende sorgfältige medizinische und psychologische Untersuchung. Die langfristigen Auswirkungen dieser medikamentösen Behandlung sind bis heute nicht bekannt. Daher warnen Experten vor möglichen Spätfolgen dieses frühen chemischen Eingriffs in das noch im Entwicklungsstadium befindliche Gehirn. Die Lebensbedingungen des Kindes, seine Beziehungen und Chancen, aktiv zu sein und soziale Kontakte zu knüpfen sowie sich körperlich frei zu bewegen, sind ganz entscheidend für die weitere Entwicklung. Es sind große Unterschiede absehbar, je nachdem, ob Verhaltensproblemen mit Medikamenten oder mit psychosozialen Angeboten begegnet wird.
Zusammen mit dem Hirnforscher Prof. Hüther aus Göttingen führte das Sigmund-Freud-Institut in Kooperation mit dem Institut für analytische Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapie in Frankfurt eine Präventionsstudie zur Förderung von Kreativität und psychosozialer Integration von Kindern im Kindergartenalter durch. Zwei Jahre lang, von 2004-2006, übten Psychologen und Pädagogen in 14 Kindertagesstätten gewaltvorbeugende Maßnahmen, Eltern wurden beraten und Erzieherinnen erhielten eine Supervision und Fortbildung. Die Kinder durchliefen dabei das Anti-Gewalt-Programm "Faust-Los". Zeitgleich beobachteten die Wissenschaftler an weiteren 14 Kindertagsstätten das Geschehen, dort jedoch lief das gewohnte und althergebrachte Programm.
Das Ergebnis war verblüffend: Die Auswertung der Daten zeigte, dass die Aggressivität in der Projektgruppe deutlich abnimmt, in der Vergleichsgruppe jedoch auf demselben Niveau wie vorher blieb. Als besonders positiv bewerteten die Wissenschaftler, dass das Präventionsprogramm bei den extrem auffälligen Kindern besonders gut angeschlagen hat. 17 Kinder wurden während der Studie einzeltherapeutisch betreut.
Die Ergebnisse haben nach Auffassung der Forscher deutlich gemacht, dass verhaltensauffälligen Kindern in einer Vielzahl von Fällen auch ohne Medikamentenverschreibung weitergeholfen werden kann. Problematisch erscheint den Wissenschaftlern, dass man eine geographische Häufung der Verschreibung von Ritalin, dem gängigsten Medikament bei ADHS, beobachten konnte: 30 Prozent des bundesweiten Verschreibungs-Aufkommens würden von lediglich 66 Kinderärzten verordnet. Pharmazeutische Therapie sei auf Dauer jedoch wenig hilfreich: "Es ist eine große Verführung, Probleme mit Medikamenten zum Verschwinden zu bringen. Jedoch nimmt es den Kindern die Chance, mit ihrem eigenen Schicksal umzugehen. Nötig sind stattdessen ganzheitliche Maßnahmen schon im Vorschulalter", so die Projektleiterin Prof. Leuzinger-Bohleber.
Hier findet man die Projektbeschreibung:
Frankfurter Präventionsstudie in Kindergärten: Eine repräsentative, prospektive Präventions- und Interventionsstudie zur Verhinderung von psychosozialen Anpassungsstörungen (insb. von ADHS) bei Kindergartenkindern
In einem Artikel der Frankfurter Rundschau werden die Studie und ihre Ergebnisse beschrieben: Prävention im Kindergarten hilft gegen Gewalt
Gerd Marstedt, 2.2.2007
GKV erreicht mit Präventionsleistungen doppelt so viele Menschen wie im Vorjahr
 Die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) hat im Jahr 2004 mit Präventionsleistungen etwa doppelt so viele Menschen erreicht wie im Jahr 2003. Dies geht aus dem vierten Präventionsbericht hervor, den der Medizinische Dienst der Spitzenverbände der Krankenkassen (MDS) gemeinsam mit den Spitzenverbänden der Krankenkassen herausgibt.
Die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) hat im Jahr 2004 mit Präventionsleistungen etwa doppelt so viele Menschen erreicht wie im Jahr 2003. Dies geht aus dem vierten Präventionsbericht hervor, den der Medizinische Dienst der Spitzenverbände der Krankenkassen (MDS) gemeinsam mit den Spitzenverbänden der Krankenkassen herausgibt.
So konnten im Jahr 2004 ca. 3,4 Millionen Menschen über Präventionsmaßnahmen erreicht werden; 2003 waren es noch ca. 1,7 Millionen Menschen. Zudem hat sich die Zahl der Personen bei Präventionsmaßnahmen im Lebensumfeld im Vergleich zum Vorjahr sogar fast vervierfacht. Vor allem in Schulen und Berufsschulen konnten die Krankenkassen im Berichtsjahr nahezu 1,9 Millionen junge Menschen mit präventiven Angeboten erreichen (2003: 0,54 Millionen).
Die aktuellen Ergebnisse verdeutlichen, dass die Krankenkassen ihr Engagement sowohl in nichtbetrieblichen Bereichen als auch in der Betrieblichen Gesundheitsförderung (BGF) erfolgreich fortgesetzt und ausgebaut haben. Diese Ausweitung der Präventionsaktivitäten spiegelt sich auch in der Ausgabenentwicklung der gesetzlichen Krankenkassen wider: Gaben die Kassen im Jahr 2000 43 Millionen Euro aus, so stiegen die Ausgaben für Prävention in 2004 auf über 148 Millionen (im Jahr 2003 waren es 113,5 Mio. Euro); dies entspricht einer jährlichen Steigerungsrate von 36 Prozent.
Mit diesen Ergebnissen unterstreichen die Krankenkassen die Bedeutung von Prävention und Gesundheitsförderung in der Gesundheitspolitik. Prävention und Gesundheitsförderung stellen im Übrigen eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe dar, die weit über die Zuständigkeit der GKV hinausgeht. Deshalb fordern die Spitzenverbände der Gesetzlichen Krankenversicherung die Verantwortlichen in Bund und Ländern auf, sich nicht aus diesem Bereich zurückzuziehen, sondern ihr eigenes Engagement ebenfalls auszubauen.
Die jährlich veröffentlichte Dokumentation macht die Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen in der Primärprävention und in der Betrieblichen Gesundheitsförderung transparent. Dazu haben sich die Krankenkassen freiwillig verpflichtet.
Die gesamte Dokumentation (136 Seiten) gibt es als PDF-Datei: Dokumentation 2004 Leistungen der Gesetzlichen Krankenversicherung in der Primärprävention und Betrieblichen Gesundheitsförderung gemäß ß 20 Abs. 1 und 2 SGB V
Gerd Marstedt, 6.1.2006
Nur 3 Prozent der Gesundheitsausgaben in OECD-Ländern für Prävention und öffentliche Gesundheitsprogramme
 Trotz der praktisch von niemand mehr bestrittenen positiven u.a. Behandlungskosten einsparenden Wirkungen von Präventionsprogrammen oder öffentlichen Gesundheitskampagnen für Impfen, gegen übermäßigen Alkohol- oder Tabakkonsum, werden aktuell in allen OECD-Ländern durchschnittlich nur 3 Prozent der Gesundheitshaushalte für derartige Aktivitäten ausgegeben. Dieser Anteil schwankt allerdings erheblich: Während er in Italien gerade einmal 0,6 Prozent beträgt, führt Kanada mit 8 Prozent die Liste an und liegt Deutschland mit 4,8 Prozent im oberen Drittel der Mitgliedsländer. Dies sind einige der vielen interessanten Ergebnisse der gerade erschienenen OECD- Publikation "Health at a Glance - OECD Indicators 2005".
Trotz der praktisch von niemand mehr bestrittenen positiven u.a. Behandlungskosten einsparenden Wirkungen von Präventionsprogrammen oder öffentlichen Gesundheitskampagnen für Impfen, gegen übermäßigen Alkohol- oder Tabakkonsum, werden aktuell in allen OECD-Ländern durchschnittlich nur 3 Prozent der Gesundheitshaushalte für derartige Aktivitäten ausgegeben. Dieser Anteil schwankt allerdings erheblich: Während er in Italien gerade einmal 0,6 Prozent beträgt, führt Kanada mit 8 Prozent die Liste an und liegt Deutschland mit 4,8 Prozent im oberen Drittel der Mitgliedsländer. Dies sind einige der vielen interessanten Ergebnisse der gerade erschienenen OECD- Publikation "Health at a Glance - OECD Indicators 2005".
Hier finden Sie eine kostenlose Zusammenfassung weiterer Ergebnisse des 2005-OECD-Berichts
Bernard Braun, 28.11.2005
Aids-Prävention - eine Innovation in der Krise
 Safer Sex ist zumindest in der nach wie vor hauptsächlich von der Epidemie AIDS betroffenen Gruppe der schwulen Männer zur sozialen Norm geworden, mit Befolgungsraten von 80 und mehr Prozent. Bei den i. v. Drogenbenutzern liegt der Erfolg in ähnlicher Größenordnung. Die zielgruppenbezogene und selbst organisierte Primärprävention der HIV-Infektion ist mittlerweile zum Pilotfall der erfolgreichen Umsetzung eines modernen, gesundheitswissenschaftlich fundierten Präventionskonzepts geworden. Es hat sich als möglich erwiesen, durch öffentlich vermitteltes Lernen Verhalten in den Lebensbereichen der Sexualität und des Drogengebrauchs zu verändern, also in Bereichen wirksam zu sein, die weithin von Tabus und von Scham gekennzeichnet sind und zum Teil in der Illegalität liegen.
Safer Sex ist zumindest in der nach wie vor hauptsächlich von der Epidemie AIDS betroffenen Gruppe der schwulen Männer zur sozialen Norm geworden, mit Befolgungsraten von 80 und mehr Prozent. Bei den i. v. Drogenbenutzern liegt der Erfolg in ähnlicher Größenordnung. Die zielgruppenbezogene und selbst organisierte Primärprävention der HIV-Infektion ist mittlerweile zum Pilotfall der erfolgreichen Umsetzung eines modernen, gesundheitswissenschaftlich fundierten Präventionskonzepts geworden. Es hat sich als möglich erwiesen, durch öffentlich vermitteltes Lernen Verhalten in den Lebensbereichen der Sexualität und des Drogengebrauchs zu verändern, also in Bereichen wirksam zu sein, die weithin von Tabus und von Scham gekennzeichnet sind und zum Teil in der Illegalität liegen.
AIDS-Prävention, so stellt Rolf Rosenbrock fest, ist also eine positive Ausnahme in der Präventionslandschaft, von der noch viel gelernt werden kann. Anders als bei den früher im Rahmen von Prävention gängigen Zwangsstrategien waren die AIDS-Maßnahmen "eine moderne Mischung aus einer multimodalen Mehrebenen-Kampagne mit Bezug und Verknüpfung zu vielen dezentralen Aktivitäten in und mit den Lebenswelten der Zielgruppen." Was dabei heraus gekommen ist, kann gesundheitspolitisch als lernträchtig erfolgreiches Pilotmodell gewertet werden.
Dargelegt werden von Rolf Rosenbrock (Leiter der Forschungsgruppe Public Health im Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) und Mitglied im Sachverständigenrat für die Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen sowie Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirats der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), in diesem Aufsatz aber auch die Gründe des heute leider unbestreitbaren Rückgangs von präventivem Verhalten und einige Gedanken zur Überwindung dieser Defizite.
PDF-Datei Aids-Prävention - eine Innovation in der Krise
Gerd Marstedt, 27.9.2005
Forschungsdokumentation Prävention, Vorsorge, Vorbeugung
 Unter dem Titel "Prävention, Vorsorge, Vorbeugung" stellt die vom Informationszentrum Sozialwissenschaften der Arbeitsgemeinschaft Sozialwissenschaftlicher Institute in Bonn im August 2005 herausgegebene und von Gisela Ross-Strajhar bearbeitete 200-Forschungsdokumentation 261 Nachweise von Veröffentlichungen und Forschungsprojekten der letzten 10 Jahre zusammen, die sich mit Prävention aus sozialwissenschaftlicher Sicht - überwiegend im deutschsprachigen Raum - befassen.
Unter dem Titel "Prävention, Vorsorge, Vorbeugung" stellt die vom Informationszentrum Sozialwissenschaften der Arbeitsgemeinschaft Sozialwissenschaftlicher Institute in Bonn im August 2005 herausgegebene und von Gisela Ross-Strajhar bearbeitete 200-Forschungsdokumentation 261 Nachweise von Veröffentlichungen und Forschungsprojekten der letzten 10 Jahre zusammen, die sich mit Prävention aus sozialwissenschaftlicher Sicht - überwiegend im deutschsprachigen Raum - befassen.
Ausdrücklich will die Dokumentation der Forschungsergebnisse nach dem vorübergehenden Scheitern des Präventionsgesetzes zur Fundierung der weiteren Präventionsdebatte beitragen.
In Kapitel 1 finden sich theoretische Studien und Forschungsansätze verschiedener Fachrichtungen zu Präventionskonzepten. Hier finden sich auch international vergleichende Arbeiten.
Die Prävention im Gesundheitsbereich wird in Kapitel 2 dargestellt. Dort wird z.B. über die deutsche Herz-Kreislauf-Studie, über zahnmedizinische Prävention oder über medizinische Berichterstattung in Medien berichtet. Es werden Präventionsangebote für diverse Krankheitsbilder dargestellt sowie für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen beschrieben. Auch über Bewegung als Vorbeugemaßnahme wird hier berichtet.
Kapitel 3 widmet sich der Prävention am Arbeitsplatz und im Betrieb. Hier finden sich auch Nachweise von Forschungen über die Arbeit des betrieblichen Arbeitsschutzbeauftragten, eine Funktion, die zur Förderung betrieblicher Sicherheits- und Gesundheitsstrukturen vor Ort installiert wurde. Gleichfalls gibt es Informationen aus den Bereichen Betriebsunfälle und Berufskrankheiten.
Kapitel 4 beschäftigt sich mit Prävention bei Kindern und Jugendlichen sowie in Familien und Schulen. Die Präventionsaktivitäten richten sich z.B. auf das Erkennen von emotionalen oder habituellen Auffälligkeiten bei Vorschulkindern und auf pädagogische Ziele wie Schulmüdigkeit und Schulverweigerung.
Kapitel 5 beschäftigt sich mit der Prävention von abweichendem Verhalten, mit den Entstehungsbedingungen und den Erscheinungsformen von Gewalt, Kriminalität, Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus. Hier werden auch Nachweise zur Drogenproblematik eingeordnet, sofern sie nicht unter dem Aspekt Kinder- und Jugenddelinquenz zum vorhergehenden Kapitel gehören. Ausgespart bleibt in dieser Dokumentation der gesamte Bereich der internationalen Politik, d.h. Präventionsstrategien im Bereich von Außenpolitik, internationalen Beziehungen und von Friedens- und Konfliktforschung sind nicht Gegenstand dieser Dokumentation.
Hier gibt es die Forschungsdokumentation
Bernard Braun, 26.9.2005
Das deutsche Präventionsgesetz 2005 - ein gescheiterter Anlauf
 Im Jahre 2005 sollte nach dem Willen der rot-grünen Bundesregierung das "Gesetz zur Stärkung der gesundheitlichen Prävention" in Kraft treten. Damit sollte die Prävention neben Kuration, Pflege und Rehabilitation zu einer eigenständigen "vierten Säule" des Systems der Gesundheitssicherung ausgebaut werden. In den Jahren 2005 bis 2007 sollten die in die neuen Strukturen fließenden Gelder stetig zunehmen, um im Jahre 2008 den vorgesehenen jährlichen Umfang von 250 Mio. Euro erreichen. Dazu kam es nicht: Der Gesetzentwurf wurde nach ausführlicher Anhörung im Bundestagsausschuss für Gesundheit und Soziale Sicherung zwar am 22. April 2005 vom Bundestag verabschiedet. In seiner 811. Sitzung beschloss der Bundesrat (Länderkammer) dann jedoch am 27. Mai 2005 das Gesetz aufzuhalten und den Vermittlungsausschuss "mit dem Ziel der grundlegenden Überarbeitung" anzurufen. Rolf Rosenbrock (Wissenschaftzentrum Berlin, Mitglied des Sachverständigenrats zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen) skizziert in diesem Aufsatz noch einmal die Entstehungsgeschichte des Präventionsgesetzes - nicht in nostalgischer Wehmut, sondern um (auch für die nächste Legislaturperiode) die Perspektiven zu dokumentieren, die mit der Gesetzesenwurf verbunden waren.
Im Jahre 2005 sollte nach dem Willen der rot-grünen Bundesregierung das "Gesetz zur Stärkung der gesundheitlichen Prävention" in Kraft treten. Damit sollte die Prävention neben Kuration, Pflege und Rehabilitation zu einer eigenständigen "vierten Säule" des Systems der Gesundheitssicherung ausgebaut werden. In den Jahren 2005 bis 2007 sollten die in die neuen Strukturen fließenden Gelder stetig zunehmen, um im Jahre 2008 den vorgesehenen jährlichen Umfang von 250 Mio. Euro erreichen. Dazu kam es nicht: Der Gesetzentwurf wurde nach ausführlicher Anhörung im Bundestagsausschuss für Gesundheit und Soziale Sicherung zwar am 22. April 2005 vom Bundestag verabschiedet. In seiner 811. Sitzung beschloss der Bundesrat (Länderkammer) dann jedoch am 27. Mai 2005 das Gesetz aufzuhalten und den Vermittlungsausschuss "mit dem Ziel der grundlegenden Überarbeitung" anzurufen. Rolf Rosenbrock (Wissenschaftzentrum Berlin, Mitglied des Sachverständigenrats zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen) skizziert in diesem Aufsatz noch einmal die Entstehungsgeschichte des Präventionsgesetzes - nicht in nostalgischer Wehmut, sondern um (auch für die nächste Legislaturperiode) die Perspektiven zu dokumentieren, die mit der Gesetzesenwurf verbunden waren.
PDF-Datei des Aufsatzes: Das deutsche Präventionsgesetz 2005 - ein gescheiterter Anlauf
Gerd Marstedt, 1.9.2005
Prävention in Deutschland: Note mangelhaft
 Maßnahmen zur Gesundheitsvorsorge und Prävention werden in Deutschland nur äußerst mangelhaft umgesetzt, so lautet das Ergebnis einer Studie, die von der Felix Burda Stiftung und dem Management- und Technologie-Beratungsunternehmen "Booz Allen Hamilton" durchgeführt wurde. Mitgewirkt haben mehr als 40 führende Präventionsexperten in Deutschland: Ärzte, Forscher aus Fachbereichen der Medizin, Motivationsforscher, Versorgungsforscher, Gesundheitsökonomen, Patientenvertreter und Repräsentanten gesetzlicher Krankenkassen.
Maßnahmen zur Gesundheitsvorsorge und Prävention werden in Deutschland nur äußerst mangelhaft umgesetzt, so lautet das Ergebnis einer Studie, die von der Felix Burda Stiftung und dem Management- und Technologie-Beratungsunternehmen "Booz Allen Hamilton" durchgeführt wurde. Mitgewirkt haben mehr als 40 führende Präventionsexperten in Deutschland: Ärzte, Forscher aus Fachbereichen der Medizin, Motivationsforscher, Versorgungsforscher, Gesundheitsökonomen, Patientenvertreter und Repräsentanten gesetzlicher Krankenkassen.
Schlechte Noten gaben die Experten vor allem der Vorsorge bei Krebs (Darm, Prostata, Haut und Brust) sowie der allgemeinen Gesundheitsförderung - die übergreifende Schulnote lautet hierbei im Vergleich zu anderen Industrieländern "mangelhaft". Lediglich die Schwangerschaftsvorsorge und die Vorsorge-untersuchungen im Kindesalter werden im internationalen Vergleich als "gut" bis "sehr gut" bewertet. Im Unterschied zu anderen Studien, die recht umstandslos auf Kosteneinsparungen durch Prävention hinweisen, kommen die Experten hier zu einem ausgewogeneren Urteil. Der Effekt von Prävention auf die gesamtgesellschaftlichen Kosten sei zwar nach wie vor umstritten, dagegen stünden jedoch auch nichtmonetäre Positiveffekte: Reduzierung des krankheitsbedingten Verlusts an Lebensqualität, Verlängerung der Lebenserwartung, Stärkung der Eigenverantwortung.
In der Studie mit dem Titel "Von der Reaktion zur Prävention - Leitbild für eine moderne Gesellschaft. Studie zum Stand der Prävention in Deutschland" wird eine Vielzahl von Vorsorge- und Präventionsbereichen auf der Basis von Tiefen-Interviews mit 40 Experten detailliert bewertet. Auf der Homepage von Booz Allen Hamiltongibt es eine kürzere Zusammenfassung, daneben auch den gesamten Text der Studie (46 Seiten, 2.8 MB) als PDF-Datei.
PDF-Datei Von der Reaktion zur Prävention
Gerd Marstedt, 1.8.2005