



Home | Patienten | Gesundheitssystem | International | GKV | Prävention | Epidemiologie | Websites | Meilensteine | Impressum
Sämtliche Rubriken in
"Prävention"
andere Themen |
Alle Artikel aus:
Prävention
andere Themen
Evidenz jenseits von Medizin und Pharmazie: Häufige soziale Kontakte mit Freunden im mittleren Lebensalter senken Demenzrisiko
 Während in regelmäßigen Abständen Meldungen zu einem möglichen Arzneimittel zur Verhinderung von Demenz oder zu deren Linderung auftauchen und meist folgenlos wieder verschwinden, gibt es immer wieder ebenfalls hoffnungsverbreitende Meldungen von außerhalb der Medizin und Arzneimittelentwicklung. Ihr gemeinsamer Nenner sind bessere kognitive Fähigkeiten. Da die meisten dazu durchgeführten Beobachtungsstudien ihre UntersuchungsteilnehmerInnen nur eine relativ kurze Zeit beobachten, galten sie nicht nur als untauglich zur Gewinnung kausaler Zusammenhänge, sondern auch als problematisch zur Identifizierung so langer Prozesse wie der Entstehung von Demenz. Selbst Studienergebnisse, die zeigten, dass weniger häufige soziale Kontakte mit einem höheren Demenzrisiko assoziiert waren, konnten wegen des kurzen Untersuchungszeitraum nicht klären, ob soziale Isolation eine Konsequenz oder die Ursache von Demenz darstellt.
Während in regelmäßigen Abständen Meldungen zu einem möglichen Arzneimittel zur Verhinderung von Demenz oder zu deren Linderung auftauchen und meist folgenlos wieder verschwinden, gibt es immer wieder ebenfalls hoffnungsverbreitende Meldungen von außerhalb der Medizin und Arzneimittelentwicklung. Ihr gemeinsamer Nenner sind bessere kognitive Fähigkeiten. Da die meisten dazu durchgeführten Beobachtungsstudien ihre UntersuchungsteilnehmerInnen nur eine relativ kurze Zeit beobachten, galten sie nicht nur als untauglich zur Gewinnung kausaler Zusammenhänge, sondern auch als problematisch zur Identifizierung so langer Prozesse wie der Entstehung von Demenz. Selbst Studienergebnisse, die zeigten, dass weniger häufige soziale Kontakte mit einem höheren Demenzrisiko assoziiert waren, konnten wegen des kurzen Untersuchungszeitraum nicht klären, ob soziale Isolation eine Konsequenz oder die Ursache von Demenz darstellt.
Eine Anfang August 2019 in der Open Access-Fachzeitschrift "PLOS Medicine" veröffentlichte retrospektive Neuauswertung der so genannnten Whitehall II-Studie, einer prospektiven Kohortenstudie von 10.308 Beschäftigten im öffentlichen Dienst Londons im Zeitraum von 1985-88 (TeilnehmerInnen waren damals 35-55 Jahre alt) bis 2017, verbesserte die Erkenntnisgrundlage erheblich.
In den Untersuchungsjahren 1985 bis 2013 wurden die TeilnehmerInnen sechsmal zur Häufigkeit ihrer sozialen Kontakte mit Freunden und Verwandten befragt. Zwischen 1997 und 2017 wurden fünfmal umfangreiche Tests zu ihren kognitiven Fähigkeiten durchgeführt. Bis 2017 wurde mit Routinedaten aus der gesundheitlichen Versorgung ermittelt, ob die TeilnehmerInnen an Demenz litten.
Die wichtigsten Ergebnisse dieser Studie lauteten:
• Wer mit 60 häufige soziale Kontakte hatte, hatte im weiteren Lebensalter ein signifikant geringeres Demenzrisiko. Wer in diesem Alter Freunde praktisch jeden Tag sah, hatte ein 12% geringeres Risiko dement zu werden als jemand, der ein oder zwei Freunden alle paar Monate begegnete. Darauf, dass es sich um kausale Zusammenhänge handelt, weist hin, dass das Demenzrisiko mit jeder Erhöhung der sozialen Kontakte sank. Dieser Zusammenhang von Effektstärke und Wirkung zeigte sich auch im Alter von 50 und 70, war aber statistisch nicht signifikant.
• Die Assoziation zwischen sozialen Kontakten und der Demenz-Inzidenz wurde von Kontakten zu Freunden gefördert, nicht aber von Kontakten zu Verwandten.
• Häufige soziale Kontakte im mittleren Lebensalter waren mit einer höheren kognitiven Leistungsfähigkeit verbunden, mit deutlichen kognitiven Unterschieden zwischen Personen mit geringen und hohen sozialen Kontakten. Dieser Zusammenhang war über 14 Jahre stabil vorhanden.
• Diese Funde lassen nach Meinung der AutorInnen den Schluss zu, dass häufigere soziale Kontakte im mittleren Lebensabschnitt eine Art kognitive Reserve aufbauen, die sich präventiv auf das Demenzrisiko im weiteren Lebensverlauf auswirkt.
• Die alternative Erklärung, dass frühe kognitive Unterschiede die Fähigkeiten von Menschen, soziale Beziehungen aufzubauen, beeinflussen und so die Anfälligkeit für Demenz fördern, schließen die AutorInnen nicht aus.
• Durch die lange Beobachtungszeit konnte aber weitgehend die Möglichkeit ausgeschlossen werden, dass der Beginn des Abbaus von kognitiven Fähigkeiten dazu führte, dass Personen weniger andere Personen zu sehen bekommen.
• Zu den Beschränkungen dieser Studie gehört, dass die Kenntnisse über Demenz aus Gesundheitsdaten gewonnen wurden, die potenziell zu wenig Fälle von schwer sozial isolierten Personen enthalten, was wiederum zu einer Unterschätzung der Assoziation von sozialen Kontakten und Demenz führen könnte.
Die 18-seitige Studie Association of social contact with dementia and cognition: 28-year follow-up of the Whitehall II cohort study. von Andrew Sommerlad, Séverine Sabia, Archana Singh-Manoux, Glyn Lewis und Gill Livingston ist in "PLOS Medicine" (2019; 16 (8)) erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 5.8.19
Handhygiene in Kliniken: "probably slightly reduces infection…and colonisation rates" aber "based moderate certainty of evidence"
 Eine Erhöhung der Häufigkeit und Gründlichkeit der Handhygiene aller Beschäftigten in Krankenhäusern reduziert nach zahlreichen weltweiten Studien sowohl die Keimbesiedlung als auch die Rate der oft schwerwiegenden Infektionen und Todesfälle. Da dies entgegen manchen Erwartungen an die Professionalität von Ärzten und Pflegekräften nicht automatisch zu den notwendigen Veränderungen von Einstellungen und Verhalten von Ärzten und Pflegekräften geführt hat, wurde die Erkenntnis in eine Vielzahl unterschiedlichster Interventionsvorschlägen integriert - darunter z.B. ein umfangreicher Handlungskatalog der Weltgesundheitsorganisation (WHO).
Eine Erhöhung der Häufigkeit und Gründlichkeit der Handhygiene aller Beschäftigten in Krankenhäusern reduziert nach zahlreichen weltweiten Studien sowohl die Keimbesiedlung als auch die Rate der oft schwerwiegenden Infektionen und Todesfälle. Da dies entgegen manchen Erwartungen an die Professionalität von Ärzten und Pflegekräften nicht automatisch zu den notwendigen Veränderungen von Einstellungen und Verhalten von Ärzten und Pflegekräften geführt hat, wurde die Erkenntnis in eine Vielzahl unterschiedlichster Interventionsvorschlägen integriert - darunter z.B. ein umfangreicher Handlungskatalog der Weltgesundheitsorganisation (WHO).
Ob diese Interventionen aber wirksam und ausreichend sind oder möglicherweise nicht, war das Thema eines bereits im Jahr 2004 gestarteten so genannten Cochrane Reviews, also eines Versuchs den Stand der Forschung möglichst auf der Basis von methodisch hochwertigen primären Interventionsstudien (vor allem randomisierte kontrollierte Studien) zu ermitteln.
In einer ersten Veröffentlichung über die Ergebnisse zweier Studien aus dem Jahr 2007 hieß es dann: "There is not enough evidence to be certain about what strategies improve hand hygiene compliance. 'One off' teaching sessions about hand hygiene may not improve hand hygiene, but again there is not enough evidence to be certain. More research is needed." (Dinah Gould, Jane H Chudleigh, Donna Moralejo, Nicholas Drey: Interventions to improve hand hygiene compliance in patient care).
Nach einem zweiten Review im Jahr 2010 mit etwas mehr Studien, konnte die Reviewergruppe jetzt 2017 auf die Ergebnisse von 26 weltweit zwischen November 2009 und Oktober 2016 in verschiedenen Krankenhaustypen durchgeführte Studien zurückgreifen, darunter 14 randomisierte, zwei nicht-randomisierte und 10 andere klinische Studien (Vorher-Nachher-Analysen und "interrupted time series(ITS)"-Analysen).
Im Zentrum aller Studien und des Reviews stand die Frage, ob Handhygiene mit Seife oder alkoholhaltigen Mitteln oder beiden Stoffen und den verschiedensten Arrangements und Feedbacktechniken die Keimbesiedlung und die Infektions- oder gar Sterblichkeitshäufigkeit reduzierten oder nicht.
Trotz der im gesamten Zeitraum immer wieder betonten Relevanz der Handhygiene, der Vielzahl an Untersuchungen und des langen Beobachtungszeitraums sind die Ergebnisse sehr durchwachsen und schwächer als für die weitere Praxis erhofft.
Die trotzdem vorhandene Generaltendenz lässt sich an der Zusammenfassung der Interventionen auf Basis der WHO-Empfehlung ablesen. Hierzu heißt es: "Multimodal interventions that include some but not all strategies recommended in the WHO guidelines may slightly improve hand hygiene compliance (five studies; 56 centres) and may slightly reduce infection rates (three studies; 34 centres), low certainty of evidence for both outcomes."
Auch wenn Konsens besteht, dass komplexere Interventionen mehr bewirken als unimodale, kommt es auch durch sie nicht zum durchschlagenden Erfolg bei Keimbesiedlung und Infektionen und selbst diese Ergebnisse sind nicht hochevident und unbestreitbar.
So ähnelt die Zusammenfassung des 2017-er-Reviews auch nach rund 13-jähriger Arbeit am Forschungsstand sehr dem zitierten zehn Jahre alten ersten Ergebnis: "With the identified variability in certainty of evidence, interventions, and methods, there remains an urgent need to undertake methodologically robust research to explore the effectiveness of multimodal versus simpler interventions to increase hand hygiene compliance, and to identify which components of multimodal interventions or combinations of strategies are most effective in a particular context."
Zu dem am 1. September 2017 veröffentlichten Cochrane Review Interventions to improve hand hygiene compliance in patient care von Gould DJ, Moralejo D, Drey N, Chudleigh JH, Taljaard M. gibt es kostenlos eine umfangreiche Zusammenfassung.
Bernard Braun, 13.9.17
Zwischen unter 20% bis 70%: Unterschiede der durch Verhaltensmodifikationen beeinflussbaren Krebsinzidenz und Mortalität
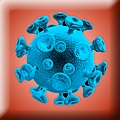 Eine 2015 in der Wissenschaftszeitschrift "Science" veröffentlichte Studie zur Ätiologie von Krebserkrankungen führte zwei Drittel von ihnen auf zufällige und damit nicht verhinderbare oder beeinflussbare Mutationen bei der DNA-Replikation zurück und nur ein Drittel auf Erb- oder Umwelteinflüsse, die aber samt ihren Folgen auch nur zum Teil beeinflussbar sind.
Eine 2015 in der Wissenschaftszeitschrift "Science" veröffentlichte Studie zur Ätiologie von Krebserkrankungen führte zwei Drittel von ihnen auf zufällige und damit nicht verhinderbare oder beeinflussbare Mutationen bei der DNA-Replikation zurück und nur ein Drittel auf Erb- oder Umwelteinflüsse, die aber samt ihren Folgen auch nur zum Teil beeinflussbar sind.
Nimmt oder nähme man dies ernst, schrumpften das Volumen der überhaupt sinnvollen präventiven Interventionen und der mögliche Erfolg einer Primärprävention von Krebserkrankungen gewaltig zusammen.
Eine andere, am 19. Mai 2016 online in der Fachzeitschrift JAMA Oncology" erschienene Studie kommt aber als Ergebnis einer prospektiven Kohortenstudien mit den Krebserkrankungs- und Lebensstildaten der "Nurses' Health Study"(16.531 Frauen) und der "Health Professionals Follow-up Study" (11.731 Männer), wieder zu einem deutlich höheren Anteil lebensstilassoziierter Krebserkrankungen und Krebsmortalität und damit einem höheren Erfolgspotenzial von Krebs-Primärprävention.
Unter gesundem gesundem Lebensstil wird Nichtrauchen, mäßiger Alkoholkonsum, ein gesundes Gewicht (BMI <27,5) und regelmäßige Bewegung verstanden.
Die altersstandardisierten Ergebnisse lauten u.a.:
• Das zusätzliche oder erhöhte bevölkerungsbezogene Risiko ("population-attributable risk" - PAR) für eine Neuerkrankung an allen Karzinomen war bei Männern mit einem gesunden Lebensstil bzw. einem niedrigen Verhaltensrisiko um 33% geringer als bei ihren Geschlechtsgenossen mit ungesünderem Gesundheitsverhalten. Bezogen auf die Mortalität aller Krebserkrankungen lag das zusätzliche Risiko bei den Männern mit gesundem Lebensstil um 44% unter dem der Mänbner mit ungesundem Lebensstil. Die PAR-Werte liegen bei den Frauen mit gesundem Lebensstil bei der Inzidenz aller Krebsarten um 25% und bei der Mortalität aller Krebsarten um 48% für unter den Werten der Frauen mit gesünderem Lebensstil.
• Beim Vergleich mit der gesamten weißen Bevölkerung in den USA, die einen deutlich schlechteren gesundheitsbezogenen Lebensstil als die Angehörigen der beiden Studienkohorten hat, steigen die Werte für Männer mit gesundem Lebensstil auf 63% (Inzidenz) und 67% (Mortalität) Abstand zu den Werten der ungesünderen Vergleichsgruppe. Bei den Frauen erhöhen sich die positiven Abstände auf 41% und 59%.
• Bei einzelnen Krebsarten wirkt sich ein gesunder Lebensstil zum Teil noch deutlich stärker positiv aus: So ist z.B. die Inzidenz von Lungenkarzinomen bei Frauen mit ungesundem Lebensstil um 82% und bei entsprechenden Männern um 78% höher als bei den sich gesund verhaltenden Angehörigen beider Geschlechter. Beim weiblichen Brustkrebs erhöht sich das PAR-Risiko um 4%, beim Prostatakrebs der Männer um 21%. Ähnliche Unterschiede gibt es auch bei der Mortalität.
• Zusammengefasst können bei den Angehörigen der beiden Kohorten potenziell 20% bis 40% aller Krebsfälle und rund die Hälfte aller Krebstodesfälle durch Modifikationen des Lebensstils verhindert werden. Rechnet man diese Ergebnisse auf die gesamte weiße Bevölkerung der USA hoch, steigt der Anteil präventiv verhinderbarer Krebsfälle auf 40% bis 70% an.
• Die für präventiv Tätige hoffnungsvolle Schlussfolgerung der StudienautorInnen lautet: "Primary prevention should remain a priority for cancer control."
Die Studie Variation in cancer risk among tissues can be explained by the number of stem cell divisions von Cristian Tomasetti und Bert Vogelstein erschien am 2. Januar 2015 in "Science" (Vol. 347, Issue 6217: 78-81). Das Abstract ist kostenlos erhältlich.
Die Studie Preventable Incidence and Mortality of Carcinoma Associated With Lifestyle Factors Among White Adults in the United States von Mingyang Song und Edward Giovannucci ist am 19. Mai 2016 in der Fachzeitschrift "JAMA Oncology" zunächst online erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
In dem ebenfalls kostenlos erhältlichen Editorial The Preventability of CancerStacking the Deck von Graham A. Colditz und Siobhan Sutcliffe werden die unterschiedlichen präventionsrelevanten Ergebnisse differenziert bewertet.
Bernard Braun, 23.5.16
"Die Studie zum Sonntag" - Frauen, die mehr als 1x pro Woche in einen Gottesdienst gehen, leben länger und gesünder
 Dass soziale Sicht- und Verhaltensweisen etwas mit Religion bzw. speziell mit der protestantischen Ethik zu tun haben, halten viele Menschen seit und mit Max Weber als gesichert. Andere Studien hoben außerdem immer wieder Zusammenhänge von Religiosität dies- und jenseits der verschiedenen Religionen und Gesundheit hervor. Gläubige sollten generell oder zumindest hinsichtlich bestimmter Erkrankungen gesünder sein. Was oft umstritten war, ist die Richtung des möglicherweise sogar kausalen Zusammenhangs: Sind also Gläubige gesünder oder sind Gesunde eher gläubig.
Dass soziale Sicht- und Verhaltensweisen etwas mit Religion bzw. speziell mit der protestantischen Ethik zu tun haben, halten viele Menschen seit und mit Max Weber als gesichert. Andere Studien hoben außerdem immer wieder Zusammenhänge von Religiosität dies- und jenseits der verschiedenen Religionen und Gesundheit hervor. Gläubige sollten generell oder zumindest hinsichtlich bestimmter Erkrankungen gesünder sein. Was oft umstritten war, ist die Richtung des möglicherweise sogar kausalen Zusammenhangs: Sind also Gläubige gesünder oder sind Gesunde eher gläubig.
Die Ergebnisse der mit 74.534 über 16 Jahre (1996 bis 2012) beobachteten bzw. befragten Teilnehmerinnen (Angehörige der so genannten "Nurses' Healthy Study") größten und methodisch aufwändigsten Untersuchung dieses Zusammenhangs liegen seit dem 16. Mai 2016 vor und sehen so aus:
• Von den Frauen, die zu Beginn der Studie an keiner kardiovaskulären Erkrankung litten oder an Krebs erkrankt waren, starben im Untersuchungszeitraum 13.537. Davon 2.721 an einer kardiovaskulären Erkrankung und 4.479 an Krebs.
• Nach der Adjustierung einer Vielzahl von soziodemografischen Merkmalen, Lebensstilfaktoren, Risikofaktoren, dem Niveau der sozialen Integration und dem Besuch religiöser Veranstaltungen im Jahr 1992 und von Faktoren, die erlaubten, die Richtung der Zusammenhänge zu bestimmen, war die Gesamtsterblichkeit in der Gruppe der Personen, die mehr als einmal pro Woche eine religiöse Veranstaltung besuchten, signifikant um 33% geringer als bei den Personen, die dies während des gesamten Untersuchungszeitraums nie machten. Dieses Risiko war bei den Personen, die einmal wöchentlich einen Gottesdienst besuchten um 26% niedriger und bei denjenigen, die dies weniger als einmal pro Woche machten um 13% geringer - immer gegenüber den Nie-Besuchern von religiösen Veranstaltungen. Die AutorInnen kommen zu dem Schluss, dass der mehrmalige Besuch religiöser Veranstaltungen in der Woche einen signifikanten positiven Effekt auf die Gesamtmortalität und krankheitsspezifische Mortalität hat und schließen die Möglichkeit einer "reverse causation" aus. Die intensiven Kirchgänger lebten im Durchschnitt 5 Monate länger.
• Die Risikorate (hazard ratio) für die kardiovaskuläre Sterblichkeit war bei den intensiven Kirchgängern 27% und die für Krebs um 21% niedriger als bei den Nicht-Kirchgängern.
• Interessant ist die Beobachtung, dass der positive Gesamteffekt des häufigen Kirchgangs seinerseits durch eine Reihe von Einzelfaktoren oder Mediatoren erklärt wird, die nichts mit der Religosität im engeren Sinne zu tun haben. So erklärt eine hohe soziale Unterstützung 23%, die Depressivität 11%, das Rauchen 22% und der Grad einer optimistischen Sicht der Welt 9% der geringeren Mortalität. Praktisch könnte also ein Teil der Lebensverlängerung auch durch den Besuch anderer sozialer und rauchfreier Veranstaltungen oder Institutionen erreicht werden.
Trotz allen methodischen Aufwands weisen die AutorInnen aber auf Grenzen der Verallgemeinerbarkeit ihrer Studie hin. Bei den Teilnehmerinnen handelt es sich hauptsächlich um weiße christliche Krankenschwestern, also mit einem relativ einbheitlichen Sozialstatus, die dazu noch ein überdurchschnittliches Gesundheitsbewusstsein haben dürften.
Die Studie Association of Religious Service Attendance with Mortality Among Women von Shanshan Li, Meir J. Stampfer, David R. Williams und Tyler J. VanderWeele ist am 16.5. 2016 online in der Fachzeitschrift "JAMA Internal Medicine" erschienen. Ein Abstract ist kostenlos erhältlich
Bernard Braun, 22.5.16
Prävention für Kinder okay, aber müssen sie dafür unbedingt "krankgeforscht" werden?
 Um es vorweg zu sagen: Nichts spricht gegen gezielte präventive Gesundheitsangebote für Kinder und Jugendlichen im Setting Schule oder in anderen Settings und auch prinzipiell nichts gegen dafür konzipierte Angebote wie z.B. fit4future.
Um es vorweg zu sagen: Nichts spricht gegen gezielte präventive Gesundheitsangebote für Kinder und Jugendlichen im Setting Schule oder in anderen Settings und auch prinzipiell nichts gegen dafür konzipierte Angebote wie z.B. fit4future.
Worüber aber etwas gründlicher nachgedacht werden sollte, sind die dafür häufig genutzten dramatisierenden Beschreibungen einer Verschlechterung des Gesundheitszustandes von Kindern in den letzten Jahren bzw. die häufig daraus linear abgeleiteten pessimistischen Prognosen ihres künftigen Gesundheitszustands.
Diese folgen meist einem Argumentationsmuster, das einer der profundesten Kenner der Geschichte des Heilens, Roy Porter, bereits 1997 (deutsch 2000) am Ende seiner "Geschichte des Heilens" so beschrieb: "Ängste und Eingriffe schrauben sich immer höher wie eine außer Kurs geratene Rakete" und zwar als "Teil eines Systems, in dem ein wachsendes medizinisches (und auch nichtmedizinisches - Anmerkung bb) Establishment angesiuchts einer immer gesünderen Bevölkerung dazu getrieben wird, normale Ereignisse…zu medikalisieren, Risiken zu Krankheiten zu machen und einfache Beschwerden mit ausgefallenen Prozeduren zu behandeln. Ärzte und 'Konsumenten' erliegen zunehmend der Vorstellung, dass jeder irgendetwas hat, dass jeder und alles behandelt werden kann." (S. 717)
Ob zu dem erwähnten nichtmedizinischen Establishment auch präventionsorientierte Krankenkassen gehören, soll am Beispiel einer von der gesetzlichen Krankenkasse DAK am 26.4.2016 veröffentlichten Studie beleuchtet werden. Unter den Überschriften "Immer mehr Grundschüler haben Gesundheitsprobleme" und "Gesundheitsfalle Schule" kommt die Studie zu dem Schluss "Konzentrationsschwäche, Verhaltensauffälligkeiten, Bewegungsdefizite - gesundheitliche Probleme bei Grundschülern haben in den letzten zehn Jahren stark zugenommen." Es handelt sich um das Ergebnis einer bundesweiten telefonischen Befragung von 500 repräsentativ ausgewählten Lehrern der Klassenstufen 1 bis 6, die dabei u.a. um ihre retrospektive Einschätzung zur Veränderung der Schülergesundheit in den letzten 10 Jahren gebeten wurden. Hinzu kamen Fragen zu den möglichen Gründen der wahrgenommenen Veränderungen und Fragen zur eigenen Gesundheit.
Die wichtigsten Ergebnisse lauten auf den ersten Blick so:
• 49% der Lehrer gaben an, dass die Anzahl der Schüler mit gesundheitlichen Problemen innerhalb der letzten zehn Jahre etwas zugenommen habe, 20% haben den Eindruck, die Anzahl habe stark zugenommen.
• Im Verlaufe der ersten vier bis sechs Schuljahre nahmen 2% der Lehrer eine starke Verschlechterung des generellen Gesundheitszustandes der Schüler wahr, 29% meinten, dass sich dieser in diesem Zeitraum etwas verschlechtert habe.
• 54% der Lehrer sagen, Konzentrationsprobleme hätten stark zugenommen, 45% sagen dies für Verhaltensauffälligkeiten und 14% für Übergewicht.
• Zu den möglichen "Ursachen von Stress" bei den Kindern zählen 91% der Lehrer u.a. die mediale Reizüberflutung, 83% den Erwartungsdruck seitens der Eltern und 36% die Leistungsforderungen in der Schule.
• Trotz dieses auf den ersten Blick existierenden Bedarfs an Prävention, sind eher entsprechende Angebote eher selten. So gaben zwar knapp 60 % der Lehrer an, an ihrer Schule gäbe es Bewegungsangebote für die Pausen. Seltener sind in den Unterricht integrierte Bewegungspausen abseits des Schulsports (29%) oder Sportförderunterricht für Schüler mit motorischen Defiziten (16 %). Auch Rückzugs- und Entspannungsmöglichkeiten für Schüler nannten nur 18 % der Lehrer als Schulangebot. Gesundheitsförderung für die Lehrkräfte steht noch seltener auf dem Stundenplan: Nur 9 % der Befragten gaben an, dass solche Maßnahmen an ihrer Schule existierten.
Ein zweiter Blick auf die Ergebnisse zeigt aber, dass es sich bei einem Teil der Verschlechterung des Gesundheitszustandes von Grundschülern möglicherweise um durch die Konzentration auf den Schulalltag verengte Wahrnehmungen von Lehrern, Fehleinschätzungen oder um eine erhebliche Überschätzung handelt.
Ein erstes Indiz ist, dass die Lehrer keineswegs eine einhellige Einschätzung abgaben. So schätzten die über 50-jährigen Lehrer die Gesundheitssituation der Kinder wesentlich schlechter ein als ihre jüngeren KollegInnen. Von den älteren LehrerInnen sagten 25%, die Anzahl stark gesundheitlich beeinträchtigter SchülerInnen habe stark zugenommen. Von den jüngeren, d.h. bis 39-jährigen LehrerInnen, sagten dies 5%. Eine mögliche Erklärung ist, dass ältere LehrerInnen selber gesundheitlich angeschlagen sind, dadurch schlechter mit den SchülerInnen zurechtkommen und dies u.a. darauf zurückführen, dass diese stressiger und letztlich ungesünder geworden sind. Dafür spricht auch der in der DAK-Befragung ebenfalls abgefragte selbst wahrgenommene Gesundheitszustand der LehrerInnen: Während 13% der bis zu 39 Jahre alten Befragten sagen, er wäre weniger gut oder schlecht sind dies unter den über 50-Jährigen bereits 30%. Schließlich leiden retrospektive Einschätzungen von Veränderungen über längere Zeiträume je nach Thema erwiesenermaßen an deutlichen Unter- oder Überschätzungen des bewerteten Phänomens und sollten daher generell mit Vorsicht genutzt werden.
Ein zweites Indiz ergibt sich aus dem Vergleich der in der qualitativ hochwertigen repräsentativen KIGGS-Studie ("Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland") mittels Befragungen von rund 17.000 oder 12.000 drei- bis siebzehnjährigen Kindern bzw. ihren Eltern in einer Basiserhebung (2003/2006) und einer Folgebefragung (2009/12) erhobenen umfassenden Daten zur Kinder- und Jugendlichengesundheit.
Die wesentlichen Ergebnisse (vgl. ausführlicher die Basispublikation zur Welle 1 und den Überblick über die Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland: Wichtige Ergebnisse der ersten Folgebefragung (KiGGS Welle 1)) sehen zwar in manchen Bereichen auch kritisch aus, was Veränderungen oder gar Verschlechterungen angeht aber deutlich weniger dramatisch aus:
• Fast unverändert rund 90% der Eltern, Kinder und Jugendlichen bezeichnen den allgemeinen Gesundheitszustand als sehr gut oder gut. Für Jugendliche ab 11 Jahre "ist die subjektive Gesundheit…heute so gut wie selten zuvor."
• "Seit der KiGGS-Basiserhebung (2003 bis 2006) ist die Häufigkeit von Asthma bronchiale und Heuschnupfen leicht gestiegen, besonders bei Kindern bis sechs Jahre und hier vor allem bei Mädchen. Für Neurodermitis ist dagegen ein leicht rückläufiger Trend zu beobachten."
• "Fünf Prozent der 7- bis 17-Jährigen hatten mindestens einmal Migräne, 1,2 Prozent leiden an Epilepsie und 0,2 Prozent sind an Diabetes erkrankt. Erkrankungen an Windpocken und Keuchhusten sind in den Zielgruppen für die veränderten Impfempfehlungen deutlich zurückgegangen."
• "Im Vergleich mit der KiGGS-Basiserhebung sind Unfallhäufigkeit, Unfallorte sowie Alters- und Geschlechtsverteilung weitgehend gleich geblieben."
• "Bei jedem fünften Kind (20,2 Prozent) zwischen 3 und 17 Jahren können Hinweise auf psychische Störungen festgestellt werden. Die Häufigkeit (Prävalenz) ist damit seit der KiGGS-Basiserhebung unverändert."
• Und selbst die öffentlich heftig kommunizierte Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) wurde lediglich "bei 5 Prozent der Kinder und Jugendlichen (3 bis 17 Jahre) … jemals ärztlich oder psychologisch diagnostiziert": "Die Häufigkeit hat sich seit der KiGGS-Basiserhebung nicht verändert."
• "Der Anteil der Kinder und Jugendlichen mit mindestens einem Besuch bei einer Kinderärztin oder Kinderarzt pro Jahr nahm seit der KiGGS-Basiserhebung zwar um 8,7 Prozentpunkte zu. Dieser Anstieg kann unter anderem mit zusätzlich eingeführten Leistungen wie U-Untersuchungen und Impfungen erklärt werden."
Selbst wenn man die methodischen Unterschiede und die etwas jüngere Zusammensetzung der von den Lehreren beurteilten Kinder berücksichtigt, handelt es sich offensichtlich um zwei Welten. Für eine verstärkte gezielte Prävention im Setting Schule reichen aber auch die Risiokoprävalenzen aus den KIGGS-Untersuchungen vollkommen aus.
Die Folienpräsentation - und im Moment auch nur die - der wichtigsten und nach Alter und Geschlecht differenzierten Ergebnisse der Studie DAK-Studie 2016: Gesundheitsfalle Schule - Probleme und Auswege ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 28.4.16
Gesundheit durch Impfen - Der unbeirrbare Glaube an biomedizinische Lösungen
 Effizienzdruck und Marktmechanismen bestimmen in zunehmendem Maße auch die entwicklungspolitische Agenda. Selbstverständlich ist es gerechtfertigt, die Ressourcen möglichst wirksam und zielgenau dahin zu lenken, wo sie am besten zur Entwicklung und Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen beitragen. In Anbetracht der Komplexität der Gegebenheiten und Herausforderungen ist das allerdings leichter gesagt als getan. Nicht alles, was gut gemeint ist, entwickelt auch die gewünschte Wirkung. Hinzu kommt das relativ neue Phänomen des Wohltätigkeitskapitalismus von Unternehmen bzw. UnternehmerInnen, die nicht mehr wissen, wie sie ihre unermesslichen Renditen investieren sollen und sich massiv in der Entwicklungsagenda mitmischen. Ein anschauliches Beispiel für die neuen Herrschaftsverhältnisse und die wachsende Einmischung privater GeberInnen in die Entwicklungspolitik ist die 1999 entstandene Globale Allianz für Impfungen und Immunisierungen GAVI. In der Oktoberausgabe 2015 (Seiten 32-36) widmete das Magazin Gesundheit und Gesellschaft des AOK-Bundesverbands der internationalen Impfallianz eine ausführliche Betrachtung.
Effizienzdruck und Marktmechanismen bestimmen in zunehmendem Maße auch die entwicklungspolitische Agenda. Selbstverständlich ist es gerechtfertigt, die Ressourcen möglichst wirksam und zielgenau dahin zu lenken, wo sie am besten zur Entwicklung und Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen beitragen. In Anbetracht der Komplexität der Gegebenheiten und Herausforderungen ist das allerdings leichter gesagt als getan. Nicht alles, was gut gemeint ist, entwickelt auch die gewünschte Wirkung. Hinzu kommt das relativ neue Phänomen des Wohltätigkeitskapitalismus von Unternehmen bzw. UnternehmerInnen, die nicht mehr wissen, wie sie ihre unermesslichen Renditen investieren sollen und sich massiv in der Entwicklungsagenda mitmischen. Ein anschauliches Beispiel für die neuen Herrschaftsverhältnisse und die wachsende Einmischung privater GeberInnen in die Entwicklungspolitik ist die 1999 entstandene Globale Allianz für Impfungen und Immunisierungen GAVI. In der Oktoberausgabe 2015 (Seiten 32-36) widmete das Magazin Gesundheit und Gesellschaft des AOK-Bundesverbands der internationalen Impfallianz eine ausführliche Betrachtung.
Mit Impfungen lassen sich viele Leben retten, sie schützen nicht nur den Einzelnen, sondern auch die Allgemeinheit, und können dazu beitragen, die Ausbreitung von Krankheitserregern einzudämmen und Seuchen auszurotten. 1999 entstand GAVI als öffentlich-private Partnerschaft, um die weltweiten Anstrengungen zum Schutz vor ansteckenden Krankheiten zu bündeln. Heute ist die Impfallianz der wichtigste Financier von Impfstoffen in armen Ländern. Für den Schutz vor Infektionskrankheiten zeichnet eigentlich die Weltgesundheitsorganisation verantwortlich, da aber ihre Finanzkraft sinkt, springen private Geldgeber in die Bresche.
Impfungen eignen sich besonders gut für das Konzept des zunehmenden Wohltätigkeitskapitalismus, der sich streng an unternehmerischen Grundsätzen orientiert. Entwicklungsprogramme und -projekte müssen definierte Zielvorgaben sowie klare Kosten-Nutzen-Analysen erfüllen und messbare Resultate liefern. Doch zugleich entsteht ein Sammelsurium von Einzelprojekten nach Gutdünken der Sponsoren, das sich jeder demokratischen Legitimierung entzieht und Governance-Bestrebungen sowohl in der nationalen als auch globalen Gesundheitspolitik zuwiderläuft. Das erklärte Ziel von GAVI, die Impfstoffpreise für arme Länder erschwinglich zu halten, führt nur zu relativen Preissenkungen: die Kosten für einige neuere Substanzen überfordern viele Länder und garantieren den Herstellern in jedem Fall hinreichende Gewinne.
Vor allem fließen durch vertikale Programme wie GAVI erhebliche finanzielle Mittel in die Entwicklungsländer, die nationale Prioritäten und politische Vorgaben beeinflussen können. Die enge Ausrichtung auf die Vermeidung von Infektionskrankheiten drängt andere Gesundheitsprobleme in den Hintergrund und schwächt die Bemühungen der Länder um die allseits geforderte Stärkung ihrer Gesundheitssysteme. Und sie setzt ausschließlich auf biomedizinische Ansätze zur Lösung grundlegender Gesundheitsprobleme. Dabei hängt die Gesundheit weit stärker von anderen Einflussfaktoren als von Mikroben und dem medizinischen Versorgungssystem ab. Das Fazit des Artikels über GAVI ist deutlich: "Am wirksamsten wären "Impfungen" gegen Armut, Unterernährung, geringe Bildung und gesundheitsschädliche Arbeitsbedingungen. Ein solches Wundermittel wird aber nicht aus medizinischen oder mikrobiologischen Labors kommen. Dafür bedarf es einer Änderung der herrschenden Verhältnisse und einer Teilhabe aller Menschen am weltweit wachsenden Wohlstand.
Solche Aspekte kommen auch in der soeben erschienenen Februar-2016-Ausgabe von Health Affairs nicht zur Sprache. Vielmehr belegen verschiedene Artikel in der Medizinerzeitschrift die Erfolge von Impfprogrammen und deren bisher sogar unterschätzte Kosteneffektivität. Das ware nicht die erste von klaren Interessen geleitete oder gar gesponsorte Ausgabe von Health Affairs.
Der Artikel Große Spender für den kleinen Pieks steht kostenfrei zum Download zur Verfügung.
Bernard Braun, 29.2.16
Korruption sowie private Finanzierung von Gesundheitsleistungen - wichtigste Ursachen für zunehmende Antibiotikaresistenzen
 Antibiotika sind gehören zweifelsohne zu den wichtigsten Medikamenten. Sie erlauben die wirksame und ursächliche Therapie bakterieller Infektionen und tragen erheblich dazu bei, früher lebensbedrohliche Krankheiten zu beherrschen. Mittlerweile warnen ExpertInnen weltweit vor der Ausbreitung von Antibiotika-Resistenzen und ihren Folgen für die moderne Medizin. Zunehmende Antibiotikaresistenzen von Krankheitserregern haben auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) auf den Plan gerufen, die vor einer "postantibiotischen Ära" warnt, in der einfache Infektionen wieder zur tödlichen Gefahr werden können, nachzulesen beispielsweise in dem Artikel WHO warns against 'post-antibiotic' era von Sara Reardon in der angesehenen Zeitschrift Nature. Im vergangenen Jahr legte die WHO den Bericht Antimicrobial resistance: global report on surveillance 2014, in dem sie die Resistenzentwicklung in verschiedenen Weltregionen und bei bestimmten Bakterien detailliert darstellt.
Antibiotika sind gehören zweifelsohne zu den wichtigsten Medikamenten. Sie erlauben die wirksame und ursächliche Therapie bakterieller Infektionen und tragen erheblich dazu bei, früher lebensbedrohliche Krankheiten zu beherrschen. Mittlerweile warnen ExpertInnen weltweit vor der Ausbreitung von Antibiotika-Resistenzen und ihren Folgen für die moderne Medizin. Zunehmende Antibiotikaresistenzen von Krankheitserregern haben auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) auf den Plan gerufen, die vor einer "postantibiotischen Ära" warnt, in der einfache Infektionen wieder zur tödlichen Gefahr werden können, nachzulesen beispielsweise in dem Artikel WHO warns against 'post-antibiotic' era von Sara Reardon in der angesehenen Zeitschrift Nature. Im vergangenen Jahr legte die WHO den Bericht Antimicrobial resistance: global report on surveillance 2014, in dem sie die Resistenzentwicklung in verschiedenen Weltregionen und bei bestimmten Bakterien detailliert darstellt.
Mittlerweile haben beispielsweise die us-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention und der National Health Service explizite Warnung vor Antiobiotika-Resistenzen herausgegeben: Antimicrobial resistance und Antibiotic Resistance Threats in the US.
Auch in Deutschland stehen multiresistente Keime und zunehmende Resistenzentwicklungen zunehmend auf der Tagesordnung. Die DAK führt die zunehmende Resistenzentwicklung in ihrem Antibiotika-Report 2014 auf die bestehende Über- und Fehlversorgung im Gesundheitswesen zurück. Eine Umfrage zeigte, dass ein Drittel der BürgerInnen in den letzten zwölf Monaten mindestens einmal ein Rezept für ein Antibiotikum erhielt, bei Frauen sogar zwei von fünf Befragten. Dabei sind die Indikationen vielfach mehr als fragwürdig.
Ende März 2015 legte Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe einen 10-Punkte-Plan zur Bekämpfung resistenter Erreger: 10-Punkte-Plan zur Vermeidung behandlungsassoziierter Infektionen und Antibiotika-Resistenzen vor. Er beginnt mit dieser Analyse: "In Deutschland treten jährlich zwischen 400.000 bis 600.000 behandlungsassoziierte Infektionen auf. Diese können im Zusammenhang mit einer stationären oder ambulanten Behandlung stehen. Die demographische Entwicklung, eine Zunahme an komplizierten medizinischen Eingriffen und der Anstieg an resistenten Infektionserregern tragen zu einer Verstärkung des Problems bei. Ein Drittel dieser Infektionen ist durch geeignete Maßnahmen vermeidbar. Durch eine enge Zusammenarbeit von Bund und Ländern, aber auch von Krankenhäusern und ihren Trägern muss dieser hohen Zahl von Infektionen mit jährlich 10.000 bis 15.000 Todesfällen entgegengewirkt werden."
Den hier erkennbaren, eingeengten Blick des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) auf die wachsenden Problematik multiresistenter Krankheitserreger zeigen auch die zehn Punkte des Plans:
1. Ausbreitung multiresistenter Erreger verhindern
2. Hygienestandards in allen Einrichtungen weiter ausbauen
3. Bessere Informationen zur Hygienequalität in Krankenhäusern
4. Meldepflichten zur Früherkennung resistenter Erreger verschärfen
5. Verpflichtende Fortbildung des medizinischen Personals
6. Versorgungsforschung zur Vermeidung nosokomialer Infektionen verbessern
7. "One-Health"-Gedanken stärken: Aktualisierung der Deutschen Antibiotika-Resistenzstrategie
8. Forschung und Entwicklung neuer Antibiotika ermöglichen (Pharmadialog)
9. Deutsche globale Gesundheitspolitik zur Bekämpfung von Antibiotika-Resistenzen nutzen
10. Antibiotika-Resistenzen durch Kooperation der G7 bekämpfen
Die Pharma-Hersteller wittern bereits Morgenluft: Der Verband forschender Arzneimittelhersteller (vfa) stellt sich in seinem Positionspapier "Antibiotika und Resistenzen" eine vielversprechende Zukunft vor: "Neue Antibiotika gegen Problemkeime werden dringend gebraucht. Forschende Pharma-Unternehmen arbeiten weltweit wieder verstärkt an solchen Präparaten", und fordert bei dieser Gelegenheit "angemessene frühe Nutzenbewertungen und Vergütungen für neu entwickelte, auch gegen resistente Bakterien wirksame Antibiotika". Offenbar sieht auch die Bundesregierung das Heil in der Technologie, sei es durch Verbesserung der Hygiene, Erfassung, Fortbildung oder Pharma-Forschung; aus diesem fokussierten Mehr-vom-Gleichen hebt sich allein die "One-Health"-Idee ab, also der Förderung und Erhaltung der Gesundheit im Human-, Tier- und Umweltbereich - aber so richtig sie ist, auch sie lässt die gebotene Komplexität vermissen.
Über den deutschen Tellerrand hinaus will die Bundesregierung mit dem Multiresistenz-Problem nun auch in die globale Gesundheitspolitik eingreifen. Diese Art des zuletzt so oft geforderten verstärkten Engagements Deutschlands in der Welt ist grundsätzlich zu begrüßen. Aber der 10-Punkte-Plan und bisherige Verlautbarungen lassen befürchten, dass die gesundheitspolitische Prioritätensetzung für den nächsten, von Deutschland ausgerichteten G7-Gipfel Stückwerk bleiben. Das Problem zunehmender Antibiotika-Resistenzen verdeutlicht nachdrücklich die enge Verknüpfung von nationaler und globaler Gesundheitspolitik sowie die Komplexität wirksamer Gesundheitspolitik. Antibiotika-Resistenzen erfordern nicht nur Maßnahmen in der ärztlichen Versorgung - z. B. Verminderung des Verschreibungsverhalten durch geeignete Leitlinien, Honorierungsformen und Anreize -, und in der Veterinärmedizin - u. a. zurückhaltende Antibiotika-Gaben, Trennung von Verordnung und Gewinn, sondern auch grundlegende Änderungen in der Marketing- und Verkaufspolitik der Pharmaunternehmen und der landwirtschaftlichen Produktion: Solange die krank machenden Mastbedingungen in der Geflügel-, Schweine-, Rinder und Fischzucht die ständige Verabreichung von Medikamenten gegen Bakterien und Pilze erfordern, ist wenig Änderung zu erwarten. Hinzu kommt die Verabreichung bestimmter Antibiotika nicht aus medizinischen Gründen, sondern zur Mastbeschleunigung im Dienste purer Profitgier.
Soeben legte der Wissenschaftliche Beirat für Agrarpolitik beim Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft sein aktuelles Gutachten zum Thema über Wege zu einer gesellschaftlich akzeptierten Nutztierhaltung vor. Darin widmet sich der Rat auch ausführlich dem Thema der Antibiotikaresistenzen und möglicher Einflüsse aus bzw. Effekte auf die Landwirtschaft und konstatiert unter anderem "erhebliches Potenzial zur Reduktion des Antibiotikaeinsatzes beim Masthuhn ohne Einbußen bei der Tiergesundheit" (S. 147). Es bleibt zu hoffen, dass diese Erkenntnisse hinreichende Berücksichtigung in der globalen Gesundheitspolitik der Bundesregierung und auf bei den entsprechenden Verhandlungen auf dem G7-Gipfel im Juni auf dem bayerischen Schloss Elmau findet.
Mittlerweile deutet zudem einiges darauf hin, dass ein Erfolg versprechendes Vorgehen gegen zunehmende Antibiotikaresistenzen ein noch komplexeres Vorgehen erfordert. Galten bisher die zu häufige und falsche Verschreibung sowie der intensive Gebrauch von Antibiotika in der Landwirtschaft als wesentliche Verursacher der weltweiten Resistenzzunahme, weisen nun australische WissenschaftlerInnen auf andere Faktoren hin. In dem kürzlich in der Open—Source-Zeitschrift PLOS one erschienenen Artikel Antimicrobial Resistance: The Major Contribution of Poor Governance and Corruption to This Growing Problem kommen die AutorInnen Peter Collignon, Prema-chandra Athukorala, Sanjaya Senanayake und Fahad Khan zu dem Ergebnis, dass Regierungsführung (bzw. "Governance" und Korruption entscheidende Triebfedern bei der Entstehung von Multiresistenzen sind; zudem korreliert die Resistenzentwicklung mit dem Ausmaß der privaten Gesundheitsfinanzierung.
In ihrer retrospektiven multivariaten Analyse der Antibiotikaresistenzvariabilität in Europa berücksichtigten die australischen ForscherInnen nicht nur den Gebrauch von Antibiotika in der Humanmedizin, sondern auch den Anteil privater Gesundheitsausgaben, die berufliche Bildung, die Wirtschaftsentwicklung (gemessen am Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt) und der Güte der Regierungsführung bzw. dem Ausmaß von Korruption. Die Ergebnisse beruhen auf zwischen 1998 und 2010 erhobenen Daten aus 28 europäischen Ländern, die Vergleiche zwischen Ländern wie innerhalb der Staaten erlauben. Grundlage der Modellrechnungen war ein Paneldatensatz aus menschlichen Blutproben, bei denen ein Screening nach sieben pathogenen Klassen aus Erregern und Resistenzen gegenüber bestimmten Antibiotika und die Messung der entsprechenden Antibiotikaresistenzraten erfolgte.
Die Ergebnisse der Forschergruppe aus Australien lassen sich folgendermaßen zusammenfassen:
• Nur 28 % der ermittelten Länderunterschiede bei der Antibiotikaresistenz sind auf Antibiotika-Gebrauch zurückzuführen; rechnet man Einmaleffekte hinzu, steigt die Erklärungskraft auf 33 %.
• Berücksichtigt man in der Regressionsanalyse jedoch den Indikator Korruptionskontrolle als zusätzliche Variable, lässt sich die Gesamtvariation in der Antibiotikaresistenz zu fast zwei Dritteln (63 %) erklären.
• Da komplette multivariate Regressionsanalyse dieses Ergebnis nur um 7 % ändert, stellt Korruption den wichtigsten sozioökonomischen Faktor der Antibiotikaresistenz dar; die Korruptionseffekte waren statistisch signifikant (P < 0,01); eine Verbesserung des Korruptionsindikators um eine Einheit reduziert der Antibiotikaresistenz um etwa 0,7 Einheiten.
•Das Einkommensniveau eines Landes scheint keine Auswirkungen auf die Resistenzraten zu haben, wohl aber der Anteil der privaten Gesundheitsausgaben am Nationaleinkommen: Je höher der Anteil der Privatausgaben in der Gesundheitsfinanzierung, desto größer ist das Risiko für Antibiotikaresistenzen.
Die AutorInnen verweisen auf die bedeutsamen (gesundheits)politischen Implikationen ihrer Untersuchungsergebnisse und kommen zu dem Schluss: "These findings support the hypothesis that poor governance and corruption contributes to levels of antibiotic resistance and correlate better than antibiotic usage volumes with resistance rates. We conclude that addressing corruption and improving governance will lead to a reduction in antibiotic resistance." Sie bezweifeln nicht die Bedeutung der Human- und Veterinärmedizin und der Umwelt für die Entstehung von Resistenzen gegen Antibiotika und sind sich der Vielschichtigkeit dieses Problems bewusst. Aber sie zeigen in eindrücklicher Weise auf, dass die gängigen nationalen wie globalen, rein gesundheitspolitischen Ansätze zur Beherrschung der Resistenzentwicklung unzureichend für eine Überwindung dieses Problems sind.
Der Artikel ist kostenfrei verfügbar und steht auch als PDF-Datei zum Download zur Verfügung.
Jens Holst, 30.3.15
Bedeutung der Therapietreue für den Behandlungserfolg weiter unbestritten
 Wiederholt hat das Forum Gesundheitspolitik das Thema Adherence aufgegriffen und den Forschungsstand auf diesem relativ neuen gesundheitswissenschaftlichen bzw. -politischen Gebiet zusammengefasst, zuletzt in den Beiträgen Therapietreue - vorrangiges Ziel von Gesundheitsreformen und Therapietreue - Ansatz zu verbesserter Gesundheit und zur Kostendämpfung. Seither sind einige neue erwähnenswerte Untersuchungen zu diesem Thema veröffentlicht, die im Wesentlichen die bisher vorliegenden Ergebnisse bestätigen oder untermauern.
Wiederholt hat das Forum Gesundheitspolitik das Thema Adherence aufgegriffen und den Forschungsstand auf diesem relativ neuen gesundheitswissenschaftlichen bzw. -politischen Gebiet zusammengefasst, zuletzt in den Beiträgen Therapietreue - vorrangiges Ziel von Gesundheitsreformen und Therapietreue - Ansatz zu verbesserter Gesundheit und zur Kostendämpfung. Seither sind einige neue erwähnenswerte Untersuchungen zu diesem Thema veröffentlicht, die im Wesentlichen die bisher vorliegenden Ergebnisse bestätigen oder untermauern.
Nennenswert ist dabei eine im Jahr 2012 in Medical Care veröffentlichte Arbeit aus Los Angeles. Zur Erfassung der Therapietreue und ihrer Auswirkungen auf die beiden großen Volkskrankheiten Bluthochdruck und Zuckerkrankheit werteten Forscher von der University of Southern California die Abrechnungsdaten sowie elektronischen Krankenakten von über 2.300 Ärzten eines großen Versorgungsnetzes aus. So konnten sie etwa 770.000 Patientenleben von Diabetikern und Hypertonikern in ihre große retrospektive Beobachtungsstudie aufnehmen. Endpunkte waren alle mikro- und makrovaskulären Komplikationen einschließlich Myokardinfarkt, Schlaganfall, Nierenversagen und diabetische Retinopathie. Die Datenauswertung erfolgte mittels multivariater logistischer Regression und einer instrumentellen Variablen-Bewertung an Hand arztbezogener Größen zur Abschätzung kausaler Zusammenhänge.
Dabei zeigte sich, dass gute Therapietreue bei einer Arzneimittelmehrfachbehandlung durchblutungsbedingte Komplikationen bei beiden Patientengruppen signifikant senkt: Eine Steigerung der Einnahmerate von 50 auf 80 % verringerte die Auftrittswahrscheinlichkeit solcher Ereignisse um fast ein Drittel (29,5 %), optimale Einnahme sogar um fast die Hälfte (46,9 %). Bei kardiovaskulären Komplikationen zeigte sich der gleiche Trend in geringerer Ausprägung (23 % bei guter Adherence). Die Studie von Jae-Jin An und Michael Nichol mit dem Titel Multiple Medication Adherence and its Effect on Clinical Outcomes Among Patients With Comorbid Type 2 Diabetes and Hypertension in Med Care 51 (10), S. 879-887 steht nur als Abstract kostenfrei zur Verfügung.
Bereits aus dem Jahr 2010 stammt eine retrospektive Längsschnittskohortenstudie mit insgesamt 4.708 Typ-2-Diabetikern. Im Rahmen einer 7,5-jähriger Verlaufskontrolle mit vierteljährlichen Erhebungen zur Arzneimittel-Adherence und multiplen anderen, zeitlich variablen Confoundern zeigten mehr als die Hälfte (2.644 bzw. 56,2 %) Komplikationen in Folge mikroangiopathischer Veränderungen. Bei der Anwendung des marginalen strukturellen Modells, einer Methode zur Wirksamkeitsmessung medizinischer Interventionen mit Hilfe der Gewichtung der inversen Wahrscheinlichkeit für erfolgte Behandlung, und nach Adjustierung nach zeitvariablen Faktoren reduzierte gute Adherence gegenüber Antidiabetika die Häufigkeit mikrovaskulärer Komplikationen signifikant um ein Viertel (Hazard Ratio 0,76 (95 % bootstrap KI: 0,60, 0,92). Der Artikel Estimating the effect of medication adherence on health outcomes among patients with type 2 diabetes - an application of marginal structural models von Andrew Yu, Yanny Yu und Michael Nichol aus in Value in Health: S.1038-1045, steht in voller Länge kostenfrei zum Download zur Verfügung.
Auch bei Personen mit schwer behandelbarem Asthma bronchiale besteht ein erkennbarer Zusammenhang zwischen der Zuverlässigkeit bei der Anwendung ihrer die Bronchen erweiternden Medikation und dem Verlauf der Erkrankung. Dies zeigen Anna Murphy, Amandine Proeschal, Christopher Brightling, Andrew Wardlaw, Ian Pavord, Peter Bradding und Ruth Green in ihrer 2012 in der Zeitschrift Thorax publizierten Studie The relationship between clinical outcomes and medication adherence in difficult-to-control asthma. Geringere Therapietreue führte nicht nur zu einer schlechteren Lungenfunktion gemessen an der Einsekundenausatmungskapazität (75,5 % (Standardabweichung 20,9) bei wenig gegenüber 84,3 % (St.abw.23,5) bei sehr therapietreuen Asthmatikern, p= 0,049). Klinisch relevant war dabei, dass mit schlechterem Einnahmeverhalten das Risiko beatmungspflichtiger Asthmakrisen signifikant ansteigt (Odds Ratio 0,054; 95 % KI 0,01-0,47; p=0.008). Demnach steigt mit einer zehnprozentigen Abnahme der Therapietreue gegenüber bronchodilatatorischen Arzneimitteln die Wahrscheinlichkeit auf beatmungspflichtige Komplikationen um 35 %. Der Artikel von Murphy und Kollegen steht Abonnenten als Volltext und Nicht-Abonnenten als Abstract zur Verfügung.
Im Oktober 2013 publizierte das American Journal of Medicine eine Metaanalye zum Zusammenhang zwischen Therapietreue und Verlauf sowie Kosten bei Erkrankungen der Herzkranzgefäße. Die Forscher Asaf Bitton, Niteesh Choudhry, Olga Matlin, Kellie Swanton, und William Shrank aus Boston werteten im Rahmen ihrer systematischen Literaturanalyse letztlich 25 Studien aus, die sämtliche Einschlusskriterien erfüllten und von hoher Qualität waren. Ein Fünftel der Untersuchungen gingen den primärpräventiven Effekten nach, während 20 die Beziehungen zwischen Adherence und Ausgaben oder klinischem Verlauf analysierten, die meisten davon bei blutdrucksenkender Therapie und Einnahme von Aspirin. Zwar erfolgte bei der Mehrzahl der Studien eine Adjustierung nach Begleiterkrankungen und soziodemografischen Faktoren, aber nur bei wenigen nach dem "healthy adherer effect" genannten Placebo-Effekt. Drei Studien zeigten, dass gute Therapietreue die klinischen Ergebnisse signifikant verbessert und die Ausgaben für die Sekundärprävention bei koronarer Herzkrankheit um knapp 300 bis fast 870 US-Dollar pro Person senkt; daraus ergeben sich bei Therapietreue Einsparungen zwischen 10 und knapp 18 % gegenüber unzuverlässiger Medikamenteneinnahme. Der Artikel The Impact of Medication Adherence on Coronary Artery Disease Costs and Outcomes: A Systematic Review ist nur für Abonnenten in voller Länge zugänglich; kostenfrei steht das Abstract zur Verfügung.
Der Vollständigkeit halber sei zu guter Letzt eine Studie genannt, die erneut die unerwünschten Folgen von Selbstbeteiligungen auf die Adherence und damit auf den klinischen Verlauf bei chronischen Erkrankungen bestätigt. Zuzahlungssenkungen z. B. im Rahmen wirksamkeitsbasierter Versicherungspläne (value-based benefit design) um durchschnittlich ein Drittel (bei gleichzeitiger geringfügiger Erhöhung des Eigenanteils um knapp 5 % in der Kontrollgruppe) erhöhten die Wahrscheinlichkeit zuverlässiger Medikamenteneinnahme bei Diabetikern von 75,3 auf 82,6 %, während die Adhärenz bei der Kontrollgruppe im Vergleichszeitraum sogar diskret von 79,1 auf 78,5 % sank. Anders ausgedrückt: Sinkende Zuzahlungen erhöhten die Wahrscheinlichkeit zuverlässiger Medikamenteneinnahme auf mehr als das Anderthalbfache (Odds Ratio = 1,56, P=0,03, 95 % Konfidenzintervall 1,04-2,34). Die lesenswerte Studie der kalifornischen Forschergruppe um Zeng steht kostenfrei zum Download zur Verfügung: The Impact of Value-Based Benefit Design on Adherence to Diabetes Medications:A Propensity Score-Weighted Difference in Difference Evaluation.
Jens Holst, 17.2.14
"Zu den gesundheitlichen Folgen weiterer Kriegseinsätze in aller Welt fragen Sie bereits heute Ihre amerikanischen Waffenbrüder"
 Es ist abzusehen, dass der Bundestag dem Antrag des Bundesaußenministers Steinmeier zustimmen wird, den Alt-Einsatz der Bundeswehr in dem sicherlich nicht weniger kriegerischer werdenden Afghanistan bis zum Ende des Jahres zu verlängern. Und die Bundesverteidigungsministerin v.d. Leyen will die Bundeswehr durch vermehrte Einsätze in Afrika oder an anderen "Hindukuschs" dieser Welt nicht aus der Übung kommen lassen - sie bei den Entfernungen aber mit Sicherheit nicht familienfreundlicher machen. Damit sie nicht am Ende sagen können, sie hätten nichts über die sicheren Folgen solcher Einsätze gewusst, seien ihnen und natürlich auch den Gegnern solcher Einsätze die laufenden Veröffentlichungen aus den USA zu den unerwünschten Folgen solcher zum Teil völlig "assymmetrisch" geführter Kriegseinsätze unbedingt empfohlen.
Es ist abzusehen, dass der Bundestag dem Antrag des Bundesaußenministers Steinmeier zustimmen wird, den Alt-Einsatz der Bundeswehr in dem sicherlich nicht weniger kriegerischer werdenden Afghanistan bis zum Ende des Jahres zu verlängern. Und die Bundesverteidigungsministerin v.d. Leyen will die Bundeswehr durch vermehrte Einsätze in Afrika oder an anderen "Hindukuschs" dieser Welt nicht aus der Übung kommen lassen - sie bei den Entfernungen aber mit Sicherheit nicht familienfreundlicher machen. Damit sie nicht am Ende sagen können, sie hätten nichts über die sicheren Folgen solcher Einsätze gewusst, seien ihnen und natürlich auch den Gegnern solcher Einsätze die laufenden Veröffentlichungen aus den USA zu den unerwünschten Folgen solcher zum Teil völlig "assymmetrisch" geführter Kriegseinsätze unbedingt empfohlen.
Dies gilt auch für den am 13. Februar 2014 u.a. durch das "Institute of Medicine" der USA erstellten und veröffentlichten Bericht über die mittel- bis langfristigen gesundheitlichen und sozialen Folgen der bisher vor allem in Afghanistan und im Irak durch improvisierte Sprengsätze ("improvised explosive devices (IEDS)") verursachten Sprengverwundungen. Rund 32.000 der insgesamt in diesen Kriegen gravierend verwundeten 50.500 US-Soldaten wurden dies durch Auswirkungen von unter Straßen, im Gelände oder in Autos versteckten Sprengsätzen. Die häufig durch anhaltende Schmerzen und Entstellungen bestimmten Sprengverletzungen erschweren nach Feststellungen der staatlichen US-Krankenversicherung "Veteran Affairs (VA)" die Rückkehr vieler SoldatInnen in ihr ziviles Leben bis zum heutigen Tag.
Der vorgelegte Bericht bewertet umfassend die Evidenz der in den letzten Jahren gewonnenen wissenschaftlichen Erkenntnisse für eine Fülle von durch IEDS-Einwirkung bedingten allgemeinen und spezifischen gesundheitlichen Folgen. Gesicherte Evidenz für die unspezifischen Folgen überwiegt. Für viele spezifische und vor allem kausale Assoziationen gibt es noch keine ausreichende Anzahl von evidenten Belegen aus qualitativ hochwertigen Studien. Angesichts der absehbaren Zunahme derartig verletzten us-amerikanischen aber z.B. auch deutschen SoldatInnen empfehlen die US-Gutachter eine Fülle zusätzlicher Forschungsbemühungen. Deren Ergebnisse sollen die VA, die häufig um Krankenbehandlungskosten kämpfen müssenden Ex-Soldaten und andere Interessenten "provide … with knowledge that can be used to inform decisions on how to prevent blast injuries, how to diagnose them effectively, and how to manage, treat, and rehabilitate victims of battlefield traumas in the immediate aftermath of a blast and in the long term."
Der 230 Seiten umfassende Bericht Gulf War and Health, Volume 9: Long-Term Effects of Blast Exposures. des National Research Council ist über die genannte Website sowohl online zu lesen als auch nach einer unaufwändigen und soweit bekannt folgenlosen Anmeldung auch kostenlos herunterladbar.
Bernard Braun, 13.2.14
WHO-Krebsforschungszentrum: Luftverschmutzung ist mit ausreichender Evidenz "a leading environmental cause of cancer deaths"
 Über den Erhalt, die mögliche Verringerung, Ausnahmeregelungen oder gar die Ausdehnung der immer noch relativ wenigen Umweltzonen in deutschen Städte finden immer noch zähe Auseinandersetzungen praktisch um jede Straße und jeden Block statt. Dieses Ringen sollte mit dem Erscheinen der "Monographie 161: Air pollution and cancer" der "International Agency for Research on Cancer (IARC)", einer wissenschaftlichen Einrichtung der Weltgesundheitsorganisation, beendet und sogar qualitativ derart erweitert werden, dass mehrere bisher weitgehend unbeachtete Schadstoffe berücksichtigt und vermieden werden sollten.
Über den Erhalt, die mögliche Verringerung, Ausnahmeregelungen oder gar die Ausdehnung der immer noch relativ wenigen Umweltzonen in deutschen Städte finden immer noch zähe Auseinandersetzungen praktisch um jede Straße und jeden Block statt. Dieses Ringen sollte mit dem Erscheinen der "Monographie 161: Air pollution and cancer" der "International Agency for Research on Cancer (IARC)", einer wissenschaftlichen Einrichtung der Weltgesundheitsorganisation, beendet und sogar qualitativ derart erweitert werden, dass mehrere bisher weitgehend unbeachtete Schadstoffe berücksichtigt und vermieden werden sollten.
Für die WHO-Onkologen besteht für die durch mehrere Stoffe bestimmte Luftverschmutzung nach der Sichtung von mehr als 1.000 weltweit erschienenen Studien eine ausreichende Evidenz, dass mehrere dieser Stoffe und ihre Mischung Lungen- und auch andere Krebsarten auslösen können. Luftverschmutzung wird deshalb innerhalb der Risikobewertungsklassifikation der IARC ein so genanntes Group 1-Karzinogen ("agent is carcinogenic to humans" und hat "sufficient evidence of carcinogenicity").
Zu der riskanten Schadstoffmischung in der Außenluft gehören z.B. gehören polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe, Ruß, Titandioxid und Talk, offene Feuer und das Anbraten unter hohen Temperaturen im Haushalt, Bitumen und Bitumen-Emissionen und verwandte polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAH) sowie Diesel und andere Fahrzeugabgase sowie Nitroarene, deren Gefährlichkeit einzeln auch bereits in anderen IARC-Monographien nachgewiesen wurde. Der in den "Innenstadt-Umweltzonen"-Debatten eine bedeutende Rolle spielende Feinstaub wurde in einer weiteren Studie ebenfalls zum Group 1-Karzinogen erklärt.
Die Autoren der Monographie 161 heben zwar hervor, dass ihre Forschungsergebnisse sicher das Krebsrisiko der Luftverschmutzung als Ursache für weltweit, also ausdrücklich auch in europäischen Großstädten rund 223.000 Tote pro Jahr nachweisen, lassen aber nicht unerwähnt, dass Luftverschmutzung auch signifikant mit anderen Krankheiten assoziiert ist wie z.B. Herz-Kreislauf- oder Atmungsorganerkrankungen. Trotz eines zunächst geringen individuellen Risikos, wegen der Luftverschmutzung z.B. an Lungenkrebs zu erkranken und zu versterben, stellt die Verringerung der Verschmutzung ein weltweit enormes Public-Health-Thema dar.
Dass die Auswirkung von Luftverschmutzung auf die Morbidität und Frühsterblichkeit von Bevölkerungen keineswegs ein Problem der Dritten Welt oder Chinas ist, zeigten auch bereits zwei im Sommer 2013 erschienene methodisch hochwertige Studien.
Die in der Zeitschrift "Lancet Oncology" vorgestellte Meta-Analyse der Ergebnisse von 17 in Europa durchgeführten Kohortenstudien, die in Regionen mit erhöhten Schadstoffanteilen in der Außenluft leben, bestand bei einem maximalen Follow-up von 13 Jahren bei mehreren Schadstoffen ein signifikant erhöhtes Risiko, an Lungenkrebs zu erkranken.
Eine Meta-Analyse von 35 internationalen Studien in der Fachzeitschrift "Lancet" belegt, dass höhere Expositionen gegenüber bestimmten Schadstoffen (z.B. Carbon-Monoxid) das Risiko erhöhte, während Krankenhausbehandlung wegen Herzschwäche zu sterben. In den USA könnten durch eine Absenkung der Schadstoffkonzentration in der Luft um 3,9 Mikrogramm pro Kubikmeter rund 8.000 Todesfälle während der stationären Behandlung von Herzschwäche pro Jahr vermieden werden.
Einen Überblick über das IARC-Programm für eine "encyklopaedia of carcinogens" gibt die knappe IARC-Pressemitteilung Nr. 221 vom 17.10.2013.
Die von Kurt Straif, Aaron Cohen und Jonathan Samet herausgegebene Monographie 161. IARC Scientific Publication No. 161 "Air Pollution and Cancer" kann man als E-Book im epub-Format kostenlos herunterladen und bei Bedarf z.B. mit dem Programm Calibre in ein anderes Readerformat umwandeln.
Zu dem im August 2013 erschienenen Aufsatz Air pollution and lung cancer incidence in 17 European cohorts: prospective analyses from the European Study of Cohorts for Air Pollution Effects (ESCAPE) von Ole Raaschou-Nielsen rt al. - erschienen in "The Lancet Oncology" (Volume 14, Issue 9, Pages 813 - 822) gibt es das Abstract kostenlos.
Ebenfalls das kostenlose Abstract gibt es für den im September 2013 online erschienenen Aufsatz Global association of air pollution and heart failure: a systematic review and meta-analysis von Anoop SV Shah et al. aus der Zeitschrift "The Lancet" (Volume 382, Issue 9897, Pages 1039 - 1048). 21 September 2013
Bernard Braun, 18.10.13
Ein erhellender Nachtrag: Warum gibt es wenig Transparenz über die Folgen der Freiheit des Waffenbesitzes in den USA ?!
 Der eine oder andere Leser des kürzlich vorgestellten Forumbeitrags zu einer Studie über die Gewalterfahrungen von Waffenbesitzern in den USA mag gedacht haben, ein aktuellerer Aufsatz als der aus dem Jahr 2004 wäre besser gewesen.
Der eine oder andere Leser des kürzlich vorgestellten Forumbeitrags zu einer Studie über die Gewalterfahrungen von Waffenbesitzern in den USA mag gedacht haben, ein aktuellerer Aufsatz als der aus dem Jahr 2004 wäre besser gewesen.
Warum keine aktuellere Untersuchung vorgestellt wurde, liegt nicht daran, dass sie übersehen wurde, sondern an massiven Interventionen der US-Bundesregierung und den Gesetzen einiger Bundesstaaten der USA, kritische Untersuchungen mit allen Mitteln zu verhindern oder gar zu verbieten.
Ein am 13. Februar 2013 in der Zeitschrift "JAMA" veröffentlichter Beitrag macht diese über anderthalb Jahrzehnte gelungenen Versuche transparent, freie Forschung über die von privat verfügbaren Waffen ausgehende Gewalt zu behindern oder zu verbieten:
• 1997 strich die damalige US-Bundesregierung den staatlichen "Centers of disease control and prevention (CDC)" bzw. einer ihrer Fachabteilungen das Geld für die Erforschung von Waffenbesitz und Waffengewalt.
• Um was es den politisch Verantwortlichen dabei ging, formulierten sie völlig offen und klar in der Begründung des Gesetzes. In der Omnibus Consolidated Appropriations Bill. HR 3610, Pub L No. 104-208. heißt es wörtlich: "none of the funds made available for injury prevention and control at the Centers for Disease Control and Prevention may be used to advocate or promote gun control."
• Als dann eine Fall-Kontroll-Studie des ebenfalls staatlichen "National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism" im Jahr 2009 sich doch noch einmal mit der Waffengewalt beschäftigte, dauerte es nur zwei Jahre bis das 1997er-Verbot solcher Forschung auf die "National Institutes of Health (NIH)" ausgedehnt wurde.
• Die massive Einflussnahme auf die öffentliche Transparenz und damit auch Diskussion der Zusammenhänge von Waffenbesitz und Mord wie Selbstmord beschränkte sich aber nicht nur auf die Bundesebene. Bereits 1997 blockierte der Bundesstaat Washington nach der Veröffentlichung einer diese Daten nutzenden Studie per Gesetz den Zugang zu den Meldedaten über privaten Waffenbesitz. Solche Analysen können daher bis zum heutigen Tag zumindest in diesem Bundesstaat mangels Datenzugang nicht durchgeführt werden.
• In Florida und sieben weiteren Bundesstaaten gibt es seit 2011 Gesetze, die Ärzten und anderen Beschäftigten im Gesundheitswesen unter Androhung von Strafen bis hin zum Entzug der Arbeitslizenz verbieten, über Waffensicherheit zu diskutieren oder entsprechende Daten zu sammeln und zu dokumentieren. Der Rechtsstreit über die Zulässigkeit solcher Drohungen oder Verbote ist bisher noch nicht entschieden.
Zu welcher problemfernen, tendenziösen bzw. an den Interessen der Waffenlobby orientierten Forschung und öffentlichen Debatte diese Palette von Verboten und Zugangsbarrieren führt, illustrieren die Autoren mit dem Hinweis, dass in den USA über die seit 1997 in Kampfhandlungen im Irak und in Afghanistan getöteten 4.586 amerikanischen SoldatInnen unverhältnismäßig mehr und intensiver debattiert wird als über die wenigstens 427.000 Personen, die im selben Zeitraum durch einen Waffenschuss getötet wurden, einschließlich 165.000 Mordopfern.
Der kurze Aufsatz Silencing the science on gun research von Kellermann AL und Rivara FP. ist in der Zeitschrift "JAMA" (309:549) und komplett kostenlos erhältlich. Dort gibt es eine Reihe Links auf weitere interessante Hintergrundtexte.
Der Aufsatz Investigating the Link Between Gun Possession and Gun Assault von Charles C. Branas, Therese S. Richmond, Dennis P. Culhane, Thomas R. Ten Have und Douglas J. Wiebe ist im Jahr 2009 im "American Journal of Public Health" (Vol. 99, No. 11, pp. 2034-2040) erschienen und ebenfalls kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 9.3.13
USA: Risiko zu Hause ermordet zu werden oder sich selber umzubringen in Schusswaffen-Haushalten höher als in waffenfreien.
 Sowohl bei der "National Rifle Association (NRA)", dem militanten und äußerst einflussreichen Verband der Waffenbesitzer in den USA, als auch z.B. bei der ansonsten eher friedlich-ökologisch gestimmten Organisation "NaturalNews" (Tenor: "Beyond the emotion, here are the facts: As more guns are sold, violent crime goes down" und als Überblick), erfreut sich die Suggestivfrage "was wäre, wenn plötzlich jemand in ihrer Wohnung oder Schule stünde, und bewaffnet wäre", in vielen Varianten hoher Beliebtheit. In diesen Fällen eine "gute Waffe" zur Hand zu haben, so die Verteidiger des in den USA bisher verfassungsmäßigen Rechts, Waffen zu besitzen und zu tragen, könne man sich doch nicht verbieten lassen. Wie das Tauziehen zwischen der US-Bundesregierung und der breiten Pro-Waffenallianz dieses Mal ausgeht, wissen wir nicht.
Sowohl bei der "National Rifle Association (NRA)", dem militanten und äußerst einflussreichen Verband der Waffenbesitzer in den USA, als auch z.B. bei der ansonsten eher friedlich-ökologisch gestimmten Organisation "NaturalNews" (Tenor: "Beyond the emotion, here are the facts: As more guns are sold, violent crime goes down" und als Überblick), erfreut sich die Suggestivfrage "was wäre, wenn plötzlich jemand in ihrer Wohnung oder Schule stünde, und bewaffnet wäre", in vielen Varianten hoher Beliebtheit. In diesen Fällen eine "gute Waffe" zur Hand zu haben, so die Verteidiger des in den USA bisher verfassungsmäßigen Rechts, Waffen zu besitzen und zu tragen, könne man sich doch nicht verbieten lassen. Wie das Tauziehen zwischen der US-Bundesregierung und der breiten Pro-Waffenallianz dieses Mal ausgeht, wissen wir nicht.
Bekannt ist aber seit einer epidemiologischen Studie im Jahre 2004, dass häuslicher Waffenbesitz eher das Gewalt- und Sterberisiko ihrer Besitzer erhöht als es senkt. Mit Daten des "US mortality follow-back survey" untersuchten Wissenschaftler der "Centers for Disease Control and Prevention (CDC)", ob zu Hause vorhandene Waffen das Risiko eines gewaltsamen Todes durch Mord oder Selbstmord erhöht und ob das Risiko vom Lagerort, dem Waffentyp oder der Anzahl der Waffen abhängig ist.
Die Ergebnisse sahen im Detail so aus:
• Die Personen mit häuslichem Waffenbesitz hatten gegenüber waffenfreien Personen ein um 90% höheres Risiko zu Hause ermordet zu werden (adjustierte Odds Ratio=1,9)
• Das Risiko dieses Personenkreises zu Hause mit einer Feuerwaffe ermordet zu werden, war ebenfalls deutlich erhöht (OR=3,5), allerdings variierte dieses Risiko nach dem Alter und danach, ob die betreffende Person alleine oder mit anderen Personen zusammenlebte.
• Männer in Haushalten mit Waffenbesitz hatten im Vergleich mit Männern aus waffenfreien Haushalten das rund zehnfache adjustierte Risiko auf irgendeine Art Selbstmord zu begehen. Bei Frauen war dieses Risiko "nur" etwas mehr als doppelt so hoch.
• Bei Personen, die eine Waffe in ihrem Haushalt hatten, war das Risiko eines Selbstmords mit einer Feuerwaffe sogar um das Einunddreißigfache höher als Selbstmorde mit anderen Methoden.
• Die Risiken mit Schusswaffen ermordet zu werden oder Selbstmord zu begehen war in "Waffenhaushalten" unabhängig vom Lagerort, der Waffenart oder der Anzahl der Schusswaffen deutlich höher als in "Nicht-Waffenhaushalten".
• Zusammenfassend halten die Epidemiologen eine "strong association between guns in the home and risk of suicide" fest und fanden ein Ermordungsrisiko, das sie im Vergleich aber als "more modest" charakterisieren. Ob es sich um kausale ZUsammenhänge handelt, kann die Studie aber nicht mit abschließender Sicherheit beantworten.
Die Autoren schließen ihre Studie mit einigen Hinweisen auf Grenzen ihrer Untersuchung und auf mögliche zusätzliche Einflussfaktoren. Ein wichtiger Hinweis ist der auf den Einfluss der Nachbarschaft oder des sozialen Klimas im Stadtteil. Außerdem erfassen sie nicht die Waffengewalt gegen sich selbst und gegen andere Personen außerhalb der häuslichen Umgebung. Die Mehrheit dieser Gewalttaten fand aber innerhalb der häuslichen vier Wände statt.
Der Aufsatz Guns in the Home and Risk of a Violent Death in the Home: Findings from a National Study von Linda L. Dahlberg, Robin M. Ikeda und Marcie-jo Kresnow ist im "American Journal of Epidemiology" (2004. 160 (10): 929-936) erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 26.2.13
Wie handlungsanregend sind zusätzlich 0,008 QALY's/Kopf/Leben oder wie überzeugt man Nicht-Ökonomen von Gesundheitsprogrammnutzen?
 Initiatoren und Finanziers von alten oder neuen kurativen oder präventiven gesundheitsbezogenen Maßnahmen und Angebote fordern und nutzen für Entscheidungen über die Verwendung knapper Ressourcen neben gesicherter Evidenz ihrer Wirksamkeit zunehmend auch (gesundheits-)ökonomische Bewertungen oder Indikatoren.
Initiatoren und Finanziers von alten oder neuen kurativen oder präventiven gesundheitsbezogenen Maßnahmen und Angebote fordern und nutzen für Entscheidungen über die Verwendung knapper Ressourcen neben gesicherter Evidenz ihrer Wirksamkeit zunehmend auch (gesundheits-)ökonomische Bewertungen oder Indikatoren.
Dies gilt auch für die Motivation und "Überweisung" von körperlich inaktiven Personen mit Risikofaktoren für schwerere Erkrankungen (z.B. Herz-Kreislauferkrankungen, Diabetes) durch ihre Hausärzte, z.B. Fitnessklubs aufzusuchen und dort an einem maßgeschneiderten Übungsprogramm teilzunehmen. In einem "Health Technology Assessment"-Bericht (Pavey T. et al. (2011): The clinical effectiveness and cost-effectiveness of exercise referral schemes (ERS): a systematic review and economic evaluation. (15 (44): 1-254 oder den entsprechenden Forumsbeitrag) fanden die AutorInnen in den sieben bewerteten randomisierten kontrollierten Studien Evidenz für den Nutzen und die Wirtschaftlichkeit von ERS - auch wenn sie sie selber als "very limited" bezeichneten. Im Vergleich mit Personen oder Patienten, die wie üblich z.B. nur mit verbalen Hinweisen auf Bewegungsmöglichkeiten behandelt wurden, war die Wahrscheinlichkeit, dass ERS-Empfänger körperlich aktiv wurden, um 11% höher. Dieser Unterschied war aber statistisch nicht signifikant.
Die gesundheitsökonomischen Eckwerte für ERS gab der HTA-Bericht so an: Die Mehrkosten pro Kopf betrugen 169 britische Pfund und der Zugewinn an "quality-adjusted life-year (QALY)" beträgt pro Nutzerkopf und pro gesamter Lebenszeit 0,008. Damit kostet ein ganzes QALY für inaktive Personen ohne eine medizinische Erkrankung 20.876 £. Die Kosten für ein QALY sinken bei inakiven übergewichtigen Personen auf 14.618 £, bei inaktiven Personen mit Bluthochdruck auf 12.834 £ und bei Personen mit einer Depression auf 8.414 £.
Die Frage, die sich zwei britische Gesundheitsökonomen nun in einem im Januar 2013 veröffentlichten Aufsatz stellten, ist, ob sich mit den aus der klassischen Kosten-Nutzenanalyse (cost-utility analysis [CUA]) stammenden Werten wie dem beschwerdefreien Lebensjahrezugewinn von 0,008 Jahre Gesundheitspolitiker oder gar gesundheitsferne Kostenverwalter dazu bewegen lassen, Geld für ERS auszugeben. Nachdem sie diese Frage verneinen und in der spröden und technischen Charakteristik von Kostenwerten einen Hauptgrund für die Startschwierigkeiten wichtiger gesundheitsbezogener Leistungen sehen, schlagen sie als Lösung das gesundheitsökonomische Alternativkonzept der so genannten "cost-consequence analysis (CCA)" vor.
Der Argumentationsgang der CCA beginnt mit den für eine Kohorte von 100.000 Personen geschätzten Gesamtausgaben von 22 Millionen £ für die Leistungen der Gesundheitsanbieter und 12 Millionen £ von den TeilnehmerInnen noch zusätzlich zu finanzierenden Mitgliedsbeiträgen etc.. Der Nutzen wird in der CCA in "natürlichen Einheiten" ("natural units")dargestellt. So werden durch ERS im Vergleich zu normal Behandelten zusätzlich 3.900 von 100.000 Personen körperlich aktiv, 51 Fälle von schweren Herz-Kreislauferkrankungen, 16 Schlaganfälle und 86 Fälle Erkrankungen am Altersdiabetes werden verhindert. Insgesamt nimmt die Anzahl von QALY's um rund 800 Jahre zu. Insgesamt trägt das ERS-Programm dazu bei, dass zusätzlich 152 Personen erkrankungsfrei bleiben. Am Ende einer noch wesentlich längeren Liste von sinnlich fassbarem und vermittelbarem Nutzen des Programms gibt es aber auch Nachteile der Intervention: So steigt das Risiko von Muskel- und Skelettverletzungen oder schmerzhaft behindertem Gang um das Vierfache.
Im Resumée der britischen Ökonomen ist die CUA weiterhin eine Art "common currency" für die Berechnung und Darstellung der Wirtschaftlichkeit von Interventionen. Da deren Ergebnisse aber erfahrungsgemäß oft nur "little resonance with stakeholders from the non-health sector" haben und wenig Überzeugungsimpluse und Handlungsanreize liefert, könnten die Ergebnisse einer CCA hier überzeugen und initiieren helfen.
Dies gilt selbst dann auf jeden Fall für andere nachweisbar wirkungsvollere Intervention und Therapien, wenn man am Nutzen von ERS wegen der oben genannten schwachen Evidenz zweifelt und daher auch keinen Nicht-Ökonomen davon überzeugen will.
Der materialreiche und ideenreiche Aufsatz Applying economic evaluation to public health interventions: the case of interventions to promote physical activity von Paul Trueman und Nana Kwame Anokye ist im "Journal of Public Health" (2013, Vol. 35, No. 1: 32-39) erschienen und als "open access"-Beitrag komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 24.2.13
Sturzrisiko von älteren Menschen: häufig, aber nicht einfach zu verhindern
 Ältere Menschen haben ein relativ hohes Risiko zu stürzen und eine Reihe von zum Teil schwerwiegenden Sturzverletzungen und Einschränkungen ihrer funktionellen Kompetenzen davon zu tragen. Stürze und ihre Folgen sind auch häufig Auslöser für eine stationäre Langzeitversorgung. Um Stürze und kurz- wie langfristige Folgen zu verhindern gibt es eine Fülle von personen- und sachbezogenen Maßnahmen und Interventionen.
Ältere Menschen haben ein relativ hohes Risiko zu stürzen und eine Reihe von zum Teil schwerwiegenden Sturzverletzungen und Einschränkungen ihrer funktionellen Kompetenzen davon zu tragen. Stürze und ihre Folgen sind auch häufig Auslöser für eine stationäre Langzeitversorgung. Um Stürze und kurz- wie langfristige Folgen zu verhindern gibt es eine Fülle von personen- und sachbezogenen Maßnahmen und Interventionen.
Am Ende einer Analyse der Veröffentlichungen von 184 aus 12.000 durchgeführten Studien über die Wirksamkeit und den Nutzen dieser Maßnahmen sehen sich die VerfasserInnen eines 2012 veröffentlichten HTA-Berichts aber mangels konsistenter positiver Wirkungen auf die Sturzhäufigkeit wie die Sturzfolgen nicht in der Lage, eine oder mehrere dieser Maßnahmen uneingeschränkt zu empfehlen.
Nach einer Reihe internationaler Studien stürzen ca. 30% aller Menschen über 65 Jahre mindestens ein Mal jährlich und ihr Risiko für weitere Stürze ist deutlich erhöht. In Subgruppen wie z.B. den Bewohnern von Langzeitpflegeeinrichtungen erreicht die jährliche Sturzinzidenz die 50%-Marke. Diese Angaben werden zwar für Deutschland nicht durch große bevölkerungsbezogene Studien belegt, kleinere Untersuchungen bestätigen aber zumindest das Niveau des Auftretens von Stürzen unter älteren Menschen. In der jährlichen bundesweiten Dokumentation der Sturzhäufigkeit in stationären Einrichtungen, stürzten 3,7% der Angehörigen einer Stichprobe von KrankenhauspatientInnen und 3,9% einer Stichprobe aller BewohnerInnen von Pflegeheimen vor dem Erhebungszeitpunkt mindestens einmal.
Bei diesen Stürzen verletzten sich zwischen 30% und 70% der Gestürzten, wobei der Großteil (einige Studien nennen hier 90%) von ihnen keine medizinische Versorgung benötigt. Ob Stürze das Risiko frühzeitig zu sterben erhöhen, ist unklar. Wenn es zu behandlungsbedürftigen Verletzungen kommt, sind diese meist ernsthafter und langwieriger Natur. Dazu gehören insbesondere hüftgelenksnahe Frakturen.
Zu den gravierenden Folgen von Stürzen alter Menschen gehört aber auch deren Erlebnis als traumatischem, schwerwiegenden Ereignis, welches das Selbstbewusstsein und das Eigenständigkeitsgefühl beeinträchtigt und eine ausgesprochene Sturzangst fördert. Mit diesen eher psychischen Folgen ist der vorübergehende oder dauerhafte Verlust funktioneller Kompetenzen verbunden, die besonders bei den gestürzten Personen auftreten, die wegen der Sturzverletzungen stationär behandelt werden müssen. Sturzbedingte Verletzungen sind u.a. wegen dieser Einschränkungen der Fertigkeiten für das tägliche Leben in schätzungsweise 40% der Fälle der Auslöser für eine notwendige stationäre pflegerische Langzeitversorgung.
Angesichts dieses wahrscheinlich wegen der demografischen Entwicklung noch zunehmenden Problemdrucks, gehören die Fragen wie man eine Sturzgefahr bei älteren Personen so früh wie möglich identifiziert und durch geeignete Maßnahmen verhindert, zu den wichtigsten Themen der Prävention für ältere Menschen.
Ein über 600 Seiten dicker Health Technology Assessment (HTA)-Bericht Lübecker Mediziner hat nun versucht, diese Fragen auf der Basis von rund 12.000 Veröffentlichungen und einer Auswahl von 184 methodisch hochwertigen Studien zu beantworten.
Die wesentlichen Ergebnisse dieser Studien lauten:
• Instrumente und Tests zur Beurteilung des Sturzrisikos allein tragen weder zu einer Senkung der Sturzhäufigkeit noch zu einer häufigeren Anwendung prophylaktischer Maßnahmen bei.
• Trainingsangebote zur Förderung motorischer Funktionen können insbesondere dann, wenn sie multidimensional sind und über einen längeren Zeitraum genutzt werden, das Sturzrisiko mindern. Ob dadurch sturzbedingte Verletzungen verhindert werden können, ist unklar. Bei besonders gebrechlichen RentnerInnen zeigen sich aber auch unerwünschte Effekte motorischer Übungen.
• Chirurgische Eingriffe an den Augen oder das Einsetzen von Herzschrittmachern haben nicht durchgängig positive Effekte. So wird zum Teil die Sturzrate gesenkt, nicht aber das Frakturrisiko.
• Schulungsmaßnahmen und Interventionen, die allein oder vorrangig die Kompetenzen von Fachkräften erhöhen, haben wenig sturzmindernde Wirksamkeit.
• Die Anpassung der Wohnumgebung hat für ältere Personen ohne bisherige Stürze zu keiner signifikanten Reduktion der Sturzhäufigkeit geführt. Anders sieht es mit sturzprophylaktischen Maßnahmen in den Wohnungen von Personen aus, die bereits Stürze hinter sich haben.
• Für Hüftprotektoren gibt es weder bei den im eigenen Haushalt wohnenden Personen noch bei BewohnerInnen von Einrichtungen der Langzeitversorgung einen eindeutig positiven Effekt. Diesen gibt es dagegen für gangstabilisierendes Schuhwerk.
• Das vorliegende Studienmaterial zur zusätzlichen Einnahme von Vitamin D, der Aufnahme kalorienreicher Nahrungsergänzungsmittel oder Multivitaminpräparate als sturzprophylaktischen Mitteln liefert keine konsistenten Wirksamkeitsnachweise.
• Für Maßnahmen zur Reduktion des Sturzrisikos durch Anpassung der Einnahme von Medikamenten, die z.B. den Gleichgewichtssinn oder die Wachheit der Personen beeinträchtigen, lässt sich meist kein Wirksamkeitsnachweis erbringen. Dies gilt besonders für den Nachweis einer positiven Wirkung auf sturzbedingte Verletzungen.
• Die 8 Studien zum präventiven Nutzen von multiplen Interventionen und die fast 30 Studien über die Wirkungen multifaktorieller Interventionen, liefern ein sehr durchwachsenes Bild. In jedem Fall sind aber Einfach-Programme mit geringer inhaltlicher und zeitlicher Intensität wesentlich unwirksamer als multifaktorielle Interventionen. Aber auch dort mangelt es an konsistenten Belegen für die Reduktion der Sturzrate und gibt es praktisch keine Belege für die Reduktion der sturzbedingten Verletzungen.
• Neben den Studien mit medizinisch-pflegerischen Fragestellungen enthält der HTA-Bericht noch einen Überblick über die wenigen Studien mit gesundheitsökonomischer, juristischer, ethischer oder sozialer Fragestellung. Auch dort mangelt es an guten Studien oder zeigen z.B. Untersuchungen der Wirksamkeit freiheitsentziehender Maßnahmen in Pflegeheimen keinen positiven Effekt.
• Durch praktisch alle aufgearbeiteten Studien zieht sich ein grundsätzlicher Mangel: Mangels eines einheitlichen Forschungsprogramms sind die vorliegenden Studien in inhaltlicher wie methodischer Hinsicht so heterogen, dass sich fast zwangsläufig keine eindeutigen Ergebnisse gewinnen lassen. Viele der bereits ausgewählten Studien enthalten z.B. keinen Wirksamkeitsnachweis oder beschäftigen sich nur mit der Sturzrate, nicht aber mit dem Risiko sturzbedingter Verletzungen.
Wegen der bereits in dieser Zusammenfassung erkennbaren Unklarheit der Wirksamkeit praktisch aller Maßnahmen auf die Sturzrate und die damit assoziierten negativen Wirkungen sprechen die AutorInnen des Berichts keine klare Empfehlung zugunsten bestimmter Maßnahmen aus. Die wenigen gesichert positiven Wirkungen auf den einen oder anderen Aspekt des Sturzgeschehens zeigen allerdings, dass es sich lohnt weiter nach wirksameren präventiven Interventionen zu suchen.
Der Bericht "Sturzprophylaxe bei älteren Menschen in ihrer persönlichen Wohnumgebung" von Katrin Balzer, Martina Bremer, Susanne Schramm, Dagmar Lühmann und Heiner Raspe ist 2012 als HTA-Bericht 116 des "Deutschen Instituts für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI)" erschienen und kostenlos erhältlich. (http://portal.dimdi.de/de/hta/hta_berichte/hta255_bericht_de.pdf)
Bernard Braun, 27.6.12
Ehrenamtliche Tätigkeit im höheren Alter fördert soziale Kontakte und subjektives Wohlbefinden
 Mäßige und intensivere ehrenamtliche Tätigkeiten und vor allem die soziale Unterstützung durch Freunde steigern sowohl bei den jüngeren als auch den älteren Angehörigen einer Gruppe von 55- bis 94-jährigen BürgerInnen das subjektive Wohlbefinden. Zusammen mit der körperlichen Leistungsfähigkeit ist das subjektive Wohlbefinden eine wichtige Bedingung für die Möglichkeit gesund und in Würde alt zu werden.
Mäßige und intensivere ehrenamtliche Tätigkeiten und vor allem die soziale Unterstützung durch Freunde steigern sowohl bei den jüngeren als auch den älteren Angehörigen einer Gruppe von 55- bis 94-jährigen BürgerInnen das subjektive Wohlbefinden. Zusammen mit der körperlichen Leistungsfähigkeit ist das subjektive Wohlbefinden eine wichtige Bedingung für die Möglichkeit gesund und in Würde alt zu werden.
In der australischen "Transitions In Later Life"-Studie mit 561 Personen zwischen 55 und 94 Jahren wurden u.a. der Umfang der ehrenamtlichen Tätigkeiten, die sozialen Interaktionen und Austauschprozesse sowie der Erhalt und die Verfügbarkeit sozialer Unterstützung durch Freunde, Verwandte und Nachbarn erhoben. Damit konnte die Lebenszufriedenheit und das subjektive Wohlbefinden von ehrenamtlich tätigen Personen mit der/dem von nicht ehrenamtlich Tätigen verglichen werden.
Als erstes zeigten sich enge innere Zusammenhänge der Existenz von Freundeskreisen und ehrenamtlicher Tätigkeit. So initiieren Freundes-Netzwerke mehr als Verwandtschaften und Nachbarschaften ehrenamtliche Tätigkeiten und umgekehrt führen ehrenamtliche Tätigkeiten oft zu neuen Freundschaften.
Die positive Assoziation, die zwischen einer bereits moderaten ehrenamtlichen Tätigkeit von bis zu 7 Stunden pro Woche und dem subjektiven Wohlbefinden besteht, wird vom Erhalt der sozialen Unterstützung durch Freunde, Verwandte und Nachbarn und den mit ihnen stattfindenden sozialen Interaktionen vermittelt. Unerwartet wirkte sich die soziale Unterstützung durch Freunde am stärksten auf den positiven Effekt von ehrenamtlicher Tätigkeit auf das subjektive Wohlbefinden aus. 36% dieses Effekts wurde durch die Beziehungen zu Freunden, 16% durch die soziale Unterstützung durch Verwandte bedingt und ein weiterer Anteil von 13% verdankt sich generellen positiven sozialen Beziehungen. Die Hypothese, dass negative soziale Beziehungen und Erfahrungen eine ebenfalls negative Wirkung auf die Assoziation zwischen ehrenamtlicher Tätigkeit und subjektivem Wohlbefinden haben können, konnte nicht verifiziert werden. Die Ergebnisse der Studie belegen eher, dass ehrenamtliche Arbeit eher mit positiven als mit negativen sozialen Beziehungen assoziiert ist.
Zu dem von Pilkington, P.D., Windsor, T.D. und Crisp, D.A. verfassten Aufsatz "Volunteering and subjective well-being in midlife and older adults: the role of supportive social networks.", veröffentlicht im "The Journals of Gerontology, Series B: Psychological Sciences and Social Sciences, 2012; 67(2), 249-260, ist das Abstract kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 16.6.12
Dekubitusprophylaxe für ältere Patienten muss bei den wenigen Stunden auf Tragbahren in Notfallambulanzen anfangen, und lohnt sich
 Druckgeschwüre oder Dekubiti gehören zu den am schnellsten entstehenden und schwersten unerwünschten Nebenwirkungen bei zum Liegen gezwungenen Patienten im Krankenhaus oder auch von bettlägrigen häuslichen Patienten oder Heimbewohnern. Wenn erst einmal ein Druckgeschwür entstanden ist, ist es sehr aufwändig, es wieder weg zu bekommen und weitere Folgen zu vermeiden.
Druckgeschwüre oder Dekubiti gehören zu den am schnellsten entstehenden und schwersten unerwünschten Nebenwirkungen bei zum Liegen gezwungenen Patienten im Krankenhaus oder auch von bettlägrigen häuslichen Patienten oder Heimbewohnern. Wenn erst einmal ein Druckgeschwür entstanden ist, ist es sehr aufwändig, es wieder weg zu bekommen und weitere Folgen zu vermeiden.
Deshalb gelten gezielte präventive Maßnahmen wie das personalintensive ständige Umlagern gefährdeter PatientInnen oder druckentlastende Unterlagen bzw. Matratzen zu den anerkannten Gegenmitteln. Da weder zusätzliches Personal kostenlos zu erhalten ist, noch geeignete Matratzen billig sind, scheuen viele Behandlungs- und Pflegeeinrichtungen vor solchen Personal- und/oder Sachinvestitionen aus Kostengründen zurück und riskieren damit eine lang andauernde gesundheitliche Beeinträchtigung sowie auch Folgekosten für das Krankenhaus.
Dass dieses Verhalten weder human noch kosteneffizient ist, weist jetzt eine kanadische Studie über die Kosten und den finanziellen Nutzen früher Prävention von Druckgeschwüren durch spezielle druckentlastende Matratzen in Notfallambulanzen bis auf den Dollar-Cent genau nach. Da dort viele dieser Patienten lange auf Tragbahren und einfachen Betten liegen müssen und sich bereits dadurch ein Druckgeschwür bilden oder verschlimmern kann, untersuchten die ForscherInnen mittels einer aufwändigen Analysemethodik (Markov-Modelle) für die rund 240.000 älteren Patienten in Ontario, die über eine Notfallambulanz ins Krankenhaus kamen, die Inzidenz von Druckgeschwüren nach durchschnittlich 15,4 Stunden Aufenthalt auf normalen Liegegelegenheiten und bei der Nutzung von speziellen druckentlastenden Betten.
Die Ergebnisse sehen so aus:
• Die Inzidenz eines während eines Notfallambulanzaufenthalts erworbenen Druckgeschwürs betrug bei PatientInnen, die auf einfachen Tragbahren etc. lagen, 1,90%. Bei den Patienten mit einem speziellen präventiv wirkenden Schaumstoffbett belief sich die Inzidenz auf 1,48%. Für die erfolgreiche Verhinderung eines Druckgeschwürs mussten 238 PatientInnen behandelt werden ("number needed to treat").
• Die Ausgaben für die Umrüstung auf druckentlastende Betten bzw. entsprechend wirkende Matratzen für Tragbahren beliefen sich auf 0,30 Canada-Dollar pro Patient.
• Das Liegen in den Spezialbetten stellte ein wirksames Mittel der Frühprävention gegen Druckgeschwüre dar, führte zu einer Verlängerung der "quality-adjusted life-days" von 0,0015 und führte zu einer durchschnittlichen Gesamtkostenersparnis von 32,36 Kanada-Dollar pro älterem Patient. Der Anteil des durch die Verlängerung der gesunden Lebenszeit bedingten Gesundheitsnutzens am finanziellen Netto-Nutzen betrug 0,21 Kanada-Dollar. Die Kostenersparnis pro Patient schlug mit 32,15 Kanada-Dollar zu Buche. Selbst wenn ein Patient nur eine Stunde in einer Notfallambulanz lag, betrug der finanzielle Nutzen der Dekubitus-Prävention mittels einer speziellen Matratze noch 4 Kanada-Dollar pro Patient selbst dann, wenn diese nur eine Stunde liegend in einer Krankenhaus-Ambulanz auf ihre Behandlung warten mussten.
• Die positive gesundheitliche und ökonomische Wirkung druckentlastender Schaumstoffmatratzen bestätigte sich auf unterschiedlichen Niveaus auch noch in weiteren Analysen, die z.B. Effekte über längere Zeiträume untersuchten.
• Trotz der Absicht, nach weiteren Effekte in differenzierteren Untersuchungen zu suchen, kommen die AutorInnen zu dem eindeutigen Schluss, dass "the economic evidence supports early prevention with pressure-redistribution foam mattresses in the emergency department. Early prevention is likely to improve health for elderly patients and save hospital costs."
Zu dem in der Novemberausgabe 2011 in der Fachzeitschrift "Annals of Emergency Medicine" (Volumen 58 [5]: 468-78) erschienenen Aufsatz "Early Prevention of Pressure Ulcers Among Elderly Patients Admitted Through Emergency Departments: A Cost-effectiveness Analysis" von Ba' Pham et al. ist kostenlos lediglich das Abstract erhältlich.
Bernard Braun, 14.12.11
96,4% des in NRW untersuchten Mastgeflügels mit Antibiotika behandelt. Nie erfolgte dies in Kleinbetrieben mit längerer Mastdauer.
 Auch wenn jetzt der öffentliche Aufschrei auf einen am 14. November 2011 veröffentlichten Bericht des NRW-Verbraucherschutzministeriums groß ist und eigentlich alle Beteiligten, Verantwortlichen und Betroffenen "rasche und entschiedene Maßnahmen" fordern: Das Problem des Antibiotika-Einsatzes in der Tierzucht und das der wachsenden Anzahl der u.a. dadurch resistent gewordenen Krankheitserreger ist mindestens schon zwei, drei Jahrzehnte bekannt und taucht etwa zusammen oder in bunter Reihe mit dem Tranquilizereinsatz bei Schweinen und weiteren vergleichbaren Tierpharma-Usancen regelmäßig im Skandal-Zirkus auf. Genauso regelmäßig verschwindet aber der Skandal wieder, nicht ohne Appelle und Versprechungen der Mastbetriebe, ihren Verbänden und den approbierten Pharmadealern, so etwas nie wieder zu tun.
Auch wenn jetzt der öffentliche Aufschrei auf einen am 14. November 2011 veröffentlichten Bericht des NRW-Verbraucherschutzministeriums groß ist und eigentlich alle Beteiligten, Verantwortlichen und Betroffenen "rasche und entschiedene Maßnahmen" fordern: Das Problem des Antibiotika-Einsatzes in der Tierzucht und das der wachsenden Anzahl der u.a. dadurch resistent gewordenen Krankheitserreger ist mindestens schon zwei, drei Jahrzehnte bekannt und taucht etwa zusammen oder in bunter Reihe mit dem Tranquilizereinsatz bei Schweinen und weiteren vergleichbaren Tierpharma-Usancen regelmäßig im Skandal-Zirkus auf. Genauso regelmäßig verschwindet aber der Skandal wieder, nicht ohne Appelle und Versprechungen der Mastbetriebe, ihren Verbänden und den approbierten Pharmadealern, so etwas nie wieder zu tun.
Ein Indiz für das Dauerproblem sind die mit einer Ausnahme auch in den letzten Jahren stetig gegenüber dem Vorjahr steigenden Mengen von für die "Tiergesundheit" eingesetzten Antibiotika: Für das Jahr 2005 schätzte der Bundesverband für Tiergesundheit und berichtete am 1. September 2011 die Bundesregierung auf eine Anfrage von Bündnis 90/Die Grünen, dass 784,4 Tonnen Antibiotika verabreicht worden sind. Das war gegenüber 2004 eine Zunahme um 8,8%. 2006 stieg der Verbrauch um 7%, 2007 um 9,2%, 2008 um 1%, um 2009 sogar einmal um 2,5% abzunehmen, die aber 2010 durch eine erneute Zunahme um 2% zum größten Teil wieder aufgeholt wurde. Bisher wurde aber von Seiten der Politik wenig getan, um das datengestützte Problembewusstsein zu fördern. In der seit Januar 2011 geführten bundeseinheitlichen DIMDI-Datenbank zu den nach Postleitzahlen aufgeschlüsselten Arzneimittelverwendungen war und ist die Geflügelwirtschaft ausgenommen.
Der Untersuchung des "Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen" liegen die "Daten von 962 Mastdurchgängen und von 182 verschiedenen Betrieben in NRW innerhalb des Zeitraums von Februar bis Juni 2011" zugrunde. Die amtlichen Experten halten dies, ohne dass ihnen bisher jemand direkt widersprach, für eine "belastbare Datengrundlage". Nebenbei erfährt man, dass allein in den nordrhein-westfälischen Hühnermastbetrieben jährlich fast 57 Millionen Tiere gehalten und geschlachtet werden. Die Betriebsgröße schwankt zwischen 3.400 und 170.000 Tieren.
Das Fazit der 10-seitigen Expertise ist an Deutlichkeit nicht zu übertreffen und lautet im Wortlaut:
• "Die Haltung von Masthühnern erfolgte bei 163 (17 %) aller Mastdurchgänge bzw. in 18 (10 %) der ausgewerteten Betriebe durchgehend ohne den Einsatz von antimikrobiellen Substanzen. Auffallend ist, dass auf diesen 10 % der Betriebe lediglich 3,6 % der Tiere gehalten wurden, also 96,4% der Masthühner einer antibiotischen Behandlung unterzogen wurden."
• "Bei den erfassten Mastdurchgängen mit Antibiotikaeinsatz kam eine Vielzahl von Wirkstoffen zum Teil zeitgleich zum Einsatz (1-8 Wirkstoffe pro Mastdurchgang) und die jeweilige Behandlungsdauer eines Wirkstoffes lag bei 53 % (924 von 1748) der Behandlungen mit 1-2 Tagen deutlich unter den Zulassungsbedingungen der verabreichten Wirkstoffe." Dies ist vor allem deshalb gefährlich, weil durch diese zu kurze Behandlung Bakterien Resistenzen entwickeln können.
• "Bei kleinen Betrieben (<20.000 Tiere) und bei einer Mastdauer >45 Tage wurde eine signifikant geringere Behandlungsintensität (Dauer, Anzahl der Wirkstoffe) festgestellt. Ein genereller Zusammenhang zwischen Behandlungsintensität und Betriebsgröße war auf Basis der Einzelbetriebsdaten dagegen nicht erkennbar."
• "Die dargestellte Situation, wonach über 96 % der Masthühner behandelt werden, ist nicht akzeptabel und legt den Schluss nahe, dass das Haltungssystem nicht den Vorgaben des Tierschutzgesetzes entspricht, da die angemessene Ernährung, Pflege und verhaltensgerechte Unterbringung in Frage gestellt werden muss."
Unklar bleibt, ob der Antibiotika-Einsatz als Wachstumsförderung stattfindet, und damit seit 2006 ausdrücklich verboten ist, oder als Gesundheitsförderung bzw. Krankheitsprophylaxe. Angesichts der oberen Betriebsgrößen und dem damit verbundenen Risiko einer Masseninfektion aufgrund der Massenhaltung, dürfte letzteres das Hauptmotiv für den Antibiotika-Einsatz sein.
Die Reaktion des "Zentralverbands der Deutschen Geflügelwirtschaft" und des "Deutschen Bauernverbandes" ist als Musterbeispiel für Problemvernebelung lesenswert: Natürlich "nehmen (wir) diese Ergebnisse sehr ernst" und starten jetzt "in enger Abstimmung mit der Tierärzteschaft ein Monitoring-Programm innerhalb des QS-Systems". Dabei geht es aber lediglich darum, dass der "im EU-Vergleich ohnehin niedrige Antibiotika-Einsatz weiter minimiert" wird. Und im Übrigen könne trotz "der ermittelten Antibiotikagaben Geflügelfleisch bedenkenlos verzehrt werden". Deswegen und aus ein paar Gründen mehr "sollte die Auseinandersetzung mit den Erkenntnissen über den Antibiotika-Einsatz beim Hähnchen auch nicht im Zusammenhang mit dem Thema Antibiotikaresistenzen missbraucht werden."
Und wer ein großes Merkzettelbrett hat, sollte die folgende Schlusspassage der Verbändeerklärung mindestens 5 Jahre lang dort hängen lassen: "'Die Ergebnisse der Studie (aus NRW) machen einmal mehr deutlich, dass eine verlässliche Auswertung vorhandener Daten bisher nicht möglich ist - das muss nun unverzüglich angegangen werden', fordert DBV-Generalsekretär Dr. Born. Die Wirtschaft ergreift daher die Initiative und hat die Etablierung eines eigenen Monitoringsystems für Antibiotikagaben in der Geflügelaufzucht in die Wege geleitet. Eine Meldepflicht besteht ohnehin schon: DBV und ZDG machen deutlich, dass bereits seit zehn Jahren alle tierhaltenden Betriebe in Deutschland verpflichtet sind, jeden Einsatz von Tierarzneimitteln zu dokumentieren. Zudem müssen die Betriebsleiter den Amtsveterinären jederzeit Einsicht in diese Unterlagen geben. Darüber hinausgehend soll das von der Geflügelwirtschaft initiierte QS-Monitoring eine verlässliche bundesweite Auswertung als Grundlage für eine Reduzierung des Antibiotika-Einsatzes liefern: So hat sich die deutsche Geflügelwirtschaft auf die Zielvereinbarung verständigt, durch Verbesserungen im Tierhaltungsmanagement den Antibiotika-Einsatz in den kommenden fünf Jahren um 30 Prozent zu verringern.
Den "Abschlussbericht. Evaluierung des Antibiotikaeinsatzes in der Hähnchenhaltung gibt es kostenlos herunterzuladen.
Und wem bisher nicht der Appetit vergangen ist: Weitere Informationen, Debatten und Erklärungen aus den letzten Jahren und diverse Links findet man auf der Antibiotika-Themenseite des Verbraucherschutzministeriums. Zwei Beispiele: "Mehr Gewicht in kürzerer Zeit: Um 1,6 Kilogramm zuzunehmen brauchte ein Masthähnchen 1970 noch 48 Tage. 2007 waren es nur noch 27 Tage" und "Zwischen 1985 und 2007 stieg das durchschnittliche Gewicht bei Masthähnchen um 61 Prozent."
Bernard Braun, 16.11.11
Ein Hauch von Scylla und Charybdis: Einmalige Gabe einer Jahresdosis Vitamin D zur Sturzprävention ist nicht erfolgreich
 Die regelmäßige Einnahme von Vitamin D kann Ältere vor Stürzen und damit verbundenen Knochenbrüchen schützen. Das Problem ist lediglich, dass Ältere sich aus unterschiedlichsten Gründen oft nicht an die Einnahmevorschriften für Arzneien halten und der Schutzeffekt von Vitamin D daher schwindet. Ein bei erstem Hinsehen genialer Trick hat leider nicht das gehalten, was man sich davon versprochen hatte: Eine im Herbst oder Winter verabreichte einmalige Gabe einer hohen Dosis, die für ein ganzes Jahr ausreicht, führte in einer methodisch gut abgesicherten Studie leider zu einer überdurchschnittlich hohen Sturzrate.
Die regelmäßige Einnahme von Vitamin D kann Ältere vor Stürzen und damit verbundenen Knochenbrüchen schützen. Das Problem ist lediglich, dass Ältere sich aus unterschiedlichsten Gründen oft nicht an die Einnahmevorschriften für Arzneien halten und der Schutzeffekt von Vitamin D daher schwindet. Ein bei erstem Hinsehen genialer Trick hat leider nicht das gehalten, was man sich davon versprochen hatte: Eine im Herbst oder Winter verabreichte einmalige Gabe einer hohen Dosis, die für ein ganzes Jahr ausreicht, führte in einer methodisch gut abgesicherten Studie leider zu einer überdurchschnittlich hohen Sturzrate.
Das Risiko von Stürzen und damit verbundenen Knochenbrüchen ist besonders bei älteren Personen erhöht und folgenreich. Eine Reihe von Studien zeigte, dass man dieses Risiko durch die regelmäßige Einnahme einer Dosis des Vitamins D positiv beeinflussen kann. Das präventive Potenzial wurde dabei als durchaus bedeutsam eingeschätzt, auch wenn einige andere Studien keine statistisch signifikanten Effekte oder sogar ein leicht erhöhtes Risiko von Hüftfrakturen unter der Einnahme von Vitamin D zeigten. Trotzdem gilt ein zu niedriges Vitamin D-Niveau weiterhin als Risikofaktor für Stürze und Brüche und als veränderbar. Die wichtigste Voraussetzung, um aber unabhängig von der geschilderten, nicht einhelligen Studienlage wirklich wirksam zu sein, ist die regelmäßige tägliche Einnahme. Besonders bei älteren Personen lässt aber die Therapietreue bei der Einnahme von Medikamenten oder eben auch Vitaminen erheblich zu wünschen übrig.
Als Lösung wird seit einiger Zeit eine einmalige orale Gabe einer Dosis Vitamin D im Herbst oder Winter verabreicht, die für ein ganzes Jahr ausreicht. Anders als in vielen ähnlichen Fällen untersuchten Mediziner nun in einer doppelt blinden, placebokontrollierten Studie bei 2.256 zwischen Juni 2003 und Juni 2005 rekrutierten, zu Hause lebenden Frauen im Alter über 70 Jahren die Wirkungen dieser Jahresdosis. Die Beobachtungszeit betrug zwischen 3 und 5 Jahren. (doppelt blind = weder Wissenschaftler noch Teilnehmer wissen, ob sie in der Untersuchungs- oder Kontrollgruppe sind; placebokontrolliert = es gibt eine Kontrollgruppe, in der statt eines Medikaments ein Placebo verabreicht wird)
Bei der Analyse der Sturz- und Knochenbruchhäufigkeit zeigten sich aber dann in der 837 Frauen umfassenden Vitamin D-Gruppe signifikant höhere Werte als in der Placebogruppe mit 769 Frauen. 2.892 Stürze (83,4 Stürze pro 100 Personenjahre) und 171 Frakturen in der Vitamin D-Gruppe standen in der Placebogruppe 2.512 Stürze (72,7 Stürze pro 100 Personenjahre) und 135 Knochenbrüche gegenüber (p=0,03).
Das relative Risiko (RR) eines Knochenbruchs in der Vitamin D-Gruppe betrug 1,26 gegenüber der Placebogruppe (p=0,047). Das höchste Risiko für Stürze belief sich in der Vitamin D-Interventionsgruppe innerhalb der ersten 3 Monate nach Verabreichung der Jahresdosis auf 1,31. Der Wert sank in den folgenden 9 Monaten zwar auf 1,13, war aber immer noch höher als in der Placebo-Gruppe. Insgesamt war das Risiko eines Sturzes um 15 % erhöht.
Die WissenschaftlerInnen fügen ihrem Nachweis, dass die Jahresdosisbehandlung die Sturz- und Frakturrisiken erhöht, noch einige weitere Hinweise für die Behandlung und die weitere Forschung hinzu. Ein wichtiger Hinweis ist, dass offensichtlich die Einnahme von Vitamin D allein keine ausreichende präventive Wirkung hat, sondern durch andere Maßnahmen (z.B. entsprechende Trainingsangebote oder primärpräventive Unterstützung im Wohnumfeld) ergänzt oder sogar ersetzt werden sollte. Sie vermuten ferner, dass die unerwünschten Effekte auch durch die sehr hohe Vitamindosis entstanden sein könnten. Dass man eine unerwünschte Situation und Wirkung (fehlende Therapietreue) durch eine Intervention zu verändern sucht, ist nachvollziehbar. Sobald diese Intervention jedoch selber zu unerwünschten Wirkungen führt, sollte dies Anlass sein, über intelligentere und weniger gesundheitsriskante Formen der Förderung von Therapietreue nachzudenken.
Dass dies über das Ziel, Sturz- und Frakturrisiken zu senken, hinaus von Bedeutung sein könnte, zeigt ein gerade veröffentlichter Aufsatz in der Fachzeitschrift "Journals of Gerontology". Dort wurde nachgewiesen, dass der Vitamin D-Spiegel einen Einfluss auf die geistige Aktivität haben kann. Wenn er zu niedrig ist, schwindet die kognitive Flexibilität. Selbst wenn man weitere Einflussfaktoren auf die geistige Flexibilität kontrolliert, bleibt ein positiver Effekt des Vitamin D bestehen.
Ein Abstract des Jahresdosis-Aufsatzes, erschienen in der Ausgabe von JAMA vom 12. Mai 2010 (12;303(18):1815-22) ist kostenlos erhältlich: Sanders KM, Stuart AL, Williamson EJ, et al.: Annual high-dose oral vitamin D and falls and fractures in older women: a randomized controlled trial
Der Aufsatz über den Einfluss von Vitamin D auf die geistige Flexibilität ist in der Juli-Ausgabe 2010 der Zeitschrift The Journals of Gerontology (Series A Volume 64A, Issue 8: 888-895) erschienen und komplett kostenlos erhältlich: Jennifer Buell et al.: Vitamin D Is Associated With Cognitive Function in Elders Receiving Home Health Services
Bernard Braun, 6.8.10
Leitlinien zur Händehygiene in Krankenhäusern nur wirksam bei aktiver Implementierung
 Als eine der unbestrittenen Ursachen zahlreicher schwerer bis tödlicher Infektionen bei KrankenhauspatientInnen gilt die fehlende oder mangelhafte Händehygiene von Ärzten, Pflegekräften und auch PatientInnen. Lange Zeit glaubte man, das Problem durch Appelle an ethische oder professionelle Grundsätze wie dem des "zuerst einmal nicht schaden (primum non nocere)" oder an den Reinlichkeitssinn bewältigen zu können. Studien im Ausland wie in Deutschland zeigten einerseits, dass Hygienemaßnahmen und darunter Händehygiene wirksame Maßnahmen zur Prävention zahlreicher Krankenhausinfektionen (darunter auch mit multiresistenten Erregern) sind. Andererseits weist aber der aktuellste HTA-Bericht (Korczak/Schöffmann 2010) auf die "irritierend … stark unterschiedlichen Complianceraten" (S. 1) bei der Händehygiene hin, die sich negativ auf die Gesamtwirkung auswirken dürfte. Frühere Studien zeigen, dass diese mangelnde Hygiene aus Sicht der Handelnden auf einer Reihe gewichtiger Faktoren beruht. Einer der genannten Gründe für die mangelnde Compliance war die mangelnde wissenschaftliche Gewissheit über den Nutzen von mehr Händehygiene im Verhältnis zu dem für sie notwendigen Aufwand.
Als eine der unbestrittenen Ursachen zahlreicher schwerer bis tödlicher Infektionen bei KrankenhauspatientInnen gilt die fehlende oder mangelhafte Händehygiene von Ärzten, Pflegekräften und auch PatientInnen. Lange Zeit glaubte man, das Problem durch Appelle an ethische oder professionelle Grundsätze wie dem des "zuerst einmal nicht schaden (primum non nocere)" oder an den Reinlichkeitssinn bewältigen zu können. Studien im Ausland wie in Deutschland zeigten einerseits, dass Hygienemaßnahmen und darunter Händehygiene wirksame Maßnahmen zur Prävention zahlreicher Krankenhausinfektionen (darunter auch mit multiresistenten Erregern) sind. Andererseits weist aber der aktuellste HTA-Bericht (Korczak/Schöffmann 2010) auf die "irritierend … stark unterschiedlichen Complianceraten" (S. 1) bei der Händehygiene hin, die sich negativ auf die Gesamtwirkung auswirken dürfte. Frühere Studien zeigen, dass diese mangelnde Hygiene aus Sicht der Handelnden auf einer Reihe gewichtiger Faktoren beruht. Einer der genannten Gründe für die mangelnde Compliance war die mangelnde wissenschaftliche Gewissheit über den Nutzen von mehr Händehygiene im Verhältnis zu dem für sie notwendigen Aufwand.
Diese Gewissheit vermitteln nun bereits seit Jahren evidenzbasierte Leitlinien zur Händehygiene, die es in den USA nicht nur seit 2002 gibt, sondern die dort auch bereits flächendeckend eingesetzt wurden. Die von den US-"Centers for Disease Control and Prevention (CDC)" entwickelte Guideline for Hand Hygiene in Healthcare Settings gilt als eine der ersten umfassenden (56 Seiten) und wissenschaftlich gründlichen Leitlinien. Darin wird auch bereits auf die Notwendigkeit hingewiesen, ihre Umsetzung am besten im größeren Rahmen einer Sicherheitskultur zu organisieren. Von internationaler Bedeutung sind die 2009 veröffentlichten WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care First Global Patient Safety Challenge. Clean Care is Safer Care. Auf einem Teil der 270 Seiten dieser Leitlinie beschäftigen sich auch deren Verfasser damit, wie man die Implementierung und die Wirkung solcher wissenschaftlich eindeutig nützlicher und machbarer Handlungsempfehlungen gewährleistet. Danach soll die Händehygiene in die allgemeine Debatte über Indikatoren für Leistung, Ergebnisqualität oder soziales Marketing von Gesundheitseinrichtungen eingebettet werden.
Wie zutreffend und praktisch notwendig solche Hinweise sind, zeigt das Kernergebnis der ersten Studie über die Implementierung der CDC-Leitlinie in US-amerikanischen Krankenhäusern: Von einer schlichten Implementierung als zusätzlichem Informations- oder Wissensangebot darf nicht allzu viel erwartet werden. Die in 40 Krankenhäusern durchgeführte Studie verglich die Raten der versorgungsbedingten Infektionsraten ein Jahr vor und nach der Publikation der Leitlinienempfehlungen. Hierbei war hilfreich, dass die 40 Krankenhäuser Mitglieder des "National Nosocomial Infections Surveillance System" in den USA waren, also sogar deutlich mehr für das Problem der Prävention von Krankenhausinfektionen sensibilisiert waren als der Großteil der Krankenhäuser. Zusätzlich untersuchten die ForscherInnen u.a. durch Befragungen auch sonstige Veränderungen in den Kliniken, die sowohl Folgen als auch Bedingungen für den Erfolg der Leitlinienimplementation sein können. Ergänzt wurde das Bild durch die direkte Beobachtung der Leitlinientreue.
Die wichtigsten Ergebnisse waren:
• Alle Krankenhäuser hatten ihre ausformulierten Hygienegrundsätze der Leitlinie angepasst und auch eine Reihe leitliniengerechter Instrumente und Produkte entwickelt und bereit gestellt.
• Fast 90% der dazu anonym befragten MitarbeiterInnen sagten, sie seien mit den Leitlinien vertraut.
• Auf einer Bewertungsskala für Implementationen erreichte die Händehygiene-Leitlinie 10,5 von 12 maximal möglichen Punkten. Für die Bewertung spielten allerdings Struktur- und Prozessindikatoren wie z.B. die Erhältlichkeit von alkoholischen Mitteln zur Händeinfektion oder die Existenz von Schulungsprogrammen die vorrangige Rolle und lediglich nachrangig Indikatoren für die Ergebnisqualität.
• In 44,2% (19 von 40) der Krankenhäuser existierte aber dennoch kein nachweisbares Programm, das unter Einbeziehung aller Akteure oder Disziplinen die Leitlinientreue verbessern helfen sollte.
• Die Handhygieneraten verharrten bei durchschnittlich 56,6%.
Bei den erhobenen Wirkungen der Handhygiene gab es uneinheitliche Ergebnisse: Die Infektionen durch Arterienkatheter waren in Krankenhäusern mit hohen Handhygieneraten hochsignifikant besser als in Häusern mit niedrigen Raten. Auf alle anderen Möglichkeiten von Behandlungsinfektionen wirkte sich die Implementation der Leitlinie oder der Stand der Händehygiene nicht aus.
Weder die aufwändige und praktikerfreundliche (z.B. Kurzversionen oder so genannte "Kitteltaschen-Versionen") Verbreitung der Leitlinie in den untersuchten Krankenhäusern noch relativ umfangreiche Schulungsmaßnahmen haben allein weder zu multidisziplinären Verbesserungsbemühungen noch zum erhofften Erfolg bei der Senkung von Infektionsraten geführt. Die ForscherInnen sind der Meinung, dass derartige Hygieneleitlinien nur dann ihre unbestrittene Wirksamkeit erreichen können, wenn es multidisziplinär abgestimmte Bemühungen gibt, die Umsetzung so aktiv und vielfältig wie möglich erfolgt und die Umsetzung administrativ und von den leitenden Akteuren aktiv unterstützt wird.
Jüngste Erfahrungen (Schnoor, Maike; Schäfer, Tobias; Welte, Tobias: Leitlinien: Aktive Implementierung zeigt Wirkung (Deutsches Ärzteblatt 2010; 107(12): A-541 / B-472 / C-646;) mit der Implementierung der S3-Leitlinie "Infektionen der unteren Atemwege" innerhalb einer randomisierten kontrollierten Studie an deutschen Krankenhäusern, verweisen für ihr Sachgebiet ebenfalls auf geringere Wirkungen als erwartet wurden. Auch hier werden aber eine bessere Implementierung und höhere Wirkungen erst von einer besonderen, aktiven Form und intensiveren Maßnahmen wie Audits und Qualitätszirkeln erwartet.
Der HTA-Bericht von Korczak und Schöffmann unterstreicht dies für die Prävention der MRSA-Infektionen und schlägt z.B. eine multimodale Kombination von individualisierten Screenings, Schulungen und eines Antibiotika-Managements vor. Ob damit aber die gewünschten und notwendigen Ergebnisse erreicht werden können, kann wegen der bisher fehlenden Evaluation kombinierter Präventions- und Kontrollmaßnahmen nicht verlässlich gesagt werden.
Hier ist ein Abstract: Elaine L. Larson, Dave Quiros und Susan X. Lin (2007): Dissemination of the CDC's Hand Hygiene Guideline and impact on infection rates (American Journal of Infection Control Volume 35, Issue 10: 666-675)
Hier ist die Studie von Korczak/Schöffmann als Volltext: Dieter Korczak, Christine Schöffmann (2010): Medizinische Wirksamkeit und Kosten-Effektivität von Präventions- und Kontrollmaßnahmen gegen Methicillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA)-Infektionen im Krankenhaus (HTA-Schriftenreihe Bd. 100. Köln)
Bernard Braun, 30.4.10
Wie entscheiden sich Patienten für oder gegen Therapien und welche Rolle spielen dabei Entscheidungshilfen? Das Beispiel Tamoxifen
 Wie viele Frauen mit einem relativ hohem Risiko, innerhalb der nächsten 5 Jahre an primärem Brustkrebs zu erkranken, versuchen dieses Risiko durch die Einnahme des nachweislich wirksamen aber auch nebenwirkungsreichen Wirkstoffs Tamoxifen (vgl. genauere pharmakologische und sonstige Angaben mit hervorragenden und hilfreichen Links in der umfassend aufgebauten Datenbank "ChemIDplus lite" der US-National Library of Medicine) zu verringern bzw. eine Erkrankung zu vermeiden?
Wie viele Frauen mit einem relativ hohem Risiko, innerhalb der nächsten 5 Jahre an primärem Brustkrebs zu erkranken, versuchen dieses Risiko durch die Einnahme des nachweislich wirksamen aber auch nebenwirkungsreichen Wirkstoffs Tamoxifen (vgl. genauere pharmakologische und sonstige Angaben mit hervorragenden und hilfreichen Links in der umfassend aufgebauten Datenbank "ChemIDplus lite" der US-National Library of Medicine) zu verringern bzw. eine Erkrankung zu vermeiden?
Wie entscheiden sie sich, wenn ihnen umfassende, wissenschaftliche ausgewogene und verständliche Informationen über ihr individuelles Erkrankungsrisiko, das Pro und Contra zu den Wirkungen des Wirkstoffs und die positiven wie negativen Wirkungen des Verzichts, ihn einzunehmen, mittels einer maßgeschneiderten Entscheidungshilfe ("tailored decision aid") im Rahmen einer "informed decision making"-Behandlung zur Verfügung gestellt werden?
Der Hintergrund dieser Fragen ist, dass einerseits nach Angaben des "National Cancer Institute" der USA in mehreren seit 1998 durchgeführten Brustkrebs-Präventionsstudien bei Frauen, die ohne Vorerkrankung also präventiv ein Arzneimittel mit dem Wirkstoff Tamoxifen eingenommen hatten, eine geringere Inzidenz von Brustkrebs nachgewiesen wurde. Andererseits nehmen aber schätzungsweise von den allein in den USA lebenden 10 Millionen Frauen, die etwas von der Wirkung dieser Präventionsmaßnahme haben könnten, nur wenige Tamoxifen ein.
Ob dies an Informationsmängeln oder dem Fehlen verständlicher und ausgewogener Information liegt, wollte nun erstmals ein Wissenschaftlerteam in den USA genauer wissen.
Dazu wählten sie auf Basis von medizinischen Daten in zwei Krankenversicherungen in Michigan und im Bundesstaat Washington die Frauen im Alter von 40 bis 74 Jahren aus, die zur Zielgruppe der Prophylaxe gehören und für die ein erhöhtes 5-Jahresrisiko für Brustkrebs berechnet werden konnte. Vorgeklärt wurde ferner, ob Tamoxifen nicht evtl. durch sonstige Erkrankungen kontraindiziert wäre.
Von den zunächst als mögliche Teilnehmerinnen mit einem Einladungs- und Informationsschreiben angesprochenen 8.896 Frauen blieben nach weiteren Überprüfungen ihrer Eignung für die Studie noch 632 Teilnehmerinnen übrig. Sie waren durchschnittlich 59 Jahre alt, weiß und gut ausgebildet.
Jede Teilnehmerin erhielt im Rahmen der Studie eine Online-Information zur Quantität ihres Erkrankungsrisikos, der Risiken der Einnahme aber auch der Nichteinnahme von Tamoxifen, die bis in Details auf ihre Person zugeschnitten war. Die VerfasserInnen wollten die Leserinnen ausdrücklich nicht überzeugen, Tamoxifen einzunehmen, sondern ihnen lediglich ausgewogene evidente Informationen zur Entscheidungsfindung liefern. Nachdem die Teilnehmerinnen die Entscheidungshilfe gelesen hatten wurden sie nach ihren Verhaltensabsichten gefragt. Nach 3 Monaten folgten Fragen zum tatsächlichen Verhalten bis zu diesem Zeitpunkt, nach dem Wissensstand und nach Gründen für die Nichteinnahme des Wirkstoffs.
Dabei gab es eine Reihe interessanter Ergebnisse, die in dieser Qualität erstmalig erhoben worden sind:
• Nach der ersten Lektüre der Entscheidungshilfe wollten 28,8% der Teilnehmerinnen sich nach weiteren Informationen umsehen, die sie zum Teil durch Links in dem Hilfetext leicht erreichen konnten. 29,5 % wollten darüber mit ihrem Arzt reden. Nur 5,8% gaben aber an, sie würden innerhalb des folgenden Jahres mit der Einnahme von Tamoxifen beginnen. Dies waren sogar weniger als bei Frauen, die keine derartige Informationsbasis besaßen.
• Es gab einen Zusammenhang zwischen einem erhöhten Risikoniveau (abgebildet mit dem so genannten Gail score) und dem Wunsch mit einem Arzt über mögliche Behandlungsschritte zu reden. Keine Assoziation gab es aber zwischen dem Risikoniveau und der Absicht, weitere Informationen zum Wirkstoff zu suchen.
• Nach 3 Monaten hatten 0,9% (n=3) der Teilnehmerinnen mit der Einnahme von Tamoxifen begonnen, 5,8 % hatten mit ihrem Arzt geredet und 5,4% hatten nach weiteren Informationen gesucht. Selbst Frauen mit dem höchsten Risikowert suchten zwar etwas häufiger nach Informationen oder redeten mit ihrem Arzt, aber mehr als 10,6% und nochmals 10,6% waren dies nicht. Die große Mehrheit reagierte nicht auf die Informationen der Entscheidungshilfe.
• Als einen Grund für die geringe Anzahl von Teilnehmerinnen mit Reaktionen und Folgeaktivitäten nennen die WissenschaftlerInnen das trotz umfassender Information relativ geringe Wissensniveau vieler Angehörigen der Interventionsgruppe: Alles in Allem beantworteten die Teilnehmerinnen 4,31 der 6 Wissensfragen korrekt. 63% von ihnen beantworteten mindestens 5 Fragen korrekt und 41,4% gaben ausschließlich richtige Antworten. Nur 3% beantworteten aber sämtliche Fragen falsch und stellten interessanterweise einen überproportionalen Anteil an der Gruppe von Frauen, die Tamoxifen einnehmen wollten.
• 81% der Frauen wussten dabei genau, dass der Wirkstoff ihr Risiko, an Brustkrebs zu erkranken, präventiv beeinflussen kann.
• Gut ein Drittel waren schließlich noch daran interessiert mehr über das Risiko und den Nutzen von Brustkrebs und Tamoxifen zu lernen.
• Da es unmöglich ist, mit den 3 TeilnehmerInnen, die nach der Intervention Tamoxifen einnahmen, differenzierte Analysen über mögliche Ursachen durchzuführen, gaben die ForscherInnen lediglich plausible Hinweise auf die Rolle subjektiver Erwartungen über die Risiken und den Nutzen von Tamoxifen. Hinzu kamen bei 80% der TeilnehmerInnen, die den Wirkstoff nicht einzunehmen beabsichtigten, Sorgen über seine Nebenwirkungen, 58,8% bewerteten den Nutzen nicht so hoch, dass er die Risiken aufwiegen könnte und zwischen 20 und 40% dieser Gruppe hielten viele Umstände einer Arzneimitteltherapie persönlich nicht für ertragbar.
Selbst bei einer so großen Anzahl von Studienteilnehmerinnen und nach dem erstmaligen Einsatz einer maßgeschneiderten Risiko- und Nutzeninformation waren also "many women at elevated risk … unwilling to accept the risks of tamixofen to reduce their breast cancer risk."
Die Studie liefert eine Reihe Einblicke in die wirkliche relative Bedeutung von evidenten und gut aufbereiteten Informationen für Entscheidungen von Gesunden und PatientInnen über medizinische Interventionen. Bemerkenswert ist die insgesamt geringe handlungsauslösende oder -steuernde Rolle der Ressource Wissen bzw. die bereits in anderem Zusammenhang beobachtete deutliche Differenz zwischen dem Interesse an "mehr Informationen", Handlungsabsichten und tatsächlichem Handeln. Weitere empirische Belege hierfür finden sich z.B. in dem Forums-Beitrag "Wissen=Handeln?". Diese Differenz ist für all jene Studien und Interventionsprojekte wichtig, die sich ausschließlich an Informations- oder Handlungsinteressen und -absichten orientieren und dabei riskieren, dass ihre Intervention quantitativ wenig genutzt wird oder wirkungslos verpufft. Lehrreich sind die Ergebnisse dieser Studie auch für jene, die beabsichtigen, optimale Versorgungsziele per informationsorientierten Entscheidungshilfen bzw. "decision aids" zu erreichen.
Da die Studie weder für andere ethnischen Gruppen und auch nicht für Frauen mit anderen Bildungsabschlüssen Gültigkeit besitzen kann, wird erst eine repräsentative Studie, dann aber auch gleich mit Kontrollgruppe, zeigen können, wie sich Entscheidungshilfen in einer Normalbevölkerung auswirken.
Die konkrete 48-seitige Entscheidungshilfe Tamoxifen und Brustkrebs ist für diejenigen, die sich für diese Form der patientenorientierten Entscheidungshilfe interessieren, kostenlos erhältlich.
Zum Aufsatz "Women's decisions regarding tamoxifen for breast cancer prevention: responses to a tailored decision aid" von Angela Fagerlin et al. in der Fachzeitschrift "Breast Cancer Research Treatment" (12. November 2009 - elektronische Vorabveröffentlichung) gibt es kostenlos nur ein Abstract.
Bernard Braun, 6.1.10
Sind RaucherInnen unterm Strich doch volkswirtschaftlich nützlich? Klärendes aus Österreich
 In ehemaligen Raucherkneipen und in regelmäßigen Abständen auch in seriösen epidemiologischen Papers und Präsentationen steht nicht selten die These im Raum, Rauchen sei doch letztlich gar nicht nur oder so schädlich wie behauptet wird. Raucher würden beispielsweise gar nicht so lange leben und Rente in Anspruch wie Nichtraucher und zahlten außerdem erhebliche Beträge an Steuern.
In ehemaligen Raucherkneipen und in regelmäßigen Abständen auch in seriösen epidemiologischen Papers und Präsentationen steht nicht selten die These im Raum, Rauchen sei doch letztlich gar nicht nur oder so schädlich wie behauptet wird. Raucher würden beispielsweise gar nicht so lange leben und Rente in Anspruch wie Nichtraucher und zahlten außerdem erhebliche Beträge an Steuern.
Ob und wie weit diese These neben der Wirklichkeit liegt untersuchte jetzt eine Gruppe von WissenschaftlerInnen vom österreichischen "Institut für Höhere Studien" in Wien. Dazu bediente sie sich des "methodischen Konzepts der Rauchen-attributablen Anteile"". In ihm werden die volkswirtschaftlichen Kosten und fiskalischen Vorteile (Nutzen) des Rauchens gegenüberstellt. Dabei wird auch das epidemiologisch gesicherte erhöhte Gesundheitsrisiko von Aktiv-, Ex- sowie Passiv-RaucherInnen quantifiziert.
Die methodischen Vorzüge ihrer Analyse beschreiben sie zusammengefasst so: "Gängige, ein-periodige Modelle können dynamische Bevölkerungseffekte aufgrund niedrigerer Sterblichkeit der Nicht-Passiv-RaucherInnen nicht erfassen. Sie über- bzw. unterschätzen die medizinischen bzw. ökonomischen Kosten von Rauchern durch die Vernachlässigung der höheren Lebenserwartung von NichtraucherInnen, welche eine rauchfreie Bevölkerung wachsen lassen würde. Aus diesem Grund implementierten die AutorInnen "ein (diese Effekte mitberücksichtigendes) sogenanntes Lebenszyklus-Modell, welches als Basis die Bevölkerung im Jahr 2003 heranzieht und in den Szenarien "Status quo" bzw. "rauchfreie Gesellschaft" die Alterskohorten mit den jeweiligen Sterblichkeiten und Aufwendungen zu Ende leben lässt."
Die wesentlichen Ergebnisse dieser Art von Analysen lauten:
• Zuerst zu den Lebenszeitverlusten durch Rauchen und den verschiedenen Kosten des Rauchens: "Im Jahr 2003 starben 8.600 Männer und Frauen in Österreich ursächlich wegen ihres Tabakkonsums. Dies entspricht 11% der insgesamt Verstorbenen im Jahr 2003, oder einem Toten alle 60 Minuten. Das erhöhte Sterberisiko von Aktiv-RaucherInnen schlägt sich in einer reduzierten Lebenserwartung von im Schnitt 5 Jahren im Vergleich zu lebenslangen NichtraucherInnen nieder. Passiv-RaucherInnen verlieren rund 9 Monate an Lebenserwartung."
• Allein die höheren Pro-Kopf-Gesundheitsausgaben von RaucherInnen für die medizinischen Kosten von Rauchen belaufen sich jährlich auf 760 Mio. EUR, das sind 3,3% der Gesundheitsausgaben im Jahr 2003 (ohne Pflege und Investitionen). Berücksichtigt man zusätzlich die höhere Lebenserwartung von NichtraucherInnen, so errechnet das Lebenszyklus-Modell unter Berücksichtigung des Kohorteneffekts vermeidbare medizinische Kosten von jährlich EUR 53,7 Mio. bzw. 0,26% der Gesundheitsausgaben im Jahr 2003 (ohne Pflege und Investitionen). Die nicht-medizinischen Kosten wie Pflege- und Krankengelder sowie Invaliditätspensionen belaufen sich auf jährlich 40,9 bzw. 26 Mio. EUR. In Summe betragen die nicht-medizinischen Kosten jährlich 75 Mio. EUR. Die ökonomischen Kosten bedingt durch häufigere Krankenstände, Invalidität und vorzeitige Sterblichkeit von erwerbstätigen RaucherInnen errechnen sich aus den resultierenden Arbeitsausfällen. Die vorliegende Studie schätzt die Rauchen-attributablen Ausfälle mit rund 17.600 Vollzeitäquivalenten im Jahr 2003. Dadurch gehen der österreichischen Volkswirtschaft jährlich rund 1.430 Mio. EUR oder 0,63 % des Bruttoinlandprodukts (BIP) verloren.
• Im Rahmen dieser Studie wurde, "erstmals für Österreich, die unfreiwillige Verkürzung der Lebenserwartung von Passiv-RaucherInnen monetär bewertet. Die hypothetischen Kompensationszahlungen der RaucherInnen an Passiv-RaucherInnen belaufen sich jährlich auf 81 Mio. EUR. Dieser Betrag stellt eine Unterschätzung dar, da nur der Verlust an Lebensquantität und nicht an -qualität von Passiv-RaucherInnen berücksichtigt wurde."
• Nun zu den Kosten einer "Rauchfrei-Politik": Im Jahr 2003 gab es in Österreich insgesamt 9.821 vollzeitäquivalente Beschäftigten in der Tabakwarenproduktion und im Tabakhandel. Die damit verbundene volkswirtschaftliche Wertschöpfung von 645 Mio. Euro würde durch eine "Rauchfreipolitik" wegfallen. Ob diese Beschäftigten andere Arbeitsplätze finden und dort wiederum Wertschöpfung stattfindet, ist zwar wahrscheinlich, aber nicht sicher.
• Sicher ist aber der Verlust an fiskalischen Einnahmen aus dem Tabakwarenkonsum wie Umsatzsteuer, Arbeitnehmerabgaben und Körperschaftssteuer in Höhe von 1.328,7 Mio. Euro im Jahr 2003. Im Rahmen des Lebenszyklus-Modells entsprechen die Tabaksteuereinnahmen einem jährlichen Betrag von 1.087 Mio. EUR.
• Schließlich, und hier findet der eingangs erwähnte Kneipendialog seinen materiellen Grund, beliefe sich der Mehr-Aufwand der öffentlichen Hand in einer rauchfreien Gesellschaft im Bereich der Alters- und Hinterbliebenenpensionen (so genannter Witweneffekt) jährlich auf 45 Mio. EUR oder 0,18 % des Pensionsaufwands für Alters- und Witwen/er-Pensionen im Jahr 2003.
• "In der Gegenüberstellung von Kosten und Nutzen übersteigen die gesellschaftlichen Kosten des Rauchtabakkonsums dessen Nutzen jährlich um 511,4 Mio. EUR; diese Differenz entspricht 0,23% des BIPs. Von diesen Netto-Kosten sind knapp ein Viertel, nämlich 118,6 Mio., auf Effekte des Passivrauchens zurückzuführen. Dabei handelt es aber immer noch um eine Unterschätzung der wahren Kosten von Rauchen. So sind die Kosten Arbeits- und Verkehrsunfälle, Wohnungsbrände sowie Produktivitätsverluste aufgrund von Warte- und Wegzeiten für medizinische Behandlungen, Rauchpausen während der Arbeitszeit, unbezahlten Pflegeleistungen der Angehörigen, etc. schwer zu quantifizieren und daher nicht erfasst worden."
• Schlussfolgerungen für den ökonomischen Sinn einer Rauchfrei-Politik: "Aus sozioökonomischer Sicht ist … die gesellschaftliche Toleranz und die fiskalische Nutznießung des Konsums von Rauchtabakwaren nicht gerechtfertigt. Die Effekte des Passivrauchens schlagen sich mit knapp einem Viertel der Netto-Kosten von Rauchen monetär nieder."
Es gibt keinen theoretischen Grund, dass die Lebenszyklus-Effekte von Aktiv-, Passiv- und Nichtrauchen sich zwischen Österreich und Deutschland qualitativ und quantitativ erheblich unterscheiden und Deutschland oder einige seiner Bundesländer einen bayrischen oder hessischen Sonderweg schaffen könnten. Daher lohnt ein gründlicherer Blick in die schon etwas älteren 207 Seiten des Schlussberichts der Studie "Volkswirtschaftliche Effekte des Rauchens. Eine ökonomische Analyse für Österreich" von Markus Pock, Thomas Czypionka, Sandra Müllbacher und Alexander Schnabl (Endbericht, April 2008), die in Gänze kostenlos zu erhalten sind.
Zu einer abweichenden Bilanz war im Jahr 2008 eine niederländische Studie gekommen. Allerdings hatte diese gesundheitsökonomische Untersuchung auch nur die direkten Versorgungs-Kosten von Rauchern und Nichtrauchern (unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Lebenserwartung) verglichen. Nicht berücksichtigt - so schrieben die Wissenschaftler ausdrücklich in ihrem Artikel - waren mehrere Faktoren, die das Ergebnis möglicherweise verändert hätten: Höhere Krankenstände und Produktivitätsverluste durch rauchende Erwerbstätige, daraus resultierende volkswirtschaftliche Verluste, geringere Renteneinzahlungen, sinkende Tabaksteuereinnahmen. vgl.: Niederländische Studie rechnet vor: Prävention bringt keine direkten Kosteneinsparungen im Gesundheitssystem
Bernard Braun, 24.11.09
Händewaschen: Mit flotten Leuchtschriften in Toiletten von Autobahn-Raststätten lässt sich Hygiene (ein wenig) verbessern
 Händewaschen gilt als eines der effektivsten und zugleich am billigsten und schnellsten durchführbaren Mittel, um sich und andere vor Infektionskrankheiten zu schützen. Gleichwohl fällt es sogar Ärzten und anderen in der medizinischen Versorgung tätigen Berufen schwer, diese Einsicht auch in die Tat umzusetzen (vgl. etwa: Händewaschen gegen Krankenhausinfektionen). Wie man die auch bei Normalbürgern beobachtete Abneigung gegen das Händewaschen auf öffentlichen Toiletten verbessern kann, hat nun eine US-amerikanische Studie untersucht, deren Ergebnisse jetzt in der Zeitschrift "American Journal of Public Health" veröffentlicht wurden. Es zeigte sich, dass der Textinhalt bestimmter kurzer Leuchtschriften, die den Toilettenbesuchern gezeigt wurden, in begrenztem Umfang durchaus effektiv ist.
Händewaschen gilt als eines der effektivsten und zugleich am billigsten und schnellsten durchführbaren Mittel, um sich und andere vor Infektionskrankheiten zu schützen. Gleichwohl fällt es sogar Ärzten und anderen in der medizinischen Versorgung tätigen Berufen schwer, diese Einsicht auch in die Tat umzusetzen (vgl. etwa: Händewaschen gegen Krankenhausinfektionen). Wie man die auch bei Normalbürgern beobachtete Abneigung gegen das Händewaschen auf öffentlichen Toiletten verbessern kann, hat nun eine US-amerikanische Studie untersucht, deren Ergebnisse jetzt in der Zeitschrift "American Journal of Public Health" veröffentlicht wurden. Es zeigte sich, dass der Textinhalt bestimmter kurzer Leuchtschriften, die den Toilettenbesuchern gezeigt wurden, in begrenztem Umfang durchaus effektiv ist.
Die Wissenschaftler beobachteten an 32 Tagen im Zeitraum Juli bis September 2008 etwa 108.000 männliche und 90.000 weibliche Toilettenbenutzer einer Autobahnraststätte in England. Vollautomatisch mit Hilfe von Sensoren protokolliert wurde - in Männer- und Frauentoilette - ob der jeweilige Besucher auch den Seifenspender über dem Waschbecken benutzt hatte. Um die "Studienteilnehmer" zum Händewaschen zu motivieren, wurden ihnen unterschiedliche kurze Botschaften in einer Leuchtschrift am Eingang der Toiletten gezeigt - allerdings nicht immer, sondern nur manchmal, um zu sehen, ob diese Texte überhaupt einen Einfluss haben auf die Benutzung von Wasser und Seife nach dem Toilettengang. Und überdies wurde der Text der Werbebotschaften variiert, zum Einsatz kamen insgesamt 14 verschiedene Mitteilungen.
Diese Kurztexte (mit maximal 48 Zeichen) waren von Psychologen, Gesundheitswissenschaftlern und Marketing-Experten entwickelt worden und beschrieben jeweils eine andere Informationslogik und Anreizqualität. Angesprochen waren unter anderem: Reine Informationsvermittlung (z.B. "Wasser allein zerstört Keime nicht, man benötigt Seife"), Appelle an den Status ("Sei kein schmutziger Seifen-Schwindler!"), Betonung des Komforts ("Seife gibt Dir ein Frischegefühl") oder Hervorrufen von Ekel oder Scham ("Nimm das Klo nicht mit nach draußen, wasch Dich mit Seife").
In der Auswertung der Daten zeigte sich dann, dass bestimmte Botschaften eine Steigerung des Händewaschens um etwa 10 Prozent (im Vergleich zur vorherigen Situation ohne Leuchtbotschaften) bewirkt hatten. Insgesamt schwankte die Steigerungs-Quote für das Händewaschen zwischen 2 und 12 Prozent. Überraschend war, dass Frauen und Männer sich für sehr unterschiedliche Mitteilungen empfänglich zeigten. Während bei Männern Komfort-Hinweise ("Seife gibt Dir ein Frischegefühl") und Ekelappelle ("Nimm das Klo nicht mit nach draußen, wasch Dich mit Seife") überaus erfolgreich waren, zeigten sich Frauen am sensibelsten gegenüber der Vermittlung von reiner Information ("Wasser allein zerstört Keime nicht, man benötigt Seife", "Seife vernichtet Krankheitserreger"). Für beide Geschlechter gleich effektiv (+ 11-12%) war allerdings eine Mitteilung, die auf soziale Kontrolle abzielt: "Wäscht sich die Person neben Dir auch mit Seife?"
Hier ist ein Abstract der Studie: Gaby Judah et al: Experimental Pretesting of Hand-Washing Interventions in a Natural Setting (American Journal of Public Health S405-S411, October 2009, Vol 99, No. S2)
Gerd Marstedt, 18.11.09
Qualitätssicherung von Prävention und Gesundheitsförderung: Welche Kriterien sind wichtig?
 Über die Anforderungen oder Kriterien, die in Qualitätssicherungsprogrammen im Gesundheitswesen bedeutsam sind, besteht unter Experten hohe Übereinstimmung. Fast genauso sicher sind sich diese aber auch über die zahlreichen Kollisionen zwischen wichtigen Bereichen und Kriterien der Qualitätssicherung - diese sind eher Regel als Ausnahme. Aufgezeigt wurden diese Ergebnisse in einer Umfrage unter mehr als 200 deutscher Praktikern und Managern von Prävention und Gesundheitsförderung aus Betrieben, Krankenkassen oder dem Öffentlichen Gesundheitsdienst, die dazu in den Jahren 2004 bis 2007 von Hamburger Wissenschaftlern befragt wurden.
Über die Anforderungen oder Kriterien, die in Qualitätssicherungsprogrammen im Gesundheitswesen bedeutsam sind, besteht unter Experten hohe Übereinstimmung. Fast genauso sicher sind sich diese aber auch über die zahlreichen Kollisionen zwischen wichtigen Bereichen und Kriterien der Qualitätssicherung - diese sind eher Regel als Ausnahme. Aufgezeigt wurden diese Ergebnisse in einer Umfrage unter mehr als 200 deutscher Praktikern und Managern von Prävention und Gesundheitsförderung aus Betrieben, Krankenkassen oder dem Öffentlichen Gesundheitsdienst, die dazu in den Jahren 2004 bis 2007 von Hamburger Wissenschaftlern befragt wurden.
Die Idee der systematischen Qualitätssicherung verbreitet sich auch im Gesundheitswesen immer mehr. Trotzdem existieren ernsthafte Zweifel an der Evidenz vieler Qualitätssicherungsprogramme, ihren "Outcome-Gewinnen bei den Nutzern", Effektgrößen von "schwach bis moderat", einem kaum belegten Kosten-Nutzen-Verhältnis und an insgesamt "sehr schwacher Evidenz" in Gestalt von Expertenmeinungen. Diese kritische Bilanz ist der Ausgangspunkt eines Versuchs Hamburger Wissenschaftler, Brauchbarkeitsbereiche und Brauchbarkeitskriterien für die Qualitätssicherung im Bereich von Prävention und Gesundheitsförderung zu bestimmen. Dazu extrahierten sie zunächst aus der wissenschaftlichen Literatur in einer strukturierten Bilanz 5 Bereiche und 21 Kriterien.
Diese Taxonomie enthielt beispielsweise im Bereich "leichte, effiziente Handhabung" Kriterien wie Sparsamkeit und Benutzerfreundlichkeit; im Bereich "Nutzungsmöglichkeiten und Aufgabenspektrum" spielten Rückmeldungen an Projekte, Fairness gegenüber praktischen Erfordernissen oder die Funktionsbreite eine Rolle; Im Bereich "sachliche Vollständigkeit und Reichweite" waren es die Möglichkeit der Ursachenermittlung, die Erfassung der Wirtschaftlichkeit von Maßnahmen oder die Darstellung aller Qualitätsdimensionen von Struktur über Prozess bis zum Ergebnis; im Bereich "Akzeptanz und Motivierung der Anwender/innen" erkennbare Zwecke, und die Möglichkeit zur Partizipation sowie schließlich im Brauchbarkeitsbereich "wissenschaftliche Güte" die Kriterien Validität, Reliabilität und Unparteilichkeit.
Die Antworten der 228 von insgesamt 308 befragten Experten (Rücklaufquote von 74%) auf die Frage nach der professionellen Brauchbarkeit dieser Bereiche und Kriterien lauteten u.a. so:
• 18 von 26 (69%) Bereichs- und Einzelkriterien wurden auf einer 5er-Skala von (1 für sehr wichtig bis 5 für unwichtig) als sehr wichtig oder wichtig beurteilt, 7 weitere als fast ebenso wichtig. Insgesamt hielten die Experten also 25 von 26 Kriterien für irgendwie wichtig.
• Für die Vollständigkeit der abgefragten Kriterien spricht, dass insgesamt nur 6 Vorschläge für zusätzliche Kriterien gemacht wurden. Darunter waren z.B. der Nachweis der Wirksamkeit und Nützlichkeit des Verfahrens oder die "Veränderungssensivität" des Verfahrens
• 94% der Experten berichteten über Konflikte zwischen den Brauchbarkeitsbereichen. Die meisten Experten, nämlich 76% der Befragten, sahen Kollisionen zwischen leichter Handhabung und wissenschaftlicher Güte sowie 74% zwischen leichter Handhabung und sachlicher Vollständigkeit.
• Die Vereinbarkeit aller Bereiche bejahten lediglich 6% der Experten.
• Unabhängig von den Berufsfeldern, Disziplinen und Arbeitsaufgaben gaben die Befragten fast identische Beurteilungsmuster an. Zu den wenigen Ausnahmen zählte, dass Krankenkassenakteure die Vollständigkeit und Reichweite für wichtiger hielten als Befragte aus der Forschung.
Die meisten Befragten setzten die leichte, effiziente Handhabung der Qualitätssicherung an die erste, die wissenschaftliche Güte an die zweite und die Motivierung der Anwender an die dritte Stelle einer Wichtigkeitsskala. Weniger wichtiger waren den Experten die sachliche Vollständigkeit/Reichweite und das Nutzungsspektrum des Verfahrens.
Die Wissenschaftler sehen durch die Ergebnisse dieser Befragung die "Validität und weitgehende Vollständigkeit der literaturgestützten Kriterien" bestätigt. Für das künftige Austarieren der Anforderungen an die Leistungen eines Qualitätssicherungsverfahrens und beim Ziel, Nutzer-, Stakeholder- und Expertenerwartungen für die vergleichende Entwicklung derartiger Verfahren zu ermitteln und zu klären, kommt man um diese Kriterien aber nicht mehr herum.
Dies gilt aber auch für ein anderes Ergebnis der Expertenbefragung: Die Befragten berichteten nämlich nahezu übereinstimmend "von erheblichen Problemen, diese Anforderungen bei der Gestaltung von Qualitätssicherung in Einklang zu bringen", so dass "Kollisionen der Gestaltungsprinzipien die Regel, nicht die Ausnahme" darstellen.
Ungeklärt bleibt, inwiefern die von den Hamburger Wissenschaftlern selbst geäußerte Skepsis gegenüber der schwachen Evidenz von Expertenmeinungen nicht auch für wesentliche Erkenntnisse gilt, die durch die Antworten der hier befragten 228 Experten gewonnen wurden.
Von dem Aufsatz "Anforderungen an Qualitätssicherungsverfahren für Prävention und Gesundheitsförderung" von T. Kliche, A. Elsholz, C. Escher, K. Weitkamp, J. Töppich und U. Koch, der in der Fachzeitschrift " Prävention und Gesundheitsförderung" (DOI 10.1007/s11553-009-0172-2) erschienen ist, gibt es kostenlos lediglich ein Abstract: Anforderungen an Qualitätssicherungsverfahren für Prävention und Gesundheitsförderung
Bernard Braun, 11.10.09
Sachlichkeit statt "Pandemie-Hype": Allgemeinarztverband und Arzneimittelkommission zum ob, wer, wie und wie oft der Grippeimpfung
 Generalstabsmäßig meldet seit einigen Tagen Bundesland für Bundesland Vollzug: Zig Millionen von Impfdosen gegen die Schweinegrippe bzw. die angeblich "neue Influenza" liegen in Hunderten von Lagerstätten bereit, um am Tag X in Gesundheitsämtern und Schwerpunktpraxen an genau definierte Bevölkerungsgruppen ausgegeben werden zu können. Doch trotz dieser beeindruckenden Verteidigungskulisse kommt man sich als Beobachter ein wenig wie Loriots Rennbahnbesucher vor: "Ja, wo ist sie denn?"
Generalstabsmäßig meldet seit einigen Tagen Bundesland für Bundesland Vollzug: Zig Millionen von Impfdosen gegen die Schweinegrippe bzw. die angeblich "neue Influenza" liegen in Hunderten von Lagerstätten bereit, um am Tag X in Gesundheitsämtern und Schwerpunktpraxen an genau definierte Bevölkerungsgruppen ausgegeben werden zu können. Doch trotz dieser beeindruckenden Verteidigungskulisse kommt man sich als Beobachter ein wenig wie Loriots Rennbahnbesucher vor: "Ja, wo ist sie denn?"
Denn parallel zum Aufbau der Abwehrmaßnahmen, der immer wieder aufflackernden Debatte über die Verteilung der Impfkosten, der Diskussion möglicher unerwünschter Wirkungen der Impfstoffe und der stetigen Verlängerung der schon jetzt langen Kette inplausibler und intellektuell unredlicher Argumentationen im öffentlichen Schweinegrippe-Diskurs ist und bleibt die Schweinegrippe ein weltweit seltenes, hinsichtlich ihrer Tödlichkeit vergleichsweise "harmloses" Phänomen und dieses wird sogar im Moment in vielen Ländern faktisch kleiner oder verschwindet.
Bei vielen der seit Monaten von Gesundheitspolitikern aber auch einem Teil der Gesundheitsbehörden und Organisationen wie dem nationalen Robert-Koch-Institut (RKI) und der internationalen Weltgesundheitsorganisation (WHO) verbreiteten Prognosen und Szenarien handelt es sich
• im Falle der Erwartung einer "zweiten" und auch gleich noch wesentlich gefährlicheren Welle um eine abenteuerliche Analogie zu der in den letzten 100 Jahren einzigen derartigen Konstellation in den Jahren 1918/19. Dass es seither keinen zweiten Fall einer gefährlicheren zweiten Welle gegeben hat, wird in der eigenartigen "Pandemie-Euphorie" ignoriert und damit die Tatsache ignoriert, dass es zu dieser zweiten Welle wahrscheinlich nur wegen der historisch in der neueren Zeit hoffentlich einmaligen Konstellation einer durch Krieg und Hunger körperlich wie mental geschwächten Bevölkerung in Europa und der eigentlich schon immer geschwächteren Bevölkerung in Ländern der 3. Welt (zur Erinnerung: der Großteil der Toten der "spanischen Grippe" von 1918/19 war nicht in Spanien oder Europa zu beklagen, sondern z.B. in Indien) kommen konnte.
• und bei der Prognose einer viel gefährlicheren Winter-Schweinegrippe oder eines so genannten Reassortements des Schweinegrippe- mit dem Vogelgrippevirus um reine und mit fast keiner Wahrscheinlichkeit ausgestattete Spekulationen. Im Falle der Befürchtung, die normale Wintergrippe könne mit der Schweinegrippe oder gar einem völlig neuen Grippe-Typ zusammen zu einer gewaltigen Risiko- und Risikofolgenkumulation führen, gibt es, wenn man auf das Erkrankungsgeschehen auf der winterlichen Südhalbkugel schaut, gegenläufige oder garantiert keine bestätigende empirische Entwicklungen.
Trotz aller aktueller und mit Sicherheit im Nordhalbkugelwinter zu erwartenden Empirie (wie jedes Jahr wird es im Winter auch ohne Schweinegrippe "ganz normal" zahlreiche Grippefälle und -Tote geben und darunter sind wahrscheinlich auch Personen, die am Schweinegrippevirus versterben) wollen unverständlicherweise weder die WHO noch das RKI die oberste Pandemiestufe 6 und damit auch nationale Pandemiepläne abblasen oder abmildern und insgesamt deeskalierend wirken.
Wie so etwas aussehen könnte und wie man sich dabei trotzdem nicht im anderen Extrem der Verharmlosung befindet, zeigen zwei gerade erschienene Stellungnahmen der Arzneimittel-Kommission der deutschen Ärzteschaft und der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Allgemeinmedizin(DEGAM), die sich schwerpunktmäßig mit den Impfplänen und der kritischen Debatte über unerwünschte Nebenwirkungen auseinandersetzen.
Die Stellungnahme der Arzneimittelkommission fasst auf der Basis von vorhandenen Erkenntnissen aus anderen Ländern die gesicherte Erkenntnislage u.a. so zusammen:
• Die "Übertragungsrate in epidemiologischen Analysen basierend auf Daten aus Peru, Mexiko, Japan und Neuseeland (wird) ähnlich oder sogar höher als bei der saisonalen Influenza eingeschätzt."
• Und: "Derzeit ist nicht auszuschließen, dass die Übertragungswahrscheinlichkeit in Mitteleuropa in den Wintermonaten höher ist als aktuell beobachtet."
• Trotz der spekulativen Annahme über die Existenz von Schweinegrippefällen, die tödlich geendet haben, aber als leichte Fälle eingeschätzt und dokumentiert worden sein sollen, ist die empirisch gesicherte Prognose wieder deutlich harmloser: Eine empirische Untersuchung nämlich "spricht dafür, dass die Sterblichkeit der neuen Influenza etwas höher liegt, jedoch in der gleichen Größenordnung wie bei der saisonalen Influenza"
• Dem schließt sich der aber auch schon für alle anderen Grippeinfektionen geltende und zutreffende Hinweis auf die Existenz der besonders gefährdeten und daher auch möglichst durch Impfen zu schützenden Schwangeren und an anderen schweren chronisch erkrankten Personen an: Sie sind "mit einem höheren Risiko für einen schweren Verlauf einer Erkrankung an neuer Influenza assoziiert."
• Die Wirksamkeit und die Risiken der Impfung beurteilen die Arzneimittelexperten sehr differenziert und verantwortungsvoll zurückhaltend. So ist es für sie "nicht sicher zu beurteilen, ob die jetzige Impfung auch gegen ein verändertes hoch pathogenes H1N1-Virus schützt" also jenes Virus, dessen Auftreten von denselben Akteuren prognostiziert wird, die sich für eine hohe Durchimpfungsrate gegen den aktuellen Schweinegrippevirus stark machen. Auch wenn sie für die genannten Risikopersonen eine Impfung empfehlen, schlagen sie trotzdem vor, dass Schwangeren und Kindern wegen der nicht durch Studien entkräfteten Wirkungen eines dem Impfstoff zugesetzten Wirkungsverstärkers (Adjuvans) "ein nicht-adjuvanzierter Impfstoff angeboten werden."
• Die Kommission schlägt ferner ein engmaschiges Überwachungssystem für erwartete Erscheinungen vor.
Zu der Frage, ob man eigentlich bei einer flächendeckend geplanten Impfung wirklich Impfstoffe mit Wirkverstärkern braucht, um schnell einen hohen Impfstoffwirkspiegel und Schutz erreichen zu können, gibt es fast paradoxe aber hierzulande wenig diskutierte noch gar praktisch aufgegriffene Ergebnisse aus den USA.
Dort entschieden die nationalen Sicherheitsinstitutionen zum einen, nur Impfstoffe ohne Wirkverstärker einzusetzen. Zum anderen aber existieren in den USA und Australien erste Hinweise aus kleinen Studien, dass die eigentlich wirkärmeren traditionell gefertigten Impfstoffe, um ihre volle Wirksamkeit erreichen zu können, nur einmal gespritzt werden müssen und nicht zweimal wie beim angeblich wirkmächtigeren "moderneren" Impfstoff deutscher Prägung
Die Stellungnahme der "Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin (DEGAM) zum Entwurf der STIKO-Empfehlungen bezüglich der Impfung gegen die Neue Influenza A (H1N1" ähnelt der Stellungnahme der Arzneimittelexperten der deutschen Ärzteschaft im Grundtenor, spitzt seine POsitionen aber deutlicher zu.
Zur Epidemiologie erklärt die DEGAM einleitend und sehr gezielt: "Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat bei der Ausrufung der Pandemie für die Neue Influenza (H1N1 09) die seit Jahren bestehende Definition des Begriffs geändert und den entscheidenden Satz, dass "weltweit eine enorme Zahl von Erkrankungen und Toten" aufgetreten sein müssen, weggelassen. Bei dieser Vorgehensweise, welche die Unterschiede zwischen pandemischer und saisonaler Grippe verwischt, haben möglicherweise interessensgeleitete Berater eine wesentliche Rolle gespielt."
Angesichts des harmlosen und unkomplizierten bisherigen Verlaufs von Schweinegrippenerkerankungen heben die Autoren nochmals eigentlich Selbstverständliches hervor:
• "Dieser insgesamt gutartige Verlauf der Erkrankung in Deutschland verpflichtet bei prophylaktischen Maßnahmen zu einer besonders sorgfältige Abwägung von Nutzen und Schaden."
• Und: "An einen für die gesamte Bevölkerung vorgesehenen Impfstoff (sind) ganz besonders strenge Kriterien anzulegen."
Die 8 Seiten umfassende Stellungnahme der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft zur Schutzimpfung gegen die neue Influenza A (H1N1)1 ist am 10. September 2009 erschienen und kostenlos erhältlich.
Dies gilt auch für die vierseitige DEGAM-Stellungnahme.
Die Ergebnisse der zwei Untersuchungen zur Art und Häufigkeit von Impfungen und vor allem der Notwendigkeit und des höheren Schutzes zweier Impfungen finden sich kostenlos herunterladbar im am 10. September 2009 erschienenen Heft des "New England Journal of Medicine (NEJM)". Der Aufsatz "Trial of Influenza A (H1N1) 2009 Monovalent MF59-Adjuvanted Vaccine — Preliminary Report" von Clark et al. hier und der Aufsatz "Response after One Dose of a Monovalent Influenza A (H1N1) 2009 Vaccine — Preliminary Report" von Greenberg et al. hier.
Bernard Braun, 18.9.09
Was kinderfreundliche Menschen beim "Genuss" einer Zigarette wissen sollten! "Tabakrauchen tötet", aber ist Tabak vorher harmlos?
 Über einen Teil der gesundheitlichen Risiken des Tabakkonsums kann man sich seit ein paar Wochen im Tabak-Atlas Deutschland informieren. Welche gesundheitlichen und sozialen Probleme bereits vor dem Anstecken einer Zigarette, also beispielsweise durch den Anbau und die Ernte von Tabak, entstehen und wer davon betroffen ist, zeigt nun exemplarisch ein Bericht der vor allem in der 3. Welt aktiven Kinderhilfsorganisation Plan International für das Dritte-Welt-Land Malawi.
Über einen Teil der gesundheitlichen Risiken des Tabakkonsums kann man sich seit ein paar Wochen im Tabak-Atlas Deutschland informieren. Welche gesundheitlichen und sozialen Probleme bereits vor dem Anstecken einer Zigarette, also beispielsweise durch den Anbau und die Ernte von Tabak, entstehen und wer davon betroffen ist, zeigt nun exemplarisch ein Bericht der vor allem in der 3. Welt aktiven Kinderhilfsorganisation Plan International für das Dritte-Welt-Land Malawi.
Malawi ist einer der größten Tabakproduzenten weltweit. In dem südostafrikanischen Land verdienen vier Fünftel der Menschen ihren Lebensunterhalt direkt oder indirekt mit dem Anbau von Tabak. In Malawi arbeiten außerdem schätzungsweise 78.000 Kinder auf Tabakplantagen. Zum Teil sind sie erst fünf Jahre alt. Im Schnitt zahlen ihnen die als Arbeitgeber fungierenden multinationalen Tabakproduzenten 17 US-Cent pro Tag. Die Studie von Plan International kommt zu dem Ergebnis, dass die Kinder durch das ständige Berühren der Pflanzen und das Einatmen des Staubes bis zu 54 Milligramm Nikotin täglich aufnehmen, eine Menge, die der beim Rauchen von 50 Zigaretten entspricht. Da sie ohne Handschuhe und Atemschutz arbeiten, leiden viele unter der so genannten grünen Tabakkrankheit. Diese äußert sich in Form von starken Kopf- und Bauchschmerzen, Husten, Atembeschwerden und Muskelschwäche.
Auch wenn die Zustände in den tabakproduzierenden Länder zum Teil bereits in der Vergangenheit bekannt wurden (siehe auch weiter unten), unterscheidet sich die jetzt veröffentlichte Plan-Studie dadurch, dass sie betroffene Kinder direkt zu den Folgen der Arbeit auf den Tabakplantagen befragt hat. Insgesamt nahmen 44 Kinder aus drei Distrikten an der Studie "Harte Arbeit, lange Arbeitszeiten und schlechte Bezahlung" teil. 23 davon waren unter 16 Jahren. Die Kinder beklagten nicht nur sehr konkret die körperlichen Folgen durch den Kontakt mit den Tabakblättern ("Es fühlt sich an, als ob man keine Luft mehr bekommt. Das Atmen tut so weh, dass der ganze Brustkorb brennt. Dann kommt die Übelkeit und mit dem Übergeben spuckt man Blut"), sondern sie gaben auch an, von ihren Arbeitgebern geschlagen, missbraucht und oft genug nicht wie vereinbart bezahlt zu werden.
Die wahrscheinlich nur Westeuropäern herausrutschende Frage, warum sich dann die Kinder und ihre Eltern nicht andere Arbeit suchen, ist leicht mit der sonstigen sozialen Lage großer Teile der Bevölkerung in einem durch die Monoproduktion unter multinationaler Aufsicht völlig bestimmten Dritte-Welt-Land zu beantworten.
Einschlägige Websites wie die der "unfairtobacco"-Initiative schildern die Lage so:
• "Die Kultivierung von Tabak ist gerade auch in Malawi so arbeitsintensiv, dass den Bauern keine Zeit bleibt, um Nahrungsmittel für sich anzubauen. Von der Saat bis zum Verkauf der getrockneten Blätter gehen die Pflanzen zwischen 30 und 50 Mal durch die Hände der Arbeiter: Sie werden von Hand ausgesät, mehrfach umgesetzt, gegen Schädlinge behandelt und schließlich geerntet. Zudem gehen große, für die Subsistenzwirtschaft wichtige Agrarflächen verloren.
• Sechzig Prozent der Exporteinnahmen dieses ostafrikanischen Staates stammen aus dem Tabakanbau.
• Wegen der extrem niedrigen Löhne fehlt den Bauern sogar das Geld für die grundlegendsten Mittel zum Leben. Zu arm, um sich Schutzkleidung leisten zu können, leiden viele Tabakbauern unter den Auswirkungen von Nikotin- und Pestizidvergiftungen. Wegen notwendiger Investitionen hochverschuldet, geraten sie und ihre Familien in Hunger und Armut. Der große Arbeitsaufwand erfordert die Mitarbeit der gesamten Familie", und daher auch der Kinder und dies ist wohl auch in frühkapitalistischer Art und Weise in die Löhne "eingepreist".
Den umfangreichen (81 Seiten), fakten- und zitatenreichen Bericht "Hard work, long hours and little pay. Research with children working on tobacco farms in Malawi" erhält man kostenlos.
Bernard Braun, 27.8.09
Programme für Jugendliche zur Sexualerziehung zeigen in England sehr unerwünschte Effekte
 Die englische Boulevard-Presse war im Juli 2009 voller Häme: "Effekt eines 6 Millionen Pfund teuren Programms gegen Schwangerschaften bei Teenagern: Doppelt so viele Schwangerschaften!" (6 million pounds drive to cut teen pregnancies sees them DOUBLE") Tatsächlich hatte die wissenschaftliche Evaluation eines groß angelegten Programms zur Jugendarbeit in problematischen Stadtteilen mit benachteiligten Jungen und Mädchen ergeben, dass die angestrebten Ziele (etwa im Umgang mit Alkohol und Drogen) gar nicht erreicht wurden, wenn man Vergleiche mit Kontrollgruppen anstellte. Oder, noch schlimmer: In den Interventionsgruppen, in denen auch ein verantwortungsbewusstes Sexualverhalten vermittelt werden sollte, zeigten sich 18 Monate nach Beginn deutlich höhere Quoten für sehr frühe Sexualkontakte und Teenager -Schwangerschaften.
Die englische Boulevard-Presse war im Juli 2009 voller Häme: "Effekt eines 6 Millionen Pfund teuren Programms gegen Schwangerschaften bei Teenagern: Doppelt so viele Schwangerschaften!" (6 million pounds drive to cut teen pregnancies sees them DOUBLE") Tatsächlich hatte die wissenschaftliche Evaluation eines groß angelegten Programms zur Jugendarbeit in problematischen Stadtteilen mit benachteiligten Jungen und Mädchen ergeben, dass die angestrebten Ziele (etwa im Umgang mit Alkohol und Drogen) gar nicht erreicht wurden, wenn man Vergleiche mit Kontrollgruppen anstellte. Oder, noch schlimmer: In den Interventionsgruppen, in denen auch ein verantwortungsbewusstes Sexualverhalten vermittelt werden sollte, zeigten sich 18 Monate nach Beginn deutlich höhere Quoten für sehr frühe Sexualkontakte und Teenager -Schwangerschaften.
Das "Young People's Development Programme (YPDP)" verfolgt in England sehr ambitionierte Ziele: Männliche und weibliche Jugendliche im Alter von 13-15 Jahren aus problematischen Stadtteilen (mit hohen Arbeitslosen- und Ausländeranteilen) sollen in ihrer Freizeit durch Teilnahme an Veranstaltungen und Schulungen gesellschaftlich stärker integriert werden. Die Liste der Erziehungs-Ziele ist lang: Eine verantwortungsbewusstes Sexualverhalten (mit weniger ungewollten Schwangerschaften, weniger Geschlechtskrankheiten), ein geringerer Alkohol- und Drogenkonsum, eine bessere psychische Gesundheit und ein gestärktes Selbstwertgefühl, weniger Schulverweise, selteneres Schulschwänzen, weniger Kriminalität und Gewalt, bessere Fertigkeiten zur Bewerbung auf Arbeits- oder Lehrstellen sind nur einige der erhofften Veränderungen.
Zur Teilnahme gewonnen wurden die Jungen und Mädchen über Multiplikatoren, die man in den Stadtteilen ansprach: Lehrer in Schulen, Sozialarbeiter und Sozialpädagogen, Übungsleiter in Sportvereinen. Gesagt wurde den Multiplikatoren, man suche verhaltensauffällige Jugendliche "at risk", also mit hohem Risiko für Gewalttaten oder Problemlagen. Versprochen wurden diesen dann spannende Freizeitaktivitäten, aber auch eine Vermittlung von Kenntnissen und Fertigkeiten , die ihnen später helfen würden, eine Lehr- oder Arbeitsstelle zu bekommen. In etwa 6-10 Stunden pro Woche sollten sie trainieren, wie man sich bewirbt, eine Gesundheits- und Sexualerziehung erhalten, aber auch Kunstunterricht und Sport.
Insgesamt 54 kommunale Projekte mit etwa 2.700 Teilnehmern, in denen das YPDP umgesetzt wurde, waren jetzt Gegenstand einer wissenschaftlichen Evaluation, in der die angestrebten mit den tatsächlich erreichten Zielen verglichen wurde. In diese Evaluation einbezogen waren auch Kontrollgruppen Jugendlicher, die nicht an dem Programm teilgenommen hatten.
Das Ergebnis der Evaluation war mehr als ernüchternd:
• Im Vergleich von Interventions- und Kontrollgruppen zeigten sich keinerlei Unterschiede, was den Alkohol- und Drogenkonsum anbetraf, Kontakte mit der Polizei oder Schulverweise. Auch hinsichtlich des Gebrauchs von Kondomen bei Sexualkontakten waren die Jugend-Maßnahmen erfolglos.
• Für einige Indikatoren zeigten sich dann aber sogar Ergebnisse, die die pädagogischen Absichten auf den Kopf stellten. In der Interventionsgruppe berichteten nach 18 Monaten 16% der Mädchen über eine Schwangerschaft (Kontrollgruppe: 6%), sehr frühe sexuelle Erfahrungen mit Jungen hatten 58% (Kontrollgruppe 33%) und 34% gaben an, dass sie in Kürze Mutter werden würden (Kontrollgruppe 24%).
Die Wissenschaftler erklären sich diese in pädagogischer Hinsicht katastrophalen Befunde unter anderem durch die Gruppenbildung. In den Projekten waren teilweise auch einige Jugendliche mit überaus promiskuitiven Einstellungen und sexuell freizügigen Verhaltensweisen vertreten. Deren Verhaltensweisen und Orientierungen wurden von anderen Jugendlichen dann übernommen und kopiert. Dieser aus peer-groups durchaus bekannte Mechanismus konnte auch durch den Unterricht zur Sexualkunde nicht gebremst werden.
Meg Wiggins et al: Health outcomes of youth development programme in England: prospective matched comparison study, British Medical Journal (BMJ) 2009;339:b2534, doi:10.1136/bmj.b2534)
• PDF-Datei des BMJ-Artikels
• HTML-Seite im BMJ
• Beschreibung des "Young People's Development Programme (YPDP)" und detaillierte Evaluation (PDF, 114 Seiten): Meg Wiggins et al:Young People's Development Programme evaluation - Final report Social Science Research Unit, Institute of Education, University of London with the London School of Hygiene and Tropical Medicine
Gerd Marstedt, 23.8.09
Eine Scheidung hinterlässt gesundheitliche Spuren - lebenslänglich!
 Seit langem sind die gesundheitlich erwünschten aber auch unerwünschten Wirkungen so genannter lebensverändernder Ereignisse oder "life events" bekannt, wie die der Geburt eines Kindes, des Tod bekannter Personen, der Heirat aber auch Scheidung.
Seit langem sind die gesundheitlich erwünschten aber auch unerwünschten Wirkungen so genannter lebensverändernder Ereignisse oder "life events" bekannt, wie die der Geburt eines Kindes, des Tod bekannter Personen, der Heirat aber auch Scheidung.
Gerade bei Scheidungen, inbesondere wenn das Scheidungspaar noch Kinder hat, kumuliert eine Reihe finanzieller, psychischer und sozialer Faktoren, die z.B. das Selbstwertgefühl der Beteiligten tangieren oder Ängste vor dem Alleinsein und -bleiben auslösen.
Nach dem Sprichwort "die Zeit heilt Wunden" war mit diesem Psychostress trotzdem die Hoffnung verbunden, dass insbesondere die psychischen Folgen und das zusätzliche Risiko von Folgeerkrankungen am Herz-Kreislaufsystem, im Stoffwechsel (Diabetes) und sogar von Krebs rasch wieder verschwinden.
Dies scheint aber für Geschiedene nicht zuzutreffen. So jedenfalls die Ergebnisse einer jetzt veröffentlichten Studie über den weiteren Gesundheitsverlauf von 8.652 Personen zwischen 51 und 61 Jahren, die seit 1992 in der US-repräsentativen Längsschnittsstudie "Health and Retirement Study (HRS)" mit Personen über 50 Jahre sind und deren Familienstandsveränderungen und Erkrankungsgeschichte seitdem dokumentiert sind.
Danach tragen
• Geschiedene und auch Verwitwete ein um 18% höheres Risiko für chronische Erkrankungen wie Verheiratete. Außerdem hatten sie mit einer um 21% erhöhten Wahrscheinlichkeit Probleme beim Laufen oder Treppensteigen, kurz bei ihrer Mobilität.
• Eine neue Ehe beseitigt zwar einige dieser Folgen, verhindert sie aber nicht vollständig. Das Risiko chronisch krank zu werden ist bei Wiederverheirateten immer noch um 12% höher als bei immer Verheirateten und die Wahrscheinlichkeit für Mobilitätsverlust ist um 19% höher.
• Der Schluss, dann lieber gar nicht zu heiraten und das Scheidungsrisiko samt Folgen zu umgehen, ist aber nach derselben Studie auch kein Königsweg. Nachgewiesen wurden zwar im Vergleich zu Verheirateten keine Unterschiede mehr bei der Wahrscheinlichkeit chronischer Erkrankungen, aber bei den Chancen Mobilitätsprobleme und Depressionen zu bekommen schnitten Dauer-JunggesellInnen um 18% und 14% schlechter ab als Verheiratete.
• Personen mit mehrfachen Unterbrechungen oder Veränderungen ihres Familienstandes hatten höhere Chancen chronisch krank oder immobil zu werden als nur einmal Geschiedene.
• Personen mit längerer Ausbildungszeit hatten durchweg bessere Gesundheitswahrscheinlichkeiten. Schwarze hatten höhere Wahrscheinlichkeiten für alle negativen Zustände als weiße oder hispanische US-BürgerInnen.
Die Ergebnisse sind mit verschiedenen multivariaten Regressionsmodellen gewonnen worden und statistisch durchweg hochsignifikant.
Der Aufsatz "Marital Biography and Health at Mid-Life" von Mary Elizabeth Hughes und Linda Waite erscheint in der Septemberausgabe der Fachzeitschrift "Journal of Health and Social Behavior" (2009, Vol 50 (September):344-358) und ist im Moment in einer Feature-Version komplett und kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 2.8.09
Don't worry, be happy! Wissenschaftler will die englische Bevölkerung glücklicher machen
 Mit einem bislang einmaligen Experiment möchte der englische Psychologe Prof. Richard Wiseman (University of Hertfordshire) die englische Bevölkerung glücklicher machen. Im Internet können Teilnehmer jetzt einen kurzen Fragebogen ausfüllen, in dem unter anderem gefragt wird, wie glücklich sie sich zur Zeit fühlen. Sie werden dann per Zufall einer von vier Gruppen zugeordnet. In jeder Gruppe wird ein kurzes Video gezeigt, in dem jeweils verschiedene psychologische Techniken zum Glücklichsein kurz vorgestellt werden. Die Teilnehmer sollen dann versuchen, fünf Tage lang (vom 2.-6. August 2009) diese Ratschläge auch in die Tat umzusetzen. Danach soll dann erneut eine Einschätzung der eigenen Glücksgefühle online abgegeben werden. Der Wissenschaftler hofft, auf diese Weise herauszufinden, welche der vielen, vielen von Psychologen beschriebenen Techniken, um sich glücklicher zu fühlen, am effektivsten ist. Und er hofft tatsächlich auch, in der gegenwärtigen Krisensituation das Befinden der Engländer/innen zu bessern, sofern sich genügend Teilnehmer finden. Dies scheint jedoch wahrscheinlich, denn der Versuch wird in zahlreichen englischen Medien (auch seriösen wie der Times Online) vorgestellt.
Mit einem bislang einmaligen Experiment möchte der englische Psychologe Prof. Richard Wiseman (University of Hertfordshire) die englische Bevölkerung glücklicher machen. Im Internet können Teilnehmer jetzt einen kurzen Fragebogen ausfüllen, in dem unter anderem gefragt wird, wie glücklich sie sich zur Zeit fühlen. Sie werden dann per Zufall einer von vier Gruppen zugeordnet. In jeder Gruppe wird ein kurzes Video gezeigt, in dem jeweils verschiedene psychologische Techniken zum Glücklichsein kurz vorgestellt werden. Die Teilnehmer sollen dann versuchen, fünf Tage lang (vom 2.-6. August 2009) diese Ratschläge auch in die Tat umzusetzen. Danach soll dann erneut eine Einschätzung der eigenen Glücksgefühle online abgegeben werden. Der Wissenschaftler hofft, auf diese Weise herauszufinden, welche der vielen, vielen von Psychologen beschriebenen Techniken, um sich glücklicher zu fühlen, am effektivsten ist. Und er hofft tatsächlich auch, in der gegenwärtigen Krisensituation das Befinden der Engländer/innen zu bessern, sofern sich genügend Teilnehmer finden. Dies scheint jedoch wahrscheinlich, denn der Versuch wird in zahlreichen englischen Medien (auch seriösen wie der Times Online) vorgestellt.
Auf der Website The Science of Happiness wird das Experiment kurz beschrieben und auch der Fragebogen präsentiert, der dann online ausgefüllt werden kann. Nur Alter, Geschlecht und Email-Adresse sind anzugeben sowie 4 Fragen zu beantworten, die das Ausmaß des Glücklichseins beschreiben. Dann wird ein kurzes Video gezeigt: Hier wird jeweils eine von 4 Techniken näher vorgestellt, die sich in früheren Forschungsstudien von Richard Wiseman als vermeintlich erfolgreich herausgestellt haben. Darunter:
• der Tipp "Keep smiling", mehrfach an jedem Tag ein Lächeln ins Gesicht bringen und diesen Gesichtsausdruck so lange wie möglich beibehalten. Die Anlässe zum Lächeln können beliebig sein, wenn das Telefon klingelt, wenn man die Wohnung verlässt, ein Geschäft betritt, ....
• der Ratschlag, jeden Tag einen Freund, Kollegen oder Verwandten mit einem Kompliment, einem kleinen Geschenk oder einer positiven Botschaft per Email, Telefon oder SMS zu beglücken,
• der Tipp, sich ganz auf ein Ereignis in den letzten 24 Stunden zu konzentrieren, das positiv und überaus zufriedenstellend verlaufen ist,
• der Rat, Dankbarkeit zu zeigen und auszudrücken für etwas, das im eigenen Leben besonders positiv verlaufen ist.
Am 11. August will Prof. Wiseman dann die Ergebnisse des Massenexperiments vorstellen: a) Ob sich die Befindlichkeit der englischen Nation gebessert hat, und b) welche der vier Techniken am allerglücklichsten macht. Erst vor kurzem hatte der Psychologe in seinem Buch ":59 seconds" eine Reihe von Tipps veröffentlicht, die die Quintessenz seiner bisherigen Forschungsstudien repräsentieren. Empfehlenswert sind danach folgende "10 Tipps zum Glücklichsein":
• Einen Freund/eine Freundin treffen, die man lange nicht gesehen hat
• Eine lustige TV-Sendung oder einen witzigen Film anschauen
• Dreimal in der Woche 30 Minuten Sport betreiben
• Die Zeit vor dem Fernseher auf die Hälfte kürzen
• Erfahrungen erwerben, keine Konsumgüter: Ins Konzert oder Kino gehen, zu einem ungewöhnlichen Ort oder Restaurant
• Neue Herausforderungen beginnen: Ein neues Hobby, einem Verein beitreten, ein Handwerk lernen
• 20 Minuten in der Sonne spazieren gehen
• 10 Minuten entspannende oder aufbauende Musik hören
• Einen Hund streicheln
• Keine Nachrichten mehr lesen oder Nachrichtensendungen betrachten
Prof. Wiseman's Techniken zum Glücklichsein sind zweifellos toll. Aber die Redakteure des Forum Gesundheitspolitik schätzen den Körperzellen-Rock von Mosaro & Astrid Kuby eigentlich noch höher ein. Denn der Körperzellen-Rock macht nicht nur glücklich, sondern auch gesund - Motto: "Jede Zelle meines Körpers ist glücklich, jede Körperzelle fühlt sich wohl!" "Wer bei diesem Lied aktiv mitmacht, kann so Krankheiten heilen," heißt es bei der Vorstellung des Videos auf YouTube, "ein stärkeres, körperliches und geistiges Wohlbefinden bemerken und eine liebevolle Verbindung zu seinem Körper spüren."
Aber natürlich überlässt die Redaktion es jedem 1-Euro-Jobber, Arbeitslosen und Krisengeschädigten selbst, ob er/sie nun den Körperzellen-Rock singt, einen Hund streichelt oder die Nachrichten boykottiert, um ein wenig glücklicher zu sein.
Gerd Marstedt, 2.8.09
Wie verbessert man kurz- und langfristig das Arzneimittel-Einnahmeverhalten von Patienten?
 Zu den zahlreichen anbieterinduzierten Problemen finanzieller und gesundheitlicher Art bei der Verordnung und Einnahme von Arzneimitteln kommt noch das Einnahmeverhalten der Patienten hinzu. Studien zeigen, dass keine kontinuierliche Einnahme erfolgt und Patienten häufig nicht die angezeigte Dosis des Medikaments einnehmen - so etwa die US-Amerikaner, sie "typically take less than half the prescribed doses". Dies kann im besseren Fall Heilung und Linderung verzögern und im schlimmsten Fall zu unerwünschten Verläufen der nicht korrekt behandelten Erkrankung führen.
Zu den zahlreichen anbieterinduzierten Problemen finanzieller und gesundheitlicher Art bei der Verordnung und Einnahme von Arzneimitteln kommt noch das Einnahmeverhalten der Patienten hinzu. Studien zeigen, dass keine kontinuierliche Einnahme erfolgt und Patienten häufig nicht die angezeigte Dosis des Medikaments einnehmen - so etwa die US-Amerikaner, sie "typically take less than half the prescribed doses". Dies kann im besseren Fall Heilung und Linderung verzögern und im schlimmsten Fall zu unerwünschten Verläufen der nicht korrekt behandelten Erkrankung führen.
Die so genannte Compliance oder auch Adhärenz zu sichern, stellt daher einen unbedingt notwendige, Bestandteil einer Arzneimittelbehandlung dar.
Wenn man den Glauben in die Wirksamkeit einfacher Appelle von Ärzten verloren hat, drängen sich eine Fülle von mehr oder weniger aufwändigen Alternativen auf. Dazu zählen insbesondere Beratungsgespräche, schriftliche Informationen und persönliche Telefonanrufe, Erinnerungsanrufe und zahlreiche weitere Formen der Supervision und Aufmerksamkeit, die häufig zumindest kurzfristigen Erfolg versprechen.
Ob diese Aktivitäten wirklich hilfreich sind, untersuchte eine Gruppe von ForscherInnen im Rahmen eines systematischen Cochrane-Reviews und veröffentlichte ihre Ergebnisse im Jahr 2008. Für kurz dauernde Arzneimittelbehandlungen scheinen einige der genannten Mittel hilfreich zu sein. Vier von 10 Interventionen aus 9 RCTs zeigten einen Effekt auf Adhärenz und wenigstens bei einem klinischen Ergebnis.
Für längerfristigere Behandlungen gibt es keine einfache und wirksame Intervention und auch nur einige der komplexeren Konzepte führen zu Verbesserungen bei den gesundheitlichen Ergebnisse der Behandlung. Sogar mit den wirksamsten Methoden für langfristige Behandlungen waren die Verbesserungen beim Gebrauch von Arzneimitteln oder der Gesundheit nicht groß. Gerade einmal 36 von 83 unterschiedlichen Interventionen aus 70 RCT's trugen zu Verbesserungen der Adhärenz bei. Am Ende waren es aber nur noch 25 dieser Interventionen, die mindestens ein Behandlungsergebnis verbesserten.
Mehrere der reviewten randomisierten kontrollierten Studien zeigten aber auch, dass die mündliche Konfrontation von Patienten mit unerwünschten Wirkungen ihrer Medikamente bzw. ihrer ungenügenden Adhärenz nicht ihren problematischen Umgang mit ihren Arzneimitteln berührt.
Beinahe alle der Interventionen, die für langfristige Versorgung wirksam waren, waren komplexer Natur. Sogar die wirksamsten Interventionen führten aber nicht zu großen Verbesserungen bei der Adhärenz und den Behandlungserfolgen.
Von dem Cochrane-Review "Interventions for enhancing medication adherence von Haynes RB, Ackloo E, Sahota N, McDonald HP, Yao X (Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 2. Art. No.: CD000011) gibt es kostenlos ein umfangreiches Abstract aber auch den 165 Seiten umfassenden Volltext.
Bernard Braun, 17.2.09
Weniger Feinstaub - weniger Herzinfarkte
 Eine Minderung der Feinstaubkonzentration verlängert die Lebenserwartung, lautet das Fazit einer kürzlich im New England Journal of Medicine veröffentlichten Studie. Der Epidemiologe Arden Pope von der Brigham Young University in Boston wertete die Daten über die Verbesserung der Luftqualität in 51 US-amerikanischen Städten in den Jahren 1980 bis 2000 aus und korrelierte sie mit der Sterblichkeit der Bewohner. Die Lebenserwartung stieg im Untersuchungszeitraum insgesamt um 2,72 Jahre. 5 Monate davon sind nach den Berechnungen der Wissenschaftler auf die verbesserte Luftqualität zurückzuführen. Die Minderung der Feinstaub-Konzentration um 10 Mikrogramm pro Kubikmeter ging mit einer Verbesserung der Lebenserwartung um 0,77 Jahre einher. Andere Einflussfaktoren auf die Lebenserwartung, wie sozioökonomischer Status, demographische Entwicklung und Tabakkonsum, wurden in den Berechnungen berücksichtigt.
Eine Minderung der Feinstaubkonzentration verlängert die Lebenserwartung, lautet das Fazit einer kürzlich im New England Journal of Medicine veröffentlichten Studie. Der Epidemiologe Arden Pope von der Brigham Young University in Boston wertete die Daten über die Verbesserung der Luftqualität in 51 US-amerikanischen Städten in den Jahren 1980 bis 2000 aus und korrelierte sie mit der Sterblichkeit der Bewohner. Die Lebenserwartung stieg im Untersuchungszeitraum insgesamt um 2,72 Jahre. 5 Monate davon sind nach den Berechnungen der Wissenschaftler auf die verbesserte Luftqualität zurückzuführen. Die Minderung der Feinstaub-Konzentration um 10 Mikrogramm pro Kubikmeter ging mit einer Verbesserung der Lebenserwartung um 0,77 Jahre einher. Andere Einflussfaktoren auf die Lebenserwartung, wie sozioökonomischer Status, demographische Entwicklung und Tabakkonsum, wurden in den Berechnungen berücksichtigt.
Der ursächliche Zusammenhang zwischen einer Umweltbelastung und der Sterblichkeit ist durch eine Bevölkerungsstudie wegen der Vielzahl einwirkender Faktoren nicht direkt zu erbringen. In der gemeinsamen Bewertung mit anderen Studien erscheint die Evidenz für Kausalität jedoch deutlich. Frühere Studien aus den Niederlanden, Finnland und Kanada hatten einen Zusammenhang von steigender Mortalität bei steigender Feinstoffkonzentration festgestellt. Pope hat jetzt erstmals den umgekehrten Sachverhalt sinkender Sterblichkeit bei Verbesserung der Luftqualität erhoben.
Die Weltgesundheitsorganisation hatte auf Grund der damaligen Datenlage bereits im Weltgesundheitsbericht 2002 den Anteil der Todesfälle, die auf Feinstaubbelastung zurückzuführen sind, auf 1,4 Prozent geschätzt.
Die biologischen Mechanismen der Schädigung beschreibt Brooks in einem kürzlich in Clinical Science erschienen Aufsatz. Luftverschmutzung besteht aus Gasen, Flüssigkeiten und Partikeln. Partikel mit einem Durchmesser von weniger als 2,5 Mikrometern werden als Feinstaub (engl. particulate matter, PM2,5) bezeichnet. Feinstaub entsteht in städtischen Regionen überwiegend bei der Verbrennung von fossilen Energieträgern. Die Partikel werden über die Atemwege in den Organismus aufgenommen. Bezüglich der Gesundheitsschäden steht aber - entgegen intuitiven Annahmen - nicht die Lunge sondern das Herz-Kreislauf-System im Vordergrund. Seit Mitte der 1990er Jahre ist bekannt, dass die Veränderungen der Morbidität (Krankheitsgeschehen) und Mortalität (Sterblichkeit) in erster Linie auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen zurückzuführen sind.
Kurz- und langfristige Exposition steht in Verbindung mit Herzinfarkt, Durchblutungsstörungen, Herzrhythmusstörungen, Herzschwäche und Schlaganfall. Feinstaubpartikel werden ins Blut aufgenommen und können akut eine Vasokonstriktion (Verkrampfung der Blutgefäße), Herzrhythmusstörungen und eine Erhöhung der Gerinnungsfähigkeit mit der Folge einer Thrombose (Bildung eines Blutpfropfes) auslösen. Die kurzzeitige Erhöhung der Konzentration steigert die Sterblichkeit um 0,2 bis 0,6 Prozent pro 10 Mikrogramm Feinstaub.
Bei chronischer Belastung bewirken die Partikel entzündliche Vorgänge im Gesamtorganismus, insbesondere in den Atemwegen und am Endothel (Innenhaut) der Arterien. Dadurch wird langfristig die Arteriosklerose (Arterienverkalkung) gefördert und die Morbidität und Mortalität für die koronare Herzkrankheit erhöht. Bei vorhandener Vorschädigung kann ein Herzinfarkt ausgelöst werden.
Anzumerken ist, dass die Risikoerhöhung für Einzelpersonen gering ist. Ein relevantes Gesundheitsproblem ist Feinstaub, weil durch die Belastung großer Teile der Bevölkerung die Zahl der geschädigten trotz geringem individuellen Risikos hoch ist.
Studie im NEJM, Volltext: Pope CA, III, Ezzati M, Dockery DW. Fine-Particulate Air Pollution and Life Expectancy in the United States. N Engl J Med 2009;360(4):376-386
Weltgesundheitsbericht 2002. Reducing Risks, Promoting Healthy Life. S. 68. Download Full report
Aufsatz über die biologischen Mechanismen und Effekte (Volltext): Brook RD. Cardiovascular effects of air pollution. Clinical Science 2008;115(6):175-187.
David Klemperer, 9.2.09
Ansteckungsgefahren auf Gesundheitspostern 1920-1999 - Ein etwas anderer Blick auf Public Health und aus Public Health-Sicht
 Wer ist nicht schon mal dem "eye catch"-Effekt eines der vielen Pro-Kondom-Plakate zur Prävention von HIV und AIDS erlegen? Dieses Beispiel und frühere wie etwa die die Strafbewehrung der Gurtpflicht begleitende öffentliche Plakatwerbung zeigen, dass phantasievoll gestaltete Poster ein seit vielen Jahrzehnten erprobtes Hilfsinstrument zur Krankheitsverhinderung, Risikodämpfung und präventivem Verhalten sind, und auch begleitend zu schriftlichen Informationen jedweder Art genutzt wurden und werden sollten.
Wer ist nicht schon mal dem "eye catch"-Effekt eines der vielen Pro-Kondom-Plakate zur Prävention von HIV und AIDS erlegen? Dieses Beispiel und frühere wie etwa die die Strafbewehrung der Gurtpflicht begleitende öffentliche Plakatwerbung zeigen, dass phantasievoll gestaltete Poster ein seit vielen Jahrzehnten erprobtes Hilfsinstrument zur Krankheitsverhinderung, Risikodämpfung und präventivem Verhalten sind, und auch begleitend zu schriftlichen Informationen jedweder Art genutzt wurden und werden sollten.
Die Ausstellung "An Iconography of Contagion. An Exhibition of 20th-Century Health Posters" der National Academy of Sciences der USA stellt einer breiteren Öffentlichkeit 20 Gesundheitsposters aus dem letzten Jahrhundert vor, die sich zumeist mit Infektionskrankheiten wie Malaria, Tuberkulose, diversen traditionellen Geschlechtskrankheiten aber auch bereits AIDS befassen. Sie stammen überwiegend aus Nordamerika und Europa und zu einem kleineren Teil aus Asien und Afrika. Die Ausstellung liefert eine Reihe Einblicke in die für Public Health äußerst wichtigen wandelnden Beziehungen zwischen öffentlichen Verständnissen über Erkrankungen und Gesellschaftswerten in denen der Einsatz von "eye-catching posters, pamphlets, and motion pictures" und die Nutzung deren Ästhetik, Grafikmanipulationen, Perspektivveränderungen und Sehgewohnheiten eine immer bedeutendere und professionellere Rolle spielten.
Die Exponate zeigen auch plastisch die sich verändernden Ängste, Interessengebiete und zur Verfügung stehenden medizinischen Kenntnisse. Je massenmedial-visueller die Gesellschaften Europas und Nordamerika geworden und je visueller große Teile der analphabetischen "Dritten Welt" mehr oder weniger freiwillig geblieben sind, desto wichtiger werden Bilder als Art von Aufklärung.
Der farbige Katalog, der die Ausstellung "An Iconography of Contagion. An Exhibition of 20th-Century Health Posters" , der die 20 Gesundheitsposter zusammen mit kurzen erläuternden und Hintergrunds-Texten auf 21 Seiten darstellt, ist kostenlos als PDF-Datei erhältlich.
Bernard Braun, 2.11.08
Verbraucher meinen: Politiker beachten Verbraucherinteressen zu wenig und knicken vor Wirtschaftsunternehmen ein
 Verbraucher kritisieren, dass ihre Interessen von der Politik gegenüber der Wirtschaft nicht durchgesetzt werden. Dies ist zentraler Befund einer repräsentativen Meinungsumfrage im Auftrag des Verbraucherzentrale Bundesverbandes, deren Ergebnisse jetzt veröffentlicht wurden. Insgesamt etwa 3.500 Männer und Frauen wurden von Januar bis März 2008 zu ihren Meinungen befragt im Hinblick auf ihre Rechte als Verbraucher, Einflussnahme der Politik, Veränderungswünsche sowie auch Erfahrungen mit Verbraucherschutzeinrichtungen.
Verbraucher kritisieren, dass ihre Interessen von der Politik gegenüber der Wirtschaft nicht durchgesetzt werden. Dies ist zentraler Befund einer repräsentativen Meinungsumfrage im Auftrag des Verbraucherzentrale Bundesverbandes, deren Ergebnisse jetzt veröffentlicht wurden. Insgesamt etwa 3.500 Männer und Frauen wurden von Januar bis März 2008 zu ihren Meinungen befragt im Hinblick auf ihre Rechte als Verbraucher, Einflussnahme der Politik, Veränderungswünsche sowie auch Erfahrungen mit Verbraucherschutzeinrichtungen.
Ein zu geringes Engagement der Politik für Verbraucherinteressen ist ein zentraler Kritikpunkt in der Umfrage. Beim Statement "Wenn es um die Interessen der Verbraucher geht, setzt sich die Politik auch gegen die Wirtschaft durch" gibt es von 47% der Bevölkerung eine deutliche Ablehnung, also die Werte -5, -4 oder -3 auf einer elfstufigen Skala von -5 bis +3. Und auf die Frage, ob sich die folgenden Akteure wirkungsvoll für die Verbraucher engagieren, erhält die Bundesregierung von 49%, Parteien von 57% die Bewertung einer sehr geringen Wirksamkeit.
Weitere Ergebnisse der Befragung:
• Auf die Frage, welche Themen grundsätzlich stärker zugunsten der Verbraucher verändert werden müssen, werden an erster Stelle "Lebensmittel und Lebensmittelsicherheit" genannt. Es folgen die Themen "Preise", "Energiemarkt und Energieversorgung" sowie "Einfluss auf Wirtschaft und Politik"
• Politische Verbände (Parteien, Bundes-, Landesregierungen) erhalten als Interessenvertretung der Verbraucher durchweg schlechte Noten, ähnlich wie Unternehmen und Unternehmensverbände. Auch Kirchen, aber auch die Gewerkschaften werden nicht besonders positiv bewertet, die Medien schon eher. Mit deutlichem Abstand werden jedoch die Stiftung Warentest und die Verbraucherzentralen, in Teilen auch noch die Umweltverbände, als wirkungsvolle Interessenvertreter wahrgenommen.
• Knapp 3/4 der Befragten haben eine ungefähre Vorstellung davon, wie zur Zeit die Verbraucherzentrale finanziert wird. Die große Mehrzahl der Verbraucher befürwortet eine öffentliche Finanzierung der Verbraucherberatung. Finanzielle Engpässe durch Schließung von Beratungsstellen zu beseitigen, wird nicht als sinnvoll betrachtet. Eine breite Zustimmung findet hingegen, dass die Wirtschaft sich an der Finanzierung der Verbraucherberatung beteiligen soll. Vom "Werbegroschen" bis zu Stiftungs-und Fondsmodellen werden nahezu alle Formen befürwortet, die die finanzielle Lage verbessert, aber die bisherige Unabhängigkeit der Verbraucherzentralen nicht gefährdet.
Die 35-seitige Broschüre mit allen Ergebnissen zur Umfrage ist hier zu finden: Verbraucherschutz in Deutschland - Was meinen die Verbraucher? (Ergebnisse einer repräsentativen Verbraucherbefragung im Auftrag des Verbraucherzentrale Bundesverbandes, vzbv, Berlin, Juni 2008)
Gerd Marstedt, 27.6.2008
Niederländische Studie rechnet vor: Prävention bringt keine direkten Kosteneinsparungen im Gesundheitssystem
 Die in den letzten Jahren zu beobachtenden vermehrten Bemühungen und Interventionen zur Prävention und Gesundheitsförderung, durch Regelungen zum Nichtraucherschutz, Kampagnen wie "1000 Schritte extra" oder die geplante Kennzeichnung von Lebensmitteln zielen zwar vorrangig auf eine längere Lebenserwartung der Bürger ohne Gesundheitsbeeinträchtigungen. Aber direkt oder indirekt waren stets auch Hoffnungen auf damit verbundene Kosteneinsparungen mit im Spiel. Dass diese Hoffnung trügerisch sein könnte, hat nun eine gesundheitsökonomische Analyse niederländischer Wissenschaftler nahegelegt. Ihr Fazit: Gesunde Bürger ohne Übergewicht sind für das Gesundheitssystem teurer als Raucher und Fettleibige, denn aufgrund der längeren Lebenserwartung der Gesunden entstehen langfristig höhere Kosten.
Die in den letzten Jahren zu beobachtenden vermehrten Bemühungen und Interventionen zur Prävention und Gesundheitsförderung, durch Regelungen zum Nichtraucherschutz, Kampagnen wie "1000 Schritte extra" oder die geplante Kennzeichnung von Lebensmitteln zielen zwar vorrangig auf eine längere Lebenserwartung der Bürger ohne Gesundheitsbeeinträchtigungen. Aber direkt oder indirekt waren stets auch Hoffnungen auf damit verbundene Kosteneinsparungen mit im Spiel. Dass diese Hoffnung trügerisch sein könnte, hat nun eine gesundheitsökonomische Analyse niederländischer Wissenschaftler nahegelegt. Ihr Fazit: Gesunde Bürger ohne Übergewicht sind für das Gesundheitssystem teurer als Raucher und Fettleibige, denn aufgrund der längeren Lebenserwartung der Gesunden entstehen langfristig höhere Kosten.
Die Kosten für die medizinische Versorgung von Rauchern wurden unlängst in England mit 1,9 bis 2,3 Milliarden Euro jährlich beziffert (BBC: The real cost of smoking). Übergewicht und Adipositas, so eine US-amerikanische Studie, ziehen medizinische Versorgungskosten in Höhe von 55-60 Milliarden Euro in den USA in jedem Jahr nach sich (Overweight and Obesity: Economic Consequences). Verlockend erscheint es angesichts dieser Zahlen, Gesundheitspolitik systematischer und umfassender als bislang auf das Feld der Prävention zu lenken, um die knappen Kassen der Gesundheitssysteme zu entlasten. Und auch in Deutschland sprachen einige Wissenschaftler und Politiker es ganz direkt aus: "Vorbeugung statt Reparatur: Prävention senkt die Kosten im Gesundheitssystem".
Dem widersprachen nun holländische Wissenschaftler. Sie verwendeten Modellrechnungen zu den Überlebensraten, Erkrankungen und Versorgungskosten für drei (hypothetische) Gruppen von Bürgern, und zwar für eine Zeitspanne vom 20.Lebensjahr bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie aufgrund der Modellrechnung sterben würden. Diese drei Gruppen waren: Stark übergewichtige Nichtraucher (BMI über 30), "Gesunde", die nicht rauchten und ein Normalgewicht hatten, sowie lebenslange Raucher mit einem Normalgewicht. Für diese drei Gruppen berechneten sie auf der Basis offizieller Statistiken aus den Niederlanden die Lebenserwartung, die Häufigkeit des Auftretens bestimmter Krankheiten und die Kosten für die medizinische Behandlung dieser Erkrankungen.
Ihre Berechnungen zeigten dann, dass bis zum Alter von 56 Jahren die medizinischen Kosten für die Übergewichts-Gruppe am höchsten ausfallen und für die Bürger mit gesunder Lebensweise am niedrigsten. In den Lebensjahren danach verursachten die Raucher die höchsten Kosten. Die Forscher berücksichtigten dann allerdings auch noch die unterschiedliche Lebnenserwartung der drei Gruppen. Diese Lebenserwartung fällt - nach derzeitigem Wissensstand - bei 20jährigen Übergewichtigen um 5 Jahre und bei 20jährigen Rauchern um 8 Jahre niedriger aus als bei den Gesunden. Da gleichwohl auch Personen mit gesundem Lebensstil (Normalgewicht, Nichtrauchen) im Alter nicht völlig von Krankheiten verschont bleiben, fallen aufgrund der höheren Lebenserwartung und der medizinischen Kosten für diese auch Mehrausgaben an. Die medizinischen Versorgungskosten, so das Fazit der Wissenschaftler, fallen für die Gruppe mit gesunder Lebensweise am höchsten aus, für Raucher am niedrigsten und für die Übergewichtigen mittel.
Nicht berücksichtigt in den Modellrechnungen, dies schreiben die Niederländer ausdrücklich in ihrem Artikel, sind allerdings eine Reihe von Faktoren, die das Ergebnis verändern könnten: Höhere Krankenstände und Produktivitätsverluste durch rauchende und fettleibige Erwerbstätige, daraus resultierende volkswirtschaftlichen Verluste, geringere Renteneinzahlungen, sinkende Tabaksteuereinnahmen. "Aber", so schreiben sie zum Schluss, "das Ziel des Gesundheitssystems ist es nicht, Kosten zu senken, sondern den Menschen vermeidbares Leiden und Sterben zu ersparen. Wenn darüber auch noch Kosteneinsparungen möglich sind, wäre dies nicht viel mehr als ein I-Tüpfelchen."
Die Studie ist hier kostenlos im Volltext zu lesen: Pieter H. M. van Baal u.a: Lifetime Medical Costs of Obesity: Prevention No Cure for Increasing Health Expenditure (PLoS Med 5(2): e29 doi:10.1371/journal.pmed.0050029)
Gerd Marstedt, 8.2.2008
"Fußballspiele anschauen kann tödlich sein!" - Erhöhtes Herzattacken-Risiko deutscher Fans während der WM 2006
 Die Warnung der Editoren des US-Informationsportal "Physician’s First Watch": "Perhaps something to keep in mind when the New England Patriots face the New York Giants this Super Bowl Sunday?" am 31. Januar 2008 dürfte wohl für die Millionen von American-Football-Fans zu spat sein. Wenn nicht alle US-GesundheitswissenschaftlerInnen im Stadion oder vor den TV-Monitoren sitzen und noch monatelang über das Ergebnis diskutieren, gibt es eventuell in einem Jahr eine US-Studie, die mit der jetzt über das Herzinfaktrisiko von deutschen Fußballfans während der letztjährigen Fußballweltmeisterschaft vergleichbar ist.
Die Warnung der Editoren des US-Informationsportal "Physician’s First Watch": "Perhaps something to keep in mind when the New England Patriots face the New York Giants this Super Bowl Sunday?" am 31. Januar 2008 dürfte wohl für die Millionen von American-Football-Fans zu spat sein. Wenn nicht alle US-GesundheitswissenschaftlerInnen im Stadion oder vor den TV-Monitoren sitzen und noch monatelang über das Ergebnis diskutieren, gibt es eventuell in einem Jahr eine US-Studie, die mit der jetzt über das Herzinfaktrisiko von deutschen Fußballfans während der letztjährigen Fußballweltmeisterschaft vergleichbar ist.
Im "New England Journal of Medicine (NEJM)" (2008 31.1. 2008; volume 358 (5): 475-483) haben nämlich gerade die Münchner Mediziner Ute Wilbert-Lampen et al. den Aufsatz "Cardiovascular Events during World Cup Soccer" über die Häufigkeit z. B. neuer Herzinfarkte während der vom 9. Juni bis 9. Juli 2006 dauernden WM im Vergleich mit vier Vergleichsphasen vom 1.5. bis 8. Juni 2006, vom 10. Juli bis 31. Juli 2006, sowie vom 1. Mai bis 31. Juli in 2003 und 2005 veröffentlicht.
Dessen Kernergebnis der Bewertung des Geschehens bei 4.279 Patienten lautete:
• An Tagen, an denen die deutsche Mannschaft spielte, war das Neuauftreten von Herzinfarkten und vergleichbar schweren gefährlichen Herzattacken ("cardiac emergencies") 2,66 mal so hoch wie während der Vergleichszeiträumen (je nach Zeitpunkt zwischen 2,33 und 3,04; P<0.001). Männer lebten gefährlicher, d.h. ihr Risiko war um das 3,26fache höher, während das von Frauen "nur" um das 1,82fache höher lag.
• Unter den PatientInnen mit kardiovaskulären Ereignissen war bei 47% eine koronare Herzerkrankung bekannt, ein Wert der bei den Erkrankten in den Kontroillzeiten lediglich 29,1% betraf.
• Die höchste durchschnittliche Inzidenz von Herzattacken wurde während der ersten 2 Stunden nach dem Beginn eines Spieles der deutschen Kicker beobachtet.
• Das höchste Risiko wurde für Herzrhythmusstörungen beobachtet (3,07), dem die instabile Angina Pectoris mit 2,49 und der Herzinfarkt mit 2,49 folgten.
Was der Ratschlag der AutorInnen, "preventive measures are urgently needed", konkret meint, können sich Präventivwissenschaftler in Deutschland nicht mehr lange überlegen: Die Fußball-WM in Österreich und der Schweiz startet für die deutsche Mannschaft am 8. Juni 2008 um 20.45 Uhr in Klagenfurt gegen die polnische Mannschaft.
Der 9-seitige Aufsatz der Münchner Klinker im NEJM ist als Abstract und kostenlos auch als kompletter PDF-Text erhältlich.
Bernard Braun, 2.2.2008
Die Mär von der "Atomkraft-Renaissance" und den "gesunden AKW" - Propaganda und Wirklichkeit in der aktuellen AKW-Debatte
 Manchmal werden propagandistische und mythenreiche Debatten und die hinter ihnen stehenden Interessenten bereits an ihrem Starttag durch solide empirische Analysen widerlegt, enthüllt oder zumindest irritiert. Zumindest kann danach niemand mehr sagen, er habe von gegenteiligen tatsächlichen Verhältnissen oder Trends nichts gewusst oder zu spät erfahren.
Manchmal werden propagandistische und mythenreiche Debatten und die hinter ihnen stehenden Interessenten bereits an ihrem Starttag durch solide empirische Analysen widerlegt, enthüllt oder zumindest irritiert. Zumindest kann danach niemand mehr sagen, er habe von gegenteiligen tatsächlichen Verhältnissen oder Trends nichts gewusst oder zu spät erfahren.
Ein solcher Idealfall findet sich am 12. Januar 2008 mit wenigen Seiten Abstand in der "Süddeutschen Zeitung" und reicht weit über das Wochenende hinaus. Angesichts der gerade wieder am Beispiel der erhöhten Leukämie-Erkrankungsrisiken für Kinder im Umkreis von deutschen AKWs aktuell bewussten kurz-, mittel- und vor allem langfristigen Risiken von Atomkraftwerken, ist dies auch ein Thema von Gesundheitspolitik.
Auf Seite 1 berichtet die Zeitung unter der Schlagzeile "London entfacht neue Atom-Debatte in Deutschland" von dem neuen Energiegesetz der britischen Regierung, das prinzipiell den Weg für den Bau neuer Atomkraftwerke frei gemacht hatte. Angeblich sollen im März 2008 Pläne für den Bau zweier AKW veröffentlicht werden, was zu einer allerdings nur geringen Zunahme des Anteils von 16% der gesamten Energiekapazität führen würde, die in Großbritannien bisher schon aus Kernkraft gewonnen werden - irgendwann nach 2015! Und um ja nicht einen "Vorsprung" Deutschlands zu verlieren oder dafür verantwortlich zu sein, dass in "Deutschland die Lichter ausgehen", springt reflexartig die innenpolitische Debatte in Deutschland an. In der Unterschlagzeile der SZ: "Gabriel kritisiert die britische Entscheidung" … "Glos und Beckstein fordern längere Laufzeiten".
Und flugs verkündet der Generaldirektor der Internationalen Atomagentur NEA, Luis Echavarri, auch, Atomstrom sei angesichts des Ölpreises auch "rentabel".
Dass dies ohne Rücksicht auf die Glaubwürdigkeit und mögliche Verluste zu behaupten praktisch zu den Kernaufgaben eines leitenden Angestellten der NEA gehört, bleibt leider in der Berichterstattung selbst guter Tageszeitungen auf der Strecke. Was die unter dem Dach der OECD angesiedelte zwischenstaatliche Einrichtung ("semi-autonomous body") von Ländern mit Atomkraftwerken will und soll, geht offen und parteilich aus der Beschreibung ihrer "Mission" hervor: "The mission of the NEA is to assist its Member countries in maintaining and further developing, through international co-operation, the scientific, technological and legal bases required for the safe, environmentally friendly and economical use of nuclear energy for peaceful purposes. To achieve this, the NEA works as: a forum for sharing information and experience and promoting international co-operation; a centre of excellence which helps Member countries to pool and maintain their technical expertise; a vehicle for facilitating policy analyses and developing consensus based on its technical work."
Alle aktuellen und vor allem für die nächsten einhundert Generationen existierenden Risiken der Energieproduktion in Kernkraftwerken und der Lagerung ihres Mülls, werden zwar auch in den Berichten dieser "Missionare" angesprochen, erscheinen aber durchweg beherrschbar oder sind jedenfalls kein Grund, heute über die Beendigung dieses Typs der Energieproduktion oder Alternativen nachzudenken.
Im Wirtschaftsteil der Zeitung breitet dagegen in einem "Forum" der Geschäftsführer der Forschungsstelle Umweltpolitik an der Freien Universität Berlin, Lutz Mez, unter der Überschrift "Die Mär von der Atomkraft-Renaissance - Viele reden über die Wiederkehr der Kernenergie - dabei wird es auf absehbare Zeit überhaupt keinen Bauboom bei neuen Anlagen geben" (aktuell weder elektronisch noch kostenlos erhältlich) im wesentlichen die Ergebnisse des Anfang Januar mit Faktenstand vom 31. Dezember 2007 veröffentlichten "World Nuclear Industry Status Report 2007" aus.
Dieser Report erschien in der Verantwortung des Worldwatch Insitute in Washington, des WISE-Paris und von Greenpeace International zum ersten Mal 1992 und wird seit 2004 von der Grünenfraktion im Europäischen Parlament herausgegeben und veröffentlicht. Die Berechnungen und Prognosen des Reports bestätigten sich in diesem Zeitraum mehrmals und werden auch von internationalen Fachzeitschriften (so der Zeitschrift "Nuclear Engineering International" anlässlich des Reports 2004) geteilt.
Die wesentlichen Ergebnisse des Reports lauten:
• Am 1. November 2007 waren weltweit 439 Atomreaktoren am Netz. Das sind 16 Reaktoren mehr als 1987 und fünf weniger als vor fünf Jahren.
• 32 Einheiten werden von der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) als "im Bau" befindlich aufgeführt. Das sind ca. 20 Einheiten weniger als Ende der 90er Jahre.
• Im Jahre 1989 wurden insgesamt 177 Atommeiler in den jetzigen 27 EU-Mitgliedstaaten betrieben. Diese Zahl sank bis zum 1. November 2007 auf 146 Reaktoren.
• Um allein die aus technischen, politischen (z. B. in Schweden durch Volksabstimmung oder in Deutschland durch Vertrag) oder betriebswirtschaftlichen Gründen vom Netz gehenden Reaktoren zu ersetzen müssten zusätzlich zu den geplanten Reaktoren, die ein Datum für die Inbetriebnahme aufweisen 69 Reaktoren (42.000 MW) bis zum Jahre 2015 geplant, gebaut und in Betrieb genommen werden - das entspricht einem Reaktor alle 1 ½ Monate. In den darauf folgenden 10 Jahren müssten 192 zusätzliche Reaktoren fertig gestellt werden - alle 18 Tage einer. An diesem absolut utopischen Szenario hat sich im Übrigen seit 2004, wo dies zum ersten Mal entwickelt wurde, nichts geändert.
• Auch was die Diskrepanz zwischen dem gefordertem und als geplant angekündigten Anteil der Kernenergie an der gesamten Energiekapazität angeht, klafft sie mehrere Welten auseinander: Die Internationale Kernenergieagentur IAEA hatte in den 70er Jahren eine Kapazität von 4.450.000 Megawatt prognostiziert. Tatsächlich betrug im Jahre 2000 die nukleare Stromkapazität aller 436 weltweit betriebenen Reaktoren weniger als 352.000 Megawatt. Heute produzieren die 439 Meiler weltweit 371.000 Megawatt. Atomkraftwerke liefern 16% der Elektrizität, 6% der kommerziellen Primärenergie und 2-3% der Endenergie in der Welt - in der Tendenz sinkend - weniger als Wasserkraft allein. 21 der 31 Länder, in denen Atomkraftwerke betrieben werden haben im Vergleich zum Jahre 2003 den Anteil der Atomenergie am Strommix gesenkt.
• Mez weist darauf hin, dass viele der "im Bau" befindlichen Reaktoren dies schon zwischen 21 und 32 Jahren sind.
• Die oft zitierten asiatischen AKW-Boomländer, Indien und China, halten sich auf niedrigstem Niveau trotz einiger auch schon jahrzehntealten Ausbauplänen beim wirklichen Ausbau zurück: In Indien werden im Moment 2,6% des Strombedarfs von Atomreaktoren gedeckt, in China - immerhin eine der offiziellen Atommächte - sind es 1,9%.
• Der FU-Forscher weist zum Abschluss seines Forums-Beitrags auch noch auf die beliebte und von den AKW-Betreibern gepflegte "Halbwahrheit" hin, Kernkraftwerke wären mangels Ausstoßes von Treibhausgasen letztlich eine "gesunde" Alternative der Energieerzeugung. Danach sind sie nicht völlig CO2-frei, sondern erreichen schon im Moment ein Drittel der Emissionen moderner Gaskraftwerke. Wegen der technischen Weiterentwicklung der Gaskraftwerke (Stichwort: Kraft-Wärme-Koppelung) und dem zum Abbau von immer mehr Uran notwendigen steigenden Einsatz von fossiler Energie, geht z. B. das Darmstädter Öko-Institut davon aus, dass dann AKWs keinen CO2-Vorteil mehr haben.
Unabhängig von der wirklich zu erwarteten Entwicklung der Anzahl von AKWs sollte allerdings auch die Debatte darüber, ob schon die derzeitige Anzahl von Reaktoren wirklich notwendig sind und nicht durch alternative und erneuerbare Energien ersetzt werden können, nicht stillgelegt, sondern auf der Basis des kritischen Wissens über die Risiken der Kernkraft weiter geführt werden.
Die Ergebnisse des "The World Nuclear Industry Status Report 2007(Updated to 31 December 2007)" von Mycle Schneider, Paris und Antony Froggatt, London erarbeitet, sind in einer 37-seitigen Langfassung und in einer vier Seiten umfassenden Zusammenfassung kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 14.1.2008
USA: Bis zu 101.000 vermeidbare Tote pro Jahr durch gezielte präventive Interventionen bei den bis zu 75-Jährigen
 Wäre es in den USA gelungen, die Rate der potenziell durch gezielte gesundheitlichen Maßnahmen beeinflussbaren und vermeidbaren Sterblichkeit unter den bis zu 75-Jährigen zwischen 1997/98 und 2002/03 auf das Niveau der drei Industrieländer (Frankreich, Japan, Australien) mit dem niedrigsten Wert für diesen Indikator abzusenken, wären zuletzt rund 101.000 weniger tote BürgerInnen zu beklagen gewesen. Hätten die USA wenigstens den Wert der durchschnittlichen Absenkung dieser Rate in allen18 hierzu untersuchten anderen Industrieländern erreicht, wären jährlich noch ungefähr 75.000 US-AmerikanerInnen von 0 bis 75 Jahren am Leben.
Wäre es in den USA gelungen, die Rate der potenziell durch gezielte gesundheitlichen Maßnahmen beeinflussbaren und vermeidbaren Sterblichkeit unter den bis zu 75-Jährigen zwischen 1997/98 und 2002/03 auf das Niveau der drei Industrieländer (Frankreich, Japan, Australien) mit dem niedrigsten Wert für diesen Indikator abzusenken, wären zuletzt rund 101.000 weniger tote BürgerInnen zu beklagen gewesen. Hätten die USA wenigstens den Wert der durchschnittlichen Absenkung dieser Rate in allen18 hierzu untersuchten anderen Industrieländern erreicht, wären jährlich noch ungefähr 75.000 US-AmerikanerInnen von 0 bis 75 Jahren am Leben.
Dies ist eines der dramatischsten Ergebnisse einer großen Studie, die zu den beiden genannten Zeitpunkten die Rate der altersstandardisierten vermeidbaren Mortalität ("amenable mortality") in den USA, Kanada, Australien, Neuseeland, Japan und 14 westeuropäischen Ländern, darunter Deutschland, untersuchten. Die an der London School of Hygiene and Tropical Medicine arbeitenden Forscher, Ellen Nolte und C. Martin McKnee, veröffentlichten die wichtigsten Ergebnisse jetzt unter der Überschrift "Measuring the Health of Nations: Updating an Earlier Analysis" in der US-Fachzeitschrift "Health Affairs" (Januar/Februar 2008; 27 (1): 58-71).
Für die Berechnung des in den 1970er Jahren u.a. für die Bewertung und den Quer- wie Längsschnittsvergleich von Qualität und Performance von nationalen Gesundheitssystemen entwickelten Indikators nutzen Nolte und McKee Daten der Weltgesundheitsorganisation WHO über die Sterblichkeit an einer Reihe von vermeidbaren Krankheiten (z. B. behandelbare Krebserkrankungen, Diabetes and Herz-Kreislauferkrankungen), die durch präventive Interventionen im weitesteren Sinne beeinflusst werden können.
Zu den wichtigsten Ergebnissen zählen:
• Zwischen den beiden Untersuchungszeitpunkten sank die Rate der "amenable mortality" in allen Ländern (ohne die USA) um durchschnittlich 16%.
• In den USA nahm diese Rate lediglich um 4% ab.
• 1997/98 lag die USA mit 114,7 Toten pro 100.00 Einwohner an vierter Stelle der Neunzehner-Rangliste. Schlechter als die USA waren die Werte nur noch in Finnland, Portugal, Großbritannien und dem "Spitzenreiter" Irland mit rund 134 Toten pro 100.000 Einwohner. Den geringsten Wert vermeidbarer Sterblichkeit gab es mit 76 Toten pro 100.000 Einwohner in Frankreich. Deutschland befand sich, wie so oft, mit 106 vermeidbaren Toten/100.000 Einwohnern im Mittelfeld.
• 2002/03 liegen die USA mit 110 vermeidbaren Toten/100.000 Einwohnern an der Spitze, dicht gefolgt von Portugal (104), Irland (103) und Großbritannien. Frankreich weist nachwievor den niedrigsten Wert auf, und zwar mit 65 vermeidbaren Toten 11 Tote/100.000 Einwohnern weniger als rund 5 Jahre zuvor. In Deutschland sank die Anzahl der vermeidbaren Toten um 19, lag damit 2003 bei 90 Toten und weiterhin im Mittelfeld der 19 untersuchten Nationen.
• Für die USA bedeuten diese Berechnungen, dass selbst der niedrigere Wert von 75.000 durch im weiten Sinn präventiven Maßnahmen vermeidbaren Toten noch rund doppelt so hoch ist wie die vom US-Institute of Medicine geschätzte Anzahl von vermeidbaren Toten aufgrund medizinischer Irrtümer und Fehler - eine Zahl, welche die US-Öffentlichkeit extrem zum Nachdenken über die Qualität ihres Gesundheitssystems gebracht hat.
• Auch wenn sich die vermeidbare Mortalität in Deutschland konstant im Mittelmaß bewegt ist es kein Grund zum Zurücklegen: Auch hier könnten jährlich Tausende von Toten vermieden werden, wenn es gelänge, durch geeignete und weitgehend bekannte und erprobte Maßnahmen das Niveau Frankreichs zu erreichen.
Die Ergebnisse kann man kostenfrei nur in einem inhaltlich sehr kargen Abstract des "Health Affairs"-Aufsatzes nachlesen.
Der komplette Aufsatz setzt ein Abonnement voraus, das vor allem angesichts der anhaltenden Wechselkursstärke des Euro, von Interessenten an der internationalen und vor allem angelsächsischen Gesundheitspolitik auch generell erwogen werden sollte. Nicht-US-StudentInnen zahlen als Individuen im Moment für jährlich 6 dicke gedruckte und online verfügbare Zeitschriftenbände 134 US-Dollar, Nichtstudierende 185 US-Dollar. Ein zeitlicher befristeter Zugriff auf einen Aufsatz kostet 12,95 US-Dollar.
Wer etwas mehr lesen und sehen will, kann sich die bekannt solide Zusammenfassung der Ergebnisse von Deborah Lorber in der stets zwei Seiten umfassenden "In the Literature"-Reihe des Commonwealth Fund kostenlos herunterladen.
Bernard Braun, 8.1.2008
"23andMe" oder Googeln für Hypochonder und Fatalisten. Das Neueste aus der US-Gesundheitswirtschaft!
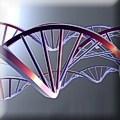 Jeder Mensch hat 23 Chromosomenpaare. Wer sie als US-BürgerIn bisher nicht näher kennt, kann dies seit Mitte November 2007 durch den Einsatz von rund 1.000 US-Dollar und einer Speichelprobe bei "23and Me" nachholen.
Jeder Mensch hat 23 Chromosomenpaare. Wer sie als US-BürgerIn bisher nicht näher kennt, kann dies seit Mitte November 2007 durch den Einsatz von rund 1.000 US-Dollar und einer Speichelprobe bei "23and Me" nachholen.
Und die im Mai 2007 vom Suchmaschinenanbieter Google für 2,9 Millionen Euro erworbene Biotech-Firma "23andMe" ist oder wird nicht lange allein sein, denn mit der isländischen Firma "deCode" existiert für die Gebühr von 985 US-Dollar bereits ein zweiter Anbieter, der bereits 1998 mit dem Erwerb der Erbdatenbank der isländischen Bevölkerung begonnen hatte, ins Innerste der Menschen zu schauen. Zwei weitere Firmen bereiten in den USA ihren Markteintritt vor. Anders als die beiden Erstanbieter verlangt der dritte bekannte künftige Anbieter, die Firma Navigenics, für ihre DNA-Analyse 2.500 US-Dollar, bietet dafür aber auch eine zusätzliche telefonische Genetik-Beratung an.
Alles zusammen deutet an, dass es bald zur gesundheitlichen Pflicht oder Eigenverantwortung gehören könnte, seine DNA zu kennen. Und wer könnte schon etwas gegen das "empowering [von] Individuals to Access and Understand Their Own Genetic Information" (Überschrift der Presseerklärung von 23andMe vom 19. November 2007 zu ihrem Marktauftritt) haben?
Wie man zu diesen Kenntnissen komnmt und ob und wie sie den Kenner stärken oder nicht verdient aber ernsthaft hinterfragt zu werden solange dieser neueste Schrei der Gesundheitswirtschaft noch in den Kinderschuhen steckt.
In gut verständlicher Weise hat damit unter der Überschrift "The DNA Age: My Genome, Myself: Seeking Clues in DNA" die Journalistin Amy Harmon in der "New York Times" vom 17. November 2007 begonnen, die zu den journalistischen Vortestern des Angebots gehörte. Diesen und andere Artikel sowie das umfangreiche Archiv der NYT kann man nach einer kostenlosen Registrierung auf der Homepage der Zeitung lesen.
Zuvor soll aber kurz dargestellt werden, worin die Leistungen derartiger Firmen bereits jetzt bestehen. Dies lässt sich am besten in den Worten der Presseankündigung der Firma 23andMe nachvollziehen:
• "23andMe sends individuals a saliva kit containing a barcoded tube for saliva collection. Customers then use the enclosed mailing materials to send their samples to 23andMe's contracted laboratory. The DNA is then extracted and exposed to a microchip-like device made by Illumina, a leading developer of genetic analysis tools (Nasdaq: ILMN), that reads more than half a million points in the individual's genome, including a proprietary set chosen by 23andMe scientists, to produce a detailed genetic profile.
• Once the analysis has been completed, individuals will be able to use their own private login to access their data via 23andMe's secure website. Using 23andMe's web-based tools, individuals can explore their ancestry, see what genetics research means for them and compare themselves to friends and family members.
• Ultimately, they will become part of a community that works together to advance the overall understanding of the human genome."
Die Skepsis, mit der die vorhandenen und künftigen Angebote zu beurteilen sind, orientiert sich an folgenden Aspekten:
• Die Haftungsansprüche der Kunden sind unklar oder zumindest nicht in der in der EU gewohnten Weise gesichert. Die Firma deCODE bringt dies so zum Ausdruck: "Obwohl deCODE modernste Methoden zum Genotyping anwendet und nach höchsten Qualitätsstandards arbeitet", heißt es im Service-Agreement, "gibt deCODE keinerlei Garantie darauf, dass der Scan des genetischen Materials erfolgreich sein oder korrekte Resultate liefern wird." Da Island nicht der Europäischen Union angehört, greifen hier übrigens auch EU-Bestimmungen zu Kunden- und Datenschutz nicht.
• Auch wenn die Genanalysen nach Meinung von Experten auf labortechnisch hohem Niveau stattfinden, bleibt die Frage, wie die so genetisch analysierten Personen mit den sie betreffenden Ergebnissen umgehen. Dies betrifft zum einen den Umgang mit der Fülle von Risiko-Informationen bei Abwesenheit konkreter Erkrankungen. Auch wenn es Firmen gibt, die eine telefonische Beratung anbieten und nicht nur einen elektronischen "Genome Explorer" oder ein "Gen Journal", zeigt der Bericht über die Werte der NYT-Journalistin eine Reihe der hier auf die Nutzer solcher Angebote zukommenden Herausforderungen:" I found a perverse sense of accomplishment. My risk of breast cancer was no higher than average, as was my chance of developing Alzheimer’s. I was 23% less likely to get Type 2 diabetes than most people. And my chance of being paralyzed by multiple sclerosis, almost nil. I was three times more likely than the average person to get Crohn’s disease, but my odds were still less than one in a hundred. I was in remarkably good genetic health ... and then I opened my 'Gene Journal’ for heart disease to find that I was 23% more likely than average to have a heart attack." Fünf der SNPs oder "snips" aus den rund 10 Millionen "single nucleotide polymorphisms" oder Variationen der 23 Chromosomenpaare (die Firmen analysieren aber im Moment "nur" 1 Million solcher genetischer zusammenhänge), zeigen der Berichterstatterin ferner, dass sie eine hundertfach höhere Wahrscheinlichkeit hat, einen Zusammenbruch der Makula zu erleiden, also massive Sehverluste zu bekommen. Andere Snips beruhigen sie aber darin, dass sie im höheren Alter wohl keine bösartige Form der Arthritis in den Fingern haben dürfte, mithin weiter ohne Probleme Artikel tippen kann. Die einzige Hilfe beim Umgang mit ihrem Herzattackenrisiko, die das "Gene Journal" im übrigen lieferte, war der völlig banale Hinweis auf - wer hätte das gedacht - "healthy lifestyle choices".
• Der Gebrauchswert zahlreicher Leistungen, wie etwa die genetische Identifikation der Herkunftsgegend von Vorfahren der Personen oder ein "celebrity feature", das anzeigt mit welcher berühmten Person man genetisch etwas gemein hat, ist eher gering. Ob es im Genbestand dieser Formen womöglich Hinweise auf einen bisher unbekannten Bruder gibt, könnte dagegen präventiv für Erbstreitigkeiten interessant sein.
• Auch wenn alle Unternehmen ihren Kunden versichern, die persönlichen Daten niemand direkt zugänglich zu machen, gibt es Angebote, die zumindest nicht alle Möglichkeiten einer missbräuchlichen Verwendung dieser Daten verhindern: Dazu gehört z. B. das Angebot, "Genetische Familienportaits" erstellen zu lassen, in denen die Daten mehrerer Familienangehörigen zusammengeführt werden können. Technisch möglich sind auch "Genplauschs" mit Freunden. Ob dies irgendwann einmal "freundliche" Nachfragen von Arbeitgebern oder Versicherungsunternehmen provoziert, man habe doch nichts zu verbergen und solle mal einen Blick auf die Risikoprofile erlauben, ist natürlich im Moment nur eine Spekulation - aber praktisch möglich. Unabhängig davon stellt sich aber auch die Frage, ob das Internet wirklich technisch sicher für die Übertragung derartig sensible Daten ist.
• Das Angebot im Internet offenbart zugleich die wachsende Schwäche der in vielen Ländern bestehenden gesetzlichen Verbote einer solchen Genetikberatung von Anbietern in diesem Land.
• Auch wenn genanalytische Qualitätsstandards eingehalten werden, die Datensicherheit gewährleistet ist und selbst wenn es bessere Methoden der Erläuterung gibt, bleibt völlig offen bzw. ist wissenschaftlich nicht abschließend erforscht, in welchem Maße Menschen und ihre Gesundheit wirklich durch Genomsequenzen ohne jegliche Freiheitsgrade determiniert sind. Dies liegt allein schon daran, dass eine ganze Reihe von genetischen Steuerungsmechanismen nicht in der DNA-Sequenz kodiert ist. Es droht also die Gefahr, dass eine Reihe der Nutzer dieser Angebote zwischen Hypochondrie und Fatalismus hin- und hertreiben. Bei diesen Verunsicherungsfolgen hilft dann eventuell auch der Rat nicht, sich über derartige Profile mit seinen Arzt zu unterhalten. Aktuell dürften Hausärzte nämlich nicht arg viel sachkundiger sein als ihre Gen-Googler.
Bernard Braun, 26.11.2007
Zwischen "Cash-for-pounds" und Spekulation gegen sich selbst": Geld-Anreize von US-Firmen zum Abbau von Übergewicht - erfolgreich?
 In den USA, wo auch sonst, entdeckt der landeskulturspezifische "war on obesity" jetzt offensichtlich auch komplexere Varianten der Steuerung von Gesundheitsverhalten mittels ökonomischer Anreize.
In den USA, wo auch sonst, entdeckt der landeskulturspezifische "war on obesity" jetzt offensichtlich auch komplexere Varianten der Steuerung von Gesundheitsverhalten mittels ökonomischer Anreize.
Über die Ergebnisse eines Anreizprogramms, das mit Barzahlungen für nachgewiesene Gewichtsverluste operierte, berichtet jetzt der am "RTI International", einem internationalen mit rd. 2.600 Mitarbeitern operierenden Wissenschafts- und Beratungs-Think-Tank, beschäftigte Gesundheitsökonom Eric Finkelstein.
Unter der Überschrift "Financial Incentives help employees lose weight, study finds" referiert Finkelstein über ein 6 Monate dauerndes Interventionsprogramm, für das mehr als 200 TeilnehmerInnen zufällig aus den Beschäftigten einer Universität und dreier "community colleges" in North Carolina ausgesucht wurden. Sie wurden in drei Gruppen aufgeteilt, von denen eine Gruppe keinerlei finanzielle Anreize für einen Gewichtsverlust, eine zweite 7 US-Dollar für jeden Prozentpunkt und die Angehörigen der dritten Gruppe 14 US-Dollar pro Prozentpunkt Gewichtsabnahme erhielt. Die Forscher von RTI und der University of North Carolina at Chapel Hill fanden heraus, dass die größeren finanziellen Anreize zum stärksten kurzfristigen Gewichtsverlust führten.
Konkret: Nach drei Monaten verloren die TeilnehmerInnen ohne finanziellen Anreiz 2 Pfund, die 7-Dollar-Gruppe dast 3 Pfund und die 14-Dollargruppe 4,7 Pfund. Die Wahrscheinlichkeit, mit der die höchstangereizten gegenüber den TeilnehmerInnen ohne finanziellen Anreiz 5 Prozent ihres Körpergewichts verloren, war 5 ½-fach höher.
Sechs Monate nach Start des Programms bot sich aber ein interessantes Bild, das den optimistischen Tenor der Schlagzeile erheblich relativiert: Die Gewichtsverluste ähnelten sich zu diesem Zeitpunkt über alle Gruppen hinweg immer mehr, d.h. die Personen, die keinen einzigen Dollar für ihren Gewichtsverlust erhielten, nahmen in etwa gleich viel oder wenig ab wie diejenigen, die für Gewichtsverluste Geld kassierten. Angesichts der Tatsache, dass die Laufzeit dieses Übergewichtsprogramms vergleichsweise zu anderen erfolgreicheren Programmen sehr kurz ist, wäre eine Nachanalyse dazu, ob die Gewichtsverluste in allen Gruppen anhielten oder alle TeilnehmerInnen zum Ausgangsgewicht zurückkehrten, von großer Bedeutung für die ökonomische Bewertung dieses "Cash-for-pounds"-Programms gewesen.
Insgesamt verloren 67% aller TeilnehmerInnen während der Studienzeit an Gewicht.
Zur weiteren Lektüre ist ein Abstract der Originalpublikation "A Pilot Study Testing the Effect of Different Levels of Financial Incentives on Weight Loss Among Overweight Employees" von Finkelstein, Eric; Linnan, Laura; Deborah F. und Birken, Ben in der Zeitschrift "Journal of Occupational & Environmental Medicine"( 49(9):981-989, September 2007) erhältlich.
Über die offensichtlich nicht durchschlagende und nachhaltige Wirkung finanzieller Boni wundern sich allerdings andere amerikanische Ökonomen wenig. Sie schlagen auch gleich ein alternatives Anreizmodell vor und liefern die entsprechende Firma gleich mit, die diese Reize ab Dezember 2007 im Internet vertreibt.
Der an der Yale-Universität arbeitende Ökonom Barry Nalebuff konstatiert, dass der Anreiz etwas zu verlieren zu viel größeren Anstrengungen antreibe als der Anreiz, einen Bonus zu erhalten oder etwas zu gewinnen. Ohne das auch noch weiter und tiefer zu begründen arbeiten Nalebuff und einige seiner Kollegen am Aufbau einer Art Wett- oder Spekulationsbörse für Übergewichtige.
Auf der Website www.stickk.com kann jeder ab Ende dieses Jahres nicht mit erwarteten Verlusten des Preises für Sackweizen oder Stahlträger spekulieren, sondern mit der Abnahme seines eigenen Körpergewichts.
Entsprechend veranlagte Personen können dazu einen Vertrag mit sich selbst über ihre künftige Gewichtsreduktion abschließen. Den dabei festzulegenden Startbetrag verliert die kleine Ich-Spekulations-AG, wenn das Gewicht nicht um einen ebenfalls vereinbarten Wert abnimmt. Ein schwacher Trost ist, dass der Betrag zunächst an Wohltätigkeitsorganisationen, Freunde oder die Familie fiele.
In dem bereits zitierten Überblick der RTI-Forschungen breitet schließlich E. Finkelstein auch noch in aller Offenheit die Beweggründe und erwarteten Nutzen von finanziellen Anreizsystemen zur Gewichtsabnahme für Beschäftigte und vor allem für Unternehmen aus: "Financial incentives tied directly to weight loss are an attractive strategy from an employer's perspective because they require no start-up costs and employees receive the incentive only if they achieve the targeted weight loss goal" und "employees may also prefer incentive-based programs that provide the resources and flexibility to improve their health without being tied to the small menu of options that may be offered by the employer."
Bernard Braun, 12.11.2007
Nächtlicher Fluglärm und Gesundheit: Mehr Verordnungen von Hochdruck- und Herz-Arzneimittel bei Anwohnern eines Nachtflughafens
 Die nachgewiesenen gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch den Verkehrslärm in Wohngebieten werden immer noch gerne für den Flugverkehr und dabei auch nächtliche Starts und Landungen von Verkehrs- und Frachtmaschinen bestritten. Dabei werden "Flüstertriebwerke" ins Feld geführt und außerdem auf den im Vergleich zum Straßenverkehr wesentlich "löchrigeren" Lärmteppich und die Limitierung der Anzahl von Flugbewegungen verwiesen.
Die nachgewiesenen gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch den Verkehrslärm in Wohngebieten werden immer noch gerne für den Flugverkehr und dabei auch nächtliche Starts und Landungen von Verkehrs- und Frachtmaschinen bestritten. Dabei werden "Flüstertriebwerke" ins Feld geführt und außerdem auf den im Vergleich zum Straßenverkehr wesentlich "löchrigeren" Lärmteppich und die Limitierung der Anzahl von Flugbewegungen verwiesen.
Eine im Oktober 2007 im "Journal of Public Health" (Volume 15, Nr. 5) veröffentlichte Studie über die Verordnungshäufigkeit von blutdrucksenkenden und kardiovaskulären Arzneimittteln in der Bevölkerung, die rund um die Flugschneisen des größten deutschen Nachtflughafens in Köln-Bonn wohnt und schläft, weist auf die Fragwürdigkeit dieser Argumentation hin.
Dazu ermittelten die Bremer ForscherInnen Eberhard Greiser, Claudia Greiser und Katrin Jahnsen sowohl die Fluglärmbelastungen jedes einzelnen Fluges in den sechs flugintensivsten Monaten des Jahres 2004. Zusätzlich analysierten sie mit Daten gesetzlicher Krankenkassen die Arzneiverordnungsdaten von 809.379 Personen im Umfeld des Köln-Bonner Flughafens. Diese Daten dienten als Indikatoren für spezifische gesundheitliche Beeinträchtigungen, die mit der nächtlichen Fluglärmbelastung assoziiert wurden. Dann wurden jeder Wohnlage spezifische Lärmdaten zugeordnet. Mit multivariaten Methoden verrechneten die Wissenschaftler dann sehr differenzierte Daten über Fluglärm und anderen Lärm mit Daten zum Alter und zu ausgewählten sozialen Charakteristika der exponierten Bevölkerung.
Die Ergebnisse von Greiser et al. lauteten:
• Erhöhte Verordnungslevels gab es ausgeprägter bei Frauen.
• Mittlere Zunahmen der durch den nächtlichen Fluglärm bedingten Wahrscheinlichkeit der Verordnung von Hochdruckpräparaten und kardiovaskulärer Arzneimittel.
• Ausgeprägtere Effekte waren bei jenen Personen zu erkennen, die Arzneimittel aus verschiedenen Arzneimittelgruppen erhielten, wie z. B. Hochdruck- und Herz-Kreislaufarzneimittel oder Präparate aus diesen Gruppen und der Beruhigungsmittel. In diesen Gruppen erreichte die Wahrscheinlichkeit der Verordnung der besagten Arzneimittel-"Pakete" das 3,7fache der Verordnungshäufigkeit von nicht lärmbelasteten Männern und das 3,9fache des Werts von Frauen ohne Fluglärmbelastung.
• Zunahmen dieser Art von Verordnungen waren in allen sozialen Subgruppen der untersuchten Bevölkerungsgruppe zu finden.
Von dem Aufsatz "Night-time aircraft noise increases prevalence of prescriptions of antihypertensive and cardiovascular drugs irrespective of social class—the Cologne-Bonn Airport study" von Greiser, Greiser und Jahnsen ist nur ein "Abstract" kostenfrei erhältlich.
Bernard Braun, 31.10.2007
Kleinere Schulklassen = bessere Bildung und Gesundheit. US-Studie hält Bildungspolitik für die effektivere Gesundheitspolitik
 Die Verkleinerung von Schulklassen schon in den Hauptschulen wäre einer US-amerikanischen Studie zufolge eine effektivere Strategie im Bereich der Gesundheitspolitik als viele derzeitige Maßnahmen zur Prävention, Gesundheitsförderung oder auch medizinischen Versorgung. Effekte einer solchen Intervention wären mehr und höhere Bildungsabschlüsse der einbezogenen Schüler, damit zusammenhängend dann bessere berufliche Chancen und im Endeffekt ein besserer Gesundheitszustand, eine höhere Lebensqualität und auch Lebenserwartung. Auch wären die Ausgaben im medizinischen Versorgungssystem dadurch geringer. Die notwendigen ökonomischen Ausgaben für diese Schulreform wären zwar hoch, würden aber durch mittel- und langfristige Einsparungen weitgehend wieder ausgeglichen. Dies ist das Fazit einer Studie zweier US-Wissenschaftler, die jetzt in der Zeitschrift "American Journal of Public Health" veröffentlicht wurde.
Die Verkleinerung von Schulklassen schon in den Hauptschulen wäre einer US-amerikanischen Studie zufolge eine effektivere Strategie im Bereich der Gesundheitspolitik als viele derzeitige Maßnahmen zur Prävention, Gesundheitsförderung oder auch medizinischen Versorgung. Effekte einer solchen Intervention wären mehr und höhere Bildungsabschlüsse der einbezogenen Schüler, damit zusammenhängend dann bessere berufliche Chancen und im Endeffekt ein besserer Gesundheitszustand, eine höhere Lebensqualität und auch Lebenserwartung. Auch wären die Ausgaben im medizinischen Versorgungssystem dadurch geringer. Die notwendigen ökonomischen Ausgaben für diese Schulreform wären zwar hoch, würden aber durch mittel- und langfristige Einsparungen weitgehend wieder ausgeglichen. Dies ist das Fazit einer Studie zweier US-Wissenschaftler, die jetzt in der Zeitschrift "American Journal of Public Health" veröffentlicht wurde.
Dass Bildung und Gesundheit auch heute noch sehr eng miteinander zusammenhängen, dass Angehörige höherer Sozialschichten mit besserem Bildungsniveau seltener chronisch erkranken und auch eine um mehrere Jahre höhere Lebenserwartung haben, ist nicht neu, sondern durch viele internationale Studien belegt (vgl. hierzu z.B. die Berichte in Forum Gesundheitspolitik "Soziale Lage, Armut und soziale Ungleichheit"). Die beiden Public-Health-Wissenschaftler Peter Muennig und Steven H. Woolf haben diesen Forschungsstand allerdings einmal in eine konkrete politische Perspektive überführt. Anhand großer Datensätze aus Langzeitstudien überprüften sie, welche ökonomischen und gesundheitlichen Effekte sich ergeben, wenn man in Schulen kleinere Klassengrößen einführt und haben die Ergebnisse dann auf die US-Bevölkerung hochgerechnet und mit anderen Indikatoren (Gesundheit, Einkommen usw.) verknüpft.
Basis ihrer Analysen ist das im Jahr 1985 begonnene schulische Bildungsprojekt "STAR" (Student Teacher Achievement Ratio), das im US-Staat Tennessee in 46 Schulbezirken durchgeführt wurde. Über 300 Schulklassen waren beteiligt, in der Hälfte aller Klassen wurde die gängige Klassengröße von etwa 22-25 Schülern auf 13-17 Schüler reduziert, in der übrigen Hälfte blieb alles beim Alten. Die Schüler wurden dabei per Zufall den kleineren oder größeren Klassen zugeordnet, STAR ist also eine "randomisierte" Kontrollstudie. Der weitere Lebensverlauf der Studienteilnehmer wurde dann - seit 1985 - exakt verfolgt. Im Ergebnis zeigte sich, dass Schüler aus den kleineren Klassen um 12 Prozent häufiger (im Vergleich zu den größeren Klassen) auch einen High School Abschluss schafften, bei Schülern aus unteren Sozialschichten lag diese Quote besserer Abschlüsse sogar um 18 Prozent höher.
Um auch ökonomische und gesundheitliche Aspekte in die Analyse einschließen zu können, wurden andere große US-amerikanische Datensätze verwendet, in denen auf individueller Ebene Zusammenhänge zwischen Bildungsniveau, Gesundheitszustand und Kosten in der medizinischen Versorgung, Berufsverläufen und Einkommen festgehalten sind. Als Ergebnis ihrer komplexen Analysen zeigte sich dann, dass die Verkleinerung der Schulklassen für die Beteiligten eine um durchschnittlich 1,7 Jahre höhere Lebenserwartung mit sich bringen würde, und zwar sogenannte "qualitäts-adjustierte" Lebensjahre bei guter Gesundheit und Lebensqualität. In finanzieller Hinsicht würde die Maßnahme für den Staat 14.000 $ an zusätzlichen Kosten pro gewonnenem Lebensjahr bedeuten. Diese Relation, so die Wissenschaftler, ist eher gering im Vergleich zu vielen anderen Maßnahmen im Bereich von Prävention oder medizinischer Versorgung. Sie liegt etwa auf demselben Niveau wie der lebensrettende Ertrag einer Impfung von Kindern in Relation zu den Impfkosten. Ihre nachvollziehbare Schlussfolgerung: "Eine Reduzierung der Größe von Schulklassen ist sehr viel kosteneffektiver für die Verbesserung der Gesundheit als die meisten Maßnahmen im Bereich Medizin und Public Health".
Hier ist ein Abstract der Studie: Peter Muennig, Steven H. Woolf: Health and Economic Benefits of Reducing the Number of Students per Classroom in US Primary Schools (American Journal of Public Health, November 2007, Vol 97, No. 11)
Gerd Marstedt, 31.10.2007
Was könnte die Schmerztherapie von Sauerländern mit dem Hindukusch zu tun haben? "Poppy for Medicine" in Afghanistan!
 Auch wenn der damalige Bundesverteidigungsminister Peter Struck (SPD) das zu Beginn des deutschen Militärengagements in Afghanistan mit seinem legendären Spruch von "unserer Freiheit", die es nach der endgültigen heimischen Umzingelung durch Freunde jetzt "am Hindukusch zu verteidigen" gälte, nicht so gemeint hat: Es gibt ausgerechnet Public Health-Ideen, von denen sowohl eine bestimmte Bevölkerungsgruppe in vielen westlichen aber auch östlichen Ländern wirklich profitiert, die den kriminellen Bürgerkriegs-Warlords und Talibangruppen in Afghanistan den durch Illegalität extrem angeschwollenen Geldfluss abschneidet und die schließlich die wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen insbesondere für die kleinen und mittleren Bauern des Hindukusch-Landes verbessern könnten.
Auch wenn der damalige Bundesverteidigungsminister Peter Struck (SPD) das zu Beginn des deutschen Militärengagements in Afghanistan mit seinem legendären Spruch von "unserer Freiheit", die es nach der endgültigen heimischen Umzingelung durch Freunde jetzt "am Hindukusch zu verteidigen" gälte, nicht so gemeint hat: Es gibt ausgerechnet Public Health-Ideen, von denen sowohl eine bestimmte Bevölkerungsgruppe in vielen westlichen aber auch östlichen Ländern wirklich profitiert, die den kriminellen Bürgerkriegs-Warlords und Talibangruppen in Afghanistan den durch Illegalität extrem angeschwollenen Geldfluss abschneidet und die schließlich die wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen insbesondere für die kleinen und mittleren Bauern des Hindukusch-Landes verbessern könnten.
Der Dreh- und Angelpunkt aller dieser Vorteile ist eine unter öffentlicher internationalen Kontrolle erfolgende Legalisierung der Anpflanzung von Mohnplantagen als Quelle des bisher weitgehend illegalen und damit den Profitinteressen der nationalen Warlords und der weltweiten kriminelllen Drogenkartellen überlassenen Rohstoffs für die Opiumproduktion.
Begonnen haben derartige Überlegungen im Jahre 2005, als der private internationale Thinktank "The Senlis Council" seine Überlegungen für ein so genanntes "Afghan Poppy for Medicine model" begonnen hat. Ein technisches Dossier, das auf einer Konferenz in Kabul vorgestellt wurde, zeigte für 2006, dass in Afghanistan 92% des weltweiten illegalen Opiums produziert wurde und direkt mindestens 13% der afghanischen Bevölkerung mit der Produktion beschäftigt waren. Wie meistens bei kriminalisierter und illegaler Tätigkeit, sind die Nutznießer der Produktion nicht die Produzenten, d.h. meist kleine Bauern in oft abgelegenen ländlichen Regionen, sondern die nationalen und internationalen Händler und die zum Schutz der illegalen Plantagen angeheuerten Gangs.
Die Kernidee des "Poppy for Medicine"-Modells ist, den Anbau von Mohnplanzen zu legalisieren und unter entsprechender Kontrolle auf örtlicher Ebene eine Produktion von Morphintabletten oder -platten zu organisieren, die dann im Rahmen normaler Handelsbeziehungen der weltweiten Weiterverarbeitung in Schmerzmedikamenten zugeführt werden. Die dann geringeren, aber immer noch respektablen Gewinne aus der Rohopiumproduktion verblieben weitgehend im ländlichen Umkreis der Bauern und könnten direkt für die Entwicklung der in Afghanistan dominanten ländlichen Lebensverhältnisse dienen. Zu den potenziellen Gewinnern zählen aber nicht nur afghanische Produzenten, sondern auch große Teile der Weltbevölkerung (schätzungsweise 80%), für deren Schmerzversorgung es nach Feststellung des "International Narcotics Control Board" der UN es dringend an Morphin-Medikamenten fehlt. Mit einem derartigen Projekt könnten also sowohl gesundheitliche, zivilgesellschaftliche, friedensstiftende und ökonomische Entwicklungsimpulse gegeben und gefördert werden.
Die Erfolge eines vergleichbaren "Poppy for Medicine"-Modells in der ländlichen Türkei der 1970er Jahre zeigen, dass die erwarteten Wirkungen realistisch sind und innerhalb relativ kurzer Zeit (in der Türkei dauerte es vier Jahre) eintreten können. Für Afghanistan wurde die Realisierbarkeit eines örtlichen und vor krimineller Einflussnahme gefeiten Kontrollsystems in den Jahren 2005 und 2006 sozial- und kriminalwissenschaftlich abgeklärt.
Das Europaparlament hat im Oktober 2007 über diese Art der zivilgesellschaftlichen Hilfe für den Aufbau Afghanistans debattiert und den EU-Mitgliedsstaaten empfohlen, über die baldige Förderung von Modellprojekten nachzudenken bzw. sie zu unterstützen. Dazu stellte das Parlament auch die bisherige Antidrogenpolitik der Konzentration auf die Zerstörung der Mohnanplanzungen in Frage, da sie der weit unterentwickelten afghanischen Ökonomie nicht helfe und gleichzeitig auch nichts gegen den illegalen Anbau erreiche.
Näheres erfährt man über das "Poppy for Medicine"-Modell in einer Kurzfassung, und die über einen Link kostenfrei erhältliche 112 Seiten umfassende Langfassung der Studie "Poppy for Medicine. Licensing poppy for the production of essential medicines: an integrated counter-narcotics, development, and counter-insurgency model for Afghanistan", die im Juni 2007 vom "Senlis Council" in London veröffentlicht wurde.
Bernard Braun, 30.10.2007
Das falsche und richtige "end of the evidence stick" der "Krankenhaus - Hygiene - Diskussion" in Großbritannien!
 Da das Forum-Gesundheitspolitik bereits mehrfach auf Studien und Aktionen über und zu den Problemen der Krankenhaushygiene hingewiesen hat, wollen wir auch auf ein aktuell in "Lancet" (2007; 370: 1102) veröffentlichtes Editorial zum Thema hinweisen, das sich kritisch mit der ab Januar 2008 vorgesehenen Abschaffung der weißen, langärmligen Ärztebekleidung in Großbritannien auseinandersetzt. Unter der Überschrift "The traditional white coat: goodbye, or au revoir?" kritisieren die Kommentatoren die populistische Orientierung manchen Beitrags und fordern mehr Sachlichkeit ein.
Da das Forum-Gesundheitspolitik bereits mehrfach auf Studien und Aktionen über und zu den Problemen der Krankenhaushygiene hingewiesen hat, wollen wir auch auf ein aktuell in "Lancet" (2007; 370: 1102) veröffentlichtes Editorial zum Thema hinweisen, das sich kritisch mit der ab Januar 2008 vorgesehenen Abschaffung der weißen, langärmligen Ärztebekleidung in Großbritannien auseinandersetzt. Unter der Überschrift "The traditional white coat: goodbye, or au revoir?" kritisieren die Kommentatoren die populistische Orientierung manchen Beitrags und fordern mehr Sachlichkeit ein.
So richtig die Vermutung sein könnte, dass bei langen Ärmeln der abschließende Bund mit Mikroorganismen kontaminiert werden kann, so wenig Beweise gibt es nämlich dafür. Zum Evidenzniveau der neuen Kleidervorschrift stellen die "Lancet-Autoren daher fest: "Übertragen Ärmelaufschläge Infektionen? Die Arbeitsgruppe des Gesundheitsministers erklärte, dass 'es keine klaren Hinweise darauf gibt, dass Uniformen (oder andere Arbeitskleidung) eine signifikante Gefahr bezüglich der Verbreitung von Infektionen darstellen’. Auf welcher Basis machte also der Gesundheitsminister seine Empfehlungen? Die Arbeitsgruppe nahm Zuflucht zu 'sachkundigem gesunden Menschenverstand' - eine Beweislage, die knapp über purem Raten (guesswork) liegt."
Mit den vom neuen britischen Premierminister Gordon Brown geäußerten Vorschlägen einer "Reinigung Station für Station" und einer Erhöhung der Anzahl von Oberschwestern, um die Stationsreinigung zu überwachen und auf das Tragen kurzärmliger Kleidung zu achten, gehen die Editoren ähnlich kritisch ins Gericht: "Die Desinfektion häufig berührter Oberflächen ist viel notwendiger als die Entfernung sichtbaren Schmutzes" und die Oberschwestern "wären sinnvoller eingesetzt, wenn sie sicherstellen würden, dass Ärzte, Schwestern und Besucher ihre Hände richtig waschen, denn das ist eine nachgewiesenermaßen sichere Methode, Krankenhausinfektionen zu stoppen." Er habe sich am "wrong end of the evidence stick" zu schaffen gemacht.
Als deutscher Beobachter der britischen Debatte bleibt dem höchstens noch toppend hinzuzufügen, dass trotz der hierzulande ähnlichen Folgen mangelhafter Krankenhaushygiene vergleichbare politische Akteure bisher lieber ganz die Finger vom Hygiene-"Stick" lassen.
Nach einer notwendigen persönlichen, kostenfreien und folgenfreien (keine Werbeflut) Anmeldung bei "Lancet" findet man hier den kompletten Text des Editorials.
Wer solche Artikel aber partout nicht in Englisch lesen will oder kann, findet über den im Kern kostenfrei bestellbaren aber etwas werblicheren Newsletter von "wissenschaft-online" jede Woche längere deutschsprachige Zusammenfassungen ausgewählter Artikel - mit Links zu den Originalartikeln.
Bernard Braun, 29.9.2007
Keine Studie, sondern harte Wirklichkeit: "Halbgott in Weiß" - aber bitte mit kurzen Ärmeln, ohne Krawatte und Ehering!
 Im britischen Gesundheitssystem steht eine wirkliche Revolution oder der "größte anzunehmende Traditionsbruch (GAT)" bevor: Nachdem das Auftreten des "Methicillin-resistenten Erregers Staphylococcus aureus (MRSA)" nach dem im Juli 2007 erschienenen MRSA-Report der "Health Protection Agency (HPA)" zuletzt im ersten Quartal 2007 um 10 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum geringer geworden ist, sieht die britische Regierung die Chance, diese u.a. durch eine pflichtgemäße Berichterstattung und Veröffentlichung der unerwünschten Krankenhaus-Infektionsraten begonnene Entwicklung, weiter zu fördern. Zugleich nahm aber die Häufigkeit der Infektion mit einem anderen typischen, besonders bei älteren Patienten auftretenden Krankenhaus-Erreger, Clostridium difficile, im selben Zeitraum um 2 % zu.
Im britischen Gesundheitssystem steht eine wirkliche Revolution oder der "größte anzunehmende Traditionsbruch (GAT)" bevor: Nachdem das Auftreten des "Methicillin-resistenten Erregers Staphylococcus aureus (MRSA)" nach dem im Juli 2007 erschienenen MRSA-Report der "Health Protection Agency (HPA)" zuletzt im ersten Quartal 2007 um 10 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum geringer geworden ist, sieht die britische Regierung die Chance, diese u.a. durch eine pflichtgemäße Berichterstattung und Veröffentlichung der unerwünschten Krankenhaus-Infektionsraten begonnene Entwicklung, weiter zu fördern. Zugleich nahm aber die Häufigkeit der Infektion mit einem anderen typischen, besonders bei älteren Patienten auftretenden Krankenhaus-Erreger, Clostridium difficile, im selben Zeitraum um 2 % zu.
Im Mittelpunkt eines Bündels von Maßnahmen gegen diese auch weltweit verbreiteten multiresistenten Erreger steht dabei die Kleidung der Ärzte und Pflegekräfte im Gesundheitswesen, die neben der bereits mehrmals berichteten schlechten Handhygiene ein Infektionsherd erster Ordnung ist.
Der neue "dress code" enthält dann wahrhaft revolutionäre Elemente:
• Alle mit Patienten in Kontakt kommenden Beschäftigte dürfen nur noch Kleidung mit kurzen Ärmeln tragen. Dies gilt auch für Hemden. Erhofft wird damit eine erhöhte Bereitschaft, die dann einfachere Möglichkeit der Handhygiene durchzuführen.
• Offensichtlich ist dann auch noch zusätzlich an den "death of the white coat" (BBC) gedacht.
• Schmuck, Uhren und Krawatten dürfen nicht mehr getragen werden.
• Außerdem sollen künftig durchweg Plastikschürzen als Verschmutzungsschurz zum Einsatz kommen.
Ergänzt werden die Maßnahmen zur Verbesserung der Kleidungshygiene durch einige organisatorische Veränderungen:
• Künftig müssen Oberschwestern ("matrons") viermal im Jahr über ihre Erfahrungen mit Sauberkeit und Hygiene an die Krankenhaus-Leitung berichten. Bisher hatten derartige Erfahrungen und mögliche Problemlösungen nicht das höhere Management erreicht.
• Krankenhaus-Manager haben die gesetzliche Pflicht, Infektionsfälle an die im NHS-System dafür zuständige HPA zu melden.
• Außerdem gibt es neue Richtlinien, wie man Patienten, die mit MRSA oder Clostridium difficile (ein anderer verbreiteter Krankenhauserrreger) infiziert sind, isoliert und betreut werden (z. B. konstante Betreuung einer Infiziertengruppe durch dieselben Pflegekräfte).
Selbst wenn die "Kleider"-Politik der Regierung und des NHS erfolgreich ist, bleibt die Frage, warum es dazu eigentlich erst einer Regierungsvorschrift mit langer Vorbereitungszeit bedurfte? Vor allem, wenn Ärzte und Pflegekräfte immer schon ihren laschen Umgang mit dem Händewaschen u.a. damit begründeten, das scheitere an den widrigen Umständen - darunter den langen Ärmeln!! Die Statistik der HPA wird zeigen, ob diese "Revolution" möglich ist und die erwarteten Wirkungen hat.
Weitere Einzelheiten finden sich in der BBC-News-Health-Meldung "End of traditional doctor’s coat" vom 17.9. 2007.
Wen die gesamte neue Kleidungsvorschrift des "Department of Health" samt einiger interessanter Begründungen und Vermutungen über Patientenerwartungen interessiert, kann sie als 10-seitige PDF-Datei "Uniforms and Workwear. An evidence base fore developing local policy" hier herunterladen.
Wer sich im übrigen intensiver über die britische Gesundheitspolitik informieren will, kann den täglichen Mail-Infodienst von BBC News mit dem Themenschwerpunkt Health über diese Seite bestellen und dann entsprechende Mails auf die Stunde genau nach einer kostenfreien Anmeldung beziehen.
Bernard Braun, 17.9.2007
Memorandum der British Medical Association: Boxen schädigt Ihre Gesundheit und kann tödlich enden
 In einem Memorandum hat die British Medical Association, die Gewerkschaft der britischen Ärzte, jetzt gefordert, das Amateur- und Profi-Boxen und ebenso verwandte Kampfsportarten komplett zu verbieten. Begründet wird diese Forderung mit einem Memorandum, in dem umfangreiche medizinische Erfahrungen und Stellungnahmen zitiert werden, aus denen die gesundheitsschädlichen, bisweilen sogar tödlichen Folgen des Boxens hervorgehen. Der Verband weist darauf hin, dass aktuell nur noch in fünf Staaten der Erde das Boxen gänzlich verboten ist (Norwegen, Island, Kuba, Iran und Nordkorea), während es 15 Jahre zuvor erheblich mehr Staaten waren.
In einem Memorandum hat die British Medical Association, die Gewerkschaft der britischen Ärzte, jetzt gefordert, das Amateur- und Profi-Boxen und ebenso verwandte Kampfsportarten komplett zu verbieten. Begründet wird diese Forderung mit einem Memorandum, in dem umfangreiche medizinische Erfahrungen und Stellungnahmen zitiert werden, aus denen die gesundheitsschädlichen, bisweilen sogar tödlichen Folgen des Boxens hervorgehen. Der Verband weist darauf hin, dass aktuell nur noch in fünf Staaten der Erde das Boxen gänzlich verboten ist (Norwegen, Island, Kuba, Iran und Nordkorea), während es 15 Jahre zuvor erheblich mehr Staaten waren.
Dass das Boxen eine systematische Gesundheitsschädigung mit sich bringt, sieht die BMA durch eine Vielzahl von Befunden belegt. Verwiesen wird etwa auf einen unveröffentlichten Bericht britischer Neurologen aus dem Jahr 1974. Dort waren Erkrankungen von Sportlern dokumentiert, die an einer traumatisch-chronischen Enzephalopathie leiden (einer dauerhaft krankhaften Veränderung des Gehirns). Unter den Sportlern befanden sich: 12 Jockeys, 5 Fußballspieler, 2 Rugby-Spieler, 2 Ringer, 1 Fallschirmspringer und 294 Boxer. Anderen Berichten zufolge sind etwa 80 Prozent aller Profiboxer von Gehirnschädigungen betroffen und stehen unter dem Risiko langfristiger Folgeerkrankungen wie insbesondere Parkinson oder Alzheimer. Zwei besonders prominente ehemalige Profis, die später von solchen Krankheiten ereilt wurden, sind Muhammad Ali und Wilfred Benitez, aber das BMA-Memorandum nennt auch noch eine große Zahl weiterer Namen.
Den Boxsport durch Regeländerungen weniger gesundheitsriskant zu gestalten, etwa durch kürzere Zeitdauer der einzelnen Runden, durch einen auch für Profis obligatorischen Kopfschutz oder zusätzliche, medizinische Experten am Ring hält man für wenig erfolgversprechend. Seit 1990 sind Todesfälle von zumindest 140 Boxern nachgewiesen, die sich aufgrund von Verletzungen im Training oder bei Titelkämpfen ereigneten. Noch häufiger kommt es indes zu nicht-tödlichen Verletzungen. Eine australische Studie hat aufgezeigt, dass es im Jahr 2003 bei insgesamt 427 Kämpfen zu 107 schwerwiegenden Verletzungen kam.
Als einen ersten Schritt auf dem Weg zu einem kompletten gesetzlichen Verbot des Boxsports und anderer Arten des Kampfsports fordert die BAM, dies zumindest für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren zu untersagen. Dem oftmals geäußerten Einwand, Boxen sei eine ausgezeichnete Möglichkeiten, um Aggressionen abzubauen und sich selbst zu disziplinieren, wird entgegengehalten, dass es eine Vielzahl anderer Sportarten wie Schwimmen, Fußball oder Leichtathletik gibt, in denen dasselbe pädagogische Ziel erreicht werden kann, in denen jedoch weniger Risiken einer Gehirnschädigung bestehen.
Was die BMA allerdings nicht sagt: In einer Ellenbogen- und Konkurrenzgesellschaft und in einer Kultur, in der schon Kinder mit Ballerspielen und Rocky-Sprüchen (Ruck-zuck-ist-die-Fresse-dick!) aufwachsen, dürfte es schwer fallen, Schülern oder Auszubildenden klarzumachen, dass sie mit Rückenschwimmen oder 20-km-Gehen in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis großartige Anerkennung finden. Auch Großereignisse der Leichtathletik finden heute vor fast leeren Stadion-Tribünen statt, während fast jeder Titelkampf im Boxen ein Millionenpublikum im Fernsehen findet. Die BMA argumentiert nicht wesentlich anders als Innenpolitiker, die phantasielos und litaneihaft immer wieder Verbote und Strafen zur Korrektur gesellschaftlicher Missstände fordern. Boxen und nicht Synchronschwimmen ist heute die Metapher für gesellschaftliches Vorankommen.
Das Memorandum der BMA mit umfangreichen Materialanhängen zum Download ist hier zu finden: The British Medical Association’s position on boxing
Gerd Marstedt, 5.9.2007
US-Gesundheitswissenschaftler: "Antidepressiva für die gesamte Bevölkerung zur Prävention"
 In ihrer Juni-Ausgabe veröffentlichte die Fachzeitschrift PharmacoEconomics (2007; 25 (6): 511-521) eine Studie mit dem viel sagenden Titel Kosten und Vorzüge direkter Verbraucher-Werbung. Darin kommt der Gesundheitswissenschaftler Adam Block aus Harvard zu dem Ergebnis, der durchschnittliche Lebensqualitätsgewinn für jeden neu mit Antidepressiva behandelten Patienten sei 63 Mal so groß wie die anfallenden Therapiekosten. Der so ermittelte Therapiegewinn auf Seiten der tatsächlich an Depression Erkrankten sei so überwältigend, dass sich die Behandlung einer ganzen Nation selbst dann rechnet, wenn die Behandlung 15 Mal so viele Gesunde wie Depressive erfassen würde und praktisch nur einer von 20 neu mit Antidepressiva behandelten "Patienten" das Medikament wirklich brauchte. Insgesamt sei es gesundheitsökonomisch gerechtfertigt, die gesamte US-Bevölkerung ohne vorherigen Arztkontakt und entsprechende Diagnostik und Rezeptausstellung mit Psychopharmaka zu behandeln.
In ihrer Juni-Ausgabe veröffentlichte die Fachzeitschrift PharmacoEconomics (2007; 25 (6): 511-521) eine Studie mit dem viel sagenden Titel Kosten und Vorzüge direkter Verbraucher-Werbung. Darin kommt der Gesundheitswissenschaftler Adam Block aus Harvard zu dem Ergebnis, der durchschnittliche Lebensqualitätsgewinn für jeden neu mit Antidepressiva behandelten Patienten sei 63 Mal so groß wie die anfallenden Therapiekosten. Der so ermittelte Therapiegewinn auf Seiten der tatsächlich an Depression Erkrankten sei so überwältigend, dass sich die Behandlung einer ganzen Nation selbst dann rechnet, wenn die Behandlung 15 Mal so viele Gesunde wie Depressive erfassen würde und praktisch nur einer von 20 neu mit Antidepressiva behandelten "Patienten" das Medikament wirklich brauchte. Insgesamt sei es gesundheitsökonomisch gerechtfertigt, die gesamte US-Bevölkerung ohne vorherigen Arztkontakt und entsprechende Diagnostik und Rezeptausstellung mit Psychopharmaka zu behandeln.
Die flächendeckende antidepressive Behandlung aller US-Bürger schlüge nach Blocks Berechnungen mit einem Überschuss von 72 Millionen US-$ (58 Mio €) zu Buche und führe damit zu einem unbestreitbaren "Wohlfahrtsgewinn". Diesen Überschuss hat der Professor aus Harvard an Hand so genannter qualitäts-adjustierter Lebensjahre (QALY's) ermittelt, die auf einer recht willkürlichen Umrechnung von Krankheiten und Behinderungen in kalkulierbare Kosten basieren Damit sieht der Autor die Einwände gegen Laienwerbung für verschreibungspflichtige Medikamente entkräftet, die bisher nur in den USA und Neuseeland zulässig ist und dort zu einem rasanten Anstieg der Arzneimittelausgaben geführt hat.
Das Ganze hat nur einen kleinen Haken: In der abschließenden Diskussion seines Beitrags gesteht Block, sein Ergebnis würde vermutlich völlig anders ausfallen, wenn er die unerwünschten Erscheinungen von Antidepressiva berücksichtigt hätte. Die hatte er nämlich in seinem Kalkül schlichtweg unter den Tisch fallen lassen. Dabei gehören Psychopharmaka zu den meist gefürchteten Medikamenten mit erheblichen "Neben"-Wirkungen. Sie verursachen nicht nur selber Kopfschmerzen, Verwirrtheit, Magen-Darm-Probleme oder sexuelle Dysfunktionen. Weitaus problematischer sind die häufigen Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln, deren Wirkung sie wahlweise verstärken oder abschwächen können.
Passend zur meist schlichten Modellwelt der Ökonomie blendet Block, der Professor an einer der auch von deutschen Politikern so gerne erwähnten Elite-Universitäten ist, auch alle weiteren externen Effekte aus. So berücksichtigt er weder ökonomische oder ökologische Zusatzkosten erhöhter Tablettenproduktion für ein 320-Millionenvolk noch die Konsequenzen für den anfallenden Massentransport. Schleierhaft bleibt zudem, ob schon jeder Säugling als Psychopharmaka-Verbraucher mitgezählt ist. Ganz zu schweigen von den direkten und indirekten Kosten der zu erwartenden unerwünschten Wirkungen, die durch den Verlust an QALY's, zusätzliche Arztkontakte und Krankenhausaufenthalte sowie erhöhtem Medikamentenverbrauch bei allen Präparaten ebenfalls erhebliche volkswirtschaftliche Kosten erwarten lassen. Einen Einblick in die komplexe Welt der Antidepressiva-induzierten Wechselwirkungen vermittelt ein im Internet frei zugängliches Vorlesungskript von Josef Donnerer am Institut für Experimentelle und Klinische Pharmakologie der Universität Graz.
Einen Überblick über die Prävalenz und Bedeutung von depressiven Erkrankungen, die therapeutischen Möglichkeiten und häufige unerwünschte Wirkungen von Antidepressiva vermittelt der frei zugängliche Beitrag von Vincenza Snow, Steven Lascher und Christel Mottur-Pilson im Auftrag des American College of Physicians - American Society of Internal Medicine verfasste Beitrag Pharmacologic Treatment of Acute Major Depression and Dysthymia: Clinical Guideline, Part 1 (Annals of Internal Medicine 2000; 132 (9), S. 738-742). Die wichtigsten Leitlinien fasst der Beitrag von John Williams, Cynthia Mulrow, Elaine Chiquette, Polly Hitchcock, Christine Aguilar und John Cornell A Systematic Review of Newer Pharmacotherapies for Depression in Adults: Evidence Report Summary: Clinical Guideline, Part 2 zusammen (Ann Int Med 2000; 132 (9), S. 743-756).
Das Thema der Laienbewerbung verschreibungspflichtiger Medikamente kommt auch in der EU in den letzten Jahren verstärkt auf die Tagesordnung. Neben deutlich steigenden Medikamentenausgaben zeigen gesundheitswissenschaftliche Studien über Folgen allgemein zugänglicher Werbung für Arzneimittel in den USA vor allem zwei Tendenzen. Die Studie Promotion of Prescription Drugs to Consumers von Meredith Rosenthal, Ernst Berndt, Julie Donohue, Richard Frank und Arnold Epstein im N Engl J Med 2002; 346 (7), S. 498-505 diagnostiziert neue Herausforderungen an Ärzte, die ihren Patienten beistehen müssen, die Informationen und Behauptungen aus der Laienwerbung richtig einzuordnen. Frei zugänglich ist nur das Abstract des Artikels aus dem New England Journal of Medicine.
Richard Kravitz, Ronald Epstein, Mitchell Feldman, Carol Franz, Rahman Azari, Michael Wilkes, Ladson Hinton und Peter Franks bestätigen diesen Befund in ihrem Artikel Influence of Patients' Requests for Direct-to-Consumer Advertised Antidepressants: A Randomized Controlled Trial im JAMA 2005; 293 (16), S. 1995-2002 und weisen auf widersprüchliche Effekte von direkter Verbraucherwerbung hin: Zwar könnten sie Unterversorgung vermeiden helfen, aber gleichzeitig beflügeln die sie Überversorgung. Kostenfrei stehet ebenfalls nur das Abstract des JAMA-Artikels zur Verfügung.
Die Kalkulationsstudie über flächendeckenden Einsatz von Antidepressiva zeigt nicht zuletzt vor dem Hintergrund vorliegender sozial- und gesundheitswissenschaftlicher Erkenntnisse eindrücklich, welchen Unsinn auch renommierte Universitäten verzapfen, auf die deutsche Bildungspolitiker so gerne verweisen. Und sie wirft ein schräges Licht auf die Seriosität ökonomischer Fachzeitschriften, die wie die Pilze aus dem Boden schießen und ihre politischen Intentionen kaum verbergen. Kostenfrei ist nur das Abstract der Studie aus der Juni-Ausgabe von Pharmacoeconomics herunterzuladen. Eine Glosse zur Studie und zur zunehmenden Stromlinienform von Fachpublikationen liefert die tageszeitung in ihrer Ausgabe vom 13.7.2007.
Hier finden sie einen Hintergrundartikel zu der Untersuchung aus Harvard aus der Ausgabe vom 9. August 2007 der Zürcher WochenZeitung
Jens Holst, 11.7.2007
Profi-Fussball: Frühere Verletzungen erhöhen das Risiko von Folgeschäden um das Dreifache
 Profi-Fußballer, die sich in einer Spielsaison eine Verletzung zuzogen, weisen auch nach dem Auskurieren der gesundheitlichen Schäden in der folgenden Saison ein fast dreimal so hohes Risiko auf, sich wieder zu verletzen wie Spieler, die die vorherige Spielzeit unbeschadet überstanden. Dies ist das zentrale Ergebnis einer schwedischen Doktorarbeit, in der die gesundheitlichen Risiken des Fußballs anhand von Daten aus der dänischen und schwedischen Profiliga über mehrere Spielzeiten hinweg analysiert wurden. Die Dissertation von Martin Hägglund an der schwedischen Universität Linköping bezog darüber hinaus aber auch Statistiken von Amateurfußballern und weiblichen Spielerinnen ein und untersuchte auch, ob bestimmte Rehabilitationsprogramme dazu geeignet sind, spätere Verletzungsrisiken zu reduzieren. Tatsächlich zeigte sich bei Kickern aus dem Amateurlager, dass das Risiko einer erneuten Verletzung um 75 Prozent niedriger lag, wenn die betroffenen Spieler an einem kontrollierten Rehabilitationsprogramm teilnahmen.
Profi-Fußballer, die sich in einer Spielsaison eine Verletzung zuzogen, weisen auch nach dem Auskurieren der gesundheitlichen Schäden in der folgenden Saison ein fast dreimal so hohes Risiko auf, sich wieder zu verletzen wie Spieler, die die vorherige Spielzeit unbeschadet überstanden. Dies ist das zentrale Ergebnis einer schwedischen Doktorarbeit, in der die gesundheitlichen Risiken des Fußballs anhand von Daten aus der dänischen und schwedischen Profiliga über mehrere Spielzeiten hinweg analysiert wurden. Die Dissertation von Martin Hägglund an der schwedischen Universität Linköping bezog darüber hinaus aber auch Statistiken von Amateurfußballern und weiblichen Spielerinnen ein und untersuchte auch, ob bestimmte Rehabilitationsprogramme dazu geeignet sind, spätere Verletzungsrisiken zu reduzieren. Tatsächlich zeigte sich bei Kickern aus dem Amateurlager, dass das Risiko einer erneuten Verletzung um 75 Prozent niedriger lag, wenn die betroffenen Spieler an einem kontrollierten Rehabilitationsprogramm teilnahmen.
Weitere Ergebnisse der Studie waren:
• Zwischen den Jahren 1982 und 2001 erhöhte sich das Trainingspensum in der ersten schwedischen Fußball-Liga um knapp 70 Prozent, ein deutlicher Hinweis darauf, dass die früheren Halbprofis jetzt durchweg Vollprofis sind. Überraschender Weise hat sich im gleichen Zeitraum trotz erhöhter körperlicher Beanspruchung die Quote der Verletzungen jedoch nur sehr geringfügig erhöht, was wohl durch eine bessere medizinische Betreuung zu erklären ist. Die Zahl der Verletzungen pro 1.000 Trainingsstunden stieg lediglich von 4,6 auf 5,2 an.
• Im Vergleich der ersten Liga aus Dänemark und Schweden zeigt sich, dass das Verletzungsrisiko dänischer Profis doppelt so groß ist wie das der Schweden (12 bzw. 6 Verletzungen pro 1.000 Stunden, 1,8 bzw. 0,7 schwere Verletzungen pro 1.000 Stunden). Der Autor vermutet, dass dies durch sportmedizinisch ungünstigere Trainingsmethoden in Dänemark verursacht sein könnte.
• Schwedische Profis, die sich in der Saison 2001 bestimmte Verletzungen zuzogen (Achillessehne, Leistengegend, Knieverletzung), hatten in der nachfolgenden Saison 2-3mal so häufig wie unverletzte Spieler erneut einen Schaden an denselben Körperpartien. Für Verstauchungen am Fußknöchel konnte dieses erhöhte Risiko allerdings nicht gefunden werden.
• Das Risiko einer Verletzung ist bei Profis deutlich höher als bei Amateuren. Nimmt man einen Kader von 20 Spielern, so beträgt die durchschnittliche Zahl der Verletzungen pro 1.000 Trainingsstunden bei männlichen Profis der Ersten Liga 45 (davon 4-5 schwere Fälle), bei weiblichen Profis 25 (3) und bei männlichen Amateuren 11 (2-3).
• Die Wirksamkeit eines vom Trainer kontrollierten Rehabilitations-Programms mit speziellen Übungen und Trainingseinheiten zeigte bei Amateuren, dass dadurch das Risiko einer erneuten Verletzung mit derselben Diagnose um etwa 75% gesenkt werden kann.
• Hier ist eine Pressemitteilung der Universität Linköping mit den wichtigsten Ergebnissen
• Die Studie im Volltext: Martin Hägglund: Epidemiology and prevention of football injuries
Gerd Marstedt, 19.3.2007
"Zehen statt Pillen!?" - Von falschen Erwartungen an den "guten Knoblauch"
 Es gibt Lebensmittel und natürliche Stoffe, deren gesundheitsfördernde Wirkung unumstößlich erscheint, bestätigt durch die jahrhundertelange Nutzung bei "gesunden" Naturvölkern oder eben eine geschickte Werbung industrieller Hersteller. Dies führt im Falle der Vitaminpillen dazu, dass in Nordamerika und Europa 80 bis 160 Millionen Menschen regelmäßig Vitamine einnehmen, und dies oft weit über dem natürlich erreichbaren Level. Auch der in den letzten Jahren und Jahrzehnten in Mitteleuropa steil angestiegene Konsum von natürlichen Knoblauchzehen und in Kapseln abgefüllten Knoblauchextrakten ist maßgeblich mit gesundheitlichen Erwartungen verbunden und gefördert.
Es gibt Lebensmittel und natürliche Stoffe, deren gesundheitsfördernde Wirkung unumstößlich erscheint, bestätigt durch die jahrhundertelange Nutzung bei "gesunden" Naturvölkern oder eben eine geschickte Werbung industrieller Hersteller. Dies führt im Falle der Vitaminpillen dazu, dass in Nordamerika und Europa 80 bis 160 Millionen Menschen regelmäßig Vitamine einnehmen, und dies oft weit über dem natürlich erreichbaren Level. Auch der in den letzten Jahren und Jahrzehnten in Mitteleuropa steil angestiegene Konsum von natürlichen Knoblauchzehen und in Kapseln abgefüllten Knoblauchextrakten ist maßgeblich mit gesundheitlichen Erwartungen verbunden und gefördert.
Fast gleichzeitig ist die antioxidative Wirkung von Betakarotin und Vitaminen aber auch die angeblich den Cholesterinspiegel absenkende Wirkung des Knoblauchs in randomisierten und kontrollierten Studien oder in Reviews und Meta-Analysen solcher Studien widerlegt oder erheblich eingeschränkt worden. Über die Vitaminstudie berichteten wir heute in einer anderen Meldung.
Bei der randomisierten klinischen Studie in deren Mittelpunkt der Verzehr von Knoblauch stand, ging man von der verbreiteten Hoffnung aus, dass es mit Knoblauch möglich wäre, einen mäßig erhöhten Cholesterolspiegel im Blut (Low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C) Konzentration von 130 bis 190 mg/dL) "natürlich" senken zu können. 200 Studienteilnehmer mussten an 6 Tagen pro Woche und über 6 Monate entweder 4 Gramm rohen Knoblauch, zwei industrielle Knoblauchprodukte mit vergleichbarer Wirkstoffmenge oder ein Placebo zu sich nehmen.
Keiner der verabreichten Stoffe "had neither a statistically detectable effect nor a clinically relevant effect on plasma lipid concentrations", fassten die Forscher das Ergebnis zusammen.
Die Herausgeber der Zeitschrift "Archives of Internal Medicine" in deren aktueller Ausgabe der Aufsatz über diese Studie erschienen ist, betonen zwar, dass das Ergebnis nicht bedeutet, dass Knoblauch aufgrund bestimmter bioaktiver Inhaltsstoffe nicht z.B. bei der Prävention Herzerkrankungen hilfreich sein könnte. Trotzdem weist die veröffentlichte Studie erneut auf die Notwendigkeit hin, auch per se "gesunde Naturmittel" kritisch zu überprüfen als blind an ihre positive Wirkung zu glauben.
kritischer Überprüfung statt blindem Glauben
Hier können Sie die 8-seitige PDF-Datei des Aufsatzes "Effect of Raw Garlic vs Commercial Garlic Supplements on Plasma Lipid Concentrations in Adults With Moderate Hypercholesterolemia" von Gardner et al. in der Zeitschrift "Archives of Internal Medicine" (Arch Intern Med. 2007;167:346-353) herunterladen.
Bernard Braun, 1.3.2007
Training für Ältere zur Aufrechterhaltung der geistigen Fitness: Sudoku hilft besser als Memory
 Wer seine intellektuelle Fitness und geistige Frische auch im hohen Lebensalter aufrecht erhalten möchte, der sollte von seinem Gehirn auch kontinuierlich Leistungen abfordern. Eine US-Studie hat jetzt gezeigt, dass bestimmte Übungen tatsächlich dazu geeignet sind, das altersbedingte Nachlassen von Gehirn-Leistungen zu verhindern oder zumindest einzuschränken. Am besten hierzu geeignet sind Denksport-Übungen und ein Training in analytischem Denken, so wie es bei Aufgaben zum Vervollständigen von Zahlenreihen vorkommt oder derzeit noch populärer: bei Sudoku-Rätseln. Im Vergleich dazu schneiden Übungen, die das Gedächtnis und das Erinnerungsvermögen trainieren (wie bei Memory-Spielen) deutlich schlechter ab.
Wer seine intellektuelle Fitness und geistige Frische auch im hohen Lebensalter aufrecht erhalten möchte, der sollte von seinem Gehirn auch kontinuierlich Leistungen abfordern. Eine US-Studie hat jetzt gezeigt, dass bestimmte Übungen tatsächlich dazu geeignet sind, das altersbedingte Nachlassen von Gehirn-Leistungen zu verhindern oder zumindest einzuschränken. Am besten hierzu geeignet sind Denksport-Übungen und ein Training in analytischem Denken, so wie es bei Aufgaben zum Vervollständigen von Zahlenreihen vorkommt oder derzeit noch populärer: bei Sudoku-Rätseln. Im Vergleich dazu schneiden Übungen, die das Gedächtnis und das Erinnerungsvermögen trainieren (wie bei Memory-Spielen) deutlich schlechter ab.
Die US-Wissenschaftler hatten eine Freiwilligen-Stichprobe von 2.800 Älteren (Durchschnittsalter 74 Jahre), die aber geistig noch voll auf der Höhe waren, in vier Gruppen aufgeteilt. In einer Kontrollgruppe wurde nichts unternommen. In den übrigen Gruppen wurden drei verschiedenen Arten kognitiven Trainings durchgeführt:
• Ein Gedächtnistraining, bei dem Wörterlisten oder Texte vorgegeben wurden, die man sich merken sollte
• Ein Training in analytischem Denken, bei dem Zahlenreigen oder Ähnliches nach logischen Abfolgen überprüft und vervollständigt werden mussten
• Ein Training zum Erkennen von Objekten, die auf einem PC-Monitor gezeigt und möglichst schnell benannt werden sollten.
Die Gruppen wurden über fünf Jahre hinweg beobachtet. Zur Messung des Effekts der Übungen wurde die sogenannte "IADL-Skala" (Instrumental Activities of Daily Living, etwa: Praktische Aktivitäten des täglichen Lebens) eingesetzt, bei der acht verschiedene Alltagsfähigkeiten auf einer vierstufigen Skala bewertet werden. Dazu gehören unter anderem "Benutzt Telefon aus eigener Initiative" (bzw.: Wählt einige bekannte Nummern, Nimmt ab - wählt aber nicht selbständig, Benutzt das Telefon gar nicht mehr), Kauft selbständig die meisten Dinge ein, Plant und kocht die nötigen Mahlzeiten selbständig , Wäscht sämtliche eigene Wäsche, Benutzt unabhängig öffentliche Verkehrsmittel oder eigenes Auto, Nimmt Medikamente selbständig zur richtigen Zeit in richtiger Dosierung.
Als Ergebnisse der Studie zeigte sich nach fünf Jahren:
• Teilnehmer, die zusätzliche Trainingseinheiten auch noch nach 11 und 35 Monaten durchführten, zeigten deutlich bessere Ergebnisse hinsichtlich ihrer Alltags-Fähigkeiten als solche, welche nur die zehn Trainingsübungen zu Beginn der Studie absolvierten.
• Die Gruppe mit dem Training in analytisch-logischem Denken zeigte dreimal bessere Resultate im Alltag als die Kontrollgruppe, in der keine Übungen stattfanden
• Für die beiden Gruppen mit Gedächtnis- bzw. Erkennungs-Training konnten keine statistisch abgesicherten Effekte hinsichtlich des Zurechtkommens im Alltag festgestellt werden.
• Betrachtet man nicht die mit der IADL-Skala erfassten Alltagskompetenzen, sondern die spezifischen Leistungen, die auch in den jeweiligen Übungen trainiert wurden, so zeigt sich allerdings für alle Gruppen, dass hinsichtlich dieser ganz spezifischen einzelnen Kompetenzen Trainingseffekte und bessere Werte im Vergleich zur Kontrollgruppe auch noch nach fünf Jahren nachweisbar sind.
Ein Abstract der Studie ist hier nachzulesen: Long-term Effects of Cognitive Training on Everyday Functional Outcomes in Older Adults (JAMA Vol. 296 No. 23, December 20, 2006)
Gerd Marstedt, 11.2.2007
Sexualerziehung in Europa - Auch in Deutschland herrscht noch Nachholbedarf
 Eine eingehende und wissenschaftlich fundierte Aufklärung Jugendlicher über die Verhütung von Krankheiten und von unerwünschten Schwangerschaften hilft dabei, verantwortungsbewusste Entscheidungen zu treffen und ihre Gesundheit zu schützen. Die These, dass dies zu einem früheren Beginn sexueller Aktivität führt, lässt sich nicht bestätigen. Dies ist das Fazit einer international vergleichenden Studie zur Praxis der Sexualerziehung in der Europäischen Region.
Eine eingehende und wissenschaftlich fundierte Aufklärung Jugendlicher über die Verhütung von Krankheiten und von unerwünschten Schwangerschaften hilft dabei, verantwortungsbewusste Entscheidungen zu treffen und ihre Gesundheit zu schützen. Die These, dass dies zu einem früheren Beginn sexueller Aktivität führt, lässt sich nicht bestätigen. Dies ist das Fazit einer international vergleichenden Studie zur Praxis der Sexualerziehung in der Europäischen Region.
Die erhobenen Daten zeigen deutlich, dass eine umfassende Akzeptanz von Sexualerziehung bei allen Bevölkerungsgruppen nur in wenigen Ländern zu finden ist und dass die jeweiligen politischen Rahmenbedingungen dabei immer noch eine erhebliche Rolle spielen. So findet Sexualerziehung in Ländern wie Dänemark und den Niederlanden allgemeine Akzeptanz und Unterstützung, während in Ländern wie Tschechien, Deutschland, Irland und Polen teilweise heftiger Widerstand herrscht.
Religiöse Gemeinschaften spielen mittlerweile bei der sexuellen Aufklärung von Jugendlichen eine immer wichtigere Rolle. Auch Massenmedien kommt eine bedeutende Rolle bei der Sexualaufklärung zu. Ihre Sichtweise unterscheidet sich von Land zu Land erheblich. So leisten insbesondere in den skandinavischen Ländern die Medien insgesamt eine wichtige Unterstützungs- und Informationsarbeit. In Dänemark etwa haben nationale Rundfunkanstalten kostenlose Sendezeit für Programme zur Sexualaufklärung zur Verfügung gestellt. In anderen Ländern wie dem Vereinigten Königreich werden sexuelle Themen eher reißerisch ausgebeutet - mit negativen Auswirkungen für die Sexualaufklärung. Sexuelle Aufklärung hilft jungen Menschen auch dabei, Wertvorstellungen und Fähigkeiten zu entwickeln, die sie bei ihrem Sexualverhalten die richtigen Entscheidungen treffen lassen. Selbstachtung und Achtung für andere, wohlüberlegte Entscheidungen in Bezug auf das eigene Sexualverhalten und der Erwerb von emotionaler Intelligenz sind die wichtigsten Ergebnisse dieses Lernprozesses.
Die Studie informiert in vergleichenden Tabellen über wichtige "Input"- und "Output"-Indikatoren in den europäischen Ländern (u.a. nationale AIDS-Kampagnen, schulischer Sexualunterricht, Schwangerschaften, Abtreibungen, AIDS-Prävalenz bei 15-19jährigen) und bietet auch Darstellungen der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und Maßnahmen in den einbezogenen 26 Ländern. Verantwortlich für die Studie sind das Europäische Netzwerk des Internationalen Verbands für Familienplanung (IPPF) in Zusammenarbeit mit der Universität Lund (Schweden) und dem WHO-Regionalbüro für Europa mit finanzieller Unterstützung der Europäischen Kommission.
Die (englische) Broschüre (PDF, 98 Seiten) ist hier zu finden:
Sexuality education in Europe - A reference guide to policies and practices
Gerd Marstedt, 6.1.2007
Mundgesundheit 1997-2005: Besser, schlechter und soziale Schieflage
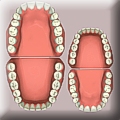 Im Auftrag der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung und der Bundeszahnärztekammer wurden im Jahr 2005 4.631 Deutsche aus vier Altersgruppen zum Zustand ihrer Zähne befragt und zahnmedizinisch untersucht.
Im Auftrag der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung und der Bundeszahnärztekammer wurden im Jahr 2005 4.631 Deutsche aus vier Altersgruppen zum Zustand ihrer Zähne befragt und zahnmedizinisch untersucht.
Diese bereits "Vierte Deutsche Mundgesundheitsstudie (DMS IV)" ergänzt damit den methodisch ähnlich vorgehenden Bundesgesundheitssurvey für einen manchmal vernachlässigten Gesundheitsbereich.
Die Ergebnisse der Studie zeigen Licht- wie Schattenseiten der Zahn- und Mundgesundheit:
• Die Karies ist in Deutschland dank intensiver Prophylaxe weiter auf dem Rückzug. 12-Jährige haben heute im Schnitt nur 0,7 kariöse, gefüllte oder wegen Karies fehlende Zähne. 1997 lag der Wert noch bei 1,7. Deutschland hat sich damit eine internationale Spitzenposition bei der Mundgesundheit von Kindern erobert.
• Auch bei Erwachsenen und Senioren sind Zahnverluste deutlich rückläufig.
• Parodontalerkrankungen, also chronisch-entzündliche Erkrankungen von Zahnfleisch und Kieferknochen, nehmen aber zu, was eine paradoxe Folge des längeren Erhalts des natürlichen Gebisses ist.
• Auch bei der Kariesbekämpfung gibt es aber eine sogar noch zunehmende soziale Ungleichheit: 1997 waren 61 Prozent aller Karieserkrankungen auf 22 Prozent der Kinder aus sozial schwachen Familien verteilt. 2005 konzentrierte sich dieselbe Karieslast auf nur noch 10,2 Prozent dieser Kindergruppe.
• Auch Erwachsene mit niedrigem Bildungsstatus erkranken fast 2,5-mal so häufig an einer schweren Paradontitis wie solche mit hohem Bildungsstatus.
Eine Kurzfassung der Studie steht hier zum Download bereit: Vierte Deutsche Mundgesundheitsstudie (DMS IV)
Bernard Braun, 21.11.2006
Musizieren kann der Gesundheit schaden
 Aktives Musizieren gilt als Hobby, das die Persönlichkeit, Kreativität und soziale Fähigkeiten stärkt, Musiker als Beruf, in dem man persönlichen Neigungen und Leidenschaften umfassend nachgehen darf. Dass viele Freizeit- wie Berufsmusiker jedoch trotz eines jungen Lebensalters schon erhebliche gesundheitliche Beeinträchtigungen zeigen, hat jetzt eine von der GEK (Gmünder Ersatzkasse) in Auftrag gegebene Studie gezeigt. Befragt wurden insgesamt 705 Musiker und Musikschüler im Alter von 16-25 Jahren, die sich entweder noch in einer musikalischen Ausbildung befinden oder bereits als Berufsmusiker in Sinfonieorchestern tätig sind. Damit wurde erstmals in einer Studie mit internationaler Beteiligung von Musikern (u.a. aus Deutschland, Finnland, Slowenien, Niederlande) der Frage nach Berufsperspektiven, Belastungen und Gesundheit junger Musiker nachgegangen.
Aktives Musizieren gilt als Hobby, das die Persönlichkeit, Kreativität und soziale Fähigkeiten stärkt, Musiker als Beruf, in dem man persönlichen Neigungen und Leidenschaften umfassend nachgehen darf. Dass viele Freizeit- wie Berufsmusiker jedoch trotz eines jungen Lebensalters schon erhebliche gesundheitliche Beeinträchtigungen zeigen, hat jetzt eine von der GEK (Gmünder Ersatzkasse) in Auftrag gegebene Studie gezeigt. Befragt wurden insgesamt 705 Musiker und Musikschüler im Alter von 16-25 Jahren, die sich entweder noch in einer musikalischen Ausbildung befinden oder bereits als Berufsmusiker in Sinfonieorchestern tätig sind. Damit wurde erstmals in einer Studie mit internationaler Beteiligung von Musikern (u.a. aus Deutschland, Finnland, Slowenien, Niederlande) der Frage nach Berufsperspektiven, Belastungen und Gesundheit junger Musiker nachgegangen.
Deutlich wurde dabei, dass junge Musiker und Musikschüler im Vergleich zu einer repräsentativen gleichaltrigen Bevölkerungsstichprobe erheblich öfter über Gesundheitsbeschwerden und Schmerzen klagen. So finden sich Nackenschmerzen, Schmerzen an den Schultern, in den Fingern, an Unter- und Oberarm bei Musikern zwei-, drei- oder sogar viermal so oft wie bei jüngeren Schülern, Studenten oder Erwerbstätigen in der Bevölkerung. Gerade diese Körperpartien jedoch sind es, so bilanzieren die Autoren der Studie, die zum Musizieren besonders häufig und intensiv beansprucht werden.
Ein zweites Ergebnis hat die Wissenschaftler vom Zentrum für Sozialpolitik der Universität Bremen und von der Deutschen Gesellschaft für Musikphysiologie und Musikermedizin in Berlin zumindest genau so stark verblüfft. Obwohl Musiker und Musikschüler deutlich häufiger von Schmerzen betroffen sind und auch häufiger als im Bevölkerungsdurchschnitt über Beeinträchtigungen des Wohlbefindens berichten (Schlafstörungen, innere Unruhe, Magenbeschwerden usw.), bewerten sie ihren Gesundheitszustand insgesamt deutlich besser, sagen also öfter, dass sie sich gesund und fit. Fühlen. Damit ist ein Defizit in der Risikowahrnehmung der Gesundheitsbeeinträchtigungen bei Musikern zu verzeichnen: Beschwerden, die sich aus dem Musizieren ergeben, werden bagatellisiert oder verdrängt und werden nicht konsequent in ein individuelles Gesundheitskonzept integriert. Offensichtlich steht dahinter die Furcht, dass die Schmerzen eine zukünftige musikalische Betätigung in Frage stellen könnten.
Die Wissenschaftler fanden jedoch auch heraus, dass gesundheitliche Beeinträchtigungen keineswegs eine zwangsläufige Folge häufigen Übens und Musizierens sind. Als sie überprüften, welche Teilnehmer der Befragung "kerngesund" sind, besonders wenig oder keine Beeinträchtigungen aufweisen, so fand sich ein überraschendes Ergebnis: Diese Gruppe ist von der eigenen musikalischen Leistung und Begabung voll überzeugt, hat bereits auf der Karriereleiter einige Stufen erfolgreich bewältigt, ist von äußeren Erwartungen wenig beeindruckt und schätzt seine Zukunftsaussichten überaus positiv ein. Er bzw. sie ist überaus "selbstbewusst", weist hohe soziale Kompetenzen auf, und auch das Gesundheitsverhalten "kerngesunder" Musiker ist in medizinischer Hinsicht vorbildlich: Sie treiben häufig Sport oder körperlich anstrengende Tätigkeiten, sind Nichtraucher, essen viel Obst und finden ausreichend Schlaf. Den höchsten Anteil "Kerngesunder" fand man bei einer hohen Selbsteinstufung der musikalischen Talente und Leistungen und zugleich einem gesundheitsbewussten Alltagsverhalten.
Gesundheitsbeschwerden sind also trotz intensiver Beanspruchung von Muskeln und Sehnen durchaus vermeidbar. Ein besonders wirksames Regulativ scheint in diesem Zusammenhang die Ausübung von Sport zu sein. Wer regelmäßig Sport betreibt, ist entweder von seiner Persönlichkeitsstruktur her weniger stressanfällig oder aber er erreicht durch die körperliche Aktivität einen Abbau von Stress.
Ein Problem erkennen die Wissenschaftler allerdings darin, dass präventive Maßnahmen, (wie etwa Entspannungsverfahren) oftmals erst dann zum Einsatz zu kommen, wenn sich bereits negative Gesundheitsfolgen eingestellt haben. Im Hinblick auf solche Stressbewältigungs- und Entspannungstechniken artikulieren Musiker und Musikerschüler einerseits zwar große Informations- und Wissensdefizite. Gleichzeitig sind aber Vorurteile und emotionale Vorbehalte eher gering, die Wirksamkeit der Techniken wird sehr hoch eingeschätzt, und das Interesse an mehr Informationen auch als Bestandteil des Musikunterrichts ist groß.
Die Ergebnisse sind auch insofern von Bedeutung, als junge Musiker keine quantitativ so unbedeutende Berufsgruppe sind wie man vermuten könnte: In Deutschland sind derzeit etwa 11.500 Berufsmusiker in Sinfonie- und Theaterorchestern tätig, weitere 35.700 in Musikschulen. In den Musikstudiengängen sind etwa 25.500 Studenten eingeschrieben und an den staatlichen Musikschulen nahezu 1 Mio. Schülerinnen und Schüler angemeldet.
Auch ein in der Bevölkerung verbreitetes Vorurteil über Musiker konnte durch Befragung widerlegt werden: Das bisweilen kolportierte Klischee des musikbesessenen, nur mit seinem Instrument "verheirateten" Musikers ist falsch. Ganz im Gegenteil: Ehrgeizige, übungsfleißige und engagierte junge Musiker zeichnen sich aus durch häufige soziale Kontakte und Freizeitaktivitäten mit Freunden und Bekannten. Insgesamt zeigt sich, dass Musiker und Musikschüler hinsichtlich ihrer Probleme und Wertorientierungen, von Ausnahmen abgesehen, kaum von "Normalbürgern" ihres Alters abweichen.
Die gesamte Studie (Hrsg.: GEK, Gmünder ErsatzKasse; Autoren: Walter Samsel, Gerd Marstedt, Helmut Möller, Rainer Müller) kann hier als PDF-Datei heruntergeladen werden:
Musiker-Gesundheit - Ergebnisse einer Befragung junger Musiker über Berufsperspektiven, Belastungen und Gesundheit
Verfügbar ist auch eine Kurzfassung
Gerd Marstedt, 14.3.2006
Ärzteumfrage des Gesundheitsmonitor zeigt: Ärzte sind präventiv kaum tätig
 Im Rahmen des Gesundheitsmonitors hat die Bertelsmann Stiftung sowohl die Bevölkerung als auch niedergelassene Haus- und Fachärzte nach ihren Einstellungen und Verhaltensweisen zum Thema Prävention befragt. Wichtige Ergebnisse dieser Datenanalysen sind jetzt im Newsletter Nr.1/2006 zum Gesundheitsmonitor veröffentlicht worden.
Im Rahmen des Gesundheitsmonitors hat die Bertelsmann Stiftung sowohl die Bevölkerung als auch niedergelassene Haus- und Fachärzte nach ihren Einstellungen und Verhaltensweisen zum Thema Prävention befragt. Wichtige Ergebnisse dieser Datenanalysen sind jetzt im Newsletter Nr.1/2006 zum Gesundheitsmonitor veröffentlicht worden.
Einige zentrale Befunde:
• Drei Viertel der Ärzte sprechen sich für eine Stärkung der Prävention im deutschen Gesundheitswesen aus. 40 Prozent von ihnen geben an, dass sie ihren Patienten selbst Beratungen, Schulungen und Kurse zur Primärprävention und Gesundheitsförderung anbieten.
- Insgesamt schreiben Ärzte verhaltensbezogenen Maßnahmen bei der Verhütung von Krankheiten eine höhere Bedeutung zu als medikamentösen Therapien. Dies zeigt sich am Beispiel von Herz- Kreislauf-Erkrankungen. Hier erachten die Ärzte alle verhaltenspräventiven Interventionen (wie Verringerung des Tabakkonsums, Abnehmen, mehr Bewegung, Ernährungsumstellung) zur Krankheitsvorbeugung für wirksamer als die Einnahme von Arzneimitteln (etwa Blutdruck- und Blutfettsenker).
• Vier von fünf Ärzten geben an, dass sie nicht mehr als 10 Prozent ihrer Arbeitszeit für Primärprävention nutzen. Bei den Fachärzten entfallen durchschnittlich 8,5 Prozent der Arbeitszeit auf primärpräventive Maßnahmen.
• Nach Meinung der Ärzte wären vor allem eine bessere Vergütung präventiver Leistungen und mehr verfügbare Zeit geeignete Anreize, damit sich Mediziner stärker um die Vorbeugung von Krankheiten kümmern. Ein Fünftel der Ärzte meint jedoch, schon jetzt ausreichend viel für die Prävention zu tun. Eine bessere Fortbildung halten nur noch 17 Prozent der Leistungserbringer für eine geeignete Maßnahme. 15 Prozent schließlich geben an, sie bräuchten mehr wissenschaftliche Nachweise über den Nutzen von Prävention.
Mehr Detailinformationen und auch die Ergebnisse der Patientenbefragung zur Prävention sind hier abrufbar: Gesundheitsmonitor Newsletter Nr.1/2006 zum Thema "Prävention"
Gerd Marstedt, 7.2.2006
Aids-Prävention - eine Innovation in der Krise
 Safer Sex ist zumindest in der nach wie vor hauptsächlich von der Epidemie AIDS betroffenen Gruppe der schwulen Männer zur sozialen Norm geworden, mit Befolgungsraten von 80 und mehr Prozent. Bei den i. v. Drogenbenutzern liegt der Erfolg in ähnlicher Größenordnung. Die zielgruppenbezogene und selbst organisierte Primärprävention der HIV-Infektion ist mittlerweile zum Pilotfall der erfolgreichen Umsetzung eines modernen, gesundheitswissenschaftlich fundierten Präventionskonzepts geworden. Es hat sich als möglich erwiesen, durch öffentlich vermitteltes Lernen Verhalten in den Lebensbereichen der Sexualität und des Drogengebrauchs zu verändern, also in Bereichen wirksam zu sein, die weithin von Tabus und von Scham gekennzeichnet sind und zum Teil in der Illegalität liegen.
Safer Sex ist zumindest in der nach wie vor hauptsächlich von der Epidemie AIDS betroffenen Gruppe der schwulen Männer zur sozialen Norm geworden, mit Befolgungsraten von 80 und mehr Prozent. Bei den i. v. Drogenbenutzern liegt der Erfolg in ähnlicher Größenordnung. Die zielgruppenbezogene und selbst organisierte Primärprävention der HIV-Infektion ist mittlerweile zum Pilotfall der erfolgreichen Umsetzung eines modernen, gesundheitswissenschaftlich fundierten Präventionskonzepts geworden. Es hat sich als möglich erwiesen, durch öffentlich vermitteltes Lernen Verhalten in den Lebensbereichen der Sexualität und des Drogengebrauchs zu verändern, also in Bereichen wirksam zu sein, die weithin von Tabus und von Scham gekennzeichnet sind und zum Teil in der Illegalität liegen.
AIDS-Prävention, so stellt Rolf Rosenbrock fest, ist also eine positive Ausnahme in der Präventionslandschaft, von der noch viel gelernt werden kann. Anders als bei den früher im Rahmen von Prävention gängigen Zwangsstrategien waren die AIDS-Maßnahmen "eine moderne Mischung aus einer multimodalen Mehrebenen-Kampagne mit Bezug und Verknüpfung zu vielen dezentralen Aktivitäten in und mit den Lebenswelten der Zielgruppen." Was dabei heraus gekommen ist, kann gesundheitspolitisch als lernträchtig erfolgreiches Pilotmodell gewertet werden.
Dargelegt werden von Rolf Rosenbrock (Leiter der Forschungsgruppe Public Health im Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) und Mitglied im Sachverständigenrat für die Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen sowie Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirats der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), in diesem Aufsatz aber auch die Gründe des heute leider unbestreitbaren Rückgangs von präventivem Verhalten und einige Gedanken zur Überwindung dieser Defizite.
PDF-Datei Aids-Prävention - eine Innovation in der Krise
Gerd Marstedt, 27.9.2005