



Home | Patienten | Gesundheitssystem | International | GKV | Prävention | Epidemiologie | Websites | Meilensteine | Impressum
Sämtliche Rubriken in
"Epidemiologie"
Soziale Lage, Armut, soziale Ungleichheit |
Alle Artikel aus:
Epidemiologie
Soziale Lage, Armut, soziale Ungleichheit
Häufigkeit sozialer Kontakte (z.B. Besuche, Gruppenaktivitäten) und Sterblichkeitsrisiken assoziiert
 Mittel einer prospektiven Kohortenanalyse mit Daten zu 5 Merkmalen sozialer Kontakte oder Verbindungen der 458.146 Angehörigen der Biobank Großbritanniens/UK Biobank und den Daten verschiedener Sterblichkeitsregister untersuchte eine Gruppe von Wissenschaftler:innen der Universität Glasgow Zusammenhänge der Gesamt-Sterblichkeit und der Sterblichkeit an kardiovaskulären Erkrankungen. Als Indikatoren für soziale Kontakte wurden zwei funktionale Merkmale, nämlich die Häufigkeit sich jemandem anvertrauen zu können und das Gefühl, einsam zu sein und drei strukturelle Merkmale ausgewählt. Letztere waren die Häufigkeit, mit der man monatlich von Freunden und Familienangehörigen besucht wird, wöchentliche Gruppenaktivitäten unternahm und alleine oder zusammen mit Haushaltsangehörigen lebte.
Mittel einer prospektiven Kohortenanalyse mit Daten zu 5 Merkmalen sozialer Kontakte oder Verbindungen der 458.146 Angehörigen der Biobank Großbritanniens/UK Biobank und den Daten verschiedener Sterblichkeitsregister untersuchte eine Gruppe von Wissenschaftler:innen der Universität Glasgow Zusammenhänge der Gesamt-Sterblichkeit und der Sterblichkeit an kardiovaskulären Erkrankungen. Als Indikatoren für soziale Kontakte wurden zwei funktionale Merkmale, nämlich die Häufigkeit sich jemandem anvertrauen zu können und das Gefühl, einsam zu sein und drei strukturelle Merkmale ausgewählt. Letztere waren die Häufigkeit, mit der man monatlich von Freunden und Familienangehörigen besucht wird, wöchentliche Gruppenaktivitäten unternahm und alleine oder zusammen mit Haushaltsangehörigen lebte.
In dem durchschnittlichen Untersuchungszeitraum von 12,6 Jahren starben insgesamt 7,2 % der Biobank-Angehörigen, 1,1 % an kardiovaskulären Erkrankungen.
Eine Reihe statistischer VerknĂĽpfungen einzelner oder kombinierter Merkmale der sozialen Kontakte mit den beiden Sterblichkeitsindikatoren lassen u.a. folgende Assoziationen (hazard ratio) erkennen:
• Im Vergleich mit Personen, die täglich Besuche von Freunden und/oder Familienangehörigen erhielten und nicht alleine lebten, war das gesamte Sterblichkeitsrisiko fĂĽr Personen, die zwar täglich Besuche erhielten aber alleine lebten um 19 % höher.
• Dieses Risiko war fĂĽr Personen, die niemals Besuche bekamen aber nicht alleine lebten um 33 % höher als bei den Personen, die tägliche Besuche von Freunden und/oder Familienangehörigen erhalten und nicht alleine lebten.
• Wer niemals Besuche bekam und alleine lebte hatte ein um 77 % höheres Sterblichkeitsrisiko als die Vergleichspersonen mit Besuchern und weiteren Haushaltsangehörigen.
• Bei den Personen deren funktionalen und strukturellen Komponenten sozialer Kontakte negativ ausgeprägt waren, war das Risiko an einer kardiovaskulären Erkrankung zu sterben, um 63 % höher als bei den Personen, bei denen beide Komponenten positiv ausgeprägt waren.
Der am 10. November 2023 veröffentlichte 17 Seiten umfassende Aufsatz Social connection and mortality in UK Biobank: a prospective cohort analysis von Hamish M. E. Foster, Jason M. R. Gill, Frances S. Mair, Carlos A. Celis-Morales, Bhautesh D. Jani, Barbara I. Nicholl, Duncan Lee und Catherine A. O'Donnell ist in der Fachzeitschrift "BMC Medicine"- volume 21, Article number: 384 (2023) - als "open access"-Beitrag erschienen und komplett erhältlich.
Dort gibt es auch eine ausführliche Darstellung der aufwändigen Methodik der Studie und ihrer Ergebnisse, eine vergleichende Diskussion der Ergebnisse anderer thematisch ähnlicher Studien und die Limitationen der Studie.
Bernard Braun, 11.11.23
USA: Trotz der weltweit höchsten Pro-Kopfausgaben für Gesundheit sinkt die Lebenserwartung seit 2014.
 Anders als in den anderen entwickelten Ländern Europas, Asiens und Nordamerika nahm die Lebenserwartung der Gesamtbevölkerung ab der Geburt in den USA nach einem Anstieg von 69,9 Jahren (1959) auf 79,1 Jahren im Jahr 2014, auf 78,9 Jahre im Jahr 2016 ab.
Anders als in den anderen entwickelten Ländern Europas, Asiens und Nordamerika nahm die Lebenserwartung der Gesamtbevölkerung ab der Geburt in den USA nach einem Anstieg von 69,9 Jahren (1959) auf 79,1 Jahren im Jahr 2014, auf 78,9 Jahre im Jahr 2016 ab.
ForscherInnen haben nun die Verläufe der Lebenserwartung zwischen 1959 und 2016 noch etwas genauer betrachtet.
Ihre Ergebnisse sehen so aus:
• Die Zunahme der Lebenserwartung war zwischen 1969 und 1979 am größten, verlangsamte sich in den 1980er Jahren und gerieten 2011 ins Stocken.
• Die jüngste Abnahme der Lebenserwartung beruhten zum größten Teil auf einer Zunahme der Sterblichkeit der 25- bis 64-Jährigen. Hauptursachen sind Überdosen von illegalen Drogen, alkoholbedingte Lebererkrankungen, Selbstmord und mit Bluthochdruck assoziierte Erkrankungen.
• In Neuengland-Staaten (New Hampshire, Vermont) und im Bereich des Ohio-Tals (West Virginia, Ohio, Indiana, Kentucky) waren die Zuwachsraten der Sterblichkeit im mittleren Alter am höchsten.
In einem Kommentar wiesen die Herausgeber der Zeitschrift "JAMA" darauf hin, dass künftige Studien "must explore how income inequality, unstable employment, divergent state policies and other social dimensions affect disease."
In jedem Fall wird auch hieran wieder deutlich wie wenig die Höhe der Gesundheitsausgaben oder die Existenz einer High-Tech-Gesundheitsversorgung Auswirkungen auf so elementare Gesundheitsindikatoren wie die Lebenserwartung haben können.
Der Aufsatz Increases in Midlife Mortality a Major Contributor to Decreasing Life Expectancy in U.S. von Stephen Woolf und Heidi Schoomaker ist am 26. November 2019 in der Zeitschrift "JAMA" (2019;322(20):1996-2016) erschienen. Ein Abstract ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 28.11.19
Länger leben in Gesundheit? Ja, aber mit erheblichen und zunehmenden sozialen Unterschieden. Das Beispiel Schweiz.
 Die Lebenserwartung der gesamten Bevölkerung nimmt in den meisten entwickelten Ländern (aktuelle Ausnahme ist die USA) in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich zu.
Die Lebenserwartung der gesamten Bevölkerung nimmt in den meisten entwickelten Ländern (aktuelle Ausnahme ist die USA) in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich zu.
Die in diesem Zusammenhang wichtige Frage ist, ob damit auch die Lebenszeit in gutem Gesundheitszustand zunimmt oder zumindest ein Teil der zusätzlichen Lebensjahre mit Krankheiten verbunden sind. In der darüber seit vielen Jahren heftig geführten Debatte zwischen VertreterInnen einer Medikalisierung der gewonnenen Lebensjahre oder einer "compression of morbidity" am Ende einer Reihe von gewonnenen gesunden Lebensjahre (siehe dazu mit diesen Stichworten eine Reihe von Beiträgen in diesem Forum) überwiegen Studien, welche die Kompressions-Hypothese empirisch belegen.
Unabhängig wie diese Debatte weiter- oder ausgeht, zeigt eine im November 2019 veröffentlichte Studie über die Lebenserwartung in der Schweiz zusätzliche wichtige soziale Besonderheiten ihrer Entwicklung.
Mit Daten der "Swiss National Cohort (SNC)" von 11.650.000 Personen, die zwischen 1990 und 2015 jemals in der Schweiz lebten, und mit Daten aus den "Swiss Health Surveys" kamen die WissenschaftlerInnen zu folgenden Ergebnissen:
• Im Untersuchungszeitraum stieg die Lebenserwartung von 30-jährigen Männern von 78 auf 82 (exakt: plus 5,02 Jahre) und die der gleichaltrigen Frauen von 83 auf 86 Jahre (exakt: plus 3,09 Jahre).
• 4,5 Jahre ihrer längeren Lebenszeit konnten Männer in guter Gesundheit verbringen. Bei Frauen war dies in der gesamten zusätzlichen Lebenszeit der Fall.
• Sowohl bei der Lebenserwartung als auch bei den zusätzlichen Jahre in guter (healthy life expectancy) oder schlechter (years of bad health) Gesundheit gibt es beträchtliche und auch signifikante Unterschiede zwischen Menschen mit "compulsory education" (Hauptschulabschluss), "secondary education" (Real-/Gymnasialabschluss) und "tertiary education" (Hochschulabschluss). So betrug z.B. der Unterschied der Jahre in guter Gesundheit zwischen Männern mit Haupt- und allen anderen Abschlüssen im Zeitraum 2010-2014 8,8 Jahre. Bei den Frauen betrug dieser Unterschied 2010-2014 5 Jahre.
• Entgegen manchen Erwartungen nahmen die gerade genannten sozialen Unterschiede zwischen 1990 und 2010-2014 sogar zu: Für Männer von 7,6 auf 8,8 Jahre und bei den Frauen von 3,3 auf 5 Jahre (hier könnten aber laut den AutorInnen Besonderheiten beim Zugang von Frauen zur höheren Bildung und zur Arbeitswelt in den 1920er Jahren eine Rolle spielen).
• Zur Erklärung der Unterschiede bei den untersuchten Kennziffern zur Lebenserwartung zwischen Personen mit niedrigem und hohem Bildungsabschluss verweisen die AutorInnen auf eine Marginalisierung der erstgenannten Bevölkerungsgruppe. Diese weist in der Schweiz eine deutlich überdurchschnittliche Arbeitslosenrate auf. Hinzu kämen Faktoren aus dem Gesundheitssystem wie "the unequal ability of the Swiss healthcare system to provide curative and preventive medicine to everyone" oder "out-of-pocket payments for health and unmet health care needs for financial reasons", die in der Schweiz im Vergleich mit anderen OECD-Ländern am höchsten sind.
Die Studie Longer and healthier lives for all? Successes and failures of a universal consumer-driven healthcare system, Switzerland, 1990-2014 von A. Remund, S. Cullati, S. Sieber, C. Burton-Jeangros und M. Oris ist in der Zeitschrift "International Journal of Public Health" (2019; 64 (8): 1173-1181) erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 13.11.19
Grenzen des Zugangs zur gesundheitlichen Versorgung von objektiv Bedürftigen im "sozialen Europas" größer als erwartet.
 In vielen bevölkerungsrepräsentativen Studien über die gesundheitliche Versorgung sind die ärmsten und eigentlich versorgungsbedürftigsten EinwohnerInnen aus verschiedenen Gründen unter- oder gar nicht repräsentiert.
In vielen bevölkerungsrepräsentativen Studien über die gesundheitliche Versorgung sind die ärmsten und eigentlich versorgungsbedürftigsten EinwohnerInnen aus verschiedenen Gründen unter- oder gar nicht repräsentiert.
Was damit gar nicht in den Blick selbst kritischer Analysen gerät, zeigt nun eine Veröffentlichung der Ergebnisse von Befragungen oder anderen Erhebungs- und Dokumentationsmethoden von europaweit 43.286 Personen bzw. PatientInnen, die in irgendeiner Weise mit Mitgliedern der Initiative "Ärzte der Welt" und vergleichbarer Nichtregierungsorganisationen standen.
Die NutzerInnen der Dienste dieser Einrichtungen sind bereits ein Beleg, dass die Annahme, alle europäischen Länder gewährleisteten einen ungehinderten Zugang zur gesundheitlichen Versorgung für viele dort Lebenden nicht stimmt.
Die allgemeinste Erkenntnis der Befragung dieser Menschen bestätigt dies drastisch: 55,2% von ihnen sagten, sie hätten überhaupt keinen gesicherten Zugang zur Gesundheitsversorgung in ihren jeweiligen Aufenthaltsländern.
Mit 79,1% stellten die MigrantInnen aus Nicht-EU-Ländern (13% aus Syrien) die bei weitem die stärkste und auch am meisten durch Zugangsprobleme betroffene Gruppe. Aber auch 12,1% der StaatsbürgerInnen der jeweiligen Länder und 7,5% der Migranten aus EU-Ländern mussten um den Zugang zur Gesundheitsversorgung kämpfen oder erhielten ihn nicht.
Neben einer Fülle weiterer sozio-demografischer Charakteristika und des Gesundheitszustandes dieser Personen liefert der Report ähnlich wie die Reports in den letzten Jahren auch eine differenzierte Einblicke in die Lebensumstände dieser noch laufend wachsenden Personengruppe mitten in Europa.
Diese sahen u.a. so aus:
— 38,9% der PatientInnen hatten kein verlässliches soziales Netzwerk,
— 54,6% hatten lediglich begrenzte Kenntnisse der Landessprache.
— Die Migranten aus EU-Ländern sind am ärmsten und leben am häufigsten in sozialer Isolation und ohne Wohnung.
— 61,7% waren von ihren Kindern unter 18 Jahren getrennt.
— Auf die Frage nach den Ursachen oder Gründen für den fehlenden Zugang zur Gesundheitsversorgung gaben 18,9% an, sie würden es gar nicht (mehr) versuchen und von denjenigen, die es versuchten, scheiterten 17% an administrativen Hürden oder an ihrer Unfähigkeit, das Gesundheitssystem zu verstehen und dann nutzen zu können.
In Kenntnis dieser Befragung und selbst dann, wenn sie inhaltliche und methodische Mängel und Schwachstellen enthält, kann niemand mehr sagen, man wisse nichts über die gesundheitsbezogenen Lebensumstände dieser Menschengruppe im "sozialen Europa".
Der 50 Seiten umfassende äußerst detaillierte 2017 Observatory Report Falling through the cracks: The failure of Universal Healthcare Coverage in Europe von Ärzte der Welt und anderen (European Network to Reduce Vulnerabilities in Health) ist komplett kostenlos herunterladbar.
Bernard Braun, 16.11.17
USA: Deutliche Zunahme der Lebenserwartungslücke zwischen gering- und vielverdienenden Frauen und Männern
 Dass Personen mit einem hohen Einkommen und/oder Vermögen eine höhere Lebenserwartung haben als Personen mit einem niedrigen Einkommen und meistens keinem nennenswerten Vermögen gehört mittlerweile zu den kaum mehr bestrittenen sozialen Tatsachen.
Dass Personen mit einem hohen Einkommen und/oder Vermögen eine höhere Lebenserwartung haben als Personen mit einem niedrigen Einkommen und meistens keinem nennenswerten Vermögen gehört mittlerweile zu den kaum mehr bestrittenen sozialen Tatsachen.
Was bisher weniger belegt und thematisiert wurde, ist, dass diese Lebenserwartungslücke ständig wächst.
Dass dies so ist, belegen zwei Ökonomen der us-amerikanischen Denkfabrik "Brookings Institution" auf der Basis zweier großer Bevölkerungssurveys zumindest für die USA.
Dies zeigt sich bei Frauen wie Männern folgendermaßen:
• Frauen, die 1970 50 Jahre alt waren und deren Einkommen um ihr 40. Lebensjahr ("mid-career") herum im unteren Zehntel der Einkommensskala lag, hatten eine Lebenserwartung von 80,4 Jahren. Gleichaltrige Frauen, deren Einkommen im oberen Zehntel der Einkommenssskala lag, wurden 84,1 Jahre alt. Die Lebenserwartungslücke betrug also 3,5 Jahre.
• Von den Frauen, die zwei Jahrzehnte später, also 1990 50 Jahre alt waren, lebten die Niedrigverdienerinnen durchschnittlich nicht länger als die 1970 fünfzigjährigen Niedrigverdienerinnen. Ganz anders die Lebenserwartung der Hochverdienerinnen, die um 6,4 Jahre auf 90,5 Jahre wuchs. Die Lebenserwartungslücke nahm als auf rund 10 Jahre zu.
• Die Entwicklung bei den Männern verlief ähnlich. Bei ihnen nahm die Lebenserwartungslücke zu Ungunsten der Niedrigverdiener zwischen 1970 und 1990 von 5 auf 12 Jahre zu.
Für die USA weisen die Autoren noch auf ein damit verknüpftes Problem der sozialen Gerechtigkeit hin. Ähnlich wie in Deutschland wird in den USA darüber diskutiert wie man die Folgen der Verlängerung der Lebenserwartung auf die Finanzen der Rentenversicherung abmildern kann. Dazu zählen z.B. die Anhebung der gesetzlichen Altersgrenze und spürbare Abschläge (in den USA 6% bis 7,5% pro Monat) für diejenigen Personen, die vorher in Rente gehen. Damit würden aber auch viele Personen Nachteile für etwas, nämlich die gestiegene Lebenserwartung, erleiden, ohne überhaupt deren Vorteil genossen zu haben bzw. zu genießen.
Ob dies z.B. in Deutschland qualitativ ähnlich verlief, wäre interessant zu untersuchen.
Der Artikel The growing life-expectancy gap between rich and poor von Gary Burtless ist in der Los Angeles Times vom 23. Februar 2016 erschienen und kostenlos erhältlich.
Der komplette, materialreiche und 174 Seiten umfassende Forschungsbericht LATER RETIREMENT, INEQUALITY IN OLD AGE, AND THE GROWING GAP IN LONGEVITY BETWEEN RICH AND POOR von Barry Bosworth und Gary Burtless (The Brookings Institution) sowie Kan Zhang (George Washington University) ist komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 23.2.16
Public Health als Weg zur Optimierung des Menschen im Sinne besserer Resilienz
 Mitte Juni legte die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina gemeinsam mit der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften e. V. und der Union der deutschen Akademien der Wissenschaften e. V. ihre Stellungnahme Public Health in Deutschland (2015) vor. Das Papie mit dem Untertitel Strukturen, Entwicklungen und globale Herausforderungen geht erklärtermaßen der Frage nach, ob Deutschland sein Potenzial im Bereich Public Health in Hinblick auf nationale und globale Herausforderungen ausschöpft. Dazu hat "eine internationale Arbeitsgruppe aus hochrangigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern die bestehenden Grundlagen von Public Health in Deutschland untersucht und die zukünftigen Anforderungen an die Förderung und Weiterentwicklung des Gebietes ausgelotet" (S. 3).
Mitte Juni legte die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina gemeinsam mit der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften e. V. und der Union der deutschen Akademien der Wissenschaften e. V. ihre Stellungnahme Public Health in Deutschland (2015) vor. Das Papie mit dem Untertitel Strukturen, Entwicklungen und globale Herausforderungen geht erklärtermaßen der Frage nach, ob Deutschland sein Potenzial im Bereich Public Health in Hinblick auf nationale und globale Herausforderungen ausschöpft. Dazu hat "eine internationale Arbeitsgruppe aus hochrangigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern die bestehenden Grundlagen von Public Health in Deutschland untersucht und die zukünftigen Anforderungen an die Förderung und Weiterentwicklung des Gebietes ausgelotet" (S. 3).
Die Stellungnahme umfasst eine Vielzahl unterschiedlicher Aspekte von Public und Global Health und geht im Einzelnen auf die folgenden Themenbereiche ein: Ziele und Funktionen von Public Health, Herausforderungen, Fortschritte und Aussichten von Public Health, Globale Herausforderungen bewältigen: Erfolgreiche globale Gesundheitspolitik beginnt zu Hause, Geschichte und aktuelle Situation von Public Health in Forschung und Lehre in Deutschland und europäischer Hintergrund, und leitet daraus einschlägige Folgerungen und Empfehlungen für die Zukunft von Public Health in Deutschland ab.
Die mit der Stellungnahme unterstrichene Forderung nach stärkerer Beachtung und Bedeutung von Public Health in der Wissenschaft ist grundsätzlich begrüßenswert und könnte eine wichtige Weichenstellung in diese Richtung darstellen. Auch erscheint die einleitende Verortung dieses Wissenschaftszweigs plausibel, nachvollziehbar und korrekt: "Public Health ist mehr als Medizin" (S. 13) und "Public Health ist eine wichtige integrative Wissenschaft, die Ergebnisse der Grundlagenforschung in praktische Maßnahmen für die Gesundheit der Bevölkerung umsetzt" (S. 6). Auch der Forderung, Public-Health-Forschung müsse dazu beitragen, "effektive politische Maßnahmen, Programme und Strategien zur Verbesserung der Gesundheit, auch im nichtmedizinischen Bereich, zu entwickeln und Gesundheitssysteme zu stärken" (S. 9), ist nicht zu widersprechen.
Die Überlegungen der beteiligten WissenschaftlerInnen beruhen nicht zuletzt auf der beklagenswerten Situation, dass deutsche Forschungsergebnisse und praktische Erfahrungen nur geringen Einfluss auf die internationale Debatte und globale Gesundheitsansätze haben. Daher fordern sie: "Hier kann sich Deutschland verstärkt in die internationale Zusammenarbeit einbringen, vor allem da, wo es über einen reichen Erfahrungsschatz verfügt, beispielsweise in den Bereichen Forschung, Innovation, flächendeckende Gesundheitsversorgung und soziale Sicherheit" (S. 7) und kommen zu der Analyse: "Letztlich ist festzustellen, dass die in Deutschland erzielten Forschungsergebnisse und praktischen Erfahrungen zu Public Health bisher nicht in dem ihnen angemessenen Umfang in die Debatte zu Global Health eingeflossen sind" (ibid.). Das wiederholt in dem Papier eingeforderte Mehr an Forschung lässt sich aus dieser Formulierung allerdings schwerlich ablesen, hapert es doch vielmehr an der richtigen Vermarktung in der merkantilisierten Welt der Wissenschaft. Dieses Dilemma ist in erster Linie Folge des sprachlich, inhaltlich und machtbedingten Publikationsbias der internationalen wissenschaftlichen Publikationsszene und zum anderen dem in Deutschland vielfach zu beobachtenden gesundheitswissenschaftlichen und -politischen Germano- oder zumindest Eurozentrismus geschuldet. Dies zu ändern, erfordert eher Publikations- als Wissenschaftsförderung. Doch davon steht in dem Papier nichts, ebenso wenig wie von den möglichen Ursachen der aufgeführten unterschiedlichen nationalen Publikationsumfänge (S. 48ff).
Eine Kernforderung des Leopoldina-Papiers ist die nach "Entwicklung einer innovativen Forschungsagenda für die Bereiche Public Health und Global Health, die die globale, sich wandelnde Krankheitslast widerspiegelt" (S. 9, 61). Dieser Satz spiegelt unübersehbar den überwiegend medizinisch-naturwissenschaftlichen Hintergrund der AutorInnen wider und entlarvt gleichzeitig ihre eigentliche Absicht. Wer Public Health primär als Antwort auf die "Krankheitslast" begreift und funktionalisiert, degradiert sie zu einem verlängerten Arm von Medizin und Biowissenschaften. Dazu passt der ausgesprochen beschränkte Präventionsbegriff der Leopoldina-AutorInnen (S. 30; wenngleich nachgehend wieder etwas aufgeweitet, s. S. 44). Die Verkürzung von Prävention auf Impfungen und Früherkennung entspricht dem Verständnis von BiologInnen, MedizinerInnen und anderen NaturforscherInnen - einem gesundheitswissenschaftlichen Ansatz wird sie aber ebenso wenig gerecht wie dem tatsächlichen Umfang von Krankheitsvorbeugung bzw. -vermeidung und dem Bedarf an gesund erhaltenden Maßnahmen. Der Leopoldina-Standpunkt ist nicht nur biomedizinisch geprägt ("Wie verbessern wir den Beitrag von Forschung und Wissenschaft, um die Gesundheit der Bevölkerung zu verbessern?" (S. 7)), sondern erkennbar selbstreferenziell: "Inwiefern könnte eine Reform der wissenschaftlichen Einrichtungen im Bereich Public Health in Deutschland die Rolle Deutschlands auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene stärken? (S. 7f). Zwar enthält die Stellungnahme auch Empfehlungen für die Rückbesinnung auf die öffentliche Hand ("Ein starker Öffentlicher Gesundheitsdienst (ÖGD) und eine angemessene Ausbildung sind wichtige Voraussetzungen für ein funktionierendes Public-Health-System" (S. 8) - was auch immer ein "Public-Health-System" sein soll). Aber die Betonung vertikaler Ansätze wie der Bekämpfung von HIV/AIDS und chronischer Krankheiten (NCD, s. S. 6) weckt gleichzeitig Zweifel an der Komplexität und Integralität des Public-Health-Verständnisses der Leopoldina.
Insgesamt wappnen sich die AutorInnen des Papiers durch die stetige Verwendung genereller Begrifflichkeiten, gängiger Allgemeinplätze und unspezifischer Worthülsen gegen den Vorwurf einer inakzeptablen Einengung und der Auslassung relevanter Aspekte. Bedenklich ist dabei zugleich die Gewichtung bzw. wiederholte selektive Hervorhebung einzelner Gesichtspunkte, die zwar durchaus ihre Bedeutung haben mögen, deren grundlegende gesundheitswissenschaftliche Relevanz man allerdings in Frage stellen muss. So heißt es in der Zusammenfassung des Papiers: "Darüber hinaus müssen mehr Mittel für Sozial- und Verhaltenswissenschaften sowie für Genomik und andere, auf Omics-Technologien basierende Forschungsansätze und deren systematische Verbindung untereinander bereitgestellt werden" (S. 9; s. auch S. 33, 61, 66). Schön ist, dass auch Sozial- und Verhaltenswissenschaften benannt sind; schade ist dabei, dass viele andere Teile der Gesundheitswissenschaften keine zusätzlichen Mittel erhalten sollen; und besorgniserregend die einseitige Betonung von Genomik und Omics-Technologien. Die auf den ersten Blick willkürlich erscheinende, bei genaueren Hinsehen erkennbar interessensgeleitete Fokussierung auf einen bio-technokratischen Ansatz verdeutlicht den kaum verhohlenen Versuch, die Gesundheits- im Dienste der Krankheitswissenschaften zu instrumentalisieren und zu Hilfswissenschaften der Biomedizin zu degradieren.
Die grundlegenden und hinlänglich bekannten, in dem Papier ja zumindest auch benannten Auswirkungen sozialer Determinanten auf die Gesundheit der Bevölkerung lassen sich aber weder durch Genforschung noch durch Omics beseitigen oder kompensieren - erst recht nicht, wenn gleichzeitig soziale Ungleichheit und Depravation weltweit zunehmen. Ohne die Probleme aufgrund bestehender Patentregelungen zu benennen - das Wort Patent taucht nicht ein einziges Mal auf -, entbehrt die Forderung nach Forschungsförderung in Gentechnologie und sonstigen Bereichen der Biomedizin nicht nur einer überzeugenden Grundlage, sondern ist grob fahrlässig: Unter den bestehenden Bedingungen der Renditeorientierung und Gewinnmaximierung werden innovative biomedizinische Erkenntnisse bestehende soziale und gesundheitliche Ungleichheiten verstärken und eben nicht dazu beitragen, die Gesundheit der Bevölkerung zu verbessern.
Vor diesem Hintergrund entlarven sich die Verweise der mit ihrem traditionellen Namen Nationale Akademie der Naturforscher wesentlich treffender beschriebenen Leopoldina auf soziale Determinanten als Alibi, wenn nicht gar als Ablenkungsmanöver. "Weitere Forschungsanstrengungen sind erforderlich, um diese bereichsübergreifenden Themen zu verstehen; dazu zählt das breite Feld der Ungleichheit und der die Gesundheit beeinflussenden sozialen Determinanten" (S. 9). Hier ist deutlicher Widerspruch angezeigt: Es braucht nicht mehr und immer mehr Forschung, um die Zusammenhänge immer wieder aufs Neue zu belegen, die seit Jahrzehnten und letztlich spätestens seit Rudolf Virchow in diesem Land hinlänglich bewiesen sind. Die Beforschung sozialer Bedingungen und Ungleichheiten bleibt Selbstzweck, solange die Ergebnisse keine hinreichende Berücksichtigung in einer nationalen und globalen Health-in-All-Politik finden. Und so lange wie realitätsferne Modellbetrachtungen aus der Ökonomie erheblich größeren Einfluss auf gesundheitspolitische Entscheidungen nehmen als tausendfach belegte Zusammenhänge zwischen Lebensbedingungen und Gesundheit.
Auf den ersten Blick erscheint die Stellungnahme der Leopoldina zu Public Health als hervorragend gelungene Komposition aus Wort- und Begriffshülsen, die praktisch alle Aspekte benennen, aber kaum etwas davon mit Inhalt hinterlegen. Das Ganze ist garniert von wiederholten abrupten und inhaltlich nicht nachvollziehbaren Aneinanderreihungen (z.B. S. 30, linke Spalte Mitte und re. Spalte oben). Aus diesem dahin plätschernden Sammelsurium fallen allein biomedizinisch-naturwissenschaftliche Einzelaspekte heraus, die ein armseliges Verständnis von "Public Health" offenbaren, dabei aber klar die Stoßrichtung der angestrebten Neuausrichtung dieser Wissenschaft in Deutschland vorgeben.
Das lässt nichts Gutes ahnen. Tatsächlich ist die eigentliche Botschaft bedrohlich. Auch wenn der Begriff an keiner Stelle auftaucht, kann die Omics-Forschung - zumal bei ihrer bisher (?) ausschließlich individualmedizinischen Ausrichtung - letztlich doch eher auf die menschliche Resilienz, also die Widerstandsfähigkeit der Spezies Mensch gegenüber den herrschenden Umwelt- und Lebensbedingungen Einfluss nehmen als "die Umgebung und Gesellschaft so zu ändern, dass sie zum menschlichen Körper passen" (S. 33), wie das Leopoldina-Papier vollmundig behauptet. Mit dieser Logik lässt sich nicht nur die Forderung nach Änderung der krank machenden Verhältnisse aushebeln und damit die Auseinandersetzung mit machtvollen Strukturen vermeiden. Sie ist zynisch, bahnt sie doch bisher ungeahnte Möglichkeiten zur sozialen Selektion: Only the fittest survive - wer nicht genügend Resilienz erwerben kann, muss mit den katastrophalen Verhältnissen leben und sterben.
Die Leopoldina-NaturforscherInnen stellen ihre Stellungnahme als Volltext kostenfrei zum Download zur Verfügung.
Jens Holst, 28.6.15
Arbeitslosigkeit und Sterblichkeit an Prostatakrebs - ein OECD-weit vielfach signifikanter Zusammenhang
 Dass Arbeitslosigkeit negative gesundheitliche Effekte und Wirkungen im ursächlichen Sinn hat, ist bereits seit mehreren Jahren und in unterschiedlichsten Ländern und Gesellschaften durch viele Studien belegt. Eine gerade veröffentlichte Studie ergänzt und vertieft diesen Zusammenhang noch in zweierlei Hinsicht: Erstens reicht ihr Untersuchungszeitraum von 1990 bis 2009 und bezieht Daten aus 30 Mitgliedsländer der OECD ein. Zweitens konzentriert sie sich auf mögliche Effekte bzw. "knock-on effects" von Arbeitslosigkeit auf die Krebsmortalität und besonders die durch Prostatakarzinome bedingte.
Dass Arbeitslosigkeit negative gesundheitliche Effekte und Wirkungen im ursächlichen Sinn hat, ist bereits seit mehreren Jahren und in unterschiedlichsten Ländern und Gesellschaften durch viele Studien belegt. Eine gerade veröffentlichte Studie ergänzt und vertieft diesen Zusammenhang noch in zweierlei Hinsicht: Erstens reicht ihr Untersuchungszeitraum von 1990 bis 2009 und bezieht Daten aus 30 Mitgliedsländer der OECD ein. Zweitens konzentriert sie sich auf mögliche Effekte bzw. "knock-on effects" von Arbeitslosigkeit auf die Krebsmortalität und besonders die durch Prostatakarzinome bedingte.
Das Ergebnis ist eindeutig:
• Der Anstieg von Arbeitslosigkeit in den OECD-Ländern um 1 Prozent ist unter rechnerischer Berücksichtigung der unterschiedlichen Bevölkerungsgröße, demografischen Strukturrn und weiteren Merkmalen der Infrastruktur mit signifikanten Anstiegen der Sterblichkeit an Prostatakrebs assoziiert.
• Dieser Effekt hält auch über mehrere Jahre an. So war die Sterblichkeit an Prostatakrebs über den gesamten Zeitraum von 5 Jahren nach einer Erhöhung der Arbeitslosigkeit um 1 Prozent mit abnehmender Tendenz aber durchweg statistisch signifikant erhöht.
• Angesichts der Möglichkeit, dass so genannte Confounding-Faktoren also z.B. soziodemografische Merkmale oder Versorgungsstrukturen für die Assoziationen ursächlich sind, berücksichtigten die AutorInnen in einer weiteren Analyse insgesamt 46 mögliche Einflussfaktoren. Bei diesem "robustness check" blieb der Zusammenhang zwischen Anstieg der Arbeitslosigkeit und Prostatamortalität bei Berücksichtigung jedes einzelnen und aller 46 Faktoren signifikant.
• Schließlich führten die WissenschaftlerInnen auch noch eine so genannte "time trend analysis" durch. Sie untersuchten dafür die Häufigkeit der Prostata-Mortalität in den Jahren 2000 bis 2007, also den Jahren vor dem Höhepunkt der wirtschaftlichen Rezession im Jahre 2008, leiteten daraus zu erwartende Werte in den Jahren 2008 bis 2010 ab und verglichen diese mit den tatsächlichen Werten. Mit einigen nationalen Unterschieden war die Prostatamortalität ab dem Krisenhöhepunkt auch aus dieser Perspektive signifikant erhöht.
• Neben diesen Ergebnissen ermutigt die Studie auch zu politische Initiativen gegen Arbeitslosigkeit.
Die Studie Unemployment and prostate cancer mortality in the OECD, 1990-2009. von Mahiben Maruthappuet al. ist im Mai 2015 in der Zeitschrift "E cancer medical science" erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 17.5.15
"Health & Financial Crisis Monitor": Welche Zusammenhänge gibt es zwischen Gesundheit, Wirtschafts- und Finanzkrise?
 Der politische Zusammenbruch der Sowjetunion und der radikal marktwirtschaftliche Umbau der Gesellschaft Russlands führte innerhalb kürzester Zeit zu einer dramatischen Verkürzung der Lebenserwartung vor allem der dortigen männlichen Bevölkerung um Zig-Millionen-Personenjahre. Ähnliches ereignete sich auch in einigen unabhängig gewordenen Folgestaaten der SU.
Der politische Zusammenbruch der Sowjetunion und der radikal marktwirtschaftliche Umbau der Gesellschaft Russlands führte innerhalb kürzester Zeit zu einer dramatischen Verkürzung der Lebenserwartung vor allem der dortigen männlichen Bevölkerung um Zig-Millionen-Personenjahre. Ähnliches ereignete sich auch in einigen unabhängig gewordenen Folgestaaten der SU.
In der Folge der politischen, ökonomischen und sozialen Krise Griechenlands erhöhte sich dort in kürzester Zeit die Selbstmordrate auf ein vorher nicht voprstellbares Niveau. Derartige Zusammenhänge zwischen ökonomischen Krisen und gesundheitlich unerwünschten Entwicklungen zeigen sich zum Teil weniger spektakulär auch in anderen Ländern z.B. im Gefolge der jüngsten Finanzkrise nach 2008.
Wer sich grundsätzlicher für die Art und die Mechanismen dieser Zusammewnhänge interessiert, kann sich darüber auf der Website des Health & Financial Crisis Monitor (HFCM)" informieren, der vom "European Observatory on Health Systems and Policies" und der "Andalusian School of Public Health" entwickelt und betreut wird.
Dieser Monitor sammelt und ordnet laufend evidente Belege für diese Zusammenhänge, liefert einen konzeptionellen Ansatz für die gesundheitspolitischen Antwort auf ökonomische Schocks und berichtet u.a. auf der Basis eines europaweiten Surveys von den politischen Optionen mit solchen Herausforderungen umzugehen. Auf der Website finden sich Links zu wissenschaftlicher Literatur auf der Pubmed-Seite und weiteren Daten.
Bernard Braun, 6.1.15
Hängt die Gesundheit der "Menschen mit Migrationshintergrund" von der Art der Integrationspolitik ab? Irgendwie schon.
 Um es gleich vorweg zu sagen: Wie die Gesundheit der länger als 10 Jahre in Deutschland lebenden "Menschen mit Migrationshintergrund" im Vergleich mit derselben sozialen Gruppe in anderen europäischen Ländern aussieht, findet sich einer gerade veröffentlichten Querschnittsuntersuchung mit Daten des "European Union Survey on Income and Living Conditions" zu den möglichen Zusammenhängen von Gesundheit und Integrationspolitik nicht. Der Grund: Für Deutschland kann wie für ein paar andere Länder (Estonia, Latvia, Malta, Slovenia) nicht unterschieden werden, ob die Einwanderer in EU-Ländern oder außerhalb der EU geboren wurden.
Um es gleich vorweg zu sagen: Wie die Gesundheit der länger als 10 Jahre in Deutschland lebenden "Menschen mit Migrationshintergrund" im Vergleich mit derselben sozialen Gruppe in anderen europäischen Ländern aussieht, findet sich einer gerade veröffentlichten Querschnittsuntersuchung mit Daten des "European Union Survey on Income and Living Conditions" zu den möglichen Zusammenhängen von Gesundheit und Integrationspolitik nicht. Der Grund: Für Deutschland kann wie für ein paar andere Länder (Estonia, Latvia, Malta, Slovenia) nicht unterschieden werden, ob die Einwanderer in EU-Ländern oder außerhalb der EU geboren wurden.
Die mit Daten aus dem Jahr 2011 durchgeführte Studie schließt 14 europäische Länder ein. Die Integrationspolitik dieser Länder wurde mittels des erprobten "Migrant Integration Policy Index" nach drei Typen unterschieden: multikulturell (9 Länder darunter Großbritannien, Italien, Schweden), exklusionistisch (Österreich, Dänemark) und assimilationistisch (je nach Dimension mehr oder weniger sind das Frankreich, Schweiz, Luxemburg). In die Untersuchung des Gesundheitszustandes wurden dann Daten von 177.300 über sechszehnjährige Personen einbezogen, die in den jeweiligen Ländern geboren waren und Daten von 7.088 Personen bzw. Immigranten, die außerhalb der EU geboren waren und bereits 10 und mehr Jahre in dem jeweiligen EU-Land wohnten. Mit diesem Merkmal sollte der so genannte "healthy immigrant effect" ausgeschlossen werden.
Gewichtet nach Alter, Bildungsabschluss, Beschäftigungsstatus und sozio-ökonomischen Bedingungen wurde dann der selbst wahrgenommene Gesundheitszustand zur Bewertung der Gesundheit genutzt.
Verglichen mit Immigranten in Ländern mit multikultureller Integrationspolitik war der Gesundheitszustand der in Ländern mit exklusionistischer Integrationspolitik lebenden Immigranten signifikant schlechter, und zwar komplett adjustiert um das 1,78-fache bei Männern und um das 1,47-fache bei Frauen. Und selbst im Vergleich mit Ländern, deren Politik sich vor allem auf die Assimilation von ausländischen Personen konzentriert, war die Gesundheit der Immigranten in exklusionistischen Ländern noch signifikant schlechter: um das 1,19-fache bei Männern und 1,22-fache bei Frauen.
Zusätzlich war auch die Ungleichheit beim Gesundheitszustand zwischen Immigranten und Einwohnern ohne Migrationshintergrund in Ländern mit einer auf Exklusion gerichteten Integrationspolitik am höchsten - auch nach dem Ausschluss des Einflusses der sozioökonomischen Verhältnisse.
Auch wenn eine weitere Erforschung solcher Zusammenhänge sicher notwendig ist, kann sich nach den Ergebnissen dieser Studie niemand mehr damit selbst beruhigen, dass es sich bei der Alternative "Willkommenskultur" oder "Festung Europa"-Mentalität um eine Stimmungs- oder Stilfrage handelt.
Und vielleicht schaffen es dann auch die deutschen Organisatoren des Survey den Unterschied zwischen in Birmingham oder Manila geborenen Immigranten zu erfassen. Welche Art von Integrationspolitik dann in Deutschland praktiziert wird, ist im Lichte der aktuellen gesetzgeberischen und faktischen Asylbewerberpolitik leider nicht eindeutig abzusehen.
Der Aufsatz Immigrants' health and health inequality by type of integration policies in European countries von Davide Malmusi ist am 17. September 2014 im "European Journal of Public Health" online first erschienen. Das Abstract ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 26.9.14
Globale Gesundheitspolitik - mehr als deutsche Pillen und Technik für den Weltmarkt
 Die 2011 von verschiedenen zivilgesellschaftlichen und akademischen AkteurInnen gegründete Deutsche Plattform für Globale Gesundheit hat ein grundlegendes Papier zu Fragen globaler Gesundheitspolitik vorgelegt. Unter dem Titel Globale Gesundheitspolitik - für alle Menschen an jedem Ort zeigt die Plattform entscheidende Aspekte von dem auf, was globale Gesundheitspolitik ausmachen muss.
Die 2011 von verschiedenen zivilgesellschaftlichen und akademischen AkteurInnen gegründete Deutsche Plattform für Globale Gesundheit hat ein grundlegendes Papier zu Fragen globaler Gesundheitspolitik vorgelegt. Unter dem Titel Globale Gesundheitspolitik - für alle Menschen an jedem Ort zeigt die Plattform entscheidende Aspekte von dem auf, was globale Gesundheitspolitik ausmachen muss.
Auslöser für dieses Papier war die Verabschiedung des Konzeptpapiers Globale Gesundheitspolitik gestalten - gemeinsam handeln - Verantwortung wahrnehmen im September 2013 durch die damalige schwarz-gelbe Bundesregierung. Ende 2013 stellte das Forum Gesundheitspolitik dieses Papier in dem Beitrag Globale Gesundheit - scheidende Bundesregierung hinterlässt bedenkliches Erbe vor und verwies auf weitere Stellungnahmen und Analysen. Insgesamt bleibt festzuhalten, dass das Konzeptpapier der Bundesregierung zu globaler Gesundheitspolitik dem formulierten Anspruch schwerlich gerecht wird.
Die Plattform für globale Gesundheit hat sich intensiv mit dem Konzeptpapier der Bundesregierung auseinandergesetzt und ist zu dem Schluss gekommen, dass die Bundesregierung in ihrem Konzeptpapier von einem verkürzten Gesundheitsbegriff ausgeht.
Die Plattform, in der Gewerkschaften, Sozial- bzw. Wohlfahrtsverbände, entwicklungs- wie migrationspolitische Organisationen, Wissenschaft, soziale Projekte und Bewegungen zusammenarbeiten, hat sich mit dem Ziel gegründet, unter den Bedingungen der fortschreitenden Internationalisierung der Lebensbedingungen den engen Zusammenhang zwischen globalen und lokalen Einflussfaktoren von Gesundheit stärker ins öffentliche Bewusstsein zu bringen, vorhandene Kräfte zu bündeln und in Deutschland politisch Einfluss zu nehmen. Sie will keine weitere gesundheits- oder entwicklungspolitische Lobby-Gruppe sein, sondern eine übergreifende Initiative mit dem Ziel, die sozialen Bedingungen für Gesundheit stärker in den Mittelpunkt der nationalen und internationalen Gesundheitsdebatte zu rücken. Dafür will sie die Zusammenarbeit zwischen nationaler und internationaler Gesundheitspolitik intensivieren und damit einen Beitrag zur Überwindung der bestehenden Trennung zwischen innenpolitischer und globaler Gesundheitspolitik leisten.
Wenn man diesen Anspruch Ernst nimmt, muss man, wie die Plattform, zu dem Schluss kommen, dass im Konzeptpapier der Bundesregierung zentrale gesundheitspolitische Probleme entweder gar nicht, nicht hinreichend oder gar fehlleitend zur Sprache kommen. Wichtige Aspekte globaler Gesundheitspolitik fehlen. Denn globale Gesundheitspolitik muss nicht nur alle Menschen weltweit in den Blick nehmen, sondern auch die sozialen Determinanten von Gesundheit und alle anderen Faktoren indirekter Gesundheitspolitik.
Als Grundlagen für eine künftige ressortübergreifende Strategie für globale Gesundheit fordert die Deutsche Plattform für globale Gesundheitspolitik daher
• eine stärkere Ausrichtung auf Gesundheitsförderung als auf Biomedizin
• eine hinreichende Beachtung sozialer Ungleichheiten
• gesunderhaltende Arbeits- und Lebensbedingungen
• universelle soziale Absicherung im Krankheitsfall
• ausreichende und sichere Ernährung
• angemessene handels- und steuerpolitische Regulierungen
• Kontrolle und Zurückdrängen von Profitinteressen in der Gesundheitswirtschaft
• Steuerung der Migration von Fachkräften
• Verminderung der gesundheitlichen Risiken des Klimawandels
• Gesundheitsförderliche Energiepolitik
• Eindämmung von Rüstungsexporten und Krieg
• Zugang zur Krankenversorgung auch für Illegale
• Demokratisierung der WHO als relevante Sonderorganisation der Vereinten Nationen.
Im Fazit des Plattform-Papiers heißt es: "In der globalisierten Welt ist globale Gesundheitspolitik eine bedeutende wie auch vielschichtige Querschnittsaufgabe. Es ist ermutigend, dass die weltweiten Zusammenhänge von Gesundheit in den vergangenen Jahren verstärkt in den Blick gerückt sind. Und es ist gut, dass sich auch die Bundesregierung mit der Vorlage eines Konzeptpapiers dieser Herausforderung gestellt hat. Das vorgelegte Papier macht allerdings auch deutlich, wie weit der Weg zu einem umfassenden Verständnis von globaler Gesundheitspolitik und geeigneten politischen Strategien zur Verbesserung der weltweiten Gesundheit noch ist."
Zusammenfassend kommt die Plattform in ihrem Gegenkonzept zu der Einschätzung: "Auch wenn mit Blick auf den laufenden Post-2015-Prozess nun eine Chance vertan sein könnte, besteht für die Deutsche Plattform für Globale Gesundheit kein Zweifel, dass der eingeschlagene Weg in die richtige Richtung führt. Dafür ist allerdings ein klares Bekenntnis zu einem menschenrechtlichen Verständnis erforderlich, das Gesundheit nicht als profitables "Geschäftsmodell" begreift, sondern als Anspruch jedes Menschen. Die Krise der gegenwärtigen Gesundheitspolitik ist nicht zuletzt Folge des Gefangenseins in Einstellungen und Überzeugungen, die bestehende Probleme verlängern, nicht aber überwinden. "Probleme", darauf hat schon Albert Einstein verwiesen, "kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind."
Allen Interessierten steht das Grundsatzpapier der Deutschen Plattform für globale Gesundheit zum Thema Globale Gesundheitspolitik - für alle Menschen an jedem Ort kostenfrei zum Download zur Verfügung.
Jens Holst, 27.8.14
Biomedizinisches Korrelat zur sozialen Ungleichheit von Gesundheit
 Zumindest in den Gesundheits- und Teilen der Sozialwissenschaften sind die Auswirkungen des sozioökonomischen Status auf die Gesundheit der Menschen seit etlichen Jahren bekannt und wichtiger Teil der epidemiologischen Forschung. Auch das Robert-Koch-Institut als Bundesbehörde .... untersucht regelmäßig die Zusammenhänge zwischen Auftreten und Häufigkeit von Erkrankungen und Einkommen, Bildungsstand und anderen sozialen Determinanten.
Zumindest in den Gesundheits- und Teilen der Sozialwissenschaften sind die Auswirkungen des sozioökonomischen Status auf die Gesundheit der Menschen seit etlichen Jahren bekannt und wichtiger Teil der epidemiologischen Forschung. Auch das Robert-Koch-Institut als Bundesbehörde .... untersucht regelmäßig die Zusammenhänge zwischen Auftreten und Häufigkeit von Erkrankungen und Einkommen, Bildungsstand und anderen sozialen Determinanten.
Anders als es die gängige gesundheitspolitische Debatte glauben macht, sind die gesellschaftlichen Faktoren für Gesundheit und Krankheit mittlerweile hinlänglich bekannt und vielfach belegt. Eine Vielzahl von Modellen und Erklärungsansätzen versucht, diese offenkundigen Zusammenhänge einzuordnen und mögliche Wirkmechanismen zu erkennen. So ist biomedizinisch nachvollziehbar, dass Dauerstress ohne entsprechende körperliche Betätigung über einen dauerhaften Reiz des sympathischen Nervensystems Bluthochdruck verursachen kann oder wie ungünstige Ernährung zusammen mit Bewegungsmangel zu Fettleibigkeit und darüber zur Zuckerkrankheit beitragen kann.
Mittlerweile wächst darüber hinaus die Erkenntnis, dass ungünstige sozioökonomische Bedingungen bereits auf der Ebene der Körperzellen wirken. In ihrem kürzlich in der Wissenschaftszeitschrift Nature veröffentlichten Artikel Social disadvantage, genetic sensitivity, and children's telomere length beschreiben die us-amerikanischen ForscherInnen Mitchell, Hobcraft, McLanahan, Rutherford-Siegel, Berg, Brooks-Gunn, Garfinkel und Notterman Veränderungen in den Körperzellen, die Folge sozialer Benachteiligung zu sein scheinen. Eine wichtige Rolle kommt dabei offenbar den Telomeren zu. Diese bestehen aus sich wiederholenden DNA-Sequenzen am Ende eines Chromosoms schützen dieses als eine Art Schutzhüllen vor dem Verfall bzw. dem Abbau, dienen also dem Erhalt des Erbmaterials im Inneren der Zellen. Die Telomere unterliegen zeitlebens einem Umbauprozess und ihre Länge nimmt natürlicherweise mit zunehmender Lebensdauer ab.
Inzwischen liegen etliche Untersuchungen vor, die neben dem wichtigen Einfluss der Beschaffenheit der Telomere auf den Alterungsprozess auch Auswirkungen auf die Immunabwehr - so zum Beispiel die Studie von Heidinger, Blount, Boner, Griffiths, Metcalfe und Monaghan Telomere length in early life predicts lifespan in der Wissenschaftszeitschrift Procedures of the National Academy of Science Nr. 109 (5), S. 1743-1748 - und die Entstehung chronischer Erkrankungen belegen, so zum Beispiel die beiden Studien The Relationship between Telomere Length and Mortality in Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) von Lee, Sandford, Connett, Yan, Mui, Li, Daley, Anthonisen, Brooks-Wilson, Man und Sin im online Journal PLoS ONE 7(4): e35567 und Telomeres and Cardiovascular Disease - Does Size Matter? der beiden spanischen Kardiologen Antonio Serrano und Vicente Andrés in Circulation Research Nr. 94 (5), S. 575-584.
Die Verkürzung der Telomere lässt sich bei Vorliegen von Stressoren bereits im Kindes- und Jugendalter nachweisen. Beispielhaft sei hier auf die Artikel von Theall, Brett, Shirtcliff, Dunn und Drury mit dem Titel Neighborhood disorder and telomeres: Connecting children's exposure to community level stress and cellular response in Social Science and Medicine Nr. 85, S. 50-58, der kostenfrei als Volltext zum Download zur Verfügung steht, und von Shalev, Moffitt, Sugden, Williams, Houts, Danese, Mill, Arseneault und Caspi Exposure to violence during childhood is associated with telomere erosion from 5 to 10 years of age: A longitudinal study in Molecular Psychiatry 18 (5): 576-581, von dem nur das Abstract kostenfrei zum Download zur Verfügung steht.
Nun zeigt die im April 2014 publizierte gemeinsame Studie der ForscherInnen verschiedener us-amerikanischer Universitäten, dass die Telomer-Länge nicht nur als Biomarker für den physiologischen Alterungsprozess und für chronischen Stress geeignet zu sein scheint. Denn bei Personen, die unter sozial benachteiligenden Bedingungen leben ist - ebenso wie bei Depression -bereits im Jugendalter eine Verkürzung der Telomere zu beobachten. Die Messung der Telomerlänge erfolgte über eine real-time Polymerase-Ketten-Reaktion (PCR), einem häufig verwandten, quantitativen molekularbiologischen Verfahren. Anders als die meisten anderen Untersuchungen basierte diese Studie nicht auf weißen Blutkörperchen, sondern auf einfacher zu gewinnenden Speichelzellen.
Dabei verglichen sie die Telomerlänge von 40 schwarzen us-amerikanischen Jungen ab neun Jahren, die in die Fragile Families and Child Wellbeing Study (FFCWS) eingeschlossen sind, einer Längsschnittsbeobachtungsstudie von Haushalten in den USA. Die eine Hälfte der Kinder wuchs unter besonders schwierigen Verhältnissen auf, während die andere Hälfte unter günstigeren sozio-familiären Bedingungen groß wurde.
Es zeigte sich, dass das Aufwachsen unter benachteiligten Bedingungen mit einer durchschnittlich 19-prozentigen Verkürzung der Telomerlänge einherging (P = 0,02), während andererseits Verdoppelung des Verhältnisses zwischen Haushaltseinkommen und Bedarf, das in der eingeschlossenen Gruppe zwischen 0,7 und 2,7 variiert, mit einer 5-prozentigen Zunahme der Telomerlänge korrelierte. Auch das Ausbildungsniveau der Mütter hat Einfluss auf die Telomerlänge, die bei Kindern von Frauen mit mindestens High-School-Abschluss die Telomere 32 (P=0,006) und bei solchen mit höherer Bildung sogar 35 Prozent (P=0,005) länger waren. Häufie Veränderungen der Familienstruktur bzw. -konstellation wiederum waren mit einer 40-prozentigen Verkürzung der Telomerlänge assoziiert.
Dieses Ergebnis liefert nicht nur Hinweise auf gesellschaftlich bedingte morphologische Veränderungen auf Zellebene, die ein wichtiges Bindeglied bei der Erklärung der Auswirkungen sozialer Determinanten auf Gesundheit und Krankheit darstellen. Es dürfte auch wichtiger Hinweise für die Epigenetik und das Zusammenspiel zwischen Erbfaktoren und Umwelteinflüssen liefern. Dieser konzeptionell neue Ansatz für das Verständnis von Erbfaktoren und genetischen Regulationen befasst sich mit Mechanismen und Konsequenzen vererbbarer Chromosomen-Modifikationen, die nicht auf strukturellen Formationen und Veränderungen des Erbmaterials beruhen. Neben den wesentlichen epigenetischen Modifikationen - nachträgliche Änderungen bestimmter DNA-Basen (DNA-Methylierung), Veränderungen des Chromatins (Histon-Modifikationen) und RNAi vermittelte Mechanismen - verdichten sich die Hinweise, dass auch Telomer-Veränderungen für Entwicklungs- und Erkrankungs-Prozesse mitverantwortlich sind.
Die für MedizinerInnen, Sozial- und GesundheitswissenschaftlerInnen und andere Interessierte gleichermaßen relevante Studie von Colter Mitchell und KollegInnen steht kostenfrei als Volltext zum Download zur Verfügung.
Jens Holst, 15.6.14
Kann eine Reform des Krankenversicherungsschutzes Leben retten? Positive Anzeichen in Massachusetts (USA)
 Fast jede Gesundheitsreform ist mit Versprechungen oder Erwartungen verbunden, die Ausgaben zu reduzieren oder mindestens ihr Anwachsen zu dämpfen, mit weniger Geld mehr Qualität bis hin zu einer Verlängerung der Lebenserwartung zu erreichen. Bereits die Tatsache, dass weltweit nach dem Motto "nach der Gesundheitsreform ist vor der Gesundheitsreform", Kostendämpfung so gut wie immer nicht oder nicht für längere Zeit gelingt, zeigt die Wirklichkeitsferne mancher dieser Ankündigungen.
Fast jede Gesundheitsreform ist mit Versprechungen oder Erwartungen verbunden, die Ausgaben zu reduzieren oder mindestens ihr Anwachsen zu dämpfen, mit weniger Geld mehr Qualität bis hin zu einer Verlängerung der Lebenserwartung zu erreichen. Bereits die Tatsache, dass weltweit nach dem Motto "nach der Gesundheitsreform ist vor der Gesundheitsreform", Kostendämpfung so gut wie immer nicht oder nicht für längere Zeit gelingt, zeigt die Wirklichkeitsferne mancher dieser Ankündigungen.
Umso interessanter sind Reformen in deren zeitlichem Kontext es gelingt, Veränderungen gravierender Art nachweisen und sie als Reformfolgen zu identifizieren.
Eine in der us-amerikanischen Fachzeitschrift "Annals of Internal Medicine" im Mai 2014 veröffentlichte Studie von Wissenschaftzlern der Harvard School of Public Health (HSPH) über die Mortalitätsentwicklung in den ersten vier Jahren nach der 2006 im US-Bundesstaat Massachusetts gestarteten Gesundheitsreform, liefert hierzu handfeste Daten. Diese sind auch deshalb von enormer Bedeutung, weil die mit dieser Reform initialisierte (fast) allgemeine Krankenversicherungspflicht eine Art Modell für die USA-weite Gesundheitsreform des "Affordable Care Act" darstellt.
Im Vergleich mit anderen Bundesstaaten mit vergleichbarer soziodemografischer Struktur aber ohne vergleichbare Reformen als Kontrollgruppe und der Zeiträume 2001 bis 2005 vor der Reform und 2007 bis 2010 nach dem Reformstart sank die Sterblichkeit unter den 20- bis 64-Jährigen in Massachusetts (n=146.825) signifikant um 2,9% oder absolut um 8,2 Sterbefälle pro 100.000 Erwachsene. Die Sterblichkeit an Ursachen, die überhaupt der Gesundheitsversorgung zugänglich sind, sank ebenfalls signifikant um 4,5%. Positive Veränderungen der Sterblichkeit waren in Bezirken ("counties") mit niedrigerem durchschnittlichen Haushaltseinkommen und höherer Rate unversicherter Personen vor der Reform größer. Weitere Analysen zeigten signifikante Gewinne oder Zunahmen beim Versicherungsschutz, dem Zugang zur Krankenversorgung und beim selbst wahrgenommenen Gesundheitszustand. Um einen Todesfall pro Jahr verhindern zu können mussten rund 830 erwachsene Personen eine Krankenversicherung erhalten ("number needed to treat").
Die Autoren weisen allerdings selber auf einige Limitationen ihrer Analyse hin. So handelt es sich nicht um eine randomisierte Untersuchungsgruppe und mögliche Störfaktoren, die das Ergebnis in Wirklichkeit beeinflussten, sind nicht systematisch gesucht und untersucht worden. Sie warnen außerdem davor, die Ergebnisse komplett auf andere US-Bundesstaaten oder die gesamte USA zu übertragen.
Der Aufsatz Changes in Mortality After Massachusetts Health Care Reform: A Quasi-experimental Study von Benjamin D. Sommers, Sharon K. Long und Katherine Baicker ist am 5. Mai 2014 in der Zeitschrift "Annals of Internal Medicine" (160: 585-593) erschienen. Ein Abstract ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 18.5.14
Soziale Determinanten der Gesundheit in den 53 europäischen Mitgliedstaaten der WHO
 In Europa sind in den letzten 30 Jahren erhebliche Fortschritte im Hinblick auf die gesundheitliche Lage der Bevölkerung erzielt worden. Aber sowohl zwischen als auch innerhalb der 53 europäischen Mitgliedsstaaten der WHO bestehen weiterhin ausgeprägte soziale Ungleichheiten für die Gesundheit. Das Konzept "Closing the Gap" konnte bislang nur in geringem Maße umgesetzt werden.
In Europa sind in den letzten 30 Jahren erhebliche Fortschritte im Hinblick auf die gesundheitliche Lage der Bevölkerung erzielt worden. Aber sowohl zwischen als auch innerhalb der 53 europäischen Mitgliedsstaaten der WHO bestehen weiterhin ausgeprägte soziale Ungleichheiten für die Gesundheit. Das Konzept "Closing the Gap" konnte bislang nur in geringem Maße umgesetzt werden.
Der von dem europäischen Büro der Weltgesundheitsorganisation unter der Leitung von Prof. Michael Marmot (London) erstellte und Ende 2013 veröffentlichte Bericht basiert auf den Ergebnissen der folgenden dreizehn Arbeitsgruppen: 1 Frühe Kindheit, Erziehung und Familie, 2 Beruf und Arbeitsbedingungen, 3 Soziale Exklusion und soziale Benachteiligung, 4 Bruttosozialprodukt, Einkommen und Sozialleistungen, 5 Aufrechterhaltung des Gemeinwohls, 6 Prävention und Gesundheitsleistungen, 7 Gender, 8 Ältere Bevölkerung 9 Governance, 10 Investitionen für Gesundheit, 11 Globale Einflüsse, 12 Soziale Gerechtigkeit und Menschenrechte, 13 Messprobleme und Gesundheitsziele.
Einer der im Bericht dokumentierten Indikatoren für die Gesundheit ist die mittlere Lebenserwartung (MLE). Dies ist ein sehr robuster Indikator für die Gesundheit. Er misst allerdings nur die Lebensdauer, nicht aber die gesundheitliche Lebensqualität und das individuelle und subjektive Wohlbefinden. Chronische Krankheiten und Beschwerden wie z.B. Diabetes mellitus, starke Rückenschmerzen und vielfältige Suchtproblematiken können die subjektive Lebensqualität erheblich einschränken. Als amtliche Todesursachen treten sie allerdings kaum in Erscheinung.
Innerhalb der 53 europäischen WHO-Mitgliedsländer gibt es erhebliche Unterschiede für die MLE. Bei den Männern beläuft sich der Unterschied zwischen dem Land mit der höchsten und der niedrigsten MLE
auf 17 Jahren: Israel 80 Jahre, Russland 63 Jahre. Der entsprechende Unterschied beträgt bei den Frauen 12 Jahre: Spanien 85 Jahre, Kirgisien 73 Jahre. Hier noch die Ränge 2-5 für die MLE. Frauen: Frankreich, Italien, San Marino und Andorra. Männer: Island, Schweden, Schweiz und Malta.
Frauen aus Spanien haben die höchste mittlere Lebenserwartung unter den 53 WHO-Mitgliedsstaaten. Spanien ist zugleich eines der "Sorgenkinder" der EU, insbesondere wegen der extrem hohen Arbeitslosigkeit.
Leider geht der WHO-Report nicht darauf ein, welche Gründe es für die hohe Lebenserwartung der spanischen Frauen geben könnte. Ländervergleiche haben das primäre Ziel, voneinander zu lernen. Offen bleibt somit die Frage, was wir von Spanien im Hinblick auf die dortige höchste europäische Lebenserwartung bei Frauen lernen könnten. Der häufig zu hörende Verweis auf die positive gesundheitliche Bedeutung der mediterranen Ernährungsweise dürfte wahrscheinlich nicht ausreichen.
Deutschland findet sich bei fast allen Indikatoiren im mittleren oder oberen Mittelfeld.
Der 44 Seiten umfassende Report Review of social determinants and the health divide in the WHO European Region. Final report (2013) ist kostenlos erhältlich
Uwe Helmert, 6.4.14
Wie stark soziale Unterschiede und nicht "die Natur" die Lebenserwartung und die Jahre in guter Gesundheit bestimmen
 Die Lebenserwartung und die Krankheitslast oder Pflegebedürftigkeit im Alter erscheinen oft als rein biologisch oder biochemisch determiniert oder als eine Folge gesundheitsbezogenen (Fehl-)Verhaltens. Wie stark aber dabei der Einfluss sozialer und damit auch beeinflussbarer Bedingungen ist, zeigt die aktuellste (Heft 2/2014) Ausgabe der vom Robert Koch-Institut herausgegeben Reihe "GBE kompakt; Zahlen und Trends aus der Gesundheitsberichterstattung des Bundes" facettenreich.
Die Lebenserwartung und die Krankheitslast oder Pflegebedürftigkeit im Alter erscheinen oft als rein biologisch oder biochemisch determiniert oder als eine Folge gesundheitsbezogenen (Fehl-)Verhaltens. Wie stark aber dabei der Einfluss sozialer und damit auch beeinflussbarer Bedingungen ist, zeigt die aktuellste (Heft 2/2014) Ausgabe der vom Robert Koch-Institut herausgegeben Reihe "GBE kompakt; Zahlen und Trends aus der Gesundheitsberichterstattung des Bundes" facettenreich.
Der dazu verfügbare Forschungsstand sieht so aus:
• "Ein niedriger sozioökonomischer Status geht mit einem erhöhten Mortalitätsrisiko und einer verringerten Lebenserwartung einher."
• Selbst ab dem 65. Lebensjahr zeigen sich für die dann fernere Lebenserwartung deutliche Unterschiede zwischen Männern und Frauen mit niedrigem und höherem Status ab.
• "Frauen und Männer aus den höheren Statusgruppen … können … mehr Lebensjahre in guter Gesundheit verbringen." So haben Frauen bei Geburt mit einem Einkommen, das auf dem Niveau von 60% des Netto-Äquivalenzeinkommens liegt, 60,8 Jahre in gesunder Lebenserwartung vor sich, Personen mit 150% und mehr über dem Netto-Äquivalenzeinkommen aber 71 gesunde Jahre. Bei Männern reicht diese Spanne von 56,8 bis zu 71,1 Jahren.
• Regionale Unterschiede bei Lebenserwartungsindikatoren haben etwas mit den Lebensbedingungen in den Regionen zu tun.
• Soziale Unterschiede in der Mortalität und Lebenserwartung gibt es in fast allen europäischen Ländern. Für Deutschland sind "Aussagen über zeitliche Entwicklungen und Trends in Bezug auf die sozialen Unterschiede in der Mortalität und Lebenserwartung" wie üblich "bislang nur eingeschränkt möglich." "Die wenigen vorliegenden Studien deuten aber bereits an, dass sich die beobachteten Unterschiede … im Zeitverlauf ausgedehnt haben könnten."
Die materialreichen 13 Seiten der Informationsbroschüre Soziale Unterschiede in der Mortalität und Lebenserwartung von T. Lampert und LE Kroll sind komplett kostenlos erhältlich
Bernard Braun, 21.3.14
Bewohner sozial schlecht gestellter Landkreise in Deutschland haben höhere Krebssterberisiken als Bewohner anderer Landkreise
 Zahlreiche internationale wie nationale so genannte "small-aerea"-Studien haben gezeigt, dass Erkrankungsrisiken sowohl zwischen durchaus vergleichbaren Staaten aber auch innerhalb von Staaten ungleich verteilt sind. Weniger untersucht wurde bisher, ob die Chancen einer erfolgreichen Behandlung oder Überlebensrisiken ebenfalls regional unterschiedlich verteilt sind. Sowohl in Erkrankungsrisiko- wie Behandlungschancen-Studien spielt der mögliche Zusammenhang mit der sozialen Lage eine wichtige Rolle.
Zahlreiche internationale wie nationale so genannte "small-aerea"-Studien haben gezeigt, dass Erkrankungsrisiken sowohl zwischen durchaus vergleichbaren Staaten aber auch innerhalb von Staaten ungleich verteilt sind. Weniger untersucht wurde bisher, ob die Chancen einer erfolgreichen Behandlung oder Überlebensrisiken ebenfalls regional unterschiedlich verteilt sind. Sowohl in Erkrankungsrisiko- wie Behandlungschancen-Studien spielt der mögliche Zusammenhang mit der sozialen Lage eine wichtige Rolle.
Für Deutschland hat sich nun eine Analyse der zwischen 1997 und 2006 in 10 regionalen Krebsregistern gesammelten Daten über die Überlebenschancen der an 25 der häufigsten Krebsarten (z.B. Lungen-, Darm-, Prostata-, Brust- und Hautkrebs) erkrankten Personen beider Fragen angenommen.
Die vor allem am Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) tätigen WissenschaftlerInnen konnten zeigen, dass Patienten, deren Wohn-Landkreis zum Fünftel der sozioökonomisch schwächsten Landkreise gehörte (gemessen durch Einkommen, Arbeitslosenquote, Kriminalität etc.), durchweg ein höheres Sterberisiko hatten als Mitpatienten aus allen anderen Regionen, d.h. früher starben. Dies traf bei 21 der 25 ausgewählten Krebsarten zu.
Zeitlich gestaffelt war das Sterberisiko der Krebspatienten in den 20% sozial schlechtgestelltesten Landkreisen
• nach drei Monaten um 24%,
• nach 9 Monaten um 16% und
• nach 4 Jahren immer noch um 8%
höher als in allen anderen Landkreisen.
Wie es in den restlichen 6 Bundesländern aussieht, konnten die DKFZ-WissenschaftlerInnen mangels vergleichbarer Registerdaten nicht ermitteln. An der Schlussfolgerung, diese Ungleichheiten "indicate a potential for improving cancer care and survival in Germany" ändert dies aber nichts.
Für praktische Interventionen hinderlich ist lediglich, dass die bisher vorliegenden Daten nicht erklären können, wodurch die Ungleichheit zustandekommt. So könnte entweder die medizinische Versorgung in den sozioökoomisch schwachen Landkreisen schlechter sein oder die Krankheitslast z.B. durch mehr oder schwerere Komorbidität höher sein. In Frage kommen könnte auch eine Kumulation beider Effekte.
Weitere Erklärungsfaktoren wie z.B. die Inanspruchnahme von Früherkennungsuntersuchungen bzw. unterschiedliche Tumorstadien bei der Entdeckung der Krebserkrankung schließen die ForscherInnen aber bereits jetzt aus.
Der Aufsatz Socioeconomic deprivation and cancer survival in Germany: An ecological analysis in 200 districts in Germany von Lina Jansen et al. (Mitglieder der GEKID Cancer Survival Working Group ) ist am 2. Dezember 2013 online erschienen und wird im "International Journal of Cancer" erscheinen. Ein Abstract liegt kostenlos vor
Bernard Braun, 1.2.14
Mehr Herzinfarkte in ärmeren Stadtteilen. Ergebnisse aus dem Bremer Herzinfarktregister
 In Bremer Stadteilen mit einer ungünstigen sozialen Bevölkerungsstruktur gibt es deutlich mehr Herzinfarkte als in sozial privilegierteren Bezirken. Infarktpatienten aus sozial schwachen Vierteln sind außerdem jünger als ihre Leidensgenossen aus den besser gestellten Gegenden der Stadt und haben ein höheres Risiko, innerhalb eines Jahres nach dem Infarkt zu sterben.
In Bremer Stadteilen mit einer ungünstigen sozialen Bevölkerungsstruktur gibt es deutlich mehr Herzinfarkte als in sozial privilegierteren Bezirken. Infarktpatienten aus sozial schwachen Vierteln sind außerdem jünger als ihre Leidensgenossen aus den besser gestellten Gegenden der Stadt und haben ein höheres Risiko, innerhalb eines Jahres nach dem Infarkt zu sterben.
Das berichtete die Studienkoordinatorin Susanne Seide vom Klinikum Links der Weser auf dem Kongress der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie (ESC) im September 2013 in Amsterdam. Ihre Forschungsgruppe analysierte 2.061 Herzinfarkt-Patienten des Bremer Herzinfarktregisters im Hinblick auf den Sozialstatus. Dabei teilte sie die Stadtteile der Patienten nach dem sogenannten Allgemeinen Bremer Benachteiligungsindex (BI) und der Einkommensstatistik in vier Gruppen ein. Der BI berücksichtigt Kriterien wie Arbeitslosigkeit oder Beschäftigung, Migrationshintergrund, Schulbildung, Kriminalität, Wahlbeteiligung oder Geschlecht und Alter der Bevölkerung.
In den Teilen der Stadt mit dem niedrigsten Sozialstatus gab es 66 Herzinfarkte pro 100.000 Einwohner, in den sozial stärksten Gegenden betrug dieses Verhältnis 47 pro 100.000 Einwohner. Die Infarktpatienten aus den sozial schwächsten Bezirken waren mit durchschnittlich 62 Jahren signifikant jünger als die sozial besser gestellten Patienten. Diese waren durchschnittlich 67 Jahre alt.
Einen gewissen Hinweis auf die Ursachen liefern die erfassten kardiovaskulären Risikofaktoren. Die Patienten mit dem geringsten Sozialstatus rauchten häufiger regelmäßig Zigaretten als die aus den besten Stadtvierteln (51 versus 36 Prozent) und hatten häufiger starkes Übergewicht (26 versus 17 Prozent).
Bremen hat eine lange Tradition in der erfolgreichen Erforschung der Bedeutung sozialer Faktoren für die gesundheitliche Lage der Bevölkerung. Die Datenlage für Bremen wie auch bundesweit ist sehr konsistent. Das hat auch das Robert-Koch-Institut aus Berlin bereits vor vielen Jahren erkannt und gab die Parole aus "Taten statt Daten". Zumindest hat sich allmählich die Erkenntnis durchgesetzt, dass es manifeste wissenschaftliche Nachweise dafür gibt, dass soziale Begleitumstände bei Herzinfarkten eine weitaus größere Rolle spielen als von Ärzten gemeinhin angenommen wird.
Die Ergebnisse der Studie von Seide et al. finden sich im ESC Abstract 1968 - Socially disadvantaged city districts show a higher incidence of acute ST-Elevation myocardial infarctions due to elevated risk factors-results from the Bremen STEMI registry, die einer Pressemitteilung der "Deutschen Gesellschaft für Kardiologie (DKG)" vom September 2013 zugrundeliegen.
Uwe Helmert, 22.1.14
Globale Gesundheit - scheidende Bundesregierung hinterlässt bedenkliches Erbe
 Kurz vor Ende ihrer Amtszeit legte die schwarz-gelbe Koalition im Spätsommer 2013 das Konzeptpapier Globale Gesundheitspolitik gestalten - gemeinsam handeln - Verantwortung wahrnehmen vor. So begrüßenswert es ist, dass sich die Bundesregierung mit den Herausforderungen globaler Gesundheit auseinandersetzt - das Konzept der scheidenden Regierung lässt etliche Wünsche offen. Zwar benennt es wichtige Fragen globaler Gesundheitspolitik und teils zutreffende Argumente. Bei genauerem Hinsehen entpuppt sich das in monatelanger Arbeit entstandene Papier allerdings vielfach als reine Rhetorik oder gar als Verschleierung bedenklicher Zielsetzungen. Die abgeleiteten politischen Konsequenzen und Strategien sind nicht nur unzureichend, sondern geben sogar Anlass zur Sorge.
Kurz vor Ende ihrer Amtszeit legte die schwarz-gelbe Koalition im Spätsommer 2013 das Konzeptpapier Globale Gesundheitspolitik gestalten - gemeinsam handeln - Verantwortung wahrnehmen vor. So begrüßenswert es ist, dass sich die Bundesregierung mit den Herausforderungen globaler Gesundheit auseinandersetzt - das Konzept der scheidenden Regierung lässt etliche Wünsche offen. Zwar benennt es wichtige Fragen globaler Gesundheitspolitik und teils zutreffende Argumente. Bei genauerem Hinsehen entpuppt sich das in monatelanger Arbeit entstandene Papier allerdings vielfach als reine Rhetorik oder gar als Verschleierung bedenklicher Zielsetzungen. Die abgeleiteten politischen Konsequenzen und Strategien sind nicht nur unzureichend, sondern geben sogar Anlass zur Sorge.
Unter Federführung des Bundesgesundheitsministeriums waren das Auswärtige Amt sowie die Bundesministerien für Wirtschaft, für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung sowie für Forschung und Bildung an dem Konzeptpapier zu globaler Gesundheitspolitik beteiligt. Entstanden ist ein Sammelsurium aus außen-, handels-, entwicklungs-, forschungspolitischen Aspekten. Das Papier beruft sich wiederholt auf deutsche Traditionen und Erfahrungen, meint damit aber vor allem die von Paul Ehrlich geprägte Forschung zur Krankheitsbekämpfung. Die maßgeblich auf Rudolf Virchow zurückgehende Erkenntnis, dass Gesundheit in erster Linie von den Lebens- und Arbeitsbedingungen abhängt, kommt in dem Konzeptpapier allenfalls am Rande zur Sprache.
In ihrem Konzeptpapier benennt die Bundesregierung drei Leitgedanken für ihre globale Gesundheitspolitik:
• Schutz und Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland durch globales Handeln
• Wahrnehmung globaler Verantwortung durch die Bereitstellung deutscher Erfahrungen, Expertise und Mittel
• Stärkung internationaler Institutionen der globalen Gesundheit
Dabei konzentriert sie sich auf fünf Schwerpunkte:
• Wirksam vor grenzüberschreitenden Gesundheits- gefahren schützen
• Gesundheitssysteme weltweit stärken - Entwicklung ermöglichen
• Intersektorale Kooperationen ausbauen - Wechselwirkungen mit anderen Politikbereichen
• Gesundheitsforschung und Gesundheitswirtschaft - Wichtige Impulse für die globale Gesundheit setzen
• Globale Gesundheitsarchitektur stärken.
Erheblich größere Bedeutung als den gesellschaftlichen Bedingungen von Gesundheit misst das Konzept der Bundesregierung nämlich der heilenden Wirkung von Exportprodukten der deutschen Pharma-, Medizingeräte- oder Versicherungsindustrie bei. Diese Einschätzung ist bestenfalls naiv, eher aber gefährlich. Denn deutsche Erzeugnisse unterliegen in erster Linie den Gewinninteressen der Hersteller und nur in geringem Maße dem tatsächlichen Bedarf. Wer es ernst meint mit globaler Gesundheit, der muss das Allgemeinwohl über Herstellerinteressen stellen und gegen Handelsbarrieren vorgehen, die armen Ländern u. a. den Zugang zu wichtigen Arzneimitteln versperren.
So richtig die Forderung der Bundesregierung nach universeller Absicherung im Krankheitsfall ist, so wenig glaubhaft ist ihr Bekenntnis, solange sie mit ihrer Sparpolitik in Folge der Eurokrise die soziale Absicherung beispielsweise der Griechen untergräbt. Universelle Absicherung im Krankheitsfall gilt für alle Menschen, auch für Migranten. Und der Export privater Krankenversicherungen in Entwicklungsländer hemmt den Aufbau umfassender Systeme und erschwert universelle soziale Absicherung.
Von solchen Erkenntnissen ist ebenso wenig die Rede wie von krank machenden oder gar tödlichen Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie in Bangladesch und anderswo, wo die Opfer einstürzender Gebäude nur die Spitze eines Eisbergs sind. Die alltäglichen Arbeitsbedingungen gefährden die Gesundheit. Auch vermeidet das Papier das Thema der gesundheitsschädlichen Wirkungen vieler Ausfuhrprodukte der deutschen Gesundheitswirtschaft, ganz zu schweigen von anderen Exportgütern made in Germany: Dabei ist Deutschland die drittgrößte, bei Kleinwaffen sogar zweitgrößte Rüstungsschmiede der Welt - eine Umwandlung dieses Industriezweigs wäre ein riesiger Beitrag zur globalen Gesundheit. Gleichzeitig gehört dieses Land zu den größten Umweltverschmutzern und erwirtschaftet seine Exportüberschüsse auch mit umweltschädlichen Produkten: Konsequente Eindämmung des Treibhausgasausstoßes und eine neue Verkehrspolitik können ebenso wie abgas- und lärmarme Autos erheblich mehr zur Verbesserung der Gesundheit hierzulande und weltweit beitragen als Arzneimittel und Medizintechnologie.
Alle diese Widersprüche lässt das Konzeptpapier der Bundesregierung völlig außer Acht. Vielmehr suggeriert es eine rückwärtsgewandte, selbstbezogene und auf den eigenen Vorteil bedachte Haltung, die Reminiszenzen an das Credo "Am deutschen Wesen soll die Welt genesen", sei es durch Medizinprodukte aus deutscher Herstellung oder durch soziale Sicherungssysteme nach deutschem Vorbild. Auch wenn das Papier die Bedeutung der bilateralen Zusammenarbeit wie multilateraler Akteure und insbesondere der Weltgesundheitsorganisation WHO betont, liegt der Schwerpunkt des Papiers woanders.
Die angesehene Medizinerzeitschrift Lancet widmete dem Konzeptpapier bereits ihrer Ausgabe vom 21. September 2013 ein Editorial. Namhafte deutsche Gesundheitswissenschaftler kritisierten zwei Monate später in derselben Zeitschrift die Bundesrepublik Deutschland, deren geringer Einsatz für Fragen der globalen Gesundheit der politischen und wirtschaftlichen Rolle des Landes würde nicht gerecht. In ihrem Teilbeitrag mit dem Titel Germany and global health: an unfinished agenda? mit dem Titel benennen die Autoren eine Reihe von Mängeln des Regierungskonzepts:
• Intellektuelle Eigentumsrechts und Zugang zu Arzneimitteln,
• Thematisierung struktureller Determinanten wie Handel, Wirtschaftskrise und weltweite Ungleichheit,
• relevante Beschränkungen des Rechts auf größtmögliche Gesundheit für MigrantInnen, Flüchtlinge und Asylsuchende in der Europäischen Union einschließlich Deutschlands,
• zuverlässige Finanzierungsmechanismen für die WHO,
• Förderung globaler Gesundheitsforschung und -erziehung,
• effektive und transparente interministerielle Institutionalisierung der deutschen globalen Gesundheitspolitik.
Im Lancet findet sich auch eine englischsprachige Zusammenfassung.
Die Große Koalition hat nun die Gelegenheit, das bisher stiefmütterlich behandelte Thema der globalen Gesundheitspolitik von nun ab aktiver und vor allem auch ernsthafter zu verfolgen. Das bisher vorliegende Konzeptpapier eignet sich allerdings schwerlich als Grundlage, dafür ist es zu lückenhaft, einseitig und letztlich irreführend. Gefordert ist ein Konzept für globale Gesundheitspolitik, das nicht deutsche Interessen und die Logik der Krankheitswissenschaften in den Vordergrund stellt, sondern auf Grundlage gesundheitswissenschaftlicher Erkenntnisse Vorschläge entwickelt, wie die Bundesrepublik und ihre Regierungen systematisch zur Verbesserung der Gesundheit weltweit beitragen können.
Das Konzeptpapier der Bundesregierung lässt sich hier kostenfrei herunterladen.
Jens Holst, 17.12.13
Datenreport 2013: Ein "Sozialatlas über die Lebensverhältnisse in Deutschland" jenseits von Wahlkampfphrasen und Kopflangertum
 Passend zur kritischen Auseinandersetzung mit dem Wahrheitsgehalt des Mantras von Angela Merkel und der Mehrheit der so genannten Wirtschaftsweisen (z.B. in der Zeit vom 21. November 2013: "Deutschland geht es gut. Die Beschäftigung nimmt seit Jahren zu … zudem wird oft der falsche Eindruck geweckt, die Ungleichheit der Einkommen habe jüngst stark zugenommen und viele Beschäftigten lebten in prekären Verhältnissen: Die verfügbaren Einkommen sind jedoch deutlich weniger ungleich verteilt als noch im Jahr 2005."), noch nie habe es so viele Beschäftigte gegeben und damit glückliche und zufriedene, auf jeden Fall nicht-arme BürgerInnen in Deutschland, erschien wie bereits in den Vorjahren der renommierte "Datenreport 2013. Ein Sozialbericht für die Bundesrepublik Deutschland".
Passend zur kritischen Auseinandersetzung mit dem Wahrheitsgehalt des Mantras von Angela Merkel und der Mehrheit der so genannten Wirtschaftsweisen (z.B. in der Zeit vom 21. November 2013: "Deutschland geht es gut. Die Beschäftigung nimmt seit Jahren zu … zudem wird oft der falsche Eindruck geweckt, die Ungleichheit der Einkommen habe jüngst stark zugenommen und viele Beschäftigten lebten in prekären Verhältnissen: Die verfügbaren Einkommen sind jedoch deutlich weniger ungleich verteilt als noch im Jahr 2005."), noch nie habe es so viele Beschäftigte gegeben und damit glückliche und zufriedene, auf jeden Fall nicht-arme BürgerInnen in Deutschland, erschien wie bereits in den Vorjahren der renommierte "Datenreport 2013. Ein Sozialbericht für die Bundesrepublik Deutschland".
In diesem vom Wissenschaftszentrum Berlin (WZB), dem Statistischen Bundesamt und der Bundeszentrale für politische Bildung in Kooperation mit dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) herausgegebenen und u.a. auf der Basis des Sozioökonomischen Panels erarbeiteten Report sieht die bundesdeutsche Sozialwelt aktuell und leider auch seit einiger Zeit etwas anders aus.
Aus der Fülle der Daten und Analyseergebnisse sind z.B. folgende Aspekte besonders wichtig:
• Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist zwar in der Tat 2012 auf das Allzeit-Hoch von 41,5 Millionen gestiegen. Das Arbeitsvolumen, d.h. die Anzahl der geleisteten und bezahlten Stunden ist aber nicht nur nicht gestiegen, sondern nimmt seit Jahren stetig ab, ohne dass dies Folge einer tarifvertraglichen Arbeitszeitverkürzung gewesen wäre. Wichtigste Ursache: Die enorm zunehmende Teilzeitarbeit.
• Zugenommen hat zwischen 2007 und 2011 aber auch der Anteil der armutsgefährdeten Personen (an der Gesamtbevölkerung von 15,2% auf 16,1%. Besonders betroffen sind die 55- bis 64-Jährigen, unter denen dieser Anteil 2011 nach einer Zunahme von drei Prozentpunkten bei 20,5% lag. Als arm gelten in diesem Report Personen, die 2011 weniger als monatlich 980 Euro zur Verfügung hatte.
• Für die soziale Situation der Betroffenheit aber auch der einkommensabhängigen Beiträge dieser Personen zu den diversen gesetzlichen Sozialversicherungen ist besonders kritisch, dass sich die Armutsgefährdung bei vielen dieser Personen zu einem Dauerzustand entwickelt hat. Waren im Jahr 2000 "nur" 27% der damals Armutsgefährdeten auch bereits in den 5 Jahren davor arm gewesen, lag dieser Anteil 2011 bei 40%.
• Eine für die arme Bevölkerung noch wesentlich drastischere Folge ihrer Situation ist die für die Lebenserwartung. Auch wenn es sich auch hier um keinen im strengen Sinn kausalen Zusammenhang handelt, haben arme Männer und Frauen gegenüber nichtarmen BürgerInnen ein 2,7-fach bzw. 2,4-fach erhöhtes Sterberisiko. In Lebensjahren: Arme Männer sterben im Durchschnitt fast elf Jahre vor nichtarmen Männern. Die Differenz beträgt bei Frauen noch rund acht Jahre.
• Auf der Pressekonferenz zur Veröffentlichung des Datenreports führte einer der Herausgeber noch einen weiteren Punkt an: Die gerade zitierten "Differenzen gelten auch in der sogenannten ferneren Lebenserwartung ab einem Alter von 65 Jahren. Hier beträgt die Differenz bei den Männern 5,3 Jahre und bei Frauen 3,5 Jahre. Überspitzt könnte man diese Befunde treffend so charakterisieren: Arme sterben früher. Das liegt natürlich nicht an der Einkommenslage an sich, sondern daran, dass mit steigenden Einkommen in aller Regel auch steigende materielle, kulturelle und soziale Ressourcen verbunden sind. Solche Ressourcen sind als Mechanismen zu verstehen, mit physischen und psychischen Belastungen im Lebensverlauf besser 'umzugehen'".
• Auch das "Risiko, einen weniger guten oder schlechten allgemeinen Gesundheitszustand zu haben, ist bei Männern aus der armutsgefährdeten Gruppe im Verhältnis zu Männern aus der hohen Einkommensgruppe um den Faktor 3,2 erhöht, bei Frauen beträgt das entsprechende Verhältnis 2,2:1. Daneben kann gezeigt werden, dass Männer und Frauen, die von Armut betroffen sind, in fast allen Altersgruppen deutlich häufiger stark übergewichtig (adipös) sind als Männer und Frauen in höheren Einkommensgruppen."
Eine knappe Übersicht über einige der vielen wichtigen Ergebnisse des Reports und Links auf mehrere Herausgeber-Statements gibt es als WZB-Pressemitteilung vom 26.11.2013 kostenlos.
Wer an allen anderen Inhalten auf den 432 Seiten des Datenreports 2013 interessiert ist, kann ihn komplett kostenlos herunterladen.
Bernard Braun, 26.11.13
PIAAC: Geringe Lesekompetenz stark mit geringerer politischer Wirksamkeit und schlechterem Gesundheitszustand assoziiert
 Das eigentlich Bedenkliche der im Oktober 2013 veröffentlichten ersten Ergebnisse der OECD-Erhebung über die Fähigkeiten und Fertigkeiten Erwachsener (PIAAC) bei 5.465 in Deutschland lebenden Erwachsenen, also inklusive fremdsprachige Zuwanderer, zwischen 16 und 65 Jahren sind nicht deren im Vergleich mit anderen Ländern unter- oder überdurchschnittlichen Lesekompetenzen, alltagsmathematische Kompetenzen oder die technologiebasierte Problemlösungskompetenz. Dass "Deutschland" hier nie in der Spitzengruppe auftaucht, dürfte eigentlich nach diversen PISA-Studien nicht weiter verwundern.
Das eigentlich Bedenkliche der im Oktober 2013 veröffentlichten ersten Ergebnisse der OECD-Erhebung über die Fähigkeiten und Fertigkeiten Erwachsener (PIAAC) bei 5.465 in Deutschland lebenden Erwachsenen, also inklusive fremdsprachige Zuwanderer, zwischen 16 und 65 Jahren sind nicht deren im Vergleich mit anderen Ländern unter- oder überdurchschnittlichen Lesekompetenzen, alltagsmathematische Kompetenzen oder die technologiebasierte Problemlösungskompetenz. Dass "Deutschland" hier nie in der Spitzengruppe auftaucht, dürfte eigentlich nach diversen PISA-Studien nicht weiter verwundern.
Wo Deutschland aber "Spitze" ist und nur in den USA dieser Unterschied noch größer ist, ist der "Lesekompetenzvorsprung von Erwachsenen, die mindestens einen Elternteil mit Tertiärbildung haben, gegenüber Erwachsenen, deren Eltern keinen Sekundärschul-II-Abschluss haben". Selbst wenn der Zusammenhang zwischen dem Bildungsniveau der Eltern und der Lesekompetenz ihrer Kinder durch Berücksichtigung weiterer Faktoren schwächer wird, ist die relative soziale Immobilität bei dieser Kompetenz in Deutschland immer noch mit am stärksten ausgeprägt.
Auch wenn die aktuelle Aufregung darüber groß ist, handelt es sich bei diesem Phänomen leider um ein mindestens seit einem halben Jahrhundert diskutiertes Problem. Der Ruf nach "Brechung des Bildungsprivilegs", nach "mehr Arbeiterkinder an die Uni" oder nach der Abschaffung der weltweit fast einmaligen Sozialauslese von 10-jährigen Grundschülern beschäftigt mindestens seit dem 1964 veröffentlichten "Bildungskatastrophen"-Buch von Georg Picht (seine zentralen Thesen lassen sich ganz gut in einem kurzen Auszug nachlesen) die Öffentlichkeit, wahrscheinlich 300 Kultusministerkonferenzen und Tausende von Bildungsausschuss-Mitglieder auf fast folgenlos gebliebenen steuerfinanzierten Sozial-Sightseeing-Touren in Finnland, Singapore oder Korea.
Welche Auswirkungen eine geringe Lesekompetenz haben kann, zeigt sich in ihren Zusammenhängen oder Assoziationen (Ursache-Wirkungs-Analysen und vor allem die Bestimmung welches die Ursache und was die Wirkungen sind, sind mit den PIAAC-Daten nicht möglich) mit anderen negativen sozialen Sachverhalten. So ist die Wahrscheinlichkeit, dass Personen mit niedrigem (höchstens Kompetenzstufe 1) Lesekompetenzniveau nur ein geringes Vertrauen in ihre Mitmenschen haben, gegenüber Personen mit einem Niveau der Stufe 4/5 um fast das 2,5-Fache, ihre geringe politische Wirksamkeit um das 4,5-Fache, ihre Teilnahme an ehrenamtlichen Tätigkeiten um das 2,6-Fache und schließlich ein mittelmäßiger bis schlechter Gesundheitszustand sogar um das 4,7-Fache höher. Auch in dieser Untersuchung zeigt sich also ein soziales Dilemma für Teile der Bevölkerung, das in der Gleichzeitigkeit und Kumulation verschiedenartigster sozialer Nachteile besteht. Interessant ist, dass die deutschen Befragten hier vor allem bei der geringen politischen Wirksamkeit und dem schlechten Gesundheitszustand wesentlich schlechter abschneiden als die Befragten in allen anderen Ländern. So erhöht sich die Wahrscheinlichkeit dieser beiden negativen sozialen Zustände bei Personen mit geringer Lesekompetenz dort "nur" um das 2,5- bzw. 2-Fache. Darüber, warum dies so ist, gibt die OECD-Studie bisher keine Erklärung.
Zu den zahlreichen bildungs- und qualifikationspolitischen Funden mit u.a. gesundheits- oder versorgungspolitischen Auswirkungen gehört die IT-Kompetenz der Bevölkerung. Anders als in technik-affinen und wahrscheinlich latent jugendzentrierten Umfragen gaben in PIAAC 11,6% der unter 65-jährigen (!) deutschen Erwachsenen an, sie hätten keinerlei Erfahrung mit Computern oder es fehlten ihnen grundlegendste Computerkenntnisse. Und die technologiebasierte Problemlösungskompetenz bei der Nutzung der Informationstechnologien lag bei 44.8% der Befragten maximal auf der Kompetenzstufe 1. Diese Personen können "lediglich weitverbreitete und bekannte Anwendungen wie E-Mail-Programme oder Internet-Browser nutzen, um Aufgaben zu bewältigen, für die nur wenige Arbeitsschritte, einfache Schlussfolgerungen und wenig oder keinerlei Navigieren durch verschiedene Anwendungen erforderlich sind." Da diese Kompetenz bei über 65-Jährigen mit Sicherheit nicht verbreiteter ist, kommt die Mehrheit der deutschen Bevölkerung also offensichtlich nicht mit der Informationsquelle Internet zu Recht. Nicht zuletzt die Diskussionen darüber, dass sich dank des Internets fast jeder Bürger z.B. über Krankheiten oder Behandlungsmöglichkeiten wie -stätten informieren können, erhalten dadurch einige einige Dämpfer.
Einen Überblick über die Methoden, Inhalte und Ergebnisse verschafft die OECD-PIAAC-Website. Die 2013-Ausgabe des "Skills Outlook" enthält auf über 400 Seiten erste Ergebnisse der Untersuchung.
Außerdem gibt in deutscher Sprache eine 17-seitige OECD PIAAC-Ländernotiz Deutschland kostenlos.
Bernard Braun, 10.10.13
Arme sterben jünger als Wohlhabendere und die sozialen Unterschiede bei der Lebenserwartung von 65-Jährigen werden größer
 Dass ärmere Menschen mit meist lebenslang schlechteren Lebensbedingungen als wohlhabendere oder reiche Menschen eine kürzere Lebenserwartung haben, ist auch aus anderen Untersuchungen bereits bekannt. Neu ist aber nach einer Längsschnittauswertung von Daten der deutschen Rentenversicherung für männliche deutsche Versicherte, dass der Abstand zwischen der künftigen Lebenserwartung von einkommensstarken und -schwachen 65-Jährigen zwischen der Mitte der 1990er Jahre und 2008 zunahm.
Dass ärmere Menschen mit meist lebenslang schlechteren Lebensbedingungen als wohlhabendere oder reiche Menschen eine kürzere Lebenserwartung haben, ist auch aus anderen Untersuchungen bereits bekannt. Neu ist aber nach einer Längsschnittauswertung von Daten der deutschen Rentenversicherung für männliche deutsche Versicherte, dass der Abstand zwischen der künftigen Lebenserwartung von einkommensstarken und -schwachen 65-Jährigen zwischen der Mitte der 1990er Jahre und 2008 zunahm.
Die von Wissenschaftlern des Rostocker Max-Planck-Instituts für demografische Forschung und des Zentrums für Bevölkerungsforschung durchgeführte Studie zeigte:
• Mitte der 1990er Jahre betrug der Abstand der Lebenserwartung der beiden Gruppen in Westdeutschland rund drei Jahre und in Ostdeutschland dreieinhalb Jahre.
• 2008 wuchsen die Abstände auf 4,8 und 5,6 Jahre.
• Dies heißt, dass alle deutschen männlichen 65-Jährigen mit sehr kleinen Renten (30-39 Rentenpunkte) 2008 eine durchschnittliche Lebenserwartung von 79,8 Jahren hatten und ihre gleichaltrigen Mitversicherten mit hohen Renten (65 Rentenpunkte und mehr) im Durchschnitt 84,3 Jahre alt wurden.
Die aus verschiedenen Gründen erfolgte Nichtberücksichtigung von Frauen, Ausländern, Beamten und Selbständigen bei dieser Analyse, beeinträchtigt nach Meinung der Wissenschaftler nicht die "Aussagekraft des Ergebnisses". Dies unterstreicht aber den in Deutschland unterentwickelten Zustand der Datenbasis für Untersuchungen des Verhältnisses von Lebenszeit und sozialem Status.
Einen zweiseitigen Überblick über die Ergebnisse der Studie gibt der Beitrag Arme sterben jünger des Mitautors der wissenschaftlichen Studie, Domantas Jasilionis, in dem wie immer empfehlenswerten Newsletter "Demografische Forschung. Aus Erster Hand" (Nr. 3 2013).
Von dem Originalbeitrag Widening socioeconomic differences in mortality among men aged 65 years and older in Germany von Eva Kibele et al. im "Journal of Epidemiology & Community Health" (2013;67: 453-457) gibt es kostenlos das Abstract.
Bernard Braun, 9.10.13
Ärztetag, Armut und Gesundheit: Kleinkariert, selbstbezogen und beschränkt
 So schlimm sind die deutschen Ärzte doch gar nicht, könnte man im Anschluss an den 116. Ärztetag vom 28. - 31. Mai 2013 in Hannover denken. Nach Organspendeskandalen, Abkassiererei durch Individuelle Gesundheitsleistungen (IGeL) und parallel zum Bekenntnis zur regressiven Kopfpauschale in der Krankenkassenfinanzierung - das Forum berichtet in dem Beitrag Auf rückwärtsgewandten Pfaden weiter zur Zweiklassenmedizin - beschlossen die Delegierten des Ärztetags, die gesundheitliche Förderung sozial Benachteiligter zu stärken: "Als Ärzteschaft sehen wir unsere Verantwortung vor allem darin, auf eine Verringerung schichtenspezifischer Unterschiede in den Zugangsmöglichkeiten, in der Inanspruchnahme und Verfügbarkeit gesundheitlicher Leistungen einzuwirken", heißt es in dem angenommen Antrag laut einer Meldung des Deutschen Ärzteblatts.
So schlimm sind die deutschen Ärzte doch gar nicht, könnte man im Anschluss an den 116. Ärztetag vom 28. - 31. Mai 2013 in Hannover denken. Nach Organspendeskandalen, Abkassiererei durch Individuelle Gesundheitsleistungen (IGeL) und parallel zum Bekenntnis zur regressiven Kopfpauschale in der Krankenkassenfinanzierung - das Forum berichtet in dem Beitrag Auf rückwärtsgewandten Pfaden weiter zur Zweiklassenmedizin - beschlossen die Delegierten des Ärztetags, die gesundheitliche Förderung sozial Benachteiligter zu stärken: "Als Ärzteschaft sehen wir unsere Verantwortung vor allem darin, auf eine Verringerung schichtenspezifischer Unterschiede in den Zugangsmöglichkeiten, in der Inanspruchnahme und Verfügbarkeit gesundheitlicher Leistungen einzuwirken", heißt es in dem angenommen Antrag laut einer Meldung des Deutschen Ärzteblatts.
Näheres geht aus der Pressemitteilung der Bundesärztekammer hervor. Richten soll es demnächst der ansonsten eher stiefmütterlich behandelte Öffentliche Gesundheitsdienst (ÖGD). Zwar hatte das Deutsche Ärzteblatt im März 2012 in dem Beitrag Der Öffentliche Gesundheitsdienst: Standortbestimmung mit hoffnungsvollem Ausblick ein interessantes Schlaglicht auf den ÖGD und dessen Annäherung an Public Health geworfen, aber auch der ÖGD spiegelt nur einen kleineren Ausschnitt der Gesundheitswissenschaften wider.
In der deutschen Ärzteschaft herrscht offenkundig ein sehr enges Verständnis vom Zusammenhang zwischen Armut und Gesundheit vor, wie eine online verfügbare Umfrage des Deutschen Ärzteblatts eindrücklich belegt. MedizinerInnen denken zuallererst oder ausschließlich an Ursachen und Ansätze innerhalb Krankenversorgungssystems, wenn es um Armut und Gesundheit geht. Das ist weder verwunderlich noch illegitim - aber eben nur ein Teil einer überaus komplexen Wirklichkeit.
Dem eingeschränkten Mediziner-Denken sitzen auch deutsche Medien auf, wenn sie aus Anlass des 116. Deutschen Ärztetags über den Zusammenhang zwischen Armut und Gesundheit berichten. Zwar ist es zweifelsohne begrüßenswert, dass beispielsweise die Süddeutsche Zeitung diesem Thema einen längeren Beitrag dem Titel Arme sterben früher widmet. Allerdings ist die enge Ausrichtung auf präventiv-medizinische Ansätze wie ärztliche Beratung, Zahnvorsorge, Schwangerenvorsorge doch etwas ernüchternd angesichts der internationalen und teilweise auch nationalen Debatte über Soziale Determinanten von Gesundheit.
Ebenso wie eine Vielzahl früherer Untersuchungen zeigt auch der jüngste umfangreiche Bericht der WHO Kommission zu Sozialen Determinanten von Gesundheit mit dem Titel Closing the gap in a generation, dass die Gesundheit einer Bevölkerung von weitaus mehr gesellschaftlichen Faktoren abhängt als die Deutsche Ärzteschaft zu erkennen scheint. Bildung, Einkommen, soziale Einbindung, Lebens- und Arbeitsverhältnisse, Lärm- und Umweltbelastungen und andere soziale Determinanten bestimmen die Gesundheit der Bevölkerung weitaus mehr als das üblicherweise als Gesundheitswesen bezeichnete Krankenversorgungssystem, dessen Einfluss bei etwa 20 % liegen dürfte. Wer spürbare Auswirkungen von den auf dem Ärztetag 2013 vorgeschlagenen Maßnahmen erwartet, überschätzt massiv die Einflussmöglichkeiten des Medizinsystems und verkennt die große Bedeutung indirekter Gesundheitspolitik auf allen gesellschaftlichen Ebenen.
Auf die vielfach belegten Zusammenhänge zwischen Armut, sozialer Ungleichheit und Gesundheit hat das Forum Gesundheitspolitik wiederholt hingewiesen, so bereits 2005 in dem Beitrag Soziale Ungleichheit, Armut und Gesundheit Soziale Ungleichheit, Armut und Gesundheit oder im Mai 2012 in dem Beitrag Soziale Ungleichheiten der Gesundheit - Erfahrungen und Lehren aus 13 Jahren Labour-Regierung
Wer sich ernsthaft mit dem Thema Sozialer Determinanten von Gesundheit auseinandersetzen will, findet anderswo relevantere Erkenntnisse als auf dem Ärztetag, beispielsweise auf der Homepage vom 18. Kongress Armut und Gesundheit. Eine kleine Minderheit der niedergelassenen Ärzteschaft mag diese Veranstaltung als Ausdruck der vermeintlich linken Dominanz im Gesundheitswesen betrachten, wie es ein Beitrag auf der Homepage des radikalen Niedergelassenen-Netzwerks Hippokranet mit dem Titel Herr Montgomery spielt über Bande nahelegt. Nicht nur dieser wahrlich bemerkenswerte Kommentar belegt, dass sich Teile der deutschen Ärzteschaft mittlerweile meilenweit von den Gedanken eines Rudolf Virchow entfernt hat, der den Arzt noch als quasi natürlichen Sachwalter der Armen betrachtete.
Wer sich ein umfassenderes Bild von der aktuellen Debatte über soziale Determinanten machen möchte, findet neben der oben genannten WHO-Publikation wichtige Hinweise unter den Unterlagen des 18. Kongresse Armut und Gesundheit, der am 6. und 7. März 2013 mit mehr als 2.000 TeilnehmerInnen unter Motto "Brücken bauen zwischen Wissen und Handeln - Strategien der Gesundheitsförderung" in Berlin stattfand. Eine umfangreiche Dokumentation der Thematiken des Kongresses steht kostenfrei zum Download zur Verfügung.
Jens Holst, 31.5.13
Warum ist Schottland der "kranke Mann" Europas, war das immer so und sind Whisky sowie frittierte Schokoriegel die Hauptursachen?
 Zwischen vergleichbaren Ländern Europas und Nordamerikas gibt es gerade in der jüngeren Vergangenheit erhebliche Gesundheits- und auch Sterblichkeitsunterschiede. Das bekannteste Beispiel ist die insbesondere für russische Männer nach der Auflösung der Sowjetunion und der Gründung Russlands dramatische Verringerung der Lebenserwartung auf durchschnittlich unter 60 Jahre. Allein zwischen 1990 und 1994 sank die Lebenserwartung für russische Männer von 63,8 auf 57,7 Jahre und für russische Frauen von 74,4 auf 71,2 Jahre. Näheres erfährt man in dem kostenlos erhältlichen Aufsatz "Causes of Declining Life Expectancy in Russia" von Francis C. Notzon, Yuri M. Komarov, Sergei P. Ermakov, Christopher T. Sempos, James S. Marks, Elena V. Sempos in JAMA (1998; 279(10): 793-800).
Zwischen vergleichbaren Ländern Europas und Nordamerikas gibt es gerade in der jüngeren Vergangenheit erhebliche Gesundheits- und auch Sterblichkeitsunterschiede. Das bekannteste Beispiel ist die insbesondere für russische Männer nach der Auflösung der Sowjetunion und der Gründung Russlands dramatische Verringerung der Lebenserwartung auf durchschnittlich unter 60 Jahre. Allein zwischen 1990 und 1994 sank die Lebenserwartung für russische Männer von 63,8 auf 57,7 Jahre und für russische Frauen von 74,4 auf 71,2 Jahre. Näheres erfährt man in dem kostenlos erhältlichen Aufsatz "Causes of Declining Life Expectancy in Russia" von Francis C. Notzon, Yuri M. Komarov, Sergei P. Ermakov, Christopher T. Sempos, James S. Marks, Elena V. Sempos in JAMA (1998; 279(10): 793-800).
Als eine der wichtigsten Erklärungen für diesen in der Neuzeit wohl größten Verlust an Lebensjahren wurde von vielen Autoren die Einführung einer freien Marktwirtschaft, der Zusammenbruch relativ fester Institutionen und die Erosion sozialer Beziehungen als die entscheidenden sozialen Veränderungen genannt. Der hohe Wodkakonsum als gewichtigstem Gesundheitsverhaltensproblem ist sicherlich gerade auch in Russland zu beachten, erklärt aber die sinkende Lebenserwartung schon deshalb nicht entscheidend, weil er auch in der Sowjetunion relativ hoch war, wenn nicht sogar höher als im nachsowjetischen Russland oder der Ukraine.
Näheres zur Vielfalt von Erklärungen und auch zum langsamen Wiederanstieg der Lebenserwartung ab Mitte der 1990er Jahre findet man u.v.a. in den kostenlosen Abstracts der Aufsätze "Changes in life expectancy in Russia in the mid-1990s" von Vladimir Shkolnikov, Martin McKee und David A Leon in "The Lancet" (2001, Volume 357, Issue 9260: 917 - 921), "Huge variation in Russian mortality rates 1984—94: artefact, alcohol, or what?" von Dr David A Leon, Laurent Chenet, Vladimir M Shkolnikov, Sergei Zakharov, Judith Shapiro, Galina Rakhmanova, Sergei Vassin und Martin McKee in "The Lancet" (1997, Volume 350, Issue 9075: 383 - 388) und "Mass privatisation and the post-communist mortality crisis: a cross-national analysis" von David Stuckler, Lawrence King und Martin McKee in "The Lancet" (2009, Volume 373, Issue 9661:399 - 407).
Eine Gruppe schottischer Gesundheitswissenschaftler hat sich nun die Frage gestellt, warum Schottland auf einem weniger dramatischen Niveau mittlerweile im Vergleich mit Großbritannien und anderen west- und nordeuropäischen Ländern wegen einer deutlich niedrigeren Lebenserwartung als "kranker Mann Europas" gilt. Und auch dabei stellte sich die Frage, ob z.B. der traditionell hohe Whisky-Konsum und sonstige Besonderheiten des gesundheitlich relevanten individuellen Verhaltens in Schottland die entscheidenden Determinanten sind.
Die Wissenschaftler analysierten auf der Suche nach Antworten für den Zeitraum 1855 bis 2006 Daten aus der so genannten "Human Mortality Database" und stellten fest:
• Die Lebenserwartung der schottischen Bevölkerung entsprach fast ein Jahrhundert der in vergleichbar wohlhabenden Ländern Westeuropas.
• Sie begann erst nach 1950 langsamer zu wachsen als in vergleichbaren Ländern. Insbesondere seit 1980 nahm die mit Alkohol, Gewalt, Selbstmord, Arzneimitteln und verschiedenen Erkrankungen assoziierte Sterblichkeit noch einmal erheblich zu. Damit verbunden war die enorme Zunahme immer ungleicher verteilten Erkrankungs- und Sterberisiken. Eine ähnliche Verschlechterung bei der Lebenserwartung begann im Übrigen nach 1981 auch in den USA.
• Die Lebenserwartung in Schottland liegt im Moment zwischen der der westeuropäischen Ländern inklusive England, Wales und Nordirland und der in den osteuropäischen Ländern bzw. den Nachfolgestaaten der Sowjetunion.
• Nach Meinung der Forschergruppe gibt es mindestens 17 Hypothesen über Faktoren welche das besondere Mortalitätsgeschehen in Schottland erklären.
• Nach einer systematischen Überprüfung der Evidenzen dieser Erklärungen konzentrieren sich die Autoren auf eine der Hypothesen, die insbesondere für die besondere Entwicklung seit dem Beginn der 1980er Jahre evidente empirische Belege zu liefern scheint.
• Die entscheidende Annahme dieser Hypothese ist, dass Schottland nach dem Antritt der konservativen Thatcherregierung im Jahre 1979 "suffered disproportionately from a neoliberal 'political attack'".
• Als Indikator für die Existenz und das Wirken neoliberaler Orientierungen und Einflussnahmen benutzen die Autoren den "Index of Economic Freedom". Dieser Index wird aus 23 Faktoren (für den aktuellsten Bericht über das Jahr 2009 42 Indikatoren) gebildet, welche Ökonomen als Indikatoren für ein neoliberales ökonomisches System betrachten. Wer Näheres wissen und sich auch kritisch mit dem Index auseinandersetzen will, kann dies anhand der neuesten Ausgabe "Economic Freedom of the World: 2011 Annual Report"von James Gwartney, Robert Lawson und Joshua Hall machen, die komplett kostenlos von der Website des Fraser Institute heruntergeladen werden kann.
• Insbesondere für die osteuropäischen Länder gab es einen deutlichen inversen Zusammenhang von hohem Index (dieser bewegt sich zwischen 0 für wenig und 10 für viel "freedom" im neoliberalen Verständnis) und Lebenserwartung. Je mehr und verbreiteter neoliberale Bedingungen und Einflüsse vorhanden sind und wirken desto geringer steigt zwischen 1980 und 2006 im Vergleich mit Ländern in denen es weniger neoliberale Einflüsse gibt die Lebenserwartung an oder sinkt sogar. Für Schottland gibt es allerdings nur einen mäßigen ("moderate") statistischen Zusammenhang.
In derselben Ausgabe der Zeitschrift setzt sich der mit internationalen Vergleichen seit Jahrzehnten erfahrene niederländische Gesundheitswissenschaftler Johan Mackenbach kritisch mit dem Erklärungsansatz der schottischen Wissenschaftler auseinander. Trotz einer Reihe bedenkenswerter Argumente kommt aber auch er zu dem folgenden für die weitere Beschäftigung mit der Erklärung ungleicher Risiken zwischen Ländern wichtigen Schluss: "That (seine kritischen Anmerkungen) should, however, not discourage readers to seriously consider the possibility that political decisions, past and present, are playing a role in the explanation of variations in health between Scotland and the rest of the UK, and between countries generally."
Alle Autoren sind sich einig, dass vordergründige Erklärungen wie z.B. mangelhafte Ernährung oder exzessiver Alkoholkonsum nicht und vor allem nicht allein geeignet sind, ungleiche Sterblichkeitsrisiken zu erklären.
Der Aufsatz "Has Scotland always been the 'sick man' of Europe? An observational study from 1855 to 2006" von Gerry McCartney et al. ist im Dezemberheft 2012 des "European Journal of Public Health" (22 (6): 756-760) erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Vom Editorial "From deep-fried Mars bars to neoliberal political attacks: explaining the Scottish mortality disadvantage" Johan P. Mackenbachs (European Journal of Public Health, Vol. 22, No. 6, 751) ist kostenlos nur ein Extrakt erhältlich.
Notwendiger Nachtrag: Warum dem nichtschottischen Betrachter beim Thema Lebenserwartung in Schottland Schokoriegel einfallen könnten und was beides miteinander zu tun haben könnte, gibt Mackenbach preis, wenn er von der angeblich in Schottland verbreiteten Sitte spricht, tiefgefrorene Marsriegel in heißes Öl zu tunken und dann aufzuessen. Selbst wenn man das Verspeisen anfrittierter Schokoriegel nur mit ordentlichen Mengen Whisky bewältigen sollte, wäre auch damit das kürzere Leben der Schotten wahrscheinlich nicht hinreichend erklärbar.
Bernard Braun, 25.11.12
Soziale Ungleichheiten der Gesundheit - Erfahrungen und Lehren aus 13 Jahren Labour-Regierung
 13 Jahre hatte die Labour-Regierung Zeit, die selbst gesteckten Gesundheitsziele zu erreichen: die Gesundheit der in der Gesellschaft am schlechtesten Gestellten verbessern und die Gesundheitslücke ("health gap") verkleinern - dies erklärte die 1997 gewählte Labor-Regierung zu einem Schlüsselelement ihrer Gesundheitsstrategie.
13 Jahre hatte die Labour-Regierung Zeit, die selbst gesteckten Gesundheitsziele zu erreichen: die Gesundheit der in der Gesellschaft am schlechtesten Gestellten verbessern und die Gesundheitslücke ("health gap") verkleinern - dies erklärte die 1997 gewählte Labor-Regierung zu einem Schlüsselelement ihrer Gesundheitsstrategie.
Eine Reihe von Publikationen (siehe Literaturverzeichnis) setzte sich in letzter Zeit mit der Bilanz der Strategie auseinander, teils im Zusammenhang mit der Marmot-Review, in der eine erneuerte Strategie für die Jahre nach 2010 vorgestellt wird (auf die hier allerdings nicht eingegangen werden kann).
Als die Labour Party im Jahr 1997 nach 27 Jahren konservativer Vorherrschaft wieder die Regierung übernahm, schienen die Vorzeichen für eine erfolgreiche Strategie zur Minderung der sozialen Ungleichheiten der Gesundheit günstig, denn England war in vielen Belangen Vorreiter in der Befassung mit Fragen von sozialer Lage und Gesundheit gewesen.
Wegweisendes wurde geleistet
• in der Aufarbeitung von Daten zur Abbildung der sozialen Ungleichheiten der Gesundheit
• in der Durchführung von Studien (z.B. Geburtskohorten 1946, 1958, 1970, Whitehall-Studien)
• in der Aufarbeitung des Wissens in Berichten für die Politik (Black Report 1980, Acheson Report 1998 und - gegen Ende der 13 Jahre Regierung - Marmot Review 2010)
Die konservative Regierung hatte im Jahr 1980 den wegweisenden Black-Report regelrecht in der Schublade verschwinden lassen, ihm dadurch aber paradoxerweise eine hohe Publizität im öffentlichen Raum verschafft.
Die Labour-Regierung ließ sich 1998 durch den Acheson Report mit frischen Informationen und Vorschlägen versorgen und gründete darauf ihre Strategie, die sie in 2 Berichten darlegte:
• 1999 Reducing health inequalities: an action report
• 2002 Cross Cutting Review of Health Inequalities.
Die konkreteste Form erhielt die Strategie 2003 in dem Bericht "Tackling health inequalities: A Programme for Action". Hier legte die Regierung den Ministerien Zuständigkeitsgrenzen hinweg 82 Verpflichtungen auf ("departmental commitments"), die insgesamt mit mehr als 30 Milliarden Pfund Haushaltsmitteln hinterlegt waren.
Die Strategie baute auf 2 übergeordnete Ziele,
• Minderung der Lücke ("gap") in der Lebenserwartung zwischen den Regionen um 10%
• Minderung der Ungleichheit in der Kindersterblichkeit zwischen den Klassen um 10%.
Für das Monitoring wurden 12 nationale Indikatoren ("National Headline Indicators") gebildet, die sich auf Ernährung, Bildung, Obdachlosigkeit, Wohnen, Grippeimpfung, Schulsport, Rauchen, Teenageschwangerschaften und Mortalität an den "major killer diseases" beziehen (Annex C, S. 65-67).
Die vier großen Überschriften zu den 82 Verpflichtungen lauteten:
• Supporting families, mothers and children
• Engaging communities and individuals
• Preventing illness and providing effective treatment and care
• Addressing the underlying determinants of health
Die darunter gefassten Aufgabenbereiche sind im Annex B des Papiers im Einzelnen benannt (S. 58-64). Viele der Maßnahmen zielten auf die einkommensschwache Gruppen oder auf benachteiligte Regionen.
Der Verlauf bzw. die Ergebnisse wurden in mehreren Berichten festgehalten:
• Zwischenberichte zum Stand der Entwicklung 2005 und 2007 sowie eine 10-Jahresbilanz ("Tackling health inequalities: 10 years on"), die im Sinne "halbvolles Glas" zu einer eher positiven Bewertung gelangte
• Bericht des Gesundheitsausschusses des Unterhauses, der im Sinne von "halbleeres Glas" die selben Daten eher negativ bewertete mit einer Reihe berechtigter kritischer Anmerkungen.
Hier einige kurz gefasste Ergebnisse, Erfahrungen, und Lehren:
• Die Lebenserwartung stieg im Landesdurchschnitt im Vergleich der Zeiträume 1995-1997 und 2005-2007 um 3,1 Jahre für Männer sowie 2,1 Jahre für Frauen. In den benachteiligten Regionen (sog. "spearhead group" von lokalen Verwaltungseinheiten) stieg die Lebenserwartung der Männer um 2,9 und der Frauen um 1,9 Jahre.
• Die Kindersterblichkeit fiel landesweit von 5,6 auf 4,7 pro Tausend, in den benachteiligten Regionen von 6,3 auf 5,4.
Auf diese Ergebnisse gibt es zwei zutreffende Sichtweisen:
• Die Ziele zur Minderung der sozialen Ungleichheit der Gesundheit wuden verfehlt.
• Die Gesundheit der Bevölkerung hat sich in diesem 10-Jahreszeitraum deutlich verbessert. Auch die benachteiligten Gruppen haben deutlich gewonnen, bei der Lebenserwartung allerdings etwas weniger als der Bevölkerungsdurchschnitt. Ohne die Strategie dürfte die Gesundheit eher noch weiter auseinandergedriftet sein.
Unabhängig davon, welche Sichtweise man bevorzugt, ist festzuhalten, dass die Strategie einige grundlegende Schwächen hatte.
Die Fokussierung auf zwei Ziele im Zusammenhang mit der Mortalität führt dazu, dass Determinanten und Maßnahmen in Bereichen wie Obdachlosigkeit, Kinderarmut und Brennstoffmangel wegen ihrer geringen Auswirkungen auf die Mortalität für den Erfolg der Strategie nicht zählen. Insgesamt kritisiert insbesondere Mackenbach, dass der Abgleich von Zielen und Maßnahmen (policies) bei weitem nicht optimal gewesen sei. Dies sei ein Ergebnis davon, dass das Programm ein Kompromiss aus Wissenschaft und politischer Opportunität gewesen sei; die Politik habe die 39 Empfehlungen und 123 Unterpunkten des Acheson Report als eine Art Einkaufsliste betrachtet, aus der heraus sie die Punkte auswählte, die am besten in ihre bereits vorhandenen Konzepte passten.
Viele der 82 Verpflichtungen sind zwar erfüllt worden - eine eindrucksvolle Darstellung findet sich im Zwischenbericht 2007 (Tackling Health Inequalities: 2007 Status Report on the Programme for Action) auf den Seiten 64-69. Offensichtlich hätten die Maßnahmen jedoch (noch) effektiver, intensiver und zielgenauer sein müssen. Zur Zielerreichung sind grundlegende Veränderungen in der Verteilung von Ressourcen erforderlich. Hierfür reichten die 82 Verpflichtungen und die 20 Milliarden Pfund nicht aus.
Ausgeblieben ist insbesondere eine gerechtere Verteilung der materiellen Ressourcen. Einkommensungleichheit gilt als eine der wesentlichen Determinanten für die Ungleichheit der Gesundheit. Eine radikale Umverteilung der Einkommen zugunsten der schlechter Gestellten war aber nicht Teil des Wahlprogramms der Labour Party.
Insgesamt konnte die Strategie nicht umfassend auf wissenschaftliche Evidenz gegründet werden, weil diese für die meisten Maßnahmen nicht vorlag. Auch während der 13 Jahre wurden die Gelegenheiten, hochwertige Evidenz zu generieren, nicht konsequent genutzt.
Zusammenfassend ist festzuhalten:
In England wurde die bislang umfassendste Strategie zur Minderung der sozialen Ungleichheit der Gesundheit in Form eines Regierungsprogramms implementiert und über einen Zeitraum von 13 Jahren durchgeführt.
Im Ergebnis wurden (Teil-) Erfolge erzielt. Die "Gesundheitslücke" zu verkleinern ist aber offensichtlich sehr viel schwieriger, als es sich die meisten Wissenschaftler und Politiker bis dahin vorgestellt hatten. Für stärkere Effekte sind zumindest erforderlich: ein noch höheres Maß an politischer Entschlossenheit, als es die Labour-Regierung gezeigt hat, eine bessere Abstimmung von Zielen und Maßnahmen, mehr Wissen über das was funktioniert, also mehr Evidenz und ein Mandat des Wählers an die Regierung, das weiterreichende Maßnahmen erlaubt, wie z.B., eine Minderung der Einkommensungleichheit.
Dies erfordert, wie im Marmot-Bericht ("Fair Society, Healthy Lives") festgestellt wird, eine starke soziale Bewegung, die sich für soziale Gerechtigkeit einsetzt. Für weniger ist eine Minderung der sozialen Ungleichheit der Gesundheit offensichtlich nicht zu haben.
Berichte des Department of Health (Auswahl)
1999 Reducing health inequalities: an action report Website
2002 Tackling health inequalities - cross-cutting review Website
2003 Tackling health inequalities: A Programme for Action Website
2008 Tackling health inequalities: 2007 Status Report on the Programme for Action Website
2009 Tackling health inequalities: 10 years on Website
Berichte zur Politikberatung
• 1980 Inequalities in Health: Report of a Research Working Group. (The Black Report) Website
• 1998 Independent Inquiry into Inequalities in Health Report (Acheson Report) Website
• 2010 Fair Society, Healthy Lives. A Strategic Review of Health Inequalities in England Post-2010 (The Marmot Review) Link
Bericht des Unterhauses
House of Commons. Health Committee - Third Report. Health Inequalities Website, Bericht als PDF Donnload
Erwiderung der Regierung Website
Mackenbach JP. Can we reduce health inequalities? An analysis of the English strategy (1997-2010). Journal of Epidemiology and Community Health 2011;65:568-75 Abstract
Eine Interessante Diskussion über die Marmot Review und die Politik der Labour-Regierung mit insgesamt 9 Beiträgen findet sich in der Oktober-Ausgabe 2011 der Zeitschrift Social Science and Medicine. Link
Hierzu auch ein 12-minütiges Videostatement von Michael Marmot auf YouTube Link
David Klemperer, 16.5.12
Sozioökonomische Struktur des Wohnumfeldes bestimmt dauerhaft den selbst wahrgenommenen Gesundheitszustand
 Der selbst wahrgenommene Gesundheitszustand gilt als valider Indikator für die körperliche und mentale Verfassung. Er ist auch ein verlässlicher Prädiktor für künftige Erkrankungen und die mit ihnen assoziierte Sterblichkeit. Die meisten Studien untersuchen in diesem Zusammenhang Faktoren, die mit dem selbst wahrgenommenen Gesundheitszustand zu einem bestimmten Zeitpunkt oder einer Veränderung assoziiert sind. Ob, wodurch und wie sich dieser Indikator im Zeitverlauf und bei Personen mit unterschiedlichen Neuerkrankungen entwickelt, war aber wenig bekannt.
Der selbst wahrgenommene Gesundheitszustand gilt als valider Indikator für die körperliche und mentale Verfassung. Er ist auch ein verlässlicher Prädiktor für künftige Erkrankungen und die mit ihnen assoziierte Sterblichkeit. Die meisten Studien untersuchen in diesem Zusammenhang Faktoren, die mit dem selbst wahrgenommenen Gesundheitszustand zu einem bestimmten Zeitpunkt oder einer Veränderung assoziiert sind. Ob, wodurch und wie sich dieser Indikator im Zeitverlauf und bei Personen mit unterschiedlichen Neuerkrankungen entwickelt, war aber wenig bekannt.
Eine über fast 18 Jahre von 1987 bis 2006 durchgeführte Längsschnittstudie liefert jetzt hierzu erste Hin-weise. Dazu wurden 15.792 schwarze und weiße TeilnehmerInnen der "Atherosclerosis Risk in Communi-ties"-Kohorte zu Beginn der Studie und dann jedes Jahr mit einer Standardfrage nach ihrem Gesundheits-zustand gefragt. Am Ende lagen 276.200 Einzeldaten vor, denen jeweils ein Wert zwischen 0 Punkten=tot und 95/100 Punkten=exzellente Gesundheit zugewiesen wurde. Zusätzlich wurden stetig die wichtigsten soziodemografischen Merkmale (z.B. Alter, Geschlecht, Ausbildung), Gesundheitsparameter (z.B. Body Mass Index), Merkmale des Gesundheitsverhaltens und der Krankheitsbehandlung und die Qualität der Wohngegend nach dem Zentralwert des Haushaltseinkommens in der Nachbarschaft ("neighbourhood-level median household income") erhoben. Die Gruppe wurde in eine Gruppe von 11.188 TeilnehmerInnen aufgeteilt, die weder zu Beginn noch nach der Studie an Herzinfarkt, Schlaganfall, Lungenkrebs, Herzversagen erkrankt waren oder eine Wiederherstellung der Durchblutung des Herzens z.B. durch eine Bypass-Operation benötigten und den Rest, der an einer oder mehreren dieser Erkrankungen erkrankt war.
Unabhängig vom Eintritt einer der beobachteten Erkrankungen gab es bei allen Kohortenmitgliedern, d.h. auch bei den dauerhaft Gesunden, eine positive Assoziation zwischen dem selbst wahrgenommenem Ge-sundheitszustand und der Wohnumgebung. Erwartungsgemäß war er bei denen am schlechtesten, die in Gegenden mit niedrigem sozioökonomischem Niveau lebten. Die Bewohner besserer Wohngegenden wiesen umgekehrt und kontinuierlich den besten selbst bewerteten Gesundheitszustand auf.
Das Ausgangsniveau und der Verlauf der wahrgenommenen Gesundheit waren nach einer umfassenden Adjustierung nach den erhobenen soziodemografischen und gesundheitsbezogenen Merkmalen sehr un-terschiedlich. Das höchste und am wenigsten verringerte Ausgangsniveau hatten die Personen, die über die gesamten 18 Jahre nicht an einer der ausgewählten Krankheiten erkrankten. Ihr Gesundheitszustand sank von rund 74 maximal um 1,4 Punkte. Fast alle Personen, die während der 18 Jahre schwer erkrankte bewerteten ihren Gesundheitszustand schon drei Jahre vor dem Ereignis schlechter als die dauerhaft Nichterkrankten. Das Ausgangsniveau derjenigen, die z.B. später an einem Herzversagen litten, lag bei 59 Punkten. Bei den später an Herzversagen oder Lungenkrebs erkrankten Personen sank der selbst wahrgenommene Gesundheitszustand schon in den drei Jahren vor dem Erkrankungsjahr um bis zu 8 Punkte. Im ersten Jahr nach dem Eintritt der Erkrankung sank mit Ausnahme der Schlaganfallerkrankten der Wert des selbst bewerteten Gesundheitszustandes bei allen Erkrankten, die das Ereignis überlebten, am stärksten. An dem Gesundheitswert von um die 65 Punkte vor dem Schlaganfall änderte sich auch in den fünf Jahren nach dem Schlaganfall wenig. Im zweiten Jahr nach dem Ereignis stieg mit Ausnahme der an Lungenkrebs erkrankten und häufiger verstorbenen Personen der Wert des selbst bewerteten Ge-sundheitszustandes mehr oder weniger kräftig an, ohne aber das Niveau von vor dem Ereignis auch nach 5 Jahren wieder zu erreichen. Weitere Berechnungen identifizierten das zunehmende Alter und die geringeren Bildungsfertigkeiten als entscheidende Prädiktoren der Abnahme des Niveaus der selbst bewerteten Gesundheit - unabhängig von der Art der Erkrankung. Bei einigen Erkrankungen spielten außerdem noch hoher Blutdruck, Übergewichtigkeit und das Rauchverhalten eine bestimmende Rolle beim Absinken des Gesundheitsniveaus.
Die Studie unterstreicht u.a. die hohe Verlässlichkeit und Empfindlichkeit des Indikators des selbst wahrgenommenen Gesundheitszustandes auch für Analysen des Verlaufs von Krankheitsereignissen sowie auch in diesem Kontext die enorme beherrschende Bedeutung der sozialen Umwelt für den Gesundheitszustand. Die AutorInnen regen außerdem an, die Faktoren, die zu einem schlechten Verlauf der Gesund-heitsbewertungen vor und nach einem Krankheitsergebnis beitragen, daraufhin zu untersuchen, ob man über sie nicht unabhängig von der Erkrankungsart den gesundheitlichen Outcome verbessern kann.
Der Aufsatz "Socioeconomic status and the trajectory of self-rated health" von Randi E. Foraker, Kathryn M. Rose, Patricia P. Chang, Ann M. McNeill, Chirayath M. Suchindran, Elizabeth Selvin und Wayne D. Rosamond ist im Juli 2011 in der Fachzeitschrift "Age Ageing" (40 (6): 706-711) erschienen. Ein kostenloses Abstract ist erhältlich.
Bernard Braun, 28.1.12
Sozial-"Datenreport 2011": Zunahme von gesundheitlicher Ungleichheit zwischen Gering- und Vielverdienern seit den 1990er Jahren
 Auch 2011 ist einer der Klassiker einer umfassenden Sozialberichterstattung in Deutschland (vgl. dazu auch den Forums-Bericht über den "Datenreport 2008") erschienen.
Auch 2011 ist einer der Klassiker einer umfassenden Sozialberichterstattung in Deutschland (vgl. dazu auch den Forums-Bericht über den "Datenreport 2008") erschienen.
Der alle zwei Jahre vom Statistischen Bundesamt, der Bundeszentrale für politische Bildung und dem Wissenschaftszentrum Berlin (WZB) herausgegebene Bericht beruht im Wesentlichen auf Erhebungen der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, auf Berechnungen des Statistischen Bundesamtes, auf Daten des Mikrozensus, einer jährlich durchgeführten Haushaltsstichprobe, an der ein Prozent der Privathaushalte in Deutschland teilnehmen und den langjährigen Daten des Sozioökonomischen Panels (SOEP).
Zu den Oberthemen des Datenreports gehören die Bevölkerung, Familie/Lebensformen und Kinder, Bildung, Wirtschaft und öffentlicher Sektor, Arbeitsmarkt und Erwerbstätigkeit, Einkommen/Ausgaben/Ausstattung privater Haushalte, Sozialstruktur und soziale Lagen, Wohnverhältnisse und Wohnkosten, öffentliche Sicherheit und Strafverfolgung, Räumliche Mobilität und regionale Unterschiede, Umwelt und Nacvhhaltigkeit, Freizeit und gesellschaftliche Partizipation, Demokratie und politische Partizipation, subjektives Wohlbefinden und Wertorientierungen, Deutschland in Europa sowie Gesundheit und soziale Sicherung.
Neben den schon immer dargestellten Eckdaten zum Gesundheitszustand der Bevölkerung und den Ressourcen der Gesundheitsversorgung oder den Einstellungen zur Gesundheit und dem gesundheitsbezogenen Verhalten enthält der neueste Report erstmals auch Daten zum Thema gesundheitliche Ungleichheit in der erwachsenen Bevölkerung
Zunächst werden anhand der klassischen Ungleichheitsdimensionen Einkommen, Bildung und Berufsstatus Ungleichheiten in der gesundheitlichen Lage und im Gesundheitsverhalten aufgezeigt. Im Anschluss werden Bezüge zu Arbeitslosigkeit und zur Bevölkerung mit Migrationshintergrund hergestellt. Eine abschließende Betrachtung der Entwicklung gesundheitlicher Ungleichheiten im Verlauf der letzten 15 Jahre rundet den Beitrag ab.
Wesentliche Erkenntnisse lauten beispielsweise so:
• Die Unterschiede bei der Selbsteinschätzung des Gesundheitszustandes - einem wichtigen und validen Gesundheitsindikator - haben zwischen den Angehörigen der unteren und oberen Einkommensgruppe in den letzten Jahren fast durchweg zugenommen: "Für die 18- bis 64-jährige Bevölkerung zeigt sich im Vergleich von drei Beobachtungszeiträumen (1994 bis 1999, 2000 bis 2005 und 2006 bis 2009), dass in der niedrigen Einkommensgruppe der Anteil der Männer und Frauen, die ihren allgemeinen Gesundheitszustand als weniger gut oder schlecht beurteilen, im Verlauf der letzten 15 Jahre zugenommen hat. In der hohen Einkommensgruppe und bei Frauen auch in der mittleren Einkommensgruppe ist eine gegenläufige Entwicklung zu beobachten. Bezüglich des Risikos eines weniger guten oder schlechten allgemeinen Gesundheitszustandes lässt sich nach Kontrolle des Alterseinflusses die Aussage treffen, dass die Differenz zwischen der niedrigen und hohen Einkommensgruppe bei Männern um 46% und bei Frauen um 39 % zugenommen hat." (257)
• Auch der "objektive" Gesundheitsindikator, nämlich die Häufigkeit mit der viele Krankheiten und Beschwerden in der Bevölkerung vorkommen, belegt ein vermehrtes Erkrankungsrisiko bei Personen mit geringem Einkommen, unzureichender Bildung und niedriger beruflicher Stellung. So treten bei Menschen mit niedrigem Einkommen in der Altersgruppe ab 45 Jahre Herzinfarkte, Schlaganfälle, Hypertonie, Diabetes oder Depressionen häufiger auf.
• Selbst wenn sich eine Komponente des gesundheitlichen Verhaltens insgesamt positiv entwickelt, wie zum Beispiel die körperliche-sportliche Aktivität, zeigen sich signifikante Ungleichheiten: "Für die Sportbeteiligung ist im Zeitraum 1994 bis 2009 eine deutliche Zunahme festzustellen. Dabei fällt auf, dass in der Altersspanne von 18 bis 44 Jahren der Anteil der Männer und Frauen, die in den letzten vier Wochen keinen Sport getrieben haben, in allen Bildungsgruppen abgenommen hat. Bei Personen mit hoher Bildung zeichnet sich diese Entwicklung aber noch deutlicher ab als bei Personen mit mittlerer und nied riger Bildung. Nach Kontrolle des Alterseffektes kann die Zunahme des Risikos für sportliche Inaktivität im Vergleich der niedrigen zur hohen Bildungsgruppe bei Männern mit 61 % und bei Frauen mit 72 % beziffert werden." (258)
• Als Ursachen und Gründe der ungleichen Gesundheitsrisiken verweisen die AutorInnen an vorderster Stelle "auf den Tabak- und Alkoholkonsum, die Ernährung und körperlich-sportliche Aktivität sowie zum Teil auch die Inanspruchnahme von Präventions- und Versorgungsangeboten." (258) Diesem stark individuellen und verhaltensorientierten Erklärungsversuch folgt zwar noch der Hinweis auf den eher kollektiven und verhältnisorientierten Einflussfaktor der Arbeitslosigkeit, die sie in materieller wie psychosozialer Sicht "mit einer schlechteren Gesundheit assoziiert" sehen. Was leider fehlt, sind sowohl theoretische Hinweise wie auch empirische Belege für weitere soziale Determinanten von Gesundheit wie die Bildungs- oder auch Weiterbildungschancen, die so genannten atypischen Beschäftigungsverhältnisse oder die Diskriminierung von älteren Erwerbsfähigen oder auch Rentnerinnen in der Arbeitswelt und im gesellschaftlichen Leben.
Der 451 Seiten umfassende zweibändige Datenreport 2011. Ein Sozialbericht fur die Bundesrepublik Deutschland und damit auch das von Thomas Lampert, Lars Eric Kroll Benjamin Kuntz und Thomas Ziese verfasste Kapitel über "Gesundheitliche Ungleichheit" sind weiterhin für deutsche Verhältnisse vorbildlich komplett und kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 12.10.11
Gesundheitliche Ungleichheit am Beispiel Erwerbsminderung: Niedrig Qualifizierte tragen bis zu 10-x höheres Risiko als Akademiker
 Bildung ist der wichtigste Einflussfaktor auf die unfreiwillige, weil u.a. mit erheblichen finanziellen Nachteilen verbundene Inanspruchnahme einer Erwerbsminderungsrente. Konkret heißt dies: Gering qualifizierte Arbeitnehmer tragen ein sehr viel höheres Risiko als Akademiker, wegen einer Krankheit dauerhaft arbeitsunfähig zu werden: Die Wahrscheinlichkeit ist bei niedrig Qualifizierten bis zu zehnmal so hoch.
Bildung ist der wichtigste Einflussfaktor auf die unfreiwillige, weil u.a. mit erheblichen finanziellen Nachteilen verbundene Inanspruchnahme einer Erwerbsminderungsrente. Konkret heißt dies: Gering qualifizierte Arbeitnehmer tragen ein sehr viel höheres Risiko als Akademiker, wegen einer Krankheit dauerhaft arbeitsunfähig zu werden: Die Wahrscheinlichkeit ist bei niedrig Qualifizierten bis zu zehnmal so hoch.
Eine Auswertung der Rentenversicherungs-Routinedaten von 127.199 Menschen, die 2008 zum ersten Mal eine Erwerbsminderungsrente bewilligt bekamen, also zu krank waren, um regulär weiterzuarbeiten, zeigte zweierlei:
• Fast jeder fünfte Arbeitnehmer, der heute in Rente geht, muss sein Arbeitsleben aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig beenden und bekommt eine Erwerbsminderungsrente. Sehr häufige Krankheiten sind Muskel-Skelett-Erkrankungen etwa aufgrund schwerer körperlicher Arbeit, Erkrankungen von Herz und Kreislauf sowie psychische Leiden aufgrund etwa von Arbeitsverdichtung und Stress.
• Bei den Frauen und Männern mit Fach- oder Hochschulabschluss gehen mit Ende 50 nur rund fünf von 1.000 gesetzlich Rentenversicherten in die Erwerbsminderungsrente. Bei niedrig qualifizierten Männern sind es hingegen fast 25, bei niedrig qualifizierten Frauen 19. Beschäftigte mit mittlerer Qualifikation liegen demnach dazwischen.
Neben der Qualifikation spielen aber auch noch Geschlecht und Wohnort eine Rolle beim Risiko nicht mehr regulär weiterarbeiten zu können: So haben westdeutsche Männer und Freauen ein generell niedrigeres Risiko als ihre ostdeutschen "Brüder und Schwestern". Männer haben sowohl in West- wie in Ostdeutschland das jeweils höhere Risiko, mit einer Erwerbsminderungsrente frühzeitig aus dem Arbeitsleben zu scheiden. Und auch bei den Krankheiten, die zur Erwerbsminderung führen gibt es einige soziodemografisch relevante Unterschiede: So ist in Ost wie West das Risiko wegen psychischer Erkrankungen in Frührente gehen zu müssen bei Frauen höher als bei Männern. Umgekehrt sieht es bei der Frührente wegen Muskel- und Skeletterkrankungen aus - doch ist in Westdeutschland der Anteil der männlichen und weiblichen Frührentner an 1.000 aktiv Versicherten fast gleich hoch (0,70 und 0,68).
Die von den im Institut für Soziologie der Freien Universität Berlin, im Deutschen Zentrum für Altersfragen, im Robert-Koch-Institut und im Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung arbeitenden WissenschaftlerInnen Christine Hagen, Ralf K. Himmelreicher, Daniel Kemptner und Thomas Lampert erstellte Studie Soziale Ungleichheit und Risiken der Erwerbsminderung ist in den WSI Mitteilungen (der Fachzeitschrift des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) in der Hans-Böckler-Stiftung) 7/2011 erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 30.9.11
Weltweit sozial ungleiche Unterversorgung mit Medikamenten zur Sekundärprävention nach Herzinfarkt und Schlaganfall
 Zu den notwendigen, nachweislich wirksamen und zum Teil auch relativ preisgünstigen Mitteln, die Patienten nach einem Herzinfakt oder Schlaganfall sekundärpräventiv einnehmen sollten, gehören blutverflüssigende Wirkstoffe wie die Acetylsalicylsäure (ASS), diverse Blutdrucksenker (Betablocker, ACE-Hemmer) und Statine.
Zu den notwendigen, nachweislich wirksamen und zum Teil auch relativ preisgünstigen Mitteln, die Patienten nach einem Herzinfakt oder Schlaganfall sekundärpräventiv einnehmen sollten, gehören blutverflüssigende Wirkstoffe wie die Acetylsalicylsäure (ASS), diverse Blutdrucksenker (Betablocker, ACE-Hemmer) und Statine.
Eine kanadische Forschergruppe untersuchte nun in einer so weltweit erstmals durchgeführten Studie (die so genannte "Prospective Urban Rural Epidemiological (PURE) study") mit 153.996 erwachsenen Personen zwischen 35 und 70 Jahren aus 628 städtischen und ländlichen Gemeinden, wie der Versorgungsalltag der in dieser Population identifizierten 7.942 Herzinfakt- und Schlaganfallpatienten aussieht. Die Länder der Studienteilnehmer wurden nach ihrem durchschnittlichen Einkommensniveau in drei reichere, sieben mit mittlerem Einkommen und vier arme Länder unterschieden.
Das Gesamtbild war eindeutig: Meist weniger die Hälfte der Patienten erhielt auf schriftliches oder mündliches Befragen eines der Medikamente verordnet. Zusätzlich gab es überall auch noch ein mehr oder weniger starkes und meist statistisch hochsignifikantes soziale Gefälle bei der Behandlung.
Im Einzelnen sah es so aus:
• ASS erhielten durchschnittlich nur rund 25% der Patienten verordnet, die sekundärpräventiv behandelt wurden. Die Verordnungsrate schwankte dabei zwischen 62% in wohlhabenderen Länddern wie Kanada oder Schweden, 20 bis 25% in Ländern mit mittlerem Durchschnittseinkommen wie etwa Polen oder China und 9% in armen Ländern wie Pakistan oder Simbabwe.
• Statine erhielten durchschnittlich 14,6% der Patienten. Der Wert lag in reicheren Ländern bei 66% und in armen Ländern bei 3%.
• ACE-Hemmer nahmen insgesamt 19,5% aller an den beiden Krankheiten erkrankten Personen. Und auch hier stand einer Verordnungs-/Einnahmerate von knapp 50% in den reicheren Ländern eine Rate von 5% in den ärmeren Ländern gegegenüber.
• In den reicheren Ländern erhielten 11,2% der Herzinfarkts- und Schlaganfallspatienten überhaupt keines der sekundärpräventiven Arzneimittel. Dieser Wert stieg in über 45% und 69% in der Gruppe der Länder mit mittlerem Einkommen (differenziert in oberes und unteres mittleres Einkommen) bis auf 80,2% in Ländern mit geringem Durchschnittseinkommen.
• Korrespondierend mit dieser Ungleich- bzw. Unterversorgung gibt es auch erhebliche Unterschiede zwischen der Versorgung der Stadt- und Landbevölkerung: Zum Beispiel wurden Medikamente mit dem Wirkstoff ASS 29% der in Städten lebenden Kranken verordnet aber nur 21% der auf dem Lande lebenden Kranken. Auch hier waren die Stadt-Landunterschiede in ärmeren Ländern größer als in reicheren.
• Interessant war schließlich noch, dass die Nutzung dieser sekundärpräventiven Arzneimittel stärker mit dem sozialen und ökonomischen Niveau des jeweiligen Landes assoziiert war als mit Individualfaktoren wie dem Alter, Geschlecht, Rauchverhalten, Gewicht etc.
Zu dem am 28. August 2011 "early online" publizierten Aufsatz "Use of secondary prevention drugs for cardiovascular disease in the community in high-income, middle-income, and low-income countries (the PURE Study): a prospective epidemiological survey" von Salim Yusuf et al. aus der Fachzeitschrift "The Lancet" gibt es kostenlos ein relativ üppiges Abstract.
Bernard Braun, 31.8.11
Finanzkrise 2008 ff. und Gesundheit: Anstieg der Arbeitslosigkeit erhöht die Anzahl der Selbsttötungen
 Eine internationale Forschergruppe fand 2009 für den Zeitraum von 1970 bis 2007 einen signifikanten Zusammenhang von wachsender Arbeitslosigkeit, Selbstmorden und Verkehrsunfällen in der Bevölkereung von 26 EU-Ländern heraus: Ein Anstieg der Arbeitslosigkeit von 1% führte bei den meisten Altersgruppen von 0 bis 65 Jahren zu einem Anstieg der Selbstmorde um 0,79%. Betrug die Steigerungsrate 3% wuchs die Anzahl der Selbstmorde um 4,45%. Die Anzahl der Verkehrsunfalltoten nahm wegen der geringeren Mobilität - so die Erklärung der Forscher - ab. Einen weiteren engen Zusammenhang sah die Forschungsgruppe zwischen der Existenz und Intervention sozialer Sicherungssysteme und der Selbstmordhäufigkeit. So dämpfte etwa die Investition von 10 US-Dollar in aktive Arbeitsmarktpolitik den Effekt von Arbeitslosigkeit auf die Selbstmordhäufigkeit um 0,038%.
Eine internationale Forschergruppe fand 2009 für den Zeitraum von 1970 bis 2007 einen signifikanten Zusammenhang von wachsender Arbeitslosigkeit, Selbstmorden und Verkehrsunfällen in der Bevölkereung von 26 EU-Ländern heraus: Ein Anstieg der Arbeitslosigkeit von 1% führte bei den meisten Altersgruppen von 0 bis 65 Jahren zu einem Anstieg der Selbstmorde um 0,79%. Betrug die Steigerungsrate 3% wuchs die Anzahl der Selbstmorde um 4,45%. Die Anzahl der Verkehrsunfalltoten nahm wegen der geringeren Mobilität - so die Erklärung der Forscher - ab. Einen weiteren engen Zusammenhang sah die Forschungsgruppe zwischen der Existenz und Intervention sozialer Sicherungssysteme und der Selbstmordhäufigkeit. So dämpfte etwa die Investition von 10 US-Dollar in aktive Arbeitsmarktpolitik den Effekt von Arbeitslosigkeit auf die Selbstmordhäufigkeit um 0,038%.
In dieser Analyse wagten die Wissenschaftler die Vorhersage, dass die internationale Finanzkrise des Jahres ähnliche messbare Effekte haben würde, und zwar sehr rasch und kurzfristig.
Eine erste, am 9. Juli 2011 im Medizin-Journal Lancet veröffentlichte Analyse der Entwicklungen der Selbstmordhäufigkeit in 6 alten (z.B. Österreich, Finnland, Großbritannien) und 4 neuen (z.B. Ungarn, Litauen) EU-Ländern von 2007 bis 2009, bestätigte jetzt die Vorhersage und lieferte ein paar zusätzliche Einblicke in die Dynamik der Zusammenhänge.
Die wichtigsten Ergebnisse lauteten:
• Der ständige Rückgang der Selbstmorde bis 2007 hörte 2008 schlagartig auf.
• In den neuen EU-Ländern stieg die Selbstmordrate weniger als 1% an, in den alten EU-Ländern dagegen um beinahe 7%. In beiden Ländergruppen setzte sich der Anstieg 2009 fort.
• In den Ländern, die bis zum heutigen Tag die Krisenschlagzeilen bestimmen, also Griechenland, Irland und das ebenfalls knapp dem Staatsbankrott entkommene Litauen, lag der Anstieg der Selbstmorde bei 17%, 13% und mehr als 17%.
• In 2009 betrug der Anstieg gegenüber 2007 in fast allen Ländern 5%. Einzige Ausnahme ist Österreich, wo es 2009 5% weniger Selbstmorde gab als 2007.
• Auch 2008 und 2009 sank die Todesrate durch Verkehrsunfälle.
• Sowohl in der 30-Jahresuntersuchung als in der Finanzkrisen-Analyse zeigte sich kein evidenter Einfluss der Arbeitslosigkeitstrends auf die Gesamtsterblichkeit.
• Der Versuch, die relativ positive Entwicklung in Österreich mit dem dortigen stabilen sozialen Netzwerk zu erklären, steht auf wackeligen Beinen. Finnland, ebenfalls ein Land mit einem hoch entwickelten und wirksamen sozialen Sicherheitssystem, nahmen Selbstmorde um rund 5% zu.
Auf die angekündigten weiteren Analysen der Wissenschaftlergruppe mit Daten aus weiteren Ländern und weiteren Detailuntersuchungen der Art des Zusammenhangs von sozialen Sicherheitssystemen, Arbeitslosigkeit und Sterblichkeit darf man gespannt sein.
Wünschenswert sind zusätzlich weitere aktuelle Analysen der möglichen Auswirkungen von Arbeitslosigkeit auch auf die Morbidität.
Von der 2009 erschienen Studie "The public health effect of economic crises and alternative policy responses in Europe: an empirical analysis" von David Stuckler, Sanjay Basu, Marc Suhrcke, Adam Coutts und Martin McKee, erschienen in "The Lancet" (Volume 374, Issue 9686, Pages 315 - 323) gibt es kostenlos lediglich das Abstract.
Komplett kostenlos erhält man dagegen die knappe "Correspondence" Effects of the 2008 recession on health: a first look at European data von Stuckler et al. in "The Lancet" (Volume 378, Issue 9786, Pages 124 - 125).
Bernard Braun, 17.7.11
Sozialer Aufstieg ist nicht gesundheitsförderlich - sozialer Abstieg hingegen gesundheitsriskant
 Studien, die sich mit den Zusammenhängen von sozialer Lage und Gesundheit beschäftigen, vermitteln häufig den Eindruck, dass durch soziale Aufwärts-Mobilität gesundheitliche Ungleichheiten vermieden oder gemildert werden könnten. Eine britische Untersuchung kommt jedoch zu einem anderen Ergebnis: nur der soziale Abstieg wirkt sich auf das Gewicht aus - und zwar negativ. Die Prävalenz von Adipositas ist bei sozialen Aufsteigern dagegen genauso hoch, wie in der sozialen Schicht aus der sie kamen.
Studien, die sich mit den Zusammenhängen von sozialer Lage und Gesundheit beschäftigen, vermitteln häufig den Eindruck, dass durch soziale Aufwärts-Mobilität gesundheitliche Ungleichheiten vermieden oder gemildert werden könnten. Eine britische Untersuchung kommt jedoch zu einem anderen Ergebnis: nur der soziale Abstieg wirkt sich auf das Gewicht aus - und zwar negativ. Die Prävalenz von Adipositas ist bei sozialen Aufsteigern dagegen genauso hoch, wie in der sozialen Schicht aus der sie kamen.
Ob diese Erwartungen berechtigt oder lediglich politisch wünschenswert sind, ist nicht einfach zu untersuchen. Dazu braucht man langjährige Daten über möglichst viele Indikatoren für die soziale Lage (z.B. Ausbildungs- und Beschäftigungsstand sowie Einkommen), deren Veränderungen in der Zeit und ebenfalls differenzierte Daten zur Inzidenz und Prävalenz von Erkrankungen.
Eine der wenigen großen bevölkerungsbezogenen Datensammlungen, die sich dem Thema der sozialen Determiniertheit von Gesundheit widmet, ist die in den Jahren 1985 bis 1988 gestartete so genannte Whitehall II-Studie. In ihr wurden diese Daten für 10.308 britische Staatsbeamte im damaligen Alter von 35 bis 55 Jahren gesammelt und die Angaben werden weiterhin laufend aktualisiert. In der fünften Phase der Studie wurden 1997 bis 1999 im Rahmen einer Zusatzstudie klinischen Untersuchungen bei 4.598 Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Alter von 44 bis 69 Jahren zur Prävalenz von Übergewicht und Adipositas erhoben. Diese Werte konnten dann zusammen mit den für diese Kohorte gesammelten Daten zur sozialen Lage und Entwicklung auf die Art und den Umfang möglicher Zusammenhänge untersucht werden.
Die wesentlichen Ergebnisse dieser von britischen und dänischen Forschern durchgeführten Untersuchung lauten folgendermaßen:
• Soziale Mobilität hat nur dann einen Effekt für die Gesundheit und hier für Übergewicht und Adipositas, wenn es sozial abwärts geht: 52 % der Beamtinnen, die einen sozialen Abstieg durchlebten, waren übergewichtig oder adipös, während dies lediglich 36,1 % der Beamtinnen waren, die auf ihrem hohen sozialen Niveau stabil geblieben sind.
• Personen, die sozial nach oben mobil waren, hatten fast die gleiche Übergewichts- und Adipositas-Prävalenz wie diejenigen Personen, deren niedrigerer sozialer Status unverändert geblieben ist: Die Prävalenz betrug bei diesen beiden Gruppen weiblicher Studienteilnehmer fast identische 62,3 % und 63,9 %.
• Zugleich wurde in der Kohortenstudie deutlich: Eine im Lebensverlauf zu beobachtende Kumulation sozialer Benachteiligung erhöht das Risiko von Übergewicht und Adipositas bis um das 2.6-fache.
Die Autoren ziehen aus ihrer Untersuchung den praktischen Schluss, Public Health-Aktivitäten müssten sich vor allem darauf richten, die Abwärtsmobilität und die Akkumulation von sozialen Nachteilen zu verhindern. Umgekehrt hätte eine Konzentration auf die Förderung der Aufwärtsmobilität bei Weitem nicht die gesundheitlichen Effekte, die damit möglicherweise verknüpft werden.
Von der Studie ist kostenlos nur ein Abstract erhältlich: Alexandros Heraclides; Niels Steensens: Social mobility and social accumulation across the life course in relation to adult overweight and obesity: the Whitehall II study (Journal of Epidemiology and Community Health, 64: 714-719, 2010)
Bernard Braun, 20.1.11
Oberschicht-Angehörige haben bei Krebserkrankungen eine deutlich längere Überlebensrate
 Eine kanadische Studie, die knapp 40.000 Krebserkrankungen in der kanadischen Provinz Ontario untersucht hat, kam jetzt zu dem Ergebnis, dass Angehörige oberer Sozialschichten eine deutlich höhere Überlebensrate haben als Unterschicht-Angehörige. Diese jetzt in der Fachzeitschrift "Cancer" veröffentlichten Ergebnisse sind insofern überraschend, als sich bei der Erstdiagnose kein Unterschied im Schweregrad und Stadium der Krebserkrankung gezeigt hatte, wenn man Erkrankungen in den verschiedenen Sozialschichten miteinander verglich.
Eine kanadische Studie, die knapp 40.000 Krebserkrankungen in der kanadischen Provinz Ontario untersucht hat, kam jetzt zu dem Ergebnis, dass Angehörige oberer Sozialschichten eine deutlich höhere Überlebensrate haben als Unterschicht-Angehörige. Diese jetzt in der Fachzeitschrift "Cancer" veröffentlichten Ergebnisse sind insofern überraschend, als sich bei der Erstdiagnose kein Unterschied im Schweregrad und Stadium der Krebserkrankung gezeigt hatte, wenn man Erkrankungen in den verschiedenen Sozialschichten miteinander verglich.
Die Forschungslage zum Zusammenhang von Krebserkrankungen und Sozialschicht ist nicht nur in Deutschland recht unbefriedigend. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen fasst den Erkenntnisstand in seinem Gutachten "Koordination und Qualität im Gesundheitswesen" so zusammen: "Bei folgenden Lokalisationen ist offenbar eine erhöhte Prävalenz in der unteren sozialen Schicht vorhanden: Magen-/Darmkrebs, Lungenkrebs, Nieren-/Blasenkrebs, Leukämie und maligne Lymphome. (…) Ein entsprechender Zusammenhang ist aber nicht durchgängig für alle Arten von Neubildungen zu erkennen." Die Differenzen sind dabei nicht unbeträchtlich. Männliche Angehörige der unteren Sozialschicht haben zum Beispiel ein 70% höheres Risiko an Magen-/Darmkrebs zu erkranken als Mitglieder der Oberschicht. (S. 74)
Die jetzt in Ontario durchgeführte Studie erfasste in den Jahren 2003 bis 2007 alle in den acht regionalen Krebsregistern der Provinz Ontario gemeldeten Krebserkrankungen, sofern es sich um Brustkrebs, Magenkrebs, Darmkrebs, Lungenkrebs, Gebärmutterhalskrebs oder Kehlkopfkrebs handelte. Für jeden einzelnen Fall wurde registriert: Das vom jeweiligen Arzt diagnostizierte Stadium der Erkrankung (abhängig z.B. von Metastasen), Alter und Geschlecht des Patienten, die exakte Diagnose der Krebsart (ICD-Klassifikation) und schließlich auch die Schichtzugehörigkeit. Diese wurde näherungsweise errechnet anhand der Wohnadresse des Patienten und verfügbarer Informationen über das durchschnittliche Einkommen in diesem Wohnquartier. Alle Patienten wurden so einer von 5 Sozialschichten zugeordnet, von der Oberschicht über obere Mittelschicht, Mittelschicht und untere Mittelschicht bis hin zur Unterschicht. Erfasst wurden überdies auch die den Krebsregistern gemeldeten Todesfälle.
In den statistischen Analysen zeigten sich dann erhebliche Unterschiede, wenn man 5-Jahres-Überlebensraten allgemein (ohne Berücksichtigung der Todesursache) und krebsspezifische 3-Jahres-Überlebensraten in den verschiedenen Sozialschichten miteinander verglich. So betrugen beispielsweise die 5-Jahres-Überlebensraten innerhalb der fünf Sozialschichten (von unten nach oben):
• Brustkrebs: 77%, 79%, 81%, 83%, 84%
• Darmkrebs: 52%, 53%, 54%, 57%, 60%
• Gebärmutterhalskrebs: 63%, 71%, 71%, 73%, 79%
Ähnliche, wenngleich nicht ganz so hohe Differenzen zwischen den Schichten ergaben sich bei einem Vergleich der krebsspezifischen 3-Jahres-Überlebensraten, bei denen nur die jeweils diagnostizierte Krebserkrankung als Todesursache für die Analysen berücksichtigt wurde.
Um zu überprüfen, ob für die signifikant unterschiedlichen Überlebensraten ursächlich sein könnte, dass bei Angehörigen unterer Sozialschichten (etwa durch spätes Aufsuchen eines Arztes) im Durchschnitt ein sehr viel späteres Krebsstadium bei der Erstdiagnose vorliegt, wurden dann im Rahmen multivariater Analysen auch diese Informationen über das Stadium und ebenso das Lebensalter berücksichtigt. An den Ergebnissen änderte sich jedoch nur wenig. Hier zeigte sich dann etwa, dass bei Brustkrebs die Wahrscheinlichkeit, 5 Jahre nach der Erstdiagnose noch zu leben, bei Oberschicht-Patienten (im Vergleich zu Unterschicht-Angehörigen) um 47% höher ist, bei Darmkrebs um 36%.
Die Wissenschaftler zeigen sich überrascht von ihren Befunden, da es in Kanada - im Unterschied zu den benachbarten USA - eine medizinische Versorgung gibt, die für alle Bevölkerungsgruppen verfügbar ist. Sie diskutieren verschiedene Erklärungsmöglichkeiten für ihre Befunde. Denkbar ist einerseits dass das schichtenspezifische Gesundheitsverhalten (z.B. höhere Raucherquoten in der Unterschicht) eine Rolle spielen könnte. Möglich sind nach ihrer Meinung aber auch unterschiedliche Versorgungsleistungen, in Abhängigkeit allein von der Sozialschicht. So hatte eine schwedische Studie 2008 herausgefunden: Oberschicht-Angehörige erhalten nach einem Herzinfarkt öfter eine bessere medizinische Versorgung - und leben danach länger. Und ähnlich hatte eine US-amerikanische Studie gezeigt: Hohes Einkommen und Bildungsniveau steigern die Überlebenszeit nach einem Herzinfarkt deutlich
Hier ist ein Abstract der jetzt veröffentlichten kanadischen Studie zu schichtspezifischen Überlebensraten bei Krebs: Christopher M. Booth et al: The impact of socioeconomic status on stage of cancer at diagnosis and survival. A population-based study in Ontario, Canada (Cancer, Early View, Published Online: 2 Aug 2010)
Gerd Marstedt, 5.8.10
Schwedische ADHS-Studie: Medikamente werden häufiger verschrieben bei unterprivilegierten Müttern
 Eine große schwedische Studie, in der jetzt Daten von 1,1 Millionen Kindern und Jugendlichen (Alter 6-19 Jahre) analysiert wurden, hat gezeigt: Das sogenannte Aufmerksamkeitsdefizit- Hyperaktivitäts-Syndrom findet sich sehr viel häufiger bei Kindern, wenn Mütter aus unterprivilegierten sozialen Milieus kommen, also eine geringe Schulbildung aufweisen, alleinerziehend sind oder von Sozialhilfe leben. Genauer gesagt, wurde die Verteilung von ADHS nicht anhand ärztlicher Krankheitsdiagnosen untersucht, sondern die Verschreibung bestimmter, für die Krankheit typischer Medikamente wie Ritalin analysiert.
Eine große schwedische Studie, in der jetzt Daten von 1,1 Millionen Kindern und Jugendlichen (Alter 6-19 Jahre) analysiert wurden, hat gezeigt: Das sogenannte Aufmerksamkeitsdefizit- Hyperaktivitäts-Syndrom findet sich sehr viel häufiger bei Kindern, wenn Mütter aus unterprivilegierten sozialen Milieus kommen, also eine geringe Schulbildung aufweisen, alleinerziehend sind oder von Sozialhilfe leben. Genauer gesagt, wurde die Verteilung von ADHS nicht anhand ärztlicher Krankheitsdiagnosen untersucht, sondern die Verschreibung bestimmter, für die Krankheit typischer Medikamente wie Ritalin analysiert.
1.162.524 schwedische Kinder und Jugendliche im Alter von 6-19 Jahren wurden von einem Forschungsteam aus Stockholm und Uppsala anhand mehrerer Nationaler Register in die Analysen einbezogen. Erfasst wurde einerseits anhand des schwedischen Medikamenten-Registers, ob den Studienteilnehmern im Jahre 2005 ein Medikament verschrieben wurde, das einen für ADHS charakteristischen Wirkstoff wie Methylphenidat ("Ritalin") enthält. Andererseits wurde eine Reihe sozialstatistischer Daten der Mütter erfasst, so unter anderem Geschlecht, Alter, Region des Wohnsitzes, Schulbildung, Art der Einkünfte (Sozialhilfe ja oder nein), ob alleinerziehend. Ferner wurde berücksichtigt, ob eine psychiatrische Erkrankung oder Suchterkrankung vorliegt.
Insgesamt fand man 7.960 Fälle, bei denen ADHS-Medikamente verschrieben wurden, dabei überwogen männliche Kinder und Jugendliche mit 1.06 % der Gesamtstichprobe im Vergleich zu 0.29 % Mädchen. Methylphenidate (wie "Ritalin") wurden am häufigsten verschrieben (88%), gefolgt von Atomoxetin (wie "Strattera") (9%) and Amphetaminen (3%).
In multivariaten Analysen (unter gleichzeitiger Berücksichtigung aller dieser Einflussfaktoren) zeigte sich dann, dass drei dieser Merkmale besonders stark mit der Verschreibung von ADHS-Medikamenten zusammenhängen.
• Den deutlichsten Effekt zeigte das Bildungsniveau der Mutter. Bei niedriger Schulbildung (0-9 Schulklassen absolviert) war die Wahrscheinlichkeit ("Odds-Ratio"), dass das Kind ADHS-Medikamente einnimmt, 2,3mal so hoch wie bei Müttern mit sehr hoher Schulbildung.
• Wenn die Mutter alleinerziehend war, lag das Risiko bei 1,45 und wenn sie von Sozialhilfe lebte, betrug es 2,06.
• Ein niedriges Bildungsniveau der Mutter erklärt 33 Prozent der ADHS-Fälle bzw. Medikamenten-verschreibungen, 14 Prozent gehen auf das Konto der Alleinerziehung.
Zur Studie gibt es kostenlos nur ein kurzes Abstract: A Hjern, GR Weitoft, F Lindblad: Social adversity predicts ADHD-medication in school children - a national cohort study (Acta Pćdiatrica, Volume 99 Issue 6, Pages 920 - 924)
ADHS ist eine im Kindesalter beginnende psychische Erkrankung, die sich durch leichte Ablenkbarkeit und Konzentrationsstörungen, geringes Durchhaltevermögen, sowie gesteigerte Aktivität und Impulsivität auszeichnet. Die Ursachen der Erkrankung sind nicht restlos geklärt, man vermutet eine Kombination aus angeborenen und umwelt- bzw. sozialisationsbedingten Faktoren. Etwa drei bis zehn Prozent aller Kinder zeigen Symptome im Sinne einer ADHS. Jungen sind deutlich häufiger betroffen als Mädchen. Man geht davon aus, dass ein multifaktoriell bedingtes Störungsbild mit einer erblichen Disposition vorliegt. Unklar ist, in welchem Umfang eine ADHS-Diagnose gestellt wird, obwohl nur ein vergleichsweise harmloses und oft reversibles kindliches Sozialverhalten vorliegt.
Frühere Studien hatten nämlich gezeigt:
• Wenn Eltern sich scheiden lassen und das Kind danach Symptome des sogenannten "Zappelphilipp-Syndroms" zeigt (Aufmerksamkeitsdefizit - Hyperaktivitäts - Syndrom - ADHS), dann besteht ein doppelt so großes Risiko wie bei zusammen lebenden und verheirateten Eltern, dass dieses Kind ein Medikament wie Ritalin verschrieben bekommt, um die Verhaltensauffälligkeiten zu behandeln.
• Durch Aggressivität oder "Hyperaktivität" verhaltensauffällige Kinder, die bei nur einem Elternteil leben, werden doppelt so oft mit Medikamenten (mit dem Wirkstoff Methylphenidat) behandelt wie wenn sie in der Obhut von zwei Elternteilen sind.
• Auch für Kinder, die bei Stiefeltern leben, hatten sich ähnliche Ergebnisse gezeigt.
• Eine neuere Studie hat jetzt angedeutet, dass möglicherweise nicht das Fehlen eines Elternteils der eigentliche Risikofaktor ist, sondern der durch die Scheidung bei Eltern wie Kindern gleichermaßen ausgelöste Stress.
vgl. zum Thema auch:
• Therapie des "Zappelphilipp-Syndroms": Kinder geschiedener Eltern bekommen häufiger Medikamente verordnet)
• Der Einsatz von Medikamenten zur Behandlung "hyperaktiver" Kinder hat sich weltweit verdreifacht
• Aggression im Kindergartenalter - Eine Studie zeigt: Es geht auch ohne Medikamente
Gerd Marstedt, 11.7.10
"Wirtschaftliche Krise gleich sinkende Lebenserwartung - das ist so!" Kontraintuitives aus der Zeit der "Großen Depression"
 Wirtschaftliche Krise oder Depression gleich sinkende Einkommen, steigende Langzeit-Arbeitslosigkeit, Verlust an sozialer Perspektive und gesellschaftlicher Inklusion, anwachsende Morbidität und schließlich eine spürbare Verringerung der Lebenserwartung durch Selbstmord oder sonstige Mortalität so oder so ähnlich sehen Prognosen zu den Folgen heftiger ökonomischer Krisen aus.
Wirtschaftliche Krise oder Depression gleich sinkende Einkommen, steigende Langzeit-Arbeitslosigkeit, Verlust an sozialer Perspektive und gesellschaftlicher Inklusion, anwachsende Morbidität und schließlich eine spürbare Verringerung der Lebenserwartung durch Selbstmord oder sonstige Mortalität so oder so ähnlich sehen Prognosen zu den Folgen heftiger ökonomischer Krisen aus.
Die Finanzkrise der Jahre 2008ff. und die ökonomischen Folgen des "historischen" Renditemaximierungsspiels der europäischen und anderen Banken, Anleger und Spekulanten auf dem Rücken der griechischen aber auch eines Teils der EU-Bevölkerung, könnten also in Kürze große Spuren bei der Morbidität und Mortalität der Bevölkerungen vieler EU-Staaten und Staaten Nordamerikas hinterlassen.
Dass dies stimmt und/oder zwangsläufig so eintritt, lässt sich aber nach einer von zwei us-amerikanischen Sozialökonomen und -epidemiologen im September 2009 online veröffentlichen fundierten Studie über die Auswirkungen der wirtschaftlichen Entwicklung zwischen 1920 und 1940 und dabei besonders der so genannten "Great Depression" in den 1930er Jahren auf die Lebenserwartung der damaligen US-Bevölkerung, bezweifeln.
Zu den wesentlichen Ergebnisse einer für den Zeitraum vom Anfang der 1920er bis zum Ende der 1930er Jahre durchgeführten Zusammenhangsanalyse gehört nämlich:
• "Life expectancy generally increased throughout the period of study. However, it oscillated substantially throughout the 1920s and 1930s with important drops in 1923, 1926, 1928-1929, and 1936 coinciding with strong economic expansions. During the Great Depression, it rose from 57.1 in 1929 to 63.3 years in 1933. The rates of infant mortality and age-specific mortality for all age groups under 20 years generally declined during the 1920s and 1930s. Superimposed on this general declining trend, peaks in both infant mortality and mortality for children aged 1-4, 5-9, 10-14, and 15-19 were observed in the years 1923, 1926, 1928-1929, and 1934-1936. These peaks all coincide with periods of strong economic growth."
• Entgegen allen Erwartungen verschlechterte sich also vor allem die gesundheitliche Situation und das Sterberisiko immer dann, wenn es zu Wirtschaftswachstum kam und verbesserte sich umgekehrt in den Jahren wirtschaftlicher und sozialer Depression.
• Dies gilt mit Ausnahme der Sterblichkeit durch Selbstmord, die während der Zeit der "Großen Depression" zunahm, aber insgesamt "nur" 2 % der Gesamtsterblichkeit umfasst.
• Und noch mal ausdrücklich bezogen auf die Phase der "Großen Depression" zwischen 1930 und 1934: "Population health did not decline and indeed generally improved during the 4 years of the Great Depression, 1930-1933, with mortality decreasing for almost all ages, and life expectancy increasing by several years in males, females, whites, and nonwhites."
• Schließlich:: "Population health did not decline and indeed generally improved during the 4 years of the Great Depression, 1930-1933, with mortality decreasing for almost all ages, and life expectancy increasing by several years in males, females, whites, and nonwhites."
Obwohl also große Rezessionen, und die Krise der Jahre 1930-34 gehört zu den größten, "periods of pessimism, shrinking revenues, and social malaise" sind, erklären sich die Forscher die unerwartete Nichtwirkung all dieser Bedingungen mit anderen sozialen Mechanismen, die mögliche negative Wirkungen von Krisen auf die Gesundheit und die Lebenserwartung (über-)kompensieren und sich umgekehrt in Zeiten wirtschaftlicher Erholung negativ auf die Gesundheit und Lebenserwartung auswirken (z.B. zunehmende Luftverschmutzung, mehr Verkehrsunfälle). Welche Faktoren aber im Einzelnen zu den unerwarteten Wirkungen führen, bleibt ungeklärt.
Eine durchaus naheliegende Erklärung, wirtschaftliche Krisen- und Wachstumsbedingungen wirkten sich erst mit einer zeitlichen Verzögerung auf Gesundheitsbedingungen aus, halten die Wissenschaftler für den von ihnen untersuchten Zeitraum nicht für stichhaltig oder nur marginal bedeutsam. So sinkt zwar z.B. im ersten Boomjahr 1936, d.h. vier Jahre nach dem Beginn der "Großen Depression" die Lebenserwartung drastisch, um sich aber 1937 gleich wieder kräftig zu verbessern.
Geht man weiter davon aus, dass wirtschaftliche Krisen einen negativen Einfluss auf die soziale Lebenslage großer Teile der Bevölkerungen und damit auf deren Gesundheit und Lebenserwartung haben, hat die genauere Erforschung der fördernden und hemmenden Bedingungen eine enorme wirtschafts- und sozialpolitische Bedeutung.
Dazu braucht man sich noch nicht einmal mit der Empirie der 1930er Jahre in den USA oder in Deutschland auseinandersetzen (die Qualität mancher damaliger Statistik z.B. über die Arbeitslosigkeit ist schlecht), sondern findet mit der Finanzkrise der letzten drei Jahre und ihren Folgen genügend aktuelle Empirie.
Die 6 Seiten der Studie "Life and death during the Great Depression" von Jose´ A. Tapia Granados und Ana V. Diez Roux sind als Beitrag in den renommierten "Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS)" online veröffentlicht worden (Published online before print September 28, 2009, doi: 10.1073/pnas.0904491106) und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 6.5.10
Unterschicht-Angehörige sind nicht nur häufiger chronisch erkrankt, sondern haben auch öfter Kopfschmerzen oder Erkältungen
 Dass die soziale Schichtzugehörigkeit, definiert über Bildungsniveau, Einkommen und beruflichen Status, den Gesundheitszustand und die Betroffenheit von chronischen Erkrankungen nachhaltig beeinflusst, ist seit langem bekannt. Eine Vielzahl empirischer Studien hat dies belegt, über die wir auch in der Rubrik Epidemiologie: Soziale Lage, Armut, soziale Ungleichheit hier im Forum berichtet haben. Aber nicht nur schwer wiegende chronische Erkrankungen oder Behinderungen, sondern auch Bagatell-Krankheiten wie Erkältungen oder Kopfschmerzen findet man sehr viel häufiger bei Bürgerinnen/Bürgern mit niedrigem Bildungsniveau oder niedrigem Einkommen.
Dass die soziale Schichtzugehörigkeit, definiert über Bildungsniveau, Einkommen und beruflichen Status, den Gesundheitszustand und die Betroffenheit von chronischen Erkrankungen nachhaltig beeinflusst, ist seit langem bekannt. Eine Vielzahl empirischer Studien hat dies belegt, über die wir auch in der Rubrik Epidemiologie: Soziale Lage, Armut, soziale Ungleichheit hier im Forum berichtet haben. Aber nicht nur schwer wiegende chronische Erkrankungen oder Behinderungen, sondern auch Bagatell-Krankheiten wie Erkältungen oder Kopfschmerzen findet man sehr viel häufiger bei Bürgerinnen/Bürgern mit niedrigem Bildungsniveau oder niedrigem Einkommen.
Dieses überraschende Ergebnis fand man jetzt in einer US-amerikanischen Studie, bei der rund 355 Tausend Erwachsene im Jahr 2008 in Telefon-Interviews nach ihrem Gesundheitszustand, Gesundheitsverhalten und vielen anderen, insbesondere sozialstatistischen und beruflichen Aspekten befragt wurden. In drei Fragen dieser Umfrage "Gallup-Healthways" wurde erfasst, ob der Betroffene am gestrigen Tag a) eine Erkältung oder Grippe hatte, b) gestern längere Zeit Kopfschmerzen, c) gestern längere Zeit Schmerzen, ganz gleich welcher Art hatte. Überprüft wurde dann, ob sich für die Häufigkeit dieser Beschwerden Unterschiede zeigten in Abhängigkeit vom Bildungsniveau oder Einkommen.
Tatsächlich zeigte sich dann ein sehr deutlicher Einfluss beider Faktoren der Schichtzugehörigkeit:
• Aufgeteilt wurde die Stichprobe in sechs Gruppen mit unterschiedlich hohem Bildungsniveau, von Abschluss weniger als High School (also kein Gesamtschul-Abschluss) bis Universitäts-Abschluss. Schmerzen irgendwelcher Art hatten dann am gestrigen Tag 36 Prozent in der untersten Bildungsgruppe, aber nur halb so viele (18%) derjenigen mit dem höchsten Bildungsniveau. Ähnlich große Differenzen ergaben sich auch für das Auftreten von Kopfschmerzen (18%, 9%) und für eine Grippe oder Erkältung (10%, 6%).
• Acht Gruppen bildeten die Forscher für das monatliche Einkommen der Interviewteilnehmer, die unterste Gruppe lag unter 1000 Dollar, die oberste Gruppe über 10.000 Dollar. Auch hier fanden sich sehr große Unterschiede für die Betroffenheit von Gesundheitsbeschwerden am gestrigen Tag. Die Vergleiche ergaben für die unterste und oberste Einkommensgruppe: Schmerzen 47% : 15%, Kopfschmerzen 21% : 7%, Erkältung oder Grippe 11% : 6%.
• In einer so genannten multivariaten Analyse überprüften die Wissenschaftler dann, ob diese Zusammenhänge möglicherweise verursacht sind durch andere Faktoren, die sich hinter der Schichtzugehörigkeit bzw. Bildung und Einkommen verbergen ("Confounder"). Als solche Hintergrundfaktoren wurden unter anderem herangezogen: Alter, Geschlecht, fester Partner/in, Sport und körperliche Bewegung, Rauchen, Vorerkrankungen. Hier zeigte sich dann, dass der Einfluss der Schichtzugehörigkeit quantitativ ein wenig zurückging, aber immer noch sehr deutlich (und statistisch signifikant) erkennbar blieb.
In der gesundheitspolitischen Diskussion über jene Mechanismen, die dem Zusammenhang von Schichtzugehörigkeit und Gesundheit zu Grunde liegen, überwiegen zwei Erklärungen. Zum einen wird auf die schichtspezifische Inanspruchnahme des medizinischen Versorgungssystems hingewiesen (z.B.: Unterschicht-Angehörige nehmen weniger an Früherkennung teil), zum anderen auf das Gesundheitsverhalten (Rauchen ist in Unterschichten stärker verbreitet). Beide Erklärungen, so die Wissenschaftler in einer Bilanz ihrer Befunde greifen jedoch für die in ihrer Studie überprüften Bagatell-Erkrankungen überhaupt nicht.
Sehr viel einleuchtender, so ihre These, ist der Effekt von unterschiedlichen Arbeits- und Lebensbedingungen: Erkältungen und grippale Infekte könnten bei Unterschicht-Angehörigen stärker verbreitet sein, weil sie sich öfter in großen Menschenmengen aufhalten (Wohnbedingungen, Weg zur Arbeit in öffentlichen Verkehrsmitteln). Kopfschmerzen könnten öfter auftreten, weil sie im Alltag oder bei der Arbeit stärkerem Lärm ausgesetzt sind, ihre Arbeitsbelastungen mehr Stress verursachen etc.
Von der Studie ist leider nur ein kurzer Abriss verfügbar (erste 150 Wörter): Arthur A. Stone et al: The Socioeconomic Gradient in Daily Colds and Influenza, Headaches, and Pain (Arch Intern Med. 2010;170(6):570-572)
Eine Zusammenfassung findet man auch hier: Medical News Today: Income And Education Are Likely To Affect Everyday Health
Gerd Marstedt, 1.4.10
Schottische Verlaufsstudie über 20 Jahre zeigt: Niedrige Intelligenz erhöht die Herz-Kreislauf-Mortalität
 Intelligenzquotienten sind auch Indikatoren für die Schichtzugehörigkeit. Und Angehörige unterer Sozialschichten weisen höhere Gesundheits- und Sterblichkeitsrisiken auf. Insofern ist nicht überraschend, dass ein niedriger Intelligenzquotient auch mit höheren Risiken für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Todesfälle einhergeht. Neu an einer jetzt veröffentlichten, vom britischen Medical Research Council finanzierten wissenschaftlichen Untersuchung ist jedoch, dass der Einfluss der Intelligenz mit anderen hinlänglich bekannten Risikofaktoren verglichen worden ist. Dabei zeigte sich: Nach dem Rauchen ist ein niedriger Intelligenzquotient der stärkste Einflussfaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und auch die Gesamtsterblichkeit.
Intelligenzquotienten sind auch Indikatoren für die Schichtzugehörigkeit. Und Angehörige unterer Sozialschichten weisen höhere Gesundheits- und Sterblichkeitsrisiken auf. Insofern ist nicht überraschend, dass ein niedriger Intelligenzquotient auch mit höheren Risiken für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Todesfälle einhergeht. Neu an einer jetzt veröffentlichten, vom britischen Medical Research Council finanzierten wissenschaftlichen Untersuchung ist jedoch, dass der Einfluss der Intelligenz mit anderen hinlänglich bekannten Risikofaktoren verglichen worden ist. Dabei zeigte sich: Nach dem Rauchen ist ein niedriger Intelligenzquotient der stärkste Einflussfaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und auch die Gesamtsterblichkeit.
Basis der Studie sind Daten aus der "West of Scotland Twenty-07 Study", die den Einfluss sozialer Faktoren auf die Gesundheit erfassen soll. Die aktuell in der Zeitschrift "European Journal of Cardiovascular Prevention & Rehabilitation" veröffentlichte Analyse umfasst Daten von 1145 Männern und Frauen im Alter von durchschnittlich etwa 55 Jahren, die seit dem Jahre 1987 über einen Zeitraum von rund 20 Jahren erhoben wurden.
Erfasst wurden sehr vielfältige Daten: Körpergröße und Gewicht, Blutdruck, Rauchverhalten, körperliche Bewegung, Bildungsniveau und Berufstätigkeit. Außerdem wurde der Intelligenzquotient (IQ) anhand eines gängigen schriftlichen Tests erfasst.
In der multivariaten statistischen Analyse, in der diese Einflussfaktoren gleichzeitig berücksichtigt wurden, zeigte sich dann: Die Sterblichkeit aufgrund von Herz-Kreislauf-Erkrankungen war am stärksten beeinflusst vom Rauchen. Das relative Risiko ("Odds-Ratio - OR") lag für Raucher 5,6mal so hoch. An zweiter Stelle lag jedoch schon der IQ (OR: 3,8), noch vor der Einkommenshöhe (OR: 3,2), Bluthochdruck (OR: 2,6) und dem Ausmaß an Sport und körperlicher Bewegung (OR: 2,1). Ähnliche Ergebnisse zeigten sich auch für die Gesamtsterblichkeit.
Hinsichtlich der Auswirkungen dieser Ergebnisse auf das Gesundheitswesen betonte der Studienleiter, Dr. Batty, dass die individuellen Fähigkeiten eines Patienten und darunter auch der Intelligenzquotient überaus wichtig für das Management kardiovaskulärer Risikofaktoren sind, also die Vermeidung riskanter Verhaltensgewohnheiten (Alkohol, Rauchen) und Beachtung anderer Verhaltensregeln (Ernährung, Bewegung).
Diese Erklärung ist allerdings wenig befriedigend, da wiederum das individuelle Gesundheitsverhalten als zentraler Erklärungsfaktor im Vordergrund stünde. Und dass dieses Gesundheitsverhalten nicht nur von individueller Intelligenz abhängig ist, sondern vielen anderen Persönlichkeitsfaktoren wie sozialen Arbeits- und Lebensbedingungen haben viele Studien aufgezeigt.
"Vom Standpunkt des Gesundheitswesens aus gesehen bestünde durchaus die Möglichkeit, den IQ zu steigern, wobei aber die Ergebnisse aus Studien zu Frühförderung und schulvorbereitenden Programmen noch keine eindeutigen Rückschlüsse erlauben", erklärte Dr. Batty und machte außerdem darauf aufmerksam, dass der IQ einer der wichtigsten Gründe dafür ist, dass die soziale Schicht in hohem Maße für Ungleichheiten hinsichtlich der gesundheitlichen Versorgung ursächlich ist. Ein niedriger IQ könnte aber eine weitere unabhängige Erklärung darstellen.
Hier ist ein Abstract der Studie: David Batty, G. et al: Does IQ predict cardiovascular disease mortality as strongly as established risk factors? Comparison of effect estimates using the West of Scotland Twenty-07 cohort study (European Journal of Cardiovascular Prevention & Rehabilitation: February 2010 - Volume 17 - Issue 1 - pp 24-27, doi: 10.1097/HJR.0b013e328321311b)
Gerd Marstedt, 12.2.10
Je größer die Schere zwischen Arm und Reich, desto schlechter der Gesundheitszustand der Bevölkerung
 Je größer die Unterschiede zwischen Arm und Reich in einem Land sind, desto schlechter ist es um die Gesundheit der Bürger/innen bestellt. Auch frühere Studien hatten bereits auf den Einfluss ökonomischer Ungleichheit auf den Gesundheitszustand, auf Morbidität und Mortalität aufmerksam gemacht. Die jetzt vom Gesundheitsökonomen Martin Karlsson von der TU Darmstadt in Kooperation mit der Universität Lund (Schweden) durchgeführte Studie ist allerdings methodisch noch einmal besonders fundiert: Sie basiert auf Daten aus 21 Ländern weltweit.
Je größer die Unterschiede zwischen Arm und Reich in einem Land sind, desto schlechter ist es um die Gesundheit der Bürger/innen bestellt. Auch frühere Studien hatten bereits auf den Einfluss ökonomischer Ungleichheit auf den Gesundheitszustand, auf Morbidität und Mortalität aufmerksam gemacht. Die jetzt vom Gesundheitsökonomen Martin Karlsson von der TU Darmstadt in Kooperation mit der Universität Lund (Schweden) durchgeführte Studie ist allerdings methodisch noch einmal besonders fundiert: Sie basiert auf Daten aus 21 Ländern weltweit.
Die Studie, deren Ergebnisse jetzt in der Zeitschrift "Social Science and Medicine" veröffentlicht wurden, umfasst Staaten mit relativ geringer ökonomischer Ungleichheit wie Deutschland oder Dänemark bis hin zu solchen mit extrem ungleicher Vermögensverteilung wie Russland oder Südafrika. Einbezogen wurden auch die bevölkerungsreichsten Länder der Welt wie China und Indien.
"Alle befragten Personen zusammen repräsentieren die Hälfte der Weltbevölkerung", erklärte der Wissenschaftler Martin Karlsson. Frühere Studien mit derselben Fragestellung seien innerhalb eines Landes oder nur unter Beteiligung von reichen Ländern durchgeführt worden. Die Korrelation zwischen ökonomischer Ungleichheit und Gesundheit sei wegen der schmalen Datenbasis bisheriger Studien stark bezweifelt worden. Doch diese Zweifel würden durch die neue Studie deutlich relativiert.
Die Wissenschaftler verknüpften in ihrer Studie die in Befragungen (bei einer repräsentativen Gruppe von 1000 Menschen pro Land) ermittelte Selbsteinschätzung des Gesundheitszustands (Durchschnittswert) mit der aus offiziellen Statistiken abgeleiteten ökonomischen Ungleichheit, festgemacht am sogenannten "Gini-Index", ein quantitatives Maß für die Schere zwischen arm und reich. Der Gini-Index ist groß für Länder, in denen ein kleiner Teil der Bevölkerung ein sehr hohes Einkommen besitzt und klein für Staaten, deren Vermögen sich weitgehend gleichmäßig auf die Bevölkerung verteilt. Für die der Arbeit zu Grunde liegenden Umfrage wurde eine repräsentative Gruppe von 1000 Menschen pro Land ausgewählt.
Eine große Streuung zeigt sich zunächst bei Betrachtung des durchschnittlichen Gesundheitszustands: Über 75 Prozent der befragten Kanadier, Dänen, Franzosen, Engländer oder US-Bürger bewerteten ihren Gesundheitszustand als "gut" oder "sehr gut" an. Die deutschen Studienteilnehmer lagen mit knapp 70 Prozent "guter" oder "sehr guter" Gesundheit im oberen Mittelfeld der 21 Nationen. Weit unten rangierten China, die Türkei und Russland mit nur 33%, 30% bzw. 17% guten oder sehr guten Urteilen.
Diese Werte setzten die Forscher dann in Beziehung zur Einkommensverteilung im jeweiligen Land. In mehreren statistischen Analysen wurden dann weitere Informationen über die Befragten mitberücksichtigt, wie die Kinderzahl, Geschlecht, Bildungsniveau oder Familienstand. Dabei zeigte sich, dass die beobachtete Korrelation zwischen ökonomischer Ungleichheit und Gesundheit (vgl. Grafik) bestehen blieb und von anderen potentiellen Faktoren nicht beeinflusst wurde. Besonders deutlich trat der Zusammenhang allerdings in einkommensstarken Ländern hervor. 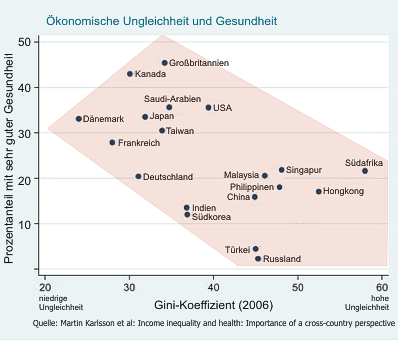
Die Wissenschaft heben in der Bilanz ihrer empirischen Befunde hervor, dass die Studie keine Kausalzusammenhänge zwischen der ökonomischen Ungleichheit und der Bevölkerungs-Gesundheit eindeutig belegen könne. Das Ziel der Forscher sei es jedoch, diese Faktoren in Zukunft näher zu identifizieren.
Abstract der Studie: Martin Karlsson et al: Income inequality and health: Importance of a cross-country perspective (Social Science & Medicine, Article in Press, doi:10.1016/j.socscimed.2009.10.056)
Gerd Marstedt, 18.1.10
Persönliche Konzepte von Gesundheit und gesunder Ernährung sind in der Mittelschicht andere als in der Unterschicht
 In einer kaum mehr überschaubaren Zahl von Studien hat sich gezeigt, dass ein riskantes Gesundheitsverhalten, etwa, was Rauchen und Alkoholkonsum, Sport und Bewegung oder auch die Ernährung anbetrifft, in unteren Sozialschichten sehr viel häufiger anzutreffen ist. Die Frage, warum dies so ist, wurde in wissenschaftlichen Studien allerdings weitaus seltener aufgegriffen - obwohl ein genaueres Verständnis der hier maßgeblichen Hintergründe dazu beitragen würde, schichtspezifische Barrieren im Rahmen von Gesundheitsförderung abzubauen. Eine schottische Studie hat diese Fragestellung nun aufgegriffen und im Rahmen von qualitativen Interviews herauszufinden versucht, inwieweit auch das gesundheitsbezogene Alltagsverhalten sich aus allgemeineren Normen und Erfahrungen in Unter- und Mittelschichtfamilien ableiten lässt.
In einer kaum mehr überschaubaren Zahl von Studien hat sich gezeigt, dass ein riskantes Gesundheitsverhalten, etwa, was Rauchen und Alkoholkonsum, Sport und Bewegung oder auch die Ernährung anbetrifft, in unteren Sozialschichten sehr viel häufiger anzutreffen ist. Die Frage, warum dies so ist, wurde in wissenschaftlichen Studien allerdings weitaus seltener aufgegriffen - obwohl ein genaueres Verständnis der hier maßgeblichen Hintergründe dazu beitragen würde, schichtspezifische Barrieren im Rahmen von Gesundheitsförderung abzubauen. Eine schottische Studie hat diese Fragestellung nun aufgegriffen und im Rahmen von qualitativen Interviews herauszufinden versucht, inwieweit auch das gesundheitsbezogene Alltagsverhalten sich aus allgemeineren Normen und Erfahrungen in Unter- und Mittelschichtfamilien ableiten lässt.
Nachdem die Wissenschaftler in einer vorherigen Studie Interviews mit 13-14jährigen männlichen und weiblichen Teenagern und deren Familien durchgeführt hatten (siehe zusammenfassend Backett-Milburn, K. et al: Making sense of eating, weight and risk in the early teenage years: views and concerns of parents in poorer socio-economic circumstances), überprüfte man in einer jetzt veröffentlichten Studie wiederum am Beispiel des Themas Ernährung die Bedeutung sozialer Normen für das Gesundheitsverhalten bei Teenagern aus Mittelschicht-Familien.
In den insgesamt 72 qualitativen Interviews mit Jungen und Mädchen, die jeweils zur Hälfte ein Normalgewicht bzw. Übergewicht hatten, zeigten sich dann folgende Befunde:
• In der Beschreibung der aktuellen Lebensbedingungen dominieren in den Mittelschichtfamilien Hinweise auf eine relative Sicherheit, was Einkommen und Konsumchancen betrifft, auf Wahl- und Entscheidungsfreiräume. Demgegenüber finden sich in den Unterschichtfamilien sehr viel mehr Hinweise auf Risiken und Unsicherheiten und es überwiegt eine Perspektive des "Wir müssen hier und jetzt zurecht kommen".
• Dementsprechend dominiert in der Mittelschicht die Erwartung, durch ein bestimmtes Ernährungsverhalten auch Einfluss nehmen zu können auf das eigene Körpergewicht und den zukünftigen Gesundheitszustand. In der Unterschicht wird eher darauf verwiesen, dass die mit einer ungesunden Ernährung zusammen hängenden Gesundheitsrisiken vergleichsweise gering sind, wenn man andere Verhaltensrisiken (im Zusammenhang mit Drogen, Alkohol, Rauchen, Sex) damit vergleicht.
• In Mittelschichten ist eine recht starke Kontrolle des Ernährungsverhaltens durch die Eltern vorherrschend. Dies wird von Kindern teilweise als Bevormundung wahrgenommen, aber doch akzeptiert. Dieses Verhaltensmuster betrifft zum einen die Größe und Menge der jeweils verzehrten Speisen, wobei insbesondere Mütter darauf achten (und entsprechende Hinweise erteilen), dass ihr Kind sich keine zu großen Portionen auf den Teller lädt. Andererseits betrifft dies auch die Auswahl der Speisen: Eltern versuchen darauf hin zu wirken, dass das Kind zumindest ein wenig Gemüse, Salat und Obst verzehrt,. selbst wenn es diese Nahrungsmittel überhaupt nicht mag.
• Im Vergleich dazu besitzen Unterschicht-Teenager eine sehr viel größere Autonomie, was die Auswahl der Speisen anbetrifft oder auch Ort und Zeitpunkt der Mahlzeiten. Viele Teenager betonten, sie würden zu ganz anderen Zeiten als ihre Eltern essen, und viele Eltern wiesen darauf hin, dass ihre Kinder letztlich doch das essen würden, was sie mögen und sich selber aussuchen.
• Snacks und Knabbereien waren in der Mehrzahl der befragten Mittelschichtfamilien verpönt. Wenn überhaupt, so machten Teenager davon zu Hause nur Gebrauch, wenn Eltern dies explizit erlaubt hatten. Oder man war sich mit den Eltern einig, dass man solche Snacks ebenso wie "Junk-Food" nicht besonders attraktiv findet. Im Verlauf der Interviews wurde deutlich, dass das elterliche Kontrollverhalten in der Mittelschicht nicht umstandslos von den Kindern akzeptiert wird, sondern ein sehr langwieriger, oftmals konfliktträchtiger und mühsamer Prozess ist, bei dem von elterlicher Seite auch immer wieder Begründungen für ihre Vorschriften geliefert werden müssen.
• Die in der Mittelschicht hervorgehobenen Erkrankungsrisiken durch eine ungesunde Ernährung werden in Unterschichten (fast schon fatalistisch) als normale Begleiterscheinungen des Lebens wahrgenommen, ebenso wie unterschiedliche Ausprägungen des Körpergewichts (einschließlich Übergewicht und Adipositas) akzeptiert und moralisch nicht in Frage gestellt werden. Viele Interviewpartner weisen darauf hin, es gäbe weitaus wichtigere Dinge im Leben als sich über sein Körpergewicht Sorgen zu machen.
Die Wissenschaftler beschreiben noch eine Reihe weiterer Unterschiede in den gesundheits- und ernährungsbezogenen Normen von Mittel- und Unterschicht-Familien. Ein ganz zentraler Aspekt ist dabei die unterschiedliche Zukunftsperspektive: Während in Mittelschichten die Sichtweise vorherrscht, dass man auch durch die Ernährung den eigenen zukünftigen Gesundheitszustand positiv beeinflussen kann, wird diese zukunftsgerichtete Orientierung in Unterschichten stark beeinträchtigt durch Zwänge und Anforderungen, irgendwie in der Gegenwart zurecht zu kommen. Und Ernährung und Körpergewicht sind dabei keine besonders herausragenden Einflussgrößen.
Hingewiesen wird in der Diskussion der Befunde auch darauf, dass Gesundheitsförderungsmaßnahmen diese schichtspezifischen Normen mit berücksichtigen müssen. Was dies im Einzelnen für die Gestaltung der Maßnahmen und Interventionen bedeutet, wird allerdings als Fragestellung für zukünftige Forschungsprojekte definiert.
• Von dieser Seite aus Download mehrerer Dokumente zur Studie
• Zusammenfassung der Befunde: Wills, Wendy et al (2008). Parents' & teenagers' conceptions of diet, weight & health: Does class matter? Full Research Report
• Ergebnisse der vorherigen Studie über gesundheitsbezogene Normen bei Jugendlichen aus der Unterschicht: Backett-Milburn, K., Wills, W.J., Gregory, S., and Lawton, J. (2006) Making sense of eating, weight and risk in the early teenage years: views and concerns of parents in poorer socio-economic circumstances (Social Science & Medicine. 63(3): 624-635)
Gerd Marstedt, 13.1.10
Australische Studie stellt große soziale Ungleichheit fest bei der Versorgung von Patienten mit Angina pectoris
 Eine große Zahl von Studien aus den USA hat gezeigt, dass dort ein hohes Maß an sozialer Ungleichheit feststellbar ist, was die Qualität der medizinischen Versorgung anbetrifft. Angehörige unterer Sozialschichten und ethnischer Minderheiten werden dort bei einer Vielzahl von Erkrankungen benachteiligt (vgl. hier die Kurzfassungen vieler Studien im Forum Gesundheitspolitik, Rubrik: USA: Soziale Ungleichheit). Ein zentraler Grund dafür ist allerdings der fehlende Krankenversicherungsschutz dieser Bevölkerungsgruppen. In Staaten, die für alle Bürger eine Krankenversicherungspflicht eingeführt haben oder ein umfassendes Recht auf medizinische Versorgung, findet man daher kaum einmal Studien, die solche soziale Ungleichheiten in der medizinischen Versorgung nachweisen, die ausschließlich mit der sozio-ökonomischen Stellung der Patienten zusammenhängen.
Eine große Zahl von Studien aus den USA hat gezeigt, dass dort ein hohes Maß an sozialer Ungleichheit feststellbar ist, was die Qualität der medizinischen Versorgung anbetrifft. Angehörige unterer Sozialschichten und ethnischer Minderheiten werden dort bei einer Vielzahl von Erkrankungen benachteiligt (vgl. hier die Kurzfassungen vieler Studien im Forum Gesundheitspolitik, Rubrik: USA: Soziale Ungleichheit). Ein zentraler Grund dafür ist allerdings der fehlende Krankenversicherungsschutz dieser Bevölkerungsgruppen. In Staaten, die für alle Bürger eine Krankenversicherungspflicht eingeführt haben oder ein umfassendes Recht auf medizinische Versorgung, findet man daher kaum einmal Studien, die solche soziale Ungleichheiten in der medizinischen Versorgung nachweisen, die ausschließlich mit der sozio-ökonomischen Stellung der Patienten zusammenhängen.
Einige wenige Ausnahmen hierzu fand man bislang unter anderem in Kanada, wo man herausfand: Teure Diagnoseverfahren werden Oberschicht-Patienten häufiger verordnet oder in Schweden, wo eine Studie ergab: Oberschicht-Angehörige erhalten nach einem Herzinfarkt öfter eine bessere medizinische Versorgung - und leben danach länger.
Jetzt hat eine australische Studie diese Liste erweitert und gezeigt: Patienten mit Angina pectoris erhalten bestimmte, therapeutisch sinnvolle, aber relative kostenträchtige Diagnose- und Therapieverfahren deutlich häufiger, wenn sie einen hohen sozialen Status haben, also der Oberschicht und nicht der Mittel- oder Unterschicht angehören. Dieser Effekt zeigte sich auch dann, wenn die Wissenschaftler in sogenannten multivariaten Analysen den potentiellen Einfluss anderer Faktoren (unter anderem: Art des Krankenhauses, private oder andere Krankenversicherung des Patienten, Alter, Geschlecht, Begleiterkrankungen usw.) mitberücksichtigten.
Basis der Studie waren medizinische Versorgungsdaten von knapp 2 Millionen Menschen aus West-Australien. Herausgefiltert wurden Daten von Patienten, die in den Jahren 2001-2003 wegen eines Herzinfarkts oder Angina pectoris in einem Krankenhaus behandelt worden sind. Bei ihnen wurde dann überprüft, welche diagnostischen und therapeutischen Verfahren im weiteren Verlauf eingesetzt wurden. Dabei konzentrierte man sich auf einige wenige Prozeduren: Bypass-Operation (Überbrückung verengter oder verstopfter Herzkranzgefäße durch eine Umleitung), Angiographie (Darstellung von Blutgefäßen durch diagnostische Bildgebungsverfahren) und Angioplastie (Erweiterung verengter Blutgefäße durch dort eingeführte Katheter).
In der Auswertung der Daten zeigte sich dann in multivariaten Analysen, die auch andere Einflussfaktoren mitberücksichtigten:
• Bei einem Herzinfarkt (Myokardinfarkt) ergaben sich keine Unterschiede des weiteren medizinischen Vorgehens, die allein auf den sozio-ökonomischen Status der Patienten zurückzuführen waren
• Bei der Diagnose "Angina pectoris" waren solche Unterschiede jedoch durchaus feststellbar: Im Vergleich zu Unterschicht-Patienten erhielten solche aus der Oberschicht häufiger angiographische Verfahren (etwa um 11% häufiger), um 30% häufiger Bypass-Operationen und um 52% häufiger angioplastische Maßnahmen.
• Die Unterschiede waren nur begrenzt darauf zurückzuführen, dass mit dem sozioökonomischen Status auch die Häufigkeit einer privaten Krankenversicherung stieg.
• Darüber hinaus fand die Studie auch heraus, dass Unterschicht-Patienten ohne private Krankenversicherung erheblich länger auf eine medizinische Behandlung warten mussten.
Die Wissenschaftler diskutieren in der Bilanz ihrer Befunde eine Vielzahl potentieller Erklärung, von denen jedoch keine völlig befriedigend ist. So beziehen sie hier auch folgende Merkmale von Unterschicht-Patienten als mögliche Einflussfaktoren ein: Höhere Risikofaktoren (Rauchen, Übergewicht, spätere Klinikeinweisung), geringere Nutzung von Fachärzten, die eher Empfehlungen aussprechen für die genannten speziellen Verfahren. Auch unterschiedliche Ein stellungen von Ärzten gegenüber Unter- bzw. Oberschicht-Patienten könnten nach Meinung der Studien-Autoren eine Rolle spielen.
Die Studie ist im Volltext von dieser Seite aus verfügt: Rosemary J Korda, Mark S Clements, Chris W Kelman: Universal health care no guarantee of equity: Comparison of socioeconomic inequalities in the receipt of coronary procedures in patients with acute myocardial infarction and angina (BMC Public Health 2009, 9:460doi:10.1186/1471-2458-9-460)
Gerd Marstedt, 13.1.10
Eine gute und eine schlechte Nachricht zur Sterblichkeit von Diabetikern
 Die gute Botschaft zuerst: Die Sterblichkeit von Menschen mit einer Diabetes mellitus Typ 2-Erkrankung in der kanadischen Provinz Ontario sank alters- und geschlechtsstandardisiert zwischen 1995 und 2005 von 4,05% auf 2,69%.
Die gute Botschaft zuerst: Die Sterblichkeit von Menschen mit einer Diabetes mellitus Typ 2-Erkrankung in der kanadischen Provinz Ontario sank alters- und geschlechtsstandardisiert zwischen 1995 und 2005 von 4,05% auf 2,69%.
Dies ist für die weltweit mit dramatisierender Vehemenz geführte Diskussion über die "Volksseuche" Diabetes eine wichtige Entwicklung, die Atem schafft, eher über Prävention und die leitliniengerechte bzw. evidenzbasierte Behandlung von DiabetikerInnen (z.B. die immer noch zu nachlässige systematische Untersuchung von Augen und Füßen, um die Erblindung und die Amputation unterer Extremitäten als schlimme Endpunkte zu vermeiden) zu reden.
Die 10-Jahresuntersuchung stützt sich auf eine bevölkerungsbezogene retrospektive Kohortenanalyse der Sterblichkeit mit 367.426 im Jahr 1994/95 an Diabetes erkrankten TeilnehmerInnen im Alter von 30 und mehr Jahren in der kanadischen Provinz Ontario. Die Anzahl der Erkrankten stieg bis zum Jahr 2005/06 auf 843.629 Personen, was wiederum vielen pessimistischen Prognosen als empirischer Beleg der von ihnen erwarteten Tendenz dient oder genügt. Schaut man etwas genauer hin, finden sich zum Teil andere Trends: In derselben Zeit stieg beispielsweise der Anteil der 30 Jahre und älteren Einwohner ohne (!) Diabetes um 17% von 5.907.012 auf 6.888.074. Die Analysen wurden mit Hilfe von Daten aus der Bevölkerungsstatistik und administrativer Gesundheitsdaten des regionalen Krankenversicherungsträgers geführt, bei dem alle Einwohner Ontarios versichert sind. Für Personen, die älter als 64 Jahre sind, gibt es materielle Unterstützung für verordnete Arzneimittel und bei Bedarf auch soziale Unterstützung ("social assistance"). Unter den soziodemografischen Verwaltungsdaten befinden sich auch Angaben zum Einkommen.
Und damit hängt die schlechte Nachricht zusammen. Sie lautet: Die Abnahme der Sterblichkeit ist bei Erkrankten mit hohem Einkommen wesentlich höher als bei Versicherten mit niedrigerem Einkommen. Bei den Gutverdienenden oder Angehörigen der höchsten Einkommensgruppe sank die Sterblichkeit an Diabetes bzw. Diabetesfolgen um 39% und bei Personen mit dem niedrigsten Einkommen statistisch signifikant verschieden um 31%. Auch hier liefert eine differenzierte Analyse noch deutlichere Aussagen: Betrachtet man nur die Gruppe der 30-64-Jährigen DiabetikerInnen betrug der Unterschied der Chance der Abnahme des Sterblichkeitsrisikos ("mortality rate ratio") von Gering- und Vielverdienern mehr als 40 Prozent. Bei weiblichen Geringverdienern betrug die Abnahme 12% (Männer: 14%) und bei den Gutverdienenden 59 % (Männer: 60%). Bei den über 64-Jährigen hatte das Einkommen einen geringeren Einfluss auf die Sterblichkeitstrends. Der einkommensabhängige Unterschied der Sterblichkeit von DiabetikerInnen beider Einkommensgruppen in diesem Alter wuchs in den 10 Untersuchungsjahren nur um 0,9%. Die AutorInnen der Studie werten diese relativ geringen ungleichen Trends bei Rentnern u.a. als Ausdruck der materiellen Unterstützung/Subvention ihrer Versorgung. Welche Faktoren im Detail und ursächlich für die einkommensabhängigen Unterschiede in anderen Altersgruppen verantwortlich sind, lässt sich noch nicht abschließend sagen.
Ausdrücklich weisen die VerfasserInnen auf die Existenz derartiger Mortalitätsunterschiede selbst in dem eher auf soziale Gleichheit orientierten Gesundheitssystem wie dem Kanadas hin.
Der Aufsatz "Income-related differences in mortality among people with diabetes mellitus" von Lorraine L. Lipscombe, Peter C. Austin, Douglas G. Manuel, Baiju R. Shah, Janet E. Hux und Gillian L. Booth ist im "Canadian Medical Association Journal (CMAJ)" (2010; 182 E1-E17) erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 13.1.10
Auch dies sind Ernährungsprobleme von US-Bürgern: Unzureichende Nahrungsaufnahme aus Geldmangel
 Beim Thema Ernährung stehen viele Länder und Regionen dieser Erde nahezu reflexartig für Unterernährung, Hunger und Völlerei oder ernährungsbedingtes Übergewicht und Fettsucht. Dass es sich dabei manchmal um ein einseitiges Bild mit sehr praktischen Konsequenzen handelt, wird oft nicht bedacht. Dies gilt aus aktuellem Anlass auch für die Ernährungsverhältnisse in den USA als einer wichtigen Bedingung für Gesundheit und Gesundheitsversorgung. Das Thema Ernährung in den USA wird spontan und zunehmend mit dem Problem ernährungsbedingter Fehl-, Überernährung und Fettsucht und möglichen präventiven und kurativen Gegenmaßnahmen assoziiert.
Beim Thema Ernährung stehen viele Länder und Regionen dieser Erde nahezu reflexartig für Unterernährung, Hunger und Völlerei oder ernährungsbedingtes Übergewicht und Fettsucht. Dass es sich dabei manchmal um ein einseitiges Bild mit sehr praktischen Konsequenzen handelt, wird oft nicht bedacht. Dies gilt aus aktuellem Anlass auch für die Ernährungsverhältnisse in den USA als einer wichtigen Bedingung für Gesundheit und Gesundheitsversorgung. Das Thema Ernährung in den USA wird spontan und zunehmend mit dem Problem ernährungsbedingter Fehl-, Überernährung und Fettsucht und möglichen präventiven und kurativen Gegenmaßnahmen assoziiert.
Ein gerade vom "Economic Research Service" des US-Landwirtschaftsministeriums veröffentlichter Report belegt jetzt nachdrücklich mit entsprechenden Daten für das Jahr 2008, dass es sich dabei nur um einen Teil der Wahrheit bzw. Ernährungsrealität in den USA handelt. Danach hatten 85% der us-amerikanischen Haushalte das gesamte Jahr Zugang zu einer für ein aktives, gesundes Leben notwendigen Nahrungsmittelmenge für sämtliche Haushaltsmitglieder.
Für 14,6 % aller US-Haushalte war die Ernährungssicherheit aber mindestens einige Zeit im Jahr 2008 nicht gewährleistet. Sie war in 5,7 % dieser Haushalte sehr niedrig, was bedeutet, dass die Nahrungsaufnahme für eines oder mehrere Haushaltsmitglieder mehrere Male stark einschränkt war und ihre Essgewohnheiten ebenfalls oftmals unterbrochen werden mussten. Ständiger Grund war der Geldmangel oder fehlende andere Ressourcen für Nahrungsmittel. Die beiden Problemgruppen waren noch 2007 sichtbar kleiner, nämlich 11,1% und 4,1%. Seit 1995, dem Jahr, in dem es den ersten nationalen Nahrungs- und Ernährungssurvey in den USA gab, sind die Verhältnisse des Jahres 2008 die schlechtesten.
Was Ernährungsunsicherheit bedeutet, lässt sich daran ermessen, dass Haushalte, deren Ernährungslage gesichert war, 31% mehr für Nahrungsmittel ausgaben als die typischen Haushalte mit Ernährungsproblemen - bei gleicher Größe und Zusammensetzung. 55% der Haushalte mit Ernährungsproblemen nahmen an einem der drei größten von 15 nationalen Unterstützungsprogramme für Nahrung und Ernährung teil. Dies sind "The Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP)", das früher als "Food Stamp Program" bezeichnet wurde, das "National School Lunch Program" und das "Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children (WIC)".
Die so genannten "food stamps", d.h. in der Regel eine Plastikkarte, die beim Einkauf vorzulegen ist, sind aus ihrer anfänglichen Bedeutung als äußerste Hilfe für vorübergehende Notlagen zu einer dauerhaften Hilfe für mehr als 36 Millionen BürgerInnen geworden, also einem Achtel aller US-BürgerInnen und einem Viertel aller Kinder unter 18 Jahren, überhaupt Grundnahrungsmittel wie Milch, Brot und Käse einkaufen zu können. Unter dem Einfluss der wirtschaftlichen Krise wächst diese Anzahl um täglich 20.000 Menschen.
Nach einer am 29.11.2009 veröffentlichten Analyse der "New York Times", verteilt sich die Ernährungsunsicherheit innerhalb der USA und zwischen unterschiedlichen sozialen Gruppen sehr unterschiedlich. So erhalten in 239 "counties" (das können Stadtteile wie die Bronx in New York oder Philadelphia mit Millionen von Einwohnern oder ländliche Gemeindebezirke mit 10.000 Einwohnern sein) der USA mindestens ein Viertel der Bevölkerung food stamps. In mehr als 750 counties kann sich ein Drittel der schwarzen BürgerInnen nur mit food stamps ernähren. In mehr als 800 counties helfen food stamps einem Drittel der Kinder, etwas zum Essen zu haben. In einigen Großstädten im Verlaufe des Mississippi wie St. Louis, Memphis und New Orleans erhalten mehr als die Hälfte der Kinder Lebensmittelmarken. Die aktuelle Situation ist nicht nur Ausdruck der immer schon bedeutenden Armutsrate in den USA, sondern insbesondere ihr Wachstum ist auch Folge der aktuellen Immobilienkrise.
Hinzu kommt, dass die jetzt veröffentlichten Werte die wirklichen Verhältnisse keineswegs vollständig anzeigen. In einer Analyse der "State Food Stamp Participation Rates in 2006" zitieren die Autoren Untersuchungen nach denen in jenem Jahr nur rund 67% aller bedürftigen Personen food stamps beantragen oder erhalten. Diese Dunkelziffer dürfte sich nicht verändert haben und schwankte ebenfalls erheblich zwischen 50% in Kalifornien und 2% in Missouri. Dass damit die Ungleichheit beim Erhalt von Grundnahrungsmittel noch lange nicht ausreichend abgebildet ist, zeigt ein weiteres Detail der Versorgungssituation in 2006. Von der Gruppe der so genannten "working poor" erhielten USA-weit 57% food stamps - auch hier wieder mit erheblichen regionalen Unterschieden.
Und eine weitere Studie über die Betroffenheit von Armut, Ernährungsunsicherheit und food stamps im Lebensverlauf zwischen dem 20ten und 65ten Lebensjahr, zeigte eine zusätzliche Facette dieser Art sozialer Probleme in den USA: Knapp 75% aller Amerikaner werden mindestens ein Jahr in Armut oder Beinahe-Armut leben müssen. Noch mehr überraschte aber, dass zwei Drittel der US-BürgerInnen innerhalb dieser 45 Jahre mindestens einmal ein Wohlfahrtsprogramm wie das der food stamps in Anspruch nehmen müssen. Schließlich müssen 40% der AmerikanerInnen innerhalb ihrer Erwerbstätigkeitsphase in 5 oder mehr separaten Jahren ein Wohlfahrtsprogramm nutzen müssen. Dieses so genannte Lebenslaufrisiko für Armut hat von den 1970er bis zu den 1990er Jahren erheblich zugenommen.
Die speziellen Ergebnisse der gerade in der Fachzeitschrift "Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine" (Arch Pediatr Adolesc Med. 2009;163(11):994-999) veröffentlichten Studie "Estimating the Risk of Food Stamp Use and Impoverishment During Childhood" stellen nach Meinung ihrer beiden Verfasser, Mark Rank und Thomas Hirschl, eine "essential information for the health care and social service communities" dar. Denn selbst eine begrenzte Erfahrung von Armut "can have detrimental effects upon a child's overall quality of health and well-being."
Die Ergebnisse beruhen auf einer Analyse der Daten der "Panel Study of Income Dynamics (PSID)", die seit 1968 eine repräsentative Auswahl amerikanischer Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen und ihre Familien im Längsschnitt zu ihren Armutserfahrungen befragt hat.
Zu den wesentlichen Ergebnissen zählen:
• 49,2% aller US-Kinder werden zu irgendwelchen Zeitpunkten ihrer Kindheit in einem Haushalt leben und ernährt werde, der dies nur mit food stamps schafft.
• Dies trifft auf 90% afroamerikanischer und 37% weißhäutiger bzw. kaukasischer Kinder zu.
• 91% der Kinder in Alleinerzieherhaushalten werden diese Erfahrungen machen. Kinder in Haushalten mit verheirateten Eltern erleben dies ebenfalls.
• Verschärft wird das Risiko dieser unerfreulichen Erfahrung noch durch die Kumulation von Merkmalen. Von den Kindern, die gleichzeitig schwarzhäutig sind, in Haushalten leben, deren "Oberhaupt" nicht verheiratet ist und weniger als 12 Jahre eine Schule besucht hat, leben zu 97% in einem Haushalt, in dem sie im Alter von 10 Jahren von food stamps leben müssen.
Der Report "Measuring Food Security in the United States. Household Food Security in the United States, 2008" von Mark Nord, Margaret Andrews, und Steven Carlson, sämtlich MitarbeiterInnen in unterschiedlichen Abteilungen des U.S. Department of Agriculture, umfasst 66 Seiten und ist komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 29.11.09
Atypisch Beschäftigte nehmen 2008 weiter zu und der Verdienst von fast jedem Zweiten liegt unter der Niedriglohngrenze
 Der im Forum bereits mehrfach beschriebene Trend der Zunahme atypischer Beschäftigung (u.a. zuletzt für das Jahr 2007) setzte sich nach den gerade für die Zeit von 1998 bis 2008 vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Daten ungebremst fort. Damit veränderte sich nicht nur die soziale Situation der atypisch beschäftigten Personen, sondern auch die Einnahmesituation der Sozialversicherungsträger, deren Beiträge sich immer noch auf das Bruttoeinkommen beziehen.
Der im Forum bereits mehrfach beschriebene Trend der Zunahme atypischer Beschäftigung (u.a. zuletzt für das Jahr 2007) setzte sich nach den gerade für die Zeit von 1998 bis 2008 vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Daten ungebremst fort. Damit veränderte sich nicht nur die soziale Situation der atypisch beschäftigten Personen, sondern auch die Einnahmesituation der Sozialversicherungsträger, deren Beiträge sich immer noch auf das Bruttoeinkommen beziehen.
Nach den Ergebnissen des Mikrozensus arbeiteten 1998 noch 72,6% aller Beschäftigten in einem so genannten Normalarbeitsverhältnis, was 2008 nur noch für 66% zutraf. Der Anteil atypischer Beschäftigungsformen stieg im gleichen Zeitraum von 16,2% auf 22,2%.
Unter einem Normalarbeitsverhältnis wird ein Beschäftigungsverhältnis verstanden, das voll sozialversicherungspflichtig, mit mindestens der Hälfte der üblichen vollen Wochenarbeitszeit und mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag ausgeübt wird. Ein Normalarbeitnehmer arbeitet direkt in dem Unternehmen, mit dem er einen Arbeitsvertrag hat, was bei Zeitarbeitnehmerinnen und -arbeitnehmern nicht der Fall ist. Von atypischen Beschäftigungsformen wird gesprochen, wenn eines oder mehrere dieser Kriterien nicht erfüllt sind. Dazu zählen neben der Zeitarbeit, Teilzeitbeschäftigungen mit 20 oder weniger Stunden Arbeit pro Woche, geringfügige Beschäftigungen sowie befristete Beschäftigungen.
Unabhängig von der von einigen Protagonisten der atypischen Beschäftigung erwarteten verbesserten Flexibilität der atypisch Beschäftigten und des damit angeblich verbundenen Vorteils für ihre langfristigen Beschäftigungschancen - zum Teil unbewiesen, zum Teil widerlegt - gibt es durch die niedrigeren Einkommen dieser Beschäftigtengruppe systematisch soziale Nachteile. Diese werden wenig kommuniziert und ihre Quantität ist häufig auch unbekannt.
Mit den jetzt vom Statistischen Bundesamt vorgelegten Ergebnissen der Verdienststrukturerhebung, die zuletzt 2006 durchgeführt wurde, existiert eine solide quantitative Basis für die weitere Debatte. Vorgelegt wurden die Angaben der Personen im Erwerbsalter von 15 bis 64 Jahren, soweit sich diese nicht in Bildung oder Ausbildung befinden.
Nach dieser amtlichen Erhebung erhielt fast jeder zweite atypisch Beschäftigte (49,2%) einen Bruttostundenlohn unter der Niedriglohngrenze. Die Niedriglohngrenze wurde nach international angewendeten Kriterien der Organisation für ökonomische Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) errechnet. Demnach gilt der Stundenlohn einer Person als Niedriglohn, wenn er weniger als zwei Drittel des Medians aller erfassten Bruttostundenlöhne beträgt. Der Median ist der Wert, der alle erfassten Bruttostundenlöhne genau in zwei Hälften teilt. Im Jahr 2006 lag die so berechnete Niedriglohngrenze bei 9,85 Euro.
Die Anzahl der Angehörigen der einzelnen Gruppen atypischer Beschäftigung welchen lediglich den Niedriglohn verdienten sah im einzelnen so aus:
• Bei der größten Gruppe der atypisch Beschäftigten, den Teilzeitbeschäftigten mit wöchentlich 20 oder weniger Stunden, erhielten knapp ein Fünftel (19,5%) einen Niedriglohn.
• Befristet Beschäftigte hatten ein Niedriglohnrisiko von 36,0%.
• Am stärksten waren 2006 die geringfügig Beschäftigten (81,2%) von Niedriglöhnen betroffen.
• Auch die Zeitarbeit (67,2%) war häufig mit einem Niedriglohn verbunden.
Somit lag für alle Kategorien atypisch Beschäftigter das Niedriglohnrisiko deutlich höher als für Personen in einem Normalarbeitsverhältnis. Der Vollständigkeit halber sei aber festgehalten, dass Niedriglohn nicht nur ein Problem der atypisch Beschäftigten ist: "Immerhin 11,1% der Normalarbeitnehmerinnen und -arbeitnehmer bekamen 2006 auch einen Niedriglohn. Das waren von den nahezu 19 Millionen Beschäftigten, über die die Verdienststrukturerhebung repräsentative Aussagen macht, 1,6 Millionen Normalbeschäftigte mit einem Stundenverdienst unter der Grenze von 9,85 Euro. Berücksichtigt man, dass Betriebe mit weniger als zehn Beschäftigten und insbesondere die Wirtschaftsabschnitte Land- und Forstwirtschaft, Fischerei, Öffentliche Verwaltung sowie Private Haushalte durch die Erhebung nicht abgedeckt sind, dürfte die Zahl der Niedriglohnbezieher noch höher liegen."
Berücksichtigt man weiter, dass 42,6% der Niedriglohnbezieher in einem Normalarbeitsverhältnis arbeiten, scheint das typisch us-amerikanische Phänomen der "working poor" voll in Deutschland angekommen zu sein. Unter allen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Deutschland lag der Niedriglohnanteil bei 20,0%.
Auch wenn in Deutschland u.a. wegen der Möglichkeit soziale Transferleistungen zu erhalten ein Niedriglohn aus Erwerbstätigkeit nicht zwingend zu Armutsgefährdung führt, zeigt sich bei Auswertungen des Mikrozensus für 2008: Atypisch Beschäftigte nach EU-Definition sind deutlich häufiger armutsgefährdet (14,3%) als Personen in einem Normalarbeitsverhältnis (3,2%). Insgesamt waren in Deutschland 2008 6,2% aller Erwerbstätigen armutsgefährdet.
Das bei einer Pressekonferenz des Statistischen Bundesamt am 19. August 2009 vorgelegte, 27 Seiten umfassende statistische Material zum Thema "Niedrigeinkommen und Erwerbstätigkeit", kann kostenlos bezogen werden und enthält eine Fülle weiterer Angaben zum gruppenspezifischen Umfang, Art und zur Betroffenheit von atypischer Beschäftigung und niedrigem Einkommen.
Bernard Braun, 19.8.09
Schulden machen dick: Deutsche Studie zeigt Zusammenhänge zwischen finanzieller Überschuldung und Übergewicht
 Zusammenhänge zwischen sozio-ökonomischem Status und Übergewicht sind schon in einer Reihe epidemiologischer Studien aufgezeigt worden. Wissenschaftler der Johannes Gutenberg-Universität Mainz haben nun aber auch einen eindeutigen Zusammenhang zwischen finanzieller Überschuldung und Übergewicht sowie Adipositas festgestellt. Überschuldete Menschen haben in Deutschland im Vergleich zum Bevölkerungsdurchschnitt ein höheres Risiko, übergewichtig oder fettleibig zu sein, auch wenn man andere Einflussfaktoren wie Schichtzugehörigkeit, Bildung oder das Rauchverhalten berücksichtigt.
Zusammenhänge zwischen sozio-ökonomischem Status und Übergewicht sind schon in einer Reihe epidemiologischer Studien aufgezeigt worden. Wissenschaftler der Johannes Gutenberg-Universität Mainz haben nun aber auch einen eindeutigen Zusammenhang zwischen finanzieller Überschuldung und Übergewicht sowie Adipositas festgestellt. Überschuldete Menschen haben in Deutschland im Vergleich zum Bevölkerungsdurchschnitt ein höheres Risiko, übergewichtig oder fettleibig zu sein, auch wenn man andere Einflussfaktoren wie Schichtzugehörigkeit, Bildung oder das Rauchverhalten berücksichtigt.
Basis der jetzt in der Fachzeitschrift "BMC Public Health" veröffentlichten Studie sind zwei Erhebungen:
• Eine schriftliche Umfrage des Instituts für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin unter 949 überschuldeten Menschen aus Rheinland-Pfalz und Mecklenburg-Vorpommern aus den Jahren 2006 und 2007
• der mit Telefon-Interviews durchgeführte Gesundheitssurvey des Robert-Koch-Instituts bei einer repräsentativen Stichprobe von 8318 Deutschen aus dem Jahre 2003.
In einem Gruppenvergleich zeigt sich zunächst, dass in der Stichprobe der Überschuldeten 25 Prozent fettleibig waren im Vergleich zu 11 Prozent in der Durchschnittsbevölkerung. Da jedoch eine große Zahl von Faktoren für Übergewicht und Adipositas ursächlich sein können, führten die Wissenschaftler auch multivariate Analysen durch, in denen gleichzeitig neben der Überschuldung auch der Einfluss zum Beispiel des Bildungsniveaus, Alters, Geschlechts, Rauchverhaltens überprüft wurde. Dabei zeigte sich dann immer noch ein überaus starker Effekt der Variable "Überschuldung". Hierzu gehörige Personen wiesen eine fast zweimal so hohe Chance auf übergewichtig zu sein (Odds-Ratio 1,97) und eine zweieinhalb mal so hohe Chance für Adipositas (Odds-Ratio 2,56).
Die Forscher machen für diesen Zusammenhang vor allem die hohen Preise für gesunde Nahrungsmittel, fehlendes Wissen über preisgünstige, aber dennoch gesunde Ernährung und vor allem die psychisch sowie sozial belastende Situation der überschuldeten Bürgerinnen und Bürger mitverantwortlich. Diese ökonomischen Entbehrungen können zu einer Neigung der betroffenen Personen zum "Trost-Essen" sowie zu körperlicher Inaktivität führen. Da die Ursachen-Wirkungs-Beziehung mit dem Studiendesign einer einmaligen Befragung nicht nachgewiesen werden kann, diskutieren die Wissenschaftler ebenso, ob Fettleibige eventuell eher ihren Arbeitsplatz verlieren und somit in die Überschuldungsfalle geraten können - schließlich ist Arbeitslosigkeit der häufigste Grund für eine Überschuldungssituation.
Wie die Wissenschaftler ausführen, können sich Schulden auf die Risikofaktoren für chronische Erkrankungen auswirken, beispielsweise indem weniger Freizeitaktivitäten stattfinden und die Teilnahme an sozialen Ereignissen reduziert wird. Auch die Qualität der Ernährung kann unter der Schuldensituation leiden: "Energiereiche Nahrungsmittel wie Süßigkeiten oder fettige Snacks sind meistens billiger als Nahrungsmittel mit geringerem Energiegehalt, etwa Früchte oder Gemüse." Angesichts dieser Befunde schlägt die Expertin vor, eine Niedrigpreiskampagne für gesunde Lebensmittel zu starten. Nötig wären außerdem weitere Studien, insbesondere Langzeitstudien, um eindeutige Aussagen über Ursache und Wirkung zu erhalten.
Die Überschuldung von Privatpersonen ist nicht nur ein finanzielles und juristisches Problem, sondern auch ein soziales und - wie nun gezeigt werden konnte - ein gesundheitliches Problem. "Die überschuldeten Bürgerinnen und Bürger und deren Familien brauchen zielgruppenspezifische Gesundheitsförderung und Prävention. Hier sind die Öffentliche Gesundheitspflege, also Bundes- und Landesministerien sowie Kommunen, und die Krankenkassen gefordert", so Münster.
Die Studie ist hier veröffentlicht (Abstract, von dieser Seite aus ist die kostenlose PDF-Datei mit dem Volltext verfügbar): Eva Münster, Heiko Rüger, Elke Ochsmann, Stephan Letzel, André M Toschke: Over-indebtedness as a marker of socioeconomic status and its association with obesity: a cross-sectional study (BMC Public Health 2009, 9:286doi:10.1186/1471-2458-9-286)
Gerd Marstedt, 11.8.09
Adhärenz bei Drogenabhängigen - und es geht doch
 NutzerInnen illegaler Drogen gelten gemeinhin als schwieriges Klientel, auch in der medizinischen Versorgung. Seit 20 Jahren unterstützt ein interdisziplinäres Team aus Pflegenden, Ärzten, Zahnärzten, Zahnarzthelfern und Sozialarbeitern in Berlin-Kreuzberg intravenös applizierende Drogenkonsumenten mit einem speziell auf diese Zielgruppe zugeschnittenen niedrigschwelligen, aufsuchenden und Sucht begleitenden Angebot. Nun erfuhr das Gesundheitsteam des eingetragenen Verein Fixpunkt e.V. eine besondere Auszeichnung für die langjährige, teilweise mühevolle Arbeit mit chronisch Drogenkranken und erhielt den mit 10.000 Euro dotierten Ehrenpreis des Berliner Gesundheitspreises.
NutzerInnen illegaler Drogen gelten gemeinhin als schwieriges Klientel, auch in der medizinischen Versorgung. Seit 20 Jahren unterstützt ein interdisziplinäres Team aus Pflegenden, Ärzten, Zahnärzten, Zahnarzthelfern und Sozialarbeitern in Berlin-Kreuzberg intravenös applizierende Drogenkonsumenten mit einem speziell auf diese Zielgruppe zugeschnittenen niedrigschwelligen, aufsuchenden und Sucht begleitenden Angebot. Nun erfuhr das Gesundheitsteam des eingetragenen Verein Fixpunkt e.V. eine besondere Auszeichnung für die langjährige, teilweise mühevolle Arbeit mit chronisch Drogenkranken und erhielt den mit 10.000 Euro dotierten Ehrenpreis des Berliner Gesundheitspreises.
Der vom AOK-Bundesverband und der Berliner Ärztekammer gemeinsam ausgelobte Berliner Gesundheitspreis 2008 stand unter dem Motto "Gesagt ist nicht getan" und widmete sich dem Thema der Adherence. Nach der Formulierung des AOK-Bundesverbandes beschreibt Adhärenz das Maß der Übereinstimmung des Patientenverhaltens der mit den gemeinsam mit Arzt oder Ärztin beschlossenen Behandlungszielen. Der Begriff Adherence trägt dem veränderten Rollenverständnis zwischen A(e)rztIn und PatientIn Rechnung, indem er eine partnerschaftliche Verständigung über Art und Umfang der Therapie voraussetzt und den PatientInnen eine aktive und eigenverantwortliche Rolle in der Therapie zubilligt. Der Begriff ersetzt zunehmend den herkömmlichen Ansatz der Compliance, dem eine asymmetrische Arzt-Patienten-Beziehung zugrunde liegt.
Der Arbeitsansatz des Fixpunkt-Gesundheitsmobils basiert auf den Prinzipien der Suchtakzeptanz und Hilfe zur Selbsthilfe, Gesundheitsförderung und Stärkung des Gesundheitsbewusstseins der Konsumenten illegaler Drogen stehen in den Mittelpunkt. Seit 2007 erfolgt im Rahmen eines niedrigschwelligen Angebots für intravenös applizierende Drogengebraucher in Berlin die Behandlung chronischer Wunden mit Methoden des "modernen Wundmanagement" nach ICW an (Initiative chronische Wunden). Chronisch-venöse Hautveränderungen spielen nämlich bei Langzeitgebrauchern illegaler Drogen eine zunehmende Rolle. Biomedizinische und psychosoziale Besonderheiten dieser Gruppe erschweren die angemessene Behandlung chronischer Wunden und erfordern einen speziellen Therapieansatz.
Primäre Zielgruppe dieses neuartigen Therapieangebots sind Drogenabhängige mit chronischen Hautulcera, die mindestens 10-mal in einem Jahr zur Behandlung kommen. Dieses neue, patientenorientierte Verfahren, das aufgrund begrenzter Ressourcen nur ausgewählten Patienten zur Verfügung steht, ergänzt oder ersetzt bisherige Therapieansätze. Nach Einführung des Wundmanagement nach ICW zeigte sich ein signifikanter Zuwachs der medizinischen Kontakte drogenabhängiger Patienten aufgrund von chronischen Hautgeschwüren. Insgesamt stiegen die Behandlungszahl chronischer Ulcera seit Einführung des Wundmanagement um über 60 Prozent gegenüber den Durchschnittswerten der vorangegangenen vier Jahre und ihr Anteil an den Behandlungen insgesamt um 38 Prozent. Die verbesserte Adherence bei Anwendung des Wundmanagement nach ICW ermöglicht bei dieser speziellen Patientengruppe die wirksame Prophylaxe von Superinfektionen und anderen Komplikationen sowie insgesamt eine verbesserte Heilungstendenz bei chronischen Wunden.
Adherence ist eine wichtige Voraussetzung, um Patienten in speziellen gesundheitlichen und sozialen Bedingungen eine langwierige und belastende Behandlung zu ermöglichen. Angepasstes Wundmanagement nach ICW verbessert bei der Behandlung chronischer Wunden intravenös applizierender Drogengebraucher die Adherence und damit die Voraussetzungen für einen Therapieerfolg. Auch wenn der ursächliche Zusammenhang zwischen neuartigen Wundauflagen und Behandlungsergebnis bisher unbewiesen ist, zeigt sich vermutlich aufgrund begleitender Maßnahmen eine Überlegenheit dieses Behandlungskonzepts bei der speziellen Zielgruppe Drogenabhängiger. Auf der Website des AOK-Bundesverbandes findet sich eine kurze Darstellung der Arbeit von Fixpunkt e.V.. Die G+G-Sonderausgabe zum Thema Gesagt ist nicht getan - Adherence Arzt und Patient in gemeinsamer Verantwortung stellt neben den beiden Hauptpreisträgern auch die Gesundheitsarbeit von Fixpunkt vor.
So weit, so gut. Neben der allgemeinen Anerkennung für die Arbeit des Gesundheitsteam von Fixpunkt e.V. brachte die Verleihung des Berliner Gesundheitspreises 2008 aber auch etwas ganz anderes zum Vorschein. Offenbar ist die Geschäftsleitung des mittlerweile auf über 30 MitarbeiterInnen angewachsenen Vereins weder mit grundlegenden Fragen des Personalmanagements vertraut noch den Anforderungen an die Personalführung bei einer solchen Zahl von Beschäftigten gewachsen. Der Vereinsvorstand, teilweise durch enge verwandtschaftliche Beziehungen zur Geschäftsführung befangen, erweist sich als uninformiert über die Auswirkungen der verfehlten Personalführung auf das Versorgungsangebot und als nachhaltig unfähig, seiner Verantwortlichkeit sowohl für den Verein als auch für dessen MitarbeiterInnen nachzukommen und Schaden von dem Verein abzuwenden. So fördert er den Druck der Geschäftsführung auf einzelne MitarbeiterInnen, sich in der Gehaltsgruppe zurückstufen zu lassen, deckt das unverhohlen Mobbing gegenüber solchen Angestellten, die sich dagegen zur Wehr setzen, und deckt das autoritäre Gebaren der Geschäftsführung.
Außenstehende bekommen unweigerlich den Eindruck, bei Fixpunkt herrschten Arbeitsverhältnisse wie bei Lidl. In der Tat empfinden etliche Mitarbeiter die Arbeitsbedingungen als bedrückend, Maßnahmen der Geschäftsführung als willkürlich und die Beschäftigungssituation bei Fixpunkt e.V. als demotivierend. Mobbing, Willkür und fehlende Transparenz und Partizipationsfähigkeit führen zunehmend zum Abwandern langjähriger, verdienter MitarbeiterInnen. Geäußerte Kritik hat nur dazu geführt, dass die Beschäftigten einen Maulkorb umgehängt bekommen und ihnen bei Zuwiderhandlung Abmahnung oder gar Entlassung drohen. Die Folgen einer derart unprofessionellen Personalpolitik erscheinen geeignet, eine wichtige Selbstverpflichtung von Fixpunkt e.V. in Frage zu stellen, nämlich die Aussage "Wir arbeiten verbindlich, kontinuierlich und kompetent", die ebenso im Leitbild des Vereins nachzulesen ist wie der Satz: "Wir pflegen Strukturen, die für jedeN MitarbeiterIn persönliche Entfaltungsmöglichkeiten schaffen", gegen den Vorstand wie Geschäftsführung ganz offensichtlich verstoßen. Auch die Aussage "Wir entwickeln und realisieren effektiv, zuverlässig und wirtschaftlich Angebote zur Verbesserung der Lebenssituation und der gesundheitlichen Situation von Konsumenten illegaler Drogen" (Hervorhebung Forum Gesundheitspolitik) bedarf sicherlich unter den aktuellen Umständen einer angemessenen Überprüfung.
Deren menschenverachtendes Verhalten, die völlige Kritikunfähigkeit und die Weigerung, den unhaltbaren Zuständen mit professioneller Hilfe zu begegnen, haben mittlerweile dazu geführt, dass ein ärztlicher Mitarbeiter wegen fristloser Kündigung die Arbeit auf dem Gesundheitsmobil einstellen musste und drei ÄrztInnen ihre Mitarbeit aufgekündigt haben. Deswegen und in Folge zusätzlicher, teilweise längerer Krankheitsausfälle des Pflegepersonals konnte Fixpunkt e.V. phasenweise eine Grundvoraussetzung für Adhärenz, nämlich die Kontinuität des Versorgungsangebots, nicht oder nur mit fachlich nicht adäquat vorbereitetem Personal aufrechterhalten. So fordert beispielsweise das britische Royal College of Nursing nicht nur eine regelmäßige Begutachtung der Wunden und ihrer Entwicklung, sondern empfiehlt auch, diese Kontrollen möglichst in der Hand eines hinreichend qualifizierten Behandlers zu belassen. Doch die unprofessionelle Personalpolitik von Fixpunkt e.V. hat erstens in der Wundbehandlung sehr erfahrene Experten herausgedrängt bzw. durch MitarbeiterInnen ohne gleichwertige Qualifikation ersetzt und zweitens das zuverlässige Aufrechterhalten der kontinuierlichen medizinischen Versorgung phasenweise unmöglich gemacht. Im ersten Halbjahr 2009 hat die soeben ausgezeichnete besondere Arbeit des Fixpunkt-Gesundheitsteams schweren Schaden genommen und die Träger des Vereins billigend eventuelle Befundverschlechterungen und Gefährdungen der PatientInnen in Kauf genommen. Das lässt sich aus den ausführlichen Guidelines des Royal College of Nursing ableiten, die hier kostenlos zum Download zur Verfügung stehen: The nursing management of patients with venous leg ulcers.
Auch die Träger des Berliner Gesundheitspreises 2008 weigerten sich, diese Problematik angemessen zur Kenntnis zu nehmen, obwohl die AOK erneut in Ausgabe 03 ihres Medienservices vom 12.6.2009 in dem Beitrag Krankheit durch Stress am Arbeitsplatz muss nicht sein ausdrücklich auf die krankmachenden Effekte von Distress und Kommunikationsproblemen m Arbeitsplatz hinweist. So erfolgte die Preisverleihung trotz der unübersehbaren Schwierigkeiten und die Berichterstattung in der entsprechenden Presseerklärung ließ diese Problematik unerwähnt. Auch die übrige mediale Berichterstattung stand eher im Zeichen von Friede, Freude und Eierkuchen denn im Dienste einer angemessenen Aufklärung der Öffentlichkeit. So berichtete der Berliner Tagesspiegel am 21.4.2009 anlässlich der Preisverleihung in dem Artikel Drogenbus am Kotti bekommt Gesundheitspreis über die Arbeit des Gesundheitsmobil vor Ort. Die grundlegenden Probleme in dem Verein und bei der Nachhaltigkeit des Angebots fanden in dem Beitrag Wunder Punkt ebenfalls keine Erwähnung.
Hier können die LeserInnen des Forum Gesundheitspolitik exklusiv die Präsentation als Volltext heruterladen, mit der sich das Team des Fixpunkt-Gesundheitsmobils erfolgreich um den Berliner Gesundheitspreis 2008 bewarb: Behandlung intravenös injizierender Drogengebraucher mit chronischen Wunden im Rahmen eines niedrigschwelligen Angebots nach Leitlinien des modernen Wundmanagements gemäß ICW.
Jens Holst, 17.6.09
Der Verzicht auf medizinische Versorgungsleistungen: In unteren Sozialschichten weitaus stärker ausgeprägt
 Analysen sozialer Ungleichheit in gesundheitlichen Fragen haben bislang vor allem berufliche und ökonomische Belastungen sowie das Gesundheitsverhalten als Hintergrund für ungleich verteilte Quoten der Morbidität oder Lebenserwartung identifiziert. Anders als in den USA wurden hierzulande und in Europa bislang kaum einmal Hinweise gefunden, dass auch das medizinische Versorgungssystem soziale Ungleichheiten hervorruft oder verfestigt. Eine im Rahmen der sog. "Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE)" durchgeführte Analyse hat nun gezeigt, dass Angehörige unterer Sozialschichten weitaus häufiger als andere auf medizinische Leistungen aus Kostengründen oder wegen eines aufwändigen Zugangs verzichten.
Analysen sozialer Ungleichheit in gesundheitlichen Fragen haben bislang vor allem berufliche und ökonomische Belastungen sowie das Gesundheitsverhalten als Hintergrund für ungleich verteilte Quoten der Morbidität oder Lebenserwartung identifiziert. Anders als in den USA wurden hierzulande und in Europa bislang kaum einmal Hinweise gefunden, dass auch das medizinische Versorgungssystem soziale Ungleichheiten hervorruft oder verfestigt. Eine im Rahmen der sog. "Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE)" durchgeführte Analyse hat nun gezeigt, dass Angehörige unterer Sozialschichten weitaus häufiger als andere auf medizinische Leistungen aus Kostengründen oder wegen eines aufwändigen Zugangs verzichten.
Für die Erklärung schichtspezifischer Unterschiede bei Morbidität und Mortalität gibt es seit den Ausführungen von Mielck (1993) ein umfassendes theoretisches Koordinatensystem. Der "soziale Gradient" ist danach zu erklären durch höhere gesundheitliche Belastungen, geringere Bewältigungsmöglichkeiten, ungesünderes Verhalten und eine schlechtere medizinische Versorgung unterer Sozialschichten. Die exakte empirische Erforschung und Gewichtung der hier wirksamen Bedingungen schreitet allerdings in Deutschland nur zögerlich voran. Insbesondere für die Einflussdimension "schlechtere medizinische Versorgung unterer Sozialschichten" fanden sich bislang nur wenige empirische Befunde, sieht man von Indikatoren wie Wartezeiten auf einen Arzttermin oder Inanspruchnahme von Früherkennung einmal ab, auch wenn einzelne empirische Studien durchaus Hinweise hierzu geliefert haben (vgl. etwa: Oberschicht-Angehörige erhalten nach einem Herzinfarkt öfter eine bessere medizinische Versorgung - und leben danach länger).
Im Rahmen der europäischen SHARE-Studie werden seit 2004 in elf Ländern Daten zum Gesundheitszustand, sozioökonomischen Status sowie zu den sozialen und familiären Netzwerken der über 50jährigen Bevölkerung erhoben. In einer Teilauswertung der Daten von über 14 Tausend Teilnehmern aus Frankreich, Deutschland, Griechenland, Italien und Schweden gingen deutsche und niederländische Wissenschaftler nun der Frage nach, ob sich Unterschiede finden in der Inanspruchnahme medizinischer Leistungen, die nicht mit dem Gesundheitszustand zusammenhängen, sondern der Schichtzugehörigkeit. Die dazu ausgewertete Frage hieß: Haben Sie in den letzten 12 Monaten auf irgendwelche medizinischen Leistungen verzichtet, entweder wegen der Kosten oder weil diese Leistungen gar nicht oder nicht so leicht verfügbar waren?
Im Rahmen einer multivariaten Analyse, bei der dann Alter, Geschlecht, Gesundheitszustand und das Vorliegen chronischer Erkrankungen kontrolliert wurde, zeigte sich: Tatsächlich verzichten Angehörigen der untersten Sozialschicht sehr viel häufiger darauf, bestimmte medizinische Leistungen in Anspruch zu nehmen. Besonders stark ausgeprägt ist dieser Befund in den beiden Untersuchungsländern Griechenland und Deutschland. In Deutschland findet sich ein solcher Verzicht in der untersten Sozialschicht etwa doppelt so oft wie in der Oberschicht.
In der Diskussion ihrer Analysebefunde weisen die Autoren darauf hin, dass die Ergebnisse noch sehr stark interpretationsbedürftig sind und von daher weitere Forschungsarbeiten dringend nötig wären, um eine Reihe von Fragen zu erklären: Um welche medizinischen Leistungen handelt es sich vorwiegend? Welche negativen gesundheitlichen Effekte hat dieser Verzicht? Aus welchen Motiven und Rahmenbedingungen resultiert das Verhalten?
Die Studie ist hier im Volltext verfügbar: Andreas Mielck, Raphael Kiess, Olaf von dem Knesebeck, Irina Stirbu, Anton E Kunst: Association between forgone care and household income among the elderly in five Western European countries - analyses based on survey data from the SHARE-study (BMC Health Services Research 2009, 9:52; doi:10.1186/1472-6963-9-52)
Gerd Marstedt, 3.5.09
"Das Design bestimmt das Bewusstsein" nicht nur in Bayern - Wissenswertes und Hilfreiches für Jedermann zu Gesundheitsberichten
 Immer mehr Bundesländer erstellen eine qualitativ weit über die traditionelle Seuchen- und Medizinalstatistik hinausgehende Gesundheitsberichterstattung und stellen die Ergebnisse dem interessierten landes- und bundesweiten Publikum auch über das Internet zur Verfügung.
Immer mehr Bundesländer erstellen eine qualitativ weit über die traditionelle Seuchen- und Medizinalstatistik hinausgehende Gesundheitsberichterstattung und stellen die Ergebnisse dem interessierten landes- und bundesweiten Publikum auch über das Internet zur Verfügung.
Dies gilt auch für das Land Bayern, das diese Aufgabe im Wesentlichen dem "Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit" übertragen hat. Dessen Arbeiten verdienen außerbayrisch weniger wegen der "Pflicht", d.h. der Erstellung von regelmäßigen Gesundheitsberichten (in Bayern unter der Bezeichnung "Gesundheitsmonitor") Aufmerksamkeit (außer man sucht nach Daten über die Gesundheit in Bayern), sondern wegen einiger "Kür"-Arbeiten, die wissenschaftlich und praktisch auch außerhalb Bayerns ausgesprochen nützlich sind.
Einen Überblick über das gesamte Internetangebot des Landesamtes listet dies u.a. nach den Schwerpunkten Arbeitsschutz und Produktsicherheit (z.B. Heben und Tragen von Lasten - Ratgeber zur ergonomischen Lastenhandhabung), Gesundheit (z.B. Neugeborenen-Hörscreening: Vierter Zwischenbericht), Umweltmedizin (z.B. Mobilfunk: Mobilfunkbasisstationen und menschliche Befindlichkeit), Lebensmittel und schließlich Gesundheitsberichterstattung auf.
Vier der erwähnten Kür-Berichte aus dem Bereich Gesundheitsberichterstattung (GBE) sollen etwas ausführlicher vorgestellt werden. Zwei der drei Berichte beschäftigen sich mit der Erklärung von regionalen Sterblichkeitsunterschieden im allgemeinen und speziell zwischen Nord- und Südbayern. Der Band 3 der "Gesundheitsberichterstattung für Bayern" geht von der bereits vorher bekannten Tatsache der regionalen Unterschieden der Sterblichkeit aus und erhebt sowie bewertet auf 48 Seiten das unterschiedliche Gesundheitsverhalten als wichtigen zwischen sozioökonomischen Bedingungen und Mortalitätsunterschieden vermittelnden Faktor.
Zusätzlich stellt eine 42-seitige für das Landesamt erstellte Studie die verschiedenen sozialepidemiologischen Erklärungen für regionale Morbiditäts- und Mortalitätsunterschiede dar. Als Erklärungsansätze werden kurz, vollständig und verständlich die Bevölkerungszusammensetzung, der regionale soziale Status, die Environmental Justice, die Einkommensungleichheit und das soziale Kapital dargestellt.
Die erste der beiden "Handlungshilfen" beschäftigt sich auf lediglich 34 Seiten in sehr praxisorientierter und wissenschaftlich klarer wie differenzierter Art u.a. mit Grundbegriffen und Maßzahlen der Epidemiologie wie Kausalität und Assoziation, Prävalenz und Inzidenz und verschiedenen Effektmaße, mit statistischen Methoden in der Epidemiologie wie Altersstandardisierung und Signifikanzprüfung sowie einem anschaulichen Überblick über Typen epidemiologischer Studien und dabei mit den Evidenzklassen, der Objektivität, Reliabilität, Sensitivität und Spezifität von Studien.
Ebenfalls sehr anschaulich und konzentriert befasst sich der Band 4 der Handlungshilfen für die GBE-Praxis unter dem Motto "das Design bestimmt das Bewusstsein" mit medialen Aspekten der GBE. Hier geht es darum, mit welchen Darstellungs- und Abbildungsformen die Ergebnisse wissenschaftlicher Analysen an die interessierte politische Öffentlichkeit vermittelt werden können und was man dabei zum eigenen Nutzen nicht machen sollte.
Nach ein wenig Theorie über das Prinzip "form follows function", geht es wiederum mit guten und schlechten Beispielen illustriert um das Layout und die Gestaltung von Gesundheitsberichten und deren Vermarktung in Presseerklärungen und barrierefreien Internetdokumenten. Viele der Hinweise sind auch für die Erstellung von Bachelorarbeiten oder Fakten-Papieren hilfreich. Sicherlich trägt zum Nutzen dieser Handlungshilfe bei, dass sie sich praktisch an den eigenen Ratschlägen orientiert, also nicht nur Tipps auflistet, sondern selber eine Art "model of good practice" darstellt.
Der 48-seitige Band 4 der Schriftenreihe "GBE-Praxis" "Mediale Aspekte der Gesundheitsberichterstattung Handlungshilfe" steht kostenlos zur Verfügung.
Dies gilt auch für
• die 48-Seiten-Studie "Gesundheit regional Gesundheitsberichterstattung für Bayern 3. Eine Untersuchung zu regionalen Unterschieden des Gesundheitsverhaltens,
• die theoretische Fundierung zur Erklärung regionaler Gesundheitsunterschiede in dem Band "Erklärungsmodelle regionaler Gesundheitsunterschiede Fachinformation Gesundheit. Zusammenstellung der wissenschaftlichen Evidenz für das Projekt "Gesundheit regional" Eine bevölkerungsrepräsentative Befragung zum Gesundheitsverhalten in Bayern.
42 Seiten, und für
• die Handlungshilfe 2"Epidemiologie und Gesundheitsberichterstattung Begriffe, Methoden, Beispiele".
Bernard Braun, 31.3.09
Umverteilung verbessert die Gesundheit - Vergleich der Sozialpolitik von 18 OECD-Ländern
 Welche Bedeutung haben Prinzipien des Wohlfahrtsstaats für die Bevölkerungsgesundheit? Dies ist das Thema einer kürzlich im LANCET veröffentlichten Studie. Die aus Schweden, Dänemark, Finnland und Norwegen stammenden Wissenschaftler untersuchten dafür die Familienpolitik der Jahre 1950 bis 2000 und die Rentenpolitik von 1930 bis 2000 in 18 OECD-Ländern. Sie analysierten das Ausmaß der materiellen Umverteilung an Familien und an alte Menschen.
Welche Bedeutung haben Prinzipien des Wohlfahrtsstaats für die Bevölkerungsgesundheit? Dies ist das Thema einer kürzlich im LANCET veröffentlichten Studie. Die aus Schweden, Dänemark, Finnland und Norwegen stammenden Wissenschaftler untersuchten dafür die Familienpolitik der Jahre 1950 bis 2000 und die Rentenpolitik von 1930 bis 2000 in 18 OECD-Ländern. Sie analysierten das Ausmaß der materiellen Umverteilung an Familien und an alte Menschen.
Die Sozialpolitik wurde mit Hilfe des Social Citizenship Indicator Program analysiert, einer Datenbank, welche anhand von Sozialindikatoren die Sozialpolitik von 18 Ländern seit 1930 abbildet.
Bestimmt wurde der Anteil der Umverteilung am Durchschnittseinkommen eines Arbeitnehmers bzw. eines Haushaltes ("replacement rate"). Die Forscher gingen davon aus, dass der Umfang der finanziellen Umverteilung (im Bericht als "generosity" - Großzügigkeit bezeichnet) ihre Wirkung über die Vermehrung der materiellen und der nicht-materiellen Ressourcen entfaltet. Materielle Umverteilung erfolgt in den untersuchten Ländern u.a. über die Sozialversicherungen, die Unterstützung von Familien, die Kinderbetreuung und die Versorgung von alten Menschen.
Drei Arten von Familienpolitik wurden unterschieden.
• Eine universale Sozialpolitik mit dem expliziten Ziel der Chancengleichheit, wie sie von den nordischen Länder (Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden) verfolgt wird. Diese Politik geht mit ausgeprägter Umverteilung einher und finanziert sich mit hohen Steuern, sie bietet öffentliche Dienstleistungen wie Kinderbetreuung an und unterhält einen großen öffentlichen Sektor. Familienpolitisch unterstützen diese Länder die Zweiverdiener-Familien mit gleichberechtigter Aufteilung von Erwerbs- und Familienarbeit zwischen Frau und Mann ("dual-earner model").
• Ein zweiter Typ von Familienpolitik("market-oriented model") beschränkt sich im Wesentlichen auf die Unterstützung derjenigen, die arm sind. Dies gilt z.B. für die USA, England, Australien und Japan.
• Eine dritte Form der Sozialpolitik fokussiert auf die soziale Unterstützung der traditionellen Familie mit dem Mann als Einkommenserzieler ("general family model") und gilt u.a. für Deutschland, Österreich, Frankreich und Italien.
Die Auswertung für die Familienpolitik ergibt das höchste Ausmaß an materieller Umverteilung für die Länder mit dem Zwei-Einkommenmodell. Eine Mittelstellung nehmen die Länder mit dem allgemeinen Familienmodell ein. Die geringste Umverteilung erbringt das Markt-orientierte Modell.
Die Kindergesundheit steht in enger Verbindung mit dem Ausmaß der Umverteilung - je höher der Transfer, desto niedriger die Kindersterblichkeit. Die weltweit niedrigste Kindersterblichkeit besteht neben Japan in Schweden, Finnland und Norwegen. Hier hatte die Politik Mitte bis Ende der 1960-er Jahre für einen schnellen Anstieg der Umverteilung in Richtung von Familien mit zwei berufstätigen Eltern gesorgt, hauptsächlich durch Elternzeiten mit einkommensabhängigem Elterngeld. Dies sicherte die beiden Einkommen und senkte die Armutsquoten bei Familien mit Kindern. Ein Zusammenhang zwischen Kindersterblichkeit und Bruttoinlandsprodukt konnte für die untersuchten Länder nicht festgestellt werden.
Bezüglich der Rentenpolitik werden ebenfalls drei Typen unterschieden, je nach Ausprägung der staatlich gewährleisteten Absicherung. Diese ist in Finnland, Norwegen und Schweden umfassend ("encompassing"). Länder wie Deutschland, Österreich, Belgien, Italien und Japan nehmen eine Zwischenstellung ein ("corporatist"). In den USA, England, Kanada, Australien und herrscht die private finanzielle Altersabsicherung vor ("targeted").
Bei der Rentenpolitik geht ein höheres Maß an Umverteilung bezüglich der Grundrente mit niedrigerer Sterblichkeit einher. Dies dürfte daran liegen, dass hauptsächlich die Bezieherinnen einer niedrigen Rente von der Umverteilung profitieren und damit die Altersarmut gemindert wird.
Die Autoren schlussfolgern, dass die Sozialpolitik eines Landes über das Ausmaß der materiellen Umverteilung wesentlichen Einfluss auf die Bevölkerungsgesundheit hat. Ein Mangel an Ressourcen führt zu erhöhten Morbiditäts- und Mortalitätsrisiken. Ökonomische Ressourcen sind am wichtigsten, weil sie leicht in andere Formen von Ressourcen umgewandelt werden können, die den Menschen helfen, ihre Lebensbedingungen zu kontrollieren und zu lenken. Daher sei die Sozialpolitik von großer Bedeutung für die Minderung der sozialen Ungleichheit der Gesundheit.
Die Studie ist kostenlos als Abstract und nach Anmeldung ebenfalls kostenlos herunterladbar.
Lundberg et al. The role of welfare state principles and generosity in social policy programmes for public health: an international comparative study. The Lancet 8. November 2008
David Klemperer, 29.11.08
Englische Studie: Mehr Parks und Grünanlagen in ärmeren Wohngegenden könnten gesundheitliche Ungleichheit verringern
 Untersucht man bei der gesamten englischen Bevölkerung, die noch nicht im Rentenalter ist, also bei knapp 41 Millionen Personen nur zwei Merkmale, nämlich die Einkommenshöhe und die Nähe der Wohnung zu Parks und Grünflächen, dann zeigt sich: Die Gesamt-Mortalität fällt auch innerhalb derselben Einkommensgruppen bei jenen Personen deutlich niedriger aus, die in der Nähe von Grünflächen wohnen. Und noch deutlicher sieht dieser Befund aus bei der Sterblichkeit infolge von Herz-Kreislauferkrankungen. Mehr Parks und Grünanlagen in ärmeren Wohngegenden, so eine Schlussfolgerung der jetzt in der Zeitschrift "Lancet" veröffentlichten Studie, könnten also zur Verringerung sozialer Ungleichheit beitragen.
Untersucht man bei der gesamten englischen Bevölkerung, die noch nicht im Rentenalter ist, also bei knapp 41 Millionen Personen nur zwei Merkmale, nämlich die Einkommenshöhe und die Nähe der Wohnung zu Parks und Grünflächen, dann zeigt sich: Die Gesamt-Mortalität fällt auch innerhalb derselben Einkommensgruppen bei jenen Personen deutlich niedriger aus, die in der Nähe von Grünflächen wohnen. Und noch deutlicher sieht dieser Befund aus bei der Sterblichkeit infolge von Herz-Kreislauferkrankungen. Mehr Parks und Grünanlagen in ärmeren Wohngegenden, so eine Schlussfolgerung der jetzt in der Zeitschrift "Lancet" veröffentlichten Studie, könnten also zur Verringerung sozialer Ungleichheit beitragen.
Zwei schottische Wissenschaftler haben sehr unterschiedliche Datensätze zusammengefügt. Zunächst erfassten sie bei der englischen Bevölkerung vor dem Rentenalter anonymisierte Daten über Todesfälle und Todesursachen. Bei diesen Datensätzen war jedoch jeweils angegeben, in welchem kleinräumigen Bezirk oder Areal der Verstorbene gewohnt hatte. Das gesamte United Kingdom ist in diese Areale aufgeteilt, sogenannte "lower level super output areas (LSOA)", die jeweils etwa 4 Quadratkilometer und im Durchschnitt 1.500 Personen umfassen. In einem Register ist für jedes einzelne Areal festgehalten, wie groß die naturbelassene Fläche (Parks, Wälder, Flussebenen, Wiesen) ist. Entsprechend dieser Angabe wurden die Areale in fünf Gruppen aufgeteilt, von sehr niedriger oder fehlender Grünfläche bis hin zu sehr großer Grünfläche.
Darüber hinaus schätzten die Wissenschaftler das für die einzelne Areale jeweils durchschnittliche Einkommensniveau - wie dies genau und im Einzelnen erfolgte, geht aus der Veröffentlichung leider nicht hervor. Diese Daten der LSOAs: Einkommenshöhe, Größe der Grünfläche als Einflussfaktoren und Todesfälle bzw. krankheitsspezifische Todesfälle wurden dann in Beziehung gesetzt.
Als Ergebnis zeigte sich: Die Unterschiede zwischen armen und reichen Wohngegenden lassen sich auch an den Sterblichkeitsraten ablesen. Jedoch ist dieser Unterschied weitaus deutlicher in Gegenden mit wenig öffentlichem Grün, und sehr viel schwächer ausgeprägt in Arealen mit sehr viel Wäldern und Parks. Konkret:
• Bei der Gesamt-Sterblichkeit betrug die Inzidenzrate (IRR, Quote der Todesfälle) in den grünen Wohngegenden 1,43 und in den weniger grünen Wohngegebenen 1,93.
• Berücksichtigte man nur Herz-Kreislauf-Erkrankungen, waren die Unterschiede zwischen arm und reich noch deutlicher: Die IRR betrug 1,54 in den grünen und 2,19 in den weniger grünen Arealen.
Eine Erklärung sehen die Forscher Richard Mitchell und Frank Popham in unterschiedlichen Freizeitmöglichkeiten, die es Bewohnern grüner Bezirke eher erlauben, Sport zu betreiben oder sich von beruflichem Stress zu erholen. Mehr Parks und Grünflächen in ärmeren Wohngegenden wären nach ihrer Ansicht daher ein nachhaltiger Beitrag zur Gesundheitsförderung.
Die Studie ist nach kostenloser Registrierung im "Lancet" auch im Volltext verfügbar: Richard Mitchell, Frank Popham: Effect of exposure to natural environment on health inequalities: an observational population (The Lancet, Volume 372, Issue 9650, Pages 1655 - 1660, 8 November 2008)
Die große Zahl der hier berücksichtigten Daten und die Stichprobengröße mag zunächst beeindrucken und den Ergebnisse eine hohe Zuverlässigkeit bescheinigen. Tatsächlich könnte in der Studie wieder einmal nur eine Scheinkorrelation erfasst worden sein. Denn mit der Einkommenshöhe ist zwar ein wichtiger Einflussfaktor, aber keineswegs der einzige kontrolliert worden. So wäre es nicht überraschend, wenn in den grüneren Wohngegenden nicht nur die Einkommensstärkeren zu finden sind, sondern auch jene, die mehr Wert legen auf einen gesundheitsbewussten Lebensstil (Rauchen, Bewegung, Ernährung). Ob dem so ist, wäre nur durch differenziertere Analysen nachweisbar.
Dass Interventionen nicht ganz so einfach nach dem vorgeschlagenen Muster verlaufen: "Mehr Parks und Grünflächen motivieren Bewohner zu mehr Sport und Bewegung, was sich dann in besserer Gesundheit niederschlägt", hat unlängst eine niederländische Studie gezeigt. Knapp 5.000 Personen waren dort befragt worden über ihr Ausmaß an Sport und körperlicher Bewegung, ihren sozialen Status und ihren Gesundheitszustand sowie die Größe der Grünflächen innerhalb eines Radius von einem Kilometer um ihre Wohnung und innerhalb von drei Kilometern. Das Ergebnis verlief hier sogar gegenteilig zu den Erwartungen: Personen, denen mehr Grünflächen in der Nähe zur Verfügung standen, zeigten in deutlich geringerem Umfang, dass sie Fahrrad fahren oder zu Fuß gehen, sowohl was die Häufigkeit als auch, was den Zeitumfang abetrifft. Dafür allerdings - und dies erklärt in großem Umfang das Ergebnis - verbrachten sie mehr Zeit mit Gartenarbeit.
Diese Studie ist im Volltext kostenlos verfügbar: Jolanda Maas, Robert A Verheij, Peter Spreeuwenberg, Peter P Groenewegen: Physical activity as a possible mechanism behind the relationship between green space and health: A multilevel analysis (BMC Public Health 2008, 8:206doi:10.1186/1471-2458-8-206)
Gerd Marstedt, 13.11.08
WHO-Studie: Soziale Faktoren und nicht Erbanlagen erklären die großen Unterschiede bei Lebenserwartung und Gesundheitszustand
 Ein Kind, das in einem Vorort von Glasgow in Schottland geboren wurde, kann unter Umständen eine Lebenserwartung haben, die um 28 Jahre kürzer ist als die eines anderen Kindes, das nur 13 km entfernt aufgewachsen ist. Ein Mädchen in Lesotho (im südlichen Afrika) hat im Durchschnitt eine 42 Jahre kürzere Lebenserwartung als ein japanisches Mädchen. In Schweden liegt die Mortalitätsquote für eine Frau während der Schwangerschaft und Geburt bei 1:17.400, in Afghanistan beträgt das Risiko 1:8. Biologie und Genetik können diese Unterschiede nicht erklären, tatsächlich resultieren die Unterschiede bei Morbidität und Mortalität innerhalb von Ländern und zwischen ihnen aus den sozialen Lebensbedingungen, unter denen Menschen geboren werden, heranwachsen, arbeiten und altern - dies sind die Kernaussagen eines jetzt veröffentlichten WHO-Reports über Ursachen gesundheitlicher Ungleichheit und Veränderungsmöglichkeiten.
Ein Kind, das in einem Vorort von Glasgow in Schottland geboren wurde, kann unter Umständen eine Lebenserwartung haben, die um 28 Jahre kürzer ist als die eines anderen Kindes, das nur 13 km entfernt aufgewachsen ist. Ein Mädchen in Lesotho (im südlichen Afrika) hat im Durchschnitt eine 42 Jahre kürzere Lebenserwartung als ein japanisches Mädchen. In Schweden liegt die Mortalitätsquote für eine Frau während der Schwangerschaft und Geburt bei 1:17.400, in Afghanistan beträgt das Risiko 1:8. Biologie und Genetik können diese Unterschiede nicht erklären, tatsächlich resultieren die Unterschiede bei Morbidität und Mortalität innerhalb von Ländern und zwischen ihnen aus den sozialen Lebensbedingungen, unter denen Menschen geboren werden, heranwachsen, arbeiten und altern - dies sind die Kernaussagen eines jetzt veröffentlichten WHO-Reports über Ursachen gesundheitlicher Ungleichheit und Veränderungsmöglichkeiten.
Die "sozialen Einflussfaktoren auf die Gesundheit" waren drei Jahre lang Gegenstand einer Untersuchung von aktuellen und früheren Politikern und Wissenschaftlern, die im Auftrag der WHO gearbeitet haben und jetzt ihren Bericht über gesundheitliche Ungleichheit und politische Möglichkeiten der Veränderung vorgelegt haben. Die Autoren weisen darauf hin, dass es seit langem Studien gibt, die ungerechte und vermeidbare Ursachen von Krankheit aufzeigen und dabei große Unterschiede zwischen Ländern feststellen. Aber auch innerhalb einzelner Länder bestehen große Unterschiede, die überwiegend sehr deutlich auf den sozialen Hintergrund der Krankheitsverursachung verweisen:
• Die Lebenserwartung für männliche Ureinwohner in Australien ist um 17 Jahre kürzer als die der anderen Männer im fünften Kontinent.
• Die Müttersterblichkeit ist in Indonesien bei Armen 3-4mal höher als bei Reichen.
• Im United Kingdom unterscheidet sich die Sterblichkeit von Stadtbewohnern in ärmeren und besser gestellten Bezirken um das 2-3fache.
• Die Kindersterblichkeit in den Slums von Nairobi ist 2.5mal höher als in den übrigen Bezirken der Stadt.
• in Uganda beträgt die Sterblichkeit der Kinder unter 5 Jahren in den reichsten Haushalten etwa 106 von 1000. In den ärmeren Haushalten liegt diese Quote bei 192:1000.
Hinsichtlich der Frage politischer Veränderungen liegt ein Großteil der Möglichkeiten jenseits des medizinischen Sektors, erklärte ein Mitglied der WHO-Kommission. "Das Problem von Krankheiten, die durch schmutziges und verseuchtes Trinkwasser verursacht werden, liegt nicht darin, dass es einen Mangel an Antibiotika dort gibt. Vielmehr liegt es am verseuchten Wasser und an den politischen und ökonomischen Rahmenbedingungen, durch die sauberes Trinkwasser für alle nicht zur Verfügung gestellt wird. Übergewicht und Adipositas sind nicht verursacht durch ein persönliches Versagen von Individuen, sondern durch das Überangebot an zucker- und fettreichen Nahrungsmitteln.
• Hier ist eine umfangreiche Pressemitteilung der WHO: Inequities are killing people on a "grand scale" reports WHO's Commission
• Auf dieser Website mit dem WHO-Report gibt es unterschiedlichen Download-Möglichkeiten: Closing the gap in a generation: Health equity through action on the social determinants of health
Gerd Marstedt, 28.8.2008
Das Informations- und Partizipationsverhalten in unteren Sozialschichten bewirkt auch soziale Ungleichheit in der Versorgung
 Meldungen aus den USA über extrem hohe soziale Unterschiede im Zugang zur medizinischen Versorgung und der Versorgungsqualität können kaum noch überraschen, zu häufig sind inzwischen die Befunde aus wissenschaftlichen Studien. Für Deutschland indes wurde zuletzt gehäuft festgestellt, es sei "unwahrscheinlich, dass Versorgungsdefizite einen substanziellen Beitrag zur Erklärung der höheren Krankheitslast und vorzeitigen Sterblichkeit in den unteren Statusgruppen leisten." (vgl.: Lampert/Mielck: Gesundheit und soziale Ungleichheit - Eine Herausforderung für Forschung und Politik)
Meldungen aus den USA über extrem hohe soziale Unterschiede im Zugang zur medizinischen Versorgung und der Versorgungsqualität können kaum noch überraschen, zu häufig sind inzwischen die Befunde aus wissenschaftlichen Studien. Für Deutschland indes wurde zuletzt gehäuft festgestellt, es sei "unwahrscheinlich, dass Versorgungsdefizite einen substanziellen Beitrag zur Erklärung der höheren Krankheitslast und vorzeitigen Sterblichkeit in den unteren Statusgruppen leisten." (vgl.: Lampert/Mielck: Gesundheit und soziale Ungleichheit - Eine Herausforderung für Forschung und Politik)
Eine jetzt veröffentlichte Studie der Bertelsmann-Stiftung hat mit Daten des "Gesundheitsmonitor" nun allerdings gezeigt, dass solche Versorgungsdefizite daraus entstehen, dass Angehörige unterer Sozialschichten ein ganz anderes Informations- und Partizipationsverhalten im Versorgungssystem aufweisen als Patienten der Oberschicht mit hohem Bildungsniveau. Ausgangspunkt der Studie sind drei Hypothesen, nach denen die Chancen zu einer erfolgreichen Therapie höher sind, wenn ein Patient a) informiert ist über Entstehungshintergründe seiner Krankheit und Symptome, über Präventionsmöglichkeiten und auch unterschiedliche Therapie-Alternativen, b) im Rahmen der Therapie eigene Kenntnisse und Erwartungen einbringt und an Entscheidungen partizipiert und c) seinen Arzt sehr sorgfältig aussucht und gegebenenfalls auch wechselt.
Hiervon ausgehend wird mit Daten des Gesundheitsmonitor aus mehreren Erhebungswellen seit 2004 Fragestellungen nachgegangen, die schichtspezifische Differenzen für eine Reihe von Verhaltensweisen überprüfen, die damit in engem Zusammenhang stehen, und zwar:
• bei der Klärung oder Vertiefung ärztlicher Informationen im Zusammenhang eines Arztbesuchs,
• beim Wunsch nach Mitbestimmung bei der Festlegung der Therapie (Shared Decision Making),
• bei der Auswahl eines Arztes und den dabei maßgeblichen Kriterien sowie beim Arztwechsel,
• hinsichtlich des Verständnisses medizinischer Informationen im Rahmen von Medikamenten-Beipackzetteln.
Tatsächlich zeigt sich in den Daten, für fast alle überprüften Handlungsorientierungen, dass Unterschicht-Patienten hier spezifische Tendenzen aufweisen, und zwar solche, die einer erfolgreichen Therapie eher abträglich sind. Das Bemühen um eine Klärung, Ergänzung oder Vertiefung ärztlicher Informationen im Zusammenhang mit einem Arzttermin ist bei Unterschicht-Angehörigen deutlich schwächer ausgeprägt und ebenso ist das Interesse an Shared Decision Making als Ausdruck eines Wunsches nach Mitbestimmung bei der Therapie deutlich geringer. Zugleich finden sich seltenere Arztwechsel und eine geringere Differenzierung zwischen Ärzten. Dass es große Unterschiede gibt (Fachwissen, Sozialkompetenz), wird bei unteren Bildungsschichten weniger stark wahrgenommen. Schließlich lässt sich am Beispiel der Arzneimittel-Informationen (Beipackzettel) aufzeigen, dass das Verständnis medizinischer Informationen sehr viel mehr Probleme bereitet und teilweise größere Ängste und Irritationen hervorruft.
Insgesamt entsteht so der Eindruck, dass die Informationsbemühungen in Gesundheitsfragen und auch der Wunsch nach Mitbestimmung in der Arztpraxis bei Patienten mit niedrigem Bildungsniveau sehr viel geringer sind. Der "informierte und partizipations-interessierte Patient" ist in unteren Sozialschichten eher eine Ausnahmeerscheinung. Die in diesem Leitbild verborgenen Verhaltensnormen sind eher charakteristisch für mittlere und obere Sozialschichten. Ähnlich wie beim Informationsverhalten zeigt sich auch bei der "Navigation" im Versorgungssystem, also bei Auswahl und Wechsel eines Arztes, eine sehr viel größere Passivität und ein geringeres Engagement unterer Sozialschichten. Da diese Verhaltensmerkmale jedoch, wie eine große Zahl empirischer Studien gezeigt hat, durchaus bedeutsam sind für den Therapieerfolg, ergeben sich für Unterschicht-Patienten dann tendenziell schlechtere medizinische Versorgungseffekte: Sie verzichten auf eigenständige "Recherchen" vor oder nach Arztbesuchen und ebenso auf eine Mitsprache bei Therapie-Entscheidungen, obwohl dadurch in vielen Fällen therapeutische Alternativen ins Blickfeld rücken würden, die ihren persönlichen Interessen stärker entgegen kämen. Und sie bemühen sich weniger stark, einen Arzt zu finden, der ihren persönlichen Erwartungen entspricht, was vielfach zumindest die Chancen zu einer besseren Arzt-Patient-Kommunikation reduziert.
Die Autoren fassen ihre Befunde so zusammen, dass eine "von Ärzten gewollt oder ungewollt realisierte Ungleichbehandlung eher die Ausnahme ist. Was unsere Befunde allerdings andeuten, ist eine gesellschaftlich suggerierte Chancengleichheit der medizinischen Versorgung, die in dieser Form nicht mit der Realität übereinstimmt. Patienten, die sich umfassender und nicht nur in der Arztpraxis gesundheitlich informieren, die sich bei anstehenden Therapie-Entscheidungen persönlich einmischen, und die ihren Arzt sehr sorgfältig auswählen und gegebenenfalls wechseln, haben bessere Chancen einer erfolgreichen Krankheitsvorbeugung oder Behandlung. Und exakt diese Verhaltensmerkmale und damit assoziierte Normen und Orientierungen sind jedoch, wie unsere empirischen Befunde gezeigt haben, bei Unterschicht-Patienten deutlich schwächer ausgeprägt." Diskutiert wird auch eine Reihe von Veränderungsmöglichkeiten, die für die Wissenschaftler insbesondere im Bereich einer besseren und flexibleren, auf individuelle Voraussetzungen und Motive zugeschnittenen Patienteninformation liegt.
Die Studie ist hier kostenlos verfügbar: Soziale Ungleichheit: Schichtspezifisches Informations- und Partizipationsverhalten in der ambulanten Versorgung (Gesundheitsmonitor, Newsletter 3/2008)
Gerd Marstedt, 24.8.2008
Geburten unter schlechten ökonomischen Rahmenbedingungen erhöhen das Mortalitäts-Risiko durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen
 Tödliche Herz-Kreislauf-Erkrankungen im hohen Lebensalter können auch verursacht sein durch ungünstige ökonomische Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt der Geburt. Dies ist das Ergebnis einer Studie, die das Institut zur Zukunft der Arbeit (IZA) jetzt veröffentlicht hat. Wenn zum Zeitpunkt der Geburt eines Kindes ungünstige wirtschaftliche Rahmenbedingungen herrschen, führt dies zu einem deutlich höheren Risiko, dass die betreffende Person später an Herz-Kreislauf-Erkrankungen stirbt. Kinder, die in Rezessionszeiten geboren wurden, sterben im Durchschnitt 15 Monate früher als diejenigen, die unter besseren wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zur Welt kamen. Hauptgrund dafür ist ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Eine Forschergruppe um IZA-Programmdirektor Gerard van den Berg (Freie Universität Amsterdam) ist angesichts dieses Befunds der Frage nachgegangen, welche Ursachen hierfür maßgeblich sind.
Tödliche Herz-Kreislauf-Erkrankungen im hohen Lebensalter können auch verursacht sein durch ungünstige ökonomische Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt der Geburt. Dies ist das Ergebnis einer Studie, die das Institut zur Zukunft der Arbeit (IZA) jetzt veröffentlicht hat. Wenn zum Zeitpunkt der Geburt eines Kindes ungünstige wirtschaftliche Rahmenbedingungen herrschen, führt dies zu einem deutlich höheren Risiko, dass die betreffende Person später an Herz-Kreislauf-Erkrankungen stirbt. Kinder, die in Rezessionszeiten geboren wurden, sterben im Durchschnitt 15 Monate früher als diejenigen, die unter besseren wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zur Welt kamen. Hauptgrund dafür ist ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Eine Forschergruppe um IZA-Programmdirektor Gerard van den Berg (Freie Universität Amsterdam) ist angesichts dieses Befunds der Frage nachgegangen, welche Ursachen hierfür maßgeblich sind.
Den Forschern standen Daten für Personen zur Verfügung, die um das Jahr 1900 geboren wurden. Ein solch weiter Blick in die Vergangenheit ist notwendig, um die langfristigen Auswirkungen auf die Sterblichkeit festzustellen. Als besonders geeignet erwiesen sich Daten zu dänischen Zwillingen, da deren Todesursachen über Jahrzehnte hinweg systematisch dokumentiert wurden. Zudem ließen sich anhand dieser Daten Zusammenhänge zwischen den Gesundheitszuständen der Zwillingspaare ermitteln. In der Tat zeigten sich dabei auffällige Ähnlichkeiten im Gesundheitsbild der Zwillinge, die in "schlechten Zeiten" geboren wurden. "Erstaunlich ist, dass die negativen gesundheitlichen Auswirkungen einer Geburt in Rezessionszeiten oft erst siebzig bis achtzig Jahre später bemerkbar werden", erklärte Gerard van den Berg. "Bis in dieses Alter lassen sich keine Auffälligkeiten feststellen, auch das Krebsrisiko ist annähernd gleich. Dann aber wächst das Risiko einer lebensbedrohlichen Herz-Kreislauf-Erkrankung für diese Gruppe deutlich an."
Als Ursache für den Zusammenhang zwischen der wirtschaftlichen Lage zum Geburtszeitpunkt und dem Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen die Forscher insbesondere die Kombination von unzureichender Ernährung und mangelnder medizinischer Infrastruktur in der frühen Lebensphase an. Ein rezessionsbedingt geringes Haushaltseinkommen ist offenbar weniger schädlich für die langfristige Gesundheit eines Neugeborenen, sofern in der Umgebung gute Gesundheits- und Hygieneeinrichtungen vorhanden sind. Denkbar ist nach Ansicht der Forscher allerdings auch, dass sich Stress, dem die Eltern eines Neugeborenen in wirtschaftlich schlechten Zeiten ausgesetzt sind, auf die Kinder überträgt und die Anfälligkeit für Herzkrankheiten erhöht.
Zwar lassen sich die Ergebnisse der Analyse nicht ohne weiteres auf heute Geborene übertragen. Trotz medizinischen Fortschritts und verbesserter Hygienebedingungen spricht jedoch einiges dafür, dass heute andere Risikofaktoren wie Stress und falsche Ernährung eine ähnliche Wirkung entfalten. Dass ein Zusammenhang zwischen Wirtschaftslage und Krankheitsrisiko besteht, wird auch durch weitere Untersuchungen untermauert, denen zufolge ein niedriges Geburtsgewicht, das häufiger in Rezessionszeiten anzutreffen ist, negative Auswirkungen auf die Gesundheit im höheren Erwachsenenalter hat. Nach den Ergebnissen der Studie könnte es sinnvoll sein, unter widrigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen geborene Jugendliche bereits zu einem frühen Zeitpunkt auf Indikatoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen hin zu untersuchen und gegebenenfalls vorbeugende Maßnahmen anzubieten, darunter auch Programme zur Förderung gesunder Ernährung.
Der Volltext der englischsprachigen Studie (PDF, 45 Seiten) ist kostenlos hier verfügbar: Gerard J. van den Berg u.a.: Being Born Under Adverse Economic Conditions Leads to a Higher Cardiovascular Mortality Rate Later in Life: Evidence Based on Individuals Born at Different Stages of the Business Cycle (IZA Discussion Paper No. 3635, Bonn: August 2008)
Gerd Marstedt, 12.8.2008
Rentner und Pensionäre mit hohen Ruhestandsbezügen haben auch eine höhere Lebenserwartung
 Männliche Ruheständler (Rentner, Pensionäre), die früher in ihrem Berufsleben ein höheres Einkommen hatten und daher auch höhere Altersbezüge haben, leben im Durchschnittlich deutlich länger als Männer mit einem niedrigeren Lebenseinkommen. Je nach wirtschaftlicher und sozialer Lage unterscheidet sich die weitere Lebenserwartung von 65-jährigen Männern um bis zu fünf Jahre. Pensionierte Beamte leben zwei Jahre länger als Rentner. Zu diesen Ergebnissen kommen Wissenschaftler/innen des Forschungsdatenzentrums der Rentenversicherung (FDZ-RV) in Berlin und des Rostocker Zentrums zur Erforschung des Demografischen Wandels.
Männliche Ruheständler (Rentner, Pensionäre), die früher in ihrem Berufsleben ein höheres Einkommen hatten und daher auch höhere Altersbezüge haben, leben im Durchschnittlich deutlich länger als Männer mit einem niedrigeren Lebenseinkommen. Je nach wirtschaftlicher und sozialer Lage unterscheidet sich die weitere Lebenserwartung von 65-jährigen Männern um bis zu fünf Jahre. Pensionierte Beamte leben zwei Jahre länger als Rentner. Zu diesen Ergebnissen kommen Wissenschaftler/innen des Forschungsdatenzentrums der Rentenversicherung (FDZ-RV) in Berlin und des Rostocker Zentrums zur Erforschung des Demografischen Wandels.
Die "sozialen Unterschiede bei der Lebenserwartung", so die Wissenschaftler, haben sich in den vergangenen Jahren trotz insgesamt steigender Lebenserwartung nicht verkleinert. Künftig dürften sie durch hohe Arbeitslosigkeit und Einschränkungen bei der gesetzlichen Alterssicherung und im Gesundheitswesen sogar eher größer werden. In Deutschland gebe es bislang keine umfassende politische Strategie, um dem Problem zu begegnen, dass Menschen in schlechteren sozialen und wirtschaftlichen Verhältnissen im Verhältnis früher sterben, schreiben die Forscher in der aktuellen Ausgabe der WSI Mitteilungen.
Die Wissenschaftler untersuchten erstmals auf sehr breiter Datenbasis die fernere Lebenserwartung von Rentnern und von Pensionären und beschränkten ihre Untersuchung auf Männer. Für ältere Frauen seien die Renten- und Pensionsdaten im Hinblick auf ihre Sterblichkeiten nicht aussagekräftig genug, weil vor allem in den alten Bundesländern nur ein Teil von ihnen langjährig erwerbstätig war.
65-jährige Rentner leben im Durchschnitt weitere 15,8 Jahre. Je nach finanzieller Stellung im Berufsleben unterscheidet sich die fernere Lebenserwartung um knapp drei Jahre: Wohlhabende Rentner leben im Schnitt weitere 17,5 Jahre, schlechter gestellte 14,6 Jahre. Pensionäre haben mit 65 eine durchschnittliche fernere Lebenserwartung von 17,8 Jahren. Sie variiert zwischen 15,8 Jahren bei pensionierten Beamten im einfachen Dienst und 19,6 Jahren bei Beamten des höheren Dienstes. Abhängig von wirtschaftlicher und sozialer Position unterscheidet sich die durchschnittliche Lebenserwartung von Männern in Deutschland somit um bis zu fünf Jahre.
Die Forscher führen die soziale Ungleichheit bei der Lebenserwartung, die auch in anderen europäischen Ländern beobachtet wird, auf verschiedene Ursachen zurück. So arbeiteten Personen mit höherem Lebenseinkommen oder höherer Laufbahn eher in Berufen, die körperlich nicht so stark belasten. Sie haben auch seltener mit existenziellen wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen, was sich wiederum positiv auf Lebenszufriedenheit und Gesundheitsbewusstsein auswirke. Darüber hinaus sehen die Wissenschaftler aber noch zwei weitere Umstände, die zur insgesamt höheren Lebenserwartung von Staatsdienern beitragen: Die bei Beamten wie Pensionären verbreitete private Krankenversicherung verbessere die medizinische Versorgung. Auf der anderen Seite beeinflusse auch die obligatorische Gesundheitsprüfung vor der Übernahme ins Beamtenverhältnis die statistische Lebenserwartung: Über diese Hürde gelangen von vornherein nur tendenziell gesündere Bewerber in den Staatsdienst.
Im Zeitverlauf zeigt sich, dass die weitere Lebenserwartung in den letzten Jahren insgesamt gestiegen ist. Zwischen 1999 und 2003 nahm sie bei Rentnern um durchschnittlich drei und bei Pensionären um 2,5 Monate zu. Die Lücke zwischen den verschiedenen Einkommens- und Laufbahngruppen hat sich dabei aber nicht verkleinert. Die Wissenschaftler führen das auch darauf zurück, dass es in Deutschland zwar "Einzelmaßnahmen zur Verringerung der gesundheitlichen Ungleichheit" gebe, "konkrete Zielvorgaben oder eine umfassende politische Strategie" aber fehlten. Damit liege die Bundesrepublik im Vergleich zu anderen westeuropäischen Ländern zurück.
Der Aufsatz zur Studie ist hier zu finden: Ralf K. Himmelreicher, Daniela Sewöster, Rembrandt Scholz, Anne Schulz: Die fernere Lebenserwartung von Rentnern und Pensionären im Vergleich (WSI Mitteilungen 5/2008, S. 274-280)
Gerd Marstedt, 26.6.2008
Sozioökonomische Ungleichheiten der Gesundheit in 22 europäischen Ländern
 In einer kürzlich im New England Journal of Medicine veröffentlichten Studie berichtet eine Arbeitsgruppe der EU über sozioökonomische Ungleichheiten der Gesundheit in 22 europäischen Ländern. Grundlage waren Gesundheitsdaten über Mortalität (3,5 Millionen Sterbefälle in 16 Ländern), Morbidität, Gesundheitsverhalten und selbsteingeschätzte Gesundheit (Befragungen in 19 Ländern). Der sozioökonomische Status (SES) wurde über den Bildungsabschluss und die Berufszugehörigkeit erfasst.
In einer kürzlich im New England Journal of Medicine veröffentlichten Studie berichtet eine Arbeitsgruppe der EU über sozioökonomische Ungleichheiten der Gesundheit in 22 europäischen Ländern. Grundlage waren Gesundheitsdaten über Mortalität (3,5 Millionen Sterbefälle in 16 Ländern), Morbidität, Gesundheitsverhalten und selbsteingeschätzte Gesundheit (Befragungen in 19 Ländern). Der sozioökonomische Status (SES) wurde über den Bildungsabschluss und die Berufszugehörigkeit erfasst.
Es zeigte sich, dass in fast allen Ländern die Sterblichkeit und die selbsteingeschätzte Gesundheit in den Gruppen mit niedrigem SES deutlich ungünstiger sind im Vergleich zu den besser gestellten Gruppen.
Im Ländervergleich ist die Ausprägung der Ungleichheiten jedoch unterschiedlich. Um mehr als den Faktor 4 ist die Mortalität in der Bevölkerungsgruppe mit dem niedrigsten SES in Ungarn, Tschechien, Polen und Litauen erhöht im Vergleich zu der Gruppe mit dem höchsten SES. In England und Schweden ist der Unterschied der Sterblichkeit weniger als zweifach, der kleinste Unterschied besteht im Baskenland. Die starken Unterschiede sind auf Todesursachen zurückzuführen, die mit Tabak und Alkohol in Verbindung stehen.
Für ganz Europa gilt, dass ein geringeres Maß an Bildung mit schlechterer Gesundheit einhergeht.
Auf tabakssoziierte Krankheiten sind 21% der Ungleichheiten in der Gesamtortalität bei Männern und 6% bei Frauen in Europa zurückzuführen, alkoholassoziierte Krankheiten bewirken 11% der Unterschiede bei den Männern und 6% bei den Frauen.
Die selbst eingeschätzte Gesundheit ist in ganz Europa bei weniger Gebildeten schlechter, die Variabilität aber geringer und die Verteilungsmuster anders als bei der Mortalität.
In ganz Europa geht schlechtere Bildung mit vermehrtem Rauchen und stärkerem Übergewicht einher - ersteres stärker ausgeprägt bei Männern, letzteres bei Frauen.
Bildungsassoziierte Raucherraten unterscheiden sich stark in Nord-, West- und Zentraleuropa, weniger stark in Südeuropa - hier ist bei Frauen sogar eine Umkehr der Beziehung zu beobachten - der Anteil von Rauchenden ist höher bei gebildeten Frauen.
Bemerkenswert ist diese Studie für die aktuelle Beschreibung des unterschiedlichen Ausmaßes der sozialen Ungleichheiten der Gesundheit in europäischen Ländern. Anzumerken ist jedoch, dass sie wenig Neues zur Erklärung dieses Phänomens beisteuert.
Bei dieser Studie handelt es sich um eine Fortschreibung der Untersuchung der sozioökonomischen Ungleichheiten von Morbidität und Mortalität in 11 westeuropäischen Ländern aus dem Jahr 1997.
Über die ausführlichere englischsprachige Arbeit "Health Inequalities: Europe in Profile" zu den sozio-ökonomischen Ungleichheiten im Gesundheitsbereich in 25 EU-Mitgliedsländern hatten wir berichtet.
New England Journal of Medicine, 5. Juni 2008 Socioeconomic Inequalities in Health in 22 European Countries kostenloser Volltext
LANCET 7. Juni 1997 Socioeconomic inequalities in morbidity and mortality in western Europe kostenloser Volltext
Health Inequalities: Europe in Profile
David Klemperer, 24.6.2008
Hohes Einkommen und Bildungsniveau steigern die Überlebenszeit nach einem Herzinfarkt deutlich
 Wissenschaftler vermuten schon seit längerem, dass sozio-ökonomische Faktoren wie Einkommen und Bildung auch einen Einfluss darauf haben, wie lange Patienten nach einem Herzinfarkt überleben. Eine jetzt in der Zeitschrift "Mayo Clinic Proceedings" veröffentlichte Studie hat diese Vermutung nun eindrucksvoll bestätigt: Ein um ca. 10.000 Dollar höheres Einkommen steigert die Ein-Jahres-Überlebensrate um zehn Prozent.
Wissenschaftler vermuten schon seit längerem, dass sozio-ökonomische Faktoren wie Einkommen und Bildung auch einen Einfluss darauf haben, wie lange Patienten nach einem Herzinfarkt überleben. Eine jetzt in der Zeitschrift "Mayo Clinic Proceedings" veröffentlichte Studie hat diese Vermutung nun eindrucksvoll bestätigt: Ein um ca. 10.000 Dollar höheres Einkommen steigert die Ein-Jahres-Überlebensrate um zehn Prozent.
Die Wissenschaftler der renommierten Mayo Klinik in Rochester analysierten Krankenakten von etwas mehr als 700 Patienten, die im Zeitraum November 2002 bis Mai 2006 aufgrund eines Herzinfarkts in das Krankenhaus eingeliefert und medizinisch behandelt worden waren. Aus den Krankenakten konnten die Forscher das Bildungsniveau der Patienten entnehmen und die Wohnungsadresse. Dieser Hinweis auf die Lage der Wohnung wurde dann mit Volkszählungsdaten verknüpft und dazu verwendet, um das Einkommen der Teilnehmer einzuschätzen.
Von den 705 Studienteilnehmern starben nach 2006 dann 155. Diese wurden dann in mehrere Gruppen eingeteilt, sowohl unterschieden nach dem Einkommen wie auch nach dem Schulabschluss. Beide Variablen erwiesen sich dann in der Analyse als hochsignifikante Einflussfaktoren für die Überlebenszeit. Es zeigte sich:
• Für Patienten aus Wohngegenden mit einem Einkommen von durchschnittlich etwa 28-44.000 Dollar betrug die Ein-Jahres-Überlebensrate 75 Prozent, in der nächst höheren Einkommensklasse 83 Prozent und lag in der obersten Einkommensgruppe (57-74.000 $) bei 86 Prozent.
• Ähnlich einflussreich war auch die Schulbildung: Bei weniger als 12 Jahren Schulausbildung (kein High-School-Abschluss) überlebten für ein Jahr 67 Prozent, bei 12 Jahren (High-School-Abschluss) waren es schon 81 Prozent und bei Studienteilnehmern mit 12 und mehr Jahren (College, Universität) stieg die Ein-Jahresüberlebensrate nochmals auf 85 Prozent.
Die Unterschiede sind auch nach Meinung der Wissenschaftler beträchtlich, wenn man berücksichtigt, dass eine Verbesserung der Ein-Jahr-Überlebensrate um wenige Prozent in klinischen Studien schon als Erfolg gilt. Auch die Autoren äußerten sich über das quantitative Ausmaß ihrer Analyse überrascht, denn die Patienten der Mayo Clinic haben ein Einkommen, das deutlich über dem US-Durchschnitt liegt und die medizinische Versorgung in der Klinik gilt als vorbildlich. Einer der Autoren, Yariv Gerber, vermutet daher, dass die Effekte sich auf eine größere Gesundheitskompetenz und Selbstwirksamkeitserwartung aufgrund einer längeren Ausbildungszeit zurückführen lassen.
Die Studie im Volltext (kostenlos) ist hier: Yariv Gerber u.a.: Neighborhood Income and Individual Education: Effect on Survival After Myocardial Infarction (Mayo Clin Proc. 2008;83:663-669)
Gerd Marstedt, 19.6.2008
Soziale Ungleichheit: Die Schichtzugehörigkeit wirkt sich auch auf die Häufigkeit und Intensität von Schmerzen aus
 Für eine Vielzahl chronischer Erkrankungen ist in wissenschaftlichen Studien ein "sozialer Gradient" festgestellt worden, also ein starker Effekt der Schichtzugehörigkeit auf die Betroffenheit von Krankheiten und auch die Lebenserwartung. Die Befunde über eine sozial höchst ungleiche Verteilung von Krebs- und Herz-Kreislauferkrankungen, Adipositas und Diabetes, müssen nun um ein neues Merkmal erweitert werden: Schmerzen. Bei Interviews mit knapp 4.000 US-Amerikanern wurde jetzt festgestellt, dass diejenigen mit einem niedrigeren Einkommen und geringeren Bildungsstand im Alltag deutlich häufiger Schmerzen verspüren als andere Bevölkerungsgruppen. Und es wurde darüber hinaus auch festgestellt, dass die empfundene Schmerz-Intensität bei Unterschicht-Angehörigen stärker ist.
Für eine Vielzahl chronischer Erkrankungen ist in wissenschaftlichen Studien ein "sozialer Gradient" festgestellt worden, also ein starker Effekt der Schichtzugehörigkeit auf die Betroffenheit von Krankheiten und auch die Lebenserwartung. Die Befunde über eine sozial höchst ungleiche Verteilung von Krebs- und Herz-Kreislauferkrankungen, Adipositas und Diabetes, müssen nun um ein neues Merkmal erweitert werden: Schmerzen. Bei Interviews mit knapp 4.000 US-Amerikanern wurde jetzt festgestellt, dass diejenigen mit einem niedrigeren Einkommen und geringeren Bildungsstand im Alltag deutlich häufiger Schmerzen verspüren als andere Bevölkerungsgruppen. Und es wurde darüber hinaus auch festgestellt, dass die empfundene Schmerz-Intensität bei Unterschicht-Angehörigen stärker ist.
Die jetzt in der renommierten britischen Fachzeitschrift "The Lancet" veröffentlichte Studie basiert auf einer Zufallsauswahl von 3.982 US-amerikanischen Männern und Frauen, die mit einer CATI-Software (Computer Assisted Telephone Interviews) zufällig ausgewählt und angerufen wurden. Bei denjenigen, die an der Befragung teilnehmen wollten (37% aller Angerufenen), wurde für einen Zeitraum von 24 Stunden (Vortag 4 Uhr bis Anruftag 4 Uhr) eine Art Tagebuch erstellt, welchen Beschäftigungen man in dieser Zeitspanne jeweils wie lange nachgegangen ist, egal, ob es sich um Aktivitäten wie Schlafen oder Arbeiten, Fernsehen oder Spazieren gehen handelte. Danach wurden von der PC-Software nach dem Zufallsprinzip drei Zeitintervalle von 15 Minuten Dauer ausgewählt und die Studienteilnehmer wurden dann gefragt, welche Emotionen sie in dieser Viertelstunde hatten und wie intensiv diese waren . Als Emotionen waren 6 Möglichkeiten vorgegeben: Schmerzen, glücklich, müde, gestresst, traurig, interessiert. Schließlich waren dann diese Gefühle auch noch auf einer Skala von 0-6 einzustufen, wobei "6" die höchste Intensität bedeutete.
In der Analyse zeigte sich dann:
• Entgegen allen Vermutungen der Forscher zeigten Männer und Frauen kaum Unterschiede in der Häufigkeit oder Intensität von Schmerzempfindungen.
• Das Alter spielt jedoch eine Rolle: Etwa ab dem Alter von 40 spielt Schmerz eine größere Rolle, diese Erfahrung steigt jedoch mit höherem Lebensalter nicht weiter an.
• Das Haushaltseinkommen spielt eine große Rolle: Befragte mit einem Einkommen bis 30.000 Dollar berichteten sehr viel öfter 15-Minuten-Intervalle mit Schmerzen (34%) als Befragte mit einem Einkommen über 100.000 Dollar (23%). Auch die durchschnittliche Bewertung der Schmerzintensität lag in der niedrigen Einkommensgruppe mit einem Mittelwert von 1.3 fast doppelt so hoch wie bei Besserverdienern (0.7).
• Nahezu gleich lautende Ergebnisse zeigten sich auch, wenn man anstelle des Einkommens den höchsten Schulabschluss als Indikator der Schichtzugehörigkeit verwendete.
Ein kostenloses Abstract der Studie ist hier: Alan B Krueger, Arthur A Stone: Assessment of pain: a community-based diary survey in the USA (The Lancet 2008; 371:1519-1525, DOI:10.1016/S0140-6736(08)60656-X)
Gerd Marstedt, 6.5.2008
England: Bevölkerungsgesundheit verbessert, Ungleichheiten bleiben
 Für alle sozialen Gruppen ist in England die Lebenserwartung gestiegen und die Kindersterblichkeit gesunken. Verglichen mit dem Bevölkerungsdurchschnitt sind die Verbesserungen für die unteren Schichten bzw. für die Bewohner der am meisten deprivierten Regionen allerdings geringer, so dass die sozialen Ungleichheiten sich etwas vergrößert haben. Dies geht aus der am 13. März erschienen Untersuchung Tackling health inequalities: 2007 Status Report on the Programme for Action hervor.
Für alle sozialen Gruppen ist in England die Lebenserwartung gestiegen und die Kindersterblichkeit gesunken. Verglichen mit dem Bevölkerungsdurchschnitt sind die Verbesserungen für die unteren Schichten bzw. für die Bewohner der am meisten deprivierten Regionen allerdings geringer, so dass die sozialen Ungleichheiten sich etwas vergrößert haben. Dies geht aus der am 13. März erschienen Untersuchung Tackling health inequalities: 2007 Status Report on the Programme for Action hervor.
Für eine Beurteilung der Wirksamkeit der im Jahr 2003 beschlossenen politischen Maßnahmen ist es nach Meinung von Michael Marmot, dem Vorsitzenden des wissenschaftlichen Begleitgremiums, aufgrund des noch sehr kurzen Untersuchungszeitraums zu früh.
Auf Grundlage der wissenschaftlichen Aufarbeitung im sog. Acheson Report von 1998 (Independent Inquiry into Inequalities in Health Report) hatte die Englische Regierung im Jahr 2003 das Programm Tackling health inequalities:A Programme for Action zur Minderung der sozialen Ungleichheit der Gesundheit verabschiedet. Die Zielsetzung besteht in der Minderung der Ungleichheiten der Gesundheit um 10 Prozent, gemessen an der Kindersterblichkeit und der Lebenserwartung.
Bericht des Department of Health: Tackling health inequalities: 2007 Status Report on the Programme for Action
Programm zur Minderung der sozialen Ungleichheit der Gesundheit Tackling health inequalities:A Programme for Action
Acheson Report von 1998 (Independent Inquiry into Inequalities in Health Report)
Der Acheson Report knüpft an den legendären Black Report von 1980 an, der ebenfalls als Volltext im Internet verfügbar ist. Inequalities in Health. Report of a Research Working Group
David Klemperer, 21.3.2008
Die Lebenserwartung ist weiter gestiegen - hauptsächlich jedoch für Bevölkerungsgruppen mit höherer Bildung
 Die Lebenserwartung in den USA ist in den 80er und 90er Jahren des 20.Jahrhunderts weiter gestiegen - leider zeigt sich dieser Effekt nicht bei allen Bevölkerungsgruppen in gleichem Maße, sondern wirkt sich sehr viel deutlicher bei Personen mit besonders hohem Bildungsniveau (zum Beispiel mit Hochschulabschluss) aus. Der Titel der Studie, die jetzt in der Zeitschrift "Health Affairs" veröffentlicht wurde ("The Gap Gets Bigger", Die Kluft wird größer), macht auf das Problem einer zunehmenden sozialen Ungleichheit in den Lebensbedingungen aufmerksam, die nicht nur in den USA beobachtet wird.
Die Lebenserwartung in den USA ist in den 80er und 90er Jahren des 20.Jahrhunderts weiter gestiegen - leider zeigt sich dieser Effekt nicht bei allen Bevölkerungsgruppen in gleichem Maße, sondern wirkt sich sehr viel deutlicher bei Personen mit besonders hohem Bildungsniveau (zum Beispiel mit Hochschulabschluss) aus. Der Titel der Studie, die jetzt in der Zeitschrift "Health Affairs" veröffentlicht wurde ("The Gap Gets Bigger", Die Kluft wird größer), macht auf das Problem einer zunehmenden sozialen Ungleichheit in den Lebensbedingungen aufmerksam, die nicht nur in den USA beobachtet wird.
Basis der Studie sind Analysen unter Verwendung der National Longitudinal Mortality Study (NLMS), einer repräsentativen US-Datenbank, die aktuell etwa 3 Millionen Einträge und 250 Tausend Todesfälle umfasst. Dabei ist auch die Todesursache vermerkt und eine große Zahl sozio-demographischer Merkmale. In der Auswertung fanden die Wissenschaftler dann heraus, dass sowohl im Zeitraum 1981-1988 als auch 1990-2000 die Lebenserwartung vor allem für solche Bevölkerungsgruppen angestiegen ist, die eine zwölfjährige Schulausbildung absolviert haben. Für diese stieg die Lebenserwartung in den 80er-Jahren um etwa 1,4 Jahre und in den 90er Jahren um weitere 1,6 Jahre. Weniger gut schnitten Gruppen mit niedrigem Bildungsniveau ab: Ihre Lebenserwartung stieg in den 80ern nur um 0,5 Jahre, in den 90ern stieg sie dann gar nicht mehr an und stagnierte.
Die Wissenschaftler kamen zu dem Ergebnis, dass Personen mit überdurchschnittlich hohem Bildungsniveau (Hochschul-Diplom), die im Jahre 2000 ein Alter von 25 Jahren aufwiesen, durchschnittlich damit rechnen können, 82 Jahre alt zu werden. Bei weniger gebildeten Personen ist diese Erwartung um 7 Jahre niedriger und beträgt nur 75 Jahre.
Diskutiert werden auch unterschiedliche Erklärungsansätze für diese zunehmende Schere in der Lebenserwartung bei unteren und oberen Sozialschichten. Ein wichtiger Faktor ist für die Forscher die im Beobachtungszeitraum auch gestiegene Einkommens-Ungleichheit, die - insbesondere in den USA - Bevölkerungsgruppen am unteren Ende der Einkommensskala keinen Zugang zu einer Krankenversicherung und damit auch zur medizinischen Versorgung erlaubt.
Darüber hinaus spielen nach ihrer Meinung jedoch auch Verhaltensrisiken eine Rolle, insbesondere das Rauchen, das sie für etwa 20 Prozent der Unterschiede in der Lebenserwartung verantwortlich machen. Sie führen dies auf Todesursachen zurück, die eng mit dem Rauchen verknüpft sind. Zu dieser Erklärung passt, dass in Bevölkerungsgruppen mit höherer Bildung der Anteil der Raucher sehr viel deutlicher zurückgegangen ist als bei unteren Bildungsschichten. Auch das Problem Übergewicht spielt nach Meinung der Wissenschaftler eine Rolle: Ähnlich wie das Rauchen ist auch Übergewicht und vor allem Adipositas in unteren Sozialschichten häufiger verbreitet.
Hier ist ein Abstract der Studie: Ellen R. Meara u.a.: The Gap Gets Bigger: Changes In Mortality And Life Expectancy, By Education, 1981-2000 (Health Affairs, 27, no. 2 (2008): 350-360, doi: 10.1377/hlthaff.27.2.350)
Gerd Marstedt, 13.3.2008
Oberschicht-Angehörige erhalten nach einem Herzinfarkt öfter eine bessere medizinische Versorgung - und leben danach länger
 Erst vor kurzem hatte eine Studie gezeigt, dass schwarzafrikanische Patienten in den USA nach einem akuten Herzinfarkt oder schweren Herzattacken deutlich schlechter versorgt werden als Weiße (vgl.: Grundmerkmale des US-Gesundheitswesens: Qualitativ ungleiche Krankenhausbehandlung von weißen und schwarzen Patienten). Die Annahme, dies sei nun ein spezifischer Auswuchs von Rassendiskriminierung in den USA, wurde nun durch eine große schwedische Studie widerlegt. Auch im skandinavischen Wohlfahrtsstaat fand man heraus, dass Angehörige unterer Sozialschichten eine deutlich schlechtere medizinische Versorgung nach einem Herzinfarkt bekommen als Patienten der Oberschicht.
Erst vor kurzem hatte eine Studie gezeigt, dass schwarzafrikanische Patienten in den USA nach einem akuten Herzinfarkt oder schweren Herzattacken deutlich schlechter versorgt werden als Weiße (vgl.: Grundmerkmale des US-Gesundheitswesens: Qualitativ ungleiche Krankenhausbehandlung von weißen und schwarzen Patienten). Die Annahme, dies sei nun ein spezifischer Auswuchs von Rassendiskriminierung in den USA, wurde nun durch eine große schwedische Studie widerlegt. Auch im skandinavischen Wohlfahrtsstaat fand man heraus, dass Angehörige unterer Sozialschichten eine deutlich schlechtere medizinische Versorgung nach einem Herzinfarkt bekommen als Patienten der Oberschicht.
Basis der Studie waren Daten aus dem Schwedischen Herzinfarkt Register. Dort wurde die Daten aller 45-84jährigen Patienten erfasst, die in den Jahren 1993-1996 einen Herzinfarkt für 4 Wochen überlebten. Insgesamt waren dies etwa 16.000 Frauen und 30.000 Männer. Für die Analysen herangezogen wurden noch weitere Angaben, wie insbesondere das Haushaltseinkommen und Angaben dazu, ob der Patient im Zeitraum von 5 Jahren nach dem Infarkt verstorben war oder noch lebte. Als Indikator für die Versorgungsqualität wurde herangezogen, ob bei den Patienten eine sogenannte "Revaskularisierung" nach der Herzattacke durchgeführt worden war. Darunter versteht man das Einpflanzen von feinen Blutgefäßen in ein krankheitsbedingt nicht durchblutetes Herz oder auch die Auflösung einer Verstopfung im Herzbereich, also Maßnahmen, die bei Herzinfarktpatienten oft gesundheitlich absolut notwendig sind und sich lebensverlängernd auswirken.
Als Ergebnis zeigte sich dann:
• Bei Patienten aus oberen Einkommensgruppen hatten Mediziner zwei- bis dreimal so häufig eine Revaskularisierung durchgeführt wie bei den Patienten mit dem niedrigsten Einkommen.
• Vermutlich als Folge dieser besseren Versorgung war die 5-Jahres-Überlebensquote bei den einkommensstarken Patienten doppelt so groß.
• Diese Ergebnisse hatten auch dann noch Bestand, wenn man andere Variablen wie das Alter, Begleiterkrankungen oder Art der Klinik bei der Einweisung mitberücksichtigte.
Über mögliche Ursachen dieser Ungleichbehandlung erfährt man im Aufsatz leider nichts: "Die Gründe für diese Selektionsprozesse bleiben im Dunkeln, aber ihre Existenz ist eine der vielen Herausforderungen für das Schwedische Gesundheitssystem und sein Grundprinzip der Gleichbehandlung aller."
Hier ist ein Abstract der Studie: Maria Rosvall u.a.: The association between socioeconomic position, use of revascularization procedures and five-year survival after recovery from acute myocardial infarction (BMC Public Health 2008, 8:44doi:10.1186/1471-2458-8-44)
Kostenlos verfügbar ist auch eine vorläufige PDF-Datei
Gerd Marstedt, 5.2.2008
Kinderarmut wirkt sich auch langfristig und im weiteren Lebensverlauf negativ aus
 Ein Aufwachsen in Armut hat gravierende negative Folgen auch für die langfristige Entwicklung von Kindern. Dies lässt sich anhand der seit dem Jahr 2000 erhobenen Daten des Deutschen Jugendinstituts (DJI) für eine Vielzahl von Aspekten nachweisen. Beeinträchtigt werden die soziale Teilhabe und Persönlichkeitsentwicklung, Schulleistungen und kindliches Wohlbefinden. Das Deutsche Jugendinstitut hat jetzt Ergebnisse einer Langzeitstudie ("DJI-Kinderpanel") zu den Lebenslagen von Kindern veröffentlicht. In diesen Teiluntersuchungen werden die Zusammenhänge von Armut und sozialer Teilhabe, Persönlichkeit, kognitiven Leistungen und kindlichem Wohlbefinden differenziert aufgezeigt. Auf der Website des DJI werden diese Ergebnisse in der Rubrik "Thema 2007/11: Kinderarmut: einmal arm - immer arm?" zusammenfassend vorgestellt.
Ein Aufwachsen in Armut hat gravierende negative Folgen auch für die langfristige Entwicklung von Kindern. Dies lässt sich anhand der seit dem Jahr 2000 erhobenen Daten des Deutschen Jugendinstituts (DJI) für eine Vielzahl von Aspekten nachweisen. Beeinträchtigt werden die soziale Teilhabe und Persönlichkeitsentwicklung, Schulleistungen und kindliches Wohlbefinden. Das Deutsche Jugendinstitut hat jetzt Ergebnisse einer Langzeitstudie ("DJI-Kinderpanel") zu den Lebenslagen von Kindern veröffentlicht. In diesen Teiluntersuchungen werden die Zusammenhänge von Armut und sozialer Teilhabe, Persönlichkeit, kognitiven Leistungen und kindlichem Wohlbefinden differenziert aufgezeigt. Auf der Website des DJI werden diese Ergebnisse in der Rubrik "Thema 2007/11: Kinderarmut: einmal arm - immer arm?" zusammenfassend vorgestellt.
Als die Bundesregierung 2005 ihren 2. Armutsbericht veröffentlichte, waren in Deutschland "1,1 Mio. Kinder unter 18 Jahren BezieherInnen von Sozialhilfe." Ein aktueller Armutsbericht liegt derzeit nicht vor, aber der Kinderschutzbund gibt für das Jahr 2007 mit 2,6 Mio. armen Kindern in Deutschland eine alarmierende Schätzung ab. Als arm gilt in Deutschland derjenige, dessen Einkommen weniger als 60% des Durchschnittseinkommens beträgt. Diese Einkommensarmut ist als Schlüsselmerkmal von Armut zu sehen mit all ihren Auswirkungen auf weitere Lebensbereiche wie zum Beispiel Gesundheit oder Bildung.
Gerhard Beisenherz (DJI) betont im "Interview", dass wir möglichst im frühen Kindesalter ansetzen müssen, um die "Vererbung" von Armut über den Bildungskanal zu verhindern. Dafür brauchen wir jedoch niedrigschwellige und möglichst aufsuchende Angebote für genau diese Zielgruppe der bildungsfernen und zugleich armen Familien. Umfassende Förder- und Betreuungsangebote wären erste Schritte, um die Abwärtsspirale der Armut zu unterbrechen, meint auch der Sprecher der Nationalen Armutskonferenz Dr. Wolfgang Gern im "Blick von außen". Er warnt aber gleichzeitig davor, die Armut zu pädagogisieren. "Das lenkt vom eigentlichen Problem ab. Durch Bildung allein lässt sich Armut nicht bekämpfen, solange Arbeitsplätze fehlen."
In der Rubrik "Auf einen Blick" werden einerseits aktuelle statistische Daten zur Kinderarmut in Deutschland im Detail vorgestellt, darüber hinaus aber auch empirische Befunde zu den psychischen und sozialen Folgen.
So zeigt sich beispielsweise für den Aspekt Soziale Teilhabe: Der Anteil der Kinder, die häufige gemeinsame Aktivitäten mit den Eltern berichten, wächst mit steigender Schicht deutlich: Über die fünf Schichten, die wir unterscheiden - Unterschicht, untere, mittlere und obere Mittelschicht und Oberschicht - finden wir die folgenden Anteile: 5%, 9%, 16% 20% und 23%. Kinder aus der untersten Sozialschicht berichten zu fast 24%, dass sie in letzter Zeit Streit mit der Mutter wegen des Einkaufs spezieller Markenkleidung hatten. Demgegenüber berichten nur ca. 9%, 8%, 11% und 7% der Kinder in den anderen Schichten über solche Streitursachen.
Im Bereich Persönlichkeitsentwicklung werden verschiedene Dimensionen näher erfasst, und zwar: die Internalisierung (die Neigung, sich in sich zurück zu ziehen); die Externalisierung (die Tendenz, aus sich heraus zu gehen, z.T. auch aggressiv zu werden); die motorische Unruhe; das Selbstbild, insbesondere Selbstvertrauen und Vorstellung von Selbstwirksamkeit; die soziale/kognitive Aufgeschlossenheit. Mit Ausnahme der letzten Dimension finden sich für alle anderen Aspekte statistisch hochsignifikante Unterschiede mit der Tendenz zu einer verzögerten und weniger ausgereiften Persönlichkeitsentwicklung in der unteren Sozialschicht.
Hinsichtlich der intellektuellen Entwicklung wird deutlich: Die Schulleistungen im Rechnen und Lesen werden durch die Dauer der Armut dann nachhaltig beeinträchtigt, wenn diese schon zwei bis drei Jahre anhält. Bereits in der erste Welle weisen Kinder der älteren Kohorte in unterschiedlichen Armutslagen zum Teil erhebliche Leistungsunterschiede in der Schule auf. Bei Kindern, die schon vor der Erstbefragung in Armut lebten und dann darin verharrten, finden wir eine markante Differenz in der Rechenkompetenz zu den übrigen Kindern. Circa 46% dieser dauerhaft armen Kinder sind im Rechnen schlecht ("nicht so gut" oder "überhaupt nicht gut") gegenüber 15% der gelegentlich armen Kinder und 20% der nie armen Kinder. Die Lesekompetenz der 9- bis 10jährigen Grundschüler ist dagegen von der Armutslage generell beeinflusst. Die Kinder, deren Situation sich vor der Ersterhebung noch verschlechtert hat und/oder die seither dauerhaft in Armut verharren, weisen massive Unterschiede in der Lesekompetenz gegenüber den dauerhaft nicht-armen Kindern auf.
Für das kindliche Wohlbefinden in der Schule wird deutlich, dass sich gerade das schulische Wohlbefinden bei Kindern in Armutslagen von der 2. bis zur 4. Klasse verschlechtert.
Deutsches Jugendinstitut: Thema 2007/11: Kinderarmut: einmal arm - immer arm? Ergebnisse auf einen Blick
Gerd Marstedt, 2.11.2007
Grippe-Impfschutz für "hard-to-reach populations" in den USA - Vernachlässigt trotz höherem Risiko für "Restbevölkerung"
 Mit Sicherheit nicht nur ein us-amerikanisches Phänomen, aber dort jetzt aktuell untersucht: Die meisten Grippe-Impfschutzprogramme und auch andere Schutzprogramme gegen ansteckende Krankheiten kümmern sich nicht mit dem gebotenen Druck bzw. der notwendigen Phantasie darum, ob und wie die Angehörigen der so genannten "hard-to-reach populations (HTR)", dazu zählen vor allem nichtgemeldete Immigranten, Obdachlose, Drogenabhängige, an ihr Haus gebundene ältere Menschen und weitere Minoritäten, eine Schutzimpfung erhalten.
Mit Sicherheit nicht nur ein us-amerikanisches Phänomen, aber dort jetzt aktuell untersucht: Die meisten Grippe-Impfschutzprogramme und auch andere Schutzprogramme gegen ansteckende Krankheiten kümmern sich nicht mit dem gebotenen Druck bzw. der notwendigen Phantasie darum, ob und wie die Angehörigen der so genannten "hard-to-reach populations (HTR)", dazu zählen vor allem nichtgemeldete Immigranten, Obdachlose, Drogenabhängige, an ihr Haus gebundene ältere Menschen und weitere Minoritäten, eine Schutzimpfung erhalten.
Dabei ist David Vlahov, dem Verfasser der in der zweiten August-2007-Ausgabe des "Journal of Urban Health: Bulletin of The New York Academy of Medicine" veröffentlichten Studie "Strategies for Improving Influenza Immunization Rates among Hard-to-Reach Populations" zuzustimmen, wenn er die Relevanz dieser Bevölkerungsgruppen für die öffentliche Gesundheit folgendermaßen zusammenfasst: "Hard-to-reach populations are important to vaccinate not only because they’re personally vulnerable, but because they could be widely transmitting disease to others."
Dabei sind die Folgen einer außer Kontrolle geratenden Grippeepidemie groß und auch der Umfang der HTR-Population: In den USA sterben an der Virusgrippe jährlich rund 36.000 Personen, von denen die meisten älter als 65 Jahre alt sind und 10-20 % der US-Bevölkerung werden angesteckt. Die Autoren dieser Studie gehen für die USA von 12 Millionen nichtgemeldeter Immigranten, 1,5 Millionen Drogenabhängigen und 744.000 Obdachlosen aus. Das Ansteckungsrisiko durch Immigranten und Obdachlose ist z. B. deshalb so hoch, weil viele Angehörige dieser Gruppe in der Nahrungsmittelproduktion arbeiten oder sich sehr oft bevorzugt in öffentlichen Verkehrsmitteln aufhalten.
Die Studie stellt einige "models of good practice" dar und gibt Ratschläge für zusätzliche besondere Bemühungen:
• In einem Projekt der Akademie für New York, "Venue-Intensive Vaccines for Adults (VIVA)", bieten entsprechend ausgerüstete Helfer Impfungen auf belebten Bürgersteigen in Harlem an oder von Haustür-zu-Haustür in der Südbronx.
• Gezielte Erinnerungen von Hochrisikogruppen über Rundmails und SMS könnten solche aufsuchenden Aktionen ergänzen.
• Nicht zuletzt sollten sich allerdings auch mehr GesundheitsarbeiterInnen in sozial benachteiligten Gegenden und Gruppen impfen lassen: Die Studie stellte fest, dass nur ein Drittel bis zur Hälfte dieser Gruppe im Moment gegen Grippe geimpft sind.
Weitere Informationen erhält man durch eine Pressemitteilung auf der Website der "New York Academy of Medicine".
Mit etwas Glück gibt der Verlag auch den kompletten Artikel nach der Veröffentlichung als PDF-Dokument zum kostenfreien Herunterladen frei. Daher lohnt es sich bei entsprechendem Interesse ab dem 24. August 2007 auf die Website des "Journal of Urban Health: Bulletin of The New York Academy of Medicine" zu gehen und nach dem mit Sicherheit kostenfreien Abstract oder dem Kompletttext des Aufsatzes "Strategies for Improving Influenza Immunization Rates among Hard-to-Reach Populations" zu schauen.
Bernard Braun, 20.8.2007
Erhöhtes Erkrankungsrisiko neugeborener schwarzer Kinder in den USA - auch nach Ausschluss anderer Einflussfaktoren!
 In der neuesten Ausgabe des von den staatlichen "Centers for Disease Control and Prevention (CDC)" wöchentlich herausgegebenen fünfseitigen "Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR)" (20 Juli, 2007 / 56(28);701-705) wird via Schlagzeile über die im Zeitraum 2003 bis 2005 gegenüber den Jahren 2000-2001 erfolgreiche Senkung der Neuerkrankungshäufigkeit von Streptokokken-Erkrankungen (Typ 2) ("Group B Streptococcal Disease [GBS]") unter Neugeborenen um ein Drittel berichtet. Das Ausgangsjahr 2002 ist nicht zufällig gewählt, sondern das Jahr in dem eine Leitlinie der CDC schwangeren Frauen ein allgemeines Screening zwischen der 35. und 37. Schwangerschaftswoche u.a. zur Verhinderung dieser Erkrankung ihrer Babies empfahl.
In der neuesten Ausgabe des von den staatlichen "Centers for Disease Control and Prevention (CDC)" wöchentlich herausgegebenen fünfseitigen "Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR)" (20 Juli, 2007 / 56(28);701-705) wird via Schlagzeile über die im Zeitraum 2003 bis 2005 gegenüber den Jahren 2000-2001 erfolgreiche Senkung der Neuerkrankungshäufigkeit von Streptokokken-Erkrankungen (Typ 2) ("Group B Streptococcal Disease [GBS]") unter Neugeborenen um ein Drittel berichtet. Das Ausgangsjahr 2002 ist nicht zufällig gewählt, sondern das Jahr in dem eine Leitlinie der CDC schwangeren Frauen ein allgemeines Screening zwischen der 35. und 37. Schwangerschaftswoche u.a. zur Verhinderung dieser Erkrankung ihrer Babies empfahl.
So positiv diese Entwicklung ist und unabhängig davon, dass es keinen Nachweis über den kausalen Zusammenhang zwischen Screening und spezifischer Veränderung der Inzidenz gibt, hat dieser Erfolg aber auch eine ausgesprochen dunkle Seite. Die 33 %-Verbesserung bezieht sich nämlich nur auf die Kinder weißer Eltern und nicht auf die afroamerikanischer oder schwarzer Eltern. Unter den schwarzen Neugeborenen stieg die Inzidenzrate in der Betrachtungsperiode dagegen insgesamt um 70 %.
In einem Editorial weist die Wissenschaftlergruppe zur Erklärung der Unterschiede zwischen weißen und schwarzen Kinder u.a. auf den höheren Anteil von Frühgeburten (einem Risikofaktor für GBS) bei den schwarzen Müttern und deren geringerem Zugang zur vorgeburtlichen Vorsorge und Behandlung hin. Es handelte sich demnach also um die "ganz normale" Ungleichheit zwischen unterschiedlichen Ethnien über der viele Kenner der Vielzahl ähnlicher Studien schnell zur Tagesordnung übergehen.
Irritierend sind aber zwei Besonderheiten des Auftretens von GBS unter afroamerikanischen Neugeborenen: Im ersten Jahr nach Veröffentlichung der Vorsorgeempfehlung erreichte der Wert (genauer der Indikator "early-onset GBS disease [EOD]") ein Rekordtief, stieg dann aber in den zwei Folgejahren um den besagten Wert. Noch nachdenklicher stimmt das Ergebnis einer Studie, die den Einfluss der genannten Einflussfaktoren kontrollierte und rechnerisch ausschloss: Die Zugehörigkeit zur schwarzen Rasse blieb auch dann, wenn sich die verglichenen Gruppen nicht mehr nach Frühgeburtenhäufigkeit und Nutzung der Vorsorgeangebote unterschieden, die zentrale unabhängige Determinante für GBS. Wer also die Inzidenz von GBS bei schwarzen Neugeborenen senken will, erreicht dies nicht oder nicht vorrangig durch Frühgeburtenprophylaxe und Vorsorgemaßnahmen, sondern nur durch Veränderungen der mit der Rassezugehörigkeit verbundenen sozialen Bedingungen.
Selbstverständlich muss weiter untersucht werden, ob diese getrennten Trends sich fortsetzen und verfestigen und welche Barrieren besonders die schwarzen Mütter vom Besuch des Screenings abhalten.
Der MMWR-Report "Perinatal Group B Streptococcal Disease After Universal Screening Recommendations - United States, 2003-2005" ist hier komplett und kostenlos erhältlich. Die gesamte Ausgabe des Mortality and Morbidity Weekly Report vom 20. Juli 2007 lässt sich auch als PDF kostenfrei herunterladen.
Bernard Braun, 21.7.2007
Hohe Einkommensunterschiede: Ursache auch sozialer, kultureller und gesundheitlicher Probleme
 Die Einkommensschere in Deutschland hat sich im internationalen Vergleich besonders weit auseinander entwickelt, meldete die "Deutsche Welle" im Juni 2007 mit der Schlagzeile "Einkommensunterschiede in Deutschland besonders groß". "Nur in Ungarn, Polen, Südkorea und Neuseeland sei die Lohnschere zwischen 1995 und 2005 noch weiter auseinander gegangen, teilte die OECD mit." Einige Zeit zuvor hatte die "Süddeutsche" unter Berufung auf unveröffentlichte Daten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) unter dem Titel "Der große Graben" berichtet: "Reiche Deutsche verdienen immer mehr, der Rest ist von der Lohnentwicklung abgeschnitten: Die Einkommensunterschiede hierzulande sind so groß wie noch nie seit der Wiedervereinigung. Auch die Zahl der Armen erreichte im Jahr 2005 einen Rekordwert."
Die Einkommensschere in Deutschland hat sich im internationalen Vergleich besonders weit auseinander entwickelt, meldete die "Deutsche Welle" im Juni 2007 mit der Schlagzeile "Einkommensunterschiede in Deutschland besonders groß". "Nur in Ungarn, Polen, Südkorea und Neuseeland sei die Lohnschere zwischen 1995 und 2005 noch weiter auseinander gegangen, teilte die OECD mit." Einige Zeit zuvor hatte die "Süddeutsche" unter Berufung auf unveröffentlichte Daten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) unter dem Titel "Der große Graben" berichtet: "Reiche Deutsche verdienen immer mehr, der Rest ist von der Lohnentwicklung abgeschnitten: Die Einkommensunterschiede hierzulande sind so groß wie noch nie seit der Wiedervereinigung. Auch die Zahl der Armen erreichte im Jahr 2005 einen Rekordwert."
Die in Deutschland angewachsene Schere zwischen Arm und Reich ist bislang vorwiegend in der Perspektive der Einkommensarmut betrachtet worden, als soziales Problem einer zunehmenden Zahl von Hartz-IV-Beziehern oder Niedriglohn-Empfängern. Viele Gewerkschafter und einige wenige Ökonomen hoben überdies das wirtschaftliche Problem der fehlenden Massenkaufkraft hervor. Dass ökonomische Not auch einen direkten Zusammenhang zu Erkrankungsrisiken aufweist, ist andererseits durch eine Vielzahl von Studien belegt. Die vermeintlich uralte Redewendung "Wenn Du arm bist, musst Du früher sterben", hat auch heute noch Gültigkeit. (vgl. Berichte dazu in Forum Gesundheitspolitik in dieser Rubrik)
Ein Aufsatz der beiden englischen Wissenschaftler Richard G. Wilkinson und Kate E. Pickett von den englischen Universitäten Nottingham und York hat das Thema ökonomischer Ungleichheit und daran geknüpfter sozialer Probleme in einem Aufsatz in der Zeitschrift "Social Science & Medicine" nun in einer sehr umfassenden gesellschaftlichen Perspektive theoretisch und empirisch erörtert. Vorgestellt werden zum einen bereits veröffentlichte Forschungsergebnisse, die aufzeigen: Je größer die Einkommensunterschiede in einem Land sind, desto häufiger tauchen dort auch andere soziale, kulturelle oder gesundheitliche Probleme auf. Zum anderen werden aber auch neue Befunde vorgestellt, die deutlich machen, dass die Problematik noch sehr viel weiter reicht und auch solche Sektoren des Sozialstaats betroffen sind, die man bislang kaum in Verbindung brachte mit der Höhe der Einkommensunterschiede.
Die Zusammenfassung schon bekannter Zusammenhänge zählt folgende Aspekte auf:
• Krankheit und Lebenserwartung: Eine Meta-Analyse von insgesamt 104 Studien, in denen bei länderübergreifenden Vergleichen sowohl Daten zum Gesundheitszustand als auch Daten zu den Einkommensverhältnissen berücksichtigt worden waren, zeigte: 81 dieser 104 Studien (78%) belegten - auch nach statistischer Kontrolle anderer potentieller Einflussfaktoren - einen eindeutigen Zusammenhang zwischen ökonomischer Ungleichheit und Morbiditäts- oder Mortalitäts-Indikatoren.
• Übergewicht: Eine Studie zur Verbreitung von Übergewicht und Adipositas in 21 der reichsten Länder der Welt wurde ein deutlicher Zusammenhang festgestellt: Je größer die Einkommensunterschiede, desto stärker ist die Verbreitung starken Übergewichts (BMI>30).
• Teenager-Schwangerschaften: In derselben Studie zeigte sich auch, dass unerwünschte Schwangerschaften von Teenagern in Ländern mit hohen Einkommensunterschieden häufiger vorkommen. Auch ein Vergleich der 50 Bundesstaaten der USA bestätigt dieses Ergebnis.
• Psychische Erkrankungen: (vgl. die Grafik, oberer Teil) Daten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zeigen bei einem Vergleich von 14 Staaten auf, dass die Häufigkeit psychischer Erkrankungen (schwerwiegende und leichtere Formen zusammengefasst) zunimmt, je größer die länderspezifische ökonomische Ungleichheit ist. Die Korrelation hierfür beträgt 0.79.
• Tötungsdelikte: Es liegen insgesamt 24 Studien vor, die belegen, dass Mord und Totschlag in Ländern mit großen Einkommensunterschieden deutlich häufiger vorkommen.
• Fremdenfeindlichkeit und Rassismus: Zwei US-amerikanischen Studien, die eine Reihe von Großstädten in den USA bzw. Bundesstaaten miteinander verglichen, kamen zu dem Ergebnis, dass Fremdenfeindlichkeit und Rassismus ebenfalls ein Effekt von großen Einkommensunterschieden sind.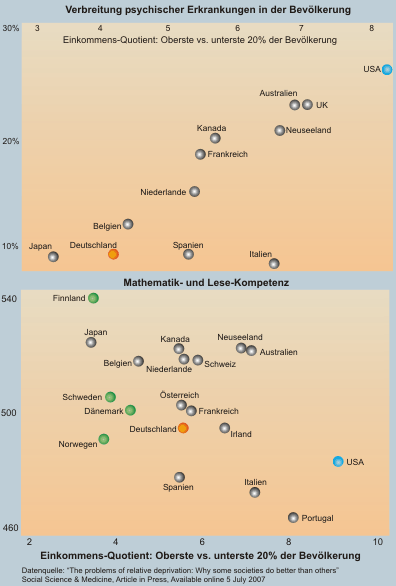
Nach der Referierung dieser schon aus der Literatur bekannten Forschungsergebnisse stellen die Wissenschaftler dann aber auch noch einige neue Zusammenhänge aufgrund eigener Analysen vor. Die dabei verwendeten Daten stammen aus den "Human Development Indicators (HDI)" des Jahres 2003. Berücksichtigt wurden insgesamt 24 Staaten weltweit (einschl. Deutschland), für die auch Zahlen vorlagen zu den Einkommensunterschieden. Verwendet wurde hierfür ein Quotient: Verhältnis der Einkommenssumme der reichsten 20 Prozent einer Bevölkerung zu den ärmsten 20 Prozent. Dabei rangierte Japan mit einem Wert von 3,4 ganz vorne und Singapur mit einem Wert von 9,7 ganz hinten. Entwicklungs- und Schwellenländer wurden wegen der besonderen Verhältnisse nicht berücksichtigt, aber auch, um die politische Bedeutung der Analysebefunde nicht einzuschränken.
Als gesellschaftliche Problemfelder, die ebenfalls vom Ausmaß der Einkommensunterschiede beeinflusst werden, erörtern die Forscher dann:
• Schulleistungen von Jugendlichen: (vgl. die Grafik, unterer Teil) Aus dem "OECD Programme for International Student Assessment 2004" wurden Daten ausgewählt, die kombinierte Werte angeben für die mathematische Kompetenz und das Leseverständnis 15jähriger Schüler. Hierzu waren Werte aus 19 Ländern verfügbar. Es zeigt sich, dass Einkommensungleichheit und Schulleistung sehr hoch miteinander zusammenhängen. Die Korrelation beträgt -0.50. Bei einem Vergleich nur der US-Bundesstaaten liegt die Korrelation bei -0.69.
• Zahl der Strafgefangenen: Daten hierzu (aus dem United Nations Crime and Justice Information Network, 2000) zeigen einen hohen statistischen Zusammenhang von 0.75. Schließt man die USA hier wegen der besonderen Verhältnisse aus, beträgt der Wert immer noch 0.69. Im Vergleich zwischen den US-Bundessstaaten ist der Zusammenhang noch größer.
• Todesfälle durch Drogen: Hier wurden altersstandardisierte Daten des Center for Disease Control and Prevention verwendet, die einen statistischen Zusammenhang von 0.61 ergaben.
• Soziale Mobilität: Hier wurde anhand von Längsschnitt-Daten aus acht Ländern überprüft, inwieweit die Einkommenshöhe von Vätern und ihren Söhnen im Alter von 30 Jahren Unterschiede aufwiesen. Der Zusammenhang in diesem Bereich sozialer (bzw. sozioökonomischer) Mobilität betrug 0.93.
Die Wissenschaftler erörtern in ihrem Aufsatz abschließend auch sehr ausführlich die theoretische und politische Bedeutung ihrer Analyse. Ein Abbau ökonomischer Ungleichheit, so bilanzieren sie, ist nach diesen Befunden nicht mehr so ohne weiteres zurückzuweisen. Zwar ist schon länger bekannt, dass der Sozialstatus oder die Einkommenshöhe von Bevölkerungsgruppen auch sehr stark mit ihrem Gesundheitszustand (Morbidität, Mortalität) zusammenhängt. Bislang wurde jedoch oftmals verwiesen auf fehlende Belege eines Kausalzusammenhangs. Es sei unklar, so wurde argumentiert, ob Armut nun zu Krankheit führt, oder ob umgekehrt Kranke öfter aus dem Erwerbssystem herausfallen und dann verarmen.
Je weiter der Horizont ist, innerhalb dessen Zusammenhänge zwischen Einkommensungleichheit und anderen sozialen Problemen festgestellt werden, so die beiden Wissenschaftler, umso plausibler wird es, dass die ökonomische Ungerechtigkeit Kern und Ursache auch anderer Problemfelder ist: "Wenn wir einen starken Zusammenhang aufzeigen können zwischen den nationalen Einkommensunterschieden und sozialen Problemen, auch unabhängig vom Thema Gesundheit, gewinnen wir ein besseres Verständnis auch der Kausalzusammenhänge. Wenn wir herausfinden, dass die Zahl der Morde und tödlichen Gewaltdelikte oder die Zahl der Übergewichtigen umso höher ist, je größer die Einkommensunterschiede in einem Land sind, dann kann man nicht mehr so leicht behaupten, dass nun Gewalt oder Übergewicht die Einkommensschere vergrößert hat. Dann wird es umso plausibler dass die Verursachungskette genau umgekehrt verläuft."
Ein kostenloser Abstract des Aufsatzes ist hier zu finden: Richard G. Wilkinson, Kate E. Pickett: The problems of relative deprivation: Why some societies do better than others
(Social Science & Medicine, Article in Press, Available online 5 July 2007)
Der Volltext des Aufsatz mit vielen Diagrammen und Literaturquellen ist leider kostenpflichtig bzw. setzt ein Abonnement bei "Science Direct" voraus
Gerd Marstedt, 12.7.2007
Ungleiche Gesundheitschancen zwischen Arm und Reich verschärfen sich mit zunehmenden Lebensalter
 Die Schere zwischen den oberen und unteren gesellschaftlichen Schichten betrifft Vermögensverhältnisse und Konsumchancen, das Bildungniveau und Teilhabechancen am gesellschaftlichen Leben, nicht zuletzt aber auch den Gesundheitszustand und die Lebenserwartung. So viel ist bekannt und in einer Vielzahl internationaler Studien eindeutig belegt. Bislang war allerdings nicht eindeutig klar: Verringert sich diese sozial bedingte Ungleichheit mit zunehmenden Lebensalter, beispielsweise dadurch, dass mit dem Eintritt ins Rentenalter und dem Ausscheiden aus der Erwerbstätigkeit sich Gesundheitsrisiken und Stressfaktoren für alle reduzieren, ungeachtet ihrer Zugehörigkeit zur Ober- oder Unterschicht?
Die Schere zwischen den oberen und unteren gesellschaftlichen Schichten betrifft Vermögensverhältnisse und Konsumchancen, das Bildungniveau und Teilhabechancen am gesellschaftlichen Leben, nicht zuletzt aber auch den Gesundheitszustand und die Lebenserwartung. So viel ist bekannt und in einer Vielzahl internationaler Studien eindeutig belegt. Bislang war allerdings nicht eindeutig klar: Verringert sich diese sozial bedingte Ungleichheit mit zunehmenden Lebensalter, beispielsweise dadurch, dass mit dem Eintritt ins Rentenalter und dem Ausscheiden aus der Erwerbstätigkeit sich Gesundheitsrisiken und Stressfaktoren für alle reduzieren, ungeachtet ihrer Zugehörigkeit zur Ober- oder Unterschicht?
Eine neue Analyse hat jetzt jedoch gezeigt: Das Gegenteil ist der Fall. Die Schere zwischen den oberen und unteren Sozialschichten im Hinblick auf die körperliche und seelische Gesundheit vergrößert sich mit zunehmendem Lebensalter. Die jetzt von Forschern des "International Institute for Society and Health", am University College London, in der Zeitschrift "British Medical Journal (BMJ)" veröffentlichte Studie hat über einen Zeitraum von 20 Jahren (im Rahmen der sog. "Whitehall II Studie") den Gesundheitszustand von über 10.000 Beschäftigten im Öffentlichen Dienst in Großbritannien verfolgt. Überprüft wurde zwischen 1985 und 2002 im Rahmen mehrfacher Befragungen (bis zu sieben Erhebungen in diesem Zeitraum), wie sich der Gesundheitszustand in Abhängigkeit von der jeweiligen Schichtzugehörigkeit veränderte.
Als Untersuchungsinstrument wurde dabei der international vielfach erprobte und bewährte Fragebogen "SF-36" eingesetzt, ein Messinstrument zur Erfassung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität von Patienten. Der SF-36 erfasst acht verschiedene Dimensionen, die sich in die Bereiche "körperliche Gesundheit" und "psychische Gesundheit" unterteilen lassen. Skalen sind: Körperliche Funktionsfähigkeit, Körperliche Rollenfunktion, Körperliche Schmerzen, Allgemeine Gesundheitswahrnehmung, Vitalität, Soziale Funktionsfähigkeit, Emotionale Rollenfunktion und Psychisches Wohlbefinden.
Als Hauptergebnis zeigte sich: Zu jedem Zeitpunkt des Alters findet man einen besseren Gesundheitszustand bei Angehörigen höherer Schichten. Dies ist allerdings auch aus anderen Studien bekannt. Neu war jedoch die Erkenntnis: Mit zunehmendem Lebensalter zeigt sich eine zunehmend größere Distanz zwischen den sozio-ökonomischen Schichten. So weist beispielsweise ein 70jähriger Angehöriger der Oberschicht dieselben gesundheitlichen Merkmale auf wie ein um acht Jahre jüngerer 62jähriger Kollege aus der Unterschicht. Im mittleren Lebensalter beträgt diese Differenz nur etwa 4.5 Jahre, das heißt: Ein 45jähriger Erwerbstätiger mit hoher beruflicher Stellung zeigt ähnliche gesundheitliche Merkmale auf wie ein un- oder angelernter Angestellter im Alter von 40.5 Jahren.
Die Wissenschaftler haben in ihrer Studie zwar nur Angestellte, Beschäftigte mit nicht-körperlicher Arbeit untersucht. Sie kommentierten ihre Ergebnisse jedoch so, dass sie fest überzeugt seien, dass ihr Befund auch bei Arbeitern und körperlichen Tätigkeiten Bestand hat und womöglich sogar noch größere Differenzen zutage treten könnten. Darüber hinaus würden ihre Befunde frühere Forschungsergebnisse widerlegen, die über eine Angleichung der gesundheitlichen Verfassung von Angehörigen höherer und niedrigerer beruflicher Stellung berichtet haben.
Die Studie ist im Volltext hier nachzulesen: Social inequalities in self reported health in early old age: follow-up of prospective cohort study (BMJ, doi:10.1136/bmj.39167.439792.55, published 27 April 2007)
Ein Abstract ist hier
Hier findet man weitere Informationen zur Whitehall II Study
Gerd Marstedt, 28.4.2007
Sogar im Wohlfahrtsstaat Schweden: Herzerkrankungen und Todesfälle sind in Problem-Stadtteilen deutlich häufiger
 Wer in problematischen Stadtteilen wohnt oder gar in "Armutsquartieren" mit hohem Ausländer- und Arbeitslosenanteil, mit alten, sanierungsbedürftigen Arbeitervierteln oder Hochhäusern des sozialen Wohnungsbaus, hat auch im Wohlfahrtsstaat Schweden ein deutliches höheres Risiko, an einer Koronaren Herzkrankheit (Arteriosklerose, Herzinfarkt) zu erkranken und daran zu sterben als Bürger in privilegierten Wohngegenden. Dies ist das Ergebnis einer großen schwedischen Studie bei über 130.000 Personen. Überraschend ist dieser Befund, hebt eine der Wissenschaftlerinnen, Marilyn Winkleby, hervor, "weil wir immer davon ausgehen, dass Wohlstand und Bildung uns von den prägenden Einflüssen unserer unmittelbaren Umgebung schützen können."
Wer in problematischen Stadtteilen wohnt oder gar in "Armutsquartieren" mit hohem Ausländer- und Arbeitslosenanteil, mit alten, sanierungsbedürftigen Arbeitervierteln oder Hochhäusern des sozialen Wohnungsbaus, hat auch im Wohlfahrtsstaat Schweden ein deutliches höheres Risiko, an einer Koronaren Herzkrankheit (Arteriosklerose, Herzinfarkt) zu erkranken und daran zu sterben als Bürger in privilegierten Wohngegenden. Dies ist das Ergebnis einer großen schwedischen Studie bei über 130.000 Personen. Überraschend ist dieser Befund, hebt eine der Wissenschaftlerinnen, Marilyn Winkleby, hervor, "weil wir immer davon ausgehen, dass Wohlstand und Bildung uns von den prägenden Einflüssen unserer unmittelbaren Umgebung schützen können."
Dass solche großen Unterschiede bei Erkrankungsraten und Todesfällen sogar in Schweden zu beobachten sind, wo jedermann ungeachtet seiner Bildung, seines Einkommens oder Wohngegend freien Zugang zur medizinischen Versorgung hat, ist umso diskussionsbedürftiger, erklärte die Forscherin der Stanford University School of Medicine. "Es zeigt auf, dass möglicherweise auch die Qualität der medizinischen Versorgung zwischen einzelnen Stadtteilen erhebliche Unterschiede aufweist, obwohl es keinerlei Zugangsbeschränkungen zu Versorgungseinrichtungen gibt."
Die Wissenschaftler hatten aus einer Bevölkerungsstichprobe aller Schwedinnen und Schweden im Alter von 35-74 Jahren (insgesamt 3.7 Millionen Personen) Anfang 1996 all jene herausgesucht, bei denen noch keine Herzerkrankung auffällig geworden war. Diese Stichprobe von rund 130.000 Personen wurde über einen Zeitraum von 10 Jahren hinweg bis Anfang 2006 beobachtet. Erfasst wurden dabei neben Erkrankungen und Todesfällen auch Daten zur Wohngegend, und zwar durch Indikatoren wie Bildungsniveau, Einkommen, Arbeitslosigkeit oder Sozialhilfebezug im jeweiligen Wohnquartier. Die Wohngegend wurde daraufhin eingestuft als hoch, mittel oder nicht benachteiligt.
Im Abgleich mit den auch beobachteten Erkrankungs- und Todesfällen zeigte sich dann, auch bei statistischer Berücksichtigung des Lebensalters: Koronare Herzerkrankungen treten in problematischen Wohngegenden bei Frauen fast zweimal so oft, bei Männern anderthalbmal so oft auf. Die Todesfälle durch diese Erkrankungen lagen 1,6 bis 1,7 mal höher. Der Zusammenhang zwischen sozialer Lage und Gesundheit, die höhere Betroffenheit von Erkrankungen und geringere Lebenserwartung unterer Sozialschichten ist zwar ein vielfältig belegtes und keineswegs neues Forschungsergebnis. Die Wissenschaftler hatten jedoch nicht erwartet, dass sich diese soziale Ungleichheit auch noch in einem Merkmal wie der Lebensqualität der Wohngegend widerspiegelt. Sie hatten entgegen den jetzt gefundenen Ergebnissen vermutet, dass der für alle Schweden freie Zugang zu jeder Arztpraxis und jeder Klinik einen Teil der durch Bildung oder elterliche Herkunft verursachten sozialen Ungleichheit auch in Bezug auf den Gesundheitszustand aufhebt.
Ein Abstract der im American Journal of Preventive Medicine (Volume 32, Issue 2 , February 2007, Pages 97-106) veröffentlichten Studie ist hier zu finden:
Inequities in CHD Incidence and Case Fatality by Neighborhood Deprivation
Gerd Marstedt, 19.2.2007
Verzerrte Weltkarten - Maßstab ist nicht die Landfläche, sondern soziale und gesundheitliche Benachteiligung
 Soziale ungleich verteilte Chancen auf Gesundheit und Lebensqualität sind ein Thema, das in trockenen Statistiken etwa der WHO oder OECD immer wieder auftaucht, am Beispiel der Verbreitung von HIV/AIDS oder Malaria oder der Säuglingssterblichkeit. Daten und Fakten sind bekannt, doch zu nennenswerten Veränderungen im Bewusstsein der Bevölkerungen reicher Industrienationen haben sie nicht geführt. Die von Danny Dorling, Professor für Geographie an der University of Sheffield, Großbritannien, erstellten neuen Weltkarten möchten diesen Zustand zumindest ein wenig ändern.
Soziale ungleich verteilte Chancen auf Gesundheit und Lebensqualität sind ein Thema, das in trockenen Statistiken etwa der WHO oder OECD immer wieder auftaucht, am Beispiel der Verbreitung von HIV/AIDS oder Malaria oder der Säuglingssterblichkeit. Daten und Fakten sind bekannt, doch zu nennenswerten Veränderungen im Bewusstsein der Bevölkerungen reicher Industrienationen haben sie nicht geführt. Die von Danny Dorling, Professor für Geographie an der University of Sheffield, Großbritannien, erstellten neuen Weltkarten möchten diesen Zustand zumindest ein wenig ändern.
Seine Weltkarten, die bei erster Betrachtung so wirken, als habe man sie mit einer Software zur Verzerrung von Porträtfotos wie "Power-Goo" bearbeitet, haben unterschiedliche Themen. Die Karten sind zwar maßstabsgerecht, was die Größe der Ozeane anbetrifft, hinsichtlich der Größe einzelner Länder erkennt man jedoch massive Schrumpfungen oder auch grotesk wirkende Aufblähungen. Die Themen sind sehr unterschiedlich, betreffen jedoch immer Aspekte, die die ungleiche Verteilung von Reichtum, Wohlstand und Gesundheit in den 200 betrachteten Ländern verdeutlichen: Verbreitung von Malaria und AIDS, Arbeitslosigkeit und Kriminalität, Gewalt gegen Frauen und Tote durch Kriege und Bürgerkriege, Ausgaben für das Gesundheitswesen und Drogenkonsum. Viele weitere Themenkarten sind in der Planungsphase, so die Verteilung der CO2-Emissionen. Noch in diesem Jahr wollen die Autoren auf ihrer Homepage insgesamt 366 Karten präsentieren, später sogar in Form eines interaktiven dreidimensionalen Globus mit der Möglichkeit für Besucher, ein- und auszuzoomen.
"Auf der ganzen Welt", so beginnt der Artikel auf der Website von PLOS, in dem das Projekt vorgestellt wird, "haben sozial benachteiligte Bevölkerungskreise einen schlechteren Zugang zur Gesundheitsversorgung, sind öfter krank und sterben früher als andere in privilegierten Schichten. Die soziale Ungleichheit in Bezug auf Gesundheit nimmt heute immer noch zu, trotz eines globalen Wohlstands und des technischen Fortschritts." Und um diese ungleiche Verteilung von Ressourcen und Risiken besser zu verdeutlichen als in trockenen Zahlen und Statistiken, hat Dorling das Projekt "Worldmapper" entwickelt und online gestellt. Besonders eindrucksvoll sind dabei jene Karten, die die unterschiedliche Reichtums- und Wohlstandsverteilung, aber auch die unterschiedlichen gesundheitlichen Probleme zwischen Europa und Nordamerika einerseits und Afrika oder Asien andererseits darstellen.
Hier ist die Homepage des Projekts mit allen bisher erstellten Karten: www.worldmapper.org
Die Beschreibung des Projekts (einschl. vieler Karten als Illustration) findet man in der Public Library of Science Medicine (PLoS): Worldmapper: The Human Anatomy of a Small Planet
Gerd Marstedt, 8.2.2007
Wochenbericht der "Kaiser Family Foundation" über rassische und ethnische Ungleichheiten bei Gesundheit in den USA
 Angesichts der zahlreichen alten und neuen Ungleichheiten bei den gesundheitlichen Risiken und den Behandlungschancen der im "melting pot" USA besonders zahlreichen und unterschiedlichen Angehörigen nahezu aller Rassen und Ethnien dieser Erde, ermöglicht die "Kaiser Family Foundation" mit ihrem "Kaiser Health Disparities Report: A Weekly Look at Race, Ethnicity and Health" einen wöchentlichen über das Internet automatisch erhältlichen Kurzüberblick über aktuelle Tendenzen, Reports und Probleme.
Angesichts der zahlreichen alten und neuen Ungleichheiten bei den gesundheitlichen Risiken und den Behandlungschancen der im "melting pot" USA besonders zahlreichen und unterschiedlichen Angehörigen nahezu aller Rassen und Ethnien dieser Erde, ermöglicht die "Kaiser Family Foundation" mit ihrem "Kaiser Health Disparities Report: A Weekly Look at Race, Ethnicity and Health" einen wöchentlichen über das Internet automatisch erhältlichen Kurzüberblick über aktuelle Tendenzen, Reports und Probleme.
Der Bericht für die Woche vom 8. Bis 12. Januar 2007 enthält auf 11 Druckseiten u. a. folgende Meldungen:
• Disparities in Access to Preventive Health Screenings Exist for Minorities, Low-Income, Uninsured U.S. Residents, AHRQ Report Finds
• Study Finds USDA Nutrition Education Material Intended for Minorities Inadequate
• California Gov. Schwarzenegger Proposes Universal Health Coverage for All State Residents, Including Undocumented Immigrants
• Studies Examine Increasing Black Physician Population
• Toolkit Discusses Methods for Reducing Racial, Ethnic Health Disparities Among Medicaid Managed Care Beneficiaries
• Editorial Adresses Race Relations in the Workplace for Black Physicians
Am Beispiel der rassebezogenen Arbeitsplatzerfahrungen afro-amerikanischer Ärzte (oder ganz im Zeichen der "political correctness" auch Ärzte afrikanischer Herkunft - "african descent") im Nordosten der USA soll kurz der Aufbau der Wochenberichte dargestellt werden: Die oben wiedergegebene Schlagzeile führt zu einem themenbezogenen Kurztext, der ähnlich wie in diesem Forum kurz den Inhalt einer oder mehrerer aktueller Untersuchungen darstellt und Links zum Abstract oder Volltext enthält. In diesem Fall gelangt der Nutzer des "Disparities Report" am Ende zum Abstract der qualitativen Untersuchung von Nunez-Smith et al. mit dem Titel "Impact of Race on the Professional Lives of Physicians of African Descent" in der Ausgabe der Zeitschrift "Annals of Internal Medicine" vom 2. Januar 2007 (Volume 146 Issue 1: 45-51).
Die sicherlich noch zu vertiefende Studie zeigt, dass rassistische Vorbehalte keineswegs nur gegenüber farbigen Angehörigen der Unterschichten zur Geltung kommen, sondern auch durchaus zwischen und gegenüber Angehörigen mittlerer und gebildeter Schichten.
Die Schlussfolgerung lautet: "The issue of race remains a pervasive influence in the work lives of physicians of African descent. Without sufficient attention to the specific ways in which race shapes physicians’ work experiences, health care organizations are unlikely to create environments that successfully foster and sustain a diverse physician workforce."
Über diese, auch als Bestellseite dienende, Startseite kommen sie zu der jeweils aktuellen Ausgabe des "Kaiser Health Disparities Report".
Bernard Braun, 13.1.2007
Gesundheitliche Ungleichheit in Europa
 Dieser (englischsprachige) Bericht von Johan P. Mackenbach bietet eine Übersicht über verschiedene Indikatoren sozio-ökonomischer Ungleichheit im Gesundheitsbereich in 25 EU-Mitgliedsländern. Die mit vielen Grafiken und Tabellen angereicherte Veröffentlichung stellt Daten unter anderem zur Mortalität und Lebenserwartung, zur Morbidität (u.a. chronische und Krebserkrankungen, neurotische Störungen, Suizid) zusammen, die jeweils nach sozio-ökonomischen Bevölkerungsgruppen und Geschlecht differenziert sind. In Kapitel 4 wird auch auf Ursachen und sozio-ökonomische Hintergründe sozialer Ungleichheit im Motalitäts- und Morbiditätsspektrum eingegangen. Hier werden Rauchen, Alkoholkonsum und Ernährung als bedeutende Determinanten im Bereich des Gesundheitsverhaltens genannt.
Dieser (englischsprachige) Bericht von Johan P. Mackenbach bietet eine Übersicht über verschiedene Indikatoren sozio-ökonomischer Ungleichheit im Gesundheitsbereich in 25 EU-Mitgliedsländern. Die mit vielen Grafiken und Tabellen angereicherte Veröffentlichung stellt Daten unter anderem zur Mortalität und Lebenserwartung, zur Morbidität (u.a. chronische und Krebserkrankungen, neurotische Störungen, Suizid) zusammen, die jeweils nach sozio-ökonomischen Bevölkerungsgruppen und Geschlecht differenziert sind. In Kapitel 4 wird auch auf Ursachen und sozio-ökonomische Hintergründe sozialer Ungleichheit im Motalitäts- und Morbiditätsspektrum eingegangen. Hier werden Rauchen, Alkoholkonsum und Ernährung als bedeutende Determinanten im Bereich des Gesundheitsverhaltens genannt.
Einige Ergebnisse, die schon vorliegende Befunde anderer Studien bestätigen:
• Gesundheitszustand, Betroffenheit von chronischen Erkrankungen und Lebenserwartung differieren erheblich in Abhängigkeit von der Schichtzugehörigkeit. Verschiedene Indikatoren hierfür, wie höchster Bildungsabschluss, Einkommenshöhe oder Stellung im Beruf, zeigen vergleichbare Ergebnisse.
• Die Unterschiede zwischen oberen und unteren Sozialschichten hinsichtlich Morbidität und Mortalität liegen in der Größenordnung von etwa 1:1,5 bis 1:2,5, d.h. Angehörige unterer Schichten sind zum Teil zweieinhalbmal so oft von Erkrankungen oder einem schlechteren Gesundheitszustand betroffen.
• Besonders auffällig sind die Schicht-Unterschiede in einigen Ländern aus dem ehemaligen "Ostblock" (z.B. Estland, Litauen, Slowenien, Polen).
• Die "Schere" gesundheitlicher Ungleichheit hat sich in den 80er und 90er Jahren noch vergrößert,
Eine kurze deutschsprachige Zusammenfassung der Ergebnisse findet sich in der österreichen Zeitschrift "korso": Soziale Ungleichheit gefährdet Ihre Gesundheit.
Der komplette Bericht (englisch, 52 Seiten) steht hier zum Download bereit: Johan P. Mackenbach: Health Inequalities: Europe in Profile
Gerd Marstedt, 13.12.2006
Armutsrisiko Gesundheitsversorgung in Deutschland 2005
 Mitten in die Debatten um das Festhalten der "Großen Koalition" am extrem niedrigen Versorgungsniveau des Arbeitslosengeld II und den Versuchen arbeitgebernaher Experten die verbreiteten Forderungen nach einer nach 10 Jahren Reallohnabsenkung notwendigen kräftigen Lohnerhöhung wegzuargumentieren (Motto: Eigentlich passt Lohnerhöhung weder im Ab- noch im Aufschwung -also lieber nie!), veröffentlichte das Statistische Bundesamt gerade und zum ersten Mal EU-weit vergleichbare Daten zu "Armut und Lebensbedingungen in Deutschland 2005" aus der Befragungs-Studie "Leben in Europa".
Mitten in die Debatten um das Festhalten der "Großen Koalition" am extrem niedrigen Versorgungsniveau des Arbeitslosengeld II und den Versuchen arbeitgebernaher Experten die verbreiteten Forderungen nach einer nach 10 Jahren Reallohnabsenkung notwendigen kräftigen Lohnerhöhung wegzuargumentieren (Motto: Eigentlich passt Lohnerhöhung weder im Ab- noch im Aufschwung -also lieber nie!), veröffentlichte das Statistische Bundesamt gerade und zum ersten Mal EU-weit vergleichbare Daten zu "Armut und Lebensbedingungen in Deutschland 2005" aus der Befragungs-Studie "Leben in Europa".
Armut oder Armutsgefährdung existiert danach, wenn Menschen mit weniger als 60 % des durchschnittlichen Einkommens auskommen müssen, was in Deutschland bei einer alleinstehenden Person ein Einkommen von weniger als 856 Euro im Monat bedeutet. Eine Familie mit zwei Kindern gilt dann als arm oder armutsgefährdet, wenn sie weniger als 1.798 Euro monatlich zur Verfügung hat.
Legt man diese Maßstäbe an, waren 2004 rund 13 % oder 10,6 Millionen in Deutschland armutsgefährdet, darunter 1,7 Millionen Kinder unter 16 Jahren.
Neben vielen sozialen Armutsrisiken, die in dem Bericht ausführlich und plastisch dokumentiert sind, behindert Armut auch den Zugang zur Gesundheitsversorgung. Das bedeutet u.a.:
• Mehr als ein Fünftel der Armutsgefährdeten (aber auch 7 % der nicht Armutsgefährdeten) werden durch Zuzahlungen und Selbstbeteiligungen davon abgehalten, sich einer notwendigen ärztlichen oder zahnärztlichen Behandlung zu unterziehen.
• Der Anteil von Personen, die auf einen Arztbesuch verzichten ist dabei unter den Armutsgefährdeten fast doppelt so hoch wie unter den Nicht-Armen.
• Armutsgefährdete Befragte schätzen ihren Gesundheitszustand als deutlich schlechter ein als Nicht-Arme. Dies gilt vor allem für die 25-64-Jährigen zu.
• Armutsgefährdete sind aber auch bei potenziell gesundheitsrelevanten sozialen Lebensumständen erheblich schlechter gestellt als Nicht-Arme: 14 % (Nicht-Arme: 3 %) müssen im Winter an der Heizung sparen, 22 % (12 %) leben in feuchten Wohnungen und 26 % (8 %) von ihnen können sich nicht mindestens jeden zweiten Tag eine hochwertige Mahlzeit leisten.
Für alle Akteure, die über "Hartz V" oder den "überfälligen Umbau des Sozialstaats" nachdenken: Ohne die noch vorhandenen sozialen Transferleistungen wäre ein knappes Viertel der Bevölkerung armutsgefährdet.
Hier finden Sie ein rund 50-seitiges Presseexemplar des Berichtes "Armut und Lebensbedingungen in Deutschland 2005"
Bernard Braun, 5.12.2006
Wenn Du arm bist, musst Du früher sterben - Neue Belege für eine alte These
 Dass es einen deutlichen Zusammenhang gibt zwischen Armut und Gesundheit und auch zwischen sozialer Schicht und Lebenserwartung, ist durch zahlreiche Studien aus dem Ausland inzwischen hinreichend belegt und unstrittig. Für Deutschland gab es bislang jedoch keine aussagekräftigen Untersuchungen und belastbare Daten. Die Fragestellung konnte bislang vor allem aufgrund strengerer Datenschutzbestimmungen nicht gezielt untersucht werden. Seit kurzem gibt es jedoch zwei Studien, die die internationale Datenlage eindeutig erhärten.
Dass es einen deutlichen Zusammenhang gibt zwischen Armut und Gesundheit und auch zwischen sozialer Schicht und Lebenserwartung, ist durch zahlreiche Studien aus dem Ausland inzwischen hinreichend belegt und unstrittig. Für Deutschland gab es bislang jedoch keine aussagekräftigen Untersuchungen und belastbare Daten. Die Fragestellung konnte bislang vor allem aufgrund strengerer Datenschutzbestimmungen nicht gezielt untersucht werden. Seit kurzem gibt es jedoch zwei Studien, die die internationale Datenlage eindeutig erhärten.
So legte unlängst ein Autorenteam um Karl Lauterbach (MdB, Professor für Gesundheitsökonomie und Klinische Epidemiologie an der Universität zu Köln, Berater im Gesundheitsministerium) den Bericht "Zum Zusammenhang zwischen Einkommen und Lebenserwartung" vor. Grundlage der Berechnungen waren die Daten des Sozioökonomischen Panels (SOEP) des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), einer repräsentativen Stichprobe mit jährlich mehr als 22.000 Befragten. Als Ergebnis zeigte sich: Männer mit einem Bruttoeinkommen von weniger als 1.500 Euro haben eine Lebenserwartung von 71 Jahren, bei einem Einkommen über 4.500 Euro beträgt die Lebenserwartung 80 Jahre. Ähnliche Differenzen finden sich für Frauen: 78 Jahre bei niedrigem, 84 Jahre bei sehr hohem Einkommen. An Lauterbachs Analyse kritisiert wurde allerdings, dass die Fallzahlen sehr niedrig sind. Zugrunde gelegt wurden die Sterbefälle im SOEP der Jahre 2001-2004.
Methodisch weniger angreifbar ist eine jetzt veröffentlichte neue Untersuchung, die Rembrandt Scholz vom Max-Planck-Institut für Demografische Forschung in Rostock mit Kollegen vorgelegt hat. Dort konnten erstmals Daten des Forschungsdatenzentrums der Deutschen Rentenversicherung verwendet werden, die wegen des Datenschutzes bislang unzugänglich waren. Datenbasis waren alle Männer, die eine gesetzliche Rente beziehen bzw. bezogen haben, rund 5 Millionen Deutsche, von denen im Untersuchungsjahr 2003 etwa 250.000 starben. Im Ergebnis zeigt sich derselbe Trend wie bei Lauterbach, wenngleich ein wenig abgeschwächt: Ein heute 65jähriger Mann, der in seinem Leben wenig verdient und wenig in die Rentenkasse eingezahlt hat, lebt durchschnittlich noch etwa 14 Jahre, ein anderer mit früher sehr hohem Einkommen und hoher Rente hat eine weitere Lebenserwartung von knapp 19 Jahren. Für Frauen konnte Scholz die Analyse allerdings nicht durchführen, dazu ist die Datenbasis der Rentenversicherung zu "durchlöchert", aufgrund von Erwerbsunterbrechungen vieler Frauen oder Phasen ohne Renteneinzahlungen.
Beide Studien sind als PDF-Dateien online verfügbar:
• Lauterbach K, Lüngen M, Stollenwerk B, Gerber A, Klever-Deichert G. Zum Zusammenhang zwischen Einkommen und Lebenserwartung. Studien zu Gesundheit, Medizin und Gesellschaft 2006; Köln: Ausgabe 01/2006 vom 25.02.2006
• Hans-Martin von Gaudecker, Rembrandt D. Scholz: Lifetime earnings and life expectancy, MPIDR WORKING PAPER WP 2006-008, MARCH 2006
Gerd Marstedt, 28.11.2006
USA: Fachzeitschrift zur Gesundheitsversorgung der Armen
 Seit 2004 erscheint in den USA die wahrscheinlich weltweit einzigartige gesundheitswissenschaftliche Fachzeitschrift "Journal of Health Care of the Poor and Underserved". Das offizielle Organ der wohl auch ziemlich einmaligen "Association of Clinicians for the Underserved" beschäftigt sich unter anderem mit dem Zugang zur Gesundheitsversorgung, der Leistungsqualität, den Kosten und der Gesetzgebung für die Armen und aus sozialen Gründen Unterversorgten vor allem im US-Gesundheitssystem. Auch die älteren Texte sind meist nur als Abstracts erhältlich, einige wenige Beiträge aber auch als PDF-Dateien.
Seit 2004 erscheint in den USA die wahrscheinlich weltweit einzigartige gesundheitswissenschaftliche Fachzeitschrift "Journal of Health Care of the Poor and Underserved". Das offizielle Organ der wohl auch ziemlich einmaligen "Association of Clinicians for the Underserved" beschäftigt sich unter anderem mit dem Zugang zur Gesundheitsversorgung, der Leistungsqualität, den Kosten und der Gesetzgebung für die Armen und aus sozialen Gründen Unterversorgten vor allem im US-Gesundheitssystem. Auch die älteren Texte sind meist nur als Abstracts erhältlich, einige wenige Beiträge aber auch als PDF-Dateien.
Hier gibt es den Überblick zum Inhalt der bisherigen Ausgaben.
Bernard Braun, 5.11.2006
Verdeckte Armut: 1,9 Millionen Geringverdiener verzichten auf staatliche Unterstützung
 Nach wie vor nehmen mehrere Millionen Bedürftige in Deutschland ihren Anspruch auf staatliche Hilfen nicht wahr. Darunter sind knapp zwei Millionen Erwerbstätige, die ihren geringen Verdienst nicht "aufstocken" lassen, obwohl das möglich wäre. Sie leben in verdeckter Armut - und mit ihnen etwa eine Million Kinder. Das zeigt eine von der Hans-Böckler-Stiftung geförderte Simulationsstudie der Frankfurter Verteilungsforscherin Dr. Irene Becker.
Nach wie vor nehmen mehrere Millionen Bedürftige in Deutschland ihren Anspruch auf staatliche Hilfen nicht wahr. Darunter sind knapp zwei Millionen Erwerbstätige, die ihren geringen Verdienst nicht "aufstocken" lassen, obwohl das möglich wäre. Sie leben in verdeckter Armut - und mit ihnen etwa eine Million Kinder. Das zeigt eine von der Hans-Böckler-Stiftung geförderte Simulationsstudie der Frankfurter Verteilungsforscherin Dr. Irene Becker.
Insgesamt dürften gut 10 Millionen Menschen einen gesetzlichen Anspruch auf Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld haben. Tatsächlich erhalten derzeit aber lediglich 7,4 Millionen Menschen Hartz-IV-Leistungen, zeigt die Untersuchung. Die Wissenschaftlerin hat dafür auf Basis des Sozio-Oekonomischen Panels (SOEP) das Ausmaß von Bedürftigkeit 2004 - also kurz vor der Hartz-IV-Reform - geschätzt und mit aktuellen Zahlen der Bundesagentur für Arbeit (BA) verglichen.
Die BA-Statistik verrate nur die "halbe Wahrheit" über Hilfebedürftige in Deutschland, so Becker. Zwar sei durch die Hartz- IV-Reform die Dunkelziffer der Armut "mäßig gesunken" - insbesondere bei Arbeitslosen, die vor der Reform den Gang zum Sozialamt scheuten und nun ihre Ansprüche bei der Arbeitsagentur anmelden. Doch etwa 1,9 Millionen Geringverdiener nehmen offenbar ihren Anspruch auf aufstockende Leistungen nicht wahr. Damit liegt die Zahl der bedürftigen Erwerbstätigen etwa dreimal so hoch wie die 900.000 gemeldeten "Aufstocker". Betroffen sind vor allem gering Qualifizierte, Teilzeitbeschäftigte, die keine volle Stelle finden, sowie Familien mit drei oder mehr Kindern. 1,5 Millionen Haushalte schützt auch ein Vollzeiteinkommen nicht vor Bedürftigkeit.
Die Ergebnisse der Studie stehen in "auffallendem Kontrast" zu Thesen über negative Arbeitsanreize der staatlichen Grundsicherungszahlungen, so Irene Becker. Offenbar scheint breiten Schichten das Bedürfnis nach Eigenständigkeit, Anerkennung und einer längerfristigen Lebensperspektive wichtiger zu sein, als das kurzfristige wirtschaftliche Kalkül, folgert Becker. Nicht Leistungsmissbrauch sei verbreitet, sondern Arbeit trotz Mini-Einkommen.
Auf der Website der Hans-Böckler-Stiftung ist die gesamte Studie (44 Seiten) als PDF-Datei verfügbar:
Armut in Deutschland: Bevölkerungsgruppen unterhalb der Alg II-Grenze
und ebenso eine einseitige Kurzfassung der Ergebnisse
Gerd Marstedt, 26.10.2006
Mindestens 1,8 Millionen Bedürftige in Deutschland leben ohne staatliche Hilfe
 Die verdeckte Armut in Deutschland erreicht fast die Größenordnung der statistisch erfassten und bekämpften. Neben den 2,8 Millionen Menschen, die staatliche Hilfe zum Lebensunterhalt erhalten, leben in der Bundesrepublik mindestens 1,8 Millionen Bedürftige ohne öffentliche Unterstützung. Das zeigt eine von der Hans-Böckler-Stiftung geförderte Studie der Frankfurter Wirtschaftswissenschaftler Prof. Dr. Richard Hauser und Dr. Irene Becker. Im Jahre 2003 kamen nach Analyse der Armutsforscher auf drei Empfänger von Sozialhilfe als Hilfe zum Lebensunterhalt "mindestens zwei, eher drei Berechtigte", die sich nicht bei den Behörden meldeten. Das entsprach 1,8 bis 2,8 Millionen Menschen. Nach der Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe dürfte die Zahl tendenziell gesunken sein, weil die Dunkelziffer unter den Arbeitslosen zurückging - in anderen Gruppen hingegen nicht. Deutlich überproportional von verdeckter Armut betroffen sind allein stehende Frauen über 60 Jahre. Zudem sehen die Forscher Indizien, dass das auch für die ausländische Bevölkerung gilt.
Die verdeckte Armut in Deutschland erreicht fast die Größenordnung der statistisch erfassten und bekämpften. Neben den 2,8 Millionen Menschen, die staatliche Hilfe zum Lebensunterhalt erhalten, leben in der Bundesrepublik mindestens 1,8 Millionen Bedürftige ohne öffentliche Unterstützung. Das zeigt eine von der Hans-Böckler-Stiftung geförderte Studie der Frankfurter Wirtschaftswissenschaftler Prof. Dr. Richard Hauser und Dr. Irene Becker. Im Jahre 2003 kamen nach Analyse der Armutsforscher auf drei Empfänger von Sozialhilfe als Hilfe zum Lebensunterhalt "mindestens zwei, eher drei Berechtigte", die sich nicht bei den Behörden meldeten. Das entsprach 1,8 bis 2,8 Millionen Menschen. Nach der Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe dürfte die Zahl tendenziell gesunken sein, weil die Dunkelziffer unter den Arbeitslosen zurückging - in anderen Gruppen hingegen nicht. Deutlich überproportional von verdeckter Armut betroffen sind allein stehende Frauen über 60 Jahre. Zudem sehen die Forscher Indizien, dass das auch für die ausländische Bevölkerung gilt.
Als arm definiert die Untersuchung Menschen, die nicht über das gesetzlich festgelegte Existenzminimum verfügen. Prof. Dr. Hauser und Dr. Becker werteten drei große Haushaltsstichproben aus: die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe des Statistischen Bundesamtes, das Sozio-Ökonomische Panel des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung sowie das Niedrigeinkommenspanel von Infratest Sozialforschung. Auf dieser Basis kalkulierten sie die verdeckte Armut für 1998. Ergänzende Auswertungen zeigen: die Zahlen haben sich bis 2003 kaum verändert.
Eine wesentliche Ursache dafür, dass Bedürftige auf staatliche Hilfe verzichten, ist Unwissenheit. So geht in Befragungen mehr als die Hälfte der verdeckt Armen davon aus, Sozialhilfe zurückzahlen zu müssen. Dass auch Beschäftigte Anspruch auf ergänzende Sozialhilfe hatten, war vielen nicht bekannt, zeigt die Analyse. Die Hartz-Gesetze dürften dieses Informationsdefizit vergrößert haben, schätzen die Wissenschaftler: "Die Working Poor dürften sich noch seltener als anspruchsberechtigt sehen als vor der Reform - denn sie sind ja nicht arbeitslos."
Auch Furcht vor Stigmatisierung schreckt viele eigentlich Unterstützungsberechtigte ab. Um verdeckte Armut zu bekämpfen, empfehlen die Forscher mehr Informationen und aufsuchende Sozialarbeit. Politiker sollten "verallgemeinernde Äußerungen über angeblich verbreiteten Missbrauch des Wohlfahrtsstaates" vermeiden.
Weitere Details zur Studie in: Böckler Impuls 1/2006
Gerd Marstedt, 18.1.2006
UN-Human Developement Report 2005: Internationale Ungleichheit ein wachsendes Problem
 Aktuelle, umfassende und verlässliche Zahlen zum Stand, den Determinanten und den wichtigsten Problemen der Humanentwicklung in den der UNO angehörenden Länder liefert der gerade mit einem Umfang von 388 Seiten vom United Nations Development Programme (UNDP) herausgegebene sechste "Human Developement Report 2005. International cooperation at a crossroads. Aid, trade and security in an unequal world." Der Bericht betont seine relative Unabhängigkeit von der offiziellen Politik der UN-Mehrheit.
Aktuelle, umfassende und verlässliche Zahlen zum Stand, den Determinanten und den wichtigsten Problemen der Humanentwicklung in den der UNO angehörenden Länder liefert der gerade mit einem Umfang von 388 Seiten vom United Nations Development Programme (UNDP) herausgegebene sechste "Human Developement Report 2005. International cooperation at a crossroads. Aid, trade and security in an unequal world." Der Bericht betont seine relative Unabhängigkeit von der offiziellen Politik der UN-Mehrheit.
Zu den wichtigsten Indikatoren für humane Entwicklung gehören neben den geläufigen Gesundheitsindikatoren (z.B. Kindersterblichkeit, Lebenserwartung) auch beispielsweise die Bildungschancen, die Partizipation der BürgerInnen, das Einkommen, die Armut, die Beteiligung am internationalen Handel und die Gewalt. Der aus diesen und weiteren Indikatoren berechnete "Human Developement Index (HDI)" dokumentiert die enorme Ungleichheit zwischen Ländern und Regionen, an der sich trotz einiger internationaler Programme (z.B. die Millenium-Ziele und das Anti-Armutsprogramm der Weltbank) kaum etwas positiv verändert - im Gegenteil.
Unter der programmatischen Überschrift vom "Ende der Konvergenz" ziehen die Verfasser eine sehr pessimistische Bilanz der Entwicklung der letzten 40 Jahre: "A worrying aspect of human development today is that the overall rate of convergence is slowing - and for a large group of countries divergence is becoming the order of the day. In a world of already extreme inequalities human development gaps between rich and poor countries are in some cases widening and in others narrowing very slowly. The process is uneven, with large variations across regions and countries. We may live in a world where universal rights proclaim that all people are of equal worth - but where you are born in the world dictates your life chances."
In der Ländergruppe mit hohem HDI befinden sich 57 Länder (darunter z.B. Deutschland), in der mit mittlerem HDI sind 88 Länder (z.B. Russland, Venezuela) und 32 Länder (darunter zahlreiche afrikanische Länder) befinden sich auf einem niedrigen Niveau der Humanentwicklung.
Hier finden Sie die sehr große PDF-Datei: Human Developement Report 2005
Bernard Braun, 21.9.2005
Soziale Ungleichheit, Armut und Gesundheit
 Erst vor kurzem hat die Bundesregierung den 2. Armuts- und Reichtumsbericht vorgelegt. Der Bericht selbst sowie Forschungsberichte und Gutachten zum 2. Armuts- und Reichtumsbericht finden sich auf der Website von Sozialpolitik aktuell. In einem Kapitel werden dort auch zusammenfassend Ergebnisse einer Forschungsstudie zum Thema Armut und Gesundheit beschrieben. Die detaillierten Befunde der Forschungsstudie liegen nun auch in einem 225seitigen Papier vor, das vom RKI in der Reihe "Gesundheitsberichterstattung des Bundes" herausgegeben wird. Die Autoren Thomas Lampert und Thomas Ziese untersuchen dort detailliert, welche Effekte Bildung, Einkommen, Arbeitsbedingungen, Arbeitslosigkeit, Migration und andere Faktoren auf Krankheiten und Krankheitsrisiken haben. Die Broschüre liegt als PDF-Datei im Rahmen der Gesundheitsberichterstattung des Bundes beim RKI vor: Armut, soziale Ungleichheit und Gesundheit
Erst vor kurzem hat die Bundesregierung den 2. Armuts- und Reichtumsbericht vorgelegt. Der Bericht selbst sowie Forschungsberichte und Gutachten zum 2. Armuts- und Reichtumsbericht finden sich auf der Website von Sozialpolitik aktuell. In einem Kapitel werden dort auch zusammenfassend Ergebnisse einer Forschungsstudie zum Thema Armut und Gesundheit beschrieben. Die detaillierten Befunde der Forschungsstudie liegen nun auch in einem 225seitigen Papier vor, das vom RKI in der Reihe "Gesundheitsberichterstattung des Bundes" herausgegeben wird. Die Autoren Thomas Lampert und Thomas Ziese untersuchen dort detailliert, welche Effekte Bildung, Einkommen, Arbeitsbedingungen, Arbeitslosigkeit, Migration und andere Faktoren auf Krankheiten und Krankheitsrisiken haben. Die Broschüre liegt als PDF-Datei im Rahmen der Gesundheitsberichterstattung des Bundes beim RKI vor: Armut, soziale Ungleichheit und Gesundheit
In ähnlicher Weise wird die alte und neue Problematik ("Wenn Du arm bist, musst Du früher sterben") in einem Forschungsprojekt "Soziale Ungleichheit von Gesundheit und Krankheit in Europa" aufgegriffen. Johannes Siegrist fasst einige wesentliche neuere Erkenntnis der Forschungsstudie in einem Referat auf dem 108. Deutschen Ärztetag 2005 in Berlin so zusammen: Erstens: Der soziale Einfluss von Schicht, Bildung und Einkommensbedingungen auf Morbidität und Mortalität wird bereits am Beginn des Lebens, in der Schwangerschaft und in den aller ersten Lebensjahren gebahnt. Zweitens: Im frühen und mittleren Erwachsenenalter wird dieser Einfluss durch die Qualität der Erwerbsarbeit entscheidend beeinflusst.
In diesem Zusammenhang von Interesse ist auch das Kapitel 3 aus dem letzten Gutachten (2005) des Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen, das unter dem Titel "Sozioökonomischer Status und Verteilung von Mortalität, Morbidität und Risikofaktoren" auf rund 70 Seiten ebenfalls Ergebnisse internationaler Studien zum Zusammenhang von Schicht, Bildung und Krankheitsrisiken zusammenträgt. Analysiert werden dort unterschiedlichste Erkrankungsarten, wie Herz-Kreislauf, Diabetes, Stütz- und Bewegungsapparat, Haut- und Atemwegserkrankungen etc. Das gesamte Gutachten liegt ebenfalls als PDF-Datei vor (762 Seiten): Koordination und Qualität im Gesundheitswesen
Gerd Marstedt, 16.8.2005
SVR stellt fest: Bildung und Arbeit beeinflussen Krankheitsrisiken
 Der Sachverständigenrat (SVR) zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen hat der Gesundheitsministerin Ulla Schmidt sein neues Gutachten mit dem Titel "Koordination und Qualität" vorgestellt und Analysen und Vorschläge für die Weiterentwicklung des Gesundheitswesens unterbreitet. Schwerpunktthemen des diesjährigen Gutachtens sind die korporativen Strukturen des deutschen Gesundheitswesens, Prävention, Pflege sowie die Versorgung mit Heilmitteln, Hilfsmitteln und Arzneimitteln. Unter anderem gefordert wird eine Stärkung neuer Versorgungsformen und des Vertragswettbewerbes im Gesundheitssystem."
Der Sachverständigenrat (SVR) zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen hat der Gesundheitsministerin Ulla Schmidt sein neues Gutachten mit dem Titel "Koordination und Qualität" vorgestellt und Analysen und Vorschläge für die Weiterentwicklung des Gesundheitswesens unterbreitet. Schwerpunktthemen des diesjährigen Gutachtens sind die korporativen Strukturen des deutschen Gesundheitswesens, Prävention, Pflege sowie die Versorgung mit Heilmitteln, Hilfsmitteln und Arzneimitteln. Unter anderem gefordert wird eine Stärkung neuer Versorgungsformen und des Vertragswettbewerbes im Gesundheitssystem."
Auch für gesundheitspolitisch weniger Interessierte recht aufschlussreich sind die umfangreichen Daten und Informationen über die sozial ungleiche Verteilung von Erkrankungen. Als Fazit heißt es: "Wer schlecht ausgebildet ist, wenig verdient und in einem Beruf mit geringer gesellschaftlicher Anerkennung arbeitet, hat eine niedrigere Lebenserwartung und trägt ein höheres Krankheitsrisiko als besser gestellte Bevölkerungsgruppen. Lebensbedingungen und Lebensstile, die Bildung und der Arbeitsplatz beeinflussen die Gesundheit mehr als häufig angenommen wird."
Pressemitteilungen und Langfassung des Gutachtens sind hier zu finden: Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen
Gerd Marstedt, 6.7.2005