



Home | Patienten | Gesundheitssystem | International | GKV | Prävention | Epidemiologie | Websites | Meilensteine | Impressum
Sämtliche Rubriken in
"Epidemiologie"
Übergewicht, Adipositas |
Alle Artikel aus:
Epidemiologie
Übergewicht, Adipositas
Übergewichtsprävention für jugendliche Risikogruppen erreicht diese nicht, sondern überwiegend deutschsprachige Eltern
 Wichtig und richtig ist es nach allem was über ihre altersspezifische Prävalenz bekannt ist, mit Hinweisen zum Abbau oder zur Prävention von Übergewicht und Fettleibigkeit bei jungen Ziel- oder Risikogruppen zu starten.
Wichtig und richtig ist es nach allem was über ihre altersspezifische Prävalenz bekannt ist, mit Hinweisen zum Abbau oder zur Prävention von Übergewicht und Fettleibigkeit bei jungen Ziel- oder Risikogruppen zu starten.
In welcher Weise dies für besondere und auch nicht einfach erreichbare Risikogruppen, d.h. für Kinder und Jugendliche aus Familien mit Migrationshintergrund und niedrigem Sozialstatus geschieht, versucht jetzt eine in Deutschland durchgeführte Studie genauer in Erfahrung zu bringen.
Dazu recherchierten die Wissenschaftler*innen mittels eines evidenzbasierten Kriterienkatalogs im Spätsommer 2017 mit einer der großen Suchmaschinen nach frei verfügbaren print- und webbasierten Materialien zur Gesundheitsförderung mit dem Schwerpunkt Übergewichtsprävention. Zusätzlich suchten sie in einem App-Store nach kostenfreien und ebenfalls ernährungs- und übergewichtsbezogenen Gesundheits-Apps.
Sie fanden 89 Printmedien, 58 Websites und 25 Apps.
Die qualitativ wichtigsten Ergebnisse lauten so:
• "Die meisten Websites richten sich an Eltern respektive Erwachsene (65,6%) und Fachkreise (62,5%). Von den untersuchten Websites waren nur 9,4% speziell für Kinder konzipiert."
• "Webbasierte Materialien sind zu 37,5% kultursensibel gestaltet. Bei 40,6% der Websites lassen sich entweder unterschiedliche Sprachen auswählen oder es stehen Dokumente in unterschiedlichen Sprachen zum Download zur Verfügung."
• "Bei 9,4% der Websites kann eine Version in leichter Sprache aufgerufen werden. Knapp ein Fünftel der Websites bietet eine Version in Gebärdensprache und 3,1% eine Hörfassung."
• "In der Gesamtschau erfüllen Printmedien zu 92,8% die formalen und zu 87,8% die inhaltlichen Kriterien. Risikogruppen für Übergewicht werden zu 53% berücksichtigt."
• "Websites erfüllen formale Kriterien zu 88,8% und inhaltliche Kriterien zu 91,7%. Risikogruppen wurden bei etwa der Hälfte der Websites berücksichtigt (48,8%)."
• "Von den getesteten Apps richten sich die wenigen qualitativ hochwertigen an Eltern und Schwangere, sind häufig textbasiert und ausschließlich in deutscher Sprache verfasst."
Alles in Allem ist es nicht verwunderlich, wenn die Resonanz all dieser inhaltlich überwiegend korrekten Aufklärungsmaterialien bei den genannten Risikogruppen gering ist bzw. diese Gruppen damit gar nicht erreicht werden.
Die Forderungen der Autor*innen für die (Weiter-)Entwicklung solcher Materialien lauten daher auch so: "Bei ihrer Entwicklung sollten Web- und App-Entwicklerinnen und Entwickler sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die diversen Ausprägungen der Gesundheitskompetenz von Nutzerinnen und Nutzern berücksichtigen. Die Informationen sollten alltagsnah sein und praktische Anregungen zu einem gesundheitsfördernden Verhalten im Alltag geben. Risikogruppen der Gesundheitsförderung profitieren von kurzen Texten in leichter Sprache respektive in ihrer Herkunftssprache."
Selbst wenn aber mehr textbasierte Informationsmaterial für die jungen Zielgruppen existieren, löst dies nicht das Problem, dass ein nicht geringer Teil von ihnen selbst dann, wenn sie an Informationen interessiert sind, diese nicht lesen und verstehen können. Laut der jüngsten PISA-Befragung 2018 - Ländernotiz Deutschland haben 21% aller 15-Jährigen eine Lesekompetenz auf dem Grundschulniveau und dürften damit selbst mit Texten in einfacher Sprache nichts anfangen können. Dass dies noch keineswegs der höchste Anteil von Jugendlichen mit objektivem Informations- und Handlungsbedarf sein dürfte, die eine geringe Lesekompetenz haben, zeigt folgende Überlegung: Übergewicht, schlechte Ernährung und auch Leseschwäche sind überdurchschnittlich bei Angehörigen unterer sozialer Schichten zu finden Ausgerechnet Jugendliche, die also besonders Aufklärung nötig hätten, sind daher auch zu mehr als 20% leseschwach. Konkret waren es laut der 18 Seiten umfassenden Zusammenfassung der Grundbildung im internationalen Vergleich der PISA-Studie 2018 von Kristina Reiss et al. bei 29,2% der in Deutschland in nichtgymnasialen Schularten lernenden Schüler*innen der Fall. Unter den Schüler*innen in Gymnasien betrug dieser Anteil 1,8%. Fügt man diesen 21%, 29,2% oder 1,8% noch den wahrscheinlich auch nicht geringen Anteil der an solchen Informationen aus verschiedenen Gründen nicht interessierten Jugendlichen hinzu, wird die sehr begrenzte Reichweite selbst der besten Aufklärungsmaterialien offenbar.
Der Aufsatz Gesundheitsförderung und Übergewichtsprävention - systematische Bewertung verfügbarer Informationsmaterialien mit Fokus auf Risikogruppen von Jana Brauchmann, Laura Hruschka, Nadja-Raphaela Baer, Birgit Jödicke, Marc Urlen, Susanna Wiegand und Liane Schenk ist in der Ausgabe 12/2019 der Zeitschrift "Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz" erschienen. Ein Abstract ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 6.12.19
12 Jahre danach: Deutliche Gewichtsabnahme für stark Übergewichtige durch einen Magenbypass kann nachhaltig sein.
 Auch wenn nichtinvasive Maßnahmen für den Abbau erheblichen Übergewichts immer noch anstrebenswert sind, das Risiko einer Operation nicht unterschätzt werden darf und frühere Studien Zweifel am mittel- bis langfristigen Nutzen einer bariatrischen Operation förderten oder nicht ausschließen konnten, zeigt eine aktuelle Studie mit zwei Vergleichsgruppen auch nach 12 Jahren einen signifikanten und beträchtlichen Nutzen durch einen so genannten Roux-en-Y-Magenbypass - einer der häufigsten Methoden den natürlichen Weg der Nahrung durch den Magen-Darm-Trakt so zu verändern, "dass die Patienten geringere Mengen an fester und flüssiger Nahrung aufnehmen." (mehr unter dem Wikipedia-Stichwort Roux-en-Y-Magenbypass).
Auch wenn nichtinvasive Maßnahmen für den Abbau erheblichen Übergewichts immer noch anstrebenswert sind, das Risiko einer Operation nicht unterschätzt werden darf und frühere Studien Zweifel am mittel- bis langfristigen Nutzen einer bariatrischen Operation förderten oder nicht ausschließen konnten, zeigt eine aktuelle Studie mit zwei Vergleichsgruppen auch nach 12 Jahren einen signifikanten und beträchtlichen Nutzen durch einen so genannten Roux-en-Y-Magenbypass - einer der häufigsten Methoden den natürlichen Weg der Nahrung durch den Magen-Darm-Trakt so zu verändern, "dass die Patienten geringere Mengen an fester und flüssiger Nahrung aufnehmen." (mehr unter dem Wikipedia-Stichwort Roux-en-Y-Magenbypass).
Eine Gruppe von 1.156 schwer übergewichtigen Personen wurde dazu auf drei Gruppen verteilt: Eine Operationsgruppe, eine erste Nichtoperations-Vergleichsgruppe deren Angehörige zwar eine Operation wollten, sie aber überwiegend wegen ihrer schlechten Versicherung nicht erhielten und eine dritte Gruppe bzw. die zweite Nichtoperationsgruppe deren Angehörige nicht operiert werden wollten. Alle StudienteilnehmerInnen wurden zu Beginn der Studie sowie nach 2, 6 und 12 Jahren gründlich auf die Betroffenheit durch Diabetes Typ 2, Bluthochdruck und Fettstoffwechselstörungen untersucht.
Der adjustierte durchschnittliche Gewichtsverlust betrug in der Operationsgruppe im Vergleich zum Ausgangsgewicht nach zwei Jahren 45 kg, 36,3 kg nach6 Jahren und 35 kg nach 12 Jahren. Nach 12 Jahren hatten die Angwehörigen der ersten Nichtoperationsgruppe 2,9 kg abgenommen. Das Gewicht der nichtoperierten Angehörigen der zweiten Vergleichsgruppe hatte sich nach 12 Jahren nicht verändert. Zusätzlich zu der signifikant größeren Gewichtsabnahme hatten die bariatrisch Operierten auch signifikant geringere Inzidenzraten für Diabetes Typ 2 (3% gegenüber 26%) Bluthochdruck und Fettstoffwechselstörungen als die nichtoperierten aus der ersten Vergleichsgruppe.
Die Studie Weight and Metabolic Outcomes 12 Years after Gastric Bypass von Ted D. Adams et al. ist am 21. September 2017 in der Zeitschriftr "New England Journal of Medicine (NEJM)" (377:1143-115) erschienen. Ein Abstract ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 30.9.17
Wie das ernste Problem der Übergewichtigkeit und Fettleibigkeit zur Epidemie prognostiziert wird. Das Beispiel einer OECD-Studie
 Das Niveau und die weitere Entwicklung der Häufigkeit von Übergewicht oder gar Fettleibigkeit gehören sicherlich zu den wichtigsten gesundheitspolitischen Herausforderungen. Ob es dazu der alarmistischen Etikettierung als Epidemie oder Pandemie bedarf, kann aus zweierlei Gründen in Frage gestellt werden: Erstens verhindert oder lähmt der damit häufig erzeugte Eindruck der Unausweichlichkeit und die schlichte Problemmasse viele Gegeninitiativen, fördert Fatalismus. Und zweitens verschwinden in dem Epidemie-Diskurs eine Reihe von Erkenntnissen, die viele Grundannahmen differenzieren und auch zu empirisch anderen und weniger dramatischen Ergebnissen kommen. Dies gilt z.B. für eine Reihe von international vergleichenden Längsschnittuntersuchungen, welche keine Hinweise auf eine globale explosionsartige Zunahme von Inzidenz und Prävalenz der Fettleibigkeit gefunden haben, sondern ein sehr differenziertes Bild zeichneten.
Das Niveau und die weitere Entwicklung der Häufigkeit von Übergewicht oder gar Fettleibigkeit gehören sicherlich zu den wichtigsten gesundheitspolitischen Herausforderungen. Ob es dazu der alarmistischen Etikettierung als Epidemie oder Pandemie bedarf, kann aus zweierlei Gründen in Frage gestellt werden: Erstens verhindert oder lähmt der damit häufig erzeugte Eindruck der Unausweichlichkeit und die schlichte Problemmasse viele Gegeninitiativen, fördert Fatalismus. Und zweitens verschwinden in dem Epidemie-Diskurs eine Reihe von Erkenntnissen, die viele Grundannahmen differenzieren und auch zu empirisch anderen und weniger dramatischen Ergebnissen kommen. Dies gilt z.B. für eine Reihe von international vergleichenden Längsschnittuntersuchungen, welche keine Hinweise auf eine globale explosionsartige Zunahme von Inzidenz und Prävalenz der Fettleibigkeit gefunden haben, sondern ein sehr differenziertes Bild zeichneten.
Wie trotzdem aktuell auch angesehene Institutionen am gegenteiligen Eindruck mitstricken und mit Sicherheit auch auf die öffentliche Diskussion einwirken und sich dabei selber an entscheidenden Punkten mit präsentierten Daten widersprechen, lässt sich exemplarisch am "Obesity Update 2017" der OECD ablesen.
Eine der zentralen Aussagen lautet: "Obesity rates are projected to increase further by 2030, and Korea and Switzerland are the countries where obesity rates are projected to increase at a faster pace."
In zwei Übersichten über die Entwicklung der "overweight (including obesity) rates" von Erwachsenen im Alter von 15 bis 74 Jahren zwischen den Jahren 1972 (USA als einziges OECD-Mitgliedsland mit Daten) bis 2015/16 (Daten von 10 Mitgliedsländern) und zu den "projected rates of obesity" für die 10 Länder bis zum Jahr 2030 liefert die OECD folgende Einblicke in die empirische Situation:
• Als erstes zeigt sich für die Jahre 2015/16 eine regional extrem unterschiedliche Übergewichtsrate, die von rund 30% in Korea bis zu rund 70% in Mexiko reicht. Dazwischen liegen im niedrigeren Bereich z.B. die Schweiz und Italien und im höheren Bereich Ungarn und die USA. Zumindest in bestimmten Ländern rechtfertigen die Zahlen (noch) nicht die Charakterisierung als Epidemie. Ferner weisen diese Unterschiede auch darauf hin, dass Fettleibigkeit in "modernen" Staaten offensichtlich nicht generell oder auf einem gleich hohen Niveau unausweichlich und unvermeidbar ist.
• Hinzu kommt, dass in den meisten der 10 Ländern die Rate in den Jahren ab 2000 nicht mehr nennenswert oder gar epidemisch-explosionsartig zunimmt, ja sogar z.B. in Spanien leicht sinkt oder sich in England oder Italien auf und abbewegt. Trotzdem stellt die OECD unterschiedslos fest, die "obesity epidemic has spread further in the past five years".
• Trotzdem wird sich die künftige Rate von Fettleibigkeit laut OECD in allen 10 Ländern von den Ausgangsjahren 2015/16 an bis 2030 plötzlich voll-kontinuierlich und fast linear auf ein deutlich höheres Niveau entwickeln, das dann die Kennzeichnung als Epidemie rechtfertigt. Die Fettleibigkeitsrate in den USA soll im Jahr 2030 rund fünfmal so hoch sein wie in Korea. Da die von der OECD für die letzten Jahre präsentierten Zahlen nicht zwangsläufig für einen weiteren kräftigen Anstieg sprechen und auch die OECD über Faktoren berichtet, die möglicherweise die Dynamik abbremsen, bleibt unklar worauf ihre Prognose beruht.
• Was an der scheinbar linearen Weiterentwicklung u.a. Zweifel weckt, ist der folgende Hinweis in der OECD-Analyse: "People with a lower level of education or socio-economic status are more likely to be overweight or obese, and the gap is generally larger in women. Women are obese more often than men - however, in the OECD countries for which data are available, obesity has been generally growing fastest in men." Dass Fettleibigkeit in den USA in den letzten Jahren anders als in allen anderen OECD-Mitgliedsländern am schnellsten in der Gruppe der hochgebildeten Personen zugenommen hat, unterstreicht nur zusätzlich die Fragwürdigkeit linearer Prognosen. Der mögliche hemmende Effekt der aus vielen nichtgesundheitlichen Gründen zu erwartenden Verbesserung des künftigen Bildungsniveaus in weiten Teilen der Bevölkerung relativiert oder konterkariert die Darstellung bzw. Prognose, die Fettleibigkeitsrate würde ab sofort linear zunehmen, erheblich. Letzteres ist auch deshalb gewagt und unverständlich, weil die OECD selber auf die Existenz eines Bündels ("comprehensive policy packages") gesundheitspolitischer Maßnahmen hinweist, die eventuell den Trend zur Epidemie abschwächen, wenn nicht sogar verhindern oder umkehren könnten.
Trotz allem ist zu befürchten, dass das Wachstumsszenario der OECD in der öffentlichen Wahrnehmung hängenbleibt und die weitere öffentliche Diskussion mitbestimmen wird.
Der 12-seitige Text Obesity Update 2017der OECD ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 19.5.17
Auch Nützliches muss nicht immer und für alles nützlich sein. Das Beispiel Stillen.
 Auch wenn das Stillen sicherlich eine Menge physiologischer und psychischer Vorteile für Mütter wie Babies hat, sollte der mittel- und langfristige Nutzen für das Wachstum, die Normalgewichtigkeit und einen normalen Blutdruck der Kinder trotz einiger Belege durch Beobachtungsstudien nicht überschätzt werden.
Auch wenn das Stillen sicherlich eine Menge physiologischer und psychischer Vorteile für Mütter wie Babies hat, sollte der mittel- und langfristige Nutzen für das Wachstum, die Normalgewichtigkeit und einen normalen Blutdruck der Kinder trotz einiger Belege durch Beobachtungsstudien nicht überschätzt werden.
Dies ist jedenfalls das Ergebnis der Sekundäranalyse entsprechender Daten aus einer auf der Basis eines WHO-Programms in Weissrussland durchgeführten randomisierten kontrollierten Langzeitstudie von 13.557 Kindern mit durchschnittlich 16,2 Jahren (48,5% Mädchen/junge Frauen). Die Kinder in der Interventionsgruppe waren möglichst lange ausschließlich gestillt worden, die in der Kontrollgruppe deutlich weniger und kürzer (im Alter von drei Monaten waren 45% der Babies in der Interventions- und 6% in der Kontrollgruppe auuschließlich gestillt worden).
Die Ergebnisse:
• Eine höhere Intensität von Stillen war im Alter von 16 Jahren nicht mit einer geringeren Übergewichtigkeit oder einem niedrigeren Blutdruck assoziiert.
• Betrachtet man nur den Body Mass Index, war der bei den Kindern mit intensivem Stillen sogar höher als bei den weniger intensiv gestillten Kindern.
Die AutorInnen weisen einschränkend auf einige Schwierigkeiten der Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse hin und betonen, dass andere diskutierte positive Wirkungen des Stillens dieses durchaus rechtfertigen.
Der Aufsatz Effects of Promoting Long-term, Exclusive Breastfeeding on Adolescent Adiposity, Blood Pressure, and Growth TrajectoriesA Secondary Analysis of a Randomized Clinical Trial von Richard M. Martin et al. ist am 1. Mai 2017 in der Fachzeitschrift "JAMA Pediatrics" erschienen und als "online first"-Beitrag komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 7.5.17
"Fettleibigkeits-Epidemie"? Prävalenz der Bauchfettleibigkeit von US-Kindern/Jugendlichen pendelt sich zwischen 2003 und 2012 ein!
 Die Beschäftigung mit dem Gewicht oder Übergewicht von Kindern und Jugendlichen und vor allem dessen Entwicklung ist wegen der vielfach belegten langfristigen Folgen von Übergewicht und Fettsucht im späteren Leben und deren möglichen Prävention wichtig. Umso sorgfältiger muss dies aber geschehen. Wie bereits die generelle Debatte über validere (Über-)Gewichts-Indikatoren (z.B. Bauchfettleibigkeit bzw. abdominale Adipositas) als dem "Body Mass Index (BMI)" und die spezielle Debatte über die Fehlmessungen von kindlichem Gewicht durch den BMI zeigt, gibt es hier noch kein Patentrezept für die Methodik. Umso vorsichtiger sollten also Trendaussagen und bisherige Prognosen zur Gewichtssituation bewertet werden, die bisherige Trends linear oder gar exponentiell fortschreiben.
Die Beschäftigung mit dem Gewicht oder Übergewicht von Kindern und Jugendlichen und vor allem dessen Entwicklung ist wegen der vielfach belegten langfristigen Folgen von Übergewicht und Fettsucht im späteren Leben und deren möglichen Prävention wichtig. Umso sorgfältiger muss dies aber geschehen. Wie bereits die generelle Debatte über validere (Über-)Gewichts-Indikatoren (z.B. Bauchfettleibigkeit bzw. abdominale Adipositas) als dem "Body Mass Index (BMI)" und die spezielle Debatte über die Fehlmessungen von kindlichem Gewicht durch den BMI zeigt, gibt es hier noch kein Patentrezept für die Methodik. Umso vorsichtiger sollten also Trendaussagen und bisherige Prognosen zur Gewichtssituation bewertet werden, die bisherige Trends linear oder gar exponentiell fortschreiben.
Was bei gründlichen Langzeituntersuchungen ausgewählter Indikatoren zur Gewichtssituation herauskommen kann, zeigt eine im Juli 2014 online veröffentlichte Studie über die Entwicklung der abdominalen Fettleibigkeit - also der so genannten "Schwimmring-Übergewichtigkeit" bei 16.601 zwei- bis achtzehnjährigen us-amerikanischen Kindern und Jugendlichen zwischen den Jahren 2003-2004, 2005-2006, 2007-2008, 2009-2010 und 2011-2012. Diese Art der Fettleibigkeit wurde im "National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES)" mit zwei Indikatoren gemessen: dem Taillenumfang ("waist circumference"), wenn eine Person im neunzigsten Percentil des geschlechts- und altersspezifischen Wertes lag und dem Verhältnis von Taillenumfang zur Körpergröße ("waist-to-height"), wenn dieses ≥0,5 ist.
Das Ergebnis sah so aus:
• Zunächst referieren die Wissenschaftler bisherige Studien, die für den Zeitraum von 1988-94 bis 2003-2004 eine signifikante Zunahme der Taillenfettleibigkeit unter den US-Kindern und -Jugendlichen nachgewiesen hatten.
• 2011-12 waren nach dem Indikator Taillenumfang 17,95% der zwei bis 18 Jahre alten Kinder und Jugendlichen abdominal fettleibig. Nach dem Indikator Taillen-Körpergrößen-Indikator waren es 32,93% der sechs- bis achtzehnJährigen.
• Das wichtiste Ergebnis lautete aber: Die durchschnittliche Prävalenz beider Arten von Fettleibigkeit veränderte sich zwischen 2003-2004 und 2011-2012 praktisch nicht bzw. blieb auf dem erreichten Niveau - und zwar unabhängig vom Geschlecht, Alter und der ethnischen Zugehörigkeit.
• In der Altersgruppe der Zwei- bis Fünfjährigen nahm die Fettleibigkeit im Untersuchungszeitraum sogar signifikant ab.
Auch wenn das Problem übergewichtiger oder schwer fettleibiger Kinder und Jugendlichen in den USA immer noch herausfordernd umfangreich ist, mindert das Einpendeln der Prävalenz im letzten Jahrzehnt einen Teil der Dramatik der Debatten in Richtung Obesity-Epidemie. Wichtig ist dabei auch, durch weitere Forschung mehr über die Ursachen dieses empirischen Trends zu erfahren und dabei Hinweise zu bekommen, ob sich dieser Trend stabilisiert, die Abnahme in der jüngsten Altersgruppe anhält, der Effekt beim Älterwerden dieser Gruppe erhalten bleibt oder sogar eine Abnahme der Prävalenz in anderen Altersgruppen möglich ist.
Der Aufsatz Trends in Abdominal Obesity Among US Children and Adolescents von Bo Xi et al. ist am 21. Juli 2014 online von der Zeitschrift "Pediatrics" verlöffentlicht worden und ein Abstract ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 10.8.14
"Ich habe das richtige Gewicht" - Selbstwahrnehmung vieler übergewichtiger und fetter Kinder in den USA anders als Messwerte
 Für den Erfolg jeder verhaltensbezogenen Intervention sind die Existenz wirksamer Maßnahmen, die Motivation und schließlich auch die Selbstwahrnehmung des Risikos entscheidend. Wer seinen Zustand für unproblematisch oder gar für ideal hält, wird weder verhältnisbezogene Maßnahmen begrüßen und nutzen noch sein Verhalten verändern.
Für den Erfolg jeder verhaltensbezogenen Intervention sind die Existenz wirksamer Maßnahmen, die Motivation und schließlich auch die Selbstwahrnehmung des Risikos entscheidend. Wer seinen Zustand für unproblematisch oder gar für ideal hält, wird weder verhältnisbezogene Maßnahmen begrüßen und nutzen noch sein Verhalten verändern.
Dass dies auch im Bereich von Übergewicht oder Fettsucht bei Kindern und Jugendlichen häufig der Fall sein könnte, zeigt jetzt eine aktuelle Auswertung des "National Health and Nutrition Examination Survey" für acht- bis fünfzehnjährige Kinder in den USA im Zeitraum 2005 bis 2012.
Diese Zielgruppe wird in dem für die USA repräsentativen Survey gebeten die folgende Frage zu beantworten: "Do you consider yourself now to be fat or overweight, too thin, or about the right weight?" Außerdem werden Körpergröße und Gewicht erhoben womit der Body Mass Index errechnet werden kann.
Die Ergebnisse sehen so aus:
• Rund 81% der nach ihrem alters- und geschlechtsspezischen BMI-Wert übergewichtigen Jungen und 71% der übergewichtigen Mädchen ("greater than or equal to the 85th and less than the 95th percentile" eines in den USA geltenden Zielwerts) halten ihr Gewicht für das richtige.
• Von den Kindern, die fettsüchtig waren ("greater than or equal to the 95th percentile" des genannten Zielwerts), sagten immer noch 48% der Jungen und 36% der Mädchen, sie hätten aus ihrer Sicht das richtige Gewicht.
• Kinder aus Familien mit niedrigem Einkommen und aus nichtweißen Familien misklassifizierten ihre Gewicht mit größerer Wahrscheinlichkeit als die aus Familien mit höherem Einkommen. Von den Kindern aus Familien mit einem Einkommen, das 350% und mehr über der so genannten "family income-to-poverty ratio (FIPR)" lag, nahmen 26,3% ihr Gewicht falsch war. In Familien, die 130% bis 349% der FIPR Einkünfte hatten, machten dies 30,7% und in den ärmsten Familien mit weniger als 130% der FIPR 32,5%. Dieser Trend war statistisch signifikant. Interessanterweise waren die Unterschiede bei Mädchen deutlich größer und auch signifikant unterschiedlich als bei Jungen.
Die Fehlwahrnehmung des eigenen Gewichts ist aber nicht nur im Bereich tatsächlichen Übergewicht und Fettsucht ein Problem, sondern tritt auch umgekehrt bei völlig normalgewichtigen Kindern und Jugendlichen auf. Angehörige dieser Gruppe halten sich nicht selten für zu dick oder gar fett, versuchen deshalb mit allen Mitteln abzunehmen und riskieren gesundheitsschädlich untergewichtig zu werden.
Der Aufsatz Perception of Weight Status in U.S. Children and Adolescents Aged 8-15 Years, 2005-2012 von Neda Sarafrazi et al. ist im Juli 2014 als Heft 158 des "National Center for Health Statistics data brief" erschienen und kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 24.7.14
Kostensparen durch Magenverkleinerung!!? Wie oft wollen Politik und Krankenkassen noch auf "Kostenwunder" hereinfallen?
 Zu den verlockendsten und meistgeglaubten Versprechungen der Anbieter von gesundheitsbezogenen Leistungen gehört es, mit geringeren Kosten bessere Qualität zu liefern oder zumindest die Kosten zu senken. Und genauso regelmäßig wie dies Gesundheitspolitiker und Krankenkassen glaubten, wuchs der Leistungskatalog mit dieser Art von Angeboten, die sich dann aber häufig als weder qualitativ hochwertig, noch wirksam und kostensparend erwiesen.
Zu den verlockendsten und meistgeglaubten Versprechungen der Anbieter von gesundheitsbezogenen Leistungen gehört es, mit geringeren Kosten bessere Qualität zu liefern oder zumindest die Kosten zu senken. Und genauso regelmäßig wie dies Gesundheitspolitiker und Krankenkassen glaubten, wuchs der Leistungskatalog mit dieser Art von Angeboten, die sich dann aber häufig als weder qualitativ hochwertig, noch wirksam und kostensparend erwiesen.
Das jüngste Beispiel, so eine in der Fachzeitschrift "JAMA Surgery" gerade veröffentlichte Studie, ist die als radikale und mit Sicherheit mittel- wie langfristig kostensparende Therapie für extrem Übergewichtige seit einigen Jahren propagierte und auch durchgeführte operative Verkleinerung des Magens. Angesichts der großen und zum Teil zunehmenden Anzahl von adipösen Personen und deren praktischen Schwierigkeiten dies durch ein anderes Ess- und Bewegungsverhalten zu ändern, schien die auch Adipositaschirurgie genannte Reihe von Verkleinerungstechniken eine Art Patentlösung zu sein.
Eine Untersuchung von anfänglich 29.820 Personen, die bariatrisch operiert worden waren, über 6 Jahre (2002 bis 2008) und der Vergleich ihrer gesundheitlichen Versorgung und deren Kosten mit den in gesundheitlicher Sicht ähnlichen (z.B. Betroffenheit von Übergewicht) Angehörigen einer nichtoperierten Vergleichsgruppe, zeigte aber ein wesentlich unpatenteres Bild.
Die gesamten Gesundheitsausgaben der operierten Personen waren bis zum dritten Jahr der Untersuchung größer als die der Kontrollgruppenangehörigen. In den weiteren Jahren ähneln sich die Ausgaben.
Dabei waren die Ausgaben der bariatrisch operierten Personen für Medikamente und Arztbesuche niedriger, die für stationäre Behandlung aber höher als in der Kontrollgruppe. Letztere entstanden überwiegend durch unerwünschte und zum Teil erst nach Jahren auftretenden Komplikationen und Folgen der überwiegenden Operationstechnik, einer so genannten laparoskopischen Operation.
Zusammenfassend betonten die AutorInnen und der Verfasser eines Editorials zwei Aspekte:
• "We were unable to identify any short- or long-term reductions in overall health care costs associated with surgery."
• Ein Herausgeber der Zeitschrift weist in seiner "invited critique" stattdessen auf eine qualitative völlig andere Herangehens- und Bewertungsweise für diese und andere Behandlungsangebote hin: "The indications for bariatric surgery should be viewed in terms of individual patient benefit without anticipating that there will be cost savings to a health care system by offering this treatment." Zum patientenbezogenen Nutzen und zu den Entscheidungskriterien für eine Operation gehört für die ForscherInnen auch noch das "well-being" der betroffenen Personen.
Der am 20. Februar 2013 zuerst online veröffentlichte Aufsatz Impact of Bariatric Surgery on Health Care Costs of Obese Persons. A 6-Year Follow-up of Surgical and Comparison Cohorts Using Health Plan Data von Jonathan P. Weiner et al. ist in der Fachzeitschrift "JAMA Surgery" (2013;():1-8) erschienen und komplett kostenlos zugänglich.
Der komplette Text der "Invited Critique" Is Bariatric Surgery Worth It? Comment on "Impact of Bariatric Surgery on Health Care Costs of Obese Persons" von Edward H. Livingston ist ebenfalls kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 22.2.13
Gewichtiges aus den USA: Kann das Übergewichtsproblem bei Kindern und Jugendlichen abnehmen, und wenn ja, warum?
 Egal, ob es sich um die Gesundheitsausgaben oder Erkrankungen handelt, kennt die Entwicklung und der öffentliche Diskurs scheinbar nur eine Richtung oder Dynamik: Teurer bis zur Unfinanzierbarkeit, explodierender Bedarf an mehr Therapien und Therapeuten und schlimmer. Dies gilt insbesondere für die so genannten Volkskrankheiten und in besonderem Maße für das Übergewicht und die Fettsüchtigkeit von Erwachsenen und Kinder wie Jugendlichen.
Egal, ob es sich um die Gesundheitsausgaben oder Erkrankungen handelt, kennt die Entwicklung und der öffentliche Diskurs scheinbar nur eine Richtung oder Dynamik: Teurer bis zur Unfinanzierbarkeit, explodierender Bedarf an mehr Therapien und Therapeuten und schlimmer. Dies gilt insbesondere für die so genannten Volkskrankheiten und in besonderem Maße für das Übergewicht und die Fettsüchtigkeit von Erwachsenen und Kinder wie Jugendlichen.
Dass dies nicht so sein muss und woran dies möglicherweise liegt, belegen eine Reihe jüngster empirischer Funde und Spuren in den USA.
Erinnert sei daran, dass in den USA nach Statistiken der staatlichen "Centers for Disease Control and Prevention" rund 17% aller Kinder und Jugendlichen unter 20 Jahren fettsüchtig sind, d.h. rund 12.5 Millionen junger Personen. Der Anteil dieser Kinder und Jugendlichen hat sich in den letzten 30 Jahren in etwa verdreifacht.
Bereits im September 2012 hatte ein "Health Policy Snapshot" der Robert Wood Johnson Foundation zum Thema "Childhood Obesity" mit seiner Überschrift signalisiert, dass entgegen des jahre- oder jahrzehntelangen epidemiologischen Trends und der herrschenden Krankheitsdebatte in den USA Unerwartetes zu beobachten ist: "Declining childhood obesity rates—where are we seeing the most progress?".
Die Kernbotschaften lauteten:
• In den Großstädten New York und Philadelphia sowie in so unterschiedlichen Bundesstaaten Kalifornien und Mississippi sanken die Raten der übergewichtigen und fettsüchtigen Kinder und Jugendlichen zwischen 2007 und 2011 signifikant.
• Diese Entwicklung trat besonders dort auf wo umfassende individuelle und öffentliche (z.B. Restaurants, Schulen) Aktionen im Bereich Ernährung (z.B. Förderung von Lebensmittelläden mit Nahrungsmitteln aus der Region und Akzeptanz der in den USA von Millionen Menschen benötigten Lebensmittelmarken bei Bauern), körperliche Aktivitäten und Freizeitverhalten (z.B. Limitierung der Fernsehzeit in öffentlichen Kindertagesstätten) stattgefunden haben und dauerhaft installiert wurden.
• Trotz vieler Bemühungen gibt es aber in den USA weiterhin eine erhebliche sozioökonomische, ethnische oder regionale Ungleichverteilung der Übergewichtigkeit. Aber auch hier zeigen Einzelbeispiele wie das von Philadelphia, dass dies kein unabänderlicher Zustand ist.
• Richtig ist aber auch, dass in Bundesstaaten, in denen die "obesity rate" insgesamt sank, sie in 31 der 58 "counties" trotzdem anstieg.
Wie stark der Rückgang der Rate übergewichtiger Kinder und Jugendlichen ausfällt und ob sich der Trend bis 2012 fortsetzte, findet sich ausführlich in einem am 10. Dezember 2012 in der "New York Times" veröffentlichten Bericht:
• So wird z.B. am Beispiel New Yorks sowohl gezeigt, dass sich die Rate insgesamt verkleinert, als auch, dass das Sinken je nach Ethnie deutliche Unterschiede aufweist: Eine Studie, welche die Gewichtsentwicklung einer Gruppe von Kindern vom Kindergarten bis zur achten Schulklasse untersuchte, fand zwischen 2007 und 2011 eine Abnahme des Anteils übergewichtiger weißer Kinder um 12,5%, aber nur um 1,9% unter den schwarzen Kindern. Im Durchschnitt sank die Rate um 5,5%.
• In Philadelphia sinkt die Rate laut zitierter amtlicher Angaben auch von 2011 auf 2012 um 2,5% weiter.
• Die beschriebene Entwicklung findet sich schließlich nicht nur in den bisher genannten Großstädten, sondern z.B. auch in Los Angeles, Anchorage in Alaska oder der eher kleineren Stadt Kearney im Bundesstaat Nebraska.
Damit scheint sich etwas fortzusetzen, was bereits in einer Studie über die Entwicklung seit Ende der 1990er Jahre bis 2010 belegt wurde und worüber im "forum-gesundheitspolitik" unter dem Titel "Ja, wo explodieren sie denn?" - Cui bono oder Grenzen der Anbieter- "Epidemiologie" von Übergewicht und psychischen Krankheiten" Anfang 2012 berichtet wurde.
Der Artikel "Obesity in Young Is Seen as Falling in Several Cities" von Sabrina Tavernise in der New York Times vom 10. Dezember 2012, ist kostenlos erhältlich und enthält zahlreiche Links zu weiteren wissenschaftlichen Texten zum Problem.
Dazu gehört auch der Hinweis auf den umfangreichen Konsensus-Report des "Committee on Accelerating Progress in Obesity Prevention; Food and Nutrition Board" des "Institute of Medicine (IOM)" der USA. In dem Report "Accelerating Progress in Obesity Prevention: Solving the Weight of the Nation", herausgegeben von Dan Glickman, Lynn Parker, Leslie J. Sim, Heather Del Valle Cook und Emily Ann Miller, ist auf fast 500 Seiten dargestellt, welche Interventionen und vor allem welcher Mix von Interventionen in den USA für erfolgreich gehalten wird bzw. nach den hier zitierten Entwicklungen erfolgreich ist. Der Report ist kostenlos, wie seit einigen Monaten alle Reports des IOM, nach einer kurzen und seriösen Anmeldeprozedur erhältlich.
Bernard Braun, 11.12.12
"Ja, wo explodieren sie denn?" - Cui bono oder Grenzen der Anbieter- "Epidemiologie" von Übergewicht und psychischen Krankheiten
 Egal, ob es um die Entwicklung von alten, neuen, somatischen oder psychischen Krankheiten geht: Unterhalb von "Explosion" oder Epi-/Pandemie scheint es keine Entwicklungsdynamik mehr zu geben. Die maßgeblichen Propagandisten und schlussendlich auch Nutznießer dieser "Explosionen" sind die Angehörigen einer Allianz von traditionellen aber auch alternativen Therapeuten, Herstellern der passenden Arzneimittel, Berichterstattungs- und Präventionsexperten, Weiterbildungsanbietern und einem stetig wachsenden Heer von Gesundheitswirtschaftsbetreibern, denen verständlicherweise eine 100-Prozent-Prävalenz am liebsten wäre. Dass dieser Zustand weder neu noch seine kritische Charakterisierung besonders böswillig ist, zeigen zwei etwas ältere kritische Anmerkungen zu den damaligen Ausdrucksformen dieser Art anbieter- oder angebotsinduzierten Epidemiologie.
Egal, ob es um die Entwicklung von alten, neuen, somatischen oder psychischen Krankheiten geht: Unterhalb von "Explosion" oder Epi-/Pandemie scheint es keine Entwicklungsdynamik mehr zu geben. Die maßgeblichen Propagandisten und schlussendlich auch Nutznießer dieser "Explosionen" sind die Angehörigen einer Allianz von traditionellen aber auch alternativen Therapeuten, Herstellern der passenden Arzneimittel, Berichterstattungs- und Präventionsexperten, Weiterbildungsanbietern und einem stetig wachsenden Heer von Gesundheitswirtschaftsbetreibern, denen verständlicherweise eine 100-Prozent-Prävalenz am liebsten wäre. Dass dieser Zustand weder neu noch seine kritische Charakterisierung besonders böswillig ist, zeigen zwei etwas ältere kritische Anmerkungen zu den damaligen Ausdrucksformen dieser Art anbieter- oder angebotsinduzierten Epidemiologie.
Der Medizinhistoriker Roy Porter, spricht gegen Ende seiner großen Geschichte des Heilens davon, dass ein "wachsendes medizinisches Establishment angesichts einer immer gesünderen Bevölkerung dazu getrieben wird …, normale Ereignisse wie die Menopause zu medikalisieren, Risiken zu Krankheiten zu machen und einfache Beschwerden mit ausgefallenen Prozeduren zu behandeln. Ärzte und 'Konsumenten' erliegen zunehmend der Vorstellung, dass jeder irgendetwas hat, dass jeder und alles behandelt werden kann." (Porter, R. [2000]: Die Kunst des Heilens. Eine medizinische Geschichte der Menschheit von der Antike bis heute. Heidelberg: 717)
Die mindestens bereits vor rund 10 Jahren gestartete Springflut psychischer Erkrankungen kommentierte der angesehene Psychiater Klaus Dörner 2002 im "Deutschen Ärzteblatt" so: "Der Wettbewerb zwingt zur Erschließung neuer Märkte. Das Ziel muss die Umwandlung aller Gesunden in Kranke sein, also in Menschen, die sich möglichst lebenslang sowohl chemisch-physikalisch als auch psychisch für von Experten therapeutisch, rehabilitativ und präventiv manipulierungsbedürftig halten, um "gesund leben" zu können. … Das Sinnesorgan Angst, zuständig für die Signalisierung noch unklarer Bedrohungen, ist zwar unangenehm, jedoch vital notwendig und daher kerngesund; nur am falschen Umgang mit Angst (zum Beispiel Abwehr, Verdrängung) kann man erkranken. In den 70er- und 80er-Jahren jedoch hat man die Angst als Marktnische erkannt und etliche neue, selbstständige Krankheitseinheiten konstruiert - mit vielen wunderbaren Heilungsmöglichkeiten für die dafür dankbaren Patienten. … Nach dem Erfurter Amoklauf blieb einer Schülerin die Äußerung vorbehalten, das Schrecklichste seien eigentlich die Psychologen gewesen, die das Alleinsein mit sich selbst und/oder mit Freunden/Angehörigen mit den raffiniertesten Tricks zu verhindern versucht hätten." (Dörner Klaus (2002): Gesundheitssystem in der Fortschrittsfalle. In: Dtsch Arztebl 2002; 99: A 2462-2466 [Heft 38])
Zu den jüngsten besonders "dramatisch" "explodierenden Krankheiten" gehören das Übergewicht und die Fettsüchtigkeit sowie die psychischen Erkrankungen.
Zwei Längsschnittanalysen aus den USA und mehreren europäischen Ländern zeigen aber für beide Krankheitskomplexe für unterschiedlich lange Zeiträume vor der Gegenwart eher stagnative oder sogar leicht implodierende Tendenzen.
Drei Wissenschaftlerinnen der US-"Centers for Disease Control and Prevention" haben die Entwicklung der Prävalenz von Übergewichtigkeit und des Body Mass Index bei us-amerikanischen Kindern, Heranwachsenden und Erwachsenen für die Jahre 1999 bis 2010 mit den Daten des "National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES)" genauer untersucht.
Sie kommen dabei zu folgenden Ergebnissen:
• Nach einer kräftigen Zunahme der Prävalenz von Übergewichtigkeit bei Kindern in den 1980er und 1990er Jahren gab es zwischen 1999/2000 und 2007/2008 keinen signifikanten weiteren Anstieg. Von allen Kindern und Heranwachsenden zwischen 2 und 19 Jahren waren in beiden Jahreszeiträumen 16,9% übergewichtig oder fettleibig. Bei der Betrachtung von Untergruppen zeigen sich aber bei männlichen Kindern und Heranwachsenden sowohl bei der Veränderung der Übergewichtigkeit als auch des Body Mass Index (BMI) leichte aber statistisch signifikante Zunahmen - nirgends aber für Mädchen und junge Frauen.
• Die alters- und ethno-adjustierte Prävalenz von Übergewichtigkeit und Fettleibigkeit hat sich 2009/2010 mit 35,5% bei erwachsenen Männern und 35,8% bei erwachsenen Frauen nicht signifikant gegenüber 1999 verändert. Damals betrugen die Prävalenzwerte 35,7% und ebenfalls 35,8%. Ähnlich sah es bei der Entwicklung des BMI aus. Auch hier wichen aber Untergruppen vom Gesamttrend ab. So nahm die Übergewichtigkeit bei nicht-hispanischen schwarzen Frauen und mexikostämmigen AmerikanerInnen signifikant zu.
Eine internationale Forschergruppe um den Dresdener Psychiater Hans Ulrich Wittchen hat sich 2005 und 2010 u.a. mit der Prävalenz psychischer Erkrankungen in der Bevölkerung der EU-27-Länder, der Schweiz, Islands und Norwegens beschäftigt.
Zu den Hauptergebnissen im Jahr 2010 gehört, dass etwas mehr als jeder dritte EU-Bürger mindestens einmal in einem Jahr an einer klinisch bedeutsamen psychischen Störung leidet. Die häufigsten Erkrankungsformen sind Angststörungen (14,0 % der Gesamtbevölkerung), Schlafstörungen (7,0 %), unipolare Depressionen (6,9 %), psychosomatische Erkrankungen (6,3 %), Alkohol- und Drogenabhängigkeit (> 4 %), Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätsstörungen (5 % aller Kinder und Jugendlichen), und Demenzen (1 % bei 60-65 Jährigen bis 30 % bei Personen über 85 Jahren.
Depressionen, Demenzen, Alkoholabhängigkeit und Schlaganfall sind zusammen für 26,6 % der gesellschaftlichen Gesamtbelastung durch Krankheiten in der EU verantwortlich. Dabei beschäftigen sich die ForscherInnen nicht mit den u.a. von Dörner geäußerten Zweifeln am Krankheitswert mancher Angststörung etc.
Die ForscherInnengruppe stellt in beiden Jahren fest, dass höchstens ein Drittel aller Betroffenen in der EU irgendeine Form professioneller Aufmerksamkeit oder eine Therapie erhalte. Zur verbreiteten Unterversorgung gehört auch, dass eine Behandlung meist erst Jahre nach Krankheitsbeginn beginnt und oft nicht den minimalen Anforderungen an eine adäquate Therapie entspricht.
Bei der Prävalenz sieht es beim Zeitvergleich zunächst nach einer kräftigen Zunahme aus: 2005 wurde sie auf 27,4 % und 2010/11 auf 38,2 % geschätzt. Doch bereits im Satz und Abschnitt nach dieser Schätzung rücken die ForscherInnen den Sachverhalt doppelt zurecht: "The 2005 report estimate was based on a restricted number of 13 diagnostic groups, restricted to age groups 18-65, and highlighted to be an extremely conservative estimate. The present report adds a total of 14 additional diagnoses, now more appropriately reflecting the true size of mental disorders across all age groups. No indications were found for increasing or decreasing rates of mental disorders from 2005 to 2011 when exactly the same diagnoses are considered (27.4% in 2005 vs. 27.1% in 2011). Thus, the apparent increase in prevalence is entirely due to including additional diagnoses." (668)
Auch hier zeigen sich also bei allem Ernst der Unterdiagnostik, Fehl- oder Unterversorgung von psychisch Kranken in praktisch allen EU-Ländern keine Anzeichen für eine stattgefundene oder sich hörbar ankündigende "Explosion" der Prävalenz psychischer Erkrankungen.
Allen in ihrer Performanz vergleichbaren Behauptungen oder "plausiblen" Annahmen über die Entwicklung anderer Krankheiten sollte nach diesen beiden Großbeispielen grundsätzlich mit Skepsis und Zweifeln begegnet werden - bis methodisch anspruchsvolle empirische Belege vorliegen. Zusätzlich verdient die kritische Auseinandersetzung mit Behauptungen, deren Härte lediglich durch die gebetsmühlenartige Wiederholung durch die unterschiedlichen, massiv interessierten aber zum Teil durchaus ehrenhaften Angehörigen der oben genannten Allianz mehr Aufmerksamkeit als bisher.
Eine Langfassung des Aufsatzes "Prevalence of Obesity and Trends in Body Mass Index Among US Children and Adolescents, 1999-2010" von Ogden CL, Carroll MD, Kit BK und Flegal KM ist im Onlinebereich des "Journal of the American Medical Association (JAMA)" am 17. Januar 2012 veröffentlicht und bisher kostenlos erhältlich.
Dies gilt auch für den Aufsatz "Prevalence of Obesity and Trends in the Distribution of Body Mass Index Among US Adults, 1999-2010" derselben Autorinnen.
Der ECNP/EBC REPORT 2011 "The size and burden of mental disorders and other disorders of the brain in Europe 2010" von H.U. Wittchen et al. ist in der Fachzeitschrift "European Neuropsychopharmacology" (2011 [21]: 655-679) erschienen und komplett kostenlos über die Website der TU-Dresden erhältlich.
Bernard Braun, 24.1.12
Aufwand an körperlicher Aktivität, um langfristig das Normalgewicht zu halten, ist höher als erwartet
 Regelmäßige körperliche Bewegung gilt neben einer "vernünftigen" Ernährung als ein wichtiger Einflussfaktor, um das Körpergewicht langfristig im Normalbereich zu halten und als Garant für einen substantiellen gesundheitlichen Nutzen. Mehrere Leitlinien empfehlen, sich dafür wenigstens 150 Minuten pro Woche moderat bis intensiv zu bewegen - dies entspricht 7,5 sogenannter "metabolic equivalent" ("MET") Stunden pro Woche. Reichen aber etwas mehr als täglich 20 Minuten dauerndes Walking, strammes Spazierengehen oder Joggen wirklich für den genannten Nutzen aus? Eine der ernüchternden Antworten aus einer gerade abgeschlossenen Studie in den USA lautet: Nein und es bedarf weiterer Voraussetzungen für den Erfolg.
Regelmäßige körperliche Bewegung gilt neben einer "vernünftigen" Ernährung als ein wichtiger Einflussfaktor, um das Körpergewicht langfristig im Normalbereich zu halten und als Garant für einen substantiellen gesundheitlichen Nutzen. Mehrere Leitlinien empfehlen, sich dafür wenigstens 150 Minuten pro Woche moderat bis intensiv zu bewegen - dies entspricht 7,5 sogenannter "metabolic equivalent" ("MET") Stunden pro Woche. Reichen aber etwas mehr als täglich 20 Minuten dauerndes Walking, strammes Spazierengehen oder Joggen wirklich für den genannten Nutzen aus? Eine der ernüchternden Antworten aus einer gerade abgeschlossenen Studie in den USA lautet: Nein und es bedarf weiterer Voraussetzungen für den Erfolg.
In dieser Studie, einer zwischen 1992 und 2007 durchgeführten Längsschnittstudie, wurde bei 34.079 gesunden US-Frauen, die im Durchschnitt 54 Jahre alt waren, etwas genauer und über einen längeren Zeitraum untersucht, welcher Aufwand an körperlicher Aktivität zu welchen Ergebnissen bei der Gewichtszunahme führte. Die Teilnehmerinnen ernährten sich im Untersuchungszeitraum normal, d.h. ohne eine bestimmte Diät.
Dazu wurde bei den Frauen zu Beginn der Studie und dann nach 3, 6, 8, 10, 12 und 13 Jahren der Umfang ihrer körperlichen Aktivitäten und ihr Körpergewicht erfasst. Die Studienteilnehmerinnen wurden in drei Gruppen mit unterschiedlichem Bewegungsniveau eingeteilt: Weniger als 7,5, 7,5 - 21, 21 und mehr MET-Stunden pro Woche. Dabei entsprechen 21,5 MET in etwa 60 Minuten körperlicher Bewegung pro Tag.
Die Ergebnisse der Kohortenstudie sehen folgendermaßen aus:
• Die Frauen nahmen durchschnittlich um 2,6 Kilogramm zu.
• Die einzige Teilgruppe, deren Gewicht in den 15 Jahren um weniger als 2,3 kg zugenommen hatte, waren 4.540 Frauen (13,3%), deren Gewicht beim Studienstart auf der BMI-Wertskala unter 25 lag und die sich während der gesamten Studienzeit durchschnittlich 60 Minuten pro Tag körperlich aktiv verhalten hatten - also deutlich länger als in den bisherigen Leitlinien auch zur Gewichtsregulierung empfohlen wird.
• Bei den Studienteilnehmerinnen mit einem BMI zwischen 25 und 29,9 und den Adipösen mit einem BMI von 30 und mehr Punkten gab es keine signifikanten Zusammenhänge zwischen Gewichtsveränderungen und zeitlichem Umfang körperlicher Aktivitäten.
Für den Einfluss der körperlichen Bewegung auf die Gewichtszunahme gab es zwar auch bei Zeiten unter 7,5 MET und zwischen 7,5 und 20,9 MET pro Woche unterscheidbare Wirkungen. Die Effekte in beiden Gruppen waren zwar gegenüber dem Effekt in der Gruppe mit mehr als 21 MET signifikant geringer und belegen damit eine Art Dosis-Wirkungsbeziehung. Die Unterschiede der Gewichtszunahme zwischen den beiden Gruppen mit geringerer körperlicher Bewegung waren aber zu gering, als dass der Unterschied zwischen ihnen als statistisch signifikant zu bewerten wäre.
Ein gewisses Maß an körperlicher Bewegung und vor allem die immer wieder in Leitlinien als wirkungsvoll empfohlene durchschnittliche Zeitdauer von 150 Minuten pro Woche ist nach den Ergebnissen dieser Studie zu gering, um bei sich normal ernährenden Personen eine langfristige Gewichtszunahme zu verhindern. Erfolge können mit einem rund dreifach höheren Aufwand pro Tag und dann auch nur bei normalgewichtigen Frauen erreicht werden. Bei Frauen mit einem BMI von über 25 muss für langfristige Wirkungen auf die Zunahme ihres Gewichts zusätzlich zur ebenfalls möglichst längeren Dauer körperlicher Bewegung eine Reduktion der Kalorienaufnahme erfolgen.
Ein kostenloses Abstract des Aufsatzes ist hier erhältlich: Lee IM, Djoussé L, Sesso HD, Wang L, Buring JE. (2010): Physical activity and weight gain prevention (JAMA 2010 Mar 24;303(12):1173-9).
Die Ergebnisse der Studie von Lee et al. bestätigen im Übrigen Ergebnisse einer anderen Untersuchung zur Wirkung einer Kombination körperlicher Aktivitäten mit kalorienreduzierter Diät auf übergewichtige Frauen aus dem Jahr 2008.
An ihr nahmen zwischen Ende 1999 und Ende 2003 insgesamt 201 übergewichtige bis adipöse junge bis mittelaltrige Frauen teil (BMI 27 bis 40). Eines der wichtigen Ergebnisse der Studie war dann, dass Kalorienreduktion allein nicht zu einer nachhaltigen Gewichtsabnahme der übergewichtigen Teilnehmer führte. Eine anhaltende Abnahme des Gewichts von mehr als 10% des Ausgangsgewichts zeigte sich am Ende des zweijährigen Interventionszeitraums nur bei den Teilnehmerinnen, die sich zusätzlich zu ihrer Diät noch mindestens 275 Minuten pro Woche körperlich bewegten. Auch bei durchweg übergewichtigen Frauen würde also der eingangs genannte Bewegungs-Aufwand von 20 Minuten pro Tag nicht zu der erhofften Wirkung führen.
Ein kostenloses Abstract ist hier erhältlich: John M. Jakicic; Bess H. Marcus; Wei Lang; Carol Janney: Effect of Exercise on 24-Month Weight Loss Maintenance in Overweight Women (Arch Intern Med, 2008;168[14]:1550-1559)
Ebenfalls kostenlos ehält man den kompletten Aufsatz
Bernard Braun, 3.6.10
Der Body-Mass-Index (BMI): Deutsche Längsschnittstudie stellt seine Aussagekraft in Frage
 In einer Vielzahl epidemiologischer Studien wurde bislang der Body-Mass-Index (BMI) verwendet. Eine deutsche Längsschnitt-Studie mit zwei verschiedenen Stichproben und insgesamt etwa 10.500 Teilnehmern hat jetzt überprüft, welche Aussagekraft unterschiedliche Indikatoren haben, die zur Erfassung von Übergewicht Verwendung finden. Dabei zeigte sich, dass das Verhältnis von Taillenumfang zur Körpergröße (Waist to Height Ratio, "WHtR") mehrere Krankheits-Indikatoren am besten vorhersagt. Für den Body-Mass-Index zeigte sich in der Studie sogar das paradox anmutende Ergebnis, dass jene Gruppe in der Stichprobe mit dem höchsten BMI deutlich niedrigere Erkrankungsrisiken aufweist.
In einer Vielzahl epidemiologischer Studien wurde bislang der Body-Mass-Index (BMI) verwendet. Eine deutsche Längsschnitt-Studie mit zwei verschiedenen Stichproben und insgesamt etwa 10.500 Teilnehmern hat jetzt überprüft, welche Aussagekraft unterschiedliche Indikatoren haben, die zur Erfassung von Übergewicht Verwendung finden. Dabei zeigte sich, dass das Verhältnis von Taillenumfang zur Körpergröße (Waist to Height Ratio, "WHtR") mehrere Krankheits-Indikatoren am besten vorhersagt. Für den Body-Mass-Index zeigte sich in der Studie sogar das paradox anmutende Ergebnis, dass jene Gruppe in der Stichprobe mit dem höchsten BMI deutlich niedrigere Erkrankungsrisiken aufweist.
Der Body-Mass-Index war lange Zeit die mit Abstand wichtigste Kennzahl zur Abschätzung von Übergewicht und Adipositas und damit zusammenhängenden Erkrankungsrisiken. Er fand in praktisch allen nationalen und internationalen Erhebungen Verwendung. Der BMI wird so errechnet: Körpergewicht in kg dividiert durch Körpergröße zum Quadrat. 1996 führte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) folgende Grenzwerte weltweit verbindlich ein: BMI größer als 25: Übergewicht, BMI größer als 30: Adipositas. Der BMI, so nahm man an, kann als Schätzwert verwendet werden, da ein relativ hoher Zusammenhang mit dem Fettanteil an der Körpermasse besteht. In letzter Zeit wurden jedoch zunehmend Zweifel laut an der Aussagekraft des BMI.
Studien hatten gezeigt, dass zumindest leichtes Übergewicht (BMI 25-30) kein erhöhtes Mortalitätsrisiko mit sich bringt, sondern im Gegenteil sogar vorteilhaft ist für die Lebenserwartung. Allerdings gilt dies nicht für Adipositas. (vgl. Ein bisschen rund und Erneut zeigt eine Studie). Anhand von zwei deutschen Längsschnitt-Untersuchungen wurde jetzt einmal geprüft, wie aussagekräftig auch andere Indikatoren zur Erfassung von Übergewicht sind.
Dabei handelte es sich einmal um knapp 6.400 Teilnehmer an der DETECT-Studie (Diabetes Cardiovascular Risk-Evaluation: Targets and Essential Data for Commitment of Treatment), bei der Patienten eingeschlossen waren, die an einem festgelegten Tag im September 2003 eine Allgemein-Arzt-Praxis besuchten. Daten dieser Patienten wurden im Durchschnitt 3,3 Jahre lang beobachtet. Die zweite Studie mit Namen "SHIP - Study of Health In Pomerania" (SHIP) umfasste 4.300 Teilnehmer im Nordosten Deutschlands (Pommern), die im Durchschnitt 8,5 Jahre im Hinblick auf kritische Krankheits-Ereignisse verfolgt wurden.
Als solche kritischen Ereignisse wurden ein Herzinfarkt, Schlaganfall und auch Todesfälle wegen solcher kardiovaskulärer Erkrankungen in den späteren Analysen berücksichtigt. Als unterschiedliche Indikatoren zur Vorhersage dieser Ereignisse verglichen die Wissenschaftler miteinander:
• das Verhältnis Taillenumfang zu Körpergröße, (Waist to Height Ratio, WHtR)
• den Taillenumfang (waist circumference, WC)
• das Verhältnis Taillenumfang zu Hüftumfang (Waist to Hip Ratio, WHR)
• den Body-Mass-Index (BMI).
In Analysen, bei denen eine große Zahl anderer denkbarer Einflussfaktoren statistisch mitberücksichtigt wurde (unter anderem Alter, Geschlecht, Bildungsniveau, beruflicher Status, Familienstand, Rauchen, körperliche Bewegung, Krebs- und andere Erkrankungen), zeigte sich dann, dass der Indikator Taillenumfang dividiert durch Körpergröße die beste Vorhersagekraft hatte, was spätere Herz-Kreislauferkrankungen und Todesfälle anbetrifft. Die Wissenschaftler hatten dazu alle Teilnehmer vier gleich großen Gruppen zugeordnet, je nachdem welchen Wert ihre Übergewichts-Indikatoren aufwies. Es wurden also vier Gruppen gebildet mit unterschiedlichem WHtR, WHR, WC und BMI, wobei die jeweils erste Gruppe diejenige mit den niedrigsten werten war.
Dann zeigten sich folgende unterschiedliche Risiken für Sterbefälle aufgrund von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, jeweils im Vergleich oberstes Viertel (höchste Werte) zu unterstes Viertel: WHtR: 2,75 - WC: 1,74 - WHR: 1,71 - BMI: 0,74. Das heißt, Teilnehmer mit den höchsten WHtR-Werten hatten ein 2,75mal so hohes Risiko, im Beobachtungszeitraum an Herzinfarkt oder Schlaganfall zu sterben wie Teilnehmer mit den niedrigsten Werten. Für Erkrankungen zeigten sich ähnliche Unterschiede der Übergewichts-Indikatoren, auch hier war der BMI wenig aussagekräftig.
Der Wert von 0,74 für den BMI zeigt sogar das paradoxe Ergebnis, dass Teilnehmer mit den höchsten BMI-Werten ein niedriges Sterberisiko aufwiesen im Vergleich zu Teilnehmern mit den niedrigsten BMIs. Die Forscher erklären dies daraus, dass ihre Stichprobe nicht repräsentativ ist für die BMI-Verteilung. Personen mit ausgeprägter Adipositas und sehr hohen BMI-Werten sind nur sehr schwach in der Stichprobe vertreten. Exakt für diese Gruppen hatten sich jedoch in früheren Studien besonders hohe Sterbe- und Erkrankungs-Risiken gezeigt. Es bleibt also abzuwarten, ob auch in zukünftigen Studien mit ausgewogenerer Zusammensetzung des BMI diese Ergebnisse sich bestätigen. Und abzuwarten bleibt auch, ob die von den Wissenschaftlern diskutierten kritischen Werte für den Indikator WHtR sich durchsetzen. Vorgeschlagen werden hier als gesundheitsriskante Werte im Alter unter 40 WHtR höher als 0,5, Alter über 50 WHtR höher als 0,6.
Hier ist ein Abstract: Harald J. Schneider et al: The Predictive Value of Different Measures of Obesity for Incident Cardiovascular Events and Mortality
(J Clin Endocrin Metab. First published ahead of print February 3, 2010 as doi:10.1210/jc.2009-1584)
Gerd Marstedt, 7.3.10
Meta-Analyse: Vermeidung von Übergewicht bei Schulkindern ist durch Interventionen möglich, Abbau von Übergewicht bislang nicht
 Übergewicht und Fettsucht treten immer häufiger bereits bei Kindern und Jugendlichen auf und haben große Aussagekraft auch für das Fortbestehen dieser gesundheitlich riskanten Bedingungen im Erwachsenenalter. Daher haben schulbasierte Interventionsprogramme gegen Adipositas eine wachsende Bedeutung für die Prävention und das Management der beiden Risikofaktoren. Die Ergebnisse der jüngsten Meta-Analyse von methodisch fundierten Studien aus den Jahren 1995 bis 2007, die sich mit schulbasierten Interventionen gegen das kindliche oder jugendliche Übergewicht beschäftigten, wurden jetzt veröffentlicht.
Übergewicht und Fettsucht treten immer häufiger bereits bei Kindern und Jugendlichen auf und haben große Aussagekraft auch für das Fortbestehen dieser gesundheitlich riskanten Bedingungen im Erwachsenenalter. Daher haben schulbasierte Interventionsprogramme gegen Adipositas eine wachsende Bedeutung für die Prävention und das Management der beiden Risikofaktoren. Die Ergebnisse der jüngsten Meta-Analyse von methodisch fundierten Studien aus den Jahren 1995 bis 2007, die sich mit schulbasierten Interventionen gegen das kindliche oder jugendliche Übergewicht beschäftigten, wurden jetzt veröffentlicht.
Sie sehen zusammengefasst so aus:
• (1) Programme, die weniger als 6 Monate liefen, brachten für die TeilnehmerInnen gegenüber den NichtteilnehmerInnen keinen statistisch signifikant höheren Nutzen. Dauerten sie länger als 6 Monate, waren schulische Interventionen aber durchaus erfolgreich bei der Prävention von Übergewicht,
• (2) Längerfristig angelegte Maßnahmen (über ein Jahr) sind deutlich effektiver als kurzfristige.
• (3) Während die Vermeidung von Übergewicht teilweise gelingt, ist ein solcher Erfolg leider nicht feststellbar für eine deutliche Reduktion von bereits eingetretener und mit dem Body Mass Index (BMI) gemessener Fettleibigkeit.
• (4) Sofern analysierbar, senken Kombinationen von Maßnahmen, wie etwa verstärkte körperliche Aktivitäten zusammen mit Lehreinheiten über das Übergewicht im Schulunterricht, die Prävalenz kindlichen Übergewichts signifikant.
Von den zunächst 41 Studien, welche die WissenschaftlerInnen gefunden hatten, wurden am Ende 19 in die Metaanalyse einbezogen. Drei Studien waren Follow-up-Studien. Die einbezogenen Studien umfassten allgemein drei Ziele: Verringerung des Übergewichts durch die Zunahme körperlicher Aktivitäten, Verringerung der sitzenden Tätigkeiten und eine Verringerung der Aufnahme fett- und zuckerhaltiger Nahrungsmittel. Die Interventionen erfolgten in der Regel mehrgleisig. Neben dem Angebot gesünderer Lebensmittel in den Schulen oder einer intensiveren Form des Schulsports spielten Veränderungen in der Umgebung der Schulen und die Einbeziehung von Eltern wichtige ergänzende Rollen. Die Interventionsprogramme dauerten teilweise weniger als 6 Monaten und reichten bis zu mehr als 2 Jahren.
Nachteilig wirkt sich auf die Aussagekraft und die Möglichkeit, künftige Interventionen noch wirksamer zu machen, die nicht ohne weiteres mögliche Kontrolle weiterer Faktoren wie des Alters der teilnehmenden Schulkinder, des Engagements der Eltern, der Schulkulturen oder der Compliance gegenüber der Intervention aus.
Hier ist ein Abstract: Consuelo Gonzalez-Suarez et al: School-Based Interventions on Childhood Obesity: A Meta-Analysis (American Journal of Preventive Medicine, 2009; 37 (5): 418-427)
Bernard Braun, 11.2.10
Eltern übergewichtiger oder adipöser Kinder unterschätzen die Übergewichts-Problematik ihres Kindes massiv
 Väter oder auch Mütter von übergewichtigen oder adipösen Kindern nehmen in vielen Fällen nicht wahr, dass ihr Kind weniger Gewicht auf die Waage bringen sollte. In einer jetzt veröffentlichten niederländischen Studie sollten über 800 Väter und Mütter von insgesamt 439 Kindern (Alter 4-5 Jahre) ein Urteil abgeben, und zwar sowohl mit Worten als auch anhand von Vergleichsbildern, wie es mit dem Körpergewicht ihres Kindes aussieht. Dabei wurde deutlich, dass bei einem hohen Body Mass Index des Kindes Eltern gleichwohl in der Mehrzahl dazu neigten, ihr Kind als normalgewichtig einzustufen.
Väter oder auch Mütter von übergewichtigen oder adipösen Kindern nehmen in vielen Fällen nicht wahr, dass ihr Kind weniger Gewicht auf die Waage bringen sollte. In einer jetzt veröffentlichten niederländischen Studie sollten über 800 Väter und Mütter von insgesamt 439 Kindern (Alter 4-5 Jahre) ein Urteil abgeben, und zwar sowohl mit Worten als auch anhand von Vergleichsbildern, wie es mit dem Körpergewicht ihres Kindes aussieht. Dabei wurde deutlich, dass bei einem hohen Body Mass Index des Kindes Eltern gleichwohl in der Mehrzahl dazu neigten, ihr Kind als normalgewichtig einzustufen.
Bei der jetzt in der Zeitschrift "Acta Paediatrica" veröffentlichten Studie wurde Eltern von 4-5jährigen Vorschulkindern in der Provinz Groningen ein Fragebogen ausgehändigt, in dem sie eine Fülle von Angaben machen sollten: Zu Körpergröße und Gewicht ihres Kindes, diese Daten auch zu ihrer eigenen Person, Einschätzungen zum Körpergewicht des Kindes (zu schwer, ein wenig zu schwer, normal, ein wenig zu leicht, zu leicht), Vergleiche mit Umriss-Abbildungen über- und untergewichtiger Kinder, Einschätzungen, welchen Einfluss man auf das Essverhalten des Kindes hat, Fragen zum Gesundheitsverhalten (Bewegung, Ernährung usw.) und anderes mehr.
397 Mütter und 386 Väter beantworteten den Fragebogen. Der BMI von Elternteilen wie Kindern wurde errechnet anhand der elterlichen Angaben zu Körpergröße und Gewicht. Wesentliche Ergebnisse der Datenanalyse waren dann:
• Mütter wie Väter übergewichtiger und adipöser Kinder waren auch selbst öfter von dieser Problematik betroffen.
• Eltern nahmen diese Problematik bei sich selbst auch wahr. 83% der übergewichtigen Mütter und 78% solcher Väter gaben dies zu, bei adipösen Elternteilen war diese Selbstwahrnehmung noch deutlicher ausgeprägt (98% bzw. 96%).
• Wenn Eltern gebeten wurden, anhand verschiedener Schattenrisse mit den Umrissen übergewichtiger, untergewichtiger und normaler Kinder (vorgegeben wurden 7 verschiedene Abbildungen) ein Bild auszuwählen, das der Figur ihres Kindes am ähnlichsten ist, so neigten alle Befragten dazu, eine etwas schlankere Figur auszuwählen.
• Besonders stark ausgeprägt war diese Tendenz bei Eltern adipöser Kinder: Sie wählten in der Kartenreihe mit 7 Abbildungen (von stark übergewichtig links, in der Mitte normal, bis stark untergewichtig rechts) ein Bild aus, das um drei Positionen zu weit rechts lag, also eine viel zu schlanke Figur zeigte.
• Ähnliche Fehleinschätzungen ergaben sich bei einer verbalen Beurteilung des kindlichen Gewichts.
• Die Eltern der übergewichtigen und adipösen Kinder gaben an, dass ihre Kinder körperlich genau so aktiv wären wie andere und sie meinten auch, dass sie recht großen Einfluss hätten auf das Essverhalten ihres Kindes.
• Vier von fünf Elternteilen gaben an, dass sie gerne mehr Information oder Beratung bekommen möchten, falls ihr Kind Übergewicht haben sollte - dieses Interesse galt unabhängig vom realen und wahrgenommenen BMI des Kindes.
In der Diskussion der Befunde weisen die Wissenschaftler auf zweierlei hin: Zum einen läge bei Eltern übergewichtiger und noch mehr bei solchen adipöser Kinder eine dramatische Fehleinschätzung vor, was die Körperfülle und damit gesundheitliche Problematik ihres Kindes anbetrifft. Zum anderen sei jedoch ebenso bemerkenswert, dass sich in der Gesamtbevölkerung die Wahrnehmung dahingehend verschoben habe, dass ein höherer BMI jetzt als normal betrachtet wird.
Hier ist ein Abstract: HGM Oude Luttikhuis, RP Stolk, PJJ Sauer How do parents of 4- to 5-year-old children perceive the weight of their children? (Acta Pædiatrica, Volume 99 Issue 2, Pages 263 - 267, doi: 10.1111/j.1651-2227.2009.01576.x)
Gerd Marstedt, 1.2.10
Prävalenz von Übergewichtigkeit und Fettsucht bei US-Kindern und Erwachsenen 1999-2008: Eher relative Stabilität als Explosion
 "Immer mehr "Amerikaner" (US-Kinder, Jugendliche und Erwachsene) sind übergewichtig oder fettsüchtig und ihr Anteil nimmt in den letzten Jahren kontinuierlich und rasch zu!!!!!" Dieser Satz fände vermutlich in fast jeder Laien- und Expertenrunde spontane Zustimmung.
"Immer mehr "Amerikaner" (US-Kinder, Jugendliche und Erwachsene) sind übergewichtig oder fettsüchtig und ihr Anteil nimmt in den letzten Jahren kontinuierlich und rasch zu!!!!!" Dieser Satz fände vermutlich in fast jeder Laien- und Expertenrunde spontane Zustimmung.
Dass dies gar nicht so zustimmungsfähig und jedenfalls wesentlich differenziert ist, zeigen jetzt zwei im US-Fachjournal JAMA veröffentlichten Studien über Prävalenz und Trends von Obesity und einigen mit ihr assoziierten Indikatoren bei jugendlichen und erwachsenen US-Amerikanern in den Jahren 1999-2008 bzw. den Jahren 2007 und 2008.
Die Datenbasis war der "National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES)", in dem eine repräsentative Stichprobe der US-Bevölkerung regelmäßig nach ihrer Körpergröße und ihrem Gewicht gefragt werden. Verglichen wurden in beiden Studien Daten, die für den Zeitraum 1999 bis 2006 erhoben wurden mit Daten der Jahre 2007-08. Der Indikator für die Prävalenz von Übergewicht war ein Body Mass Index (BMI) von 25,0 bis 29,9 und für Fettsucht ein BMI von 30,0 oder höher. Unbestritten und vielfach u.a. durch die Daten des NHANES belegt ist, dass die Obesity-Prävalenz von 1976 bis 2000 in mehreren Schüben anstieg.
Aus den Daten von 5.555 Befragten erwachsenen, d.h. 20 Jahre alten und älteren US-BürgerInnen (bis 74 Jahre) ergibt sich zunächst ein beträchtlicher Anteil, der übergewichtig und vor allem fettsüchtig ist: 2007-2008 waren altersadjustiert insgesamt 33,8% der erwachsenen US-Amerikaner fettsüchtig. 32,2% der Männer und 35,5% der Frauen. In derselben Abfolge waren 68%, 72,3% und 64,1% übergewichtig oder fettsüchtig. Zu den Geschlechtsunterschieden kommen außerdem beträchtliche Unterschiede nach Rasse, ethnischer Zugehörigkeit und Alter. Auch ohne dass dies aus den Analysen der NHANES-Daten hervorgeht, kann man ähnlich gravierende Unterschiede auch zwischen den Angehörigen unterschiedlicher sozialer Schichten als gegeben ansehen.
Interessant ist danach aber die Untersuchung der Entwicklung von Übergewicht und Fettsucht in der Zeit, d.h. zwischen 1999/2000 und 2007/2008. Hier ergibt sich folgendes Bild:
• Sowohl bei Männern als bei Frauen gibt es in multivariaten, nach Alter, Ethnie und Rasse adjustierten Analysen keinen über die gesamte Zeit linearen und/oder statistisch signifikanten Trend.
• Bei Männern gibt es immerhin für den gesamten Zeitraum einen signifikanten linearen Trend, der aber bei differenzierterer Betrachtung ab 2003 nicht mehr existiert.
• Für die Gesamtheit der US-Frauen gibt es für diesen 10-Jahreszeitraum keinerlei statistisch signifikanten Unterschiede und folglich auch keinen signifikanten Trend. Dies schließt nicht aus, dass es auch bei Frauen Alters- oder Untergruppen nach Rasse oder Ethnie gibt, deren Gewichtsrisiko signifikant zunimmt.
• Die Fettsucht-Prävalenz erwachsener US-Amerikaner wuchs in den beiden davor liegenden 10-Jahreszeiträumen jeweils um rund 7 bis 8 Prozentpunkte. Im aktuellen Zeitraum wuchs dagegen die Prävalenz nur noch um 4,7 Prozentpunkte für Männer (signifikant) und 2,1 Prozentpunkte (nicht signifikant) für Frauen.
• "These data suggest that the increases in the prevalence of obesity previously observed between 1976-1980 and 1988-1994 and between 1988-1994 and 1999-2000 may not be continuing at a similar level over the period 1999-2008, particularly forwomen but possibly for men." Und die Daten legen den Schluss nahe, dass "the prevalence may have entered another period of relative stability, perhaps with small increases in obesity".
Nach Kenntnis dieser differenzierten Verhältnisse und vor allem ihrer Dynamik liegt die Frage nahe, ob die materielle Basis für die Zustimmung zur eingangs zitierten Trendaussage dann eben bei den unter 20-Jährigen US-Amerikanern zu finden ist.
Die Ergebnisse der auch mit Daten des NHANES durchgeführten Analyse des Niveaus und des Trends beim Übergewicht und der Fettsucht von 3.281 Kindern und Heranwachsenden im Alter von 2 bis 19 Jahren und 719 Kindern bzw. Kleinkindern von der Geburt bis zum zweiten Lebensjahr sehen so aus:
• Mit mehreren an die Gewichtsbedingungen von Kindern und Jugendlichen angepassten Indikatoren sind je nach Subgruppe bereits zwischen 9 und 32 % übergewichtig und/oder gar bereits fettsüchtig.
• Mit Ausnahme der schwersten Gruppe der 6- bis 19-jährigen männlichen Kinder und Jugendlichen gab es zwischen 1999 und 2008 bei keinem der gewählten Indikatoren und weder bei Jungs noch bei Mädchen einen statistisch signifikanten linearen Trend.
Die beiden Wissenschaftler-Teams halten trotz zahlreicher selbst eingeräumter Grenzen der Datenbasis ihrer Analysen an der Richtigkeit ihrer Trendanalysen fest. Ganz nebenbei relativieren sie schließlich noch die Brisanz der richtigen Beobachtung, die Prävalenz von Diabetes habe innerhalb der Zeiträume zugenommen und dahinter stecke doch der Übergewichtstrend. Hinter dem Gesamttrend stecken nur relativ wenige Subgruppen, deren Prävalenz erheblich zunahm und nicht ein Trend für sämtliche BürgerInnen.
Diese Analysen lassen eine Menge heißer Luft und selbsteinschüchternder Hoffnungslosigkeit vor scheinbar unaufhaltsamen Trends entweichen. Damit wird das Problem Übergewicht und Fettsucht keineswegs kleingeredet, sondern lediglich Raum für realistische und Erfolg versprechende Überlegungen zur Prävention des immer noch sehr hohen Problemniveaus geschaffen.
Insofern ist auch dem zusätzlich in dieser JAMA-Ausgabe veröffentlichten Kommentar des Bostoner Public Health-Experten J. Michael Gaziano zuzustimmen: "But even if these trends can be maintained, 68 percent of U.S. adults are overweight or obese, and almost 32 percent of school-aged U.S. children and adolescents are at or above the 85th percentile of BMI for age. Given the risk of obesity-related major health problems, a massive public health campaign to raise awareness about the effects of overweight and obesity is necessary. Such campaigns have been successful in communicating the dangers of smoking, hypertension, and dyslipidemia; educating physicians, other clinicians, and the public has yielded significant returns. Major research initiatives are needed to identify better management and treatment options. The longer the delay in taking aggressive action, the higher the likelihood that the significant progress achieved in decreasing chronic disease rates during the last 40 years will be negated, possibly even with a decrease in life expectancy."
Der Aufsatz "Prevalence and Trends in Obesity Among US Adults, 1999-2008" von Katherine M. Flegal; Margaret D. Carroll; Cynthia L. Ogden und Lester R. Curtin ist in JAMA vom 13. Januar 2010 online publiziert worden (2010;303 (3) doi:10.1001/jama.2009.2014) und komplett kostenlos erhältlich.
Der Aufsatz "Prevalence of High Body Mass Index in US Children and Adolescents, 2007-2008" von Cynthia L. Ogden, Margaret D. Carroll, Lester R. Curtin, Molly M. Lamb und Katherine M. Flegal ist in derselben Ausgabe des JAMA (doi:10.1001/jama.2009.2012) erschienen - kostenlos ist aber nur das Abstract erhältlich.
Den Kommentar "Fifth Phase of the Epidemiologic Transition: The Age of Obesity and Inactivity" von J. Michael Gaziano (JAMA. 2010;303(3):275-276) gibt es kostenlos leider nur in der Version mit den ersten 150 Worten.
Bernard Braun, 20.1.10
Ein bisschen rund ist zumindest nicht ungesund: Adipositas verkürzt die Lebenserwartung, leichtes Übergewicht nicht
 Für jene Gewichtsklasse, die mit einem Body Mass Index (BMI) von 25-30 noch unterhalb der Adipositas oder Fettleibigkeit liegt, aber schon oberhalb des "Normalgewichts", gab es in den letzten Jahren höchst widersprüchliche Meldungen im Hinblick auf damit verbundene Krankheits- und Sterberisiken. Große epidemiologische Studien gaben einerseits Entwarnung, dass leichtes Übergewicht gesundheitlich unproblematisch sei, wenn nicht sogar positiv zu bewerten. Andere Studien vermeldeten das Gegenteil: Schon geringfügige höhere Werte als ein BMI von 25 würden danach die Lebenserwartung verkürzen. Eine jetzt im Deutschen Ärzteblatt veröffentlichte systematische Übersichtsarbeit der Hamburger Wissenschaftler Matthias Lenz, Tanja Richter und Ingrid Mühlhauser hat auf der Basis von 27 Metaanalysen und 15 Kohortenanalysen gezeigt: "Die Gesamtmortalität bei Übergewicht (BMI 25 bis 29,9) ist im Vergleich zu Normalgewicht (BMI 18,5 bis 24,9) nicht erhöht. Demgegenüber ist sie für einzelne Erkrankungen erhöht, für andere vermindert oder unverändert."
Für jene Gewichtsklasse, die mit einem Body Mass Index (BMI) von 25-30 noch unterhalb der Adipositas oder Fettleibigkeit liegt, aber schon oberhalb des "Normalgewichts", gab es in den letzten Jahren höchst widersprüchliche Meldungen im Hinblick auf damit verbundene Krankheits- und Sterberisiken. Große epidemiologische Studien gaben einerseits Entwarnung, dass leichtes Übergewicht gesundheitlich unproblematisch sei, wenn nicht sogar positiv zu bewerten. Andere Studien vermeldeten das Gegenteil: Schon geringfügige höhere Werte als ein BMI von 25 würden danach die Lebenserwartung verkürzen. Eine jetzt im Deutschen Ärzteblatt veröffentlichte systematische Übersichtsarbeit der Hamburger Wissenschaftler Matthias Lenz, Tanja Richter und Ingrid Mühlhauser hat auf der Basis von 27 Metaanalysen und 15 Kohortenanalysen gezeigt: "Die Gesamtmortalität bei Übergewicht (BMI 25 bis 29,9) ist im Vergleich zu Normalgewicht (BMI 18,5 bis 24,9) nicht erhöht. Demgegenüber ist sie für einzelne Erkrankungen erhöht, für andere vermindert oder unverändert."
Die Mitteilungen für gesundheitsbewusste, aber leicht übergewichtige Personen waren in den letzten Jahren höchst widersprüchlich und verwirrend, auch wenn nur die Ergebnisse methodisch fundierter Studien mit sehr großen Stichproben beachtet wurden. Zwei Studien wurden im renommierten "New England Journal of Medicine" veröffentlicht: Eine 12jährige Kohortenstudie mit über 1,2 Millionen Koreanern (vgl.: Sun Ha Jee et al: Body-Mass Index and Mortality in Korean Men and Women) und eine 10jährige Kohortenstudie mit über 500.000 US-Amerikanern (vgl.: Kenneth F. Adams et al: Overweight, Obesity, and Mortality in a Large Prospective Cohort of Persons 50 to 71 Years Old). Beide Untersuchungen waren, auch unter Berücksichtigung des Gesundheitsrisikos Rauchen, zu dem Schluss gekommen, dass schon ein geringfügig höherer BMI als 25 auch mit einer höheren Gesamtsterblichkeit (unter Berücksichtigung verschiedenster Todesursachen) einhergeht.
Völlig konträr waren demgegenüber die Befunde anderer Studien aus den USA und Kanada (vgl. Erneut zeigt eine Studie: Leichtes Übergewicht (BMI 25-30) bringt kein erhöhtes Sterberisiko mit sich - im Gegenteil). Dort hatte sich unter anderem gezeigt: Untergewicht (mit einem BMI unter 18,5) ist mit einem um 73 Prozent erhöhten Sterberisiko verbunden, starke Adipositas (BMI > 35) mit einem um 36% erhöhten Sterberisiko, während für leicht Übergewichtige (BMI 25 bis unter 30) sich sogar ein um 17 Prozent niedrigeres Sterberisiko ergab.
Die jetzt veröffentlichte deutsche Übersichtarbeit sollte der Verwirrung ein Ende bereiten, denn die Datenbasis ist beeindruckend. Einbezogen wurden 27 Metaanalysen und 15 Kohortenanalysen, wobei die Metaanalysen ihrerseits 420 Einzelstudien umfassten. Fallkontroll- und Querschnittsstudien (sowie Metaanalysen mit solchen Studien) wurden ausgeschlossen. Die methodische Qualität der eingeschlossenen Studien wurde nach Cochrane-Kriterien dokumentiert.
Die zentralen Befunde der Analysen waren dann in der Zusammenfassung der Wissenschaftler selbst:
"• Übergewicht birgt für einige Erkrankungen ein erhöhtes, für andere ein vermindertes oder unverändertes Risiko.
• Bei Übergewicht ist die Gesamtsterblichkeit nicht erhöht. Sie ist für einzelne Erkrankungen erhöht, für andere vermindert oder unverändert.
• Adipositas birgt für mehr Erkrankungen ein erhöhtes, für weniger ein vermindertes oder unverändertes Risiko.
• Bei Adipositas ist die Gesamtmortalität um etwa 20 % erhöht, bei hochgradiger Adipositas können es mehr als
200 % sein.
• Die bisherige Annahme, Übergewicht berge gegenüber dem sogenannten Normalgewicht ein erhöhtes Morbiditäts-und Mortalitätsrisiko, muss spezifiziert werden." (Lenz, Richter, Mühlhauser 2009, S. 648)
Die Studie ist kostenlos als PDF-Datei verfügbar: Matthias Lenz, Tanja Richter, Ingrid Mühlhauser: Morbidität und Mortalität bei Übergewicht und Adipositas im Erwachsenenalter. Eine systematische Übersicht
Oder als HTML-Datei
Ferner gibt es als Supplement eine PDF-Datei mit altersspezifischen Ergebnissen
Gerd Marstedt, 30.11.09
Erneut zeigt eine Studie: Leichtes Übergewicht (BMI 25-30) bringt kein erhöhtes Sterberisiko mit sich - im Gegenteil
 Die Warnungen vor einer drohenden Übergewichts-"Epidemie" werden insbesondere in den USA und im United Kingdom immer lauter. Allerdings hat jetzt eine Studie erneut gezeigt, dass lediglich Untergewicht und schwere Adipositas ein erhöhtes Sterberisiko darstellen. Ein leichtes Übergewicht mit einem Body Mass Index (BMI) von 25 bis unter 30 zeigte nach den Ergebnissen der jetzt in der Zeitschrift "Obesity" veröffentlichten Studie hingegen sogar positive Effekte für die Lebenserwartung.
Die Warnungen vor einer drohenden Übergewichts-"Epidemie" werden insbesondere in den USA und im United Kingdom immer lauter. Allerdings hat jetzt eine Studie erneut gezeigt, dass lediglich Untergewicht und schwere Adipositas ein erhöhtes Sterberisiko darstellen. Ein leichtes Übergewicht mit einem Body Mass Index (BMI) von 25 bis unter 30 zeigte nach den Ergebnissen der jetzt in der Zeitschrift "Obesity" veröffentlichten Studie hingegen sogar positive Effekte für die Lebenserwartung.
Ein Forschungsteam aus den USA und Kanada hatte jetzt Daten der "National Population Health Survey" aus Kanada ausgewertet, einer Umfrage, an der sich im Jahre 1994/95 insgesamt 11.326 Kanadier im Alter von über 24 Jahren beteiligt hatten. In dieser Umfrage, die von der obersten statistischen Behörde Kanadas alle zwei Jahre durchgeführt wird, werden auch Angaben zu Körpergröße und Körpergewicht erfragt, aus denen dann der Body Mass-Index errechnet wird. Anhand des kanadischen Sterberegisters wurden dann Todesfälle bei diesen Teilnehmern über einen Zeitraum von 12 Jahren verfolgt.
In statistischen Analysen zeigte sich dann:
• Untergewicht mit einem BMI unter 18,5 ist mit einem um 73 Prozent erhöhten Sterberisiko verbunden,
• starke Adipositas (BMI > 35) mit einem um 36% erhöhten Sterberisiko.
• Leichte Adipositas hingegen (BMI 30 bis unter 35) zeigte im Vergleich zu Normalgewichtigen keinerlei Effekte
• und für leicht Übergewichtige (BMI 25 bis unter 30) ergab sich sogar ein um 17 Prozent niedrigeres Sterberisiko.
Eine US-amerikanische Studie, die in der Zeitschrift "Journal of the American Medical Association (JAMA)" schon im Jahr 2005 veröffentlicht worden war, hatte ein ähnliches Ergebnis gezeigt. Dort war anhand von Daten der "National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES)" der Zusammenhang von Übergewicht und Sterberisiko errechnet worden. Aus den Daten von drei Erhebungs-Wellen - NHANES I (1971-1975) und NHANES II (1976-1980) mit einer Kontrolle bis 1992, und NHANES III (1988-1994) mit einer Kontrolle bis zum Jahr 2000 - errechneten die Wissenschaftler für fünf Gewichtsgruppen das jeweilige Sterberisiko.
Dort zeigte sich, dass Untergewicht (BMI < 18,5) und auch Übergewicht (BMI > 30) mit einem erhöhten Risiko verbunden war. Für leichtes Übergewicht hingegen (BMI 25 bis unter 30) zeigten sich in ähnlicher Weise wie in der kanadischen Studie sogar Vorteile. Auch unter Berücksichtigung verschiedener Altersgruppen und weiterer Risikofaktoren (wie z.B. Rauchen) lag in diesen Gruppen das Sterberisiko deutlich niedriger. Für die Gruppe der Nie-Raucher im Alter von 25-59 Jahren mit einem BMI von 25-30 zum Beispiel beträgt das Sterberisiko 0,66, ist also 34 Prozent niedriger als bei Normalgewichtigen in diesem Alter.
Über die Ursachen dieser Ergebnisse herrscht noch Unklarheit, insbesondere darüber, wieso leichtes Übergewicht ein Vorteil für die Lebenserwartung sein könnte. Denkbar ist einerseits, dass leicht Übergewichtige medizinisch besser versorgt sind, weil sie öfter zum Arzt gehen und daher Symptome schwerer Erkrankungen eher erkannt werden. Möglich scheint aber auch, dass leicht Übergewichtige mehr Energiereserven haben, die eine bessere Rekonvaleszenz im Krankheitsfalle gewährleisten. Und schließlich sollte auch die Kritik hier berücksichtigt werden, die in letzter Zeit am Body Mass Index als Kennzeichen für Übergewicht und Adipositas geübt worden ist. Hervorgehoben wurde vielfach, dass Gesundheitsrisiken sehr viel stärker von der Körperfett-Verteilung (Bauchfett) abhängen als von den Indikatoren Gewicht und Körpergröße. Die Grenzziehung für ein "Normalgewicht" mit der Festlegung "BMI unter 25" wäre demnach eher willkürlich und nicht durch Studienergebnisse über gesundheitliche Folgen belegbar.
Kostenloses Abstract der kanadischen Studie: Heather M. Orpana et al: BMI and Mortality: Results From a National Longitudinal Study of Canadian Adults (Obesity (2009) doi:10.1038/oby.2009.191)
Kostenloser Volltext der US-Studie von 2005: Katherine M. Flegal et al: Excess Deaths Associated With Underweight, Overweight, and Obesity (JAMA. 2005;293:1861-1867)
Gerd Marstedt, 28.6.09
Englische und belgische Forscher interpretieren Daten von 27.000 Europäern: Übergewicht ist sozial ansteckend
 Wissenschaftler aus Belgien und England hoben jetzt hervor, dass Übergewicht und Adipositas sozial ansteckende Phänomene seien. Sie hatten herausgefunden, dass Menschen in vielerlei Hinsicht davon beeinflusst werden, welches Körpergewicht Leute in ihrer nächsten sozialen Umgebung haben. Davon hängt unter anderem ab, ob sie sich selbst als übergewichtig einstufen, welche Entscheidungen sie in Bezug auf ihre Ernährung treffen und wie sie ihr Äußeres in Relation zu Gleichaltrigen einstufen.
Wissenschaftler aus Belgien und England hoben jetzt hervor, dass Übergewicht und Adipositas sozial ansteckende Phänomene seien. Sie hatten herausgefunden, dass Menschen in vielerlei Hinsicht davon beeinflusst werden, welches Körpergewicht Leute in ihrer nächsten sozialen Umgebung haben. Davon hängt unter anderem ab, ob sie sich selbst als übergewichtig einstufen, welche Entscheidungen sie in Bezug auf ihre Ernährung treffen und wie sie ihr Äußeres in Relation zu Gleichaltrigen einstufen.
Die Wissenschaftler stellten ihre Forschungsergebnis jetzt auf einer gesundheitsökonomischen Konferenz in Massachusetts, USA, vor. Basis ihrer Untersuchung waren Daten über 27.000 Bürger aus 29 europäischen Ländern, die aus verschiedenen Erhebungen stammen: Eurobarometer (Europäische Kommission), Sozio-ökonomisches Panel des DIW Berlin (Deutschland), National Child Development Study (UK), British Cohort Study und Health Survey of England.
Als Ergebnis zeigte sich zunächst, dass fast die Hälfte der Frauen, aber weniger als ein Drittel der Männer in Europa sich als übergewichtig bezeichnen. Dabei wurde deutlich, dass Männer und Frauen unbewusst beeinflusst werden von der Körperfülle der Menschen im nächsten sozialen Umfeld. Studienteilnehmer mit einem höheren Bildungsniveau sind sich selbst gegenüber kritischer: Völlig unabhängig von ihrem tatsächlichen Body Mass Index (BMI) bewerten sie sich häufiger als übergewichtig im Vergleich zu Menschen mit niedrigem Schulabschluss. Und es gibt deutliche Geschlechtsunterschiede: Europäische Frauen fühlten sich häufiger "zu dick", ganz unabhängig von ihrem Body Mass Index. Darüber hinaus wird die Unzufriedenheit mit dem Körpergewicht auch beeinflusst von den Durchschnittswert im jeweiligen Land.
Andrew J. Oswald, einer der beteiligten Forscher, erklärte: "Eine große Zahl von Forschungsstudien, die Übergewicht und Adipositas als Folge von mangelnder Bewegung, häufigem Sitzen, Erbanlagen oder auch der zunehmenden Fast-Food-Kultur untersucht haben, haben den zentralen Punkt übersehen: die sozialen Einflussfaktoren. Übergewicht und Adipositas müssen als soziales, und nicht als physiologisches Phänomen verstanden werden. Menschen werden in ihrem Verhalten sehr stark beeinflusst durch Vergleiche, die sie in ihrem sozialen Umfeld anstellen. Und dabei haben sich Normen verändert und sind immer noch im Fluss."
Die Studie (32 Seiten) ist hier als PDF-Datei verfügbar: David G. Blanchflower, Andrew J. Oswald, and Bert Van Landeghem: "Imitative Obesity and Relative Utility" (Prepared for the NBER Summer Institute on Health Economics, July 25, 2008)
Bereits vor einiger Zeit hatten US-amerikanische Sozialstatistiker aus Boston, Cambridge und San Diego erklärt, dass soziale Normen und Wertmaßstäbe weitaus bedeutsamer für die Entstehung von Übergewicht sind als Erbanlagen. Sie fanden mit Daten der "Framingham-Studie" heraus, dass das Übergewichts-Risiko um bis zu 171 Prozent höher liegt, wenn engere Freunde ebenfalls übergewichtig sind. Die Forscher interpretieren ihre Befunde als Effekt der Verbreitung von Normen und Wertmaßstäben in sozialen Netzwerken. Die psychosozialen Mechanismen der Verbreitung von Übergewicht beruhten dabei jedoch weniger auf einer Nachahmung von Verhaltensweisen als sehr viel mehr auf Änderungen in der generellen Wahrnehmung einer Person, was die gesellschaftliche Akzeptanz von Übergewicht anbetrifft. vgl.: Ganz dicke Freundschaften - Übergewicht wird beeinflusst von Normen im sozialen Netzwerk einer Person
Gerd Marstedt, 28.7.2008
Übergewicht und Fettleibigkeit bei jungen Erwachsenen in Großbritannien: So früh wie möglich in der Kindheit intervenieren.
 Trotz aller Kenntnisse über die Häufigkeit und das Neuauftreten von Fettleibigkeit in weiten Teilen Europas und Nordamerikas, weiß man relativ wenig über ihre Entstehungspfade. Da die Mehrheit der leicht bis mittel (BMI 25-30) oder stark Übergewichtigen (BMI über 30) dies nicht ab Geburt ist, lautet die vor allem auch für präventive Interventionen wichtige Frage, in welchem Alter der Übergang vom Normal- zum Übergewicht eigentlich erfolgt.
Trotz aller Kenntnisse über die Häufigkeit und das Neuauftreten von Fettleibigkeit in weiten Teilen Europas und Nordamerikas, weiß man relativ wenig über ihre Entstehungspfade. Da die Mehrheit der leicht bis mittel (BMI 25-30) oder stark Übergewichtigen (BMI über 30) dies nicht ab Geburt ist, lautet die vor allem auch für präventive Interventionen wichtige Frage, in welchem Alter der Übergang vom Normal- zum Übergewicht eigentlich erfolgt.
Hierzu gibt eine in Großbritannien bereits vor einigen Jahren durchgeführte 5-Jahres-Längsschnittstudie, die so genannte "Health and behaviour in teenagers study (HABITS)", differenzierte Auskunft.
In dieser 1999 gestarteten Studie wurde eine Gruppe von 5.863 zufällig an 36 Londoner Schulen ausgesuchten Schüler im Alter von 11-12 Jahren für 5 Jahre hinsichtlich ihrer Lebensumstände und ihrer Gewichtsentwicklung beobachtet.
Die wichtigsten Ergebnisse geben wichtige Einblicke in die Art und Dynamik der Entstehungspfade von Übergewichtsproblemen:
• Im Alter von 11-12 Jahren waren fast 25 % der untersuchten Schüler übergewichtig oder fettleibig. Der Anteil der Mädchen war mit 29 % höher, der von Schülern aus unteren sozialen Schichten mit 31 % noch etwas höher. Schwarze Mädchen wiesen mit 38 % den höchsten Anteil von nicht Normalgewichtigen aus.
• In der Zeit der Adoleszenz fanden sich in der Londoner Studie nur noch wenige neu auftretende Fälle von Übergewicht, genauso wenig wie es übergewichtigen Heranwachsenden in nennenswertem Umfang gelang wieder ein Normalgewicht zu erreichen.
• Was zunahm war der Anteil von Fettleibigen auf Kosten des Anteils der Übergewichtigen.
• Auch die soziale Ungleichverteilung der Gewichtsprobleme nahm während der Phase des Heranwachsens nicht mehr zu, blieb aber auch eindeutig erhalten.
• Schwarze Mädchen wiesen auch nach Durchlaufen der Adoleszenz die höchsten Häufigkeiten an Übergewicht und Fettleibigkeit auf. Der Wert war zweimal so hoch wie bei weißen Mädchen bzw. jungen Frauen. Die Studie bestätigte auch das bisher kaum erklärte Phänomen, dass schwarze Jungen oder junge Männer eine wesentlich geringere Übergewichtshäufigkeit aufweisen als schwarze Mädchen bzw. junge Frauen.
Trotz einiger methodischer Begrenztheiten der Studie (z.B. lediglich Schüler aus der Großstadt) zeigen die Ergebnisse der Studie nach Meinung der ForscherInnen, dass sich hartnäckiges Übergewicht oder Fettleibigkeit bereits im Alter unter 11 Jahren etabliert. Erfolgreiche Präventionsstrategien sollten daher schon in diesem Altersbereich ansetzen.
Der gesamte Aufsatz "Development of adiposity in adolescence: five year longitudinal study of an ethnically and socioeconomically diverse sample of young people in Britain" von Jane Wardle, Naomi Henning Brodersen, Martin J Jarvis und David R Boniface ist 2006 (5. Mai 2006) im "British Medical Journal (BMJ)" erschienen und als PDF-Datei kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 14.7.2008
Eigenes Übergewicht wird heute von Briten seltener als Gewichtsproblem wahrgenommen als früher
 Obwohl Übergewicht und Adipositas fast täglich in den Medien als Gesundheitsrisiko auftauchen und obwohl die Zahl der Übergewichtigen und Fettleibigen in den letzten Jahren massiv zugenommen hat, sinkt - zumindest in Großbritannien - die Zahl derjenigen, die ihr eigenes Körpergewicht auch korrekt einschätzen und das Problem Übergewicht sich selbst gegenüber zugeben.
Obwohl Übergewicht und Adipositas fast täglich in den Medien als Gesundheitsrisiko auftauchen und obwohl die Zahl der Übergewichtigen und Fettleibigen in den letzten Jahren massiv zugenommen hat, sinkt - zumindest in Großbritannien - die Zahl derjenigen, die ihr eigenes Körpergewicht auch korrekt einschätzen und das Problem Übergewicht sich selbst gegenüber zugeben.
Basis der Studie, die jetzt in der Zeitschrift "British Medical Journal" veröffentlicht wurde, sind zwei repräsentative Bevölkerungsumfragen in Großbritannien aus den Jahren 1999 und 2007. Dort wurden in beiden Jahren jeweils mehr als 1.800 Männer und Frauen neben sozialstatistischen Daten auch nach ihrem Körpergewicht und ihrer Körpergröße befragt und sie sollten ihr Gewicht in einer von 5 Gruppen einstufen: starkes Untergewicht, eher Untergewicht, ungefähr Normalgewicht, eher Übergewicht, starkes Übergewicht.
Als zentrales Ergebnis zeigte sich, dass im Zeitverlauf der beiden Erhebungsjahre das selbst berichtete Körpergewicht deutlich zunahm und ebenso auch der aus den Angaben der Befragungsteilnehmer errechnete Body Mass Index. So stieg das selbst berichtete Körpergewicht im Durchschnitt von 71,9 kg auf 74,9 kg - bei Männern und Frauen, wobei in beiden Gruppen eine Zunahme von etwa 3 kg zu beobachten war. Ähnliche Zuwächse (etwa um 1,5 bis 2,0) zeigten sich auch für den BMI.
Trotz dieser eindeutigen Tendenz einer Gewichtszunahme in den Teilnehmer-Aussagen zeigte sich jedoch nicht, dass auch in gleichem Ausmaß eine korrekte Bewertung des eigenen Übergewichts zu finden war. Während sich 1999 noch 81 Prozent der Übergewichtigen (BMI > 25) korrekt einstufte, waren es 2007 nur noch 75%.
Die Autoren führen diese Diskrepanz unter anderem darauf zurück, dass Übergewicht und Adipositas derzeit als gravierendes Gesundheitsproblem mit nicht unbeträchtlichen ökonomischen Implikationen diskutiert wird, und immer wieder auch individuelles Fehlverhalten (Ernährung, Bewegung) als Ursache in den Vordergrund gestellt wird. Von daher ist eine abnehmende Tendenz naheliegend, auch das (stigmatisierende) Label "Ich bin übergewichtig" zu akzeptieren. Gleichwohl ist dies ein gravierendes Public Health Problem, denn ohne eine solche Einsicht in gesundheitliche Risiken wird es auch kaum zu einer Motivation der Verhaltensänderung kommen. Dies gilt umso mehr, als erst kürzlich auch Studien gezeigt haben, dass Ärzte sich scheuen, von sich aus das Problem Übergewicht und Adipositas bei Patienten anzusprechen.
Hier ist ein Abstract der Studie: F Johnson u.a.: Changing perceptions of weight in Great Britain: comparison of two population surveys (BMJ 2008;337:a494)
Gerd Marstedt, 13.7.2008
Leiden am Schein und weniger am Sein: Sich dick fühlen verringert die Lebensqualität stärker als dick sein.
 Pünktlich zur Kür von "Germany's Next Topmodel" bekommt die Diskussion um den Schlankheitswahn neue Nahrung. Der Kinder- und Jugendgesundheitssurvey KiGGS fand heraus: Während nur knapp ein Fünftel der Mädchen tatsächlich übergewichtig oder fettleibig ist, hält sich über die Hälfte dafür. Die Lebensqualität der tatsächlich dicken Kinder ist dabei besser als die der eingebildet dicken.
Pünktlich zur Kür von "Germany's Next Topmodel" bekommt die Diskussion um den Schlankheitswahn neue Nahrung. Der Kinder- und Jugendgesundheitssurvey KiGGS fand heraus: Während nur knapp ein Fünftel der Mädchen tatsächlich übergewichtig oder fettleibig ist, hält sich über die Hälfte dafür. Die Lebensqualität der tatsächlich dicken Kinder ist dabei besser als die der eingebildet dicken.
Der KiGGS bietet eine solide Datengrundlage für die künftige Diskussion um Übergewicht von Kindern und Jugendlichen in Deutschland. In der Studie wurden 17.641 Teilnehmer zwischen 0 und 17 Jahren medizinisch untersucht. Zudem wurden alle Eltern sowie die 11- bis 17-jährigen Teilnehmer schriftlich befragt. "Zu dick" und "zu dünn" sind dabei relative Größen: Als übergewichtig gilt ein Kind, wenn sein BMI-Wert oberhalb des alters- und geschlechtsspezifischen Perzentils der Referenzpopulation aus den Jahren 1985 bis 1998 liegt und als adipös mit einem BMI oberhalb des 97. Perzentils. Als untergwichtig gilt ein Kind, wenn sein BMI unterhalb des 10. Perzentils, und als extrem untergewichtig, wenn er unterhalb des 3. Perzentils liegt.
Die Ergebnisse bei den 11 bis 17-Jähringen im Einzelnen:
• Gemessenes Gewicht: Bei den Mädchen sind 75,4% normalgewichtig, 9,5 übergewichtig, 8,3% adipös, 5,1% untergewichtig und 1,8% extrem untergewichtig. Bei den Jungen sind 74,3% normalgewichtig, 9,9% übergewichtig, 7,7% adipös, 5,7 untergewichtig und 2,4 extrem untergewichtig.
• Sozialstatus: Je nach Alter und Geschlecht stammen knapp zwei- bis fünfmal so viele adipöse Kinder aus Familien mit niederem Sozialstatus. Der Extremfall: Unter den 11- bis 13-jährigen Mädchen mit niederem Sozialstatus sind 14,7% adipös, unter den mit hohem Sozialstaus nur 3%.
• Gefühltes Gewicht: Bei den Mädchen sagen 36,6%, sie hätten "genau das richtige Gewicht", 44,5% halten sich für "ein bisschen zu dick", 10% für "viel zu dick", 7,2% für "ein bisschen zu dünn" und 1,7% für "viel zu dünn". Bei den Jungen haben 44,1% "genau das richtige Gewicht", 30,8% halten sich für "ein bisschen zu dick", 4,7% für "viel zu dick", 17,2% für "ein bisschen zu dünn" und 3,2% für "viel zu dünn".
• Übereinstimmung von gemessenem und gefühltem Gewicht: Von den normalgewichtigen Mädchen halten sich 44,3% für richtig, 45,6% für ein bisschen zu dick und 3,8% für viel zu dick. Von den normalgewichtigen Jungen halten sich 54,3% für richtig, 25,1% für ein bisschen zu dick und 1,1% für viel zu dick. Von den adipösen Mädchen halten sich 38,5% für ein bisschen zu dick und 60,6% für viel zu dick. Von den adipösen Jungen halten sich 64,8% für ein bisschen zu dick und 32,2% für viel zu dick.
• Lebensqualität: Normalgewichtige Mädchen haben einen KINDL-Gesamtscore (mit den Einzelaspekten Körper, Psyche, Selbstwert, Familie, Freunde und Schule) von 71,7, adipöse Mädchen von 68,5. Normalgewichtige Jungen haben einen Score von 74,2, adipöse Jungen von 70,2. Normalgewichtige Mädchen, die ihr Gewicht für richtig halten, haben einen Score von 74,8, normalgewichtige Mädchen, die sich für viel zu dick halten, von 62,3. Normalgewichtige Jungen, die ihr Gewicht für richtig halten, haben einen Score von 75,7, normalgewichtige Jungen, die sich für viel zu dick halten, von 66,6.
Die Autorinnen möchten die Auswirkung der Adipositas auf die körperliche Gesundheit nicht relativieren, ziehen aber dennoch das Fazit: "Muss eine realistische Körpereinschätzung adipöser Kinder und Jugendlicher erreicht werden, um die Veränderungsbereitschaft des Betroffenen zu fördern, wenn der Preis eine verminderte Lebensqualität ist? Zudem ist sehr sorgsam zu überlegen, inwieweit die derzeit allgegenwärtigen Kampagnen gegen das Übergewicht den Anteil der Jugendlichen erhöht, der sich ohne Grund als zu dick erachtet."
Christian Weymayr, 7.6.2008
BZgA: Erhebliche Mängel bei den Versorgungsangeboten für übergewichtige und adipöse Kinder und Jugendliche in Deutschland
 Angesichts der hohen Anzahl übergewichtiger Kinder und Jugendlicher (rund 15 %) in Deutschland, von denen 6 % unter starkem Übergewicht (Adipositas) leiden, besteht in der öffentlichen Debatte seit geraumer Zeit Einigkeit über den hohen Präventions- und Behandlungsbedarf.
Angesichts der hohen Anzahl übergewichtiger Kinder und Jugendlicher (rund 15 %) in Deutschland, von denen 6 % unter starkem Übergewicht (Adipositas) leiden, besteht in der öffentlichen Debatte seit geraumer Zeit Einigkeit über den hohen Präventions- und Behandlungsbedarf.
Auch wenn die internationalen und vor allem nationalen Untersuchungen der Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Vielzahl von einschlägigen Angeboten für Kinder und Jugendlichen teils zu skeptischen Bewertungen kommen und nur wenige, meist sehr aufwändige Interventionen wirklich ihren Nutzen bewiesen haben (Einzelheiten zeigt eine bereits im Forum-Gesundheitspolitik vorgestellte Überblicksarbeit zur internationalen Forschungslage über Anti-Übergewichts- und Adipositaprogramme), gab es bisher in Deutschland noch nicht einmal genügend Transparenz über die wesentlichen Angebote, geschweige denn ihre Qualität.
Diesem Zustand hat nun eine im Auftrag der "Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)" am Universitätsklinikum Eppendorf Hamburg durchgeführte bundesweite Bestandsaufnahme ein Ende bereitet.
Die wesentlichen Teilziele der Studie waren:
• Erfassung des Versorgungsangebots.
• Einschätzung der Qualität der Angebote und ihrer Verteilung auf ambulante, teilstationäre und stationäre Behandlungen sowie die wichtigsten Träger (Kliniken, Ernährungsberatungsstellen, ärztliche Praxen, Gesundheitsämter u. a.).
• Bestimmung von Stärken und Schwächen verschiedener Angebote.
• Aufzeigen von Optimierungsmöglichkeiten der Versorgung.
Die vorliegende Studie liefert einen Überblick über die Versorgungslage, die Angebotsdichte sowie die Qualität von Angeboten zur Therapie von Übergewicht und Adipositas bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland in den Jahren 2004-2005. Der Datensatz über die bundesweite Versorgungslage umfasst 492 Angebote und bietet damit die breiteste und differenzierteste Datenbasis für Versorgungsanalysen des Feldes. Insgesamt ist von der Existenz von rund 700 Angeboten auszugehen.
Die Hauptergebnisse der Analyse waren:
• Zwei Drittel der Einrichtungen ambulant arbeiten. Dabei handelt es sich um Angebote, die die Kinder und Jugendlichen ein- bis dreimal pro Woche aufsuchen und ansonsten den gewohnten Alltag in ihrer Familie verbringen.
• Knapp 20 % der Einrichtungen sind stationäre Maßnahmen, in denen die Betroffenen über mehrere Wochen auch über Nacht bleiben.
• Die restlichen Angebote sind gemischte Formen und Maßnahmen, die in Kindergärten, Schulen und Sportvereinen stattfinden.
• Zu den größten Anbietern in der Adipositastherapie von jungen Menschen gehören Kliniken und Ernährungsberatungsstellen. Psychotherapeutische Praxen, Gesundheitsämter, Sportvereine, Krankenkassen, sozialpädiatrische Zentren sowie Kinder- und allgemeinärztliche Praxen halten nur wenige Angebote vor.
• Die Qualität der Angebote wurde anhand von Qualitätskriterien ermittelt, die zuvor in einem intensiven Austausch zwischen dem Bundesministerium für Gesundheit, der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und den führenden Fachgesellschaften und Wissenschaftlern entwickelt wurden.
• Die Studie zeigt deutliche Defizite in der Qualität der Angebote: So erfüllen nur etwa 51 % der Maßnahmen die zugrunde gelegten Qualitätsmerkmale. Insgesamt weisen stationäre Angebote die höchste Qualität auf, gefolgt von teilstationären und ambulanten Maßnahmen, wobei es bei allen Versorgungstypen gute und schlechte Maßnahmen gibt. Die Kosten der jeweiligen Maßnahme weisen nur einen geringen Zusammenhang zur Qualität auf. Konkret heißt das, dass es teure Maßnahmen mit geringer Qualität und preiswerte Maßnahmen mit guter Qualität gibt.
Die BZgA will sich daher künftig gezielt darum kümmern, die Qualität der Angebote zu verbessern und auch künftig genügend Transparenz herzustellen.
Bei der BzGA sind auch kostenlos weitere Informationsmaterialien erhältlich und stehen weitere Informationen zum Qualitätssicherungsprozess in der Versorgung übergewichtiger Kinder und Jugendlicher zur Verfügung.
Die als Band 8 ihrer Fachheftreihe zur "Gesundheitsförderung Konkret" 2007 erschienene 115 Seiten umfassende Studie "Die Versorgung übergewichtiger und adipöser Kinder und Jugendlicher in Deutschland" ist ebenfalls kostenlos u.a. als PDF-Datei erhältlich.
Bernard Braun, 26.4.2008
USA: Zur Benachteiligung von Schwarzen und Frauen kommt nun auch noch die Diskriminierung der Dicken
 Die Übergewichtsproblematik bekommt in den USA eine neue Dimension: Nach der medizinischen und gesundheitsökonomischen Diskussion stößt jetzt auch die gesellschaftliche Diskriminierung von Personen wegen ihrer (überdurchschnittlichen) Körperfülle auf Aufmerksamkeit. Wie eine Studie gezeigt hat, verdoppelte sich in den letzten zehn Jahren der Anteil übergewichtiger Amerikaner, die auf der Straße oder im Restaurant persönlich beleidigt wurden, eine Versicherung nicht abschließen konnten oder bei der Vergabe einer Mietwohnung den Kürzeren zogen - durchweg wegen ihres Äußeren.
Die Übergewichtsproblematik bekommt in den USA eine neue Dimension: Nach der medizinischen und gesundheitsökonomischen Diskussion stößt jetzt auch die gesellschaftliche Diskriminierung von Personen wegen ihrer (überdurchschnittlichen) Körperfülle auf Aufmerksamkeit. Wie eine Studie gezeigt hat, verdoppelte sich in den letzten zehn Jahren der Anteil übergewichtiger Amerikaner, die auf der Straße oder im Restaurant persönlich beleidigt wurden, eine Versicherung nicht abschließen konnten oder bei der Vergabe einer Mietwohnung den Kürzeren zogen - durchweg wegen ihres Äußeren.
Bei zwei Befragungen, einmal Mitte der 90er Jahre und einmal im Zeitraum 2004-2006, erfasste die Forschungsgruppe aus Connecticut persönliche Erfahrungen einer repräsentativen Stichprobe erwachsener Amerikaner zum Thema "Diskriminierung". Gefragt wurde nach Beleidigungen, Belästigungen und ungerechtfertigten Benachteiligungen aus unterschiedlichen Gründen: Wegen ihres Geschlechts oder ihrer Hautfarbe, wegen ihres Lebensalters oder eben ihres Übergewichts. Dabei wurden verschiedene Situationen vorgegeben:
• Im Bereich der Diskriminierung durch Institutionen waren es negative Erfahrungen mit Lehrern, Arbeitgebern und Vorgesetzten, Ärzten und Versicherungen.
• Im Bereich persönlicher Herabsetzungen wurden Erfahrungen abgefragt wie zum Beispiel ein schlechter Service im Restaurant, Beschimpfungen, Bedrohungen oder fehlender Respekt in Geschäften.
Die wesentlichen Ergebnisse der Befragung waren:
• In den letzten zehn Jahren hat sich die Erfahrung persönlicher Diskriminierung nur aufgrund des Körpergewichts fast verdoppelt. Waren es 1994-96 nur 7 Prozent, so berichten 2004-2006 rund 12 Prozent der Amerikaner über solche Erfahrungen.
• Übergewichtige Frauen sind sehr viel häufiger betroffen als Männer.
• Mit dem Body Mass Index (BMI) steigt fast proportional auch das Ausmaß der Diskriminierung.
• Zwar ist nach wie vor die Benachteiligung von Frauen allein wegen ihres Geschlechts die häufigste Form der Diskriminierung (siehe Abbildung), gefolgt von der Rassendiskriminierung männlicher Bevölkerungsgruppen mit schwarzer Hautfarbe. Doch Negativerfahrungen wegen des Körpergewichts stehen bei Frauen bereits an dritter Stelle.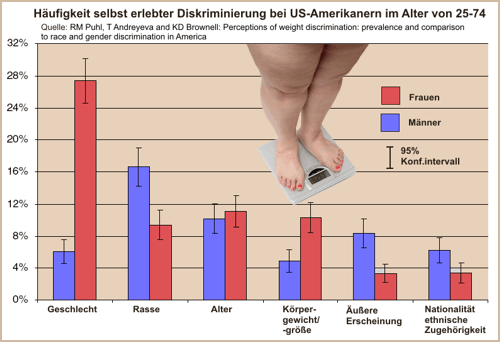
• Im Rahmen einer multivariaten Analyse (unter Einbezug von Variablen wie Alter, Geschlecht, Rasse, Schulbildung, beruflicher Status) berechneten die Wissenschaftler auch die Wahrscheinlichkeit, mit der ein US-Amerikaner heute mit Diskriminierungs-Erfahrungen aufgrund bestimmter Eigenschaften rechnen muss. Sie beträgt: für Übergewicht (BMI 25-30) 3.5, Adipositas (BMI 30-35) 5.0, schwere Adipositas (>35) 9.0, für das Geschlecht (Frauen) 9.6 und für die Hautfarbe (schwarz) 28.7.
Die Wissenschaftler diskutieren in ihren beiden Veröffentlichungen zur Studie auch die möglichen gesellschaftlichen Hintergründe. Dabei wird auch die Berichterstattung von Medien kritisiert, die Adipositas zunehmend öfter als alleinigen Effekt individuellen Fehlverhaltens im Bereich der Ernährung und körperlichen Bewegung darstellen. Übergewichtige werden daher als Ernährungssünder und Bewegungsmuffel stigmatisiert, die ganz alleine schuld sind an ihrer Körperfülle und dies auch problemlos ändern könnten.
Hier findet man Abstracts der beiden Veröffentlichungen:
• RM Puhl, T Andreyeva and KD Brownell: Perceptions of weight discrimination: prevalence and comparison to race and gender discrimination in America (International Journal of Obesity, advance online publication, 4 March 2008; doi:10.1038/ijo.2008.22)
• Tatiana Andreyeva, Rebecca M. Puhl and Kelly D. Brownell: Changes in Perceived Weight Discrimination Among Americans, 1995-1996 Through 2004-2006 (Obesity (2008). doi:10.1038/oby.2008.35)
Gerd Marstedt, 18.4.2008
Bei Frauen mit Übergewicht werden in den USA bestimmte Krebs-Untersuchungen deutlich seltener durchgeführt
 Bei übergewichtigen und adipösen Frauen werden in den USA deutlich seltener Screening-Untersuchungen für Brustkrebs und Gebärmutterhalskrebs durchgeführt als bei Frauen mit Normalgewicht, also einem Body Mass Index unter 25. Bei Darmkrebs-Untersuchungen ist das Bild nicht so eindeutig. Dies ist das Ergebnis einer Metaanalyse von insgesamt 32 schon veröffentlichten Studien mit fast einer halben Million US-Patientinnen, die jetzt online vorab in der Zeitschrift "Cancer" veröffentlicht wurde.
Bei übergewichtigen und adipösen Frauen werden in den USA deutlich seltener Screening-Untersuchungen für Brustkrebs und Gebärmutterhalskrebs durchgeführt als bei Frauen mit Normalgewicht, also einem Body Mass Index unter 25. Bei Darmkrebs-Untersuchungen ist das Bild nicht so eindeutig. Dies ist das Ergebnis einer Metaanalyse von insgesamt 32 schon veröffentlichten Studien mit fast einer halben Million US-Patientinnen, die jetzt online vorab in der Zeitschrift "Cancer" veröffentlicht wurde.
Wie Sarah S. Cohen, eine der an der Studie beteiligten Wissenschaftlerinnen der University of North Carolina, in der Veröffentlichung mitteilt, sind die Teilnahmeraten an Krebsfrüherkennungsuntersuchungen in den USA teilweise sehr hoch. Etwa 75 Prozent der Patientinnen über 40 Jahre wurden im Zeitraum der letzten zwei Jahre mit einer Mammographie auf Brustkrebs untersucht und bei 86% der Frauen wurde in den letzten drei Jahren ein sogenannter "Pap-Test" oder " Papanicolaou-Test" durchgeführt, wobei mit einem Abstrich Zellmaterial von Muttermund und Gebärmutterhalskanal entnommen und miskroskopisch auf Tumorzellen begutachtet wird. Die Teilnahmequoten für die Früherkennung von Darmkrebs (durch eine Darmspiegelung oder Analyse von Stuhlproben auf "okkultes" Blut) sind sehr viel niedriger und liegen nur etwa bei 33 Prozent.
In einer Neubilanzierung von insgesamt 32 Studien, die unterschiedlichste Daten von fast 500.000 Patientinnen enthielten, überprüften die Forscherinnen dann, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen dem Body Mass Index der Frauen und durchgeführten Früherkennungsuntersuchungen. Die Studien stammten aus den Jahren 1990-2004, wurden aber überwiegend in den 90er Jahren durchgeführt. Dabei verwerteten sie Daten aus Studien zur
• Brustkrebs-Diagnose mit Mammographien (10 Studien, ca. 70.000 Patientinnen)
• Gebärmutterhalskrebs-Erkennung mit Papanicolaou-Test (14 Studien, über 220.000 Teilnehmer)
• Darmkrebs-Früherkennung mit Darmspiegelung (Koloskopie) oder Analysen auf okkultes Blut (8 Studien, über 180.000 Teilnehmer)
Als Ergebnis zeigte sich, dass die Wahrscheinlichkeit für übergewichtige und adipöse Frauen, an einer Brustkrebs- oder Gebärmutterhalskrebs-Untersuchung teilzunehmen, in multivariaten Analysen (die andere Faktoren wie Alter, chronische Erkrankungen usw. statistisch kontrollierten) um 10-40 Prozent niedriger war als bei normalgewichtigen Patientinnen. Für diese Screening-Untersuchungen zeigten fast alle berücksichtigten Studien eine einheitliche Tendenz, auch wenn die Stärke des Zusammenhang unterschiedlich ausfiel. Teilweise ergaben sich für Frauen mit besonders starker Adipositas noch erheblich niedrigere Werte für eine Teilnahme. Im Hinblick auf Darmkrebs waren die Befunde uneinheitlich: 5 Studien zeigten dieselbe Tendenz, 3 von insgesamt 8 Studien erbrachten jedoch keine signifikanten Differenzen.
Hinsichtlich der Interpretation dieser Befunde konnten die Wissenschaftlerinnen nur Hypothesen formulieren. Einerseits halten sie es für möglich, dass übergewichtige Frauen sich wegen ihres Äußeren auch scheuen, an Brustkrebs- oder Gebärmutter-Untersuchungen teilzunehmen, bei denen sie sich ja auch teilweise entkleiden müssen. Ebenso gut ist aber denkbar, dass die technische Ausstattung von medizinischen Praxen teilweise unzureichend zugeschnitten ist auf adipöse Frauen, so dass Ärzte diese Frauen seltener zur Früherkennung ermuntern. Und ebenso gut könnte die stärkere Verbreitung von Übergewicht in unteren Sozialschichten und bei ethnischen Minderheiten eine Rolle spielen: Die Bevölkerungsgruppen sind ja gleichzeitig auch seltener krankenversichert und haben seltener Zugang zu Früherkennungsmaßnahmen.
Hier ist ein Abstract der Studie: Sarah S. Cohen u.a.: Obesity and screening for breast, cervical, and colorectal cancer in women (Cancer, Early View, Published Online: 24 Mar 2008; doi: 10.1002/cncr.23408)
Gerd Marstedt, 27.3.2008
Übergewicht und Krebs - neue Metaanalyse
 Andrew Renehan und Kollegen haben in einer systematischen Übersichtsarbeit und Metaanalyse (LANCET 16.2.2008) das Verhältnis von Krebs und Körpergewicht (body mass index - BMI) untersucht. Von den zahlreichen bereits vorhandenen Metaanalysen unterscheidet sich diese nicht nur durch Aktualität sondern auch durch die Beschränkung auf die Auswertung prospektiver Studien, die Einbeziehung seltener Krebsarten und den internationalen Vergleich.
Andrew Renehan und Kollegen haben in einer systematischen Übersichtsarbeit und Metaanalyse (LANCET 16.2.2008) das Verhältnis von Krebs und Körpergewicht (body mass index - BMI) untersucht. Von den zahlreichen bereits vorhandenen Metaanalysen unterscheidet sich diese nicht nur durch Aktualität sondern auch durch die Beschränkung auf die Auswertung prospektiver Studien, die Einbeziehung seltener Krebsarten und den internationalen Vergleich.
Die Metaanaylse umfasst 141 Publikationen mit insgesamt 282.137 Krebspatienten aus 76 Studien (67 Kohortenstudien, 6 in einer laufenden Kohortenstudie durchgeführte Fall-Kontroll-Studien, sog. nested case-control studies, und 3 randomisierte kontrollierte Studien).
Ein Anstiegt des BMI um 5 kg/m2 geht in dieser Auswertung mit einer Erhöhung des Risikos u.a. für folgende Krebsarten einher:
Männer
• Speiseröhrenkrebs (Adenokarzinom) 52%
• Schilddrüse 33%
• Dickdarm 24%
• Niere 24%
Frauen
• Gebärmutterschleimhaut (Korpuskarzinom) 59%
• Gallenblase 59%
• Speiseröhrenkrebs (Adenokarzinom) 51%
• Niere 34%
28 Studien stammen aus Nordamerika, 35 aus Europa und Australien, 11 aus Asien und dem pazifischen Raum. Bis auf einen stärkeren Zusammenhang bei Brustkrebs im asiatisch-pazifischen Raum zeigten sich keine wesentlichen regionalen Unterschiede.
Eine umgekehrte Beziehung zum BMI ergab sich für Lungenkrebs und das Plattenepithelkarzinom der Speiseröhre - zwei Krebsarten die wesentlich durch Tabakrauchbestandteile verursacht werden. Dies wird erklärt durch den appetitmindernden Effekt des Rauchens und den im Vergleich zu Nichtrauchern niedrigeren BMI der Raucher.
Auch für Risikoerhöhung des Speiseröhrenkrebses (Adenokarzinom) bei höherem BMI gibt es eine naheliegende Erklärung - mit Anstieg des BMI steigt auch das Risiko für die sog. Refluxkrankheit, den Rückfluss von Mageninhalt in die Speiseröhre mit der möglichen Folge krebsiger Entartung von Zellen der Speiseröhre.
Im Übrigen ist wenig über die Mechanismen der Verursachung von Krebs durch Übergewicht bekannt. Diskutiert werden Hormone (Insulin, Insulinähnliche Wachstumsfaktoren - insulin-like growth factors - und Adipokine) sowie die höheren Östrogenspiegel beim postmenopausalen Brustkrebs.
Durch die bevölkerungsweite Gewichtszunahme in den meisten Ländern gewinnt Übergewicht als kausaler Faktor für die Entstehung von Krebs eine zunehmende Bedeutung.
Podcast der Studie
Body-mass index and incidence of cancer: a systematic and meta-analysis of prospective observational studies Abstract der Studie - LANCET vom 16.2.2008
David Klemperer, 18.2.2008
Niederländische Studie rechnet vor: Prävention bringt keine direkten Kosteneinsparungen im Gesundheitssystem
 Die in den letzten Jahren zu beobachtenden vermehrten Bemühungen und Interventionen zur Prävention und Gesundheitsförderung, durch Regelungen zum Nichtraucherschutz, Kampagnen wie "1000 Schritte extra" oder die geplante Kennzeichnung von Lebensmitteln zielen zwar vorrangig auf eine längere Lebenserwartung der Bürger ohne Gesundheitsbeeinträchtigungen. Aber direkt oder indirekt waren stets auch Hoffnungen auf damit verbundene Kosteneinsparungen mit im Spiel. Dass diese Hoffnung trügerisch sein könnte, hat nun eine gesundheitsökonomische Analyse niederländischer Wissenschaftler nahegelegt. Ihr Fazit: Gesunde Bürger ohne Übergewicht sind für das Gesundheitssystem teurer als Raucher und Fettleibige, denn aufgrund der längeren Lebenserwartung der Gesunden entstehen langfristig höhere Kosten.
Die in den letzten Jahren zu beobachtenden vermehrten Bemühungen und Interventionen zur Prävention und Gesundheitsförderung, durch Regelungen zum Nichtraucherschutz, Kampagnen wie "1000 Schritte extra" oder die geplante Kennzeichnung von Lebensmitteln zielen zwar vorrangig auf eine längere Lebenserwartung der Bürger ohne Gesundheitsbeeinträchtigungen. Aber direkt oder indirekt waren stets auch Hoffnungen auf damit verbundene Kosteneinsparungen mit im Spiel. Dass diese Hoffnung trügerisch sein könnte, hat nun eine gesundheitsökonomische Analyse niederländischer Wissenschaftler nahegelegt. Ihr Fazit: Gesunde Bürger ohne Übergewicht sind für das Gesundheitssystem teurer als Raucher und Fettleibige, denn aufgrund der längeren Lebenserwartung der Gesunden entstehen langfristig höhere Kosten.
Die Kosten für die medizinische Versorgung von Rauchern wurden unlängst in England mit 1,9 bis 2,3 Milliarden Euro jährlich beziffert (BBC: The real cost of smoking). Übergewicht und Adipositas, so eine US-amerikanische Studie, ziehen medizinische Versorgungskosten in Höhe von 55-60 Milliarden Euro in den USA in jedem Jahr nach sich (Overweight and Obesity: Economic Consequences). Verlockend erscheint es angesichts dieser Zahlen, Gesundheitspolitik systematischer und umfassender als bislang auf das Feld der Prävention zu lenken, um die knappen Kassen der Gesundheitssysteme zu entlasten. Und auch in Deutschland sprachen einige Wissenschaftler und Politiker es ganz direkt aus: "Vorbeugung statt Reparatur: Prävention senkt die Kosten im Gesundheitssystem".
Dem widersprachen nun holländische Wissenschaftler. Sie verwendeten Modellrechnungen zu den Überlebensraten, Erkrankungen und Versorgungskosten für drei (hypothetische) Gruppen von Bürgern, und zwar für eine Zeitspanne vom 20.Lebensjahr bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie aufgrund der Modellrechnung sterben würden. Diese drei Gruppen waren: Stark übergewichtige Nichtraucher (BMI über 30), "Gesunde", die nicht rauchten und ein Normalgewicht hatten, sowie lebenslange Raucher mit einem Normalgewicht. Für diese drei Gruppen berechneten sie auf der Basis offizieller Statistiken aus den Niederlanden die Lebenserwartung, die Häufigkeit des Auftretens bestimmter Krankheiten und die Kosten für die medizinische Behandlung dieser Erkrankungen.
Ihre Berechnungen zeigten dann, dass bis zum Alter von 56 Jahren die medizinischen Kosten für die Übergewichts-Gruppe am höchsten ausfallen und für die Bürger mit gesunder Lebensweise am niedrigsten. In den Lebensjahren danach verursachten die Raucher die höchsten Kosten. Die Forscher berücksichtigten dann allerdings auch noch die unterschiedliche Lebnenserwartung der drei Gruppen. Diese Lebenserwartung fällt - nach derzeitigem Wissensstand - bei 20jährigen Übergewichtigen um 5 Jahre und bei 20jährigen Rauchern um 8 Jahre niedriger aus als bei den Gesunden. Da gleichwohl auch Personen mit gesundem Lebensstil (Normalgewicht, Nichtrauchen) im Alter nicht völlig von Krankheiten verschont bleiben, fallen aufgrund der höheren Lebenserwartung und der medizinischen Kosten für diese auch Mehrausgaben an. Die medizinischen Versorgungskosten, so das Fazit der Wissenschaftler, fallen für die Gruppe mit gesunder Lebensweise am höchsten aus, für Raucher am niedrigsten und für die Übergewichtigen mittel.
Nicht berücksichtigt in den Modellrechnungen, dies schreiben die Niederländer ausdrücklich in ihrem Artikel, sind allerdings eine Reihe von Faktoren, die das Ergebnis verändern könnten: Höhere Krankenstände und Produktivitätsverluste durch rauchende und fettleibige Erwerbstätige, daraus resultierende volkswirtschaftlichen Verluste, geringere Renteneinzahlungen, sinkende Tabaksteuereinnahmen. "Aber", so schreiben sie zum Schluss, "das Ziel des Gesundheitssystems ist es nicht, Kosten zu senken, sondern den Menschen vermeidbares Leiden und Sterben zu ersparen. Wenn darüber auch noch Kosteneinsparungen möglich sind, wäre dies nicht viel mehr als ein I-Tüpfelchen."
Die Studie ist hier kostenlos im Volltext zu lesen: Pieter H. M. van Baal u.a: Lifetime Medical Costs of Obesity: Prevention No Cure for Increasing Health Expenditure (PLoS Med 5(2): e29 doi:10.1371/journal.pmed.0050029)
Gerd Marstedt, 8.2.2008
Bevölkerungs- und Ärztemeinungen über Ursachen und Lösungsmöglichkeiten für das Problem Übergewicht
 Biologische und genetische Faktoren werden in der Bevölkerung deutlich häufiger als Ursachen für Übergewicht und Adipositas genannt als von Medizinern. Hinsichtlich möglicher Lösungen für das Problem werden von Laien wie Ärzten Selbsthilfegruppen am häufigsten als erfolgversprechende Strategie bewertet. Dies sind Ergebnisse einer Befragung niedergelassener Ärzte und Bürger, deren Ergebnisse jetzt in der Zeitschrift "Patient Education and Counseling" veröffentlicht wurden. Teilnehmer an der Befragung waren 73 niedergelassene Ärzte und 311 zufällig ausgewählte Bürger/innen einer südenglischen Stadt, die jeweils einen umfassenden Fragebogen ausfüllten. Dort gaben sie Auskunft über ihre sozialstatistischen Daten, vor allem jedoch über ihre Ansichten zu den Ursachen von Übergewicht und zu ihrer Meinung nach effektiven Vorgehensweisen dagegen.
Biologische und genetische Faktoren werden in der Bevölkerung deutlich häufiger als Ursachen für Übergewicht und Adipositas genannt als von Medizinern. Hinsichtlich möglicher Lösungen für das Problem werden von Laien wie Ärzten Selbsthilfegruppen am häufigsten als erfolgversprechende Strategie bewertet. Dies sind Ergebnisse einer Befragung niedergelassener Ärzte und Bürger, deren Ergebnisse jetzt in der Zeitschrift "Patient Education and Counseling" veröffentlicht wurden. Teilnehmer an der Befragung waren 73 niedergelassene Ärzte und 311 zufällig ausgewählte Bürger/innen einer südenglischen Stadt, die jeweils einen umfassenden Fragebogen ausfüllten. Dort gaben sie Auskunft über ihre sozialstatistischen Daten, vor allem jedoch über ihre Ansichten zu den Ursachen von Übergewicht und zu ihrer Meinung nach effektiven Vorgehensweisen dagegen.
Zur Bewertung der zentralen Ursachen gab es im Fragebogen verschiedene Dimensionen: Biologische und genetische Faktoren (Hormone, Erbanlagen), psychologische (Selbstwertgefühl, Depressive Tendenzen), individuelle Verhaltensweisen (zu viel essen, zu wenig Bewegung, zu ungesunde Nahrungsmittel), soziale Aspekte (niedriges Einkommen, Arbeitslosigkeit, niedrige Bildung) und schließlich aus strukturelle Faktoren (Fast-Food-Kultur, hohe Kosten gesunder Ernährung). Jeder dieser potentiellen Einflussfaktoren war auf einer fünfstufigen Skala hinsichtlich seiner Bedeutung zu bewerten, als überaus wichtig oder unwichtig.
In ähnlicher Weise war auch anzugeben, welche von sechs verschiedenen Vorgehensweisen man für besonders erfolgversprechend hält: Arzneimitteltherapie, chirurgische Maßnahmen, persönliche Beratung, politische Maßnahmen, Beratung durch einen Arzt, Teilnahme an einer Selbsthilfegruppe (wie "Weight Watchers").
Bei Betrachtung der Antworten zeigten sich einige Unterschiede zwischen Medizinern und Laien.
• Hinsichtlich der zentralen Ursachen von Übergewicht gaben Ärzte am häufigsten Verhaltensdefizite an (97% der Antworten), biologisch-genetische Aspekte am seltensten (29%). Auch bei Laien waren Verhaltensweisen des Einzelnen an vorderster Stelle zu finden, hier wurden jedoch biologische Faktoren häufiger genannt als von Ärzten. Am seltensten tauchten hier Antworten auf, die soziale Ursachen (Einkommen, Bildung, Arbeitslosigkeit) hervorhoben.
• Bei der Bewertung der Strategien waren bei Ärzten Selbsthilfegruppen eindeutiger Favorit (92%), alle übrigen Lösungswege wurden etwa gleichrangig bewertet - als vermutlich weniger erfolgreich. Die Autoren der Studie heben hierzu hervor, dass Ärzte hinsichtlich der Effektivität der meisten Strategien sehr skeptisch sind. Bei den medizinischen Laien lag diese Vorgehensweise auch vorne (58%), jedoch wurden Beratungen und auch chirurgische Lösungen (Magenverkleinerung) im Vergleich zu den Ärzten als sehr viel erfolgreicher eingestuft.
Besonders aufschlussreich waren dann Analysen die einen Zusammenhang herzustellen versuchten zwischen den jeweils wahrgenommenen Ursachen und den favorisierten Lösungen. Hier zeigte sich, dass bei Medizinern eine stärkere Logik vorherrschte. Wenn Ärzte biologische Ursachen als zentrale Ursache vermuteten, schlugen sie auch häufiger biologisch orientierte Lösungen vor (Chirurgie, Medikamente). Wurden vorrangig psychologische Ursachen genannt, so rangierten auch hieran orientierte Strategien (Beratung, Selbsthilfe) weiter vorne. Bei Laien ließ sich ein solcher Zusammenhang gar nicht oder nur sehr begrenzt feststellen - ein Hinweis darauf, dass das Wissen von Normalbürgern zum Übergewicht nicht sehr fundiert ist und sich eher zusammensetzt aus weltanschaulichen Überzeugungen und einzelnen Medien-Informationen.
Hier ist ein Abstract der Studie: Jane Ogden, Zakk Flanagan:Beliefs about the causes and solutions to obesity: A comparison of GPs and lay people (Patient Education and Counseling, Article in Press, Corrected Proof)
Gerd Marstedt, 3.2.2008
"Nationale Verzehrstudie" zeigt massive Wissenslücken der Bevölkerung zum Thema Ernährung und Gesundheit
 Rund 20.000 Deutsche im Alter von 14-80 Jahren wurden in der jetzt veröffentlichten "Nationalen Verzehrstudie" zu ihrem Wissen über Ernährung, ihrem Einkaufsverhalten und ihren Kochkünsten befragt. Die Studie dokumentiert einmal mehr, dass Übergewicht und Adipositas nicht nur in England und den USA ein großes Problem ist, sie zeigt darüber hinaus aber auch, dass große Teile der Bevölkerung nur sehr wenig Kenntnisse haben über den Zusammenhang von Ernährung und Gesundheit.
Rund 20.000 Deutsche im Alter von 14-80 Jahren wurden in der jetzt veröffentlichten "Nationalen Verzehrstudie" zu ihrem Wissen über Ernährung, ihrem Einkaufsverhalten und ihren Kochkünsten befragt. Die Studie dokumentiert einmal mehr, dass Übergewicht und Adipositas nicht nur in England und den USA ein großes Problem ist, sie zeigt darüber hinaus aber auch, dass große Teile der Bevölkerung nur sehr wenig Kenntnisse haben über den Zusammenhang von Ernährung und Gesundheit.
Wichtige Ergebnisse der Studie sind unter anderem:
• Ernährungsinformation und Ernährungswissen: Zwei Drittel der Deutschen informieren sich über das Thema Ernährung. Für über die Hälfte dieser Teilnehmer sind die Printmedien (56%), Angaben auf Lebensmittelverpackungen (54%), persönliche Kontakte über Freunde und Familie (54%) und das Fernsehen (51%) die Hauptinformationsquellen. Gleichwohl kannten nur 29% der Teilnehmer die richtige Bedeutung der Kampagne "5amTag" (5mal täglich Obst oder Gemüse), wobei Frauen diese doppelt so häufig kannten wie Männer.(40% zu 18%). Und nur 8% der erwachsenen Deutschen (19-80 Jahre) können ihren persönlichen Energiebedarf richtig einschätzen. 31% schätzen ihn mit einer großen Abweichung zum Richtwert für die Nährstoffzufuhr falsch ein (meist zu gering). Mehr als die Hälfte (53%) hat hierzu überhaupt keine Angabe gemacht.
• Nahrungsergänzungsmittel: 28% der Deutschen nehmen Nahrungsergänzungspräparate und angereicherte Medikamente ein, 31% der Frauen und 24% der Männer. Hierbei steigt bei beiden Geschlechtern zunächst die Einnahme bis 35 Jahre an, fällt dann etwas ab, um in der Altersgruppe ab 51 bis 80 Jahre wieder deutlich anzusteigen (bei den 65-80 jährigen Frauen auf 43% und den gleichaltrigen Männern auf 30%). Bei dem selbst eingeschätzten Gesundheitszustand werden bei der Angabe "schlecht" am häufigsten Supplemente eingenommen.
• Risikoeinschätzung und -wahrnehmung: Bei der Risikowahrnehmung bezüglich allgemeiner Gesundheitsgefahren liegen Nahrungsmittel und Getränke lediglich auf Platz 9 von 10 vorgegebenen Risiken. Fast alle anderen Gesundheitsgefährdungen (wie z. B. Zigaretten, Radioaktivität, Stress im Beruf, Verkehr) werden häufiger genannt. Das größte Risiko für die eigene Gesundheit, nämlich "Zu viel und zu einseitig essen" rangiert erst auf Rang 4 (von 14) ein. Rückstände von Spritzmitteln im Pflanzenbau und Rückstände von Tierarzneimitteln sowie verdorbene Lebensmittel werden hingegen als höheres Risiko eingeschätzt.
• Einkaufsverhalten: Bei 47% der Männer kümmert sich eine andere Person um den Lebensmitteleinkauf. Leben die Männer mit einer Partnerin zusammen, steigt dieser Anteil auf 51%. Je mehr Personen im Haushalt leben, desto weniger häufig sind Männer für den Lebensmitteleinkauf zuständig. Frauen übernehmen zu zwei Dritteln den Einkauf, unabhängig davon, ob sie mit oder ohne Partner leben. Die häufigsten Einkaufsstätten sind Supermärkte, gefolgt von Discountern und Lebensmittelfachgeschäften. Es sind deutlich mehr Personen mit hohem Einkommen oder einem hohen Schulabschluss, die sich für den Einkauf von Bioprodukten entscheiden. Frauen kaufen generell in allen Einkommensschichten öfter Bioprodukte als Männer.
• Kochkünste: Zwei Drittel der Frauen und ein Drittel der Männer schätzen ihre Kochfähigkeiten mit sehr gut bis gut ein. Frauen haben sechs vorgegebene Gerichte (von leicht bis schwer) je nach Gericht zu 84-93% alle bereits selbst aus Grundzutaten zubereitet. Männer kommen hierbei nur auf eine Häufigkeit von 33-61% in Abhängigkeit vom Gericht. Diese Angaben bestätigen die angegebene Selbsteinschätzung.
• Übergewicht: 66 Prozent der Männer und 51 Prozent der Frauen sind übergewichtig. Jeder Fünfte ist adipös und damit gefährdet an Herz-Kreislauferkrankungen oder Diabetes zu erkranken. Während der Anteil übergewichtiger junger Erwachsener in den letzten zehn Jahren deutlich anstieg, sank bei den Frauen über 30 Jahren der Anteil Übergewichtiger im gleichen Zeitraum je nach Altersgruppe um bis zu acht Prozent.
Materialien zur Studie:
• Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz: Nationale Verzehrstudie (PDF, 174 Seiten)
• Ergänzungsband "Ausgewählte Ergebnisse nach Schichtindex"
• Download-Seite mit weiteren Berichten zur Nationalen Verzehrstudie
Gerd Marstedt, 30.1.2008
Forscher entdecken ein neues Gesundheitsrisiko für Übergewichtige und Fettleibige, denn sie sind "Gurtmuffel"
 Obwohl Studien zuletzt Hinweise erbracht hatten, dass ein leichtes Übergewicht (BMI 25-30) möglicherweise sogar eine reduzierte Sterblichkeitsrate bewirken kann (vgl. Cause-Specific Excess Deaths Associated With Underweight, Overweight, and Obesity sowie: Adipositas: Körperliche Einschränkungen als Preis für ein längeres Leben?), ist man sich doch darin einig, dass Übergewichtige und vor allem Fettleibige mit erheblichen Gesundheitsrisiken rechnen müssen: Metabolisches Syndrom, Diabetes mellitus Typ II, Nierenerkrankungen usw. Ein US-amerikanisches Forschungsteam hat nun jedoch die Liste der Gesundheitsrisiken um einen Aspekt erweitert, der in der Forschung bislang kaum Beachtung gefunden hatte. Übergewichtige sind nämlich Gurtmuffel beim Autofahren. Je dicker die Autofahrer, umso seltener schnallen sie sich auch im Straßenverkehr an, was natürlich wiederum erhebliche Gesundheitsschäden bei Unfällen nach sich zieht.
Obwohl Studien zuletzt Hinweise erbracht hatten, dass ein leichtes Übergewicht (BMI 25-30) möglicherweise sogar eine reduzierte Sterblichkeitsrate bewirken kann (vgl. Cause-Specific Excess Deaths Associated With Underweight, Overweight, and Obesity sowie: Adipositas: Körperliche Einschränkungen als Preis für ein längeres Leben?), ist man sich doch darin einig, dass Übergewichtige und vor allem Fettleibige mit erheblichen Gesundheitsrisiken rechnen müssen: Metabolisches Syndrom, Diabetes mellitus Typ II, Nierenerkrankungen usw. Ein US-amerikanisches Forschungsteam hat nun jedoch die Liste der Gesundheitsrisiken um einen Aspekt erweitert, der in der Forschung bislang kaum Beachtung gefunden hatte. Übergewichtige sind nämlich Gurtmuffel beim Autofahren. Je dicker die Autofahrer, umso seltener schnallen sie sich auch im Straßenverkehr an, was natürlich wiederum erhebliche Gesundheitsschäden bei Unfällen nach sich zieht.
Basis der Studie waren Daten aus einer repräsentativen Umfrage bei US-Bürgern im Alter über 18 Jahre. Aus dieser 2002 durchgeführten "Behavioral Risk Factor Surveillance System Survey" lagen Daten von über 220.000 Teilnehmern vor, darunter Angaben zum Alter, Geschlecht, Hautfarbe, Bildungsniveau. Weiterhin war in den Telefon-Interviews gefragt worden, wie oft der Betreffende beim Autofahren den Sicherheitsgurt anlegt (immer, fast immer, manchmal, selten, nie). Und schließlich wurde auch noch aus den persönlichen Angaben zu Körpergröße und Gewicht der Body-Mass-Index berechnet.
Es wurde dann errechnet, in welchem Zusammenhang BMI und das Anlegen des Sicherheitsgurts im Straßenverkehr stehen. Es zeigte sich:
• Normalgewichtige Verkehrsteilnehmer (BMI unter 25) legen zu 83% immer den Gurt an,
• diese Quote fällt auf unter 70% bei stark Fettleibigen (BMI über 40).
• In der multivariaten Datenanalyse, die auch Aspekte mit einbezog wie Alter, Geschlecht, Bildungsniveau oder Art der gesetzlichen Regelung zu Sicherheitsgurten im jeweiligen US-Bundesstaat, ergaben sich dann Risiken (Verzicht auf den Gurt) für die einzelnen Gewichtsklassen in folgender Höhe: BMI 25-30: 0.89, BMI 30-40: 0.69, BMI über 40: 0.45.
Die Diskussion der Befunde ist dann ebenso kurz wie prägnant: "Nicht angelegte Sicherheitsgurte im Straßenverkehr sind ein weiterer Risikofaktor bei Übergewicht. Es werden effektive Präventionsmaßnahmen benötigt, um eine häufigere Benutzung der Gurte im Straßenverkehr durch übergewichtige und fettleibige Personen zu erreichen."
Die Studie ist hier kostenlos im Volltext verfügbar: David G. Schlundt u.a.: BMI and Seatbelt Use (Obesity 15:2541-2545, 2007)
Gerd Marstedt, 5.1.2008
Abnehmen mit Appetitzüglern - Wenig Wirkung, unklarer Nutzen aber schwere Nebenwirkungen
 Egal wie man es dreht und wendet, die Wahrscheinlichkeit die Probleme von Übergewicht und Fettsucht einfach, in kurzer Zeit und vor allem allein mit medizinischen oder pharmakologischen Interventionen "in den Griff" zu bekommen oder gar lösen zu können, ist denkbar gering. Hinzu kommen die in diesen "Lösungen" sichtbar werdenden unerwünschten gesundheitlichen Risiken.
Egal wie man es dreht und wendet, die Wahrscheinlichkeit die Probleme von Übergewicht und Fettsucht einfach, in kurzer Zeit und vor allem allein mit medizinischen oder pharmakologischen Interventionen "in den Griff" zu bekommen oder gar lösen zu können, ist denkbar gering. Hinzu kommen die in diesen "Lösungen" sichtbar werdenden unerwünschten gesundheitlichen Risiken.
Dies bestätigen mehrere in den letzten Tagen in internationalen Fachzeitschriften erschienene Auswertungen teilweise langjähriger Studien über pharmakologische Interventionen.
In einer Metaanalyse von vier randomisierten kontrollierten 4.105 Patienten umfassenden Doppelblind-Studien, die eine Behandlung mit täglich 20 Milligram des weit verbreiteten Appetitzügler-Präparats "Rimonabant®" gegenüber einem Placebo verglichen, kommen die dänischen Forscher um Arne Astrup vom Department of Human Nutrition der Faculty of Life Sciences an der Universität von Kopenhagen zu einer Reihe bemerkenswerten Ergebnissen über Wirkungen dieser "Einwerfversion" des Abnehmens von Übergewicht:
• Als erstes reduziert das Medikament das Ausgangsgewicht um durchschnittlich 4,7 kg.
• Als zweites hatten jedoch die NutzerInnen von Rimonabant ein um 40% höheres Risiko nachteiliger oder auch schwerwiegender Zwischenfälle. Die mit diesem Mittel behandelte Patienten brachen die Therapie auf Grund depressiver Störungen zweieinhalb mal häufiger ab als die Placebo-Gruppe, und dreimal so oft beendeten sie die Behandlung auf Grund von Angstzuständen. Das Auftreten solch schwerer psychischer Störungen wie einer Depression ist insofern nicht ernst genug zu nehmen, weil die in diese Studien aufgenommenen Übergewichtigen und Fettsüchtigen ausdrücklich nicht depressiv sein durften bzw. das Vorliegen einer solchen Erkrankung ein Ausschlussgrund gewesen wäre. Als Ursache oder Auslöser dieser unerwünschten Wirkungen wird vermutet, dass Rimonabant, was einen Wirkstoff enthält, der auf die Cannabinoid-Rezeptoren vom Typ 1 hemmend wirkt, bei der Blockade dieser Rezeptoren für körpereigene Cannabinoide deren stimmungsaufhellender Effekt ebenfalls unterdrückt und dadurch die negativen Gefühlszustände auftreten.
• Drittens weisen die Metaanalytiker noch auf ein auch hier beobachtbares und weit verbreitetes methodisches Manko von Übergewichts- und Abnehmstudien hin, nämlich dem Fehlen von Nachuntersuchungen nach Ende der aktiven Therapie und der Unmöglichkeit etwaige Gewichtszuwächse bewerten zu können.
Unabhängig davon, ob dies mit Vorsatz oder unbeabsichtigt eintritt, skizzieren die Forscher in diesem Zusammenhang folgendes Szenario der medikamentösen Intervention: "Wie bei anderen Appetitzüglern auch wird nach dem Beenden der Therapie ein Rückfall erwartet. Um ein dauerhaftes Gewicht und die Verbesserung der Risikofaktoren für das Herz-Kreislaufsystem und Diabetes beizubehalten, müssen die Medikamente lebenslang eingenommen werden." 2005 betrug der weltweite Umsatz mit Appetitzügler immerhin 1,2 Millarden US-Dollar.
Die Schlussfolgerungen der Wissenschaftler, die auch noch andere, in den USA laufende Debatten berücksichtigen, sind eindeutig: "Taken together with the recent US Food and Drug Administration finding of increased risk of suicide during treatment with rimonabant, we recommend increased alertness by physicians to these potentially severe psychiatric adverse reactions."
Die Ergebnisse des Aufsatzes "Efficacy and safety of the weight-loss drug rimonabant: a meta-analysis of randomised trials" von Robin Christensen, Pernelle Kruse Kristensen, Else Marie Bartels, Prof Henning Bliddal und Prof Arne Astrup (The Lancet 2007; 370:1706-1713) finden sich in einem Abstract.
Zusätzlich werden die Ergebnisse noch unter der Überschrift "Depression and anxiety with rimonabant" von Ph. Mitchell und M. Morris kommentiert (The Lancet 2007; 370:1671-1672).
Die jetzt veröffentlichten Erkenntnisse zu unerwünschten schweren Nebenwirkungen von Appetitzügler relativieren auch etwas optimistischere Ergebnisse, die ebenfalls in diesem Jahr in früheren Ausgaben des "Lancet" publiziert worden waren.
In dem Aufsatz "Drug treatments for obesity: orlistat, sibutramine, and rimonabant" von Padwal und Majumdar (The Lancet 2007; 369:71-77), für den es nur ein Abstract gibt, empfahlen die Autoren zwar einerseits "antiobesity treatment … for selected patients in whom lifestyle modification is unsuccessful." Andererseits verbanden sie dies mit einigen, wie wir jetzt wissen, nicht substanzlosen Warnungen: "In light of the lack of successful weight-loss treatments and the public-health implications of the obesity pandemic, the development of safe and effective drugs should be a priority. However, as new drugs are developed we suggest that the assessment processes should include both surrogate endpoints (ie, weight loss) and clinical outcomes (ie, major obesity-related morbidity and mortality). Only then can patients and their physicians be confident that the putative benefits of such drugs outweigh their risks and costs."
Parallel zu diesem Ergebnis veröffentlichten kanadische Forscher im "British Medical Journal (BMJ)" ihre Forschungsergebnisse zur Wirksamkeit von Rimonabant und zwei weiteren Appetitzüglern, Orlistat und Sibutramine.
Dazu reviewten sie die Ergebnisse von 30 doppelblinden, placebo-kontrollierten Studien, in denen fast 20.000 übergewichtige bzw. fettsüchtige Personen im Alter über 18 Jahren und mit einem Durchschnittsgewicht von 100 Kilogramm und einem Body Mass Index (BMI) von 35-36 Punkten eines der drei Medikamente mindestens ein Jahr einnahmen.
Am Ende der Interventionsphase waren die Orlistat-Patienten durchschnittlich 2,9 kg leichter, die Persionen, die Sibutramine einnahmen, waren 4,2 kg und die Rimonabant-Einnehmer sogar 4,7 kg leichter.
Alle Personen, die eines der drei Mittel einnahmen hatten auch eine höhere Wahrscheinlichkeit eine Gewichtsabnahme von 5-10% zu schaffen als die Personen, die ein Placebo einnahmen.
Dem standen in mehreren der reviewten Studien spezifische unerwünschte Effekte gegenüber und vor allem beendeten 30-40% der anfänglichen StudienteilnehmerInnen ihre Teilnahme vorzeitig. Solch hohen Drop-out-Raten sind zwar nicht selten, aber machen es noch schwerer, den Nutzen der medikamentösen Intervention tatsächlich zu bewerten.
Insgesamt blieb in den Studien auch ungeklärt, ob der Gewichtszuverlust stark genug war, um einen großen Gesundheits- und Lebenserwartungs-Nutzen damit zu realisieren. Teilweise untersuchten die Studien aber auch gar nicht den Effekt auf die Sterblichkeit oder das Neuauftreten (Inzidenz) spezifischer Erkrankungen.
Die Ergebnisse des Aufsatzes "Long term pharmacotherapy for obesity and overweight: updated meta-analysis" von Diana Rucker, Raj Padwal, Stephanie K Li, Cintia Curioni und David C W Lau (BMJ Online vom 15 November 2007) kann man sich als Abstract und als komplette 11-seitige PDF-Version als BMJ-Online-Veröffentlichung herunterladen.
Unter Berücksichtigung der kanadischen und dänischen Forschungsergebnisse weist der britische Mediziner Gareth Williams schließlich noch auf die besondere aktuelle Problematik der in den USA laufenden Zulassung einiger Anti-Obesity-Medikamente zum freien Verkauf ohne Verordnung hin: "Selling anti-obesity drugs over the counter will perpetuate the myth that obesity can be fixed simply by popping a pill and could further undermine the efforts to promote healthy living, which ist he only long term escape from obesity."
Bernard Braun, 19.11.2007
Deutsche sind die dicksten Europäer? Wie es zu einer Zeitungsente kam und was die neuesten Fakten sind
 Pressemeldungen und wissenschaftliche Studienergebnisse über die zunehmende Bedeutung von Übergewicht und Adipositas häuften sich bis vor kurzem vorwiegend jenseits des Atlantik oder Ärmelkanals. Von dort kamen auch Berichte über stets neue Gegenstrategien: Die "Lebensmittel-Ampel" auf Ernährungsprodukten, gesundes Schulessen, Werbeverbote im Kinderfernsehen, Volksläufe und auch die operative Magenverkleinerung. Eine sehr oberflächliche Datensammlung über die Verbreitung von Übergewicht in den EU-Ländern und daraus abgeleitete Schlagzeilen ("Deutsche sind die dicksten Europäer") brachten dann jedoch auch in Deutschland eine neue Präventionsdebatte ins Rollen. Es geschah im April 2007, als eine Meldung der hierzulande weithin unbekannten "International Association for the Study of Obesity (IASO)" in den Schlagzeilen nahezu aller TV-Sender, Tages- und Wochenzeitschriften auftauchte. "Deutsche sind die dicksten Europäer" hieß es da (Süddeutsche Zeitung), "Deutsche holen zweifelhaften Rekord - Europameister im Dicksein!" (Tagesschau) oder sprachverspielter: "Deutsche haben in Moppel-Liga den Bauch vorn" (Spiegel online).
Pressemeldungen und wissenschaftliche Studienergebnisse über die zunehmende Bedeutung von Übergewicht und Adipositas häuften sich bis vor kurzem vorwiegend jenseits des Atlantik oder Ärmelkanals. Von dort kamen auch Berichte über stets neue Gegenstrategien: Die "Lebensmittel-Ampel" auf Ernährungsprodukten, gesundes Schulessen, Werbeverbote im Kinderfernsehen, Volksläufe und auch die operative Magenverkleinerung. Eine sehr oberflächliche Datensammlung über die Verbreitung von Übergewicht in den EU-Ländern und daraus abgeleitete Schlagzeilen ("Deutsche sind die dicksten Europäer") brachten dann jedoch auch in Deutschland eine neue Präventionsdebatte ins Rollen. Es geschah im April 2007, als eine Meldung der hierzulande weithin unbekannten "International Association for the Study of Obesity (IASO)" in den Schlagzeilen nahezu aller TV-Sender, Tages- und Wochenzeitschriften auftauchte. "Deutsche sind die dicksten Europäer" hieß es da (Süddeutsche Zeitung), "Deutsche holen zweifelhaften Rekord - Europameister im Dicksein!" (Tagesschau) oder sprachverspielter: "Deutsche haben in Moppel-Liga den Bauch vorn" (Spiegel online).
Die "IASO" hatte eine Pressemitteilung herausgegeben und im Internet eine zweiseitige Tabelle veröffentlicht, in der Daten zur Häufigkeit von Übergewicht und Adipositas in 25 EU-Ländern dargestellt waren (IASO 2007). Am Schluss der Tabelle tauchten einige Hinweise auf: Dass die Stichproben der Länder hinsichtlich der Altersgruppen voneinander abweichen, dass unterschiedliche Erhebungsjahre vorliegen, dass (schwer vergleichbare) Ergebnisse aus Messungen und aus Befragungen verwendet wurden. Doch diese Hinweise wurden übergangen oder blieben unverstanden, war doch aus der Tabelle klar abzulesen, dass 75,4 Prozent der deutschen Männer einen BMI-Wert von über 25 aufweisen und damit auf der Europa-Rangliste für Übergewicht auf Platz 1 liegen.
Der "Gesundheitsmonitor" der Bertelsmann-Stiftung beschäftigt sich vor diesem Hintergrund in einer Extra-Ausgabe seines Newsletter mit dem Thema Übergewicht und Adipositas.
• Ein Beitrag von Helmert/Schorb gibt zunächst einen Überblick über die nationalen und internationalen Daten zur Häufigkeit und Verteilung von Übergewicht und Adipositas und eine Analyse zu deren zeitlicher Entwicklung 2002 bis 2006 in Deutschland anhand der im Gesundheitsmonitor erfassten Daten. Dabei zeigt zunächst ein internationaler Vergleich zur Adipositas in den OECD-Staaten: Deutsche sind keineswegs die dicksten Europäer. Die USA weisen insgesamt mit Abstand die höchste Rate auf (Männer 31,1 Prozent, Frauen 33,2 Prozent). Die beiden folgenden Ränge nehmen Griechenland und Neuseeland ein. Deutschland befindet sich unter den Ländern mit Befragungsdaten im Mittelfeld (Männer Rang 5, Frauen Rang 6). Allerdings wird auch deutlich, dass zwischen 2002 und 2005 für die drei gewählten Gewichtsklassen bei beiden Geschlechtern ein deutlicher Anstieg der Adipositas-Quoten und ein leichter Anstieg der Übergewichts-Quoten (BMI >= 25) zu verzeichnen ist. Der schon zuvor beobachtete Trend der Verbreitung von Übergewicht hält also auch in Deutschland an.
• In einem zweiten Beitrag gibt B.Braun eine Übersicht zu gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnissen über die Erreichbarkeit und Teilnahmebereitschaft der Bevölkerung an Präventionsmaßnahmen zu diesem Thema und zur Wirksamkeit der vielfältigen Interventionen. Die Überschrift des Artikels "Mehr Bescheidenheit in der Zielsetzung wäre angeraten" verdeutlicht die Kernbefunde. Einerseits zeigen fast alle Studien, dass nur ein verschwindend kleiner Teil jener Personengruppen, die aufgrund ihres BMI oder anderer Indikatoren zur Zielgruppe von Übergewichtsreduktions-Programmen gehören, auch zur Teilnahme an einem Programm (ganz gleich welcher Thematik), mobilisiert werden kann. Darüber hinaus wird aber aus der großen Mehrzahl zumindest der methodisch fundierten Studien deutlich, dass der längerfristige Erfolg von Interventionsmaßnahmen überaus bescheiden ist. Der Artikel zählt auch einige Ergebnisse auf, die sich als zentrale Voraussetzung für eine erfolgreiche Durchführung von Maßnahmen erwiesen haben. Dazu zählen etwa die Einbettung in die soziale Realität der Untersuchungsteilnehmer unter Einbeziehung der alltäglichen Lebensräume (Arbeit, Schule, Familie, Peer-Groups) oder auch eine gezielte Teilnehmer-Auswahl und eine klare konzeptionelle Orientierung auf die spezielle Zielgruppe anstelle der zumeist gängigen Ansprache an anonyme Bevölkerungskreise.
• Der Newsletter gibt abschließend noch einen Überblick über internationale Erfahrungen bei der Bekämpfung von Übergewicht und Adipositas durch kurze Länderberichte aus Kanada, den USA, Polen, Spanien und Japan und stellt beispielhaft Inhalte, Umfang und Wirksamkeit der dort durchgeführten Programme vor.
Hier finden Sie den Gesundheitsmonitor Newsletter Sonderausgabe 2007 - Übergewicht
Hier ist ein Anhang zum Newsletter mit Literaturangaben und Daten-Tabellen
Gerd Marstedt, 24.8.2007
Ganz dicke Freundschaften - Übergewicht wird beeinflusst von Normen im sozialen Netzwerk einer Person
 Die Gen-Forschung hat unlängst das sogenannte "FTO"-Gen entschlüsselt, deren Träger ein um 30 Prozent höheres Risiko haben, an Übergewicht oder Adipositas zu erkranken, bei bestimmten genetischen Eigenschaften beträgt das Risiko sogar 67%. Amerikanische Sozialstatistiker aus Boston, Cambridge und San Diego haben diese Entdeckung jetzt allerdings in den Schatten gestellt. Nach ihren Untersuchungsergebnissen sind soziale Normen und Wertmaßstäbe weitaus bedeutsamer für die Entstehung von Übergewicht als Erbanlagen. Sie fanden mit Daten der "Framingham-Studie" heraus, dass das Übergewichts-Risiko um bis zu 171 Prozent höher liegt, wenn engere Freunde ebenfalls übergewichtig sind.
Die Gen-Forschung hat unlängst das sogenannte "FTO"-Gen entschlüsselt, deren Träger ein um 30 Prozent höheres Risiko haben, an Übergewicht oder Adipositas zu erkranken, bei bestimmten genetischen Eigenschaften beträgt das Risiko sogar 67%. Amerikanische Sozialstatistiker aus Boston, Cambridge und San Diego haben diese Entdeckung jetzt allerdings in den Schatten gestellt. Nach ihren Untersuchungsergebnissen sind soziale Normen und Wertmaßstäbe weitaus bedeutsamer für die Entstehung von Übergewicht als Erbanlagen. Sie fanden mit Daten der "Framingham-Studie" heraus, dass das Übergewichts-Risiko um bis zu 171 Prozent höher liegt, wenn engere Freunde ebenfalls übergewichtig sind.
In der Studie wurden Daten von mehr als 12.000 Menschen über einen Zeitraum von 32 Jahren (1971-2003) analysiert und dabei zu mehreren Erhebungszeitpunkten unter anderem das Gewicht (anhand des Body-Mass-Index, BMI) erfasst. Berücksichtigt wurden in diesen Analysen auch die sozialen Zusammenhänge zwischen den Teilnehmern, ob es sich um Ehepartner handelte, Geschwister oder engere Freunde. Und erfasst wurde auch die räumliche Nähe zwischen diesen Personen. Auf diese Weise konstruierte man mit statistischen Modellen ein soziales Netzwerk, das darauf hin beobachtet wurde, wie sich im Zeitverlauf der BMI der Studienteilnehmer veränderte. Dabei unterschied man in der statistischen Analyse "Ego"-Personen als primäre Bezugspunkte innerhalb eines Netzwerks und "Alter"-Personen, also deren Ehepartner oder Geschwister, Freunde oder Nachbarn.
Die Datenauswertung kam dann zu einigen überraschenden Befunden:
• Wenn sich das Körpergewicht eines "Ego" zu einem Zeitpunkt t0 veränderte, dann hatte dies zu einem späteren Zeitpunkt t1 auch einen statistisch hoch bedeutsamen Einfluss auf Gewichtsveränderungen bei den "Alter"-Personen im sozialen Netzwerk.
• Die Wahrscheinlichkeit, ebenfalls Übergewicht zu bekommen (oder umgekehrt: deutlich abzumagern) war abhängig von der Art der Beziehung und besonders hoch unter gleichgeschlechtlichen engen Freunden oder Freundinnen.
• Das Risiko, einen BMI-Wert von über 30 aufzuweisen, betrug unter Ehepartnern 37%, unter Geschwistern 40%, unter engen Freunden 57%.
• Besonders hoch (171%) fiel das Risiko aus, wenn beide Personen des Netzwerks sich als enge Freunde bezeichneten. Sofern diese Freundschaft jedoch nur einseitig als solche erklärt wurde, zeigte sich kein Effekt mehr. Ebenso war für Nachbarn kein Zusammenhang zu beobachten.
• Das Geschlecht spielt eine große Rolle: Unter gleichgeschlechtlichen Freunden waren die Effekte deutlich höher.
• Die beobachteten Veränderungen zeigten sich dabei noch bis ins dritte Kettenglied, also dem Freund eines Freundes eines Freundes, und dies auch ganz unabhängig von der räumlichen Nähe.
In der Diskussion ihrer Befunde weisen die Wissenschaftler zunächst auf einige Detail-Ergebnisse hin, die zunächst naheliegende Interpretationen als unzutreffend ausweisen. So können die Ergebnisse nicht gedeutet werden nach dem Motto "Gleich und gleich gesellt sich gern". Es ist also nicht so, dass Übergewichtige sich nun einen Freundeskreis aussuchen, der sich aus Personen mit ebenfalls größerer Körperfülle zusammensetzt. Dagegen spricht zum einen, dass in den Daten Veränderungen des Körpergewichts zu verschiedenen Zeitpunkten erfasst wurden. Ansonsten hätte man schon zum Anfang der Erhebungen innerhalb eines persönlichen Netzwerks hohe Übereinstimmungen im BMI finden müssen. Zum andern zeigte sich in den Analysen auch, dass die gefundenen Zusammenhänge ganz unabhängig davon gelten, wie weit Personen voneinander entfernt leben.
Überprüft wurde von den Wissenschaftlern auch, inwieweit das Rauchen oder ein Verzicht auf das Rauchen eine Erklärung spielen könnte, etwa nach dem Prinzip: "Ego" hört auf zu rauchen, teilt dies (mit vielfältigen Hinweisen auf Gesundheitsrisiken oder andere Vorteile des Nichtrauchens) im sozialen Umfeld mit, woraufhin dort ebenfalls etliche Raucher ihr Laster aufgeben - und an Gewicht zunehmen. Tatsächlich zeigte sich jedoch, dass das zu verschiedenen Zeitpunkten ebenfalls erfasste Rauchverhalten keinen Einfluss auf die Körpergewichtsveränderungen im sozialen Netzwerk hat.
Die Forscher interpretieren ihre Befunde vielmehr als Effekt der Verbreitung von Normen und Wertmaßstäben in sozialen Netzwerken. Es hat sich nach ihren Befunden gezeigt, dass "die psychosozialen Mechanismen der Verbreitung von Übergewicht weniger auf einer Nachahmung von Verhaltensweisen beruhen als sehr viel mehr auf Änderungen in der generellen Wahrnehmung einer Person, was die gesellschaftliche Akzeptanz von Übergewicht anbetrifft. [...] So nimmt Ego vielleicht wahr, dass Alter an Körpergewicht zunimmt und kann dann eine Gewichtszunahme bei sich selbst eher als akzeptabel bewerten."
"Soziale Einflüsse", so erklärt James H. Fowler, einer der Autoren in einer Pressemitteilung seiner Universität, "sind sehr viel stärker als man bisher annahm. Es gab sehr umfassende Anstrengungen, um jene Gene zu finden, die für Übergewicht verantwortlich sind. Unsere Studie zeigt nun, dass man zumindest genau so viel Energie darauf verwenden sollte, die sozialen Aspekte des Lebens besser zu verstehen." Die politische Bedeutung ihrer Befunde schätzen die Wissenschaftler recht hoch ein, da sich die gefundenen sozialen Einflüsse über drei Stationen der Beziehung hinweg gezeigt haben. Von daher würde sich eine Public-Health-Maßnahme, die bei einer Person erfolgreich zu einem Verlust des Übergewichts führt, nicht nur bei dieser einen Person auswirken, sondern nach dem Schneeball-Prinzip bei einer Vielzahl weiterer Personen im sozialen Netzwerk. "Nicht nur dicke Personen wirken 'ansteckend', sondern auch dünne", erklärte Fowler.
• Die Studie ist hier im Volltext kostenlos als PDF verfügbar: The Spread of Obesity in a Large Social Network over 32 Years (New England Journal of Medicine, 2007;357:370-9)
• Hier ist das Editorial im New England Journal of Medicine nachzulesen, das sich mit der Bedeutung sozialer Netzwerke beschäftigt: Network Medicine - From Obesity to the "Diseasome"
• Hier ist die Pressemitteilung der University of California, San Diego
Gerd Marstedt, 27.7.2007
Ein unterschätztes Präventionshemmnis: Übergewichtige verdängen Probleme mit ihrer Körperfülle
 Fast ebenso schnell wie die Schlagzeilen über viel zu dicke Schulkinder oder Deutsche als dickste Europäer schossen in den letzten Wochen und Monaten auch die politischen Ad-hoc-Rezepte aus dem Boden: Mehr Aufklärung und Information über gesunde Ernährung, mehr Schulsport und für Erwachsene "Jeden Tag 3000 Schritte extra!". Was bei den (oft wenig innovativen) gesundheitspolitischen Ideen leider übersehen wurde: Verhaltensänderungen setzen eine Motivation voraus, erfordern, dass den übergewichtigen Hamburger-Fans und Bewegungsmuffeln ihr Übergewicht und damit verbundene Gesundheitsrisiken überhaupt als lösbare Problematik bewusst ist und nicht ständig durch Beschönigung verdrängt wird. Dass dies leider nur bei einer Minderheit der Fall ist, hat jetzt eine große US-amerikanische Studie gezeigt.
Fast ebenso schnell wie die Schlagzeilen über viel zu dicke Schulkinder oder Deutsche als dickste Europäer schossen in den letzten Wochen und Monaten auch die politischen Ad-hoc-Rezepte aus dem Boden: Mehr Aufklärung und Information über gesunde Ernährung, mehr Schulsport und für Erwachsene "Jeden Tag 3000 Schritte extra!". Was bei den (oft wenig innovativen) gesundheitspolitischen Ideen leider übersehen wurde: Verhaltensänderungen setzen eine Motivation voraus, erfordern, dass den übergewichtigen Hamburger-Fans und Bewegungsmuffeln ihr Übergewicht und damit verbundene Gesundheitsrisiken überhaupt als lösbare Problematik bewusst ist und nicht ständig durch Beschönigung verdrängt wird. Dass dies leider nur bei einer Minderheit der Fall ist, hat jetzt eine große US-amerikanische Studie gezeigt.
Knapp 2.000 erwachsene Amerikaner wurden im März 2007 von der "National Consumers League (NCL)", einer privaten, nichtkommerziellen Verbraucherschutz-Organisation, zu unterschiedlichsten Aspekten im Zusammenhang mit Körpergewicht und Ernährung, Übergewicht und Gesundheit befragt. Obwohl nach offiziellen US-Statistiken etwa 66% der Amerikaner übergewichtig sind (BMI* über 25) und davon etwa die Hälfte adipös (schwer übergewichtig, BMI > 30), gaben ganze 12% an, dass sie jemals von einem Arzt oder anderen medizinischen Experten auf ihr Übergewicht hingewiesen worden sind. In der Studie war bei den allermeisten Teilnehmern (96%) auch Körpergröße und Gewicht gemessen worden und stimmte sehr gut mit den offiziellen Daten überein (35% BMI 25-30, 34% BMI > 30).
Die Selbsteinschätzung der Befragten wich von den Messergebnissen jedoch erheblich ab - die korpulenteren Teilnehmer neigten in starkem Maße dazu, ihr Gewicht zu beschönigen. Während bei Normalgewichtigen nur 7% ihr Gewicht unterschätzten, stieg diese Fehleinschätzung in dem Maße an, je dicker die Befragten waren: Bei leichtem Übergewicht neigten bereits 30% zur Beschönigung ihrer Körpermasse, bei starkem Übergewicht waren es über 80 Prozent.
Dass hier ein Verdrängungsmechanismus vorliegt und viele übergewichtige Amerikaner wohl nachhaltig von schlechtem Gewissen und Selbstzweifeln geplagt sind, zeigen andere Ergebnisse der Studie:
• Knapp zwei Drittel (64%) sind unzufrieden mit ihrem Gewicht
• Über drei Viertel haben schon einmal ernsthaft versucht abzunehmen, die meisten dieser Gruppe berichten, dies sei das schwierigste Unterfangen in ihrem Leben gewesen
• Lediglich 20% der Befragten kennen ihren Body-Mass-Index
• 78% meinen, dass Übergewicht bzw. Adipositas eine ernsthafte chronische Erkrankung ist, die medizinischer Hilfe bedarf
• Zugleich sagen 61%, dass Übergewicht in den USA ein Tabu-Thema ist, über das man nicht reden kann
• Etwa die Hälfte gibt an, dass sie selbst "extrem stark motiviert" seien, um abzunehmen
Unter dem Strich wird damit deutlich, dass die Probleme des Übergewichts und damit verbundene Gesundheitsrisiken den meisten bewusst sind, dass viele auch schon (meist erfolglos) Verhaltensänderungen zur Gewichtsabnahme ausprobiert haben. Die Erfolglosigkeit bisheriger Bemühungen führt dann bei vielen zur Verdrängung des Problems: Man ist ja gar nicht sooo dick! Pure Informations- und Mitmachkampagnen dürften damit als Problemlösung weitgehend ins Leere laufen.
• Hier ist eine Pressemitteilung mit wichtigsten Befunden der US-Studie: New Obesity Survey: Many Americans Think They're 'Lighter' than They Are, Most NOT Being Told by A Doctor They Need to Lose Weight
• Zusammenfassender Report (PDF, 9 Seiten) Weight and Obesity in America
• Grafiken mit allen Ergebnissen (PDF, 61 Seiten) Chart-Pack: Weight and Obesity in America
Die Ergebnisse der US-amerikanischen Studie sind durchaus übertragbar auf deutsche Verhältnisse. Dies hat jetzt eine Umfrage der Privaten Krankenversicherung der Allianz zu den Themen Körpergefühl, Gewicht und Ernährungsgewohnheiten ergeben. Für die Studie waren 500 Bundesbürger ab 14 Jahren befragt worden. Zu dick fühlen sich der Umfrage zufolge lediglich 31 Prozent der Deutschen - dabei mehr Frauen (37%) als Männer (25%). Das überwiegend gute Gefühl der Befragten dem eigenen Gewicht gegenüber hat mit der Realität aber nur wenig gemein. Denn mehr als die Hälfte (55%) gibt an, dass sie nach dem wissenschaftlichen Kennwert zur Gewichtsbeurteilung, dem Body-Mass-Index BMI* übergewichtig sind. Dabei stufen sich 44 Prozent als leicht übergewichtig ein und weitere 11 Prozent als klar übergewichtig. Männer bewerten sind dabei eher zu dick (60%) als Frauen (51%).
Zwar ist die Vorgehensweise in der Umfrage nicht unproblematisch, denn man setzt die Kenntnis der BMI-Berechnung bei den Befragungsteilnehmern voraus: "Sie kennen sicher die Formeln, die einem rein rechnerisch das eigene Idealgewicht abhängig von der Größe angeben. Was würden Sie sagen, haben Sie danach ...?" Tatsächlich dürften diese Kenntnisse jedoch bei den wenigsten vorhanden sein. In der oben referierten US-amerikanischen Studie kannten gerade einmal 20 Prozent ihren BMI. Gleichwohl dokumentieren die Ergebnisse, insbesondere die Zufriedenheit mit dem eigenen Körpergewicht, dass hier bei vielen Übergewichtigen eine verfälschte Wahrnehmung vorliegt, die sich auch als massive Hürde gegenüber Präventionsmaßnahmen auswirken dürfte.
Eine Pressemitteilung mit den wichtigsten Ergebnissen der Umfrage ist hier zu finden: Rund, na und? Die meisten Deutschen fühlen sich mit dem eigenen Gewicht genau richtig
Das Chartbook mit Grafiken zu allen Umfrage-Ergebnissen kann per Email bei der Allianz Deutschland AG auf dieser Seite angefordert werden.
* BMI = Body Mass Index, wird so berechnet: 100 x Gewicht in kg / (Körpergröße in cm x Körpergröße in cm)
Gerd Marstedt, 27.6.2007