



Home | Patienten | Gesundheitssystem | International | GKV | Prävention | Epidemiologie | Websites | Meilensteine | Impressum
Sämtliche Rubriken in
"Epidemiologie"
Kinder und Jugendliche |
Alle Artikel aus:
Epidemiologie
Kinder und Jugendliche
Wer wird wie lange, mit welchem Erfolg und womit kieferorthopädisch behandelt? Erste Ergebnisse einer prospektiven Kohortenstudie
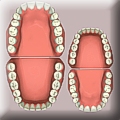 Nach einer durch eine Mitteilung des Bundesrechnungshofes im Jahr 2017 angestoßenen Debatte über die fehlende oder unzulängliche Transparenz über die kieferorthopädische Versorgung von Kindern und Jugendlichen, verständigten sich die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV), das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) und Fachverbände der Kieferorthopäden auf eine Reihe von Maßnahmen und Projekten (siehe dazu Näheres in dem hier vorgestellten Report). Dazu zählt auch das vom Spitzenverband Bund der GKV koordinierte Projekt einer retrospektiven Analyse von Behandlungsdaten. Zum Stand dieses Projekts gibt es bisher keine öffentlich zugänglichen Informationen oder gar Ergebnisse.
Nach einer durch eine Mitteilung des Bundesrechnungshofes im Jahr 2017 angestoßenen Debatte über die fehlende oder unzulängliche Transparenz über die kieferorthopädische Versorgung von Kindern und Jugendlichen, verständigten sich die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV), das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) und Fachverbände der Kieferorthopäden auf eine Reihe von Maßnahmen und Projekten (siehe dazu Näheres in dem hier vorgestellten Report). Dazu zählt auch das vom Spitzenverband Bund der GKV koordinierte Projekt einer retrospektiven Analyse von Behandlungsdaten. Zum Stand dieses Projekts gibt es bisher keine öffentlich zugänglichen Informationen oder gar Ergebnisse.
Etwas besser sieht es bei einem unabhängig davon seit längerem geplanten und laufenden prospektiven Projekts bei der Handelskrankenkasse (hkk) aus Bremen aus. Ein Wissenschaftlerteam aus dem Bremer Gesundheitswissenschaftler Bernard Braun und dem Greifswalder Kieferorthopäden Alexander Spassov will den möglichst gesamten Behandlungsverlauf einer Kohorte aller 2018 in der hkk versicherten Kinder und Jugendlichen untersuchen, die im selben Jahr mit einem indikationsgestützten Behandlungsplan erstmals eine kieferorthopädische Behandlung begonnen haben. Eine derartige prospektive Studie gibt es im Bereich dieser Versorgungsart bisher nicht und auch nur sehr selten in anderen Behandlungsbereichen.
Der jetzt veröffentlichte Teil 1 dieser Studie informiert u.a. über die soziodemografische Zusammensetzung der 2.920 Angehörigen der Kohorte und deren Kieferorthopädischen Indikationsgruppen (KIG) und einige erste Angaben zur Behandlung. Hinweise auf die im weiteren Verlauf der Studie beabsichtigten Analysen runden den Report ab. Der Abschlussbericht ist 2023 zu erwarten.
Zu den bereits jetzt gewonnenen Ergebnissen zählen u.a.:
• Auf die versorgungspolitisch interessante Frage, wie viele Kinder und Jugendliche eines Geburts- oder Altersjahrgangs in der Bundesrepublik Deutschland bis zum Ende ihres 18. Lebensjahres kieferorthopädisch behandelt werden, bewegen sich die diversen Schätzungen zwischen rund 30 bis über 60 %. Mit den Daten der Kohorte dieser Studie wurde jetzt berechnet, dass von einer Gruppe von 7-Jährigen (in diesem Alter beginnen kieferorthopädische Behandlungen in den allermeisten Fällen) bis sie 18 Jahre alt sind, 53,5% mindestens einmal kieferorthopädisch behandelt werden.
• Die hkk-Studie zeigt, dass der Anteil der Kinder mit einseitigem Kreuzbiss von 32 % bei den 7-jährigen auf 10,4 % bei den 11-jährigen, also um 67,5 % zurückgeht - und zwar ohne eine kieferorthopädische Behandlung. Damit scheint sich auch in Deutschland die in einer internationalen Studie gemachte Beobachtung einer "spontanen Korrektur" zu zeigen. Es stellt sich vor diesem Hintergrund nun nicht mehr die Frage, "Behandlung ja oder nein", sondern: "Sofort Behandeln oder erst einmal Abwarten und Beobachten bis die Kinder 11 Jahre alt sind". Über diese Möglichkeit einer Selbstkorrektur ohne kieferorthopädisches Zutun sollten Eltern (besser) informiert werden.
Der 25 Seiten umfassende hkk-Gesundheitsreport 2020 Kieferorthopädische Behandlung von Kindern und Jugendlichen Charakteristika einer Kohorte - Teil 1: Wer wird behandelt? von B. Braun und A. Spassov ist komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 22.5.20
Erste Schritte für mehr Transparenz über die Art, den Umfang und die Bedarfsgerechtigkeit der kieferorthopädischen Behandlung
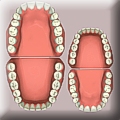 Wer den Eindruck hat, dass auffällig viele der 12- bis 15-Jährigen eine Zahnspange tragen und dann genau wissen will, wie viele Angehörige eines Altersjahrgangs denn kieferorthopädisch behandelt werden, in welchem Alter Behandlungen beginnen , warum sie behandelt werden, mit welchen Mitteln die Ziele erreicht werden, wie lange die Wirkung anhält und wie viel solche Behandlungen im Einzelnen die gesetzlichen Krankenkassen und die Eltern der SpangenträgerInnen kostet, bekommt bisher nahezu keine oder vage Antworten.
Wer den Eindruck hat, dass auffällig viele der 12- bis 15-Jährigen eine Zahnspange tragen und dann genau wissen will, wie viele Angehörige eines Altersjahrgangs denn kieferorthopädisch behandelt werden, in welchem Alter Behandlungen beginnen , warum sie behandelt werden, mit welchen Mitteln die Ziele erreicht werden, wie lange die Wirkung anhält und wie viel solche Behandlungen im Einzelnen die gesetzlichen Krankenkassen und die Eltern der SpangenträgerInnen kostet, bekommt bisher nahezu keine oder vage Antworten.
Er oder sie finden sich dabei in bester Gesellschaft, denn seit Beginn dieses Jahrhunderts haben u.a. sowohl der Gesundheitssachverständigenrat, AutorInnen eines HTA-Berichts für das "Deutsche Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI)" als auch jüngst der Bundesrechnungshof und zum jeweiligen Zeitpunkt auch einige WissenschaftlerInnen oder Teile der interessierten Öffentlichkeit die fehlende Intransparenz beklagt und auf die eigentümlich unterentwickelte oder evidenzarme/-lose kieferorthopädische Behandlungspraxis hingewiesen. Eine Reaktion der vertraglich verantwortlichen Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung (KZBV), des Berufsverbandes der Kieferorthopäden oder mit wenigen Ausnahmen der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) blieb häufig aus oder beschränkte sich auf ein apodiktisches und veränderungsresistentes "Die Behandlung ist gut, die Patienten sind zufrieden, also weiter so".
Eine der GKV-Ausnahmekassen war und ist die regional auf den Nordwesten Deutschlands konzentrierte Handelskrankenkasse Bremen (hkk), die bereits 2012 eine Befragung von kieferorthopädisch behandelten Kindern und Jugendlichen samt ihren Eltern durchführt. Eine andere war die damalige Barmer GEK, die im Rahmen des Gesundheitsmonitors der Bertelsmann Stiftung 2016 eine bundesweite Befragung von bei ihr krankenversicherten Kindern und Jugendlichen(ausgewählte Ergebnisse) durchführte, die gerade mit einer kieferorthopädischen Behandlung begonnen hatten oder eine Behandlung bereits abgeschlossen hatten.
2018 ermöglichte schließlich die hkk einer Forschergruppe aus dem Facharzt für Kieferorthopädie (Dr. med. dent. A. Spassov, Greifswald) und dem Gesundheitswissenschaftler (Dr. rer. pol. B. Braun, Bremen) eine erstmalige pionierhafte Analyse von zum Teil mehrjährig verfügbaren (2012 bis 2017) Abrechnungs- und Behandlungsdaten bzw. Routinedaten ihrer kieferorthopädisch behandelten jungen Versicherten. Zu den Hauptzielen gehörte die Machbarkeit solcher Analyse mit vorhandenen Daten zu demonstrieren und erste quantitative und qualitative Beispiele für die dabei zu erwartende Transparenz zu liefern und bewertbar zu machen. Zum Dritten war aber dabei klar, dass für eine völlige Transparenz und eine deutliche Verbesserung der Bedarfsgerechtigkeit und Wirtschaftlichkeit der an den Präferenzen der jungen PatientInnen und evidenzbasierten Erkenntnissen orientierte Behandlung noch wesentlich mehr und mit vielen Methoden geforscht werden muss. Trotzdem ergeben sich schon aus dem bereits Bekannten zahlreiche strukturelle, organisatorische und behandlungspraktische Schlussfolgerungen für die kieferorthopädische Versorgung.
Die wesentlichen Ergebnissen der Routinedatenanalyse lauten:
• Zahlreiche diagnostische Untersuchungen und therapeutische Maßnahmen werden ohne Notwendigkeit routinemäßig erbracht. Demnach werden fast alle Versicherten, unabhängig vom Alter und ohne Prüfung der kieferorthopädischen Erfordernis, mit Röntgenstrahlen untersucht.
• Zwei Drittel der Versicherten erhalten vor einer festen Spange eine herausnehmbare Apparatur. In den meisten Fällen wäre jedoch die ausschließliche Behandlung mit einer festsitzenden Apparatur zweckmäßig und wirtschaftlich. Eine feste Spange kommt zudem dem Wunsch der meisten Kinder und Jugendlichen nach einer möglichst kurzen Behandlung entgegen. Außerdem wirkt sie sich positiv auf Lebensqualität und Behandlungstreue aus, so ein wichtiges Ergebnis der Kinder-/Jugendlichenbefragungen.
• Schließlich ist die Behandlungsdauer mit bis zu drei Jahren zu lang und in den meisten Fällen nicht mit einem gesundheitlichen Bedarf begründbar.
• Ein spürbarer Anteil der kieferorthopädischen Behandlungen startet als so genannte Frühbehandlung im Alter von 7 oder 8 Jahren bereits im nicht bleibenden Milchgebiss. Sinnvoller wäre in den meisten Fällen, wenn überhaupt, mit einer Behandlung erst im bleibenden Gebiss zu beginnen.
Diese und zahlreiche weitere Ergebnisse sowie ein Überblick über die jahrzehntelange (Nicht)-Debatte über die Kfo-Behandlung und eine Reihe von Vorschlägen oder Denkanstößen für eine längst überfällige Reform der Behandlung und der für sie geltenden Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses aus dem Jahr 2004 finden sich im 72 Seiten umfassenden hkk-Gesundheitsreport 2018 Kieferorthopädische Behandlung von Kindern und Jugendlichen, der komplett kostenlos heruntergeladen werden kann.
Bernard Braun, 18.7.18
Wie wirkt sich ein Unterschied von einem Jahr beim Kita-Besuch auf die Persönlichkeitseigenschaften und auf Gesundheit aus?
 Das 1996 eingeführte Recht von Eltern auf einen Kindertageseinrichtungs-Platz (Kitaplatz) für ihre dreijährigen Kinder hat laut einer im April 2018 veröffentlichten Langzeitstudie mehr und vor allem längerfristigere und u.U. auch lebenslange positive Wirkungen auf nichtkognitive Persönlichkeitseigenschaften der Kinder als bisher angenommen.
Das 1996 eingeführte Recht von Eltern auf einen Kindertageseinrichtungs-Platz (Kitaplatz) für ihre dreijährigen Kinder hat laut einer im April 2018 veröffentlichten Langzeitstudie mehr und vor allem längerfristigere und u.U. auch lebenslange positive Wirkungen auf nichtkognitive Persönlichkeitseigenschaften der Kinder als bisher angenommen.
Auf Basis der Daten des "Nationalen Bildungspanels (NEPS)" untersuchten WissenschaftlerInnen des "Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW)" eine Reihe von Persönlichkeitseigenschaften von 4.579 Jugendlichen in der neunten Schulklasse, die früher oder später als mit drei Jahren einen Kitaplatz bekommen und genutzt hatten.
Beim Vergleich stellte sich heraus, dass Jugendliche, die Ende der 1990er Jahre als Kleinkind ein Jahr früher einen Kita-Platz erhielten als andere, in der neunten Schulklasse signifikant kommunikativer und durchsetzungsfähiger sind und mehr aus sich heraus gehen (Extraversion). Diese nichtkognitiven Fähigkeiten gelten als wichtig für den späteren Bildungs- und Arbeitsmarkterfolg sowie den späteren Erwerbsstatus und das Einkommen. Alles zusammen beeinflussen sie als soziale Ressourcen unmittelbar und mittelbar die gesundheitliche Entwicklung.
Die AutorInnen berücksichtigten schließlich noch das richtige Argument bzw. den Einwand, dass auch die Persönlichkeitseigenschaften der Eltern Einfluss auf die Persönlichkeit ihrer Kinder haben. Sie kommen in weiteren Berechnungen aber zu dem Schluss, dass "der positive Einfluss des frühen Kita-Besuchs auf die Extraversion (der Kinder) auch dann bestehen bleibt, wenn der Einfluss durch die Persönlichkeitseigenschaften der Eltern herausgerechnet wird."
Und auch die zwischenzeitliche Vorverlegung der Altersgrenze für den Kita-Besuch auf unter drei Jahren, verändert nach Meinung der AutorInnen nichts an den Unterschieden bei den Fernwirkungen eines früheren oder späteren Beginns des Kita-Besuchs.
Jenseits einiger immer noch laufenden familienpolitischen Debatten fordern die AutorInnen im Lichte ihrer Ergebnisse, dass der "Zugang zu früher Kinderbetreuung … grundsätzlich allen Kindern und ihren Eltern gewährt werden (sollte)". Dies sollte aber möglichst kostenlos möglich sein.
Die 10 Seiten umfassende Studie Früher Kita-Besuch beeinflusst Persönlichkeitseigenschaften bis ins Jugendalter von Maximilian Bach, Josefine Koebe und Frauke Peter ist im DIW-Wochenbericht Nr. 15 2018 erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 13.4.18
Weltweite Über- und Fehlversorgung von stationär behandelten Kindern mit Antibiotika zur Prophylaxe und nicht zur Behandlung
 Die ambulante Verschreibung von Antibiotika zur "Behandlung" meist viraler Infektionen der oberen Atemwege bei Kindern und Erwachsenen wird weltweit als wirkungslose Fehlversorgung, Verschwendung von Ressourcen und wegen der damit verbundenen Gefahr von Resistenzbildung kritisiert und mit vielfältigen Mitteln der Aufklärung von Ärzten und Patienten zu vermeiden versucht. Leider gibt es noch keinen durchschlagenden Erfolg.
Die ambulante Verschreibung von Antibiotika zur "Behandlung" meist viraler Infektionen der oberen Atemwege bei Kindern und Erwachsenen wird weltweit als wirkungslose Fehlversorgung, Verschwendung von Ressourcen und wegen der damit verbundenen Gefahr von Resistenzbildung kritisiert und mit vielfältigen Mitteln der Aufklärung von Ärzten und Patienten zu vermeiden versucht. Leider gibt es noch keinen durchschlagenden Erfolg.
Ein jetzt veröffentlichter Report über die Verordnung von Antibiotika für 6.818 von 17.693 Kindern in 226 pädiatrischen Klinikstationen in weltweit 41 Ländern an einem Stichtag im Jahr 2012 liefert ein noch problematischeres Bild:
• Es gab insgesamt 11.899 Verordnungen von Antibiotika.
• 28,6 % dieser Verordnungen erfolgten prophylaktisch. Dies bedeutet, dass von den stationär behandelten Kindern, die wenigstens eine Antibiotika-Verordnung erhielten, 32,9% (2.242 Kinder) Antibiotika erhielten, um eine potenzielle Infektion zu verhindern und nicht zur Behandlung einer vorhandenen Infektion.
• 26,6% aller dieser prophylaktisch verordneten Antibiotika wurden verordnet, um mit einer bevorstehenden Operation assoziierte mögliche Infektionen zu verhindern. Von diesen PatientInnen erhielten rund Dreiviertel das Antibiotikum länger als einen Tag. Die restlichen 73,4% wurden prophylaktisch gegen andere Typen einer möglichen Infektion verordnet.
• Auch im Krankenhaus war die Mehrheit der prophylaktisch verordneten Antibiotika (51,8%) Breitband-Antibiotika, was die Gefahr von damit bewirkten Mehrfachresistenzen erhöht.
• In 36,7% der Verordnungen wurden offensichtlich "für alle Fälle" gleichzeitig zwei oder mehr systemisch wirkende Antibiotika verordnet.
Die Vorschläge diese Verordnungspraxis durch mehr Aufklärung der verordnenden Ärzte über zum größten Teil vorhandene Behandlungs-Leitlinien und die stärkere Kontrolle der Umsetzung dieser Leitlinien zu verändern, wirken angesichts der eigentlich jedem Arzt bekannten Problematik einer derartigen Verordnungspraxis ziemlich hilflos.
Der Aufsatz High Rates of Prescribing Antimicrobials for Prophylaxis in Children and Neonates: Results From the Antibiotic Resistance and Prescribing in European Children Point Prevalence Survey. von Markus Hufnagel et al. ist am 22. März 2018 in der Fachzeitschrift "Journal of the Pediatric Infectious Diseases Society" veröffentlicht worden. Ein Abstract ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 23.3.18
USA: Gesundheitsausgaben mit Abstand Platz 1 - Säuglings- und Kindersterblichkeit "rote Laterne" unter 19 anderen OECD-Ländern
 Obwohl in den USA der weltweit höchste Anteil von derzeit rund 18% des Bruttoinlandsprodukts für die gesundheitliche Versorgung ausgegeben wird, haben die US-BürgerInnen in mehrerlei Hinsicht deutlich weniger davon als die BürgerInnen in Ländern mit zum Teil niedrigeren Gesundheitsausgaben. Dies konnte bisher vor allem an der Lebenserwartung gezeigt werden, die in den USA trotz der ständig wachsenden Gesundheitsausgaben in weiten Teilen der Bevölkerung sank.
Obwohl in den USA der weltweit höchste Anteil von derzeit rund 18% des Bruttoinlandsprodukts für die gesundheitliche Versorgung ausgegeben wird, haben die US-BürgerInnen in mehrerlei Hinsicht deutlich weniger davon als die BürgerInnen in Ländern mit zum Teil niedrigeren Gesundheitsausgaben. Dies konnte bisher vor allem an der Lebenserwartung gezeigt werden, die in den USA trotz der ständig wachsenden Gesundheitsausgaben in weiten Teilen der Bevölkerung sank.
Eine aktuelle Studie verglich die Entwicklung der Sterblichkeit von Säuglingen und 1-19 Jahre alten Kindern und Jugendlichen zwischen 1961 und 2010 in den USA und 19 anderen OECD-Ländern, also ebenfalls insgesamt wohlhabenden Ländern.
Die Ergebnisse bestätigten die bei der Lebenserwartung gezeigten Trends:
• Obwohl in allen wohlhabenden Ländern die Kindersterblichkeit seit vielen Jahrzehnten abnimmt, liegt die Kindermortalität in den USA seit den 1980er Jahren über der in vergleichbaren Ländern.
• Zwischen 2001 und 2010 war das Risiko der Säuglingssterblichkeit in den USA 76% höher als in den 19 anderen OECD-Ländern (darunter auch Deutschland).
• Im selben Zeitraum war das Risiko im Alter von einem bis 19 Jahren zu sterben in den USA um 57% höher als in den Vergleichsländern.
• Betrachtet man die gesamte Studienperiode von rund 50 Jahren führte die mangelnde Performance des US-Gesundheits- und Sozialsystem zu über 600.000 zusätzlichen Toten.
• Die hohe Sterblichkeit unter Jugendlichen beruht vor allem auf Verkehrsunfällen und Waffenattacken. So war das Risiko mit einer Waffe ermordet zu werden unter den 15-19-Jährigen in den USA 82mal höher als in den OECD19-Ländern.
Zwei Dinge zum Hintergrund und warum sich u.U. die kinder- und jugendlichenbezogenen Indikatoren in den USA künftig sogar noch verschlechtern werden:
• Aktuelle Studien weisen nach, dass nicht die Inanspruchnahme oder andere nachfrager-/patienten-/versichertenspezifischen Faktoren oder Verhaltensweisen für die Gesamtausgaben verantwortlich sind, sondern die gerade auch im internationalen Vergleich hohen Preise nahezu aller Anbieter.
• Ebenfalls aktuell versucht ein Teil der "Nadelstichpolitik" (an Stelle des vorläufig gescheiterten frontalen Versuchs an die Stelle von Obamacare Trumpcare zu setzen) der republikanischen Mehrheit im Parlament gegen jede Form der öffentlichen Gesundheitsversicherung dem speziell für Kinder armer Familien, die allerdings für die andere öffentliche Krankenversicherung Medicaid zu viel Geld verdienen, konzipierten "Children's Health Insurance Program (CHIP)" seit September 2017 den Geldhahn zuzudrehen bzw. enorme Kürzungen durchzusetzen (Stand Dezember 2017). Sollte der Kongress auch im Jahr 2018 kein oder deutlich zu wenig Geld für CHIP bewilligen und den für die Umsetzung von CHIP zuständigen Bundesstaaten überweisen, droht nach einer Berechnung in der New York Times vom 14.Dezember 2017 Ende Januar 2018 der Krankenversicherungsschutz von 4,9 Millionen Kindern in 16 Staaten, Ende Februar der von 5,6 Millionen Kindern in 24 Staaten und am Ende des Sommers der von insgesamt 8,4 Millionen Kindern in 46 Staaten einschließlich Washington D.C. verloren gehen. Schwer vorzustellen, dass sich dies nicht auch auf die Mortalität und Morbidität von Kindern und Jugendlichen auswirkt.
Der Aufsatz Child Mortality In The US And 19 OECD Comparator Nations: A 50-Year Time-Trend Analysis von Ashish P. Thakrar, Alexandra D. Forrest, Mitchell G. Maltenfort und Christopher B. Forrest ist im Januarheft 2018 der Zeitschrift "Health Affairs" (37 (1): 140-149) erschienen. Das Abstract ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 10.1.18
Auch Nützliches muss nicht immer und für alles nützlich sein. Das Beispiel Stillen.
 Auch wenn das Stillen sicherlich eine Menge physiologischer und psychischer Vorteile für Mütter wie Babies hat, sollte der mittel- und langfristige Nutzen für das Wachstum, die Normalgewichtigkeit und einen normalen Blutdruck der Kinder trotz einiger Belege durch Beobachtungsstudien nicht überschätzt werden.
Auch wenn das Stillen sicherlich eine Menge physiologischer und psychischer Vorteile für Mütter wie Babies hat, sollte der mittel- und langfristige Nutzen für das Wachstum, die Normalgewichtigkeit und einen normalen Blutdruck der Kinder trotz einiger Belege durch Beobachtungsstudien nicht überschätzt werden.
Dies ist jedenfalls das Ergebnis der Sekundäranalyse entsprechender Daten aus einer auf der Basis eines WHO-Programms in Weissrussland durchgeführten randomisierten kontrollierten Langzeitstudie von 13.557 Kindern mit durchschnittlich 16,2 Jahren (48,5% Mädchen/junge Frauen). Die Kinder in der Interventionsgruppe waren möglichst lange ausschließlich gestillt worden, die in der Kontrollgruppe deutlich weniger und kürzer (im Alter von drei Monaten waren 45% der Babies in der Interventions- und 6% in der Kontrollgruppe auuschließlich gestillt worden).
Die Ergebnisse:
• Eine höhere Intensität von Stillen war im Alter von 16 Jahren nicht mit einer geringeren Übergewichtigkeit oder einem niedrigeren Blutdruck assoziiert.
• Betrachtet man nur den Body Mass Index, war der bei den Kindern mit intensivem Stillen sogar höher als bei den weniger intensiv gestillten Kindern.
Die AutorInnen weisen einschränkend auf einige Schwierigkeiten der Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse hin und betonen, dass andere diskutierte positive Wirkungen des Stillens dieses durchaus rechtfertigen.
Der Aufsatz Effects of Promoting Long-term, Exclusive Breastfeeding on Adolescent Adiposity, Blood Pressure, and Growth TrajectoriesA Secondary Analysis of a Randomized Clinical Trial von Richard M. Martin et al. ist am 1. Mai 2017 in der Fachzeitschrift "JAMA Pediatrics" erschienen und als "online first"-Beitrag komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 7.5.17
Mit Evidenz gegen Überversorgung: Warum 60% eines Kinderjahrgangs nicht drei bis vier Jahre lang Zahnspangen tragen müssen!
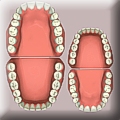 Die kieferorthopädische Behandlung von Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren gehört aus rein monetärer Sicht mit GKV-Ausgaben von rund 1 Milliarde Euro pro Jahr zu den vergleichsweise unauffälligen und daher in Debatten um Wirtschaftlichkeit durch Abbau von Über- oder Fehlversorgung kaum vorkommenden Ausgabenblöcken der GKV. Setzt man sich aber eine andere Brille auf und sieht dann u.a., dass es sich um eine Leistungen handelt, die rund 60% eines Altersjahrgangs junger GKV-Versicherten erhalten, damit eine 3 bis 4 Jahre dauernde Behandlung verbunden ist und ihre Eltern durch privat zu finanzierende Zusatzleistungen zusätzlich rund 2.000 Euro bezahlen, wirkt diese Behandlungsart keineswegs mehr so harmlos.
Die kieferorthopädische Behandlung von Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren gehört aus rein monetärer Sicht mit GKV-Ausgaben von rund 1 Milliarde Euro pro Jahr zu den vergleichsweise unauffälligen und daher in Debatten um Wirtschaftlichkeit durch Abbau von Über- oder Fehlversorgung kaum vorkommenden Ausgabenblöcken der GKV. Setzt man sich aber eine andere Brille auf und sieht dann u.a., dass es sich um eine Leistungen handelt, die rund 60% eines Altersjahrgangs junger GKV-Versicherten erhalten, damit eine 3 bis 4 Jahre dauernde Behandlung verbunden ist und ihre Eltern durch privat zu finanzierende Zusatzleistungen zusätzlich rund 2.000 Euro bezahlen, wirkt diese Behandlungsart keineswegs mehr so harmlos.
Dies trifft noch weniger zu, wenn man untersucht, ob und in welcher Weise im Lichte wissenschaftlicher Evidenz die gesamte Behandlung, die im internationalen Vergleich in Deutschland extrem lange Behandlung oder einzelne diagnostische und therapeutische Leistungen notwendig sind. Wie bei vielen anderen gesundheitsbezogenen medizinischen Leistungen ist man hierfür in Deutschland immer noch überwiegend auf Ergebnisse internationaler Studien angewiesen, die sowohl bei den gesetzlichen Krankenkassen als bei den zahnmedizinischen oder kieferorthopädischen Fachverbänden und gesetzlichen Vereinigungen bisher wenig Beachtung gefunden haben.
Der jüngste der insgesamt wenigen Versuche das eminenz- oder anbieterorientierte Wissen durch die Präsentation evidenzbasierter Informationen zu überwinden ist seit Juli 2015 der Blog mit dem programmatischen Titel "wenigeristmehrzahnspange" des in Greifswald praktizierenden Facharztes für Kieferorthopädie Dr. Alexander Spassov.
Dessen erklärtes Ziel lautet: "Mit Zahnspangen wird zu häufig, zu viel, zu lange - und vor allem aus unberechtigten Gründen behandelt. Mit wissenschaftlich gesicherten Informationen können unnötige Zahnspangen besser vermieden werden."
In der stetig wachsenden Anzahl von übersichtlichen und verständlichen aber immer mit Links zu wissenschaftlicher Literatur gut belegten Beiträgen werden z.B. folgende Themen angesprochen: "Das Ziehen von Zähnen für die Zahnspangenbvehandlung ist häufig unnötig", "Nichtbehandlung nahezu immer eine Alternative zur Zahnspangenbehandlung", "Tragekomfort und Mundhygiene: Selbst zu zahlende Brackets mit Selbstschließmechanismus NICHT besser als Brackets auf Kasse (ohne Selbstschließungsmechanismus)", "Welchen Nutzen hat eine Frühbehandlung mit Zahnspange?" und "Im Röntgenrausch - Warum Röntgenbilder für die Zahnspangenbehandlkung überflüssig sind und die Gesundheit der Patienten unnötig gefährden".
Zusammen mit den Erkenntnissen einer ersten bereits veröffentlichten empirischen Studie über die kieferorthopädische Versorgung der bei der Handelskrankenkasse Bremen (hkk) versicherten Kindern aus deren und ihrer Eltern Sicht (vgl. dazu den Forumsbeitrag "Generation Zahnspange": Wie notwendig, nützlich oder belastend ist die kieferorthopädische Behandlung aus Betroffenensicht?! und einer demnächst publik werdenden bundesweiten Studie, rundet sich langsam ein Bild ab, das die Ansatz- und Schwerpunkte für eine evidenzbasierte Neuformulierung der geltenden Richtlinien für diese Versorgungsart anzeigt.
Die Website "wenigeristmehrzahnspange" lohnt sich nicht nur für Eltern mit Kindern zwischen 8 und 14 Jahren, sondern auch für Menschen, die sich kritisch mit der Pathologisierung und Therapeutisierung von Zuständen beschäftigen, die nichts mit Gesundheit zu tun haben.
Bernard Braun, 15.9.16
Prävention für Kinder okay, aber müssen sie dafür unbedingt "krankgeforscht" werden?
 Um es vorweg zu sagen: Nichts spricht gegen gezielte präventive Gesundheitsangebote für Kinder und Jugendlichen im Setting Schule oder in anderen Settings und auch prinzipiell nichts gegen dafür konzipierte Angebote wie z.B. fit4future.
Um es vorweg zu sagen: Nichts spricht gegen gezielte präventive Gesundheitsangebote für Kinder und Jugendlichen im Setting Schule oder in anderen Settings und auch prinzipiell nichts gegen dafür konzipierte Angebote wie z.B. fit4future.
Worüber aber etwas gründlicher nachgedacht werden sollte, sind die dafür häufig genutzten dramatisierenden Beschreibungen einer Verschlechterung des Gesundheitszustandes von Kindern in den letzten Jahren bzw. die häufig daraus linear abgeleiteten pessimistischen Prognosen ihres künftigen Gesundheitszustands.
Diese folgen meist einem Argumentationsmuster, das einer der profundesten Kenner der Geschichte des Heilens, Roy Porter, bereits 1997 (deutsch 2000) am Ende seiner "Geschichte des Heilens" so beschrieb: "Ängste und Eingriffe schrauben sich immer höher wie eine außer Kurs geratene Rakete" und zwar als "Teil eines Systems, in dem ein wachsendes medizinisches (und auch nichtmedizinisches - Anmerkung bb) Establishment angesiuchts einer immer gesünderen Bevölkerung dazu getrieben wird, normale Ereignisse…zu medikalisieren, Risiken zu Krankheiten zu machen und einfache Beschwerden mit ausgefallenen Prozeduren zu behandeln. Ärzte und 'Konsumenten' erliegen zunehmend der Vorstellung, dass jeder irgendetwas hat, dass jeder und alles behandelt werden kann." (S. 717)
Ob zu dem erwähnten nichtmedizinischen Establishment auch präventionsorientierte Krankenkassen gehören, soll am Beispiel einer von der gesetzlichen Krankenkasse DAK am 26.4.2016 veröffentlichten Studie beleuchtet werden. Unter den Überschriften "Immer mehr Grundschüler haben Gesundheitsprobleme" und "Gesundheitsfalle Schule" kommt die Studie zu dem Schluss "Konzentrationsschwäche, Verhaltensauffälligkeiten, Bewegungsdefizite - gesundheitliche Probleme bei Grundschülern haben in den letzten zehn Jahren stark zugenommen." Es handelt sich um das Ergebnis einer bundesweiten telefonischen Befragung von 500 repräsentativ ausgewählten Lehrern der Klassenstufen 1 bis 6, die dabei u.a. um ihre retrospektive Einschätzung zur Veränderung der Schülergesundheit in den letzten 10 Jahren gebeten wurden. Hinzu kamen Fragen zu den möglichen Gründen der wahrgenommenen Veränderungen und Fragen zur eigenen Gesundheit.
Die wichtigsten Ergebnisse lauten auf den ersten Blick so:
• 49% der Lehrer gaben an, dass die Anzahl der Schüler mit gesundheitlichen Problemen innerhalb der letzten zehn Jahre etwas zugenommen habe, 20% haben den Eindruck, die Anzahl habe stark zugenommen.
• Im Verlaufe der ersten vier bis sechs Schuljahre nahmen 2% der Lehrer eine starke Verschlechterung des generellen Gesundheitszustandes der Schüler wahr, 29% meinten, dass sich dieser in diesem Zeitraum etwas verschlechtert habe.
• 54% der Lehrer sagen, Konzentrationsprobleme hätten stark zugenommen, 45% sagen dies für Verhaltensauffälligkeiten und 14% für Übergewicht.
• Zu den möglichen "Ursachen von Stress" bei den Kindern zählen 91% der Lehrer u.a. die mediale Reizüberflutung, 83% den Erwartungsdruck seitens der Eltern und 36% die Leistungsforderungen in der Schule.
• Trotz dieses auf den ersten Blick existierenden Bedarfs an Prävention, sind eher entsprechende Angebote eher selten. So gaben zwar knapp 60 % der Lehrer an, an ihrer Schule gäbe es Bewegungsangebote für die Pausen. Seltener sind in den Unterricht integrierte Bewegungspausen abseits des Schulsports (29%) oder Sportförderunterricht für Schüler mit motorischen Defiziten (16 %). Auch Rückzugs- und Entspannungsmöglichkeiten für Schüler nannten nur 18 % der Lehrer als Schulangebot. Gesundheitsförderung für die Lehrkräfte steht noch seltener auf dem Stundenplan: Nur 9 % der Befragten gaben an, dass solche Maßnahmen an ihrer Schule existierten.
Ein zweiter Blick auf die Ergebnisse zeigt aber, dass es sich bei einem Teil der Verschlechterung des Gesundheitszustandes von Grundschülern möglicherweise um durch die Konzentration auf den Schulalltag verengte Wahrnehmungen von Lehrern, Fehleinschätzungen oder um eine erhebliche Überschätzung handelt.
Ein erstes Indiz ist, dass die Lehrer keineswegs eine einhellige Einschätzung abgaben. So schätzten die über 50-jährigen Lehrer die Gesundheitssituation der Kinder wesentlich schlechter ein als ihre jüngeren KollegInnen. Von den älteren LehrerInnen sagten 25%, die Anzahl stark gesundheitlich beeinträchtigter SchülerInnen habe stark zugenommen. Von den jüngeren, d.h. bis 39-jährigen LehrerInnen, sagten dies 5%. Eine mögliche Erklärung ist, dass ältere LehrerInnen selber gesundheitlich angeschlagen sind, dadurch schlechter mit den SchülerInnen zurechtkommen und dies u.a. darauf zurückführen, dass diese stressiger und letztlich ungesünder geworden sind. Dafür spricht auch der in der DAK-Befragung ebenfalls abgefragte selbst wahrgenommene Gesundheitszustand der LehrerInnen: Während 13% der bis zu 39 Jahre alten Befragten sagen, er wäre weniger gut oder schlecht sind dies unter den über 50-Jährigen bereits 30%. Schließlich leiden retrospektive Einschätzungen von Veränderungen über längere Zeiträume je nach Thema erwiesenermaßen an deutlichen Unter- oder Überschätzungen des bewerteten Phänomens und sollten daher generell mit Vorsicht genutzt werden.
Ein zweites Indiz ergibt sich aus dem Vergleich der in der qualitativ hochwertigen repräsentativen KIGGS-Studie ("Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland") mittels Befragungen von rund 17.000 oder 12.000 drei- bis siebzehnjährigen Kindern bzw. ihren Eltern in einer Basiserhebung (2003/2006) und einer Folgebefragung (2009/12) erhobenen umfassenden Daten zur Kinder- und Jugendlichengesundheit.
Die wesentlichen Ergebnisse (vgl. ausführlicher die Basispublikation zur Welle 1 und den Überblick über die Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland: Wichtige Ergebnisse der ersten Folgebefragung (KiGGS Welle 1)) sehen zwar in manchen Bereichen auch kritisch aus, was Veränderungen oder gar Verschlechterungen angeht aber deutlich weniger dramatisch aus:
• Fast unverändert rund 90% der Eltern, Kinder und Jugendlichen bezeichnen den allgemeinen Gesundheitszustand als sehr gut oder gut. Für Jugendliche ab 11 Jahre "ist die subjektive Gesundheit…heute so gut wie selten zuvor."
• "Seit der KiGGS-Basiserhebung (2003 bis 2006) ist die Häufigkeit von Asthma bronchiale und Heuschnupfen leicht gestiegen, besonders bei Kindern bis sechs Jahre und hier vor allem bei Mädchen. Für Neurodermitis ist dagegen ein leicht rückläufiger Trend zu beobachten."
• "Fünf Prozent der 7- bis 17-Jährigen hatten mindestens einmal Migräne, 1,2 Prozent leiden an Epilepsie und 0,2 Prozent sind an Diabetes erkrankt. Erkrankungen an Windpocken und Keuchhusten sind in den Zielgruppen für die veränderten Impfempfehlungen deutlich zurückgegangen."
• "Im Vergleich mit der KiGGS-Basiserhebung sind Unfallhäufigkeit, Unfallorte sowie Alters- und Geschlechtsverteilung weitgehend gleich geblieben."
• "Bei jedem fünften Kind (20,2 Prozent) zwischen 3 und 17 Jahren können Hinweise auf psychische Störungen festgestellt werden. Die Häufigkeit (Prävalenz) ist damit seit der KiGGS-Basiserhebung unverändert."
• Und selbst die öffentlich heftig kommunizierte Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) wurde lediglich "bei 5 Prozent der Kinder und Jugendlichen (3 bis 17 Jahre) … jemals ärztlich oder psychologisch diagnostiziert": "Die Häufigkeit hat sich seit der KiGGS-Basiserhebung nicht verändert."
• "Der Anteil der Kinder und Jugendlichen mit mindestens einem Besuch bei einer Kinderärztin oder Kinderarzt pro Jahr nahm seit der KiGGS-Basiserhebung zwar um 8,7 Prozentpunkte zu. Dieser Anstieg kann unter anderem mit zusätzlich eingeführten Leistungen wie U-Untersuchungen und Impfungen erklärt werden."
Selbst wenn man die methodischen Unterschiede und die etwas jüngere Zusammensetzung der von den Lehreren beurteilten Kinder berücksichtigt, handelt es sich offensichtlich um zwei Welten. Für eine verstärkte gezielte Prävention im Setting Schule reichen aber auch die Risiokoprävalenzen aus den KIGGS-Untersuchungen vollkommen aus.
Die Folienpräsentation - und im Moment auch nur die - der wichtigsten und nach Alter und Geschlecht differenzierten Ergebnisse der Studie DAK-Studie 2016: Gesundheitsfalle Schule - Probleme und Auswege ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 28.4.16
Über- oder Fehlversorgung: Über 50% der US-Kinder/Heranwachsenden mit antipsychotischen Arzneimitteln bekamen sie ohne Diagnose
 Der gelegentliche Einwand gegen Forschungsprojekte über gesundheitsbezogene Behandlungen, das worüber mehr Transparenz geschaffen werden solle, sei doch reichlich an den Haaren herbeigezogen und gegen Ärzte voreingenommen, erweist sich häufig bei genauerem Hinsehen als unberechtigt und selber parteilich.
Der gelegentliche Einwand gegen Forschungsprojekte über gesundheitsbezogene Behandlungen, das worüber mehr Transparenz geschaffen werden solle, sei doch reichlich an den Haaren herbeigezogen und gegen Ärzte voreingenommen, erweist sich häufig bei genauerem Hinsehen als unberechtigt und selber parteilich.
Dies zeigt ein aktuelles Beispiel einer etwas genaueren Analyse der Verordnungen von antipsychotischen Arzneimittel, also alles andere als harmlosen Mitteln, für us-amerikanische Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zwischen einem und 24 Jahren in den Jahren 2006 und 2010.
Das Ergebnis lautet:
• Für 57% und 67% der Angehörigen dieser Bevölkerungsgruppe fanden die WissenschaftlerInnen weder aus dem ambulanten noch aus dem stationären Bereich dokumentierte Hinweise auf eine diagnostizierte psychische Erkrankung oder Beschwerde.
• Damit ist es auch trotz aller auch im US-Gesundheitswesen verbreiteten Rufe nach Qualität nicht möglich, die Angemessenheit der Verordnung zu überprüfen.
• Dass daran aber gezweifelt werden darf, zeigt ein weiteres Ergebnis: Obwohl gerade bei psychischen Leiden fachlich geboten, stammten die Verordnungen der spezifischen Arzneimittel nur bei etwas mehr als einem Drittel der PatientInnen von Kinder- oder Heranwachsendenpsychiatern.
• Wenn es Diagnosen gab, waren Depressionen, bipolare und Angststörungen unter den 18- bis 24-Jährigen am häufigsten. In der Gruppe der unter 18-Jährigen stand ADHD an der Spitze.
Obwohl die Verordnung der antipsychotischen Medikamente zwar in Leitlinien nur für schwere Fälle vorgeschlagen wird, fördert ein Blick auf die sonstige Behandlung diesbezüglich Zweifel. Nur 13,5% bis 24,8% der MedikamentennutzerInnen erhielten auch noch eine fachlich empfohlene psychotherapeutische Behandlung.
Man darf gespannt sein, welche Ergebnisse eine vergleichbare Studie in Deutschland oder außerdem für Erwachsene über 24 Jahre zu Tage fördern würde.
Der Aufsatz Treatment of Young People With Antipsychotic Medications in the United States von Mark Olfson et al. ist am 1. Juli 2015 als Onlinepublikation der Fachzeitschrift "JAMA Psychiatry" erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 3.7.15
Je nach Thema bewirken auch Arzt-Ratschläge nichts: Das Beispiel Impfen.
 Entscheidungen für oder gegen eine gesundheitsbezogene Maßnahme (z.B. Auswahl eines Krankenhauses, Durchführung einer Früherkennungsuntersuchung) hängen oft von der Kommunikation mit Ärzten bzw. deren Empfehlungen ab. Dass dies nicht immer der Fall sein muss, wo also gute Aufklärung durch Ärzte wirkungslos ist, zeigt eine gerade veröffentlichte randomisierte kontrollierte Studie über die Häufigkeit mit der Eltern zögern, ihre Kinder impfen zu lassen und die Selbstwirksamkeit von Ärzten.
Entscheidungen für oder gegen eine gesundheitsbezogene Maßnahme (z.B. Auswahl eines Krankenhauses, Durchführung einer Früherkennungsuntersuchung) hängen oft von der Kommunikation mit Ärzten bzw. deren Empfehlungen ab. Dass dies nicht immer der Fall sein muss, wo also gute Aufklärung durch Ärzte wirkungslos ist, zeigt eine gerade veröffentlichte randomisierte kontrollierte Studie über die Häufigkeit mit der Eltern zögern, ihre Kinder impfen zu lassen und die Selbstwirksamkeit von Ärzten.
An der Studie im US-Bundesstaat Washington beteiligten sich 56 Kliniken und 347 jungen Mütter. Bevor die Mütter in der Interventionsgruppe unmittelbar nach der Geburt eines gesunden Kindes umfassend und mittels eines 45-minütigen persönlichen Gesprächs über den Nutzen und die Risiken von Impfungen informiert wurden bewegte sich der Anteil impfzögerlicher Mütter nach eigenen Angaben zwischen 9,8% und 7,5%. In der Kontrollgruppe bewegte sich dieser Anteil zwischen 12,6% und 8%. In einer zweiten Befragung nach rund 6 Monaten unterschieden sich die Anteile der Mütter, die zögerten ihre Kinder impfen zu lassen bzw. der Grad der Selbstwirksamkeit der Ärzte, nicht und bewegten sich in beiden Gruppen um die 8%.
Offensichtlich sind Vorbehalte und Befürchtungen vor dem Impfen so stark untermauert, dass selbst kognitive und motivationale Aufklärung durch Ärzte wirkungslos sind.
Von dem am 1. Juni 2015 online in der us-amerikanischen Fachzeitschrift "Pediatrics" veröffentlichten Aufsatz Physician Communication Training and Parental Vaccine Hesitancy: A Randomized Trial von Nora B. Henrikson et al. gibt es das Abstract kostenlos.
Bernard Braun, 1.6.15
Das Neueste aus dem Reich der "Gesundheits"wirtschaft: Reine Muttermilch mit einem kräftigen Schuss Kuhmilch.
 Auch wer die lange Liste der vorsätzlich oder fahrlässig bestenfalls unschädlichen (z.B. zahlreiche Vitaminpräparate oder Nahrungsergänzungsmittel) oder auch gesundheitsgefährdenden (z.B. Silikonimplantate für die weibliche Brust) Produkte der Gesundheitswirtschaft zu kennen glaubt, merkt in regelmäßigen Abständen, dass die schlimmsten Befürchtungen im Zeichen hemmungsloser Gewinnsucht noch getopt werden können.
Auch wer die lange Liste der vorsätzlich oder fahrlässig bestenfalls unschädlichen (z.B. zahlreiche Vitaminpräparate oder Nahrungsergänzungsmittel) oder auch gesundheitsgefährdenden (z.B. Silikonimplantate für die weibliche Brust) Produkte der Gesundheitswirtschaft zu kennen glaubt, merkt in regelmäßigen Abständen, dass die schlimmsten Befürchtungen im Zeichen hemmungsloser Gewinnsucht noch getopt werden können.
Für das neueste Beispiel muss man zuerst einmal auf den Gedanken kommen, es gäbe hier überhaupt etwas aufzudecken. Es geht um die Güte von über Internetanbieter erhältlichen Muttermilchkonserven. Eltern, die für ihr Kind Muttermilch kaufen wollen, machen dies, weil die Mutter ihr Kind nicht selber stillen kann oder will, weil sie ihrem Kind alle nachgewiesenen Vorteile der Muttermilch zugutekommen lassen wollen und/oder weil - und hier endet die reine Geldmacherei mit teurer "Muttermilch" - ihr Kind gegen Kuhmilch allergisch ist oder sie nicht verträgt. Trotz einiger Warnungen der US Food and Drug Administration (FDA) vor nicht eindeutig überwachten "SpenderInnen" und Anbietern nahm die Anzahl der auf entsprechenden Websites plazierten Angebote von Muttermilch ständig auf aktuell mindestens 13.000 pro Jahr zu.
Eine Gruppe von us-amerikanischen Kinderernährungsexperten und Biologen beschloss nun, stichprobenartig und anonym zu überprüfen, ob die Qualitätsversprechen der Wirklichkeit entsprechen. Sie bestellten dafür 102 der als Muttermilch angepriesenen Produkte.
Das Ergebnis einer aufwändigen zweistufigen Inhaltsanalyse lautete:
• 11 der Produkte (11%) enthielten eindeutig nicht nur menschliche, sondern auch Kuhmilch.
• Zehn dieser 11 Produkte enthielten mindestens 10% flüssige Kuhmilch, was den häufig im Nahrungsmittelgeschäft benutzten Hinweis unglaubwürdig macht, das Produkt enthielte lediglich "Spuren", die "rein zufällig" in es gekommen sind. Hier wurde also mit voller Absicht gemixt und damit die genannten gesundheitlichen Risiken billigend in Kauf genommen.
Auch hier erweist sich also die Hoffnung auf Skrupel, Selbstkontrolle oder "social responsibility" der Hersteller solcher "Gesundheits"produkte als problematisch und könnten sich wesentlich härtere Kontrollen durch unabhängige öffentliche Einrichtungen und entsprechende Strafen bei so eindeutig schädigendem Verhalten als die einzig wirksame Alternative erweisen.
Dies gilt leider auch für den Appell der WissenschaftlerInnen, Eltern und Kinderärzte sollten sich trotz ihrer relativen Ohnmacht dieser Risiken bewusst sein: "Because buyers have little means to verify the composition of the milk they receive, all should be aware of the possibility that it may be adulterated. Pediatricians who care for infants should be aware that milk advertised as human is available via the internet, and some of it may not be 100% human milk."
Der Aufsatz Cow's Milk Contamination of Human Milk Purchased via the Internet von Sarah A. Keim et al. ist kostenlos online erschienen und wird gedruckt am 5. Mai 2015 in der Fachzeitschrift "Pediatrics" (Volume 135) erscheinen.
Bernard Braun, 6.4.15
Schadstoffbelastung von Schulgebäuden (k)ein Thema für die Generationengerechtigkeit
 Egal, ob es um die "schwarze Null" oder um die Finanzierung der Altersrenten geht, spielt die Generationengerechtigkeit bzw. das Nicht-Hinterlassen von finanziellen Lasten der heutigen Gesellschaft für die künftigen Generationen eine tragende rhetorische Rolle. Dass dies nicht für alle und noch nicht einmal die schwersten und nachhaltigsten Lasten gilt, zeigt eine gerade erschienene Publikation über die Belastung von Schulen und anderen öffentlichen Gebäuden sowie ihren NutzerInnen mit erwiesenermaßen gesundheitsschädlichen Stoffen.
Egal, ob es um die "schwarze Null" oder um die Finanzierung der Altersrenten geht, spielt die Generationengerechtigkeit bzw. das Nicht-Hinterlassen von finanziellen Lasten der heutigen Gesellschaft für die künftigen Generationen eine tragende rhetorische Rolle. Dass dies nicht für alle und noch nicht einmal die schwersten und nachhaltigsten Lasten gilt, zeigt eine gerade erschienene Publikation über die Belastung von Schulen und anderen öffentlichen Gebäuden sowie ihren NutzerInnen mit erwiesenermaßen gesundheitsschädlichen Stoffen.
Auf rund 400 Seiten wird erstens über die Belastung öffentlicher und damit überwiegend für die schulische Versorgung von Kindern und Jugendlichen vorhandenen Gebäude mit erwiesenermaßen gefährlicher Stoffe wie Flammschutzmitteln, Pestiziden, Asbest, Lösungsmitteln und Polychlorierten Biphenylen (PCB) berichtet. Ferner stellt der Autor, Biologe und Fachtoxikologe, die Risiken für die Gesundheit - insbesondere von Kindern und Jugendlichen - dar. Abgerundet wird dies durch die Darstellung dessen, was ein "Kartell von Behörden, Industrie und firmen-abhängigen Gutachtern, welches die Gefahren meist verharmlost und wirksame Sanierungen verhindert", tut, um sowohl das Bekanntwerden dieser intergenerativen Risiken und Lasten als auch sofortige Gegenmaßnahmen zu verhindern. Welche praktische Maßnahmen zum Gesundheitsschutz und zur Sanierung von Gebäuden sinnvoll und möglich wären, zeigt das Buch ebenfalls. In allen Teilen wird die Darstellung durch konkrete Fallbeispiele plastischer.
Das Buch Schadstoffe an Schulen und öffentlichen Gebäuden - Toxikologie, chronische Krankheiten - und wie Behörden und Gutachter damit umgehen von Hans-Ulrich Hill kann komplett kostenlos heruntergeladen werden.
Dass der Buchtext über die Website der industriekritischen "Coordination gegen BAYER-Gefahren" erhältlich ist, liegt daran, dass der Chemiekonzern Bayer zusammen mit anderen Chemieunternehmen (z.B. Monsanto) zu den Herstellern zahlreicher dieser Gefahrstoffe gehörte und gehört und weder frühzeitig über das längst bekannte Gefahrenpotenzial ihrer Produkte aufgeklärt hat noch sich an den Kosten der Sanierung oder der Schadenersatzforderungen der Opfer solcher Stoffe beteiligt hat oder zu beteiligen gezwungen wurde.
Bernard Braun, 22.3.15
Zum gesundheitlichen Nutzen einer längeren hellen Abendzeit für Kinder. Nachdenkenswertes vor der Abschaffung der Zeitumstellung.
 So sicher wie das Amen in der Kirche, werden in vielen Ländern zweimal pro Jahr in weltweit 70 Ländern die Uhren umgestellt und wird ebenso sicher über den Nutzen für die Energiebilanz aber auch die gesundheitlichen Effekte dieser Umstellung diskutiert.
So sicher wie das Amen in der Kirche, werden in vielen Ländern zweimal pro Jahr in weltweit 70 Ländern die Uhren umgestellt und wird ebenso sicher über den Nutzen für die Energiebilanz aber auch die gesundheitlichen Effekte dieser Umstellung diskutiert.
Der am 23. Oktober 2014 auf der Website "Spektrum der Wissenschaft" veröffentlichte Überblicksartikel "Schadet die Zeitumstellung wirklich der Gesundheit? kommt zu einem durchwachsenen Urteil: die erhoffte Energiersparnis findet höchstwahrscheinlich nicht statt, dauerhafte und gravierende gesundheitliche Nachteile gibt es wahrscheinlich nicht und gesundheitliche Vorteile nur mittelbar und weit verstreut (z.B. weniger Autounfälle in Minnesota). So bleiben am Ende die "EU-weite Einheitlichkeit" und die "Bedeutung für den Binnenmarkt" als entscheidende Gründe für die Fortexistenz der Zeitumstellerei übrig: "Deutschland dürfe nicht zu einer Zeitinsel werden. Dementsprechend wird die Sommerzeit wohl noch eine Zeit lang bleiben - bis sich alle Staaten vielleicht einmal gemeinsam auf die Abschaffung einigen."
Dass diese Quintessenz des zitierten aktuellen Überblicks eventuell vorschnell ist und es doch noch unerwartete positive Effekte der Verlängerung der Tageslichtzeit am Abend gibt, lässt sich den Ergebnissen einer ebenfalls gerade veröffentlichten internationalen Studie über die Zusammenhänge körperlicher Aktivitäten von Kindern und Jugendlichen mit der Anzahl heller Abendstunden entnehmen.
Dazu führten WissenschaftlerInnen der "London School of Hygiene and Tropical Medicine" und der Universität Bristol mit einem Bewegungsmessgerät erhobene Daten der körperlichen Aktivität von 23.188 5- bis 16-jährigen Kindern aus 15 Studien in neun europäischen (ohne Deutschland) und außereuropäischen Ländern zur "International Children's Accelerometry Database" zusammen.
Zwei Ergebnisse sind für die Debatte über einen für größere Bevölkerungsgruppen spürbaren gesundheitlichen Nutzen der Zeitumstellung bedeutend:
• Die Anzahl heller Abendstunden ("evening daylight") "seems to play a causal role in increasing activity in a relatively equitable manner".
• Die durch die Verlängerung der hellen Abendzeit im Durchschnitt um zwei Minuten pro Tag verlängerte körperliche Aktivität der Kinder wirkt auf den ersten Blick wenig. Dieser Eindruck verbessert sich aber im Lichte der insgesamt 33 Minuten, die sich die StudienteilnehmerInnen überhaupt pro Tag bewegten. Die Verlängerung der Bewegungszeit in den für die Bewegung von Kindern "kritischen Stunden" am Abend ließ sich im Übrigen bei allen soziodemografischen Subgruppen der Kinder nachweisen und zeigt sich auch nach der Adjustierung wichtiger persönlicher Merkmale und Wetterbedingungen.
• Die bisher gezeigten Assoziationen zwischen der Länge der hellen Abendstunden und den Bewegungsaktivitäten von Kindern werden noch durch die Analyse des Verhaltens von 439 Kindern unmittelbar vor und nach den beiden Zeitumstellungen erhärtet. Dieselben Kinder wurden an den Tagen an denen es länger hell war sofort aktiver.
Trotz der selber breit vorgestellten Limitationen der Studie sollten die beobachteten Effekte als ein positiver Public-Health-Beitrag zum Erhalt und zur Sicherung der Gesundheit einer großen Bevölkerungsgruppe bei künftigen Pro- und Contra-Debatten zur Zeitumstellung berücksichtigt werden.
Der Aufsatz Daylight saving time as a potential public health intervention: an observational study of evening daylight and objectively-measured physical activity among 23,000 children from 9 countries von Anna Goodman, Angie S Page und Ashley R Cooper ist am 23. Oktober 2013 in der Zeitschrift "International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity" (11 (1): 84) erschienen und ist komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 27.10.14
USA: Umfang und Art von Medikationsfehlern bei Kleinkindern unter Obhut ihrer Eltern.
 Kinder in den ersten Lebensjahren gehören aus vielen nachvollziehbaren Gründen (z.B. wegen der zahlreichen Infektionserkrankungen) zu den Bevölkerungsgruppen denen relativ viel Arzneimittel verordnet werden. Deren Einnahme geschieht überwiegend unter der Obhut ihrer Eltern oder anderer Erwachsenen.
Kinder in den ersten Lebensjahren gehören aus vielen nachvollziehbaren Gründen (z.B. wegen der zahlreichen Infektionserkrankungen) zu den Bevölkerungsgruppen denen relativ viel Arzneimittel verordnet werden. Deren Einnahme geschieht überwiegend unter der Obhut ihrer Eltern oder anderer Erwachsenen.
Anders als über die Einnahmetreue von und Einnahmefehler bei Erwachsenen wusste man über die Korrektheit der von Eltern bestimmten Einnahme von Medikamenten bei kleinen und größeren Kindern bisher relativ wenig.
Einige in den letzten Jahren veröffentlichten Studien zeigten allerdings beispielsweise, dass z.B. die Rechenschwächen von Eltern in den USA zu spürbaren Medikationsfehlern führte (siehe die Studienzusammenfassung Parents' Poor Math Skills May Lead to Medication Errors auf der Website der "American Academy of Pediatrics") und auch den Aufsatz über den kräftigen Anstieg der Anzahl der Kinder, die zwischen 2001 und 2008 in den USA mit schweren Medikamentenvergiftungen in Notfallstationen eingewiesen wurden, (der dies genau schildernde Aufsatz The Growing Impact of Pediatric Pharmaceutical Poisoning. von G. Randall Bond, Randall W. Woodward und Mona Ho. ist 2011 im "The Journal of Pediatrics" (Volume 160, Issue 2: 265-270) erschienen).
Eine am 20. Oktober 2014 veröffentlichte Studie zeigte mit Daten des "Nation Poison Database System" der USA für den Zeitraum von 2002 bis 2012 und für insgesamt 696.937 Kinder unter 6 Jahren mit berichteten Medikationsfehlern zahlreiche Details dieser Fehler in häuslicher Umgebung:
• Im Durchschnitt gab es jährlich über 63.000 derartiger Ereignisse oder jede achte Minute bekam ein Kind dieses Alters von seinen Eltern eine falsche Dosis, gar keines des verordneten oder ein falsches Medikament verabreicht.
• Die jährliche Rate der Medikationsfehler betrug daher 26,42 pro 10.000 Angehörigen dieser Kinderjahrgänge.
• Neben einer signifikanten Abnahme von Fehlern bei der Einnahme von Erkältungsarzneimitteln über die gesamten 11 Jahre um 42,9% stieg die Rate der Fehler bei allen anderen Arzneimitteln um 37,2%.
• Anzahl und Rate der Einnahmefehler fielen mit zunehmendem Alter der Kinder. Auf die unter Einjährigen entfielen 25,2% aller Episoden.
• Schmerzmittel und Mittel gegen Erkältungskrankheiten waren an rund 50% der fehlerhaften Einnahmen beteiligt.
• 27% der Einnahmefehler beruhten auf unachtsames Einnehmen oder die zweifache Einnahme einer Portion.
• 93,5% der Ereignisse fanden außerhalb einer Gesundheitseinrichtung statt, d.h. in alleiniger Verantwortung der Eltern. 4,4% der Kinder mit Einnahmefehlern waren in Gesundheitseinrichtungen behandelt und entlassen worden. 25 Kinder starben wegen der Fehleinnahme.
Die AutorInnen schließen ihre Analyse mit einer Reihe von Präventionsm ethoden technischer Art, zum Beispiel Timer, besser verschließbare Packungen, aber auch die stärkere Berücksichtigung der Lese- und Sprachschwächen der Eltern. Trotzdem räumen sie ein, dass sie zu wenig über die konkreten Abläufe und Ursachen der durch Eltern beeinflussten Medikationsfehler wissen.
Der Aufsatz Out-of-Hospital Medication Errors Among Young Children in the United States, 2002-2012. von Maxwell D. Smith, Henry A. Spiller, Marcel J. Casavant, Thiphalak Chounthirath, Todd J. Brophy und Huiyun Xiang. ist in der Fachzeitschrift "Pediatrics" (867-876) erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 22.10.14
"Ich habe das richtige Gewicht" - Selbstwahrnehmung vieler übergewichtiger und fetter Kinder in den USA anders als Messwerte
 Für den Erfolg jeder verhaltensbezogenen Intervention sind die Existenz wirksamer Maßnahmen, die Motivation und schließlich auch die Selbstwahrnehmung des Risikos entscheidend. Wer seinen Zustand für unproblematisch oder gar für ideal hält, wird weder verhältnisbezogene Maßnahmen begrüßen und nutzen noch sein Verhalten verändern.
Für den Erfolg jeder verhaltensbezogenen Intervention sind die Existenz wirksamer Maßnahmen, die Motivation und schließlich auch die Selbstwahrnehmung des Risikos entscheidend. Wer seinen Zustand für unproblematisch oder gar für ideal hält, wird weder verhältnisbezogene Maßnahmen begrüßen und nutzen noch sein Verhalten verändern.
Dass dies auch im Bereich von Übergewicht oder Fettsucht bei Kindern und Jugendlichen häufig der Fall sein könnte, zeigt jetzt eine aktuelle Auswertung des "National Health and Nutrition Examination Survey" für acht- bis fünfzehnjährige Kinder in den USA im Zeitraum 2005 bis 2012.
Diese Zielgruppe wird in dem für die USA repräsentativen Survey gebeten die folgende Frage zu beantworten: "Do you consider yourself now to be fat or overweight, too thin, or about the right weight?" Außerdem werden Körpergröße und Gewicht erhoben womit der Body Mass Index errechnet werden kann.
Die Ergebnisse sehen so aus:
• Rund 81% der nach ihrem alters- und geschlechtsspezischen BMI-Wert übergewichtigen Jungen und 71% der übergewichtigen Mädchen ("greater than or equal to the 85th and less than the 95th percentile" eines in den USA geltenden Zielwerts) halten ihr Gewicht für das richtige.
• Von den Kindern, die fettsüchtig waren ("greater than or equal to the 95th percentile" des genannten Zielwerts), sagten immer noch 48% der Jungen und 36% der Mädchen, sie hätten aus ihrer Sicht das richtige Gewicht.
• Kinder aus Familien mit niedrigem Einkommen und aus nichtweißen Familien misklassifizierten ihre Gewicht mit größerer Wahrscheinlichkeit als die aus Familien mit höherem Einkommen. Von den Kindern aus Familien mit einem Einkommen, das 350% und mehr über der so genannten "family income-to-poverty ratio (FIPR)" lag, nahmen 26,3% ihr Gewicht falsch war. In Familien, die 130% bis 349% der FIPR Einkünfte hatten, machten dies 30,7% und in den ärmsten Familien mit weniger als 130% der FIPR 32,5%. Dieser Trend war statistisch signifikant. Interessanterweise waren die Unterschiede bei Mädchen deutlich größer und auch signifikant unterschiedlich als bei Jungen.
Die Fehlwahrnehmung des eigenen Gewichts ist aber nicht nur im Bereich tatsächlichen Übergewicht und Fettsucht ein Problem, sondern tritt auch umgekehrt bei völlig normalgewichtigen Kindern und Jugendlichen auf. Angehörige dieser Gruppe halten sich nicht selten für zu dick oder gar fett, versuchen deshalb mit allen Mitteln abzunehmen und riskieren gesundheitsschädlich untergewichtig zu werden.
Der Aufsatz Perception of Weight Status in U.S. Children and Adolescents Aged 8-15 Years, 2005-2012 von Neda Sarafrazi et al. ist im Juli 2014 als Heft 158 des "National Center for Health Statistics data brief" erschienen und kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 24.7.14
Risikopyramide Tabakrauchen: Aktivrauchen, Passivrauchen und nun auch noch "third hand smoke"-Rauchen
 Besonders Ex-Raucher riechen sie schon immer und leiden auch gelegentlich mehr oder weniger heftig darunter: die olfaktorischen oder auch stofflichen Rückstände von Tabakrauch in Räumen, in denen aktuell niemand raucht: das so genannte "Rauchen aus dritter Hand". Auch nachdem die gesundheitlichen Risiken des Selberrauchens und des Passivrauchens umfassend analysiert wurden, gesetzliche Rauchverbote in öffentlichen Räumen und in weiten Teilen der Gastronomie verfügt und durchgesetzt wurden und deren positiven gesundheitlichen Effekte in enorm kurzer Sicht nachgewiesen werden konnten (siehe dazu mehrere Beiträge im forum-gesundheitspolitik), galt der "third hand tobacco smoke" lange Zeit vor allem als hygienisches Problem oder als "Anstellerei" von Ex-Rauchern.
Besonders Ex-Raucher riechen sie schon immer und leiden auch gelegentlich mehr oder weniger heftig darunter: die olfaktorischen oder auch stofflichen Rückstände von Tabakrauch in Räumen, in denen aktuell niemand raucht: das so genannte "Rauchen aus dritter Hand". Auch nachdem die gesundheitlichen Risiken des Selberrauchens und des Passivrauchens umfassend analysiert wurden, gesetzliche Rauchverbote in öffentlichen Räumen und in weiten Teilen der Gastronomie verfügt und durchgesetzt wurden und deren positiven gesundheitlichen Effekte in enorm kurzer Sicht nachgewiesen werden konnten (siehe dazu mehrere Beiträge im forum-gesundheitspolitik), galt der "third hand tobacco smoke" lange Zeit vor allem als hygienisches Problem oder als "Anstellerei" von Ex-Rauchern.
Eine jetzt veröffentlichte Studie in der 2011 und 2012 die Rückstände von Tabakrauch in 46 Innenräumen (in der Stadt Tarragona) ohne zum Zeitpunkt der Messung anwesende RaucherInnen in einem technisch aufwändigen Verfahren gemessen und deren gesundheitliches Risiko bestimmt wurde, warnt vor einer Unterschätzung dieser Risiken vor allem bei Kindern.
Die Kernergebnisse der Studie sahen so aus:
• Im Staub von 77% der Raucherwohnungen fanden sich weit über den dafür geltenden Grenzwerten liegende gesundheitsschädliche Konzentrationen von rauchspezifischen, d.h. bei der Verbrennung von Tabak entstehenden Nitrosaminen.
• Diese Nitrosamine werden über die Haut aufgenommen und verursachen bei Kindern bis zu sechs Jahgren einen zusätzlichen Krebsfall pro 1.000 Personen.
• Zunächst mysteriös ist, dass solche Nitrosamine auch im Staub und auf Oberflächen in 64% aller Nichtraucherwohnungen gemessen wurden. Als eine Erklärung bietet sich die extrem schnelle und weite Verbreitung von Tabakrauch durch Luftströme an.
Angesichts der Schätzung, dass 40% der Kinder bereits durch ihre rauchenden Eltern einem "second hand"-Rauchrisiko ausgesetzt sind und ein Teil der restlichen 60% außerdem einem "third hand"-Risiko, raten die AutorInnen der Studie folgendes: "This risk should not be overlooked and ist impact should be included in future educational programs and tobacco-related public health policies".
Was dies konkret bedeuten könnte oder müsste, erörtern die AutorInnen nicht weiter. Das immer beliebter werdende "Balkonrauchen" ist allerdings weder für "second-" noch für "third hand"-Raucher eine gesunde Lösung. Eine Beobachtung der Studie lautet nämlich eindeutig so: "The strong correlation between the concentrations of nicotine that were found in the house dust from smokers' homes and the number of cigarettes smoked by the members of the household outside their homes demonstrates that tobacco smoke components are released to indoor environments by additional pathways such as off-gassing from the smokers' clothing or exhaled toxins."
Praktische Schlussfolgerungen mit dem Hinweis auf die geringe Anzahl von untersuchten Räumen, das Untersuchungsland "Spanien" oder andere, auch von den AutorInnen genannten Limitationen auf die lange Bank zu schieben, dürfte allerdings mit Sicherheit falsch sein.
Die britisch-katalanische Studie Exposure to nitrosamines in thirdhand tobacco smoke increases cancer risk in non-smokers. von Noelia Ramírez, Mustafa Z. Özel, Alastair C. Lewis, Rosa M. Marcé, Francesc Borrull und Jacqueline F. Hamilton erscheint in der Oktoberausgabe der Fachzeitschrift "Environment International" (2014; Volume 71: 139-147). Ein Abstract ist kostenlos erhältlich. Der Link könnte sich nach der Druckveröffentlichung ändern. Dann bitte mit den bibliografischen Angaben selber suchen.
Bernard Braun, 17.7.14
"Das dauert 7 Tage oder eine Woche" - Auch Volksmund, Großmütter und Ratgeber täuschen sich bei der Dauer von Kinderkrankheiten
 Die mehr anekdotischen oder volksmundigen Angaben zur Dauer der nicht seltenen akuten Infektionen der oberen Atemwege ihrer Kinder beruhigen Eltern nicht unbedingt und lassen sie häufig nach massiveren Interventionen von Ärzten rufen. Geben diese u.a. auch wegen ihres mangelnden gesicherten Wissens über die Leidensdauer von Kind und Eltern diesem Ruf nach, hat man eine der Ursachen für die Über- und Fehlversorgung von Kindern und Jugendlichen mit Antibiotika.
Die mehr anekdotischen oder volksmundigen Angaben zur Dauer der nicht seltenen akuten Infektionen der oberen Atemwege ihrer Kinder beruhigen Eltern nicht unbedingt und lassen sie häufig nach massiveren Interventionen von Ärzten rufen. Geben diese u.a. auch wegen ihres mangelnden gesicherten Wissens über die Leidensdauer von Kind und Eltern diesem Ruf nach, hat man eine der Ursachen für die Über- und Fehlversorgung von Kindern und Jugendlichen mit Antibiotika.
Wie lange eine dieser Erkrankungen minimal und maximal dauert, untersuchten nun us-amerikanische Sozialmediziner auf der Basis von 23 randomisierten kontrollierten Studien und 25 Beobachtungsstudien, die sie aus 22.182 zu diesem Thema in den letzten Jahren veröffentlichten Untersuchungen auswählten.
Bei 90% der Kinder (in Klammern stehen die Tage nach denen bei 50% der Kinder keine Symptome mehr vorhanden sind) waren
• Ohrenschmerzen nach 7 bis 8 Tagen (nach 3 Tagen),
• Halsentzündungen nach 2 bis 7 Tagen,
• starker Husten oder Pseudokrupp nach 2 Tagen (nach einem Tag),
• Bronchiolitis nach 21 Tagen (nach 13 Tagen),
• akuter Husten nach 25 Tagen (nach 10 Tagen),
• normale Erkältungen nach 15 Tagen (nach 10 Tagen) und
• unspezifische Infektionen der oberen Atemwege nach 16 Tagen (nach 7 Tagen)vorbei.
Die AutorInnen merken an, dass einige dieser Erkrankungen länger dauern als in den derzeit in den USA und in Großbritannien verbreiteten Ratgeber zu lesen ist oder der Volksmund annimmt, bei anderen dagegen die Ratgeberangaben bestätigt werden. Um Fehlreaktionen der genannten Art zu verhindern und Grundlagen für eine evidenzbasierte Behandlungsentscheidung oder eben auch den Verzicht auf Behandlung zu schaffen, schlagen sie eine entsprechende Korrektur der Angaben vor.
Der Aufsatz Duration of symptoms of respiratory tract infections in children: systematic review von Matthew Thompson et al. ist am 11. Dezember 2013 im "British Medical Journal" (347: f7027) als open-access-Veröffentlichung erschienen.
Bernard Braun, 14.12.13
Präventive Wirkung von materiellen Anreizen für Schulklassen mit 11- bis 14-Jährigen nicht mit dem Rauchen anzufangen = Null!
 Angesichts der gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnisse über die gesundheitlichen Risiken des Tabakrauchens für Aktiv- und Passivraucher muss ein Schwerpunkt präventiver Interventionen sein, insbesondere Kinder und Heranwachsende vom Rauchen abzuhalten.
Angesichts der gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnisse über die gesundheitlichen Risiken des Tabakrauchens für Aktiv- und Passivraucher muss ein Schwerpunkt präventiver Interventionen sein, insbesondere Kinder und Heranwachsende vom Rauchen abzuhalten.
Da Kinder und Jugendliche oft aufgrund eines bestehenden oder vermuteten Gruppendrucks mit dem Rauchen beginnen, wurden und werden u.a. gruppenbezogene Interventionen und Anreize zum Nichtrauchen als sehr gut geeignete Präventionsmethoden angesehen. Hierzu zählen in verschiedenen Ländern Europas Aktionen eines so genannten "Smokefree Class Competition (SFC)". Dieses Programm arbeitet mit Anreizen an ganze Schulklassen von 11- bis 14-Jährigen, die sich verpflichten auch nach 6 Monaten rauchfrei zu sein. Wenn dies mindestens 90% gelingt, kommt die Klasse in eine Art Lotterie-Wettbewerb in dem zahlreiche Preise von geringem bis mittelmäßigem Wert gewonnen werden können.
Ob diese Art von Programmen aber wirklich wirksam sind, war wie bei vielen anderen präventiven Interventionen lange Zeit gar nicht bezweifelt und auch nicht untersucht worden.
Für einen systematischen Cochrane-Review und eine Meta-Analyse betrachteten eine Reihe von australischen WissenschaftlerInnen nun die Ergebnisse von 5 randomisierten kontrollierten Studien mit 6.362 TeilnehmerInnen, die beim Start der Studien nicht rauchten. 3.466 waren in der Interventionsgruppe, also der TeilnehmerInnen an einem SFC-Programm und 2.896 Heranwachsende stellten die Kontrollgruppe. Eine der Studien war keine SFC- und auch keine randomisierte Studie. Ihren erfolgreichen, d.h. rauchfrei gebliebenen TeilnehmerInnen winkten am Ende des einjährigen Studienzeitraums ebenfalls Belohnungen.
Die Ergebnisse der Studien fassen die Reviewer so zusammen:
• Nur die nicht-randomisierte Studie konnte im ersten Anlauf einen statistisch signifikanten Effekt melden. Nach einigen nootwendigen Adjustierungen gab es aber keine statistisch signifikanten Unterschiede der Risikoraten zwischen Interventions- und Kontrollgruppe mehr. Außerdem wies die Studie auch zahlreiche Verzerrungsmöglichkeiten auf, die ihre Ergebnisse generell fragwürdig erscheinen lassen.
• Drei andere, methodisch hochwertigere Studien mit 3.056 TeilnehmerInnen zeigten beim Gruppenvergleich keinerlei signifikanten Effekt der mit Anreizen operierenden Interventionen bei der Prävention des Rauchens (Risikorate RR 1,00, Konfidenzintervall von 0,84 bis 1,19).
• Die ForscherInnen sehen nur wenig belastbare Evidenz dafür, dass die TeilnehmerInnen sie hinters Licht geführt haben oder rauchende Mitschüler bedroht haben, dies nicht zu berichten.
Die ForscherInnen schlagen trotz ihrer für Interventionen, die mit materiellen Anreizen arbeiten, entmutigenden Erkenntnissen vor, zusätzlich die Wirkung derartiger Anreize auf Einzelpersonen zu überprüfen.
Von dem am 17. Oktober 2012 veröffentlichten Cochrane-Review "Incentives for preventing smoking in children and adolescents" von Johnston V, Liberato S und Thomas D. gibt es kostenlos nur das traditionell ausführliche Abstract.
Bernard Braun, 14.11.12
Verringerung gesundheitlich nicht notwendiger Verordnungen von Antibiotika für Kinder und Jugendlichen gar nicht so schwer
 Auch die jüngsten Analysen der Verordnung von Antibiotika für Kinder und Jugendliche, die an Infektionen der oberen Atemwege oder Virusinfektionen litten, mittels Routinedaten regional (hier ist es die hkk-Studie "Antibiotika bei Kindern und Jugendlichen") oder bundesweit (hier die Barmer GEK-Studie "Faktencheck Gesundheit. Antibiotika-Verordnungen bei Kindern") agierenden gesetzlichen Krankenkassen, belegt, dass ein Großteil der Verordnungen gesundheitlich nicht notwendig ist, nicht wirksam sein kann oder sogar kurz- wie vor allem mittel- bis langfristig individuell wie in Public Health-Hinsicht Schaden anrichtet (z.B. durch Resistenzbildungen bei Bakterien).
Auch die jüngsten Analysen der Verordnung von Antibiotika für Kinder und Jugendliche, die an Infektionen der oberen Atemwege oder Virusinfektionen litten, mittels Routinedaten regional (hier ist es die hkk-Studie "Antibiotika bei Kindern und Jugendlichen") oder bundesweit (hier die Barmer GEK-Studie "Faktencheck Gesundheit. Antibiotika-Verordnungen bei Kindern") agierenden gesetzlichen Krankenkassen, belegt, dass ein Großteil der Verordnungen gesundheitlich nicht notwendig ist, nicht wirksam sein kann oder sogar kurz- wie vor allem mittel- bis langfristig individuell wie in Public Health-Hinsicht Schaden anrichtet (z.B. durch Resistenzbildungen bei Bakterien).
Daher dokumentieren die genannten Berichte auch Beispiele wie PatientInnen, Eltern und Ärzte zu einem defensiveren Umgang mit Antibiotika veranlasst werden können.
Eine gerade in den USA durchgeführte Interventionsstudie bei und mit ambulant tätigen Kinderärzten zeigt, dass dies mit multimodalen aber gar nicht so aufwändigen Mitteln erreicht werden kann.
Ausgangspunkt der Studie war die auch in den USA weit verbreitete Über- und Fehlversorgung von Kindern und Jugendlichen mit Antibiotika. So fand eine Fachveröffentlichung aus dem Jahr 2011 für die Jahre 2006 bis 2008 trotz leicht sinkender Häufigkeit mehr als 30 Millionen Antibiotika-Verordnungen für die bis 18-Jährigen, die in 21% aller Arztbesuche verordnet worden waren. Bei 72,3% der Arztbesuche bei denen Antibiotika verordnet wurden erfolgte dies wegen akuter Infektionen der Atmungswege. Den 48,9% der Fälle mit einer Erkrankung aus dieser Krankheitsgruppe, bei denen Antibiotika geboten waren, standen 23,4% aller derartiger Erkrankungsfälle gegenüber bei denen Antibiotika potenziell nicht notwendig waren. In vielen der sinnvollen Verordnungen wurden Breitband-Antibiotika verordnet, deren üppiger Einsatz kritikwürdig ist.
Zu den Personen denen Antibiotika verordnet worden waren, gehörten übrigens bevorzugt junge Patienten, Bewohner der Südstaaten der USA und privat Krankenversicherte.
Die Interventionsstudie wurde in 18 zufällig einer Interventions- oder Kontrollgruppe zugeordneten großen pädiatrischen Zentren im Nordosten der USA mit durchschnittlich 174 Ärzten durchgeführt. In diesen Praxen erhielten 28% aller Kinder eine nach fachlichen Kriterien unangemessene Verordnung von Breitband-Antibiotika bei Nasennebenhöhleninfektionen, Gruppe A-Streptokokkeninfektionen des Rachens oder der Haut oder bestimmten Stadien einer Lungenentzündung.
Die Kinderärzte in der Interventionsgruppe erhielten innerhalb der Interventionszeit von drei Jahren als Einstimmung eine kurze Erinnerung an die aktuellsten Leitlinien zur Verordnung von Arzneimitteln bei Infektionserkrankungen. Danach erhielten sie vierteljährliche Berichte mit der Darstellung ihrer Verordnungsgewohnheiten im Vergleich zu den bekannten Leitlinien und außerdem einen Vergleich mit den Werten ihrer Kollegen. Die Ärzte in der Kontrollgruppe erhielten keine dieser Informationen.
Nach einem Jahr erhielten nur noch 14% der Kinder in den Interventionspraxen unangemessene Antibiotika-Verordnungen, während es in der Kontrollgruppe immer noch 23% waren.
Über die Ergebnisse der Interventionsstudie erfährt man mehr in der am 18. Oktober 2012 veröffentlichten Zusammenfassung "Study Succeeds in Cutting Inappropriate Antibiotic Prescribing by Pediatricians" eines Vortrags der ForscherInnen auf der "IDWeek-2012-Konferenz" in San Diego.
Zu dem Aufsatz "Antibiotic prescribing in ambulatory pediatrics in the United States" von Hersh AL et al. - veröffentlicht im Dezember 2011 in der Zeitschrift "Pediatrics" (2011 Dec; 128:1053) gibt es kostenlos das Abstract, aber auch auf der Website der Universität des Hauptautors eine kostenlose Komplettversion.
Bernard Braun, 5.11.12
"Generation Zahnspange": Wie notwendig, nützlich oder belastend ist die kieferorthopädische Behandlung aus Betroffenensicht?!
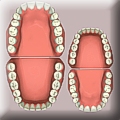 Über bestimmte gesundheitliche Probleme und Leistungen der Gesetzlichen Krankenversicherung gibt es seit Jahren oder Jahrzehnten eine kontinuierliche, facettenreiche und oft kontroverse Berichterstattung und öffentliche Debatten. Einige Probleme und Leistungen führen dagegen ein ausgesprochenes Mauerblümchendasein -trotz oder auch wegen ihres durchaus vorhandenen gesundheits- und versorgungspolitischen Sprengstoffs.
Über bestimmte gesundheitliche Probleme und Leistungen der Gesetzlichen Krankenversicherung gibt es seit Jahren oder Jahrzehnten eine kontinuierliche, facettenreiche und oft kontroverse Berichterstattung und öffentliche Debatten. Einige Probleme und Leistungen führen dagegen ein ausgesprochenes Mauerblümchendasein -trotz oder auch wegen ihres durchaus vorhandenen gesundheits- und versorgungspolitischen Sprengstoffs.
Obwohl fast alle BürgerInnen im Laufe ihres Lebens mehr oder weniger oft zahnmedizinisch behandelt werden, obwohl die Privatisierung der Finanzierung der zum Teil recht teuren Ersatzleistungen im Bereich der Zahn- und Kieferversorgung am weitesten fortgeschritten ist und nur noch Bruchteile der Gesamtkosten Kassenleistung sind und obwohl für viele in diesem Bereich angebotenen Leistungen ein Nutzennachweis fehlt oder der fehlende Nutzen bekannt ist, gehören die zahnmedizinische und gleich gar die kieferorthopädische Versorgung zu den am geringsten erforschten und debattierten Leistungsbereichen im deutschen Gesundheitswesen.
Einen Teilbereich, den der kieferorthopädischen Versorgung von Kindern und Jugendlichen, macht nun eine 2012 veröffentlichte Studie der Bremer gesetzlichen Krankenkasse "hkk" etwas transparenter.
Im Jahr 2011 hat die hkk 1.309 hkk-Versicherte im Kindes- und Jugendlichenalter bzw. ihre Eltern angeschrieben, die ihre kieferorthopädische (kurz "KfO") Behandlung im Jahr 2010 abgeschlossen hatten, und um die Beantwortung einiger Fragen zu ihrer Behandlung gebeten. Repräsentative 435 der Angeschriebenen mit einem Durchschnittsalter von 16 Jahren beantworteten diesen Fragebogen, den der Gesundheitswissenschaftler Bernard Braun vom Zentrum für Sozialpolitik (ZeS) der Universität Bremen und das "Bremer Institut für Arbeits- und Gesundheitsforschung (BIAG)" auf der Basis der wenigen dazu bereits durchgeführten Forschungsstudien entwickelten und auswerteten.
Zu den wesentlichen Ergebnissen des kürzlich der Öffentlichkeit vorgestellten Berichts "Kieferorthopädische Behandlung von Kindern und Jugendlichen" gehören:
• 42,8 Prozent der von der hkk Befragten gaben an, sie hätten vor Behandlungsbeginn keine Beschwerden gehabt; 30,1 Prozent wollten "einfach besser aussehen". Diese Angaben weisen auf einen möglichen Konflikt mit der Vorgabe des Gesetzgebers hin, laut der die Krankenkassen eine kieferorthopädische Behandlung nur dann übernehmen dürfen, wenn eine gesundheitliche Notwendigkeit vorliegt. In einem ebenfalls für die Studie durchgeführten Interview mit Knut Thedens, Fachzahnarzt für Kieferorthopädie und KfO-Referent der Kassenzahnärztlichen Vereinigung (KZV) Bremen, hebt dieser aber hervor, dass die Behandlungen häufig eine präventive Therapie zur Vermeidung späterer Funktionsstörungen darstellen. "Die Ästhetik ist lediglich ein Nebenprodukt dessen, was wir tun", so Thedens.
• 44 Prozent der Befragungsteilnehmer waren mit ihrer Behandlung insgesamt sehr zufrieden, weitere 42 Prozent immerhin zufrieden. Die wichtigsten Schlüsselfaktoren für die Zufriedenheit waren ein vertrauensvolles Verhältnis zum behandelnden Arzt, die Verbesserung des Aussehens und eine problemlose und schmerzfreie Behandlung.
• Zur Zufriedenheit mit der Behandlung kommen positive und möglicherweise dauerhafte Auswirkungen auf das gesundheitsrelevante Verhalten der jungen Patienten hinzu: 44,5 Prozent der Kinder und Jugendlichen gaben an, ihre regelmäßige Zahnpflege im Lauf der Behandlung verbessert zu haben. Zwischen 21,6 und 22,7 Prozent sagten aus, sie hätten zahnschädigendes Verhalten (z.B. das Öffnen von Kronenkorkenverschlüssen mit den Zähnen) reduziert und stärker auf regelmäßige Zahnarztbesuche oder regelmäßige professionelle Zahnreinigung geachtet. Verschlechterungen in diesen Bereichen wurden so gut wie nicht berichtet.
• Auch mit den Beratungsleistungen erklärten sich die meisten Betroffenen - in diesem Fall die Eltern der hkk-versicherten Kinder und Jugendlichen - überwiegend zufrieden. Allerdings bestehen dabei erhebliche Unterschiede: Über den Nutzen und die Ziele der Behandlung fühlten sich 84,8 Prozent gut oder sehr gut informiert. Bezüglich der Auswahl des behandelnden Kieferorthopäden oder Zahnarztes meinten dies jedoch nur 57,9 Prozent. Anders als bei niedergelassenen Allgemeinmedizinern und Fachärzten sind generell Bewertungen von KfO-Praxen kaum verfügbar und auch Krankenkassen nehmen keine eigenen Empfehlungen bestimmter Anbieter vor. Das zweitschlechteste Ergebnis entfiel auf die Beratung über die Kosten der Behandlung: Diese bezeichneten nur 61,8 Prozent als sehr gut oder gut.
• Dies ist umso verwunderlicher, weil private Zuzahlungen eine erhebliche finanzielle Belastung für die betroffenen Familien darstellen. Knapp drei Viertel der Befragten, also im Vergleich zu anderen Behandlungsbereichen einem extrem hohen Anteil, wurde mit verschiedenen Argumenten privat zu zahlende Zusatzleistungen angeboten und von ihnen auch meist in Anspruch genommen. 50 Prozent der Eltern gaben an, hierfür bis zu 500 Euro bezahlt zu haben. 32 Prozent leisteten Zuzahlungen von 500 bis 1.000 Euro, 15 Prozent von 1.000 bis 2.000 Euro. Drei Prozent erbrachten sogar noch höhere private Aufschläge. Die Ausgaben entfielen vor allem auf flexible Drähte und Bögen (35,6 Prozent), spezielle Zahnreinigung (33,8 Prozent), Fluoridierung und zusätzliche Diagnostik (24,4 bzw. 23 Prozent). Für diese Zusatzleistungen versprachen die Ärzte 34 Prozent der Befragten einen besseren Behandlungserfolg. 10,8 Prozent wurde eine attraktivere Optik während der Behandlung in Aussicht gestellt, weiteren 10,3 Prozent eine kürzere Behandlungsdauer.
Angesichts der bisher nur dürftig nachgewiesenen Langzeitwirkungen von kieferorthopädischen Interventionen im Kindes- und Jugendalter auf die Erwachsenen-Zahn-/Kiefergesundheit und des Mangels an Nutzennachweisen der oft teuren Zusatzleistungen sollten nach Meinung der Wissenschaftler und des interviewten Kieferorthopäden kontrollierte Langzeitstudien durchgeführt werden. Außerdem sollte es auch für diese Art von Leistungen eine unabhängige Patienteninformation geben. Die hkk beabsichtigt dazu bis 2013 ein Angebot zu entwickeln.
Weitere Einzelheiten über die kieferorthopädische Versorgung von Kindern und Jugendlichen (z.B. Anteil an Gesamtausgaben der GKV im Zeitverlauf, Rechtsgrundlagen und die Versorgung in anderen Ländern) finden sich in dem 22 Seiten umfassenden hkk-Bericht "Kieferorthopädische Behandlung von Kindern und Jugendlichen", der komplett kostenlos erhältlich ist.
Bernard Braun, 13.10.12
Prävention von Übergewichtigkeit und Fettsucht ist bei 6-12-jährigen Kindern möglich - erfordert aber komplexe Maßnahmen
 Die systematische Auswertung aller 55 bis zum Jahr 2010 abgeschlossenen randomisierten kontrollierten Studien über den Nutzen und die Wirksamkeit präventiver Maßnahmen gegen Übergewicht oder Fettsucht bei Kindern (darunter 37 neuere Studien) in der aktuellen Fassung eines Cochrane-Reviews liefert ein zwiespältiges Ergebnis: Einerseits empfehlen die Reviewer einen vorsichtigen Umgang mit den Ergebnissen, wegen der Heterogenität der Studien und den Schwierigkeiten, die Wirkung einzelner Interventionen und Programme zu identifizieren. Andererseits nennen sie aber Maßnahmen, die sie als präventiv nützlich bewerten. Sie belegen dies u.a. durch eine Metaanalyse mit 37 Studien und 27.946 Kindern in der sich eine spürbare Verringerung des als Indikator weit verbreiteten Body Mass Index (BMI) zeigt.
Die systematische Auswertung aller 55 bis zum Jahr 2010 abgeschlossenen randomisierten kontrollierten Studien über den Nutzen und die Wirksamkeit präventiver Maßnahmen gegen Übergewicht oder Fettsucht bei Kindern (darunter 37 neuere Studien) in der aktuellen Fassung eines Cochrane-Reviews liefert ein zwiespältiges Ergebnis: Einerseits empfehlen die Reviewer einen vorsichtigen Umgang mit den Ergebnissen, wegen der Heterogenität der Studien und den Schwierigkeiten, die Wirkung einzelner Interventionen und Programme zu identifizieren. Andererseits nennen sie aber Maßnahmen, die sie als präventiv nützlich bewerten. Sie belegen dies u.a. durch eine Metaanalyse mit 37 Studien und 27.946 Kindern in der sich eine spürbare Verringerung des als Indikator weit verbreiteten Body Mass Index (BMI) zeigt.
In den als nützlich bewerteten Programmen spielten vor allem die folgenden Aktivitäten und Komponenten die zentrale Rolle:
• Ein Curriculum zur Prävention von kindlichem Übergewicht, das zum einen die Elemente gesunde Ernährung, körperliche Bewegung und Körperbild umfasste und zum anderen so weit wie möglich in den normalen schulischen Lehrplan integriert war.
• Mehr Angebote zur körperlichen Bewegung und zur Entwicklung fundamentaler Bewe-gungsfertigkeiten während der gesamten Schulwoche und nicht nur an einem einzigen Stundenplan-Platz.
• Eine verbesserte Qualität der Nahrungsmittel, welche die SchülerInnen in der Schule er-halten bzw. erwerben können.
• Die Entwicklung und Gestaltung einer Umgebung und Kultur, die Kinder dabei unterstützen, jeden Tag wie selbstverständlich nährstoffreiche Lebensmittel zu essen und aktiv zu bleiben.
• Die Unterstützung der LehrerInnen und anderem Schulpersonal bei ihren Versuchen, Gesundheitsförderungsstrategien und -Aktivitäten im Schulalltag zu implementieren (z.B. durch Weiterbildung und den Auf- und Ausbau von Informations- und Manage-mentressourcen)
• Gemeinsame gesundheitsfördernde Aktivitäten mit Eltern, um die Schüler auch zu Hause anzuhalten, aktiver zu sein, mehr nährstoffreiche Nahrung zu sich zu nehmen und weniger Zeit vor Bildschirmen zu verbringen.
Angesichts der Fülle der bisher veröffentlichten Studien und der Anzahl noch laufender Studien empfehlen die Reviewer ferner, keine weiteren Interventionsstudien mehr zu starten, die eine kurze Laufzeit haben und vorrangig auf das individuellen Verhalten von Schulkindern im Alter von sechs bis 12 Jahren gerichtet sind. Stattdessen sollten Studien mit mehr TeilnehmerInnen, längerer Laufzeit, Kosten-Nutzen-Analysen und einer Analyse der unerwünschten Wirkungen untersuchen, welche der vielen Einzelaktivitäten und Maßnahmenbündel ein optimales Angebot für Interventionen auf der Bevölkerungsebene darstellen. Zusätzlich sollten künftig mit Vorrang die Evidenzlücken für präventive Interventionen bei 0-3-jährigen Kindern und Heranwachsenden geschlossen werden.
Von dem 2011 aktualisierten Cochrane-Review "Interventions for preventing obesity in children" von Waters E, de Silva-Sanigorski A, Hall BJ, Brown T, Campbell KJ, Gao Y, Armstrong R, Prosser L, Summerbell CD. (Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 12.) gibt es kostenlos das gewohnt umfangreiche Abstract.
Bernard Braun, 7.3.12
Geburtenraten sinken in wirtschaftlich schlechten Zeiten signifikant: Zufall oder kausaler Zusammenhang?
 Was die Kausalität dieses Zusammenhangs angeht, wird sie fast so oft wie ein enger Zusammenhang sichtbar wird, aus methodischen Gründen bestritten.
Was die Kausalität dieses Zusammenhangs angeht, wird sie fast so oft wie ein enger Zusammenhang sichtbar wird, aus methodischen Gründen bestritten.
Eine am 12. Oktober 2011 für alle 50 Bundesstaaten der USA und Washington D.C. mit den Daten des "National Center for Health Statistics" und des "Census Bureau" durchgeführte Analyse des PEW Research Centers, legt nun nicht nur erneut Geburtenzahlen vor, die sich exakt parallel zur Entwicklung der wirtschaftlichen Rezession in den USA verändern, sondern untermauert die Zusammenhänge auch noch durch eine Reihe differenzierterer Analysen.
Zunächst die generelle Entwicklung: In den USA gab es auch bereits in der Vergangenheit starke Assoziationen zwischen wirtschaftlichen Krisenphasen und sinkender Geburtenrate: Die Rate sank zum Beispiel zwischen 1926 und 1936, also der Zeit der Weltwirtschaftskrise, um 26%. Aktuell sank die Geburtenrate von einem Geburtenhoch von 69,6 Geburten auf 1.000 Frauen im wirtschaftlich guten Jahr 2007 auf 64,7 Geburten pro 1.000 Frauen im Rezessionsjahr 2010. In absoluten Zahlen heißt dies, dass trotz eines gleichzeitigen Zuwachses der Bevölkerung die Anzahl der geborenen Kinder von 4,32 Millionen auf 4,01 Millionen sank.
Einen möglichen Zusammenhang von Krise und Geburtenrate untermauert die Verfasserin der Analyse u.a. mit zwei differenzierten Analysen:
• Erstens stieg in den wenigen Bundesstaaten, die wie North Dakota bessere wirtschaftliche Eckdaten aufwiesen, die Geburtenrate sogar noch oder stagnierte nur. In den am stärksten von der Wirtschaftskrise betroffenen Bundesstaaten, wie z.B. Arizona, gab es dagegen mit 7,2% auch die stärkste Abnahme der Rate.
• Zweitens fiel die Geburtenrate in den Bevölkerungsgruppen am stärksten, deren Einkommens- oder Arbeitsplatzverluste am stärksten ausfielen: Die so genannten "Hispanics" verloren zwischen 2005 und 2009 einerseits durchschnittlich 66% ihres Vermögens. Andererseits war die Abnahme ihrer Geburtenrate zwischen 2008 und 2009 mit 5,9% am höchsten. In der schwarzen Bevölkerung der USA betrug die Abnahme 2,4%, in der weißen Bevölkerung dagegen 1,6%.
• Die Tatsache, dass die Geburtenrate in allen Altersgruppen außer bei den 40- bis 44-jährigen Frauen sank, wertet die Verfasserin als Beleg dafür, dass sich hinter der sinkenden Geburtenrate nicht prinzipielles Desinteresse an Kindern verbirgt, sondern die Frauen und ihre Familie nur auf wirtschaftlich bessere Zeiten warten wollen - wenn ihnen nicht die Zeit der Gebärfähigkeit davon läuft.
Die 15 Seiten umfassende Studie In a Down Economy, Fewer Births von Gretchen Livingston ist komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 16.10.11
Krankenhausgeistliche: Anrührendes Relikt oder doch nützlich? Ein Beispiel aus der Kinder-Palliativbehandlung.
 Welchen Nutzen stiften die rund 10.000 Geistlichen in den Krankenhäusern der USA für Patienten, ihre Angehörigen, die traditionellen Berufsgruppen der Ärzte und Pflegekräfte und die immer größer werdende Schar von Case-, Care- oder Palliativ-Care-Manager? Oder stellen sie einfach nur ein Relikt aus der Zeit vor dem medizinisch-technischen Fortschritt dar?
Welchen Nutzen stiften die rund 10.000 Geistlichen in den Krankenhäusern der USA für Patienten, ihre Angehörigen, die traditionellen Berufsgruppen der Ärzte und Pflegekräfte und die immer größer werdende Schar von Case-, Care- oder Palliativ-Care-Manager? Oder stellen sie einfach nur ein Relikt aus der Zeit vor dem medizinisch-technischen Fortschritt dar?
Diese Frage stand im Mittelpunkt einer weitgehend qualitativen Pilotstudie im Auftrag des "The Hastings Center" und des "Rush University Medical Center" deren Ergebnisse im August 2011 veröffentlicht wurden. Genauer ging es darum, mehr über die Rolle und den Alltag von Geistlichen in Palliativ-Behandlungsteams für Kinder in Erfahrung zu bringen - aus Sicht von Ärzten und Geistlicher selbst. Dabei ist weitgehend akzeptiert und belegt, dass geistige oder spirituelle Hilfe oder Behandlung ein wichtiges Element bei der Schmerzbehandlung von Kindern ist und einen Teil der Probleme ernsthafter oder gar tödlicher Erkrankungen von Kindern für sie selber und ihre Familien bewältigen oder lindern hilft.
In der Pilotstudie sollte zusätzlich untersucht werden wie spirituelle Behandlung in etablierten Programmen zur kindbezogenen Schmerzbehandlung (so genannte "pediatric palliative care" [PPC]) geliefert wird und die Rolle von in den Programmen fest integrierten Geistlichen zu beschreiben.
Dazu untersuchten die Wissenschaftler 2009 zunächst 28 USA-weit verbreitete PPC-Programme und wählten daraus acht Programme zur weiteren Analyse aus, die länger als ein Jahr existierten, interdisziplinär besetzt waren, ausgebaute Verweisungsprozeduren besaßen und in der Lage waren, Daten über ihren Arbeitsaufwand zu liefern. Sieben Programme liefen in speziellen Kinderkliniken und eines in der Kinderabteilung einer Hochschulklinik.
In den acht Programmen wurden schließlich halbstrukturierte Interviews mit dem Geistlichen und dem medizinischen Direktor oder Chefarzt durchgeführt. Zu den Ergebnissen:
• Die Chefärzte beschrieben die Programm-Beiträge der überwiegend fest am Krankenhaus angestellten Geistlichen so: Als erstes erleichterten sie das geistig verursachte Leiden der jungen Patienten und ihrer Familien. Zweitens verbesserten Gespräche mit den Geistlichen die Kommunikation zwischen den Familien und dem Behandlungsteam über die Ziele der Behandlung. Zum Beispiel erfahren vor allem Geistliche mehr über die kulturellen oder religiösen Überezeugungen und Einstellungen der Familien, deren Kenntnis allen Teammitgliedern oft erst ermöglichte elterliche Entscheidungen, Ziele, Prioritäten und Werte zu verstehen. Drittens vermitteln Geistliche auch den anderen Teammitgliedern eine etwas andere oder aufmerksamere Sichtweise der Behandlung und Behandelten. Umso wichtiger ist daher die Erkenntnis der Untersuchung, dass Geistliche in der Regel zu den gut integrierten Mitgliedern der PPC gehörten.
• Die interviewten Geistlichen berichteten im Großen und Ganzen Ähnliches über ihre Rolle und Beiträge zur Behandlung der schwer erkrankten Kinder. Sie konzentrierten sich dabei aber mehr auf den Prozess ihrer Arbeit als darauf, wie sie zu besseren Ergebnissen führt.
• Beide Gruppen waren sich einig, dass es darauf ankommt, gemeinsam im Team zu lernen, wie man die Bedürfnisse der Patienten und ihrer Angehörigen nach geistiger Unterstützung besser befriedigt und ihre Erwartungen an Geistliche genauer erkennen lernt. Zudem müssen die bei Angehörigen verbreiteten Vorurteile beseitigt werden, Geistliche wären dann präsent, wenn der Tod des Kindes kurz bevor stünde oder wollten als Missionare ihrer eigenen religiösen Überzeugung auftreten.
Die Pilotprojektergebnisse werden von den ForscherInnen als Rechtfertigung angesehen, zukünftig noch intensiver darüber zu forschen, ob und wenn ja wie die Interventionen der Geistlichen die spirituellen Bedürfnisse der Patienten und ihrer Angehörigen treffen und welche organisatorischen Bedingungen hilfreich sind, geistige Unterstützung und Behandlung zu liefern.
Die Ergebnisse der Pilotstudie "The Role of Professional Chaplains on Pediatric Palliative Care Teams: Perspectives from Physicians and Chaplains" von George Fitchett et al., erschienen in der Fachzeitschrift "JOURNAL OF PALLIATIVE MEDICINE" (Volume 14, Number 6, 2011: 704-707) sind komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 24.8.11
Alkoholmissbrauch bei Kindern und Jugendlichen trotz verschiedener Präventionsmaßnahmen auf hohem Niveau. Was hilft wirklich?
 Im letzten Drogen- und Suchtbericht der Bundesregierung aus dem Mai 2011 wird berichtet, dass der Anteil der 12- bis 17-jährigen Kinder und Jugendliche, die regelmäßig, d.h. mindestens einmal pro Woche Alkohol tranken zwischen 2004 und 2010 von 21,2% auf 12,9% gesunken ist. Auch wenn der Anteil dieser Kinder- und Jugendlichengruppe, der das so genannte Rausch- oder Komasaufen betrieb insgesamt auch leicht zurückging, praktizierte im Jahr 2010 fast jeder Fünfte von ihnen mindestens einmal im Monat diese extrem riskante Art des Alkoholkonsums. Der Bericht belegt außerdem: "Im Jahr 2009 wurden rund 26.400 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 10 und 20 Jahren aufgrund akuten Alkoholmissbrauchs stationär im Krankenhaus behandelt. Dies ist ein Anstieg von 2,8 % gegenüber 2008. Im Vergleich zum Jahr 2000 ist die Zahl um 178 % gestiegen; damals wurden rund 9.500 junge Patientinnen und Patienten mit der Diagnose "akute Alkoholintoxikation" stationär behandelt." Während die Anzahl der so behandlungsbedürftigen 10- bis 15-jährigen Kinder sank, stieg sie für die 15- bis 20-Jährigen an.
Im letzten Drogen- und Suchtbericht der Bundesregierung aus dem Mai 2011 wird berichtet, dass der Anteil der 12- bis 17-jährigen Kinder und Jugendliche, die regelmäßig, d.h. mindestens einmal pro Woche Alkohol tranken zwischen 2004 und 2010 von 21,2% auf 12,9% gesunken ist. Auch wenn der Anteil dieser Kinder- und Jugendlichengruppe, der das so genannte Rausch- oder Komasaufen betrieb insgesamt auch leicht zurückging, praktizierte im Jahr 2010 fast jeder Fünfte von ihnen mindestens einmal im Monat diese extrem riskante Art des Alkoholkonsums. Der Bericht belegt außerdem: "Im Jahr 2009 wurden rund 26.400 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 10 und 20 Jahren aufgrund akuten Alkoholmissbrauchs stationär im Krankenhaus behandelt. Dies ist ein Anstieg von 2,8 % gegenüber 2008. Im Vergleich zum Jahr 2000 ist die Zahl um 178 % gestiegen; damals wurden rund 9.500 junge Patientinnen und Patienten mit der Diagnose "akute Alkoholintoxikation" stationär behandelt." Während die Anzahl der so behandlungsbedürftigen 10- bis 15-jährigen Kinder sank, stieg sie für die 15- bis 20-Jährigen an.
Da die schlimmste Begleiterscheinung übermäßigen Alkoholkonsums, die Alkoholvergiftung, trotz verschiedener Aktivitäten zur Prävention des riskanten Alkoholkonsums anstieg, haben Wissenschaftler in einem so genannten "Health Technology Assessment(HTA)-Bericht untersucht, welche Präventionsmaßnahmen unter welchen Bedingungen Alkoholmissbrauch bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen vermindern oder gar verhindern können.
Als Datenbasis nutzten sie nach einer umfänglichen internationalen Literaturanalyse 59 aus 401 identifizierten Studien. Die überwiegende Zahl der betrachteten Studien stammt aus den USA, nur neun aus Deutschland.
Auch die ausgewählten Studien ermöglichten nicht, einen schlüssigen Überblick über wirksame Maßnahmen und Interventionen zu erlangen. Viele Studien wiesen fundamentale methodische Mängel auf. So wird der Begriff des "riskanten Konsums" in einer großen Bandbreite verwendet. Die Studien differenzieren Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene teilweise mit unterschiedlichen Altersgrenzen. Weiter fehlen Untersuchungen zu jungen Berufstätigen und Minderheiten.
In nicht wenigen Studien wird nicht präzise genug nach der Wirksamkeit der Maßnahmen gefragt bzw. wird sie nicht hinreichend dokumentiert. Keine Untersuchung benennt explizit den Grad der angestrebten Verhaltensänderung. Die Beurteilung der Effektivität der Maßnahmen erfolgt nur im Nachhinein über nachträglich festgelegte Parameter im Vergleich mit Kontrollgruppen.
Dass wirksame Präventionsmaßnahmen nicht einfach und unaufwändig sind, zeigen die in den Studien des HTA-Berichts genannten Erklärungen für den riskanten Alkoholkonsum. Sie umfassen Faktoren der sozialen Umwelt, personale und familiäre Faktoren, den Einfluss von Bezugspersonen/-gruppen sowie alkoholspezifische Wirksamkeitserwartungen und Normen. Nur eine Bündelung von Maßnahmen der Verhaltens- und Verhältnisprävention kann diese Faktoren beeinflussen - ist aber bekanntermaßen sehr schwer vorzunehmen.
Laut HTA-Bericht wirksam sind Familieninterventionsprogramme und personalisierte computergestützte Interventionen an Schulen, Colleges und Universitäten. Darüber hinaus auch kurze motivierende Interventionen und Elemente der Verhältnisprävention (z. B. die Erhöhung von Alkoholpreisen und Steuern). Die Wirksamkeit von massenmedialen Kampagnen ist nicht belegt, ebenso von nicht computergestützer schulischer Prävention. Der Bericht zeigt aber, dass nur wenige selbst dieser Maßnahmen die Häufigkeit oder Menge des Alkoholkonsums dauerhaft reduzieren. Anders als der eingangs zitierte Drogen- und Suchtbericht der Bundesregierung, der auf der Selbstauskunft der Kinder und Jugendlichen beruht, zeigen die von den HTA-AutorInnen untersuchten Studien trotz der Präventionsmaßnahmen sogar einen steigenden Alkoholkonsum mit steigendem Alter der Jugendlichen.
Das Fazit: Gegenwärtig sind Präventionsmaßnahmen zur Reduktion oder Verhinderung von riskantem Alkoholkonsum in Deutschland nicht ausreichend auf ihre nachhaltige Wirksamkeit hin evaluiert.
Die Autoren fordern spezifische und zielgruppenorientierte Präventionsmaßnahmen für den deutschen Kontext. Voraussetzung dafür sind feste Zielgrößen (z. B. Reduktion des Konsums, Änderung des Verhaltens) und eine verbindliche Definition und empirische Bestimmung des "riskanten Alkoholkonsums".
Deshalb empfehlen sie
• Eine stärkere Untersuchung der Bedeutung des Einflusses altersspezifischer Alkoholnormen für die Übergangsphase vom Jugend- zum Erwachsenenalter und deren Berücksichtigung in Präventionskonzepten,
• die Festlegung einer verbindlichen Definition für "riskanten Alkoholkonsum" für Jugendliche
• die Definition von prioritären Zielgruppen
• die Entwicklung von Präventionsmaßnahmen, die die Schulkultur und das Schulzugehörigkeitsgefühl fördern
• die Entwicklung und Durchführung spezieller Interventionsmaßnahmen für männliche 15- bis 17-jährige Jugendliche, für Jugendliche aus gut situierten Familien sowie für berufstätige Jugendliche und junge Erwachsene
• die Evaluation der deutschen Präventionsmaßnahmenund
• eine Preissteigerung für alle alkoholischen Getränke, die stärkere Kontrolle der Umsetzung des Jugendschutzgesetzes und die konsequente Sanktionierung von Verletzungen des Jugendschutzes.
Eine Übersicht und die Bewertung aktueller Präventionsmaßnahmen von riskanten Alkoholmustern und alkoholbezogenen Problemen bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland wird derzeit in einem separaten Berichtsteil erarbeitet.
Der 2011 erschienene 194-seitige HTA-Bericht 112 "Prävention des Alkoholmissbrauchs von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen von Dieter Korczak, Gerlinde Steinhauser und Marcus Dietl ist komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 28.7.11
Rasche Aufnahme von Nahrung schadet durchfallkranken Kindern in der 3. Welt nicht. Nachdenkliches zu einem Cochrane Review
 Manche noch so korrekten und aufschlussreichen wissensachaftlichen Erkenntnisse hinterlassen einen bitteren Geschmack, erzeugen Ratlosigkeit und ein Gefühl davon, wo der Sinn von Wissenschaft endet. Dies ist leider auch im folgenden Beispiel eines gerade erschienenen Cochrane-Reviews über die richtige Ernährung durchfallerkrankter Kinder in der Dritten Welt der Fall.
Manche noch so korrekten und aufschlussreichen wissensachaftlichen Erkenntnisse hinterlassen einen bitteren Geschmack, erzeugen Ratlosigkeit und ein Gefühl davon, wo der Sinn von Wissenschaft endet. Dies ist leider auch im folgenden Beispiel eines gerade erschienenen Cochrane-Reviews über die richtige Ernährung durchfallerkrankter Kinder in der Dritten Welt der Fall.
Wer jemals ein Land in der Dritten Welt besucht hat und sich außerhalb der Touristenghettos bewegte, wird selbst in den Hauptstädten mit den mehr oder weniger dramatischen Symptome des akuten infektiösen Durchfalls konfrontiert worden sein - als einer der verbreitesten Erkrankungen und Todesursachen von Millionen von Kindern in der Dritten Welt. Und auch die gerade wieder einmal zyklisch in den Nachrichten auftauchenden abgemagerten oder verhungernden Kinder in Ostafrika litten oder leiden u.a. an Durchfallerkrankungen mit dem damit verbundenen beträchtlichen Flüssigkeitsverlust.
Sofern es überhaupt etwas zu essen gibt(!!!), war bisher ungeklärt, ob akut durchfallerkrankten Kindern zusätzlich zu der absolut notwendigen Wiederaufnahme und -anreicherung mit Flüssigkeit feste Nahrung bereits sehr früh (unmittelbar nach Beginn oder innerhalb der ersten 12 Stunden nach Beginn der Rehydration) oder erst nach einiger Zeit (12 bis 48 Stunden nach Beginn der Dehydration) angeboten werden durfte. Insbesondere diejenigen welche die frühe Aufnahme praktizierten, befürchteten häufig massive und ebenfalls unerwünschte bis lebensbedrohende Abwehrreaktionen wie Erbrechen, die Notwendigkeit außerplanmäßiger intravenöser Flüssigkeitszufuhr oder auch eine Chronifizierung des Durchfalls.
Seit dem 7. Juli 2011 liefert ein diese Frage bearbeitender Cochrane-Review eine Antwort: Es gab bezogen auf die befürchteten Risiken bei Kindern unter 10 Jahren keinen signifikanten Folgen-Unterschied zwischen früher und späterer Aufnahme fester Nahrung. Positiv ausgedrückt gibt es keine Evidenz dafür, dass ein früher Beginn der Aufnahme fester Nahrung parallel zur Flüssigkeitsaufnahme die befürchteten Risiken oder unerwünschten Folgewirkungen erhöht.
Ungeklärt blieb aber und damit beginnen die Schattenseiten, welche Art von fester Nahrung den größten gesundheitlichen Nutzen erzielt. Es ist zu befürchten, dass zu dieser Frage weitere Jahre vergehen, um sie auf dem methodisch hohen Niveau eines Cochrane-Reviews, also auf der Basis einer Metaanalyse von randomisierten kontrollierten Studien beantworten zu können.
Wie unwahrscheinlich dies aber möglicherweise ist, zeigt sich, wenn man die empirische Basis für den immerhin erstellten Review näher betrachtet. Denn für ein Problem, das wahrscheinlich für mehr als 100 Millionen Kinder in der Dritten Welt und die Zukunft ihrer Länder existentielle Bedeutung hat, fanden die Cochrane-Reviewer gerade einmal 12 RCTs mit 1.283 TeilnehmerInnen. Und dies reichte quantitativ bereits im jetzigen Review nicht aus, um alle wichtigen Fragen abschließend zu beantworten. Während es zu den seltensten Erkrankungen bei Bewohnern Westeuropas und Nordamerikas in der Regel eine ausreichende Anzahl von Studien und natürlich Therapieangebote gibt, werden die in der Dritten Welt vorherrschenden Erkrankungen nicht nur unzulänglich versorgt (vgl. hierzu allein die Unterbewertung- und beachtung der Malaria), sondern auch bereits forschungsmäßig unterversorgt. Vielleicht reagieren aber Forscher auch angesichts des Nahrungsmangels in der Dritten Welt nur zynisch und meinen, es sei sinn- und nutzlos unter diesen Bedingungen über die richtige Ernährung zu forschen.
Und angesichts der Tatsache, dass weltweit alle fünf Sekunden ein Kind unter 10 Jahren verhungert und dabei meist eine Durchfallerkrankung die Auszehrung beschleunigt, stellt sich auch ernsthaft die Frage, welche Bedeutung hier Gesundheitsforschung und -versorgung haben. Denn für Kinder, die wegen absoluten Nahrungsmangels unterernährt sind, ist die Frage ob sie früh oder spät die eine oder andere Nahrung aufnehmen dürfen schlicht und einfach sinnlos.
Um was es dabei jenseits von Gesundheitsforschung und -politik mit Vorrang geht, hat der Schweizer Soziologie Jean Ziegler in der ihm eigenen drastischen Diktion in einer "nicht gehaltenen Rede zur Eröffnung der Salzburger Festspiele" gestützt auf die Berichte der Welternährungsorganisation der UN, u.a. so zusammengefasst: "Die Weltlandwirtschaft (könnte) in der heutigen Phase ihrer Entwicklung problemlos das Doppelte der Weltbevölkerung normal ernähren …. Schlussfolgerung: Es gibt keinen objektiven Mangel, also keine Fatalität für das tägliche Massaker des Hungers, das in eisiger Normalität vor sich geht. Ein Kind, das an Hunger stirbt, wird ermordet."
Zu dem Cochrane-Review "Early versus Delayed Refeeding for Children with Acute Diarrhoea" von Gregorio GV, Dans LF und Silvestre MA (Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 7) gibt es kostenlos nur das gewohnt längere Abstract.
Die Rede von Jean Ziegler kann komplett und kostenlos von der Website der Süddeutschen Zeitung vom 24.7. 2011 heruntergeladen werden.
Bernard Braun, 27.7.11
Ärztemangel ja! Pflegenotstand ja! Aber: Hebammennotstand? Und wenn doch, wo denn?
 Während sich in Deutschland Ärzteverbände, Krankenkassen und MinisterInnen die Luxusdebatte leisten können, ob die seit Jahren trotz konstanter Bevölkerung und auch (noch) nicht radikal veränderter Versorgungsbedarfe steigende Anzahl von Ärzten für die gewohnt gute Versorgung absolut zu wenig sind oder nur ihre Verteilung nicht stimmt, führt in anderen Ländern dieser Erde der Mangel an Hebammen oder vergleichbar fachkundigen Personen jährlich zum Tode von Millionen Kindern und von Hunderttausenden Frauen bzw. Müttern.
Während sich in Deutschland Ärzteverbände, Krankenkassen und MinisterInnen die Luxusdebatte leisten können, ob die seit Jahren trotz konstanter Bevölkerung und auch (noch) nicht radikal veränderter Versorgungsbedarfe steigende Anzahl von Ärzten für die gewohnt gute Versorgung absolut zu wenig sind oder nur ihre Verteilung nicht stimmt, führt in anderen Ländern dieser Erde der Mangel an Hebammen oder vergleichbar fachkundigen Personen jährlich zum Tode von Millionen Kindern und von Hunderttausenden Frauen bzw. Müttern.
Letzteres ist die Kernaussage des seit langem ersten vom United Nations Population Fund (UNFPA) veröffentlichten globalen Hebammen-Report, der sich detailliert mit der Versorgung durch Hebammen in 58 der Länder mit hohen Raten an Mütter-, Föten- und Neugeborenensterblichkeit beschäftigt. Die Ungleichheit der Lebens- und Gesundheitsverhältnisse setzt sich dabei sogar in der Gruppe der ärmsten Länder fort: Von den weltweit schätzungsweise 860.000 Personen mit essentiellen Hebammenkompetenzen praktizieren 536.000 in 57 der 58 Länder und der Rest, also rund 326.000 allein in Indien.
Zu den wichtigsten Eckdaten des Berichts gehören:
• Die Feststellung, dass jedes Jahr 358.000 Frauen und 3,6 Millionen Neugeborene an den zum größten Teil durch fachkundige Hilfe vermeidbaren Komplikationen in der Schwangerschaft, während der Geburt und in der nachgeburtlichen Phase sterben.
• Rund 3 Millionen Kinder werden zusätzlich tot geboren, was zum Teil ebenfalls durch entsprechende Interventionen vermeidbar gewesen wäre.
• Ob diese Art von vermeidbarer Sterblichkeit ab- oder zugenommen hat, lässt sich mangels vergleichbarer Daten aber nicht sagen.
• Die Ungleichverteilung des Geschehens zeigt sich daran, dass in den 58 Ländern ungefähr 60% der weltweiten Geburten stattfinden, aber 91% der Müttersterblichkeit.
• Um die im Milleniumprogramm der UN für 2015 anvisierte Reduktion der Mütter- und Neugeborenensterblichkeit zu erreichen, müssten bis dahin 22 der am schlechtesten versorgten Länder die Anzahl ihrer Hebammen verdoppeln, 7 sie verdrei- oder vervierfachen. Neun Länder, darunter etwa Haiti oder der Sudan, müssten ihre Hebammenanzahl um das 6 bis 15-fache erhöhen.
• Dass diese Ziele selbst isoliert betrachtet fast nicht zu erreichen sind, ist aber nur ein Teil des Problems. Hinzu kommt, dass in einigen dieser Länder durch den so genannten "brain drain" vieler der auch nicht gerade üppigen Anzahl von Ärzten oder Pflegekräften in die "Versorgungsmangelregionen" Europas und Nordamerikas noch größere als die sowieso schon existierenden Versorgungslücken entstehen werden. Ein Teil könnte u.a. von Hebammen gefüllt werden.
Der materialreiche 180-Seiten-Report "The State of the World's Midwifery 2011. Delivering Health, Saving Lives" ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 22.6.11
Befragung von Nutzerinnen einer Mutter-Kind-Kur: Hoher Bedarf, großer und nachhaltiger Nutzen und wie dieser erhöht werden kann!
 "Versicherte haben … Anspruch auf aus medizinischen Gründen erforderliche Rehabilitationsleistungen in einer Einrichtung des Müttergenesungswerks oder einer gleichartigen Einrichtung; die Leistung kann in Form einer Mutter-Kind-Maßnahme erbracht werden" (§ 41 SGB V)
"Versicherte haben … Anspruch auf aus medizinischen Gründen erforderliche Rehabilitationsleistungen in einer Einrichtung des Müttergenesungswerks oder einer gleichartigen Einrichtung; die Leistung kann in Form einer Mutter-Kind-Maßnahme erbracht werden" (§ 41 SGB V)
Den Bedarf für solche Maßnahmen hat das Bundesfamilienministerium beziffert. Etwa 2,1 Millionen Mütter sollen demnach kurbedürftig sein. Trotzdem sinken die Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung für Mütter-Kind- oder auch Vater-Kuren. Von 2009 auf 2010 sanken sie nach aktuellen Angaben des Müttergenesungswerks (MGW) um fast zehn Prozent von 316,7 Millionen auf 287,6 Millionen Euro. Dafür sorgt nach Meinung des MGW die in den letzten Jahren noch leicht angestiegene Erstablehnungsquote von durchschnittlich 34% im Jahr 2009. Dass diese Ablehnungen nicht nur aus berechtigten Gründen erfolgen, zeigt sich darin, dass in den rund 14.800 Widerspruchsverfahren mehr als die Hälfte der Ablehnungen unbegründet gewesen sind.
Nachdem sich nun auch noch der Bundesrechnungshof in die Überprüfung des Ablehnungs- und Bewilligungsgeschehen bei Mutter-Kindkuren (MKK) eingeschaltet hat (seitdem die GKV Steuerzuschüsse erhält, kann der Rechnungshof überprüfen wie in der GKV mit den Einnahmen umgegangen wird), wird die Debatte sicherlich noch eine Weile anhalten.
Wie bei vielen Finanzierungsdebatten verliert die Frage, welchen Nutzen die Versorgungsmaßnahmen haben und was man durch ihre Ablehnung qualitativ bewirkt, an Bedeutung. Sie wird bis auf wenige Ausnahmen kaum mehr gestellt und auch Antworten werden Mangelware.
Eine Ausnahme sind die Ergebnisse einer umfangreichen und tiefschürfenden Befragung von rund 500 versicherten Müttern (die sehr wenigen Väter wurden nicht in die Auswertung aufgenommen) der Handelskrankenkasse (hkk) Bremen, die 2009 eine stationäre MKK bewilligt und in Anspruch genommen hatten.
Zu den wichtigsten Informationen, die aus den 274 beantworteten Fragebögen gewonnen werden konnten, zählen
• der hohe gesundheitliche Bedarf, der die Mütter veranlasste, eine MKK zu beantragen: 47% der Mütter bezeichneten ihren Gesundheitszustand (physisch wie psychisch) vor Antritt der Kur als "mangelhaft" und weitere 14% als "schlecht". Die beste Schulnote für ihre Gesundheit war ein "befriedigend". Der gelegentlich geäußerte Verdacht, die MKK würde von eigentlich gar nicht bedürftigen Personen als eine Art Kurlaub in Anspruch genommen entbehrt also jeglicher Substanz.
• die proportionale Inanspruchnahme der MKK durch Mütter und Kinder aus unteren sozialen Schichten, d.h. der Bevölkerungsgruppe, die auch hier einen sehr hohen Bedarf hat.
• die hohe subjektiv wahrgenommene Wirksamkeit der MKK. Alles in Allem äußerten sich 75% der Teilnehmerinnen sehr zufrieden oder zufrieden. Unmittelbar nach der Heimkehr gaben 90% eine Verbesserung ihres vorherigen gesundheitlichen Zustands an. Und auch noch ein Jahr nach Ende der MKK bewerteten 30% der Teilnehmerinnen ihren Gesundheitszustand noch um eine Note besser als vor Beginn der MKK. Die Noote lag bei 43% um 2 Stufen über der vor Maßnahmebeginn.
• auch die Verbesserung bei objektiven Indikatoren des Gesundheitszustandes wie der Anzahl von Arztkontakten, ärztlichen Therapien und des Körperzustands. Weniger Veränderungen zeigten sich dagegen beim Gesundheitsverhalten der Mütter und im Bereich der eher psychischen Beeinträchtungen und
• positive gesundheitliche Effekte bei Kindern, sofern auch für sie altersgerechte Kurpläne erstellt werden.
Die Befragung förderte auch eine Reihe von meist einfach zu vermeidenden Schwachstellen und Defiziten der MKK zu Tage. Die Teilnehmerinnen nannten dabei vor allem folgende Details:
• Die Informationen über die Ziele und den angestrebten und gesicherten Nutzen sollten in verständlicher Form vor Antritt der MKK vorliegen. Dies gilt auch für Informationen über den Tagesablauf.
• Insgesamt plädieren die Mütter für die Vorlage eines Therapieplans. Ein Therapieplan erscheint den Müttern auch für ihre Kinder als vorteilhaft.
• Eines der größten Defizite sehen die Mütter in zu wenig Informationen oder Angeboten eines Nachsorgeprogramms. Dies wurde nur 17% angeboten und damit auch nur von sehr wenig Müttern in Anspruch genommen.
Der Bremer Gesundheitswissenschaftler Gerd Marstedt fasst den Nutzen der von ihm mit der Befragung evaluierten MKK so zusammen: "Die positiven gesundheitlichen und versorgungsökonomischen Effekte … der MKK (sind) sowohl in der Höhe als auch hinsichtlich der Nachhaltigkeit so hoch wie bei vielen anderen weit häufiger in Anspruch genommenen Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung."
Dass MKK zu Unrecht und wesentlich häufiger als viele andere GKV-Leistungen nicht bewilligt werden, sollten sich diejenigen Kassenverantwortliche, die glauben damit nutzlose Leistungen zu verweigern und wirtschaftlich zu handeln, nach der Lektüre der hkk-Mütterbefragung noch einmal gründlich durch den Kopf gehen lassen.
Die Ergebnisse der Mütter, die eine MKK in Anspruch genommen haben, sind als 17 Seiten umfassender und materialreicher Teil 2 Mutter/Vater-Kind-Kuren: Erfahrungen der hkk-Versicherten des hkk-Reports "Aspekte der Versorgungsforschung 2011" veröffentlicht und kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 3.6.11
2% -11% der Deutschen erlitten als Kinder und Jugendliche körperlichen, emotionalen und sexuellen Mißbrauch und Vernachlässigung
 Zu einem der großen sozialen und gesundheitlichen Tabuthemen gehören die körperliche und die emotionale Gewalt gegen Kinder und Heranwachsende, die meist durch Personen aus ihrem persönlichen Umfeld, also von Eltern, Verwandten oder Bekannten ausgeübt wird. Die Gewalt reicht vom "Klaps, der doch nicht schaden kann" (der passende Kommentar dazu: "Eine ordentliche Watschen hat noch jedem geschadet" [SZ 29.4.2011]) bis zum sexuellen Missbrauch, der am meisten bei Mädchen und heranwachsenden jungen Frauen erfolgt. Dies alles wird von den Betroffenen oft erst nach Jahrzehnten und meist auch erst nach langjährigen seelischen Erkrankungen oder Störungen des sozialen Verhaltens offen angesprochen und damit die wichtigste Voraussetzung für Hilfe geschaffen.
Zu einem der großen sozialen und gesundheitlichen Tabuthemen gehören die körperliche und die emotionale Gewalt gegen Kinder und Heranwachsende, die meist durch Personen aus ihrem persönlichen Umfeld, also von Eltern, Verwandten oder Bekannten ausgeübt wird. Die Gewalt reicht vom "Klaps, der doch nicht schaden kann" (der passende Kommentar dazu: "Eine ordentliche Watschen hat noch jedem geschadet" [SZ 29.4.2011]) bis zum sexuellen Missbrauch, der am meisten bei Mädchen und heranwachsenden jungen Frauen erfolgt. Dies alles wird von den Betroffenen oft erst nach Jahrzehnten und meist auch erst nach langjährigen seelischen Erkrankungen oder Störungen des sozialen Verhaltens offen angesprochen und damit die wichtigste Voraussetzung für Hilfe geschaffen.
Trotz der sicherlich auch bei der hier vorgestellten Studie hohen Dunkelziffer bringt eine jetzt veröffentlichte retrospektive Befragung von 2.504 Personen (14-90 Jahre) einer repräsentativen Stichprobe der deutschen Bevölkerung im Jahr 2010 mittels der deutschen Version des Childhood Trauma Questionnaire (der Fragebogen ist vorbildlich im Anhang des Aufsatzes dokumentiert) zu möglichen Misshandlungen und Vernachlässigungen in ihrer Kindheit und Jugend etwas Licht in dieses Dunkel. Hierbei handelt es sich erst um die zweite deutsche Studie, die versucht sämtliche Missbrauchsformen zu erheben.
Die Hauptergebnisse lauten:
• 1,6 % der Personen der Gesamtstichprobe berichteten über schweren emotionalen, 2,8 % über schweren körperlichen, 1,9 % über schweren sexuellen Missbrauch sowie 6,6 % über schwere emotionale und 10,8 % über schwere körperliche Vernachlässigung in Kindheit und Jugend.
• Unterschicht- und Mittelschichtzugehörigkeit erwiesen sich in logistischen Regressionsanalysen als Prädiktoren für schweren emotionalen und schweren körperlichen Missbrauch sowie schwerer emotionaler und schwerer körperlicher Vernachlässigung.
• Weibliches Geschlecht war in multivariaten Analysen ein klarer Prädiktor für schweren sexuellen Missbrauch.
• Die retrospektiv berichteten Häufigkeiten von Misshandlungen der aktuellen Befragung entsprechen den Ergebnissen einer bevölkerungsbasierten deutschen Studie aus dem Jahr 1995. Außerdem stimmen die Häufigkeiten mit den Ergebnissen mehrerer internationaler Studien überein.
Ein schlechter Trost ist, dass die Häufigkeit körperlicher und emotionaler Vernachlässigung bei den Nachkriegsgenerationen im Vergleich zu Menschen, die den 2. Weltkrieg und die Nachkriegszeit als Kinder und Jugendliche erlebt haben, abgenommen hat.
Trotzdem ist es auch im Nachhinein nicht verständlich warum erst im Jahre 2000 die folgende Bestimmung ins Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) Eingang gefunden hat: "Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafungen sind unzulässig."
Bleibt zu hoffen, dass diese Bestimmung auch den nachweisbaren Nutzen vergleichbarer rechtlicher Bestimmung im Ausland hat. So führte das in Schweden bereits 1979 gesetzlich eingeführte Recht auf gewaltfreie Erziehung mittlerweile zu wesentlich wenigeren Missbrauchsdelikten gegen Kinder und Jugendliche. Und vielleicht greift im gesetztreuen Deutschland ja auch mal eine Regelung schneller!
Die Studienergebnissse sind im April 2011 in dem Aufsatz "Misshandlungen in Kindheit und Jugend. Ergebnisse einer Umfrage in einer repräsentativen Stichprobe der deutschen Bevölkerung (Maltreatment in childhood and adolescence—results from a survey of a representative sample of the German population)" von Häuser W, Schmutzer G, Brähler E, Glaesmer H. im "Deutschen Ärzteblatt" (108(17): 287-94. DOI: 10.3238/arztebl.2011.0287) veröffentlicht worden, und kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 3.5.11
"Peer-Support" für höhere Stillrate: "Gutes" muss nicht immer die erwarteten positiven Wirkungen haben.
 Stillen hat mehrere Vorteile für die junge Mutter und ihr neugeborenes Kind. Die Evidenz dafür ist so ausgeprägt, dass die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt, neugeborene Kinder mindestens sechs Monate ausschließlich mit Stillen zu ernähren. Viele nationale Regierungen und Gesundheitsinstitutionen haben Initiativen gestartet, die Initialisierungsraten deutlich zu erhöhen. Trotzdem beginnen immer noch viele Frauen nicht, ihr neugeborenes Kind zu stillen.
Stillen hat mehrere Vorteile für die junge Mutter und ihr neugeborenes Kind. Die Evidenz dafür ist so ausgeprägt, dass die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt, neugeborene Kinder mindestens sechs Monate ausschließlich mit Stillen zu ernähren. Viele nationale Regierungen und Gesundheitsinstitutionen haben Initiativen gestartet, die Initialisierungsraten deutlich zu erhöhen. Trotzdem beginnen immer noch viele Frauen nicht, ihr neugeborenes Kind zu stillen.
Für eine Reihe von Interventionen die Stillbereitschaft nach der Geburt zu fördern, ist die Wirksamkeit bereits bewiesen. Seit einiger Zeit gilt nun die Unterstützung durch gleichrangige oder anerkannte Bezugspersonen ("peer") der jungen Mütter oder auch deren Vorbild im Vorfeld der Geburt als eine Intervention, die verspricht, die Stillraten zusätzlich zu erhöhen. Darüber ob der erwartete Effekt dieser Interventionsform eintritt, gab es bisher zwar eine Menge Plausibilität aber keine methodisch unverzerrten und schlüssigen Belege, beispielsweise durch randomisierte kontrollierte Studien.
Eine britische ForscherInnengruppe hat dies nun im Rahmen eines systematischen Reviews der dazu vorliegenden randomisierten kontrollierten Studien, Quasi-RCTs und Kohortenstudien genauer zu klären versucht. In ihre Untersuchungen gingen insgesamt 11 Studien mit 5.445 Frauen ein. Sieben dieser Studien mit 4.416 Frauen untersuchten generelle Unterstützungsangebote (z.B. mehrmalige Gespräche und Beratung) von gleichrangigen und anerkannten Personen an alle schwangeren Frauen. Die restlichen vier Studien mit 1.029 Teilnehmerinnen untersuchten gezielte "peer"-Angebote für diejenigen Schwangeren, die sich bereits überlegten, ihre Kinder zu stillen. Die Angehörigen der jeweiligen Kontrollgruppe wurden im Rahmen der Standardversorgung von Schwangeren von Ärzten oder Hebammen über den Sinn und die Möglichkeit des Stillens informiert.
Die wichtigsten Ergebnisse:
• Eine generelle vorgeburtliche Beratung und Unterstützung durch "Vorbild-Personen" führt nicht zu einer statistisch signifikanten Erhöhung der Stillrate bzw. der Reduktion der Rate nichtstillender Mütter. Das signifikante relative Risiko einer Nichtinitiierung von Stillen war 0,96
• Etwas anders sieht es dann aus, wenn dieses Unterstützungsangebot gezielt bei bereits interessierten Frauen platziert wird: Aber auch dort konzentriert sich der signifikant höhere Effekt in den bisherigen Studien bei den hispanischen Frauen mit niedrigem Einkommen in den USA. In einer Gruppe, wo 75 von 100 Frauen das Stillen wählen, führte eine gezielte "peer"-Unterstützung dazu, dass 9 zusätzliche Frauen zu stillen beginnen. Das relative Risiko, dass die Frauen nicht stillten, war hier 0,64.
• Da die Studienergebnisse sich insgesamt auf nur wenige Studien stützen können und diese auch keineswegs ein homogenes Wirksamkeitsbild liefern, empfehlen die ForscherInnen zu Recht weitere "high-quality evaluation". Dort sollte auch die mögliche additive Wirkung von vorgeburtlicher Unterstützung und der Unterstützung beim Stillen unmittelbar nach der Geburt untersucht werden.
Trotz seiner selbst erkannten Grenzen zeigt dieser Review, dass ansonsten als wirksam anerkannte Interventionsformen keineswegs immer zu den gewünschten Wirkungen führen müssen, sondern von Anwendungsbereich zu Anwendungsbereich neu nach der spezifischen Wirkung gefragt werden muss. Außerdem zeigen sich erneut Grenzen von universellen oder "Gießkannen"-Interventionen.
Die komplette Studie "Effect of antenatal peer support on breastfeeding initiation: a systematic review" von Lucy Ingram, Christine MacArthur, Khalid Khan, Jonathan J. Deeks und Kate Jolly ist in der kanadischen Fachzeitschrift "Canadian Medical Association Journal (CMAJ)" am 9. November 2010 (2010, 182 (16): 1739-1746) und kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 9.11.10
Schwedische ADHS-Studie: Medikamente werden häufiger verschrieben bei unterprivilegierten Müttern
 Eine große schwedische Studie, in der jetzt Daten von 1,1 Millionen Kindern und Jugendlichen (Alter 6-19 Jahre) analysiert wurden, hat gezeigt: Das sogenannte Aufmerksamkeitsdefizit- Hyperaktivitäts-Syndrom findet sich sehr viel häufiger bei Kindern, wenn Mütter aus unterprivilegierten sozialen Milieus kommen, also eine geringe Schulbildung aufweisen, alleinerziehend sind oder von Sozialhilfe leben. Genauer gesagt, wurde die Verteilung von ADHS nicht anhand ärztlicher Krankheitsdiagnosen untersucht, sondern die Verschreibung bestimmter, für die Krankheit typischer Medikamente wie Ritalin analysiert.
Eine große schwedische Studie, in der jetzt Daten von 1,1 Millionen Kindern und Jugendlichen (Alter 6-19 Jahre) analysiert wurden, hat gezeigt: Das sogenannte Aufmerksamkeitsdefizit- Hyperaktivitäts-Syndrom findet sich sehr viel häufiger bei Kindern, wenn Mütter aus unterprivilegierten sozialen Milieus kommen, also eine geringe Schulbildung aufweisen, alleinerziehend sind oder von Sozialhilfe leben. Genauer gesagt, wurde die Verteilung von ADHS nicht anhand ärztlicher Krankheitsdiagnosen untersucht, sondern die Verschreibung bestimmter, für die Krankheit typischer Medikamente wie Ritalin analysiert.
1.162.524 schwedische Kinder und Jugendliche im Alter von 6-19 Jahren wurden von einem Forschungsteam aus Stockholm und Uppsala anhand mehrerer Nationaler Register in die Analysen einbezogen. Erfasst wurde einerseits anhand des schwedischen Medikamenten-Registers, ob den Studienteilnehmern im Jahre 2005 ein Medikament verschrieben wurde, das einen für ADHS charakteristischen Wirkstoff wie Methylphenidat ("Ritalin") enthält. Andererseits wurde eine Reihe sozialstatistischer Daten der Mütter erfasst, so unter anderem Geschlecht, Alter, Region des Wohnsitzes, Schulbildung, Art der Einkünfte (Sozialhilfe ja oder nein), ob alleinerziehend. Ferner wurde berücksichtigt, ob eine psychiatrische Erkrankung oder Suchterkrankung vorliegt.
Insgesamt fand man 7.960 Fälle, bei denen ADHS-Medikamente verschrieben wurden, dabei überwogen männliche Kinder und Jugendliche mit 1.06 % der Gesamtstichprobe im Vergleich zu 0.29 % Mädchen. Methylphenidate (wie "Ritalin") wurden am häufigsten verschrieben (88%), gefolgt von Atomoxetin (wie "Strattera") (9%) and Amphetaminen (3%).
In multivariaten Analysen (unter gleichzeitiger Berücksichtigung aller dieser Einflussfaktoren) zeigte sich dann, dass drei dieser Merkmale besonders stark mit der Verschreibung von ADHS-Medikamenten zusammenhängen.
• Den deutlichsten Effekt zeigte das Bildungsniveau der Mutter. Bei niedriger Schulbildung (0-9 Schulklassen absolviert) war die Wahrscheinlichkeit ("Odds-Ratio"), dass das Kind ADHS-Medikamente einnimmt, 2,3mal so hoch wie bei Müttern mit sehr hoher Schulbildung.
• Wenn die Mutter alleinerziehend war, lag das Risiko bei 1,45 und wenn sie von Sozialhilfe lebte, betrug es 2,06.
• Ein niedriges Bildungsniveau der Mutter erklärt 33 Prozent der ADHS-Fälle bzw. Medikamenten-verschreibungen, 14 Prozent gehen auf das Konto der Alleinerziehung.
Zur Studie gibt es kostenlos nur ein kurzes Abstract: A Hjern, GR Weitoft, F Lindblad: Social adversity predicts ADHD-medication in school children - a national cohort study (Acta Pædiatrica, Volume 99 Issue 6, Pages 920 - 924)
ADHS ist eine im Kindesalter beginnende psychische Erkrankung, die sich durch leichte Ablenkbarkeit und Konzentrationsstörungen, geringes Durchhaltevermögen, sowie gesteigerte Aktivität und Impulsivität auszeichnet. Die Ursachen der Erkrankung sind nicht restlos geklärt, man vermutet eine Kombination aus angeborenen und umwelt- bzw. sozialisationsbedingten Faktoren. Etwa drei bis zehn Prozent aller Kinder zeigen Symptome im Sinne einer ADHS. Jungen sind deutlich häufiger betroffen als Mädchen. Man geht davon aus, dass ein multifaktoriell bedingtes Störungsbild mit einer erblichen Disposition vorliegt. Unklar ist, in welchem Umfang eine ADHS-Diagnose gestellt wird, obwohl nur ein vergleichsweise harmloses und oft reversibles kindliches Sozialverhalten vorliegt.
Frühere Studien hatten nämlich gezeigt:
• Wenn Eltern sich scheiden lassen und das Kind danach Symptome des sogenannten "Zappelphilipp-Syndroms" zeigt (Aufmerksamkeitsdefizit - Hyperaktivitäts - Syndrom - ADHS), dann besteht ein doppelt so großes Risiko wie bei zusammen lebenden und verheirateten Eltern, dass dieses Kind ein Medikament wie Ritalin verschrieben bekommt, um die Verhaltensauffälligkeiten zu behandeln.
• Durch Aggressivität oder "Hyperaktivität" verhaltensauffällige Kinder, die bei nur einem Elternteil leben, werden doppelt so oft mit Medikamenten (mit dem Wirkstoff Methylphenidat) behandelt wie wenn sie in der Obhut von zwei Elternteilen sind.
• Auch für Kinder, die bei Stiefeltern leben, hatten sich ähnliche Ergebnisse gezeigt.
• Eine neuere Studie hat jetzt angedeutet, dass möglicherweise nicht das Fehlen eines Elternteils der eigentliche Risikofaktor ist, sondern der durch die Scheidung bei Eltern wie Kindern gleichermaßen ausgelöste Stress.
vgl. zum Thema auch:
• Therapie des "Zappelphilipp-Syndroms": Kinder geschiedener Eltern bekommen häufiger Medikamente verordnet)
• Der Einsatz von Medikamenten zur Behandlung "hyperaktiver" Kinder hat sich weltweit verdreifacht
• Aggression im Kindergartenalter - Eine Studie zeigt: Es geht auch ohne Medikamente
Gerd Marstedt, 11.7.10
Schweizer Studie: Mehr Schulsport wirkt sich gesundheitlich überaus positiv aus
 Zwei zusätzliche Stunden Sportunterricht in der Woche - kann dies ein Mittel sein, um Übergewicht und Adipositas bei Kindern und Jugendlichen zu bekämpfen? Ein jetzt in der renommierten englischen Fachzeitschrift "British Medical Journal" veröffentlichter Artikel über eine Schweizer Interventionsstudie macht deutlich, dass mehr Sport und Bewegung in der Schule sich gesundheitlich überaus positiv auswirken, wie an einer Reihe von Indikatoren (Körperfett, Fitness, Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen) deutlich wird. Ein Wermutstropfen bleibt gleichwohl: Das Körpergewicht der Schüler und der Body Mass Index nahmen nicht ab, sondern stiegen generell ein wenig an, allerdings in der Kontrollgruppe noch stärker als in der Interventionsgruppe.
Zwei zusätzliche Stunden Sportunterricht in der Woche - kann dies ein Mittel sein, um Übergewicht und Adipositas bei Kindern und Jugendlichen zu bekämpfen? Ein jetzt in der renommierten englischen Fachzeitschrift "British Medical Journal" veröffentlichter Artikel über eine Schweizer Interventionsstudie macht deutlich, dass mehr Sport und Bewegung in der Schule sich gesundheitlich überaus positiv auswirken, wie an einer Reihe von Indikatoren (Körperfett, Fitness, Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen) deutlich wird. Ein Wermutstropfen bleibt gleichwohl: Das Körpergewicht der Schüler und der Body Mass Index nahmen nicht ab, sondern stiegen generell ein wenig an, allerdings in der Kontrollgruppe noch stärker als in der Interventionsgruppe.
Insgesamt 502 Schülerinnen und Schüler im Alter von etwa sieben bis elf Jahren nahmen an der Studie teil, die an 15 Schweizer Grundschulen im Aargau und Baseler Umland durchgeführt wurde. Ein "sozial-ökologisches Konzept" sollte auf seine Effektivität bei der Bekämpfung von Übergewicht und der Verbesserung körperlicher Fitness überprüft werden. Dazu wurden die teilnehmenden Kinder nach dem Zufallsprinzip einer Interventions- oder Kontrollgruppe zugewiesen. In der Kontrollgruppe wurde weiter nichts unternommen, der Schulunterricht lief wie gewohnt weiter und Teilnehmer wurden ganz bewusst nicht informiert, dass sie als Vergleichsgruppe dienen sollten.
In der Interventionsgruppe jedoch wurde einiges verändert:
• Der Sportunterricht wurde von drei auf fünf Unterrichtstunden (zu jeweils 45 Minuten) erhöht, und die zwei zusätzlichen Stunden wurden nicht von den gewohnten Klassenlehrern abgehalten, sondern von geschulten Sportlehrern.
• Der gesamte Unterricht wurde von Sportwissenschaftlern neu strukturiert. Lehrer sollten jetzt etwa 3-5mal am Tag kurze Pausen einlegen, um unterschiedliche motorische Übungen durchzuführen: Springen, auf einem Bein Balancieren, Kraftübungen, Koordinationsaufgaben und anderes mehr.
• Darüber hinaus bekamen die Kinder täglich andere sportliche Hausaufgaben, deren Ausübung jeweils etwa 10 Minuten dauerte und die mit den Übungen in den Unterrichtspausen vergleichbar waren: Aerobic, Krafttraining, Seilspringen, Treppen hinauf und wieder herunter hüpfen, auf einem Bein stehen und sich die Zähne putzen und ähnliches mehr.
Zur Messung der Interventionseffekte wurden als primäre Indikatoren herangezogen: Körperfett an bestimmten Hautpartien, körperliche Fitness, Ausmaß körperlicher Bewegung und Fragen zur wahrgenommenen Lebensqualität. Darüber hinaus wurden auch der Body Mass Index überprüft und ein Risikowert für kardiovaskuläre Erkrankungen gebildet (u.a. auf der Basis von Blutdruck, Blutzuckerwert, Hüftumfang, Cholesterinwerte).
Nach neun Monaten wurden diese Indikatoren dann in der Interventions-, aber auch in der Kontrollgruppe erhoben und mit den Daten zu Studienbeginn verglichen. Dabei zeigten sich in einer multivariaten Analyse, die auf statistischem Wege auch andere Einflussfaktoren (Alter, Geschlecht etc.) berücksichtigte, unterschiedliche Befunde:
• Positive Effekte zugunsten der Interventionsgruppe zeigten sich im Hinblick auf die Entwicklung von Körperfett an vier Hautpartien, die körperliche Fitness bei Aerobic-Übungen, das Ausmaß körperlicher Bewegung in der Schule. Ebenso verbesserten sich die Risikowerte für Herz-Kreislauf-Erkrankungen in der Interventionsgruppe stärker als in der Kontrollgruppe.
• Keine Unterschiede hingegen zeigten sich für die Bewertung der körperlichen und psychischen Lebensqualität.
• Im Hinblick auf Veränderungen des Body Mass Index zeigte sich überraschender Weise, dass der Durchschnittswert in beiden Gruppen (allerdings nur geringfügig) gestiegen war, wobei der Anstieg in der Kontrollgruppe noch etwas höher ausfiel (+ 0,4 bzw. + 0,3 BMI).
Die Forscher führen dieses letzte, für sie unerwartete Ergebnis darauf zurück, dass in der Interventionsgruppe der zeitliche Umfang von Sport und Bewegung in der Freizeit zurückgegangen war, und zwar vermutlich aufgrund des zeitlich erweiterten Schulsports. Da sich jedoch eine Reihe anderer Indikatoren, wie das Ausmaß an Körperfett, die körperliche Fitness und sogar kardiovaskuläre Risikofaktoren durch die Maßnahmen sehr positiv verändert haben, sprechen sie zu Recht von einem Erfolg ihrer Studie. Unterstrichen wird dies durch Ergebnisse einer Befragung am Ende der Studie: 90% der Kinder und 70% der Lehrer wünschten sich eine Fortsetzung der Maßnahmen auch in kommenden Schuljahren.
Eine wichtige Frage bleibt allerdings für Wissenschaftler zukünftig noch zu klären, nämlich die, wie man in weiteren Interventionsstudien vermeiden kann, dass eine zeitliche Ausweitung von Sport und körperlicher Bewegung im Setting Schule wieder konterkariert wird durch eine Reduktion solcher Aktivitäten in der Freizeit.
Von der Veröffentlichung gibt es im BMJ kostenlos ein Abstract, aber auch den Volltext: Susi Kriemler et al: Effect of school based physical activityprogramme (KISS) on fitness and adiposity in primary schoolchildren: cluster randomised controlled trial, BMJ 2010;340:c785, doi:10.1136/bmj.c785
• Abstract
• Volltext (PDF)
Gerd Marstedt, 30.4.10
Minderung des Softdrinkkonsums von Kindern und Jugendlichen - keine einfachen Lösungen
 Softdrinks wie Cola, Fanta und Sprite sind bei Kindern und Jugendlichen beliebt. Sie sind kalorienreich, verschaffen kein Sättigungsgefühl und tragen daher auch zum Übergewicht bei. Die Minderung des Konsums ist aus der Perspektive der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen erwünscht. In einer Studie der Mai-Ausgabe der Zeitschrift Health Affairs befassten sich die Autoren mit der Wirksamkeit von Maßnahmen zur Minderung des Softdrinkkonsums von Kindern und Jugendlichen. Dabei ging es um die Verfügbarkeit von Softdrinks über Getränkeautomaten in der Schule und um Steuern auf Softdrinks.
Softdrinks wie Cola, Fanta und Sprite sind bei Kindern und Jugendlichen beliebt. Sie sind kalorienreich, verschaffen kein Sättigungsgefühl und tragen daher auch zum Übergewicht bei. Die Minderung des Konsums ist aus der Perspektive der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen erwünscht. In einer Studie der Mai-Ausgabe der Zeitschrift Health Affairs befassten sich die Autoren mit der Wirksamkeit von Maßnahmen zur Minderung des Softdrinkkonsums von Kindern und Jugendlichen. Dabei ging es um die Verfügbarkeit von Softdrinks über Getränkeautomaten in der Schule und um Steuern auf Softdrinks.
Im Rahmen einer Kohortenstudie (Early Childhood Longitudinal Study-Kindergarten Cohort) wurden im Jahr 2004 bzw. 2007 die Kinder der 5. bzw. 8. Klasse gefragt, wie oft sie in der Schule einen Softdrink konsumiert und gekauft hatten. 27% der Fünftklässler und 60% der Achtklässler hatten in der Schule Zugang zu Softdrinks über Getränkeautomaten. 84 % aller Schüler gaben an, in der vorausgegangenen Woche Softdrinks (im Durchschnitt 6) konsumiert zu haben. 13% der Fünftklässler und 25% der Achtklässlergaben hatten Softdrinks in der Schule gekauft.
Bei Vorhandensein von Getränkeautomaten sind der Anteil der Schüler, die Softdrinks in der Schule konsumieren sowie die Anzahl der in der Schule konsumierten Softdrinks deutlich höher. Keine wesentlichen Unterschiede zeigten sich jedoch, wenn man den Konsum innerhalb und außerhalb der Schule aufaddiert. Dies bedeutet, dass Kinder aus Schulen ohne Getränkeautomaten den schulischen Minderkonsum durch Mehrkonsum außerhalb der Schule wieder ausgleichen.
Die Effekte von Softdrink-Steuern, die in einigen Bundesstaaten auf Softdrinks erhoben werden, auf den Konsum von Softdrinks und das Gewicht von Kindern und Jugendlichen untersuchten die Wissenschaftler mit den Daten des "National Health and Nutrition Examination Survey", einer großen amerikanischen Ernährungsstudie (Website Fragebögen).
Der Effekt von Softdrink-Steuern
Erfragt wurden die konsumierten Lebensmittel der letzten 24 Stunden. 54% der Kinder und Jugendlichen gaben an, einen Softdrink zu sich genommen zu haben, entsprechend durchschnittlich 205 Kalorien. Im Vergleich der Bundesstaaten mit und ohne Softdrink-Steuer zeigten sich jedoch keine wesentlichen Unterschiede im Konsum und im Körpergewicht. In Bundesstaaten mit Softdrinksteuer sind im Vergleich zu Bundesstaaten ohne Softdrinksteuer das Durchschnittsgewicht von Kindern und Jugendlichen, die durch Softdrinks zugeführte Kalorienmenge und auch das Gewicht etwas höher, der Anteil der Softdrinkkonsumenten entgegen den Erwartungen etwas geringer - keiner der Unterschiede erreicht jedoch statistische Signifikanz.
Die Autoren folgern, dass die gegenwärtige Praxis der Verkaufsrestriktion an Schulen und der Steuer in Bundesstaaten den Softdrinkkonsum nicht zu spürbaren Gewichtsminderungen bei Kindern und Jugendlichen führt. Restriktionen im Zugang müssten umfassender und Steuern auf Softdrinks höher sein, wenn diese Maßnahmen wirksam sein sollen.
Hier ist ein Abstract der Studie: Fletcher JM, Frisvold D, Tefft N.: Taxing Soft Drinks And Restricting Access To Vending Machines To Curb Child Obesity Health Aff 2010:hlthaff.2009.0725.
Ergänzend ist anzumerken, dass das Ernährungsverhalten von Kindern und Jugendlichen durch eine Vielzahl von Faktoren bestimmt wird. Die Beeinflussung eines Einzelaspektes lässt keine durchschlagenden Effekte erwarten. Erfolgversprechend sind eher bevölkerungsweite, multimodale Interventionen, wie sie der Sachverständigenrat Gesundheit in seinem Gutachten 2000/2001 umrissen hat: (SVR Band III.3, Ziffer 62-93)
Dabei werden drei Ebenen angesprochen:
1. Bevölkerungsweite Strategien, Streubotschaften und Anreize
2. Zielgruppen- und Setting-spezifische Kampagnen
3. Persönliche Kommunikation, Beratung und Behandlung
Hier eine Auswahl von Beiträgen im Forum Gesundheitspolitik zum Ernährungsverhalten:
• Steuer auf Junk Food: Gut für die Gesundheit
• Verbot der Fernsehwerbung von Fastfood-Restaurants würde die Verbreitung von Übergewicht bei Kindern senken
• Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm: Kinder imitieren auch gesundheitsriskante Ernährungsgewohnheiten ihrer Eltern,
• Viel zu viele Kalorien - Kindermenüs in Fastfoodketten
• McDonald's Werbebotschaften beeinflussen schon 4-5jährige Vorschulkinder
• Elterneinfluss auf das Essverhalten ihrer Kinder ist kleiner als erwartet
Weitere Beiträge in der Rubrik Prävention - Gesundheitsverhalten
David Klemperer, 11.4.10
Eltern überschätzen das Ausmaß körperlicher Bewegung bei ihren Kindern erheblich
 Viele Interventionen zur Erhöhung körperlicher Aktivität bei Kindern haben bislang keinen oder nur mäßigen Erfolg gezeigt. Das Ausmaß körperlicher Bewegung bei Kindern hängt nun bekanntermaßen nicht nur von ihrer eigenen Motivation sowie Rahmenbedingungen in der Freizeit ab, sondern wird auch sehr stark von elterlichen Impulsen und Initiativen beeinflusst. Eine Grundvoraussetzung für die Erhöhung der körperlichen Aktivität bei Kindern ist daher, dass Eltern überhaupt eine realistische Vorstellung des Status quo haben und gegebenenfalls überhaupt Bewegungsdefizite ihres Sohnes oder ihrer Tochter erkennen. Eine britische Studie hat nun allerdings gezeigt, dass hier Einiges im Argen liegt, denn nicht wenige Eltern denken, dass ihre Kinder sich schon genug bewegen.
Viele Interventionen zur Erhöhung körperlicher Aktivität bei Kindern haben bislang keinen oder nur mäßigen Erfolg gezeigt. Das Ausmaß körperlicher Bewegung bei Kindern hängt nun bekanntermaßen nicht nur von ihrer eigenen Motivation sowie Rahmenbedingungen in der Freizeit ab, sondern wird auch sehr stark von elterlichen Impulsen und Initiativen beeinflusst. Eine Grundvoraussetzung für die Erhöhung der körperlichen Aktivität bei Kindern ist daher, dass Eltern überhaupt eine realistische Vorstellung des Status quo haben und gegebenenfalls überhaupt Bewegungsdefizite ihres Sohnes oder ihrer Tochter erkennen. Eine britische Studie hat nun allerdings gezeigt, dass hier Einiges im Argen liegt, denn nicht wenige Eltern denken, dass ihre Kinder sich schon genug bewegen.
Die Studie hat bei knapp 2.000 Kindern im Alter von etwa 9-10 Jahren in der ostenglischen Grafschaft Norfolk das Ausmaß körperlicher Bewegung durch Messgeräte erfasst und diese Daten mit der elterlichen Einschätzung verglichen. Ein zentrales Ergebnis der Analysen war dann: Etwa 4 von 10 Mädchen und 2 von 10 Jungen zeigten nur ein überaus geringes Maß an körperlicher Aktivität. Gleichwohl gaben 80 Prozent der Eltern dieser Kinder mit geringer Bewegungsintensität an, sie hätten ausreichend Bewegung.
An der Studie beteiligt waren 1.892 Kinder, darunter 56 Prozent Mädchen, aus insgesamt 92 Schulen in Norfolk. Das Ausmaß von Sport und körperlicher Bewegung wurde im Zeitraum April bis Juli 2007 einerseits mit Beschleunigungs-Messgeräten (Akzelerometer) erfasst, die von den Schülern durchgängig getragen wurden - außer nachts, im Schwimmbad oder beim Duschen. In die Studie wurden dann nur Kinder einbezogen, deren Beschleunigungsmesser Daten von zumindest drei Tagen gespeichert hatten. Auf der Basis dieser Daten und entsprechend den Empfehlungen englischer Sportmediziner wurde die körperliche Aktivität der Kinder dann als ausreichend oder nicht ausreichend bewertet.
Die zweite Datenquelle resultierte aus Befragungen der Kinder selbst sowie aus Befragungen der Eltern. Letztere etwa wurden gefragt: "Was würden Sie sagen, hat Ihr Kind im Vergleich mit anderen gleichaltrigen Kindern viel mehr, etwas mehr, genau so viel, etwas weniger, viel weniger körperliche Bewegung?"
In der Auswertung dieser Daten ergaben sich dann folgende Befunde:
- Knapp ein Drittel der Kinder (31 Prozent) wurde nach den Daten der Beschleunigungsmesser als zu wenig aktiv eingestuft. Dabei zeigten sich markante Geschlechtsunterschiede: 39 Prozent der Mädchen im Vergleich zu 18 Prozent der Jungen waren zu wenig aktiv.
- 69 Prozent der Eltern schätzten die Intensität körperlicher Bewegung zutreffend ein - als eher aktiv oder auch eher inaktiv. Bei jener Gruppe von Kindern mit zu wenig Bewegung (31 Prozent aller Kinder) hatten jedoch 80 Prozent der Eltern dieser Gruppe eine überhöhte Einschätzung.
- Bei den Kindern selbst gab es auch Fehleinschätzungen, jedoch nicht in demselben Maße. 54 Prozent bewerteten ihre Bewegungsintensität zutreffend (als ausreichend oder zu gering). In der Gruppe mit zu wenig Bewegung (31 Prozent) überschätzten 4 von 10 Kindern (40 Prozent) ihre Aktivitäten.
Die Wissenschaftler versuchten im Rahmen einer multivariaten Analyse (in der eine Vielzahl potentieller Einflussfaktoren gleichzeitig geprüft wird) auch herauszufinden, welche Merkmale solche Eltern aufweisen, die zu einer Überschätzung der kindlichen Bewegungsintensität neigen. Hier zeigte sich dann: Dies ist häufiger der Fall, wenn das Kind einen eher niedrigen Body-Mass-Index aufweist, Eltern also nur aufgrund der Statur ihres Kindes vermuten, es hätte genug Bewegung. Zum zweiten spielt auch eine Rolle, ob Eltern davon ausgehen, dass ihr Kind viele Freunde hat, ein großes soziales Netzwerk. Beide Faktoren können jedoch täuschen.
In der Diskussion ihrer Befunde weisen die Wissenschaftler darauf hin, dass die elterliche Ermunterung zu Sport und Bewegung und unter Umständen sogar die gemeinsame Aktivität ein wichtiger Impuls für Kinder sein kann. Die Mehrzahl der Eltern zu passiver Kinder (8 von 10) nimmt diese Bewegungsdefizite jedoch gar nicht wahr. Ein Einsatz von Pedometern oder Beschleunigungsmessern, so die Forscher, läge daher nahe, um diese Wahrnehmungsverzerrung zu korrigieren. Wie dies jedoch sinnvoll im Alltag umgesetzt werden könnte, sei bislang zu wenig untersucht.
Hier ist ein Abstract der Studie zu finden: Kirsten Corder et al: Perception Versus Reality: Awareness of Physical Activity Levels of British Children
(American Journal of Preventive Medicine; Volume 38, Issue 1, January 2010, Pages 1-8)
Gerd Marstedt, 8.3.10
Deutsche Studie bei über 3.000 Schülern zeigt: Werbung verführt Jugendliche zum Trinken
 In Deutschland war man bisher bei der Diskussion eines Zusammenhangs zwischen Alkoholwerbung und Alkoholkonsum junger Menschen auf die Ergebnisse ausländischer Studien angewiesen. Und einer der wenigen deutschen Anläufe, diese Lücken zu schließen, enthielt zwar Angaben zur Bekanntheit und Bewertung verschiedener Alkoholspots, nicht aber Fakten zum Alkoholkonsum der betreffenden Jugendlichen. Diese Lücken werden nun durch eine vom Institut für Therapie- und Gesundheitsforschung (IFT Nord) im Auftrag der DAK durchgeführte Querschnittstudie bei 3.415 SchülerInnen im Alter von 10 bis 17 Jahren aus drei norddeutschen Bundesländern geschlossen.
In Deutschland war man bisher bei der Diskussion eines Zusammenhangs zwischen Alkoholwerbung und Alkoholkonsum junger Menschen auf die Ergebnisse ausländischer Studien angewiesen. Und einer der wenigen deutschen Anläufe, diese Lücken zu schließen, enthielt zwar Angaben zur Bekanntheit und Bewertung verschiedener Alkoholspots, nicht aber Fakten zum Alkoholkonsum der betreffenden Jugendlichen. Diese Lücken werden nun durch eine vom Institut für Therapie- und Gesundheitsforschung (IFT Nord) im Auftrag der DAK durchgeführte Querschnittstudie bei 3.415 SchülerInnen im Alter von 10 bis 17 Jahren aus drei norddeutschen Bundesländern geschlossen.
Das Ergebnis ist eindeutig: Es besteht ein robuster linearer Dosis-Wirkungszusammenhang ("je mehr, desto mehr") zwischen der Exposition mit Alkoholwerbung und einer Reihe von Variablen des Alkoholkonsums der Kinder und Jugendlichen. Auch nach der Kontrolle einer Reihe von Alternativerklärungen ist die multivariat durch Regressionsanalysen bestimmte Chance eines erhöhten Alkoholkonsums in der Gruppe mit höchstem Kontakt zur Alkoholwerbung rund doppelt so hoch wie bei Angehörigen der Gruppe mit dem niedrigsten Kontakt.
Weitere wichtige Ergebnisse der Studie:
• 54% der SchülerInnen hatten von den 9, ihnen für diese Studie "maskiert", d.h. ohne Hinweise auf Marken- und Produktnamen gezeigten Alkohol-Werbespots, mindestens schon einmal 6 gesehen. Diese Kontakthäufigkeit entspricht in etwa der zu Süßigkeiten und Automarken. Nur 1,5% gaben an, bisher noch keine der Alkoholwerbungen gesehen zu haben. Dabei existierte ein eindeutig positiver Zusammenhang der Bekanntheit von Werbebotschaften mit dem Fernsehkonsum.
• Jungen hatten einen signifikant höheren Alkoholwerbekontakt als Mädchen und konnten die Marken auch besser assoziieren oder abrufen.
• Die meisten der in den Spots oder Anzeigen beworbenen Alkoholika waren den Kindern und Jugendlichen namentlich bekannt. Damit haben die Werbeexperten ein "Traumziel" erreicht: Ihr Produkt hat sich in der Wahrnehmung der Menschen so festgesetzt, dass es auch über das an sich neutrale Bild einer waldigen Seenlandschaft oder an der Wand hängende Hirschgeweihe assoziiert und erinnert wird.
• Der Alkoholkonsum von Kindern und Jugendlichen findet weniger heimlich statt als erwartet: Nur 27% der dazu befragten SchülerInnen bestätigten, sie hätten schon mal ohne Wissen der Eltern Alkohol getrunken. 58% gaben dagegen an, ihre Eltern hätten ihnen bereits einmal etwas zum Trinken angeboten und dies mit ihnen gemeinsam konsumiert.
• Einige der erhobenen Daten legen für die ForscherInnen "ein wenig die Vermutung nahe", viele der SchülerInnen würden eher selten Alkohol trinken, aber dann, wenn sie trinken, viel. 56% der SchülerInnen berichten ganz in diesem Sinne, schon mal "Binge drinking" (so bezeichnet man das Trinken von mehr als 5 alkoholischen Getränken bei einer Gelegenheit) betrieben zu haben. Selbst von den 10-12-Jährigen gaben 11% an, dies schon mal gemacht zu haben.
• Die WissenschaftlerInnen weisen selbstkritisch auf die Schwäche von Behauptungen über kausale Zusammenhänge hin, die im Rahmen von Querschnittsanalysen gewonnen werden, und plädieren für zusätzliche Längsschnittstudien. Trotzdem halten sie aber die spezifische Bedeutung des Werbeinhalts für gesichert, da sich z.B. keine Assoziation zwischen Alkoholkonsum und neutralen Werbungen gezeigt hat.
Die im März 2009 veröffentlichte Studie von Morgenstein, M., Isensee, B., Sargent und Hanewinkel R. erhält man komplett (17 Seiten) und kostenlos über den Dokumentenserver der DAK: Jugendliche und Alkoholwerbung. Einfluss der Werbung auf Einstellung und Verhalten
Bernard Braun, 15.10.09
Was kinderfreundliche Menschen beim "Genuss" einer Zigarette wissen sollten! "Tabakrauchen tötet", aber ist Tabak vorher harmlos?
 Über einen Teil der gesundheitlichen Risiken des Tabakkonsums kann man sich seit ein paar Wochen im Tabak-Atlas Deutschland informieren. Welche gesundheitlichen und sozialen Probleme bereits vor dem Anstecken einer Zigarette, also beispielsweise durch den Anbau und die Ernte von Tabak, entstehen und wer davon betroffen ist, zeigt nun exemplarisch ein Bericht der vor allem in der 3. Welt aktiven Kinderhilfsorganisation Plan International für das Dritte-Welt-Land Malawi.
Über einen Teil der gesundheitlichen Risiken des Tabakkonsums kann man sich seit ein paar Wochen im Tabak-Atlas Deutschland informieren. Welche gesundheitlichen und sozialen Probleme bereits vor dem Anstecken einer Zigarette, also beispielsweise durch den Anbau und die Ernte von Tabak, entstehen und wer davon betroffen ist, zeigt nun exemplarisch ein Bericht der vor allem in der 3. Welt aktiven Kinderhilfsorganisation Plan International für das Dritte-Welt-Land Malawi.
Malawi ist einer der größten Tabakproduzenten weltweit. In dem südostafrikanischen Land verdienen vier Fünftel der Menschen ihren Lebensunterhalt direkt oder indirekt mit dem Anbau von Tabak. In Malawi arbeiten außerdem schätzungsweise 78.000 Kinder auf Tabakplantagen. Zum Teil sind sie erst fünf Jahre alt. Im Schnitt zahlen ihnen die als Arbeitgeber fungierenden multinationalen Tabakproduzenten 17 US-Cent pro Tag. Die Studie von Plan International kommt zu dem Ergebnis, dass die Kinder durch das ständige Berühren der Pflanzen und das Einatmen des Staubes bis zu 54 Milligramm Nikotin täglich aufnehmen, eine Menge, die der beim Rauchen von 50 Zigaretten entspricht. Da sie ohne Handschuhe und Atemschutz arbeiten, leiden viele unter der so genannten grünen Tabakkrankheit. Diese äußert sich in Form von starken Kopf- und Bauchschmerzen, Husten, Atembeschwerden und Muskelschwäche.
Auch wenn die Zustände in den tabakproduzierenden Länder zum Teil bereits in der Vergangenheit bekannt wurden (siehe auch weiter unten), unterscheidet sich die jetzt veröffentlichte Plan-Studie dadurch, dass sie betroffene Kinder direkt zu den Folgen der Arbeit auf den Tabakplantagen befragt hat. Insgesamt nahmen 44 Kinder aus drei Distrikten an der Studie "Harte Arbeit, lange Arbeitszeiten und schlechte Bezahlung" teil. 23 davon waren unter 16 Jahren. Die Kinder beklagten nicht nur sehr konkret die körperlichen Folgen durch den Kontakt mit den Tabakblättern ("Es fühlt sich an, als ob man keine Luft mehr bekommt. Das Atmen tut so weh, dass der ganze Brustkorb brennt. Dann kommt die Übelkeit und mit dem Übergeben spuckt man Blut"), sondern sie gaben auch an, von ihren Arbeitgebern geschlagen, missbraucht und oft genug nicht wie vereinbart bezahlt zu werden.
Die wahrscheinlich nur Westeuropäern herausrutschende Frage, warum sich dann die Kinder und ihre Eltern nicht andere Arbeit suchen, ist leicht mit der sonstigen sozialen Lage großer Teile der Bevölkerung in einem durch die Monoproduktion unter multinationaler Aufsicht völlig bestimmten Dritte-Welt-Land zu beantworten.
Einschlägige Websites wie die der "unfairtobacco"-Initiative schildern die Lage so:
• "Die Kultivierung von Tabak ist gerade auch in Malawi so arbeitsintensiv, dass den Bauern keine Zeit bleibt, um Nahrungsmittel für sich anzubauen. Von der Saat bis zum Verkauf der getrockneten Blätter gehen die Pflanzen zwischen 30 und 50 Mal durch die Hände der Arbeiter: Sie werden von Hand ausgesät, mehrfach umgesetzt, gegen Schädlinge behandelt und schließlich geerntet. Zudem gehen große, für die Subsistenzwirtschaft wichtige Agrarflächen verloren.
• Sechzig Prozent der Exporteinnahmen dieses ostafrikanischen Staates stammen aus dem Tabakanbau.
• Wegen der extrem niedrigen Löhne fehlt den Bauern sogar das Geld für die grundlegendsten Mittel zum Leben. Zu arm, um sich Schutzkleidung leisten zu können, leiden viele Tabakbauern unter den Auswirkungen von Nikotin- und Pestizidvergiftungen. Wegen notwendiger Investitionen hochverschuldet, geraten sie und ihre Familien in Hunger und Armut. Der große Arbeitsaufwand erfordert die Mitarbeit der gesamten Familie", und daher auch der Kinder und dies ist wohl auch in frühkapitalistischer Art und Weise in die Löhne "eingepreist".
Den umfangreichen (81 Seiten), fakten- und zitatenreichen Bericht "Hard work, long hours and little pay. Research with children working on tobacco farms in Malawi" erhält man kostenlos.
Bernard Braun, 27.8.09
Elterneinfluss auf das Essverhalten ihrer Kinder ist kleiner als erwartet
 Die populäre und auch einigen präventiven Interventionskonzepten zugrundeliegende Annahme, ein "gesundes" Essverhalten hinge vom Elternhaus ab und beginne da und elterliches "Diät"verhalten hülfe den Kindern, ihre Ernährungsüberzeugungen oder -verhaltensweisen zu gewinnen, sollte nach den Ergebnissen einer Studie von ForscherInnen der Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health gründlich überdacht werden. Sie fanden nämlich in der ersten großen und repräsentativen Studie in den USA, dass schon die Ähnlichkeit der Essgewohnheiten von Eltern und Kindern derselben Familie gering ist und damit auch allein von den Eltern her kein langfristiger "gesunder" Effekt zu erwarten ist.
Die populäre und auch einigen präventiven Interventionskonzepten zugrundeliegende Annahme, ein "gesundes" Essverhalten hinge vom Elternhaus ab und beginne da und elterliches "Diät"verhalten hülfe den Kindern, ihre Ernährungsüberzeugungen oder -verhaltensweisen zu gewinnen, sollte nach den Ergebnissen einer Studie von ForscherInnen der Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health gründlich überdacht werden. Sie fanden nämlich in der ersten großen und repräsentativen Studie in den USA, dass schon die Ähnlichkeit der Essgewohnheiten von Eltern und Kindern derselben Familie gering ist und damit auch allein von den Eltern her kein langfristiger "gesunder" Effekt zu erwarten ist.
Die WissenschaftlerInnen untersuchten mit Hilfe der für die USA repräsentativen Daten des "Continuing Survey of Food Intake by Individuals" des "US Department of Agriculture (USDA)" aus den Jahren 1994-96 das gesunde Essverhalten von Eltern (1.061 Väter und 1.230 Mütter) im Alter von 20 bis 65 Jahren und das ihrer Kinder (1.370 Söhne und 1.322 Töchter) im Alter von 2 bis 18 Jahren. In dem Survey wurde von 16.103 Personen im Alter von 0-90 Jahren das Essverhalten an zwei kompletten Tagen gemessen, die 3 bis 10 Tage auseinanderlagen. Nach einer vielseitigen Adjustierung der Probanden wurden die Eltern-Kind- Korrelationen zahlreicher Komponenten des Essverhaltens mit dem neuen "USDA 2005 Healthy Eating Index score (HEIn)" gemessen.
Die wichtigsten Ergebnisse lauten:
• Für die meisten Essmaßstäbe war die Eltern-Kinder-Korrelation schwach oder mäßig (0,2-0,33). Die Enge der Beziehung variierte aber auf niedrigem Niveau zwischen einzelnen Lebensmitteln.
• Die Korrelationen beim Essverhalten waren zwischen Müttern und ihren Töchtern und auch Söhnen höher als die zwischen Vätern und ihren Kindern.
• Hispanische und andere nicht-weißen Familien hatten generell und bei Softdrinks eine größere Ähnlichkeiten der Ernährungsgewohnheiten als Weiße und Afro-Amerikaner.
• Je älter die Kinder waren desto höher war auf dem insgesamt nicht hohem Niveau die Ähnlichkeit ihres Essverhaltens mit dem ihrer Eltern. Umgekehrt war aber unter dem Fünftel der Befragten, welches die höchsten HEIn-Werte hatten, der Anteil älterer Kinder eher gering.
• Der Einfluss des Familieneinkommens und des Bildungsniveaus der Eltern hatte nur einen kleinen Einfluss auf Eltern-Kind-Ähnlichkeiten.
• Andere Faktoren als das elterliche Essverhalten scheinen bei der Herausbildung eines ausgewogenen Essverhaltens eine wichtige Rolle zu spielen.
Zum Aufsatz "Parent-child dietary intake resemblance in the United States: Evidence from a large representative survey" von May A. Beydoun und Youfa Wang, der 2009 in der Zeitschrift "Social Science & Medicine" (Volume 68, Issue 12, June 2009, Pages 2137-2144) erschienen ist, gibt es kostenlos lediglich das Abstract.
Bernard Braun, 14.7.09
Auch in Bayern: Wenig Licht und viel Schatten beim Übergewicht von Jugendlichen.
 Egal, ob jemand dachte, Adipositas zähle in Bayern nicht zu den wichtigsten Public Health-Herausforderungen oder umgekehrt sogar erst recht: Der Blick in die Ergebnisse des ersten bayernweiten repräsentativen Survey bei Jugendlichen der Altersgruppe 12-24 Jahren - im Übrigen eine Altersgruppe, über deren Gewichtssituation es bisher bemerkenswert wenig Daten gibt - mit 3 Erhebungswellen aus den Jahren 1995, 2000, 2005 lohnt allemal.
Egal, ob jemand dachte, Adipositas zähle in Bayern nicht zu den wichtigsten Public Health-Herausforderungen oder umgekehrt sogar erst recht: Der Blick in die Ergebnisse des ersten bayernweiten repräsentativen Survey bei Jugendlichen der Altersgruppe 12-24 Jahren - im Übrigen eine Altersgruppe, über deren Gewichtssituation es bisher bemerkenswert wenig Daten gibt - mit 3 Erhebungswellen aus den Jahren 1995, 2000, 2005 lohnt allemal.
Das Positive vorweg: Auch in Bayern zeigt sich, dass die Adipositas bei Kindern im Einschulungsalter seit einigen Jahren nicht mehr zunimmt. Bei Jugendlichen dagegen scheint die Adipositas weiter anzusteigen und hat einen starken Zusammenhang mit ihrer sozialen Lage. Die Ergebnisse im Einzelnen:
• Die Adipositas-Prävalenz bei bayerischen Jugendlichen der Altersgruppe 12-24 ist von 1995 (2,1%) über 2000 (3,1%) bis 2005 (4%) stetig angestiegen. Sie nimmt im Altersverlauf zu: "Dies ist nicht auf eine Verschiebung der gesamten BMI-Verteilung zurückzuführen, sondern darauf, dass sich speziell der BMI in der Extremgruppe der übergewichtigen und adipösen bayerischen Jugendlichen von 1995 bis 2005 noch einmal deutlich erhöht hat." Die Verdoppelung der Prävalenz betrifft männliche wie weibliche Jugendliche in etwa gleich.
• Die bereits aus anderen Studien bekannte Sozialabhängigkeit der Übergewichtigkeit zeigt sich auch in Bayern: Je niedriger der Sozialstatus, umso höher ist die Adipositas-Prävalenz. Bemerkenswert an den bayrischen Ergebnissen ist, "dass der Sozialgradient über die Befragungswellen hinweg zu Lasten der Jugendlichen aus einem Elternhaus mit geringerer Schulbildung zugenommen hat, d. h. dass die gesundheitliche Chancengleichheit abgenommen hat."
• Mittels multivariater Analysen wurde außerdem gezeigt, dass Adipositas für beide Geschlechter mit einem erhöhten Risiko für einen nicht sehr guten Gesundheitszustand einhergeht.
• In diesen Analysen spielt aber auch das gefühlte Übergewicht - also das subjektive Körpergefühl - eine relevante und unabhängige Rolle als Risikofaktor für den Gesundheitszustand der Jugendlichen.
• Bei der Zufriedenheit mit dem eigenen Körpergewicht gibt es aber auch praktisch relevante Besonderheiten zu beachten: So geben 87 % der adipösen männlichen und 100 % der adipösen weiblichen Befragten in der Welle 2005 an, zurzeit das Gefühl zu haben, dass sie zu dick sind oder einzelne Körperpartien zu dick sind - was immerhin für die Wirklichkeitsnähe derartiger Selbsteinschätzungen spricht. Allerdings sagen dies auch 25 % der männlichen bzw. 56 % der weiblichen Befragten, die nicht adipös sind. Die Forscher verweisen zu Recht auf die praktische Bedeutung dieser Beobachtung: "Dieses Resultat beinhaltet daher auch die Botschaft, bei Kampagnen zur Adipositas-Prävention auf die nötige Differenziertheit und Sensibilität zu achten, um nicht unerwünschte Nebenwirkungen in Hinblick auf eine Störung des Körpergefühls der Jugendlichen und einen falschen Diätenkult zu provozieren."
• Dem zunächst positiv wirkenden Faktum, dass 60 % der adipösen männlichen und 77 % der adipösen weiblichen Befragten in der Welle 2005 den Wunsch nach genereller, besserer Information über Übergewicht äußerten, halten die Forscher aber Erkenntnisse über die eher bescheidenen langfristige Wirkungen verschiedener Präventions- und Interventionsmaßnahmen in Cochrane-Reviews und einigen bisherigen Beobachtungsstudien entgegen.
• Mit dem Schlusssatz "Stigmatisierung ist beim Thema Adipositas keine gute Interventionsstrategie" weisen sie schließlich ebenfalls zu Recht auf die unerwünschten Wirkungen von regierungsamtlichen "fit-statt-fett"-Kampagnen hin, die möglicherweise direkt zu Untergewicht und Bulimie führen könnten.
Von dem Aufsatz "Adipositas bei bayerischen Jugendlichen: Prävalenz im Trend, soziodemografische Strukturmerkmale und subjektive Gesundheit. Obesity in Bavarian Adolescents: Prevalence in Trend, Sociodemographic Structural Features and Subjective Health" von R. Schulz, B. Güther, S. Mutert, und J. Kuhn in der Zeitschrift "Gesundheitswesen" gibt es kostenlos leider nur ein Abstract. Viele deutsche Verlage und Zeitschriftenredaktionen haben eben immer noch nicht den Sinn und Nutzen von "open access" zumindest für einen Teil ihrer Aufsätze erkannt.
Bernard Braun, 2.7.09
Muttermilch und Milchersatzstoffe als Mittel der Primärprävention von Allergien bei Kleinkindern und Kindern
 Seit rund 40 Jahren gibt es Bemühungen, das Entstehen von allergischen und erheblich die Lebensqualität von Kindern und Eltern beeinträchtigenden Hautreaktionen im Kleinkindalter durch frühzeitige primärpräventive Maßnahmen zu verhindern. Eine zentrale Bedeutung besitzt hierbei die Vermeidung der Aufnahme bestimmter Proteine vor allem in der Kuhmilch und ihr Ersatz durch Muttermilch oder Milchprodukte, die von bestimmten natürlichen aber als allergieerzeugend geltenden Inhaltsstoffen durch Hydrolyse befreit wurden. Als hilfreich wird auch eine möglichst von allergiefördernden Stoffen freie Ernährung der schwangeren und stillenden Frau gehalten. Unklar war immer, wie lange die primärpräventive Phase dauern muss, um allergische Reaktionen beim älter werdenden Kind zu vermeiden.
Seit rund 40 Jahren gibt es Bemühungen, das Entstehen von allergischen und erheblich die Lebensqualität von Kindern und Eltern beeinträchtigenden Hautreaktionen im Kleinkindalter durch frühzeitige primärpräventive Maßnahmen zu verhindern. Eine zentrale Bedeutung besitzt hierbei die Vermeidung der Aufnahme bestimmter Proteine vor allem in der Kuhmilch und ihr Ersatz durch Muttermilch oder Milchprodukte, die von bestimmten natürlichen aber als allergieerzeugend geltenden Inhaltsstoffen durch Hydrolyse befreit wurden. Als hilfreich wird auch eine möglichst von allergiefördernden Stoffen freie Ernährung der schwangeren und stillenden Frau gehalten. Unklar war immer, wie lange die primärpräventive Phase dauern muss, um allergische Reaktionen beim älter werdenden Kind zu vermeiden.
Auf diese Fragen gab ein bereits 2003 erschienener und 2006 auf den neuesten Stand gebrachter systematischer Cochrane Review eine Reihe von Antworten. Ein 2008 von einer ExpertInnengruppe der "Section on Paediatrics, European Academy of Allergology and Clinical Immunology (SP-EAACI) verfasster und in der Fachzeitschrift "Pediatric Allergy and Immunology" erschienener Aufsatz ist zusätzlich in zweifacher Hinsicht interessant: Erstens bestätigt er wichtige Erkenntnisse des Cochrane Reviews und liefert zusätzliche Argumente gegen und für bestimmte Interventionen zur Allergieprävention bei kleinen Kindern und beschäftigt sich zweitens mit zwischenzeitlich bekannt gewordenen Fehlern in diesem Cochrane Review und einigen grundsätzlichen Problemen bei der Erstellung dieser hoch angesehenen Analysen.
Die kritische Darstellung einiger methodischer Probleme in dem Cochrane Review hat ihren Anlass im notwendig gewordenen Ausschluss von vier Studien, deren Verfasser offensichtlich Ergebnisse in den von ihm zu verantwortenden Studien verfälscht hat. Auch wenn die SP-EAACI-Experten konstatieren, der Ausschluss erfordere keine generelle inhaltliche Revision der Reviewergebnisse, weisen sie aber trotzdem auf eine Reihe zusätzlicher und aus ihrer Sicht fragwürdiger ("questionable") Inhalte des Cochrane Reviews hin. So würden dort entgegen dem sonstigen methodischen Anspruch auch Studien berücksichtigt, die keine randomisierte kontrollierte Studien waren oder auch nicht in einer peer-reviewten Zeitschrift, sondern in einer Herstellerpublikation erschienen sind. Kritisch und als zu hart sieht die Expertengruppe außerdem den Ausschluss von Studien aus dem Review, die mehr als 20 % ihrer TeilnehmerInnen vor der Follow-up-Untersuchung verloren hatten. Interessant ist schließlich noch der Hinweis auf die beim Wissensstand über den Nutzen von Muttermilch und die körperliche Situation und Still-Bereitschaft junger Mütter ethisch unmögliche Anforderung der Randomisierung einer "Muttermilch-Gruppe" und von von "Nicht-Muttermilch-Müttern und Kindern"-Gruppen. Insgesamt mindert dieser kritische Blick auf Reviews nicht deren Bedeutung als Referenz, sondern stellt sogar ein positives Beispiel für die Funktionsfähigkeit dieses öffentlichen Systems der wissenschaftlichen Selbstvergewisserung und Kontrolle dar.
Die wichtigsten alten (vgl. dazu auch schon Host et al. 2004 und Muraro et al. 2004) wie neuen Erkenntnisse zu den primärpräventiven Möglichkeiten im Bereich kindlicher Allergien lauten folgendermaßen:
• Eine selektive Ernährung ist bei Kindern mit hohem Risiko der Inzidenz einer Kuhmilchallergie sowie atopischer oder nichtatopischer Ekzeme im späteren Kleinkind- und Kindesalter präventiv wirksam. Für die mögliche Prävention anderer späterer allergischer Reaktionen wie Asthma, oder Rhinitis im Kleinkindalter mangelt es an Evidenz.
• Die wirksamste Präventionsform ist das ausschließliche Stillen des Neugeborenen durch Muttermilch mindestens bis zum vierten oder auch sechsten Lebensmonat.
• Sollte dies unmöglich sein, stellt die Ernährung mit nachgewiesenenermaßen nichtallergischen Ersatzmilchstoffen für wenigstens vier Monate eine präventiv ebenfalls wirksame Alternative dar. Dabei sollte aber feste Nahrung oder Kuhmilch völlig vermieden werden.
• Für die Frage, welche Entwöhnungsmethoden die besten sind, gibt es keine ausreichende Evidenz.
• Auch für die protektive Wirkung einer um bestimmte Stoffe (z.B. Kuhmilchproteine) reduzierten Ernährung der Schwangeren auf ihr geborenes Kind gibt es wenig Evidenz.
• Für die präventive Wirkung einer länger als 4 Monate dauernden Stillzeit oder einer ebenfalls länger erfolgenden Milchersatzernährung gibt es keine Evidenz.
Der Review Up-date der SP-EAACI-Gruppe von ist komplett kostenlos erhältlich: Arne Holst et al.: Dietary prevention of allergic diseases in infants and small children. Amendment to previous published articles in Pediatric Allergy and Immunology 2004 (Pediatr Allergy Immunol 2008: 19: 1-4)
Vom Cochrane Review gibt es kostenlos nur ein Abstract: "Formulas containing hydrolysed protein for prevention of allergy and food intolerance in infants" von Osborn DA und Sinn J. (Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 4)
Die beide schon aus dem Jahre 2004 stammenden Arbeiten mit weitgehend identischen Erkenntnissen sind
• der Aufsatz "Dietary prevention of allergic diseases in infants and small children. Part III: Critical review of published peer-reviewed observational and interventional studies and final recommendations" von Muraro et al. in der Zeitschrift "Pediatric Allergy Immunology" (2004 Aug;15(4):291-307) und
• der Aufsatz "Hypoallergenic formulas•when, to whom and how long: after more than 15 years we know the right indication!" in der Zeitschrift "Allergy" (2004 Aug;59 Suppl 78:45-52). Von beiden gibt es kostenlos lediglich ein Abstract.
Bernard Braun, 27.4.09
Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm: Kinder imitieren auch gesundheitsriskante Ernährungsgewohnheiten ihrer Eltern
 Schon 4-5jährige Vorschulkinder werden durch TV-Werbung darin beeinflusst, was sie gerne essen und was nicht so gerne. Eine US-Studie hatte unlängst gezeigt: Viele Kinder sind voll und ganz der Überzeugung, dass Getränke und Speisen wesentlich besser schmecken, wenn sie von McDonald's kommen als wenn es sich um namenlose Fritten oder Burger handelt. Die Werbebotschaften der McDonald's Corporation mit etwa 31.000 Restaurants in über 100 Ländern kommen bei Kindern umso besser an, je mehr Fernseher im Elternhaus stehen. Die Untersuchung hatte allerdings auch deutlich gemacht, dass Eltern nicht ganz unschuldig sind, wenn Kinder sich später zu Fast-Food-Freaks entwickeln. Denn die kindliche Vorliebe für Big Mac, Mac Nuggets und Happy Meals war umso stärker ausgeprägt, je häufiger die Eltern mit ihren Kindern Gäste in den Schnellrestaurants von McDonald's waren. (vgl. McDonald's Werbebotschaften beeinflussen schon 4-5jährige Vorschulkinder)
Schon 4-5jährige Vorschulkinder werden durch TV-Werbung darin beeinflusst, was sie gerne essen und was nicht so gerne. Eine US-Studie hatte unlängst gezeigt: Viele Kinder sind voll und ganz der Überzeugung, dass Getränke und Speisen wesentlich besser schmecken, wenn sie von McDonald's kommen als wenn es sich um namenlose Fritten oder Burger handelt. Die Werbebotschaften der McDonald's Corporation mit etwa 31.000 Restaurants in über 100 Ländern kommen bei Kindern umso besser an, je mehr Fernseher im Elternhaus stehen. Die Untersuchung hatte allerdings auch deutlich gemacht, dass Eltern nicht ganz unschuldig sind, wenn Kinder sich später zu Fast-Food-Freaks entwickeln. Denn die kindliche Vorliebe für Big Mac, Mac Nuggets und Happy Meals war umso stärker ausgeprägt, je häufiger die Eltern mit ihren Kindern Gäste in den Schnellrestaurants von McDonald's waren. (vgl. McDonald's Werbebotschaften beeinflussen schon 4-5jährige Vorschulkinder)
Eine neuere Studie hat jetzt noch einmal verdeutlicht, in wie starkem Maße die Vorbildfunktion der Eltern für das Ernährungsverhalten der Kinder verantwortlich ist und damit längerfristig auch für Gesundheitsrisiken durch Übergewicht und Adipositas aufgrund ungesunder Speisen und Getränke. Teilnehmer an der experimentellen Studie waren 120 Kinder im Alter von 2-6 Jahren sowie der Vater oder die Mutter des Kindes. Im Zentrum des Experiments stand ein Puppengeschäft mit einem Verkaufstresen, in dem unterschiedlichste Speisen und Getränke im Angebot waren. Den Kindern wurden zu Beginn jeweils zwei Puppen gezeigt: Die eine Puppe sollte sie selbst darstellen, die andere war ein Freund der sie zuhause besuchte. Die Geschichte ging dann so weiter, dass das Kind feststellt, es sei nichts zu essen und zu trinken da und es würde schnell mal in das Geschäft gehen, um einzukaufen. Alle im Geschäft vorhandenen Speisen und Getränke, so wurde den Kindern erklärt, könnten sie umsonst mitnehmen.
Unter den insgesamt 133 Produkten, die durch kleine Spielzeug-Miniaturen dargestellt waren, befanden sich 73 verschiedene Artikel: Obst und Gemüse, Süßigkeiten, Snacks, Brot, Fleisch, Fertiggerichte, Obstsäfte und Softdrinks. Alle Produkte waren zuvor von Lebensmittel-Experten als eher gesund oder eher ungesund eingestuft worden. Die Wissenschaftler protokollierten dann, welche Artikel jedes Kind "eingekauft" hatte und sie befragten darüber hinaus den Vater oder die Mutter mit einem Fragebogen, wie oft sie selbst bestimmte Speisen und Getränke einkaufen würden.
Die Kinder wurden dann in eine von drei Gruppen eingeordnet, je nachdem, wie viele eher gesunde und wie viele eher ungesunde Produkte sie ausgewählt hatten. Deutlich wurde dann in der Auswertung zunächst, dass die Eltern sehr viel öfter auch gesunde Produkte einkauften während dies bei ihren Kindern eher die Ausnahme war. Während zwei von drei Kindern (65%) in der Gruppe mit den ungesündesten Lebensmitteleinkäufen anzutreffen war, galt dies bei den Eltern nur für jeden zwanzigsten (5%).
Bei der Frage, welche Faktoren zu einem eher ungesunden Einkaufsverhalten führen, fanden die Wissenschaftler zunächst keine überzeugenden Antworten. Das Alter des Kindes (2-6 Jahre) spielte ebenso wenig eine Rolle wie das Geschlecht und das Bildungsniveau der Eltern war ebenso unerheblich wie die Zahl und Ausstattung der Fernseher im Haushalt. Ein sehr enger Zusammenhang wurde dann aber deutlich, wenn man das Einkaufsverhalten der Eltern berücksichtigte. Kauften diese überwiegend ungesunde Lebensmittel ein, dann verhielten sich auch die Kinder ausnahmslos so. Waren die Eltern in ihrer Auswahl der Speisen und Getränke eher gesundheitsbewusst, dann zeigten Kinder sich auch von dieser Haltung beeinflusst.
• Abstract der Studie: Lisa A. Sutherland u.a.: Like Parent, Like Child. Child Food and Beverage Choices During Role Playing (Arch Pediatr Adolesc Med. 2008; 162(11):1063-1069)
Gerd Marstedt, 29.3.09
Analyse von 173 Studien zeigt: Übermäßiger Medienkonsum schadet der Gesundheit von Kindern
 US-amerikanische Kinder verbringen im Durchschnitt etwa 45 Stunden pro Woche mit Medien: Fernsehen, Kino, Videospiele, Computer, Internet. Das ist weitaus mehr als andere Beschäftigungen ausmachen, wie der Besuch der Schule (30 Stunden) oder der Kontakt mit den Eltern (17 Stunden). Untersuchungen über den Zusammenhang von Fernsehkonsum und Gesundheit gab es schon mehrfach. Eine Forschungsgruppe aus San Francisco und New Haven unter Leitung von Dr. Marcella Nunez-Smith hat nun eine ausführliche Literaturstudie veröffentlicht, die Ergebnisse aus insgesamt 173 schon veröffentlichten Studien zusammenfasst. Das Ergebnis ist ebenso eindeutig wie besorgniserregend. 82 Prozent der einbezogenen Längsschnittuntersuchungen deuten auf einen Kausalzusammenhang hin zwischen der Intensität des Medienkonsums und gesundheitlichen Beeinträchtigungen (Übergewicht) oder gesundheitlich riskantem Verhalten (Rauchen, Alkohol, Drogen) bei Kindern.
US-amerikanische Kinder verbringen im Durchschnitt etwa 45 Stunden pro Woche mit Medien: Fernsehen, Kino, Videospiele, Computer, Internet. Das ist weitaus mehr als andere Beschäftigungen ausmachen, wie der Besuch der Schule (30 Stunden) oder der Kontakt mit den Eltern (17 Stunden). Untersuchungen über den Zusammenhang von Fernsehkonsum und Gesundheit gab es schon mehrfach. Eine Forschungsgruppe aus San Francisco und New Haven unter Leitung von Dr. Marcella Nunez-Smith hat nun eine ausführliche Literaturstudie veröffentlicht, die Ergebnisse aus insgesamt 173 schon veröffentlichten Studien zusammenfasst. Das Ergebnis ist ebenso eindeutig wie besorgniserregend. 82 Prozent der einbezogenen Längsschnittuntersuchungen deuten auf einen Kausalzusammenhang hin zwischen der Intensität des Medienkonsums und gesundheitlichen Beeinträchtigungen (Übergewicht) oder gesundheitlich riskantem Verhalten (Rauchen, Alkohol, Drogen) bei Kindern.
In einer systematischen Literaturrecherche waren Studien gesucht worden, die einen Zusammenhang untersucht hatten zwischen der Mediennutzung bei Kindern und gesundheitlichen Negativfolgen. Diese Auswirkungen hatte man eingeschränkt auf sieben verschiedene Indikatoren: Übergewicht, Rauchen, Drogenkonsum, Alkohol, schlechte Schulleistungen, Sexualverhalten, Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom (ADHS, ADHD, ADS). Die zunächst gefundenen 32 Tausend Veröffentlichungen wurden dann weiter überprüft nach ihrer Aktualität, methodischen Fundierung und anderen Kriterien. Übrig blieben dann 137 Studien, 60 Längsschnittuntersuchungen (die Kinder über viele Jahre hinweg mehrfach untersucht hatten) und 113 Querschnittsvergleiche (mit nur einer Erhebung und einem damit durchgeführten Vergleich verschiedener Gruppen).
46 Studien untersuchten den Effekt bestimmter Medieninhalte (z.B. Filmszenen, in denen geraucht wurde) auf die Gesundheit. Der ganz überwiegende Teil dieser Untersuchungen (93%) kam zu dem Schluss, dass negative gesundheitliche Folgen überwiegen. Nur eine Studie fand einen positiven Effekt: Der häufige Besuch bestimmter Websites führte dort zu besseren Schulleistungen. In insgesamt 127 Studien wurde untersucht, ob die zeitliche Dauer des Konsums unterschiedlicher Medien das Risiko gesundheitlicher Negativfolgen erhöht. Tatsächlich war dies bei 75 Prozent der Studien der Fall, 20% fanden keinen signifikanten Zusammenhang, 5% (N=7 Studien) fanden einen positiven Effekt.
Im Hinblick auf die einzelnen Indikatoren der Gesundheit werden folgende Ergebnisse hervorgehoben.
• Übergewicht: Auch in den methodisch besonders gut fundierten Längsschnittuntersuchungen wird deutlich, dass die Intensität des Medienkonsums das Risiko von Übergewicht und Adipositas erhöht.
• Rauchen: Hier wird ein ähnlicher Zusammenhang deutlich. Von den 24 zu diesem Thema einbezogenen Studien berichten 21, dass Gruppen mit einer zeitlich längeren Mediennutzung später auch häufiger rauchen und früher mit dem Rauchen beginnen. So zeigte eine Studie dass Kinder die im Alter von 5-15 Jahren maximal eine Stunde am Tag mit Medien verbringen, später im Alter von 26 Jahren nur zu 26 Prozent rauchen. Bei mehr als drei Stunden Medienkonsum ist die spätere Raucherquote fast doppelt so hoch (48%).
• Recht deutliche Zusammenhänge zeigen sich auch für die Merkmale Drogen- und Alkoholkonsum sowie Schulleistungen. Nicht ganz so eindeutig sind die Effekte für einen frühzeitigen Beginn sexueller Kontakte und die Entwicklung eines Aufmerksamkeits-Defizit-Syndroms.
Die Forschungsgruppe versucht in der abschließenden Bilanzierung ihrer Befunde auch, die praktischen Konsequenzen ihrer Befunde deutlich zu machen und Ratschläge zu geben. Diese an Eltern, Schulen und Politiker gerichteten Empfehlungen sind allerdings nicht besonders erhellend und eher ein wenig banal. So wird Eltern empfohlen, die Zeitdauer für Medien bei Ihren Kindern zu begrenzen und sie zu ermuntern, öfter im Freien zu spielen. Schulen wird nahegelegt, Kinder zu souveränen Mediennutzern zu erziehen und mehr Sportunterricht durchzuführen. Wie all dies jedoch im Einzelnen zu bewerkstelligen ist, bleibt leider offen.
Links zum Download des Berichts und anderer Materialien sind auf dieser Seite zu finden:
New Study: Exposure to Media Damages Children's Long-Term Health
Die PDF-Dateien des Berichts sind auch direkt herunterzuladen:
• Kurzfassung (8 Seiten)
• Langfassung (17 Seiten)
• Tabellen mit Detail-Ergebnissen und Kurzdarstellungen der einbezogenen Studien (48 Seiten)
Gerd Marstedt, 18.3.09
Verhindert Antibiotikaeinsatz bei Mittelohrentzündungen Folgeerkrankung oder fördert er fast nur Antibiotikaresistenz?
 Im Forum wurde bereits die Über- oder Fehlversorgung von Mittelohrentzündungen (Otitis media) mit Antibiotika angesprochen und auf deren Beitrag zur gesundheitlich immer problematischer werdenden Antibiotikaresistenz vieler Erreger hingewiesen. Diejenigen ÄrztInnen, die ihr Handeln zu rechtfertigen versuchen, geben häufig zu bedenken, sie befänden sich in einer klassischen Scylla-und-Charybdis-Situation, und müssten zwischen den möglichen mittel- bis langfristig unerwünschten Folgen der Antibiotika-Therapie und einer kurzfristig drohenden Folgeerkrankung der unbehandelten Mittelohrentzündung abwägen.
Im Forum wurde bereits die Über- oder Fehlversorgung von Mittelohrentzündungen (Otitis media) mit Antibiotika angesprochen und auf deren Beitrag zur gesundheitlich immer problematischer werdenden Antibiotikaresistenz vieler Erreger hingewiesen. Diejenigen ÄrztInnen, die ihr Handeln zu rechtfertigen versuchen, geben häufig zu bedenken, sie befänden sich in einer klassischen Scylla-und-Charybdis-Situation, und müssten zwischen den möglichen mittel- bis langfristig unerwünschten Folgen der Antibiotika-Therapie und einer kurzfristig drohenden Folgeerkrankung der unbehandelten Mittelohrentzündung abwägen.
Bei der Mittelohrentzündung wird vor allem eine so genannte Mastoiditis befürchtet, d.h. eine entzündliche Einschmelzung des knöchernen Warzenfortsatzes im Bereich des Mittelohrs, die ihrerseits wiederum das Risiko von noch schwereren Folgeerkrankungen (z. B. Gesichtsnervenlähmung, Schläfenbeinosteomyelitis, Gehirnhautentzündung, Schläfenlappen- oder Kleinhirnabszess sowie Blutvergiftung) in sich birgt oder eine Entfernung des Warzenfortsatzes erfordert. Die Informationsplattform "Gesundheitspro.de" drückt den Zusammenhang exemplarisch so aus: "Die Mastoiditis ist in der Regel (!!!) eine Komplikation einer unbehandelten oder nicht ausreichend behandelten akuten Mittelohrentzündung. Sie entwickelt sich ungefähr zwei bis vier Wochen nach einer Mittelohrentzündung. … Um einer Mastoiditis vorzubeugen, ist die fachärztliche Behandlung einer Mittelohrentzündung mit Antibiotika … nötig."
Die seit einiger Zeit bei der Mittelohrentzündung von Kindern alternativ gewählte Behandlungsweise ist der so genannte "watch-and-wait"-Ansatz. Weder die beobachtenden und abwartenden Ärzte noch die mit Antibiotika intervenierenden Ärzte konnten aber bisher eindeutig nachweisen, ob ihr Verhalten die Mastoiditis-Inzidenz erhöhte oder verhinderte. Diesen für weite Bereiche der medizinischen Versorgung typischen Wissensmangel beendet jetzt für den Komplex der Mittelohrentzündung eine britische Studie, die für den Zeitraum 1990 bis 2006 für 2.622.348 Kinder im Alter von 3 Monaten bis 15 Jahren auf der Grundlage der "General Practice Reseaech Database" die Trends der akuten Otitis media und der Mastoiditis und der als regelhaft unterstellten Zusammenhänge untersuchte.
Die Wirklichkeit sieht etwas komplexer aus und irritiert die Rechtfertigung des Antibiotikaeinsatzes erheblich:
• In den 16 untersuchten Jahren blieb die Inzidenz von Mastoiditis mit durchschnittlich rund 1,2 Fällen pro 10.000 Kinderjahren stabil.
• Anders sieht es bei der Mittelohrentzündung aus, deren Inzidenz im selben Zeitraum um 34 % abnahm.
• Von den 854 Kindern, bei denen eine Mastoiditis diagnostiziert wurde, hatten in den jeweils vorangegangenen drei Monaten lediglich 36 % eine diagnostizierte Mittelohrentzündung gehabt.
• Der Anteil der Kinder, die an einer Mittelohrentzündung erkrankt und mit Antibiotika behandelt worden waren, sank von 77 % auf 58 %. Dies liegt in Großbritannien in den hier untersuchten Jahren überwiegend an der Verbreitung des "watch-and-wait"-Ansatz.
• Die je nach Behandlung einer Mittelohrentzündung Inzidenz von Mastoiditis lag in der Gruppe der mit Antibiotika therapierten Kindern bei 1,8 Fällen bei 10.000 Episoden (139 von 792.623). Erhielten Kinder mit Otitis media kein Antibiotikum erhöhte sich ihre Mastoiditisrate auf 3,8 Fälle pro 10.000 Episoden (149 von 389.649). Das Folgerisiko der antibiotisch behandelten Kinder lag also um 53 % unter dem der Kinder, deren Entwicklung zunächst einmal beobachtet und abgewartet wurde.
• Wie in vielen anderen Fällen relativiert sich der Eindruck und der Handlungsdruck des halbierten Risikos, wenn man sich die bisher bekannten Größenordnungen vergegenwärtigt und die Schätzung der Autoren zur NNT- bzw. NNH-Rate ("numbers needed to treat" oder "number needed to harm") mitberücksichtigt, dass 4.831 Kinder bzw. Entzündungsepisoden mit Otitis media mit Antibiotika behandelt werden müssen, um ein Kind vor einer Mastoiditis zu bewahren. 4.830 Kindern hilft also die Antibiotikatherapie zumindest nicht gegen die befürchtete Folgeerkrankung, fördert aber das Resistenzbildungsrisiko und mögliche andere unerwünschten Wirkungen dieses Arzneimittels. Noch anders ausgedrückt: Wenn bei Mittelohrentzündungen gar keine Antibiotika mehr verordnet worden wären, hätte es 255 Fälle von Mastoiditis bei den Kindern gegeben, aber es hätte in Großbritannien auch 738.775 weniger Antibiotikaverordnungen pro Jahr gegeben.
WissenschaftlerInnen nennen als eine Ursache eines möglichen Rückgangs von Mittelohrentzündungen und Mastoiditis die Impfung gegen das Bakterium Streptococcus pneumoniae und verweisen dazu auf Beobachtungen in den USA. Die Inzidenz von Otitis media und Mastoiditis und der unerwünschten Wechselwirkung dürfte also in Ländern mit derartigem Impfangebot noch niedriger sein als in der britischen Studie.
Von dem Aufsatz "Effect of antibiotics for otitis media on mastoiditis in children: A retrospective cohort study using the United Kingdom General Practice Research Database" von Paula Louise Thompson et al. in der Februarausgabe 2009 der Fachzeitschrift "Pediatrics" Jahrgang 123: 424) gibt es kostenfrei nur ein Abstract.
Bernard Braun, 18.3.09
Früher aber nicht notwendiger Einsatz von Antibiotika bei Kindern - Kein Nutzen der Antibiotikaprophylaxe bei Harnwegsinfekten
 Die Über- oder Fehlversorgung von BürgerInnen aller Altersgruppen mit Antibiotika und das damit sogar verbundene Risiko, systematisch multiresistente Erreger heranzuzüchten, wird allenthalben als großes ökonomisches und gesundheitliches Problem kommuniziert.
Die Über- oder Fehlversorgung von BürgerInnen aller Altersgruppen mit Antibiotika und das damit sogar verbundene Risiko, systematisch multiresistente Erreger heranzuzüchten, wird allenthalben als großes ökonomisches und gesundheitliches Problem kommuniziert.
Der Einstieg in Antibiotikatherapien erfolgt häufig bereits bei kleinen Kindern und gewinnt zum Teil hier ihr positives Image als Waffe gegen wiederkehrende Erkrankungen und einige ihrer fürs Leben erworbenen physiologischen Folgen. Dies gilt - neben der Mittelohrentzündung - auch für die häufig wiederkehrenden Harnwegsinfektionen, die nicht nur schmerzhaft sind, sondern auch durch die mögliche Vernarbung des Nierengewebes bleibende Spuren mit wiederum möglichen unerwünschten Folgewirkungen hinterlassen.
Die Intervention gegen eine erstmalige Erkrankung an Harnwegsinfektionen galt auch bereits bei sehr jungen Kindern als geeignetes Mittel, Rezidive und Vernarbungen zu verhindern.
Ob dies wirklich zutrifft und ob daher möglicherweise das Resistenzbildungsrisiko geringer wiegt, wurde aber erst jetzt in einer randomisierten kontrollierten Studie mit 338 Kindern im Alter von 7 Monaten bis zu 7 Jahren untersucht, die erstmalig an einem fiebrigen Harnwegsinfekt erkrankt waren, der mit einer nicht-schweren Form der Umkehr der Fließrichtung des Harns (vesikoureteralem Reflux [VUR; Grad I-III]) verbunden war oder nichts davon aufwies.
In einer multizentrischen, randomisierten, kontrollierten, einseitigen Äquivalenzstudie erhielt ein Teil dieser Kinder ein Jahr lang eine Antibiotikaprophylaxe (n=127) , der andere (n=211) nicht. Bei 309 dieser Kinder wurde eine Nierenbeckenentzündung nachgewiesen und 27 Kinder litten neben einer Nierenbeckenentündung auch an Problemen des Harnabflusses (Reflux).
Die beiden Studienziele waren die Rezidivrate des fiebrigem Harnwegsinfekt und die durch diese wiederkehrenden Entzündungen verursachten Vernarbungen des Nierengewebes zu untersuchen.
Die so genannte "Intention-to treat"-Analyse ergab weder für den primären Endpunkt der Rezidivrate noch die Vernarbung des Nierengewebes einen signifikanten Unterschied zwischen der Antibiotika- und Nicht-Antibiotika-Gruppe:
• Mit Prophlaxe erkrankten 9,45 % der Kinder mit Antibiotikaeinnahme erneut und 7,11 % waren es in der Gruppe ohne Antibiotikabehandlung. In der Untergruppe mit vesikoureteralem Reflux erkrankten 12,1 % der behandelten und 19,6 % der nicht behandelten Kinder erneut an einem Harnwegsinfekt.
• 1,9 % der Kinder ohne Prophylaxe zeigten eine Vernarbung des Nierengewebes und 1,1 % der Kinder mit Prophylaxe.
- Zu keinem Lebenszeitpunkt erwies sich die fehlende Prophylaxe als ein Risikofaktor.
• In einer multivariaten Analyse erwies sich ein schwererer Grad der Fließumkehr des Harns als der entscheidende Risikofaktor für wiederkehrende fiebrige Harnwegsinfekte. Protektiv wirkte ein höheres Alter
Zumindest für die Fälle in denen es zu keiner oder einer leichten bis mittelschweren Form des Refluxes kommt, sehen daher die Wissenschaftler keinen Nutzen für die Antibiotikaprophlaxe. Damit sollten deren potenziellen mittel- bis langfristigen Nachteile und auch ihre Kosten Anlass sein, auf eine solche Therapie zu verzichten.
Von dem Aufsatz "Prophylaxis after first febrile urinary tract infection in children? A multicenter, randomized, controlled, noninferiority trial" von Montini G. et al. in der Zeitschrift Pediatrics (Vol. 122 No. 5 November 2008, pp. 1064-1071) gibt es kostenlos lediglich ein Abstract.
Bernard Braun, 1.3.09
Kindes-Misshandlung und sexueller Missbrauch ist auch in reichen Industrieländern ein alltägliches Vorkommnis
 Kindesmisshandlung ist ein Problem, das auch in reichen Wohlfahrtsstaaten beunruhigende Dimensionen einnimmt. In jedem Jahr werden zwischen 4 und 16 Prozent der Kinder körperlich und etwa 10 Prozent seelisch misshandelt. Etwa 5-10% der Mädchen werden durch Geschlechtsverkehr sexuell missbraucht, bis zu 5 Prozent der Jungen sind davon betroffen. Etwa dreimal so hoch sind Missbrauchsfälle, die jede Art von sexuell erzwungenem Kontakt betreffen. Dies sind einige der alarmierenden Befunde einer Studie, die jetzt in der renommierten medizinischen Fachzeitschrift "Lancet" veröffentlicht wurden.
Kindesmisshandlung ist ein Problem, das auch in reichen Wohlfahrtsstaaten beunruhigende Dimensionen einnimmt. In jedem Jahr werden zwischen 4 und 16 Prozent der Kinder körperlich und etwa 10 Prozent seelisch misshandelt. Etwa 5-10% der Mädchen werden durch Geschlechtsverkehr sexuell missbraucht, bis zu 5 Prozent der Jungen sind davon betroffen. Etwa dreimal so hoch sind Missbrauchsfälle, die jede Art von sexuell erzwungenem Kontakt betreffen. Dies sind einige der alarmierenden Befunde einer Studie, die jetzt in der renommierten medizinischen Fachzeitschrift "Lancet" veröffentlicht wurden.
Die Wissenschaftler aus England, den USA, Neuseeland und Schweden unter Leitung von Prof. Ruth Gilbert vom UCL Institute of Child Health, London, kamen durch unterschiedliche Quellen zu ihren Befunden:
• In kommunalen Studien fanden sich Berichte von Opfern, die in späterem Lebensalter über ihre eigenen und Erfahrungen anderer Kinder berichteten,
• ferner wurden Studien ausgewertet, die Berichte über körperliche Gewalt von Eltern enthielten,
• und schließlich wurden auch Statistiken einbezogen, die von Kinder-Schutzorganisationen oder Polizeibehörden stammten.
Während in den Berichten der Betroffenen sehr hohe Quoten von Misshandlungen angegeben wurden (vermutlich mit einer Tendenz zur Überschätzung), waren die Zahlenangaben in Statistiken von Organisationen und Behörden eher niedrig und neigten wahrscheinlich zur Unterschätzung.
Einige der in der Studie genannten Zahlen:
• United Kingdom: Jährlich werden etwa 1,5% aller Kinder nach offiziellen Statistiken wegen Missbrauchs bei einer Sozialbehörde vorgestellt
• In den USA lag diese Quote 2006 bei knapp 5%, etwa in 1,2% der Fälle wurde der Missbrauch oder die Misshandlung nachgewiesen.
• Nach eigenen Berichten von Betroffenen aus unterschiedlichen Ländern liegt die Quote körperlicher Gewalt durch Eltern zwischen 4 und 16%.
• In einigen europäischen Ländern im Osten liegt diese Quote deutlich höher (bis zu 30%).
• Bis zu 15% der Mädchen und bis zu 5% der Jungen erfahren vor ihrem 18. Geburtstag unterschiedliche Formen sexuellen Missbrauchs.
• Durch Vernachlässigung und körperliche Gewalt kommen weltweit über 150.000 Kinder unter 15 Jahren jährlich ums Leben, wobei Eltern oder Stiefeltern für 95 Prozent dieser Todesfälle direkt verantwortlich sind. Auch die große Mehrheit anderer Misshandlungen werde von den eigenen Eltern verübt.
• Eine Ausnahme ist sexueller Missbrauch, der vorwiegend durch andere Familienmitglieder oder Freunde aus dem Familienzusammenhang erfolgt.
Gewalt gegen und Missbrauch von Kindern, so betonen die Wissenschaftler, hat viele Negativfolgen, die sich oftmals ernst nach langen Zeiträumen niederschlagen. So werden misshandelte Mädchen beispielsweise doppelt so häufig wegen eines Gewaltverbrechens polizeilich festgenommen wie Mädchen ohne diese Negativerfahrung. Zu den weiteren Folgen erlittener Gewalt zählen die Forscher viele körperliche, psychische und soziale Indikatoren auf, die auch in Langzeitstudien festgestellt wurden: Alkohol- und Drogenabusus, Prostitution und Teenager-Schwangerschaften, , Depressionen und Selbstmordversuche, kriminelle Vergehen und schlechte Bildungsabschlüsse.
Ein kostenloses Abstract ist hier: Ruth Gilbert u.a.: Burden and consequences of child maltreatment in high-income countries (The Lancet, Early Online Publication, 3 December 2008, doi:10.1016/S0140-6736(08)61706-7)
Gerd Marstedt, 10.12.08
BzgA findet unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen weniger Raucher, die Quote der "Kampftrinker" bleibt jedoch konstant
 Die Raucherquote unter Jüngeren (12-25 Jahre) ist seit dem Jahre 2004 ständig gesunken und mit ihr auch die Zahl derjenigen, die Cannabis probiert haben. Was der Drogenbeauftragten der Bundesregierung, Sabine Bätzing, und ebenso der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung nach wie vor Kopfschmerzen bereitet, ist jedoch, dass im Kampf gegen das "Kampftrinken" ("binge drinking") wenig Erfolge zu verzeichnen sind. Die Quote derjenigen Jugendlichen, die in den letzten 30 Tagen mindestens einmal exzessiv Alkohol konsumiert haben (fünf alkoholische Getränke oder mehr hintereinander) ist im Zeitraum von 2004 (22,6%) bis 2008 (20,4%) nahezu konstant geblieben.
Die Raucherquote unter Jüngeren (12-25 Jahre) ist seit dem Jahre 2004 ständig gesunken und mit ihr auch die Zahl derjenigen, die Cannabis probiert haben. Was der Drogenbeauftragten der Bundesregierung, Sabine Bätzing, und ebenso der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung nach wie vor Kopfschmerzen bereitet, ist jedoch, dass im Kampf gegen das "Kampftrinken" ("binge drinking") wenig Erfolge zu verzeichnen sind. Die Quote derjenigen Jugendlichen, die in den letzten 30 Tagen mindestens einmal exzessiv Alkohol konsumiert haben (fünf alkoholische Getränke oder mehr hintereinander) ist im Zeitraum von 2004 (22,6%) bis 2008 (20,4%) nahezu konstant geblieben.
Dies sind die Kernaussagen der jetzt veröffentlichten Repräsentativerhebung "Drogenaffinität Jugendlicher in der Bundesrepublik Deutschland" der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). Befragt wurden in im Februar und März 2008 in Telefoninterviews rund 3000 Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 12 bis 25 Jahren. Ergebnisse im Einzelnen:
• Von 1979 bis Anfang der 1990er Jahre ging der Anteil rauchender Jugendlicher zurück. 1979 lag diese Quote bei 33% (Männer) und 27% (Frauen). Nach einem deutlichen Anstieg seit 1993 lässt sich ab dem Jahr 2001 wieder ein starker Rückgang beobachten. Dieser Rückgang vollzieht sich seit dem Jahr 2001 sowohl bei den männlichen als auch bei den weiblichen Jugendlichen. Aktuell liegt die Raucherquote nur noch bei 15% bzw. 16 %. Die Zahl der "Nieraucher" ist von 2004 bis 2008 von 40 auf 60 Prozent angestiegen.
• Unverändert ist dagegen die Verbreitung des Shisha-Rauchens (Wasserpfeife). Knapp 40 Prozent der 12- bis 17-Jährigen haben schon einmal in ihrem Leben eine Shisha geraucht, im Vorjahr waren es 14 Prozent. Ob sich das Shisha-Rauchen bei einem Teil der Jugendlichen zu einer ernst zu nehmenden Alternative zum Tabakrauchen entwickelt, ist unklar.
• Alkohol ist bei den Heranwachsenden derzeit das am meisten verbreitete Suchtmittel. Bei den 12 bis 17-Jährigen tranken 2008 noch 17,4 Prozent regelmäßig Alkohol, 2004 waren es 21,2 Prozent. Obwohl der größte Teil der 12- bis 17-Jährigen nach dem Jugendschutzgesetz eigentlich gar keinen Alkohol trinken dürfte, tranken im Jahr 2008 etwa 20 Prozent von ihnen im vergangenen Monat mindestens bei einer Gelegenheit 5 oder sogar mehr Gläser Alkohol. Dieser Trend zum exzessiven Trinken, das sog. "Binge Drinking", ist weiterhin ungebrochen.
• Nach vielen Jahren des Anstiegs ist der Cannabiskonsum zwischen 2004 und 2008 ein wenig rückläufig, was vermutlich mit dem Rückgang der Raucherquote zusammenhängt. 2004 hatten noch 31 Prozent der 12- bis 25-Jährigen schon einmal Cannabis probiert, 2008 sind es noch 28 Prozent. Bei den 12- bis 17- Jährigen ging im gleichen Zeitraum der Anteil von 15 Prozent auf knapp 10 Prozent zurück. Der Anteil junger Menschen mit regelmäßigem Cannabiskonsum liegt jedoch insgesamt nur bei 1 Prozent der Minderjährigen und 2 Prozent der 12- bis 25-Jährigen.
• Eine Pressemitteilung der Drogenbeauftragen der Bundesregierung und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung ist hier: Ausgeraucht - aber oft betrunken!
• Der Kurzbericht (PDF, 14 Seiten) ist hier: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, BZgA, Köln: Die Drogenaffinität Jugendlicher in der Bundesrepublik Deutschland 2008
Gerd Marstedt, 16.11.08
Leiden am Schein und weniger am Sein: Sich dick fühlen verringert die Lebensqualität stärker als dick sein.
 Pünktlich zur Kür von "Germany's Next Topmodel" bekommt die Diskussion um den Schlankheitswahn neue Nahrung. Der Kinder- und Jugendgesundheitssurvey KiGGS fand heraus: Während nur knapp ein Fünftel der Mädchen tatsächlich übergewichtig oder fettleibig ist, hält sich über die Hälfte dafür. Die Lebensqualität der tatsächlich dicken Kinder ist dabei besser als die der eingebildet dicken.
Pünktlich zur Kür von "Germany's Next Topmodel" bekommt die Diskussion um den Schlankheitswahn neue Nahrung. Der Kinder- und Jugendgesundheitssurvey KiGGS fand heraus: Während nur knapp ein Fünftel der Mädchen tatsächlich übergewichtig oder fettleibig ist, hält sich über die Hälfte dafür. Die Lebensqualität der tatsächlich dicken Kinder ist dabei besser als die der eingebildet dicken.
Der KiGGS bietet eine solide Datengrundlage für die künftige Diskussion um Übergewicht von Kindern und Jugendlichen in Deutschland. In der Studie wurden 17.641 Teilnehmer zwischen 0 und 17 Jahren medizinisch untersucht. Zudem wurden alle Eltern sowie die 11- bis 17-jährigen Teilnehmer schriftlich befragt. "Zu dick" und "zu dünn" sind dabei relative Größen: Als übergewichtig gilt ein Kind, wenn sein BMI-Wert oberhalb des alters- und geschlechtsspezifischen Perzentils der Referenzpopulation aus den Jahren 1985 bis 1998 liegt und als adipös mit einem BMI oberhalb des 97. Perzentils. Als untergwichtig gilt ein Kind, wenn sein BMI unterhalb des 10. Perzentils, und als extrem untergewichtig, wenn er unterhalb des 3. Perzentils liegt.
Die Ergebnisse bei den 11 bis 17-Jähringen im Einzelnen:
• Gemessenes Gewicht: Bei den Mädchen sind 75,4% normalgewichtig, 9,5 übergewichtig, 8,3% adipös, 5,1% untergewichtig und 1,8% extrem untergewichtig. Bei den Jungen sind 74,3% normalgewichtig, 9,9% übergewichtig, 7,7% adipös, 5,7 untergewichtig und 2,4 extrem untergewichtig.
• Sozialstatus: Je nach Alter und Geschlecht stammen knapp zwei- bis fünfmal so viele adipöse Kinder aus Familien mit niederem Sozialstatus. Der Extremfall: Unter den 11- bis 13-jährigen Mädchen mit niederem Sozialstatus sind 14,7% adipös, unter den mit hohem Sozialstaus nur 3%.
• Gefühltes Gewicht: Bei den Mädchen sagen 36,6%, sie hätten "genau das richtige Gewicht", 44,5% halten sich für "ein bisschen zu dick", 10% für "viel zu dick", 7,2% für "ein bisschen zu dünn" und 1,7% für "viel zu dünn". Bei den Jungen haben 44,1% "genau das richtige Gewicht", 30,8% halten sich für "ein bisschen zu dick", 4,7% für "viel zu dick", 17,2% für "ein bisschen zu dünn" und 3,2% für "viel zu dünn".
• Übereinstimmung von gemessenem und gefühltem Gewicht: Von den normalgewichtigen Mädchen halten sich 44,3% für richtig, 45,6% für ein bisschen zu dick und 3,8% für viel zu dick. Von den normalgewichtigen Jungen halten sich 54,3% für richtig, 25,1% für ein bisschen zu dick und 1,1% für viel zu dick. Von den adipösen Mädchen halten sich 38,5% für ein bisschen zu dick und 60,6% für viel zu dick. Von den adipösen Jungen halten sich 64,8% für ein bisschen zu dick und 32,2% für viel zu dick.
• Lebensqualität: Normalgewichtige Mädchen haben einen KINDL-Gesamtscore (mit den Einzelaspekten Körper, Psyche, Selbstwert, Familie, Freunde und Schule) von 71,7, adipöse Mädchen von 68,5. Normalgewichtige Jungen haben einen Score von 74,2, adipöse Jungen von 70,2. Normalgewichtige Mädchen, die ihr Gewicht für richtig halten, haben einen Score von 74,8, normalgewichtige Mädchen, die sich für viel zu dick halten, von 62,3. Normalgewichtige Jungen, die ihr Gewicht für richtig halten, haben einen Score von 75,7, normalgewichtige Jungen, die sich für viel zu dick halten, von 66,6.
Die Autorinnen möchten die Auswirkung der Adipositas auf die körperliche Gesundheit nicht relativieren, ziehen aber dennoch das Fazit: "Muss eine realistische Körpereinschätzung adipöser Kinder und Jugendlicher erreicht werden, um die Veränderungsbereitschaft des Betroffenen zu fördern, wenn der Preis eine verminderte Lebensqualität ist? Zudem ist sehr sorgsam zu überlegen, inwieweit die derzeit allgegenwärtigen Kampagnen gegen das Übergewicht den Anteil der Jugendlichen erhöht, der sich ohne Grund als zu dick erachtet."
Christian Weymayr, 7.6.2008
Umfrage bei Schülern der 9.-10.Klasse: Weniger Raucher, dafür steigt der Anteil der Alkoholkonsumenten
 Der Alkoholkonsum bei Schülern der 9. und 10. Klasse ist in den letzten Jahren deutlich angestiegen. Zwar hat der durch zusätzliche Besteuerung höhere Preis für "Alkopops" den Konsum dieser Getränke deutlich reduziert. Dies wurde jedoch durch die Verlagerung auf andere Getränkearten (wie insbesondere Bier und Spirituosen) kompensiert, so dass die Besteuerung insgesamt zu keiner Reduktion des Alkoholkonsums geführt hat. Nach einer jetzt veröffentlichten neuen Studie "Europäische Schülerstudie zu Alkohol und anderen Drogen 2007 (ESPAD)" stieg der Anteil der regelmäßigen Biertrinker bei den Neunt- und Zehntklässlern von 56 Prozent im Jahre 2003 auf 67 Prozent im Jahre 2007. Und auch der Konsum von harten Spirituosen, die in dieser Altersgruppe eigentlich noch verboten sind, erhöhte sich von 53 auf 57 Prozent.
Der Alkoholkonsum bei Schülern der 9. und 10. Klasse ist in den letzten Jahren deutlich angestiegen. Zwar hat der durch zusätzliche Besteuerung höhere Preis für "Alkopops" den Konsum dieser Getränke deutlich reduziert. Dies wurde jedoch durch die Verlagerung auf andere Getränkearten (wie insbesondere Bier und Spirituosen) kompensiert, so dass die Besteuerung insgesamt zu keiner Reduktion des Alkoholkonsums geführt hat. Nach einer jetzt veröffentlichten neuen Studie "Europäische Schülerstudie zu Alkohol und anderen Drogen 2007 (ESPAD)" stieg der Anteil der regelmäßigen Biertrinker bei den Neunt- und Zehntklässlern von 56 Prozent im Jahre 2003 auf 67 Prozent im Jahre 2007. Und auch der Konsum von harten Spirituosen, die in dieser Altersgruppe eigentlich noch verboten sind, erhöhte sich von 53 auf 57 Prozent.
Für die "Europäische Schülerstudie zu Alkohol und anderen Drogen" (ESPAD) wurden die Angaben von über 12 Tausend Schülern aus Bayern, Berlin, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Saarland und Thüringen ausgewertet. Themen der in Deutschland zum zweiten Mal durchgeführten europa-weiten Untersuchung waren der Umfang des Tabak-, Alkohol- und Drogenkonsums unter Jugendlichen, substanzbezogene Probleme, Einstellungen zu psychoaktiven Substanzen und die damit verbundenen Risiken.
Wesentliche Ergebnisse der Studie:
• Unter den Schülern/innen der 9. und 10. Jahrgangsstufe hat sich der Anteil der Tabakkonsumenten zwischen 2003 und 2007 von 47% auf 37% um gut zehn Prozentpunkte deutlich reduziert. Ebenso ist der Anteil derjenigen Jugendlichen gesunken, die in den letzten 30 Tagen täglich geraucht zu haben. Diese bei Erwachsenen nicht zu beobachtende sinkende Tendenz dürfte nach Meinung der Forscher im Zusammenhang stehen mit dem vollständigen Rauchverbot an Schulen sowie der Einschränkung des Zugangs zu Tabakwaren durch die Einführung von Chipkarten für die Benutzung von Zigarettenautomaten.
• Eine positive Entwicklung ist bezüglich des Cannabiskonsums zu beobachten: Der Anteil Jugendlicher, die in den letzten 30 Tagen vor der Befragung Cannabis konsumiert hatten, ging von 14% auf 8% zurück. Die Faktoren, die zu dieser Reduktion beigetragen haben, sind den Wissenschaftlern nicht klar, da keine unmittelbaren konsumreduzierenden präventiven Maßnahmen im Beobachtungszeitraum erfolgt sind.
• Während der Konsum von Alkopops im Zeitraum 2003-2007 um fast 20 Prozent zurückgegangen ist, stieg der Anteil der Biertrinker um etwa 12 Prozent und der Anteil der Konsumenten harter Spirituosen um 4 Prozent.
• Insgesamt weisen die hohen Anteile von unter 16- bzw. 18-jährigen Jugendlichen, die angaben, Alkohol in Geschäften gekauft bzw. Alkohol in Gaststätten getrunken zu haben, darauf hin, dass die notwendigen gesetzlichen Bestimmungen zwar vorliegen, deren Durchsetzung aber unzureichend ist.
• Hinsichtlich Wein bzw. Sekt und Alkopops zeigen sich Unterschiede zwischen den Schulformen: Gymnasiasten und Realschüler tranken häufiger Wein oder Sekt als Alkopops, Hauptschüler und Gesamtschüler gaben hingegen mehrheitlich an, in den letzten 30 Tagen eher Alkopops konsumiert zu haben.
• Problematisch erscheinen den Autoren der Studie die sozialen Folgen des Alkoholkonsums für bestimmte Jugendliche: Körperliche Auseinandersetzungen und Unfälle oder Verletzungen im Zusammenhang mit Alkholkonsum wurden von 15% berichtet. 22% gaben Probleme mit den Eltern, 17% Probleme mit Freunden und 8% mit der Polizei an. Leistungsprobleme in der Schule führten 13% der Befragten auf ihren Alkholkonsum zurück. Alkohol hatte auch bei 8% einen negativen Einfluss auf das Sexualverhalten, sie berichteten über Sexualkontakte ohne Benutzung eines Kondoms. Allgemein nannten mehr Jungen als Mädchen mit dem Alkoholkonsum zusammenhängende soziale Probleme.
Die Studie ist hier kostenlos verfügbar: Kraus, Pabst & Steiner: Europäische Schülerstudie zu Alkohol und anderen Drogen 2007 (ESPAD) (Herausgegeben vom IFT Institut für Therapieforschung, Reihe IFT-Berichte, Band Nr. 165, PDF, 226 Seiten)
Gerd Marstedt, 21.3.2008
Wenn Eltern psychischen Stress erleben, sind die Kinder anfälliger für Krankheiten
 Seelischer Stress im Elternhaus geht an den Kindern nicht spurlos vorüber. Im Rahmen einer Langzeitstudie beobachtete ein Forschungsteam der Universität Rochester (USA) 169 Kinder im Alter von 5-10 Jahren sowie ein Elternteil über einen Zeitraum von mehr als drei Jahren. Dabei zeigte sich bei Untersuchungen, die mehrfach im Abstand von etwa 6 Monaten durchgeführt wurden: Wenn der Vater oder die Mutter sich durch Stress seelisch stark belastet fühlte, dann wurden auch die Kinder häufiger krank im Vergleich zu anderen Eltern, die keine oder deutlich geringere Anzeichen psychischer Belastungen zeigten.
Seelischer Stress im Elternhaus geht an den Kindern nicht spurlos vorüber. Im Rahmen einer Langzeitstudie beobachtete ein Forschungsteam der Universität Rochester (USA) 169 Kinder im Alter von 5-10 Jahren sowie ein Elternteil über einen Zeitraum von mehr als drei Jahren. Dabei zeigte sich bei Untersuchungen, die mehrfach im Abstand von etwa 6 Monaten durchgeführt wurden: Wenn der Vater oder die Mutter sich durch Stress seelisch stark belastet fühlte, dann wurden auch die Kinder häufiger krank im Vergleich zu anderen Eltern, die keine oder deutlich geringere Anzeichen psychischer Belastungen zeigten.
Bereits in früheren Studien hatten sich Hinweise darauf gefunden, dass Stressreaktionen der Eltern möglicherweise auch von Kindern nachempfunden werden und so deren Immunsystem schwächen mit der Folge auch körperlicher Erkrankungen. Allerdings wiesen alle früheren Studien zum Teil erhebliche methodische Mängel auf, basierten nur auf Daten, die im Nachhinein erhoben waren oder allein auf Befragungsdaten ohne medizinische Untersuchungen. Die jetzt durchgeführte Studie ist demgegenüber methodisch sehr viel weniger angreifbar.
In den Jahren 2001-2003 wurden insgesamt 169 Kinder und ein Elternteil zur Teilnahme an der über 3jährigen Längsschnittstudie gewonnen. Dabei wurden zahlreiche Daten gesammelt:
• Zur Erfassung von Stress musste der Vater oder Mutter im halbjährlichen Abstand mehrere Fragebögen ausfüllen, zur Erfassung psychischer Störungen und Beschwerden, zum Auftreten von beruflichen und privaten Stress-Ereignissen (stressfull life-events), zu Konflikten in der Familie, Erziehungsproblemen und dem familiären Zusammenhalt.
• Die Eltern mussten darüber hinaus ein "Krankheits-Tagebuch" führen, in das sie Krankheitssymptome oder Beschwerden des Kindes eintrugen, und sie protokollierten überdies die jeweils gemessene Körpertemperatur des Kindes.
• Bei den Kindern wurden im halbjährlichen Abstand in der Universitätsklinik Blutuntersuchungen durchgeführt, bei denen verschiedene Indikatoren zur Immunreaktion gemessen wurden.
Als Ergebnis der späteren Analysen zeigte sich dann: Je höher die Stressbelastungen des beteiligten Vaters bzw. der Mutter waren, desto häufiger war das Kind krank. Wenn man die jeweiligen elterlichen Stressbelastungen auf einer Skala bewertete, dann bedeutete ein Anstieg um einen Punkt, dass das Kind um 40 Prozent häufiger krank und um 77 Prozent häufiger eine Erkrankung mit Fieber bekam. Ebenso zeigten sich sehr deutliche Effekte für einen Anstieg bestimmter Messwerte im Blut des Kindes, die auf eine geschwächte Immunabwehr hindeuteten.
Hier ist ein kostenloses Abstract: Mary T. Caserta u.a.: The associations between psychosocial stress and the frequency of illness, and innate and adaptive immune function in children (Brain, Behavior, and Immunity, Article in Press, Corrected Proof, doi:10.1016/j.bbi.2008.01.007)
Gerd Marstedt, 19.3.2008
Intensiver Konsum von Gewalt im Fernsehen führt im späteren Kindesalter zu Aggressivität und asozialem Verhalten
 Ein zeitlich sehr umfassender Konsum von Fernsehsendungen schon im frühen Kindesalter kann das spätere Sozialverhalten überaus nachhaltig beeinflussen - allerdings nur, wenn es sich um Sendungen mit gewalttätigen Darstellungen handelt. Überdies macht sich der negative Einfluss nur bei Jungen und nicht bei Mädchen bemerkbar. Dies sind zentrale Erghebnisse einer jetzt in der Zeitschrift "Pediatrics" veröffentlichten Langzeitstudie.
Ein zeitlich sehr umfassender Konsum von Fernsehsendungen schon im frühen Kindesalter kann das spätere Sozialverhalten überaus nachhaltig beeinflussen - allerdings nur, wenn es sich um Sendungen mit gewalttätigen Darstellungen handelt. Überdies macht sich der negative Einfluss nur bei Jungen und nicht bei Mädchen bemerkbar. Dies sind zentrale Erghebnisse einer jetzt in der Zeitschrift "Pediatrics" veröffentlichten Langzeitstudie.
An der Studie beteiligt waren 330 Kinder im Vorschulalter, 184 Jungen und 146 Mädchen. Zu zwei Zeitpunkten wurde bei ihnen eine Reihe von Informationen erhoben, nämlich im Alter von 2-5 Jahren und noch einmal fünf Jahre später, als die Kinder 7-10 Jahre alt waren. Zu diesen Informationen gehörten Angaben zum Fernsehkonsum, der täglichen Dauer und der Art der Sendungen. Dabei wurden die eingeschalteten Sendungen danach unterschieden, ob sie auch gewalttätige Darstellungen zeigten oder ob es sich um spezielle Kindersendungen (wie die Sendung mit der Maus) mit kindgerechter Information handelte. Überprüft wurde dann im späteren Alter der Kinder (anhand von Elternaussagen in einem Fragebogen), wie stark das Ausmaß aggressiver und antisozialer Verhaltensweisen war.
Mit in die Analyse einbezogen war auch eine Reihe anderer Aspekte, die nach dem aktuellen Forschungsstand auch als Ursachen von aggressivem Verhalten in Frage kommen. Dazu gehörten etwa die elterlichen Erziehungsstile, das soziale Milieu im Elternhaus, ob es sich um alleinerziehende Elternteile handelte und anderes mehr. Als Ergebnis dieser Analyse zeigte sich dann: Bei einem zeitlich sehr umfassenden Konsum von Fernsehsendungen mit gewalttätigem Inhalt im Vorschulalter findet sich einige Jahre später im Schulalter auch ein erhöhtes Maß an Aggressivität - allerdings nur bei Jungen. Für Mädchen fanden sich keine Hinweise auf diesen Zusammenhang. Bei Kindern, die sehr viele kindgerechte Fernsehsendungen ohne Gewaltdarstellungen schauen, fand sich ebenfalls kein Effekt auf das spätere Sozialverhalten.
Eine schlüssige Interpretation für diesen geschlechtsspezifischen Effekt liefern die Wissenschaftler nicht, sie weisen nur recht vage auf unterschiedliche "genetische Prädispositionen" und elterliche Erziehungsstile hin. Denkbar sei auch, dass die von Mädchen bevorzugten Sendungen noch einmal einen anderen Charakter von Gewalt-Darstellung hätten. Gleichwohl seien ihre Untersuchungsbefunde überaus bedeutsam, da viele andere Studien gezeigt hätten, dass aggressives und asoziales Verhalten im Kindesalter sehr häufig auch die weitere Entwicklung beeinflusse, bis hin zu kriminellen Handlungen in der Adoleszenz und im Erwachsenenalter.
Hier ist ein Abstract der Studie: Dimitri A. Christakis, Frederick J. Zimmerman: Violent Television Viewing During Preschool Is Associated With Antisocial Behavior During School Age (PEDIATRICS Vol. 120 No. 5 November 2007, pp. 993-999 - doi:10.1542/peds.2006-3244)
Die Studienergebnisse bestätigen weitgehend die Befunde einer schon früher veröffentlichten Langzeitstudie, bei der über einen Zeitraum von 17 Jahren (von 1975 bis 1993) etwa 700 Kinder beobachtet wurden. Auch dort hatte sich gezeigt, dass ein erhöhtes Maß an TV-Konsum von Sendungen mit gewalttätigen Inhalten auch zu einem gehäuften Auftreten von Aggressivität, von körperlichen Auseinandersetzungen und kleineren kriminellen Handlungen führt. Auch in dieser Untersuchung wurde überprüft, ob das antisoziale Verhalten der jugendlichen Studienteilnehmer nicht unter Umständen durch andere Faktoren verursacht war, wie etwa soziale Vernachlässigung, schlechte materielle Bedingungen in der Familie, niedriges Bildungsniveau im Elternhaus, sozial problematische Wohnbedingungen oder frühere psychische Auffälligkeiten in der Kindheit. Tatsächlich zeigte sich auch hierfür ein Effekt auf das spätere Sozialverhalten - aber der Einfluss des Fernsehkonsums von Gewaltinhalten blieb gleichwohl in der statistischen Analyse bestehen.
Die Autoren geben mehrere mögliche Interpretationen für die gefundenen Zusammenhänge: Zum einen könnte die Beobachtung von Gewalt im Fernsehen zur spielerischen Nachahmung führen, insbesondere dann, wenn in den Filmen Gewalt am Ende auch noch belohnt wird. Zum zweiten sei auch denkbar, dass ein gehäuftes Beobachten von gewalttätigen Auseinandersetzungen zu einer Desensibilisierung führt, so dass Kinder und Jugendliche nicht mehr bemerken, wann sie eine Grenze überschreiten. Gewalt wird dann als ganz normale und übliche Form der sozialen Interaktion erlebt. Zum dritten sei auch denkbar, dass durch die zeitliche Intensität des Fernsehkonsums den Kindern zu wenig Zeit bleibt, um im realen Kontakt mit Gleichaltrigen soziales Verhalten zu üben, Strategien zu erlernen, wie man in kritischen Situationen ohne Gewalt auskommt.
Die Studie im Volltext als PDF-Datei: Jeffrey G. Johnson u.a.: Television Viewing and Aggressive Behavior During Adolescence and Adulthood (Science Magazine, May 29, 2002)
Gerd Marstedt, 11.11.2007
Kinderarmut wirkt sich auch langfristig und im weiteren Lebensverlauf negativ aus
 Ein Aufwachsen in Armut hat gravierende negative Folgen auch für die langfristige Entwicklung von Kindern. Dies lässt sich anhand der seit dem Jahr 2000 erhobenen Daten des Deutschen Jugendinstituts (DJI) für eine Vielzahl von Aspekten nachweisen. Beeinträchtigt werden die soziale Teilhabe und Persönlichkeitsentwicklung, Schulleistungen und kindliches Wohlbefinden. Das Deutsche Jugendinstitut hat jetzt Ergebnisse einer Langzeitstudie ("DJI-Kinderpanel") zu den Lebenslagen von Kindern veröffentlicht. In diesen Teiluntersuchungen werden die Zusammenhänge von Armut und sozialer Teilhabe, Persönlichkeit, kognitiven Leistungen und kindlichem Wohlbefinden differenziert aufgezeigt. Auf der Website des DJI werden diese Ergebnisse in der Rubrik "Thema 2007/11: Kinderarmut: einmal arm - immer arm?" zusammenfassend vorgestellt.
Ein Aufwachsen in Armut hat gravierende negative Folgen auch für die langfristige Entwicklung von Kindern. Dies lässt sich anhand der seit dem Jahr 2000 erhobenen Daten des Deutschen Jugendinstituts (DJI) für eine Vielzahl von Aspekten nachweisen. Beeinträchtigt werden die soziale Teilhabe und Persönlichkeitsentwicklung, Schulleistungen und kindliches Wohlbefinden. Das Deutsche Jugendinstitut hat jetzt Ergebnisse einer Langzeitstudie ("DJI-Kinderpanel") zu den Lebenslagen von Kindern veröffentlicht. In diesen Teiluntersuchungen werden die Zusammenhänge von Armut und sozialer Teilhabe, Persönlichkeit, kognitiven Leistungen und kindlichem Wohlbefinden differenziert aufgezeigt. Auf der Website des DJI werden diese Ergebnisse in der Rubrik "Thema 2007/11: Kinderarmut: einmal arm - immer arm?" zusammenfassend vorgestellt.
Als die Bundesregierung 2005 ihren 2. Armutsbericht veröffentlichte, waren in Deutschland "1,1 Mio. Kinder unter 18 Jahren BezieherInnen von Sozialhilfe." Ein aktueller Armutsbericht liegt derzeit nicht vor, aber der Kinderschutzbund gibt für das Jahr 2007 mit 2,6 Mio. armen Kindern in Deutschland eine alarmierende Schätzung ab. Als arm gilt in Deutschland derjenige, dessen Einkommen weniger als 60% des Durchschnittseinkommens beträgt. Diese Einkommensarmut ist als Schlüsselmerkmal von Armut zu sehen mit all ihren Auswirkungen auf weitere Lebensbereiche wie zum Beispiel Gesundheit oder Bildung.
Gerhard Beisenherz (DJI) betont im "Interview", dass wir möglichst im frühen Kindesalter ansetzen müssen, um die "Vererbung" von Armut über den Bildungskanal zu verhindern. Dafür brauchen wir jedoch niedrigschwellige und möglichst aufsuchende Angebote für genau diese Zielgruppe der bildungsfernen und zugleich armen Familien. Umfassende Förder- und Betreuungsangebote wären erste Schritte, um die Abwärtsspirale der Armut zu unterbrechen, meint auch der Sprecher der Nationalen Armutskonferenz Dr. Wolfgang Gern im "Blick von außen". Er warnt aber gleichzeitig davor, die Armut zu pädagogisieren. "Das lenkt vom eigentlichen Problem ab. Durch Bildung allein lässt sich Armut nicht bekämpfen, solange Arbeitsplätze fehlen."
In der Rubrik "Auf einen Blick" werden einerseits aktuelle statistische Daten zur Kinderarmut in Deutschland im Detail vorgestellt, darüber hinaus aber auch empirische Befunde zu den psychischen und sozialen Folgen.
So zeigt sich beispielsweise für den Aspekt Soziale Teilhabe: Der Anteil der Kinder, die häufige gemeinsame Aktivitäten mit den Eltern berichten, wächst mit steigender Schicht deutlich: Über die fünf Schichten, die wir unterscheiden - Unterschicht, untere, mittlere und obere Mittelschicht und Oberschicht - finden wir die folgenden Anteile: 5%, 9%, 16% 20% und 23%. Kinder aus der untersten Sozialschicht berichten zu fast 24%, dass sie in letzter Zeit Streit mit der Mutter wegen des Einkaufs spezieller Markenkleidung hatten. Demgegenüber berichten nur ca. 9%, 8%, 11% und 7% der Kinder in den anderen Schichten über solche Streitursachen.
Im Bereich Persönlichkeitsentwicklung werden verschiedene Dimensionen näher erfasst, und zwar: die Internalisierung (die Neigung, sich in sich zurück zu ziehen); die Externalisierung (die Tendenz, aus sich heraus zu gehen, z.T. auch aggressiv zu werden); die motorische Unruhe; das Selbstbild, insbesondere Selbstvertrauen und Vorstellung von Selbstwirksamkeit; die soziale/kognitive Aufgeschlossenheit. Mit Ausnahme der letzten Dimension finden sich für alle anderen Aspekte statistisch hochsignifikante Unterschiede mit der Tendenz zu einer verzögerten und weniger ausgereiften Persönlichkeitsentwicklung in der unteren Sozialschicht.
Hinsichtlich der intellektuellen Entwicklung wird deutlich: Die Schulleistungen im Rechnen und Lesen werden durch die Dauer der Armut dann nachhaltig beeinträchtigt, wenn diese schon zwei bis drei Jahre anhält. Bereits in der erste Welle weisen Kinder der älteren Kohorte in unterschiedlichen Armutslagen zum Teil erhebliche Leistungsunterschiede in der Schule auf. Bei Kindern, die schon vor der Erstbefragung in Armut lebten und dann darin verharrten, finden wir eine markante Differenz in der Rechenkompetenz zu den übrigen Kindern. Circa 46% dieser dauerhaft armen Kinder sind im Rechnen schlecht ("nicht so gut" oder "überhaupt nicht gut") gegenüber 15% der gelegentlich armen Kinder und 20% der nie armen Kinder. Die Lesekompetenz der 9- bis 10jährigen Grundschüler ist dagegen von der Armutslage generell beeinflusst. Die Kinder, deren Situation sich vor der Ersterhebung noch verschlechtert hat und/oder die seither dauerhaft in Armut verharren, weisen massive Unterschiede in der Lesekompetenz gegenüber den dauerhaft nicht-armen Kindern auf.
Für das kindliche Wohlbefinden in der Schule wird deutlich, dass sich gerade das schulische Wohlbefinden bei Kindern in Armutslagen von der 2. bis zur 4. Klasse verschlechtert.
Deutsches Jugendinstitut: Thema 2007/11: Kinderarmut: einmal arm - immer arm? Ergebnisse auf einen Blick
Gerd Marstedt, 2.11.2007
"Clarion call for action" - Über 50 % des ambulanten Behandlungsgeschehens bei US-Kindern qualitativ problematisch.
 Warum auch immer dieser Fanfarenstoß nicht erwartet wurde: Experten reagierten geschockt darauf, dass Kinder in den USA nur in 47 % aller ambulanten Behandlungen richtig versorgt werden. So lautet das Kernergebnis einer gerade im "New England Journal of Medicine (NEJM)" veröffentlichten Studie von Forschern der RAND-Corporation, dem Seattle Children’s Hospital Research Institute und der School of Medicine der Universität des Bundesstaates Washington.
Warum auch immer dieser Fanfarenstoß nicht erwartet wurde: Experten reagierten geschockt darauf, dass Kinder in den USA nur in 47 % aller ambulanten Behandlungen richtig versorgt werden. So lautet das Kernergebnis einer gerade im "New England Journal of Medicine (NEJM)" veröffentlichten Studie von Forschern der RAND-Corporation, dem Seattle Children’s Hospital Research Institute und der School of Medicine der Universität des Bundesstaates Washington.
Dazu wurden die Daten von 1.536 Kindern (Neugeborene bis 18-Jährige) in 12 städtischen Bezirken im Zeitraum von 1996 bis 2000 herangezogen und die jeweiligen in medizinischen Dokumentationen erfassten Behandlungsschritte aufwändig mit 175 etablierten Behandlungsstandards für 12 klinische Bereiche verglichen (ausführliche Beispiele finden sich im Aufsatz). Drei Viertel der StudienteilnehmerInnen waren weißer Hautfarbe, 82 % waren privat krankenversichert und alle lebten in oder in der Nähe von mittelgroßen Städten.
Die Vergleiche von Behandlungswirklichkeit und -standards erbrachten auf dem insgesamt hohen Niveau qualitativer Fehlversorgung nochmals kräftige Unterschiede bei den einzelnen Behandlungsarten: Bei akuten gesundheitlichen Problemen gab es in 68 % der Behandlungsfälle eine gute Versorgung, bei der Versorgung chronischer Erkrankungen war dies noch bei 53 % des Geschehens der Fall und der Tiefpunkt erreichte die präventive Behandlung, die nur noch bei 41 % des Geschehens den Standards entsprach.
Im Einzelnen identifizierte die Studie beispielsweise folgende Behandlungslücken:
• Bei weniger als einem Drittel der Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren wurde innerhalb zweier Jahre die Größe und das Gewicht gemessen.
• Bei ernstem Durchfall erhielten die StudienteilnehmerInnen in 38 % der Fälle eine gute, d.h. in Leitlinien und Standards vereinbarte Behandlung. Dies traf bei Infektionen der ableitenden Harnwege bei 48 % zu und bei Asthma bei 46 % der Fälle.
• Selbst bei den Allerweltsinfektionen der oberen Atemwege erhielten 8 % der Kinder nicht die angemessene Behandlung.
Die Leiterin der Studie, Rita Mangione-Smith vom "Seattle Children's Hospital Research Institute", wies trotz der jetzt schon problematischen Fehlversorgung relevanter Anteile der untersuchten Kinder darauf hin, dass es sich hier sogar um ein "best-case scenario" handle, da die Mehrheit der Kinder gut versichert wären. Würde man die 15-20 % der nicht krankenversicherten Kinder noch hinzunehmen, würde die Diskrepanz von Standards und Realität der Behandlung noch größer.
Zu den Faktoren, die nach Meinung der WissenschaftlerInnen diese Situation mitschaffen gehören Ausbildungs- und Fortbildungsdefizite der Ärzte, die vorrangig auf die Behandlung akuter Krankheiten ausgerichtet ist und Versicherungsverträge, die nicht selten keine präventiven Leistungen einbeziehen.
Ebenfalls schockiert räumt James Perrin, der Chefpädiater am "Massachusetts General Hospital" und Professor an der "Harvard Medical School", in einem inhaltlich und methodisch interessanten Editorial ein: "We've been lulled into complacency, thinking this kind of thing doesn't happen with children." Einer der Hauptfaktoren, die wahrscheinlich verhinderten, dass es zu einer komplett zufälligen und repräsentativen Studie kommen konnte, war im übrigen die extrem geringe Bereitschaft der Eltern, selbst Wissenschaftlern Einblick in die Behandlungsdaten ihrer Kinder zu gewähren.
Ob auch die deutschen Akteure eingelullt (worden) sind, könnte erst eine ähnliche Studie bestätigen oder widerlegen. Bis dahin: Im Zweifel zweifeln und über Verbesserungsmöglichkeiten nachdenken!
Von dem Aufsatz "The Quality of Ambulatory Care Delivered to Children in the United States" von Rita Mangione-Smith, Alison H. DeCristofaro, Claude M. Setodji, Joan Keesey, B.A., David J. Klein, John L. Adams, Mark A. Schuster, und Elizabeth A. McGlynn im NEJM (2007; 357(15): 1515-1523 vom 11. Oktober) gibt es kostenlos eine neunseitige komplette PDF-Fassung. Dies gilt auch für das ausführliche Editorial "The Quality of Children's Health Care Matters — Time to Pay Attention" von James M. Perrin, und Charles J. Homer (357(15): 1549-1551).
Bernard Braun, 14.10.2007
Sport erzieht zu Fairness und Selbstbeherrschung. Falsch, sagt eine US-Studie, Sport fördert männliche Gewalt
 Dem Sportunterricht an US-amerikanischen Schulen (und vermutlich nicht nur dort) werden vielfältige soziale und pädagogische Funktionen zuerkannt. Danach fördert er soziale Kontakte und Teamgeist, erzieht zu Fairness und Selbstbeherrschung , fördert Wettbewerbs- und Leistungsmotivation. Kurzum, Sport ist ein perfektes Übungsfeld für das Hineinwachsen in gesellschaftliche Normen und Wertvorstellungen. So pauschal stimmt das alles nicht, erklärt US-Professor Derek A. Kreager von der Pennsylvania State University, teilweise fördert der Sportunterrichtung sogar männliche Aggressivität und Gewalt.
Dem Sportunterricht an US-amerikanischen Schulen (und vermutlich nicht nur dort) werden vielfältige soziale und pädagogische Funktionen zuerkannt. Danach fördert er soziale Kontakte und Teamgeist, erzieht zu Fairness und Selbstbeherrschung , fördert Wettbewerbs- und Leistungsmotivation. Kurzum, Sport ist ein perfektes Übungsfeld für das Hineinwachsen in gesellschaftliche Normen und Wertvorstellungen. So pauschal stimmt das alles nicht, erklärt US-Professor Derek A. Kreager von der Pennsylvania State University, teilweise fördert der Sportunterrichtung sogar männliche Aggressivität und Gewalt.
Er bezieht sich dabei auf eine von ihm durchgeführte Studie, deren Ergebnisse jetzt in der Zeitschrift "American Sociological Review" veröffentlicht wurden. Basis der Analysen sind Erhebungen bei 6.400 männlichen Schülern (an weiterführenden Highschools, Grade 7-12), die im Rahmen der sogenannten "National Longitudinal Study of Adolescent Health (Add Health)" in den Jahren 1994-2001 mehrmals befragt wurden. In diesen Umfragen wurden zahlreiche, direkt oder indirekt mit der Gesundheit zusammen hängende Themen erfasst, darunter auch einige für die Fragestellung der Studie bedeutsame Aspekte, wie unter anderem die Teilnahme an bestimmten Schulsport-Veranstaltungen und Zugehörigkeit zu Schulmannschaften, die Verwicklung in kleinere Vergehen (Alkoholgenuss, Rauscherfahrungen, unerlaubtes Steuern eines Autos, Schulschwänzen usw.) und auch die Verwicklung in Schlägereien und gewalttätige körperliche Auseinandersetzungen.
Aufgrund der Erfassung dieser "kleinen Delikte" und der Gewalterfahrungen auch schon in der 1.Highschool-Klasse (bei der ersten Add-Health-Befragung) und der Berücksichtigung dieser Befunde will Prof. Kreager Argumenten aus dem Weg gehen, dass eine möglicherweise höhere Gewaltbereitschaft bei Schülern mit intensiver sportlicher Betätigung allein aus Selektions-Mechanismen resultiert. Danach wäre es dann so, dass schon die elterliche und frühe schulische Erziehung Agressivität und Gewaltbereitschaft begünstigen und eine bestimmte Gruppe so erzogener Schüler dann im Sportunterricht ein willkommenes Feld findet, um anerzogene Impulse auszuleben.
Tatsächlich findet der Wissenschaftler in seinen Analysen Hinweise, dass auch dieser Zusammenhang gilt: Wer bereits in jungen Jahren mehr Gewaltbereitschaft zeigte, für den gilt dies auch später noch. Zugleich zeigt sich jedoch auch:
• Es gibt einige Faktoren, die die Aggressivität und Gewaltbereitschaft älterer Schüler reduzieren, dazu zählt etwa ein intaktes Elternhaus oder die Mitgliedschaft in einem Club.
• Umgekehrt zeigt sich für die intensive Beschäftigung mit einigen Schulsportarten eine deutlich höhere Ausübung von Gewalt. Dies gilt für (amerikanisches) Football und für Ringen, während sich für Tennisspieler die umgekehrte Tendenz zeigt (weniger Gewalt).
• Unabhängig hiervon und zusätzlich zur persönlichen Sport-Aktivität zeigt sich auch für die Art der sozialen Kontakte ein nachhaltiger Effekt: Wer Football-Spieler zu seiner Peergroup zählt, ist häufiger in gewalttätige Auseinandersetzungen verwickelt, während bei Tennisspielern im Freundeskreis solche Schlägereien eher verpönt sind und vermieden werden.
Betrachtet man die in der Analyse erzielten Effekte etwas genauer, dann wird allerdings deutlich, dass die frühkindliche und frühschulische Sozialisation erheblich stärkeren Einfluss hat. Die relative Häufigkeit aktueller Gewalt ist hier um den Faktor 4 erhöht (d.h.: Wer schon in jungen Jahren Schlägereien hatte, ist als älterer Schüler viermal häufiger darin verwickelt), während sich etwa für Beschäftigung mit Football nur der Einflussfaktor 1.4 ergibt. Die Befunde der Studie decken damit keine Kausalzusammenhänge auf, etwa derart, dass nun Sport oder zumindest bestimmte Sportarten wie Football die Gewaltbereitschaft fördern. Sie zeigen jedoch zumindest auf, dass eine oft aufgestellte These so nicht stimmt: Aggressivität und Gewalt werden durch Sportunterricht - zumindest in der derzeit an US-Schulen ausgeübten Form - nicht in friedliche Bahnen gelenkt, kanalisiert oder symbolisch ausgelebt, so dass Schüler im Alltag dann friedfertig sind und ohne Agressionen auskommen. Einige Sportarten scheinen eher ein Trainingsfeld für Schlägereien zu sein.
Eine Kopie der kompletten Studie, in der auch Sozialisations-Theorien zur Erklärung der Befunde detailliert erörtert werden, lässt sich hier herunter laden: Derek A. Kreager: Unnecessary Roughness? School Sports, Peer Networks and Male Adolescent Violence (American Sociological Review, 2007, Vol. 72, October, 705-724)
Gerd Marstedt, 8.10.2007
Psychische und gesundheitliche Risiken von zu viel Fernseh- und Medienkonsum im Kindesalter
 Eine unlängst in der Zeitschrift "Pediatrics" veröffentlichte Studie hat enthüllt, dass nahezu jedes zweite Kind (41%) in den USA im Alter von 5-6 Jahren bereits einen eigenen Fernseher im Kinderzimmer besitzt und etwa jedes sechste Kind im Alter von 2-3 Jahren schaut täglich mehr als zwei Stunden fern. Schlaf- und Aufmerksamkeitsstörungen, aber auch aggressives Verhalten waren bei diesen Kindern deutlich häufiger zu beobachten. (vgl.: Children's Television Exposure and Behavioral and Social Outcomes at 5.5 Years: Does Timing of Exposure Matter?). Aber auch in deutschen Kinderzimmern sieht es nicht völlig anders aus. Etwa jedes vierte Kind im Alter der Einschulung besitzt einen eigenen Fernseher - dies berichtet jetzt eine Übersichtsstudie im Deutschen Ärzteblatt, die auch über die gesundheitlichen und psychosozialen Risiken eines übermäßigen Medienkonsums informiert.
Eine unlängst in der Zeitschrift "Pediatrics" veröffentlichte Studie hat enthüllt, dass nahezu jedes zweite Kind (41%) in den USA im Alter von 5-6 Jahren bereits einen eigenen Fernseher im Kinderzimmer besitzt und etwa jedes sechste Kind im Alter von 2-3 Jahren schaut täglich mehr als zwei Stunden fern. Schlaf- und Aufmerksamkeitsstörungen, aber auch aggressives Verhalten waren bei diesen Kindern deutlich häufiger zu beobachten. (vgl.: Children's Television Exposure and Behavioral and Social Outcomes at 5.5 Years: Does Timing of Exposure Matter?). Aber auch in deutschen Kinderzimmern sieht es nicht völlig anders aus. Etwa jedes vierte Kind im Alter der Einschulung besitzt einen eigenen Fernseher - dies berichtet jetzt eine Übersichtsstudie im Deutschen Ärzteblatt, die auch über die gesundheitlichen und psychosozialen Risiken eines übermäßigen Medienkonsums informiert.
Auffällig ist wieder einmal, dass der soziale Status und das Bildungsniveau im Elternhaus von nachhaltigem Einfluss sind. Sowohl die Häufigkeit eines eigenen Fernsehers im Kinderzimmer als auch die tägliche Dauer des Fernsehkonsums sind im Unterschicht-Milieu deutlich häufiger vorzufinden. Die Studie "Übermässiger Medienkonsum von Kindern und Jugendlichen: Risiken für Psyche und Körper" berichtet zusammenfassend über unterschiedliche Negativeffekte (Sozialverhalten, Aggressivität, schulische Entwicklung, Adipositas, Diabetes usw.) - leider vermisst man im Artikel Quellenangaben zu den jeweils herangezogenen Studien.
Einige der referierten Ergebnisse:
• "Der Fernsehkonsum im Kleinkindalter ist ein Prädiktor der kognitiven Entwicklung bei der Einschulung, der Leistungszuwächse in den ersten Schuljahren sowie späterer Schulabbrüche und der Wahrscheinlichkeit, ein Studium zu beginnen. Der Einfluss ist offenbar bei geringer Intelligenz stärker. Auch längere Computer- beziehungsweise Videospielzeiten gehen mit akademischen Defiziten einher."
• "Der durch die exzessive Nutzung des Mediums resultierende Bewegungsmangel der Kinder und Jugendlichen (Verdrängung) reduziert die körperliche Fitness bis ins frühe Erwachsenenalter. (...) Ein hoher Fernsehkonsum ist deshalb mit niedrigem Obst- und Gemüsekonsum, hohem Konsum zuckerhaltiger Getränke, fettiger Snacks und Fast Food assoziiert."
• "In mehr als 30 Querschnittuntersuchungen korreliert die Prävalenz von Übergewicht beziehungsweise des Body-Mass-Index (BMI) mit dem Fernsehkonsum. Ein eigenes Fernsehgerät erhöht die Adipositas-Prävalenz zum Beispiel um das 1,31-Fache."
Der Aufsatz ist hier nachzulesen: Egmond-Fröhlich, Andreas van; Mößle, Thomas; Ahrens-Eipper, Sabine; Schmid-Ott, Gerhard; Hüllinghorst, Rolf; Warschburger, Petra: Übermässiger Medienkonsum von Kindern und Jugendlichen: Risiken für Psyche und Körper (Deutsches Ärzteblatt 104, Ausgabe 38 vom 21.09.2007, Seite A-2560)
Gerd Marstedt, 3.10.2007
McDonald's Werbebotschaften beeinflussen schon 4-5jährige Vorschulkinder
 Chicken Nuggets, Big Macs und Pommes frites sind bei Vorschulkindern im Alter von dreieinhalb bis fünfeinhalb Jahren nicht nur überaus beliebt, sondern viel mehr als das: Viele von ihnen sind voll und ganz der Überzeugung, dass diese Produkte wesentlich besser schmecken, wenn sie von McDonald's kommen als wenn es sich um namenlose Fritten oder Burger handelt. Die Werbebotschaften der McDonald's Corporation mit etwa 31.000 Restaurants in über 100 Ländern kommen bei Kindern umso intensiver an, je mehr Fernseher im Elternhaus sind und je häufiger die Eltern mit ihren Kindern in eins der Schnellrestaurants von McDonald's gehen.
Chicken Nuggets, Big Macs und Pommes frites sind bei Vorschulkindern im Alter von dreieinhalb bis fünfeinhalb Jahren nicht nur überaus beliebt, sondern viel mehr als das: Viele von ihnen sind voll und ganz der Überzeugung, dass diese Produkte wesentlich besser schmecken, wenn sie von McDonald's kommen als wenn es sich um namenlose Fritten oder Burger handelt. Die Werbebotschaften der McDonald's Corporation mit etwa 31.000 Restaurants in über 100 Ländern kommen bei Kindern umso intensiver an, je mehr Fernseher im Elternhaus sind und je häufiger die Eltern mit ihren Kindern in eins der Schnellrestaurants von McDonald's gehen.
In einem Experiment hatte eine kalifornische Forschungsgruppe insgesamt 63 Vorschulkindern verschiedene, bei Kindern beliebte Speisen gezeigt und auch ein Getränk: Hamburger, Chicken Nuggets, Pommes Frites, kleine Möhren und ein Glas Vollmilch. Alle fünf Produkte wurden jedoch in doppelter Ausführung präsentiert, einmal mit einer deutlichen Kennzeichnung durch die typische McDonald's Verpackung mit dem Firmen-Logo und einmal in neutraler Verpackung ohne jeden Produktnamen. Ansonsten waren die Speisen und Getränke im Aussehen und in der Menge und Aufmachung völlig gleich. Die Kinder wurden dann gefragt, welches der Speisen-Paare wohl besser schmecken würde.
Die Eltern der Kinder füllten darüber hinaus einen Fragebogen aus, in dem sie verschiedene Angaben machten: Zum Alter des Kindes und der ethnischen Zugehörigkeit, wie viel Fernseher es in der Wohnung gibt, ob im Kinderzimmer ein TV-Gerät steht, wie oft und wie lange das Kind fernsieht, wie oft man in der Familie McDonald's oder andere Schnellrestaurants besucht.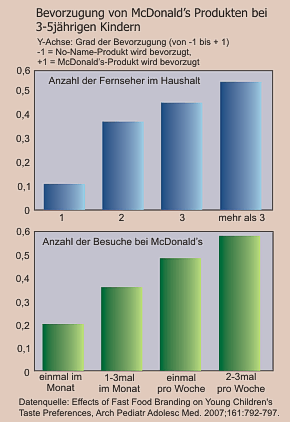
Bei den insgesamt durchgeführten Paarvergleichen ("Was schmeckt besser?") zeigte sich zunächst eine klare Überlegenheit der McDonald's Produkte, etwa 50-75% endeten zugunsten des Konzerns. Dabei war die Überlegenheit besonders groß bei Pommes Frittes (in 77% der Vergleiche pro McDonald's) und am schwächsten bei Hamburgern (48%). Auch in diesem Falle schnitt der Hamburger mit dem großen "M" jedoch noch besser ab als der No-Name-Konkurrent, der nur in 37% der Fälle bevorzugt wurden, bei 15% gab es ein Patt. Überraschend war auch, dass die Marken-Möhrchen mit 54% deutlich besser beurteilt wurden, obwohl es diese in McDonald's Filialen gar nicht gibt.
Besonders eindrucksvoll war für die Wissenschaftler jedoch (vgl. Abbildung), dass Kinder von der geschmacklichen Überlegenheit der McDonald's Produkte umso überzeugter waren, je mehr Fernseher in einer Familie liefen und je öfter die Eltern ihre Kinder in eins der Schnellrestaurants zum Essen mitnahmen.
Die Forscher bilanzieren ihren Befund mit einem Hinweis auf notwendige gesundheitspolitische Maßnahmen: "Unsere Ergebnisse bestätigen frühere Forschungsbefunde, die zeigen, dass Marken-Werbung die geschmacklichen Vorlieben jüngerer Kinder nachhaltig beeinflussen kann. (...) Die Ergebnisse bekräftigen noch einmal Empfehlungen, um das Marketing von Speisen und Getränken mit hoher Kalorienzahl und niedrigem Nährwert, das sich direkt an Kinder richtet, entweder ganz zu verbieten oder zumindest einzuschränken. Diese Initiative entstand aufgrund der Einsicht, dass Werbung, die an jüngere Kinder adressiert ist, überaus unfair ist, weil Kinder vor dem Alter von 7-8 Jahren nicht in der Lage sind, die verborgenen Botschaften und Suggestionen überhaupt zu erkennen."
Die Studie ist hier im Volltext kostenlos verfügbar: Effects of Fast Food Branding on Young Children's Taste Preferences (Arch Pediatr Adolesc Med. 2007;161:792-797.)
Hier ist das Abstract nachzulesen
Gerd Marstedt, 7.8.2007
Worst-Case bei der Prophylaxe gegen wiederholte kindliche Harnwegsinfektionen - Nur Nebenwirkungen, aber keine Wirkungen!?
 Wiederholte Harnwegsinfektionen treten bei Kleinkindern relativ häufig auf. In den USA wird geschätzt, dass dies bis zum 6. Lebensjahr bei 3 bis 7 % der Mädchen und 1 bis 2 % der Jungen der Fall ist.
Wiederholte Harnwegsinfektionen treten bei Kleinkindern relativ häufig auf. In den USA wird geschätzt, dass dies bis zum 6. Lebensjahr bei 3 bis 7 % der Mädchen und 1 bis 2 % der Jungen der Fall ist.
Trotz dieser Häufigkeit gibt es keine oder nur sehr kleine oder bereits ältere Studien über das Auftreten wiederholter Harnwegsinfektionen und auch nicht darüber, wie mit dieser Erkrankungsart im Primärversorgungsbereich umgegangen wird. Die Schätzungen über die Häufigkeit von erneuten Harnwegsinfektionen pendeln in den USA zwischen 20 und 48 % der Erstinfizierten in einem Zeitraum von 6 bis 12 Monaten nach der Erstinfektion. Auch wenn es sich dabei möglicherweise um durch Selektionsprozesse bedingte Überschätzungen handelt, ist diese Art von regelmäßigen, oft schmerzhaften "Dauer-Infektionen" eine Herausforderung an prophylaktische Bemühungen. Zu deren geläufigsten Mitteln gehört die antimikrobielle Prophylaxe.
Erstmals wurde nun in 27 primärärztlichen pädiatrischen Praxen in den drei US-Bundesstaaten Delaware, New Jersey und Pennsylvania bei 74.974 Kindern im Alter bis zu 6 Jahren, die zwischen 2001 und 2006 mindestens zweimal krank eine Klinik aufgesucht hatten, untersucht, wie oft diese einen ersten und weitere Harnwegsinfekte hatten. Dazu wurde untersucht, wie ihre antimikrobielle Prophylaxe aussah, ob es Infektionen mit resistenten Erregern gab und ob dies möglicherweise mit der antimikrobiellen vorbeugenden Behandlung zusammenhängt.
Die in dem Aufsatz "Recurrent Urinary Tract Infections in Children Risk Factors and Association With Prophylactic Antimicrobials" von Conway et al. gerade in "JAMA" veröffentlichten Ergebnisse sahen so aus:
• Von den 74.974 nach den genannten Kriterien beobachteten Kindern kamen 611 in die erste untersuchte Kohorte der Kinder mit einer ersten Harnwegsinfektion.
• 13,6 % dieser Gruppe bekamen es im Untersuchungszeitraum mehr als einmal mit einer Harnwegsinfektion zu tun.
• 20,9 % der Kinder erhielten bei ihrer ersten Harnwegsinfektion eine antimikrobielle Prophylaxe mit verschiedensten etablierten und neuen Wirkstoffen.
• 61 % der Kinder mit wiederholten Harnwegsinfektionen erkrankten an einem Erreger, der in der einen oder anderen Weise gegen antimikrobielle Intervention resistent waren.
• Die maßgeblichen Prädiktoren für eine Wiederholung einer Infektion waren nach uni- und multivariaten Analysen drei Faktoren: die Zugehörigkeit zur weißen Bevölkerung, ein Alter zwischen 3 und 5 Jahren und ein bestimmter Grad einer Erkrankung, bei der ein Teil des Urins nicht ausgeschieden wird, sondern von der Harnblase in Richtung Nieren fließt ("vesicoureteral reflux"). Die antibakterielle Prophylaxe mit Arzneimitteln ist dagegen kein Prädiktor für eine Folgeinfektion gewesen.
• Was sie allerdings stattdessen war, liest in dem Aufsatz der Forscher so: We found that antimicrobial prophylaxis was not associated with lower risk of recurrent UTI ("urinary tract infection") but was associated with increased risk of resistant infection."
Was diese von den Wissenschaftlern sehr zurückhaltend als "unfavorable risk/benefit ratio" bezeichneten Zusammenhänge für die weitere Behandlung kleinkindlicher Harnwegsinfekte bedeuten könnten, fassen sie so zusammen: "We think it is prudent for clinicians to discuss the risks and unclear benefits of prophylaxis with families as they make family-centered decisions about whether to start prophylactic antimicrobials or to closely monitor a child without prescribing antimicrobial prophylaxis after a first UTI."
Zu Recht weisen sie abschließend auf eine Reihe von möglichen Verzerrungen durch die Auswahl der untersuchten Kinder und auf die methodischen Grenzen ihres Studientyps, also einer Beobachtungsstudie hin. Die notwendigen weiteren Studien sollten aber durchaus die Brisanz der hier ermittelten Konstellation des gemeinsamen Auftretens von keinen erwünschten aber einigen unerwünschten Effekten einer Behandlung vor Augen haben.
Die komplette Studie Recurrent Urinary Tract Infections in Children Risk Factors and Association n With Prophylactic Antimicrobials von Patrick H. Conway; Avital Cnaan; Theoklis Zaoutis; Brandon V. Henry; Robert W. Grundmeier und Ron Keren ist in der Ausgabe der amerikanischen Fachzeitschrift JAMA vom 11. Juli 2007 (JAMA. 2007;298:179-186) erschienen und komplett und kostenlos als PDF-Datei herunterladbar.
Bernard Braun, 12.7.2007
16-17jährige trinken im Durchschnitt 2 Gläser Alkohol pro Tag: Alkoholkonsum bei Jugendlichen steigt 2007 wieder an
 Der Alkoholkonsum bei Jugendlichen ist nach einem Rückgang zwischen 2004 und 2005 im Jahr 2007 wieder deutlich angestiegen. Dies ist das Ergebnis einer jetzt von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) vorgestellten Repräsentativuntersuchung 2007 zum Alkoholkonsum Jugendlicher, an der 3.600 Jungen und Mädchen im Alter von 12-19 Jahren beteiligt waren. Der beobachtete Anstieg ist besonders auffällig bei den 16- bis 17-jährigen männlichen Jugendlichen. Bei den Jungen dieser Altersgruppe lag die durchschnittliche wöchentliche Trinkmenge an reinem Alkohol im Jahr 2004 bei 127 Gramm, sank im Jahr 2005 auf 108 Gramm und liegt im Jahr 2007 bei etwa 150 g reinem Alkohol im Wochendurchschnitt. Dies entspricht umgerechnet ca. 2 Gläsern alkoholischer Getränke an jedem Tag in der Woche. Auch bei den weiblichen Jugendlichen im Alter von 16 bis 17 Jahren ist zwischen 2005 und 2007 ein Anstieg in der wöchentlichen Gesamtalkoholmenge von 42 Gramm auf 53 Gramm festzustellen. Damit liegt die Trinkmenge in etwa wieder auf dem Niveau von 2004 - damals wurden im Wochendurchschnitt 54 g reiner Alkohol getrunken.
Der Alkoholkonsum bei Jugendlichen ist nach einem Rückgang zwischen 2004 und 2005 im Jahr 2007 wieder deutlich angestiegen. Dies ist das Ergebnis einer jetzt von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) vorgestellten Repräsentativuntersuchung 2007 zum Alkoholkonsum Jugendlicher, an der 3.600 Jungen und Mädchen im Alter von 12-19 Jahren beteiligt waren. Der beobachtete Anstieg ist besonders auffällig bei den 16- bis 17-jährigen männlichen Jugendlichen. Bei den Jungen dieser Altersgruppe lag die durchschnittliche wöchentliche Trinkmenge an reinem Alkohol im Jahr 2004 bei 127 Gramm, sank im Jahr 2005 auf 108 Gramm und liegt im Jahr 2007 bei etwa 150 g reinem Alkohol im Wochendurchschnitt. Dies entspricht umgerechnet ca. 2 Gläsern alkoholischer Getränke an jedem Tag in der Woche. Auch bei den weiblichen Jugendlichen im Alter von 16 bis 17 Jahren ist zwischen 2005 und 2007 ein Anstieg in der wöchentlichen Gesamtalkoholmenge von 42 Gramm auf 53 Gramm festzustellen. Damit liegt die Trinkmenge in etwa wieder auf dem Niveau von 2004 - damals wurden im Wochendurchschnitt 54 g reiner Alkohol getrunken.
Sowohl bei den Jungen als auch bei den Mädchen nimmt die Bereitschaft zu, innerhalb kürzerer Zeit mehr als fünf Gläser alkoholischer Getränke zu trinken. Dieses auch als "Binge Drinking" bezeichnete Verhalten ist ein Indikator für riskanten Alkoholkonsum. Jeder zweite Jugendliche im Alter von 16 bis 17 gibt Anfang 2007 an, im letzten Monat mindestens an einem Tag fünf oder mehr Gläser Alkohol getrunken zu haben. Im Jahr 2005 lag dieser Wert noch bei 40 Prozent der Jugendlichen.
Der Anstieg im Alkoholkonsum ist im Wesentlichen auf eine Zunahme im Trinken von Bier, Bier-Mixgetränken und von Spirituosen zurückzuführen. Die noch vor wenigen Jahren bei den Jugendlichen so populären Alkopops werden dagegen kaum noch getrunken. "Die Ergebnisse zeigen, dass die im Zusammenhang mit dem Anstieg des Alkopop-Konsums in den letzten Jahren ergriffen Maßnahmen Wirkung zeigen", betont Prof. Dr. Elisabeth Pott, Direktorin der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. "Durch das Zusammenspiel von gesetzgeberischen Regelungen und verstärkten Aufklärungsmaßnahmen konnte der Rückgang im Alkopop-Konsum erreicht werden. Die Ergebnisse zeigen aber auch, wie wichtig es ist, neue Entwicklungen zu beobachten und die bei den Alkopops erfolgreichen, umfassenden Präventionsstrategien auf den gesamten Bereich der Alkoholika auszuweiten", so Prof. Dr. Pott weiter.
Um frühzeitig Jugendliche zu erreichen und auf die negativen Folgen übermäßigen Alkoholkonsums aufmerksam zu machen, hat die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung während der Aktionstage zur Suchtwoche 2007 ihre Angebote auf die Sportvereine konzentriert. Darüber hinaus hat die BZgA umfangreiches Informationsmaterial für die Ärzteschaft und die Allgemeinbevölkerung zur Verfügung gestellt. Die Sportvereine sind wichtige Partner, da über sie viele Eltern, Kinder und Jugendliche sowie Multiplikatoren in der außerschulischen Jugendarbeit erreicht werden können. Neben dem Elternhaus und der Schule ist der Sport ein wichtiges Lernfeld, in dem die verschiedensten Fähigkeiten entwickelt und unterstützt werden können.
Die Studienergebnisse sind hier nachzulesen: BzgA: Alkoholkonsum der Jugendlichen in Deutschland 2004 bis 2007 (PDF, 19 Seiten)
Gerd Marstedt, 12.6.2007
KiGGS-Studie: Deutschen Kindern und Jugendlichen geht es gesundheitlich gut. Nur Kinder der Unterschicht und mit Migrationshintergrund stören das Bild.
 Das Robert-Koch-Institut hat jetzt erste Ergebnisse der bislang umfassendsten deutschen Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen KiGGS (Kinder- und Jugendgesundheitssurvey) veröffentlicht. In den Jahren 2003-2006 beteiligten sich insgesamt 17.641 Jungen und Mädchen an den Erhebungen, drunter vor allem schriftliche Befragungen, aber auch medizinische Untersuchungen und Leistungs-Tests, ein ärztliches Eltern-Interview, eine Probennahme von Blut und Urin sowie eine schriftliche Befragung der Eltern. Die Untersuchung wurde vom Bundesministerium für Gesundheit initiiert und mit 9,4 Millionen Euro zum größten Teil finanziert, das Bundesministerium für Bildung und Forschung beteiligte sich mit 2,5 Millionen Euro.
Das Robert-Koch-Institut hat jetzt erste Ergebnisse der bislang umfassendsten deutschen Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen KiGGS (Kinder- und Jugendgesundheitssurvey) veröffentlicht. In den Jahren 2003-2006 beteiligten sich insgesamt 17.641 Jungen und Mädchen an den Erhebungen, drunter vor allem schriftliche Befragungen, aber auch medizinische Untersuchungen und Leistungs-Tests, ein ärztliches Eltern-Interview, eine Probennahme von Blut und Urin sowie eine schriftliche Befragung der Eltern. Die Untersuchung wurde vom Bundesministerium für Gesundheit initiiert und mit 9,4 Millionen Euro zum größten Teil finanziert, das Bundesministerium für Bildung und Forschung beteiligte sich mit 2,5 Millionen Euro.
Insgesamt 41 Aufsätze mit knapp 400 Seiten wurden jetzt als "Basispublikation" im Bundesgesundheitsblatt veröffentlicht, Artikel die aber auch als PDF-Dateien auf der KiGGS-Website zum kostenlosen Download verfügbar sind. Die ersten Ergebnisse sind entweder methodischer Natur oder haben epidemiologischen Charakter, also beschreiben erst einmal nur die Verbreitung bestimmter Erkrankungen, Beschwerden oder gesundheitlicher Verhaltensweisen. Zusammenhangsanalysen etwa derart, ob und inwieweit das Ernährungs- oder Bewegungsverhalten von Kindern und Jugendlichen im Zusammenhang mit ihrem Gesundheitszustand steht, sind für später geplant. Die jetzige Bestandsaufnahme umfasst allerdings schon eine systematische Berücksichtigung von Einflussfaktoren wie Geschlecht, soziale Schichtzugehörigkeit und Migrationshintergrund im Elternhaus.
Und eben diese Berücksichtigung von Determinanten sozialer Ungleichheit zeigt bei fast jedem berücksichtigten Teilaspekt der Analyse deutliche Effekte, die auch von Gesundheitsministerin Ulla Schmid bei der Pressekonferenz nicht unerwähnt bleiben konnten: "Die vorliegenden Ergebnisse zeigen: Im Großen und Ganzen geht es den Kindern in Deutschland gut. Die meisten Kinder sind sportlich aktiv, normalgewichtig und ausgeglichen. Doch leider gibt es auch das genaue Gegenteil. Dies gilt besonders für Kinder aus sozial benachteiligten Familien und Familien mit Migrationshintergrund. Hier gibt es häufiger einen ungesunden Lebensstil, ein erhöhtes Unfallrisiko und auch Vorsorgeuntersuchungen werden seltener besucht. Daran müssen unsere Präventionsangebote in erster Linie ansetzen."
In wie starkem Maße soziale Ungleichheit, also Eltern mit Migrationshintergrund oder aus unteren Sozialschichten, auch die Gesundheit der Kinder negativ beeinträchtigt, zeigt eine schnelle tour d'horizon über einige Aufsätze mit Zitaten aus den dort formulierten Zusammenfassungen.
• Übergewicht und Adipositas: "Ein höheres Risiko für Übergewicht und Adipositas besteht bei Kindern aus Familien mit niedrigem Sozialstatus, bei Kindern mit Migrationshintergrund und bei Kindern, deren Mütter ebenfalls übergewichtig sind." Besonders deutlich zeigt sich dies im Alter von 7-10 Jahren. Adipös (BMI über 30) sind in dieser Gruppe 10% der Kinder aus unteren, aber nur 3% derjenigen aus oberen Sozialschichten, Kinder mit Migrationshintergrund sind zu 11% adipös, ohne sind es nur 5%. vgl. Die Verbreitung von Übergewicht und Adipositas bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland
• Körperlich-motorische Leistungsfähigkeit: (Erfasst wurden hier Reaktionszeit, seitliches Hin- und Herspringen, Rumpfbeweglichkeit, Fahrad-Ausdauertest usw.) "Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass zwischen Migrations- und Sozialstatus und der motorischen Leistungsfähigkeit ein Zusammenhang besteht. Die aufgezeigten Unterschiede verdeutlichen, dass mögliche Interventionsprogramme spezifisch auf Alter, Geschlecht sowie die Belange von Kindern und Familien mit Migrationshintergrund und mit niedrigem Sozialstatus abgestimmt werden sollten." vgl. Motorische Leistungsfähigkeit
• Verletzungen: "... zeigten sich jedoch bei den Verkehrsunfällen für ein- bis unter 18-jährige Mädchen und Jungen signifikant höhere Raten bei niedrigem Sozialstatus der Eltern verglichen zum hohen Sozialstatus. (...) Der Sozial- und Migrationsstatus zeigte in allen Altersgruppen einen signifikanten Zusammenhang mit niedrigen Tragequoten bezogen auf Helme und Protektoren. Die altersgruppenbezogene Datenanalyse sollte Ausgangspunkt für zielgruppenbezogene Präventionsmaßnahmen sein und insbesondere den Sozial- und Migrationsstatus berücksichtigen. Dabei sind Präventionsaktivitäten im Verkehrsbereich insbesondere auf Familien mit niedrigem Sozialstatus auszurichten." vgl. Verletzungen bei Kindern und Jugendlichen (1-17 Jahre) und Umsetzung von persönlichen Schutzmaßnahmen
• Psychische Probleme und Verhaltensauffälligkeiten: "Etwa 8,1 % der Befragten mit hohem sozioökonomischem Status, 13,4 % der mit mittlerem und 23,2 % der mit niedrigem Sozialstatus zeigen Hinweise auf psychische Probleme. Kinder mit Migrationshintergrund sind häufiger betroffen als Kinder von Nicht-Migranten." vgl. Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen
• Ess-Störungen: "Kinder und Jugendliche aus Familien mit niedrigem sozioökonomischem Status sind mit 27,6% fast doppelt so häufig betroffen wie solche aus Familien mit hohem Status (15,6%). Migranten weisen gegenüber Nicht-Migranten eine um ca. 50% erhöhte Quote auf." vgl. Essstörungen im Kindes- und Jugendalter
• Gewalt-Erfahrungen: "Mit 81,0% nie an Gewalthandlungen Beteiligter ist die Gewaltbelastung der Befragten mit hohem sozioökonomischem Status am geringsten gegenüber denen mit niedrigem (68,3%) und mittlerem Status (76,4%). Haupt- und Gesamtschüler sowie Jugendliche mit Migrationshintergrund sind häufiger als Täter von Gewalterlebnissen betroffen und haben permissivere Einstellungen zur Gewalt als Gymnasiasten, Realschüler und Nicht-Migranten. Soziale Benachteiligung und Migrationshintergrund sind mit erhöhter Gewaltbelastung und -bereitschaft von Jugendlichen assoziiert." vgl. Gewalterfahrungen von Kindern und Jugendlichen im subjektiven Selbstbericht
Es bleibt abzuwarten, inwieweit Bund und insbesondere Länder und Kommunen die in vielen Aufsätzen zu den KiGGS-Ergebnissen von den Wissenschaftlern geforderte Berücksichtigung gruppen- und schichtspezifischer Präventionsansätze tatsächlich ernst nehmen und es nicht nur bei (bislang durchweg erfolglosen) moralischen Appellen oder Konzepten zur Vermittlung von Wissen über Gesundheitsrisiken bewenden lassen.
Alle Aufsätze mit ersten Ergebnissen zur KiGGS-Studie sind hier als PDF-Dateien verfügbar: Die KiGGS-Basispublikation - Übersichtsseite mit Links zu allen Aufsätzen als PDF
Gerd Marstedt, 31.5.2007
Gesundheitliche Lebensqualität der us-amerikanischen Kinder und Jugendlichen 2006 am tiefsten Punkt seit 30 Jahren
 Bereits zum vierten Mal seit 2004 erschien in den USA im April 2007 der jüngste umfassende Bericht über die Lebensqualität von Kindern und Jugendlichen.
Bereits zum vierten Mal seit 2004 erschien in den USA im April 2007 der jüngste umfassende Bericht über die Lebensqualität von Kindern und Jugendlichen.
Dieser so genannte "Child Well-Being Index (CWI)" wird auf der Basis von 28 seit 1975 landesweit erhobenen Schlüsselindikatoren für sieben Kernbereiche der Lebensqualität gebildet. Die Daten stammen u.a. aus Erhebungen des U.S. Census Office, der Centers for Disease Control, dem National Center for Education Statistics und einer Reihe von Surveys. Verantwortlich für die Indexbildung und die Herausgabe des jährlichen Reports ist die "Foundation for Child Development".
Der CWI-Report 2007 kommt zunächst zu einer zurückhaltend positiven Generalaussage: Der Aufwärtstrend der Lebensqualitätsverbesserungen, der Anfang dieses Jahrzehnts und zwar im Jahre 2002 seinen Höhepunkt hatte, hat sich danach insgesamt nicht fortgesetzt, sondern insgesamt einen Stillstand erlebt.
Die "Sicherheit" der Kinder und Jugendlichen setzte aber beispielsweise ihren Aufwärtstrend fort, die Teenager-Schwangerschaften nahmen weiter ab, was auch für die Erfahrung von Gewaltkriminalität, Drogen- und Alkoholkonsum gilt. In den letzten sechs Jahren gab es beim Niveau der Gesamt-Lebensqualität keine gravierenden Ausschläge.
Völlig anders sieht aber die gesundheitliche Lebensqualität der Kinder und Jugendlichen aus: Sie ist in den 30 Jahren in denen sie erhoben wird, auf den niedrigsten Punkt gefallen. Die dabei am heftigsten treibenden Faktoren waren die Übergewichtigkeit der jungen US-Amerikaner und eine kleinere Abnahme der Kindersterblichkeit als dies in den letzten Jahren geschafft wurde.
Der CWI zeigt außerdem signifikante und hartnäckig existierende Ungleichheiten der gesundheitlichen Lebensqualität zwischen weißen, afro-amerikanischen und hispanischen Kindern. Obwohl die Trends in den ethnisch unterschiedlichen Gruppen von Kindern und Jugendlichen sowohl auf- als auch abwärts ähnlich verlaufen, hatten sie sich in den späten 1990er Jahren stärker angenähert. Dieser Trend setzt sich jetzt nicht fort.
Im Rückblick kommt der Report zu dem Schluss, dass es sich bei dem besten Indexwert im Jahr 2002 um eine Anomalie gehandelt hat, die auf den singulären Bedingungen nach dem 11. September 2001 beruht. So kümmerten sich offensichtlich Eltern und die Öffentlichkeit nach den Attentaten wesentlich intensiver um Kinder und Jugendliche, was sich u.a. in einer kräftigen Verbesserung des emotionalen und geistigen "well-beings" und einem hohen Niveau der sozialen Beziehungen als zwei weiteren von den sieben gemessenen Lebensaspekten niederschlug. Diese Werte rutschten in den Jahren danach wieder ab.
Der 21 Seiten umfassende, von Kenneth Land (Duke University, Durham) koordinierte "2007 Report of The Foundation for Child Development Child and Youth Well-Being Index (CWI), 1975-2005, with Projections for 2006. A composite index of trends in the well-being of America’s children and youth" kann hier als PDF-Datei heruntergeladen werden.
Bernard Braun, 31.5.2007
Regelmäßiger und mehrstündiger TV-Konsum von Jugendlichen in den USA mit schlechterem Bildungs-Outcome assoziiert!
 Eigentlich vermuteten und beschworen es aufmerksame Eltern und Lehrer schon immer: Zu viel Fernsehkonsum von Kindern und Jugendlichen im Pubertätsalter beeinträchtigt deren schulischen Erfolg, damit das mittelfristige Bildungsniveau sowie letztlich einen Teil der Lebenschancen der dann erwachsenen Personen. Nur so richtig nachgewiesen waren derartige Zusammenhänge nicht und daher verbringen immer noch viele Schulkinder viele nachmittägliche Stunden vor der "Glotze".
Eigentlich vermuteten und beschworen es aufmerksame Eltern und Lehrer schon immer: Zu viel Fernsehkonsum von Kindern und Jugendlichen im Pubertätsalter beeinträchtigt deren schulischen Erfolg, damit das mittelfristige Bildungsniveau sowie letztlich einen Teil der Lebenschancen der dann erwachsenen Personen. Nur so richtig nachgewiesen waren derartige Zusammenhänge nicht und daher verbringen immer noch viele Schulkinder viele nachmittägliche Stunden vor der "Glotze".
Ob dies wirklich zu den vermuteten negativen Folgen führt, versuchte jetzt eine prospektive Längsschnittstudie mit 648 Familien mit Kindern in diesem Alter in der "Children in the Community Study" im US-Bundesstaat New York innerhalb eines längeren Lebensabschnitt der Heranwachsenden zu klären. Dazu wurden die betreffenden Kinder im Alter von 14, 16 und 22 Jahren ausführlich nach ihrem Fernsehkonsum befragt und außerdem mit zwei altersangepassten Messmethoden (es handelt sich um das "Disorganizing Poverty Interview" und das "Diagnostic Interview Schedule for Children") auf Entwicklungs- und insbesondere Lern- und Ausbildungsschwierigkeiten hin untersucht.
Ein Team der u. a. an der New York University School of Medicine wissenschaftlich tätigen Psychiatern (Johnson/Cohen/Kasen/Brook) veröffentlichten jetzt in der Mai-Ausgabe der Fachzeitschrift "Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine" (2007; 161: 480-486) die wesentlichsten Ergebnisse.
Unter Kontrolle von Familiencharakteristika und früheren kognitiven Schwierigkeiten fanden die Forscher heraus, dass regelmäßiges Fernsehen von 14-jährigen Kindern Aufmerksamkeits- und Lernschwierigkeiten und letztlich Lernversagen nach sich zog. Jugendliche, die täglich 3 und mehr Stunden Fernsehsendungen ansahen verfehlten mit einer rund zweimal höheren Wahrscheinlichkeit die Ausbildungsmöglichkeiten nach Beendigung der Highschool als diejenigen ihrer Altersgenossen, die täglich weniger als eine Stunde vor dem Fernseher saßen (odds ratio 3.06, 95% Konfidenzintervall: 1.62-5.78).
Die Autoren wiesen auch das beliebte abmildernde Argument, der Konsum umfasse nicht nur die typischen Produkte des "Unterschichten-Fernsehens", sondern auch Bildungsprogramme - sei also sogar positiv zu bewerten, zurück: "It is important to note that although there is evidence indicating that educational programming may have positive effects on cognitive development during childhood, our findings suggest that the benefits of educational programming during childhood may tend to be outweighed by frequent viewing of entertainment and general audience programs during adolescence."
Angesichts der sich aus Ausbildungsdefiziten ergebenden potenziell lebenslänglichen Folgen empfahlen die Autoren u.a. den Gesundheitsversorgern, die Jugendlichen zu motivieren, deutlich unter 3 Stunden pro Tag fernzusehen.
Ein Abstract des Aufsatzes von Johnson et al. "Extensive Television Viewing and the Development of Attention and Learning Difficulties During Adolescence" können sie hier kostenlos herunterladen.
Bernard Braun, 10.5.2007
Jugendliche Raucher sind häufiger schlechte Schüler, Streithälse, Rauschtrinker
 Studien zur Häufigkeit des Rauchens bei Jugendlichen gibt es viele. Auch in Deutschland wurden in den letzten Jahren Ergebnisse mehrerer Befragungen hierzu veröffentlicht (Links und Downloads siehe unten). Eine jetzt veröffentlichte Studie der DAK hat jedoch nicht nur ausgezählt, wie viele Mädchen oder Jungen in welchem Alter wie viele Zigaretten pro Tag rauchen, sondern auch versucht, das sozialpsychologische Profil, den familiären Hintergrund und Motive jugendlicher Raucher zu erhellen. Herausgekommen sind dabei einige empirische Ergebnisse, die so noch nicht bekannt waren und überraschen.
Studien zur Häufigkeit des Rauchens bei Jugendlichen gibt es viele. Auch in Deutschland wurden in den letzten Jahren Ergebnisse mehrerer Befragungen hierzu veröffentlicht (Links und Downloads siehe unten). Eine jetzt veröffentlichte Studie der DAK hat jedoch nicht nur ausgezählt, wie viele Mädchen oder Jungen in welchem Alter wie viele Zigaretten pro Tag rauchen, sondern auch versucht, das sozialpsychologische Profil, den familiären Hintergrund und Motive jugendlicher Raucher zu erhellen. Herausgekommen sind dabei einige empirische Ergebnisse, die so noch nicht bekannt waren und überraschen.
Basis der Studie war eine Befragung von 1.738 Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 7 bis 13 (mittleres Alter: 15,4 Jahre) aus zwölf Schulen Schleswig-Holsteins. Vorgegeben war ein Fragebogen, der während des Unterrichts zu beantworten war. Die Autoren der Studie (Dr. Matthis Morgenstern, Dr. Gudrun Wiborg und PD Dr. Reiner Hanewinkel) heben folgende Ergebnisse ihrer Untersuchung ganz besonders hervor.
1.) Jugendliche Raucher/innen zeichnen sich durch ein besonderes sozialpsychologisches Profil aus: Sie legen häufiger einen problematischen Alkoholkonsum (Rauschtrinken) an den Tag, fühlen sich in der Schule weniger wohl und sind häufiger auch Schüler mit unterdurchschnittlichen Leistungen und schlechteren Zensuren. Ihre Freizeit verbringen Sie öfter mit Fernsehen und am Computer. Im Verhalten neigen sie stärker zu Aggressivität und Aufsässigkeit, sie sind schneller gelangweilt und suchen nach aufregenden Erlebnissen ("Sensation Seeking").
2.) Mädchen sind seltener als Jungen tägliche Raucher/innen. Bei männlichen Jugendlichen wird die erste Zigarette des Tages schon binnen einer Stunde nach dem Aufstehen geraucht, so dass Jungen ein insgesamt höheres Maß an körperlicher Abhängigkeit aufweisen. Mädchen scheinen demgegenüber eher psychisch abhängig zu sein. Deutlich wird dies auch an der Unzufriedenheit mit der eigenen Figur und Sorgen um ihr Gewicht. Sie versuchen Hungergefühle durch das Rauchen zu unterdrücken und rauchen teilweise ganz bewusst, um abzunehmen.
3.) Die Studie hat gezeigt, dass das Rauchverhalten der Eltern und Geschwister, die Einstellung der Eltern gegenüber dem Rauchen und insbesondere auch Rauchverbote in der Wohnung der Jugendlichen einen erheblichen Einfluss darauf haben, ob auch die Kinder rauchen. Klare Regeln, so folgern die Wissenschaftler, können das Rauchverhalten der Kinder beeinflussen.
Ergebnisse der Studie im Einzelnen:
• 63% der nicht rauchenden Schüler, aber nur 45% der rauchenden Schüler, geben an, dass ihre Eltern das Rauchen lästig finden würden. Eine Strafe fürs Rauchen erwarten 27% der rauchenden, aber 43% der nicht rauchenden Schüler/innen.
• 54% der nicht rauchenden Schüler/innen sagen, dass Besucher gar nicht oder nur draußen, auf dem Balkon oder im Garten rauchen dürfen, bei den rauchenden Schülern berichten dies lediglich 43%.
• Raucher/innen zeigen ein anderes Freizeitverhalten als ihre nicht rauchenden Altersgenossen: Sie sehen an Schultagen mehr Fernsehen, Videos oder DVDs und verbringen mehr Zeit am Computer als nicht rauchende Schülerinnen und Schüler.
• Erfasst man im Fragebogen die Renitenz oder die Sensationssuche in der Freizeit, dann zeigt sich: Rauchende Jugendliche stimmen in stärkerem Maße Aussagen zu wie "Ich streite mich oft mit anderen", "Es macht mir Spaß, mich nicht an die Regeln zu halten" oder "Ich denke oft, es gibt nichts zu tun".
• Rauchende Jugendliche neigen deutlich häufiger zum "Rauschtrinken" (binge-drinking). So geben 62% der rauchenden Schüler an, im letzten Monat mindestens einmal fünf oder mehr Gläser Alkohol direkt hintereinander getrunken zu haben (Nichtraucher: 20%). Besonders stark ist dieser Unterschied bei den 11- bis 15-Jährigen, in dieser Gruppe ist die Häufigkeit für "binge drinking" bei den rauchenden Schülern sogar fast fünf Mal so hoch wie bei den nicht rauchenden Schülern (52% vs. 11%).
• Raucher/innen fühlen sich in der Schule häufiger nicht wohl (33% zu 22%) und geben an, schlechtere Schulleistungen zu haben. 71% von ihnen berichten über schlechte oder nur durchschnittliche Noten im letzten Schuljahr, bei Nichtrauchern sind dies nur 56%.
• Der Großteil der jugendlichen Raucher (61%) gibt dabei an zu rauchen, um die eigene Stimmung zu verbessern, wobei dies etwas häufiger von Mädchen genannt wird als von Jungen (54% : 70%). Der Wunsch, abzunehmen oder zumindest nicht zuzunehmen, ist für Mädchen überaus bedeutsam. Ähnlich geben Mädchen deutlich häufiger als Jungen an, zu rauchen, anstatt zu essen (35% vs. 22%)
Hier findet man die DAK-Studie zum Download: Rauchen im Jugendalter: Geschlechtsunterschiede, Rolle des sozialen Umfelds, Zusammenhänge mit anderen Risikoverhaltensweisen und Motivation zum Rauchstopp - Ergebnisse einer Schülerbefragung (PDF, 13 Seiten)
Pressemitteilungen der DAK zur Studie sind hier: "Just be smokefree" 2007
Weitere Studien zum Rauchen bei Jugendlichen:
• BzgA: Förderung des Nichtrauchens, Wiederholungsbefragung, Mai 2006
• Erste Ergebnisse der KiGGS-Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland
• Ergebnisse der HBSC-Jugendgesundheitsstudie 2002 im Auftrag der WHO (PDF, 570 KB)
• HBSC: Internationale Studie zum Gesundheitsverhalten von Schülerinnen und Schülern (PDF, 767 KB)
Gerd Marstedt, 19.4.2007
Jedes fünfte deutsche Kind ist psychisch erkrankt: Ursachen sind elterliches Erziehungsversagen und schulischer Leistungsdruck
 In einem jetzt veröffentlichten Bericht hat der Berufsverband Deutscher Psychologen versucht, ein umfassendes Bild der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland zu erstellen. In mehreren Aufsätzen von Wissenschaftlern unterschiedlicher Universitäten werden der aktuelle Forschungsstand bilanziert und gesundheitspolitische Empfehlungen ausgesprochen, für Politiker, aber auch Kinderärzte, Lehrer und Psychotherapeuten.
In einem jetzt veröffentlichten Bericht hat der Berufsverband Deutscher Psychologen versucht, ein umfassendes Bild der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland zu erstellen. In mehreren Aufsätzen von Wissenschaftlern unterschiedlicher Universitäten werden der aktuelle Forschungsstand bilanziert und gesundheitspolitische Empfehlungen ausgesprochen, für Politiker, aber auch Kinderärzte, Lehrer und Psychotherapeuten.
Ein wichtiges Ergebnis der Forschungsbilanz wird darin gesehen, dass etwa 15-25% der Kinder psychische Störungen aufweisen. Allerdings ist die Aussage "Jedes fünfte deutsche Kind ist psychisch erkrankt" nach Meinung der Forscher zu relativieren, weil nur in etwa der Hälfte der Fälle die Störungen über einen längeren Zeitraum andauern. In den übrigen Fällen sind sie nach einer bestimmten Zeit von selbst "verschwunden". Festzuhalten aber gleichwohl, dass zumindest 5% der Kinder dauerhafte Symptome aufweisen und etwa die gleiche Zahl noch einmal als "dringend behandlungsbedürftig" eingeschätzt wird - in Deutschland sind das rund 320.000 Betroffene.
Die Wissenschaftler setzen sich mit verschiedenen Erklärungsversuchen auseinander, die auf veränderte Bedingungen des Heranwachsens in unserer Gesellschaft abzielen. So wird häufig die zunehmende Situation des Lebens als Einzelkind genannt oder auch der steigende Fernsehkonsum. Beide Faktoren haben sich jedoch in unterschiedlichen Studien nicht als bedeutsamer negativer Faktor für die psychische Entwicklung von Kindern und Jugendlichen erwiesen.
Dies trifft jedoch für zwei andere Aspekte zu, schulischer Leistungsdruck und elterliches Erziehungsversagen. Für beide Aspekte zeigt sich in Studien, dass sie für die gesundheitliche Entwicklung überaus negative Folgen haben können. Dass in der Schule heute erheblich mehr Leistungen verlangt werden, zeigt beispielsweise eine Studie, die sich mit den veränderten Anforderungen im Mathematikunterricht beschäftigt hat. Zugleich sind die Erwartungen und Ansprüche von Eltern erheblich gewachsen: Etwa 40-60% aller Eltern erwarten von Ihren Kindern, dass sie das Abitur schaffen. Eltern aus oberen Sozialschichten erwarten dies sogar zu 90%.
Im Bericht finden sich neben gesundheitspolitischen Empfehlungen insgesamt zehn Aufsätze, die den Forschungsstand zur psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in unterschiedlicher Perspektive bilanzieren:
• Psychische Störungen im Kindes- und Jugendalter: Gesundheitliche Lage, gesundheitliche Versorgung und Empfehlungen
• Die psychische Lage der Kinder heute
• Depressionen bei Kindern und Jugendlichen
• Zu den psychosozialen Folgen für Kinder in veränderten familiären Rahmenbedingungen und neue Lebensformen von Erwachsenen
• Qualitätssicherung für Programme zur Gewaltprävention und Gewaltverminderung
• Die Wirksamkeit von Frühförderung bei Entwicklungsstörungen
• Hochbegabung
• Suchtkranke Kinder als Abbild gesellschaftlicher Phänomene
• Integration der Elternarbeit in die gesunde Schule
• Psychotherapeutische Versorgung psychisch kranker Kinder und Jugendlicher am Beispiel Bayern
Der Bericht steht hier als Download zur Verfügung: Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen e.V.: Bericht zur Kinder- und Jugendgesundheit in Deutschland (PDF, 110 Seiten)
Gerd Marstedt, 3.4.2007
Alkohol und Drogen, Ängste und Suizidversuche bei Jugendlichen: Eltern unterschätzen Probleme ihrer Kinder massiv
 Die Legende von der unbeschwerten, sorgenfreien Kindheit und Jugend ist durch mehrere wissenschaftliche Studien seit längerem widerlegt. In einer jetzt veröffentlichen Befragung von knapp 6.000 Schülern und deren Eltern wurde noch einmal deutlich, welch massive Probleme ein erheblicher Teil der Schüler in diesem Alter (meist 14-16 Jahre) hat und wie stark dies Tendenzen zum Alkohol- und Drogenkonsum, aber auch zu Selbstverletzungen und Suizidversuchen begünstigt. Neu ist aber die aus der Studie gewonnene Erkenntnis, dass Eltern diese Probleme und auch das gesundheitliche Risikoverhalten ihrer Kinder massiv unterschätzen, also entweder gar nicht wahrnehmen und leugnen oder aber als "normale" und vorübergehende Entwicklung herunterspielen.
Die Legende von der unbeschwerten, sorgenfreien Kindheit und Jugend ist durch mehrere wissenschaftliche Studien seit längerem widerlegt. In einer jetzt veröffentlichen Befragung von knapp 6.000 Schülern und deren Eltern wurde noch einmal deutlich, welch massive Probleme ein erheblicher Teil der Schüler in diesem Alter (meist 14-16 Jahre) hat und wie stark dies Tendenzen zum Alkohol- und Drogenkonsum, aber auch zu Selbstverletzungen und Suizidversuchen begünstigt. Neu ist aber die aus der Studie gewonnene Erkenntnis, dass Eltern diese Probleme und auch das gesundheitliche Risikoverhalten ihrer Kinder massiv unterschätzen, also entweder gar nicht wahrnehmen und leugnen oder aber als "normale" und vorübergehende Entwicklung herunterspielen.
Diese Ergebnisse stammen aus der Heidelberger Studie "Lebenssituationen und Verhalten von Jugendlichen", einer repräsentativen Befragung von Schülerinnen und Schüler der 9. Klassenstufe allgemeinbildender Schulen in Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis. Geplant und durchgeführt wurde die Studie vom Universitätsklinikum, der Pädagogischen Hochschule und dem Gesundheitsamt Heidelberg. An der Befragung haben 5.832 Jugendliche und ein großer Teil ihrer Eltern (3.413) teilgenommen. Die Befragung fand jetzt nach 1996 und 2000 zum dritten Mal statt. Ziel der Studie war es, Daten zur Lebenssituation, zum Freizeitverhalten und zum Gesundheitsverhalten (Alkohol, Rauchen, Drogen), zu psychischem Befinden und Problemen von Jugendlichen aus ihrer eigenen Sicht und der von Eltern und Lehrern zu gewinnen.
Unzufriedenheit der Mädchen mit ihrem Körpergewicht: Die Ergebnisse der Befragung bestätigen zunächst, was schon in anderen Jugendstudien zutage gekommen war, zuletzt etwa in der Umfrage der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: Themenheft "Körper". Etwa 50% aller Mädchen und 22% der Jungen fühlen sich zu dick und haben bereits Diäterfahrungen gemacht, obwohl nur 11% der Mädchen und 13% der Jungen tatsächlich übergewichtig sind. Obwohl die Jungen im Durchschnitt einen höheren "Body Mass Index" (Kennzahl aus Größe und Gewicht) als die Mädchen aufweisen und auch häufiger die Kriterien für Übergewicht erfüllen, fällt die körperbezogene Selbsteinschätzung der Mädchen weitaus ungünstiger aus, denn die Hälfte aller Mädchen fühlt sich zu dick, obwohl dies nur für jede Zehnte tatsächlich zutrifft. Außerdem hat mehr als die Hälfte der Mädchen bereits Diäterfahrungen gesammelt, jede vierte Schülerin (25%) sogar mehrfach. Die Wissenschaftler erkennen hier Effekte der in den Medien propagierten Schönheitsideale, die immer öfter bewirken, dass Mädchen mit körperlichen Erscheinungsbild unzufrieden sind oder sogar Minderwertigkeitsgefühle entwickeln. Die oben erwähnte Studie der BzgA kam sogar zu dem Ergebnis, dass für jedes sechst Mädchen deshalb u.U. auch eine Schönheitsoperation denkbar ist.
Erfahrungen mit Alkohol, Tabak, aber auch illegalen Drogen sind bei den befragten Schülern und Schülerinnen recht weit verbreitet: 16% der Jugendlichen rauchen täglich, 18% der Jungen und 10% der Mädchen trinken wöchentlich Alkohol, 15% der Jungen und 10% der Mädchen hatten bereits Umgang mit illegalen Drogen. Erhöhter Suchtmittelkonsum geht durchweg mit geringerem Leistungsverhalten, weniger Schulerfolgen und schlechteren Schulnoten einher. Bei Schüler/-innen, die bereits eine Klasse wiederholt haben, steigt der Anteil täglicher Raucher/innen auf das 3- bis 5-fache an. Auch der regelmäßige Alkohol- und Drogenkonsum ist bei Schüler/-innen mit Klassenwiederholung im Vergleich zu Jugendlichen ohne Klassenwiederholung um das 2- bis 3-fache erhöht.
Absichtliche Selbstverletzungen in Form von Ritzen, Schneiden, Verbrennungen beifügen etc. berichten 10% der Jungen und 20% der Mädchen. Bei den meisten Betroffenen sind dies einzelne Vorkommnisse (1- bis 3-mal im Jahr). Wiederholte bis regelmäßige Selbstverletzungen (mehr als 3 Mal pro Jahr) berichten 2% der Jungen und 6% der Mädchen. Mit einer ähnlichen Häufigkeit wie Selbstverletzungen werden von 10% der Jungen und 20% der Mädchen ernsthafte Selbstmordgedanken berichtet. Bei etwa 5% der Jungen und 11% der Mädchen kam es nach eigenen Angaben auch zu einem Selbstmordversuch. Die Suizidversuche bleiben meist unentdeckt bzw. werden von den Eltern nicht wahrgenommen
Die Wissenschaftler erfassten mit Hilfe von Fragebögen auch, in welchem Ausmaß die Schüler/innen von Sorgen, Ängsten und selbst so wahrgenommenen Verhaltensauffälligkeiten (Aggressivität, Aufmerksamkeitsstörungen usw.) betroffen sind. Dabei wurde auch deutlich, dass die beobachteten Flucht- und Bewältigungsstrategien (Alkohol, Drogen, Selbstverletzungen) umso größer sind, je mehr die Jugendlichen von Problemen und seelischen Schwierigkeiten berichten.
Besonders auffällig sind in dem Bericht jedoch Befragungsergebnisse, die zeigen, dass Eltern die Sorgen ihrer Kinder und problematische Verhaltensweisen massiv unterschätzen:
• Während nur ein Drittel der befragten Eltern angibt, dass ihr Kind zumindest gelegentlich Alkohol zu sich nimmt, sind dies bei den Kindern selbst doppelt so viele.
• Dasselbe Bild zeigt sich für den Drogenkonsum: Nur 1% der Eltern gibt zu, dass das Kind zumindest gelegentlich Drogen einnimmt, bei den betroffenen Mädchen sind dies jedoch erheblich mehr, nämlich 8%, bei Jungen sogar 11%.
• Selbstverletzungen (Ritzen, Schneiden usw.) werden von den Eltern meist gar nicht wahrgenommen.
• Selbst berichtete Probleme der Jugendlichen wie Ängste und depressive Verstimmungen, Tendenzen zu einem sozialen Rückzug, Aufmerksamkeitsstörungen, soziale Kontaktprobleme, aggressives Verhalten sind (gemessen anhand eines Fragebogens) doppelt so groß wie entsprechende Einschätzungen der Eltern, und zwar bei Jungen wie bei Mädchen.
Diese Diskrepanz zwischen Eltern- und Jugendlichen-Wahrnehmung zeigt, dass die Eltern entweder die Problembelastungen der Jugendlichen wesentlich banaler schätzen als die Jugendlichen selbst oder dass sie über die Probleme der Jugendlichen nur sehr unzureichend informiert sind und bestimmte Warnsignale nicht wahrnehmen wollen oder können. Die Wissenschaftler weisen daher auf einen dringenden "Diskussions- und Handlungsbedarf hinsichtlich der beiden für diesen Altersbereich wesentlichen Sozialisationsinstanzen Familie und Schule".
Hier ist der komplette Bericht (PDF, 97 Seiten): Lebenssituation und Verhalten von Jugendlichen - Ergebnisse einer Befragung 14 bis 16-jähriger Jugendlicher und deren Eltern im Jahr 2005
Gerd Marstedt, 2.3.2007
Sexualisierungstendenzen in Medien und Werbung beeinträchtigen die seelische und körperliche Entwicklung vieler junger Mädchen
 Sexistische Fotos von Frauen und jungen Mädchen in der Werbung und in den Medien sind bislang vor allem auf Kritik gestoßen, weil dies die Würde der Frauen beeinträchtigt, sie zu reinen Sexualobjekten degradiert und damit auch die noch weitgehend unerreichten gesellschaftlichen Ziele der Gleichberechtigung von Männern und Frauen unterläuft. Eine jetzt von der American Psychological Association (APA) veröffentlichte Studie hat jetzt jedoch deutlich gemacht, dass die zunehmende Sexualisierung auch überaus bedenkliche Folgen hat für das gesundheitliche Wohlergehen und die psychosoziale Entwicklung vieler junger Mädchen.
Sexistische Fotos von Frauen und jungen Mädchen in der Werbung und in den Medien sind bislang vor allem auf Kritik gestoßen, weil dies die Würde der Frauen beeinträchtigt, sie zu reinen Sexualobjekten degradiert und damit auch die noch weitgehend unerreichten gesellschaftlichen Ziele der Gleichberechtigung von Männern und Frauen unterläuft. Eine jetzt von der American Psychological Association (APA) veröffentlichte Studie hat jetzt jedoch deutlich gemacht, dass die zunehmende Sexualisierung auch überaus bedenkliche Folgen hat für das gesundheitliche Wohlergehen und die psychosoziale Entwicklung vieler junger Mädchen.
Für den jetzt vorgestellten 72seitigen Bericht wurde eine Vielzahl von Veröffentlichungen bilanziert, in denen Auswirkungen sexistischer Fotos und Werbebotschaften auf die intellektuelle und emotionale Entwicklung von Mädchen und jungen Frauen untersucht worden waren, aber auch Effekte für ihre psychische und körperliche Gesundheit. Darüber hinaus wurde eine Vielzahl von Beispielen gesammelt, in welchen Lebensbereichen und Alltagssituationen heute der kritisierte Sexualisierungstrend überall vorzufinden ist: In Zeitschriften und Werbespots, in Texten der Popmusik, in Filmen und Musikvideos, im Internet und in PC-Spielen. Dabei werden auch viele Untersuchungen aufgeführt, die verdeutlichen, in welchem Maße die Sexualisierung in den letzten Jahrzehnten zugenommen hat.
Besonders problematisch erscheint den Psychologen, dass zunehmend auch Kinder zu direkten Adressaten der Werbebotschaften gemacht werden. Junge Mädchen werden tagtäglich mit Bildern konfrontiert, die perfekt gestylte Models und hochattraktive Popsängerinnen zeigen, Frauen, die reduziert sind auf einen perfekt schönen Körper. Andere Dimensionen der Persönlichkeit werden völlig ausgeblendet, so dass sich bei vielen jüngeren Betrachterinnen der Eindruck festsetzt, dass allein körperliche Attraktivität ausschlaggebend ist für Wertschätzung, soziale Anerkennung oder Erfolg im Leben. Effekt davon ist in vielen Fällen ein mangelhaftes Selbstwertgefühl und negatives Selbstbild, auf längere Sicht oftmals auch der Beginn gesundheitlicher Krisen. Ebenso wird das Verhältnis der Mädchen und jungen Frauen zu ihrer eigenen Sexualität nachhaltig beeinträchtigt. Zitiert wird von den Wissenschaftlern eine Studie, in der Tagebücher junger Mädchen aus den letzten 100 Jahren ausgewertet wurden. Es zeigte sich, dass Mädchen ihr Erwachsenwerden früher einmal vorwiegend durch Fortschritte in der Schule und eine Erweiterung ihrer Kenntnisse beschrieben, in den letzten 20 Jahren jedoch vornehmlich über körperliche Veränderungen und Verbesserungen ihrer körperlichen Attraktivität.
Die Wissenschaftler referieren eine große Zahl wissenschaftlicher Untersuchungen, die zeigen, dass die Sexualisierung in drei Bereichen überaus negative Effekte für viele weibliche Jugendliche hervorbringt:
• Kognitive und emotionale Folgen beeinträchtigen das Vertrauen in den eigenen Körper und die Zufriedenheit mit dem eigenen äußeren Erscheinungsbild, was zu Ängsten, Schamgefühlen und Selbstzweifeln führt. So haben mehrere Untersuchungen gezeigt, dass junge Mädchen, denen man Videos oder Fotos von Topmodels präsentiert hatte, oder denen man Zeitschriften-Titelseiten vorführte mit stark sexbetonten Schlagzeilen, später sehr viel mehr Selbstzweifel und Ängste aufwiesen als Kontrollgruppen.
• Körperliche und seelische Gesundheit: Viele Studien zeigen auf, dass Sexualisierungs-Erfahrungen bei Mädchen und Frauen Ursache sein können für Essstörungen (Magersucht, Bulimie), ein herabgesetztes Selbstwertgefühl oder Depressionen.
• Sexuelle Entwicklung: Forschungsstudien zeigen, dass Sexualisierungstendenzen ein gesundes, selbstbewusstes und natürliches Verhältnis zur eigenen Sexualität nachhaltig beeinträchtigen. So zeigen mehrere Studien, dass Mädchen und junge Frauen, die mit ihrem Aussehen sehr unzufrieden sind, zugleich auch sexuell deutlich enthaltsamer sind und Situationen scheuen bzw. sogar systematisch vermeiden, bei denen es zu körperlicher Nähe mit Jungen kommen könnte.
Hier ist eine Pressemitteilung mit den wichtigsten Befunden:
Sexualization Of Girls Is Linked To Common Mental Health Problems In Girls And Women—Eating Disorders, Low Self-Esteem, And Depression; An Apa Task Force Reports
Der Bericht im Volltext ist hier zu finden (PDF, 72 Seiten):
Report of the APA Task Force on the Sexualization of Girls - Psychologists call for replacing sexualized images of girls in media and advertising with positive ones
Gerd Marstedt, 24.2.2007
Lebensbedingungen der Kinder in Industrieländern: Deutschland nur Mittelmaß
 Ein neuer UNICEF-Bericht zum Wohlergehen und zu Lebensbedingungen von Kindern in Industrieländern zeichnet ein deprimierendes Bild für Deutschland, das im Vergleich mit insgesamt 21 Ländern unter dem Strich nur auf Rang 11 landet. Untersucht wurden anhand international verfügbarer Statistiken und Umfragen Daten zu sechs wichtigen Indikatoren: materielle Situation, Gesundheit, Bildung, Beziehungen zu Eltern und Gleichaltrigen, Lebensweise und Gesundheitsverhalten sowie eigene Einschätzungen der Kinder und Jugendlichen. Die Niederlande führen die UNICEF-Tabelle als kinderfreundlichstes Land an, gefolgt von Schweden, Dänemark, Finnland, Spanien, Schweiz und Norwegen. Am unteren Ende der Rangskala liegen (in dieser Reihenfolge) Tschechien, Frankreich, Portugal, Österreich, Ungarn, Großbritannien und die USA. Deutschland liegt bei der Gesamtbewertung der sechs Indikatoren genau in der Mitte.
Ein neuer UNICEF-Bericht zum Wohlergehen und zu Lebensbedingungen von Kindern in Industrieländern zeichnet ein deprimierendes Bild für Deutschland, das im Vergleich mit insgesamt 21 Ländern unter dem Strich nur auf Rang 11 landet. Untersucht wurden anhand international verfügbarer Statistiken und Umfragen Daten zu sechs wichtigen Indikatoren: materielle Situation, Gesundheit, Bildung, Beziehungen zu Eltern und Gleichaltrigen, Lebensweise und Gesundheitsverhalten sowie eigene Einschätzungen der Kinder und Jugendlichen. Die Niederlande führen die UNICEF-Tabelle als kinderfreundlichstes Land an, gefolgt von Schweden, Dänemark, Finnland, Spanien, Schweiz und Norwegen. Am unteren Ende der Rangskala liegen (in dieser Reihenfolge) Tschechien, Frankreich, Portugal, Österreich, Ungarn, Großbritannien und die USA. Deutschland liegt bei der Gesamtbewertung der sechs Indikatoren genau in der Mitte.
Es zeigt sich, dass die Wirtschaftsleistung eines Landes allein genommen nicht über die materielle Situation der Kinder entscheidet: So steht Tschechien in dieser Hinsichtlich besser da als Deutschland, Italien oder Japan. Armut und eine schlechte Lebenssituation sind dabei nicht nur am geringen Einkommen der Eltern fest zu machen. So rechnen in Deutschland, Frankreich und Großbritannien mehr als 30 Prozent der Jugendlichen damit, keine anspruchsvolle Arbeitsstelle zu finden. Mehr als die Hälfte der 15-jährigen Deutschen sagen, dass ihre Eltern kaum Zeit haben, sich mit ihnen zu unterhalten. In Italien macht nur etwa ein Viertel der Jugendlichen diese Erfahrung.
Weitere Ergebnisse der Studie:
• Den geringsten Anteil von Kindern, die in relativer Armut aufwachsen, haben die vier skandinavischen Länder. Deutschland liegt auf dem 10.Rang.
• Besonders negativ fällt das gesundheitliche Risikoverhalten deutscher Jugendlicher auf. Hier liegt Deutschland vor Großbritannien auf dem vorletzten Platz. Hauptgrund ist das Rauchen. Etwa jeder zehnte 15-Jährige in den Industrieländern raucht mindestens einmal pro Woche. In Deutschland sind es sogar mehr als 16 Prozent - trauriger Spitzenplatz, in keinem anderen Land rauchen so viele junge Menschen.
• Beim Alkoholkonsum geben in Großbritannien fast ein Drittel der befragten Kinder und Jugendlichen zwischen 11 und 15 Jahren an, zweimal oder öfter betrunken gewesen zu sein. In Deutschland sind es über 16 Prozent - in Frankreich und Italien unter 10 Prozent.
• Beim Untersuchungsaspekt "Beziehungen in der Familie" beantworteten 15jährige die Fragen: "Wie oft essen Eure Eltern die Hauptmahlzeit zusammen mit Euch gemeinsam am Tisch?" und "Wie oft nehmen sich Eure Eltern Zeit, um einfach nur mit Euch zu reden?" In der Gesamtwertung dieser Dimension kommt Deutschland auf den unterdurchschnittlichen Platz 13. Bei weitem führend sind hier Italien und Portugal.
Die vorliegenden Daten machen aber auch ein enormes Gefälle zwischen den einzelnen Bundesländern deutlich. In den Ländern am unteren Ende der Rangliste - Bremen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin - häufen sich die negativen Entwicklungen für Kinder.
Die UNICEF-Studie untersucht die Situation von Kindern in Industrieländern in sechs Dimensionen mit jeweils drei Kategorien, unter anderem:
• Materielle Situation (Relative Einkommensarmut, Arbeitslosigkeit der Eltern, Mangelsituationen)
• Gesundheit (Säuglingssterblichkeit und Geburtsgewicht, Anteil geimpfter Kinder, Unfälle und Verletzungen)
• Beziehungen zu Eltern und Gleichaltrigen (Familienstruktur, Familienalltag, Beziehungen zu Gleichaltrigen)
• Lebensweise und Risiken (Gesunde Lebensweise, Risikoreiches Verhalten, Erfahrungen mit Gewalt)
Hier ist eine Zusammenfassung der wichtigsten Studienergebnisse (PDF, 12 Seiten):
UNICEF-Bericht zur Situation der Kinder in Industrieländern: Deutschland nur Mittelmaß. Wie sorgt Deutschland für seine Kinder - internationaler Vergleich
Teilstudie für Deutschland (PDF, 54 Seiten, mit einer Differenzierung der Untersuchungsbefunde nach einzelnen Bundesländern):
Zur Lage der Kinder in Deutschland: Politik für Kinder als Zukunftsgestaltung
Der Gesamtbericht (englisch) mit internationalem Vergleich: (PDF, 52 Seiten) ist hier:
UNICEF Innocenti Research Centre: Child poverty in perspective: An overview of child well-being in rich countries
Gerd Marstedt, 24.2.2007
219 Millionen Kinder unter 5 Jahren in Entwicklungsländern ohne Entwicklungschancen: Start einer "Lancet"-Serie.
 In dem 2003 (2003; 362:65-71) in der Fachzeitschrift "Lancet" veröffentlichten Aufsatz "How many deaths can we prevent this year?" kam die "Bellagio Child Survival Study Group" zu der Feststellung, in den Entwicklungsländern würden jährlich mehr als 6 von 10 Millionen Kinder einen verhinderbaren Tod sterben müssen. Die Zahl von 10 Millionen jährlich in den Entwicklungsländern sterbenden Kinder stammt aus dem ersten Aufsatz der 2003-Serie, der sich die Frage stellte "Where and why are 10 million children dying every year?".
In dem 2003 (2003; 362:65-71) in der Fachzeitschrift "Lancet" veröffentlichten Aufsatz "How many deaths can we prevent this year?" kam die "Bellagio Child Survival Study Group" zu der Feststellung, in den Entwicklungsländern würden jährlich mehr als 6 von 10 Millionen Kinder einen verhinderbaren Tod sterben müssen. Die Zahl von 10 Millionen jährlich in den Entwicklungsländern sterbenden Kinder stammt aus dem ersten Aufsatz der 2003-Serie, der sich die Frage stellte "Where and why are 10 million children dying every year?".
Die weiteren Aufsätze befassten sich mit den Themen:
• "Reducing child mortality: can public health deliver?"
• "Applying an equity lens to child health and mortality: more of the same is not enough"
• "Knowledge into action for child survival".
Zu Beginn des ersten, in derselben Zeitschrift am 6.1.2007 veröffentlichten Teils einer dreiteiligen Serie über "Child development in developing countries" konstatiert die Autorengruppe um die britische Wissenschaftlerin Sally Grantham-McGregor, dass diese Anzahl von toten Kindern "unglücklicherweise...nur die Spitze des Eisbergs" ist. Nach ihrer "konservativen Schätzung" verhindern die Vielzahl der sozialen und natürlichen Risiken in den Entwicklungsländern, wie Armut, Unter- oder Mangelernährung, schlechte Gesundheit und eine deprimierende und nichtaktivierende häusliche Umgebung, weltweit mehr als 200 Millionen Kinder unter 5 Lebensjahren an ihrer normalen geistigen, senso-motorischen und sozial-emotionalen Entwicklung.
Die Autoren gehen in dem aktuellen Aufsatz mit dem programmatischen Titel "Developmental potential in the first 5 years for children in developing countries" von der wissenschaftlich abgesicherten Annahme aus, dass die Entwicklungsmöglichkeiten in den ersten Lebensjahren entscheidende Voraussetzungen für das weitere Leben und die Lebenschancen schaffen. Wenn Kinder dieses Entwicklungspotenzial nicht (voll) ausschöpfen können, hat dies Auswirkungen auf ihre Bildung und Ausbildung (im Moment besuchen in den Entwicklungsländern schätzungsweise 99 Millionen Kinder im Grundschulalter keine Schule und 78 % der Schüler nur die Grundschule; in 12 afrikanischen Ländern haben laut einer Studie 57 % der jungen Erwachsenen noch nicht einmal einfachste Lesekenntnisse), ihre Beschäftigungs- und Einkommenschancen, ihr eigenes Zeugungsverhalten und ihre Fähigkeit zur Sorge für eigene Kinder und letztlich für die soziale Zukunft ihrer Länder. Híer handelt es sich also um einen klassischen "Teufelskreis", der wesentliche Triebkraft für die "intergenerational transmission of poverty" ist.
Nach einer gründlichen Auswertung der relativ wenigen wissenschaftlichen Untersuchungen, die sich mit der Quantifizierung der Auswirkungen mangelnder oder mangelhaften Startbedingungen für Kinder in der unterentwickelten Welt beschäftigten, kamen Grantham-McGregor et al. zu der Zahl von dort derzeit 219 Millionen massiv benachteiligten oder gefährdeten Kinder. Das entspricht einem Anteil von 39 % aller Kinder dieser Altersgruppe in den Entwicklungsländern. Die meisten der benachteiligten Kinder, nämlich 89 Millionen, kommen aus dem südlichen Asien, in Schwarzafrika kann mit 61 % der größte Anteil der Kinder ihr geistiges Potenzial nicht ausschöpfen. Um für Europäer oder Nordamerikaner fassbar zu machen, was dies heißt, errechnen die Wissenschaftler, dass der damit verbundene Verlust an Humanpotenzial u. a. zu einem praktisch lebenslänglich 20-prozentigen Einkommensdefizit gegenüber Menschen führt, die in der Kindheit nicht derartig benachteiligt werden.
Im zweiten, demnächst veröffentlichten Teil ihrer Studie wird Genaueres über die Hauptursachen der Situation dargestellt: Unterernährung, unzureichende geistige Stimulation, Depression der Mütter sowie Infektionskrankheiten wie Malaria oder Aids. Im dritten Teil wird belegt, dass man vor allem durch eine bessere Ernährung der Kinder und spezielle Erziehungsprogramme für Eltern und Kinder vieles an negativer Entwicklung verhindern kann. Mehr Details werden wir nach dem Erscheinen der Aufsätze hier ausführlich dokumentieren.
Wenn Sie den gesamten Aufsatz lesen wollen, müssen Sie sich zuerst kostenlos für den freien Zugang zu vielen Aufsätzen der Zeitschrift "Lancet" registrieren lassen.
Nach der Registrierung können sie den hier erwähnten und die weiteren Teile der "Lancet"-Serie "Child development in developing countries" hier herunterladen.
Bernard Braun, 6.1.2007
Erste Ergebnisse der KiGGS-Studie: Auffällige Schicht-Unterschiede im Gesundheitsverhalten
 "KiGGS" heißt die bundesweite Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen, die das Robert Koch-Institut vom Mai 2003 bis zum Mai 2006 in insgesamt 167 Städten und Gemeinden mit 17.641 Jungen und Mädchen im Alter bis zu 18 Jahren durchgeführt hat. Die Studie wurde vom Bundesministerium für Gesundheit (BMG) und vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) finanziert. Allerste Ergebnisse wurden jetzt in einer Broschüre für die teilnehmenden Kinder und ihre Eltern veröffentlicht.
"KiGGS" heißt die bundesweite Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen, die das Robert Koch-Institut vom Mai 2003 bis zum Mai 2006 in insgesamt 167 Städten und Gemeinden mit 17.641 Jungen und Mädchen im Alter bis zu 18 Jahren durchgeführt hat. Die Studie wurde vom Bundesministerium für Gesundheit (BMG) und vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) finanziert. Allerste Ergebnisse wurden jetzt in einer Broschüre für die teilnehmenden Kinder und ihre Eltern veröffentlicht.
Auffällig in den Ergebnissen sind dabei Unterschiede im Gesundheitsverhalten, die sich fast durchgängig in Abhängigkeit von Schicht und Migrationshintergrund zeigen, beim Übergewicht, sportlicher Aktivität, Rauchen oder auch Ernährungsverhalten. So zeigt sich:
• Kinder und Jugendliche aus Familien mit niedrigem Sozialstatus sind von Übergewicht und Adipositas besonders häufig betroffen. Kinder mit Migrationshintergrund gehören ebenfalls zur Risikogruppe.
• Dasselbe gilt für psychische Probleme und Verhaltensauffälligkeiten (Hyperaktivität, Probleme mit Gleichaltrigen, emotionale Probleme)
• Während von Kindern und Jugendlichen mit einem hohen sozialen Status nur 16% Essstörungen aufweisen, sind dies Kinder und Jugendliche mit mittlerem Sozialstatus 21%, mit niedrigem sozialen Status sogar 28%. Hauptschüler/innen sind wesentlich häufiger vom Verdacht auf eine Essstörung betroffen als Realschüler/innen und Gymnasiasten/innen.
• Nach den Befragungsergebnissen sind Kinder und Jugendliche in Deutschland in der Mehrzahl körperlich und sportlich aktiv. Allerdings zeichnen sich einige wichtige Unterschiede ab, die darauf hinweisen könnten, dass möglicherweise nicht alle Gruppen gleichen Zugang zu sportlichen Möglichkeiten haben (geringere Anteile von Vereinssporttätigkeit bei Kindern mit Migrationshintergrund und Kindern aus Familien mit niedrigem Sozialstatus).
• Jungen und Mädchen aus Familien mit niedrigem Sozialstatus rauchen häufiger als diejenigen aus Familien mit mittlerem und vor allem mit höherem Sozialstatus. Besonders stark zeichnet sich das soziale Gefälle bei den 14- bis 17-Jährigen ab, es deutet sich aber auch bei den 11- bis 13-Jährigen an, obwohl der Anteil der Raucher in dieser Altersgruppe noch sehr gering ist.
Über Zielsetzungen und Durchführung des "Kinder- und Jugendgesundheits-Survey - KiGGS" gibt es detaillierte Informationen auf der Website KiGGS.
Die Broschüre mit ersten Untersuchungsergebnissen (96 Seiten) kann hier heruntergeladen werden: Erste Ergebnisse der KiGGS-Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland
Gerd Marstedt, 27.12.2006
Kinderarmut im Wohlfahrtsstaat Deutschland
 In der Bundesrepublik Deutschland leben etwa zehn Prozent aller Kinder in relativer Armut - das sind 1,5 Millionen Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Im internationalen Vergleich liegt Deutschland damit im Mittelfeld der wirtschaftlich am weitesten entwickelten Staaten - so das Ergebnis der UNICEF-Vergleichsstudie "Child Poverty in Rich Countries 2005". Dass es in einem so wohlhabenden Land wie Deutschland Kinderarmut gibt, ist skandalös; dass ihre Rate seit 1990 stärker gestiegen ist als in den meisten entwickelten Industriestaaten, sollte in der Politik Alarm auslösen. Kinder sind in Deutschland zudem häufiger von Armut betroffen als Erwachsene. Es ist widersinnig, dass junge Menschen in einem Land, dessen Geburtenrate seit Jahrzehnten sinkt, einem immer höheren Armutsrisiko unterliegen.
In der Bundesrepublik Deutschland leben etwa zehn Prozent aller Kinder in relativer Armut - das sind 1,5 Millionen Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Im internationalen Vergleich liegt Deutschland damit im Mittelfeld der wirtschaftlich am weitesten entwickelten Staaten - so das Ergebnis der UNICEF-Vergleichsstudie "Child Poverty in Rich Countries 2005". Dass es in einem so wohlhabenden Land wie Deutschland Kinderarmut gibt, ist skandalös; dass ihre Rate seit 1990 stärker gestiegen ist als in den meisten entwickelten Industriestaaten, sollte in der Politik Alarm auslösen. Kinder sind in Deutschland zudem häufiger von Armut betroffen als Erwachsene. Es ist widersinnig, dass junge Menschen in einem Land, dessen Geburtenrate seit Jahrzehnten sinkt, einem immer höheren Armutsrisiko unterliegen.
Die Ausgabe 26/2006 der Zeitschrift Aus Politik und Zeitgeschichte (eine Beilage zur Wochenzeitung "Das Parlament") widmet sich mit fünf Aufsätzen ausschließlich dem Thema "Kinderarmut". Die Beiträge:
• Gerda Holz: Lebenslagen und Chancen von Kindern in Deutschland. Ein Überblick über Ergebnisse der Armutsforschung. Der Aufsatz geht der Frage nach: Sind Kinder per se ein Armutsrisiko für Familien oder sind sie es, weil Familien am stärksten von gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklungen negativ betroffen sind?
• Olaf Groh-Samberg / Matthias Grundmann: Soziale Ungleichheit im Kindes- und Jugendalter. Der Aufsatz geht von dem Befund aus, dass Kinder zu haben, in Deutschland ein zunehmendes Armutsrisiko darstellt, was nicht zuletzt angesichts der demographischen Entwicklung als politischer Skandal bezeichnet werden muss.
• Michael Fertig / Marcus Tamm: Kinderarmut in reichen Ländern. Der Aufsatz dokumentiert Kinderarmut in den OECD-Staaten. Ungeachtet des mehrere Jahrzehnte beinahe stetigen Wirtschaftswachstums und des steigenden Pro-Kopf-Einkommens leben in diesen Ländern heute noch mehrere Millionen Kinder in prekären Einkommensverhältnissen.
• Carolin Reißlandt / Gerd Nollmann: Kinderarmut im Stadtteil: Intervention und Prävention. Der Beitrag dokumentiert sozialraumspezifische Erscheinungsformen von Kinderarmut, Förderprogramme, Soziale Dienste und Projekte in benachteiligten Quartieren und zeigt Interventionsansätze auf (Soziale Dienste und Projekte im Stadtteil)
• Christoph Butterwegge: Wege aus der Kinderarmut. Der Aufsatz diskutiert die in unterschiedlichen Politikfeldern möglichen Lösungsansätze, z.B. in der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik, in der Familienpolitik (Reformen des Lasten- bzw. Leistungsausgleichs) , in der Bildungspolitik (Ganztagsbetreuung und Gemeinschaftsschule) sowie Ansätze in der Gesundheits- und Sozialpolitik, Raumplanung, Stadtentwicklung und Wohnungs(bau)politik.
Download der Ausgabe 26/2006 der Zeitschrift "Aus Politik und Zeitgeschichte" zum Thema Kinderarmut
Gerd Marstedt, 24.12.2006
Unicef Weltkinderbericht 2007: Die sexuelle und gesundheitliche Diskriminierung von Mädchen
 Millionen Mädchen und Frauen leben in einem Gefängnis aus Armut, traditioneller Benachteiligung und alltäglicher Diskriminierung. Als Mädchen geboren zu werden, kommt oft sogar einem Todesurteil gleich. In Ländern wie Indien oder China werden schon weibliche Föten gezielt abgetrieben. Oder Mädchen werden nach der Geburt schlechter als die Jungen versorgt, so dass viele nicht überleben. Jedes Jahr sterben allein in Südasien rund eine Million Mädchen kurz nach der Geburt oder in den ersten Lebensjahren. Seelische Gewalt, aber auch Schläge, Vergewaltigungen und sexuelle Ausbeutung prägen das Leben vieler Mädchen und Frauen. Die weibliche Hälfte der Menschheit wird bis heute in allen Regionen der Welt benachteiligt und diskriminiert.
Millionen Mädchen und Frauen leben in einem Gefängnis aus Armut, traditioneller Benachteiligung und alltäglicher Diskriminierung. Als Mädchen geboren zu werden, kommt oft sogar einem Todesurteil gleich. In Ländern wie Indien oder China werden schon weibliche Föten gezielt abgetrieben. Oder Mädchen werden nach der Geburt schlechter als die Jungen versorgt, so dass viele nicht überleben. Jedes Jahr sterben allein in Südasien rund eine Million Mädchen kurz nach der Geburt oder in den ersten Lebensjahren. Seelische Gewalt, aber auch Schläge, Vergewaltigungen und sexuelle Ausbeutung prägen das Leben vieler Mädchen und Frauen. Die weibliche Hälfte der Menschheit wird bis heute in allen Regionen der Welt benachteiligt und diskriminiert.
Zwischen der Situation von Frauen und der Not von Kindern gibt es einen engen Zusammenhang. Wo die Menschenrechte der Frauen mit Füßen getreten werden, leiden immer auch die Kinder. Mit dem Bericht Zur Situation der Kinder in der Welt 2007 ruft UNICEF dazu auf, Mädchen und Frauen zu stärken. Fortschritte für Frauen sind auch Fortschritte für Kinder. So bewirkt jedes zusätzliche Schuljahr der Mutter, dass auch die Kinder länger zur Schule gehen. Ob in der Familie, in der Arbeitswelt oder in der Politik - wenn Frauen mitbestimmen, werden andere Prioritäten gesetzt: zugunsten der Ernährung für Kinder, zugunsten medizinischer Versorgung, Bildung und Schutz für Mädchen und Jungen.
Zahlen und Fakten:
• Mehr als eine halbe Million Frauen sterben pro Jahr an Komplikationen während der Schwangerschaft oder Geburt - das ist durchschnittlich jede Minute eine Frau weltweit.
• Jedes Jahr bekommen rund 14 Millionen Mädchen im Alter zwischen 15 und 19 Jahren ein Kind. Für diese Mütter und ihre Kinder ist das Risiko, während der Geburt oder kurz danach zu sterben, deutlich höher als für ältere Frauen.
• Weltweit fehlen schätzungsweise 113 bis 200 Millionen Frauen, weil weibliche Föten gezielt abgetrieben, Mädchen als Babys getötet oder so schlecht versorgt werden, dass sie nicht überleben. Allein in Indien und China werden nach neuesten Schätzungen jährlich eine Million weibliche Föten abgetrieben.
• Trotz großer Fortschritte bei der Förderung der Mädchenbildung kommen im weltweiten Durchschnitt auf 100 Jungen, die nicht zur Schule gehen, noch immer 115 Mädchen.
• Weltweit leben etwa 130 Millionen Mädchen und Frauen, deren Genitalien verstümmelt wurden. Jedes Jahr werden drei Millionen weitere Mädchen beschnitten - das sind 8.000 Opfer täglich.
• Frauenhandel ist ein weltweites Geschäft. Nach Schätzungen von UNICEF werden in Asien rund eine Million Minderjährige zur Prostitution gezwungen - die meisten von ihnen Mädchen.
• Allein im Jahr 2002 wurden schätzungsweise 150 Millionen Mädchen unter 18 Jahren zum Geschlechtsverkehr gezwungen. Jede dritte Frau weltweit wird statistisch gesehen mindestens ein Mal im Leben Opfer häuslicher Gewalt.
UNICEF bietet kostenlos mehrere Dokumente an, die ausführlichere Informationen beinhalten:
• Eine kurze einseite Pressemitteilung mit den wichtigsten Fakten
• Einen ausführlichen 12seitigen Pressebericht "Starke Frauen - starke Kinder"
• Den kompletten englischsprachigen Bericht, 160 Seiten, "THE STATE OF THE WORLD’S CHILDREN 2007"
Gerd Marstedt, 12.12.2006
BKK Gesundheitsreport 2006: Gesundheitszustand von Kindern hat sich verschlechtert
 Im BKK Gesundheitsreport 2006 "Demografischer und wirtschaftlicher Wandel - gesundheitliche Folgen" werden wie in den Vorjahren ausführliche Analysen zu Arbeitsunfähigkeit (AU) sowie Krankenhausbehandlungen und sogar Arzneimittelverordnungen vorgelegt. Vor dem Hintergrund der 30-jährigen Geschichte des Reports widmet sich die aktuelle Ausgabe der gesundheitlichen Entwicklung unter dem Blickwinkel der demografischen und wirtschaftlichen Veränderungen der letzen drei Dekaden. So wird auf die langfristige Entwicklung der Arbeitsunfähigkeit eingegangen, die sich seit 1980 halbiert hat, sowie auf die bereits in den letzen eineinhalb Jahrzehnten zu verzeichnende Zunahme des Durchschnittsalters der Erwerbstätigen. Darüber hinaus werden Analysen zu den Veränderungen im Morbiditätsspektrum durchgeführt und die Entwicklung einzelner Erkrankungen wie etwa der psychischer Erkrankungen gesondert analysiert. Ergebnisse für Branchen und Berufe sowie für soziale Statusgruppen wie Arbeitslose runden die Informationen des BKK Berichtes ab. Die Datenbasis des Reports umfasst den BKK Versichertenbestand und spiegelt damit die gesundheitlichen Befunde etwa eines Viertels der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und jedes/r fünften GKV-Versicherten in Deutschland wider.
Im BKK Gesundheitsreport 2006 "Demografischer und wirtschaftlicher Wandel - gesundheitliche Folgen" werden wie in den Vorjahren ausführliche Analysen zu Arbeitsunfähigkeit (AU) sowie Krankenhausbehandlungen und sogar Arzneimittelverordnungen vorgelegt. Vor dem Hintergrund der 30-jährigen Geschichte des Reports widmet sich die aktuelle Ausgabe der gesundheitlichen Entwicklung unter dem Blickwinkel der demografischen und wirtschaftlichen Veränderungen der letzen drei Dekaden. So wird auf die langfristige Entwicklung der Arbeitsunfähigkeit eingegangen, die sich seit 1980 halbiert hat, sowie auf die bereits in den letzen eineinhalb Jahrzehnten zu verzeichnende Zunahme des Durchschnittsalters der Erwerbstätigen. Darüber hinaus werden Analysen zu den Veränderungen im Morbiditätsspektrum durchgeführt und die Entwicklung einzelner Erkrankungen wie etwa der psychischer Erkrankungen gesondert analysiert. Ergebnisse für Branchen und Berufe sowie für soziale Statusgruppen wie Arbeitslose runden die Informationen des BKK Berichtes ab. Die Datenbasis des Reports umfasst den BKK Versichertenbestand und spiegelt damit die gesundheitlichen Befunde etwa eines Viertels der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und jedes/r fünften GKV-Versicherten in Deutschland wider.
Ein spezielles Kapitel widmet der Bericht dem Thema "Gesundheit von Kindern und Jugendlichen - wie gesund sind die Erwerbstätigen von Morgen?". Einige Ergebnisse aus diesem Kapitel:
• Der Gesundheitszustand von Kindern und Jugendlichen hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verändert, Krankheiten, die bis vor wenigen Jahren nur die ältere Generation betrafen, greifen auf die Jungen über. Kindheit und Jugend sind heute mehr denn je gekennzeichnet durch Bewegungsmangel, Fehlernährung und Übergewicht.
• So steigt seit Jahren die Zahl der Kinder mit Diabetes mellitus Typ 2. Nach Schätzungen des Robert Koch-Institutes ist heute jedes fünfte Kind übergewichtig, wobei Risikogruppen wie z.B. Migrantenkinder oder Kinder aus unteren sozialen Schichten besonders betroffen sind. Es ist damit zu rechnen, dass bei einer Vielzahl adipöser Kinder und Jugendlicher auch im Erwachsenenalter massive Gesundheitsstörungen wie Diabetes mellitus Typ 2 und koronare Herzkrankheiten eintreten werden.
• Aber auch psychische Erkrankungen und Störungen wie zum Beispiel ADHS oder ADS (Aufmerksamkeitsdefizits - Hyperaktivitätstörungen) werden bei Kindern immer häufiger diagnostiziert und behandelt.
• Wurde dieses Erkrankungsbild bislang immer nur in Verbindung mit dem Kindes- und Jugendalter untersucht, weitet sich die Diskussion heute auch auf das Erwachsenenalter aus. Schätzungen zu Folge bleiben die Symptome bei 30 bis 40% der Betroffenen auch im Erwachsenenalter bestehen.
• Die zunehmende pharmakologische Therapie der ADHS-Kinder, hat nicht zuletzt auch einen Einfluss auf den Umgang mit Arzneimitteln im Erwachsenenalter. Wer schon in jungen Jahren lernt, Arzneimittel zur Bewältigung von Problemen zur Hilfe zu nehmen, wird später vermutlich keine große Hemmschwelle aufweisen, Arzneimittel oder andere Bewältigungsmechanismen bis hin zu Drogen als "Lebenshilfe" einzusetzen.
Download des BKK Gesundheitsreport 2006 Demografischer und wirtschaftlicher Wandel - gesundheitliche Folgen (PDF, 4 MB)
Gerd Marstedt, 4.12.2006
Gesundheitliche Benachteiligung von Kindern und Jugendlichen durch Armut
 Seit 2003 ist das Projekt "Gesundheitsförderung bei sozial Benachteiligten" als Internetplattform mit umfangreichen Informationen zu aktuellen Themen, Entwicklungen, Initiativen sowie Veranstaltungshinweisen im Netz: gesundheitliche-chancengleichheit.de. Ziel des Projektes ist es, die Transparenz im vielschichtigen Handlungsfeld der Gesundheitsförderung für sozial benachteiligte Zielgruppen zu erhöhen und die Arbeit der Akteure miteinander zu vernetzen. In der Rubrik "Kinder- und Jugendgesundheit" bietet das Projekt mehrere Aufsätze zum Download an, die sich mit Thema der gesundheitlichen Benachteiligung von Kindern und Jugendlichen aufgrund von Armut beschäftigen.
Seit 2003 ist das Projekt "Gesundheitsförderung bei sozial Benachteiligten" als Internetplattform mit umfangreichen Informationen zu aktuellen Themen, Entwicklungen, Initiativen sowie Veranstaltungshinweisen im Netz: gesundheitliche-chancengleichheit.de. Ziel des Projektes ist es, die Transparenz im vielschichtigen Handlungsfeld der Gesundheitsförderung für sozial benachteiligte Zielgruppen zu erhöhen und die Arbeit der Akteure miteinander zu vernetzen. In der Rubrik "Kinder- und Jugendgesundheit" bietet das Projekt mehrere Aufsätze zum Download an, die sich mit Thema der gesundheitlichen Benachteiligung von Kindern und Jugendlichen aufgrund von Armut beschäftigen.
• Andreas Mielck et al. vergleichen in ihrer Studie in Westeuropa durchgeführte Interventionsmaßnahmen, die auf die Verringerung gesundheitlicher Ungleichheit abzielen. Obgleich sich die Gesundheitslage von Kindern in Europa während der letzten 100 Jahre deutlich verbessert hat, herrscht noch immer eine ausgeprägte soziökonomische Ungleichheit und damit auch eine gesundheitliche Ungleichheit bei Kindern. Mielck et al. definieren Kinderarmut als den Anteil an Kindern, die in Haushalten mit einem Einkommen von weniger als der Hälfte des Durchschnittseinkommens aufwachsen. Während in Norwegen und Schweden weniger als 4 Prozent der Kinder von Kinderarmut betroffen sind, liegt der Anteil im Vereinigten Königreich bei cirka 20 Prozent. Deutschland verzeichnet in den letzten Jahren einen drastischen Anstieg der Kinderarmut. Ein in Deutschland 1994 durchgeführter Survey belegt, dass die Prävalenz physischer und psychischer Erkrankungen in den unteren sozialen Schichten bis zu 16-mal höher ist als in den oberen Schichten. Mielck et al. zeigen dabei auf, dass schlechte sozioökonomische Lebensumstände mit ungünstigen Verhaltensmustern bei Jugendlichen einhergehen und untersuchen grundlegende Strategien zum Abbau gesundheitlicher Chancenungleichheit. PDF-Datei zum Aufsatz von Andreas Mielck, Hilary Graham und Sven Bremberg: Kinder - eine wichtige Zielgruppe für die Verminderung sozioökonomisch bedingter gesundheitlicher Ungleichheit
• Antje Richter zeigt in ihrem Aufsatz "Frühe Armut - Prävention durch Gesundheitsförderung in Kindertageseinrichtungen" anhand unterschiedlicher Datenquellen (zum Teil Schuleingangsuntersuchungen) die erhöhten Risikofaktoren materiell benachteiligter Kinder und Jugendlicher auf. Auffallend schlecht ist bei den Betroffenen u.a. oft die Grundversorgung (z.B. zur Jahreszeit unpassende Bekleidung), die Ernährungslage, der Zahnstatus und die Sprachentwicklung. Besonders ausgeprägt sind auch die Unterschiede hinsichtlich der Sprachentwicklung sowie der intellektuellen und psychomotorischen Entwicklung und ebenso treten die Befunde Übergewicht und kinderpsychiatrische Störungen in der Gruppe der sozial Benachteiligten häufiger auf. PDF-Datei des Aufsatzes von Antje Richter: Frühe Armut - Prävention durch Gesundheitsförderung in Kindertageseinrichtungen
• Die AWO/ISS-Studie zur Kinderarmut zeigt u.a. auf, dass nach der amtlichen Statistik in Deutschland Ende 2003 mehr als eine Million Kinder und Jugendliche von Hilfe zum Lebensunterhalt (Sozialhilfe) leben mussten. Dies entspricht 7% Prozent aller Kinder und Jugendlichen. Die Armutsquote ist jedoch deutlich höher: Je nach Armutsdefinition leben zwischen 13 und 19 Prozent in relativer Armut, das heißt, sie und ihre Familien haben weniger als die Hälfte des durchschnittlichen Einkommens zur Verfügung. Die Studie, die das Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik (ISS-Frankfurt a. M.) im Auftrag der Arbeiterwohlfahrt Bundesverband (AWO) und mit Förderung der Glücksspirale erarbeitet hat, stellt einen 1997 begonnenen Forschungszusammenhang unter dem Thema "Kinderarmut und deren Folgen" dar. Die aktuellen Ergebnisse basieren auf einer von Mitte 2003 bis Mitte 2004 realisierten Wiederholungserhebung bei ca. 500 Kindern. Eine Zusammenfassung des Endberichts der bisher einzigen Längsschnittstudie in Deutschland zum Thema Kinderarmut ist hier als PDF-Datei herunterladen (Autoren: Gerda Holz, Antje Richter,
Werner Wüstendörfer, Dietrich Giering): Zukunftschancen für Kinder!? - Wirkung von Armut bis zum Ende der Grundschulzeit
Gerd Marstedt, 4.12.2006
Übergewicht im Kindes- und Jugendalter ist in Unterschichten stärker verbreitet
 In der Zeitschrift für Sportmedizin, Ausgabe 9/2006, finden sich zwei Aufsätze zum Thema Übergewicht bei Kindern und Jugendlichen, die übere neuere Forschungsergebnisse berichten. Der Aufsatz Sozioökonomische Einflüsse auf Lebensstil und Gesundheit von Kindern (Danielzik S, Müller MJ) macht deutlich: "Es besteht ein inverser sozialer Gradient der Übergewichtigkeit: Je niedriger der soziale Status, desto höher ist die Prävalenz von Übergewicht. Sozialdeterminierte Verhaltensmuster können die sozialen Unterschiede im Übergewicht nur anteilig erklären. Soziale Faktoren sind auch eine Barriere für die schulische Gesundheitsförderung und die Behandlung von übergewichtigen Kindern. Diese Befunde legen nahe, dass eine rein auf das individuelle Verhalten ausgerichtete Strategie das Problem Übergewicht nicht lösen kann. Neben einer Verhaltensprävention sind deshalb zukünftig gesellschaftliche Ansätze einer Verhältnisprävention notwendig, welche die sozialen Determinanten des Übergewichts berücksichtigen."
In der Zeitschrift für Sportmedizin, Ausgabe 9/2006, finden sich zwei Aufsätze zum Thema Übergewicht bei Kindern und Jugendlichen, die übere neuere Forschungsergebnisse berichten. Der Aufsatz Sozioökonomische Einflüsse auf Lebensstil und Gesundheit von Kindern (Danielzik S, Müller MJ) macht deutlich: "Es besteht ein inverser sozialer Gradient der Übergewichtigkeit: Je niedriger der soziale Status, desto höher ist die Prävalenz von Übergewicht. Sozialdeterminierte Verhaltensmuster können die sozialen Unterschiede im Übergewicht nur anteilig erklären. Soziale Faktoren sind auch eine Barriere für die schulische Gesundheitsförderung und die Behandlung von übergewichtigen Kindern. Diese Befunde legen nahe, dass eine rein auf das individuelle Verhalten ausgerichtete Strategie das Problem Übergewicht nicht lösen kann. Neben einer Verhaltensprävention sind deshalb zukünftig gesellschaftliche Ansätze einer Verhältnisprävention notwendig, welche die sozialen Determinanten des Übergewichts berücksichtigen."
Im zweiten Aufsatz Bewegungsmangel und Übergewicht bei Kindern und Jugendlichen (Graf C, Dordel S, Koch B, Predel H-G) beleuchtet insbesondere den Einfluss von Bewegungsmangel: "National und international nimmt die Bewegungszeit in Freizeit und Alltag von Kindern und Jugendlichen ab, daraus resultiert eine Abnahme der motorischen Leistungsfähigkeit.In nahezu allen motorischen Hauptbeanspruchungsformen schneiden die übergewichtigen und adipösen Kinder und Jugendlichen schlechter ab als ihre Altersgenossen. Dies unterstützt das Meidungsverhalten und die zunehmende Inaktivität. Um dem entgegenzuwirken sollten konsequent in den verschiedenen Settings Bewegungsangebote in Freizeit und Alltag geschaffen und umgesetzt werden."
In einem Aufsatz des Deutschen Ärzteblatts (Nr. 103, Ausgabe 6 vom 10.02.2006, Seite A-334) Prävention und Therapie von Übergewicht im Kindes- und Jugendalter fassen Manfred J. Müller, Thomas Reinehr und Johannes Hebebrand die derzeit vorliegenden epidemiologischen Ergebnisse zur Adipositas bei Kindern und Jugendlichen zusammen und diskutieren auch Möglichkeiten der Prävention. In der Zusammenfassung des Aufsatzes heißt es: "Während vor 25 Jahren die Prävalenz des Übergewichts in Deutschland bei Kindern zehn Prozent betrug, sind es heute bei Verwendung derselben Referenzdaten je nach Alter und Region 20 bis 33 Prozent. Maßnahmen zur Prävention und Therapie von Übergewicht und Adipositas versuchen das für die Gesundheit relevante Verhalten von Kindern und Jugendlichen und ihrer Familie zu verbessern. Die Ergebnisse der Cochrane-Datenbanken und weitere systematische Übersichtsarbeiten zeigen, dass Übergewicht mit den aus diesen Arbeiten gewonnenen Kenntnissen nicht grundsätzlich zu vermeiden oder zu behandeln ist. Da eine weitere Zunahme der Prävalenz von Übergewicht im Kindes- und Jugendalter mutmaßlich bevorsteht, ist neben einem verhaltenstherapeutisch orientierten Ansatz, der das Kind und dessen Familie erreicht, eine gesellschaftliche Lösung des Problems erforderlich."
Maßnahmen zur Prävention, wie sie derzeit praktiziert werden, erscheinen den Autoren recht begrenzt. Mehr Erfolg versprechen "Maßnahmen der Verhältnisprävention, die gemeinsam mit Ärzten, Public-Health-Experten, Ökonomen, der Lebensmittelindustrie, den Medien und der Politik entwickelt werden". Diskutiert werden auch Ansätze wie der spätere Beginn von Sendezeiten im Fernsehen, Werbeverbot für Lebensmittel in Kindersendungen, das Verbot von Getränkeautomaten mit gesüßten Getränken in Schulen, Sonderabgaben für Fastfood oder die Einschränkung der Mobilität (begrenzte Nutzung privater PKW) wirkungsvoll sein. Allerdings wird auch hier wieder erkannt: "Diese Maßnahmen entsprechen aber nicht den gegenwärtig häufigen Wertvorstellungen und Wünschen der Menschen."
Hinzuweisen ist auch auf die Studie RKI (Robert-Koch-Institut) zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland, in der auch das Thema Übergewicht eine Rolle spielt. Bislang wurden allerdings nur erste Ergebnisse präsentiert: Symposium zur Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland
Gerd Marstedt, 12.11.2006