



Home | Patienten | Gesundheitssystem | International | GKV | Prävention | Epidemiologie | Websites | Meilensteine | Impressum
Sämtliche Rubriken in
"Epidemiologie"
Gesundheitsverhalten (Rauchen, Ernährung, Sport usw.) |
Alle Artikel aus:
Epidemiologie
Gesundheitsverhalten (Rauchen, Ernährung, Sport usw.)
Hilft Vitamin C Lungenentzündungen zu verhindern oder zu behandeln? Nein, "insufficient" wie bei vielen anderen Erkrankungen!
 Da Lungenentzündungen auch ohne Coronaviren zu den häufigsten und schwersten Erkrankungsarten mit Todesfolge (weltweit die fünfthäufigste Todesursache) gehören, wundert es nicht, wenn auch für ihre Prävention und Behandlung Nahrungsergänzungsmittel und Vitamine ins Spiel gebracht werden. Dazu gehört auch das Vitamin C dessen Nutzen durch mehrere Beobachtungsstudien oder Erfahrungsberichte gestützt zu werden scheint.
Da Lungenentzündungen auch ohne Coronaviren zu den häufigsten und schwersten Erkrankungsarten mit Todesfolge (weltweit die fünfthäufigste Todesursache) gehören, wundert es nicht, wenn auch für ihre Prävention und Behandlung Nahrungsergänzungsmittel und Vitamine ins Spiel gebracht werden. Dazu gehört auch das Vitamin C dessen Nutzen durch mehrere Beobachtungsstudien oder Erfahrungsberichte gestützt zu werden scheint.
Ob es sich dabei ebenfalls um Effekte dieser ohne Randomisierung und ohne Kontrollgruppen durchgeführten und damit systematisch verzerrten und Fehlschlüsse begünstigende Art von "Studien" handelt, untersucht nun ein am 27. April 2020 veröffentlichter "Cochrane Systematic Review".
Dazu wurden gemäß den hohen methodischen Cochranestandards 5 randomisierte kontrollierte Studien (RCT) und 2 quasi-RCTS mit insgesamt 2.774 Teilnehmer*innen untersucht, die in Großbritannien, den USA und Chile aber auch in Bangladesh und Pakistan durchgeführt wurden.
Da einer der oft gehörten Einwände gegen die Ergebnisse vergleichbarer Studien die zu geringe Menge der Vitamingaben oder die Gabe nur einer Menge war, ist bemerkenswert, dass sowohl wenn es um die präventiven als auch die kurativen Wirkungen ging, unterschiedliche Dosen für längere Zeit verabreicht wurden.
Die wichtigsten, für Studien über therapeutische Wirkungen von Vitaminen und Nahrungsergänzungsmitteln typische Ergebnisse lauten:
• Vier der sieben Studien waren von Pharmafirmen bezahlt worden und die drei anderen Studien machten keine Angaben zu ihrer Finanzierung.
• "We judged the included studies to be at overall high or unclear risk of bias. We rated the quality of the evidence as very low due to study limitations, variations amongst the studies, small sample sizes and uncertainty of estimates."
• Detailliert: "Evidence was insufficient to determine the effect of vitamin C for preventing pneumonia." Und: "Evidence was insufficient to determine the effect of vitamin C for treating pneumonia."
• Positiv: Keine Anzeichen von unerwünschten Effekten. Und sicherlich wirkt sich Vitamin C und dann auch noch in natürlicher Form in vielerlei anderer Hinsicht positiv auf das Wohlbefinden und die Gesundheit aus - nur nicht auf Lungenentzündungen.
Der 44-seitige systematische Cochrane-Review Vitamin C supplementation for prevention and treatment of pneumonia. - Intervention von Zahra Ali Padhani et al. ist am 27. April 2020 erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 5.5.20
Senkt wenig Joggen oder Walken überhaupt das Sterblichkeitsrisiko und sinken Sterberisiken mit Länge des Joggens? Ja, nein!
 Ein oft geäußertes Argument gegen den Ratschlag "doch öfter und intensiver" zu joggen oder zu walken ist der Mangel an Zeit oder besser gesagt dem Mangel an der Zeit, die man vermutlich braucht um sich so intensiv zu bewegen, dass es sich überhaupt lohnt: "5x die Woche 30 Minuten durch den Stadtpark schaff ich nicht und 1x bringt nichts".
Ein oft geäußertes Argument gegen den Ratschlag "doch öfter und intensiver" zu joggen oder zu walken ist der Mangel an Zeit oder besser gesagt dem Mangel an der Zeit, die man vermutlich braucht um sich so intensiv zu bewegen, dass es sich überhaupt lohnt: "5x die Woche 30 Minuten durch den Stadtpark schaff ich nicht und 1x bringt nichts".
Zu deutlich anderen Ergebnissen kommt ein im Oktober 2019 noch vor dem Druck veröffentlichter systematischer Review mit Meta-Analyse von sechs prospektiven Kohorten mit 232 149 TeilnehmerInnen und mit Follow-ups zwischen 5,5 und 35 Jahren.
Die zwei wichtigsten Ergebnisse lauten:
• Joggen oder Walken senkt das Gesamtsterblichkeitsrisiko, das Risiko an Krebs oder einem kardiovaskulären Ereignis zu sterben signifikant um 27%, 23% und 30%.
• Das verblüffende Ergebnis des Reviews lautet: "A meta-regression analysis combining results from three cohort studies showed no significant dose-response trends. Even the smallest doses of running that were examined in the available studies (i.e. ≤1 time a week, <50 min a week, <6 mph and <500 MET(metabolic equivalent)-min/week) were found to confer significant all-cause mortality benefits."
• Und: "We found no evidence that mortality benefits increase with greater amounts of running."
Dies sollte nun nicht dazu motivieren, egal wie viel Freizeit zur Verfügung steht weniger als 50 Minuten pro Woche zu joggen oder zu walken. Aber die Erwartung, seine Sterblichkeitsrisiken durch mehr als 50 Minuten Jogging oder Walk linear verringern zu können, scheint auch nicht ohne Weiteres einzutreffen.
Und sich regelmäßig zu bewegen verbessert auch Gesundheit wie Lebensqualität jenseits von Sterblichkeit.
Lesenswert sind zum Verständnis dieser Ergebnisse und für zukünftige Studien zum Thema die sieben von den Reviewern vorgestellten Limitationen ihres bereits methodisch hochwertigen Reviews.
Die Studie Is running associated with a lower risk of all-cause, cardiovascular and cancer mortality, and is the more the better? A systematic review and meta-analysis von Pedisic Z, Shrestha N, Kovalchik S et al. wird in der Fachzeitschrift "British Journal of Sports Medicine" erscheinen. Eine elektronische Version des Aufsatzes ist vorab komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 9.11.19
Senken langjährige Raucher ihr Herz-/Kreislauferkrankungsrisiko durch Nichtmehrrauchen? Jein, selbst nach 15 Jahren nicht völlig!
 Zu den wichtigen Überlegungen und Erwartungen von Personen, die ein potenzielles und nicht selten über Jahre ausgeübtes suchtartiges ungesundes Verhalten beenden wollen und für jene, die dies ständig empfehlen, gehört, wann der erhoffte Nutzen für die Gesundheit eintritt. Dies gilt in hohem Maße für die Beendigung von Rauchen und das mit dem Rauchen assoziierte Risiko von Herz-/Kreislauferkrankungen.
Zu den wichtigen Überlegungen und Erwartungen von Personen, die ein potenzielles und nicht selten über Jahre ausgeübtes suchtartiges ungesundes Verhalten beenden wollen und für jene, die dies ständig empfehlen, gehört, wann der erhoffte Nutzen für die Gesundheit eintritt. Dies gilt in hohem Maße für die Beendigung von Rauchen und das mit dem Rauchen assoziierte Risiko von Herz-/Kreislauferkrankungen.
Wenig hilfreich oder letztlich nicht vertrauenerweckend war aber die bisher durch Studien gestützte Spannbreite von 2 bis 20 Jahren, in denen dieses Risiko für Raucher nach Beendigung des Rauchens auf das von ständigen Nichtrauchern gesunken ist. Weit in ambulanten Praxen verbreitete Risikokalkulatoren kommen zum Ergebnis, dass frühere Raucher nur noch für 5 Jahre nach Beendigung des Tabakkonsums ein erhöhtes Herz-/Kreislauferkrankungsrisiko haben.
Die Ergebnisse einer aktuellen methodisch hochwertigen Teilstudie mit 8.770 TeilnehmerInnen der Framing Heart Study sind geeignet die Verbreitung zu optimistischer oder pessimistischer Erwartungen zu verhindern. Untersucht wurde deren Rauchverhalten und die Inzidenzen der Herz-/Kreislauferkrankungen für den Zeitraum 1971 bis 2015.
Bei zwei Risikovergleichen lauten die Ergebnisse unter Berücksichtigung einer Reihe von Confoundern folgendermaßen:
• Im Vergleich von Rauchern, die 20 oder mehr Jahre geraucht haben, ist das Herz-/Kreislauferkrankungs-Risiko der Personen, die das Rauchen aufgehört haben nach 5 Jahren deutlich geringer als das derjenigen Personen, die weiterrauchten (6,9 versus 11,6 Neuerkrankungen pro 1.000 Personenjahren).
• Beim Vergleich des Herz-/Kreislauferkrankungs-Risikos der Personen, die das Rauchen aufhörten mit den Personen, die nie geraucht haben, war aber das Risiko der ersteren auch nach 10 bis 15 Jahren höher (6,31 versus 5,09 Neuerkrankungen pro 1.000 Personenjahren), in einer Teilgruppe sogar auch noch nach 24 Jahren.
Auch wenn die Beendigung selbst mehrjährigen Rauchens sicherlich eine Entscheidung mit gesundheitlichem Nutzen ist, sollte dies weder von ÄrztInnen noch von Noch-Rauchern mit dem Argument oder der Erwartung eines sehr schnellen vollen Erfolgs verknüpft werden. Am besten ist, gar nicht mit dem Tabakrauchen anzufangen und dafür mit geeigneten Mitteln (z.B. vollkommenes Werbeverbot) zu sorgen.
Der Aufsatz Association of Smoking Cessation With Subsequent Risk of Cardiovascular Disease von "JAMA" (322(7):642-650) erschienen. Das Abstract ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 26.8.19
Evidenz zu den gesundheitlichen Effekten von E-Zigaretten. Mehr als den Herstellern lieb sein dürfte.
 Über kaum ein anderes gesundheitsbezogenes Konsumprodukt wurde und wird von Herstellern und ihren Kopflangern derartig viel Desinformation verbreitet oder der Eindruck erweckt "man wisse nichts oder nicht genug" über Nachteile und Risiken als bei Tabakprodukten. Dies gilt in gewissem Maß auch für die aktuell angebotenen Ersatzprodukte wie Iqos oder die E-Zigarette.
Über kaum ein anderes gesundheitsbezogenes Konsumprodukt wurde und wird von Herstellern und ihren Kopflangern derartig viel Desinformation verbreitet oder der Eindruck erweckt "man wisse nichts oder nicht genug" über Nachteile und Risiken als bei Tabakprodukten. Dies gilt in gewissem Maß auch für die aktuell angebotenen Ersatzprodukte wie Iqos oder die E-Zigarette.
Insofern sind Informationen darüber, dass es überhaupt einen gesicherten Informationsstand gibt und über dessen wichtigsten Inhalte wichtig.
Zu E-Zigaretten ist dies mit den Ergebnissen eines am 23. Januar 2018 veröffentlichten Berichts einer Expertengruppe der us-amerikanischen "National Academies of Sciences, Engineering and Medicine" möglich. Dessen 680 Seiten umfassender "Consensus Study Report" Public Health Consequences of E-Cigarettes basiert auf der Sichtung und Bewertung von über 800 peer-reviewten wissenschaftlichen Studien zum Thema und ist nach einer kurzen und nach Erfahrung des Verfassers ohne unerwünschte Folgen verlaufenden Anmeldeprozedur über die obige Website komplett kostenlos erhältlich.
Der Bericht kommt insgesamt zu 8 Schlussfolgerungen mit "conclusive evidence, 10 Schlussfolgerungen mit "substantial evidence", 8 Schlussfolgerungen mit "moderate evidence", 12 Schlussfolgerungen mit "limited evidence", 4 Schlussfolgerungen mit "insufficient evidence", 5 Schlussfolgerungen mit "no available evidence". Genaue Definitionen der verschiedenen Evidenzgrade finden sich in dem Report.
Eine Auswahl davon sieht in der Fassung einer Pressemitteilunbg zum Report wie folgt aus:
• There is conclusive evidence that exposure to nicotine from e-cigarettes is highly variable and depends on the characteristics of the device and the e-liquid, as well as on how the device is operated.
• There is substantial evidence that nicotine intake from e-cigarettes among experienced adult e-cigarette users can be comparable to that from conventional cigarettes.
• There is conclusive evidence that in addition to nicotine, most e-cigarettes contain and emit numerous potentially toxic substances.
• There is substantial evidence that except for nicotine, exposure to potentially toxic substances from e-cigarettes (under typical conditions of use) is significantly lower compared with conventional cigarettes.
• There is substantial evidence that e-cigarette use results in symptoms of dependence on e-cigarettes.
• There is moderate evidence that risk and severity of dependence is lower for e-cigarettes than for conventional cigarettes.
• There is moderate evidence that variability in the characteristics of e-cigarette products (nicotine concentration, flavoring, device type, and brand) is an important determinant of the risk and severity of dependence on e-cigarettes.
• There is conclusive evidence that completely substituting e-cigarettes for conventional cigarettes reduces users' exposure to many toxicants and carcinogens present in conventional cigarettes.
• There is substantial evidence that completely switching from regular use of conventional cigarettes to e-cigarettes results in reduced short-term adverse health outcomes in several organ systems.
• There is substantial evidence that e-cigarette use by youth and young adults increases their risk of ever using conventional cigarettes.
• There is conclusive evidence that e-cigarette use increases airborne concentrations of particulate matter and nicotine in indoor environments compared with background levels.
• There is moderate evidence that second-hand exposure to nicotine and particulates is lower from e-cigarettes compared with conventional cigarettes.
• There is no available evidence whether or not e-cigarette use is associated with intermediate cancer endpoints in humans. (An intermediate cancer endpoint is a precursor to the possible development of cancer; for example, polyps are lesions that are intermediate cancer endpoints for colon cancer.)
• There is limited evidence from animal studies using intermediate biomarkers of cancer to support the hypothesis that long-term e-cigarette use could increase the risk of cancer.
• There is no available evidence whether or not e-cigarettes cause respiratory diseases in humans.
• There is moderate evidence for increased cough and wheeze in adolescents who use e-cigarettes, and an increase in asthma exacerbations.
• There is conclusive evidence that e-cigarettes can explode and cause burns and projectile injuries. Such risk is significantly increased when batteries are of poor quality, stored improperly, or are being modified by users.
• There is conclusive evidence that intentional or accidental exposure to e-liquids (from drinking, eye contact, or skin contact) can result in adverse health effects such as seizures, anoxic brain injury, vomiting, and lactic acidosis.
• There is conclusive evidence that intentionally or accidentally drinking or injecting e-liquids can be fatal.
• There is no available evidence whether or not e-cigarettes affect pregnancy outcomes.
• There is insufficient evidence whether or not maternal e-cigarette use affects fetal development."
Bernard Braun, 12.2.18
"Kann eine einzige Zigarette denn noch nennenswert schädlich sein?" - Ja, und zwar deutlich mehr als erwartet!
 Zu den beliebtesten Selbstbeschwichtigungsmantras von Personen, die das Rauchen von Zigaretten eigentlich aufhören wollen, es aber nicht vollständig schaffen, gehört die gegenüber dem "großen" gesundheitlichen Risiko der zuvor täglich gerauchten 20 Zigaretten geschaffte Reduktion auf das vergleichsweise "winzige" gesundheitliche Risiko von einer Zigarette pro Tag.
Zu den beliebtesten Selbstbeschwichtigungsmantras von Personen, die das Rauchen von Zigaretten eigentlich aufhören wollen, es aber nicht vollständig schaffen, gehört die gegenüber dem "großen" gesundheitlichen Risiko der zuvor täglich gerauchten 20 Zigaretten geschaffte Reduktion auf das vergleichsweise "winzige" gesundheitliche Risiko von einer Zigarette pro Tag.
Dass dies ein gewaltiger Irrtum ist zeigt nun eine Metaanalyse von 141 prospektiven Studien zur Assoziation von Rauchen und kardiovaskulären Erkrankungen wie der koronaren Herzerkrankung oder des Schlaganfalls aus den Jahren 1946 und 2015.
Unter rechnerischer Berücksichtigung zahlreicher potenzieller Verzerrungsfaktoren oder Confounder (z.B. Cholesterinwerte, Blutdruck) lauten die wichtigsten Ergebnisse so:
• Frauen, die eine Zigarette pro Tag rauchten hatten gegenüber nichtrauchenden Frauen ein um 119% erhöhtes Risiko für koronare Herzerkrankungen und eine Risikoerhöhung für Schlaganfälle um 46%
• Bei Männern mit einer Zigarette pro Tag betrugen die Risikoerhöhungen 74% und 30%.
• Das Gesamtrisiko betrug beim Vergleich des täglichen Konsums von einer mit dem von 20 Zigaretten nicht etwa das selbstberuhigende Einzwanzigstel, sondern immer noch 64% für Männer und 36% für Frauen (adjustiertes relatives Risiko), ist also nach Ansicht der AutorInnen "much greater than expected".
Unter Hinweis auf andere Studien, in denen auch für "gelegentliche Raucher" keine nennenswerten Risikoreduktionen gefunden werden konnten, kommen die AutorInnen zu folgendem praktischen Schluss: "We show clearly that no safe level of smoking exists for cardiovascular disease at which light smokers can assume that continuing to smoke does not lead to harm. Smokers need to quit completely rather than cut down if they wish to avoid most of the risk associated with heart disease and stroke."
Der am 24. Januar 2018 erschienene Aufsatz Low cigarette consumption and risk of coronary heart disease and stroke: meta-analysis of 141 cohort studies in 55 study reports von Allan Hackshaw et al. ist in der Zeitschrift "British Medical Journal (BMJ)" (360: j3984) komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 25.1.18
Das "Glas Rotwein" zum Abendessen - "gesunde Skepsis" gegen Nutzen für Herzgesundheit, eher gut für die Lebensqualität
 In zahlreichen Studien und zahllosen Abendessenrunden wurde und wird das "Glas Rotwein" oder auch vergleichbar geringe Mengen anderer alkoholischer Getränke als Schutz gegen Herzerkrankungen kommuniziert. Nur wenn es nicht bei dieser Menge bleibt, nähme das Risiko von Herz-Kreislauferkrankungen zu. Im Umkehrschluss: Personen, die dieses "Glas Rotwein" verschmähen, kämen nicht in den Genuss seiner protektiven Wirkung. Viele dieser Thesen werden auch durch einzelne Studien immerr wieder bestätigt.
In zahlreichen Studien und zahllosen Abendessenrunden wurde und wird das "Glas Rotwein" oder auch vergleichbar geringe Mengen anderer alkoholischer Getränke als Schutz gegen Herzerkrankungen kommuniziert. Nur wenn es nicht bei dieser Menge bleibt, nähme das Risiko von Herz-Kreislauferkrankungen zu. Im Umkehrschluss: Personen, die dieses "Glas Rotwein" verschmähen, kämen nicht in den Genuss seiner protektiven Wirkung. Viele dieser Thesen werden auch durch einzelne Studien immerr wieder bestätigt.
Ob die spezifische protektive Wirkung wirklich zutrifft und durch belastbare Studien gesichert ist, versuchte jetzt eine Gruppe us-amerikanischer/kanadischer WissenschaftlerInnen durch eine methodisch anspruchsvolle mehrfach adjustierte (Berücksichtigung von Faktoren, die das Ergebnis modifizieren könnten) Metaanalyse von 45 Querschnitts- und Kohorten-Studien herauszubekommen.
Die wichtigsten Ergebnisse lauten:
• Zunächst finden auch diese ForscherInnen eine Vielzahl von Studien, die bestätigen, dass moderate (bis zu zwei Gläser Wein oder anderer Alkoholika pro Tag) Trinker im Vergleich zu Nichttrinkern oder Abstinenzler geringere Herzerkrankungsraten haben.
• Betrachtet man sich die Ergebnisse und die ihnen zugrundeliegenden Annahmen näher, findet man als erstes, dass viele ältere Nichttrinker früher sehr wohl Alkohol in kleinen oder größeren Mengen getrunken haben und damit aus gesundheitlichen Gründen aufgehört haben. Ein Teil der Abstinenzler im höheren Lebensalter ist also kränker als diejenigen Älteren, die das "Glas Rotwein" trinken, was aber nicht daher rührt, dass sie nie Alkohol getrunken haben.
• Eine weitere Verzerrung entsteht dadurch, dass Senioren, die gesund sind oder sich gesund fühlen wahrscheinlich eher das "Glas Rotwein genießen" als ihre AltersgenossInnen mit Erkrankungen.
• Dies wird durch die genauere Betrachtung einer Teilgruppe der analysierten Studien bestätigt. Diese Studien begannen mit TeilnehmerInnen im Alter von 55 Jahren und jünger, untersuchten gründlich deren Herzgesundheit sowie ihre Trinkgewohnheiten und verfolgten dann die gesundheitliche Entwicklung und das Trinkverhalten bis ins höhere Lebensalter. In diesen Studien findet sich kein signifikanter Nutzen des moderaten Trinkens von Alkohol für die Herzgesundheit.
• Eine Langzeitstudie von 9.100 britischen Erwachsenen im Alter von 23 bis 55 Jahren unterstrich außerdem die skeptische Bewertung des Nutzens moderaten Alkoholgenusses noch aus einer anderen Perspektiven: Erstens waren nur sehr wenige Angehörige dieser Gruppe lebenslange Abstinenzler. Zweitens hatten fast alle 55-jährigen Nichttrinker in den Jahren davor das Trinken von Alkohol beendet. Und schließlich waren Nichttrinker selbst wenn sie erst 23 bis 29 Jahre alt waren körperlich und psychisch kränker als diejenigen, die moderat tranken und nicht rauchten. Nichttrinker waren im Durchschnitt auch weniger gebildet und damit bei einem wichtigen lebenslangen Einflussfaktor auf die gesamte Gesundheit benachteiligt.
• Darüber hinaus listen die ForscherInnen noch für 38 der 45 untersuchten Studien eine Fülle von nicht berücksichtigten verzerrenden Faktoren auf, darunter die fehlende Unterscheidung von heutigen, früheren und gelegentlichen Alkoholtrinkern und kontinuierlichen Abstinenzlern. In 16 Studien werden außerdem unangemessene Maßeinheiten für den Alkoholkonsum verwendet. Insgesamt finden sich hier interessante Einblicke in die Menge von Verzerrungsmöglichkeiten - auch wichtig für die Bewertung anderer Untersuchungen.
• Alles in Allem kommen die AutorInnen zu folgendem Schluss: "Our major conclusion is that the hypothesis that low-volume alcohol use can confer cardio-protection cannot be confirmed, because there remain plausible alternative explanations for the observed findings."
• Da die gesundheitlichen Risiken moderaten Alkoholkonsums klein sind, sollten aber die Personen, die dies als ein Stück ihrer Lebensqualität genießen nach Meinung der AutorInnen keinesfalls damit aufhören. Nur diejenigen, die dies nur wegen des erwarteten Gesundheitseffekts tun, sollten sich das überlegen.
Die Studie Alcohol Consumption and Mortality From Coronary Heart Disease: An Updated Meta-Analysis of Cohort Studies von Jinhui Zhao, Tim Stockwell, Audra Roemer, Timothy Naimi und Tanya Chikritzhs ist am 22. Mai 2017 in der Fachzeitschrift "Journal of Studies on Alcohol and Drugs" (78 (3): 375) veröffentlicht und komplett kostenlos erhältlich.
Insgesamt bestätigt diese Metaanalyse die Ergebnisse einer 2016 veröffentlichten Studie über die Auswirkungen moderaten Trinkens auf das Sterblichkeitsrisiko: Do "Moderate" Drinkers Have Reduced Mortality Risk? A Systematic Review and Meta-Analysis of Alcohol Consumption and All-Cause Mortality von Timm Stockwell et al. in "Journal of Studies on Alcohol and Drugs" (77(2), 185-198). Das Ergebnis zusammengefasst: "Estimates of mortality risk from alcohol are significantly altered by study design and characteristics. Meta-analyses adjusting for these factors find that low-volume alcohol consumption has no net mortality benefit compared with lifetime abstention or occasional drinking." Das Abstract ist kostenlos erhältlich
Bernard Braun, 24.5.17
Weniger fettes Essen=weniger Herzinfarkttote!? Beispiel für von Beginn an fehlende Evidenz für zu einfache Gesundheitsempfehlungen
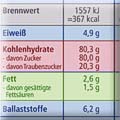 Es vergeht kein Jahr in dem nicht mit diversen methodisch einfachen Studien ein Nahrungsmittel oder seine wesentlichen Bestandteile, eine Bewegungsart oder sonstige Stoffe und Verhaltensweisen als lebensqualitätsverbesserndes oder lebensverlängerndes Mittel angepriesen wird. Und wenn dies nur lang genug und werbewirksam geschieht, tauchen viele dieser Mittel auch in Leitlinien und offiziösen Empfehlungen staatlicher Gesundheitsinstitute und in einer schier unüberschaubaren Vielzahl von Gesundheitsratgebern oder Krankenkassen-Magazinen auf. Und wenn sie erst einmal dort stehen, wird der tatsächliche Nutzen von "low cholesterol", "low fat", "no fat", Broccoli oder "no saturated fat" nicht mehr überprüft.
Es vergeht kein Jahr in dem nicht mit diversen methodisch einfachen Studien ein Nahrungsmittel oder seine wesentlichen Bestandteile, eine Bewegungsart oder sonstige Stoffe und Verhaltensweisen als lebensqualitätsverbesserndes oder lebensverlängerndes Mittel angepriesen wird. Und wenn dies nur lang genug und werbewirksam geschieht, tauchen viele dieser Mittel auch in Leitlinien und offiziösen Empfehlungen staatlicher Gesundheitsinstitute und in einer schier unüberschaubaren Vielzahl von Gesundheitsratgebern oder Krankenkassen-Magazinen auf. Und wenn sie erst einmal dort stehen, wird der tatsächliche Nutzen von "low cholesterol", "low fat", "no fat", Broccoli oder "no saturated fat" nicht mehr überprüft.
Dass dies Millionen von Menschen desinformiert, zu weitgehend nutzlosem Verhalten verführt und warum eine systematische Überprüfung der Evidenz solcher Gesundheitstipps auf der Basis von methodisch guten Studien viel Unsinn vermeiden oder korrigieren kann, zeigt ein jetzt veröffentlichter systematischer Review der Studienlage zu Beginn der Einführung von Nahrungsmittelfett-Leitlinien in den USA und Großbritannien in den Jahren 1977 und 1983. Die an damals 220 Millionen US-Amerikaner und 56 Millionen Briten gerichteten nationalen und regierungsamtlichen Empfehlungen basierten auf der festen Annahme, dass eine Reduktion der Aufnahme von Fett durch Nahrungsmittel zu einer Reduktion der Sterblichkeit an der koronaren Herzkrankheit führen würde.
Schottische und walisische Wissenschaftler untersuchten im Jahr 2015, also 39 und 33 Jahre nach der Veröffentlichung und dem Start einer Erfolgsgeschichte dieser Leitlinien, in einem systematischen Review, ob Daten aus randomisierten kontrollierten Studien oder prospektiven Kohortenstudien vor der Erstellung dieser Empfehlungen die Evidenz für sie lieferten bzw. hätten liefern können.
Ihr Schluss nach der Sichtung von 6 Studien mit 31.445 Teilnehmern: "we found no support for the recommendations to restrict dietary fat", da keine dieser Studien eine statistisch signifikante Beziehung zwischen der Sterblichkeit an koronarer Herzkrankheit und der gesamten Aufnahme von Nahrungsmittelfetten - auch von so genannten gesättigten Fettsäuren - aufzeigte. Hinzu kommt, dass die damals vorliegenden Studien ausschließlich mit Männern gemacht wurden. Selbst wenn ihre Ergebnisse also anders ausgesehen hätten, hätten daraus keine bevölkerungsweiten Empfehlungen abgeleitet werden dürfen.
Angesichts der existierenden Fülle ähnlicher Empfehlungen lohnen sich vergleichbare systematische Reviews vor allem für diejenigen Kranken oder Gesunden, die ihnen mit hohen präventiven oder kurativen Erwartungen folgen und darüber möglicherweise wirklich hilfreiche Mittel nicht nutzen. Dies bedeutet nicht, dass umgekehrt die folgenlose Aufnahme großer Mengen von Fett jedweder Art gerechtfertigt ist, sondern nur, dass dies nicht todsicher zum Herzinfarkt führt.
Die aktuellste Fassung des Reviews Evidence from prospective cohort studies did not support the introduction of dietary fat guidelines in 1977 and 1983: a systematic review von Zoë Harcombe et al. ist am 29. Juni 2016 online in der Zeitschrift "British Journal of Sports Medicine" erschienen. Sein Abstract ist kostenlos.
Eine komplett kostenlose, etwas ältere und inhaltlich leicht unterschiedliche Fassung des Reviews ist bereits 2015 unter dem Titel Evidence from randomised controlled trials did not support the introduction of dietary fat guidelines in 1977 and 1983: a systematic review and meta-analysis ebenfalls mit den AutorInnen Zoë Harcombe et al. in der Zeitschrift "Open Heart" (2(1) erschienen.
In derselben Ausgabe weist der Autor Rahul Bahl auf die methodischen (z.B. Grenzen der Ergebnisfähigkeit von RCTs durch zu geringe Teilnehmeranzahl oder zu kurze Interventionszeit- und follow-up-Zeit; Schwäche von Meta-Analysen aufgrund der Schwäche der inkludierten Einzelstudien) und inhaltlichen Schwachstellen der Studie von Harcombe et al. hin und (The evidence base for fat guidelines: a balanced diet), bestätigt aber im Grunde die Kritik an den vielfach evidenzfreien oder zu einfach gestrickten oder einfaktoriellen Empfehlungen und verbaut auch gleich das beliebte Spiel, bei Kritik an der Evidenz für den Nutzen des einen Stoffes auf einen anderen umzusteigen: "There is certainly a strong argument that an overreliance in public health on saturated fat as the main dietary villain for cardiovascular disease has distracted from the risks posed by other nutrients such as carbohydrates. Yet replacing one caricature with another does not feel like a solution. It is plausible that both can be harmful or indeed that the relationship between diet and cardiovascular risk is more complex than a series of simple relationships with the proportions of individual macronutrients." Dieser Kommentar ist ebenfalls komplett kostenlos erhältlich.
Ähnliche Argumente finden sich in dem materialreichen Beitrag Saturated fat: guidelines to reduce coronary heart disease risk are still valid des britischen Ernährungswissenschaftlers Bruce Griffin in der Zeitschrift der britischen "Royal Pharmaceutical Society" "The Pharmaceutical Journal" vom 8. April 2015. Dessen Schluss steht nicht nur im Gegensdatz zu manchen vorherigen methodischen Einwänden, sondern wirkt dann aber doch zu salomonisch: "Despite recent studies suggesting no link between saturated fat and CHD (koronare Herzerkrankungen), once you scrutinise the evidence, there is no question that too much saturated fat is bad for your health. Of course, a balanced nutritious diet remains the best way to prevent CHD and metabolic diseases (z.B. Diabetes)." Wie der Titel des Beitrags signalisiert, plädiert Griffin aber uneingeschränkt für die Fortexistenz der bisherigen Fett-Leitlinien in den USA und Großbritannien.
Dass Harcombe et al. mit ihrer Kritik an der mangelnden Evidenz der US-/UK-Fettleitlinien nicht allein sind, zeigen schließlich auch noch die Ergebnisse eines weiteren aktuellen systematischen Reviews und einer Meta-Analyse von neueren Beobachtungsstudien über mögliche Zusammenhänge des Verzehrs gesättigter Fettsäuren und ungesättigter so genannten Trans-Fettsäuren oder Transfetten mit der Gesamtsterblichkeit bzw. der Sterblichkeit an koronaren Herzerkrankungen, Schlaganfall und Typ 2 Diabetes.
Die Ergebnisse lauten zusammengefasst so: "The certainty of associations between saturated fat and all outcomes was "very low." The certainty of associations of trans fat with CHD outcomes was "moderate" and "very low" to "low" for other associations."
In Kenntnis der bisherigen Debatten weisen die AutorInnen vorsorglich darauf hin, bei künftigen Vorschlägen z.B. zum Ersatz von gesättigten Fettsäuren oder Transfetten sorgfältig die gesundheitlichen Effekte der Alternativprodukte zu prüfen.
Die am 12. August 2015 online in der Fachzeitschrift "British Medical Journal" veröffentlichte Studie Intake of saturated and trans unsaturated fatty acids and risk of all cause mortality, cardiovascular disease, and type 2 diabetes: systematic review and meta-analysis of observational studies von Russell de Souza et al. ist komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 4.7.16
"Die Studie zum Sonntag" - Frauen, die mehr als 1x pro Woche in einen Gottesdienst gehen, leben länger und gesünder
 Dass soziale Sicht- und Verhaltensweisen etwas mit Religion bzw. speziell mit der protestantischen Ethik zu tun haben, halten viele Menschen seit und mit Max Weber als gesichert. Andere Studien hoben außerdem immer wieder Zusammenhänge von Religiosität dies- und jenseits der verschiedenen Religionen und Gesundheit hervor. Gläubige sollten generell oder zumindest hinsichtlich bestimmter Erkrankungen gesünder sein. Was oft umstritten war, ist die Richtung des möglicherweise sogar kausalen Zusammenhangs: Sind also Gläubige gesünder oder sind Gesunde eher gläubig.
Dass soziale Sicht- und Verhaltensweisen etwas mit Religion bzw. speziell mit der protestantischen Ethik zu tun haben, halten viele Menschen seit und mit Max Weber als gesichert. Andere Studien hoben außerdem immer wieder Zusammenhänge von Religiosität dies- und jenseits der verschiedenen Religionen und Gesundheit hervor. Gläubige sollten generell oder zumindest hinsichtlich bestimmter Erkrankungen gesünder sein. Was oft umstritten war, ist die Richtung des möglicherweise sogar kausalen Zusammenhangs: Sind also Gläubige gesünder oder sind Gesunde eher gläubig.
Die Ergebnisse der mit 74.534 über 16 Jahre (1996 bis 2012) beobachteten bzw. befragten Teilnehmerinnen (Angehörige der so genannten "Nurses' Healthy Study") größten und methodisch aufwändigsten Untersuchung dieses Zusammenhangs liegen seit dem 16. Mai 2016 vor und sehen so aus:
• Von den Frauen, die zu Beginn der Studie an keiner kardiovaskulären Erkrankung litten oder an Krebs erkrankt waren, starben im Untersuchungszeitraum 13.537. Davon 2.721 an einer kardiovaskulären Erkrankung und 4.479 an Krebs.
• Nach der Adjustierung einer Vielzahl von soziodemografischen Merkmalen, Lebensstilfaktoren, Risikofaktoren, dem Niveau der sozialen Integration und dem Besuch religiöser Veranstaltungen im Jahr 1992 und von Faktoren, die erlaubten, die Richtung der Zusammenhänge zu bestimmen, war die Gesamtsterblichkeit in der Gruppe der Personen, die mehr als einmal pro Woche eine religiöse Veranstaltung besuchten, signifikant um 33% geringer als bei den Personen, die dies während des gesamten Untersuchungszeitraums nie machten. Dieses Risiko war bei den Personen, die einmal wöchentlich einen Gottesdienst besuchten um 26% niedriger und bei denjenigen, die dies weniger als einmal pro Woche machten um 13% geringer - immer gegenüber den Nie-Besuchern von religiösen Veranstaltungen. Die AutorInnen kommen zu dem Schluss, dass der mehrmalige Besuch religiöser Veranstaltungen in der Woche einen signifikanten positiven Effekt auf die Gesamtmortalität und krankheitsspezifische Mortalität hat und schließen die Möglichkeit einer "reverse causation" aus. Die intensiven Kirchgänger lebten im Durchschnitt 5 Monate länger.
• Die Risikorate (hazard ratio) für die kardiovaskuläre Sterblichkeit war bei den intensiven Kirchgängern 27% und die für Krebs um 21% niedriger als bei den Nicht-Kirchgängern.
• Interessant ist die Beobachtung, dass der positive Gesamteffekt des häufigen Kirchgangs seinerseits durch eine Reihe von Einzelfaktoren oder Mediatoren erklärt wird, die nichts mit der Religosität im engeren Sinne zu tun haben. So erklärt eine hohe soziale Unterstützung 23%, die Depressivität 11%, das Rauchen 22% und der Grad einer optimistischen Sicht der Welt 9% der geringeren Mortalität. Praktisch könnte also ein Teil der Lebensverlängerung auch durch den Besuch anderer sozialer und rauchfreier Veranstaltungen oder Institutionen erreicht werden.
Trotz allen methodischen Aufwands weisen die AutorInnen aber auf Grenzen der Verallgemeinerbarkeit ihrer Studie hin. Bei den Teilnehmerinnen handelt es sich hauptsächlich um weiße christliche Krankenschwestern, also mit einem relativ einbheitlichen Sozialstatus, die dazu noch ein überdurchschnittliches Gesundheitsbewusstsein haben dürften.
Die Studie Association of Religious Service Attendance with Mortality Among Women von Shanshan Li, Meir J. Stampfer, David R. Williams und Tyler J. VanderWeele ist am 16.5. 2016 online in der Fachzeitschrift "JAMA Internal Medicine" erschienen. Ein Abstract ist kostenlos erhältlich
Bernard Braun, 22.5.16
Hilft das Wissen über genetische Risiken das Gesundheitsverhalten zu verändern und sind Therapien nah? Nein, eher nicht!!
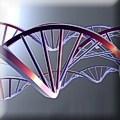 Zu den hartnäckigen mit dem Angebot von Analysen der individuellen genetischen Dispositionen und Risiken verbundenen Erwartungen und Versprechungen zu ihrem Nutzen gehört (vgl. dazu u.a. den Beitrag Das Geschäft mit Genomanalysen für Privatpersonen blüht: Krankheitsrisiken, Ernährungsratschläge, Empfehlungen zur Partnerwahl in diesem Forum), dass die NutzerInnen durch die Kenntnis ihrer DNA-basierten Erkrankungs- oder gar Sterberisiken motiviert würden gezielt ihr risikobezogenes Verhalten zu verändern. Wer also ein genetisch erkennbares und bekanntes Übergewichts- oder Herzinfarktsrisiko hat, könne und würde also seine Ernährung umstellen, das Rauchen aufhören oder sich mehr bewegen - so jedenfalls die Welt aus Sicht der Anbieter der entsprechenden Gentests.
Zu den hartnäckigen mit dem Angebot von Analysen der individuellen genetischen Dispositionen und Risiken verbundenen Erwartungen und Versprechungen zu ihrem Nutzen gehört (vgl. dazu u.a. den Beitrag Das Geschäft mit Genomanalysen für Privatpersonen blüht: Krankheitsrisiken, Ernährungsratschläge, Empfehlungen zur Partnerwahl in diesem Forum), dass die NutzerInnen durch die Kenntnis ihrer DNA-basierten Erkrankungs- oder gar Sterberisiken motiviert würden gezielt ihr risikobezogenes Verhalten zu verändern. Wer also ein genetisch erkennbares und bekanntes Übergewichts- oder Herzinfarktsrisiko hat, könne und würde also seine Ernährung umstellen, das Rauchen aufhören oder sich mehr bewegen - so jedenfalls die Welt aus Sicht der Anbieter der entsprechenden Gentests.
Angesichts der erkennbaren Zunahme des Angebots und der Nutzung solcher Tests erschien bereits 2010 ein erster Cochrane Review, der auf der Basis von damals 7 methodisch hochwertigen Studien überprüfte, ob die Welt so oder anders aussieht.
Angereichert mit den Ergebnissen von weiteren 11 Studien (nach den Kriterien von Cochrane Reviews ausgewählt nach Sichtung von 10.515 Studienabstracts) mit jeweils mehreren tausend TeilnehmerInnen erschien am 15. März 2016 ein Update dieses Reviews. Vorgestellt werden die Wirkungen der Kommunikation über Gentestergebnisse auf sieben Arten von Gesundheitsverhalten: Rauchen, Ernährung, körperliche Aktivitäten, Alkoholtrinken, Arzneimitteleinnahme, Sonnenschutz und Nutzung von Screeninguntersuchungen sowie verhaltensunterstützender Programme.
Die Ergebnisse lauten so:
• Für keine der genannten Verhaltensarten gab es einen statistisch (u.a. mit Meta-Analysen) signifikanten Effekt der Kommunikation über D• -basierte Risikoschätzungen auf das konkrete Verhalten, also z.B. mehr körperliche Bewegung oder die Beendigung des Rauchens.
• Es gab auch keine gesichert nachweisbaren Effekte auf die Motivation für Verhaltensänderungen.
• Nicht nachweisbar waren aber auch unerwünschte Effekte der Kenntnis genetischer Risiken, wie Depression oder Angst.
• Die Analyse von Untergruppen der StudienteilnehmerInnen lieferten außerdem keine klare Evidenz, dass die Kenntnis der individuellen genetischen Struktur (Genotyp) das Verhalten mehr beeinflusst als deren Nichtkenntnis.
Trotz der Eindeutigkeit der Studienlage weisen die AutorInnen des Cochrane Review aber aber auf das bisher hohe oder unklare Risiko von Verzerrungen in den analysierten Studien und die geringe Qualität der daraus gewonnenen Evidenz ("high or unclear risk of bias, and evidence was typically of low quality") hin.
Trotzdem sollte ihre Zusammenfassung der Evidenz jede Hoffnung, dass man etwas so Komplexes wie das gesundheitsbezogene Verhalten mit den Ergebnissen von Gentests steuern könne, abbremsen, wenn nicht gar stoppen: "Existing evidence does not support expectations that such interventions could play a major role in motivating behaviour change to improve population health."
Unabhängig davon verdienen aber die Fortschritte der DNA-Analysen mit den dadurch gewonnenen Einsichten in die Komplexität von Erkrankungen, die Untergruppen von Erkrankten und die möglichen positiven Auswirkungen auf die Entwicklung wirksamer Therapeutika auch hohe Aufmerksamkeit von Gesundheitswissenschaftlern.
Zum Einlesen und einem Hauch von Problembewusstsein lohnt sich z.B. ein ebenfalls gerade erschienener Aufsatz über die Bestimmung von molekularen Untertypen von jungen Personen mit einer neurologischen Entwicklungsstörung wie Autismus, intellektuelle Behinderung, Epilepsie oder Schizophrenie.
Die Autoren beginnen mit einer keineswegs selbstverständlichen zurückhaltenden Vorstellung ihres Versuchs, Patienten mit diesen Erkrankungen genetisch zu differenzieren und erst dann therapeutische Verbesserungen liefern zu können: "We propose that grouping patients on the basis of a shared genetic etiology is a critical first step in tailoring improved therapeutics to a defined subset of patients."
Was dies trotz modernster und schnellster Gen-Sequenziertechnik rein quantitativ bedeutet, machen sie daran klar, dass zwischen 500 und 1.000 Gene zur Ätiologie des Autismus beitragen, hinter intellektuellen Behinderungen mehr als 1.000 Gene stehen und auch an Epilepsie und Schizophrenie 500 bzw. 600 Gene beteiligt sind.
Selbst dann, wenn diese Zusammenhänge quantitativ zutreffend sind, räumen die AutorInnen ein, dass "hundreds of ND risk genes remain undiscovered or have not been associated with NDs with sufficient statistical significance owing to ultra-low mutation frequencies in the patient population".
Damit wird auch klar warum sie bei praktischen Ergebnissen dieser Forschung insgesamt zurückhaltend argumentieren: "Classifying patients into subgroups with a common genetic etiology and applying treatments tailored to the specific molecular defect they carry is likely to improve management of neurodevelopmental disease in the future."
Ob andere Studien mit wesentlich bestimmteren Aussagen über die strenge Determiniertheit anderer Krankheiten durch wenige Gene bzw. deren Mutationen und bevorstehende oder bald mögliche gentechnische Interventionen, wirklich zutreffen, lohnt eine intensivere Beschäftigung - trotz der zum Teil schwer verständlichen Fachbegrifflichkeiten.
Der Review The impact of communicating genetic risks of disease on risk-reducing health behaviour: systematic review with meta-analysis. von Hollands GJ, French DP, Griffin SJ, Prevost AT, Sutton S, King S und Marteau TM ist im Fachjournal "British Medical Journal" (352: i1102) als open access-Text erschienen und damit vollständig kostenlos erhältlich.
Das ausgewählte Beispiel aus der laufenden gentechnischen und -medizinischen Forschung Molecular subtyping and improved treatment of neurodevelopmental disease von Holly A. F. Stessman, Tychele N. Turner und Evan E. Eichler ist am 25. Februar 2015 als "open access"-Aufsatz in der Fachzeitschrift "Genome Medicine" (8: 22) erschienen und kostenlos erhältlich. Sämtliche dort veröffentlichten Fachaufsätze kann man nach einer Anmeldung kostenlos erhalten.
Bernard Braun, 25.3.16
"Warum denn in die Ferne schweifen, wenn das Gute wächst so nah": Raps- statt Olivenöl oder Beispiel für die Grenzen von Studien!
 Den Verfassern der Meldung auf der "Medknowledge"-Website ist die Einführung eines völlig neuen Kriteriums zur Bewertung gesundheitsrelevanter Stoffe zu verdanken: "Zudem ist es ein deutsches Regionalprodukt, welches überall und günstig erworben werden kann."
Den Verfassern der Meldung auf der "Medknowledge"-Website ist die Einführung eines völlig neuen Kriteriums zur Bewertung gesundheitsrelevanter Stoffe zu verdanken: "Zudem ist es ein deutsches Regionalprodukt, welches überall und günstig erworben werden kann."
"Es" ist Rapsöl, das nach einer gerade veröffentlichten randomisierten kontrollierten Studie "mindestens genauso gesund wie Olivenöl ist, und kardiovaskuläre Risikofaktoren mindert."
Um zu diesem Ergebnis zu kommen, überprüften Wissenschaftler bei insgesamt 18 leicht bis mittelmäßig übergewichtigen oder adipösen Männern (BMI 27 bis 35) über 4 Wochen lang den Einfluss des Verzehrs von täglich 50 Gramm Olivenöl, also dem als höchst gesundheitsfördernd erachteten Hauptbestandteil der so genannten Mittelmeerdiät, und derselben Menge Rapsöl auf eine Reihe von adipositasassoziierten Körperwerten (z.B. Cholesterinwerte, Entzündungsprozesse).
Die Ergebnisse bestätigen rein arithmetisch die dem Olivenöl ebenbürtige wenn nicht sogar zum Teil überlegene Wirksamkeit von Rapsöl.
Bevor jetzt aber allzu viel Euphorie über die Möglichkeiten einer rein deutschen Rapsanbaugegend-Diät ausbricht, sollte dem selbstkritischen Hinweis der ausschließlich deutschen AutorInnen, das Ergebnis beruhe auf Wirkungen bei 18 bzw. 9 Personen und einer Nutzungszeit von vier Wochen, mehr Beachtung geschenkt werden. Warum auf so schmaler Basis dann aber Studien durchgeführt und veröffentlich werden, hat vermutlich mehr mit der Jagd nach bibliometrisch relevanten Impact-Punkten zu tun als mit einem wirklichem Interesse an der Aufklärung über die gesundheitlichen Wirkungen von Raps- oder Olivenöl. Warum es aber auch zu solchen Ergebnissen kommt, verbirgt sich hinter dem immerhin offengelegten finanziellen Hintergrund bzw. potenziellem Interessenkonflikt dieser Studie: "This project has been funded in part by a grant from the Union zur Förderung von Oel-und Proteinpflanzen e.V.,Germany".
Unabhängig davon, wer oder was hinter den Studienergebnissen stecken mag, hat aber Rapsöl sicherlich seinen Wert, ist bekömmlich und in jedem Fall bisher garantiert billiger als die Spitzenprodukte der mediterranen Olivenproduzenten.
Die Studie Dietary rapeseed/canola-oil supplementation reduces serum lipids and liver enzymes and alters postprandial inflammatory responses in adipose tissue compared to olive-oil supplementation in obese men von M. Kruse et al. ist zuerst online am 18. November 2014 in der Fachzeitschrift "Molecular Nutrition & Food Research" erschienen. Das Abstract ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 4.2.15
Wie wirken sich viele kürzere Episoden von Arbeitslosigkeit auf Gesundheit und Gesundheitsverhalten aus? Sehr unterschiedlich!
 Mittlerweile bestehen kaum mehr Zweifel daran und gibt es auch ausreichend Daten dafür, dass Langzeitarbeitslosigkeit die Gesundheit der Davon Betroffenen erheblich belastet und verschlechtert. Dass in vielen Ländern neben den Langzeit- und Dauerarbeitslosen aber auch viele Beschäftigte über lange Zeiten häufigere mehr oder weniger kurze Episoden oder Phasen von Arbeitslosigkeit erfahren und damit kumulativ Arbeitslosigkeitsbedrohungen und -zeiten haben, die nicht arg viel kürzer sind als manche Langzeitarbeitslosigkeit, ist eine Tatsache, wurde aber bisher nicht auf ihre Auswirkung auf Gesundheit untersucht.
Mittlerweile bestehen kaum mehr Zweifel daran und gibt es auch ausreichend Daten dafür, dass Langzeitarbeitslosigkeit die Gesundheit der Davon Betroffenen erheblich belastet und verschlechtert. Dass in vielen Ländern neben den Langzeit- und Dauerarbeitslosen aber auch viele Beschäftigte über lange Zeiten häufigere mehr oder weniger kurze Episoden oder Phasen von Arbeitslosigkeit erfahren und damit kumulativ Arbeitslosigkeitsbedrohungen und -zeiten haben, die nicht arg viel kürzer sind als manche Langzeitarbeitslosigkeit, ist eine Tatsache, wurde aber bisher nicht auf ihre Auswirkung auf Gesundheit untersucht.
Dies ändert sich nun durch eine Langzeitstudie eines 1.083 Personen umfassenden Schuljahrgangs in einer nordschwedischen Stadt, deren Arbeits-, Gesundheits- und Gesundheitsverhaltensbiografien über 14 Jahre mittels regelmäßiger Befragungen untersucht wurden.
Die Ergebnisse sahen so aus:
• Der gesundheitliche Zustand (z.B. Depression, somatische Symptome) und das Gesundheitsverhalten (z.B. Arztbesuche, Rauchen, Alkoholkonsum) korrelieren "dosis"abhängig mit der kumulativen Dauer von Arbeitslosigkeit.
• Hierbei gibt es aber beträchtliche Unterschiede zwischen Männern und Frauen: Während sich der gesundheitliche Zustand der Männer unter dem Einfluss kumulativer Arbeitslosigkeit kaum veränderte oder sich gesundheitliche Symptome sogar verringerten, verschlechterte sich die Gesundheit der Frauen unter denselben Bedingungen erheblich. Genau umgekehrt sieht der Zusammenhang von kumulativer Arbeitslosigkeit und dem Gesundheitsverhalten aus: Während das Verhalten der Frauen relativ gering mit der Summe der Arbeitslosigkeitszeiten verknüpft war, verschlechterte es sich bei den Männern unter denselben Bedingungen beträchtlich.
Die AutorInnen appellieren daher an die Arbeitsmarkt- und Gesundheitspolitiker, auch der Aneinanderreihung kurzer Arbeitslosigkeitsepisoden mehr gesundheitspräventive Aufmerksamkeit zu schenken als bisher. Ob dies in anderen Teilen Schwedens und in anderen Ländern auch so ist und woran dies liegt, bleibt weiteren Studien überlassen.
Der Aufsatz Length of unemployment and health-related outcomes: a life-course analysis von Urban Janlert, Anthony H Winefield und Anne Hammarström ist am 23. November 2014 "online first" in der Zeitschrift "European Journal of Public Health" erschienen und ein Abstract ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 30.11.14
"Milch macht müde Männer munter", "Vorsicht Milch" oder Vorsicht Beobachtungsstudie?
 Eine im renommierten Medizinjournal "British Medical Journal (BMJ)" gerade veröffentlichte Studie zu möglichen Assoziationen zwischen einem hohen Milchkonsum und höherer Mortalität bei gleichzeitigem Fehlen des präventiven Nutzens von Milch gegen Knochenbrüche, erzeugt nicht nur Aufregung bei der Milchwirtschaft, sondern stellt auch ein Beispiel für mehrere in der Debatte über den gesundheitlichen Nutzen von Produkten und Dienstleistungen kritische Aspekte dar.
Eine im renommierten Medizinjournal "British Medical Journal (BMJ)" gerade veröffentlichte Studie zu möglichen Assoziationen zwischen einem hohen Milchkonsum und höherer Mortalität bei gleichzeitigem Fehlen des präventiven Nutzens von Milch gegen Knochenbrüche, erzeugt nicht nur Aufregung bei der Milchwirtschaft, sondern stellt auch ein Beispiel für mehrere in der Debatte über den gesundheitlichen Nutzen von Produkten und Dienstleistungen kritische Aspekte dar.
Doch zunächst zu den Ergebnissen der Studie: Bei den Angehörigen zweier großer Kohorten von 61.433 schwedischen Frauen, die im Startzeitraum 1987-90 39 bis 74 Jahre alt waren, und von 45.339 schwedischen Männer, die zum Startzeitpunkt 1997 45 bis 79 Jahree alt waren, wurden regelmäßig die Ernährungsgewohnheiten erhoben - darunter auch der Konsum von Milch. Nach einer durchschnittlichen Follow-up-Zeit von 20,1 Jahren waren 15.541 Frauen gestorben und 17.252 hatten einen Knochenbruch hinter sich, 4.259 eine Hüftfraktur. Nach durchschnittlich 11,2 Jahren Beobachtungszeit waren 10.112 der Männer tot und 5.066 hatten einen Knochenbruch, 1.166 einen Bruch der Hüfte.
Unter Berücksichtigung einer Reihe weiterer Faktoren berechneten die ForscherInnen, ob es eine statistische Assoziation zwischen der Menge des Milchkonsums, der generellen Sterblichkeit und von Knochenbrüchen gab. Aus bisherigen teils kleineren oder wesentlich kürzeren Studien war erwartet worden, dass sich Milch positiv auswirkt. Das Gegenteil war aber der Fall: Bei den Frauen, die drei oder mehr Gläser Milch pro Tag tranken, war das Sterblichkeitsrisiko fast doppelt so hoch wie bei Frauen, die nur ein Glas pro Tag tranken (hazard ratio 1,93). Bei den Männern war diese Assoziation mit einer hazard ratio von 1,10 kleiner aber immer noch signifikant. Hinzu kommt, dass zumindest bei Frauen das allgemeine Risiko einer Fraktur und das besondere einer Hüftfraktur mit dem Konsum von Milch zunahmen.
Vor jeder weiteren Diskussion sei erwähnt, dass die AutorInnen der Studie selber eine unabhängige Replikation ihrer Ergebnisse für notwendig halten "before they can be used for dietary recommendations."
Wenn aber ein Nahrungsmittel, das geradezu volkstümlich und fast von der Wiege bis zur Bahre als "gesund" betrachtet, verabreicht und in jeder Form zu sich genommen wird, plötzlich so an Glanz verliert und in zweifacher Hinsicht eher "ungesund" erscheint, stellt sich die Frage, wie damit umgegangen wird.
• Erstens könnten und sollten solche Ergebnisse die Sensibilität für die Möglichkeiten und Grenzen bzw. die Aussagekraft der gewählten Studienmethodik schärfen. Zu Recht monieren die Kritiker der Ergebnisse es handle sich um "eine reine Beobachtungsstudie, deren Ergebnisse immer sehr vorsichtig interpretiert werden müssen." Dass die im selben Atemzug dagegen gehaltene "allgemeine Studien- und Datenlage", die "klar den Gesundheitswert von Milch und Milchprodukten (belegt)" auch zum großen Teil aus Beobachtungsstudien oder Schlussfolgerungen von Inhaltsstoffen der Milch auf eine gesundheitliche Wirksamkeit und nicht aus randomisierten kontrollierten Studien bestehen, wird dabei lieber verschwiegen. So könnten also auch die beobachteten positiven gesundheitlichen Effekte der Milch in der von der Milchwirtschaft präferierten Studien die Wirkung anderer Nahrungsmittel oder Einwirkungen sein.
• Zweitens demonstrieren die Ergebnisse aber die Notwendigkeit, auch den Nutzen und die Schadensfreiheit vieler natürlicher und nahezu automatisch als "gesund" geltender Stoffe und Lebensmittel systematisch zu überprüfen.
Die am 28. Oktober 2014 im BMJ (349: g6015) publizierte Studie Milk intake and risk of mortality and fractures in women and men: cohort studies von Karl Michaëlsson et al. ist komplett kostenlos erhältlich uind enthält noch eine Fülle weiterer interessanter Hinweise auf mögliche Erklärungen für die gewonnenen Ergebnisse.
Eine kurze kritische Auseinandersetzung mit den Ergebnissen der schwedischen Studie lieferte z.B. die Landesvereinigung der Milchwirtschaft Niedersachsen e. V. unter der Überschrift Milchstudie sorgt für Aufregung am 31. Oktober 2014 und will die Studie weiter durchleuchten lassen.
Bernard Braun, 2.11.14
Pro und Contra zur Politik der Legalisierung von Cannabis in den USA - Vorbild für Deutschland!?
 Während die meisten Politiker in Deutschland die empirischen Entscheidungen über den legalen Gebrauch von Cannabis fast vollkommen den Gerichten überlassen (zuletzt das Urteil des Verwaltungsgerichts Köln über den unter vielen Einschränkungen legalen Anbau von Cannabis in Wohnungen von schwer kranken Personen, Überblick nicht Urteilstext), ist die Debatte in den USA wesentlich mehr durch politische Grundsatzdebatten, die Gesetzgebung in zahlreichen Bundesstaaten, durch weniger letztlich hemmenden Einschränkungen und durch Diskurse in prominenten Medien getragen. Dies verdient u.a. deshalb besondere Aufmerksamkeit, weil die USA über viele Jahrzehnte mit dem für sie fundamentalistischen Furor den "war on drug" geführt haben und das Vorbild für die Drogenpolitik in vielen anderen Ländern war.
Während die meisten Politiker in Deutschland die empirischen Entscheidungen über den legalen Gebrauch von Cannabis fast vollkommen den Gerichten überlassen (zuletzt das Urteil des Verwaltungsgerichts Köln über den unter vielen Einschränkungen legalen Anbau von Cannabis in Wohnungen von schwer kranken Personen, Überblick nicht Urteilstext), ist die Debatte in den USA wesentlich mehr durch politische Grundsatzdebatten, die Gesetzgebung in zahlreichen Bundesstaaten, durch weniger letztlich hemmenden Einschränkungen und durch Diskurse in prominenten Medien getragen. Dies verdient u.a. deshalb besondere Aufmerksamkeit, weil die USA über viele Jahrzehnte mit dem für sie fundamentalistischen Furor den "war on drug" geführt haben und das Vorbild für die Drogenpolitik in vielen anderen Ländern war.
Im Moment leben 4% der US-Bevölkerung in Bundesstaaten, die den Gebrauch von Cannabis für medizinische Zwecke aber auch zum Zwecke der Erholung und der Verbesserung der Lebensqualität für 21-Jährige und Ältere legalisiert haben.
33% der Einwohner leben in Bundesstaaten, die den Gebrauch für medizinische Zwecke legalisierten und zusätzlich eine Reihe von Entkriminalisierungsregelungen beschlossen.
4% der Bevölkerung leben mit Bundesstaats-Gesetzen, die den Handel und Gebrauch systematisch entkriminalisieren.
35% können Cannabis für medizinische Zwecke und Cannabis mit geringem Wirkstoffgehalt legal erwerben und verwenden
Der Rest, also 24% der US-Bevölkerung, leben noch unter vollkommenen prohibitiven Cannabis-Gesetzen.
Das so genannte "legal patchwork" sieht anders betrachtet so aus: 37 US-Bundessstaaten plus der District of Columbia haben die Marijuana-Gesetze in irgendeiner Weise liberalisiert.
Im Rahmen der Einführung in eine Meinungsserie der "New York Times" forderten nun die Herausgeber der "New York Times" am 26. Juli 2014 unter der Überschrift "Repeal Prohibition, Again" unmissverständlich: "The federal government should repeal the ban on marijuana", und nehmen ausdrücklich auf die Zeit der Alkohol-Prohibition in den Jahren 1920-33 Bezug. Auch hier allerdings mit der Begrenzung auf 21-Jährige und Ältere.
Diese Einführung und zwei weitere, ebenfalls am 26. Juli veröffentlichten Artikel enthalten in leicht leserlicher Form eine Reihe von epidemiologischen und sozialpolitischen Argumenten für eine Legalisierung. Mit Beiträgen zu den Themenaspekten "Criminal Justice", "History", "Health", "Track Records" und "Regulation" wird die Serie in der Zeit vom 29. Juli bis zum 5. August 2014 fortgesetzt.
Der "Editorial Board"-Beitrag Repeal Prohibition, Again, der Beitrag Let States Decide on Marijuana von David Firestone und der Beitrag The Public Lightens Up About Weed von Juliet Lapidos sind kostenlos erhältlich. Dies dürfte für die weiteren Artikel der Serie auch gelten bzw. kann durch den Besuch der NYT-Website bis Anfang August einfach verifiziert werden.
Dass mit den engagiert vorgetragenen Argumenten der NYT-AutorInnen die weitere Legalisierung keineswegs schnell erfolgt und die bisherige nicht unumstritten ist, zeigt sich u.a. in mehreren ebenfalls 2014 erschienenen Beiträgen in der renommierten Medizinzeitschrift "New England Journal of Medicine (NEJM)". Diese befassen sich vor allem mit der Bewertung des durch Cannabis möglichen gesundheitlichen Schadens. Cannabis sei, so die NYT, "weitaus weniger gefährlich als Alkohol". Sie stützen sich zum Teil auch auf Erkenntnisse aus einem US-Bundesstaat mit Legalisierung.
So warnte ein kurzer Leserbeitrag in der Januarausgabe des NEJM vor der Verbreitung von Cannabisprodukten ("Black Mamba" "K2" oder "Spice") mit einem synthetischen Cannabinoid, das bis zuz 1.000-fach stärker sein kann als natürliche Wirkstoffe. So müssten zunehmend Patienten wegen der schweren gesundheitlichen Schädigungen durch diese Produkte behandelt werden.
Der Beitrag An Outbreak of Exposure to a Novel Synthetic Cannabinoid ist in am 23. Januar 2014 in NEJM (2014; 370: 389-390) erschienen und komplett kostenlos lesbar.
Ein am 5. Juni 2014 in derselben Zeitschrift erschienener Aufsatz von AutorInnen, die am "National Institute on Drug Abuse" der USA arbeiten, beschäftigt sich ausführlich mit der Evidenz positiver und unerwünschter Wirkungen des Konsums von Cannabis oder Marijuana. Als Bereiche von eher unerwünschten Cannabis-Effekte betrachten die AutorInnen die "brain development", die "possible role as gateway drug", "mental illness", "effect on school performance and lifetime achievement", "risk of motor-vehicle accidents" (Zunahme in dem erwähnten Bundesstaat) und "risk of cancer and other effects on health". Gesundheitlich positive Effekte sehen sie dagegen z.B. bei chronischen Schmerzen, Glaukoma, AIDS-Begleiterkrankungen, Entzündungen, multipler Sklerose und Epilepsie.
In ihren Schlussfolgerungen überwiegt eine Skepsis gegenüber der Legalisierung des Cannabiskonsums bzw. die Warnung vor bereits jetzt erkennbar überwiegenden unerwünschten Wirkungen: "As policy shifts toward legalization of marijuana, it is reasonable and probably prudent to hypothesize that its use will increase and that, by extension, so will the number of persons for whom there will be negative health consequences."
Der Aufsatz Adverse Health Effects of Marijuana Use von Nora D. Volkow et al. ist in NEJM (2014, 370: 2219-2227) erschienen. Leider ist nur ein kurzer Preview-Text kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 29.7.14
Wie Bier- und Whiskyhersteller in Großbritannien Wohlfahrtsorganisationen gegen Alkoholabhängigkeit finanzieren - nur dort?
 In die Reihe der zum Teil verdeckten Einflussnahme auf die Gesundheitspolitik und die "Unterwanderung" von unabhängigen Verbänden oder Patientengruppen durch die Tabakwaren- und Pharma-Industrie reiht sich zumindest in Großbritannien jetzt die Alkoholindustrie ein.
In die Reihe der zum Teil verdeckten Einflussnahme auf die Gesundheitspolitik und die "Unterwanderung" von unabhängigen Verbänden oder Patientengruppen durch die Tabakwaren- und Pharma-Industrie reiht sich zumindest in Großbritannien jetzt die Alkoholindustrie ein.
Dies belegt die am 9. Juni 2014 online veröffentlichte Studie von Wissenschaftlern der renommierten "London School of Hygiene and Tropical Medicine" über die Realität der schon immer recht euphemistisch klingenden "corporate social responsibility activities" großer Brauereien oder Schnapsbrennereien.
Eine Auswertung von Daten über Organisationen oder Verbänden, die eigentlich unabhängig und der öffentlichen Wohlfahrt verpflichtet sind ("charities"), zeigt folgendes:
• Fünf dieser Wohlfahrtsorganisationen, Drinkaware; the Robertson Trust; British Institute of Innkeeping; Mentor UK and Addaction, sind aktiv in die Gestaltung der öffentlichen Alkoholpolitik eingebunden und erhielten gleichzeitig nicht unbeträchtliche Spenden von Firmen der Alkoholindustrie.
• Zwei dieser Organisationen, Addaction und Mentor UK, sind die beiden einzigen noch dort verbliebenen scheinbaren Nicht-Industrie- oder Regierungsmitglieder in dem von der britischen Regierung als eine Art Public-Privat-Partnership initiierten "Public Health Responsibility Deals's alcohol network". Alle anderen Public Health-Gruppen haben sich aus diesem Netzwerk wegen des Industrieeinflusses und einer Reihe entsprechend industriefreundlicher Entscheidungen zurückgezogen.
• Addaction arbeitet mit alkohol- und drogenabhängigen Menschen und erhielt in den drei letzten Jahren 560.000 britische Pfund vom Bierkonzern Heineken. Mentor UK arbeitet an der Prävention alkoholbedingter Schäden bei Kindern und akzeptierte seit 2008 u.a. 371.000 britische Pfund von Diageo, einem weltweit produzierenden Hersteller alkoholischer Getränke. Dieses Unternehmen betreibt in Großbritannien u.a. 27 Whiskybrennereien. Die Spenden von Diageo trugen 2008/09 zu 25% der gesamten Einnahmen von Mentor UK bei. Hinzu kommen z.B. auch noch 100.000 britische Pfund von zwei Unternehmen, die vom Verkauf von Alkohol profitieren.
• Die drei restlichen Wohlfahrtsorganisationen erhielten fast ihre gesamten Einnahmen von der Alkoholindustrie oder von Personen, die in dieser Industrie arbeiteten. Nicht verwunderlich ist daher auch, dass Führungskräfte dieser Organisationen häufig auch noch "senior alcohol industry figures" sind oder waren.
Auch wenn die WissenschaftlerInnen betonen, dass erst weitere Studien notwendig sind, um die Einflussnahmen zugunsten der Alkoholindustrie im Detail zu belegen, halten sie es für naiv, zu glauben, dass die Alkoholindustrie mit solchen Unterstützungszahlungen offen gegen die Interessen ihrer Anteilseigner an höheren Umsätzen und Gewinnen handeln würde. Vermutlich ist auch die Transparenz über die Geldströme zwischen Industrie und Wohlfahrtsorganisationen unvollständig.
Die Forderung "charities operating in alcohol or other policy arenas should be required to declare any possible conflicts of interest from funding sources, to ensure greater transparency" sollte nicht nur in Großbritannien umgesetzt werden. Wer stattdessen an die "social responsibility" der Industrie glaubt, kann sich am Beispiel der ähnlichen jahrzehntelangen Einflussnahmen der Tabakwarenindustrie klarmachen, welche Public Health-Folgen dies hat und was von der Glaubwürdigkeit der Selbstverpflichtungen solcher Industrien zu halten ist.
Der Aufsatz The alcohol industry, charities and policy influence in the UK von Sarah M Lyness und Jim McCambridge ist im "European Journal of Public Health" online erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 17.6.14
"Aktiv- und Passivrauchen gefährden Ihre Gesundheit" - weitere Belege aus Mehrjahresvergleichen in der Schweiz
 Auch wenn es bereits zahlreiche Belege für die unerwartet rasche erkrankungsbewahrende oder gesundheitsfördernde Wirkung von Rauchverboten gibt, verdienen weitere bevölkerungsbezogene Studienergebnisse aus möglichst vielen Ländern verbreitet zu werden. Und wenn sie dazu noch aus der Schweiz stammen, mögen sie den einen oder anderen Zweifler am Nutzen solcher Verbote überzeugen.
Auch wenn es bereits zahlreiche Belege für die unerwartet rasche erkrankungsbewahrende oder gesundheitsfördernde Wirkung von Rauchverboten gibt, verdienen weitere bevölkerungsbezogene Studienergebnisse aus möglichst vielen Ländern verbreitet zu werden. Und wenn sie dazu noch aus der Schweiz stammen, mögen sie den einen oder anderen Zweifler am Nutzen solcher Verbote überzeugen.
In der Schweiz wurde im Kanton Tessin im Jahr 2007 ein Rauchverbot an öffentlichen Plätzen eingeführt. Dies ermöglichte sowohl den langfristigen Vergleich der Inzidenz einer speziellen Form des Herzinfarkts (dem so genannten ST-Strecken-Erhebungs-Myokard Infarkt STEMI; die ST-Strecke ist ein Kurvenabschnitt des Elektrokardiogramms) innerhalb der Tessiner Bevölkerung drei Jahre vor und nach dem Rauchverbot und ferner den Vergleich mit der Inzidenz im Kanton Basel-Stadt, wo es noch kein Rauchverbot gab.
Die Ergebnisse sahen so aus:
• In jedem der drei Jahre nach dem Rauchverbot im Tessin war die Inzidenz signifikant niedriger (zwischen 89,6 und 101,6 stationären Einweisungen wegen STEMI pro 100.000 Einwohner) als in den drei Jahren davor (123,7 Einweisungen). Erneut zeigte sich also eine so nicht erwartete schnelle Wirkung des Verbots auf eine spezifische rauchassoziierte schwere Erkrankung.
• Die durchschnittliche Inzidenz von STEMI veränderte sich dagegen in Basel-Stadt im gesamten 6-Jahreszeitraum nicht signifikant.
• Die Studie liefert auch differenzierte Belege für Gesundheitswirkungen nach Alter und Geschlecht.
Die Schlussfolgerung der AutorInnen, dass "smoke-free policies … should be included in prevention programms worldwide" ist u.a. deshalb wichtig, weil es Anzeichen dafür gibt, dass sich die Tabakwarenindustrie zunehmend auf den Markt in der dritten Welt konzentriert.
Der Aufsatz Reduction of ST-elevation myocardial infarction in Canton Ticino (Switzerland) after smoking bans in enclosed public places - No Smoke Pub Study von Marcello Di Valentino et al. ist am 3. Juni 2014 vorab online als Beitrag im "European Journal of Public Health" erschienen. Das Abstract ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 8.6.14
Regionale und soziale Unterschiede im Rauchverhalten am Beispiel Nordrhein-Westfalen
 Das Tabakrauchen gilt als der wichtigste individuelle Risikofaktor für verhütbare Krankheiten und die vorzeitige Sterblichkeit. Die wichtigste kontinuierliche Datenquelle zum Rauchverhalten in Deutschland und in den Bundesländern ist der jährlich durchgeführte amtliche Mikrozensus.
Das Tabakrauchen gilt als der wichtigste individuelle Risikofaktor für verhütbare Krankheiten und die vorzeitige Sterblichkeit. Die wichtigste kontinuierliche Datenquelle zum Rauchverhalten in Deutschland und in den Bundesländern ist der jährlich durchgeführte amtliche Mikrozensus.
Nach dem Originaldatensatz des Mikrozensus 2009 rauchen in Nordrhein-Westfalen 37% der Männer und 28% der Frauen im Alter von 15 bis 64 Jahren. DieTabakprävalenz korreliert mit sozialen Einflussfaktoren. Je geringer der sozioökonomische Status und die Schulbildung, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit des Tabakgebrauchs. Arbeitslose rauchen überproportional häufig. Ihre Chancen auf die Aufgabe des Tabakkonsums sind relativ gering. Die Auswertungen zeigen, dass die Anteile der Raucher und Ex-Raucher auch zwischen den Kreisen in Nordrhein-Westfalen sehr stark variieren. Auf Kreisebene steigt die Tabakprävalenz hochgradig mit dem Anteil in der Erwerbsbevölkerung, der seinen Lebensunterhalt überwiegend durch Arbeitslosengeld I oder "Hartz IV" abdecken muss.
In NRW rauchten 2009 in der Altersgruppe 15 - 64 Jahre 33% der Erwerbstätigen, 48% der Empfänger von ALG1 und 56% der Empfänger von ALG2.
Fazit: Der Mikrozensus 2009 offenbart sehr große regionale Disparitäten und sozial bedingte Unterschiede beim Rauchen. Die Tabakabhängigkeit verschärft somit die soziale Ungleichheit der Gesundheit.
Der Mikrozensus ermöglicht für Bund, Länder und Kommunen ein Monitoring der Tabakkonsummuster und eine Evaluation regionaler Tabakkontrollpolitiken. Die Ergebnisse können auch der Entwicklung bedarfsgerechter Ansprachestrategien in der Primär- und Sekundärprävention dienen.
Der Aufsatz Regionale und soziale Unterschiede im Tabakkonsumverhalten im Mikrozensus 2009: Ergebnisse für das Land Nordrhein-Westfalen und dessen Kreise von A. Hollederer ist in der Zeitschrift "Das Gesundheitswesen" (2013. 75: 43-50) erschienen. Das Abstract ist kostenlos erhältlich.
Uwe Helmert, 7.4.14
Mythos "gesunde Ernährung ist teuer" oder "zu teuer" - Metaanalyse: Wie viel teuerer als ungesündeste ist sie wirklich?
 Eine der am häufigsten genannten Barrieren, die BürgerInnen und insbesondere solche mit niedrigerem Einkommen von einer gesünderen Ernährung abhält, ist deren zu hoher Preis. Darüber, ob dies stimmt und vor allem wie viel mehr für gesündere bzw. hochwertigere Nahrungsmittel gezahlt werden muss, gibt es interessanterweise relativ wenig und gesundheitspolitisch diskutiertes Wissen.
Eine der am häufigsten genannten Barrieren, die BürgerInnen und insbesondere solche mit niedrigerem Einkommen von einer gesünderen Ernährung abhält, ist deren zu hoher Preis. Darüber, ob dies stimmt und vor allem wie viel mehr für gesündere bzw. hochwertigere Nahrungsmittel gezahlt werden muss, gibt es interessanterweise relativ wenig und gesundheitspolitisch diskutiertes Wissen.
Eine am 5. Dezember 2013 in der Online-Ausgabe des "British Medical Journal Open" von EpidemiologInnen der "Harvard School of Public Health" veröffentlichte Metaanalyse von 27 Studien aus 10 Ländern (USA/Kanada, 6 europäische Länder, Südafrika/Australien etc.) mit im internationalen Vergleich höheren Durchschnittseinkommen schafft hierzu mehr Klarheit.
Auf den einfachsten finanziellen Nenner gebracht kostet die gesündeste Ernährung, also z.B. die mit Früchten, Gemüse, Fisch oder Nüssen insgesamt rund 1,50 US-Dollar pro Tag mehr als die am wenigsten gesunde Ernährung, bestehend aus Fertiggerichten, Fleisch oder raffinierten Samen bzw. Getreide. Dazu wurden sowohl die Kosten pro Essensportion als auch die bestimmter Kalorienmengen untersucht.
Rechnet man die unerwartet niedrigen absoluten Tageskosten einer gesunden Ernährung auf das Jahr hoch, kommt allerdings ein Betrag von rund 550 US-Dollar zusammen. Dies kann für eine Reihe von Familien eine zu hohe Kostenlast bedeuten, deren Gewicht politisch gesenkt werden muss. Dabei ist nach Ansicht der WissenschaftlerInnen hilfreich, dass die dafür erforderlichen Geldmittel im Vergleich zu den Kosten der Behandlung von ernährungsbedingten Krankheiten eher gering sind. Die Behandlungskosten würden außerdem durch gesunde Ernährung präventiv erheblich gesenkt werden.
Die WissenschaftlerInnen widmeten sich auch der Frage warum ungesündere Ernährung billiger ist. Dies liegt ihres Erachtens vor allem an einem komplexen Netzwerk von Produzenten, Vertreibern und Marketingakteure, die alle an dieser Art von Nahrungsmittel interessiert sind und daran auch gut verdienen. Sofern diese Erklärung stimmt, könnte also eine vergleichbare Infrastruktur für gesündere Nahrungsmittel sowohl deren Erreichbarkeit erhöhen als auch die Preise senken.
Auch wenn die in die Analyse eingegangenen Warenkörbe und deren Preisstruktur sich in mehrerlei Hinsicht je nach Land unterscheiden können dürfte sich an den Preisniveaus und -unterschieden in reicheren Ländern nichts Grundsätzliches ändern. Und damit auch nichts an den gesundheitspolitischen und -ökonomischen Schlussfolgerungen.
Der am 5. Dezember 2013 online veröffentlichte Aufsatz Do Healthier Foods and Diet Patterns Cost More Than Less Healthy Options? A Systematic Review and Meta-Analysis von Mayuree Rao, Ashkan Afshin, Gitanjali Singh und Dariush Mozaffarian ist in der Fachzeitschrift "BMJ Open" erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 30.12.13
Auch "Halbgötter oder -engel in weiß und grün" sind Menschen: Gesundheitsverhalten und Lebensstil von Ärzten und Pflegekräften
 Wer regelmäßig Kontakt zu ÄrztInnen oder anderen im Gesundheitswesen Tätigen hat, konnte schon immer über einzelne "leuchtende Vorbilder" von rauchenden, übergewichtigen oder bewegungsfaulen Vertretern dieser Berufe berichten. Einzelne Studien haben ferner gezeigt, dass viele Ärzte weder selber bestimmte Untersuchungen oder Behandlungen in Anspruch nehmen noch eine Inanspruchnahme ihren Angehörigen empfehlen würden, die sie ihren PatientInnen mit geballter Fachautorität empfehlen.
Wer regelmäßig Kontakt zu ÄrztInnen oder anderen im Gesundheitswesen Tätigen hat, konnte schon immer über einzelne "leuchtende Vorbilder" von rauchenden, übergewichtigen oder bewegungsfaulen Vertretern dieser Berufe berichten. Einzelne Studien haben ferner gezeigt, dass viele Ärzte weder selber bestimmte Untersuchungen oder Behandlungen in Anspruch nehmen noch eine Inanspruchnahme ihren Angehörigen empfehlen würden, die sie ihren PatientInnen mit geballter Fachautorität empfehlen.
Eine repräsentative Umfrage der US-amerikanischen "Center for Disease Control and Prevention (CDC)" zu "healthcare and lifestyle practices of healthcare workers" zeigt nun, dass es sich dabei nicht um Einzelfälle, sondern um zum Teil um mehrheitliche Verhaltensweisen handelt.
Im Rahmen eines jährlich im Rahmen des "The Behavorial Risk Factor Surveillance System (BRFSS)" telefonisch durchgeführten Surveys wurden 2008 und 2010 insgesamt 260.558 Erwachsene zu ihrem Gesundheitsverhalten und ihrem Lebensstil befragt, darunter 21.380 so genannte "healthcare workers", also vor allem Ärzte und Pflegekräfte.
Die wichtigsten Ergebnisse:
• Standardisiert nach Alter, Geschlecht, Ethnie, Ausbildung, Region, Einkommen und Beschäftigungsstatus gaben die Angehörigen von Gesundheitsberufen im Vergleich zum Rest der Bevölkerung nur für einige gesundheitlich wünschenswerte Verhaltensweisen häufiger an, sich dementsprechend zu verhalten. So war bei den Gesundheitsberufen die Wahrscheinlichkeit, einen Hausarzt zu haben, rund 24% höher, die eines Gesundheitschecks in den letzten 2 Jahren um 12% höher, die von körperlichen Aktivitäten bzw. Sport in den letzten 30 Tagen um 17% höher und die Weigerung innerhalb des letzten Monats erheblich zu viel Alkohol zu trinken um 24% höher. Sämtliche dieser Unterschiede waren statistisch signifikant.
• Keinen statistisch signifikanten Unterschied zwischen Ärzten etc. und Nicht-Ärzten oder Pflegekräften gab es dagegen in einer Vielzahl von in Anspruch genommenen Gesundheitsuntersuchungen oder gesundheitsbezogenen Verhaltensweisen. Dies gilt z.B. für die Wahrscheinlichkeit eines regelmäßigen Tests auf Gebärmutterhalskrebs, regelmäßiger Zahnarztbesuche, der Durchführung einer Kolonoskopie oder anderer Untersuchungen des Darms. Angehörige von Gesundheitsberufen unterschieden sich außerdem auch nicht signifikant vom Rest der Bevölkerung beim Übergewicht oder der Fettleibigkeit, beim Autofahren unter Alkoholeinfluss, beim Anlegen des Sicherheitsgurts, Rauchen, regelmäßigen Alkoholgenuss, der Lebenszufriedenheit oder bei übermäßigen Sonnenbädern mit Sonnenbrand.
• Negativ unterschieden sich nur weibliche Gesundheitsbeschäftigte über 50 Jahre vom Rest der gleichaltrigen Bevölkerung bei der regelmäßigen Inanspruchnahme von Mammographien. Die Wahrscheinlichkeit dies nicht zu machen war um 13% höher.
Eine Schwachstelle der Ergebnisse könnte nach Ansicht der Verfasser die sein, dass es sich um selbst berichtete Aktivitäten handelt, die nicht "objektiviert" wurden.
Und natürlich handelt es sich um Ergebnisse von amerikanischen ÄrztInnen, Pflegekräften und BürgerInnen, die vor einer Replikation dieser Befragung bei deutschen ÄrztInnen natürlich "völlig anders"="besser" aussehen.
Der kurze "research letter" "Healthcare and Lifestyle Practices of Healthcare Workers: Do Healthcare Workers Practice What They Preach?" von Benjamin K. I. Helfand und Kenneth J. Mukamal ist am 17. Dezember 2012 "online first" in der Zeitschrift "Archives of Internal Medicine" erschienen und noch komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 23.1.13
Passivrauchen und Demenz: Studie in China belegt signifikante Assoziationen und Dosis-Wirkungszusammenhänge
 Assoziationen oder sogar Ursache-Wirkungszusammenhänge zwischen passiv aufgenommenem Tabakrauch aus der Umgebungsluft, bestimmten Krebsformen, Erkrankungen der oberen Atemwege und kardiovaskulären Erkrankungen sind seit längerem bekannt. Ob dies für weitere schwere Erkrankungen und hier besonders für die Demenz auch zutrifft, war dagegen unklar. Keine Studie hatte bisher auch untersucht, ob es hier einen Dosis-Wirkungs-Zusammenhang gibt.
Assoziationen oder sogar Ursache-Wirkungszusammenhänge zwischen passiv aufgenommenem Tabakrauch aus der Umgebungsluft, bestimmten Krebsformen, Erkrankungen der oberen Atemwege und kardiovaskulären Erkrankungen sind seit längerem bekannt. Ob dies für weitere schwere Erkrankungen und hier besonders für die Demenz auch zutrifft, war dagegen unklar. Keine Studie hatte bisher auch untersucht, ob es hier einen Dosis-Wirkungs-Zusammenhang gibt.
In China gibt es mindestens 350 Millionen RaucherInnen, die bisher auch nahezu ungehindert an ihren Arbeitsplätzen und öffentlichen Orten rauchen. Daher untersuchte jetzt eine chinesisch-britische ForscherInnengruppe im Zeitraum von 2007 bis 2009 mit Standardinstrumenten und -methoden sowohl das Demenzrisiko als auch die Passivrauch-Belastung in einer Gruppe von 5.921 Personen im Alter von 60 und mehr Jahren aus vier Provinzen Chinas.
Dabei zeigte sich u.a.,
• dass 626 TeilnehmerInnen (10,6%) am Ende des Untersuchungszeitraums ernsthaft dement waren und 869 (14,7%) mäßig dement waren und
• dass TeilnehmerInnen, die gegenüber Passivrauch exponiert waren, ein signifikant höheres Risiko für eine schwerwiegende Demenz (adjustiertes relatives Risiko [RR]: 1,29) hatten.
• Das Risiko für eine schwere Demenz war außerdem signifikant dosisabhängig, d.h. je höher die Dosis des Passivrauchs war und/oder je länger die untersuchten Personen exponiert waren, desto höher war ihr relatives Risiko ernsthaft demenzkrank zu sein.
• Signifikante und ähnliche Assoziationen von Passivrauchen und schwerer Demenz gab es sowohl bei Personen, die niemals rauchten als auch bei Ex-Rauchern wie aktuell rauchenden Personen. In der Studiengruppe bestimmte hauptsächlich das Passivrauchen am Arbeitsplatz das Demenz-Risiko.
• Wenn zum Beispiel jemand an seinem Arbeitsplatz keinen Kontakt mit Passivrauch hatte, betrug sein Demenzrisiko nicht signifikante 1,12 (p=0,581). Wer 20 bis 39 Jahre exponiert war, hatte ein RR von knapp nicht signifikanten 1,86 (P=0,060). Bei 40 und mehr Jahren Passivrauchen lag das RR hochsignifikant bei 2,39 (p=<0.001).
• Keine signifikanten Assoziationen fanden die chinesischen WissenschaftlerInnen zwischen Umgebungs-Passivrauch und mäßigen Demenzsyndromen.
Der Aufsatz "Association between environmental tobacco smoke exposure and dementia syndromes" von Ruoling Chen et al. ist Anfang 2013 gedruckt in der Fachzeitschrift "Occupational Environmental Medicine" (2013;70:1 63-69 Published Online First: 26 October 2012) erschienen und dank der "open access"-Politik der Zeitschrift komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 20.1.13
1953, 1971, 2011: US-Soldaten (sterben) mit immer gesünderen Gefäßen. Ursachen: Gesünderes Verhalten oder Selektion?!
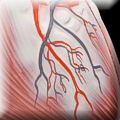 Für die solide und valide statt "gefühlte" Darstellung der Entwicklung der Inzidenz und Prävalenz von Krankheiten sollte möglichst auf Längsschnittuntersuchungen zurückgegriffen werden, die ihrerseits möglichst mit objektiven Daten angelegt sind. Viele "Epidemien" oder "dramatische Zunahmen" von Krankheiten beruhen nur auf den Ergebnissen von ein oder zwei in kurzen Abständen und mit unterschiedlichen Fragen durchgeführten Querschnittsbefragungen und viel ihrer angeblichen Dynamik basiert auf einem Detektions- oder Publikationsbias oder der Entstigmatisierung bestimmter Krankheiten mit anschließender Zunahme spezifischer Diagnosen und öffentlicher Kommunikation. Prominente aktuelle Beispiele sind die "Zunahme" psychischer Erkrankungen und ein Teil der "Zunahme" von übergewichtigen und adipösen Kindern und Jugendlichen.
Für die solide und valide statt "gefühlte" Darstellung der Entwicklung der Inzidenz und Prävalenz von Krankheiten sollte möglichst auf Längsschnittuntersuchungen zurückgegriffen werden, die ihrerseits möglichst mit objektiven Daten angelegt sind. Viele "Epidemien" oder "dramatische Zunahmen" von Krankheiten beruhen nur auf den Ergebnissen von ein oder zwei in kurzen Abständen und mit unterschiedlichen Fragen durchgeführten Querschnittsbefragungen und viel ihrer angeblichen Dynamik basiert auf einem Detektions- oder Publikationsbias oder der Entstigmatisierung bestimmter Krankheiten mit anschließender Zunahme spezifischer Diagnosen und öffentlicher Kommunikation. Prominente aktuelle Beispiele sind die "Zunahme" psychischer Erkrankungen und ein Teil der "Zunahme" von übergewichtigen und adipösen Kindern und Jugendlichen.
Ein interessantes Beispiel, was bezogen auf eine seit vielen Jahren breit diskutierte krankhafte Veränderung der Gefäße mit hohem Risiko von schweren Folgeerkrankungen bei einer zugegebenermaßen etwas ungewöhnlichen Datenbasis herauskommt, liefert eine vergleichende Analyse des Auftretens von Koronarsklerose bei gefallenen Soldaten der US-Armee im Korea-, Vietnam- sowie in den Golf- und Afghanistankriegen.
Bei den immer deutlich unter 30 Jahren alten Soldaten sank der Anteil an erkennbarer Koronarsklerose Leidenden bei der routinemäßigen Obduktion von 77% bei den in Korea (Anfang der 1950er Jahre) Gefallenen, über 45% bei den obduzierten Gefallenen im Vietnamkrieg (1960 und Anfang der 1970er Jahre) auf 8,5% bei den in diesem Jahrhundert im Golf- und Afghanistankrieg Gefallenen. Die Häufigkeit von Stenosen, welche die Koronararterie um mehr als 50% verengten, bewegte sich zwischen 15%, 0% und 2,3%. Die Soldaten mit einer Koronarsklerose litten auch deutlich häufiger als ihre Altersgenossen an Fettstoffwechselstörungen, Bluthochdruck oder Adipositas.
Unter Würdigung aller von den Autoren zum großen Teil selbst diskutierten Limitationen ihrer Studienmethodik kommt ein Editorialist zu zwei Schlussfolgerungen. Erstens: "Consequently, it is highly likely that the main finding of this study is valid: the prevalence of atherosclerosis in young men today is much lower than the prevalence in the Korean or Vietnam War eras. If these findings are generalizable to the US population as a whole, then the cardiovascular health of the US population may have improved appreciably over the past 6 decades." Zweitens: "Advances in primary (but not secondary) prevention are likely to explain the declines in coronary atherosclerosis across the 3 autopsy studies."
Zu den zahlreichen sensibilisierenden und fruchtbaren Hinweisen, welche diese Studie für die aktuelle Versorgungsforschung liefert, gehört z.B. die Schwierigkeit solide Längsschnittstudien über viele Jahrzehnte durchzuführen. Dies gilt besonders dann, wenn es sich um ein retrospektives Design handelt, das die Ergebnisse von sich methodisch in mehreren Details unterscheidenden Studien nutzt. Außerdem ist die Erklärung, es handle sich um Effekte eines gesünderen Lebensstils und einer positiv wirkenden Primärprävention, nicht zwingend. Erste Kommentare weisen auf die Möglichkeit einer Art "healthy soldier"-Effekt hin. Danach könnten durch entsprechende Musterungsuntersuchungen immer gesündere junge Männer in die Armee eingetreten und gefallen sein. Solche Selektionseffekte könnten allerdings auch bei randomisierten Studien mit unterschiedlichen Rekrutierungszeitpunkten in beide Richtungen (immer gesündere oder immer kränkere StudienteilnehmerInnen) existieren, ohne dass dies auf den ersten Blick auffällt.
Was eine gründliche Beschäftigung mit dem Ergebnis also auf jeden Fall mit sich bringt, ist eine verschärfte Nachdenklichkeit über die Beschränktheit und Schlüssigkeit mancher Querschnitts-Szenarien und den notwendigen, aber nicht einfachen methodischen Aufwand solider Verlaufsstudien.
Der am 26. Dezember 2012 erschienene Aufsatz Prevalence of and Risk Factors for Autopsy-Determined Atherosclerosis Among US Service Members, 2001-2011 von Bryant J. Webber et al. (JAMA. 2012;308(24): 2577-2583) ist komplett kostenlos zugänglich.
Dies ist ebenso bei dem Editorial Combating the Epidemic of Heart Disease von Daniel Levy (JAMA. 2012; 308(24): 2624-2625) der Fall.
Der am 18. Juli 1953 erschienene Korea-Aufsatz CORONARY DISEASE AMONG UNITED STATES SOLDIERS KILLED IN ACTION IN KOREA PRELIMINARY REPORT von William F. Enos; Robert H. Holmes, James Beyer (JAMA. 1953;152(12): 1090-1093) ist auch kostenlos erhältlich.
Den am 17. Mai 1971 veröffentlichten Aufsatz Coronary Artery Disease in Combat Casualties in Vietnam von J. Judson McNamara et al. (JAMA. 1971;216(7): 1185-1187) gibt es ebenfalls kostenlos.
Bernard Braun, 29.12.12
"Schluss mit dem Rauchen" - aber wie am besten und wirkungsvollsten?
 Gute Vorsätze sind mit dem Jahresende aufs Engste verbunden. Ein nicht seltener Vorsatz ist, "im nächsten Jahr" mit dem Rauchen aufzuhören. Eine praktische Frage ist dann, ob man die letzte Zigarette zusammen mit dem Silvesterfeuerwerk "genießt" oder die Tagesration Zigarette um Zigarette oder Pfeifenkopf um Pfeifenkopf bis Ostern verringert und am Karfreitag nikotinfrei zu leben beginnt. Viele Experten glauben, die zweite Methode sei der Beginn des Scheiterns des guten Vorsatzes. Andere Experten glauben dagegen, der plötzliche Nikotinentzug hätte nicht nur ebenso abrupt erwünschte wie unerwünschte Folgen, sondern berge häufig die Gefahr des Rückfalls in sich. Und weil das alles unklar ist und sowieso in beiden Varianten bald weitergeraucht werde, fangen viele Raucher gleich gar nicht mit dem Aufhören an.
Gute Vorsätze sind mit dem Jahresende aufs Engste verbunden. Ein nicht seltener Vorsatz ist, "im nächsten Jahr" mit dem Rauchen aufzuhören. Eine praktische Frage ist dann, ob man die letzte Zigarette zusammen mit dem Silvesterfeuerwerk "genießt" oder die Tagesration Zigarette um Zigarette oder Pfeifenkopf um Pfeifenkopf bis Ostern verringert und am Karfreitag nikotinfrei zu leben beginnt. Viele Experten glauben, die zweite Methode sei der Beginn des Scheiterns des guten Vorsatzes. Andere Experten glauben dagegen, der plötzliche Nikotinentzug hätte nicht nur ebenso abrupt erwünschte wie unerwünschte Folgen, sondern berge häufig die Gefahr des Rückfalls in sich. Und weil das alles unklar ist und sowieso in beiden Varianten bald weitergeraucht werde, fangen viele Raucher gleich gar nicht mit dem Aufhören an.
Eine Entscheidungshilfe könnte ein jetzt von der Cochrane Tobacco Addiction Review Group veröffentlichter Cochrane-Review darstellen, der u.a. untersuchte, was randomisierte kontrollierte Studien über den Erfolg beider Methoden bei aufhörwilligen Erwachsenen sagen. Als erfolgreich gelten Maßnahmen, nach denen die TeilnehmerInnen der Studien sechs Monate nach dem Aufhören noch abstinent waren. Außerdem verglich ein Teil der Studien die unerwünschten Wirkungen beider Methoden und ob und wie hilfreich dabei Arzneimittel sind.
Der Review und die Metaanalyse stützten sich auf 10 Studien mit 3.760 TeilnehmerInnen. In drei Studien waren Arzneimittel Teil der Intervention. 5 Studien stellten den TeilnehmerInnen zusätzliche Verhaltenshilfen zur Verfügung und vier schlossen Selbsthilfe-Therapien ein.
Die wichtigsten Ergebnisse lauteten:
• Alles in Allem war keine der beiden Methoden, also Abrupt- und Peu à peu-Methode, bei der Abstinenzrate gegenüber der anderen absolut überlegen, d.h. die Erfolgsraten waren ähnlich und die Unterschiede statistisch nicht signifikant (RR=0,94, 95% CI=0,79 bis 1,13).
• Auch zwischen den Therapien mit oder ohne Arzneimittelunterstützung gab es keine signifikanten Unterschiede bei der Abstinenzrate (RR= 0.87, 95% CI= 0.65 to 1.22).
• Schließlich unterscheidet sich auch der Erfolg der guten Vorsätze nicht zwischen Therapien mit oder ohne Verhaltensunterstützung (RR= 0.87, 95% CI= 0.64 to 1.17) oder mit oder ohne integrierte Selbsthilfe-Therapie (RR= 0.98, 95% CI= 0.78 to1.23).
• Die Reviewer sahen sich außerstande klare Erkenntnisse über die Art und den Grad unerwünschter Begleitumstände des Nikotinentzugs zu gewinnen. Einige der Studien zeigen aber, dass Nikotinersatztherapien (z.B. durch Nikotinpflaster) zu Beginn des Aufhörens die Wahrscheinlichkeit von Entzugserscheinungen nicht erhöhen.
• Für die Konzeption von Entwöhnungsprogrammen muss aber u.a. noch genauer untersucht werden, welche Typen von Rauchern von welcher Methode des Aufhörens und unterstützender Interventionen am meistens profitieren.
Was in jedem Fall für einen Erfolg notwendig ist, ist die unbedingte Festigkeit des Vorsatzes Aufzuhören für mehrere Monate und über eine Menge von physiologischen (z.B. wirken bestimmte nikotinaffine Mechanismen im Hirn noch mehrere Monate nach dem Aufhören) und sozialen Rückfallanreize hinweg.
Zu dem 44 Seiten umfassenden Cochrane-Review "Reduction versus abrupt cessation in smokers who want to quit." von Lindson-Hawley N, Aveyard P und Hughes JR. (Cochrane Database Syst Rev. 2012 Nov 14) gibt es das wie gewohnt umfangreiche Abstract kostenlos.
Bernard Braun, 25.12.12
Auch wer nur noch "ein paar Zigaretten zum Abgewöhnen" raucht hat ein hohes gesundheitliches Risiko für plötzlichen Herztod.
 Wenige prospektive Studien mit wirklich langen Beobachtungszeiten haben bisher die Assoziationen der Menge gerauchter Zigaretten mit dem Risiko des plötzlichen Herztodes untersucht.
Wenige prospektive Studien mit wirklich langen Beobachtungszeiten haben bisher die Assoziationen der Menge gerauchter Zigaretten mit dem Risiko des plötzlichen Herztodes untersucht.
Mit einer speziellen Auswertung der so genannten "Nurses Health Study" in den USA, einer Studie mit 101.018 Frauen, die zu Beginn der Studie im Jahr 1980 weder an einer koronaren Herzkrankheit, noch an Schlaganfall oder Krebs gelitten hatten, erlaubt nach 30 Jahren Laufzeit Einblicke in mögliche Zusammenhänge.
Die Ergebnisse untermauern bereits bekannte, aber auch einige neuen Zusammenhänge:
• Verglichen mit Teilnehmerinnen, die niemals rauchten, hatten heute noch rauchende Personen unter Kontrolle mehrerer Risikofaktoren für koronare Herzerkrankungen das um das 2,44fache höhere signifikante Risiko eines plötzlichen Herztodes.
• Nach multivariaten Analysen war die Anzahl der täglich gerauchten Zigaretten und die Dauer des Rauchens hochsignifikant und linear mit dem Risiko des plötzlichen Herztodes assoziiert.
• Personen, die als leichte bis mäßige Raucher klassifiziert wurden (1-14 Zigaretten pro Tag), hatten gegenüber Nichtrauchern das 1,84fache Herztodrisiko. Wer dagegen 25 und mehr Zigaretten pro Tag rauchte, dessen Herztodrisiko war um das 3,3fache so hoch wie das der Nichtraucher.
• Jede 5 Jahre in denen Teilnehmerinnen rauchten, waren mit einem achtprozentigen Anstieg des hier untersuchten Sterberisikos assoziiert.
• Nach 20 Jahren war das Risiko von Ex-Rauchern mit dem vergleichbar, das Personen hatten, die niemals geraucht hatten.
Der Aufsatz "Smoking, Smoking Cessation and Risk of Sudden Cardiac Death in Women" von Roopinder K. Sandhu et al. ist am 11. Dezember 2012 vorab online als Beitrag in der Fachzeitschrift "Circulation: Arrhythmia & Electrophysiology" veröffentlicht worden. Ein Abstract ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 12.12.12
Warum ist Schottland der "kranke Mann" Europas, war das immer so und sind Whisky sowie frittierte Schokoriegel die Hauptursachen?
 Zwischen vergleichbaren Ländern Europas und Nordamerikas gibt es gerade in der jüngeren Vergangenheit erhebliche Gesundheits- und auch Sterblichkeitsunterschiede. Das bekannteste Beispiel ist die insbesondere für russische Männer nach der Auflösung der Sowjetunion und der Gründung Russlands dramatische Verringerung der Lebenserwartung auf durchschnittlich unter 60 Jahre. Allein zwischen 1990 und 1994 sank die Lebenserwartung für russische Männer von 63,8 auf 57,7 Jahre und für russische Frauen von 74,4 auf 71,2 Jahre. Näheres erfährt man in dem kostenlos erhältlichen Aufsatz "Causes of Declining Life Expectancy in Russia" von Francis C. Notzon, Yuri M. Komarov, Sergei P. Ermakov, Christopher T. Sempos, James S. Marks, Elena V. Sempos in JAMA (1998; 279(10): 793-800).
Zwischen vergleichbaren Ländern Europas und Nordamerikas gibt es gerade in der jüngeren Vergangenheit erhebliche Gesundheits- und auch Sterblichkeitsunterschiede. Das bekannteste Beispiel ist die insbesondere für russische Männer nach der Auflösung der Sowjetunion und der Gründung Russlands dramatische Verringerung der Lebenserwartung auf durchschnittlich unter 60 Jahre. Allein zwischen 1990 und 1994 sank die Lebenserwartung für russische Männer von 63,8 auf 57,7 Jahre und für russische Frauen von 74,4 auf 71,2 Jahre. Näheres erfährt man in dem kostenlos erhältlichen Aufsatz "Causes of Declining Life Expectancy in Russia" von Francis C. Notzon, Yuri M. Komarov, Sergei P. Ermakov, Christopher T. Sempos, James S. Marks, Elena V. Sempos in JAMA (1998; 279(10): 793-800).
Als eine der wichtigsten Erklärungen für diesen in der Neuzeit wohl größten Verlust an Lebensjahren wurde von vielen Autoren die Einführung einer freien Marktwirtschaft, der Zusammenbruch relativ fester Institutionen und die Erosion sozialer Beziehungen als die entscheidenden sozialen Veränderungen genannt. Der hohe Wodkakonsum als gewichtigstem Gesundheitsverhaltensproblem ist sicherlich gerade auch in Russland zu beachten, erklärt aber die sinkende Lebenserwartung schon deshalb nicht entscheidend, weil er auch in der Sowjetunion relativ hoch war, wenn nicht sogar höher als im nachsowjetischen Russland oder der Ukraine.
Näheres zur Vielfalt von Erklärungen und auch zum langsamen Wiederanstieg der Lebenserwartung ab Mitte der 1990er Jahre findet man u.v.a. in den kostenlosen Abstracts der Aufsätze "Changes in life expectancy in Russia in the mid-1990s" von Vladimir Shkolnikov, Martin McKee und David A Leon in "The Lancet" (2001, Volume 357, Issue 9260: 917 - 921), "Huge variation in Russian mortality rates 1984—94: artefact, alcohol, or what?" von Dr David A Leon, Laurent Chenet, Vladimir M Shkolnikov, Sergei Zakharov, Judith Shapiro, Galina Rakhmanova, Sergei Vassin und Martin McKee in "The Lancet" (1997, Volume 350, Issue 9075: 383 - 388) und "Mass privatisation and the post-communist mortality crisis: a cross-national analysis" von David Stuckler, Lawrence King und Martin McKee in "The Lancet" (2009, Volume 373, Issue 9661:399 - 407).
Eine Gruppe schottischer Gesundheitswissenschaftler hat sich nun die Frage gestellt, warum Schottland auf einem weniger dramatischen Niveau mittlerweile im Vergleich mit Großbritannien und anderen west- und nordeuropäischen Ländern wegen einer deutlich niedrigeren Lebenserwartung als "kranker Mann Europas" gilt. Und auch dabei stellte sich die Frage, ob z.B. der traditionell hohe Whisky-Konsum und sonstige Besonderheiten des gesundheitlich relevanten individuellen Verhaltens in Schottland die entscheidenden Determinanten sind.
Die Wissenschaftler analysierten auf der Suche nach Antworten für den Zeitraum 1855 bis 2006 Daten aus der so genannten "Human Mortality Database" und stellten fest:
• Die Lebenserwartung der schottischen Bevölkerung entsprach fast ein Jahrhundert der in vergleichbar wohlhabenden Ländern Westeuropas.
• Sie begann erst nach 1950 langsamer zu wachsen als in vergleichbaren Ländern. Insbesondere seit 1980 nahm die mit Alkohol, Gewalt, Selbstmord, Arzneimitteln und verschiedenen Erkrankungen assoziierte Sterblichkeit noch einmal erheblich zu. Damit verbunden war die enorme Zunahme immer ungleicher verteilten Erkrankungs- und Sterberisiken. Eine ähnliche Verschlechterung bei der Lebenserwartung begann im Übrigen nach 1981 auch in den USA.
• Die Lebenserwartung in Schottland liegt im Moment zwischen der der westeuropäischen Ländern inklusive England, Wales und Nordirland und der in den osteuropäischen Ländern bzw. den Nachfolgestaaten der Sowjetunion.
• Nach Meinung der Forschergruppe gibt es mindestens 17 Hypothesen über Faktoren welche das besondere Mortalitätsgeschehen in Schottland erklären.
• Nach einer systematischen Überprüfung der Evidenzen dieser Erklärungen konzentrieren sich die Autoren auf eine der Hypothesen, die insbesondere für die besondere Entwicklung seit dem Beginn der 1980er Jahre evidente empirische Belege zu liefern scheint.
• Die entscheidende Annahme dieser Hypothese ist, dass Schottland nach dem Antritt der konservativen Thatcherregierung im Jahre 1979 "suffered disproportionately from a neoliberal 'political attack'".
• Als Indikator für die Existenz und das Wirken neoliberaler Orientierungen und Einflussnahmen benutzen die Autoren den "Index of Economic Freedom". Dieser Index wird aus 23 Faktoren (für den aktuellsten Bericht über das Jahr 2009 42 Indikatoren) gebildet, welche Ökonomen als Indikatoren für ein neoliberales ökonomisches System betrachten. Wer Näheres wissen und sich auch kritisch mit dem Index auseinandersetzen will, kann dies anhand der neuesten Ausgabe "Economic Freedom of the World: 2011 Annual Report"von James Gwartney, Robert Lawson und Joshua Hall machen, die komplett kostenlos von der Website des Fraser Institute heruntergeladen werden kann.
• Insbesondere für die osteuropäischen Länder gab es einen deutlichen inversen Zusammenhang von hohem Index (dieser bewegt sich zwischen 0 für wenig und 10 für viel "freedom" im neoliberalen Verständnis) und Lebenserwartung. Je mehr und verbreiteter neoliberale Bedingungen und Einflüsse vorhanden sind und wirken desto geringer steigt zwischen 1980 und 2006 im Vergleich mit Ländern in denen es weniger neoliberale Einflüsse gibt die Lebenserwartung an oder sinkt sogar. Für Schottland gibt es allerdings nur einen mäßigen ("moderate") statistischen Zusammenhang.
In derselben Ausgabe der Zeitschrift setzt sich der mit internationalen Vergleichen seit Jahrzehnten erfahrene niederländische Gesundheitswissenschaftler Johan Mackenbach kritisch mit dem Erklärungsansatz der schottischen Wissenschaftler auseinander. Trotz einer Reihe bedenkenswerter Argumente kommt aber auch er zu dem folgenden für die weitere Beschäftigung mit der Erklärung ungleicher Risiken zwischen Ländern wichtigen Schluss: "That (seine kritischen Anmerkungen) should, however, not discourage readers to seriously consider the possibility that political decisions, past and present, are playing a role in the explanation of variations in health between Scotland and the rest of the UK, and between countries generally."
Alle Autoren sind sich einig, dass vordergründige Erklärungen wie z.B. mangelhafte Ernährung oder exzessiver Alkoholkonsum nicht und vor allem nicht allein geeignet sind, ungleiche Sterblichkeitsrisiken zu erklären.
Der Aufsatz "Has Scotland always been the 'sick man' of Europe? An observational study from 1855 to 2006" von Gerry McCartney et al. ist im Dezemberheft 2012 des "European Journal of Public Health" (22 (6): 756-760) erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Vom Editorial "From deep-fried Mars bars to neoliberal political attacks: explaining the Scottish mortality disadvantage" Johan P. Mackenbachs (European Journal of Public Health, Vol. 22, No. 6, 751) ist kostenlos nur ein Extrakt erhältlich.
Notwendiger Nachtrag: Warum dem nichtschottischen Betrachter beim Thema Lebenserwartung in Schottland Schokoriegel einfallen könnten und was beides miteinander zu tun haben könnte, gibt Mackenbach preis, wenn er von der angeblich in Schottland verbreiteten Sitte spricht, tiefgefrorene Marsriegel in heißes Öl zu tunken und dann aufzuessen. Selbst wenn man das Verspeisen anfrittierter Schokoriegel nur mit ordentlichen Mengen Whisky bewältigen sollte, wäre auch damit das kürzere Leben der Schotten wahrscheinlich nicht hinreichend erklärbar.
Bernard Braun, 25.11.12
Präventive Wirkung von materiellen Anreizen für Schulklassen mit 11- bis 14-Jährigen nicht mit dem Rauchen anzufangen = Null!
 Angesichts der gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnisse über die gesundheitlichen Risiken des Tabakrauchens für Aktiv- und Passivraucher muss ein Schwerpunkt präventiver Interventionen sein, insbesondere Kinder und Heranwachsende vom Rauchen abzuhalten.
Angesichts der gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnisse über die gesundheitlichen Risiken des Tabakrauchens für Aktiv- und Passivraucher muss ein Schwerpunkt präventiver Interventionen sein, insbesondere Kinder und Heranwachsende vom Rauchen abzuhalten.
Da Kinder und Jugendliche oft aufgrund eines bestehenden oder vermuteten Gruppendrucks mit dem Rauchen beginnen, wurden und werden u.a. gruppenbezogene Interventionen und Anreize zum Nichtrauchen als sehr gut geeignete Präventionsmethoden angesehen. Hierzu zählen in verschiedenen Ländern Europas Aktionen eines so genannten "Smokefree Class Competition (SFC)". Dieses Programm arbeitet mit Anreizen an ganze Schulklassen von 11- bis 14-Jährigen, die sich verpflichten auch nach 6 Monaten rauchfrei zu sein. Wenn dies mindestens 90% gelingt, kommt die Klasse in eine Art Lotterie-Wettbewerb in dem zahlreiche Preise von geringem bis mittelmäßigem Wert gewonnen werden können.
Ob diese Art von Programmen aber wirklich wirksam sind, war wie bei vielen anderen präventiven Interventionen lange Zeit gar nicht bezweifelt und auch nicht untersucht worden.
Für einen systematischen Cochrane-Review und eine Meta-Analyse betrachteten eine Reihe von australischen WissenschaftlerInnen nun die Ergebnisse von 5 randomisierten kontrollierten Studien mit 6.362 TeilnehmerInnen, die beim Start der Studien nicht rauchten. 3.466 waren in der Interventionsgruppe, also der TeilnehmerInnen an einem SFC-Programm und 2.896 Heranwachsende stellten die Kontrollgruppe. Eine der Studien war keine SFC- und auch keine randomisierte Studie. Ihren erfolgreichen, d.h. rauchfrei gebliebenen TeilnehmerInnen winkten am Ende des einjährigen Studienzeitraums ebenfalls Belohnungen.
Die Ergebnisse der Studien fassen die Reviewer so zusammen:
• Nur die nicht-randomisierte Studie konnte im ersten Anlauf einen statistisch signifikanten Effekt melden. Nach einigen nootwendigen Adjustierungen gab es aber keine statistisch signifikanten Unterschiede der Risikoraten zwischen Interventions- und Kontrollgruppe mehr. Außerdem wies die Studie auch zahlreiche Verzerrungsmöglichkeiten auf, die ihre Ergebnisse generell fragwürdig erscheinen lassen.
• Drei andere, methodisch hochwertigere Studien mit 3.056 TeilnehmerInnen zeigten beim Gruppenvergleich keinerlei signifikanten Effekt der mit Anreizen operierenden Interventionen bei der Prävention des Rauchens (Risikorate RR 1,00, Konfidenzintervall von 0,84 bis 1,19).
• Die ForscherInnen sehen nur wenig belastbare Evidenz dafür, dass die TeilnehmerInnen sie hinters Licht geführt haben oder rauchende Mitschüler bedroht haben, dies nicht zu berichten.
Die ForscherInnen schlagen trotz ihrer für Interventionen, die mit materiellen Anreizen arbeiten, entmutigenden Erkenntnissen vor, zusätzlich die Wirkung derartiger Anreize auf Einzelpersonen zu überprüfen.
Von dem am 17. Oktober 2012 veröffentlichten Cochrane-Review "Incentives for preventing smoking in children and adolescents" von Johnston V, Liberato S und Thomas D. gibt es kostenlos nur das traditionell ausführliche Abstract.
Bernard Braun, 14.11.12
Wenn das "Beste" mehr Schlechtes als Gutes bringt. Unerwartete Effekte der Reduktion von Salz.
 Die gesundheitliche Bedeutung des Über- und Unterschreitens zahlreicher Körperwerte (z.B. Blutdruck, Blutzucker, Cholesterinspiegel, Body Mass Index) und die meist lehrmeisterlich verkündeten Annahmen über die Linearität der damit verbundenen Zu- oder Abnahme von gesundheitlichen Risiken, wird in immer mehr hochwertigen Untersuchungen relativiert und in Frage gestellt. Wie problematisch die meist nur in Konsenskonferenzen und oft unter dem Einfluss von Leistungsanbietern festgelegten exakten Grenzwerte bei den Blutdruckwerten und dem Cholesterinspiegel sind, ist mehrfach belegt worden. Ebenfalls gut belegt ist mittlerweile die Tatsache, dass entgegen den jahrzehntelangen in allen Übergewichts- und Adipositas-Gesundheitskampagnen propagierten Risiken des BMI-Anstiegs über 25, ein BMI bis zum Wert 29/30 sogar einen protektiven Nutzen gegenüber schweren Krankheitsrisiken und Mortalität hat (siehe dazu den gerade in der "Süddeutschen Zeitung" vom 3. November 2012 erschienenen ausgezeichneten Überblick "Dicke leben länger" von Christa Berndt) und Werte unter 25 auch keineswegs immer Positiveres bedeuten.
Die gesundheitliche Bedeutung des Über- und Unterschreitens zahlreicher Körperwerte (z.B. Blutdruck, Blutzucker, Cholesterinspiegel, Body Mass Index) und die meist lehrmeisterlich verkündeten Annahmen über die Linearität der damit verbundenen Zu- oder Abnahme von gesundheitlichen Risiken, wird in immer mehr hochwertigen Untersuchungen relativiert und in Frage gestellt. Wie problematisch die meist nur in Konsenskonferenzen und oft unter dem Einfluss von Leistungsanbietern festgelegten exakten Grenzwerte bei den Blutdruckwerten und dem Cholesterinspiegel sind, ist mehrfach belegt worden. Ebenfalls gut belegt ist mittlerweile die Tatsache, dass entgegen den jahrzehntelangen in allen Übergewichts- und Adipositas-Gesundheitskampagnen propagierten Risiken des BMI-Anstiegs über 25, ein BMI bis zum Wert 29/30 sogar einen protektiven Nutzen gegenüber schweren Krankheitsrisiken und Mortalität hat (siehe dazu den gerade in der "Süddeutschen Zeitung" vom 3. November 2012 erschienenen ausgezeichneten Überblick "Dicke leben länger" von Christa Berndt) und Werte unter 25 auch keineswegs immer Positiveres bedeuten.
Dafür warum das Vorliegen bestimmter Risikofaktoren bzw. das Überschreiten bestimmter Grenzwerte nicht zu den prognostizierten unerwünschten Folgen führen und warum das "mehr" oder "weniger" von bestimmten Werten nicht im Gleichschritt und zwangsläufig zu "mehr" oder "weniger" Gesundheit etc. führt, gibt es meist nur wenige evidenten Erklärungen und auch nur relativ wackelige Mußmaßungen. Was aber auch ohne weitere Erklärung deutlich wird, ist, wie brüchig und unangemessen das hinter solch platten Zusammenhangsannahmen stehende gesundheits-, krankheits- oder heilungsbezogenen Modell des Menschen als "Maschine" ist.
Das u.a. in der Prävention des kardiovaskulären Risikofaktors Bluthockdruck mit dem Motto "je weniger desto gesünder und risikoarm" weit verbreitete und rigide propagierte Rezept, den Salzkonsum so weit wie möglich einzuschränken , erweist sich durch die am 21. August 2012 veröffentlichten Ergebnisse eines systematischen Reviews und einer Metaanalyse von sechs großen randomisierten kontrollierten Studien mit 2.747 TeilnehmerInnen als äußerst fragwürdig. An den Studien hatten Erwachsene teilgenommen, die an Herzversagen litten und entweder normale Portionen Sodium bzw. Natrium (2,8 Gramm pro Tag) aufnahmen oder sich sodiumarm (1,8 Gramm pro Tag) ernährten. Dabei ist zu beachten, dass Sodium/Natrium chemisch nicht Koch-/Speisesalz bzw. Natriumchlorid identisch ist. Das bedeutet vor allem, dass 1 Gramm Kochsalz 400 mg Sodium entspricht. Das von verschiedenen Fachgesellschaften aktuell empfohlene Maximum der täglichen Aufnahme von Sodium liegt bei 2.3 Gramm was 5,75 Gramm Salz entspricht. Die aktuellen Empfehlungen von medizinischen Fachgesellschaften schwanken aber zwischen 1,5 Gramm und 5 Gramm pro Tag.
Als Endpunkte in der hier dargestellten Studie wurden bei den Angehörigen beider Gruppen die Gesamtsterblichkeit, das Auftreten eines plötzlichen Herztods bzw. eines Todes, der mit Herzschwäche assoziiert war und die (Wieder-)Einweisungen in Krankenhäuser dokumentiert, deren Anlass Herzversagen war.
Beim Vergleich der Personen, deren Salzaufnahme nicht verringert war, mit denen, die sich salzarm ernährten, sahen die Ergebnisse aller RCTs anders aus als erwartet wurde: die Angehörigen der salzarmen Gruppe hatten fast ausnahmslos statistisch signifikant höhere Risikoraten (risk ratio oder RR) als die Angehörigen der normal salzenden Gruppe. So war das Risiko der Gesamtsterblichkeit in der salzreduzierenden Gruppe um 95%, das des plötzlichen (Herz-)Todes um 72%, das des Tods durch Herzversagen um 123% und das der Wiedereinweisung in ein Krankenhaus mit einem Herzproblem um 110% höher (!!!) als bei normal salzenden Personen.
Die kritischen Kommentare zu den Ergebnissen dieses systematischen Reviews gaben zunächst auch nur an, sie hätten das Ergebnis nicht bzw. ein diametral anderes erwartet. Danach wiesen sie auf den Mangel an Informationen über die Flüssigkeitsaufnahme und die Einnahme wasserabführenden Medikamente bei den RCT-TeilnehmerInnen hin und deuten an, dass es sich bei dem Effekt um die Folgen von Flüssigkeitsmangel handeln könnte. Ein anderer Kommentator wünscht sich Vergleiche zwischen Personen mit noch wesentlich höherem und denjenigen mit reduziertem Salzkonsum. Die Stoßrichtung von Prävention ginge dann dahin, Lebensmittel mit sehr hohem Salzanteil zu meiden.
Wie schwierig, interessant und möglicherweise folgenlos der weitere praktische Umgang mit den Reviewergebnissen sein dürfte zeigen die Präsentationen und Diskussionen auf dem Workshop "Should we put the salt shaker down?", der am 26. August 2012 im Rahmen des europäischen Kardiologenkongresses in München stattfand. Auf der einen Seite stand die Beobachtung, dass "both clinicians and patients may be confused about recommendations", auf der anderen das Festhalten an den alten Empfehlungen.
Um nicht missverstanden zu werden: Die Ergebnisse des Reviews rechtfertigen keinwegs, ab sofort wieder ohne ein Gericht überhaupt zu kosten "für alle Fälle" nachzusalzen. Sie rechtfertigen aber sehr wohl, vor allzu hohen, uneingeschränkten oder linearen Erwartungen zu warnen, die mit dem sparsamen Einsatz des Salzstreuers verknüpft werden. Wer glaubt einseitig auf eine salzarme oder -freie Ernährungsweise als Allheilmittel gegen Bluthochdruck und kardiovaskuläre Erkrankungen setzen zu können, dürfte sich ebenfalls täuschen.
Von dem Aufsatz "Low sodium versus normal sodium diets in systolic heart failure: systematic review and meta-analysis." von Dinicolantonio JJ, Pasquale PD, Taylor RS, et al - am 21. August 2012 in der Fachzeitschrift "Heart"erschienen - gibt es kostenlos das Abstract.
Bernard Braun, 11.11.12
Erneut kein signifikanter Nutzen "gekaufter Gesundheit": Magnesium bei Muskelkrämpfen von älteren Personen und Schwangeren.
 Wer nach Beispielen nach Über- und Fehlversorgung im Gesundheitssystem sucht, wird insbesondere im Bereich von oft frei käuflichen Vitaminen, Mineralstoffen und sonstigen Nahrungsergänzungsmitteln fast immer fündig.
Wer nach Beispielen nach Über- und Fehlversorgung im Gesundheitssystem sucht, wird insbesondere im Bereich von oft frei käuflichen Vitaminen, Mineralstoffen und sonstigen Nahrungsergänzungsmitteln fast immer fündig.
Dies gilt nach den gründlichen Analysen eines am 12. September 2012 veröffentlichten Cochrane-Reviews auch für Magnesium, das offensiv und auch häufig von Ärzten als prophylaktisches "natürliches" Mittel gegen Muskelkrämpfen bei Schwangeren, Höheraltrigen und Personen mit Krämpfen nach körperlicher Bewegung gepriesen wird.
Dazu analysierten die Reviewer zunächst alle zwischen Mitte der 1970er Jahren und heute durchgeführten randomisierten kontrollierten Studien, welche die behaupteten und vermuteten Wirkungen auf bzw. gegen Muskelkrämpfe im Vergleich von Personen, die Magnesium einnahmen, mit unbehandelten Personen, Placebobehandelten oder sonstig therapierten Personen untersucht hatten.
Dabei fanden sich sieben aussagefähige Studien mit insgesamt 406 TeilnehmerInnen. Drei Studien kümmerten sich um Muskelkrämpfe in den Beinen von Schwangeren und vier Studien um Personen, die ohne fassbare Ursachen an Krämpfen litten.
Die wesentlichen Ergebnisse des erstmalig durchgeführten systematischen Reviews lauteten:
• Für die vor allem bei älteren Erwachsenen auftretenden idiopathischen Krämpfe gab es in der Magnesiumgruppe gegenüber den TeilnehmerInnen in der Placebogruppe zwar einen kleinen Unterschied, der aber nicht statistisch signifikant war. So nahm die Anzahl der Krämpfe pro Woche gegenüber dem Ausgangswert zu Beginn der Studie bei den MagnesiumnutzerInnen um 3,93% ab. Der Unterschied bei der Anzahl betrug zwischen den beiden Personengruppen nach vier Wochen gerade einmal 0,01 Krämpfe pro Woche.
• Der Anteil der Personen, deren Krampfrate nach Start der Studie um 25% oder mehr abnahm, war in der Magnesiumgruppe (-8%) nicht wesentlich größer als in der Placebogruppe - der Unterschied daher auch nicht signifikant, also möglicherweise rein zufällig.
• Nach vier Wochen gab es ferner keinen signifikanten Unterschied bei der Krampfintensität und -dauer. Einschränkend erwähnen die Reviewer hier aber die geringe Anzahl von Studien, die diese Indikatoren überhaupt erhoben und bewerteten.
• In ihren Schlussfolgerungen halten die Reviewer es insbesondere für ältere Erwachsene für unwahrscheinlich, dass zusätzliche Einnahmen von Magnesium zu einer klinisch spürbaren und bedeutenden Prophylaxe von Krämpfen beitragen. Für die möglichen Wirkungen von Magnesium auf Muskelkrämpfe von Schwangeren ist die Forschungsliteratur widersprüchlich. Und schließlich beschäftigte sich bisher noch keine RCT mit bewegungsassoziierten oder mit bestimmten Erkrankungen assoziierten Muskelkrämpfen.
Über den Cochrane-Review Magnesium for skeletal muscle cramps. von Garrison SR, Allan GM, Sekhon RK, et al. (Cochrane Database Syst Rev. 2012 Sep 12; 9: CD009402) gibt auch der gewohnt ausführliche kostenlose Abstract Auskunft.
Bernard Braun, 29.10.12
Vorsicht Patentrezept: 11 Jahre Life-Style-Veränderung (Ernährung und Bewegung) von Diabetikern ohne "harten" Erfolg
 11 Jahre nach seinem Start beendeten die US-"National Institutes of Health (NIH)" vorzeitig ein intensives Ernährungs- und Bewegungsprogramm zur Gewichtsabnahme von 5.145 übergewichtigen oder fettsüchtigen Erwachsenenen mit einer Typ 2-Diabeteserkrankung.
11 Jahre nach seinem Start beendeten die US-"National Institutes of Health (NIH)" vorzeitig ein intensives Ernährungs- und Bewegungsprogramm zur Gewichtsabnahme von 5.145 übergewichtigen oder fettsüchtigen Erwachsenenen mit einer Typ 2-Diabeteserkrankung.
Der in einer Presseerklärung der NIH vom 19. Oktober 2012 veröffentlichte entscheidende Grund ist, dass diese gewaltige Life-Style-Intervention zwar das Ziel der Gewichtsreduktion und einige andere Ziele (z.B. Verringerung von nächtlichem Atemstillstand, Absenkung der Anzahl von Diabetes-Arzneimittel, Erhaltung der körperlichen Beweglichkeit und Verbesserung der Lebensqualität) erreichte, nicht aber das harte Ziel, die Anzahl der unerwünschten und zum Teil tödlichen kardiovaskulären Ereignisse wie Herzinfarkte und Schlaganfälle zu verringern.
Die so genannte Look AHEAD (Action for Health in Diabetes)-Studie lief mit den 5.145 TeilnehmerInnen im Alter von 45 bis 76 Jahren an 16 Diabetes-Behandlungszentren. Die TeilnehmerInnen wurden zufällig auf eine Interventionsgruppe mit intensiven ernährungs- und bewegungsbezogenen Life-Style-Interventionen und eine Kontrollgruppe aufgeteilt, die ein allgemeines Diabetes-Unterstützungs- und Bildungsprogramm erhielt. Die Angehörigen beider Gruppen erhielten von ihren gewohnten Behandlern die routinemäßige Behandlung von DiabetikerInnen. Das rigorose Interventionsprogramm umfasste je nach Gewicht die tägliche Aufnahme von Lebensmitteln mit 1.200 bis 1.500 oder 1.500 bis 1.800 Kalorien und ein moderates Bewegungsprogramm mit wenigstens 175 Minuten pro Woche.
Die Studie erreichte das Gewichtsreduktionsziel in der Interventionsgruppe über eine Reduktion von 8% des Startgewichts nach einem Jahr. Die TeilnehmerInnen der Vergleichsgruppe verloren in derselben Zeit nur 1% ihres Ausgangsgewichts. Nach vier Jahren betrug der Verlust an Startgewicht in der Interventionsgruppe immer noch 5%, was unter ExpertInnen als gute Voraussetzung für einen harten gesundheitlichen Nutzen gilt.
Dieser Nutzen stellte sich aber auch nach 11 Jahren Intervention nicht ein. Auch wenn es keine interventionsverursachten gesundheitlichen Schäden gab, war dies für die ForscherInnen und die NIH der Anlass, die Interventionsangebote von Look AHEAD zu stoppen. Die Verantwortlichen empfehlen aber, die gesundheitliche Entwicklung derTeilnehmerInnen weiter zu beobachten und mögliche längerfristige Effekte der Intervention identifizieren zu können ("because there was little chance of finding a difference"). Diese Hofffnung beruht u.a. darauf, dass die Angehörigen der Interventions- wie Vergleichsgruppe eine geringere Anzahl von kardiovaskulären Ereignissen hatten als die TeilnehmerInnen an früheren Diabetikerstudien.
Und auch die Tatsache, dass sich die üblichen Risikofaktoren Blutdruck, Cholesterin und Blutzucker bei den Personen beider Gruppen am Ende nicht unterschieden, die Interventionsgruppen-Angehörigen aber weniger Medikamente einnahmen, wird von Kommentaren als Basis für eine Wahlmöglichkeit der PatientInnen bewertet: "That may be the choice we are highlighting" so David Nathan, einer der Projektverantwortlichen zur "New York Times". Und weiter: "You can take more medications — and more, I should say, expensive medications — or you can choose a lifestyle intervention and use fewer drugs and come to the same cardiovascular disease risk." Er sagte nicht, welche Variante besser ist, aber "those are real choices."
Die angekündigte gründliche Analyse der Daten und ihre Veröffentlichung in einer Fachzeitschrift wird sicherlich noch weitere interessante Hinweise auf die Barrieren für manchmal unreflektiert propagierte Patentrezepte liefern.
Die NIH-Presserklärung "Weight loss does not lower heart disease risk from type 2 diabetes" ist komplett erhältlich.
Dies trifft auch für den in der "New York Times" vom 19. Oktober veröffentlichten Artikel "Diabetes Study Ends Early With a Surprising Result" von Gina Kolata zu.
Bernard Braun, 23.10.12
Wer viel sitzt, ist länger tot
 Seit Langem bestehen nicht alleine der Verdacht, sondern auch vermehrt Hinweise darauf, dass langes Sitzen gesundheitsschädlich ist. So geht beispielsweise die WHO in ihrem Bericht Global health risks: mortality and burden of disease attributable to selected major risks davon aus, dass 6 % der weltweiten Sterbefälle auf Bewegungsmangel zurückzuführen sind. Belastbare empirische Belege für einen Zusammenhang zwischen täglicher Sitzdauer und Gesamtsterblichkeit standen allerdings bisher aus.
Seit Langem bestehen nicht alleine der Verdacht, sondern auch vermehrt Hinweise darauf, dass langes Sitzen gesundheitsschädlich ist. So geht beispielsweise die WHO in ihrem Bericht Global health risks: mortality and burden of disease attributable to selected major risks davon aus, dass 6 % der weltweiten Sterbefälle auf Bewegungsmangel zurückzuführen sind. Belastbare empirische Belege für einen Zusammenhang zwischen täglicher Sitzdauer und Gesamtsterblichkeit standen allerdings bisher aus.
Im März 2012 veröffentlichte die Fachzeitschrift Archives of Internal Medicine eine überaus große australische Kohortenstudie aus New South Wales. Dabei verglichen die WissenschaftlerInnen aus Sydney und Acton die im Rahmen einer prospektiven Kohortenstudie erfassten Befragungsergebnisse unter über 45-Jährigen mit Mortalitätsdaten des Geburts-, Todes- und Heiratsregisters Registry of Births, Deaths, and Marriages zwischen dem 1. Februar 2006 und dem 31. Dezember 2010 im entsprechenden Bundesstaat. In die Studie flossen die Angaben von 222.497 Personen ein, die zwischen Studienbeginn und dem 30. November 2008 den Ausgangsfragebogen ausgefüllt hatten.
Mittels proportionaler Hazardmodelle nach Cox ermittelten die UntersucherInnen die Gesamtsterblichkeit in Abhängigkeit von der durchschnittlichen täglichen Sitzdauer und adjustierten die Ergebnisse nach potentiellen Confoundern wie Geschlecht, Bildung, Wohnort (Stadt/Land), körperlicher Betätigung, Body-mass Index, Raucherstatus, subjektivem Gesundheitsempfinden und Behinderung. Während der Gesamtheit von 621.695 Personenjahren bei einer durchschnittlichen Follow-up-Zeit von 2,8 Jahren traten 5.405 registrierte Todesfälle auf. Bei einer täglichen Sitzdauer von vier bis unter acht Stunden war das Gesamtsterblichkeitsrisiko um 2 % (95 % Konfidenzintervall, 0,95-1,09), bei einer Sitzdauer zwischen acht und elf Stunden um 15 % (1,06-1,25) und bei täglicher Sitzdauer über elf Stunden sogar um 40 % (1,27-1,55) gegenüber kurzer täglicher Sitzdauer von weniger als vier Stunden erhöht, und zwar nach Adjustierung nach körperlicher Aktivität und den anderen genannten Confoundern. Die Assoziation zwischen durchschnittlicher täglicher Sitzdauer und Gesamtsterblichkeit war bei gesunden Personen gegenüber StudienteilnehmerInnen mit vorbestehenden kardiovaskulären Erkrankungen oder Diabetes mellitus konsistent gegenüber Geschlecht, Alter, Körperstatur und körperlicher Aktivität.
Aus ihren Untersuchungsergebnissen leiten die AutorInnen eine offenkundige Schlussfolgerung für eine krankheitsreduzierende Gesundheitspolitik ab: Our findings add to the mounting evidence that public health programs should focus not just on increasing population physical activity levels but also on reducing sitting time, especially in individuals who do not meet the physical activity recommendation."
Die Studie Sitting Time and All-Cause Mortality Risk in 222 497 Australian Adults von Hidde van der Ploeg, Tien Chey, Rosemary Korda, Emily Banks und Adrian Bauman steht als Volltext kostenfrei zum Download zur Verfügung.
Jens Holst, 13.9.12
Antioxidative Nahrungsergänzungsmittel von Vitamin A bis Selen: Nicht nur nutzlos, sondern zum Teil sogar lebensverkürzend
 So genannte Antioxidantien gelten seit einiger Zeit als wahre Wundermittel, Körperzellen gegen schädliche äußere Einflusse zu schützen und im Falle des Schutzes vor Krebs auch als lebensverlängernd. Diese Wirkungen wurden auch durch einige Tierexperimente, durch physiologische Modelle und einige Beobachtungsstudien gestützt. Andere Beobachtungsstudien hatten aber auf fehlende positive Wirkungen und sogar unerwünschte schädigende Effekte hingewiesen. Trotzdem boomen das Geschäft und die Einnahme von Beta-Carotin-, Vitamin A-, Vitamin C- und Selenpräparate als so genannte Nahrungsergänzungsmittel.
So genannte Antioxidantien gelten seit einiger Zeit als wahre Wundermittel, Körperzellen gegen schädliche äußere Einflusse zu schützen und im Falle des Schutzes vor Krebs auch als lebensverlängernd. Diese Wirkungen wurden auch durch einige Tierexperimente, durch physiologische Modelle und einige Beobachtungsstudien gestützt. Andere Beobachtungsstudien hatten aber auf fehlende positive Wirkungen und sogar unerwünschte schädigende Effekte hingewiesen. Trotzdem boomen das Geschäft und die Einnahme von Beta-Carotin-, Vitamin A-, Vitamin C- und Selenpräparate als so genannte Nahrungsergänzungsmittel.
Eine 2012 aktualisierte und auf noch breiterer Studienbasis argumentierende Fassung eines so genannten Cochrane-Reviews aus dem Jahr 2008 kommt jetzt aber zum Schluss, dass diese Mittel nicht nur weitgehend nutzlos sind, sondern zum Teil sogar lebensverkürzend wirken.
Dies ist das Ergebnis eines systematischen Reviews von 78 randomisierten kontrollierten klinischen Studien mit 296.707 TeilnehmerInnen, die entweder eines der genannten Nahrungsergänzungsmittel, ein Placebo oder gar nichts einnahmen. Unter den TeilnehmerInnen waren 215.900 gesund und 80.807 litten an verschiedenen Krankheiten wie Magen-Darm-, Herz-Kreislauf oder Hauterkrankungen. Die TeilnehmerInnen waren durchschnittlich 63 Jahre alt und die Dauer der Einnahme der Vitamine und sonstigen Stoffe lag bei durchschnittlich 3 Jahren zwischen 28 Tagen und 12 Jahren.
Die Ergebnisse sahen so aus:
• Insgesamt hatten alle antioxidativen Ergänzungsstoffe in einer Metaanalyse keine statistisch signifikante Wirkung auf die Sterblichkeit. Diese Nichtwirkung war sowohl in primär- als auch in sekundärpräventiv angelegten Studien zu beobachten.
• Wenn auch nur schwach und nicht bei allen Stoffen, war aber die Sterblichkeit unter den NutzerInnen einiger der Mittel oder Stoffe um das 1,03- bis 1,04-Fache höher als bei den jeweiligen NichtnutzerInnen. Die höhere Sterberate trat bei den Personen auf, die Beta-Carotin oder die Vitamine E und A (möglicherweise aber nur bei höheren Dosen) als Ergänzungsmittel einnahmen, nicht aber bei den Konsumenten von Vitamin C und Selen.
Die Reviewer raten daher sowohl gesunden als auch kranken Menschen von einer Nahrungsergänzung mit Antioxidantien wegen deren mangelnder Wirkung und schädlicher Effekte ab. Sie weisen auch darauf hin, dass diese Mittel oft als "natürlich" verharmlost werden und ihr Charakter als medizinische Produkte übersehen wird. Da sie dies aber sind, fordern die WissenschaftlerInnen vor der Marktzulassung solcher Stoffe eine strenge Bewertung. Zu betonen ist noch, dass dies kein Plädoyer gegen die Aufnahme der genannten Vitamine oder Stoffe durch die normale Ernährung ist, sondern sich nur gegen die dann meist auch noch hoch dosierte Aufnahme von Ergänzungsmitteln richtet.
Von dem am 14. März 2012 veröffentlichten aktualisierten Cochrane-Review "Antioxidant supplements for prevention of mortality in healthy participants and patients with various diseases" von Bjelakovic G, Nikolova D, Gluud LL, Simonetti RG und Gluud C. (Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 3. Art. No.: CD007176) gibt es kostenlos nur das Abstract. Dort findet man aber wie bei Abstract von Cochrane-Reviews gewohnt eine Fülle von quantitativen Daten und auch differenzierte methodische Darstellungen.
Bernard Braun, 25.3.12
Wirkungen von Massenmedien-Kampagnen für körperliche Aktivitäten: Mehrheitlich ohne verhaltensändernde Wirkung, selten evaluiert
 Massenmedienkampagnen, die sowohl über alltagstaugliche gesundheitsförderliche körperliche Aktivitäten informieren als auch Anreize enthalten, mit diesen Aktivitäten praktisch zu beginnen, nehmen international seit mehreren Jahren zu. Dies erklärt sich u.a. durch die potenzielle Reichweite und Beliebtheit (z.B. Fernsehen), die Präsenz im öffentlichen Raum (z.B. Informationsbanner an Nahverkehrsmitteln), die den meisten Massenmedien eigene Verständlichkeit und Attraktivität der Darstellung (z.B. in Illustrierten oder der "yellow press") oder auch durch die Preisgünstigkeit dieser Vermittlungsplattformen.
Massenmedienkampagnen, die sowohl über alltagstaugliche gesundheitsförderliche körperliche Aktivitäten informieren als auch Anreize enthalten, mit diesen Aktivitäten praktisch zu beginnen, nehmen international seit mehreren Jahren zu. Dies erklärt sich u.a. durch die potenzielle Reichweite und Beliebtheit (z.B. Fernsehen), die Präsenz im öffentlichen Raum (z.B. Informationsbanner an Nahverkehrsmitteln), die den meisten Massenmedien eigene Verständlichkeit und Attraktivität der Darstellung (z.B. in Illustrierten oder der "yellow press") oder auch durch die Preisgünstigkeit dieser Vermittlungsplattformen.
Wie bei vielen anderen gesundheitsbezogenen Aktivitäten spielte aber auch hier lange Zeit der empirische Nachweis der erwarteten Wirksamkeit keine, eine lediglich nachgeordnete Rolle oder wurde meist stillschweigend unterstellt.
Eine Untersuchung von 18 solcher auf das Verhalten von erwachsenen Individuen gerichteten Kampagnen, die im englischsprachigen Raum zwischen 2003 und 2010 stattfanden, beendet diesen unbefriedigenden Zustand.
Die zwei wichtigsten Erkenntnisse lauten:
• Die inhaltliche Vorbereitung und Begründung sowie das Design dieser Kampagnen und ihrer Evaluation sind äußerst heterogen. So lag lediglich 9 der 18 Kampagnen ein theo-retisches Konzept über den Inhalt und die Form der Intervention zugrunde, dessen Praxisrelevanz dann untersucht werden konnte. Die Designs schwankten zwischen experimentell und mehrheitlich nichtexperimentell. In drei der 18 evaluierten Kampagnen war grundsätzlich die Möglichkeit ausgeschlossen, die Nutzung der Medienkampagne und die dabei vermittelte Dosis von Informationen und Anreizen quantitativ zu messen. Wenn Messungen möglich waren stattfanden, reichte die Spannbreite von Einmal- bis Mehrfachmessungen und von Messungen nach kurzer oder jahrelanger Kampagnendauer.
• Bei der Wirksamkeit der untersuchten Massenmedienkampagnen unterschieden die Au-torInnen Interessenbekundungen und Absichtserklärungen, künftig körperlich aktiv zu werden von tatsächlichen Veränderungen des körperlich aktiven Verhaltens. Bei der Messung der Rückantworten auf entsprechende Informationsangebote schwankten die Werte erheblich. In den 7 der 18 evaluierten Kampagnen, die überhaupt nach Absichtserklärungen suchten, fanden die ForscherInnen nur bei einer Kampagne einen statistisch signifikanten Anstieg der Absicht, körperlich aktiv zu werden. Bei den anderen Kampagnen war meist der Anteil der teilnehmenden Personen so klein, dass keine signifikanten Aussagen zu gewinnen waren. In der Evaluation von 15 der 18 Kampagnen wurde nach praktischen Veränderungen des körperlichen oder Bewegungsverhaltens gefragt und auch entsprechende Anzeichen gefunden. Diese unterschieden sich aber nur in sieben der 15 Kampagnen statistisch signifikant von Verhaltensänderungen in der jeweiligen Vergleichsgruppe. Vier dieser sieben Kampagnen hatten ein quasi-experimentelles Design, dauerten als Kohortenstudie mehr als 5 Monaten und könnten insofern relativ verlässliche und dauerhaftere Hinweise auf Verhaltensänderungen liefern. Ein Grund, warum insgesamt relativ wenige Daten zur Wirksamkeit der Kampagnen vorliegen, könnte darin liegen, dass viele der nicht-experimentellen Studien nur ein einziges Mal versuchten, ihre Wirksamkeit zu messen.
Um künftige Kampagnen oder Interventionen dieser Art besser bewerten und vergleichen zu können, schlagen die AutorInnen für künftige vergleichbare Kampagnen ein optimales Evaluationsdesign vor, das folgende Elemente enthalten sollte: Überblick zu den theoretischen Grundlagen der gewählten Informationsmodelle, Kampagneninhalte und Evaluationsdesigns, ein Kohortenstudien-Design mit mehreren Datensammlungspunkten, eine ausreichend lange Dauer, valide Messverfahren und ausreichende finanzielle und andere Ressourcen für die Evaluation.
Von dem 2011 veröffentlichten Aufsatz von Justine E. Leavy et al. "Physical activity mass media cam-paigns and their evaluation: a systematic review of the literature 2003-2010", erschienen in der Zeitschrift "Health Education Research" (26 [6]: 1060-1085), gibt es lediglich das Abstract kostenlos.
Bernard Braun, 29.1.12
Starke, durchgängige und dosisabhängige Assoziation zwischen Passivrauchen und Schlaganfallrisiko
 Schon lange besteht unter Experten Einigkeit über einen kausalen Zusammenhang von aktivem Rauchen und dem Risiko, einen Schlaganfall zu erleiden. Ein systematischer Review von 20 zwischen 1984 und 2010 durchgeführten Studien (10 Kohorten-, 6 Fall-Kontroll- und 4 Querschnittsstudien) zur Assoziation von Passivrauchen und Schlaganfall und eine Metaanalyse mit ihren Ergebnissen zeigt zweierlei:
Schon lange besteht unter Experten Einigkeit über einen kausalen Zusammenhang von aktivem Rauchen und dem Risiko, einen Schlaganfall zu erleiden. Ein systematischer Review von 20 zwischen 1984 und 2010 durchgeführten Studien (10 Kohorten-, 6 Fall-Kontroll- und 4 Querschnittsstudien) zur Assoziation von Passivrauchen und Schlaganfall und eine Metaanalyse mit ihren Ergebnissen zeigt zweierlei:
• Nicht nur das aktive, sondern auch das passive Rauchen wirken risikoerhöhend. Unter den 885.307 TeilnehmerInnen der Studien erlitten 5.894 oder 0,7% einen Schlaganfall. Von den insgesamt 35 Risikoabschätzungen sahen 24 ein mit Passivrauchen verbunde-nes steigendes Schlaganfallrisiko, 11 Schätzungen waren auch statistisch signifikant er-höht. Die Metaanalyse, also eine Methode, welche die einzelnen Ergebnisse zusammenfasst, identifiziert ein statistisch signifikantes relatives Schlaganfallrisiko, das für die Passivraucher um 25% höher ist als für Nicht-Passivraucher. Unterscheidet man nach den Studientypen, sind die Risikoschätzungen für die TeilnehmerInnen in den Kohorten- und Fall-Kontrollstudien, also den methodisch höherwertigen Studientypen, ausnahmslos signifikant erhöht. Wegen der großen Heterogenität der Querschnittsstudien findet die Metaanalyse der Schlaganfallrisiken dort kein statistisch signifikantes Ergebnis.
• 7 der 11 Studien, die überhaupt nach dem möglichen Dosiseffekt beim Passivrauchen suchten, fanden einen evidenten Zusammenhang zwischen der Menge des eingeatmeten Rauches und des Schlaganfallrisikos - teils bei allen Personen oder auch nur bei Männern oder Frauen.
• Ein für die Praxis des Rauchverbots oder mancher Versuche relevantes Ergebnis, einen Kompromiss zwischen Raucher- und Nichtraucherinteressen zu finden, zeigt eine weitere Analyse der Zusammenhänge zwischen der Anzahl gerauchter Zigaretten und des Schlaganfallrisikos der PassivraucherInnen. Im Vergleich mit einer rauchfreien Umgebung erhöhte schon der Rauch von bis zu 5 Zigaretten pro Tag das Schlaganfallrisiko der Passivraucher um 16%. Dieses Risiko erhöhte sich schließlich durch das Einatmen des Rauches von rund 40 Zigaretten pro Tag um 56%. Das verbreitete Arrangement, ein, zwei Zigaretten pro Tag könnten doch niemand schaden, stellt offensichtlich einen für Raucher wie Passivraucher nachteiligen Irrtum dar.
Von dem im "Journal of Public Health" (33 (4): 496-502) 2011 erschienenen Aufsatz "Meta-analysis of the association between secondhand smoke exposure and stroke" von I.P. Oono et al. gibt es kostenlos lediglich das Abstract.
Bernard Braun, 29.1.12
Probiotika können präventiv gegen akute Erkältungskrankheiten helfen - schwach, möglicherweise nicht bei jedem und ob als Joghurt?
 "Ein Probiotikum (Mehrzahl Probiotika), … ist eine Zubereitung, die lebensfähige Mikroorganismen enthält. Es zählt zu den Functional-Food-Produkten. In ausreichenden Mengen oral aufgenommen, können Probiotika einen gesundheitsfördernden Einfluss auf den Wirtsorganismus haben, das Ausmaß dieser möglichen Wirkung ist jedoch in vielen Fällen umstritten. Im Vergleich zu 'konventionellen' Lebensmitteln wurde eine erhöhte Wirkung nicht nachgewiesen. Die am längsten als Probiotika angewendeten Organismen sind Milchsäurebakterien, aber auch Hefen und andere Spezies sind in Gebrauch."
"Ein Probiotikum (Mehrzahl Probiotika), … ist eine Zubereitung, die lebensfähige Mikroorganismen enthält. Es zählt zu den Functional-Food-Produkten. In ausreichenden Mengen oral aufgenommen, können Probiotika einen gesundheitsfördernden Einfluss auf den Wirtsorganismus haben, das Ausmaß dieser möglichen Wirkung ist jedoch in vielen Fällen umstritten. Im Vergleich zu 'konventionellen' Lebensmitteln wurde eine erhöhte Wirkung nicht nachgewiesen. Die am längsten als Probiotika angewendeten Organismen sind Milchsäurebakterien, aber auch Hefen und andere Spezies sind in Gebrauch."
Die in ihrer Gewundenheit korrekte Wikipedia-Definition von Probiotika kann nach dem Erscheinen eines wissenschaftlich hochkarätigen Cochrane-Reviews nun an einigen Stellen klarer, muss aber an anderen weiterhin ungeklärt bleiben.
Der Cochrane-Review beschäftigt sich mit der Annahme bzw. dem Versprechen, dass Probiotika durch eine Regulierung der Immunfunktion des Menschen dessen Gesundheit verbessern können. Dazu untersuchten die chinesischen WissenschaftlerInnen speziell die Ergebnisse von 14 randomisierten kontrollierten Studien (RCT) bzw. zehn in eine Metaanalyse einbezogenen Studien mit 3.451 Teilnehmerinnen im Kindes-, Jugendlichen- und Erwachsenenalter (bis 40 Jahre), die sich mit dem nachweisbaren Nutzen von Probiotika bei der Prävention von akuten Infektionen der oberen Atemwege befassten. Der Review schloss Studien ein, welche Probiotika gegen Placebo testeten.
Die Hauptergebnisse lauteten:
• Probiotika wirken signifikant besser als Placebo, wenn es um darum geht, wie viele TeilnehmerInnen Episoden mit akuten Infektionen der oberen Atemwege erfahren. Die Wahrscheinlichkeit einer Episode ist um rund 40% reduziert, die von wenigstens drei Erkrankungs-Episoden um fast 50% reduziert (Odds ratios 0,58 und 0,53).
• Die Rate der Verordnung von Antibiotika bei dieser Art von Infektionen war in der Probiotika-Gruppe ebenfalls signifikant niedriger als in der Placebo-Gruppe (Odds ratio 0,67). Dieses Ergebnis kann sich aber nur auf drei der 10 oder 14 Studien stützen.
• Was die Dauer der untersuchten Erkrankung anlangt, gab es nur wenige und nicht signifikante Unterschiede zwischen den beiden Untersuchungsgruppen. Dies galt auch für das Auftreten von uner-wünschten Effekten der Behandlung.
• Nebenwirkungen von Probiotika gab es wenig und Verdauungsstörungen traten bei Probiotika am meisten auf.
Damit sind Probiotika in jedem Fall zur Prävention der akuten Infektionen der oberen Atemwege nützlicher als Placebos. Die Evidenz wird von den AutorInnen aber selbst als schwach bezeichnet.
Was in dem Review mangels entsprechender RCTs nicht genauer untersucht werden konnte, ist die Wirkung von Probiotika bei älteren Personen und ob es Wirkungs- und Nutzenunterschiede zwischen dem Verzehr industrieller und meist teurer Probiotika und der Aufnahme probiotischer Stoffe durch das das ganz normale Essen von Joghurt oder Gemüse gibt.
Auf jeden Fall ist es nicht nachteilig, Joghurt, Käse oder Gemüse zu essen. Diejenigen, die dies lediglich zur Verhinderung von Erkältungskrankheiten oder anderen gesundheitlichen Beeinträchtigungen tun, sollten sich aber auch mit diesem Cochrane Review bewusst sein, dass es für solche Wirkungen nur schwache Evidenz gibt. Probiotika sind also kein Allheilmittel.
Zu dem Cochrane Review "Probiotics for preventing acute upper respiratory tract infections" von Hao Q, Lu Z, Dong BR, Huang CQ und Wu T. (Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 9. Art. No.: CD006895. DOI: 10.1002/14651858.CD006895.pub2) gibt es kostenlos lediglich ein Abstract.
Bernard Braun, 22.9.11
Bericht des US-"Surgeon General": Egal ob "nur zwei Zigarettchen" oder "extra light", Rauchen gefährdet die Gesundheit!
 Diejenigen, denen beim Thema gesundheitliche Risiken von Rauchen immer noch die kerngesunde 98-jährige Großmutter einfällt, die ein Leben geraucht hat oder die denken, dass doch drei, vier Zigaretten nichts schaden würden, können sich auf den mehr als 700 Seiten eines gerade veröffentlichten Berichts des "Surgeon General" der USA eines Besseren belehren lassen. Der "surgeon general" ist der operative Leiter des "United States Public Health Services", vom Präsidenten und Parlament für vier Jahre eingesetzt und nimmt regelmäßig zu allen Angelegenheiten des öffentlichen Gesundheitsdienstes Stellung.
Diejenigen, denen beim Thema gesundheitliche Risiken von Rauchen immer noch die kerngesunde 98-jährige Großmutter einfällt, die ein Leben geraucht hat oder die denken, dass doch drei, vier Zigaretten nichts schaden würden, können sich auf den mehr als 700 Seiten eines gerade veröffentlichten Berichts des "Surgeon General" der USA eines Besseren belehren lassen. Der "surgeon general" ist der operative Leiter des "United States Public Health Services", vom Präsidenten und Parlament für vier Jahre eingesetzt und nimmt regelmäßig zu allen Angelegenheiten des öffentlichen Gesundheitsdienstes Stellung.
In seinem jetzt vorgelegten Bericht "How Tobacco Smoke Causes Disease: The Biology and Behavioral Basis for Smoking-Attributable Disease" untermauert er auf der Basis entsprechender Forschungsergebnisse faktenreich sechs zentrale Sachverhalte im Kontext von Tabakrauchen:
• Nach den vorliegenden Kenntnissen über die Mechanismen welche durch das Rauchen von Tabakwaren Rauchen Krankheiten auslösen gibt es kein risikofreies Niveau der Exposition gegenüber Tabakrauch.
• Die Inhalation der komplexen Mischung von Stoffen im Tabakrauch löst eine Fülle von Krebs-, Herz-Kreislauf- und Atemwegserkrankungen aus. Dies erfolgt über eine Vielzahl von Mechanismen bis hin zur Schädigung der DNA und so genanntem oxidativem Stress.
• Das Risiko und die Schwere unerwünschter gesundheitlicher Ergebnisse hängen direkt von der Dauer und der Intensität der Exposition gegenüber Tabakrauch.
• Anhaltender Konsum und lang anhaltende Exposition gegenüber Tabakrauch sind für die massiven Sucht- bzw. Abhängigkeitserscheinungen bei Rauchern verantwortlich. Suchtverstärkend können vielleicht auch weitere chemische Beimengungen zum Tabak wirken.
• Bereits niedrige Levels der Exposition, welche das Passivrauchen einschließen, führen zu einem schnellen und kräftigen Anstieg von Fehlfunktionen und Entzündungen in den Gefäßwänden, die wiederum maßgeblich zu akuten kardiovaskulären Ereignissen und Thrombosen beitragen.
• Für die von den Herstellern der Tabakwaren und einigen Wissenschaftlern verbreitete Hoffnung, dass die technische Reduktion einiger spezifischer Giftstoffe im Tabakrauch das Risiko der wesentlichen unerwünschten Ergebnisse des Rauchens reduzieren, gibt es keine ausreichende Evidenz.
Trotz des Umfangs bleibt der Bericht u.a. wegen eines detaillierten Stichwortverzeichnisses übersichtlich und anschaulich. Die ausführlichen Literaturverzeichnisse ermöglichen die Vertiefung der gewonnenen Erkenntnisse.
Der 2010 vom "U.S. Department of Health and Human Services" herausgegebene 732-Seiten-Bericht "How Tobacco Smoke Causes Disease: The Biology and Behavioral Basis for Smoking-Attributable Disease: A Report of the Surgeon General." ist komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 12.12.10
Rauchen und Passivrauchen - ein Risiko auch für psychische Erkrankungen?
 Das Rauchen ist einer der stärksten Risikofaktoren für das spätere Auftreten von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, und nicht nur Raucherinnen und Raucher selbst, sondern auch ihr Umfeld ist betroffen. Rauchverbote wurden daher auch zum Schutz der Nichtraucher verhängt und viele internationale Studien haben unlängst gezeigt, dass es einen eindeutigen Zusammenhang zwischen der Einführung von Rauchverboten und der Reduzierung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen gibt. (vgl. BvPG-Broschüre "Rauchverbote schützen vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen"). Eine Verlaufsstudie im United Kingdom hat nun Hinweise gefunden, dass Rauchen nicht nur körperliche Erkrankungen begünstigt, sondern möglicherweise auch das Risiko für psychische Störungen erhöht.
Das Rauchen ist einer der stärksten Risikofaktoren für das spätere Auftreten von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, und nicht nur Raucherinnen und Raucher selbst, sondern auch ihr Umfeld ist betroffen. Rauchverbote wurden daher auch zum Schutz der Nichtraucher verhängt und viele internationale Studien haben unlängst gezeigt, dass es einen eindeutigen Zusammenhang zwischen der Einführung von Rauchverboten und der Reduzierung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen gibt. (vgl. BvPG-Broschüre "Rauchverbote schützen vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen"). Eine Verlaufsstudie im United Kingdom hat nun Hinweise gefunden, dass Rauchen nicht nur körperliche Erkrankungen begünstigt, sondern möglicherweise auch das Risiko für psychische Störungen erhöht.
Es gibt einige Hinweise aus früheren Studien, dass Passivrauchen zu psychischen Beeinträchtigungen führen kann. So fand eine Schweizer Untersuchung, dass bei Personen, die selbst nie geraucht hatten, aber Zigarettenrauch ausgesetzt waren, dies mit erheblichen Beeinträchtigungen der gesundheitsbezogenen Lebensqualität im Zusammenhang stand, einschließlich körperlicher Beschwerden und Schmerzen. Ein Großteil dieser früheren Studien, so argumentiert die britisch-schottische Forschungsgruppe, weist jedoch methodische Schwächen auf, da das Ausmaß des Passivrauchen, also Häufigkeit und Dauer der Exposition gegenüber Tabakrauch nur anhand subjektiver Aussagen erfasst wurde - was zu Verzerrungen und Fehleinschätzungen führen kann.
In der jetzt in der Zeitschrift "Archives of General Psychiatry" veröffentlichten Studie wurde demgegenüber das Passivrauchen und auch das Rauchen zu Beginn der Studie objektiv gemessen, und zwar anhand des Serumcotinin-Gehalts (ein Nikotin-Abbauprodukt) im Speichel. Aus Teilnehmern des schottischen Gesundheitssurvey der Jahre 1998 und 2003 wurde eine Teilstichprobe gezogen von 5.560 Personen, die sich dort als Nichtraucher ausgegeben hatten (Durchschnittsalter 50 Jahre, 46% männlich) und 2.595 Personen, die dort erklärt hatten, sie seien Raucher (Durchschnittsalter 45 Jahre, 50% Männer). Bei allen wurde eine Speichelprobe genommen und die Rauchexposition analysiert. Anhand dieser Serumcotinin-Werte wurden die Männer und Frauen, unabhängig von ihren persönlichen Angaben zum Rauchverhalten, einer von fünf Gruppen zugeordnet, differenziert nach der Höhe des Serumcotinin-Spiegels.
Bei allen Studienteilnehmern wurde sichergestellt, dass sie bislang klinisch-psychiatrisch nicht auffällig waren und keine psychische Erkrankung bei ihnen festgestellt worden war. Sodann wurden zahlreiche Informationen erfasst: Körpergewicht und Größe zur Bestimmung des BMI, Aspekte des Gesundheitsverhaltens wie körperliche Bewegung und Alkoholkonsum, körperliche Erkrankungen, sozio-ökonomischer Status, Alter und Geschlecht. Psychische Störungen wurden mithilfe eines Fragebogens ("General Health Questionnaire") erfasst: Bei mehr als 3 Punkten bei 12 Fragen wurde eine psychische Störung konstatiert. Der Fragebogen erfasst die allgemeine Lebenszufriedenheit, Symptome von Depressivität und Ängstlichkeit sowie Schlafstörungen und wurde schon in einer Vielzahl von Forschungsstudien eingesetzt. Bei allen Studienteilnehmern wurde ferner über einen Zeitraum von 6 Jahren kontrolliert, ob sie wegen einer psychischen Erkrankung in eine Klinik aufgenommen wurden.
Im Rahmen sogenannter multivariater statistischer Analysen, bei denen eine Vielzahl potenzieller Einflussfaktoren (die oben genannten Merkmale: BMI, Alkohol, körperliche Bewegung, Alter und Geschlecht usw.) gleichzeitig überprüft werden kann, wurde dann untersucht, welchen Einfluss die objektiv gemessene Rauchexposition auf das Vorkommen psychischer Störungen hat. Hier zeigte sich: Das Risiko einer psychischen Störung (gemessen mit dem "General Health Questionnaire") stieg gleichförmig an, und zwar im Maße der Tabakrauch-Exposition. Im Vergleich zu Nichtrauchern bzw. solchen Personen, bei denen der Serumconitin-Spiegel gleich oder nahe Null war, erhöhte sich das Risiko psychischer Störungen in den übrigen vier Gruppen mit ansteigenden Serumcotinin-Werten und hatte die Werte 1,2 - 1,3 - 1,5 - 2,2. Das heißt: In der Gruppe mit den stärksten Rauchern war das Risiko psychischer Beeinträchtigungen 2,2mal so hoch wie bei Nichtrauchern bzw. Personen ohne Rauchexposition.
Bedeutsam erscheint an diesen Befunden, dass auch schon im mittleren Bereich, der typischerweise für Passivraucher zutrifft, höhere Risiken gefunden werden. Bei der Analyse des Zusammenhangs zu späteren Klinikaufenthalten wegen einer psychiatrischen Erkrankung zeigten sich ähnliche Werte: Das Risiko für aktive Raucher war hier bei 3,7mal so hoch. Allerdings ist die Fallzahl hier mit N=41 Personen sehr klein.
Die Wissenschaftler diskutieren in ihrer Studie abschließend auch, wie diese Befunde zu erklären sind. Dabei verweisen sie auf direkte medizinische Verursachungsketten, etwa aufgrund von Entzündungsprozessen oder Dopamin-Ausschüttungen im Gefolge der Rauchexposition. Für keine dieser Hypothesen gibt es bislang allerdings überzeigende Nachweise. Und da das Rauchverhalten und die Tabakrauch-Exposition in der Studie nur zu einem Zeitpunkt gemessen und darüber hinaus auch keine Kontrollgruppe einbezogen wurde, ist eine schlüssige Annahme kausaler Zusammenhänge nicht möglich. Denkbar ist ebenso, wie auch in vielen anderen Studien erwähnt, dass psychische Beeinträchtigungen anderweitig verursacht sind, sie aber zugleich häufiger auch zum Griff zur Zigarette verführen oder zum Gang in die Gaststätte mit hoher Rauchbelastung, die früher noch im United Kingdom gegeben war.
Hier ist ein Abstract der Studie: Hamer, Mark; Emmanuel Stamatakis; G. David Batty (2010): Objectively Assessed Secondhand Smoke Exposure and Mental Health in Adults, Cross-sectional and Prospective Evidence From the Scottish Health Survey (Archives of General Psychiatry. 2010;67(8), doi:10.1001/archgenpsychiatry.2010.76)
Bernard Braun, 10.9.10
Wer nutzt und wer versteht die Kennzeichnungen von Lebensmittel-Produkten?
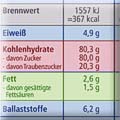 Das Europäische Parlament hat am 16.6.2010 unter massivem Druck vieler großer Hersteller von Lebensmitteln die vielfach gewünschte und auch für hilfreich und wirksam gehaltene Ampelkennzeichnung von Lebensmittelprodukten verworfen und damit im Kern die alte Kennzeichnungsform über den Nährwertgehalt verpflichtend erhalten. Mit der verpflichtenden umfangreichen Nährwertkennzeichnung (vor allem über den Energiegehalt, Fette, gesättigte Fettsäuren, Zucker und Salz) in gut lesbarer Form auf der Vorderseite der Verpackung sollen, so die erfolgreichen Antragsteller, Verbraucher eine gut überlegte Wahl treffen können, während gleichzeitig die administrativen und finanziellen Auswirkungen für die Lebensmittelbranche so weit wie möglich eingegrenzt werden sollen.
Das Europäische Parlament hat am 16.6.2010 unter massivem Druck vieler großer Hersteller von Lebensmitteln die vielfach gewünschte und auch für hilfreich und wirksam gehaltene Ampelkennzeichnung von Lebensmittelprodukten verworfen und damit im Kern die alte Kennzeichnungsform über den Nährwertgehalt verpflichtend erhalten. Mit der verpflichtenden umfangreichen Nährwertkennzeichnung (vor allem über den Energiegehalt, Fette, gesättigte Fettsäuren, Zucker und Salz) in gut lesbarer Form auf der Vorderseite der Verpackung sollen, so die erfolgreichen Antragsteller, Verbraucher eine gut überlegte Wahl treffen können, während gleichzeitig die administrativen und finanziellen Auswirkungen für die Lebensmittelbranche so weit wie möglich eingegrenzt werden sollen.
Damit haben sich die Europaparlamentarier nicht nur über mehrere Voten der Bevölkerungsmehrheit für eine Ampelkennzeichnung (u.a. in Deutschland) und deren erfolgreiche Praxis in Großbritannien hinweg gesetzt (siehe dazu die Beiträge im DIW-Wochenbericht 22/2010), sondern auch die nachgewiesene eingeschränkte Wirksamkeit der alten und neuen Kennzeichnung ignoriert.
Gemeint ist damit die aktuelle Studie eines dänisch-belgischen Forschungsteams, die in 6 Ländern Europas (darunter auch in Deutschland bei 1.963 Personen) überprüft hat, wer sich auf Lebensmittel-Produkten überhaupt die Kennzeichnungen anschaut (Kalorien, Fett, Zucker usw.) und wie viel davon von den Konsumenten verstanden wird. In der Studie wurde zum einen das Produktauswahlverhalten von Verbrauchern bei sechs Produktkategorien durch teilnehmende Beobachtung in Supermärkten erhoben. Dies wurde durch Interviews mit Verbrauchern ergänzt, in denen auch eine Reihe von sozioökonomischen Merkmalen sowie der Kenntnisstand über Lebensmittel und das Interesse an gesundem Essen erhoben wurden.
Die Ergebnisse sind klar und eindeutig:
• Nur jeder siebte Käufer schaut sich überhaupt die Kennzeichnung an.
• Das Verständnis für die Information über die Menge an Stoffen, die man mit dem Verzehr des Lebensmittel für seinen Tagesbedarf an Fetten, Kohlehydraten oder Eiweiß aufnimmt (so genannte "guideline daily amount" - GDA) ist in den Ländern unterschiedlich hoch, in Großbritannien, in Schweden und Deutschland höher als in Polen, Ungarn, Frankreich.
• In multivariaten Analysen, die den Effekt unterschiedlicher Einflussfaktoren gleichzeitig berücksichtigen, zeigte sich: Großen Einfluss auf das Verständnis und die Nutzung der GDA-Informationen besaßen zusätzlich zu länderspezifischen Einflüssen der sozio-ökonomische Status, aber auch das Interesse an gesunder Ernährung und das Wissen über Nahrungsmittel und Effekte des Ernährungsverhaltens.
Die Ergebnisse der Studie weisen aber darauf hin, dass unabhängig von der Weiternutzung und Weiterentwicklung der Kennzeichnung von Lebensmitteln in den öffentlichen Debatten auch die unterschiedliche Bedeutung des Ernährungsverhaltens in verschiedenen Subkulturen und sozialen Schichten berücksichtigt werden muss.
Ungeklärt lässt diese Studie allerdings, ob sich die gelesene Information auf die Auswahl der Lebensmittel auswirkte und insbesondere den Anteil für gesund erachteter Lebensmittel erhöhte. Unbekannt bleibt weiterhin, ob die Kennzeichnungsinformationen Einfluss auf die Planung der Ernährung und die Einkaufsplanung haben.
Die Ergebnisse der Studie sind komplett kostenlos erhältlich: Klaus G. Grunert et al: Use and understanding of nutrition information on food labels in six European countries (Journal of Public Health 2010; 18:261-277)
Einen kompakten Überblick zu weiteren, allerdings zum Teil widersprüchlichen Studien über die Akzeptanz und Nutzung der alten und neuen Nährwerttabellen-Kennzeichnung und die Alternative der Ampelkennzeichnung, liefern zwei Beiträge im Wochenbericht 22/2010 des "Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW)" vom 2. Juni 2010:
• "Nährwertkennzeichnung: Die Ampel erreicht die Verbraucher am besten" von Kornelia Hagen und
• "Hintergrund: Nährwertkennzeichnung heute. Was Verbraucher wollen - und was sie verstehen"
Bernard Braun, 5.8.10
Lebensmittel aus der Fernsehwerbung: Einfach nur ungesund
 Eine US-amerikanische Studie hat einen Monat lang knapp 100 Stunden lang Fernsehsendungen samt der eingestreuten TV-Werbespots aufgezeichnet und die dort präsentierte Werbung für Lebensmittel analysiert. Das Ergebnis war überaus erschreckend: Würde man eine Mahlzeit nur aus jenen Produkten zusammenstellen, für die im Fernsehen geworben wird, wäre dies in gesundheitlicher Hinsicht mehr als bedenklich. Für diese Mahlzeit wurden die Durchschnittswerte der in der Werbung gezeigten Nahrungsmittel errechnet. Heraus kam bei dieser Mahlzeit mit einem Brennwert von 2.000 kcal: Sie enthielte das 25fache der gesundheitlich empfohlenen Menge an Zucker und das 21fache an Fett-Anteilen. Auf der anderen Seite würde man aber nur 40 Prozent des empfohlenen Gemüse-Anteils und nur 27 Prozent der empfohlenen Obstmenge zu sich nehmen. Darüber hinaus wäre der Verbraucher hinsichtlich vieler Bestandteile der Ernährung deutlich überversorgt, bei anderen hingegen (wie Vitamine und Mineralien) deutlich unterversorgt.
Eine US-amerikanische Studie hat einen Monat lang knapp 100 Stunden lang Fernsehsendungen samt der eingestreuten TV-Werbespots aufgezeichnet und die dort präsentierte Werbung für Lebensmittel analysiert. Das Ergebnis war überaus erschreckend: Würde man eine Mahlzeit nur aus jenen Produkten zusammenstellen, für die im Fernsehen geworben wird, wäre dies in gesundheitlicher Hinsicht mehr als bedenklich. Für diese Mahlzeit wurden die Durchschnittswerte der in der Werbung gezeigten Nahrungsmittel errechnet. Heraus kam bei dieser Mahlzeit mit einem Brennwert von 2.000 kcal: Sie enthielte das 25fache der gesundheitlich empfohlenen Menge an Zucker und das 21fache an Fett-Anteilen. Auf der anderen Seite würde man aber nur 40 Prozent des empfohlenen Gemüse-Anteils und nur 27 Prozent der empfohlenen Obstmenge zu sich nehmen. Darüber hinaus wäre der Verbraucher hinsichtlich vieler Bestandteile der Ernährung deutlich überversorgt, bei anderen hingegen (wie Vitamine und Mineralien) deutlich unterversorgt.
Fernsehwerbung für Nahrungsmittel und Getränke ist eine der effektivsten Möglichkeiten, das Ernährungsverhalten von Erwachsenen wie Kindern zu beeinflussen. Im Alter von 65 Jahren, so hat eine Studie errechnet, hat der Durchschnitts-Verbraucher in den USA etwa 2 Millionen Werbespots über sich ergehen lassen, der größte Teil davon war für Nahrungsmittel und Getränke (Quelle: The Sourcebook for Teaching Science). Im Jahre 2004 gaben Lebensmittelhersteller in den USA etwa 11,2 Milliarden Dollar für Werbung aus, etwa 2 Prozent der Summe für Verbraucherinformationen zu gesunder Ernährung.
Eine Reihe von Studie hatte bereits gezeigt, dass die in der Fernsehwerbung gezeigten Speisen und Getränke überwiegend "ungesund" sind, weil sie zu hohe Anteile an Fett, Salz oder Zucker enthalten. Die bislang vorgestellten Ergebnisse dieser Studien sind jedoch methodisch angreifbar. Beispielsweise wurde in einigen Studien untersucht, wie viele Werbespots für Produkte mit zuviel Salz, Fett oder Zucker es gibt und wie viele Spots im Vergleich dazu für gesundheitlich empfehlenswerte Produkte. In der jetzt veröffentlichten Studie wurde jedoch nicht die Zahl der Werbesendungen miteinander verglichen, sondern bei den dort präsentierten Produkten wurde analysiert, welche Bestandteile im Einzelnen (Zucker, Fett, Fleisch, Gemüse, Milchprodukte, Obst, Gemüse, Ballaststoffe etc.) in einer Portion des beworbenen Produkts enthalten sind. Die dafür ermittelten Durchschnittswerte - die auch noch für andere Nahrungsbestandteile wie Vitamine, Spurenelemente usw. errechnet wurden - dienten dann als Basis für die Konstruktion einer Mahlzeit von 2.000 kcal., die ein fiktiver Konsument zu sich nimmt, wenn er sich einzig und allein mit Produkten ernährt, die er in der TV-Werbung gesehen hat.
Für die Auswahl der analysierten Lebensmittel, Speisen und Getränke zeichneten die Wissenschaftler im Herbst 2004 während eines 28tägigen Zeitraums Fernsehsendungen samt der dazu geschalteten Werbung auf, insgesamt 96 Stunden, die später analysiert wurden. Berücksichtigt wurden überwiegend Sendungen zur Hauptsendezeit, in begrenztem Umfang auch Kinder-Sendungen am Samstag vormittag. Jedes dort vorkommende Produkt wurde erfasst und mit Hilfe einer speziellen Computer-Software ("Nutritionist Pro") hinsichtlich der zentralen Nährstoffe und anderer Bestandteile analysiert.
Würde ein Verbraucher sich Mahlzeiten zusammenstellen und nur die in der Werbung gezeigten Produkte verwenden, so wäre dies überaus bedenklich. "In der Werbung gezeigte Lebensmittel," so der Leiter der Studie Prof. Michael Mink, "enthalten eine zu große Menge an Bestandteilen, die mit der Verursachung chronischer Erkrankungen im Zusammenhang stehen (u.a. gesättigte Fette, Cholesterin, Salz). Andererseits mangelt es an Substanzen, die vor Krankheiten schützen können wie Ballaststoffe, Vitamin A, E und D." In der Analyse einer solchen durchschnittlichen Essensmahlzeit nur aus Werbeprodukten zeigten sich folgende Befunde im Einzelnen.
• Sie enthält 2.560 % der täglich empfohlenen Menge an Zucker,
• 2.080 % der pro Tag empfohlenen Menge an Fett,
• aber nur 40 % des Anteils an Gemüse
• und nur 27 % der empfohlenen Tagesdosis für Obst.
• Die Mahlzeit enthielte weiterhin ein Überangebot an Eiweiß, Fett insgesamt, gesättigten Fettsäuren, Cholesterin und Natrium,
• während andererseits ein deutlicher Mangel herrscht in Bezug auf Kohlehydrate, Ballaststoffe, Vitamin A , E und D, Pantothensäure, Eisen, Phosphor, Kalzium, Magnesium, Kupfer und Kalium.
Zwar untersucht die Studie nicht, so räumen die Autoren ein, ob und in welchem Umfang nun Verbraucher ihren Speiseplan an den (oft so genannten "Einkaufs-Tipps") im Werbefernsehen ausrichten. Dies zu untersuchen, sei eine überaus wichtige zukünftige Forschungsaufgabe. Allerdings haben andere Studien schon gezeigt, dass beispielsweise schon 4-5jährige Vorschulkinder von McDonald's Werbebotschaften im Fernsehen beeinflusst werden. Und dass TV-Werbung durchaus geeignet ist, das Konsumentenverhalten zu steuern, zeigt die Höhe der Ausgaben für Werbung und Marketing.
Von der Studie ist kostenlos leider nur ein Abstract erhältlich: Michael Mink, Alexandra Evans, Charity G. Moore, Kristine S. Calderon, Shannon Cosgrove: Nutritional Imbalance Endorsed by Televised Food Advertisements (Journal of the American Dietetic Association, Volume 110, Issue 6, June 2010, Pages 904-910, doi:10.1016/j.jada.2010.03.020)
Gerd Marstedt, 1.8.10
Schweizer Studie: Mehr Schulsport wirkt sich gesundheitlich überaus positiv aus
 Zwei zusätzliche Stunden Sportunterricht in der Woche - kann dies ein Mittel sein, um Übergewicht und Adipositas bei Kindern und Jugendlichen zu bekämpfen? Ein jetzt in der renommierten englischen Fachzeitschrift "British Medical Journal" veröffentlichter Artikel über eine Schweizer Interventionsstudie macht deutlich, dass mehr Sport und Bewegung in der Schule sich gesundheitlich überaus positiv auswirken, wie an einer Reihe von Indikatoren (Körperfett, Fitness, Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen) deutlich wird. Ein Wermutstropfen bleibt gleichwohl: Das Körpergewicht der Schüler und der Body Mass Index nahmen nicht ab, sondern stiegen generell ein wenig an, allerdings in der Kontrollgruppe noch stärker als in der Interventionsgruppe.
Zwei zusätzliche Stunden Sportunterricht in der Woche - kann dies ein Mittel sein, um Übergewicht und Adipositas bei Kindern und Jugendlichen zu bekämpfen? Ein jetzt in der renommierten englischen Fachzeitschrift "British Medical Journal" veröffentlichter Artikel über eine Schweizer Interventionsstudie macht deutlich, dass mehr Sport und Bewegung in der Schule sich gesundheitlich überaus positiv auswirken, wie an einer Reihe von Indikatoren (Körperfett, Fitness, Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen) deutlich wird. Ein Wermutstropfen bleibt gleichwohl: Das Körpergewicht der Schüler und der Body Mass Index nahmen nicht ab, sondern stiegen generell ein wenig an, allerdings in der Kontrollgruppe noch stärker als in der Interventionsgruppe.
Insgesamt 502 Schülerinnen und Schüler im Alter von etwa sieben bis elf Jahren nahmen an der Studie teil, die an 15 Schweizer Grundschulen im Aargau und Baseler Umland durchgeführt wurde. Ein "sozial-ökologisches Konzept" sollte auf seine Effektivität bei der Bekämpfung von Übergewicht und der Verbesserung körperlicher Fitness überprüft werden. Dazu wurden die teilnehmenden Kinder nach dem Zufallsprinzip einer Interventions- oder Kontrollgruppe zugewiesen. In der Kontrollgruppe wurde weiter nichts unternommen, der Schulunterricht lief wie gewohnt weiter und Teilnehmer wurden ganz bewusst nicht informiert, dass sie als Vergleichsgruppe dienen sollten.
In der Interventionsgruppe jedoch wurde einiges verändert:
• Der Sportunterricht wurde von drei auf fünf Unterrichtstunden (zu jeweils 45 Minuten) erhöht, und die zwei zusätzlichen Stunden wurden nicht von den gewohnten Klassenlehrern abgehalten, sondern von geschulten Sportlehrern.
• Der gesamte Unterricht wurde von Sportwissenschaftlern neu strukturiert. Lehrer sollten jetzt etwa 3-5mal am Tag kurze Pausen einlegen, um unterschiedliche motorische Übungen durchzuführen: Springen, auf einem Bein Balancieren, Kraftübungen, Koordinationsaufgaben und anderes mehr.
• Darüber hinaus bekamen die Kinder täglich andere sportliche Hausaufgaben, deren Ausübung jeweils etwa 10 Minuten dauerte und die mit den Übungen in den Unterrichtspausen vergleichbar waren: Aerobic, Krafttraining, Seilspringen, Treppen hinauf und wieder herunter hüpfen, auf einem Bein stehen und sich die Zähne putzen und ähnliches mehr.
Zur Messung der Interventionseffekte wurden als primäre Indikatoren herangezogen: Körperfett an bestimmten Hautpartien, körperliche Fitness, Ausmaß körperlicher Bewegung und Fragen zur wahrgenommenen Lebensqualität. Darüber hinaus wurden auch der Body Mass Index überprüft und ein Risikowert für kardiovaskuläre Erkrankungen gebildet (u.a. auf der Basis von Blutdruck, Blutzuckerwert, Hüftumfang, Cholesterinwerte).
Nach neun Monaten wurden diese Indikatoren dann in der Interventions-, aber auch in der Kontrollgruppe erhoben und mit den Daten zu Studienbeginn verglichen. Dabei zeigten sich in einer multivariaten Analyse, die auf statistischem Wege auch andere Einflussfaktoren (Alter, Geschlecht etc.) berücksichtigte, unterschiedliche Befunde:
• Positive Effekte zugunsten der Interventionsgruppe zeigten sich im Hinblick auf die Entwicklung von Körperfett an vier Hautpartien, die körperliche Fitness bei Aerobic-Übungen, das Ausmaß körperlicher Bewegung in der Schule. Ebenso verbesserten sich die Risikowerte für Herz-Kreislauf-Erkrankungen in der Interventionsgruppe stärker als in der Kontrollgruppe.
• Keine Unterschiede hingegen zeigten sich für die Bewertung der körperlichen und psychischen Lebensqualität.
• Im Hinblick auf Veränderungen des Body Mass Index zeigte sich überraschender Weise, dass der Durchschnittswert in beiden Gruppen (allerdings nur geringfügig) gestiegen war, wobei der Anstieg in der Kontrollgruppe noch etwas höher ausfiel (+ 0,4 bzw. + 0,3 BMI).
Die Forscher führen dieses letzte, für sie unerwartete Ergebnis darauf zurück, dass in der Interventionsgruppe der zeitliche Umfang von Sport und Bewegung in der Freizeit zurückgegangen war, und zwar vermutlich aufgrund des zeitlich erweiterten Schulsports. Da sich jedoch eine Reihe anderer Indikatoren, wie das Ausmaß an Körperfett, die körperliche Fitness und sogar kardiovaskuläre Risikofaktoren durch die Maßnahmen sehr positiv verändert haben, sprechen sie zu Recht von einem Erfolg ihrer Studie. Unterstrichen wird dies durch Ergebnisse einer Befragung am Ende der Studie: 90% der Kinder und 70% der Lehrer wünschten sich eine Fortsetzung der Maßnahmen auch in kommenden Schuljahren.
Eine wichtige Frage bleibt allerdings für Wissenschaftler zukünftig noch zu klären, nämlich die, wie man in weiteren Interventionsstudien vermeiden kann, dass eine zeitliche Ausweitung von Sport und körperlicher Bewegung im Setting Schule wieder konterkariert wird durch eine Reduktion solcher Aktivitäten in der Freizeit.
Von der Veröffentlichung gibt es im BMJ kostenlos ein Abstract, aber auch den Volltext: Susi Kriemler et al: Effect of school based physical activityprogramme (KISS) on fitness and adiposity in primary schoolchildren: cluster randomised controlled trial, BMJ 2010;340:c785, doi:10.1136/bmj.c785
• Abstract
• Volltext (PDF)
Gerd Marstedt, 30.4.10
Steuer auf Junk Food: gut für die Gesundheit
 Höhere Preise für Cola und Pizza senken den Konsum dieser Lebensmittel, lautet das Fazit einer amerikanischen Studie.
Höhere Preise für Cola und Pizza senken den Konsum dieser Lebensmittel, lautet das Fazit einer amerikanischen Studie.
Die CARDIA-Studie wurde im Jahr 1985 in den USA initiiert, um die Faktoren zu untersuchen, die zur Entwicklung von Herzkreislauferkrankungen beitragen. Aufgenommen wurden 5115 junge Männer und Frauen (Alter 18 bis 30 Jahre) unterschiedlicher Ethnien und unterschiedlichen Bildungsstandes. Das Ernährungsverhalten wurde über einen Zeitraum von 20 Jahren mehrfach per Fragebogen erfasst. Körpergröße und Gewicht sowie Glucose und Insulin wurden im Blut wurden gemessen. An soziodemographischen Merkmalen wurden der höchste Bildungsabschluss, das Jahreseinkommen und der Familienstatus erfragt.
Analysiert wurde die Preiselastizität, d.h. die prozentuale Änderung des Konsums eines Lebensmittels bei prozentualer Änderung des Preises dieses oder eines anderen Lebensmittels - so z.B. die Veränderung des Konsums zuckerhaltiger Limonade und auch des Milchkonsums bei Veränderungen des Limonadenpreises.
Preisänderungen von Limonade und Pizza wirkten sich spürbar auf deren Konsum aus. Ein Anstieg des Preises für Limonade um 10 Prozent ging mit einem Rückgang der durch Limonade aufgenommenen Kalorien um 7 Prozent einher. Bei Pizza führt die Verteuerung um 10 Prozent zu einer Minderung der Kalorien durch Pizzakonsum um 11,5 Prozent.
Dieser Studien zufolge werden 124 Kalorien weniger aufgenommen, wenn der Limonadenpreis um einen Dollar steigt, einhergehend mit einer Gewichtsabnahme von 1,1 kg und verbesserten Stoffwechselwerten. Preissteigerungen bei Pizza zeigten vergleichbare Effekte. Steigen die Preise für Limonade und Pizza addierten sich die Effekte.
Die für den Bundesstaat New York vorgeschlagene aber abgelehnte Besteuerung von Junk Food um 18 Prozent würde bei jungen Erwachsenen und Menschen im mittleren Lebensalter zu einer Minderung der Energiezufuhr um 56 Kalorien pro Tag und zu einer Gewichtsreduktion von 2,25 kg pro Jahr sowie einer Verbesserung der Stoffwechsellage führen.
Nach Meinung der Autoren könnte somit eine Besteuerung von Junkfood über die Minderung der Kalorienaufnahme und des Körpergewichts z.B. zu einer Reduktion der Neuerkrankungen an Diabetes führen.
Duffey KJ, Gordon-Larsen P, Shikany JM, Guilkey D, Jacobs DR, Jr, Popkin BM. Food Price and Diet and Health Outcomes: 20 Years of the CARDIA Study. Arch Intern Med 2010;170(5):420-426. Abstract der Studie
David Klemperer, 26.3.10
Sport und körperliche Bewegung: Studien belegen erneut die gesundheitsförderliche Wirkung bei Älteren
 Vier neue Studien, die in der Zeitschrift "Archives of Internal Medicine" veröffentlicht wurden, dokumentieren auf unterschiedliche Weise, welche positiven gesundheitlichen Effekte Sport und körperliche Bewegung bei Älteren haben. Die Untersuchungen zeigen positive Auswirkungen für verschiedene altersbedingte Erkrankungen, für den allgemeinen Gesundheitszustand im Alter und für einzelne Zusammenhänge zwischen körperlicher Bewegung, kognitiven Leistungen und Sturzrisiken.
Vier neue Studien, die in der Zeitschrift "Archives of Internal Medicine" veröffentlicht wurden, dokumentieren auf unterschiedliche Weise, welche positiven gesundheitlichen Effekte Sport und körperliche Bewegung bei Älteren haben. Die Untersuchungen zeigen positive Auswirkungen für verschiedene altersbedingte Erkrankungen, für den allgemeinen Gesundheitszustand im Alter und für einzelne Zusammenhänge zwischen körperlicher Bewegung, kognitiven Leistungen und Sturzrisiken.
Körperliche Bewegung im mittleren Lebensalter bewirkt bei älteren Frauen einen besseren Gesundheitszustand im Alter
Ein Forschungsteam der Harvard School of Public Health in Brigham und der Harvard Medical School in Boston analysierte Daten von 13.535 Teilnehmern an der "Nurses' Health Study", einer US-amerikanischen Längsschnittstudie, die Zusammenhänge zwischen Ernährung und Krebsrisiken bei Frauen untersucht. Schon seit 1976 werden alle zwei Jahre bei Krankenschwestern Befragungen und zum Teil auch klinischen Untersuchungen durchgeführt. Bei der jetzt realisierten Datenanalyse fand man heraus, dass Teilnehmerinnen im Alter von über 70 Jahren, die früher ein höheres Maß an körperlicher Aktivität an den Tag gelegt hatten, im Alter einen deutlich besseren Gesundheitszustand aufwiesen. Verglichen wurden dabei Fragebogen-Daten aus dem Jahr 1986, als die Krankenschwestern etwa 60 Jahre alt waren, und Gesundheitsdaten aus den Jahren 1995 bis 2001. Dabei zeigte sich: Je höher das frühere Ausmaß an Sport und Bewegung war, desto seltener hatten die Frauen später chronische Erkrankungen oder andere körperliche oder seelische Beschwerden.
Hier ist ein Abstract: Qi Sun et al: Physical Activity at Midlife in Relation to Successful Survival in Women at Age 70 Years or Older (Arch Intern Med. 2010;170[2]:194 -201)
Krafttraining bei älteren Frauen verbessert körperliche Fitness und kognitive Fähigkeiten
In einer zweiten Studie zeigte sich, dass 1-2 Stunden Krafttraining in der Woche in einer Studie nicht nur die körperliche Fitness von Seniorinnen verbesserten, sondern auch die Ergebnisse in kognitiven Tests. Dabei handelte es sich um eine so genannte "randomisierte Kontrollstudie", bei der die Teilnehmer nach dem Zufallsprinzip entweder einer Interventions- oder einer Kontrollgruppe zugeordnet wurden. Beteiligt waren 155 ältere, zuhause lebenden Frauen im Alter von 65 bis 75 Jahren. Frauen der Interventionsgruppe (N=106) wurden eingeladen, entweder einmal oder zweimal in der Woche unter Anleitung eine Stunde mit Hanteln und an Kraftmaschinen zu trainieren. In einer Kontrollgruppe wurde 49 gleichaltrigen Frauen zweimal wöchentlich ein Balancetraining angeboten. Die Frauen der Interventionsgruppe schnitten am Ende der Studie (nach etwa 12 Monaten) dann hinsichtlich der Fitness, aber auch in einer Reihe von kognitiven Tests erheblich besser ab.
Hier ist ein Abstract: Teresa Liu-Ambrose et al: Resistance Training and Executive Functions. A 12-Month Randomized Con-trolled Trial (Arch Intern Med. 2010;170(2):170-178)
Körperliche Bewegung bei Älteren reduziert das Risiko kognitiver Leistungseinschränkungen
In einer deutschen Studie untersuchte Thorleif Etgen (Technische Universität München) zusammen mit Kollegen Senioren über einen Zeitraum von zwei Jahren und fand heraus, dass mittlere oder intensive körperliche Aktivität das Risiko kognitiver Beeinträchtigungen reduzierte. Die Teilnehmer an der Studie waren allesamt älter als 55 Jahre. Zu Beginn wurden bei ihnen Tests durchgeführt zur Erfassung der kognitiven Funktionen, aber auch die körperliche Fitness wurde untersucht. Zu diesem Zeitpunkt stellte man bei 418 Teilnehmern, etwa 11% der Stichprobe, kognitive Funktionseinschränkungen fest, bei etwa 3.500 anderen Teilnehmern war dies nicht der Fall. Eine erneute Überprüfung nach zwei Jahren zeigte dann, dass zusätzlich jetzt 207 weitere Senioren kognitive Defizite aufwiesen. Befragungsdaten darüber, in welchem Ausmaß die Teilnehmern in den vergangenen zwei Jahren Sport oder andere körperliche Bewegung hatten, zeigten dann einen engen Zusammenhang mit dem Risiko für die Entwicklung kognitiver Beeinträchtigungen. Ohne jeden Sport betrug das Risiko 13,9%, mit mittlerer bzw. intensiver Aktivität betrug es nur 6,7% bzw. 5,1%.
Hier ist ein Abstract: Thorleif Etgen et al: Physical Activity and Incident Cognitive Impairment in Elderly Persons: the INVADE Study (Arch Intern Med. 2010;170[2]:186 -193)
Körperliche Bewegung senkt bei älteren Frauen das Risiko von Stürzen und Knochenbrüchen
Eine weitere deutsche Studie zeigte schließlich bei 246 Frauen im Alter über 65 Jahren, dass das Risiko von Stürzen und Knochenbrüchen durch Sport und Bewegung gesenkt werden kann. Die Teilnehmerinnen wurden nach dem Zufallsprinzip einer Interventions- oder Kontrollgruppe zugeordnet. Die Kontrollgruppe nahm 18 Monate lang an einem Wellness-Programm mit moderaten und wenig anstrengenden Bewegungsübungen teil, die Interventionsgruppe führte im selben Zeitraum viermal wöchentlich ein im Vergleich dazu sehr intensives und anstrengendes Bewegungsprogramm durch. Zum Studienende wurden bei allen Teilnehmerinnen unterschiedliche Gesundheits-Indikatoren erfasst. Dabei zeigte sich dann, dass zwischen Interventions- und Kontrollgruppe kein Unterschied erkennbar war, was Herz-Kreislauf-Erkrankungen anbetraf: In beiden Gruppen ging das Risiko zurück. Unterschiede zeigten sich jedoch bei anderen Vergleichswerten: Die Interventionsgruppe zeigte eine deutlich reduzierte Anzahl von Stürzen und Knochenbrüchen im Vergleich zur Kontrollgruppe. Die niedrigeren Risiken für Frakturen erklärten die Wissenschaftler mit einer höheren Knochendichte als Folge des Bewegungsprogramms.
Hier ist ein Abstract: Wolfgang Kemmler et al: Kalender Exercise Effects on Bone Mineral Density, Falls, Coronary Risk Factors, and Health Care Costs in Older Women: the Randomized Controlled Senior Fitness and Prevention (SEFIP) Study (Arch Intern Med. 2010;170[2]:179 -185)
Gerd Marstedt, 22.3.10
Ein gesunder Lebensstil ist zur Prävention von Diabetes effektiver als Medikamente
 Die Prävention von Diabetes mellitus Typ 2 (die meist erst nach dem 30. Lebensjahr auftritt) ist gesundheitspolitisch von großer Bedeutung, da eine Therapie (im Sinne von "Heilung") nur sehr begrenzt möglich ist und eine Vielzahl von Begleit- und Folgeerkrankungen beobachtet wurde - von Herzinfarkt und Niereninsuffizienz bis hin zur Erblindung und Fußamputation. Nach einer Diagnose erhöhter Blutzuckerwerte wird vom Arzt anfänglich recht häufig das Medikament Metformin verordnet, das die Neubildung von Glukose (Traubenzucker) in der Leber hemmt und auch die Aufnahme von Glukose im Darm verzögert. Nicht selten wird diese Arzneimittelverordnung dann auch über längere Zeit beibehalten.
Die Prävention von Diabetes mellitus Typ 2 (die meist erst nach dem 30. Lebensjahr auftritt) ist gesundheitspolitisch von großer Bedeutung, da eine Therapie (im Sinne von "Heilung") nur sehr begrenzt möglich ist und eine Vielzahl von Begleit- und Folgeerkrankungen beobachtet wurde - von Herzinfarkt und Niereninsuffizienz bis hin zur Erblindung und Fußamputation. Nach einer Diagnose erhöhter Blutzuckerwerte wird vom Arzt anfänglich recht häufig das Medikament Metformin verordnet, das die Neubildung von Glukose (Traubenzucker) in der Leber hemmt und auch die Aufnahme von Glukose im Darm verzögert. Nicht selten wird diese Arzneimittelverordnung dann auch über längere Zeit beibehalten.
Aus früheren Studien bekannt ist aber auch, dass eine Änderung des Lebensstils, insbesondere eine Umstellung der Ernährung und mehr körperliche Bewegung, zumindest dieselben, teilweise bessere Effekte erzielt und überdies nicht die Nebenwirkungen der Arzneimitteltherapie mit sich bringt. Die Dauertherapie mit Metformin wurde daher auch als unnötige "Medikalisierung" von Patienten kritisiert.
Eine internationale Forschungsgruppe, die "Diabetes Prevention Program Research Group" hat nun Ergebnisse einer Studie veröffentlicht, in der über einen Zeitraum von 10 Jahren kontrolliert wurde, was zur Prävention von Diabetes Typ 2 besser geeignet ist: Eine Änderung des Lebensstils oder die Einnahme von Metformin.
Dazu wurde im Zeitraum 1996-1999 eine Studie mit 2.766 Teilnehmern begonnen und zehn Jahre lang kontrolliert, ob eine Diabetes ärztlich diagnostiziert wurde. Die Teilnehmer wurden zu Beginn nach dem Zufallsprinzip einer von drei Gruppen zugeordnet: Einer Gruppe wurde die Einnahme von Metformin verordnet. Eine zweite Gruppe erhielt Informationen und soziale Unterstützung um eine Änderung des Lebensstils zu erreichen. Diese Beratung und Information konnte ausführlich zu Beginn und später alle drei Monate in Anspruch genommen werden. Ziel der Lebensstiländerung war eine Gewichtsreduzierung um etwa 7 Prozent und das regelmäßige Durchführen von Sport oder moderater körperlicher Aktivität, und zwar im Umfang von 150 Minuten pro Woche. Eine dritte Gruppe schließlich erhielt lediglich ein Scheinmedikament (Placebo).
Sichergestellt wurde zu Beginn, dass wesentliche medizinische Risikofaktoren wie unter anderem Body Mass Index, Körpergewicht, Blutzucker- und Cholesterinwerte, aber auch Faktoren wie Alter und Geschlecht in den drei Gruppen keine gravierenden Unterschiede aufwiesen.
In einer ersten Kontrolle nach knapp drei Jahren hatte sich gezeigt, dass bei Erwachsenen mit hohem Diabetes-Risiko das Neu-Auftreten dieser Erkrankung in der Lebensstilgruppe am stärksten abgesenkt werden konnte: Verglichen mit der Placebogruppe um 58 Prozent, in der Medikamentengruppe nur um 31 Prozent.
In einer weiteren Kontrolle nach 9,0 - 10,5 Jahren wurde nun überprüft, ob sich dieses bessere Abschneiden von Lebensstiländerungen als Intervention zur Diabetes-Prävention bestätigen ließ. Tatsächlich zeigten sich ähnliche, wenn gleich nun etwas niedrigere Zahlen: Seit Studienbeginn vor etwa 10 Jahren wurde das Neuauftreten von Diabetes in der Lebensstilgruppe (im Vergleich zur Placebo-Einnahme) um 34 Prozent gesenkt, in der Metformin-Gruppe um 18 Prozent. Oder mit anderen Werten ausgedrückt: Im Gesamtzeitraum der Studie wurde folgende Zahl an neuen Diabetes-Erkrankungen pro 100 Personen-Jahre beobachtet: 5,3 Fälle in der Lebensstilgruppe, 6,4 Fälle in der Metformin-Gruppe, 7,8 Fälle in der Placebo-Gruppe. Auf einer Zeitachse betrachtet, wird das Auftreten von Diabetes durch Lebensstiländerungen um etwa vier Jahre verzögert, bei Metformin sind es zwei Jahre.
Kostenlos verfügbar ist ein Abstract der Studie: Diabetes Prevention Program Research Group: 10-year follow-up of diabetes incidence and weight loss in the Diabetes Prevention Program Outcomes Study (The Lancet, Volume 374, Issue 9702, 14 November 2009-20 November 2009, Pages 1677-1686)
Gerd Marstedt, 21.2.10
Persönliche Konzepte von Gesundheit und gesunder Ernährung sind in der Mittelschicht andere als in der Unterschicht
 In einer kaum mehr überschaubaren Zahl von Studien hat sich gezeigt, dass ein riskantes Gesundheitsverhalten, etwa, was Rauchen und Alkoholkonsum, Sport und Bewegung oder auch die Ernährung anbetrifft, in unteren Sozialschichten sehr viel häufiger anzutreffen ist. Die Frage, warum dies so ist, wurde in wissenschaftlichen Studien allerdings weitaus seltener aufgegriffen - obwohl ein genaueres Verständnis der hier maßgeblichen Hintergründe dazu beitragen würde, schichtspezifische Barrieren im Rahmen von Gesundheitsförderung abzubauen. Eine schottische Studie hat diese Fragestellung nun aufgegriffen und im Rahmen von qualitativen Interviews herauszufinden versucht, inwieweit auch das gesundheitsbezogene Alltagsverhalten sich aus allgemeineren Normen und Erfahrungen in Unter- und Mittelschichtfamilien ableiten lässt.
In einer kaum mehr überschaubaren Zahl von Studien hat sich gezeigt, dass ein riskantes Gesundheitsverhalten, etwa, was Rauchen und Alkoholkonsum, Sport und Bewegung oder auch die Ernährung anbetrifft, in unteren Sozialschichten sehr viel häufiger anzutreffen ist. Die Frage, warum dies so ist, wurde in wissenschaftlichen Studien allerdings weitaus seltener aufgegriffen - obwohl ein genaueres Verständnis der hier maßgeblichen Hintergründe dazu beitragen würde, schichtspezifische Barrieren im Rahmen von Gesundheitsförderung abzubauen. Eine schottische Studie hat diese Fragestellung nun aufgegriffen und im Rahmen von qualitativen Interviews herauszufinden versucht, inwieweit auch das gesundheitsbezogene Alltagsverhalten sich aus allgemeineren Normen und Erfahrungen in Unter- und Mittelschichtfamilien ableiten lässt.
Nachdem die Wissenschaftler in einer vorherigen Studie Interviews mit 13-14jährigen männlichen und weiblichen Teenagern und deren Familien durchgeführt hatten (siehe zusammenfassend Backett-Milburn, K. et al: Making sense of eating, weight and risk in the early teenage years: views and concerns of parents in poorer socio-economic circumstances), überprüfte man in einer jetzt veröffentlichten Studie wiederum am Beispiel des Themas Ernährung die Bedeutung sozialer Normen für das Gesundheitsverhalten bei Teenagern aus Mittelschicht-Familien.
In den insgesamt 72 qualitativen Interviews mit Jungen und Mädchen, die jeweils zur Hälfte ein Normalgewicht bzw. Übergewicht hatten, zeigten sich dann folgende Befunde:
• In der Beschreibung der aktuellen Lebensbedingungen dominieren in den Mittelschichtfamilien Hinweise auf eine relative Sicherheit, was Einkommen und Konsumchancen betrifft, auf Wahl- und Entscheidungsfreiräume. Demgegenüber finden sich in den Unterschichtfamilien sehr viel mehr Hinweise auf Risiken und Unsicherheiten und es überwiegt eine Perspektive des "Wir müssen hier und jetzt zurecht kommen".
• Dementsprechend dominiert in der Mittelschicht die Erwartung, durch ein bestimmtes Ernährungsverhalten auch Einfluss nehmen zu können auf das eigene Körpergewicht und den zukünftigen Gesundheitszustand. In der Unterschicht wird eher darauf verwiesen, dass die mit einer ungesunden Ernährung zusammen hängenden Gesundheitsrisiken vergleichsweise gering sind, wenn man andere Verhaltensrisiken (im Zusammenhang mit Drogen, Alkohol, Rauchen, Sex) damit vergleicht.
• In Mittelschichten ist eine recht starke Kontrolle des Ernährungsverhaltens durch die Eltern vorherrschend. Dies wird von Kindern teilweise als Bevormundung wahrgenommen, aber doch akzeptiert. Dieses Verhaltensmuster betrifft zum einen die Größe und Menge der jeweils verzehrten Speisen, wobei insbesondere Mütter darauf achten (und entsprechende Hinweise erteilen), dass ihr Kind sich keine zu großen Portionen auf den Teller lädt. Andererseits betrifft dies auch die Auswahl der Speisen: Eltern versuchen darauf hin zu wirken, dass das Kind zumindest ein wenig Gemüse, Salat und Obst verzehrt,. selbst wenn es diese Nahrungsmittel überhaupt nicht mag.
• Im Vergleich dazu besitzen Unterschicht-Teenager eine sehr viel größere Autonomie, was die Auswahl der Speisen anbetrifft oder auch Ort und Zeitpunkt der Mahlzeiten. Viele Teenager betonten, sie würden zu ganz anderen Zeiten als ihre Eltern essen, und viele Eltern wiesen darauf hin, dass ihre Kinder letztlich doch das essen würden, was sie mögen und sich selber aussuchen.
• Snacks und Knabbereien waren in der Mehrzahl der befragten Mittelschichtfamilien verpönt. Wenn überhaupt, so machten Teenager davon zu Hause nur Gebrauch, wenn Eltern dies explizit erlaubt hatten. Oder man war sich mit den Eltern einig, dass man solche Snacks ebenso wie "Junk-Food" nicht besonders attraktiv findet. Im Verlauf der Interviews wurde deutlich, dass das elterliche Kontrollverhalten in der Mittelschicht nicht umstandslos von den Kindern akzeptiert wird, sondern ein sehr langwieriger, oftmals konfliktträchtiger und mühsamer Prozess ist, bei dem von elterlicher Seite auch immer wieder Begründungen für ihre Vorschriften geliefert werden müssen.
• Die in der Mittelschicht hervorgehobenen Erkrankungsrisiken durch eine ungesunde Ernährung werden in Unterschichten (fast schon fatalistisch) als normale Begleiterscheinungen des Lebens wahrgenommen, ebenso wie unterschiedliche Ausprägungen des Körpergewichts (einschließlich Übergewicht und Adipositas) akzeptiert und moralisch nicht in Frage gestellt werden. Viele Interviewpartner weisen darauf hin, es gäbe weitaus wichtigere Dinge im Leben als sich über sein Körpergewicht Sorgen zu machen.
Die Wissenschaftler beschreiben noch eine Reihe weiterer Unterschiede in den gesundheits- und ernährungsbezogenen Normen von Mittel- und Unterschicht-Familien. Ein ganz zentraler Aspekt ist dabei die unterschiedliche Zukunftsperspektive: Während in Mittelschichten die Sichtweise vorherrscht, dass man auch durch die Ernährung den eigenen zukünftigen Gesundheitszustand positiv beeinflussen kann, wird diese zukunftsgerichtete Orientierung in Unterschichten stark beeinträchtigt durch Zwänge und Anforderungen, irgendwie in der Gegenwart zurecht zu kommen. Und Ernährung und Körpergewicht sind dabei keine besonders herausragenden Einflussgrößen.
Hingewiesen wird in der Diskussion der Befunde auch darauf, dass Gesundheitsförderungsmaßnahmen diese schichtspezifischen Normen mit berücksichtigen müssen. Was dies im Einzelnen für die Gestaltung der Maßnahmen und Interventionen bedeutet, wird allerdings als Fragestellung für zukünftige Forschungsprojekte definiert.
• Von dieser Seite aus Download mehrerer Dokumente zur Studie
• Zusammenfassung der Befunde: Wills, Wendy et al (2008). Parents' & teenagers' conceptions of diet, weight & health: Does class matter? Full Research Report
• Ergebnisse der vorherigen Studie über gesundheitsbezogene Normen bei Jugendlichen aus der Unterschicht: Backett-Milburn, K., Wills, W.J., Gregory, S., and Lawton, J. (2006) Making sense of eating, weight and risk in the early teenage years: views and concerns of parents in poorer socio-economic circumstances (Social Science & Medicine. 63(3): 624-635)
Gerd Marstedt, 13.1.10
Körperliche Fitness in der Adoleszenz zeigt starke Zusammenhänge zu beruflichem Erfolg und Sozialstatus im Erwachsenenalter
 "Mens sana in corpore sano" - dass in einem gesunden Körper auch ein gesunder Geist steckt, war vom römischen Dichter Juvenal in dieser viel zitierten Redewendung nicht als Feststellung eines Sachverhalts gemeint, sondern als Wunsch und Bitte an die Götter. Im Alltag allerdings wird mit dem Satz meist eine enge Verknüpfung von körperlichen und geistigen Fähigkeiten behauptet, wenn nicht sogar ein Kausalzusammenhang. Die empirischen Belege hierfür waren bislang eher dürftig. Eine große schwedische Studie hat nun allerdings solche Zusammenhänge aufgezeigt. Die zentralen Befunde: Wer in der Adoleszenz, also im frühen Erwachsenenalter von etwa 18 Jahren eine hohe körperliche Fitness aufweist, schneidet auch in verschiedenen Aspekten bei Intelligenztests besser ab. Dies gilt nur für die körperliche Fitness, nicht für die Kraft oder Muskelstärke. Und nicht zuletzt: Die körperliche Fitness in der Adoleszenz erlaubt auch eine Prognose über den späteren beruflichen Erfolg und Sozialstatus im Erwachsenenalter.
"Mens sana in corpore sano" - dass in einem gesunden Körper auch ein gesunder Geist steckt, war vom römischen Dichter Juvenal in dieser viel zitierten Redewendung nicht als Feststellung eines Sachverhalts gemeint, sondern als Wunsch und Bitte an die Götter. Im Alltag allerdings wird mit dem Satz meist eine enge Verknüpfung von körperlichen und geistigen Fähigkeiten behauptet, wenn nicht sogar ein Kausalzusammenhang. Die empirischen Belege hierfür waren bislang eher dürftig. Eine große schwedische Studie hat nun allerdings solche Zusammenhänge aufgezeigt. Die zentralen Befunde: Wer in der Adoleszenz, also im frühen Erwachsenenalter von etwa 18 Jahren eine hohe körperliche Fitness aufweist, schneidet auch in verschiedenen Aspekten bei Intelligenztests besser ab. Dies gilt nur für die körperliche Fitness, nicht für die Kraft oder Muskelstärke. Und nicht zuletzt: Die körperliche Fitness in der Adoleszenz erlaubt auch eine Prognose über den späteren beruflichen Erfolg und Sozialstatus im Erwachsenenalter.
Die jetzt in der Zeitschrift "Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)" veröffentlichte Studie basiert auf Daten von ungefähr 1,2 Millionen schwedischen Männern, die allesamt im Zeitraum 1950-1976 im Alter von etwa 18 Jahren zur Prüfung ihrer Wehrdienst-Tauglichkeit vorgeladen wurden und an Untersuchungen zu ihrer körperlichen und geistigen Fitness teilnehmen mussten. Die Stichprobe umfasste damit etwa 97 Prozent der männlichen schwedischen Bevölkerung, die zum jeweiligen Untersuchungs-Zeitpunkt 18 Jahre alt war. Für die wissenschaftliche Studie verwendet wurde Untersuchungsbefunde zur körperlichen Fitness, gemessen durch Übungen an einem Fahrrad-Ergometer, zur Muskelkraft und ferner zu vier Intelligenz-Dimensionen: logisches Denken, Sprachvermögen, räumliche Vorstellungskraft, mathematisch-technisches Denkvermögen.
In der Analyse zeigten sich dann recht enge Zusammenhänge zwischen allen vier Intelligenzdimensionen und der körperlichen Fitness. Die Korrelationen hierfür (Zusammenhangsmaß, das zwischen 0 und 1 variieren kann) lagen bei 0.13, 0.15, 0.18 und 0.20, wobei dieser höchste Wert von 0.20 für das logische Denken galt. Zusammenhänge zur Muskelkraft lagen hingegen fast bei Null. Im Rahmen einer multivariaten Analyse, in der auch andere potentielle Einflussfaktoren für die Intelligenz einbezogen wurden, bestätigten sich die gefundenen Zusammenhänge.
In der Untersuchungsstichprobe fanden sich auch 3.147 zweieiige und 1.432 eineiige Zwillinge, so dass die Wissenschaftler näherungsweise auch den Einfluss von Erbanlagen und Umweltfaktoren analysieren konnten. Aufgrund eines Vergleichs der Korrelationen zwischen Fitness und Intelligenz bei ein- und zweieiigen Zwillingen kommen die Forscher zu dem Schluss, dass über 80 Prozent der Intelligenz aus unterschiedlichen Umwelteinflüssen und weniger als 15 Prozent aus Erbanlagen resultiert.
Überprüft wurde in der Studie auch, ob die Untersuchungsbefunde bei den 18jährigen Studienteilnehmern Prognosen ermöglichen über spätere Erfolge im Bildungssystem oder Beruf. Tatsächlich zeigte sich:
• Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Studienteilnehmer später einen Universitätsabschluss schafft, liegt bei denjenigen etwa 1,8mal höher, die zu den oberen 40 Prozent gehören, was die körperliche Fitness anbetrifft.
• Und ähnliche Zusammenhänge finden sich für den späteren sozio-ökonomischen Status: Die Chancen, später einmal der Oberschicht anzugehören, liegt etwa 1,5mal höher bei jenen 40 Prozent mit besserer körperlicher Fitness.
In der Bilanz ihrer Befunde suggerieren die Forscher eine gewisse Kausalität der von ihnen untersuchten Einflüsse (körperliche Fitness -> Intelligenz -> Berufserfolg), obwohl die Anlage der Studie dies nicht leisten kann. So wird die Empfehlung ausgesprochen: "Diese Daten belegen, dass körperliche Bewegung ein wichtiges Instrument für Public-Health-Initiativen sein kann, um im gesellschaftlichen Rahmen Ausbildungsziele aber auch intellektuelle Leistungen zu optimieren und Krankheiten zu vermeiden." Auch wenn die Studie also keine kausalen Effekte belegen kann, zeigt sich doch, dass körperliche und geistige Fitness bei vielen Menschen zusammen gehören, so dass "Mens sana in corpore sano" möglicherweise doch einer Tatsachenfeststellung nahe kommt und nicht nur ein frommer Wunsch ist wie beim römischen Satirendichter Juvenal.
Zur Studie "Maria A. I. Aberg et al: Cardiovascular fitness is associated with cognition in young adulthood" (Proceedings of the National Academy of Sciences, PNAS, December 8, 2009 vol. 106, no. 49, doi 10.1073/pnas.0905307106) gibt es kostenlos ein Abstract und auch den Volltext als PDF-Datei:
• Abstract
• PDF mit Volltext
Gerd Marstedt, 3.12.09
"Rauchende Colts" - Warum zerstörte "British American Tobacco" 1992 in den USA, Kanada und Australien 60 firmeneigene Dokumente?
 In einigen der großen Prozesse gegen die Tabakwarenindustrie vor us-amerikanischen Gerichten sind bereits Millionen Seiten interner Dokumente veröffentlicht worden, aus denen hervorging, dass die wirtschaftlich und wissenschaftlich Verantwortlichen in den angeklagten Konzernen und ihren direkt abhängigen oder oberflächlich unabhängigen Instituten relativ lückenlos wussten, dass Tabakrauchen vielfältig gesundheitsschädlich war und süchtig bzw. abhängig macht.
In einigen der großen Prozesse gegen die Tabakwarenindustrie vor us-amerikanischen Gerichten sind bereits Millionen Seiten interner Dokumente veröffentlicht worden, aus denen hervorging, dass die wirtschaftlich und wissenschaftlich Verantwortlichen in den angeklagten Konzernen und ihren direkt abhängigen oder oberflächlich unabhängigen Instituten relativ lückenlos wussten, dass Tabakrauchen vielfältig gesundheitsschädlich war und süchtig bzw. abhängig macht.
Dies reichte teilweise soweit, dass mit entsprechenden Zusatzstoffen und der Erhöhung der Nikotinmenge geradezu Abhängigkeit erzeugt wurde. Die hierfür bisher maßgebliche Informationsquelle waren die über 40 Millionen Seiten interner Dokumente von 7 Tabakkonzernen, die im Gefolge eines vom US-Bundesstaat Minnesota 1998 gewonnenen Verfahrens zusätzlich zu den ebenfalls zu zahlenden 200 Milliarden US-Dollar veröffentlicht werden mussten (vgl. dazu das Urteil Tobacco Documents - Judge Fitzpatrick's Order (November 1, 1995)).
Obwohl diese frei zugängliche Sammlung ("Tobacco documents online") 8.144.313 einzelne Dokumente enthält, war es insbesondere einem der damals und heute größten internationalen Tabakkonzerne, BAT, gelungen eine Reihe aus seiner Sicht "most sensitive" Dokumente zu verheimlichen und sie zu zerstören bevor sie auch in den Rechtsstreit vor dem US-Gericht einbezogen werden konnten. Im Rahmen dieser vorsätzlichen und offiziellen Zerstörungspolitik ließ BAT in den USA, Kanada und Australien gezielt Dokumente mit Ergebnissen wissenschaftlicher Untersuchungen zum Tabakrauchen zerstören. Und 1992 bestätigte ein damit befasster Rechtsvertreter der BAT-Tochter in Kanada dem Mutterkonzern schriftlich, man habe in Kanada gerade 60 derartige Dokumente zerstört. Obwohl dieses Schreiben an die Öffentlichkeit drang und klarmachte, dass offensichtlich evidente tabakkritische Informationen vernichtet wurden, konnten die Inhalte dieser Dokumente niemals analysiert werden. Und obwohl sich bereits in den 1990er Jahren dann doch noch Kopien der Dokumente in den Archiven der britischen Dependance von BAT fanden und in das Minnesota-Verfahren eingingen, blieben ihre Inhalte praktisch unveröffentlicht.
Erst ein am 10. November 2009 im "Canadian Medical Association Journal (CMAJ)" veröffentlichter Aufsatz verschafft jetzt einen vollständigen Einblick in die Inhalte, welche BAT am liebsten auf ewig verschwinden lassen wollte.
Auf durchweg hohem naturwissenschaftlichen und statistischen Niveau durchgeführt, enthielten die 60 Dokumente 11 Reviews zu interner Forschung oder Methodenentwicklung, 2 statistische Re-Analysen früherer Studien und die restlichen 47 Originalstudien enthielten Ergebnissen interner Forschung des Unternehmens BAT oder von ihm beauftragter ForscherInnen. Das älteste Dokument stammt aus dem Jahr 1967 und die meisten Dokumente aus der Zeit um 1984.
Die Inhalte, die mit dem Schreddern der Studien verborgen werden sollten, sind in folgenden Bereichen angesiedelt:
• 40 der 60 Dokumente lieferten ihren Auftraggebern und Besitzern eindeutige Evidenz für die krebserzeugende und biologische Aktivität von Zigaretten. Wegen der erschlagenden Fülle von Belegen für diese gesundheitsgefährdenden Effekte des Rauchens waren die konzerneigenen Wissenschaftler völlig überrascht, wenn sie die eine der wenigen Studien fanden, die solche Effekte nicht fand. Viele der Studien waren Bestandteil des industrieeigenen Langzeitforschungsprojekts Janus. In diesem Programm sollten in den Jahren 1965 bis 1978 die krebserzeugenden Komponenten des Tabakrauchs identifiziert werden.
• Verschiedene hier dokumentierte Untersuchungen zeigten BAT und dem Rest der Industrie eindeutig, dass es keine signifikanten Unterschiede der unerwünschten gesundheitlichen Folgen zwischen den verschiedenen Zigarettenmarken gab und auch Filterzigaretten niemals die "guten Zigaretten" waren. Gerade bei Filterzigaretten war den Herstellern sogar durch ihre eigenen Studien früh der durch sie bedingte Anstieg bestimmter Krebsarten bekannt, der wahrscheinlich mit den tieferen Zügen zu tun hat.
• Sechs der vernichteten Dokumente stellen ein ausgeklügeltes Forschungsprogramm über die Nikotinsucht bzw. -abhängigkeit dar. Dabei ging es dieser Forschung ausdrücklich nicht darum, etwas an dieser Abhängigkeit zu ändern, sondern lediglich darum, Mittel und Wege zu finden, den Rauchern ihr folgenreiches Rauchen subjektiv zu erleichtern.
• Elf der zerstörten Dokumente enthielten Forschungsergebnisse über die gesundheitlichen Folgen des Passivrauchens. Dabei schlussfolgerten die beteiligten Wissenschaftler relativ früh, dass unter bestimmten Bedingungen, darunter gerade die "Light"-Zigaretten, Passivrauchen sogar giftiger und folgenreicher ist als Aktivrauchen. Für die gerade wieder in Deutschland aufkeimenden Debatten über die technischen Mittel, die Raumluft zu ent"giften", ist zu vermerken, dass die Industrieforscher bereits vor über 10/15 Jahren nur einen sehr kleinen Effekt solcher Maßnahmen für erwiesen ansahen, der dem der Öffnung des Fensters entsprach.
• Wie bewusst, aktiv und offensiv führende Vertreter der Tabakindustrie die Öffentlichkeit angelogen haben, machen die kanadischen Wissenschaftlern auf dem Hintergrund der klaren Ergebnisse der 60 Dokumente an zwei Zitaten klar: 9 Jahre nach Abschluss des Projekt Janus erklärte der Vorstandsvorsitzende der BAT-Tochter in Kanada, Jean-Louis Mercier, den Mitgliedern eines Komitees des kanadischen Parlaments: "It is not the position of he industry that tobacco cause any disease …The role, if any, that tobacco or smoking plays in the initiation and the development of these diseases is still very uncertain." Und der BAT-Vorstand Martin Broughton erklärte 1996, d.h. vier Jahre nach der angeordneten Vernichtung schriftlicher Gegenbeweise: "We have not concealed (verheimlicht), we do not conceal and we will never conceal. … We have no internal research which proves that smoking causes lung cancer or other diseases or, indeed, that smoking is addictive."
Der faktische Vorsatz zur oder die Billigung der komplexen Schädigung von RaucherInnen wird im Lichte des Inhalts der 60 sensitiven Dokumente so zwingend, dass es jetzt auch in Kanada von Seiten der öffentlichen Träger der Krankenversicherung Klageankündigungen gibt, bei denen es um Milliarden Dollar an Behandlungskosten geht. Dass es hier ausnahmsweise einmal gelang, die "rauchenden Colts" wiederzufinden, ist für diese Klagen sicherlich hilfreich. Jemals wieder einem Vertreter der Tabakindustrie etwas zu glauben fällt einem aber nach Lektüre dieser Dokumente wirklich sehr schwer.
Der achtseitige Aufsatz "Destroyed documents: uncovering the science that Imperial Tobacco Canada sought to conceal" von David Hammond, Michael Chaiton, Alex Lee und Neil Collishaw ist im CMAJ (2009 10.1503/cmaj.080566) erschienen und wie meisten Aufsätze dieser Fachzeitschrift komplett kostenlos erhältlich.
Die Liste der 60 zerstörten Dokumente umfasst 5 Druckseiten und zeigt bereits, um welches Themenspektrum es bei der Zerstörung ging.
Wer sich genauer mit den Inhalten beschäftigen will, kann dies zuerst anhand der tabellarischen Darstellung der Dokumente und ihrer wesentlichen Inhalte tun und bei Bedarf und anhaltendem Interesse auch über Links auf die an unterschiedlichen Orten gespeicherten Originale zugreifen.
Bernard Braun, 2.12.09
Sind RaucherInnen unterm Strich doch volkswirtschaftlich nützlich? Klärendes aus Österreich
 In ehemaligen Raucherkneipen und in regelmäßigen Abständen auch in seriösen epidemiologischen Papers und Präsentationen steht nicht selten die These im Raum, Rauchen sei doch letztlich gar nicht nur oder so schädlich wie behauptet wird. Raucher würden beispielsweise gar nicht so lange leben und Rente in Anspruch wie Nichtraucher und zahlten außerdem erhebliche Beträge an Steuern.
In ehemaligen Raucherkneipen und in regelmäßigen Abständen auch in seriösen epidemiologischen Papers und Präsentationen steht nicht selten die These im Raum, Rauchen sei doch letztlich gar nicht nur oder so schädlich wie behauptet wird. Raucher würden beispielsweise gar nicht so lange leben und Rente in Anspruch wie Nichtraucher und zahlten außerdem erhebliche Beträge an Steuern.
Ob und wie weit diese These neben der Wirklichkeit liegt untersuchte jetzt eine Gruppe von WissenschaftlerInnen vom österreichischen "Institut für Höhere Studien" in Wien. Dazu bediente sie sich des "methodischen Konzepts der Rauchen-attributablen Anteile"". In ihm werden die volkswirtschaftlichen Kosten und fiskalischen Vorteile (Nutzen) des Rauchens gegenüberstellt. Dabei wird auch das epidemiologisch gesicherte erhöhte Gesundheitsrisiko von Aktiv-, Ex- sowie Passiv-RaucherInnen quantifiziert.
Die methodischen Vorzüge ihrer Analyse beschreiben sie zusammengefasst so: "Gängige, ein-periodige Modelle können dynamische Bevölkerungseffekte aufgrund niedrigerer Sterblichkeit der Nicht-Passiv-RaucherInnen nicht erfassen. Sie über- bzw. unterschätzen die medizinischen bzw. ökonomischen Kosten von Rauchern durch die Vernachlässigung der höheren Lebenserwartung von NichtraucherInnen, welche eine rauchfreie Bevölkerung wachsen lassen würde. Aus diesem Grund implementierten die AutorInnen "ein (diese Effekte mitberücksichtigendes) sogenanntes Lebenszyklus-Modell, welches als Basis die Bevölkerung im Jahr 2003 heranzieht und in den Szenarien "Status quo" bzw. "rauchfreie Gesellschaft" die Alterskohorten mit den jeweiligen Sterblichkeiten und Aufwendungen zu Ende leben lässt."
Die wesentlichen Ergebnisse dieser Art von Analysen lauten:
• Zuerst zu den Lebenszeitverlusten durch Rauchen und den verschiedenen Kosten des Rauchens: "Im Jahr 2003 starben 8.600 Männer und Frauen in Österreich ursächlich wegen ihres Tabakkonsums. Dies entspricht 11% der insgesamt Verstorbenen im Jahr 2003, oder einem Toten alle 60 Minuten. Das erhöhte Sterberisiko von Aktiv-RaucherInnen schlägt sich in einer reduzierten Lebenserwartung von im Schnitt 5 Jahren im Vergleich zu lebenslangen NichtraucherInnen nieder. Passiv-RaucherInnen verlieren rund 9 Monate an Lebenserwartung."
• Allein die höheren Pro-Kopf-Gesundheitsausgaben von RaucherInnen für die medizinischen Kosten von Rauchen belaufen sich jährlich auf 760 Mio. EUR, das sind 3,3% der Gesundheitsausgaben im Jahr 2003 (ohne Pflege und Investitionen). Berücksichtigt man zusätzlich die höhere Lebenserwartung von NichtraucherInnen, so errechnet das Lebenszyklus-Modell unter Berücksichtigung des Kohorteneffekts vermeidbare medizinische Kosten von jährlich EUR 53,7 Mio. bzw. 0,26% der Gesundheitsausgaben im Jahr 2003 (ohne Pflege und Investitionen). Die nicht-medizinischen Kosten wie Pflege- und Krankengelder sowie Invaliditätspensionen belaufen sich auf jährlich 40,9 bzw. 26 Mio. EUR. In Summe betragen die nicht-medizinischen Kosten jährlich 75 Mio. EUR. Die ökonomischen Kosten bedingt durch häufigere Krankenstände, Invalidität und vorzeitige Sterblichkeit von erwerbstätigen RaucherInnen errechnen sich aus den resultierenden Arbeitsausfällen. Die vorliegende Studie schätzt die Rauchen-attributablen Ausfälle mit rund 17.600 Vollzeitäquivalenten im Jahr 2003. Dadurch gehen der österreichischen Volkswirtschaft jährlich rund 1.430 Mio. EUR oder 0,63 % des Bruttoinlandprodukts (BIP) verloren.
• Im Rahmen dieser Studie wurde, "erstmals für Österreich, die unfreiwillige Verkürzung der Lebenserwartung von Passiv-RaucherInnen monetär bewertet. Die hypothetischen Kompensationszahlungen der RaucherInnen an Passiv-RaucherInnen belaufen sich jährlich auf 81 Mio. EUR. Dieser Betrag stellt eine Unterschätzung dar, da nur der Verlust an Lebensquantität und nicht an -qualität von Passiv-RaucherInnen berücksichtigt wurde."
• Nun zu den Kosten einer "Rauchfrei-Politik": Im Jahr 2003 gab es in Österreich insgesamt 9.821 vollzeitäquivalente Beschäftigten in der Tabakwarenproduktion und im Tabakhandel. Die damit verbundene volkswirtschaftliche Wertschöpfung von 645 Mio. Euro würde durch eine "Rauchfreipolitik" wegfallen. Ob diese Beschäftigten andere Arbeitsplätze finden und dort wiederum Wertschöpfung stattfindet, ist zwar wahrscheinlich, aber nicht sicher.
• Sicher ist aber der Verlust an fiskalischen Einnahmen aus dem Tabakwarenkonsum wie Umsatzsteuer, Arbeitnehmerabgaben und Körperschaftssteuer in Höhe von 1.328,7 Mio. Euro im Jahr 2003. Im Rahmen des Lebenszyklus-Modells entsprechen die Tabaksteuereinnahmen einem jährlichen Betrag von 1.087 Mio. EUR.
• Schließlich, und hier findet der eingangs erwähnte Kneipendialog seinen materiellen Grund, beliefe sich der Mehr-Aufwand der öffentlichen Hand in einer rauchfreien Gesellschaft im Bereich der Alters- und Hinterbliebenenpensionen (so genannter Witweneffekt) jährlich auf 45 Mio. EUR oder 0,18 % des Pensionsaufwands für Alters- und Witwen/er-Pensionen im Jahr 2003.
• "In der Gegenüberstellung von Kosten und Nutzen übersteigen die gesellschaftlichen Kosten des Rauchtabakkonsums dessen Nutzen jährlich um 511,4 Mio. EUR; diese Differenz entspricht 0,23% des BIPs. Von diesen Netto-Kosten sind knapp ein Viertel, nämlich 118,6 Mio., auf Effekte des Passivrauchens zurückzuführen. Dabei handelt es aber immer noch um eine Unterschätzung der wahren Kosten von Rauchen. So sind die Kosten Arbeits- und Verkehrsunfälle, Wohnungsbrände sowie Produktivitätsverluste aufgrund von Warte- und Wegzeiten für medizinische Behandlungen, Rauchpausen während der Arbeitszeit, unbezahlten Pflegeleistungen der Angehörigen, etc. schwer zu quantifizieren und daher nicht erfasst worden."
• Schlussfolgerungen für den ökonomischen Sinn einer Rauchfrei-Politik: "Aus sozioökonomischer Sicht ist … die gesellschaftliche Toleranz und die fiskalische Nutznießung des Konsums von Rauchtabakwaren nicht gerechtfertigt. Die Effekte des Passivrauchens schlagen sich mit knapp einem Viertel der Netto-Kosten von Rauchen monetär nieder."
Es gibt keinen theoretischen Grund, dass die Lebenszyklus-Effekte von Aktiv-, Passiv- und Nichtrauchen sich zwischen Österreich und Deutschland qualitativ und quantitativ erheblich unterscheiden und Deutschland oder einige seiner Bundesländer einen bayrischen oder hessischen Sonderweg schaffen könnten. Daher lohnt ein gründlicherer Blick in die schon etwas älteren 207 Seiten des Schlussberichts der Studie "Volkswirtschaftliche Effekte des Rauchens. Eine ökonomische Analyse für Österreich" von Markus Pock, Thomas Czypionka, Sandra Müllbacher und Alexander Schnabl (Endbericht, April 2008), die in Gänze kostenlos zu erhalten sind.
Zu einer abweichenden Bilanz war im Jahr 2008 eine niederländische Studie gekommen. Allerdings hatte diese gesundheitsökonomische Untersuchung auch nur die direkten Versorgungs-Kosten von Rauchern und Nichtrauchern (unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Lebenserwartung) verglichen. Nicht berücksichtigt - so schrieben die Wissenschaftler ausdrücklich in ihrem Artikel - waren mehrere Faktoren, die das Ergebnis möglicherweise verändert hätten: Höhere Krankenstände und Produktivitätsverluste durch rauchende Erwerbstätige, daraus resultierende volkswirtschaftliche Verluste, geringere Renteneinzahlungen, sinkende Tabaksteuereinnahmen. vgl.: Niederländische Studie rechnet vor: Prävention bringt keine direkten Kosteneinsparungen im Gesundheitssystem
Bernard Braun, 24.11.09
Große deutsche Studie zeigt: Eine gesunde Lebensweise reduziert das Risiko chronischer Erkrankungen
 Wer nicht raucht, sich gesund ernährt, Sport betreibt oder ausreichend körperliche Bewegung hat und einen Body Mass Index (BMI) unter 30, kurz eine insgesamt gesunde Lebensweise pflegt, reduziert sein Risiko für das Auftreten chronischer Erkrankungen um knapp 80 Prozent. Dies ist das wesentliche Ergebnis einer Studie (European Prospective Investigation Into Cancer and Nutrition, Potsdam Study) mit 23.153 erwachsenen deutschen Teilnehmern im Alter von 35 bis 65 Jahren, die über einen Zeitraum von knapp 8 Jahren Zusammenhänge zwischen Gesundheitsverhalten und dem Auftreten chronischer Erkrankungen (Diabetes, Herzinfarkt, Schlaganfall, Krebs) untersucht hat.
Wer nicht raucht, sich gesund ernährt, Sport betreibt oder ausreichend körperliche Bewegung hat und einen Body Mass Index (BMI) unter 30, kurz eine insgesamt gesunde Lebensweise pflegt, reduziert sein Risiko für das Auftreten chronischer Erkrankungen um knapp 80 Prozent. Dies ist das wesentliche Ergebnis einer Studie (European Prospective Investigation Into Cancer and Nutrition, Potsdam Study) mit 23.153 erwachsenen deutschen Teilnehmern im Alter von 35 bis 65 Jahren, die über einen Zeitraum von knapp 8 Jahren Zusammenhänge zwischen Gesundheitsverhalten und dem Auftreten chronischer Erkrankungen (Diabetes, Herzinfarkt, Schlaganfall, Krebs) untersucht hat.
Um die Wirkung der gesunden Lebensweise messen zu können, erhoben die ForscherInnen, ob sich die TeilnehmerInnen der Studie bei den vier Risikofaktoren (Rauchen, Ernährung, Bewegung, BMI) eher gesund (1 Punkt) oder ungesund (0 Punkte) verhielten. Mit den Ergebnissen bildeten sie dann einen Summen-Score, der von 0 bis 4 reicht. Weniger als 4% der Teilnehmer wiesen 0 Punkte auf ( = sehr ungesund-riskant), 9% hatten vier Punkte ( = sehr gesund). Die meisten TeilnehmerInnen hatten aber einen Wert von 1-3 Punkten.
Nach einer durchschnittlich 7,8 Jahre umfassenden Zeit nach dem Start der Studie wurde bei 2.006 oder 3,7% TeilnehmerInnen eine Diabetes-Erkrankung neu diagnostiziert, bei 0,9% ein Herzinfarkt, bei 0,8% ein Schlaganfall und bei 3,8% Krebs.
Nachdem bei den Daten Alter, Geschlecht, Bildungsstand und Beschäftigungsstatus statistisch mitberücksichtigt wurden, sank die Risikowahrscheinlichkeit für das Auftreten einer chronischen Erkrankung in dem Maße, wie die Anzahl gesunder Verhaltensweisen stieg. TeilnehmerInnen, die zu Studienbeginn eine hohe Punktzahl, also wenig Risikofaktoren aufwiesen, hatten im Vergleich zu Personen mit niedriger Punktzahl ein durchschnittlich um 78 Prozentpunkte niedrigeres Risiko, eine der genannten chronischen Krankheiten zu erwerben. Die Risikoverringerung lag für eine Neuerkrankung an Diabetes bei 93%, für Herzinfarkt bei 81%, für Schlaganfall bei 50% und für Krebs immerhin noch bei 36%.
Vom Aufsatz ist kostenlos nur ein Abstract erhältlich: Earl S. Ford, Manuela M. Bergmann, Janine Kröger, Anja Schienkiewitz, Cornelia Weikert, Heiner Boeing: Healthy Living Is the Best Revenge - Findings From the European Prospective Investigation Into Cancer and Nutrition-Potsdam Study (Archives of Internal Medicine", 2009;169[15]:1355-1362)
Bernard Braun, 9.11.09
Deutsche Studie bei über 3.000 Schülern zeigt: Werbung verführt Jugendliche zum Trinken
 In Deutschland war man bisher bei der Diskussion eines Zusammenhangs zwischen Alkoholwerbung und Alkoholkonsum junger Menschen auf die Ergebnisse ausländischer Studien angewiesen. Und einer der wenigen deutschen Anläufe, diese Lücken zu schließen, enthielt zwar Angaben zur Bekanntheit und Bewertung verschiedener Alkoholspots, nicht aber Fakten zum Alkoholkonsum der betreffenden Jugendlichen. Diese Lücken werden nun durch eine vom Institut für Therapie- und Gesundheitsforschung (IFT Nord) im Auftrag der DAK durchgeführte Querschnittstudie bei 3.415 SchülerInnen im Alter von 10 bis 17 Jahren aus drei norddeutschen Bundesländern geschlossen.
In Deutschland war man bisher bei der Diskussion eines Zusammenhangs zwischen Alkoholwerbung und Alkoholkonsum junger Menschen auf die Ergebnisse ausländischer Studien angewiesen. Und einer der wenigen deutschen Anläufe, diese Lücken zu schließen, enthielt zwar Angaben zur Bekanntheit und Bewertung verschiedener Alkoholspots, nicht aber Fakten zum Alkoholkonsum der betreffenden Jugendlichen. Diese Lücken werden nun durch eine vom Institut für Therapie- und Gesundheitsforschung (IFT Nord) im Auftrag der DAK durchgeführte Querschnittstudie bei 3.415 SchülerInnen im Alter von 10 bis 17 Jahren aus drei norddeutschen Bundesländern geschlossen.
Das Ergebnis ist eindeutig: Es besteht ein robuster linearer Dosis-Wirkungszusammenhang ("je mehr, desto mehr") zwischen der Exposition mit Alkoholwerbung und einer Reihe von Variablen des Alkoholkonsums der Kinder und Jugendlichen. Auch nach der Kontrolle einer Reihe von Alternativerklärungen ist die multivariat durch Regressionsanalysen bestimmte Chance eines erhöhten Alkoholkonsums in der Gruppe mit höchstem Kontakt zur Alkoholwerbung rund doppelt so hoch wie bei Angehörigen der Gruppe mit dem niedrigsten Kontakt.
Weitere wichtige Ergebnisse der Studie:
• 54% der SchülerInnen hatten von den 9, ihnen für diese Studie "maskiert", d.h. ohne Hinweise auf Marken- und Produktnamen gezeigten Alkohol-Werbespots, mindestens schon einmal 6 gesehen. Diese Kontakthäufigkeit entspricht in etwa der zu Süßigkeiten und Automarken. Nur 1,5% gaben an, bisher noch keine der Alkoholwerbungen gesehen zu haben. Dabei existierte ein eindeutig positiver Zusammenhang der Bekanntheit von Werbebotschaften mit dem Fernsehkonsum.
• Jungen hatten einen signifikant höheren Alkoholwerbekontakt als Mädchen und konnten die Marken auch besser assoziieren oder abrufen.
• Die meisten der in den Spots oder Anzeigen beworbenen Alkoholika waren den Kindern und Jugendlichen namentlich bekannt. Damit haben die Werbeexperten ein "Traumziel" erreicht: Ihr Produkt hat sich in der Wahrnehmung der Menschen so festgesetzt, dass es auch über das an sich neutrale Bild einer waldigen Seenlandschaft oder an der Wand hängende Hirschgeweihe assoziiert und erinnert wird.
• Der Alkoholkonsum von Kindern und Jugendlichen findet weniger heimlich statt als erwartet: Nur 27% der dazu befragten SchülerInnen bestätigten, sie hätten schon mal ohne Wissen der Eltern Alkohol getrunken. 58% gaben dagegen an, ihre Eltern hätten ihnen bereits einmal etwas zum Trinken angeboten und dies mit ihnen gemeinsam konsumiert.
• Einige der erhobenen Daten legen für die ForscherInnen "ein wenig die Vermutung nahe", viele der SchülerInnen würden eher selten Alkohol trinken, aber dann, wenn sie trinken, viel. 56% der SchülerInnen berichten ganz in diesem Sinne, schon mal "Binge drinking" (so bezeichnet man das Trinken von mehr als 5 alkoholischen Getränken bei einer Gelegenheit) betrieben zu haben. Selbst von den 10-12-Jährigen gaben 11% an, dies schon mal gemacht zu haben.
• Die WissenschaftlerInnen weisen selbstkritisch auf die Schwäche von Behauptungen über kausale Zusammenhänge hin, die im Rahmen von Querschnittsanalysen gewonnen werden, und plädieren für zusätzliche Längsschnittstudien. Trotzdem halten sie aber die spezifische Bedeutung des Werbeinhalts für gesichert, da sich z.B. keine Assoziation zwischen Alkoholkonsum und neutralen Werbungen gezeigt hat.
Die im März 2009 veröffentlichte Studie von Morgenstein, M., Isensee, B., Sargent und Hanewinkel R. erhält man komplett (17 Seiten) und kostenlos über den Dokumentenserver der DAK: Jugendliche und Alkoholwerbung. Einfluss der Werbung auf Einstellung und Verhalten
Bernard Braun, 15.10.09
Australische Studie: Die Infrastruktur einer Wohngegend bestimmt das Ausmaß körperlicher Bewegung
 Auch Maßnahmen und Pläne zur Stadtentwicklung können direkt der Gesundheitsförderung dienen. Eine australische Studie hat jetzt gezeigt: In Wohngegenden, in deren Umgebung und fußläufiger Nähe bestimmte Einrichtungen wie Bushaltestellen, Briefkästen, Postämter oder Geschäfte häufiger vorhanden sind, gehen Bürgerinnen und Bürger auch sehr viel häufiger zu Fuß als in Stadtteilen mit einer verödeten Infrastruktur.
Auch Maßnahmen und Pläne zur Stadtentwicklung können direkt der Gesundheitsförderung dienen. Eine australische Studie hat jetzt gezeigt: In Wohngegenden, in deren Umgebung und fußläufiger Nähe bestimmte Einrichtungen wie Bushaltestellen, Briefkästen, Postämter oder Geschäfte häufiger vorhanden sind, gehen Bürgerinnen und Bürger auch sehr viel häufiger zu Fuß als in Stadtteilen mit einer verödeten Infrastruktur.
Die Motivierung der Bevölkerung zu mehr Sport und körperlicher Bewegung gilt als ein Schlüsselkonzept der Gesundheitsförderung und als wesentliche Voraussetzung zur Bekämpfung der Übergewichts- und Adipositas-Problematik. Die dazu vorgelegten Interventions-Konzepte beschränken sich aber weithin immer noch auf Informationskampagnen, Appelle ("3000 Schritte extra", "Fit statt fett") oder bewusst aus dem Alltag herausgehobene Aktivitäten. Dass die individuelle Motivation zu mehr körperlicher Bewegung ganz wesentlich aber auch von objektiven Faktoren, also städtebaulichen Rahmenbedingungen und kommunalen Angeboten abhängt, hat jetzt erneut eine Studie deutlich gemacht.
Die in der Zeitschrift "Preventive Medicine" veröffentlichte australische Studie hat untersucht, von welchen infrastrukturellen Rahmenbedingungen am Wohnort das Bewegungsverhalten der Bürger abhängt, also ob diese häufiger oder weniger häufig zu Fuß gehen oder spazieren gehen. Das Ausmaß körperlicher Bewegung wurde anhand einer Befragung ermittelt, an der 1.394 erwachsene Westaustralier teilnahmen. Erfasst wurde dabei auch die genaue Lage ihrer Wohnung.
Diese Daten wurden dann verknüpft mit Angaben aus einem geografischen Informationssystem (GIS), aus denen das Vorhandensein und die genaue Lage unterschiedlicher Einrichtungen hervorgeht: Postämter, Briefkästen, Geschäfte, Einkaufszentren, Bushaltestellen und Bahnhöfe, Schulen usw. Für die Datenanalyse klassifiziert wurden dann für jeden Studienteilnehmer die Art und Anzahl der Einrichtungen, die sich in einem Umkreis von 400m oder 1.500m zu seiner Wohnung befanden.
Als Ergebnis zeigte sich: Je mehr Einrichtungen in der näheren Umgebung vorhanden waren, desto häufiger fand man bei den Teilnehmern auch, dass diese die anfallenden Transporte zu Fuß erledigten. In Bezirken mit besonders vielen fußläufig erreichbaren Postkästen, Bushaltestellen, Zeitungsständen, Einkaufszentren und Haltestellen im Umkreis von 400 Metern war das Ausmaß körperlicher Bewegung zwischen 1.63 und 5mal so hoch wie in eher "verödeten" Wohngegenden. Waren dieselben Einrichtungen in einem Umkreis von bis zu 1.500 Metern vorhanden, lag das Ausmaß der körperlichen Aktivität immer noch 1,75 bis 2,38mal so hoch wie in einer von solchen Einrichtungen freien Gegend.
Der Zusammenhang war so eindeutig und eng, dass in der Studie sogar eine Dosis-Wirkungs-Abhängigkeit zwischen dem Mix der Einrichtungen und dem Zufußtransport nachgewiesen werden konnte: Jede zusätzliche Einrichtung innerhalb von 400 bis 1.500 Metern um den Wohnort führte zu einem zusätzlichen 12- bzw. 11-Minuten-Transportgang innerhalb von zwei Wochen.
Hier gibt es ein kostenloses Abstract der Studie: McCormack Gavin R. u.a.: The relationship between destination proximity, destination mix and physical activity behaviors (Preventive Medicine, Vol 46, Issue 1, S. 33-40)
Gerd Marstedt, 7.9.09
Mehr oder weniger körperliche Bewegung nach der Verrentung? Maßgeblich ist die vorherige Aktivität im Berufsleben
 "Keine Zeit" ist ein häufig geäußertes Argument, wenn es darum geht, aus gesundheitlichen Gründen im Alltag mehr Sport und körperliche Bewegung zu haben. Mit Eintritt in die Rente sollte dieses Argument dann allerdings entfallen. Ob man tatsächlich bei Rentnerinnen und Rentnern solche Verhaltensänderungen feststellen kann, hat eine US-amerikanische Längsschnittstudie jetzt untersucht. Die Analyse erbrachte keine einheitlichen Befunde: Nach einer körperlich anstrengenden Berufstätigkeit sinkt das Ausmaß körperlicher Bewegung, nach einer sitzenden, wenig belastenden Arbeit zeigt sich ein Anstieg.
"Keine Zeit" ist ein häufig geäußertes Argument, wenn es darum geht, aus gesundheitlichen Gründen im Alltag mehr Sport und körperliche Bewegung zu haben. Mit Eintritt in die Rente sollte dieses Argument dann allerdings entfallen. Ob man tatsächlich bei Rentnerinnen und Rentnern solche Verhaltensänderungen feststellen kann, hat eine US-amerikanische Längsschnittstudie jetzt untersucht. Die Analyse erbrachte keine einheitlichen Befunde: Nach einer körperlich anstrengenden Berufstätigkeit sinkt das Ausmaß körperlicher Bewegung, nach einer sitzenden, wenig belastenden Arbeit zeigt sich ein Anstieg.
Die Längsschnitt-Studie basiert auf Daten der US-amerikanischen "Health and Retirement Study", einer 1992 begonnenen Verlaufsstudie, in der eine repräsentative Stichprobe älterer Bürgerinnen und Bürger der Geburtsjahrgänge 1931-1947 mehrere Male im Abstand von zwei Jahren zu Aspekten wie Arbeit und Rente, Gesundheit und Freizeit telefonisch befragt wurden. Berücksichtigt wurden Daten aus den Jahren 1996 bis 2002, kurz vor und kurz nach der Berentung. Die Datenanalysen basieren auf Informationen von etwa 11.500 Studien-Teilnehmern. Fragestellung war: Wie verändert sich der Lebensstil und insbesondere die körperliche Aktivität nach der Verrentung? Zeigen sich hier Unterschiede in Abhängigkeit von der vorherigen Arbeit und insbesondere den dort vorherrschenden körperlichen Belastungen?
Die zentrale abhängige Variable, das Ausmaß körperlicher Aktivität wurde mit folgender Frage erfasst: "Haben Sie in den letzten 12 Monaten zumeist dreimal oder öfter pro Woche Sport getrieben oder anstrengende körperliche Aktivitäten betrieben? Mit anstrengende körperliche Aktivitäten meinen wir Sport, schwere Hausarbeit oder körperlich anstrengende berufliche Aufgaben?" Alle Teilnehmer wurden je nach ihrer Tätigkeit vor der Verrentung einer von zwei Gruppen zugeordnet: Sitzende Arbeit oder körperlich anstrengende Arbeit. Weiterhin in den Telefon-Interviews erfasst und in der Analyse berücksichtigt wurden der Gesundheitszustand, chronische Erkrankungen, das Bildungsniveau, der mit verschiedenen Fragen erfasste materielle Wohlstand, Rasse und Geschlecht.
Zentrale Ergebnisse der "multivariaten" Analyse (in der alle genannten potentiellen Einflussfaktoren zugleich mitberücksichtigt wurden), waren dann:
• Betrachtet man die Gesamtgruppe, so zeigt sich keinerlei Effekt des Renteneintritts auf Veränderungen im Niveau körperlicher Aktivität. Hintergrund dafür ist, dass man in Untergruppen extrem gegenläufige Tendenzen beobachten kann.
• Während Rentnerinnen und Rentner, die früher eine körperlich sehr anstrengende Tätigkeit innehatten, nach Ende der Berufstätigkeit nur noch sehr wenig körperliche Bewegung haben, ist dies bei Gruppen, die früher eine überwiegende sitzende und körperlich nicht anstrengende Tätigkeit ausgeübt haben, genau umgekehrt.
• Unabhängig davon bzw. zusätzlich und verstärkend zeigt sich auch ein Einfluss des materiellen Wohlstands: Bei eher ärmeren Bevölkerungsgruppen sinkt noch einmal das Ausmaß an körperlicher Aktivität. In wohlhabenderen Gruppen zeigt sich kein Effekt.
Dass Rentnerinnen und Rentner, die früher eine körperlich sehr anstrengende Tätigkeit innehatten, nach Ende der Berufstätigkeit nur noch sehr wenig körperliche Bewegung haben, hängt einerseits damit zusammen, dass ihr beruflich veranlasstes (und oft erzwungenes) hohes Aktivitäts-Niveau nun entfällt und dies andererseits nicht kompensiert wird durch freiwillige und in der Freizeit umgesetzte, körperlich anstrengende Beschäftigungen wie Sport oder Gartenarbeit. Umgekehrt gelingt es jedoch vielen früheren Angestellten bzw. Erwerbstätigen mit niedrigen Belastungen im Job mit Eintritt in die Rente, einen körperlich aktiveren Lebensstil zu führen. Woran dies liegt und welche Konzepte zur Gesundheitsförderung geeignet wären, diese besondere Problematik für frühere Arbeiter und materiell weniger gut gestellte Rentner/innen zu lösen, bedarf weiterer Forschungsarbeit.
Zur Studie gibt es kostenlos lediglich ein Abstract: Sukyung Chung, Marisa E. Domino, Sally C. Stearns, Barry M. Popkin: Retirement and Physical Activity: Analyses by Occupation and Wealth (American Journal of Preventive Medicine, Volume 36, Issue 5, May 2009, Pages 422-428)
Gerd Marstedt, 30.8.09
US-Studie zeigt: Machos gehen sehr viel seltener zur medizinischen Vorsorge-Untersuchung
 Männer nehmen deutlich seltener als Frauen medizinische Untersuchungen zur Früherkennung von Krankheiten in Anspruch. Dies ist hinlänglich aus vielen internationalen und auch deutschen Studien bekannt. Im Gesundheitsmonitor 2007 etwa geben nur 20% der Männer, aber 60% der Frauen an, sie würden regelmäßig zur Krebsfrüherkennung gehen (vgl. Koch/Scheibler: Einstellungen und Informationsstand zur Früherkennung: Informiert und doch getäuscht?). Eine US-amerikanische Studie hat nun aber gezeigt, dass es zwischen Männern noch erhebliche Unterschiede gibt: Männer mit einem sehr starken Macho-Verhalten und Vorstellungen männlicher Überlegenheit gehen deutlich seltener zu Vorsorge- oder Früherkennungs-Untersuchungen zum Arzt.
Männer nehmen deutlich seltener als Frauen medizinische Untersuchungen zur Früherkennung von Krankheiten in Anspruch. Dies ist hinlänglich aus vielen internationalen und auch deutschen Studien bekannt. Im Gesundheitsmonitor 2007 etwa geben nur 20% der Männer, aber 60% der Frauen an, sie würden regelmäßig zur Krebsfrüherkennung gehen (vgl. Koch/Scheibler: Einstellungen und Informationsstand zur Früherkennung: Informiert und doch getäuscht?). Eine US-amerikanische Studie hat nun aber gezeigt, dass es zwischen Männern noch erhebliche Unterschiede gibt: Männer mit einem sehr starken Macho-Verhalten und Vorstellungen männlicher Überlegenheit gehen deutlich seltener zu Vorsorge- oder Früherkennungs-Untersuchungen zum Arzt.
Basis der jetzt auf dem Jahres-Kongress der American Sociological Association referierten Studie sind Daten von 1.000 älteren Männern (im Durchschnitt 65 Jahre), die aus der Wisconsin Longitudinal Study stammen. Aus dieser Stichprobe wurden Befragungsdaten des Jahres 2004 verwendet, unter anderem verschiedene sozialstatistische Angaben (Alter, Geschlecht, Familienstand usw.) und sozio-ökonomischer Status (gemessen anhand des Bildungsniveaus, des Einkommens und weiterer Merkmale). Weiterhin erfasst wurden Angaben der befragten Männer, ob sie in den letzten 12 Monaten folgende drei Untersuchungen bei einem Arzt haben durchführen lassen: 1) eine allgemeine körperliche Untersuchung etwa vergleichbar dem "Gesundheits-Checkup", 2) eine vorbeugende Grippe-Impfung, 3) eine Prostata-Untersuchung. Aus den drei Merkmalen wurde dann ein Gesamtwert für das medizinische Vorsorgeverhalten gebildet.
Detailliert erfragt wurden weiterhin Einstellungen in Bezug auf Männlichkeits-Normen. Diese Fragenbatterie zur männlichen Überlegenheit ("Hegemonic Masculinity") umfasste acht Feststellungen, die man auf einer vierstufigen Skala ablehnen oder bejahen konnte. Die Statements lauteten übersetzt:
• Wenn Mann und Frau wichtige Entscheidungen über häusliche Angelegenheiten treffen müssen, sollte der Mann das letzte Wort haben.
• Ein Mann sollte bei seinen Vorhaben immer Zuversicht ausstrahlen, auch wenn er innerlich nicht besonders zuversichtlich ist.
• Es ärgert mich, wenn ein Mann etwas tut, was ich als "feminin" erlebe.
• Männer haben ein stärkeres sexuelles Verlangen als Frauen.
• Ein Mann sollte es nicht zeigen, wenn er Schmerzen hat.
• In bestimmten Situationen sollte ein Mann auch bereit sein, seine Fäuste zu gebrauchen.
• Frauen finden große, kräftige und muskulöse Männer attraktiver.
• Es ist immer besser, wenn der Mann den Lebensunterhalt verdient und die Frau sich um Heim und Familie kümmert.
Die Antworten zu diesen Statements wurden dann summiert, so dass für jeden Teilnehmer ein Maskulinitätswert errechnet wurde. Dieser wurde dann in einer multivariaten Analyse unter gleichzeitiger Berücksichtigung sozialstatistischer und sozio-ökonomischer Einflussfaktoren in Beziehung gesetzt zum Vorsorgeverhalten im vergangenen Jahr. Dabei zeigte sich dann: Je stärker die Männlichkeitsnormen bei den Teilnehmern verwurzelt waren, um so seltener wurde an Untersuchungen zur Früherkennung oder Vorsorge teilgenommen - auch wenn man andere Faktoren wie Alter oder Bildungsniveau mitberücksichtigte. Die statistische Chance für eine Teilnahme an diesen Untersuchungen war für Männer mit einer ausgeprägten Maskulinitäts-Ideologie nur etwa halb so groß wie für andere (Odds-Ratio 0,54; p<0,001).
Überraschend war für die Wissenschaftler weiterhin, dass das Bildungsniveau und der berufliche Status die enge Verknüpfung von Maskulinitäts-Einstellungen und Vorsorgeverhalten nicht kompensierte, sondern im Gegenteil noch verstärkten: In der Gruppe jener Befragungsteilnehmer mit starker Macho-Einstellung zeigte sich, dass das Vorsorgeverhalten umso schwächer ausgeprägt war, je höher der berufliche Status war.
• Pressemitteilung der ASA: ASA Press Releases: Men's Masculinity Beliefs Are a Barrier to Preventative Healthcare
• Die komplette Studie: Springer, Kristen, Mouzon, Dawne: Masculinity and Health Care Seeking among Midlife Men: Variation by Social Context (Paper presented at the annual meeting of the American Sociological Association Annual Meeting, Sheraton Boston and the Boston Marriott Copley Place, Boston, MA, Jul 31, 2008)
Gerd Marstedt, 20.8.09
EU-Studie zum Alkoholkonsum: Der Preis für alkoholische Getränke hat auch Einfluss auf die Konsummenge
 Alkohol ist nach Erkenntnissen der EU-Kommission nach Tabak und Bluthochdruck der dritte maßgebliche Risikofaktor für eine erhöhte Mortalität und Behinderungen unter der EU-Bevölkerung. Die Kosten des Alkoholmissbrauchs wurden 2003 auf rund 125 Milliarden Euro geschätzt, was 1,3% des EU-Bruttoinlandsprodukts entspricht. Gleichzeitig ist die Produktion und der Vertrieb alkoholischer Getränke aber ein wichtiger Wirtschaftszweig, der für Arbeitsplätze und Steuereinnahmen sorgt.
Alkohol ist nach Erkenntnissen der EU-Kommission nach Tabak und Bluthochdruck der dritte maßgebliche Risikofaktor für eine erhöhte Mortalität und Behinderungen unter der EU-Bevölkerung. Die Kosten des Alkoholmissbrauchs wurden 2003 auf rund 125 Milliarden Euro geschätzt, was 1,3% des EU-Bruttoinlandsprodukts entspricht. Gleichzeitig ist die Produktion und der Vertrieb alkoholischer Getränke aber ein wichtiger Wirtschaftszweig, der für Arbeitsplätze und Steuereinnahmen sorgt.
Die EU-Kommission wollte nun in einer EU-weiten Studie über die Erschwinglichkeit von Alkohol die potenziellen Wirkungen der leichten Finanzierbarkeit eines schädlichen Alkoholkonsums und die Steuerungsmöglichkeiten über die Preisgestaltung prüfen lassen.
Zu den zentralen Befunde der Studie, die nicht nur epidemiologisch von Interesse sind, sondern auch in präventiver Hinsicht überaus große Bedeutung haben gehören:
• In den meisten Ländern der EU sind alkoholische Getränke seit Mitte der 90er Jahre sehr viel billiger geworden bzw. in Relation zur Einkommensentwicklung deutlich günstiger zu erstehen, in einigen Ländern um über die Hälfte
• Es gibt eine negative Beziehung zwischen dem Preis des Alkohols und seinem Konsum und eine positive Beziehung zwischen Einkommen und Alkoholkonsum. In der Summe besteht ein enger Zusammenhang zwischen dem Ausmaß des Alkoholkonsums und der Erschwinglichkeit alkoholischer Getränke in Europa: Langfristig führt eine Erhöhung der Erschwinglichkeit um 1% zu einer Erhöhung des Konsums um 0,32%. Verschlechtert sich die Erschwinglichkeit um denselben Prozentbetrag, sinkt auch der Konsum um den genannten Wert.
• Es gibt weiterhin einen engen Zusammenhang zwischen Alkoholkonsum und verschiedenen Negativeffekten: Zahl der Verkehrsunfälle, Zahl der Verkehrstoten, Auftreten von Leberzirrhosen. Dabei führt ein erhöhter Alkoholkonsum zu einem nur zu einer geringfügig niedrigeren Erhöhung der schädlichen Folgen: Wenn der Pro-Kopf-Alkoholkonsum um 1% zunimmt, steigt innerhalb des Folgejahres die Anzahl der Verkehrstoten um 0,85%, der Verkehrsunfällen um 0,61% und die Neuerkrankungsrate wegen Leberzirrhose um 0,37%.
• Der grenzüberschreitende Einkauf von Alkoholika kann zu einer Erhöhung des Alkoholkonsums und entsprechenden Folgeschäden führen, wenn die Preisunterschiede zwischen den Ländern größer sind.
Trotz dieser zum Teil auch bereits in der Vergangenheit vermuteten und diskutierten unerwünschten Effekte wurde in der Mehrzahl der EU-Mitgliedsländer Alkohol-Preispolitik vorrangig aus fiskalpolitischer und selten aus Public Health-Sicht verstanden und betrieben. Anzeichen dafür sind die bereits genannte EU-weite Verbilligung von alkoholischen Getränken, die Duldung von Alkoholpreisen unterhalb der Kostendeckungsgrenze oder solche Vermarktungsmethoden wie "two for one" oder "happy hours". Einige Gegenaktivitäten wie etwa das deutsche "Apfelsaft-Gesetz", nach dem in Gaststätten mindestens ein alkoholfreies Getränk billiger sein muss als das billigste alkoholische Getränk oder das Verbot von Niedrigpreisangeboten in Belgien gehen in die richtige Richtung, sind aber eher Ausnahmen.
Ihre eigene und viele andere Untersuchungen belegen nach Ansicht der RAND-Forscher, "that the price and affordability of alcohol do impact on levels of harmful and hazardous alcohol consumption" ("dass Preis und Erschwinglichkeit von Alkohol das Ausmaß von schädlichem und gesundheitsgefährlich Alkoholkonsum mitbeeinflussen") Daher empfehlen sie den politisch Verantwortlichen, um alkoholassoziierte Schäden wirksam zu verringern, ohne wenn und aber solche Maßnahmen durchzuführen, die den Preis beeinflussen und Alkohol weniger erschwinglich machen.
Trotz der großen Bedeutung einer gezielten und EU-weiten Preispolitik weisen die RAND-Gutachter darauf hin, dass schädlicher und gefährlicher Alkoholkonsum ein multifaktorielles Problem ist und eine Gegenstrategie einen Policy-Mix mehrerer Aspekte und evidenzbasierter Maßnahmearten sein muss. Dazu gehört, die Dichte der Verkaufsstellen von Alkohol zu verringern, das Mindestalter für den Einkauf von alkoholischen Getränken spürbar zu erhöhen und Maßnahmen gegen Alkohol im Straßenverkehr durchzuführen oder gegebenenfalls zu verschärfen.
Die Studie wurde im Auftrag der EU-Kommission von dem privaten Think-Tank RAND Europe durchgeführt. Die Studie basiert auf vier Informationsquellen: Eine Analyse der wissenschaftlichen Literatur, eine Sekundäranalyse quantitativer Daten über die Erreichbarkeit von Alkohol, Besteuerung, Konsum und unerwünschte Folgen, eine Online-Umfrage bei 293 Mitgliedern des "European Alcohol and Health Forum" und des "Committee on National Alcohol Policy and Action", und eine Diskussion der gewonnenen Ergebnisse in einem Experten-Workshop.
Quelle: Lila Rabinovich, Philipp-Bastian Brutscher, Han de Vries, Jan Tiessen, Jack Clift, Anais Reding: The affordability of alcoholic beverages in the European Union Understanding the link between alcohol affordability, consumption and harms, Prepared for the European Commission DG SANCO EUROPE, European Commission, 2009, PDF 1,9 MB, 145 Seiten
PDF-Datei verfügbar über die Download-Seite
PDF-Datei, direkter Link
Bernard Braun, 25.7.09
Gesundheitliche soziale Ungleichheit ist nur veränderbar, wenn auch die Raucherquote in unteren Sozialschichten sinkt
 Das Rauchen hat sich in vielen epidemiologischen Studien als größter Einflussfaktor für die Lebenserwartung im Bereich des individuellen Gesundheitsverhaltens herausgestellt. Aber in solchen Studien wurde immer auch deutlich, dass die Lebenserwartung von Angehörigen unterer Sozialschichten auch ohne Berücksichtigung des Gesundheitsverhaltens mehrere Jahre unter denen der Oberschicht liegt. Eine Längsschnitt-Studie aus Schottland, die über einen Zeitraum von 28 Jahren durchgeführt wurde und über 15.000 Teilnehmer umfasste, hat nun gezeigt: Auch wenn man die einzelnen Sozialschichten getrennt und für sich genommen betrachtet, wird ein Einfluss des Rauchens auf die Lebenserwartung deutlich. Das Fazit der Wissenschaftler: Gesundheitliche soziale Ungleichheit kann nicht abgebaut werden, wenn die Raucherquote in unteren Sozialschichten so hoch bleibt wie derzeit zu beobachten ist.
Das Rauchen hat sich in vielen epidemiologischen Studien als größter Einflussfaktor für die Lebenserwartung im Bereich des individuellen Gesundheitsverhaltens herausgestellt. Aber in solchen Studien wurde immer auch deutlich, dass die Lebenserwartung von Angehörigen unterer Sozialschichten auch ohne Berücksichtigung des Gesundheitsverhaltens mehrere Jahre unter denen der Oberschicht liegt. Eine Längsschnitt-Studie aus Schottland, die über einen Zeitraum von 28 Jahren durchgeführt wurde und über 15.000 Teilnehmer umfasste, hat nun gezeigt: Auch wenn man die einzelnen Sozialschichten getrennt und für sich genommen betrachtet, wird ein Einfluss des Rauchens auf die Lebenserwartung deutlich. Das Fazit der Wissenschaftler: Gesundheitliche soziale Ungleichheit kann nicht abgebaut werden, wenn die Raucherquote in unteren Sozialschichten so hoch bleibt wie derzeit zu beobachten ist.
8.353 Frauen und 7.049 Männer, alle im Alter von 45-64 Jahren, wurden in den Jahren 1972-1976 in den beiden schottischen Städten Renfrew und Paisley zur Mitarbeit an einer Längsschnitt-Studie über gesundheitliche Verhaltensrisiken gewonnen und danach über mehrere Jahrzehnte hinsichtlich des Auftretens von Krankheiten und Todesfällen beobachtet. Zu Beginn wurden von allen Studienteilnehmer umfangreiche Daten erfasst, sowohl durch persönliche Befragung als auch durch medizinische Untersuchungen. Zu diesen Daten gehörten unter anderem: Der mit mehreren Indikatoren erfasste sozio-ökonomische Status (soziale Schicht), Berufstätigkeit, Merkmale des Gesundheitsverhaltens wie insbesondere Rauchen sowie eine Reihe medizinischer Indikatoren wie Blutdruck, Body Mass Index (BMI), Cholesterinspiegel.
Da die Schichtzugehörigkeit sehr stark in Zusammenhang steht mit dem Rauchverhalten (Angehörige unterer Sozialschichten rauchen häufiger), beide Merkmale sich in Studien aber auch als Einflussfaktoren für die Lebenserwartung herausgestellt haben, sollte die Studie klären, wie diese drei Merkmale im Detail miteinander zusammenhängen. Dazu wurden aus den Studienteilnehmern 24 Gruppen gebildet: Nach dem Geschlecht (2 Merkmale Männer, Frauen), nach dem Rauchverhaltenen (3 Merkmale: ja, früher, nie) und nach der Sozialschicht (4 Gruppen). Überprüft wurde dann getrennt nach Männern und Frauen und ebenso separat für jede der vier Sozialschichten, ob sich ein Einfluss des Rauchens auf die im Untersuchungszeitraum beobachtete Mortalität feststellen lässt. Seit dem Beginn der Studie im Jahre 1972 wurden bei den Frauen 4.387 und bei den Männern 4.891 Todesfälle beobachtet, das entspricht 55% (Frauen) bzw. 70% (Männer) der Studienteilnehmer. Berücksichtigt wurden alle Krankheiten als Todesursachen.
In den Analysen, die das Rauchverhalten miterfassten, wurde dann zusätzlich auch der Einfluss des Alters und mehrerer medizinischer Indikatoren (Body Mass Index, Cholesterinspiegel etc.) mitberücksichtigt. Es zeigte sich dann (vgl. Grafik): 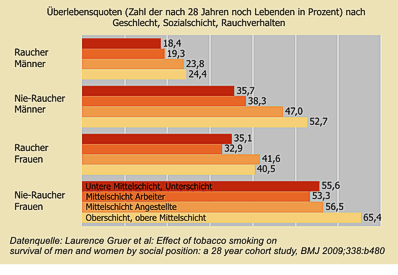
• Die niedrigsten Sterblichkeitsquoten wiesen Frauen aus der oberen Sozialschicht auf, die noch nie geraucht hatten.
• Die Mortalitätsquoten derjenigen, die mit dem Rauchen aufgehört hatten, stimmten bei Männern wie Frauen eher mit den Quoten der "Nie-Raucher" überein als mit den Quoten der aktuellen Raucher. Dies bedeutet: Mit dem Rauchen aufzuhören, rentiert sich auch noch im Alter.
•Die Überlebensraten bei Frauen (nach 28 Jahren) in den einzelnen Sozialschichten (oberste zuerst) betrugen für Nie-Raucherinnen: 65%, 57%, 53%, 56%. Die Quoten für aktuelle Raucherinnen waren deutlich niedriger: 41%, 42%, 33%, 35%.
• Ähnliche Differenzen ergaben sich für Männer, hier betrugen die Überlebensquoten bei Nie-Rauchern 53%, 47%, 38%, 36%. Für aktuelle Raucher: 24%, 24%, 19%, 18%.
Diese Zahlen bedeuten nach Auffassung der Wissenschaftler unter dem Strich, dass bei Frauen ein schichtspezifischer Überlebens-Vorteil durch das Rauchen fast völlig kompensiert wird. Bei Männern ebenso wie bei Frauen sind die Mortalitätsunterschiede zwischen aktuellen Rauchern und Nie-Rauchern größer als Unterschiede zwischen den Schichten. Von daher, so das Fazit der Wissenschaftler, kann man die gesundheitliche Ungleichheit zwischen Sozialschichten nur dann mit Aussicht auf Erfolg reduzieren, wenn die Zahl der Raucher in den unteren Schichten deutlich gesenkt wird.
Die Studie ist kostenlos im Volltext verfügbar: Laurence Gruer et al: Effect of tobacco smoking on survival of men and women by social position: a 28 year cohort study (BMJ 2009;338:b480, doi:10.1136/bmj.b480)
Gerd Marstedt, 25.7.09
Elterneinfluss auf das Essverhalten ihrer Kinder ist kleiner als erwartet
 Die populäre und auch einigen präventiven Interventionskonzepten zugrundeliegende Annahme, ein "gesundes" Essverhalten hinge vom Elternhaus ab und beginne da und elterliches "Diät"verhalten hülfe den Kindern, ihre Ernährungsüberzeugungen oder -verhaltensweisen zu gewinnen, sollte nach den Ergebnissen einer Studie von ForscherInnen der Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health gründlich überdacht werden. Sie fanden nämlich in der ersten großen und repräsentativen Studie in den USA, dass schon die Ähnlichkeit der Essgewohnheiten von Eltern und Kindern derselben Familie gering ist und damit auch allein von den Eltern her kein langfristiger "gesunder" Effekt zu erwarten ist.
Die populäre und auch einigen präventiven Interventionskonzepten zugrundeliegende Annahme, ein "gesundes" Essverhalten hinge vom Elternhaus ab und beginne da und elterliches "Diät"verhalten hülfe den Kindern, ihre Ernährungsüberzeugungen oder -verhaltensweisen zu gewinnen, sollte nach den Ergebnissen einer Studie von ForscherInnen der Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health gründlich überdacht werden. Sie fanden nämlich in der ersten großen und repräsentativen Studie in den USA, dass schon die Ähnlichkeit der Essgewohnheiten von Eltern und Kindern derselben Familie gering ist und damit auch allein von den Eltern her kein langfristiger "gesunder" Effekt zu erwarten ist.
Die WissenschaftlerInnen untersuchten mit Hilfe der für die USA repräsentativen Daten des "Continuing Survey of Food Intake by Individuals" des "US Department of Agriculture (USDA)" aus den Jahren 1994-96 das gesunde Essverhalten von Eltern (1.061 Väter und 1.230 Mütter) im Alter von 20 bis 65 Jahren und das ihrer Kinder (1.370 Söhne und 1.322 Töchter) im Alter von 2 bis 18 Jahren. In dem Survey wurde von 16.103 Personen im Alter von 0-90 Jahren das Essverhalten an zwei kompletten Tagen gemessen, die 3 bis 10 Tage auseinanderlagen. Nach einer vielseitigen Adjustierung der Probanden wurden die Eltern-Kind- Korrelationen zahlreicher Komponenten des Essverhaltens mit dem neuen "USDA 2005 Healthy Eating Index score (HEIn)" gemessen.
Die wichtigsten Ergebnisse lauten:
• Für die meisten Essmaßstäbe war die Eltern-Kinder-Korrelation schwach oder mäßig (0,2-0,33). Die Enge der Beziehung variierte aber auf niedrigem Niveau zwischen einzelnen Lebensmitteln.
• Die Korrelationen beim Essverhalten waren zwischen Müttern und ihren Töchtern und auch Söhnen höher als die zwischen Vätern und ihren Kindern.
• Hispanische und andere nicht-weißen Familien hatten generell und bei Softdrinks eine größere Ähnlichkeiten der Ernährungsgewohnheiten als Weiße und Afro-Amerikaner.
• Je älter die Kinder waren desto höher war auf dem insgesamt nicht hohem Niveau die Ähnlichkeit ihres Essverhaltens mit dem ihrer Eltern. Umgekehrt war aber unter dem Fünftel der Befragten, welches die höchsten HEIn-Werte hatten, der Anteil älterer Kinder eher gering.
• Der Einfluss des Familieneinkommens und des Bildungsniveaus der Eltern hatte nur einen kleinen Einfluss auf Eltern-Kind-Ähnlichkeiten.
• Andere Faktoren als das elterliche Essverhalten scheinen bei der Herausbildung eines ausgewogenen Essverhaltens eine wichtige Rolle zu spielen.
Zum Aufsatz "Parent-child dietary intake resemblance in the United States: Evidence from a large representative survey" von May A. Beydoun und Youfa Wang, der 2009 in der Zeitschrift "Social Science & Medicine" (Volume 68, Issue 12, June 2009, Pages 2137-2144) erschienen ist, gibt es kostenlos lediglich das Abstract.
Bernard Braun, 14.7.09
Vom Elend der Versuche, sich "am Riemen zu reißen" und mit dem Rauchen aufzuhören: Sucht - und kein Life-Style
 Wer als Raucher, Nie- bzw. Ex-Raucher meint oder als Tabakproduzent verbreitet, Rauchen sei ein selbstbestimmtes Lifestyle-Phänomen und keine Suchterkrankung, irrt bzw. untertreibt das Risiko von Rauchen beträchtlich. Wie fremdbestimmt Rauchen ist und wie schwer es ist, ohne fremde Hilfe damit aufzuhören, zeigen die im "Deutschen Ärzteblatt" vom 3. Juli 2009 veröffentlichten Ergebnisse der bevölkerungsbezogenen ESTHER-Studie (Epidemiologische Studie zu Chancen der Verhütung, Früherkennung und optimierten Therapie chronischer Erkrankungen in der älteren Bevölkerung) im Saarland, in der von Mitte 2000 bis Ende 2002 knapp 10.000 Menschen im Alter von 50 bis 74 Jahren im Rahmen eines "Gesundheits-Checkups" rekrutiert und umfangreich nach ihren Gesundheitsbasiswerten, ihrem Gesundheitsverhalten und ihrer Krankheitsvorgeschichte befragt wurden. In dieser Gruppe waren 1.528 Personen, die bei Studienbeginn Raucher waren, 4.923 waren Niemals-Raucher, 3.130 frühere Raucher und bei 248 gab es keine genauen Angaben zum Rauchverhalten.
Wer als Raucher, Nie- bzw. Ex-Raucher meint oder als Tabakproduzent verbreitet, Rauchen sei ein selbstbestimmtes Lifestyle-Phänomen und keine Suchterkrankung, irrt bzw. untertreibt das Risiko von Rauchen beträchtlich. Wie fremdbestimmt Rauchen ist und wie schwer es ist, ohne fremde Hilfe damit aufzuhören, zeigen die im "Deutschen Ärzteblatt" vom 3. Juli 2009 veröffentlichten Ergebnisse der bevölkerungsbezogenen ESTHER-Studie (Epidemiologische Studie zu Chancen der Verhütung, Früherkennung und optimierten Therapie chronischer Erkrankungen in der älteren Bevölkerung) im Saarland, in der von Mitte 2000 bis Ende 2002 knapp 10.000 Menschen im Alter von 50 bis 74 Jahren im Rahmen eines "Gesundheits-Checkups" rekrutiert und umfangreich nach ihren Gesundheitsbasiswerten, ihrem Gesundheitsverhalten und ihrer Krankheitsvorgeschichte befragt wurden. In dieser Gruppe waren 1.528 Personen, die bei Studienbeginn Raucher waren, 4.923 waren Niemals-Raucher, 3.130 frühere Raucher und bei 248 gab es keine genauen Angaben zum Rauchverhalten.
Die 17% umfassende Raucherkohorte wurde im Studienverlauf ausführlich über ihr Rauchverhalten und vor allem über die Anzahl und den Erfolg ihrer Aufhörversuche und die dazu mobilisierten Motive befragt. Das Verhalten der Raucher wurde ferner auf dem Hintergrund vorbestehender Erkrankungen differenziert bestimmt.
Die Ergebnisse sahen folgendermaßen aus:
• Von den Rauchern berichteten 76%, also die weit überwiegende Mehrheit der älteren Raucher, von mindestens einem Rauchstoppversuch in der Vergangenheit. Darunter waren auch 792 Personen (52%), die mehrfach versucht hatten aufzuhören, und zwar in allen Altersgruppen in etwa gleich viel. Frauen waren im höheren Alter tendenziell weniger bereit, das Rauchen aufzugeben.
• Bei Personen mit einer vorher bestehenden, d.h. bekannten Herz-Kreislauferkrankung erreichte der Anteil der Aufhörwilligen 89%. Dass das Aufhören trotz des Problemdrucks einer schweren Erkrankung oft nicht klappte, "lässt (die AutorInnen) jede Behauptung, Rauchen sei vorwiegend ein Lifestyle-Phänomen, absurd erscheinen."
• Allgemeiner gefragt, zeigten sich nur 11% der Raucher mit ihrem Rauchverhalten zufrieden, 30% gaben an, weniger rauchen zu wollen und 59% erklärten, sie würden gerne ganz aufhören.
Aussagekräftige Studien haben gezeigt, dass einfache strukturelle Maßnahme wie z. B. die Erstattung der Kosten einer wirksamen medikamentösen Unterstützung der Entwöhnung durch Nikotinersatzpräparate die "spontanen" Aufhörquoten um das Vierfache steigern können. Daher plädieren die ForscherInnen für eine entsprechende Finanzierung aus Krankenkassenmitteln und halten die Annahme, Rauchen sei Lifestyle und doch jederzeit mit etwas Wille aufhörbar, "für zynisch".
Andere Studien haben außerdem gezeigt, dass nur etwa 5% der RaucherInnen, die ohne weitere und/oder fremde Hilfe versuchen aufzuhören, nach einem Jahr noch tabakabstinent leben. Auch vor diesem Hintergrund stellen die AutorInnen zur Diskussion, ob nicht Ärzte stärker in eine Behandlung der Tabakabhängigkeit mit Krankheitswert von Hochrisikopatienten einbezogen werden sollen und das gesetzliche Gesundheitssystem die Mittel für möglichst wirksame Aufhörversuche auch beitragsfinanziert zur Verfügung stellen sollte.
Zu den selber eingeräumten Grenzen z.B. der Aussagefähigkeit und Verallgemeinerbarkeit über die Grenzen des Saarlands hinaus (wahrscheinlich kein wirkliches Problem), wäre das Fehlen genauer merkmalsdifferenzierter Angaben zur Häufigkeit erfolgreicher Aufhörversuche hinzuzufügen.
Der 5-seitige Aufsatz "Aufhörversuche und -wille bei älteren Rauchern: Epidemiologische Beiträge zur Diskussion um "Lifestyle" versus "Sucht"" von Breitling, Lutz Ph.; Rothenbacher, Dietrich; Stegmaier, Christa; Raum, Elke und Brenner, Hermann ist im "Deutschen Ärzteblatt" (2009; Jg. 106 [ Heft 27]: 451-5) erschienen und kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 7.7.09
Der Tabak-Atlas Deutschland informiert über (fast) alles, was mit Tabak und dem Rauchen zusammenhängt
 Seit 2002 informiert die erste Ausgabe des "Tobacco Atlas" in englischer Sprache und als PDF kostenlos im Internet angeboten über die mit dem Rauchen verbundenen Gesundheitsrisiken, aber auch über (fast) alles, was mit dem Tabak zusammenhängt: Tabakanbau und Zigarettenherstellung, Marketing der Tabakindustrie und Kulturgeschichte des Rauchens, erfolgreiche Strategien zum Nikotinverzicht und internationale Maßnahmen zum Nichtraucherschutz. Jetzt hat das Deutsche Krebsforschungszentrum Heidelberg in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Gesundheit und dem Robert-Koch-Institut Berlin den "Tabakatlas Deutschland 2009" herausgegeben und sich dabei sehr eng das englischsprachige Vorbild angelehnt, das von der englischen Wissenschaftlerin Judith Longstaff Mackay entwickelt worden war.
Seit 2002 informiert die erste Ausgabe des "Tobacco Atlas" in englischer Sprache und als PDF kostenlos im Internet angeboten über die mit dem Rauchen verbundenen Gesundheitsrisiken, aber auch über (fast) alles, was mit dem Tabak zusammenhängt: Tabakanbau und Zigarettenherstellung, Marketing der Tabakindustrie und Kulturgeschichte des Rauchens, erfolgreiche Strategien zum Nikotinverzicht und internationale Maßnahmen zum Nichtraucherschutz. Jetzt hat das Deutsche Krebsforschungszentrum Heidelberg in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Gesundheit und dem Robert-Koch-Institut Berlin den "Tabakatlas Deutschland 2009" herausgegeben und sich dabei sehr eng das englischsprachige Vorbild angelehnt, das von der englischen Wissenschaftlerin Judith Longstaff Mackay entwickelt worden war.
Auf 130 Seiten informiert jetzt der Atlas (PDF-Datei mit 26,6 MB) auch in deutscher Sprache über eine Vielzahl von Themen, wobei zwar Gesundheitsrisiken und Todesfälle durch das Rauchen eine große Rolle spielen, aber ergänzt werden um andere wissenswerte Informationen. In der Rubrik "Tabakprodukte" etwa wird auch Kautabak vorgestellt, unter "Zusatzstoffe" erfährt man, dass Tabakwarenhersteller ihren Produkten bis zu 600 Zusatzstoffe hinzufügen, die über 10 % des Gesamtgewichts eines Produktes ausmachen, und dass Menthol, Zucker, Lakrize und Kakao zu den am häufigsten verwendeten Zusatzstoffen gehören. Natürlich werden auch ausgewählte gesundheitsgefährdende Substanzen im Tabakrauch vorgestellt und beschrieben, von Ammoniak und Arsen bis hin zu Styrol und Toluol.
Ein umfangreiches Kapitel "Tabakkonsum und gesundheitliche Folgen" informiert über physiologische Wirkungen des Rauchens und Tabakabhängigkeit, über Entwicklungstrends des Tabakkonsums und durch das Rauchen bedingte Todesfälle, wie unter anderem Lungenkrebs und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Im Schluss-Kapitel über die "Tabakkontrollpolitik" erfährt man einiges über Versuche zur Eindämmung der Einflussnahme der Tabakindustrie, über Tabaksteuererhöhungen und Tabakwerbeverbote.
Natürlich werden im Tabak-Atlas auch noch einmal Ergebnisse epidemiologischer Studien zum Rauchen vorgestellt. So erfährt man, dass in Norddeutschland mehr geraucht wird als im Süden und dass überdurchschnittlich hohe Raucheranteile in den Stadtstaaten Berlin und Bremen sowie in Mecklenburg-Vorpommern zu finden sind. Warum dies so ist, bleibt leider unbeantwortet - ebenso wie die dargestellten Abhängigkeit der Raucherquoten von der sozialen Schichtzugehörigkeit, also dem Bildungs- und Einkommensniveau. Auch bei der Darstellung unterschiedlicher Raucherquoten in verschiedenen Berufsgruppen bleibt die Information leider anekdotisch und oberflächlich. Die im Vorwort geäußerte Absicht, Daten zum Tabakproblem, die bislang für Nichtwissenschaftler schwer zugänglich sind, nun einem breiten Publikum vorzulegen, ist löblich. Aber dass ohne jegliche Erklärung von Hintergründen epidemiologische Daten in Diagrammform präsentiert werden, muss kritisch angemerkt werden. So gibt es keinen einzigen erklärenden Satz, warum nun - um nur ein einziges Beispiel zu nennen - Gebäudereiniger und Raumpfleger, Maler und Lackierer Berufsgruppen mit den höchsten Raucheranteilen (59% bzw. 56%) bei Männern sind.
• Tabakatlas Deutschland, Pressemitteilungen und Download: WHO-Kollaborationszentrum für Tabakkontrolle, Tabakatlas Deutschland 2009
• Tobacco Atlas, Download von der Website der American Cancer Society: Dr. Judith Mackay, Dr. Michael Eriksen, Dr. Omar Shafey: The Tobacco Atlas, 2nd Edition
Gerd Marstedt, 3.7.09
Auch in Bayern: Wenig Licht und viel Schatten beim Übergewicht von Jugendlichen.
 Egal, ob jemand dachte, Adipositas zähle in Bayern nicht zu den wichtigsten Public Health-Herausforderungen oder umgekehrt sogar erst recht: Der Blick in die Ergebnisse des ersten bayernweiten repräsentativen Survey bei Jugendlichen der Altersgruppe 12-24 Jahren - im Übrigen eine Altersgruppe, über deren Gewichtssituation es bisher bemerkenswert wenig Daten gibt - mit 3 Erhebungswellen aus den Jahren 1995, 2000, 2005 lohnt allemal.
Egal, ob jemand dachte, Adipositas zähle in Bayern nicht zu den wichtigsten Public Health-Herausforderungen oder umgekehrt sogar erst recht: Der Blick in die Ergebnisse des ersten bayernweiten repräsentativen Survey bei Jugendlichen der Altersgruppe 12-24 Jahren - im Übrigen eine Altersgruppe, über deren Gewichtssituation es bisher bemerkenswert wenig Daten gibt - mit 3 Erhebungswellen aus den Jahren 1995, 2000, 2005 lohnt allemal.
Das Positive vorweg: Auch in Bayern zeigt sich, dass die Adipositas bei Kindern im Einschulungsalter seit einigen Jahren nicht mehr zunimmt. Bei Jugendlichen dagegen scheint die Adipositas weiter anzusteigen und hat einen starken Zusammenhang mit ihrer sozialen Lage. Die Ergebnisse im Einzelnen:
• Die Adipositas-Prävalenz bei bayerischen Jugendlichen der Altersgruppe 12-24 ist von 1995 (2,1%) über 2000 (3,1%) bis 2005 (4%) stetig angestiegen. Sie nimmt im Altersverlauf zu: "Dies ist nicht auf eine Verschiebung der gesamten BMI-Verteilung zurückzuführen, sondern darauf, dass sich speziell der BMI in der Extremgruppe der übergewichtigen und adipösen bayerischen Jugendlichen von 1995 bis 2005 noch einmal deutlich erhöht hat." Die Verdoppelung der Prävalenz betrifft männliche wie weibliche Jugendliche in etwa gleich.
• Die bereits aus anderen Studien bekannte Sozialabhängigkeit der Übergewichtigkeit zeigt sich auch in Bayern: Je niedriger der Sozialstatus, umso höher ist die Adipositas-Prävalenz. Bemerkenswert an den bayrischen Ergebnissen ist, "dass der Sozialgradient über die Befragungswellen hinweg zu Lasten der Jugendlichen aus einem Elternhaus mit geringerer Schulbildung zugenommen hat, d. h. dass die gesundheitliche Chancengleichheit abgenommen hat."
• Mittels multivariater Analysen wurde außerdem gezeigt, dass Adipositas für beide Geschlechter mit einem erhöhten Risiko für einen nicht sehr guten Gesundheitszustand einhergeht.
• In diesen Analysen spielt aber auch das gefühlte Übergewicht - also das subjektive Körpergefühl - eine relevante und unabhängige Rolle als Risikofaktor für den Gesundheitszustand der Jugendlichen.
• Bei der Zufriedenheit mit dem eigenen Körpergewicht gibt es aber auch praktisch relevante Besonderheiten zu beachten: So geben 87 % der adipösen männlichen und 100 % der adipösen weiblichen Befragten in der Welle 2005 an, zurzeit das Gefühl zu haben, dass sie zu dick sind oder einzelne Körperpartien zu dick sind - was immerhin für die Wirklichkeitsnähe derartiger Selbsteinschätzungen spricht. Allerdings sagen dies auch 25 % der männlichen bzw. 56 % der weiblichen Befragten, die nicht adipös sind. Die Forscher verweisen zu Recht auf die praktische Bedeutung dieser Beobachtung: "Dieses Resultat beinhaltet daher auch die Botschaft, bei Kampagnen zur Adipositas-Prävention auf die nötige Differenziertheit und Sensibilität zu achten, um nicht unerwünschte Nebenwirkungen in Hinblick auf eine Störung des Körpergefühls der Jugendlichen und einen falschen Diätenkult zu provozieren."
• Dem zunächst positiv wirkenden Faktum, dass 60 % der adipösen männlichen und 77 % der adipösen weiblichen Befragten in der Welle 2005 den Wunsch nach genereller, besserer Information über Übergewicht äußerten, halten die Forscher aber Erkenntnisse über die eher bescheidenen langfristige Wirkungen verschiedener Präventions- und Interventionsmaßnahmen in Cochrane-Reviews und einigen bisherigen Beobachtungsstudien entgegen.
• Mit dem Schlusssatz "Stigmatisierung ist beim Thema Adipositas keine gute Interventionsstrategie" weisen sie schließlich ebenfalls zu Recht auf die unerwünschten Wirkungen von regierungsamtlichen "fit-statt-fett"-Kampagnen hin, die möglicherweise direkt zu Untergewicht und Bulimie führen könnten.
Von dem Aufsatz "Adipositas bei bayerischen Jugendlichen: Prävalenz im Trend, soziodemografische Strukturmerkmale und subjektive Gesundheit. Obesity in Bavarian Adolescents: Prevalence in Trend, Sociodemographic Structural Features and Subjective Health" von R. Schulz, B. Güther, S. Mutert, und J. Kuhn in der Zeitschrift "Gesundheitswesen" gibt es kostenlos leider nur ein Abstract. Viele deutsche Verlage und Zeitschriftenredaktionen haben eben immer noch nicht den Sinn und Nutzen von "open access" zumindest für einen Teil ihrer Aufsätze erkannt.
Bernard Braun, 2.7.09
Sport und körperliche Aktivität bringt auch für Ältere und frühere "Couchpotatoes" noch gesundheitliche Vorteile
 Die Annahme, körperlich-sportliche Aktivitäten im Alter hätten insbesondere für Personen, die dies schon mehrere Jahre lang vernachlässigen, keinen gesundheitlichen Nutzen mehr, hat sich gerade in einer großen Kohortenstudie mit 2.205 Männern in Schweden als unzutreffend erwiesen. Die Studienteilnehmer waren zu Beginn der Studie 50 Jahre alt gewesen. Von ihnen wurde in regelmäßigen Abständen bis zum maximalen Alter von 82 Jahren erhoben, ob und wie intensiv sie körperlich aktiv waren und wie sich dies auf die Sterblichkeitsquoten auswirkte.
Die Annahme, körperlich-sportliche Aktivitäten im Alter hätten insbesondere für Personen, die dies schon mehrere Jahre lang vernachlässigen, keinen gesundheitlichen Nutzen mehr, hat sich gerade in einer großen Kohortenstudie mit 2.205 Männern in Schweden als unzutreffend erwiesen. Die Studienteilnehmer waren zu Beginn der Studie 50 Jahre alt gewesen. Von ihnen wurde in regelmäßigen Abständen bis zum maximalen Alter von 82 Jahren erhoben, ob und wie intensiv sie körperlich aktiv waren und wie sich dies auf die Sterblichkeitsquoten auswirkte.
Das Ergebnis war eindeutig: Männer, die ihr gesamtes Leben wenig körperlich aktiv waren, hatten eine hohe Sterberate von 27,1 Fällen pro 1.000 Personenjahre (PJ). Bei insgesamt mittlerer körperlicher Aktivität waren es noch 23,6 Tote pro 1.000 PJ und bei denjenigen, die schon immer intensiv Sport betrieben hatten, waren es 18,4 Tote pro 1.000 PJ. Die Sterberate liegt bei Personen mit intensiver körperlich-sportlicher Betätigung um 32 % unter der von Personen mit niedriger körperlicher Aktivität und um 22 % unter der von Personen mit mittlerer körperlicher Aktivität.
Welchen Nutzen hat nun aber ein 50-jähriger Mann mit bislang geringer körperlicher Aktivität wenn er nach Lektüre dieser Zahlen intensiv mit Bewegungsübungen beginnen will? Wenn man einen etwas längeren Atem hat, lohnt sich der Aufwand nach den Ergebnissen der schwedischen Studie: Das Sterberisiko der Männer, die sich ab dem Alter von 50 Jahren intensiver bewegen, verbessert sich im Vergleich mit ihren Altersgenossen, die schon immer körperlich aktiv waren, in den ersten 5 Jahren relativ wenig. Ihre adjustierte Risikorate ist mit 2,64 immer noch kräftig erhöht. Die Forscher vermuten aber, dass sich zwar nicht die Überlebensquote, zumindest aber die subjektive Lebensqualität dieser Männer verbessert.
Halten die "Spätberufenen" ihre sportlichen Aktivitäten aber 10 Jahre durch, liegt auch ihre adjustierte Sterblichkeitsrate mit 1,1 fast auf dem Niveau der schon in jungen Jahren Aktiven. Die schwedischen Forscher vergleichen den mit einem späten Beginn körperlicher Aktivität erzielbaren Lebensgewinn mit jenem, der nachweislich mit der Beendigung des Rauchens verbunden ist.
Ob diese Effekte auch für Frauen gelten, lässt sich dieser Studie leider nicht entnehmen. Ein vom Forscherteam selbst angesprochener Mangel ist die Messung der körperlichen Aktivität durch einen Fragebogen. Damit sind Fehleinschätzungen nicht auszuschließen. Allerdings sind auch objektive Verfahren (Messung durch Beschleunigungssensoren oder Pedometer) fehleranfällig, wie eine Studie unlängst gezeigt hat: Etwa, wenn Studienteilnehmer vergessen oder keine Lust haben, die Messgeräte anzulegen.
Eine komplette PDF-Fassung des achtseitigen Aufsatzes von Liisa Byberg, Hakan Melhus, Rolf Gedeborg, Johan Sundstrom, Anders Ahlbom, Bjorn Zethelius, Lars G Berglund, Alicja Wolk und Karl Michaelsson aus dem "British Medical Journal (BMJ)" (BMJ 2009;338:b688) ist kostenlos erhältlich: Total mortality after changes in leisure time physical activity in 50 year old men: 35 year follow-up of population based cohort
Bernard Braun, 20.6.09
Baden-Württemberger Studie zeigt auf: Bewegungsmuffel sind meist auch Sportmuffel
 In einer von der Landesstiftung Baden-Württemberg im Jahr 2006 geförderten repräsentativen Studie ("Ein aktives Leben - Alter und Altern in Baden-Württemberg") über das Bewegungsverhalten von 50- bis 70-jährigen Baden-Württembergern (N=2002) wurde überprüft, ob Personen, die öfter spazieren gehen oder Fahrrad fahren, auch zugleich häufiger Sport treiben oder ob dies Aktivitäten sind, die sich gegenseitig eher ausschließen. Zugleich wurde in der Untersuchung das Auftreten von Übergewicht beobachtet.
In einer von der Landesstiftung Baden-Württemberg im Jahr 2006 geförderten repräsentativen Studie ("Ein aktives Leben - Alter und Altern in Baden-Württemberg") über das Bewegungsverhalten von 50- bis 70-jährigen Baden-Württembergern (N=2002) wurde überprüft, ob Personen, die öfter spazieren gehen oder Fahrrad fahren, auch zugleich häufiger Sport treiben oder ob dies Aktivitäten sind, die sich gegenseitig eher ausschließen. Zugleich wurde in der Untersuchung das Auftreten von Übergewicht beobachtet.
Belegt wird in den Analysen unter anderem:
• Personen, die regelmäßig Fahrrad fahren (47,4 %) sowie Personen, die regelmäßig spazieren gehen (72,1 %), treiben zugleich auch signifikant mehr Sport. RadfahrerInnen gehen 2,5-mal so häufig wie Nicht-RadfahrerInnen und SpaziergängerInnen 1,9-mal so häufig wie Nicht-SpaziergängerInnen sportlichen Aktivitäten nach. Diese Ergebnisse bleiben auch dann bestehen, wenn sozialstatistische Merkmale und Aspekte des Gesundheitsverhalten mit berücksichtigt werden.
• Unerwartet ist folgendes Ergebnis: Personen im höheren Erwachsenenalter, die regelmäßig spazieren gehen, leiden häufiger unter Übergewicht (um 70% erhöhtes Risiko) im Vergleich zu Personen, die nicht regelmäßig spazieren gehen. Andererseits leiden Personen, die regelmäßig das Fahrrad zur Fortbewegung nutzen, dagegen signifikant seltener unter Übergewicht (um 24 % verringertes Risiko). Auch wenn keine dieser Berechnungen kausale Schlüsse erlaubt, ist vor allem der deutliche Unterschied zwischen den Wirkungen beider Bewegungsformen auf das Übergewicht ein bedenkenswerter praktischer Hinweis: Fahrradfahren scheint gesundheitlich produktiver zu sein. In beiden Fällen könnten aber Selektionseffekte (z.B. stark Übergewichtige gehen eher spazieren und eher Normalgewichtige fahren eher Rad) Einfluss auf die Ergebnisse haben. Dieser Vorbehalt muss in zukünftigen Studien geklärt werden.
• Die Erwartung, dass sich Personen im höheren Erwachsenenalter, die keinen Sport treiben, zum Ausgleich mehr im Alltag bewegen, wird von dieser Studie nicht bestätigt. "Bewegungsmuffel" sind nicht nur "Sportmuffel", sondern "Sportmuffel" sind auch "Bewegungsmuffel" mit all den damit verbundenen gesundheitlichen Risiken.
• Schließlich: Ältere Personen im Glauben zu lassen, ein regelmäßiger Parkspaziergang reiche als gesundheitsförderliche körperliche Aktivität aus, hilft ihnen - so die Heidelberger Forscherinnen - nicht. Vielmehr kommt es darauf an, sie zu körperlich-sportlichen Aktivitäten mit mittlerem Anstrengungsniveau zu motivieren.
Von dem Aufsatz von Simone Becker und Monique Zimmermann-Stenzel von der Orthopädischen Universitätsklinik der Universität Heidelberg in der "Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie gibt es kostenlos zugänglich nur ein Abstract: "Sind Bewegungsmuffel auch Sportmuffel? Sport, Übergewicht und körperliche Mobilität in der Gruppe der 50- bis 70-jährigen baden-württembergischen Bevölkerung"
Bernard Braun, 19.6.09
Norwegische Längsschnitt-Studie mit 54.000 Teilnehmern: Nach 30 Jahren ist die Hälfte der männlichen Raucher gestorben
 Es ist kein grundsätzlich neuer oder besonders überraschender Befund, der jetzt auf dem "EuroPrevent 2009 Congress" in Stockholm bekannt gemacht wurde. Auf jeder Zigarettenpackung findet man inzwischen den epidemiologischen Befund über die mit dem Rauchen verbundenen Erkrankungs- und Mortalitäts-Risiken. Allerdings ist die Teilnehmerzahl der Längsschnitt-Studie (54.075 Männer und Frauen) ebenso beachtlich wie die 30jährige Verlaufsdauer und nicht zuletzt das niederschmetternde Ergebnis: Bei den Männern waren 45% der schweren Raucher verstorben gegenüber nur 18% der Nichtraucher, bei den Frauen waren es 33 gegenüber 13 Prozent.
Es ist kein grundsätzlich neuer oder besonders überraschender Befund, der jetzt auf dem "EuroPrevent 2009 Congress" in Stockholm bekannt gemacht wurde. Auf jeder Zigarettenpackung findet man inzwischen den epidemiologischen Befund über die mit dem Rauchen verbundenen Erkrankungs- und Mortalitäts-Risiken. Allerdings ist die Teilnehmerzahl der Längsschnitt-Studie (54.075 Männer und Frauen) ebenso beachtlich wie die 30jährige Verlaufsdauer und nicht zuletzt das niederschmetternde Ergebnis: Bei den Männern waren 45% der schweren Raucher verstorben gegenüber nur 18% der Nichtraucher, bei den Frauen waren es 33 gegenüber 13 Prozent.
Während der Jahre 1974 bis 1978 waren alle 35-49jährigen Männer und Frauen aus drei norwegischen Bezirken zu einer medizinischen Untersuchung gebeten worden, um Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu untersuchen. Ein sehr hoher Anteil von 91 Prozent folgte auch tatsächlich der Einladung. Im Zeitraum 2006 bis 2008 überprüfte dann ein Forschungsteam des "Norwegian Institute of Public Health" der Universität von Oslo mit Hilfe von Fragebögen Gesundheitszustand und Erkrankungen der Teilnehmer und überprüfte auch anhand des staatlichen Sterberegisters Todesfälle und ihre Ursachen.
In einer multivariaten Analyse wurden die Teilnehmer dann nach ihrem Rauchverhalten zu Beginn der Studie unterteilt und verschiedene Einflussfaktoren (unter anderem Lebensalter, Cholesterinspiegel, Blutdruck, körperliche Bewegung) mit berücksichtigt. Dabei wurden Personen mit 20 oder mehr Zigaretten am Tag als "starke Raucher/innen" definiert. Als Ergebnis zeigte sich:
• Von den 54.075 Teilnehmern waren 30 Jahre später 13.103 (24%) verstorben.
• Diese Sterbequote fiel höchst unterschiedlich aus, je nach Geschlecht und Rauchverhalten. Sie betrug (altersadjustiert) bei starken Rauchern 45%, bei Nie-Rauchern nur 18%, bei starken Raucherinnen 33%, bei Nie-Raucherinnen 13%.
• Ähnlich große Differenzen zeigten sich für bestimmte Erkrankungen wie Herzinfarkt, Schlaganfall oder Diabetes mellitus. Das Risiko, von einer dieser Krankheiten betroffen zu sein, stieg von 20% (Nie-Raucher) auf 36% (starke Raucher). Bei Frauen lagen diese Quoten bei 14% bzw. 24%.
• Nimmt man alle beobachteten Todesfälle und die genannten Erkrankungen zusammen , dann war das Ergebnis: Etwa zwei Drittel der starken Raucher (etwa die Hälfte der Raucherinnen) war nach 30 Jahren verstorben oder schwer erkrankt. Bei Nie-Rauchern/innen lagen diese Quoten nur bei einem Drittel (Männer) bzw. einem Viertel (Frauen).
Hier ist ein Abstract der Studie: HE Meyer, A Tverdal, SE Vollset: Morbidity and mortality among smokers and non-smokers - 30 years follow-up of 54 000 middle-aged Norwegian women and men (European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation, May 2009, Vol 16, Suppl 1) Dort Abstract M137 auf Seite 36 der PDF-Datei
Pressemitteilung bei EurekAlert: 30-year follow-up study: 'Tremendous' impact of smoking on mortality and cardiovascular disease
Gerd Marstedt, 12.5.09
Gesundheitsbedrohung durch die Lebensmittel-Industrie? Ähneln die Strategien von "Big Food" denen von "Big Tobacco" ?
 In einem Schwerpunktheft der Zeitschrift "Milbank Quarterly", das sich ganz auf das Thema Übergewicht" konzentriert, findet sich auch ein Aufsatz, der Parallelen zieht zwischen den früheren Strategien der Tabak-Industrie und den aktuellen Vorgehensweisen der Lebensmittel-Industrie. "Risiken, wenn man Geschichte ignoriert. Die Tabak-Giganten spielten falsch und Millionen starben. Handeln die Lebensmittel-Giganten ähnlich?" - lautet der Titel der Veröffentlichung, in der historische Differenzen, aber auch viele Gemeinsamkeiten von "Big Tobacco" und "Big Food" beschrieben werden. ("Big Tobacco" ist im Volksmund ein verächtlicher, abwertender Begriff für die Tabak-Industrie.) Die beiden US-Wissenschaftler Kelly D. Brownell und Kenneth E. Warner der Yale University in New Haven möchten in ihrem Aufsatz auf Gesundheitsrisiken aufmerksam machen, die sich aus den Informations- und Marketingstrategien, aber ebenso aus den Produktionskonzepten von Getränke- und Nahrungsmittel-Konzernen ergeben.
In einem Schwerpunktheft der Zeitschrift "Milbank Quarterly", das sich ganz auf das Thema Übergewicht" konzentriert, findet sich auch ein Aufsatz, der Parallelen zieht zwischen den früheren Strategien der Tabak-Industrie und den aktuellen Vorgehensweisen der Lebensmittel-Industrie. "Risiken, wenn man Geschichte ignoriert. Die Tabak-Giganten spielten falsch und Millionen starben. Handeln die Lebensmittel-Giganten ähnlich?" - lautet der Titel der Veröffentlichung, in der historische Differenzen, aber auch viele Gemeinsamkeiten von "Big Tobacco" und "Big Food" beschrieben werden. ("Big Tobacco" ist im Volksmund ein verächtlicher, abwertender Begriff für die Tabak-Industrie.) Die beiden US-Wissenschaftler Kelly D. Brownell und Kenneth E. Warner der Yale University in New Haven möchten in ihrem Aufsatz auf Gesundheitsrisiken aufmerksam machen, die sich aus den Informations- und Marketingstrategien, aber ebenso aus den Produktionskonzepten von Getränke- und Nahrungsmittel-Konzernen ergeben.
Sie beschreiben in ihrem Artikel einerseits die bedeutsamen Differenzen zwischen Tabak- und Nahrungsmittel-Konzernen: Während Produkte wie Nahrungsmittel lebensnotwendig sind, gilt dies für Tabak und den Giftstoff Nikotin ganz und gar nicht. Der Verkauf von Tabak an Kinder ist verboten, für Nahrungsmittel gibt es bislang (mit Ausnahme alkoholischer Getränke) keine Beschränkungen. Für die süchtig machende Wirkung des Tabak gibt es eine Vielzahl wissenschaftlich fundierter Studien, während die Forschung über Lebensmittel gerade erst begonnen hat. Und auch die Produktstruktur, Größe und Zahl der Unternehmen beider Branchen zeigen massive Unterschiede.
Bedeutsamer erscheinen den beiden Wissenschaftlern jedoch die Gemeinsamkeiten, wobei zunächst auf eine Übereinstimmung hingewiesen wird: Die großen gesundheitlichen Risiken und ökonomischen Folgekosten des Rauchens auf der einen Seite und der durch Lebensmittel verursachten Problematik Übergewicht und Adipositas auf der anderen Seite. Sie diskutieren in ihrem sehr informativen 36seitigen Aufsatz mehrere Aspektes des Themas, bei denen sie Gemeinsamkeiten zwischen "Big Tobacco" und "Big Food" erkennen.
In diesem "Drehbuch des Handelns" sind aktuell folgende charakteristische Handlungsanleitungen und Vorgehensweisen der Lebensmittel-Industrie erkennbar:
• Die persönliche Verantwortung des Einzelnen als Ursache für das ungesunde Ernährungsverhalten der Nation hervorheben
• Die Furcht wecken, dass Maßnahmen der Regierung die persönlichen Freiheiten einschränken
• Kritiker mit totalitärer Sprache verunglimpfen, sie als "Lebensmittel-Polizei", als "Führer eines Nanny-Staates" verunglimpfen oder sie sogar als "Lebensmittel-Faschisten" bezeichnen,
• sie anklagen wegen ihrer Bemühungen, der Bevölkerung ihre bürgerlichen Freiheitsrechte weg zu nehmen
• Studien, die die Lebensmittel-Industrie angreifen, als "Billig-Wissenschaft" ("junk science") kritisieren
• Sport und körperliche Bewegung in gesundheitlicher Hinsicht als weitaus bedeutsamer charakterisieren im Vergleich zur Ernährung
• Hervorheben, dass es weder gute noch schlechte Lebensmittel gibt, daher darf auch nicht gefordert werden, bestimmte Nahrungsmittel (Soft drinks, fast food usw.) zu verändern
• Zweifel anmelden, wenn Besorgnis hinsichtlich der Lebensmittel-Industrie laut wird.
Für diese einzelnen Szenen des "Drehbuchs" werden in der Veröffentlichung viele konkrete Beispiele genannt. Darüber hinaus werden aber auch aktuell realisierte und gesellschaftlich wünschenswerte Strategien einander gegenüber gestellt. Am Beispiel "Koffein in Lebensmitteln" werden dann wiederum Konzepte und Argumentationen der Konzerne deutlich gemacht, die fatal an die Tabak-Industrie erinnern. So ist auffällig, dass Koffein inzwischen einer Vielzahl von Produkten künstlich zugesetzt wird, obwohl Koffein in pharmakologischen Studien deutliche Kennzeichen der Sucht hervorgerufen hat. Zu diesen Produkten gehören neben kaffeehaltigen Getränken und Energie-Drinks unter anderem Chips, Geleebohnen, Sonnenblumenkerne, Schokoladenriegel. Und während die Hersteller betonen, der Koffein-Zusatz diene lediglich als Geschmacksverstärker, zeigen unabhängige wissenschaftliche Studien, dass man Koffein in Lebensmitteln nicht herausschmecken kann.
Wird die Nahrungsmittel-Industrie, so fragen die Wissenschaftler abschließend, zukünftig auf ein Drehbuch setzen, das die Öffentliche Gesundheit in den Vordergrund stellt oder weist ihre Zukunft Merkmale auf, wie sie für die Tabakindustrie in der Vergangenheit galten: Schwerwiegende gesetzlichen Auflagen und überaus hohe finanziellen Bußen? Die Antwort darauf bleibt offen.
Quelle: Kelly D. Brownell, Kenneth E. Warner: The Perils of Ignoring History: Big Tobacco Played Dirty and Millions Died. How Similar Is Big Food?
• Abstract: http://www3.interscience.wiley.com/journal/122250320/abstract}
• {PDF mit Volltext
• oder auf dieser Seite PDF mit Volltext (Milbank Quarterly, Volume 87 Issue 1, Pages 259 - 294, DOI: 10.1111/j.1468-0009.2009.00555.x)
• Das Schwerpunktheft des Milbank Quarterly zum Thema "Obesity"
Gerd Marstedt, 14.4.09
Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm: Kinder imitieren auch gesundheitsriskante Ernährungsgewohnheiten ihrer Eltern
 Schon 4-5jährige Vorschulkinder werden durch TV-Werbung darin beeinflusst, was sie gerne essen und was nicht so gerne. Eine US-Studie hatte unlängst gezeigt: Viele Kinder sind voll und ganz der Überzeugung, dass Getränke und Speisen wesentlich besser schmecken, wenn sie von McDonald's kommen als wenn es sich um namenlose Fritten oder Burger handelt. Die Werbebotschaften der McDonald's Corporation mit etwa 31.000 Restaurants in über 100 Ländern kommen bei Kindern umso besser an, je mehr Fernseher im Elternhaus stehen. Die Untersuchung hatte allerdings auch deutlich gemacht, dass Eltern nicht ganz unschuldig sind, wenn Kinder sich später zu Fast-Food-Freaks entwickeln. Denn die kindliche Vorliebe für Big Mac, Mac Nuggets und Happy Meals war umso stärker ausgeprägt, je häufiger die Eltern mit ihren Kindern Gäste in den Schnellrestaurants von McDonald's waren. (vgl. McDonald's Werbebotschaften beeinflussen schon 4-5jährige Vorschulkinder)
Schon 4-5jährige Vorschulkinder werden durch TV-Werbung darin beeinflusst, was sie gerne essen und was nicht so gerne. Eine US-Studie hatte unlängst gezeigt: Viele Kinder sind voll und ganz der Überzeugung, dass Getränke und Speisen wesentlich besser schmecken, wenn sie von McDonald's kommen als wenn es sich um namenlose Fritten oder Burger handelt. Die Werbebotschaften der McDonald's Corporation mit etwa 31.000 Restaurants in über 100 Ländern kommen bei Kindern umso besser an, je mehr Fernseher im Elternhaus stehen. Die Untersuchung hatte allerdings auch deutlich gemacht, dass Eltern nicht ganz unschuldig sind, wenn Kinder sich später zu Fast-Food-Freaks entwickeln. Denn die kindliche Vorliebe für Big Mac, Mac Nuggets und Happy Meals war umso stärker ausgeprägt, je häufiger die Eltern mit ihren Kindern Gäste in den Schnellrestaurants von McDonald's waren. (vgl. McDonald's Werbebotschaften beeinflussen schon 4-5jährige Vorschulkinder)
Eine neuere Studie hat jetzt noch einmal verdeutlicht, in wie starkem Maße die Vorbildfunktion der Eltern für das Ernährungsverhalten der Kinder verantwortlich ist und damit längerfristig auch für Gesundheitsrisiken durch Übergewicht und Adipositas aufgrund ungesunder Speisen und Getränke. Teilnehmer an der experimentellen Studie waren 120 Kinder im Alter von 2-6 Jahren sowie der Vater oder die Mutter des Kindes. Im Zentrum des Experiments stand ein Puppengeschäft mit einem Verkaufstresen, in dem unterschiedlichste Speisen und Getränke im Angebot waren. Den Kindern wurden zu Beginn jeweils zwei Puppen gezeigt: Die eine Puppe sollte sie selbst darstellen, die andere war ein Freund der sie zuhause besuchte. Die Geschichte ging dann so weiter, dass das Kind feststellt, es sei nichts zu essen und zu trinken da und es würde schnell mal in das Geschäft gehen, um einzukaufen. Alle im Geschäft vorhandenen Speisen und Getränke, so wurde den Kindern erklärt, könnten sie umsonst mitnehmen.
Unter den insgesamt 133 Produkten, die durch kleine Spielzeug-Miniaturen dargestellt waren, befanden sich 73 verschiedene Artikel: Obst und Gemüse, Süßigkeiten, Snacks, Brot, Fleisch, Fertiggerichte, Obstsäfte und Softdrinks. Alle Produkte waren zuvor von Lebensmittel-Experten als eher gesund oder eher ungesund eingestuft worden. Die Wissenschaftler protokollierten dann, welche Artikel jedes Kind "eingekauft" hatte und sie befragten darüber hinaus den Vater oder die Mutter mit einem Fragebogen, wie oft sie selbst bestimmte Speisen und Getränke einkaufen würden.
Die Kinder wurden dann in eine von drei Gruppen eingeordnet, je nachdem, wie viele eher gesunde und wie viele eher ungesunde Produkte sie ausgewählt hatten. Deutlich wurde dann in der Auswertung zunächst, dass die Eltern sehr viel öfter auch gesunde Produkte einkauften während dies bei ihren Kindern eher die Ausnahme war. Während zwei von drei Kindern (65%) in der Gruppe mit den ungesündesten Lebensmitteleinkäufen anzutreffen war, galt dies bei den Eltern nur für jeden zwanzigsten (5%).
Bei der Frage, welche Faktoren zu einem eher ungesunden Einkaufsverhalten führen, fanden die Wissenschaftler zunächst keine überzeugenden Antworten. Das Alter des Kindes (2-6 Jahre) spielte ebenso wenig eine Rolle wie das Geschlecht und das Bildungsniveau der Eltern war ebenso unerheblich wie die Zahl und Ausstattung der Fernseher im Haushalt. Ein sehr enger Zusammenhang wurde dann aber deutlich, wenn man das Einkaufsverhalten der Eltern berücksichtigte. Kauften diese überwiegend ungesunde Lebensmittel ein, dann verhielten sich auch die Kinder ausnahmslos so. Waren die Eltern in ihrer Auswahl der Speisen und Getränke eher gesundheitsbewusst, dann zeigten Kinder sich auch von dieser Haltung beeinflusst.
• Abstract der Studie: Lisa A. Sutherland u.a.: Like Parent, Like Child. Child Food and Beverage Choices During Role Playing (Arch Pediatr Adolesc Med. 2008; 162(11):1063-1069)
Gerd Marstedt, 29.3.09
Schwangerschaft und Rauchen: Nützt es, noch während der Schwangerschaft mit dem Rauchen aufzuhören?
 Nicht selten werden riskante Verhaltensweisen nicht gestoppt, weil der Nutzen als ungesichert gilt oder man dadurch sogar unerwünschte Wirkungen befürchtet.
Nicht selten werden riskante Verhaltensweisen nicht gestoppt, weil der Nutzen als ungesichert gilt oder man dadurch sogar unerwünschte Wirkungen befürchtet.
Letzteres gilt für Raucherinnen, die schwanger werden und trotz der durchaus bewussten gesundheitlichen Risiken für sich und das ungeborene Kind aus Angst vor Entzugs-Stress, Angstattacken oder Depressionen weiter rauchen. Vor allem dann, wenn eine Schwangere bereits mehrere Wochen während ihrer Schwangerschaft weitergeraucht hat, wird ihr Verhalten nicht selten durch die Annahme gestützt, ein Aufhören würde letztlich auch nichts mehr an den möglichen Folgen ändern.
Diesem Argument ist jetzt durch eine Untersuchung mit 2.504 gesunden und erstschwangeren Teilnehmerinnen der "Screening for Pregnancy Endpoints (SCOPE) study" in Neuseeland und Australien ein wesentlicher Teil seiner Wirkkraft entzogen worden. 80 % der Gruppe waren schwangere Frauen, die niemals vor und während ihrer Schwangerschaft rauchten, 10 % der Teilnehmerinnen hörten in der 15. Schwangerschaftswoche mit dem Rauchen auf und 10 % der Frauen rauchten bis zum Ende der Schwangerschaft und darüberhinaus weiter.
Als mögliche Wirkungsergebnisse wurde die Häufigkeit einer spontanen Frühgeburt und ein nicht dem Schwangerschaftsstadium entsprechendes Größenwachstum des Kindes untersucht.
Die wichtigsten soziodemographisch und gesundheitlich adjustierten Ergebnisse lauten:
• Schwangere Frauen, die in der Schwangerschaftszeit weiter rauchten hatten gegenüber den Frauen, die bis spätestens bis zur 15. Schwangerschaftswoche mit dem Rauchen aufhörten, ein statistisch hochsignifikantes größeres Risiko einer Frühgeburt (10 % versus 4 %; OR=3,21) und ein höheres Risiko von Wachstumsstörungen des Kindes (17 % vs. 10 %; OR=1,76).
• Zwischen den Frauen, die bis zur 15. Schwangerschaftswoche aufhörten zu rauchen und den Nichtraucherinnen gab es keinen signifikanten Unterschied bei der Häufigkeit einer Frühgeburt (Odds Ratio [OR]=1,03) und einem inadäquaten Wachstum (OR=1,06).
• Die Frauen, die mit dem Rauchen aufhörten, litten nicht unter einem Anstieg von Stress, Angst oder Depressionen.
Der Schlussfolgerung der AutorInnen, "that these severe adverse effects of smoking may be reversible if smoking is stopped early in pregnancy" ist mit der Einschränkung zuzustimmen, dass dies nicht für andere mehr oder weniger negative Wirkungen (z.B. Suchtmerkmale) gelten könnte.
Zu dem im "British Medical Journal (BMJ)" am 26. März 2009 (BMJ 2009;338:b1081) veröffentlichten Aufsatz "Spontaneous preterm birth and small for gestational age infants in women who stop smoking early in pregnancy: prospective cohort study" von Lesley M E McCowan, Gustaaf A Dekker, Eliza Chan, Alistair Stewart, Misty Hunter, Rona Moss-Morris, Robyn A North und Lucy C Chappell gibt es ein Abstract und eine kostenlose komplette siebenseitige PDF-Fassung.
Bernard Braun, 27.3.09
Länder, in denen wenig Rad gefahren und zu Fuß gegangen wird, haben auch ein größeres Übergewichtsproblem
 Ein zu geringes Ausmaß an körperlicher Bewegung, durch Jogging oder Radfahren, Gartenarbeit oder Sport, wirkt sich oft negativ auf das Körpergewicht aus und erhöht das Risiko von Übergewicht und Adipositas. So viel ist aus einer Reihe von Studien bereits bekannt, bei denen man die körperliche Aktivität und den Body-Mass-Index von Kindern oder auch Erwachsenen miteinander in Beziehung gesetzt hat. Eine neuere, jetzt in der Zeitschrift "Journal of Physical Activity and Health" veröffentlichte Studie hat nun noch einmal untersucht, ob dieser Zusammenhang nicht nur auf der Ebene von Individuen, sondern auch auf Länder-Ebene feststellbar ist. Konkret stand die Frage im Raum: Zeigt sich auch im Vergleich nordamerikanischer und europäischer Länder, dass dort, wo Bürger/innen in ihrem Alltag viele Erledigungen und Wege zu Fuß oder mit dem Fahrrad bewältigen, sich dies auch in einem niedrigeren Vorkommen von Übergewicht niederschlägt?
Ein zu geringes Ausmaß an körperlicher Bewegung, durch Jogging oder Radfahren, Gartenarbeit oder Sport, wirkt sich oft negativ auf das Körpergewicht aus und erhöht das Risiko von Übergewicht und Adipositas. So viel ist aus einer Reihe von Studien bereits bekannt, bei denen man die körperliche Aktivität und den Body-Mass-Index von Kindern oder auch Erwachsenen miteinander in Beziehung gesetzt hat. Eine neuere, jetzt in der Zeitschrift "Journal of Physical Activity and Health" veröffentlichte Studie hat nun noch einmal untersucht, ob dieser Zusammenhang nicht nur auf der Ebene von Individuen, sondern auch auf Länder-Ebene feststellbar ist. Konkret stand die Frage im Raum: Zeigt sich auch im Vergleich nordamerikanischer und europäischer Länder, dass dort, wo Bürger/innen in ihrem Alltag viele Erledigungen und Wege zu Fuß oder mit dem Fahrrad bewältigen, sich dies auch in einem niedrigeren Vorkommen von Übergewicht niederschlägt?
Die US-amerikanische Forschungsgruppe hat dazu eine Vielzahl nationaler Studien herangezogen und die dort gefundenen Ergebnisse für einen internationalen Vergleich aufbereitet. In Deutschland war dies die Studie "Mobilität in Deutschland (MiD)", eine bundesweite Befragung von 50.000 Haushalten zu ihrem alltäglichen Verkehrsverhalten im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung. Die Umfrage wurde erstmals im Jahr 2002 durchgeführt und wird im Jahr 2008/2009 wiederholt. (vgl: Mobilität in Deutschland) Insgesamt konnten die Wissenschaftler dann Daten aus 15 Ländern in Europa, Nordamerika und Australien berücksichtigen.
Um einen Indikator zu bekommen, der das Ausmaß körperlicher Bewegung studienübergreifend benennt, verwendeten sie die Angabe: Wie viele der alltäglichen Wegstrecken (zur Arbeit, zum Einkaufen, zum Arzt usw.) werden im Landesdurchschnitt zu Fuß, mit dem Rad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln bestritten in Relation zu allen Wegen, also auch den mit dem Auto zurück gelegten. Öffentliche Verkehrsmittel wurden einbezogen, da man zu den Haltestellen ja auch in der Regel zu Fuß oder mit dem Rad gelangt. Zugleich verwendeten sie auch Studien, in denen die Verbreitung von Adipositas (Body-Mass-Index >= 30) erfasst worden ist, sei es durch objektive Messungen, sei es durch Befragungen und Selbstangaben. Alle Studien stammten aus den Jahren 1994 bis 2006. 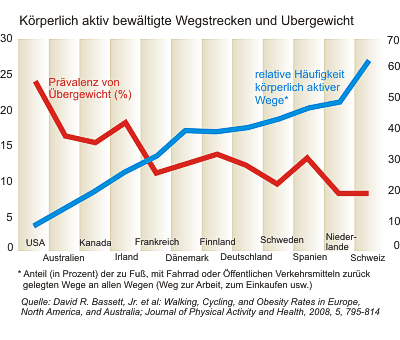
Als Ergebnis zeigte sich dann: Länder mit dem höchsten Anteil adipöser Bürger/innen wiesen auch nur ein sehr geringes Maß an aktiv bewältigten Wegstrecken auf. Besonders deutlich gilt dies etwa für die USA, Kanada und Australien. In der Grafik zeigt die rote Kurve die prozentuale Häufigkeit adipöser Bürger/innen, die blaue Kurve das Ausmaß körperlicher Aktivität durch zu Fuß zurück gelegte Kurzstrecken. In dieser Grafik abgebildet sind Adipositas-Daten aus Umfragen. In einer zweiten Analyse verwendeten die Wissenschaftler auch BMI-Daten auf der Basis objektiver Gewichtsmessungen, um Fehlerquellen auszuschließen. Das Ergebnis war jedoch dasselbe.
In der Studie wurde dann auch noch einmal berechnet, wie viele Kilometer Bürger/innen für die Bewältigung von Kurzstrecken zurücklegen. Hier wurde ebenfalls große Unterschiede deutlich: Während US-Amerikaner im Jahr nur etwa 181 km zu Fuß oder mit dem Rad zurücklegen, sind dies bei Niederländern 1225 km, bei Dänen immerhin noch 1014 km. Deutschland rangiert hier mit 663 km im Mittelfeld.
Quelle: David R. Bassett, Jr., John Pucher, Ralph Buehler, Dixie L. Thompson, and Scott E. Crouter: Walking, Cycling, and Obesity Rates in Europe, North America, and Australia; Journal of Physical Activity and Health, 2008, 5, 795-814
• Hier ist ein Abstract der Studie auf der Website von "Journal of Physical Activity and Health"
• Hier ist eine PDF-Datei mit dem Volltext der Studie auf der Website der Edward J. Bloustein School of Planning and Public Policy, Rutgers, The State University of New Jersey
Gerd Marstedt, 17.3.09
Selbst nach einer Herzerkrankung fällt vielen die Änderung gesundheitsriskanter Verhaltensweisen schwer
 Eine Änderung gesundheitsriskanter Verhaltensweisen wie Rauchen, zu wenig körperliche Bewegung, ungesunde Ernährung fällt vielen selbst dann schwer, wenn sie wegen einer koronaren Herzerkrankung in einem Krankenhaus stationär behandelt werden mussten und ihnen daher das Risiko ihrer Lebensweise sehr deutlich geworden ist. Dies ist das Ergebnis einer Studie, die in acht europäischen Ländern durchgeführt wurde und Koronar-Patienten nach ihrem Klinik-Aufenthalt mehrfach im Abstand einiger Jahre über ihr Gesundheitsverhalten befragte.
Eine Änderung gesundheitsriskanter Verhaltensweisen wie Rauchen, zu wenig körperliche Bewegung, ungesunde Ernährung fällt vielen selbst dann schwer, wenn sie wegen einer koronaren Herzerkrankung in einem Krankenhaus stationär behandelt werden mussten und ihnen daher das Risiko ihrer Lebensweise sehr deutlich geworden ist. Dies ist das Ergebnis einer Studie, die in acht europäischen Ländern durchgeführt wurde und Koronar-Patienten nach ihrem Klinik-Aufenthalt mehrfach im Abstand einiger Jahre über ihr Gesundheitsverhalten befragte.
Die jetzt in der renommierten Zeitschrift "The Lancet" veröffentlichte Studie wurde innerhalb des Forschungsprogramms "EUROASPIRE - European Action on Secondary and Primary Prevention by Intervention to Reduce Events" durchgeführt, das die Präventionsmöglichkeiten für Herz-Kreislauf-Erkrankungen untersucht. Dazu wurden in acht Ländern (Deutschland, Frankreich, Finnland, Italien, Niederlande, Ungarn, Slowenien, Tschechien) mehrfach Männer und Frauen im Alter unter 70 Jahren befragt. In der ersten Erhebung im Jahr 1195-96 waren dies 3.180, im Jahr 1999-2000 dann knapp 3.000 und schließlich in der letzten Erhebung 2006-07 rund 2.400 Patienten.
Alle Studienteilnehmer waren zu Beginn der Studie Mitte der 90er Jahre wegen einer Herz-Kreislauf-Erkrankung (oft: Herzinfarkt) in eine Klinik eingeliefert und stationär behandelt worden. In den drei späteren Befragungen wurde dann eine Vielzahl von Daten zum Gesundheitszustand und zum Risikoverhalten erhoben: familiäre Krankheitsgeschichte, aktuell eingenommene Medikamente, Rauchen, Ernährung, körperliche Bewegung, Gewicht, BMI, Blutdruck usw. Als Ergebnis der Datenanalysen wurde dann deutlich:
• Zwar hatte etwa die Hälfte der Patienten das Rauchen aufgegeben. Doch in allen drei Befragungen gab immer noch etwa jeder fünfte an, weiter zu rauchen, die Zahl der "Unverbesserlichen" blieb mit 20,3% (1995-96), 21,2% (1999-2000) und 18,2% (2006-07) etwa gleich hoch.
• Insbesondere bei den weiblichen Studienteilnehmern unter 50 Jahren hat sich dabei die Quote der Raucher überproportional erhöht, von etwa 30% auf 50%.
• Erhebliche Steigerungen fanden die Wissenschaftler auch, was den Anteil adipöser Patienten (BMI >=30) anbetrifft. Dieser Wert stieg von 25,0% in der ersten Befragung auf 32,6% und dann 38,0% in der letzten Befragung.
• Ähnlich besorgniserregend war für die Forscher auch der Anstieg der Diabetes-Erkrankungen von anfänglich 17,4% auf zuletzt 28,0%.
In einer Pressemitteilung der Zeitschrift "The Lancet" fordern die Forscher, "dass für alle Herzpatienten umfassende Programme zur Änderung des Lebensstils integraler Bestandteil der bereitgestellten Gesundheitsvorsorge sowie der Planungen der Krankenversicherungen werden müssten." Die Befunde der Studie sind jedoch nicht nur bedeutsam für die zukünftige Versorgung von Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, sondern verdeutlichen auch die Barrieren für Präventionsmaßnahmen und Programme zur Gesundheitsförderung. Deutlich wird aus den Befunden, "wie schwierig es für die Menschen sei, ihre Verhaltensweisen sogar angesichts einer lebensbedrohenden Erkrankung zu ändern."
Hier ist ein kostenloses Abstract zur Studie: Kornelia Kotseva u.a.: Cardiovascular prevention guidelines in daily practice: a comparison of EUROASPIRE I, II, and III surveys in eight European countries (The Lancet, Volume 373, Issue 9667, Pages 929 - 940, 14 March 2009, doi:10.1016/S0140-6736(09)60330-5)
Gerd Marstedt, 16.3.09
Alkoholgenuss in Spielfilmen und Werbespots regt Zuschauer vermehrt zum Konsum alkoholischer Getränke an
 Jugendliche, denen man Filme oder auch Werbespots zeigt, in denen Schauspieler genüsslich alkoholische Getränke zu sich nehmen, greifen in dieser Situation selbst auch lieber zu Bier oder Wein als zu Erfrischungsgetränken oder Mineralwasser. Dies hat jetzt eine experimentelle Studie gezeigt, die an der niederländischen Radboud University in Nijmegen durchgeführt wurde. Und zugleich wurde jetzt eine Meta-Analyse von 7 Längsschnitt- Studien veröffentlicht, die anhand der Daten von rund 13.000 Jugendlichen und jüngeren Erwachsenen zeigt: Je häufiger diese im Fernsehen, im Kino oder in Zeitschriften Werbung für alkoholische Getränke sehen, desto mehr nehmen sie im Zeitverlauf auch selber alkoholische Getränke zu sich.
Jugendliche, denen man Filme oder auch Werbespots zeigt, in denen Schauspieler genüsslich alkoholische Getränke zu sich nehmen, greifen in dieser Situation selbst auch lieber zu Bier oder Wein als zu Erfrischungsgetränken oder Mineralwasser. Dies hat jetzt eine experimentelle Studie gezeigt, die an der niederländischen Radboud University in Nijmegen durchgeführt wurde. Und zugleich wurde jetzt eine Meta-Analyse von 7 Längsschnitt- Studien veröffentlicht, die anhand der Daten von rund 13.000 Jugendlichen und jüngeren Erwachsenen zeigt: Je häufiger diese im Fernsehen, im Kino oder in Zeitschriften Werbung für alkoholische Getränke sehen, desto mehr nehmen sie im Zeitverlauf auch selber alkoholische Getränke zu sich.
In der experimentellen Studie der Universität Nijmegen wurden 80 männliche Studenten im Alter von 18-29 Jahren gebeten, an einem Experiment teilzunehmen. Sie wurden dazu in einen Raum der Universität gebeten, dessen Einrichtung einer Bar glich. Dort sollten sie sich auf einem großen TV-Bildschirm einen Film anschauen und später, so wurde ihnen gesagt, einige Angaben machen über ihre Fernsehgewohnheiten zuhause. Während des Films konnten sie sich, so wurde ausdrücklich gesagt, aus einem Kühlschrank Getränke nehmen: Bier, Wein, Cola oder Orangensaft.
Tatsächlich ging es jedoch nicht um Fernsehgewohnheiten, sondern die Wissenschaftler wollten das Trinkverhalten beobachten, genauer: die Wahl alkoholischer oder nicht-alkoholischer Getränke. Dazu wurden die 80 Teilnehmer per Zufall einer von vier Gruppen zugeteilt, in denen unterschiedliches Filmmaterial dargeboten wurde. Gezeigt wurde entweder ein Spielfilm, in dem sehr viele oder auch sehr wenig Szenen zu sehen waren, in denen Darsteller Alkohol tranken. Es handelte sich um "American Pie 2" (mit vielen Alkohol-Szenen) und um "40 Days and 40 Nights", ein Film mit sehr wenig Alkohol-Szenen. Weiterhin wurde der Spielfilm zweimal für Werbung unterbrochen, wobei in ähnlicher Weise in zwei Gruppen Werbeclips für alkoholische Getränke gezeigt wurden und in zwei anderen Gruppen solche mit neutralem Inhalt.
Protokolliert wurde, welche Getränke und wie viele die Studenten in den vier Präsentationsgruppen zu sich genommen hatten. In der Auswertung zeigte sich dann: Die Präsentation des "Alkohol-Films" zusammen mit Werbespots für alkoholische Getränke führte dazu dass in dieser Gruppe doppelt so viel Bier oder Wein getrunken wurde (im Durchschnitt 3 alkoholische Getränke) wie in der anderen Extremgruppe, die den Film mit sehr wenig Alkohol-Szenen und neutraler Werbung gesehen hatte (1,5). Dieses Ergebnis bestätigte sich auch, wenn in einer multivariaten Analyse andere potentielle Einflussfaktoren kontrolliert wurden, wie zum Beispiel generelle Trinkgewohnheiten der Teilnehmer. Die Wissenschaftler heben hervor, dass damit zum ersten Mal im Rahmen einer experimentellen Studie der Imitations-Effekt für den Alkohol-Konsum nachgewiesen wurde.
Die Studie ist hier kostenlos im Volltext verfügbar: Rutger C. M. E. Engels u.a.: Alcohol Portrayal on Television Affects Actual Drinking Behaviour (Alcohol and Alcoholism, doi:10.1093/alcalc/agp003. This version published online on March 4, 2009)
In einer Meta-Analyse schon veröffentlichter Studien untersuchten zwei englische Wissenschaftler in ähnlicher Weise den Einfluss von Alkohol-Werbung in verschiedenen Medien auf das Trinkverhalten von Jugendlichen. In den sieben einbezogenen Längsschnittstudien waren Daten von insgesamt 13.000 Jugendlichen und jüngeren Erwachsenen im Alter von 10-26 Jahren erfasst worden. Anhand von Befragungen wurde einerseits festgehalten, wie oft die Teilnehmer aufgrund ihres Fernseh- oder Leseverhaltens auch Alkoholwerbung sahen. Andererseits wurde auch das Trinkverhalten und der Alkoholkonsum erfasst. Als übereinstimmendes Ergebnis der Studien zeigte sich: Auch dann, wenn die Teilnehmer zu Beginn der verschiedenen Längsschnittuntersuchungen nur wenig Alkohol tranken, so erhöhte sich die Menge im Zeitverlauf und zwar parallel zur Anzahl der wahrgenommenen Inserate, Filme oder TV-Spots mit Alkohol-Werbung.
Auch diese Studie ist im Volltext frei verfügbar: Lesley A Smith, David R Foxcroft: The effect of alcohol advertising, marketing and portrayal on drinking behaviour in young people: systematic review of prospective cohort studies (BMC Public Health 2009, 9:51doi:10.1186/1471-2458-9-51)
Hier ist ein Abstract der Studie
Gerd Marstedt, 9.3.09
Egal, ob Atkins- oder Ornish-Diät, Weight Watchers oder Mittelmeerkost: Wichtig ist allein eine kalorien-reduzierte Ernährung
 Die Zeitschrift Focus hat unlängst nicht weniger als 50 verschiedene Diäten zum Abnehmen einzeln beschrieben und in der wissenschaftlichen Diskussion ist man sich in der Bewertung der Erfolge verschiedener Diäten uneins. Es herrschte lediglich die Einsicht vor, dass Diäten zwar kurzfristig effektiv sind, langfristig aber zur Gewichtsabnahme wenig taugen. Vermutlich werden sich die Diät-Empfehlungen in Frauenzeitschriften auch in der nächsten Zeit kaum ändern, die wissenschaftliche Diskussion allerdings sollte durch das Ergebnis einer jetzt im "New England Journal of Medicine" veröffentlichten Studie neue Akzente bekommen.
Die Zeitschrift Focus hat unlängst nicht weniger als 50 verschiedene Diäten zum Abnehmen einzeln beschrieben und in der wissenschaftlichen Diskussion ist man sich in der Bewertung der Erfolge verschiedener Diäten uneins. Es herrschte lediglich die Einsicht vor, dass Diäten zwar kurzfristig effektiv sind, langfristig aber zur Gewichtsabnahme wenig taugen. Vermutlich werden sich die Diät-Empfehlungen in Frauenzeitschriften auch in der nächsten Zeit kaum ändern, die wissenschaftliche Diskussion allerdings sollte durch das Ergebnis einer jetzt im "New England Journal of Medicine" veröffentlichten Studie neue Akzente bekommen.
Die mit 811 Männern und Frauen im Alter über 50 Jahre durchgeführte Längsschnitt-Studie hat nämlich gezeigt: Die Diskussionen über die Zusammensetzung unterschiedlicher Diäten aus Fetten, Kohlenhydraten und Proteinen sind überflüssig. Denn im Vergleich von vier Gruppen, die über einen Zeitraum von zwei Jahren jeweils unterschiedliche Diäten befolgten, zeigte sich: Effektiv kann jede Ernährungsumstellung für eine Gewichtsabnahme und Vermeidung von Adipositas und ihren Folgen sein, wenn sie nur das Prinzip befolgt, dass die Kalorienzahl dauerhaft gesenkt wird.
Alle Teilnehmer an der Studie hatten Übergewicht oder sogar Adipositas. Nach dem Zufallsprinzip wurden sie einer von vier Diätgruppen mit unterschiedlicher Zusammensetzung der Speisen zugeordnet:
• In einer Gruppe war der Fettgehalt auf 20% reduziert,
• in einer anderen Gruppe zusätzlich auch noch der Anteil der Proteine auf 25 Prozent erhöht,
• in einer Gruppe wiederum waren 40% Fett in den Speisen erlaubt,
• und in der letzten Gruppe waren auch noch Kohlehydrate deutlich reduziert.
Die jeweilige Zusammensetzung der Ernährung war in den vier Gruppen also folgendermaßen organisiert:
Fett-Proteine-Kohlenhydrate: 20-15-65%, 20-25-55%, 40-15-45%, 40-25-35%.
In allen vier Diäten wurde bei jedem Teilnehmer die Gesamtenergiezufuhr im Vergleich zu vorherigen Ernährungsgewohnheiten um 750 kcal reduziert, das Minimum der Energieaufnahme waren aber 1.200 kcal am Tag. Die Ernährung sollte darüber hinaus Leitlinien zur Prävention von Herz-Kreislauferkrankungen beachten (wenig gesättigte Fettsäuren, wenig Cholesterin, hoher Anteil von Ballaststoffen). Und schließlich wurdem Teilnehmer im gesamten Untersuchungszeitraum auf Wunsch beraten und sollten anderthalb Stunden Sport oder anstrengende Bewegung pro Woche durchführen.
Als Ergebnis zeigte sich dann während des Studienverlaufs der bekannte "Jojo"-Effekt: Nach 6 Monaten hatten die Teilnehmer in allen Gruppen im Durchschnitt etwa 6 Kilogramm an Gewicht verloren, also etwa 7 Prozent des Körpergewichts. Später, nach 2 Jahren dann, hatten die meisten jedoch wieder einiges an Gewicht zugelegt. Die gegenüber dem Ausgangsgewicht verlorenen Pfunde machten nur noch 4 Kilogramm aus, und dies auch nur bei jenen 80 Prozent der Studienteilnehmer, die nicht vorher abgebrochen hatten und aus der Studie ausgestiegen waren. Immerhin etwa 14-15% hatten ihr Körpergewicht sogar um 10 Prozent reduziert.
Die durchschnittliche Gewichtsabnahme in den vier Gruppen schwankte nach zwei Jahren zwischen 2,9 und 3,6 kg. Da diese Werte jedoch keine statistisch signifikanten Unterschiede darstellen, heißt ein Fazit der Studie: Wichtig ist die Senkung der Kalorienzahl und das Durchhalten. Dass die Zusammensetzung der Speisen unterschiedlich sein kann, erscheint den Forschern als Chance, weil Abnehmwillige so eher Speisepläne nach ihrem persönlichen Geschmack gestalten können.
Die Studie ist hier im Volltext zu finden: Frank M. Sacks u.a.: Comparison of Weight-Loss Diets with Different Compositions of Fat, Protein, and Carbohydrates (NEJM, Volume 360:859-873, February 26, 2009, Number 9)
Gerd Marstedt, 28.2.09
Schlafstörungen und zu wenig Schlaf erhöhen das Risiko für Erkältungskrankheiten um das 3-5fache
 Dass Vitamin C überaus hilfreich ist zur Vorbeugung und Therapie von Erkältungskrankheiten, glaubt zwar eine große Mehrheit der Bevölkerung (vgl. PISA-Test für Erwachsene). Nichtsdestotrotz ist dies eine klassische medizinische Fehlannahme, wie eine Cochrane-Studie erst unlängst gezeigt hat (Vitamin C gegen Erkältungen). Nur sehr wenig bekannt ist andererseits jedoch, dass Schlafstörungen und ein unruhiger Schlaf ebenso wie eine sehr kurze nächtliche Schlafdauer, ein mehrfach erhöhtes Risiko für Erkältungskrankheiten mit sich bringen.
Dass Vitamin C überaus hilfreich ist zur Vorbeugung und Therapie von Erkältungskrankheiten, glaubt zwar eine große Mehrheit der Bevölkerung (vgl. PISA-Test für Erwachsene). Nichtsdestotrotz ist dies eine klassische medizinische Fehlannahme, wie eine Cochrane-Studie erst unlängst gezeigt hat (Vitamin C gegen Erkältungen). Nur sehr wenig bekannt ist andererseits jedoch, dass Schlafstörungen und ein unruhiger Schlaf ebenso wie eine sehr kurze nächtliche Schlafdauer, ein mehrfach erhöhtes Risiko für Erkältungskrankheiten mit sich bringen.
Dies hat eine jetzt in der Zeitschrift "Archives of Internal Medicine" veröffentlichte experimentelle Studie gezeigt. Insgesamt 153 gesunde Personen, etwa gleich viele Männer und Frauen im Alter von 21-55 Jahren (Durchschnitt: 37 Jahre) nahmen an der Studie teil, die in den Jahren 2000-2004 durchgeführt wurde. Im Kern bestand das Experiment darin, den Teilnehmern durch die Nase eine Flüssigkeit zu verabreichen, die auch Viren für eine Erkältungskrankheit enthielt. Mit Nasenspülungen wurde zusätzlich versucht, die Viren zu vermehren.
Dann wurde mehrfach mit medizinischen Untersuchungen, aber auch durch Befragung der Teilnehmer überprüft, ob sich eine Erkältung entwickelt hatte oder ob das Immunsystem des Körpers die Viren erfolgreich bekämpfen konnte. Um zu analysieren, welchen Einfluss die Schlafgewohnheiten der Teilnehmer auf das Erkältungsrisiko haben, wurden schon einige Zeit vor Beginn des Experiments, aber auch mehrfach während des Experiments Befragungen durchgeführt zum Schlaf: Zeitliche Dauer in Stunden, Zeitanteil vom Zubettgehen bis zum Aufstehen ohne richtigen Schlaf, Gefühle des Erholtseins oder der Müdigkeit am frühen Morgen nach dem Aufstehen und anderes mehr. Darüber hinaus wurden umfängliche Kontrolluntersuchungen zum Gesundheitszustand vor, während und nach dem Experiment durchgeführt und viele Angaben erfragt zum Gesundheitsverhalten (Rauchen, Bewegung, Alkoholkonsum) und zum psychologischen Befinden (Stress, Lebensqualität usw.).
Als Ergebnis zeigte sich dann:
• Etwa 35 Prozent der Teilnehmer bekamen eine Erkältungskrankheit, festgestellt anhand einer objektiv nachgewiesenen Infektion mit dem Virus und weiterer medizinischer Kriterien (Beschaffenheit des Nasenschleims). Noch ein wenig mehr Teilnehmer (43 Prozent) hatten eine Erkältung, festgestellt anhand einer Infektion und subjektiver Wahrnehmungen und Empfindungen.
• Sowohl die nächtliche Schlafdauer als auch die Schlaf-Intensität (Schlafstörungen, Aufwachphasen, Zeit vom Zubettgehen bis zum Einschlafen) zeigten dann deutliche Einflüsse auf das Erkältungs-Risiko. Diese Effekte bestätigten sich dann auch in multivariaten Analysen, wenn eine Vielzahl anderer Faktoren (Alter, Gesundheitszustand, Gesundheitsverhalten, Wohlbefinden usw.) in die Analyse einbezogen wurde.
• Teilnehmer mit einer durchschnittlichen Schlafzeit von weniger als 7 Stunden waren in der Studie dreimal so oft (OR: 2,94) von einer Erkältung betroffen im Vergleich zu anderen mit 8 und mehr Stunden Schlaf.
• Ein noch deutlicherer Effekt zeigte sich für die Schlafintensität, also die Zeitanteile zwischen Zubettgehen und Aufstehen, die tatsächlich mit Schlaf verbracht wurden und nicht mit Umherwälzen oder Wachliegen. Hier zeigte sich: Personen, die maximal 92% ihrer nächtlichen Ruhezeit auch tatsächlich schlafen, haben ein 5,5mal so hohes Risiko für Erkältungen, verglichen mit effektiven Schläfern, die 98% oder mehr der nächtlichen Ruhe auch tatsächlich im Schlaf verbringen.
Abstract der Studie: Sheldon Cohen u.a.: Sleep Habits and Susceptibility to the Common Cold (Arch Intern Med. 2009;169(1):62-67)
Gerd Marstedt, 13.1.09
Vermeidung und Abbau von Übergewicht: Ist die Ernährung weitaus wichtiger als körperliche Bewegung?
 Eine gesündere Ernährung und zugleich mehr Sport und körperliche Bewegung - dies gilt seit einiger Zeit als Königsweg zur Gewichtsreduktion oder Vermeidung von Übergewicht. Nach Befunden einer jetzt veröffentlichten Studie könnte es jedoch sein, dass eine gesunde und kalorienarme Ernährung eine wesentlich größere Rolle zur Vermeidung ebenso wie zum Abbau von Übergewicht spielt als die andere empfohlene Komponente "Bewegung und Energieverbrauch". Wissenschaftler verglichen in ihrer Studie verschiedene Merkmale von 149 Frauen aus ländlichen Gegenden Nigerias und von 172 afro-amerikanischen Frauen aus dem Großraum Chicago, alle im Alter von 18-59 Jahren. Im Durchschnitt wogen die Chicagoer Frauen 184 Pfund (83,5 kg), die Frauen aus Nigeria im Vergleich dazu sehr viel weniger, nämlich nur 127 Pfund (57,7 kg).
Eine gesündere Ernährung und zugleich mehr Sport und körperliche Bewegung - dies gilt seit einiger Zeit als Königsweg zur Gewichtsreduktion oder Vermeidung von Übergewicht. Nach Befunden einer jetzt veröffentlichten Studie könnte es jedoch sein, dass eine gesunde und kalorienarme Ernährung eine wesentlich größere Rolle zur Vermeidung ebenso wie zum Abbau von Übergewicht spielt als die andere empfohlene Komponente "Bewegung und Energieverbrauch". Wissenschaftler verglichen in ihrer Studie verschiedene Merkmale von 149 Frauen aus ländlichen Gegenden Nigerias und von 172 afro-amerikanischen Frauen aus dem Großraum Chicago, alle im Alter von 18-59 Jahren. Im Durchschnitt wogen die Chicagoer Frauen 184 Pfund (83,5 kg), die Frauen aus Nigeria im Vergleich dazu sehr viel weniger, nämlich nur 127 Pfund (57,7 kg).
Die Forscher hatten erwartet, dass sie bei den deutlich schlankeren nigerianischen Frauen ein sehr viel höheres Maß an körperlicher Aktivität und Bewegung feststellen würden. Zu ihrer Überraschung fanden sie jedoch keinen signifikanten Unterschied zwischen den beiden Gruppen, was den Kalorienverbrauch durch körperliche Bewegung anbetrifft. Von daher fasste die Ernährungswissenschaftlerin Amy Luke, ein Mitglied des Forschungsteams, ihre Ergebnisse recht deutlich zusammen: "Die in vielen Gesellschaften heute deutlich niedrigere Intensität und Dauer körperlicher Bewegung ist vermutlich nicht primäre Ursache der zu beobachtenden Übergewichts-Epidemie."
"Menschen verbrennen mehr Kalorien, wenn sie sich körperlich betätigen. Aber dies gleichen sie dadurch aus, dass sie dann auch mehr essen. Wir würden uns freuen, wenn körperliche Aktivität einen positiven Effekt für das Körpergewicht hat. Aber leider scheint das nicht der Fall zu sein," erklärte Richard Cooper, Ko-Autor der Studie und Vorsitzender der Abteilung für Präventiv-Medizin und Epidemiologie.
Ernährung ist nach Ansicht des Forschungsteams wahrscheinlich eine relevantere Ursache von Übergewicht als körperliche Aktivität. Die Chicagoer Frauen wiegen deutlich mehr als die nigerianischen Frauen, obwohl sie sich im Ausmaß körperlicher Bewegung und im Kalorienverbrauch nicht unterscheiden. Andererseits gibt es jedoch deutliche Unterschiede in der Ernährung. Die nigerianische Ernährung ist reich an Ballaststoffen und Kohlenhydraten und arm an Fetten und tierischem Eiweiß. Im Gegensatz dazu enthält die Chicagoer Ernährung im Durchschnitt oft 40-45 Prozent Fett und viele Fast-Food-Artikel und Fertignahrung.
Allerdings scheinen mehr Forschungsanstrengungen nötig, um die Frage der Übergewichtsursachen genauer zu klären und den Anteil von genetischen sowie verhaltensbedingten Ursachen zu bestimmen. Das Ergebnis der Forschungsgruppe steht auch in gewissem Widerspruch zu einem früheren Befund: Eine Studie in der September-Ausgabe der Zeitschrift Archives of Internal Medicine (Physical Activity and the Association of Common FTO Gene Variants With Body Mass Index and Obesity) hatte festgestellt, dass ältere Mitglieder der Amish-Religionsgemeinschaft zwar ein Gen aufweisen, das mit Übergewicht in Verbindung gebracht wird. Gleichwohl weisen die Gruppenmitglieder jedoch fast immer ein Normalgewicht auf, und zwar deshalb, weil sie viel Sport und Bewegung haben.
Hier ist ein kostenloses Abtract: Kara E. Ebersole1 u.a.: Energy Expenditure and Adiposity in Nigerian and African-American Women (Obesity (2008) 16 9, 2148-2154. doi:10.1038/oby.2008.330)
Gerd Marstedt, 8.1.09
Gesunde oder ungesunde Ernährung: Maßgeblich ist auch die Angebotsstruktur der Lebensmittelgeschäfte und Restaurants
 Das Ernährungsverhalten ist nicht nur abhängig von erlernten Vorlieben und Gewohnheiten, sondern wird auch davon beeinflusst, welches Angebot an Nahrungsmitteln und Speisen es in Lebensmittelgeschäften und Restaurants des Wohnbezirks gibt - dies hat jetzt eine US-amerikanische Meta-Analyse von 54 Studien aufgezeigt. Alle Untersuchungen wurden im Zeitraum 1985-2008 veröffentlicht und behandelten in unterschiedlicher Form das Thema "Struktur der Lebensmittelgeschäfte und Restaurants im Stadtteil bzw. Wohnort und Zusammenhänge zum Ernährungsverhalten und Vorkommen von Übergewicht".
Das Ernährungsverhalten ist nicht nur abhängig von erlernten Vorlieben und Gewohnheiten, sondern wird auch davon beeinflusst, welches Angebot an Nahrungsmitteln und Speisen es in Lebensmittelgeschäften und Restaurants des Wohnbezirks gibt - dies hat jetzt eine US-amerikanische Meta-Analyse von 54 Studien aufgezeigt. Alle Untersuchungen wurden im Zeitraum 1985-2008 veröffentlicht und behandelten in unterschiedlicher Form das Thema "Struktur der Lebensmittelgeschäfte und Restaurants im Stadtteil bzw. Wohnort und Zusammenhänge zum Ernährungsverhalten und Vorkommen von Übergewicht".
Folgende Einzelergebnisse werden hervorgehoben, was Einkaufsmöglichkeiten für Lebensmittel anbetrifft:
• Supermärkte bieten (zumindest in den USA) im Unterschied zu kleineren Lebensmittelläden eine größere Auswahl an qualitativ guten und auch frischen Lebensmitteln an. Kleinere Lebensmittelgeschäfte sind nach Untersuchungen mehrerer US-Studien im Durchschnitt teurer, haben häufiger sehr kalorienreiche Lebensmittel im Angebot und weniger frische Produkte (Obst, Salat, Gemüse). Diese Befunde erklären dann auch teilweise, warum in anderen Studien mehrfach festgestellt wurde, dass die räumliche Nähe zu Supermärkten bzw. vergleichbaren Einkaufseinrichtungen im Wohnort oder Stadtteil auch mit einem gesünderen Ernährungsverhalten in Zusammenhang steht.
• Besonders deutlich gilt dies für ethnische Minderheiten. Eine Studie fand heraus, dass bei einer größeren Zahl von Supermärkten im Stadtteil oder Wohnort das Ernährungsverhalten bei Schwarzen deutlich häufiger als bei Weißen gesünder ist und Ernährungsleitlinien näher kommt.
• Der Zugang zu Supermärkten zeigt nicht nur Zusammenhänge zum Ernährungsverhalten, sondern auch zur Prävalenz von Übergewicht in der untersuchten Region. So fand eine große Studie mit 10.000 Teilnehmern in vier verschiedenen Bundesstaaten einen deutlichen Zusammenhang zwischen der Struktur der Lebensmittelgeschäfte (Anteil der Supermärkte) und dem Anteil Übergewichtiger in der jeweiligen Region. Dieser Befund hatte auch Bestand nach einer statistischen Kontrolle vieler anderer potentieller Einflussfaktoren (Rasse, Alter, Geschlecht, Einkommen, körperliche Bewegung usw.)
• Problematisch muss in diesem Zusammenhang dann erscheinen, dass sich kleinere Lebensmittelgeschäfte mit fehlendem oder schwachem Angebot an frischen Lebensmitteln, Gemüse und Obst häufiger in problematischen Stadtteilen niederlassen: in Gegenden mit sozial benachteiligten Bewohnern oder hohem Anteil Schwarzer. Ebenso fand man solche Läden sehr häufig in der Nähe von Schulen.
Auch die Studien zum Einfluss des jeweiligen Gastronomie-Angebots zeigten einige überraschende Befunde:
• Mehrere Untersuchungen haben belegt, dass ein häufiger Besuch von Restaurants (statt zu Hause zu essen) im Durchschnitt mit einer weniger gesunden Zusammensetzung der Speisen (Anteile von Fett, Salz, Ballaststoffen, Gemüse usw.) einhergeht.
• Dabei spielt auch der Preis eine Rolle: In einer sehr großen Studie mit über 70.000 Befragten wurde ermittelt, dass ein um 10 Prozent höherer Preis von Fast-Food-Mahlzeiten bedeutet, dass der Verzehr von frischem Gemüse und Obst um 3 Prozent höher ausfällt.
• Die Frage, ob die Zahl der Fast-Food-Restaurants in einem Bezirk auch verantwortlich ist für eine höhere Prävalenz von Übergewicht, ließ sich bislang nicht eindeutig beantworten. Einige Studien fanden solche Zusammenhänge, andere nicht.
• Ähnlich wie bei Lebensmittelgeschäften zeigt sich auch für Restaurants und Fast-Food-Restaurants im Besonderen, dass sie sich die Lage sehr genau aussuchen und dabei oft Gegenden mit hohem Anteil von Unterschicht-Angehörigen, bevorzugen die ohnehin schon höhere Erkrankungsrisiken aufweisen - aufgrund von Verhaltensweisen wie Rauchen, aber auch aufgrund schlechterer Wohn-, Arbeits- und Umgebungsbedingungen.
• Eine Studie im Großraum Los Angeles hat die Speisen von fast 700 Restaurants überprüft. Es zeigte sich, dass der Anteil an gesunden Speiseangeboten sehr viel größer in jenen Gegenden war, in denen mehr Oberschicht-Angehörige lebten.
• Problematisch erscheint auch, dass Fast-Food-Restaurants sich sehr häufig in der Nähe von Schulen niederlassen. 37 Prozent aller Schulen in den USA befinden sich in unmittelbarer Nachbarschaft zumindest eines Fast-Food-Restaurants. Und dabei lässt sich auch wiederum zeigen, dass diese sich sehr viel häufiger in Bezirken mit hohem Anteil von Unterschicht-Angehörigen befinden.
Die referierten Studien sind teilweise sicherlich beschränkt auf US-amerikanische Verhältnisse, und eine direkte Übertragung der Befunde auf Deutschland oder Europa fällt teilweise schwer. So kann man sicherlich die in der Veröffentlichung immer wieder genannten Gleichungen "Supermarkt = Angebot preisgünstiger frischer und gesunder Lebensmittel" versus "kleines Lebensmittelgeschäft = Angebot teurer, kalorienreicher Lebensmittel und Fertiggerichte" nicht übernehmen. Ein weiteres Problem ist darin zu sehen, dass die ausgewerteten Beobachtungs-Studien keinen Hinweis geben auf Kausalzusammenhänge: Schafft das Angebot an Lebensmitteln oder Restaurant-Speisen erst die jeweilige Nachfrage an ungesunden Speisen oder ist es eher umgekehrt?
Auch wenn Kommunalpolitiker nicht oder nur sehr begrenzt darüber befinden können, wo sich Restaurants oder Lebensmittelgeschäfte niederlassen, bleibt als Fazit der Meta-Analyse festzuhalten, dass die Verursachungszusammenhänge für eine ungesunde Ernährung und Übergewicht nicht nur an "schlechten Gewohnheiten" der Individuen festzumachen sind, sondern teilweise massiv verstärkt werden durch die lokale Infrastruktur der Anbieter von Lebensmitteln und Speisen.
Hier ist ein Abstract zur Studie: Nicole I. Larson u.a.: Neighborhood Environments: Disparities in Access to Healthy Foods in the U.S (American Journal of Preventive Medicine, Article in Press, Corrected Proof, Available online 1 November 2008)
Gerd Marstedt, 3.12.08
Ein gesundheitsriskanter Lebensstil ist mit einem fünfmal so hohen Mortalitätsrisiko verbunden
 Die Zahl der Studien, in denen Effekte des Rauchens, ungesunder Ernährung oder mangelnder körperlicher Bewegung auf spätere Erkrankungsrisiken oder auch Mortalitätsraten ermittelt worden sind, ist kaum mehr überschaubar. Erst in jüngster Zeit finden sich jedoch auch Studien, die den gesundheitlichen Lebensstil in einer etwas komplexeren Perspektive betrachten, also eine größere Zahl von Verhaltensrisiken gleichzeitig betrachten, so zum Beispiel die "Nurses' Health Study", eine 1976 begonnene Längsschnitt-Untersuchung, an der sich anfänglich rund 120.000 Krankenpflegerinnen im Alter von seinerzeit 30-55 Jahren beteiligten. Die Frauen füllten in jährlichem Rhythmus einen Fragebogen aus, in dem sie Auskunft gaben über viele Aspekte ihres Gesundheitszustands und Gesundheitsverhaltens. Für die jetzt veröffentlichte Studie wurden Daten aus den Jahren 1980-2004 benutzt. Eine Reihe von Teilnehmerinnen wurde aus den Analysen ausgeschlossen: Frauen, bei denen Krebs oder Herz-Kreislauferkrankungen festgestellt worden waren, die keinerlei Alkohol tranken oder einen sehr niedrigen Body Mass Index (BMI) aufwiesen.
Die Zahl der Studien, in denen Effekte des Rauchens, ungesunder Ernährung oder mangelnder körperlicher Bewegung auf spätere Erkrankungsrisiken oder auch Mortalitätsraten ermittelt worden sind, ist kaum mehr überschaubar. Erst in jüngster Zeit finden sich jedoch auch Studien, die den gesundheitlichen Lebensstil in einer etwas komplexeren Perspektive betrachten, also eine größere Zahl von Verhaltensrisiken gleichzeitig betrachten, so zum Beispiel die "Nurses' Health Study", eine 1976 begonnene Längsschnitt-Untersuchung, an der sich anfänglich rund 120.000 Krankenpflegerinnen im Alter von seinerzeit 30-55 Jahren beteiligten. Die Frauen füllten in jährlichem Rhythmus einen Fragebogen aus, in dem sie Auskunft gaben über viele Aspekte ihres Gesundheitszustands und Gesundheitsverhaltens. Für die jetzt veröffentlichte Studie wurden Daten aus den Jahren 1980-2004 benutzt. Eine Reihe von Teilnehmerinnen wurde aus den Analysen ausgeschlossen: Frauen, bei denen Krebs oder Herz-Kreislauferkrankungen festgestellt worden waren, die keinerlei Alkohol tranken oder einen sehr niedrigen Body Mass Index (BMI) aufwiesen.
Berücksichtigt wurden dann Daten von insgesamt 77.782 Frauen. Bei diesen wurden dann anhand der jährlichen Fragebogen-Erhebungen unterschiedliche Aspekte des Gesundheitsverhaltens ermittelt und die Frauen danach eingestuft, ob sie jeweils in eine Gruppe mit niedrigem Risiko einzuordnen waren. Die Kriterien für die fünf Risikofaktoren waren folgende:
• Ernährung: Hier wurden 7 Aspekte berücksichtigt, ob und wie oft man Obst zu sich nimmt, Gemüse/Salat, Nüsse und Soja, Ballaststoffe, die Relation von Fisch und Geflügel zu rotem Fleisch, Transfette, die Relation von ungesättigten zu gesättigten Fettsäuren.
• Rauchen: Ein niedriges Risiko wurde nur unterstellt für Nie-Raucher
• körperliche Bewegung: Ein Minimum von 30 Minuten zumindest mittlerer Bewegungsintensität am Tag
• Gewicht: BMI zwischen 18,5 und 25,0
• Alkohol: Maximal ein Glas am Tag (1-15g Alkohol)
Im Beobachtungszeitraum waren dann 8.882 Todesfälle feststellbar, darunter 4.527 aufgrund von Krebserkrankungen, 1.790 durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Alle fünf einbezogenen Risikofaktoren zeigten einzeln und für sich genommen einen statistisch signifikanten Einfluss auf das Mortalitätsrisiko. Besonders deutlich fielen die Unterschiede zwischen gesunder und gesundheitsriskanter Lebensweise jedoch aus, wenn man Extremgruppen miteinander verglich: Frauen mit 0 und Frauen mit 5 Risikofaktoren. Hier zeigte sich, dass die Sterbewahrscheinlichkeit bei besonders riskantem Lebensstil:
• 3,26mal so hoch war für Krebserkrankungen
• 8,17mal so hoch für Herz-Kreislauf-Erkrankungen
• 4,31mal so hoch für alle Todesfälle.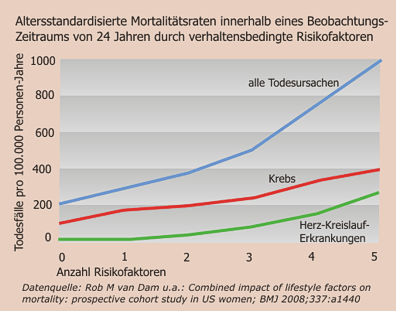
Geht man davon aus, dass in 100.000 Personen-Jahren bei Vorliegen von 0 Verhaltensrisiken 200 Todesfälle auftreten (vgl. Grafik), so ist diese Zahl dann bei 2 Risiken doppelt so hoch und bei 5 Risiken etwa 5mal so hoch. Bedeutsamster einzelner Risikofaktor war das Rauchen. Etwas mehr als die Hälfte aller Todesfälle konnte man zurückführen auf eine Kombination von vier Risiken: Übergewicht, Rauchen, keine Bewegung, ungesunde Ernährung. Die zusätzliche Berücksichtigung des Alkoholkonsums brachte keine Steigerung des Mortalitätsrisikos mehr.
Die Studie ist hier im Volltext kostenlos nachzulesen: Rob M van Dam u.a.: Combined impact of lifestyle factors on mortality: prospective cohort study in US women (BMJ, Published 16 September 2008, doi:10.1136/bmj.a1440)
Erst vor kurzem hatte eine andere Längsschnittstudie, in der vier bekannte Risikofaktoren gleichzeitig einbezogen wurden, gezeigt: Eine sehr gesunde Lebensweise bedeutet im Vergleich zu einem besonders riskanten Gesundheitsverhalten einen Unterschied von 14 Jahren Lebenserwartung. Diese Daten stammen aus der sogenannten "EPIC-Norfolk Prospective Population Study", einer Gemeindestudie aus Norfolk in England. Aus dieser Stichprobe wurden insgesamt 20.244 Männer und Frauen im Alter von 45-79 Jahren berücksichtigt, die zu Beginn nicht von einer Krebs- oder Herz-Kreislauf-Erkrankung betroffen waren. Die Studie begann 1993 und verfolgte den gesundheitlichen Werdegang der Studienteilnehmer bis zum Jahr 2006, als 1.987 Personen verstorben waren. vgl. ausführlicher: Körperliche Bewegung + Nichtrauchen + mäßig Alkohol + gesunde Ernährung = Gewinn an 14 Jahren Lebenserwartung
Gerd Marstedt, 30.11.08
BzgA findet unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen weniger Raucher, die Quote der "Kampftrinker" bleibt jedoch konstant
 Die Raucherquote unter Jüngeren (12-25 Jahre) ist seit dem Jahre 2004 ständig gesunken und mit ihr auch die Zahl derjenigen, die Cannabis probiert haben. Was der Drogenbeauftragten der Bundesregierung, Sabine Bätzing, und ebenso der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung nach wie vor Kopfschmerzen bereitet, ist jedoch, dass im Kampf gegen das "Kampftrinken" ("binge drinking") wenig Erfolge zu verzeichnen sind. Die Quote derjenigen Jugendlichen, die in den letzten 30 Tagen mindestens einmal exzessiv Alkohol konsumiert haben (fünf alkoholische Getränke oder mehr hintereinander) ist im Zeitraum von 2004 (22,6%) bis 2008 (20,4%) nahezu konstant geblieben.
Die Raucherquote unter Jüngeren (12-25 Jahre) ist seit dem Jahre 2004 ständig gesunken und mit ihr auch die Zahl derjenigen, die Cannabis probiert haben. Was der Drogenbeauftragten der Bundesregierung, Sabine Bätzing, und ebenso der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung nach wie vor Kopfschmerzen bereitet, ist jedoch, dass im Kampf gegen das "Kampftrinken" ("binge drinking") wenig Erfolge zu verzeichnen sind. Die Quote derjenigen Jugendlichen, die in den letzten 30 Tagen mindestens einmal exzessiv Alkohol konsumiert haben (fünf alkoholische Getränke oder mehr hintereinander) ist im Zeitraum von 2004 (22,6%) bis 2008 (20,4%) nahezu konstant geblieben.
Dies sind die Kernaussagen der jetzt veröffentlichten Repräsentativerhebung "Drogenaffinität Jugendlicher in der Bundesrepublik Deutschland" der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). Befragt wurden in im Februar und März 2008 in Telefoninterviews rund 3000 Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 12 bis 25 Jahren. Ergebnisse im Einzelnen:
• Von 1979 bis Anfang der 1990er Jahre ging der Anteil rauchender Jugendlicher zurück. 1979 lag diese Quote bei 33% (Männer) und 27% (Frauen). Nach einem deutlichen Anstieg seit 1993 lässt sich ab dem Jahr 2001 wieder ein starker Rückgang beobachten. Dieser Rückgang vollzieht sich seit dem Jahr 2001 sowohl bei den männlichen als auch bei den weiblichen Jugendlichen. Aktuell liegt die Raucherquote nur noch bei 15% bzw. 16 %. Die Zahl der "Nieraucher" ist von 2004 bis 2008 von 40 auf 60 Prozent angestiegen.
• Unverändert ist dagegen die Verbreitung des Shisha-Rauchens (Wasserpfeife). Knapp 40 Prozent der 12- bis 17-Jährigen haben schon einmal in ihrem Leben eine Shisha geraucht, im Vorjahr waren es 14 Prozent. Ob sich das Shisha-Rauchen bei einem Teil der Jugendlichen zu einer ernst zu nehmenden Alternative zum Tabakrauchen entwickelt, ist unklar.
• Alkohol ist bei den Heranwachsenden derzeit das am meisten verbreitete Suchtmittel. Bei den 12 bis 17-Jährigen tranken 2008 noch 17,4 Prozent regelmäßig Alkohol, 2004 waren es 21,2 Prozent. Obwohl der größte Teil der 12- bis 17-Jährigen nach dem Jugendschutzgesetz eigentlich gar keinen Alkohol trinken dürfte, tranken im Jahr 2008 etwa 20 Prozent von ihnen im vergangenen Monat mindestens bei einer Gelegenheit 5 oder sogar mehr Gläser Alkohol. Dieser Trend zum exzessiven Trinken, das sog. "Binge Drinking", ist weiterhin ungebrochen.
• Nach vielen Jahren des Anstiegs ist der Cannabiskonsum zwischen 2004 und 2008 ein wenig rückläufig, was vermutlich mit dem Rückgang der Raucherquote zusammenhängt. 2004 hatten noch 31 Prozent der 12- bis 25-Jährigen schon einmal Cannabis probiert, 2008 sind es noch 28 Prozent. Bei den 12- bis 17- Jährigen ging im gleichen Zeitraum der Anteil von 15 Prozent auf knapp 10 Prozent zurück. Der Anteil junger Menschen mit regelmäßigem Cannabiskonsum liegt jedoch insgesamt nur bei 1 Prozent der Minderjährigen und 2 Prozent der 12- bis 25-Jährigen.
• Eine Pressemitteilung der Drogenbeauftragen der Bundesregierung und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung ist hier: Ausgeraucht - aber oft betrunken!
• Der Kurzbericht (PDF, 14 Seiten) ist hier: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, BZgA, Köln: Die Drogenaffinität Jugendlicher in der Bundesrepublik Deutschland 2008
Gerd Marstedt, 16.11.08
Englische Studie: Mehr Parks und Grünanlagen in ärmeren Wohngegenden könnten gesundheitliche Ungleichheit verringern
 Untersucht man bei der gesamten englischen Bevölkerung, die noch nicht im Rentenalter ist, also bei knapp 41 Millionen Personen nur zwei Merkmale, nämlich die Einkommenshöhe und die Nähe der Wohnung zu Parks und Grünflächen, dann zeigt sich: Die Gesamt-Mortalität fällt auch innerhalb derselben Einkommensgruppen bei jenen Personen deutlich niedriger aus, die in der Nähe von Grünflächen wohnen. Und noch deutlicher sieht dieser Befund aus bei der Sterblichkeit infolge von Herz-Kreislauferkrankungen. Mehr Parks und Grünanlagen in ärmeren Wohngegenden, so eine Schlussfolgerung der jetzt in der Zeitschrift "Lancet" veröffentlichten Studie, könnten also zur Verringerung sozialer Ungleichheit beitragen.
Untersucht man bei der gesamten englischen Bevölkerung, die noch nicht im Rentenalter ist, also bei knapp 41 Millionen Personen nur zwei Merkmale, nämlich die Einkommenshöhe und die Nähe der Wohnung zu Parks und Grünflächen, dann zeigt sich: Die Gesamt-Mortalität fällt auch innerhalb derselben Einkommensgruppen bei jenen Personen deutlich niedriger aus, die in der Nähe von Grünflächen wohnen. Und noch deutlicher sieht dieser Befund aus bei der Sterblichkeit infolge von Herz-Kreislauferkrankungen. Mehr Parks und Grünanlagen in ärmeren Wohngegenden, so eine Schlussfolgerung der jetzt in der Zeitschrift "Lancet" veröffentlichten Studie, könnten also zur Verringerung sozialer Ungleichheit beitragen.
Zwei schottische Wissenschaftler haben sehr unterschiedliche Datensätze zusammengefügt. Zunächst erfassten sie bei der englischen Bevölkerung vor dem Rentenalter anonymisierte Daten über Todesfälle und Todesursachen. Bei diesen Datensätzen war jedoch jeweils angegeben, in welchem kleinräumigen Bezirk oder Areal der Verstorbene gewohnt hatte. Das gesamte United Kingdom ist in diese Areale aufgeteilt, sogenannte "lower level super output areas (LSOA)", die jeweils etwa 4 Quadratkilometer und im Durchschnitt 1.500 Personen umfassen. In einem Register ist für jedes einzelne Areal festgehalten, wie groß die naturbelassene Fläche (Parks, Wälder, Flussebenen, Wiesen) ist. Entsprechend dieser Angabe wurden die Areale in fünf Gruppen aufgeteilt, von sehr niedriger oder fehlender Grünfläche bis hin zu sehr großer Grünfläche.
Darüber hinaus schätzten die Wissenschaftler das für die einzelne Areale jeweils durchschnittliche Einkommensniveau - wie dies genau und im Einzelnen erfolgte, geht aus der Veröffentlichung leider nicht hervor. Diese Daten der LSOAs: Einkommenshöhe, Größe der Grünfläche als Einflussfaktoren und Todesfälle bzw. krankheitsspezifische Todesfälle wurden dann in Beziehung gesetzt.
Als Ergebnis zeigte sich: Die Unterschiede zwischen armen und reichen Wohngegenden lassen sich auch an den Sterblichkeitsraten ablesen. Jedoch ist dieser Unterschied weitaus deutlicher in Gegenden mit wenig öffentlichem Grün, und sehr viel schwächer ausgeprägt in Arealen mit sehr viel Wäldern und Parks. Konkret:
• Bei der Gesamt-Sterblichkeit betrug die Inzidenzrate (IRR, Quote der Todesfälle) in den grünen Wohngegenden 1,43 und in den weniger grünen Wohngegebenen 1,93.
• Berücksichtigte man nur Herz-Kreislauf-Erkrankungen, waren die Unterschiede zwischen arm und reich noch deutlicher: Die IRR betrug 1,54 in den grünen und 2,19 in den weniger grünen Arealen.
Eine Erklärung sehen die Forscher Richard Mitchell und Frank Popham in unterschiedlichen Freizeitmöglichkeiten, die es Bewohnern grüner Bezirke eher erlauben, Sport zu betreiben oder sich von beruflichem Stress zu erholen. Mehr Parks und Grünflächen in ärmeren Wohngegenden wären nach ihrer Ansicht daher ein nachhaltiger Beitrag zur Gesundheitsförderung.
Die Studie ist nach kostenloser Registrierung im "Lancet" auch im Volltext verfügbar: Richard Mitchell, Frank Popham: Effect of exposure to natural environment on health inequalities: an observational population (The Lancet, Volume 372, Issue 9650, Pages 1655 - 1660, 8 November 2008)
Die große Zahl der hier berücksichtigten Daten und die Stichprobengröße mag zunächst beeindrucken und den Ergebnisse eine hohe Zuverlässigkeit bescheinigen. Tatsächlich könnte in der Studie wieder einmal nur eine Scheinkorrelation erfasst worden sein. Denn mit der Einkommenshöhe ist zwar ein wichtiger Einflussfaktor, aber keineswegs der einzige kontrolliert worden. So wäre es nicht überraschend, wenn in den grüneren Wohngegenden nicht nur die Einkommensstärkeren zu finden sind, sondern auch jene, die mehr Wert legen auf einen gesundheitsbewussten Lebensstil (Rauchen, Bewegung, Ernährung). Ob dem so ist, wäre nur durch differenziertere Analysen nachweisbar.
Dass Interventionen nicht ganz so einfach nach dem vorgeschlagenen Muster verlaufen: "Mehr Parks und Grünflächen motivieren Bewohner zu mehr Sport und Bewegung, was sich dann in besserer Gesundheit niederschlägt", hat unlängst eine niederländische Studie gezeigt. Knapp 5.000 Personen waren dort befragt worden über ihr Ausmaß an Sport und körperlicher Bewegung, ihren sozialen Status und ihren Gesundheitszustand sowie die Größe der Grünflächen innerhalb eines Radius von einem Kilometer um ihre Wohnung und innerhalb von drei Kilometern. Das Ergebnis verlief hier sogar gegenteilig zu den Erwartungen: Personen, denen mehr Grünflächen in der Nähe zur Verfügung standen, zeigten in deutlich geringerem Umfang, dass sie Fahrrad fahren oder zu Fuß gehen, sowohl was die Häufigkeit als auch, was den Zeitumfang abetrifft. Dafür allerdings - und dies erklärt in großem Umfang das Ergebnis - verbrachten sie mehr Zeit mit Gartenarbeit.
Diese Studie ist im Volltext kostenlos verfügbar: Jolanda Maas, Robert A Verheij, Peter Spreeuwenberg, Peter P Groenewegen: Physical activity as a possible mechanism behind the relationship between green space and health: A multilevel analysis (BMC Public Health 2008, 8:206doi:10.1186/1471-2458-8-206)
Gerd Marstedt, 13.11.08
Viel zu viele Kalorien - Kindermenüs in Fastfoodketten
 93 Prozent der Kindermenüs in den großen Fastfoodketten enthalten zu viele Kalorien. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung des Center for Science in the Public Interest, in der die Ernährungsqualität von Kindermenüs der umsatzstärksten Fastfoodketten analysiert wurden. 13 der 19 kontaktierten Unternehmen stellten im Juni 2008 die Angaben zur Zusammensetzung ihrer Speisen zur Verfügung. Grundlage der Bewertung waren nationale Ernährungsstandards, die sich auf die Kalorienzahl, den Gesamtfettgehalt, den Anteil gesättigter Fette und Transfette, Zuckerzusatz, Kochsalz und Nährstoffgehalt beziehen.
93 Prozent der Kindermenüs in den großen Fastfoodketten enthalten zu viele Kalorien. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung des Center for Science in the Public Interest, in der die Ernährungsqualität von Kindermenüs der umsatzstärksten Fastfoodketten analysiert wurden. 13 der 19 kontaktierten Unternehmen stellten im Juni 2008 die Angaben zur Zusammensetzung ihrer Speisen zur Verfügung. Grundlage der Bewertung waren nationale Ernährungsstandards, die sich auf die Kalorienzahl, den Gesamtfettgehalt, den Anteil gesättigter Fette und Transfette, Zuckerzusatz, Kochsalz und Nährstoffgehalt beziehen.
Statt der empfohlenen maximal 430 Kalorien enthält ein Kindermenü der Kette Chili's aus frittierten Hühnchenteilen ("country-fried chicken crispers"), Zimtäpfeln und Schokoladenmilch 1.020 Kalorien - der höchste erzielte Wert der Untersuchung.
Auch die Kombinationen von McDonalds (Happy meal), Burger King und Wendy's lagen zu mehr als 90 Prozent über der empfohlenen Grenze, Kentucky Fried Chicken zu 89 Prozent. 45 Prozent der Kindermenüs enthalten zudem einen zu hohen Anteil von gesättigten Fetten und Transfetten, 86 Prozent zu viel Kochsalz.
Gute Noten erhielt nur die Kette Subway's, von deren Kindermenüs nur 33 Prozent die 430-Kalorien-Grenze überschreiten. Subway ist zudem die einzige Kette, die keine Softdrinks in Verbindung mit den Kindermenüs anbietet.
Erwachsene schätzen den Kaloriengehalt von Fastfoodangeboten häufig falsch ein. Die Autoren empfehlen daher die Angabe der Kalorienzahl auf den Speisekarten bzw. den Menüboards über den Verkaufstresen. Bei Subway's führte dies im Rahmen einer Studie zu einer Minderung pro Bestellung von 53 Kalorien. Weitere Empfehlungen lauten: Gemüse und Obst anstelle von Pommes frittes als Beilage, fettarme Milch und Wasser anstelle von zuckerhaltiger Limonade. Bestehen derartige Optionen bestellen 70 Prozent der Eltern die gesündere Mahlzeit für ihre Kinder.
Ein Drittel der täglichen Kalorien nehmen Kinder in den USA außer Haus auf, doppelt so viel wie vor 30 Jahren. Eine Mahlzeit außer Haus enthält etwa doppelt so viele Kalorien im Vergleich zur Mahlzeit zu Hause.
• Studie zum Download Kids' Meals: Obesity on the Menu
• Centers for Science in the Public Interest
• Mehr zur Kennzeichnung von Mahlzeiten
David Klemperer, 9.11.08
Finnische Verlaufsstudie: Rauchen im höheren Lebensalter senkt Lebensqualität und Lebenserwartung nachhaltig
 Wie bei vielen anderen gesundheitlichen Phänomenen offenbart oft erst eine personenbezogene Längsschnittsanalyse das tatsächliche Volumen und die Artbreite der gesundheitlichen Risiken bestimmter Handlungen. Dies gilt auch für die Auswirkungen des Tabakkonsums, die in einer Gruppe von 1.658 weißen und männlichen finnischen Bürgern, die zu Beginn der Studie rund 48 Jahre alt waren und im Lauf der Jahre öfter befragt wurden ob sie rauchten oder nicht und wie es ihnen gesundheitlich, über 26 Jahre hinweg gemessen wurden. Die Teilnehmer der Studie waren sich sozioökonomisch relativ ähnlich, da sie alle auch Teilnehmer in der "Helsinki Businessmen Study" waren.
Wie bei vielen anderen gesundheitlichen Phänomenen offenbart oft erst eine personenbezogene Längsschnittsanalyse das tatsächliche Volumen und die Artbreite der gesundheitlichen Risiken bestimmter Handlungen. Dies gilt auch für die Auswirkungen des Tabakkonsums, die in einer Gruppe von 1.658 weißen und männlichen finnischen Bürgern, die zu Beginn der Studie rund 48 Jahre alt waren und im Lauf der Jahre öfter befragt wurden ob sie rauchten oder nicht und wie es ihnen gesundheitlich, über 26 Jahre hinweg gemessen wurden. Die Teilnehmer der Studie waren sich sozioökonomisch relativ ähnlich, da sie alle auch Teilnehmer in der "Helsinki Businessmen Study" waren.
Die in der Ausgabe der us-amerikanischen Fachzeitschrift "Archives of Internal Medicine" (Arch Intern Med. 2008;168(18):1968-1974) unter dem Titel "The Effect of Smoking in Midlife on Health-Related Quality of Life in Old Age. A 26-Year Prospective Study" veröffentlichten Ergebnisse zeigen folgende Effekte im weiteren Lebensverlauf der Raucher und Nichtraucher:
• Rund ein Fünftel der Gruppe starben während der follow-up-Zeit, d.h. vor ihrem vierundsiebzigsten Lebensjahr.
• Diejenigen, die nie geraucht hatten (n=614), lebten über 10 Jahre länger als ihre MitbürgerInnen, die mehr als eine Packung Zigaretten pro Tag rauchten (n=188).
• Unter denjenigen, die die 26 Jahre überlebten (n=1.131), standen die Niemals-Raucher bei den wichtigsten Indikatoren der Lebensqualität (die so genannte "health-related quality of life [HRQoL]", die mit dem Instrument des "RAND 36-Item Health Survey" erhoben wurde, die dem Instrument des "Medical Outcomes Study Short-Form Health Survey") wie beispielsweise dem physischen Zustand oder körperliche Schmerzen, signifikant besser da. Dies relativiert oder widerlegt sogar eine bisher oft gehegte Befürchtung, länger lebende Nicht(mehr)raucher wären in der Überlebenszeit kränker und hätten eine schlechte Lebensqualität.
• Die Lebensqualität hing direkt mit der Anzahl der gerauchten Zigaretten, d.h. der Dosis zusammen: Die Lebensqualität sank umso stärker wie die Anzahl der Zigaretten anstieg.
• Letzteres stützt die fast schon verständnisvoll auf die Abhängigkeitsprobleme von Rauchern reagierende Position der ForscherInnen, auch ein "cutting back" der Zigarettenmenge wäre schon nützlich.
Ein Abstract des 10-Seiten-Aufsatzes "The Effect of Smoking in Midlife on Health-Related Quality of Life in Old Age. A 26-Year Prospective Study" von Arto Y. Strandberg, Timo E. Strandberg, Kaisu Pitkälä, Veikko V. Salomaa, Reijo S. Tilvis und Tatu A. Miettinen ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 23.10.08
Antioxidative Nahrungsergänzungsmittel fast sämtlich nicht zur Prävention von Darmkrebs tauglich oder sogar potenziell gefährlich
 Oxidativer Stress, d.h. ein unterdurchschnittlicher Gehalt antioxidativer Stoffe im Blutplasma, in dessen Folge die Wahrscheinlichkeit toxischer Effekte auf gesunde Zellen z. B. durch freie Radikale wächst, gilt u.a. als eine Ursache von Krebserkrankungen des Verdauungssystems. Parallel zu dieser Erkenntnis verbreitet sich die natürlich durch die Hersteller dieser zum Teil hochpreisigen Mittel genährte Hoffnung, gastrointestinale Krebserkrankungen durch die Auf- oder Einnahme antioxidativer Nahrungsergänzungsmittel verhindern zu können. Einzelne Studien hatten aber bereits in der Vergangenheit immer wieder Zweifel an dieser Art von Wirksamkeit geäußert und außerdem auf mögliche unerwünschte und gefährliche Nebenwirkungen ihrer Einnahme hingewiesen.
Oxidativer Stress, d.h. ein unterdurchschnittlicher Gehalt antioxidativer Stoffe im Blutplasma, in dessen Folge die Wahrscheinlichkeit toxischer Effekte auf gesunde Zellen z. B. durch freie Radikale wächst, gilt u.a. als eine Ursache von Krebserkrankungen des Verdauungssystems. Parallel zu dieser Erkenntnis verbreitet sich die natürlich durch die Hersteller dieser zum Teil hochpreisigen Mittel genährte Hoffnung, gastrointestinale Krebserkrankungen durch die Auf- oder Einnahme antioxidativer Nahrungsergänzungsmittel verhindern zu können. Einzelne Studien hatten aber bereits in der Vergangenheit immer wieder Zweifel an dieser Art von Wirksamkeit geäußert und außerdem auf mögliche unerwünschte und gefährliche Nebenwirkungen ihrer Einnahme hingewiesen.
Um dies gesichert bewerten zu können, führte eine internationale Forschergruppe bzw. Cochrane-Gruppe im Rahmen alle bisher dazu vorliegenden randomisierten kontrollierten Studien aus verschiedenen Forschungsregistern und -dokumentationen zusammen und erstellte Mitte diesen Jahres einen der qualitativ höchstwertigsten Cochrane-Reviews, der jetzt unter dem Titel "Antioxidant supplements for preventing gastrointestinal cancer" in der Cochrane Library (Cochrane Database Syst Rev. 2008 16. Juli; (3): CD004183) erhältlich ist.
Im Mittelpunkt des Interesses standen 20 durchweg qualitativ hochwertige RCT-Studien mit 211.818 TeilnehmerInnen, in denen die Effekte der Einnahme der als antioxidativ angesehenen Stoffe Beta-Karotin, Vitamin A, Vitamin C, Vitamin E und Selen im Vergleich zu Placebos gemessen wurden. Zu den Effekten gehören Krebserkrankungen des Magen-Darmtraktes, die Gesamtsterblichkeit der Untersuchten und das Auftreten unerwünschter Wirkungen. Gemessen wurde jeweils das relative Risiko (RR) des Auftretens.
Die Ergebnisse sahen folgendermaßen aus:
• Insgesamt hatten antioxidative Nahrungszusätze keinen statistisch signifikanten Effekt der untersuchten Stoffe auf die Krebserkrankungen des Magen-Darmtrakts (RR 0,94, 95 % Konfidenzintervall 0,83 bis 1,06).
• Wie das Konfidenzintervall bereits anzeigt, gibt es aber je nach Stoff eine gewisse Heterogenität der Effekte: So erhöht sich unter der Einnahme von Beta-Karotin potenziell das spezifische Krebsrisiko während es durch Selen potenziell abnimmt.
• In einem von mehreren Wirkungsmodellen hatten alle Zusatzstoffe einen signifikant erhöhenden Effekt auf die Gesamtmortalität. Betakarotin erhöht (RR 1,16) in Kombination mit Vitamin das allgemeine Mortalitätsrisiko, was ebenfalls für die alleinige Einnahme von Vitamin E festgestellt wurde (RR 1,06). Insgesamt starben 17.114 der 122.501 TeilnehmerInnen an den Studien (14.0%), die per Zufall der Antioxidantien-Einnahmegruppe zugewiesen wurden und 8.799 der 78.693 TeilnehmerInnen (11.2%), die per Zufall in der Placebogruppe war.
• Zu den unerwünschten Effekten gehören außerdem eher harmlose Erscheinungen wie z. B. die Gelbverfärbung der Haut nach der Zuführung von Betakarotin. - In 5 Studien, die allerdings alle mit dem Risiko starker Verzerrungen behaftet sind, trug allerdings Selen schließlich signifikant zur Senkung des Auftretens von Magen-Darm-Krebserkrankungen bei (RR 0,59).
Die Cochrane-Forschergruppe fasst ihre Einzelergebnisse so zusammen: "We could not find convincing evidence that antioxidant supplements prevent gastrointestinal cancers. On the contrary, antioxidant supplements seem to increase overall mortality. The potential cancer preventive effect of selenium should be tested in adequately conducted randomised trials." Dies bedeutet nicht, dass sämtliche oder einzelne dieser Stoffe nicht gegen die eine oder andere Erkrankung oder Befindlichkeitsstörung präventiv hilfreich sein können, nur als Mittel, um Magen-Darmkrebs zu verhindern, sollten sie weder angepriesen noch eingenommen werden.
Eine Zusammenfassung der Ergebnisse des Intervention Review "Antioxidant supplements for preventing gastrointestinal cancers" von Goran Bjelakovic, Dimitrinka Nikolova, Rosa G Simonetti und Christian Gluud ist kostenlos in der Cochrane Library erhältlich. Wer entsprechende Zugriffsrechte besitzt, kann von der Seite des Abstracts auch auf den gesamten Inhalt des Review zugreifen.
Bernard Braun, 19.10.08
Gesundheit steckt an - Nichtrauchen kein einsamer Entschluss
 In einer im New England Journal of Medicine veröffentlichten Studie untersuchten Nicholas Christakis und James Fowler die Frage, wie sich Personen in ihrem Raucherverhalten gegenseitig beeinflussen.
In einer im New England Journal of Medicine veröffentlichten Studie untersuchten Nicholas Christakis und James Fowler die Frage, wie sich Personen in ihrem Raucherverhalten gegenseitig beeinflussen.
Ihre Daten gewannen sie aus der Framingham-Studie, einer prospektiven Kohortenstudie, die im Jahr 1948 initiiert wurde und unter Einschluss neuer Gruppen bis heute fortgeführt wird.
Die Forscher erhoben Daten von 12.067 Erwachsenen im Alter von 21 bis 70 Jahren. Die Teilnehmer wurden zwischen 1973 und 1999 alle 3 Jahre nach ihren Rauchgewohnheiten und ihren sozialen Kontakten befragt, erhoben wurden auch Bildung und geographische Nähe zu den Kontakten. Für die Studie wurden letztlich die Angaben von 5.124 Personen ausgewertet, die insgesamt 53.228 soziale Verbindungen angaben, entsprechend 10,4 Verbindungen pro Person.
Es zeigte sich, dass Raucher und Nichtraucher Cluster bilden, d.h. dass Raucher mit höherer Wahrscheinlichkeit Kontakte zu Rauchern haben und Nichtraucher eher zu Nichtrauchern.
Die Änderung des Rauchverhaltens steht in engem Verhältnis zu dem Verhalten der Mitglieder des sozialen Netzwerks. Hörte ein Ehepartner mit dem Rauchen auf, nahm die Wahrscheinlichkeit, dass der andere weiterrauchte um 67 Prozent ab. Hörte ein Bruder oder eine Schwester auf betrug diese Wahrscheinlichkeit 25 Prozent, bei einem Freund 36 Prozent und bei Arbeitskollegen in Kleinfirmen 34 Prozent. Für Freunde gilt, dass eine höhere Bildung mit einem stärkeren Einfluss einhergeht. Zu beobachten war auch, dass im Untersuchungszeitraum die Verbindungen zwischen den Netzwerken von Rauchern und Nichtrauchern abnahmen und die Personen, die weiter rauchten eher an den Rand des Netzwerkes gerieten.
Die Forscher schließen daraus, dass der Entschluss zum Nichtrauchen keine einsame Entscheidung isolierter Personen ist sondern im Sinne gruppendynamischer Prozesse sich von einer Person auf die andere überträgt und in sozialen Gruppen bzw. Netzwerken kaskadenförmig erfolgt. Dieses Phänomen wurde insbesondere innerhalb von Familien und Betrieben beobachtet, wobei der Effekt in kleinen Betrieben mit engeren Kontakten stärker als in großen Betrieben ist.
Für Sozialwissenschaftler und Sozialpsychologen mögen diese Ergebnisse nicht überraschend sein. Offensichtlich erscheint jedoch, dass dieses Wissen um die soziale Dynamik von Gesundheitsverhalten in Konzepten der Prävention und Gesundheitsförderung noch nicht ausreichend genutzt und in Interventionen und Kampagnen umgesetzt wird. Die damit zu erzielenden Gesundheitsgewinne dürften erheblich sein.
Die soziale Dynamik gilt nicht nur für das Rauchverhalten - in einer im Juli 2007 veröffentlichten Studie hatten die selben Autoren durch Untersuchung der selben Kohorte bereits gezeigt, dass sich auch die Zunahme des Übergewichts innerhalb von sozialen Netzwerken ausgebreitet hat (Bericht im Forum Gesundheitspolitik).
Abstract der Studie "The Collective Dynamics of Smoking in a Large Social Network". New England Journal of Medicine 22. Mai 2008
Bericht über die Studie im NHS Knowledge Service (englisch)
Abstract der Studie über die Ausbreitung des Übergewichts (The Spread of Obesity in a Large Social Network over 32 Years). New England Journal of Medicine vom 26. Juli 2007.
David Klemperer, 28.5.2008
Zu wenig Schlaf und zu viel Schlaf hängt gleichermaßen zusammen mit gesundheitlich riskanten Verhaltensweisen
 In der "Whitehall II Studie", einer Verlaufsstudie mit über 10.000 englischen Angestellten, war bereits vor kurzem festgestellt worden: Teilnehmer, die ihren Schlaf von 7 auf 5 Stunden gesenkt hatten, zeigten danach ein 1,7fach erhöhtes Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen und ein 2,0mal so hohes Sterberisiko. Aber auch diejenigen, die ihre nächtliche Ruhe auf 8 Stunden oder mehr erhöht hatten, wiesen ein doppelt so hohes Mortalitätsrisiko auf. Vor allem das Ergebnis, dass auch eine längere Schlafdauer ungünstig ist, hatte die Wissenschaftler ratlos gemacht. (vgl. Kurze Schlafdauer verdoppelt das Sterblichkeitsrisiko - aber auch zu viel Schlaf ist problematisch)
In der "Whitehall II Studie", einer Verlaufsstudie mit über 10.000 englischen Angestellten, war bereits vor kurzem festgestellt worden: Teilnehmer, die ihren Schlaf von 7 auf 5 Stunden gesenkt hatten, zeigten danach ein 1,7fach erhöhtes Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen und ein 2,0mal so hohes Sterberisiko. Aber auch diejenigen, die ihre nächtliche Ruhe auf 8 Stunden oder mehr erhöht hatten, wiesen ein doppelt so hohes Mortalitätsrisiko auf. Vor allem das Ergebnis, dass auch eine längere Schlafdauer ungünstig ist, hatte die Wissenschaftler ratlos gemacht. (vgl. Kurze Schlafdauer verdoppelt das Sterblichkeitsrisiko - aber auch zu viel Schlaf ist problematisch)
Zur Auflösung der damit verbundenen Fragen trägt jetzt möglicherweise eine neue Studie bei, die Interview-Daten von 87.000 US-Bürgern aus den Jahren 2004-2006 ausgewertet hat. Die vom "National Center for Health Statistics", einer Einrichtung der "Centers for Disease Control and Prevention" durchgeführte Studie fand dabei auffällige Zusammenhänge zwischen sehr kurzer und sehr langer Schlafdauer einerseits und problematischen gesundheitlichen Verhaltensweisen bzw. Risiken (Rauchen, Bewegungsmangel, Alkoholkonsum, Übergewicht) andererseits.
Die Studie fand im Einzelnen heraus:
• Für 63% der US-Amerikaner im Alter über 18 ist eine Schlafdauer von 7-8 Stunden die Norm, für 20% etwa 6-7 Stunden. Jeweils etwa jeder zehnte schläft weniger als 6 Stunden oder 9 Stunden und länger.
• Rauchen und Schlaf: 21% der Amerikaner sind tägliche Raucher. Diese Quote variiert jedoch, und hängt mit der Schlafdauer zusammen. Am niedrigsten (18%) ist die Raucherquote bei normaler Schlafdauer (7-8 Stunden), am höchsten bei weniger als 6 Stunden Schlaf (31%). Aber auch bei langer Schlafzeit (über 9 Stunden) ist die Raucherquote höher (26%).
• Schlaf und Alkohol: Hier zeigt sich ein ganz ähnlicher Zusammenhang wie für das Rauchen, auch wenn die Effekte quantitativ nicht ganz so stark ausfallen.
• Bewegungsmangel: Auch für diese Facette des Gesundheitsverhaltens zeigen sich statistische Zusammenhänge zu den Schlafgewohnheiten. Fehlende körperliche Bewegung zeigt sich bei weniger als 6 Stunden Schlaf bei 44%, bei 9 und mehr Stunden Schlaf bei 48%. Im Vergleich dazu liegen die Quoten bei mittlerer Schlafdauer (6-8 Stunden) mit 38% deutlich niedriger.
• Adipositas: Die Daten hierzu zeigen einen ähnlichen Trend. Die höchste Quote Adipöser zeigt sich mit 33% bei einer Schlafdauer von unter 6 Stunden, die niedrigste Quote (22%) bei 7-8 Stunden.
Die Studie kann zwar, wie die Wissenschaftler auch selbst hervorheben, keine Kausal-Zusammenhänge aufzeigen. Sie vermittelt jedoch einen überaus interessanten Einblick in strukturelle Zusammenhänge zwischen unterschiedlichen Aspekten des Gesundheitsverhaltens.
Ein Überblick über die wichtigsten Ergebnisse (einschl. Tabellen und Diagramme) ist hier zu finden: Charlotte A. Schoenborn, Patricia F. Adams: Sleep Duration as a Correlate of Smoking, Alcohol Use, Leisure-Time Physical Inactivity, and Obesity Among Adults: United States, 2004-2006 (National Center für Health Statistics, Publications and Information Products)
Gerd Marstedt, 12.5.2008
Sport und körperliche Aktivität: Nicht nur abhängig von individueller Motivation, sondern auch von Rahmenbedingungen im Stadtteil
 Die Motivierung der Bevölkerung zu mehr Sport und körperlicher Bewegung gilt als ein Schlüsselkonzept der Gesundheitsförderung und als wesentliche Voraussetzung zur Bekämpfung der Übergewichts- und Adipositas-Problematik. Die dazu vorgelegten Interventions-Konzepte beschränken sich aber weithin immer noch auf Informationskampagnen und Appelle ("3000 Schritte extra", "Fit statt fett"). Dass die individuelle Motivation zu mehr körperlicher Bewegung ganz wesentlich aber auch von objektiven Faktoren, also städtebaulichen Rahmenbedingungen und kommunalen Angeboten abhängt, haben jetzt erneut mehrere Studien deutlich gemacht.
Die Motivierung der Bevölkerung zu mehr Sport und körperlicher Bewegung gilt als ein Schlüsselkonzept der Gesundheitsförderung und als wesentliche Voraussetzung zur Bekämpfung der Übergewichts- und Adipositas-Problematik. Die dazu vorgelegten Interventions-Konzepte beschränken sich aber weithin immer noch auf Informationskampagnen und Appelle ("3000 Schritte extra", "Fit statt fett"). Dass die individuelle Motivation zu mehr körperlicher Bewegung ganz wesentlich aber auch von objektiven Faktoren, also städtebaulichen Rahmenbedingungen und kommunalen Angeboten abhängt, haben jetzt erneut mehrere Studien deutlich gemacht.
Eine australische Studie, die in der Zeitschrift "Preventive Medicine" veröffentlicht wurde, hat untersucht, von welchen infrastrukturellen Rahmenbedingungen am Wohnort das Bewegungsverhalten der Bürger abhängt, also zum Beispiel, ob diese häufiger oder weniger häufig zu Fuß gehen oder spazieren gehen, wenn in der Umgebung und in fußläufiger Nähe bestimmte Einrichtungen vorhanden sind wie Bushaltestellen, Briefkästen, Postämter oder Geschäfte. Das Ausmaß körperlicher Bewegung wurde anhand einer Befragung ermittelt, an der knapp 1.400 erwachsene Westaustralier teilnahmen. Erfasst wurde dabei auch die genaue Lage ihrer Wohnung.
Diese Daten wurden dann verknüpft mit Angaben aus einem geografischen Informationssystem (GIS), aus denen die Lage unterschiedlicher Einrichtungen hervorgeht: Postämter, Briefkästen, Geschäfte, Einkaufzentren, Bushaltestellen und Bahnhöfe, Schulen usw. Für die Datenanalyse klassifiziert wurden dann für jeden Studienteilnehmer die Art und Anzahl der Einrichtungen, die sich in einem Umkreis von 400m oder 1.500m zu seiner Wohnung befanden. Als Ergebnis zeigte sich: Je mehr Einrichtungen in der näheren Umgebung vorhanden waren, desto häufiger fand man bei den Teilnehmern auch, dass sich diese zu Fuß bewegten. In Bezirken mit besonders vielen fußläufig erreichbaren Anlaufstationen war das Ausmaß körperlicher Bewegung 1.6 bis 1.8mal so hoch wie in eher "verödeten" Wohngegenden.
Hier ist ein Abstract der Studie: Gavin R. McCormack u.a.: The relationship between destination proximity, destination mix and physical activity behaviors (Preventive Medicine Volume 46, Issue 1, January 2008, Pages 33-40)
Eine andere in England durchgeführte Studie hat untersucht, inwieweit für Bevölkerungsgruppen aus unteren Sozialschichten mit eher riskantem Gesundheitsverhalten und überdurchschnittlich großen Übergewichtsproblemen besondere Zugangsbarrieren zu Sporteinrichtungen bestehen. Ausgehend von der Annahme, dass auch weite Entfernungen zu Sportplätzen , Turnhallen, Parks usw. eine Barriere für mehr körperliche Bewegung sind, untersuchten sie 400 Einwohner von Norwich, einer mittelgroßen Stadt an der ostenglischen Küste. Erfasst wurde auch hier das Ausmaß körperlicher Bewegung, die Wohnlage und darüber hinaus das Haushaltseinkommen.
Verschiede Informationssysteme lieferten dann Informationen über die genaue Lage öffentlich zugänglicher Einrichtungen, in denen man Sport betreiben kann, Sportplätze und Turnhallen, aber auch Fitness-Center und ähnliches. In der Verknüpfung der Daten zeigte sich dann, dass Bürger/innen aus oberen Sozialschichten (gemessen am Einkommen) es am bequemsten haben, die räumliche Distanz von ihrer Wohnung zu Sporteinrichtungen ist erheblich niedriger als bei jenen Schichten, für die mehr körperliche Bewegung aufgrund ihres Gesundheitszustands und -verhaltens sehr viel wichtiger wäre.
Das Abstract dieser Studie ist hier: Jenna Pantera u.a.: Equity of access to physical activity facilities in an English city (Preventive Medicine, Volume 46, Issue 4, April 2008, Pages 303-307)
Eine österreichische Studie schließlich hat näher untersucht, von welchen individuellen und auch sozialen Faktoren es abhängt, ob Bürger/innen öfter das Fahrrad als Verkehrsmittel benutzen. Dazu wurden Telefoninterviews mit 1.000 Einwohnern der Stadt Graz durchgeführt, in denen sie Auskunft gaben, wie oft sie das Fahrrad benutzen, zu welchen Einrichtungen, wie sie die Fahrstrecke und die Fahrradwege dorthin bewerteten. Auch einige Persönlichkeitsmerkmale und sozialstatistische Angaben wurden erhoben.
Es zeigte sich dann im Rahmen einer multivariaten Analyse unter statistischer Kontrolle von Faktoren wie Alter, Geschlecht, Bildungsniveau usw.: Je mehr die zurückzulegenden Fahrtstrecken mit Radwegen ausgestattet waren und je besser diese bewertet wurden, umso häufiger wurde auch das Fahrrad benutzt. Die Häufigkeit hierfür war bei besonders guter und verkehrsgünstiger Ausstattung mehr als doppelt so hoch. Neben diesem (eher naheliegenden) Ergebnis zeigte sich jedoch auch, dass noch eine Reihe weiterer Merkmale für die intensivere Benutzung eines Fahrrads maßgeblich war: Die soziale Infrastruktur der Fahrtstrecke (ob man dort ab und an Bekannte traf) und die im Vergleich zu anderen Möglichkeiten (Auto, Bus, zu Fuß) schnellere Erreichbarkeit.
Ein Abstract der Studie ist hier verfügbar: Sylvia Titze u.a.: Association of built-environment, social- environment and personal factors with bicycling as a mode of transportation among Austrian city dwellers (Preventive Medicine, Online First, doi: 10.1016/j.ypmed.2008.02.019)
Gerd Marstedt, 3.4.2008
Rauchen, die Lebensfreude des "kleines Mannes"? Eine Studie zeigt: Raucher sind keineswegs glücklicher als Nichtraucher
 Es war im Juni 2004, als der damalige britische Gesundheitsminister Dr. John Reid eine viel beachtete und ebenso stark kritisierte Rede hielt, die das Rauchen als letztes Vergnügen des "kleines Mannes" bezeichnete. In dieser Rede wollte er auch geplanten weiteren Verboten und Einschränkungen für Raucher entgegentreten. "Welche Freuden hat denn eine 21jährige Mutter," so der Politiker und spätere Verteidigungsminister, "die in einer Sozialwohnung mit drei Kindern lebt? Ihr einziges Vergnügen ist es, ab und zu eine Zigarette zu rauchen."
Es war im Juni 2004, als der damalige britische Gesundheitsminister Dr. John Reid eine viel beachtete und ebenso stark kritisierte Rede hielt, die das Rauchen als letztes Vergnügen des "kleines Mannes" bezeichnete. In dieser Rede wollte er auch geplanten weiteren Verboten und Einschränkungen für Raucher entgegentreten. "Welche Freuden hat denn eine 21jährige Mutter," so der Politiker und spätere Verteidigungsminister, "die in einer Sozialwohnung mit drei Kindern lebt? Ihr einziges Vergnügen ist es, ab und zu eine Zigarette zu rauchen."
Mit diesen Zitaten beginnt auch eine Forschungsgruppe aus Exeter und Cambridge ihre Veröffentlichung zu einer Studie, in der man der Frage nachgeht: Haben Raucher mehr Lebensfreude als Nichtraucher? Basis ihrer Verlaufsstudie sind knapp 9.200 Befragungsteilnehmer im Alter über 45, die in den Jahren 1998-2001 an der "Health Survey for England" teilnahmen und nach der Erstbefragung bis zum Jahr 2002 weiter beobachtet wurden. Sie wurden einer von drei Gruppen zugeordnet: Tägliche Raucher, ehemalige Raucher, Niemals-Raucher. Erfasst wurde bei ihnen die sozio-ökonomische Schichtzugehörigkeit anhand des Haushaltseinkommens und darüber hinaus mit verschiedenen Fragebögen die Lebenszufriedenheit bzw. die generelle Lebensfreude.
Dazu wurden verschiedene Indikatoren errechnet, unter anderem
• die subjektiv empfundene Lebensqualität, die sich aus vier Skalen mit insgesamt 19 Fragen ergibt: Kontrolle, Autonomie, Selbstverwirklichung, Lebensfreude
• die wahrgenommene Lebensfreude, ermittelt aus den Antworten zu Feststellungen wie: Ich freue mich auf den nächsten Tag; Mein Leben hat einen Sinn; Ich freue mich, wenn ich mit anderen zusammen bin; Mir gefällt das, was ich mache; Alles in allem bin ich durchaus glücklich, wenn ich mein bisheriges Leben betrachte.
Im Vergleich der drei Gruppen (tägliche Raucher, ehemalige Raucher, Niemals-Raucher) zeigte sich dann, dass Raucher weder bei der Lebensqualität noch bei der Lebensfreude höhere Werte erreichen als Ex- oder Nie-Raucher. Es zeigt sich sogar das Gegenteil, dass sowohl frühere Raucher wie Befragte, die nie geraucht haben, bei diesen Werten signifikant besser abschneiden. Auch als die Wissenschaftler zur Kontrolle des Einflusses von ökonomischen Rahmenbedingungen nur noch Angehörige der Unterschicht bzw. mit niedrigem Einkommen berücksichtigten, bestätigten sich die Befunde. Fazit der Forscher: Zwar kann es durchaus sein, dass Raucher nach dem Griff zur Zigarette oder Pfeife für zehn Minuten körperlich und seelisch höhere Lebensfreude empfinden. Unter dem Strich ist es jedoch so, dass die allgemeine Bilanz "Wieviel Freude am Leben habe ich?" für Raucher eher negativ ausfällt.
Hier ist ein Abstract der Studie: I. Lang u.a.: Was John Reid right? Smoking, class, and pleasure: A population-based cohort study in England (Public Health, Volume 121, Issue 7, July 2007, Pages 518-524)
Gerd Marstedt, 31.3.2008
Das Ernährungsverhalten wird selbst bei Patienten mit Bluthochdruck kaum durch medizinische Empfehlungen beeinflusst
 In wie starkem Maße das Ernährungsverhalten in der Bevölkerung durch anerzogene Gewohnheiten und Defizite bei den Einkaufsangeboten beeinflusst wird, und wie stark es daher - selbst bei Patienten mit Bluthochdruck - auch gegenüber medizinischen Empfehlungen resistent ist, hat jetzt eine US-amerikanische Studie gezeigt, die in der Zeitschrift "Archives of Internal Medicine" veröffentlicht wurde. Basis der Studie ist die sogenannte "National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES)", aus der Erhebungsdaten der Jahre 1988-1994 und 1999-2004 analysiert wurden.
In wie starkem Maße das Ernährungsverhalten in der Bevölkerung durch anerzogene Gewohnheiten und Defizite bei den Einkaufsangeboten beeinflusst wird, und wie stark es daher - selbst bei Patienten mit Bluthochdruck - auch gegenüber medizinischen Empfehlungen resistent ist, hat jetzt eine US-amerikanische Studie gezeigt, die in der Zeitschrift "Archives of Internal Medicine" veröffentlicht wurde. Basis der Studie ist die sogenannte "National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES)", aus der Erhebungsdaten der Jahre 1988-1994 und 1999-2004 analysiert wurden.
Erfasst wurden dort in sehr akribischer Weise die Ernährungsgewohnheiten mit Hilfe eines Fragebogens. In der Auswertung wurde dann berücksichtigt, ob die Betroffenen Empfehlungen zur Zusammensetzung ihrer Mahlzeiten folgten - im Hinblick auf Fett und gesättigte Fettsäuren, Protein und Cholesterin, Ballaststoffe und Spurenelemente. Darüber hinaus wurden auch soziodemografische Daten erhoben (Alter, Geschlecht, Einkommen, Bildungsniveau) und Angaben zum Gesundheitszustand und zur Krankengeschichte, wobei auch diagnostizierte Herz-Kreislauf-Krankheiten und Angaben zum Blutdruck berücksichtigt wurden.
In die endgültige Analyse einbezogen wurden dann 4.386 Teilnehmer an der NHANES-Studien, die im letzten Erhebungszeitraum 1999-2004 unter Bluthochdruck litten. In der Analyse zeigte sich dann:
• Nur knapp 20 Prozent dieser Gruppe mit Bluthochdruck ernährte sich auch so, wie es in den medizinischen Empfehlungen staatlicher Gesundheitseinrichtungen festgelegt war und so, wie Ärzte dies ihren Bluthochdruck-Patienten mitteilen sollten.
• In multivariaten Analysen, die auch noch das Alter, Bildungsniveau und andere Faktoren statistisch mitberücksichtigten, zeigte sich, dass die "Non-Compliance", also Nichtbefolgung der Ernährungsrichtlinien besonders stark ausgeprägt war bei Jüngeren, schwarzen Bürgern, Angehörigen unterer Bildungsschichten.
• Im Vergleich zu den Daten aus den Jahren 1988-1994 stellen die Wissenschaftler fest, dass sich im Zeitablauf sogar eine Verschlechterung feststellen lässt, was die Befolgung der Ernährungs-Empfehlungen anbetrifft.
In der Bilanzierung ihrer Befunde beklagen die Forscher, dass die bisherigen Bemühungen zur Änderung des Ernährungsverhaltens selbst bei Patienten, die besonders hohen Risiken aufgrund ihres Blutdrucks ausgesetzt sind, bislang unzureichend waren und aktuell sogar geringere Resonanz zeigen als noch vor einem Jahrzehnt. Sie diskutieren eine Vielzahl von Faktoren, die dafür maßgeblich sein können. Hervorgehoben wird einerseits die unzureichende Beratung durch Ärzte: Nur jeder dritte Patient mit Bluthochdruck erhält eine ärztliche Ernährungsberatung, was wiederum an der unzureichenden Ausbildung, Personalausstattung und Finanzierung dieser Leistung liegt. Kritisiert wird andererseits aber auch, dass insbesondere in Wohngebieten mit hoher Risikostruktur (viele Unterschicht-Angehörige und Schwarze) das Angebot an "gesunden" Nahrungsmitteln (frisches Obst und Gemüse) im Vergleich zu Fast-Food-Imbissen und Supermärkten erhebliche Defizite aufweist und auch die Infrastruktur zur Förderung körperlicher Bewegung hier besonders mangelhaft ist.
Hier ist ein Abstract der Studie: Philip B. Mellen u.a.: Deteriorating Dietary Habits Among Adults With Hypertension - DASH Dietary Accordance, NHANES 1988-1994 and 1999-2004 (Arch Intern Med. 2008;168(3):308-314)
Gerd Marstedt, 17.2.2008
18 Studenten/innen essen vier Wochen nur Junk-Food - "Supersize me" unter strenger wissenschaftlicher Kontrolle
 Die Manager von McDonald's und Burger King dürften klammheimliche Freude empfunden haben, als Ernährungswissenschaftler die These aufstellten, Morgan Spurlock habe in seinem Film "Supersize Me" wohl eindeutig herumgetrickst, um zu den für die Junk-Food-Ernährung vernichtenden Ergebnissen zu kommen. Nun hat ein schwedischer Wissenschaftler das Experiment noch einmal mit 12 Studenten und 6 Studentinnen wiederholt, unter strenger wissenschaftlicher Kontrolle und mit Erfassung einer Vielzahl medizinischer Daten.
Die Manager von McDonald's und Burger King dürften klammheimliche Freude empfunden haben, als Ernährungswissenschaftler die These aufstellten, Morgan Spurlock habe in seinem Film "Supersize Me" wohl eindeutig herumgetrickst, um zu den für die Junk-Food-Ernährung vernichtenden Ergebnissen zu kommen. Nun hat ein schwedischer Wissenschaftler das Experiment noch einmal mit 12 Studenten und 6 Studentinnen wiederholt, unter strenger wissenschaftlicher Kontrolle und mit Erfassung einer Vielzahl medizinischer Daten.
Heraus kam Erstaunliches: Die Leberwerte der meisten Teilnehmer zeigten bedrohliche Werte, zugleich ergaben sich für Blutfettwerte eher positive Entwicklungen. Manche Teilnehmer nahmen in 4 Wochen gewaltig zu, andere kaum. Und alle verloren später ihr Übergewicht. Wieder können die Burger-Ketten befriedigt auf die Wissenschaftler verweisen, die da gezeigt haben: Einige nehmen halt sehr stark zu, andere nicht - alles eine Frage der Gene und der Veranlagung und bei jedem anders.
Frederik Nyström von der schwedischen Universität Linköping hatte 18 Studenten an einem Experiment teilnehmen lassen. 4 Wochen lang sollten sie sich nur mit Junk-Food ernähren, Cola und Shake-Getränke, Burger und Pizzas. Sie sollten nach einem exakten Ernährungsplan tagtäglich doppelt so viele Kalorien zu sich nehmen wie sie eigentlich benötigten, am Schluss der Studie etwa 5.000. Und zusätzlich wurde gefordert: So wenig körperliche Bewegung wie möglich, maximal eine Stunde in der Woche. Sobald ein Teilnehmer 15% seines Körpergewichts zusätzlich auf die Waage brachte, schied er aus der Studie aus. Die Ergebnisse zeigten dann Erstaunliches:
• Die Gewichtszunahme fiel bei den einzelnen Teilnehmern höchst unterschiedlich aus, manche nahmen 5-6 Kilo zu, ein Teilnehmer sogar 12 kg, andere nur minimal 1-2 kg.
• Bei 11 von 18 Teilnehmern zeigte ein bestimmter Laborwert für die Ausschüttung von Leber-Enzymen extrem bedrohliche Werte, die normalerweise auf eine Leberschädigung hindeuten, wie sich durch Alkoholmissbrauch oder Hepatitis verursacht wird.
• Am meisten überrascht waren die Wissenschaftler jedoch darüber, dass ein bestimmter Blutfett-Wert (HDL, das sogenannte "gute Cholesterin") innerhalb des Studienzeitraums größer wurde - im Prinzip ein gutes Zeichen, da dieses HDL das "böse" und gesundheitsschädliche Cholesterin LDL in Grenzen hält.
Die Studie ist bislang noch nicht veröffentlicht, die Wissenschaftler wollen zunächst noch einmal die Vielzahl ihrer Daten prüfen und auch deren Bedeutung für den Zusammenhang von Ernährung und Übergewicht. Schon jetzt lässt sich jedoch die Frage stellen, welche wissenschaftliche Aussagekraft und welchen praktischen Nutzen für die Präventionspolitik wohl eine Studie hat, die nicht von realen Lebensbedingungen und Alltagsgewohnheiten von Menschen ausgeht, sondern diesen ein vollkommen irreales Verhaltensraster aufzwängt:
• Obwohl alle Teilnehmer Ekel oder Widerwillen empfanden, die geforderten fünf- oder sechstausend Kalorien täglich zu essen, folgten sie dieser Pflicht, oft mit Tricks, etwa indem eine Teilnehmerin die am Tagesende noch fehlenden tausend Kalorien durch ein Gläschen Olivenöl zu sich nahm.
• Obwohl alle Teilnehmer während der gesamten Studiendauer immer wieder einen unbändigen Drang verspürten, sich körperlich zu bewegen oder anderweitig körperlich aktiv zu werden, mussten sie diesen Impuls massiv unterdrücken - mit Ausnahme von einer Stunde Training pro Woche.
• Obwohl eine ungesunde und zu kalorienreichem Ernährung ein Problem übergewichtiger und fettleibiger Personen ist, nahmen an der Studie junge, gesunde, normalgewichtige Studenten teil, die bislang das Gegenteil von Burger- oder Pizza-Fans waren: Dr. Nyström schaffte es nicht, die ursprünglich vorgesehene Teilnehmerzahl von 10 Studenten und 10 Studentinnen zu rekrutieren, als er mitteilte, was an Ernährungs-Zumutungen vorgesehen war.
Dr. Nyström will nun vor einer Veröffentlichung seiner Befunde erst noch einmal alle Daten prüfen. Man ahnt schon, wohin die Reise gehen wird, wenn er das vorläufige Fazit zieht: "Einige Menschen sind vermutlich sehr viel anfälliger für Übergewicht als andere."
• Ein ausführlicher Bericht über die Studie findet sich in der Zeitschrift "New Scientist", der Zugang ist aber leider kostenpflichtig: Douglas K: "Super size me" revisited - under lab conditions (New Scientist 2007; 27. Januar}
• Eine Zusammenfassung findet man auch hier im "Guardian": Only another 5,500 calories to go ...
• und auch hier (Deutschlandradio): Supersize me revisited
Übrigens: Erst vor kurze hatten Forscher der Universität Münster gewarnt, Olivenöl sei weitaus weniger gesund als landläufig angenommen. Arteriosklerose würde nicht verhindert, sondern womöglich ganz im Gegenteil sogar begünstigt. Hintergrund der Studie: Die Wissenschaftler hatten Meerschweinchen, deren Grundnahrungsmittel ganz überwiegend Heu ist, 4 Monate lang mit einer Diät aus Ölsäure gefüttert. vgl.: Wissenschaftler kritisieren: Leitlinien und Ratschläge zur gesunden Ernährung verursachen oft mehr Schaden als Nutzen
Gerd Marstedt, 14.2.2008
"Nationale Verzehrstudie" zeigt massive Wissenslücken der Bevölkerung zum Thema Ernährung und Gesundheit
 Rund 20.000 Deutsche im Alter von 14-80 Jahren wurden in der jetzt veröffentlichten "Nationalen Verzehrstudie" zu ihrem Wissen über Ernährung, ihrem Einkaufsverhalten und ihren Kochkünsten befragt. Die Studie dokumentiert einmal mehr, dass Übergewicht und Adipositas nicht nur in England und den USA ein großes Problem ist, sie zeigt darüber hinaus aber auch, dass große Teile der Bevölkerung nur sehr wenig Kenntnisse haben über den Zusammenhang von Ernährung und Gesundheit.
Rund 20.000 Deutsche im Alter von 14-80 Jahren wurden in der jetzt veröffentlichten "Nationalen Verzehrstudie" zu ihrem Wissen über Ernährung, ihrem Einkaufsverhalten und ihren Kochkünsten befragt. Die Studie dokumentiert einmal mehr, dass Übergewicht und Adipositas nicht nur in England und den USA ein großes Problem ist, sie zeigt darüber hinaus aber auch, dass große Teile der Bevölkerung nur sehr wenig Kenntnisse haben über den Zusammenhang von Ernährung und Gesundheit.
Wichtige Ergebnisse der Studie sind unter anderem:
• Ernährungsinformation und Ernährungswissen: Zwei Drittel der Deutschen informieren sich über das Thema Ernährung. Für über die Hälfte dieser Teilnehmer sind die Printmedien (56%), Angaben auf Lebensmittelverpackungen (54%), persönliche Kontakte über Freunde und Familie (54%) und das Fernsehen (51%) die Hauptinformationsquellen. Gleichwohl kannten nur 29% der Teilnehmer die richtige Bedeutung der Kampagne "5amTag" (5mal täglich Obst oder Gemüse), wobei Frauen diese doppelt so häufig kannten wie Männer.(40% zu 18%). Und nur 8% der erwachsenen Deutschen (19-80 Jahre) können ihren persönlichen Energiebedarf richtig einschätzen. 31% schätzen ihn mit einer großen Abweichung zum Richtwert für die Nährstoffzufuhr falsch ein (meist zu gering). Mehr als die Hälfte (53%) hat hierzu überhaupt keine Angabe gemacht.
• Nahrungsergänzungsmittel: 28% der Deutschen nehmen Nahrungsergänzungspräparate und angereicherte Medikamente ein, 31% der Frauen und 24% der Männer. Hierbei steigt bei beiden Geschlechtern zunächst die Einnahme bis 35 Jahre an, fällt dann etwas ab, um in der Altersgruppe ab 51 bis 80 Jahre wieder deutlich anzusteigen (bei den 65-80 jährigen Frauen auf 43% und den gleichaltrigen Männern auf 30%). Bei dem selbst eingeschätzten Gesundheitszustand werden bei der Angabe "schlecht" am häufigsten Supplemente eingenommen.
• Risikoeinschätzung und -wahrnehmung: Bei der Risikowahrnehmung bezüglich allgemeiner Gesundheitsgefahren liegen Nahrungsmittel und Getränke lediglich auf Platz 9 von 10 vorgegebenen Risiken. Fast alle anderen Gesundheitsgefährdungen (wie z. B. Zigaretten, Radioaktivität, Stress im Beruf, Verkehr) werden häufiger genannt. Das größte Risiko für die eigene Gesundheit, nämlich "Zu viel und zu einseitig essen" rangiert erst auf Rang 4 (von 14) ein. Rückstände von Spritzmitteln im Pflanzenbau und Rückstände von Tierarzneimitteln sowie verdorbene Lebensmittel werden hingegen als höheres Risiko eingeschätzt.
• Einkaufsverhalten: Bei 47% der Männer kümmert sich eine andere Person um den Lebensmitteleinkauf. Leben die Männer mit einer Partnerin zusammen, steigt dieser Anteil auf 51%. Je mehr Personen im Haushalt leben, desto weniger häufig sind Männer für den Lebensmitteleinkauf zuständig. Frauen übernehmen zu zwei Dritteln den Einkauf, unabhängig davon, ob sie mit oder ohne Partner leben. Die häufigsten Einkaufsstätten sind Supermärkte, gefolgt von Discountern und Lebensmittelfachgeschäften. Es sind deutlich mehr Personen mit hohem Einkommen oder einem hohen Schulabschluss, die sich für den Einkauf von Bioprodukten entscheiden. Frauen kaufen generell in allen Einkommensschichten öfter Bioprodukte als Männer.
• Kochkünste: Zwei Drittel der Frauen und ein Drittel der Männer schätzen ihre Kochfähigkeiten mit sehr gut bis gut ein. Frauen haben sechs vorgegebene Gerichte (von leicht bis schwer) je nach Gericht zu 84-93% alle bereits selbst aus Grundzutaten zubereitet. Männer kommen hierbei nur auf eine Häufigkeit von 33-61% in Abhängigkeit vom Gericht. Diese Angaben bestätigen die angegebene Selbsteinschätzung.
• Übergewicht: 66 Prozent der Männer und 51 Prozent der Frauen sind übergewichtig. Jeder Fünfte ist adipös und damit gefährdet an Herz-Kreislauferkrankungen oder Diabetes zu erkranken. Während der Anteil übergewichtiger junger Erwachsener in den letzten zehn Jahren deutlich anstieg, sank bei den Frauen über 30 Jahren der Anteil Übergewichtiger im gleichen Zeitraum je nach Altersgruppe um bis zu acht Prozent.
Materialien zur Studie:
• Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz: Nationale Verzehrstudie (PDF, 174 Seiten)
• Ergänzungsband "Ausgewählte Ergebnisse nach Schichtindex"
• Download-Seite mit weiteren Berichten zur Nationalen Verzehrstudie
Gerd Marstedt, 30.1.2008
Körperliche Bewegung + Nichtrauchen + mäßig Alkohol + gesunde Ernährung = Gewinn an 14 Jahren Lebenserwartung
 Eine kaum mehr überschaubare Vielzahl epidemiologischer Studien hat in den letzten Jahren aufgezeigt, wie hoch die Risiken durch Rauchen oder Alkoholkonsum für eine reduzierte Lebenserwartung sind oder wie stark ein gesundheitsbewusstes Alltagsverhalten, etwa durch gesunde Ernährung und körperliche Bewegung, vor chronischen Erkrankungen schützt. Ein gravierendes Defizit der allermeisten Studien war jedoch, dass sie nur einzelne Faktoren des Risikoverhaltens in den Analysen berücksichtigten.
Eine kaum mehr überschaubare Vielzahl epidemiologischer Studien hat in den letzten Jahren aufgezeigt, wie hoch die Risiken durch Rauchen oder Alkoholkonsum für eine reduzierte Lebenserwartung sind oder wie stark ein gesundheitsbewusstes Alltagsverhalten, etwa durch gesunde Ernährung und körperliche Bewegung, vor chronischen Erkrankungen schützt. Ein gravierendes Defizit der allermeisten Studien war jedoch, dass sie nur einzelne Faktoren des Risikoverhaltens in den Analysen berücksichtigten.
Ein Forschungsteam aus Cambridge, England, hat nun Ergebnisse einer Längsschnittstudie veröffentlicht, in der vier bekannte Risikofaktoren gleichzeitig einbezogen wurden und deren kombinierter Einfluss auf die Sterblichkeit analysiert wurde. Zentrales Ergebnis der Analyse war: Eine besonders gesunde Lebensweise bedeutet im Vergleich zu einem besonders riskanten Gesundheitsverhalten einen Unterschied von 14 Jahren Lebenserwartung. Die "gesunde Lebensweise" war dabei definiert über vier Verhaltensaspekte:
1.) Nichtrauchen
2.) Nur mäßiger Alkoholkonsum, maximal 14 Einheiten pro Woche, wobei eine Einheit definiert war als 1 Glas Wein, 1 Schnaps oder 1 Glas Bier (etwa 0,3 Liter)
3.) körperliche Bewegung bei der Arbeit oder in der Freizeit (dies wurde mit 4 Fragen erfasst)
4.) eine Ernährung mit mindestens 5 Portionen Obst und Gemüse am Tag (hier wurde der Vitamin C-Spiegel im Blutplasma gemessen und vercodet, ob dieser die Marke erreichte, die den Ernährungsempfehlungen zum Obst- und Gemüseverzehr entspricht)
Für jeden Aspekt eines gesunden Lebensstils wurde dann 1 Punkt vergeben, so dass hieraus Gruppen mit 0, 1, 2, 3 und 4 Punkten resultierten.
Die Daten stammen aus der sogenannten "EPIC-Norfolk Prospective Population Study", einer Gemeindestudie aus Norfolk in England. Aus dieser Stichprobe wurden insgesamt 20.244 Männer und Frauen im Alter von 45-79 Jahren berücksichtigt, die zu Beginn nicht von einer Krebs- oder Herz-Kreislauf-Erkrankung betroffen waren. Die Studie begann in den Jahren 1993-1997 und verfolgte den gesundheitlichen Werdegang der Studienteilnehmer bis zum Jahr 2006. Erhoben wurden neben den genannten Aspekten des Gesundheitsverhaltens auch viele sozialstatistische Daten, ferner wurden die Teilnehmer auch von Krankenschwestern körperlich untersucht und dabei der Body-Mass-Index ermittelt.
Bis zum Jahre 2006 waren dann 1.987 Studienteilnehmer verstorben. Die Wissenschaftler überprüften dann, wie sich das Gesundheitsverhalten auf die Lebenserwartung ausgewirkt hatte. In dieser multivariaten Analyse wurden neben dem Gesundheitsverhalten gleichzeitig auch noch sozialstatistische und andere Einflussfaktoren (Alter, Geschlecht, soziale Schichtzugehörigkeit, Body-Mass-Index) mitberücksichtigt. Aus der Analyse ausgeschlossen wurden solche Fälle, wenn Teilnehmer schon innerhalb von zwei Jahren nach Studienbeginn verstorben waren.
Es zeigte sich dann:
• Im Vergleich zu jener Gruppe mit insgesamt 4 Punkten (= Elementen eine gesundheitsbewussten Verhaltens) lag das Sterblichkeitsrisiko in den anderen Gruppen: bei 3 Punkten bei 1.39, bei 2 Punkten bei 1.95, bei 1 Punkt bei 2.52 und bei null Punkten bei 4.04. Das heißt: In der Gruppe mit extrem gesundheitsriskantem Verhalten ist das Mortalitätsrisiko viermal so hoch.
• Der Effekt war am stärksten ausgeprägt für Todesursachen, die mit kardio-vaskulären Erkrankungen zusammenhängen.
• Die Einflüsse blieben auch in etwa derselben Größenordnung nachweisbar, wenn Männer und Frauen getrennt betrachtet wurden.
• Als bedeutsamster Risikofaktor erwies sich das Rauchverhalten.
• Die Forscher errechneten dann auch, was die Risiken bedeuten im Hinblick auf den Gewinn oder Verlust von Lebensjahren. Es zeigte sich, dass ein Unterschied von 0 und 4 Punkten im Rahmen des Gesundheitsverhaltens insgesamt 14 Lebensjahre ausmacht.
• Deutlich wurde auch, dass ein konsequent gesundheitsbewusstes Verhalten (4 Punkte) nur bei einer Minderheit von 21% der Männer und 39% der Frauen vorzufinden ist. Umgekehrt findet sich ein extrem gesundheitsriskantes Verhalten (0 Punkte) allerdings bei einer noch kleineren Gruppe von 1.2% der Männer und 0.7% der Frauen.
Die Studie steht hier kostenlos im Volltext der Open-Access-Zeitschrift "PLOS Medicine" zur Verfügung:
Kay-Tee Khaw u.a.: Combined Impact of Health Behaviours and Mortality in Men and Women: The EPIC-Norfolk Prospective Population Study
Gerd Marstedt, 8.1.2008
Gesundheitswissenschaftliches zum Fest der Liebe: Wangenkuss birgt geringeres Gripperisiko als Händeschütteln
 Zumindest Rhinoviren als einem der häufigsten Erreger von Erkältungskrankheiten können - so eine der einschlägigen wissenschaftlichen Studien - nur sehr schwer oder gar nicht durch Küsse auf die Wangen übertragen werden. Der bevorzugte Übertragungsweg für diese und zahlreiche andere Erkältungs- und Grippeviren ist wie auch bei vielen Erregern von Magen- und Darminfektionen (z. B. Salmonellen) der über die Hände.
Zumindest Rhinoviren als einem der häufigsten Erreger von Erkältungskrankheiten können - so eine der einschlägigen wissenschaftlichen Studien - nur sehr schwer oder gar nicht durch Küsse auf die Wangen übertragen werden. Der bevorzugte Übertragungsweg für diese und zahlreiche andere Erkältungs- und Grippeviren ist wie auch bei vielen Erregern von Magen- und Darminfektionen (z. B. Salmonellen) der über die Hände.
Dies ist eines der wichtigsten Ergebnisse einer gerade im "American Jounal of Infection Control" (2007; Vol. 35 No. 10 Supplement 1: S27-S64) unter dem Titel "The effectiveness of hand hygiene procedures in reducing the risks of infections in home and community settings including handwashing and alcohol-based hand sanitizers" erschienenen umfangreichen und materialreichen Überblicksarbeit von Sally F. Bloomfield, Allison E. Aiello, Barry Cookson, Carol O'Boyle und Elaine L. Larson, die u.a. an der renommierten London School of Hygiene and Tropical Medicine und in verschiedenen US-Universitäten forschen.
Die Forschungsgruppe hebt zunächst hervor und belegt dies auch konkret, dass infektiöse Erkrankungen in der privaten und öffentlichen Sphäre ein ernstzunehmender Teil der Gesamtmorbidität bleiben. Eine Reihe von demografischen, ökologischen und Versorgungsfaktoren führen sogar in der nächsten Zeit dazu, die Bedrohung durch infektioöse Erkrankungen zu vergrößern. Dafür sind im Wesentlichen zwei Faktoren verantwortlich: die konstant anhaltende Wandlungs- und Anpassungsfähigkeit der Natur, die die Anzahl und Art neuer pathogener Erreger ständig erhöht und verändert und demografisch bedingte Abnahmen Widerstandsfähigkeit menschlicher Populationen.
Die Studie von Bloomfield et al. untersucht nun vor allem die Evidenz der Bedeutung oder Wirksamkeit der Handhygiene für die Reduktion der Übertragung von infektiösen Erkrankungen in der häuslichen und kommunal-öffentlichen Umgebung in Nordamerika und Europa. Er untersucht und bewertet außerdem den Einsatz alkoholbasierter Hygienemittel als einer Alternative oder als Ergänzung des normalen Händewaschens. Die Studie wertet dafür weit über hundert quantitative und qualitative Interventionsstudien aus.
Die wesentlichen Erkenntnisse lauten:
• Handhygiene ist eine Schlüsselkomponente für gute Hygienepraxis in der häuslichen und öffentlichen Umgebung und kann signifikanten Nutzen bei der Reduktion von Infektionen im Magen-Darmtrakt, der Atemwege und der Haut stiften.
• Die Entkeimung der Hände ist sowohl durch Händewaschen mit Seife als auch durch wasserlose Mittel zu erreichen.
• Der Erfolg von Händehygiene bei der Reduktion von Infektionsrisiken könnte noch dadurch vergrößert werden, wenn die Menschen sich überzeugen lassen, die Handhygiene sorgfältig und zum richtigen Zeitpunkt bzw. nach bestimmten Prozeduren (z. B. nach Stuhlgang oder Wechsel von Babywindeln) durchzuführen.
• Um den gesundheitlichen Nutzen der Förderung der Handhygiene noch zu verbessern sollte sie durch allgemeine Hygieneerziehung verknüpft werden und auch die Förderung anderer Aspekte von Hygiene umfassen. Ausdrücklich warnen daher die Forscher vor einer Reduktion ihrer Reviewergebnisse auf die Formel ''if you wash your hands you won't get sick.''
Zum Aufsatz "The effectiveness of hand hygiene procedures in reducing the risks of infections in home and community settings including handwashing and alcohol-based hand sanitizers" gibt es sowohl ein Abstract als auch eine komplette PDF-Version des Aufsatzes.
Ein 57-seitiges Rohmanuskript des Aufsatzes und weitere wissenschaftliche Untersuchungen und praktische Konzepte zur häuslichen Hygiene (home hygiene) findet man auf der speziellen Website des "International Scientific Forum on Home Hygiene (IFH)".
Bernard Braun, 21.12.2007
"Overfed but undernourished": Gesunde Ernährung wird auch durch hohe Preise für kalorienarme Lebensmittel beeinträchtigt
 In Debatten über "gesunde oder hochwertige Ernährung" spielt oft deren höherer Preis eine Rolle, was dazu führt, dass häufig die Angehörigen unterer sozialer Schichten mit oft erhöhten Erkrankungsrisiken sich nur die gesundheitlich "schlechteren" Nahrungsmittel leisten können.
In Debatten über "gesunde oder hochwertige Ernährung" spielt oft deren höherer Preis eine Rolle, was dazu führt, dass häufig die Angehörigen unterer sozialer Schichten mit oft erhöhten Erkrankungsrisiken sich nur die gesundheitlich "schlechteren" Nahrungsmittel leisten können.
Dass die Preiseffekte und damit die Anreize gegen "gesunde" und für "ungesunde" Ernährung in Wirklichkeit noch viel drastischer sind, zeigt - zumindest für die USA - eine jetzt gerade am "Center for Public Health Nutrition" der Universität des Bundesstaates Washington durchgeführte Untersuchung.
Die Ernährungswissenschaftler erhoben im Großraum Seattle im Jahre 2004 die Preise von frischen Früchten, Gemüse und anderen niederkalorischen Lebensmitteln ebenso wie die Preise von hochkalorischen Lebensmitteln mit verfeinertem Mehl, Zucker- und Fettzusätzen. Schon damals stellten sie durchweg niedrigere Preise der hochenergetischen Lebensmittel fest. Energiereiche Lebensmittel gelten u.a. deshalb als gesundheitlich problematisch, weil man mit ihnen, ohne dies richtig zu merken, mehr Kalorien konsumiert als man eigentlich bräuchte.
Als sie im Jahr 2006 dieselbe Preiserhebung ein zweites Mal durchführten und die Entwicklung der Preise untersuchten, fanden sie, dass sich die Unterschiede der Preise dieser Lebensmittelgruppen in diesem Zeit deutlich vergrößert hatten. Während die Preise der hochkalorischen Nahrungsmittel nahezu unverändert blieben, stiegen die der niedrigkalorischen Lebensmittel in diesem Zeitraum um 19,5% an. Dieser Anstieg lag deutlich über der Inflationsrate für Lebensmittel, die 5% betrug.
Der Leiter der Studie, Drewnowski, schlussfolgert daher auch zu Recht: "The gap between what we say people should eat and what they can afford is becoming unacceptably wide. If grains, sugars and fats are the only affordable foods left, how are we to handle the obesity epidemic?" Übergewicht und Fettsucht sind also in viel umfassenderer Weise als dies Querschnittsvergleiche der Lebensmittelpreise bisher zeigten auch ein ökonomisches Problem.
Was mit dieser Untersuchung aber auch klar wurde ist, dass die typische statistische Untersuchung des durchschnittlichen "Nahrungsmittelkorbs" gerade den besonderen Anstieg der Preise der gesündesten Nahrungsmittel drastisch unterschätzt.
Ein Abstract der Studie ist hier zu finden: Pablo Monsivais, Adam Drewnowski: The Rising Cost of Low-Energy-Density Foods (Journal of the American Dietetic Association, Volume 107, Issue 12, December 2007, Pages 2071-2076)
Bernard Braun, 10.12.2007
Sportliche Aktivität bewirkt schulischen und beruflichen Erfolg? Oder lieben Erfolgsmenschen Sport und Wettbewerb?
 "Jugendliche, die regelmäßig Sport treiben, erzielen durchschnittlich höhere Bildungsabschlüsse als ihre bewegungsscheuen Altersgenossen. Dieser Zusammenhang konnte in einer vom Bonner Institut zur Zukunft der Arbeit (IZA) veröffentlichten Untersuchung jetzt erstmals für Deutschland nachgewiesen werden. Demnach erhöht die Teilnahme an außerschulischen Sportangeboten die Wahrscheinlichkeit, die Hochschulreife zu erlangen oder ein Universitätsstudium erfolgreich zu absolvieren, um jeweils bis zu sechs Prozentpunkte." Dieses Fazit zieht das Bonner Institut zur Zukunft der Arbeit (IZA) in einer Pressemitteilung " Wer Sport treibt, ist erfolgreicher in Schule und Beruf - Studie belegt positive Wirkung sportlicher Aktivität auf den Bildungserfolg" und bezieht sich dabei auf eine Studie, die mit Daten des Deutschen Sozio-ökonomischen Panels (SOEP) durchgeführt wurde.
"Jugendliche, die regelmäßig Sport treiben, erzielen durchschnittlich höhere Bildungsabschlüsse als ihre bewegungsscheuen Altersgenossen. Dieser Zusammenhang konnte in einer vom Bonner Institut zur Zukunft der Arbeit (IZA) veröffentlichten Untersuchung jetzt erstmals für Deutschland nachgewiesen werden. Demnach erhöht die Teilnahme an außerschulischen Sportangeboten die Wahrscheinlichkeit, die Hochschulreife zu erlangen oder ein Universitätsstudium erfolgreich zu absolvieren, um jeweils bis zu sechs Prozentpunkte." Dieses Fazit zieht das Bonner Institut zur Zukunft der Arbeit (IZA) in einer Pressemitteilung " Wer Sport treibt, ist erfolgreicher in Schule und Beruf - Studie belegt positive Wirkung sportlicher Aktivität auf den Bildungserfolg" und bezieht sich dabei auf eine Studie, die mit Daten des Deutschen Sozio-ökonomischen Panels (SOEP) durchgeführt wurde.
Festgestellt wird in der Studie weiterhin:
• Bei Frauen ist der statistische Zusammenhang besonders stark ausgeprägt. Erklärt wird dies damit, "dass sich sportlich aktive Frauen mit gesteigertem Selbstbewusstsein und Durchsetzungsvermögen dem Wettbewerb mit Männern stellen - ob im Klassenverband oder bei der Bewerbung um eine Lehrstelle. Denn aus experimentellen Studien ist bekannt, dass Frauen von Natur aus Wettbewerbssituationen eher scheuen als Männer. So nahm auch nur rund die Hälfte der befragten weiblichen Sportler während der Schullaufbahn an Wettkämpfen teil, während dies auf drei Viertel der männlichen Sportler zutrifft."
• Eine zu hohe Intensität und Zeitdauer sportlicher Betätigung kann den festgestellten positiven Effekt wieder einengen. Befragte, die Leistungssport betrieben und an Wettkämpfen teilgenommen haben, sind zumindest im Hinblick auf höhere Bildungsabschlüsse nicht erfolgreicher als der Durchschnitt. Man vermutet: "Offenbar lässt sich die lernintensive Vorbereitung auf Abitur oder Examen nicht immer mit den zeitlichen Verpflichtungen eines Wettkampfsportlers vereinen."
Nicht nur in der Schlagzeile der Pressemitteilung wird ein Kausalzusammenhang "Sport - > Erfolg" suggeriert, auch an anderen Stellen der Pressemitteilung und im Bericht selbst wird dies konstatiert: "Auch der außerschulische Sport wirkt sich durchweg positiv auf die Bildungsproduktivität aus" oder: "Overall, we conclude that participation of German adolescents in sport activities has significant positive effects on educational attainment." Und es werden auch Empfehlungen ausgesprochen: "Kinder und Jugendliche sollten nicht nur unter gesundheitlichen Aspekten zu sportlicher Aktivität animiert werden, sondern auch zur Steigerung ihrer Bildungs- und Berufsaussichten."
Das SOEP, dessen Daten der Studie zugrunde liegen, ist eine echte "Panel"-Studie, also eine (in jährlichem Turnus) durchgeführte Längsschnitt-Befragung bei ein und denselben Personen, so dass man aufgrund dieser seltenen methodischen Voraussetzungen tatsächlich näherungsweise auch kausale Zusammenhänge überprüfen könnte. Betrachtet man die Studie jedoch ein wenig genauer, dann wird deutlich, dass hier zwar tatsächlich einige signifikante statistische Zusammenhänge zwischen sportlicher Aktivität in der Jugend und dem späterem schulischen und beruflichen Abschluss gefunden wurden. Auch wurde eine Reihe von Variablen mitüberprüft, die ebenfalls den Schul- und Berufserfolg mit beeinflussen können, wie z.B. das Bildungsniveau der Eltern oder die Zahl der Geschwister (als Indikator für die individuelle Zuwendung in der Erziehung). Gleichwohl bleibt jedoch die Richtung des gefundenen Zusammenhangs völlig offen: Beeinflusst sportliche Aktivität den späteren Erfolg oder haben Erfolgreiche eher eine Persönlichkeitsstruktur, in der Wettbewerb und Durchsetzungsvermögen stärker verankert sind, so dass sie deshalb auch häufiger Sport treiben?
Die Studie kann dies mit den im Nachhinein analysierten Daten nicht klären. Die Frage der sportlichen Aktivität wurde nur anhand von zwei Fragen erfasst: Ob man früher in der Jugend Sport getrieben und an Wettkämpfen teilgenommen hat. Weder wurden Motive der sportlichen Betätigung erfragt, noch die Persönlichkeitsstruktur (Ehrgeiz, Konkurrenzorientierung, Willensstärke) noch intellektuelle Kompetenzen. Dass das Bildungsmilieu im Elternhaus, also deren schulischer und beruflicher Ausbildungserfolg, einen statistisch weitaus größeren Einfluss auf den Schulerfolg der Kinder hat als deren sportliche Betätigung, erfährt man im Übrigen erst aus den Tabellen-Daten der Analyse. Die Empfehlung "Treibt mehr Sport, das ist nicht nur gesund, sondern führt zusätzlich auch zu Erfolg in Schule und Beruf" steht insofern auf mehr als tönernen Füßen, was ihre wissenschaftliche Fundierung anbetrifft.
Dies ist keineswegs ein Plädoyer gegen den Sport, mehr und besserer Sportunterricht an Schulen wäre ein überaus wichtiger gesundheitspolitischer Beitrag zur Prävention. Aber man sollte dies nicht mit begründen mit bildungspolitischen Argumenten, die einer Überprüfung nicht stand halten. Und dass Sport nicht immer und in jeder Form die Persönlichkeitsentwicklung fördert, hat unlängst eine US-amerikanische Studie gezeigt, nach der ein Effekt von Sport auch Aggressivität und Gewalt sein kann. (vgl. "Sport erzieht zu Fairness und Selbstbeherrschung. Falsch, sagt eine US-Studie, Sport fördert männliche Gewalt"
Die Pressemitteilung zur Studie des Instituts zur Zukunft der Arbeit ist hier: Wer Sport treibt, ist erfolgreicher in Schule und Beruf - Studie belegt positive Wirkung sportlicher Aktivität auf den Bildungserfolg
Die komplette Studie (englisch) steht hier zum Download zur Verfügung: T. Cornelißen, C. Pfeifer: The Impact of Participation in Sports on Educational Attainment: New Evidence from Germany
Gerd Marstedt, 14.11.2007
Gesundheitliche Aufklärung: Wenig ist angekommen, zumindest bei australischen Jugendlichen
 Seit ihrer Gründung vor 40 Jahren führt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) Projekte und Aufklärungskampagnen zur Gesundheitserziehung und -bildung durch: Über die Gefahren des Rauchens, Schutzmaßnahmen gegen AIDS, über die Risiken von Alkohol und Drogen. In den letzten Jahren betrug der jährliche Etat nach einer Übersicht des Wissenschaftsrats knapp 12 Millionen Euro jährlich. Doch kommen die Botschaften zu gesundheitsbewussterem Alltagsverhalten auch an? Nach einer Meldung des Instituts für Demoskopie Allensbach achten die Deutschen heute mehr auf ihre Gesundheit. "Anfang des Jahrzehnts betonten erst 27 Prozent, dass sie sehr gesundheitsbewusst leben, inzwischen sagen das 33 Prozent."
Seit ihrer Gründung vor 40 Jahren führt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) Projekte und Aufklärungskampagnen zur Gesundheitserziehung und -bildung durch: Über die Gefahren des Rauchens, Schutzmaßnahmen gegen AIDS, über die Risiken von Alkohol und Drogen. In den letzten Jahren betrug der jährliche Etat nach einer Übersicht des Wissenschaftsrats knapp 12 Millionen Euro jährlich. Doch kommen die Botschaften zu gesundheitsbewussterem Alltagsverhalten auch an? Nach einer Meldung des Instituts für Demoskopie Allensbach achten die Deutschen heute mehr auf ihre Gesundheit. "Anfang des Jahrzehnts betonten erst 27 Prozent, dass sie sehr gesundheitsbewusst leben, inzwischen sagen das 33 Prozent."
Betrachtet man die Ergebnisse über die Verbreitung von Übergewicht und falscher Ernährung, von Alkoholkonsum und Bewegungsmangel könnte man an diesen Befragungsergebnissen zweifeln. Wie es bei Jugendlichen aussieht, ob sie heute ein stärkeres Gesundheitsbewusstsein an den Tag legen als ihre Vorgängergeneration vor rund 20 Jahren, hat jetzt eine australische Studie näher untersucht. Verglichen wurden Befragungsergebnisse von 10-15jährigen australischen Schülern und Schülerinnen aus dem Jahre 1985 mit Antworten gleichaltriger Schulbesucher aus dem Jahre 2004. Antworten lagen damit von 398 Befragungsteilnehmern vor 20 Jahren vor und von 467 Teilnehmern 2004.
Gefragt wurde - damals wie heute - zum einen, wie man seinen eigenen Gesundheitszustand und ebenso seine körperliche Fitness einschätzt. Zum anderen war eine Reihe von Verhaltensweisen vorgegeben und es wurde gefragt, für wie wichtig man deren Bedeutung für die Gesundheit einschätzt. Zu diesen Aspekten gehörten u.a. ein jährlicher Besuch beim Arzt, beim Zahnarzt, regelmäßige körperliche Bewegung und Sport, Ernährung und Schlaf, Rauchen und Freundschaften. Die jeweils 4 Antwortmöglichkeiten reichten dabei von "sehr wichtig" bis "unwichtig".
• Die Bedeutung der einzelnen Aspekte für die Gesundheit wurde sehr unterschiedlich bewertet. Das Antwortmuster "sehr wichtig" variierte zwischen 91% und 32%. Dabei lag bei Mädchen wie Jungen der Aspekt "gute Freundschaften" ganz vorne, dicht gefolgt von "Nicht rauchen". Ganz hinten rangierten Besuche bei Arzt und Zahnarzt sowie Kenntnisse über den eigenen Körper.
• Für einige Aspekte zeigte sich keine Veränderung im Verlauf der zwei Jahrzehnte. Dies gilt etwa für "Freundschaften", "körperliche Bewegung" oder "sich nicht stressen lassen".
• Für mehrere der vorgegeben Einflussfaktoren wurden indes im Jahre 2004 deutlich geringere Bewertungen der Wichtigkeit gefunden. So sank die Einschätzung, dass Schlaf sehr wichtig ist um über 20%, für gesunde Ernährung um knapp 20%, für Arzt- und Zahnarztbesuche um 15-20% und für "Kenntnisse über den eigenen Körper" um 6%.
• Nur in einem einzigen Aspekt war feststellbar, dass das Urteil "sehr wichtig für die Gesundheit" heute öfter abgegeben wird als vor 20 Jahren, dies war das "Nichtrauchen".
Unter dem Strich bedeutet auch nach Auffassung der Wissenschaftler, dass lediglich die gesundheitliche Aufklärung über die Risiken des Rauchens bei Jugendlichen angekommen ist. In allen anderen Punkten jedoch ist bei australischen Schülern die Sensibilität gegenüber gesundheitsriskanten Alltagsgewohnheiten von 1985 bis 2004 gesunken. Problematisch erscheint dies umso mehr, als in der Befragung auch deutlich wurde, dass die Einschätzung des eigenen Gesundheitszustands sich verschlechtert hat. Über 15% der Jungen wie Mädchen geben heute eine schlechtere Bewertung ab.
Es ist unklar, ob diese Ergebnisse auch auf europäische Länder oder Deutschland übertragbar sind. In der Diskussion der Befunde weisen die Autoren allerdings auf eine Vielzahl von Aufklärungskampagnen, auf Schulprogramme zur Gesundheitsförderung und anderes mehr hin, so dass man die Befunde gewiss nicht als völlig exotisch zur Seite legen kann. Leider gibt es von der BzgA keine vergleichbaren Befragungsergebnisse, obwohl ältere Datenbestände hierzu mit mehreren Repräsentativbefragungen der 70er Jahre "Gesundheitsverhalten und Einstellung zu Gesundheitsfragen (Effizienzkontrolle)" hierzu durchaus vorliegen.
Hier ist ein Abstract der Studie: James Dollman, Felicity Lewis: Trends in health attitudes and self-perceptions among school-age South Australians between 1985 and 2004 (Australian and New Zealand Journal of Public Health, Volume 31 Issue 5 Page 407-413, October 2007)
Gerd Marstedt, 15.10.2007
Kurze Schlafdauer verdoppelt das Sterblichkeitsrisiko - aber auch zu viel Schlaf ist problematisch
 Eine Meldung aus der Epidemiologie, die einmal nicht die Risiken des Rauchens oder Alkoholkonsums, des Bewegungsmangels oder ungesunder Ernährung betrifft, sondern eine eher wenig beachtete Facette des Gesundheitsverhaltens: Den Schlaf. Wissenschaftler der Universität Warwick (England) und des University College London fanden im Rahmen einer sehr großen und über viele Jahre hinweg geführten Studie heraus, dass Angestellte, die ihre nächtlichen Ruhezeiten von zuvor üblicherweise 7 Stunden auf 5 Stunden reduziert hatten und dies über mehrere Jahre hinweg so beibehielten, 11-17 Jahre später eine 1,7mal so hohe Mortalitätsrate aufwiesen und 2,0mal so oft von Herz-Kreislauf-Erkrankungen betroffen waren.
Eine Meldung aus der Epidemiologie, die einmal nicht die Risiken des Rauchens oder Alkoholkonsums, des Bewegungsmangels oder ungesunder Ernährung betrifft, sondern eine eher wenig beachtete Facette des Gesundheitsverhaltens: Den Schlaf. Wissenschaftler der Universität Warwick (England) und des University College London fanden im Rahmen einer sehr großen und über viele Jahre hinweg geführten Studie heraus, dass Angestellte, die ihre nächtlichen Ruhezeiten von zuvor üblicherweise 7 Stunden auf 5 Stunden reduziert hatten und dies über mehrere Jahre hinweg so beibehielten, 11-17 Jahre später eine 1,7mal so hohe Mortalitätsrate aufwiesen und 2,0mal so oft von Herz-Kreislauf-Erkrankungen betroffen waren.
Basis der Analysen ist die sogenannte "Whitehall II Studie", eine Verlaufsstudie mit über 10.000 englischen Angestellten im Alter von 20-64 Jahren. Aus dieser Stichprobe wählten die Wissenschaftler Teilgruppen aus, die über mehrere Jahre hinweg (1985-1988 und 1992-1993) ihre Schlafgewohnheiten, also die zeitliche Dauer ihrer Nachtruhe nicht verändert hatten. Dann kontrollierten sie, ob in der Folgezeit, bis zum Jahr 2004 Änderungen der Schlafdauer eingetreten waren.
Hier zeigte sich nun: Diejenigen, die ihren Schlaf von 7 Stunden (eine Zeitdauer, die für viele gilt) auf 5 Stunden gesenkt hatten, zeigten danach (bis zum Jahr 2004) ein 1,7fach erhöhtes Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen und ein 2,0mal so hohes Sterberisiko. Aber auch diejenigen, die nach 1992 ihre nächtliche Ruhe auf 8 Stunden oder mehr erhöht hatten, wiesen ein doppelt so hohes Mortalitätsrisiko auf, wobei allerdings Herz-Kreislauf-Erkrankungen als Todesursache eher unbedeutend waren.
Im Rahmen der Analysen wurde eine Vielzahl von Faktoren kontrolliert, die als Risikofaktoren mit eine Rolle spielen können: Alter, Geschlecht, Familienstand, Beruf und sozialer Status, Rauchen, körperliche Bewegung, Alkoholkonsum, Body Mass Index, Blutdruck und Cholesterinwerte, andere Erkrankungen.
Für die Risiken eines zu kurzen Schlafdauer finden die Wissenschaftler plausible Erklärungen und verweisen auch darauf, dass andere Studien schon festgestellt haben, dass zu wenig Schlaf die Entstehung von Übergewicht, Bluthochdruck und Diabtes Typ II begünstigt. Ihrem zweiten Ergebnis, dass auch eine Verlängerung der Schlafdauer hohe Gesundheitsrisiken mit sich bringt, stehen sie jedoch bislang eher ratlos gegenüber. Hierzu können sie nur Vermutungen anstellen, etwa derart, dass die längere Schlafdauer nicht die eigentliche Ursache ist, sondern nur ein Indikator für beginnende Erkrankungen (sie vermuten Krebs und Depressionen), die in den Daten der Whitehall II Studie noch nicht erkannt und dokumentiert waren.
Die Ergebnisse der Studie werden in Kürze in der Zeitschrift "Sleep" veröffentlicht.
Hier ist eine Pressemitteilung der Universität Warwick: Researchers say lack of sleep doubles risk of death… but so can too much sleep
Gerd Marstedt, 27.9.2007
Ernährungsgewohnheiten in der Unterschicht: Die Differenzen zur Gesamtbevölkerung sind geringer als erwartet
 Eine wesentlicher Erklärungsfaktor für die geringere Lebenserwartung von Angehörigen unterer Sozialschichten und ihre stärkere Betroffenheit von chronischen Erkrankungen wird dem gesundheitlichen Risikoverhalten zugeschrieben. Rauchen, wenig körperliche Bewegung, ungesunde Ernährung, so die gängige wissenschaftliche These, ist wesentlich öfter verbreitet in unteren Sozialschichten, in Arbeiterfamilien oder bei Beziehern niedriger Einkommen oder Sozialleistungen. Eine umfassende britische Studie zu den Ess- und Trinkgewohnheiten in einkommensschwachen Haushalten hat diese Einsicht nun jedoch in Frage gestellt oder zumindest relativiert.
Eine wesentlicher Erklärungsfaktor für die geringere Lebenserwartung von Angehörigen unterer Sozialschichten und ihre stärkere Betroffenheit von chronischen Erkrankungen wird dem gesundheitlichen Risikoverhalten zugeschrieben. Rauchen, wenig körperliche Bewegung, ungesunde Ernährung, so die gängige wissenschaftliche These, ist wesentlich öfter verbreitet in unteren Sozialschichten, in Arbeiterfamilien oder bei Beziehern niedriger Einkommen oder Sozialleistungen. Eine umfassende britische Studie zu den Ess- und Trinkgewohnheiten in einkommensschwachen Haushalten hat diese Einsicht nun jedoch in Frage gestellt oder zumindest relativiert.
Die Daten für diese neuen Erkenntnisse stammen aus der "Ernährungsstudie bei Niedrigeinkommen" ("Low Income Diet and Nutrition Survey LIDNS", die von der halbstaatlichen britischen Food Standards Agency in Auftrag gegeben und von mehreren wissenschaftlichen Einrichtungen durchgeführt wurde. In persönlichen Interviews und in wiederholten Telefonbefragungen wurden rund 3.700 Bürger/innen aus etwa 2.500 Haushalten akribisch über ihre täglichen Speisen und Getränke, ihre körperlichen Aktivitäten, ihre Rauchgewohnheiten und den Alkoholkonsum befragt. Einbezogen waren in diese Stichprobe nur Haushalte, die im Hinblick aus das Gesamteinkommen den untersten 15 Prozent angehören.
Das zentrale Ergebnis der Studie war für die Wissenschaftler einigermaßen verblüffend. Entgegen vielen landläufigen Vorurteilen unterscheiden sich Angehörige der unteren Sozialschicht nicht besonders stark von britischen Normalbürgern, auch wenn man in einigen Punkten Unterschiede herausfand. Als bedeutungsvoll wird in Pressemitteilungen und auch im Vorwort des Ergebnisberichts jedoch nicht herausgestellt, dass nun die Ärmsten im Königreich sich besonders ungesund ernähren, sondern dass die Gesamtbevölkerung in einer Vielzahl von Aspekten die wissenschaftlichen Empfehlungen zu gesunder Ernährung missachtet. Zentrales Fazit war daher: "Die Kluft zwischen Niedrigverdienern und dem Rest der Bevölkerung ist im Hinblick auf die Ernährungsgewohnheiten nicht so groß wie bisweilen befürchtet, obwohl dieses Verhalten in einigen Punkten als etwas weniger gesund zu bezeichnen ist."
Als Ergebnisse fand man im Einzelnen:
• Die Art und auch Menge der Nahrungsmittel, die typischer Weise in Haushalten unterer Sozialschichten bzw. von Niedrigstverdienern auf den Tisch kommt, unterscheidet sich nur sehr geringfügig vom Speiseplan der Durchschnittsbevölkerung. So zeigt sich etwa im Hinblick auf Gemüse und Obst, dass diese Nahrungsmittel weitaus seltener als von Ernährungs-Wissenschaftlern empfohlen konsumiert werden - aber diese Empfehlung wird in allen Schichten kaum beherzigt.
• Unterschiede in der schichtspezifischen Ernährung werden vor allem deutlich, wenn man verschiedene Altersgruppen unterscheidet sowie Männer und Frauen. Hier zeigt sich etwa, dass Kinder und Jugendliche aus der Unterschicht sich ungesünder ernähren (z.B. mehr zuckerhaltige Erfrischungsgetränke, Chips, Pizzas usw.), andererseits werden in der Altersgruppe ab 65 nur noch geringe Unterschiede zum Bevölkerungsdurchschnitt deutlich.
• Differenzen zeigen sich trotz der relativ großen Ähnlichkeit der Speisepläne weiterhin bei einigen Nahrungsmitteln. So kommen in ärmeren Haushalten weniger Vollkorn-Produkte und Gemüse auf den Tisch. Gleichzeitig werden mehr Soft Drinks getrunken, wird öfter mit Nitraten vorbehandeltes Fleisch (Würste, Hamburger, Kebap, Schinken, Speck usw.) verzehrt, werden teilweise (je nach Alter und Geschlecht) auch mehr Chips, Pizzas und Pommes Frites gegessen und im Haushalt wird mehr Zucker verwendet.
Eine Diskussion der Studienergebnisse hinsichtlich der Frage, inwieweit nun der Einfluss einer gesunden Ernährung auf Lebenserwartung und spätere chronische Erkrankungen neu definiert werden muss, steht noch aus. Der Bericht selbst erleichtert eine Stellungnahme und Diskussion nicht besonders: Vergleichsdaten aus einer nationalen britischen Stichprobe (NDNS) zu den einzelnen Indikatoren finden sich nicht durchgängig in den Tabellen, sondern nur unsystematisch und verstreut auf den insgesamt 800 Seiten des Berichts.
• Hier ist eine Pressemitteilung mit den wichtigsten Ergebnissen
• Auf dieser Seite findet man Links zu mehreren Dokumenten des Ergebnisberichts
Gerd Marstedt, 16.7.2007
"Soft Drinks": Nicht nur Dickmacher, sondern auch Mitverursacher von Diabetes
 Die klassischen "Erfrischungsgetränke", sind zwar kaum noch im Trend und stagnieren im Absatz. Durch eine geschickte Verwandlung von Sprudel und Limonade zu Fitness- und Energy-Drinks hat es die Getränke-Industrie jedoch geschafft, ihre Umsätze noch zu steigern. Dass diese "Soft Drinks" indes in gesundheitlicher Hinsicht überaus problematisch sind und mit eine Ursache von Übergewicht und Diabetes, hat jetzt erneut eine Studie belegt. Ausgewertet wurden dabei die Ergebnisse von insgesamt 88 schon veröffentlichten wissenschaftlichen Publikationen.
Die klassischen "Erfrischungsgetränke", sind zwar kaum noch im Trend und stagnieren im Absatz. Durch eine geschickte Verwandlung von Sprudel und Limonade zu Fitness- und Energy-Drinks hat es die Getränke-Industrie jedoch geschafft, ihre Umsätze noch zu steigern. Dass diese "Soft Drinks" indes in gesundheitlicher Hinsicht überaus problematisch sind und mit eine Ursache von Übergewicht und Diabetes, hat jetzt erneut eine Studie belegt. Ausgewertet wurden dabei die Ergebnisse von insgesamt 88 schon veröffentlichten wissenschaftlichen Publikationen.
Die Ergebnisse der jetzt in der Zeitschrift "American Journal of Public Health" veröffentlichten Meta-Analyse werden von den Autoren folgendermaßen zusammengefasst: "Wir fanden eindeutige Zusammenhänge zwischen der Einnahme von Soft Drinks einerseits sowie der Energieaufnahme und dem Körpergewicht andererseits. Dieser Effekt zeigte sich ebenso zwischen dem Soft Drink Konsum und einer reduzierten Einnahme von Milch, Kalzium und anderen wichtigen Ernährungsgrundlagen. Damit zusammen hängt auch ein erhöhtes Risiko für verschiedene Erkrankungen (wie z.B. Diabetes)."
Nach eigener Aussage waren die Autoren am meisten überrascht von dem überaus klaren Zusammenhang zwischen dem Soft-Drink-Konsum und dem Risiko, an Diabetes-II zu erkranken. Während es für diesen Zusammenhang eine sehr eindeutige empirische Basis durch eine große Längsschnittstudie gibt, waren die Befunde für andere Erkrankungen nicht ganz so deutlich. Hervorgehoben werden außerdem folgende Befunde: Methodisch bessere Studien mit größeren Stichproben fanden auch stärkere Zusammenhänge zu den verwendeten Indikatoren (Körpergewicht, Erkrankungsrisiken). Und nicht überraschend zeigte sich auch: Studien, die von der Industrie finanziert waren, kamen zu Ergebnissen, die Soft Drinks weitaus weniger als gesundheitlich problematisch belasten.
Ein Abstract der Meta-Analyse ist hier zu finden: Effects of Soft Drink Consumption on Nutrition and Health: A Systematic Review and Meta-Analysis ((Am J Public Health. 2007;97:667-675. doi:10.2105/AJPH.2005.083782)
Die in der Meta-Analyse zitierte, sehr aussagekräftige Studie zum Zusammenhang von Soft-Drink-Konsum und Diabetes war im Jahr 2004 in der Zeitschrift JAMA veröffentlicht worden. Berichtet wurde dort über eine 8jährige Verlaufsstudie mit über 80.000 Frauen. Als Ergebnis hatte sich dort gezeigt: Frauen, die im Beobachtungszeitraum einen oder mehr Soft Drinks pro Tag zu sich genommen hatten, wiesen (neben einer deutlichen Gewichtszunahme) ein doppelt so hohes Erkrankungsrisiko für Diabetes (Typ II) auf im Vergleich zu Frauen, die solche Getränke seltener oder gar nicht zu sich genommen hatten. In dieser Analyse waren andere Faktoren, die ebenfalls ein Erkrankungsrisiko darstellen können, miterfasst und statistisch berücksichtigt worden. Gezeigt hatte sich dabei auch, dass das Diabetes-Risiko insbesondere zurückzuführen war auf Getränke, die mit Zucker angereichert waren.
Diese Studie ist hier kostenlos im Volltext nachzulesen: Sugar-sweetened beverages, weight gain, and incidence of type 2 diabetes in young and middle-aged women (JAMA. 2004 Aug 25;292(8):927-34)
Gerd Marstedt, 14.7.2007
Armut und Alkohol in Russland: Fast jeder zweite Todesfall durch das Trinken hochprozentiger Parfüme, Reinigungsmittel
 Dass Russen ihren Wodka etwa in der Menge zu sich nehmen wie Franzosen ihren Rotwein, war ebenso bekannt wie die Tatsache, dass in der Statistik der Todesursachen durch übermäßigen Alkoholkonsum Russland recht weit vorne rangiert. Die realen und überaus beklagenswerten Ausmaße des armutsbedingten Alkoholismus in einer typischen russischen Industriestadt hat jetzt jedoch eine in der renommierten Zeitschrift "The Lancet" veröffentlichte Studie deutlich gemacht. Die Wissenschaftler aus London, Rostock und Izhevsk fanden nicht nur heraus, dass dort fast die Hälfte (43%) der Todesfälle bei 25-54jährigen durch Alkoholabusus bedingt war. Noch erschreckender war der Befund: Bei einer Vielzahl der in die Analyse einbezogenen Fälle wurde deutlich, dass die verstorbenen Personen nicht Wodka, Bier oder Wein, sondern hochprozentige alkoholhaltige Flüssigkeiten konsumiert hatten: medizinische Tinkturen, Reigungsmittel oder auch Parfüme. Im Unterschied zu Wodka mit "nur" etwa 43% Alkoholgehalt enthalten diese sehr viel billigeren Produkte etwa 60-97% reinen Alkohol.
Dass Russen ihren Wodka etwa in der Menge zu sich nehmen wie Franzosen ihren Rotwein, war ebenso bekannt wie die Tatsache, dass in der Statistik der Todesursachen durch übermäßigen Alkoholkonsum Russland recht weit vorne rangiert. Die realen und überaus beklagenswerten Ausmaße des armutsbedingten Alkoholismus in einer typischen russischen Industriestadt hat jetzt jedoch eine in der renommierten Zeitschrift "The Lancet" veröffentlichte Studie deutlich gemacht. Die Wissenschaftler aus London, Rostock und Izhevsk fanden nicht nur heraus, dass dort fast die Hälfte (43%) der Todesfälle bei 25-54jährigen durch Alkoholabusus bedingt war. Noch erschreckender war der Befund: Bei einer Vielzahl der in die Analyse einbezogenen Fälle wurde deutlich, dass die verstorbenen Personen nicht Wodka, Bier oder Wein, sondern hochprozentige alkoholhaltige Flüssigkeiten konsumiert hatten: medizinische Tinkturen, Reigungsmittel oder auch Parfüme. Im Unterschied zu Wodka mit "nur" etwa 43% Alkoholgehalt enthalten diese sehr viel billigeren Produkte etwa 60-97% reinen Alkohol.
Die Statistik zeigt für Russland eine erschreckend niedrige Lebenserwartung auf. Sie beträgt nur 59 Jahre für Männer und 72 Jahre für Frauen - das sind etwa 20-25 Jahre weniger als in Deutschland. Verschiedene internationale Studien zum Alkoholkonsum haben gezeigt, dass Russland mit etwa 13-15 Liter reinem Alkohol pro Kopf und Jahr (bei über 15jährigen) sehr weit vorne rangiert. Und die Sterblichkeitsquote der Russen und Russinnen im Alter von 25-65 Jahren ist etwa dreimal so hoch wie in Mitteleuropa. Ob es zwischen diesen Zahlen Zusammenhänge gibt, wollte das Forschungsteam etwas genauer prüfen.
In der Industriestadt Ischewsk im Ural untersuchten sie im Zeitraum von 2003 bis 2005 insgesamt etwa 3.500 Männer, von denen die Hälfte in dieser Zeit verstarb. Von besonderem Interesse waren die Trinkgewohnheiten der Befragten: Wann und wie oft wurde wieviel Wodka, Bier oder anderes Hochprozentige konsumiert? Aber auch andere Aspekte wurden von den insgesamt 34 speziell geschulten Interviewern erfragt: Ob man raucht, Alter, Familienstand und Bildungsniveau waren von Interesse. Bei diesen persönlichen Interviews wurden dann ebenso überraschende wie erschreckende Details deutlich: Ein erheblicher Teil der später als "Problemtrinker" eingestuften Teilnehmer offenbarte, dass sie häufiger aus finanziellen Gründen nicht zum Wodka, sondern zu hochprozentigen anderen Flüssigkeiten griffen, die eigentlich nicht als Getränk verkauft werden: Eau de Cologne und Parfüm, medizinische Tinkturen, Reinigungsmittel für den Haushalt.
Als nach Abschluss der Befragungen später dann bei den etwa 1.800 Todesfällen von Interviewteilnehmern ein Zusammenhang zum Alkohol hergestellt wurde zeigte sich:
• Ein sechsfach erhöhtes Sterberisiko zeigte sich für sogenannte "Problemtrinker" (mit sehr häufigem Konsum großer Alkoholmengen) und ebenso für Personen, die häufiger hochprozentige, aber billige Flüssigkeiten zu sich genommen hatten, die nicht als Getränk verkauft wurden.
• Sogar ein neunfach erhöhtes Risiko zeigte sich für Trinker, die immer auf Billigalkohol zurück griffen und solchen, die dies nie taten.
• 43 Prozent, also fast die Hälfte aller Todesfälle bei Männern im arbeitsfähigen Alter in einer typischen russischen Industriestadt könnten nach Ansicht der Forscher auf problematischen Alkoholkonsum zurückzuführen sein, das ist weitaus mehr als eine frühere Studie (mit einer Schätzung von 27%) gezeigt hat.
Ein Abstract der Studie ist hier nachzulesen: Alcohol consumption and public health in Russia (Lancet, Volume 369, Issue 9578, 16 June 2007-22 June 2007, Pages 1975-1976)
Leider gehen die Wissenschaftler auf die sozialen Hintergründe des Problemtrinkens und insbesondere auch des Konsums von Billig-Alkohol in Haushaltsprodukten so gut wie gar nicht ein. Eine andere Veröffentlichung aus den Reihe des Forscherteams macht allerdings deutlich, wie stark der Zusammenhang von Armut (gemessen am Bildungsniveau, beruflicher Stellung, Erwerbstätigkeit oder Einkommen) und dem Konsum von Alkohol - und insbesondere auch tödlichem Billigalkohol - ist. Dort zeigt sich etwa: Männer der untersten Bildungsschicht trinken im Vergleich zu solchen aus höheren Bildungsniveaus etwa 8mal so oft "Surrogat-Alkohol" (Parfüm, Reigungsmittel usw.), haben etwa 5mal so oft einen "zapoi" (Rückzug aus dem normalen Leben) und etwa 4mal so oft einen schweren Alkoholkater.
Diese Studie ist hier kostenlos im Volltext verfügbar: Prevalence and socio-economic distribution of hazardous patterns of alcohol drinking: study of alcohol consumption in men aged 25-54 years in Izhevsk, Russia (Addiction, Volume 102 Issue 4 Page 544-553, April 2007)
Gerd Marstedt, 20.6.2007
Wissenschaftler sind sich einig: Alkohol und Tabak sind schädlicher als Cannabis
 Eine Veröffentlichung in der renommierten medizinischen Fachzeitschrift "The Lancet" hat jetzt gezeigt, dass eine große Zahl von Wissenschaftlern, darunter auch Mediziner und Spezialisten im Bereich Sucht, die Risiken und Gesundheitsgefahren der ganz legalen Drogen Tabak und Alkohol sehr viel höher einstufen als beispielsweise die in vielen Ländern illegale Droge Cannabis (Haschisch, Marihuana). In der Studie wurde der Versuch unternommen, endlich zu einer wissenschaftlich fundierten Bewertung der Schädlichkeit von Drogen und Betäubungsmitteln zu kommen und dabei mit Vorurteilen und irrationalen Einschätzungen aufzuräumen. Ausgangspunkt der Arbeit war die in Großbritannien in einem Gesetz ("Misuse of Drugs Act of 1971") festgelegte Klassifizierung von Betäubungsmitteln in drei Gruppen, wobei in der Gruppe A (überaus schädlich) beispielsweise Ecstasy, LSD und Heroin zu finden sind, in der unteren Gruppe C (weniger schädlich) Tranquilizer wie Valium und Librium, aber auch Cannabis. Tabak und Alkohol sind in der gesetzlichen Vorlage nicht erwähnt.
Eine Veröffentlichung in der renommierten medizinischen Fachzeitschrift "The Lancet" hat jetzt gezeigt, dass eine große Zahl von Wissenschaftlern, darunter auch Mediziner und Spezialisten im Bereich Sucht, die Risiken und Gesundheitsgefahren der ganz legalen Drogen Tabak und Alkohol sehr viel höher einstufen als beispielsweise die in vielen Ländern illegale Droge Cannabis (Haschisch, Marihuana). In der Studie wurde der Versuch unternommen, endlich zu einer wissenschaftlich fundierten Bewertung der Schädlichkeit von Drogen und Betäubungsmitteln zu kommen und dabei mit Vorurteilen und irrationalen Einschätzungen aufzuräumen. Ausgangspunkt der Arbeit war die in Großbritannien in einem Gesetz ("Misuse of Drugs Act of 1971") festgelegte Klassifizierung von Betäubungsmitteln in drei Gruppen, wobei in der Gruppe A (überaus schädlich) beispielsweise Ecstasy, LSD und Heroin zu finden sind, in der unteren Gruppe C (weniger schädlich) Tranquilizer wie Valium und Librium, aber auch Cannabis. Tabak und Alkohol sind in der gesetzlichen Vorlage nicht erwähnt.
Die Wissenschaftler unternahmen zunächst den Versuch, ein neues Bewertungsschema für die Einstufung der "Schädlichkeit" von Drogen zu entwerfen. Dabei unterschieden sie drei theoretische Dimensionen:
• Das Risiko körperlicher Schäden und Erkrankungen: Dabei werden kurzfristige, aber auch langfristige Folgen berücksichtigt, wie sie beispielsweise für Tabak oder Alkohol durch viele Studien belegt sind. Eingeschlossen wird hier auch das Risiko psychischer Störungen.
• Das Risiko von Sucht und Abhängigkeit: Berücksichtigt werden in dieser Dimension sowohl die psychische als auch die körperliche Abhängigkeit.
• Soziale Gefahren: Hierbei werden Risiken eingeschlossen, die sich durch den Drogengebrauch auf soziale Kontakte und die Familie auswirken, aber auch finanzielle Belastungen, die sich für die gesundheitliche Versorgung und soziale Fürsorge Abhängiger ergeben.
In einem ersten Schritt ließen die Wissenschaftler dann 14 verschiedene Drogen, von Heroin und Kokain über Amphetamine und Barbiturate bis hin zu Tabak und Alkohol von 29 Medizinern bewerten. Alle Mediziner waren Spezialisten im Bereich "Sucht" und Mitglieder des "Royal College of Psychiatrists". Die Bewertung erfolgte für jede Droge innerhalb der drei neu entwickelten Dimensionen (körperliche Schäden, Abhängigkeit, soziale Risiken) mit einem Urteil 1, 2 oder 3 für die jeweilige Schädlichkeit.
Nachdem so sicher gestellt war, dass die Bewertungstabelle mit 3 Dimensionen und 3 Schädlichkeitsstufen überhaupt von medizinischen Wissenschaftlern als seriös und praxistauglich akzeptiert wird, folgte in einem zweiten Schritt eine noch fundiertere Bewertung von Drogen. Die Forscher führten dazu ein sog. "Delphi-Experiment" durch, eine Befragung von Experten, bei der in mehreren Stufen Einschätzungen zu wissenschaftlich ungeklärten Fragen durchgeführt werden. Die Teilnehmer bekommen dabei in jeder Stufe neue Informationen zur Fragestellung und können ihre vorherigen Aussagen aufgrund des neuen Informationsstandes korrigieren.
Konkret bedeutete dies, dass in einer Reihe von Gruppensitzungen mit jeweils 8-16 Experten, darunter Pharmakologen und Mediziner, Suchtexperten und Psychiater, insgesamt 20 verschiedene Drogen jeweils einzeln bewertet wurden. In allen Gruppensitzungen wurden neue Forschungsergebnisse zu den Drogen vorgestellt, die zugrunde liegenden Studien diskutiert und ein Meinungsbild erstellt. Abschließend gab dann, teilweise erst nach mehreren Sitzungen, jeder Teilnehmer eine Drogenbewertung innerhalb des neuen Bewertungsschemas ab.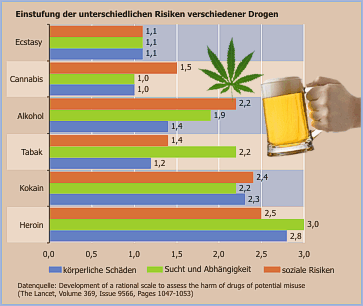
Das Ergebnis war überraschend: Einige der im englischen Gesetz in der höchsten Schädlichkeitsklasse zu findenden Drogen (wie LSD und Ecstasy) wurden in der neuen wissenschaftlichen Bewertung eher in eine mittlere bis untere Risiko-Gruppe eingestuft. Und umgekehrt bekamen die im Gesetz überhaupt nicht berücksichtigten Drogen Alkohol und Tabak jetzt eine Einstufung im mittleren bis oberen Risikobereich. In der Skala der schädlichsten Drogen rangieren in der neuen wissenschaftlichen Bewertung Heroin, Kokain, Barbiturate an vorderster Stelle, dicht gefolgt von Alkohol, Amphetaminen und Tabak. Cannabis liegt erst auf Platz 11, LSD auf Platz 14 und Ecstasy auf Platz 18.
Für einzelnen Drogen gaben die Wissenschaftler unterschiedliche Einstufungen auf drei Risiko-Skalen an: Risiko körperlicher Schäden, Sucht- und Abhängigkeits-Gefahren, soziale Risiken. Dabei stellt der Wert 3 ein maximales Risiko dar, der Wert 0 keinerlei Risiko. Die Grafik verdeutlicht die Bewertungs-Ergebnisse.
Ein Abstract der Studie ist hier nachzulesen: Development of a rational scale to assess the harm of drugs of potential misuse (The Lancet, Volume 369, Issue 9566, 24 March 2007-30 March 2007, Pages 1047-1053)
Hier findet man den (kostenpflichtigen) Volltext der Studie
Gerd Marstedt, 23.3.2007
Alkoholkonsum in Europa: Deutsche sind im Vergleich zu EU-Nachbarn eher moderate Trinker
 In einer speziellen Umfrage der EU "Einstellungen zum Alkoholkonsum" wurden 25.000 EU-Bürgern in insgesamt 25 Staaten befragt, um die Häufigkeit und Menge und Alkoholkonsums näher zu erfassen, aber auch, um Meinungen zu möglichen Schutzmaßnahmen (wie Warnhinweise auf alkoholhaltigen Getränken, Preiserhöhungen und Senkungen der Promillegrenze) auszuloten. Hintergrund der Befragung waren sowohl die jüngst bekannt gewordenen Fälle von Alkoholexzessen bei Jugendlichen, aber auch der schon länger bekannte statistische Befund, dass Alkoholmissbrauch zu jährlich etwa 195.000 Todesfällen in der EU führt und jeder vierte Todesfall bei jungen Männern im Alter zwischen 15 und 29 Jahren auf schädlichen Alkoholkonsum zurückzuführen ist.
In einer speziellen Umfrage der EU "Einstellungen zum Alkoholkonsum" wurden 25.000 EU-Bürgern in insgesamt 25 Staaten befragt, um die Häufigkeit und Menge und Alkoholkonsums näher zu erfassen, aber auch, um Meinungen zu möglichen Schutzmaßnahmen (wie Warnhinweise auf alkoholhaltigen Getränken, Preiserhöhungen und Senkungen der Promillegrenze) auszuloten. Hintergrund der Befragung waren sowohl die jüngst bekannt gewordenen Fälle von Alkoholexzessen bei Jugendlichen, aber auch der schon länger bekannte statistische Befund, dass Alkoholmissbrauch zu jährlich etwa 195.000 Todesfällen in der EU führt und jeder vierte Todesfall bei jungen Männern im Alter zwischen 15 und 29 Jahren auf schädlichen Alkoholkonsum zurückzuführen ist.
Das aus den Umfragergebnissen ableitbare Trinkprofil der Deutschen zeigt, dass diese im europäischen Vergleich eher moderate Trinker sind. Deutsche nahmen zu 71% in den letzten 30 Tagen Alkohol in irgendeiner Form und Menge zu sich. In der EU sind es 66%, deutlich höher liegen jedoch Dänen und Niederländer (84%). Auch bei der Häufigkeit des Alkoholkonsums sind andere Länder vor uns platziert. Über 4-7maligen Alkoholgenuss in der Woche berichten nur 15% der Deutschen (EU: 21%, Portugal 55%, Italien 40%). Und auch das Vollrauschtrinken ist nicht Spezialdisziplin der Deutschen, nur 5% nehmen 5 oder mehr Drinks zu sich, wenn sie einmal Alkohol konsumieren (EU: 10%, Irland 34%, Dänemark, England, Finnland ca. 25%)
Im europäischen Vergleich zeigte sich bei den Ergebnissen:
• Mehr Männer als Frauen konsumieren überhaupt Alkohol, und Männer konsumieren auch größere Mengen an Alkohol als Frauen. In der Umfrage gaben 84 % der männlichen Befragten an, sie hätten im letzten Jahr Alkohol getrunken, bei Frauen waren es dagegen nur 68 %.
• 35 % der Männer gaben an, mehr als drei alkoholische Getränke hintereinander getrunken zu haben, wenn sie Alkohol genossen hatten, bei Frauen überwiegt eine deutliche geringere Menge an Drinks.
• Jeder zehnte Europäer trinkt fünf oder mehr alkoholische Getränke hintereinander, was der weit verbreiteten Definition des Rauschtrinkens bei Männern entspricht.
• Diese Zahl ist besonders hoch bei den jüngsten Befragten. Fast jeder Fünfte in der Altersgruppe der 15- bis 24-Jährigen (19 %) trinkt fünf oder mehr alkoholische Getränke hintereinander, bei den Älteren (ab 55) sind dies nur noch 4%.
• Es gibt beträchtliche nationale Unterschiede, so geben 34 % der irischen Befragten an, dass sie sich regelmäßig bis zur Besinnungslosigkeit betrinken. In Finnland (27 %), dem Vereinigten Königreich (24 %) und in Dänemark (23%) ist es jeder Vierte. Andererseits betrinken sich in Italien und Griechenland nur 2 % der Befragten und nur 4 % in Portugal regelmäßig bis zur Besinnungslosigkeit. Auch die Deutschen sind hier eher zurückhaltend (5 %).
• Über völlige Alkoholabstinenz in den letzten 12 Monaten berichtet jeder vierte Europäer. In Italien, Ungarn, Portugal und Spanien trifft dies sogar für mehr als jeden dritten zu, in Deutschland nur für jeden Fünften.
Bei der Frage, ob der Staat eingreifen solle, um Bürger vor den Folgen eines übermäßigen Alkoholkonsums zu schützen oder ob dies Angelegenheit jedes einzelnen sei, zeigte sich eine gespaltene Meinung in der EU. 52% meinten, dafür sei jeder individuell verantwortlich, 44% wünschten sich Schutzmaßnahmen von staatlicher Seite. Bei den in der Umfrage angesprochenen Schutzmaßnahmen zeigte sich dann:
• 79% befürworten es, gesundheitliche Warnhinweise auf Alkoholflaschen und Anzeigen anzubringen, um Schwangere und Autofahrer vor den Gefahren des Alkoholkonsums zu warnen.
• 76 % begrüßen das Verbot von Alkoholwerbung, die auf junge Menschen abzielt.
• Fast drei Viertel (73 %) wären mit der Einführung eines niedrigeren Grenzwerts von 0,2 g/l für den Blutalkoholgehalt bei jungen und unerfahrenen Autofahrern einverstanden
• 80 % der Befragten sind der Meinung, dass Zufallsstichproben der Polizei dem Problem des Alkohols am Steuer entgegenwirken würden.
In der Frage, ob Preiserhöhungen eine sinnvolle Maßnahme sei, regte sich dann aber bei einer Mehrheit Widerspruch. Die meisten Befragten meinten, dass höhere Alkoholpreise junge Menschen und starke Trinker nicht abschrecken würden. 62 % erklärten, sie würden nicht weniger alkoholische Getränke kaufen, selbst wenn der Preis um 25 % ansteigen würde. Jüngere Befragte lassen sich indes von Preiserhöhungen stärker beeinflussen: 44 % der jüngsten Befragten meinten, dass sie bei einer Preiserhöhung von 25 % weniger Alkohol kaufen würden.
Die Ergebnisse der Umfrage, mit zahlreichen Tabellen und Grafiken, Aufgliederung der Ergebnisse nach Ländern und Bevölkerungsgruppen (Geschlecht, Alter usw.) sind hier als PDF-Datei (76 Seiten) verfügbar:
Eurobarometer 66.2: Attitudes towards alcohol
Gerd Marstedt, 16.3.2007
Studienberichte über "gesunde Drinks": Finanzierungen durch die Industrie fördern positive Resultate
 Dass Arzneimittelstudien, die von der Pharma-Industrie gesponsert sind, im Vergleich zu staatlich oder universitär geförderten Studien ganz überwiegend zu positiven Ergebnissen für die von ihnen untersuchten Medikamente kommen, ist schon seit längerem bekannt. Eine neuere Veröffentlichung in der Zeitschrift PLOS Medicine hat jetzt jedoch deutlich gemacht, dass dieser Einfluss der Finanzierung auf die wissenschaftlichen Resultate auch für andere Produkte, in diesem Fall nicht-alkoholische Getränke (Milch, Obstsäfte, Drinks) gilt, die auf dem Gesundheitsmarkt eine große Rolle spielen.
Dass Arzneimittelstudien, die von der Pharma-Industrie gesponsert sind, im Vergleich zu staatlich oder universitär geförderten Studien ganz überwiegend zu positiven Ergebnissen für die von ihnen untersuchten Medikamente kommen, ist schon seit längerem bekannt. Eine neuere Veröffentlichung in der Zeitschrift PLOS Medicine hat jetzt jedoch deutlich gemacht, dass dieser Einfluss der Finanzierung auf die wissenschaftlichen Resultate auch für andere Produkte, in diesem Fall nicht-alkoholische Getränke (Milch, Obstsäfte, Drinks) gilt, die auf dem Gesundheitsmarkt eine große Rolle spielen.
Die Wissenschaftler aus Boston und Washington hatten Veröffentlichungen in wissenschaftlichen Zeitschriften über gesundheitliche Effekte von Milch, Soft Drinks und Säfte, die zwischen 1999 und 2003 erschienen waren, nach mehreren Kriterien näher untersucht. Einerseits wurden die Studien danach eingestuft, zu welchem Ergebnis sie für das untersuchte Produkt kamen, ob es als gesundheitsförderlich eingestuft wurde, als eher gesundheitsriskant oder neutral. Diese Einstufung wurde von unabhängigen wissenschaftlichen Experten vorgenommen, ohne Kenntnis der zugrunde liegenden Autoren oder der Finanzierung. Zum zweiten überprüften sie auch eben diese Finanzierung der Studie, ob vollständig von Industrieunternehmen gefördert, ob ohne deren Beitrag oder in einem Mix aus Public-Private Finanzierung. Zu dieser Einstufung wurden zusätzliche Recherchen durchgeführt, um den privatwirtschaftlichen bzw. öffentlichen oder gemeinnützigen Status der finanzierenden Einrichtung zu bestimmen. Darüber hinaus wurden die Studien auch nach ihrer Methodik unterschieden (Beobachtung, Intervention, Review).
Insgesamt wurden so 206 Veröffentlichungen über wissenschaftliche Studien in die Analyse einbezogen, von denen allerdings nur 111 Angaben zu ihrer Finanzierung machten. Etwa jede fünfte Studie war danach industrie-gesponsert, etwa die Hälfte ohne Industriebeteilung und ein Drittel wies einen Finanzierungsmix auf. Die Frage nach dem Zusammenhang von Finanzierungsmodus und Studienausgang zeigte dann: "Veröffentlichungen über Studien, die nur von Lebensmittel- oder Getränke-Unternehmen finanziert waren, zeigten [je nach Arzt der Studie] vier- bis achtmal so häufig positive Ergebnisse, was die finanziellen Interessen des Sponsors anbetrifft, im Vergleich zu Studien ohne finanzielle Beteiligung privatwirtschaftlicher Unternehmen." Besonders deutlich trat dieser Zusammenhang bei Interventionsstudien auf, also Untersuchungen, bei denen einige Teilnehmer das untersuchte Produkt zu sich nahmen, andere Teilnehmer nicht. Hier zeigte sich: Keine einzige der 19 industrie-finanzierten Studien erbrachten negative Effekte (= 0%), ohne Beteiligung der Industrie lag diese Quote immerhin bei 37%.
Ein weiteres Ergebnis der Analyse war, dass die Quote der Veröffentlichungen zu industrie-gesponserten Studien im Zeitraum 1999-2003 erheblich angewachsen ist, von knapp über 40% auf knapp unter 80%. Die Wissenschaftler fassen ihre Ergebnisse so zusammen, dass die auf dem Gesundheitsmarkt sehr vielfältig und häufig verbreiteten Informationen über die angeblich gesundheitsförderliche Wirkung bestimmter Nahrungsmittel oder Getränke wahrscheinlich Verzerrungen und teilweise zu positive Ergebnisse aufweisen, eben dadurch, dass Studien mit finanzieller Unterstützung der Lebensmittelindustrie überdurchschnittlich oft zu positiven Ergebnissen kommen. Die Studie ist hier im Volltext nachzulesen: Relationship between Funding Source and Conclusion among Nutrition-Related Scientific Articles
Ein in der Tendenz völlig ähnlicher Befund war bereits 2003 berichtet worden, und zwar für Medikamente. Eine Forschergruppe aus New Haven, Connecticut/USA, hatte insgesamt 1.140 Veröffentlichungen in ähnlicher Weise darauf hin analysiert, wer die Studie finanziert hat und ob die Wirkung des Medikaments eher positiv, eher negativ oder neutral bewertet wurde. Als Ergebnis zeigte sich, dass Studien mit Unterstützung der Pharma-Industrie oder pharma-naher Einrichtungen etwa 4mal so oft zu positiven Resultaten für die Medikamente kamen wie andere Studien ohne finanzielle Beteiligung von Pharma-Unternehmen. Ein Abstract der Studie ist hier nachzulesen: Scope and impact of financial conflicts of interest in biomedical research: a systematic review
Gerd Marstedt, 11.2.2007
Alkoholbedingte Todesfälle stehen in Finnland bei den Todesursachen auf Platz 1
 Todesfälle aufgrund von Alkohol sind in den letzten Jahren in Finnland dramatisch angestiegen und waren nach einer offiziellen finnischen Statistik im Jahre 2005 erstmals die häufigste Todesursache bei Männern, noch vor Herzerkrankungen und Unfällen. Bei Frauen war der Anstieg weniger dramatisch, allerdings lagen die Todesursachen Alkoholabusus und Brustkrebs fast gleichauf. Für den steigenden Alkoholismus werden zwei Ursachen genannt. Zum einen wurde die Alkoholsteuer in Finnland erheblich gesenkt (um 40%), zum anderen sind durch die Erweiterung der EG die Grenzen nach Estland durchlässig geworden, so dass Finnen sich jetzt im Nachbarland ebenfalls sehr billig Alkoholika besorgen können.
Todesfälle aufgrund von Alkohol sind in den letzten Jahren in Finnland dramatisch angestiegen und waren nach einer offiziellen finnischen Statistik im Jahre 2005 erstmals die häufigste Todesursache bei Männern, noch vor Herzerkrankungen und Unfällen. Bei Frauen war der Anstieg weniger dramatisch, allerdings lagen die Todesursachen Alkoholabusus und Brustkrebs fast gleichauf. Für den steigenden Alkoholismus werden zwei Ursachen genannt. Zum einen wurde die Alkoholsteuer in Finnland erheblich gesenkt (um 40%), zum anderen sind durch die Erweiterung der EG die Grenzen nach Estland durchlässig geworden, so dass Finnen sich jetzt im Nachbarland ebenfalls sehr billig Alkoholika besorgen können.
Bei 17% der Todesfälle von 15-64jährigen Männern wurden Ursachen im Zusammenhang mit Alkohol festgestellt, mehr als bei ischämischen Herzkrankheiten (Angina pectoris, Koronarinsuffizienz, Herzinfarkt), die 16,6% ausmachten und Unfällen (13%). Berücksichtigt man, dass auch bei jedem dritten Suizid Alkohol im Spiel war und bei nahezu jedem zweiten tödlichen Unfall Trunkenheit des Unfallverursachers festgestellt wurde, dann erhöht sich der fatale Einfluss des Alkohols noch einmal. (vgl. Statistics Finland: Leading cause of death for working-age men is alcohol-related in 2005)
Finnische Politiker nahmen die neuen statistischen Daten mit großer Besorgtheit zur Kenntnis und beraten über Möglichkeiten, den Alkoholkonsum einzuschränken. Geplant sind u.a. Warnhinweise auf Flaschen mit alkoholischen Getränken, der Verkauf alkoholischer Getränke am Vormittag und ein Verbot der TV-Werbung für Alkohol. Jeder Finne nimmt durchschnittlich 10,5 Liter an reinem Alkohol im Jahr zu sich zu sich. In dieser Hinsicht unterscheiden sich Finnen und Deutsche allerdings kaum. So wurde nach Angaben des Robert-Koch-Instituts für das Jahr 2001 ein Pro-Kopf-Verbrauch an alkoholischen Getränken in Höhe von 152,8 Litern für Deutschland berechnet . Dies entspricht einer Menge von 10,5 Litern reinem Alkohol pro Einwohner, also exakt so viel wie in Finnland im Jahr 2005. Bei den Todesfällen durch Alkohol allerdings zeigen deutsche Statistiken sehr viel niedrigere Werte: Im Jahr 1996 waren 17.561 Todesfälle in Deutschland eindeutig dem Konsum von Alkohol zuzuschreiben, 42.000 Todesfälle waren mit Alkohol assoziiert. Dies entspricht einer Quote direkt oder indirekt alkoholbedingter Todesursachen von etwa 7% in Deutschland. (vgl. RKI: Gesundheitsbericht Alkoholkonsum) Die Deutsche Hauptstelle gegen die Suchtgefahren geht von derzeit rund 2,5 Millionen behandlungsbedürftigen Alkoholkranken in Deutschland aus.
Die sehr unterschiedlichen Quoten der Todesursachen durch Alkohol in Finnland und Deutschland trotz einer vergleichbaren Menge an Alkoholgenuss dürften zu einem erheblichen Teil also auch bedingt sein durch Unterschiede in der Versorgung Alkoholkranker oder auch unterschiedliche Gepflogenheiten bei der Feststellung von Todesursachen. Dies wurde auch deutlich an den in deutschen Bundesländern festgestellten Daten. Mecklenburg-Vorpommern weist zum Beispiel mehr als doppelt so viele "Alkoholtote" wie der bundesweite Durchschnitt auf (38 auf 100.000 Todesfälle), ähnliche hohe Werte zeigen auch Sachsen-Anhalt und Bremen (jeweils 32), Brandenburg (30) und Sachsen (29). Auf der anderen Seite finden sich in Baden-Württemberg, Bayern und Hessen nur sehr wenig alkoholbedingte Todesfälle (13-14). (vgl. Information zur unterschiedlichen Häufigkeit wegen Alkoholkonsums gestorbener Menschen in den neuen und alten Bundesländern)
Finnland liegt zwar, was den Alkoholkonsum anbetrifft, zusammen mit anderen skandinavischen Ländern nach WHO- und OECD-Statistiken recht weit vorne. In einem Punkt allerdings finden sie ihren "Meister" in einem anderen Land, und zwar, was den Anteil der sog. Alkohol-Exzesse anbetrifft. Damit angesprochen ist der Anteil des Konsums großer Mengen an Alkohol zu einem Zeitpunkt ("Besäufnisse") am Alkohol-Gesamtkonsum. Hier liegen die Engländer (United Kingdom) unangefochten vorne. Bei Männern im UK machen diese Alkohol-Exzesse 40% des Alkoholgesamtkonsums aus, in Schweden 33%, in Finnland 29% und in Deutschland lediglich 14%. (vgl. WHO: Gesundheit im Schlaglicht: Deutschland 2004)
Gerd Marstedt, 31.1.2007
Neues Themenheft zur Gesundheitsberichterstattung: "Körperliche Aktivität"
 Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat ein neues Heft zum Thema "Körperliche Aktivität" in der Reihe "Gesundheitsberichterstattung des Bundes" herausgeben und zum Download bereit gestellt. Auf 26 Seiten wird der aktuelle Forschungsstand auf der Basis deutscher und internationaler Studien dargestellt. Für Deutschland liegen neuere Daten zugrunde, die auf dem telefonischen Gesundheitssurvey 2003 basieren.
Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat ein neues Heft zum Thema "Körperliche Aktivität" in der Reihe "Gesundheitsberichterstattung des Bundes" herausgeben und zum Download bereit gestellt. Auf 26 Seiten wird der aktuelle Forschungsstand auf der Basis deutscher und internationaler Studien dargestellt. Für Deutschland liegen neuere Daten zugrunde, die auf dem telefonischen Gesundheitssurvey 2003 basieren.
Berichtet wird beispielsweise
• über gesundheitliche Risiken körperlicher Inaktivität,
• über die Verbreitung von körperlicher und sportlicher Aktivität in Deutschland, auch differenziert nach Schichtzugehörigkeit, Alter und Geschlecht,
• über Häufigkeit und Dauer sportlicher Aktivitäten im europäischen Vergleich,
• über verfügbare Ressourcen in Deutschland (Sportstätten, Fitness-Studios).
In der Studie wird sehr nachdrücklich unterschieden zwischen "Sport" und "körperlicher Aktivität", die sehr viel umfassender ist und zum Beispiel auch Haus- und Berufsarbeit, Treppensteigen, Fahrradfahren oder Gartenarbeit umfasst. Unter Berücksichtigung dieser Unterscheidung zeigt sich dann, dass Deutsche im europäischen Vergleich körperlich überdurchschnittlich oft aktiv sind (Platz 2 hinter den Niederlanden), während sie gleichzeitig nur durchschnittlich oft Sport betreiben (Platz 9). Allerdings sind Spanier, Belgier und Italiener noch sportfauler als Deutsche.
Heft 26 des RKI "Körperliche Aktivität"
Gerd Marstedt, 28.8.2005