



Home | Patienten | Gesundheitssystem | International | GKV | Prävention | Epidemiologie | Websites | Meilensteine | Impressum
Sämtliche Rubriken in
"Epidemiologie"
Andere Themen |
Alle Artikel aus:
Epidemiologie
Andere Themen
Häufigkeit sozialer Kontakte (z.B. Besuche, Gruppenaktivitäten) und Sterblichkeitsrisiken assoziiert
 Mittel einer prospektiven Kohortenanalyse mit Daten zu 5 Merkmalen sozialer Kontakte oder Verbindungen der 458.146 Angehörigen der Biobank Großbritanniens/UK Biobank und den Daten verschiedener Sterblichkeitsregister untersuchte eine Gruppe von Wissenschaftler:innen der Universität Glasgow Zusammenhänge der Gesamt-Sterblichkeit und der Sterblichkeit an kardiovaskulären Erkrankungen. Als Indikatoren für soziale Kontakte wurden zwei funktionale Merkmale, nämlich die Häufigkeit sich jemandem anvertrauen zu können und das Gefühl, einsam zu sein und drei strukturelle Merkmale ausgewählt. Letztere waren die Häufigkeit, mit der man monatlich von Freunden und Familienangehörigen besucht wird, wöchentliche Gruppenaktivitäten unternahm und alleine oder zusammen mit Haushaltsangehörigen lebte.
Mittel einer prospektiven Kohortenanalyse mit Daten zu 5 Merkmalen sozialer Kontakte oder Verbindungen der 458.146 Angehörigen der Biobank Großbritanniens/UK Biobank und den Daten verschiedener Sterblichkeitsregister untersuchte eine Gruppe von Wissenschaftler:innen der Universität Glasgow Zusammenhänge der Gesamt-Sterblichkeit und der Sterblichkeit an kardiovaskulären Erkrankungen. Als Indikatoren für soziale Kontakte wurden zwei funktionale Merkmale, nämlich die Häufigkeit sich jemandem anvertrauen zu können und das Gefühl, einsam zu sein und drei strukturelle Merkmale ausgewählt. Letztere waren die Häufigkeit, mit der man monatlich von Freunden und Familienangehörigen besucht wird, wöchentliche Gruppenaktivitäten unternahm und alleine oder zusammen mit Haushaltsangehörigen lebte.
In dem durchschnittlichen Untersuchungszeitraum von 12,6 Jahren starben insgesamt 7,2 % der Biobank-Angehörigen, 1,1 % an kardiovaskulären Erkrankungen.
Eine Reihe statistischer VerknĂĽpfungen einzelner oder kombinierter Merkmale der sozialen Kontakte mit den beiden Sterblichkeitsindikatoren lassen u.a. folgende Assoziationen (hazard ratio) erkennen:
• Im Vergleich mit Personen, die täglich Besuche von Freunden und/oder Familienangehörigen erhielten und nicht alleine lebten, war das gesamte Sterblichkeitsrisiko fĂĽr Personen, die zwar täglich Besuche erhielten aber alleine lebten um 19 % höher.
• Dieses Risiko war fĂĽr Personen, die niemals Besuche bekamen aber nicht alleine lebten um 33 % höher als bei den Personen, die tägliche Besuche von Freunden und/oder Familienangehörigen erhalten und nicht alleine lebten.
• Wer niemals Besuche bekam und alleine lebte hatte ein um 77 % höheres Sterblichkeitsrisiko als die Vergleichspersonen mit Besuchern und weiteren Haushaltsangehörigen.
• Bei den Personen deren funktionalen und strukturellen Komponenten sozialer Kontakte negativ ausgeprägt waren, war das Risiko an einer kardiovaskulären Erkrankung zu sterben, um 63 % höher als bei den Personen, bei denen beide Komponenten positiv ausgeprägt waren.
Der am 10. November 2023 veröffentlichte 17 Seiten umfassende Aufsatz Social connection and mortality in UK Biobank: a prospective cohort analysis von Hamish M. E. Foster, Jason M. R. Gill, Frances S. Mair, Carlos A. Celis-Morales, Bhautesh D. Jani, Barbara I. Nicholl, Duncan Lee und Catherine A. O'Donnell ist in der Fachzeitschrift "BMC Medicine"- volume 21, Article number: 384 (2023) - als "open access"-Beitrag erschienen und komplett erhältlich.
Dort gibt es auch eine ausführliche Darstellung der aufwändigen Methodik der Studie und ihrer Ergebnisse, eine vergleichende Diskussion der Ergebnisse anderer thematisch ähnlicher Studien und die Limitationen der Studie.
Bernard Braun, 11.11.23
"Closing borders is ridiculous" (A. Tegnell), und zahlreiche Studien bestätigen dies seit vielen Jahren.
 Gerade weil selbst die noch vor wenigen Tagen und Wochen wortstärksten Protagonisten von Grenzschließungen und jeglichen Reisebeschränkungen in ihren laufenden Meinungsumschwung Bemerkungen einfließen lassen, es gäbe eigentlich keine oder nur schwache Evidenz für die präventive Wirksamkeit dieser Maßnahmen, muss daran erinnert werden, dass dafür nicht erst seit Mai 2020 Belege existieren.
Gerade weil selbst die noch vor wenigen Tagen und Wochen wortstärksten Protagonisten von Grenzschließungen und jeglichen Reisebeschränkungen in ihren laufenden Meinungsumschwung Bemerkungen einfließen lassen, es gäbe eigentlich keine oder nur schwache Evidenz für die präventive Wirksamkeit dieser Maßnahmen, muss daran erinnert werden, dass dafür nicht erst seit Mai 2020 Belege existieren.
Wenn im weiteren Verlauf der Kommunikation über und des Umgangs mit Covid-19 nach Beispielen für folgenreiches Handeln entgegen vorhandenem Wissen gesucht wird, eignen sich die Grenzschließungen im besonderen Maße.
Dass Grenzschließungen bei einer Epidemie "in den meisten Fällen ineffektiv" sind, also weder die Ausbreitung zu Beginn der Pandemie noch nach einer weltweiten Verbreitung des Virus eine zweite, dritte oder weitere Wellen höchstens etwas verzögert aber nicht verhindert werden könnte, wird in zahlreichen Studien und systematischen Reviews seit vielen Jahren nachgewiesen. Dass trotz minimal möglichen positiven Effekten diese stets auch noch gegen mögliche negative Effekte von Schließungen (z.B. sozialer und wirtschaftlicher Art) abgewogen werden müssen, gehört zu den Standards des Umgangs mit Studienergebnissen.
Für die Schließungs-Protagonisten in Deutschland besonders peinlich ist, dass zu diesem Schluss- allerdings noch vor der Sars-Cov-2-Pandemie - die Autor*innen des vom Robert-Koch-Institut (RKI) herausgegebenen Nationaler Pandemieplan Teil II. Wissenschaftliche Grundlagen seit 2007 und auch noch in seiner letzten Fassung aus dem Jahr 2016 kamen. Der damalige Forschungsstand wurde so zusammengefasst: "Zum Thema Grenzschließungen als Maßnahme der Übertragung von Influenza wurde ein Review des ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC): Guide to public health measures to reduce the impact of influenza pandemics in Europe: 'The ECDC Menu' 2009) identifiziert. In diesem wird von Grenzschließungen klar abgeraten. Zusammenfassung: An den Grenzen ist ebenfalls eine Vielzahl an Maßnahmen denkbar. Bezüglich des Einreise- und Ausreise-Screening (Entry- und Exit-Screening) besteht theoretische und empirische Einigkeit, dass diese Maßnahme aufwendig und ineffektiv ist. Es ist allenfalls, selbst bei sehr gewissenhafter und lückenloser Durchführung eine Verzögerung der pandemischen Welle von 1 - 2 Wochen zu erwarten. Als Alternative vorgeschlagen wurde die Durchführung gleichzeitiger, mehrerer informativer Maßnahmen sowohl für Reisende als auch primärversorgende Ärzte. Von Grenzschließungen wird abgeraten."
Da dies schlicht und einfach überlesen oder stillschweigend ignoriert wurde, kam es noch nicht einmal zu einer durchaus zulässigen Diskussion, ob dies auch für das "neuartige" Sars-CoV-2-Virus gilt oder nicht.
Ein im "Bulletin of the World Health Organization" 2014 veröffentlichter systematischer Review über 23 seit den Nuller Jahren durchgeführten Studien fand für sämtliche Formen der Reisebeschränkungen durch Grenzschließungen oder den Stopp von Flugverbindungen lediglich "limited effectiveness", wobei der minimale Nutzen mögliche zeitliche Verzögerungen der Verbreitung waren.
Zusammengefasst: "It seems likely that, for delaying the spread and reducing the magnitude of an epidemic in a given geographical area, a combination of interventions would be more effective than isolated interventions. Travel restrictions per se would not be sufficient to achieve containment in a given geographical area, and their contribution to any policy of rapid containment is likely to be limited."
Der Review Effectiveness of travel restrictions in the rapid containment of human influenza: a systematic review von Ana LP Mateus , Harmony E Otete , Charles R Beck , Gayle P Dolan und Jonathan S Nguyen-Van-Tam ist im "Bulletin of the World Health Organization" (2014;92:868-880) erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Für diejenigen aber, die meinen (könnten), dies gelte für das grenzüberschreitende Potenzial des Sars-Cov-2-Virus nicht, lieferte eine im März 2020 veröffentlichte Publikation über die Verbreitung des Virus zu Beginn der Covid-19-Pandemie mit Daten aus China in der Zeitschrift "Science" (komplett erhältlich: The effect of travel restrictions on the spread of the 2019 novel coronavirus (COVID-19) outbreak von Matteo Chinazzi et al. in "Science" (Vol. 368, Issue 6489: 395-400)) folgende Erkenntnisse: "The travel quarantine around Wuhan has only modestly delayed the spread of disease to other areas of mainland China. This finding is consistent with the results of separate studies on the diffusion of SARS-CoV-2 in mainland China. The model indicates that although the Wuhan travel ban was initially effective at reducing international case importations, the number of imported cases outside mainland China will continue to grow after 2 to 3 weeks. Furthermore, the modeling study shows that additional travel limitations (up to 90% of traffic) have only a modest effect unless paired with public health interventions and behavioral changes that can facilitate a considerable reduction in disease transmissibility. The model also indicates that, despite the strong restrictions on travel to and from mainland China since 23 January 2020, many individuals exposed to SARS-CoV-2 have been traveling internationally without being detected. Moving forward, we expect that travel restrictions to COVID-19-affected areas will have modest effects and that transmission reduction interventions will provide the greatest benefit for mitigating the epidemic."
Eine Gruppe US-amerikanischer Wissenschaftler*innen von der Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health mahnte in ihrem "integrative review of the limited evidence on international travel bans" bei politischen Entscheidungen Folgendes zu beachten: "When assessing the need for, and validity of, a travel ban, given the limited evidence, it's important to ask if it is the least restrictive measure that still protects the public's health, and even if it is, we should be asking that question repeatedly, and often."
Der Integrative review of the limited evidence on international travel bans as an emerging infectious disease disaster control measure von Nicole A. Errett et al. ist in der Januar/Februar-Ausgabe 2020 des "Journal of Emergency Management" (2020; 18 (1): 7-14) erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
14 renommierte Spezialist*innen für Infektionskrankheiten aus der gesamten Welt veröffentlichten schließlich im April 2020 in der Fachzeitschrift "International Journal of Infectious Diseases" einen dringenden Appell für die künftige Erforschung der Umstände von Reisebeschränkungen unter Pandemiebedingungen. Ihren Überlegungen zugrunde liegt die folgende Erkenntnis: "Travel bans to affected areas or denial of entry to passengers coming from affected areas are usually not effective in preventing the importation of cases but have a significant economic and social impact."
Auch der kurze Aufruf COVID-19 travel restrictions and the International Health Regulations - Call for an open debate on easing of travel restrictions in der Zeitschrift "International Journal of Infectious Diseases" (94 (2020) 88-90) ist kostenlos zugänglich.
Leider nur für Abonnenten komplett zugänglich ist eine ausgezeichnete Zusammenfassung der Erkenntnisse zu Grenzschließungen Grenzen auf von Christina Berndt und Markus Grill in der "Süddeutschen Zeitung" vom7. Mai 2020. Die Autoren weisen dort u.a. darauf hin, dass Flugreisebeschränkungen bis hin zur Einstellung des Flugverkehrs auch völlig unerwünschte negative Auswirkungen haben kann. Impfstoffe gegen andere Krankheiten und andere Hilfsgüter kommen dann nämlich auch nicht mehr z.B. in Ländern der Dritten Welt an.
Bernard Braun, 18.5.20
"Für Firmen packt man die Bazooka aus, für Eltern nicht mal die Wasserpistole" (SZ 4.5.2020) Eltern, Corona-Pandemie in Österreich
 Dass Eltern von Kita- und schulpflichtigen Eltern, die erwerbstätig sind, durch die Corona-Lockdowns besonders unter dem Neben- und der tendenziellen Unvereinbarkeit von Homeoffice, ganztägiger häuslicher Kinderbetreuung, Homeschooling und normalem Leben zu leiden haben, war von Beginn an klar. Weder die akute Situation noch die möglichen langfristigen sozialen und psychischen Folgen für Eltern und Kinder führte aber zu mehr als den wohlfeilen Etikettierungen als "Alltagshelden" oder "systemrelevant". Eine ähnliche Kluft zwischen Risiko-Rhetorik (Hochrisikogruppen) und Nichtstun (fehlende Schutzausrüstung) existierte wochenlang beim Umgang mit der Lage in Alten- und Pflegeheimen. Warum ausgerechnet besonders vulnerable Gruppen lange Zeit und zum Teil bis heute nicht im Zentrum von Hilfsbemühungen standen, sollte bei der Aufarbeitung von Corona-Risikokommunikation und -management besonders thematisiert werden.
Dass Eltern von Kita- und schulpflichtigen Eltern, die erwerbstätig sind, durch die Corona-Lockdowns besonders unter dem Neben- und der tendenziellen Unvereinbarkeit von Homeoffice, ganztägiger häuslicher Kinderbetreuung, Homeschooling und normalem Leben zu leiden haben, war von Beginn an klar. Weder die akute Situation noch die möglichen langfristigen sozialen und psychischen Folgen für Eltern und Kinder führte aber zu mehr als den wohlfeilen Etikettierungen als "Alltagshelden" oder "systemrelevant". Eine ähnliche Kluft zwischen Risiko-Rhetorik (Hochrisikogruppen) und Nichtstun (fehlende Schutzausrüstung) existierte wochenlang beim Umgang mit der Lage in Alten- und Pflegeheimen. Warum ausgerechnet besonders vulnerable Gruppen lange Zeit und zum Teil bis heute nicht im Zentrum von Hilfsbemühungen standen, sollte bei der Aufarbeitung von Corona-Risikokommunikation und -management besonders thematisiert werden.
Wie es Eltern in der Corona-Pandemie ging und geht, lässt sich jetzt recht plastisch einer Befragungsstudie in Österreich entnehmen. Dazu befragte das sozialwissenschaftliche Institut SORA in Wien zwischen dem 14. und 22. April 2020 524 Eltern von Kindern unter 15 Jahren. Da die Lockdownmaßnahmen ähnlicher Art wie in Deutschland waren und sich wahrscheinlich auch sonst die sozialen Verhältnisse nicht grundlegend unterscheiden, sind die Ergebnisse auch für die Lage von Eltern in Deutschland aussagefähig.
Die wesentlichen Ergebnisse in Schlagzeilen aus der Kurzfassung des Studienberichts lauten:
• "Je niedriger der soziale Status, desto wahrscheinlicher sind Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit." "Auch die Nutzung vom Home-Office unterscheidet sich, je nach Bildungsstand: Unter AkademikerInnen arbeiten mehr als zwei Drittel (67%) im Corona-bedingten Homeoffice. Hingegen sind es bei Menschen mit maximal Pflichtschulabschluss nur 11% - hier müssen 55% der Eltern wie immer zum Arbeitsplatz reisen." Wie dann Zwangs-Kinderbetreuung funktioniert, hat die Studie nicht erhoben, stressfrei mit Sicherheit aber nicht.
• "Home-Office führt nicht zu besserer Vereinbarkeit: Eltern arbeiten weniger und nachts"
• "Kinderbetreuung: Mehr als 10.000 Kinder bei Oma und Opa" - und dies obwohl ja Großeltern zu den (Hoch-)Risikopersonen gehören! "11% aller Eltern sagen, sie müssen ihre Kinder derzeit einen Teil des Tages auch unbetreut Zuhause lassen, unter AlleinerzieherInnen sind es 17%."
• "Mütter weiterhin hauptverantwortlich für die Kinderbetreuung. Die Coronakrise hat nicht zu einer gerechteren Aufteilung der Verantwortung für die Kinderbetreuung geführt. In der aktuellen Krise haben zwar 23% der Väter die Hauptverantwortung für die Kinderbetreuung übernommen, dies vor allem in jenen Haushalten, in denen die Männer derzeit zuhause sind und die Frauen weiterhin ihrer Arbeit auswärts nachgehen müssen. Mütter bleiben in 42% aller Haushalte hauptverantwortlich für die Betreuung ihrer Kinder."
• "Mehr als die Hälfte der Mütter sehr stark belastet. Fast die Hälfte (46%) der befragten Eltern gibt an, dass die derzeitige Situation sie sehr stark belastet. Die Belastungen sind jedoch nicht gleich verteilt: Während Männer zu 40% angeben, unter der derzeitigen Situation zu leiden, sind es unter Frauen bzw. Müttern 51%. Das liegt nicht daran, dass Mütter die Vereinbarkeit von Berufs- und Familienleben grundsätzlich negativer bewerten: Vor der Krise haben Mütter die Vereinbarkeit sogar positiver gesehen als ihre Partner, aktuell ist es umgekehrt."
• Und zum schlechten Schluss noch ein Ausblick auf den Sommer: "Jede/r Vierte vor großen Problemen. Die Hälfte der Eltern hat für die Kinderbetreuung Urlaubstage verbraucht, dies betrifft vor allem Doppelverdiener-Haushalte und Beschäftigte ohne Möglichkeit auf Home-Office. Jedes vierte Elternteil schätzt deshalb, im Sommer nicht genug Urlaubstage für die Kinderbetreuung zu haben. Ebenso viele wissen nicht, wie sie die durchgängige Betreuung der Kinder im Sommer leisten sollen. Fast die Hälfte gibt an, sich keine externe Betreuung im Sommer leisten zu können, in der ArbeiterInnenschicht sind es 59%, unter Alleinerziehenden 71%."
Wer mehr Details wissen will kann den im Mai 2020 veröffentlichten 29-seitigen Endbericht Zur Situation von Eltern während der Coronapandemie von Daniel Schönherr kostenlos herunterladen.
Bernard Braun, 6.5.20
Ehemänner-Stress zwischen Alleinverdienerlast und Zweitverdiener"schmach". Die Macht und Hartnäckigkeit von Geschlechterrollen
 Auch wenn es im Durchschnitt immer noch die so genannte "gender pay gap" gibt, d.h. eine trotz oft gleicher Tätigkeit und Leistung geringere Bezahlung von Frauen, steigt mit der wachsenden Frauen- und Ehefrauenerwerbstätigkeit auch deren Anteil am Haushaltseinkommen.
Auch wenn es im Durchschnitt immer noch die so genannte "gender pay gap" gibt, d.h. eine trotz oft gleicher Tätigkeit und Leistung geringere Bezahlung von Frauen, steigt mit der wachsenden Frauen- und Ehefrauenerwerbstätigkeit auch deren Anteil am Haushaltseinkommen.
Ob und wie sich dies auf das Wohlbefinden oder die psychische Gesundheit ihrer Ehepartner auswirkt, hat jetzt eine Wissenschaftlerin der britischen Universität von Bath mit über 15 Jahren erhobenen Daten (insgesamt 19.688 Einzelbeobachtungen) der "Panel Study of Income Dynamics (PSID)" von 6.034 us-amerikanischen heterosexuellen Partnern untersucht und ist zu paradoxen Ergebnissen für das Selbstbewusstsein und die Geschlechtsrollenidentität von Männern gelangt.
• Erstens fühlen sich Ehemänner in der Rolle als Alleinverdiener des Haushaltseinkommens negativ gestresst (Disstress gemessen mit der "Kessler Psychological Distress Scale (K6)") was zu einer Reihe von unerwünschten gesundheitlichen Problemen führen kann bzw. führt.
• Zweitens fühlen sich Ehemänner dann am wenigsten gestresst, wenn ihre Ehefrauen erwerbstätig sind und mit ihrem Einkommen bis zu 40% zum Haushaltseinkommen beitragen.
• Drittens fühlen sich Ehemänner dann schnell zunehmend gestresst und "uncomfortable", wenn ihre Ehefrauen mehr als 40% des Haushaltseinkommens verdienen. Überschreitet dieser Anteil die 50%-Grenze, nehmen sich die Ehemänner als ökonomisch völlig abhängig wahr und erreichen den höchsten Stressgrad.
Für die Geschlechterforschung interessant sind in diesem Zusammenhang die zwischen Ehefrauen und -männern deutlich unterschiedlichen Einschätzungen des geringsten Stresslevels in Abhängigkeit von den Anteilen am Haushaltseinkommen. Während Männer dann sagen, sie seien am wenigsten wegen der Einkommen gestresst, wenn die Frauen mit 40% zum Haushaltseinkommen beitragen, meinen Ehefrauen, dies sei erst der Fall, wenn das Verhältnis 50%:50% sei - und schließen dann wahrscheinlich von sich auf ihren Partner.
Mehr über einkommensassoziierten Hintergründe mancher Verhaltens- und gesundheitlichen Symptomatik von verpartnerten Männern findet sich im Aufsatz Spousal Relative Income and Male Psychological Distress der Ökonomin Joanna Syrda, im November 2019 veröffentlicht in der Fachzeitschrift "Personality and Social Psychology Bulletin". Ein kurzes Abstract ist kostenlos erhältlich. Auf der Webseite der University of Bath findet man außerdem eine etwas längere Kurzübersicht über die Ergebnisse der Studie und ein Interview mit der Autorin.
Bernard Braun, 25.11.19
Länger leben in Gesundheit? Ja, aber mit erheblichen und zunehmenden sozialen Unterschieden. Das Beispiel Schweiz.
 Die Lebenserwartung der gesamten Bevölkerung nimmt in den meisten entwickelten Ländern (aktuelle Ausnahme ist die USA) in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich zu.
Die Lebenserwartung der gesamten Bevölkerung nimmt in den meisten entwickelten Ländern (aktuelle Ausnahme ist die USA) in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich zu.
Die in diesem Zusammenhang wichtige Frage ist, ob damit auch die Lebenszeit in gutem Gesundheitszustand zunimmt oder zumindest ein Teil der zusätzlichen Lebensjahre mit Krankheiten verbunden sind. In der darüber seit vielen Jahren heftig geführten Debatte zwischen VertreterInnen einer Medikalisierung der gewonnenen Lebensjahre oder einer "compression of morbidity" am Ende einer Reihe von gewonnenen gesunden Lebensjahre (siehe dazu mit diesen Stichworten eine Reihe von Beiträgen in diesem Forum) überwiegen Studien, welche die Kompressions-Hypothese empirisch belegen.
Unabhängig wie diese Debatte weiter- oder ausgeht, zeigt eine im November 2019 veröffentlichte Studie über die Lebenserwartung in der Schweiz zusätzliche wichtige soziale Besonderheiten ihrer Entwicklung.
Mit Daten der "Swiss National Cohort (SNC)" von 11.650.000 Personen, die zwischen 1990 und 2015 jemals in der Schweiz lebten, und mit Daten aus den "Swiss Health Surveys" kamen die WissenschaftlerInnen zu folgenden Ergebnissen:
• Im Untersuchungszeitraum stieg die Lebenserwartung von 30-jährigen Männern von 78 auf 82 (exakt: plus 5,02 Jahre) und die der gleichaltrigen Frauen von 83 auf 86 Jahre (exakt: plus 3,09 Jahre).
• 4,5 Jahre ihrer längeren Lebenszeit konnten Männer in guter Gesundheit verbringen. Bei Frauen war dies in der gesamten zusätzlichen Lebenszeit der Fall.
• Sowohl bei der Lebenserwartung als auch bei den zusätzlichen Jahre in guter (healthy life expectancy) oder schlechter (years of bad health) Gesundheit gibt es beträchtliche und auch signifikante Unterschiede zwischen Menschen mit "compulsory education" (Hauptschulabschluss), "secondary education" (Real-/Gymnasialabschluss) und "tertiary education" (Hochschulabschluss). So betrug z.B. der Unterschied der Jahre in guter Gesundheit zwischen Männern mit Haupt- und allen anderen Abschlüssen im Zeitraum 2010-2014 8,8 Jahre. Bei den Frauen betrug dieser Unterschied 2010-2014 5 Jahre.
• Entgegen manchen Erwartungen nahmen die gerade genannten sozialen Unterschiede zwischen 1990 und 2010-2014 sogar zu: Für Männer von 7,6 auf 8,8 Jahre und bei den Frauen von 3,3 auf 5 Jahre (hier könnten aber laut den AutorInnen Besonderheiten beim Zugang von Frauen zur höheren Bildung und zur Arbeitswelt in den 1920er Jahren eine Rolle spielen).
• Zur Erklärung der Unterschiede bei den untersuchten Kennziffern zur Lebenserwartung zwischen Personen mit niedrigem und hohem Bildungsabschluss verweisen die AutorInnen auf eine Marginalisierung der erstgenannten Bevölkerungsgruppe. Diese weist in der Schweiz eine deutlich überdurchschnittliche Arbeitslosenrate auf. Hinzu kämen Faktoren aus dem Gesundheitssystem wie "the unequal ability of the Swiss healthcare system to provide curative and preventive medicine to everyone" oder "out-of-pocket payments for health and unmet health care needs for financial reasons", die in der Schweiz im Vergleich mit anderen OECD-Ländern am höchsten sind.
Die Studie Longer and healthier lives for all? Successes and failures of a universal consumer-driven healthcare system, Switzerland, 1990-2014 von A. Remund, S. Cullati, S. Sieber, C. Burton-Jeangros und M. Oris ist in der Zeitschrift "International Journal of Public Health" (2019; 64 (8): 1173-1181) erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 13.11.19
Wirkt sich die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns auf die Gesundheit aus? Ja, aber etwas anders als vermutet.
 Die Einführung eines Mindestlohns war sicherlich eine der besseren sozialpolitischen Leistungen der großkoalitionären Phase Deutschlands, auch wenn die aktuelle Höhe zu niedrig ist.
Die Einführung eines Mindestlohns war sicherlich eine der besseren sozialpolitischen Leistungen der großkoalitionären Phase Deutschlands, auch wenn die aktuelle Höhe zu niedrig ist.
Da sich die Höhe des Einkommens auf die Einnahmenseite der Sozialversicherungsträger und damit auch auf die Einnahmen der Gesetzlichen Krankenversicherung auswirkt, besitzt der Mindestlohn auch gesundheitspolitische Bedeutung.
Ob sie sich auch auf die Gesundheit oder genauer gesagt auf die selbsteingeschätzte Gesundheit der NutznießerInnen des Mindestlohns auswirkt, hat jetzt eine Forschergruppe des "Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB)" der Bundesagentur für Arbeit und der Universität Erlangen-Nürnberg mittels Befragungs- und administrativen Beschäftigungsdaten von zuletzt 6.110 Personen untersucht. Die selbsteingeschätzte Gesundheit wurde mit der vielfach validierten Standardfrage "Wie würden Sie Ihren generellen Gesundheitszustand in den letzten 4 Wochen" und den fünf Antwortmöglichkeiten von sehr gut bis schlecht gemessen.
Für das Jahr 2015 kommen die IAB-Forscher nach mehreren aufwändigen statistischen Verfahren zur Ausschaltung von möglichen Störgrößen (Differenzen-in-Differenzen Schätzungen mit Propensity-Score Matching) zu folgendem Ergebnis:
• Die Einführung des Mindestlohns erhöhte die Wahrscheinlichkeit, die Gesundheit als gut oder sehr gut einzuschätzen um 8 bis 9 Prozentpunkte.
• Die Reform erhöhte die monatlichen Einkommen nicht signifikant.
• Was aber signifikant reduziert wurde, waren die wöchentlichen Arbeitsstunden, was nach den Autoren letztlich die beobachteten Verbesserungen der selbsteingeschätzten Gesundheit erklären könnte.
Spannend für eine künftige gesundheitsbezogene Arbeitszeitpolitik ist, zu überprüfen, ob der bisher nur kurzfristig gemessene gesundheitliche Effekt weiterbesteht oder z.B. eine ökonomisch mögliche Reduktion der Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich ähnliche letztlich auch wieder ökonomische Effekte hat.
Die Untersuchung Do Minimum Wages Improve Self-Rated Health? Evidence from a Natural Experiment von Lucas Hafner (University of Erlangen-Nuremberg) und Benjamin Lochner (IAB and University of Erlangen-Nuremberg) ist als "IAB-Discussion Paper 17/2019" komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 22.8.19
Global Health: Öffentliche Gesundheit in Theorie und Praxis
 Global Health steht weit oben auf der internationalen politischen Agenda. Aus gesundheitswissenschaftlicher und -politischer Sicht ist diese Entwicklung so überfällig wie begrüßenswert. Allerdings weist das gängige Verständnis von Global Health Schwächen auf und wird den komplexen Herausforderungen nur teilweise gerecht. Vor allem mangelt es an der konsequenten Umsetzung der globalen Ansätze in der heimischen Politik, denn globale Gesundheit fängt zu Hause an. Zunehmende globale Ungleichheiten bestehen in Deutschland, Europa und der gesamten Welt. Kommerzialisierung bedeutet Ausgrenzung und damit zunehmende gesundheitliche Ungleichheit. Ohne geeignete politische Weichenstellungen und Politikkohärenz wird das Recht Aller auf Gesundheit schwerlich zu gewährleisten sein. Die Auswirkungen der Globalisierung erfordern eine Stärkung und verbesserte Abstimmung von öffentlicher Gesundheitsforschung und -praxis, denn letztlich ist Global Health die folgerichtige Weiterentwicklung von Public Health in der globalisierten Welt.
Global Health steht weit oben auf der internationalen politischen Agenda. Aus gesundheitswissenschaftlicher und -politischer Sicht ist diese Entwicklung so überfällig wie begrüßenswert. Allerdings weist das gängige Verständnis von Global Health Schwächen auf und wird den komplexen Herausforderungen nur teilweise gerecht. Vor allem mangelt es an der konsequenten Umsetzung der globalen Ansätze in der heimischen Politik, denn globale Gesundheit fängt zu Hause an. Zunehmende globale Ungleichheiten bestehen in Deutschland, Europa und der gesamten Welt. Kommerzialisierung bedeutet Ausgrenzung und damit zunehmende gesundheitliche Ungleichheit. Ohne geeignete politische Weichenstellungen und Politikkohärenz wird das Recht Aller auf Gesundheit schwerlich zu gewährleisten sein. Die Auswirkungen der Globalisierung erfordern eine Stärkung und verbesserte Abstimmung von öffentlicher Gesundheitsforschung und -praxis, denn letztlich ist Global Health die folgerichtige Weiterentwicklung von Public Health in der globalisierten Welt.
In seinem Beitrag Produktions Global Health: Öffentliche Gesundheit in Theorie und Praxis in in der Zeitschrift ASU Arbeitsmedizin Sozialmedizin Umweltmedizin fordert der Fuldaer Global-Health Professor Jens Holst einen intensiveren Austausch zwischen ÖGD und theoretischer Public Health benötigt die stärkere Einbeziehung der staatlichen Öffentlichen Gesundheitsdienste in die theoretische Öffentliche Gesundheitsforschung und -lehre ebenso wie gemeinsame Forschungsprogramme und die engere Verknüpfung von Lehre und Ausbildung im ÖGD. Das ist erforderlich, um interdisziplinäre gesundheitswissenschaftliche Erkenntnisse und Empirie nicht nur in die Praxis öffentlicher Gesundheitsvor- und -fürsorge, sondern auch in wirksame Politikberatung übertragen zu können. Dabei handelt es sich keineswegs um einen Automatismus, sondern es braucht aktive Umsetzung, Förderung und Gestaltung. Eine zunehmend globale Perspektive von Wissenschaft, Praxis und Politik im Bereich Öffentliche Gesundheit kann einen wichtigen Beitrag dazu leisten.
Der Artikel steht sowohl zur Online-Lektüre als auch direkt zum Download als PDF kostenfrei zum Download zur Verfügung.
Bernard Braun, 20.8.19
Gesundheit global. Anforderungen an eine nachhaltige Gesundheitspolitik
 Global health, globale Gesundheit, steht weit oben auf der internationalen politischen Agenda. Diese Entwicklung ist aus gesundheitswissenschaftlicher und -politischer Sicht so überfällig wie begrüßenswert. Das gängige Verständnis von Global Health weist dabei allerdings einige konzeptionelle Beschränkungen auf, Reichweite und Inhalte der Diskussion werden vielfach nicht den komplexen Herausforderungen in der globalisierten Welt gerecht.
Global health, globale Gesundheit, steht weit oben auf der internationalen politischen Agenda. Diese Entwicklung ist aus gesundheitswissenschaftlicher und -politischer Sicht so überfällig wie begrüßenswert. Das gängige Verständnis von Global Health weist dabei allerdings einige konzeptionelle Beschränkungen auf, Reichweite und Inhalte der Diskussion werden vielfach nicht den komplexen Herausforderungen in der globalisierten Welt gerecht.
Heute wäre es naiv zu glauben, Gesundheit und Wohlbefinden der Menschen ließen sich allein innerhalb der eigenen Grenzen gewährleisten. Das liegt allerdings nicht so sehr an der schnelleren Ausbreitung ansteckender Krankheiten, sondern vor allem daran, dass die wesentlichen Einflussfaktoren für die Gesundheit der Bürger*innen nicht an den Grenzen eines Landes halt machen. Zwar bestimmen in der Praxis sowie in der ersten Strategie der deutschen Bundesregierung zu globaler Gesundheit - siehe dazu den entsprechenden Bericht im Forum Gesundheitspolitik - bis heute ein technik- und exportorientiertes und ein stark sicherheitsorientiertes Verständnis von Global Health den offiziellen Diskurs - globale Gesundheitspolitik und Gesundheitssystemstärkung versprechen weltweite Absatzmöglichkeiten für Arzneimittel, Medizintechnik und Know-how made in Germany. Aber eine international ausgerichtete Gesundheitspolitik, die primär auf die Sicherung nationaler Territorien und Bevölkerungen durch Schutz vor grenzüberschreitenden Gesundheitsgefahren zielt, verstellt den Blick auf die Komplexität des Themas; darauf verweist auch die Deutsche Plattform für Globale Gesundheit, wie das Forum im August 2014 berichtete.
Die Herausforderungen an die internationale Gesundheitspolitik gehen tatsächlich weit über biomedizinische, pharmakologische und technologische Forschung und den Export von Know-how, Arzneimitteln und Medizintechnik hinaus. Was globale Gesundheitspolitik umfasst und berücksichtigen muss, um wirksam zur Verbesserung der Gesundheit der Menschen auf diesem Globus beizutragen, zeigt der in der März/April-Ausgabe der Fachzeitschrift Dr. Med. Mabuse erschienene, hier kostenfrei verfügbare Artikel Gesundheit global. Anforderungen an eine nachhaltige Gesundheitspolitik von Jens Holst.
David Klemperer, 12.8.19
Schwachstelle mehrjähriger Gesundheitssurveys: sinkende und dabei noch sozial selektiv sinkende Beteiligung
 Bevölkerungsumfragen zu einer Fülle von Gesundheitsfragen haben einen festen und zunehmenden Stellenwert in der gesundheitswissenschaftlichen und -politischen Diskussion. Sie bieten auch die Möglichkeit für zeitliche und internationale Vergleiche.
Bevölkerungsumfragen zu einer Fülle von Gesundheitsfragen haben einen festen und zunehmenden Stellenwert in der gesundheitswissenschaftlichen und -politischen Diskussion. Sie bieten auch die Möglichkeit für zeitliche und internationale Vergleiche.
Eine im April 2018 erschienene Studie über die in Finnland seit 25 Jahren durchgeführten Surveys zur gesundheitlichen Lage weist aber auf mögliche Verzerrungen und Beeinträchtigungen der Repräsentativität von Ergebnissen durch die insgesamt aber auch selektiv sinkende Bereitschaft sich an solchen Befragungen zu beteiligen hin.
Dazu untersuchten die ForscherInnen die soziale Zusammensetzung (Indikatoren: Bildungsniveau und Beschäftigungsstatus) in sechs Querschnittsbefragungen des FINRISK-Surveys zwischen 1987 und 2012. Da es für diese Surveys einen Link zu nationalen Personenregistern gibt, ist es möglich die soziale Zusammensetzung von Surveyteilnehmern und -nichtteilnehmern zu ermitteln.
Die Ergebnisse sahen so aus:
• Die Teilnehmerraten sanken in allen Untergruppen der befragten Bevölkerung. Die Abnahme der Beteiligung an dem Survey sank aber am stärksten und schnellsten in der Gruppe der Personen mit niedrigem Bildungsniveau. Bezüglich des Beschäftigungssstatus gab es kaum Unterschiede. Die jährliche Abnahme der Beteiligungsbereitschaft an diesem Survey betrug bei Männern oder Frauen mit höherem Bildungsniveau 0,9 oder 0,7 Prozentpunkte und bei Männern und Frauen mit niedrigem Bildungsniveau 1,3 oder 1,4 Prozentpunkte.
• Die AutorInnen weisen noch darauf hin, dass es Hinweise für ähnliche Entwicklungen der TeilnehmerInnenrate in den USA, Australien, den Niederlanden und Dänemark gibt.
Angesichts der möglichen Verzerrungen bei der Repräsentativität jedes solcher Surveys und der Gefahr falscher Ergebnisse von Vergleichen mehrerer Survey-Wellen mit unterschiedlicher sozialer Zusammensetzung weisen die finnischen ForscherInnen darauf hin, dies sowohl bei allen bisherigen Ergebnissen zu beachten als auch in künftigen Surveys über methodische Verbesserungen nachzudenken, wie die beschriebenen Effekte vermieden oder vermindert werden können.
Dazu schlagen sie u.a. vor: "To prevent the increase of bias in estimates and the deterioration of the representativeness of health surveys, we should pay particular attention to the recruitment of those who are less willing to participate or hard to reach. For example, telephone interview has been found out to reach people with low education better than postal survey. Previous studies have shown that even small monetary incentives can increase the response rates and that paying an incentive may be especially useful among the groups that would otherwise be under-represented among respondents. Thus, participation could be increased by tailoring the recruitment separately for different socio-economic groups. ... It is also important to consider using methods for missing data handling, such as multiple imputation or weighting methods and to include possible socio-economic factors in calculations."
Die Studie Participation rates by educational levels have diverged during 25 years in Finnish health examination surveys von Jaakko Reinikainen, Hanna Tolonen, Katja Borodulin, Tommi Härkänen, Pekka Jousilahti, Juha Karvanen, Seppo Koskinen, Kari Kuulasmaa, Satu Männistö und Harri Rissanen ist im "European Journal of Public Health" (Volume 28, Issue 2, 1 April 2018, Pages 237-243) erschienen. Ein Abstract ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 19.3.19
Kosten der Medikalisierung nichtmedizinischer Probleme - Eine defensive Schätzung für die USA und nicht nur für sie.
 Die Pathologisierung und Medikalisierung von nichtmedizinischen Problemen zu medizinisch oder pharmakologisch behandlungsbedürftigen Erkrankungen oder Störungen - auch als "disease mongering" bezeichnet - ist ein weltweit nicht seltenes Phänomen.
Die Pathologisierung und Medikalisierung von nichtmedizinischen Problemen zu medizinisch oder pharmakologisch behandlungsbedürftigen Erkrankungen oder Störungen - auch als "disease mongering" bezeichnet - ist ein weltweit nicht seltenes Phänomen.
Um welche Probleme es sich handelt und wie hoch die Kosten dieser eigentlich nicht notwendigen medizinischen Versorgung sind, berechneten us-amerikanische Soziologen für die USA im Jahr 2005. Da diese Art von Medikalisierung mit Sicherheit nicht ab- sondern eher noch zugenommen hat, sind die berechneten Zahlen auch 2019 noch von Relevanz.
In Übereinstimmung mit zahlreichen dazu durchgeführten Studien bezogen die Autoren neun Arten von Störungen ("disorders") und Erkrankungen ("medical conditions") in ihre Analysen ein, die ihres Erachtens Resultat erfolgreicher Medikalisierung sind. Dazu gehören verschiedene Formen von Angst-, Schlaf- und Verhaltensstörungen, normale Traurigkeit, Teile einer normalen Schwangerschaft, Körperbildprobleme, Potenzstörungen, Teile der Probleme in der Menopause, bestrimmte Probleme mit dem Körpergewicht und mit Störungen aufgrund des Konsums von legalen oder illegalen Stoffen.
Die direkten Kosten für die medizinische Behandlung dieser Gruppe von medikalisierten Zuständen betrugen in den USA im Jahr 2005 77,1 Milliarden US-Dollar. Dies entsprach einem Anteil von 3,9% an den gesamten Gesundheitsausgaben. Am meisten wurde mit 18,3 Mrd. $ und 12,4 Mrd. $ für medizinisch nicht notwendige Behandlungen von normal Schwangeren und kosmetische plastische Chirurgie ausgegeben. Zur möglichen Meinung, dass 77,1 Mrd. $ nicht besonders viel wären, weisen die Autoren darauf hin, dass im selben Jahr für die Behandlung von Herzerkrankungen "nur" 56,7 Mrd. $ und für die Krebsbehandlung 39,9 Mrd. $ ausgegeben wurden.
Abschließend weisen die Autoren darauf hin, dass es auch noch indirekte Kosten der Medikalisierung geben dürfte, welche die volkswirtschaftliche Bedeutung von Medikalisierung noch ein Stück vergrößern dürfte. Außerdem habe Medikalisierung auch noch gesellschaftliche Wirkungen, indem sie eine Grundlage der objektiv falschen Behauptung darstellt, die gesundheitliche Situation der Bevölkerung in Ländern wie den USA oder Deutschlands verschlechtere sich ständig und/oder epidemisch.
Würde man die Berechnungen aktualisieren und auch noch z.B. die vielfältige Medikalisierung des Alterns (z.B. das meiste was die Basis von Anti-Ageing darstellt) aber auch des Erwachsenwerdens (z.B. Teile der Auslöser von kieferorthopädischen Behandlung für Kinder und Jugendliche) einbeziehen, könnten die Kosten von Medikalisierung wahrscheinlich zu einem zweistelligen Anteil an sämtlichen Gesundheitsausgaben anwachsen.
Und wie sieht es in Deutschland aus: Es gibt keine vergleichbaren Studien, die darauf hindeuten, dass sowohl das Phänomen der Medikalisierung als auch die daraus resultierenden Kosten und gesellschaftlichen Effekte in Deutschland nicht existieren oder wesentlich geringer wären - im Gegenteil.
Der Aufsatz Estimating the costs of medicalization von Peter Conrad, Thomas Mackie und Ateev Mehrotra ist in der Zeitschrift "Social Science & Medicine" (Volume 70, Issue 12, June 2010, Pages 1943-1947) erschienen. Ein Abstract und eine Videozusammenfassung der Ergebnisse durch Peter Conrad sind kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 21.2.19
Verlässlichkeit und Nutzen der Antwort auf die Frage nach dem selbst wahrgenommenen Gesundheitszustand erneut bestätigt
 Bereits eine Reihe von methodisch hochwertigen Studien in den 2000-Nuller-Jahren hatten belegt, dass der mit einer Frage mit 5 Antwortmöglichkeiten erhobene subjektiv wahrgenommene Gesundheitszustand ein einfach einsetzbarer, valider und reliabler Indikator oder Prädiktor für die aktuelle wie künftige gesundheitliche Situation ganzer Bevölkerung oder einzelner "Risikogruppen" ist (siehe dazu den 2009 verfassten Überblick Selbsteinschätzung des Gesundheitszustands: Studien bestätigen wieder einmal die Zuverlässigkeit dieses Indikators). Kritisiert wurde an diesem Indikator, dass er überwiegend in Ländern mit höherem oder hohem Einkommen getestet wurde, d.h. nicht für Ländern mit niedrigem oder mittlerem Einkommen tauglich ist.
Bereits eine Reihe von methodisch hochwertigen Studien in den 2000-Nuller-Jahren hatten belegt, dass der mit einer Frage mit 5 Antwortmöglichkeiten erhobene subjektiv wahrgenommene Gesundheitszustand ein einfach einsetzbarer, valider und reliabler Indikator oder Prädiktor für die aktuelle wie künftige gesundheitliche Situation ganzer Bevölkerung oder einzelner "Risikogruppen" ist (siehe dazu den 2009 verfassten Überblick Selbsteinschätzung des Gesundheitszustands: Studien bestätigen wieder einmal die Zuverlässigkeit dieses Indikators). Kritisiert wurde an diesem Indikator, dass er überwiegend in Ländern mit höherem oder hohem Einkommen getestet wurde, d.h. nicht für Ländern mit niedrigem oder mittlerem Einkommen tauglich ist.
Ein Bündel von bevölkerungsbezogenen Kohortenstudien mit 16.940 TeilnehmerInnen im Alter von 65 Jahren und mehr in China, India, Cuba, Dominican Republic, Peru, Venezuela, Mexico und Puerto Rico, die im Jahre 2003 stattfanden, kam nach Berücksichtigung der sozio-demografischen Charakteristika der UntersuchungsteilnehmerInnen, deren Nutzung von Gesundheitsleistungen und verschiedenen Gesundheitsfaktoren auch für die genannten Länder zu folgenden Ergebnissen:
— Die Prävalenz eines mit dieser Frage gemessenen guten Gesundheitszustands (die Frage lautete "'how do you rate your overall health in the past 30 days' mit den Antwortmögkichkeiten von excellent bis poor) war in städtischen Gebieten höher als in ländlichen - ausgenommen in China.
— Männer wiesen einen besseren Gesundheitszustand auf als Frauen.
— Depressionen hatten in allen Ländern und unter allen Umständen die größte negative Wirkung auf den selbst erworbenen Gesundheitszustand.
— Unadjustiert zeigten Personen mit einem selbst wahrgenommenen schlechten Gesundheitszustand innerhalb der 4 Jahre nach Befragung eine Zunahme des Sterberisikos um 142% - verglichen mit den Personen, die ihren Gesundheitszustand als moderat bewerteten. Selbst nach Adjustierung mit eine Reihe von Faktoren und Bedingungen war das Sterberisiko im o.g. Vergleich um 43% höher.
Die Frage nach dem selbst wahrgenommenen Gesundheitszustand ist also auch in Ländern mit geringem oder mittlerem Einkommen ein einfaches und verlässliches Instrument um besonders bedürftige Gruppen zu identifizieren und in Ländern mit geringen Evaluationsressourcen Gesundheitsinterventionen evaluieren zu können.
Die Studie Self-rated health and its association with mortality in older adults in China, India and Latin America—a 10/66 Dementia Research Group study von Hanna Falk, Ingmar Skoog, Lena Johansson, Maëlenn Guerchet, Ingmar Skoog ist am 1. November 2017 online in der Fachzeitschrift "Age and Ageing" (Volume 46, Issue 6, Seite 932-939) erschienen. Das Abstract ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 23.11.17
Hilft das Wissen über genetische Risiken das Gesundheitsverhalten zu verändern und sind Therapien nah? Nein, eher nicht!!
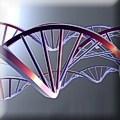 Zu den hartnäckigen mit dem Angebot von Analysen der individuellen genetischen Dispositionen und Risiken verbundenen Erwartungen und Versprechungen zu ihrem Nutzen gehört (vgl. dazu u.a. den Beitrag Das Geschäft mit Genomanalysen für Privatpersonen blüht: Krankheitsrisiken, Ernährungsratschläge, Empfehlungen zur Partnerwahl in diesem Forum), dass die NutzerInnen durch die Kenntnis ihrer DNA-basierten Erkrankungs- oder gar Sterberisiken motiviert würden gezielt ihr risikobezogenes Verhalten zu verändern. Wer also ein genetisch erkennbares und bekanntes Übergewichts- oder Herzinfarktsrisiko hat, könne und würde also seine Ernährung umstellen, das Rauchen aufhören oder sich mehr bewegen - so jedenfalls die Welt aus Sicht der Anbieter der entsprechenden Gentests.
Zu den hartnäckigen mit dem Angebot von Analysen der individuellen genetischen Dispositionen und Risiken verbundenen Erwartungen und Versprechungen zu ihrem Nutzen gehört (vgl. dazu u.a. den Beitrag Das Geschäft mit Genomanalysen für Privatpersonen blüht: Krankheitsrisiken, Ernährungsratschläge, Empfehlungen zur Partnerwahl in diesem Forum), dass die NutzerInnen durch die Kenntnis ihrer DNA-basierten Erkrankungs- oder gar Sterberisiken motiviert würden gezielt ihr risikobezogenes Verhalten zu verändern. Wer also ein genetisch erkennbares und bekanntes Übergewichts- oder Herzinfarktsrisiko hat, könne und würde also seine Ernährung umstellen, das Rauchen aufhören oder sich mehr bewegen - so jedenfalls die Welt aus Sicht der Anbieter der entsprechenden Gentests.
Angesichts der erkennbaren Zunahme des Angebots und der Nutzung solcher Tests erschien bereits 2010 ein erster Cochrane Review, der auf der Basis von damals 7 methodisch hochwertigen Studien überprüfte, ob die Welt so oder anders aussieht.
Angereichert mit den Ergebnissen von weiteren 11 Studien (nach den Kriterien von Cochrane Reviews ausgewählt nach Sichtung von 10.515 Studienabstracts) mit jeweils mehreren tausend TeilnehmerInnen erschien am 15. März 2016 ein Update dieses Reviews. Vorgestellt werden die Wirkungen der Kommunikation über Gentestergebnisse auf sieben Arten von Gesundheitsverhalten: Rauchen, Ernährung, körperliche Aktivitäten, Alkoholtrinken, Arzneimitteleinnahme, Sonnenschutz und Nutzung von Screeninguntersuchungen sowie verhaltensunterstützender Programme.
Die Ergebnisse lauten so:
• Für keine der genannten Verhaltensarten gab es einen statistisch (u.a. mit Meta-Analysen) signifikanten Effekt der Kommunikation über D• -basierte Risikoschätzungen auf das konkrete Verhalten, also z.B. mehr körperliche Bewegung oder die Beendigung des Rauchens.
• Es gab auch keine gesichert nachweisbaren Effekte auf die Motivation für Verhaltensänderungen.
• Nicht nachweisbar waren aber auch unerwünschte Effekte der Kenntnis genetischer Risiken, wie Depression oder Angst.
• Die Analyse von Untergruppen der StudienteilnehmerInnen lieferten außerdem keine klare Evidenz, dass die Kenntnis der individuellen genetischen Struktur (Genotyp) das Verhalten mehr beeinflusst als deren Nichtkenntnis.
Trotz der Eindeutigkeit der Studienlage weisen die AutorInnen des Cochrane Review aber aber auf das bisher hohe oder unklare Risiko von Verzerrungen in den analysierten Studien und die geringe Qualität der daraus gewonnenen Evidenz ("high or unclear risk of bias, and evidence was typically of low quality") hin.
Trotzdem sollte ihre Zusammenfassung der Evidenz jede Hoffnung, dass man etwas so Komplexes wie das gesundheitsbezogene Verhalten mit den Ergebnissen von Gentests steuern könne, abbremsen, wenn nicht gar stoppen: "Existing evidence does not support expectations that such interventions could play a major role in motivating behaviour change to improve population health."
Unabhängig davon verdienen aber die Fortschritte der DNA-Analysen mit den dadurch gewonnenen Einsichten in die Komplexität von Erkrankungen, die Untergruppen von Erkrankten und die möglichen positiven Auswirkungen auf die Entwicklung wirksamer Therapeutika auch hohe Aufmerksamkeit von Gesundheitswissenschaftlern.
Zum Einlesen und einem Hauch von Problembewusstsein lohnt sich z.B. ein ebenfalls gerade erschienener Aufsatz über die Bestimmung von molekularen Untertypen von jungen Personen mit einer neurologischen Entwicklungsstörung wie Autismus, intellektuelle Behinderung, Epilepsie oder Schizophrenie.
Die Autoren beginnen mit einer keineswegs selbstverständlichen zurückhaltenden Vorstellung ihres Versuchs, Patienten mit diesen Erkrankungen genetisch zu differenzieren und erst dann therapeutische Verbesserungen liefern zu können: "We propose that grouping patients on the basis of a shared genetic etiology is a critical first step in tailoring improved therapeutics to a defined subset of patients."
Was dies trotz modernster und schnellster Gen-Sequenziertechnik rein quantitativ bedeutet, machen sie daran klar, dass zwischen 500 und 1.000 Gene zur Ätiologie des Autismus beitragen, hinter intellektuellen Behinderungen mehr als 1.000 Gene stehen und auch an Epilepsie und Schizophrenie 500 bzw. 600 Gene beteiligt sind.
Selbst dann, wenn diese Zusammenhänge quantitativ zutreffend sind, räumen die AutorInnen ein, dass "hundreds of ND risk genes remain undiscovered or have not been associated with NDs with sufficient statistical significance owing to ultra-low mutation frequencies in the patient population".
Damit wird auch klar warum sie bei praktischen Ergebnissen dieser Forschung insgesamt zurückhaltend argumentieren: "Classifying patients into subgroups with a common genetic etiology and applying treatments tailored to the specific molecular defect they carry is likely to improve management of neurodevelopmental disease in the future."
Ob andere Studien mit wesentlich bestimmteren Aussagen über die strenge Determiniertheit anderer Krankheiten durch wenige Gene bzw. deren Mutationen und bevorstehende oder bald mögliche gentechnische Interventionen, wirklich zutreffen, lohnt eine intensivere Beschäftigung - trotz der zum Teil schwer verständlichen Fachbegrifflichkeiten.
Der Review The impact of communicating genetic risks of disease on risk-reducing health behaviour: systematic review with meta-analysis. von Hollands GJ, French DP, Griffin SJ, Prevost AT, Sutton S, King S und Marteau TM ist im Fachjournal "British Medical Journal" (352: i1102) als open access-Text erschienen und damit vollständig kostenlos erhältlich.
Das ausgewählte Beispiel aus der laufenden gentechnischen und -medizinischen Forschung Molecular subtyping and improved treatment of neurodevelopmental disease von Holly A. F. Stessman, Tychele N. Turner und Evan E. Eichler ist am 25. Februar 2015 als "open access"-Aufsatz in der Fachzeitschrift "Genome Medicine" (8: 22) erschienen und kostenlos erhältlich. Sämtliche dort veröffentlichten Fachaufsätze kann man nach einer Anmeldung kostenlos erhalten.
Bernard Braun, 25.3.16
Gibt es kausale, assoziative oder keine Zusammenhänge zwischen der Teilnahme am Golfkrieg und Erkrankungen - und welche?
 Mit dem Erscheinen des zehnten Bandes endet eine mehrjährige Untersuchung des möglichen Zusammenhangs des Einsatzes von Soldaten der US-Armee im so genannten Golfkrieg und ihrem gesundheitlichen Zustand. Ein Team von Epidemiologen und anderen WissenschaftlerInnen sichtete dazu koordiniert durch die "National Academies of Sciences, Engineering and Medicine" und das "Institute of Medicine" mehrfach die seit Ende dieses Krieges erschienenen Studien und berichtete darüber in bereits erschienenen neun Bänden ausführlich (vgl. im Forum zum Beispiel Viele, die "uns" am Hindukusch oder sonstwo verteidigen, werden schwer krank! Erfahrungsvorsprung der USA könnte Leid verkürzen!).
Mit dem Erscheinen des zehnten Bandes endet eine mehrjährige Untersuchung des möglichen Zusammenhangs des Einsatzes von Soldaten der US-Armee im so genannten Golfkrieg und ihrem gesundheitlichen Zustand. Ein Team von Epidemiologen und anderen WissenschaftlerInnen sichtete dazu koordiniert durch die "National Academies of Sciences, Engineering and Medicine" und das "Institute of Medicine" mehrfach die seit Ende dieses Krieges erschienenen Studien und berichtete darüber in bereits erschienenen neun Bänden ausführlich (vgl. im Forum zum Beispiel Viele, die "uns" am Hindukusch oder sonstwo verteidigen, werden schwer krank! Erfahrungsvorsprung der USA könnte Leid verkürzen!).
Da sowohl us-amerikanische als auch Bundeswehrsoldaten weiterhin in aller Welt unter zum Teil vergleichbaren Bedingungen (z.B. das Phänomen der asymmetrischen Auseinandersetzungen) eingesetzt sind, sollten die hier gewonnenen Erkenntnisse in die politische Entscheidungsfindung über die Verlängerung oder den Neubeginn solcher Einsätze einbezogen werden. Nichtwissen über unerwünschte Folgen ist also kein seriöses Argument.
Die Kernergebnisse der Arbeit des "Committee on Gulf War and Health" sehen so aus:
• Für die posttraumatische Belastungsstörung (englisch Posttraumatic stress disorder) gibt es ausreichend Evidenz für einen kausalen Zusammenhang.
• Für vier Erkrankungsgruppen (z.B. chronische Müdigkeit, Angststörungen, Depressionen, gastrointestinale Störungen und eine spezielle Gulf War illness) gibt es ausreichende Evidenz für eine Assoziation.
• Für drei Erkrankungsgruppen (z.B. sexuelle Störungen, schwere Schmerzen und die Amyotrophe Lateralsklerose (ALS), d.h. eine nicht heilbare degenerative Erkrankung des motorischen Nervensystems) gibt es begrenzte oder zweideutige/andeutende ("suggestive") Evidenz für eine Assoziation.
• Für 16 Krankheiten (z.B. diverse Krebsarten, Atemwegs- und Hauterkrankungen, Geburtsdefekte und erhöhte Mortalität an einer Reihe von Erkrankungen) gibt es keine oder untaugliche Evidenz dafür, dass eine Assoziation existiert.
• Für fünf Erkrankungen (z.B. multiple Sklerose, Lungenfunktionsstörungen) gibt es begrenzte oder zweideutige/andeutende ("suggestive") Evidenz dafür dass es keine Assoziation gibt.
Der vorliegende Band liefert zusammen mit dem in den vorherigen Bänden Belegten detaillierte Hinweise auf die empirische Basis in Hunderten von Studien.
Den 292 Seiten umfassenden Band 10 "Golfwar and Health. Update of Health Effects of Serving in the Gulf War" herausgegeben von Deborah Cory-Slechta und Roberta Wedge kann man kostenlos entweder online lesen oder über diesselbe Website und nach einer kurzen und unproblematischen Anmeldung auch kostenlos herunterladen.
Bernard Braun, 23.3.16
"Zu den gesundheitlichen Folgen weiterer Kriegseinsätze in aller Welt fragen Sie bereits heute Ihre amerikanischen Waffenbrüder"
 Es ist abzusehen, dass der Bundestag dem Antrag des Bundesaußenministers Steinmeier zustimmen wird, den Alt-Einsatz der Bundeswehr in dem sicherlich nicht weniger kriegerischer werdenden Afghanistan bis zum Ende des Jahres zu verlängern. Und die Bundesverteidigungsministerin v.d. Leyen will die Bundeswehr durch vermehrte Einsätze in Afrika oder an anderen "Hindukuschs" dieser Welt nicht aus der Übung kommen lassen - sie bei den Entfernungen aber mit Sicherheit nicht familienfreundlicher machen. Damit sie nicht am Ende sagen können, sie hätten nichts über die sicheren Folgen solcher Einsätze gewusst, seien ihnen und natürlich auch den Gegnern solcher Einsätze die laufenden Veröffentlichungen aus den USA zu den unerwünschten Folgen solcher zum Teil völlig "assymmetrisch" geführter Kriegseinsätze unbedingt empfohlen.
Es ist abzusehen, dass der Bundestag dem Antrag des Bundesaußenministers Steinmeier zustimmen wird, den Alt-Einsatz der Bundeswehr in dem sicherlich nicht weniger kriegerischer werdenden Afghanistan bis zum Ende des Jahres zu verlängern. Und die Bundesverteidigungsministerin v.d. Leyen will die Bundeswehr durch vermehrte Einsätze in Afrika oder an anderen "Hindukuschs" dieser Welt nicht aus der Übung kommen lassen - sie bei den Entfernungen aber mit Sicherheit nicht familienfreundlicher machen. Damit sie nicht am Ende sagen können, sie hätten nichts über die sicheren Folgen solcher Einsätze gewusst, seien ihnen und natürlich auch den Gegnern solcher Einsätze die laufenden Veröffentlichungen aus den USA zu den unerwünschten Folgen solcher zum Teil völlig "assymmetrisch" geführter Kriegseinsätze unbedingt empfohlen.
Dies gilt auch für den am 13. Februar 2014 u.a. durch das "Institute of Medicine" der USA erstellten und veröffentlichten Bericht über die mittel- bis langfristigen gesundheitlichen und sozialen Folgen der bisher vor allem in Afghanistan und im Irak durch improvisierte Sprengsätze ("improvised explosive devices (IEDS)") verursachten Sprengverwundungen. Rund 32.000 der insgesamt in diesen Kriegen gravierend verwundeten 50.500 US-Soldaten wurden dies durch Auswirkungen von unter Straßen, im Gelände oder in Autos versteckten Sprengsätzen. Die häufig durch anhaltende Schmerzen und Entstellungen bestimmten Sprengverletzungen erschweren nach Feststellungen der staatlichen US-Krankenversicherung "Veteran Affairs (VA)" die Rückkehr vieler SoldatInnen in ihr ziviles Leben bis zum heutigen Tag.
Der vorgelegte Bericht bewertet umfassend die Evidenz der in den letzten Jahren gewonnenen wissenschaftlichen Erkenntnisse für eine Fülle von durch IEDS-Einwirkung bedingten allgemeinen und spezifischen gesundheitlichen Folgen. Gesicherte Evidenz für die unspezifischen Folgen überwiegt. Für viele spezifische und vor allem kausale Assoziationen gibt es noch keine ausreichende Anzahl von evidenten Belegen aus qualitativ hochwertigen Studien. Angesichts der absehbaren Zunahme derartig verletzten us-amerikanischen aber z.B. auch deutschen SoldatInnen empfehlen die US-Gutachter eine Fülle zusätzlicher Forschungsbemühungen. Deren Ergebnisse sollen die VA, die häufig um Krankenbehandlungskosten kämpfen müssenden Ex-Soldaten und andere Interessenten "provide … with knowledge that can be used to inform decisions on how to prevent blast injuries, how to diagnose them effectively, and how to manage, treat, and rehabilitate victims of battlefield traumas in the immediate aftermath of a blast and in the long term."
Der 230 Seiten umfassende Bericht Gulf War and Health, Volume 9: Long-Term Effects of Blast Exposures. des National Research Council ist über die genannte Website sowohl online zu lesen als auch nach einer unaufwändigen und soweit bekannt folgenlosen Anmeldung auch kostenlos herunterladbar.
Bernard Braun, 13.2.14
Globale Gesundheit - scheidende Bundesregierung hinterlässt bedenkliches Erbe
 Kurz vor Ende ihrer Amtszeit legte die schwarz-gelbe Koalition im Spätsommer 2013 das Konzeptpapier Globale Gesundheitspolitik gestalten - gemeinsam handeln - Verantwortung wahrnehmen vor. So begrüßenswert es ist, dass sich die Bundesregierung mit den Herausforderungen globaler Gesundheit auseinandersetzt - das Konzept der scheidenden Regierung lässt etliche Wünsche offen. Zwar benennt es wichtige Fragen globaler Gesundheitspolitik und teils zutreffende Argumente. Bei genauerem Hinsehen entpuppt sich das in monatelanger Arbeit entstandene Papier allerdings vielfach als reine Rhetorik oder gar als Verschleierung bedenklicher Zielsetzungen. Die abgeleiteten politischen Konsequenzen und Strategien sind nicht nur unzureichend, sondern geben sogar Anlass zur Sorge.
Kurz vor Ende ihrer Amtszeit legte die schwarz-gelbe Koalition im Spätsommer 2013 das Konzeptpapier Globale Gesundheitspolitik gestalten - gemeinsam handeln - Verantwortung wahrnehmen vor. So begrüßenswert es ist, dass sich die Bundesregierung mit den Herausforderungen globaler Gesundheit auseinandersetzt - das Konzept der scheidenden Regierung lässt etliche Wünsche offen. Zwar benennt es wichtige Fragen globaler Gesundheitspolitik und teils zutreffende Argumente. Bei genauerem Hinsehen entpuppt sich das in monatelanger Arbeit entstandene Papier allerdings vielfach als reine Rhetorik oder gar als Verschleierung bedenklicher Zielsetzungen. Die abgeleiteten politischen Konsequenzen und Strategien sind nicht nur unzureichend, sondern geben sogar Anlass zur Sorge.
Unter Federführung des Bundesgesundheitsministeriums waren das Auswärtige Amt sowie die Bundesministerien für Wirtschaft, für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung sowie für Forschung und Bildung an dem Konzeptpapier zu globaler Gesundheitspolitik beteiligt. Entstanden ist ein Sammelsurium aus außen-, handels-, entwicklungs-, forschungspolitischen Aspekten. Das Papier beruft sich wiederholt auf deutsche Traditionen und Erfahrungen, meint damit aber vor allem die von Paul Ehrlich geprägte Forschung zur Krankheitsbekämpfung. Die maßgeblich auf Rudolf Virchow zurückgehende Erkenntnis, dass Gesundheit in erster Linie von den Lebens- und Arbeitsbedingungen abhängt, kommt in dem Konzeptpapier allenfalls am Rande zur Sprache.
In ihrem Konzeptpapier benennt die Bundesregierung drei Leitgedanken für ihre globale Gesundheitspolitik:
• Schutz und Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland durch globales Handeln
• Wahrnehmung globaler Verantwortung durch die Bereitstellung deutscher Erfahrungen, Expertise und Mittel
• Stärkung internationaler Institutionen der globalen Gesundheit
Dabei konzentriert sie sich auf fünf Schwerpunkte:
• Wirksam vor grenzüberschreitenden Gesundheits- gefahren schützen
• Gesundheitssysteme weltweit stärken - Entwicklung ermöglichen
• Intersektorale Kooperationen ausbauen - Wechselwirkungen mit anderen Politikbereichen
• Gesundheitsforschung und Gesundheitswirtschaft - Wichtige Impulse für die globale Gesundheit setzen
• Globale Gesundheitsarchitektur stärken.
Erheblich größere Bedeutung als den gesellschaftlichen Bedingungen von Gesundheit misst das Konzept der Bundesregierung nämlich der heilenden Wirkung von Exportprodukten der deutschen Pharma-, Medizingeräte- oder Versicherungsindustrie bei. Diese Einschätzung ist bestenfalls naiv, eher aber gefährlich. Denn deutsche Erzeugnisse unterliegen in erster Linie den Gewinninteressen der Hersteller und nur in geringem Maße dem tatsächlichen Bedarf. Wer es ernst meint mit globaler Gesundheit, der muss das Allgemeinwohl über Herstellerinteressen stellen und gegen Handelsbarrieren vorgehen, die armen Ländern u. a. den Zugang zu wichtigen Arzneimitteln versperren.
So richtig die Forderung der Bundesregierung nach universeller Absicherung im Krankheitsfall ist, so wenig glaubhaft ist ihr Bekenntnis, solange sie mit ihrer Sparpolitik in Folge der Eurokrise die soziale Absicherung beispielsweise der Griechen untergräbt. Universelle Absicherung im Krankheitsfall gilt für alle Menschen, auch für Migranten. Und der Export privater Krankenversicherungen in Entwicklungsländer hemmt den Aufbau umfassender Systeme und erschwert universelle soziale Absicherung.
Von solchen Erkenntnissen ist ebenso wenig die Rede wie von krank machenden oder gar tödlichen Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie in Bangladesch und anderswo, wo die Opfer einstürzender Gebäude nur die Spitze eines Eisbergs sind. Die alltäglichen Arbeitsbedingungen gefährden die Gesundheit. Auch vermeidet das Papier das Thema der gesundheitsschädlichen Wirkungen vieler Ausfuhrprodukte der deutschen Gesundheitswirtschaft, ganz zu schweigen von anderen Exportgütern made in Germany: Dabei ist Deutschland die drittgrößte, bei Kleinwaffen sogar zweitgrößte Rüstungsschmiede der Welt - eine Umwandlung dieses Industriezweigs wäre ein riesiger Beitrag zur globalen Gesundheit. Gleichzeitig gehört dieses Land zu den größten Umweltverschmutzern und erwirtschaftet seine Exportüberschüsse auch mit umweltschädlichen Produkten: Konsequente Eindämmung des Treibhausgasausstoßes und eine neue Verkehrspolitik können ebenso wie abgas- und lärmarme Autos erheblich mehr zur Verbesserung der Gesundheit hierzulande und weltweit beitragen als Arzneimittel und Medizintechnologie.
Alle diese Widersprüche lässt das Konzeptpapier der Bundesregierung völlig außer Acht. Vielmehr suggeriert es eine rückwärtsgewandte, selbstbezogene und auf den eigenen Vorteil bedachte Haltung, die Reminiszenzen an das Credo "Am deutschen Wesen soll die Welt genesen", sei es durch Medizinprodukte aus deutscher Herstellung oder durch soziale Sicherungssysteme nach deutschem Vorbild. Auch wenn das Papier die Bedeutung der bilateralen Zusammenarbeit wie multilateraler Akteure und insbesondere der Weltgesundheitsorganisation WHO betont, liegt der Schwerpunkt des Papiers woanders.
Die angesehene Medizinerzeitschrift Lancet widmete dem Konzeptpapier bereits ihrer Ausgabe vom 21. September 2013 ein Editorial. Namhafte deutsche Gesundheitswissenschaftler kritisierten zwei Monate später in derselben Zeitschrift die Bundesrepublik Deutschland, deren geringer Einsatz für Fragen der globalen Gesundheit der politischen und wirtschaftlichen Rolle des Landes würde nicht gerecht. In ihrem Teilbeitrag mit dem Titel Germany and global health: an unfinished agenda? mit dem Titel benennen die Autoren eine Reihe von Mängeln des Regierungskonzepts:
• Intellektuelle Eigentumsrechts und Zugang zu Arzneimitteln,
• Thematisierung struktureller Determinanten wie Handel, Wirtschaftskrise und weltweite Ungleichheit,
• relevante Beschränkungen des Rechts auf größtmögliche Gesundheit für MigrantInnen, Flüchtlinge und Asylsuchende in der Europäischen Union einschließlich Deutschlands,
• zuverlässige Finanzierungsmechanismen für die WHO,
• Förderung globaler Gesundheitsforschung und -erziehung,
• effektive und transparente interministerielle Institutionalisierung der deutschen globalen Gesundheitspolitik.
Im Lancet findet sich auch eine englischsprachige Zusammenfassung.
Die Große Koalition hat nun die Gelegenheit, das bisher stiefmütterlich behandelte Thema der globalen Gesundheitspolitik von nun ab aktiver und vor allem auch ernsthafter zu verfolgen. Das bisher vorliegende Konzeptpapier eignet sich allerdings schwerlich als Grundlage, dafür ist es zu lückenhaft, einseitig und letztlich irreführend. Gefordert ist ein Konzept für globale Gesundheitspolitik, das nicht deutsche Interessen und die Logik der Krankheitswissenschaften in den Vordergrund stellt, sondern auf Grundlage gesundheitswissenschaftlicher Erkenntnisse Vorschläge entwickelt, wie die Bundesrepublik und ihre Regierungen systematisch zur Verbesserung der Gesundheit weltweit beitragen können.
Das Konzeptpapier der Bundesregierung lässt sich hier kostenfrei herunterladen.
Jens Holst, 17.12.13
Wenig TeilnehmerInnen in randomisierten Studien= Überschätzung von Therapieerfolgen?!
 Auch wenn es sich um randomisierte Studien handelt, bedeutet dies noch nicht die uneingeschränkte Verlässlichkeit ihrer Ergebnisse. Kritisch wird nämlich oft deren Größee, d.h. die Anzahl der teilnehmenden PatientInnen angemerkt, die möglicherweise die Ergebnisse verfälsche und damit die Wirkung des untersuchten Medikaments oder einer anderen Behandlungsart zweifelhaft ist. Wie die Verfälschung genau aussieht wird aber oft nicht gesagt.
Auch wenn es sich um randomisierte Studien handelt, bedeutet dies noch nicht die uneingeschränkte Verlässlichkeit ihrer Ergebnisse. Kritisch wird nämlich oft deren Größee, d.h. die Anzahl der teilnehmenden PatientInnen angemerkt, die möglicherweise die Ergebnisse verfälsche und damit die Wirkung des untersuchten Medikaments oder einer anderen Behandlungsart zweifelhaft ist. Wie die Verfälschung genau aussieht wird aber oft nicht gesagt.
Hierzu geben aber nun die Ergebnisse einer im Sommer 2013 veröffentlichten Metaanalyse, die selber 93 Metaanalysen mit insgesamt 735 randomisierten Studien umfasste, umfassend Auskunft. Die Anzahl der TeilnehmerInnen in den einzelnen Studien reichte von weniger als 50 bis zu 1.000 und mehr.
Die Metaanalyse zeigt, dass verglichen mit randomisierten Studien mit 1.000 und mehr TeilnehmerInnen Studien mit kleineren Fallzahlen (500 bis 999 PatientInnen) die Therapie-Wirksamkeit der untersuchten Medikamente/Interventionen um 10% und Studien mit weniger als 50 TeilnehmerInnen diese bis zu 48% überschätzen. Hierbei handelt es sich nicht um Zahlenspielereien, sondern hinter solchen Überschätzungen stecken eventuell vergebliche Versuche einer Therapie oder das Verschieben einer möglicherweise wirksameren Therapie und entsprechende negativen Folgen für die Gesundheit.
Die AutorInnen schlagen als erstes für zuverlässigere Resultate randomisierter Studien eine Größenordnung der Teilnehmerschaft von 500 bis 1.000 und mehr Personen vor. Ein zusätzliches methodisches Gegenmittel sieht dann so aus: "More generally, our results raise questions about how meta-analyses are currently performed, especially whether all available evidence should be included in meta-analyses because it could lead to more beneficial results."
Die Meta-Metaanalyse Influence of trial sample size on treatment effect estimates: Meta-epidemiological study von Dechartres A et al. ist am 24. April 2013 im "British Medical Journal (BMJ)" (346: f2304) erschienen und im Rahmen der vorbildlichen Open Acess-Politik des BMJ kostenlos und komplett erhältlich.
Bernard Braun, 6.10.13
�"rztetag, Armut und Gesundheit: Kleinkariert, selbstbezogen und beschränkt
 So schlimm sind die deutschen Ă"rzte doch gar nicht, könnte man im Anschluss an den 116. Ă"rztetag vom 28. - 31. Mai 2013 in Hannover denken. Nach Organspendeskandalen, Abkassiererei durch Individuelle Gesundheitsleistungen (IGeL) und parallel zum Bekenntnis zur regressiven Kopfpauschale in der Krankenkassenfinanzierung - das Forum berichtet in dem Beitrag Auf rĂĽckwärtsgewandten Pfaden weiter zur Zweiklassenmedizin - beschlossen die Delegierten des Ă"rztetags, die gesundheitliche Förderung sozial Benachteiligter zu stärken: "Als Ă"rzteschaft sehen wir unsere Verantwortung vor allem darin, auf eine Verringerung schichtenspezifischer Unterschiede in den Zugangsmöglichkeiten, in der Inanspruchnahme und VerfĂĽgbarkeit gesundheitlicher Leistungen einzuwirken", heiĂźt es in dem angenommen Antrag laut einer Meldung des Deutschen Ă"rzteblatts.
So schlimm sind die deutschen Ă"rzte doch gar nicht, könnte man im Anschluss an den 116. Ă"rztetag vom 28. - 31. Mai 2013 in Hannover denken. Nach Organspendeskandalen, Abkassiererei durch Individuelle Gesundheitsleistungen (IGeL) und parallel zum Bekenntnis zur regressiven Kopfpauschale in der Krankenkassenfinanzierung - das Forum berichtet in dem Beitrag Auf rĂĽckwärtsgewandten Pfaden weiter zur Zweiklassenmedizin - beschlossen die Delegierten des Ă"rztetags, die gesundheitliche Förderung sozial Benachteiligter zu stärken: "Als Ă"rzteschaft sehen wir unsere Verantwortung vor allem darin, auf eine Verringerung schichtenspezifischer Unterschiede in den Zugangsmöglichkeiten, in der Inanspruchnahme und VerfĂĽgbarkeit gesundheitlicher Leistungen einzuwirken", heiĂźt es in dem angenommen Antrag laut einer Meldung des Deutschen Ă"rzteblatts.
Näheres geht aus der Pressemitteilung der Bundesärztekammer hervor. Richten soll es demnächst der ansonsten eher stiefmĂĽtterlich behandelte öffentliche Gesundheitsdienst (Ă´GD). Zwar hatte das Deutsche Ă"rzteblatt im März 2012 in dem Beitrag Der öffentliche Gesundheitsdienst: Standortbestimmung mit hoffnungsvollem Ausblick ein interessantes Schlaglicht auf den Ă´GD und dessen Annäherung an Public Health geworfen, aber auch der ?-GD spiegelt nur einen kleineren Ausschnitt der Gesundheitswissenschaften wider.
In der deutschen Ă"rzteschaft herrscht offenkundig ein sehr enges Verständnis vom Zusammenhang zwischen Armut und Gesundheit vor, wie eine online verfĂĽgbare Umfrage des Deutschen Ă"rzteblatts eindrĂĽcklich belegt. MedizinerInnen denken zuallererst oder ausschlieĂźlich an Ursachen und Ansätze innerhalb Krankenversorgungssystems, wenn es um Armut und Gesundheit geht. Das ist weder verwunderlich noch illegitim - aber eben nur ein Teil einer ĂĽberaus komplexen Wirklichkeit.
Dem eingeschränkten Mediziner-Denken sitzen auch deutsche Medien auf, wenn sie aus Anlass des 116. Deutschen Ă"rztetags Ă…ber den Zusammenhang zwischen Armut und Gesundheit berichten. Zwar ist es zweifelsohne begrĂĽĂźenswert, dass beispielsweise die SĂĽddeutsche Zeitung diesem Thema einen längeren Beitrag dem Titel Arme sterben frĂĽher widmet. Allerdings ist die enge Ausrichtung auf präventiv-medizinische Ansätze wie ärztliche Beratung, Zahnvorsorge, Schwangerenvorsorge doch etwas ernĂĽchternd angesichts der internationalen und teilweise auch nationalen Debatte ĂĽber Soziale Determinanten von Gesundheit.
Ebenso wie eine Vielzahl frĂĽherer Untersuchungen zeigt auch der jĂĽngste umfangreiche Bericht der WHO Kommission zu Sozialen Determinanten von Gesundheit mit dem Titel Closing the gap in a generation, dass die Gesundheit einer Bevölkerung von weitaus mehr gesellschaftlichen Faktoren abhängt als die Deutsche Ă"rzteschaft zu erkennen scheint. Bildung, Einkommen, soziale Einbindung, Lebens- und Arbeitsverhältnisse, Lärm- und Umweltbelastungen und andere soziale Determinanten bestimmen die Gesundheit der Bevölkerung weitaus mehr als das ĂĽblicherweise als Gesundheitswesen bezeichnete Krankenversorgungssystem, dessen Einfluss bei etwa 20 % liegen dĂĽrfte. Wer spĂĽrbare Auswirkungen von den auf dem Ă"rztetag 2013 vorgeschlagenen MaĂźnahmen erwartet, ĂĽberschätzt massiv die Einflussmöglichkeiten des Medizinsystems und verkennt die groĂźe Bedeutung indirekter Gesundheitspolitik auf allen gesellschaftlichen Ebenen.
Auf die vielfach belegten Zusammenhänge zwischen Armut, sozialer Ungleichheit und Gesundheit hat das Forum Gesundheitspolitik wiederholt hingewiesen, so bereits 2005 in dem Beitrag Soziale Ungleichheit, Armut und Gesundheit Soziale Ungleichheit, Armut und Gesundheit oder im Mai 2012 in dem Beitrag Soziale Ungleichheiten der Gesundheit - Erfahrungen und Lehren aus 13 Jahren Labour-Regierung
Wer sich ernsthaft mit dem Thema Sozialer Determinanten von Gesundheit auseinandersetzen will, findet anderswo relevantere Erkenntnisse als auf dem Ă"rztetag, beispielsweise auf der Homepage vom 18. Kongress Armut und Gesundheit. Eine kleine Minderheit der niedergelassenen Ă"rzteschaft mag diese Veranstaltung als Ausdruck der vermeintlich linken Dominanz im Gesundheitswesen betrachten, wie es ein Beitrag auf der Homepage des radikalen Niedergelassenen-Netzwerks aend mit dem Titel Herr Montgomery spielt ĂĽber Bande nahelegt. Nicht nur dieser wahrlich bemerkenswerte Kommentar belegt, dass sich Teile der deutschen Ă"rzteschaft mittlerweile meilenweit von den Gedanken eines Rudolf Virchow entfernt hat, der den Arzt noch als quasi natĂĽrlichen Sachwalter der Armen betrachtete.
Wer sich ein umfassenderes Bild von der aktuellen Debatte über soziale Determinanten machen möchte, findet neben der oben genannten WHO-Publikation wichtige Hinweise unter den Unterlagen des 18. Kongresse Armut und Gesundheit, der am 6. und 7. März 2013 mit mehr als 2.000 Teilnehmer*innen unter Motto "Brücken bauen zwischen Wissen und Handeln - Strategien der Gesundheitsförderung" in Berlin stattfand. Eine umfangreiche Dokumentation der Thematiken des Kongresses steht kostenfrei zum Download zur Verfügung.
Jens Holst, 31.5.13
Gesundheitspolitik und Sterben - Sterben zwar kein Tabu mehr, aber Wissens- und Zugangshürden vor Hospiz- und Palliativleistungen.
 Auch wenn viele kurativen oder gar präventiven Angebote im Gesundheitswesen den Eindruck erwecken, mit ihrem Erwerb sei die Möglichkeit eines immer besseren und längeren Lebens verbunden, sterben die meisten Menschen immer noch deutlich vor der 90- oder 100-Jahregrenze. Und die Ergebnisse einer gezielten Frage nach dem gewünschten Lebens-/Sterbealter (siehe dazu ausführlich "Was wir in unsere Gesundheit investieren und mit welchen Motiven wir es tun." von Klaus Koch und Andreas Waltering im Gesundheitsmonitor Newsletter 1/2012) im Rahmen der bevölkerungsrepräsentativen Gesundheitsmonitor-Befragung 2011 zeigten, dass dies auch den subjektiven Erwartungen oder Zielwerten in der Bevölkerung entspricht. So gaben 44% der Befragten an, mindestens 80 Jahre alt zu werden. 23% wollten mindestens 90 Jahre alt werden, 8% mindestens 100. 16% war das Sterbealter egal oder sie wussten nicht, für was sie sich entscheiden sollten. Zu den interessanten Unterschieden der Erwartungen des Sterbealters gehörte, dass mehr Männer als Frauen mindestens 90 Jahre alt werden. Und von den Rauchern wollten nur 13 % mindestens 90 werden, während es unter den Nichtrauchern immerhin 25% wollten. Als eine zum Teil weit von der Wirklichkeit entfernte weitere Erwartung der Bevölkerung ans Sterben gehört seit außerdem schon immer, dass die Mehrheit von ihr zu Hause sterben möchte.
Auch wenn viele kurativen oder gar präventiven Angebote im Gesundheitswesen den Eindruck erwecken, mit ihrem Erwerb sei die Möglichkeit eines immer besseren und längeren Lebens verbunden, sterben die meisten Menschen immer noch deutlich vor der 90- oder 100-Jahregrenze. Und die Ergebnisse einer gezielten Frage nach dem gewünschten Lebens-/Sterbealter (siehe dazu ausführlich "Was wir in unsere Gesundheit investieren und mit welchen Motiven wir es tun." von Klaus Koch und Andreas Waltering im Gesundheitsmonitor Newsletter 1/2012) im Rahmen der bevölkerungsrepräsentativen Gesundheitsmonitor-Befragung 2011 zeigten, dass dies auch den subjektiven Erwartungen oder Zielwerten in der Bevölkerung entspricht. So gaben 44% der Befragten an, mindestens 80 Jahre alt zu werden. 23% wollten mindestens 90 Jahre alt werden, 8% mindestens 100. 16% war das Sterbealter egal oder sie wussten nicht, für was sie sich entscheiden sollten. Zu den interessanten Unterschieden der Erwartungen des Sterbealters gehörte, dass mehr Männer als Frauen mindestens 90 Jahre alt werden. Und von den Rauchern wollten nur 13 % mindestens 90 werden, während es unter den Nichtrauchern immerhin 25% wollten. Als eine zum Teil weit von der Wirklichkeit entfernte weitere Erwartung der Bevölkerung ans Sterben gehört seit außerdem schon immer, dass die Mehrheit von ihr zu Hause sterben möchte.
Trotzdem erscheint Sterben immer noch tabulisiert zu sein oder wird, wenn es ein öffentliches Thema ist, ein massenmedial inszenziertes und zelebriertes Großereignis. Wie aktuell die Einstellungen und Erwartungen zum Sterben jenseits von Großereignissen in der Bevölkerung aussehen, wollte nun der "Deutsche Hospiz- und PalliativVerband" im dreißigsten Jahr seines Bestehens etwas genauer wissen. In seinem Auftrag befragte dazu die Forschungsgruppe Wahlen Telefonfeld in Auftrag zwischen dem 25. und 28. Juni 2012 1044 Deutsche ab 18 Jahren.
Die Hauptergebnisse der im August 2012 der Öffentlichkeit vorgestellten Studie lauteten:
• 58 % der Befragten geben an, dass sich die Gesellschaft mit dem Thema Sterben und Tod zu wenig befasst.
• 66 % der Befragten wollen zuhause sterben. Zur Wirklichkeit gibt die aktuelle Studie aber an: "Abhängig von dem regional jeweils unterschiedlichen Stand des Ausbaus der Versorgungsstrukturen sterben - so Daten aus anderen Erhebungen - in der Regel die meisten Menschen (über 40 %) nach wie vor im Krankenhaus, rund 30 % in der stationären Pflegeeinrichtung und etwa 25 % zuhause."
• 89 % der Befragten geben an, vom Begriff Hospiz gehört zu haben und 66 % können den Begriff richtig einordnen. Anders sieht es aber beim Begriff palliativ aus. 89 %, die bereits vom Begriff Hospiz gehört haben, stehen nur 49 % gegenüber, die vom Begriff palliativ gehört haben. Und während 66 % den Begriff Hospiz richtig zuordnen konnten, sind es im Vergleich dazu bei dem Begriff palliativ nur 32 %.
• Der Mehrheit der Bevölkerung war trotz den seit Jahren geltenden gesetzlichen Vorschriften aber unbekannt, dass die Versorgung in einem Hospiz oder eine Hospizbegleitung zuhause kostenlos ist: Nur 11 % der Befragten waren darüber informiert.So gibt es seit 1997 mit dem § 39a SGB V stationäre und ambulante Hospizleistungen als GKV-Leistung und seit 2007 mit dem § 132d SGB V das Recht auf die Leistung einer spezialisierten ambulanten Palliativversorgung. Trotz aller Bekanntheit stellen solche Wissensdefizite mit Sicherheit massive Barrieren für die Inanspruchnahme der entsprechenden Leistungen dar.
• Menschen fühlen sich von der Gesellschaft getragen und aufgehoben, auch wenn sie krank sind. 90 % der Befragten und immerhin 76 % der allein lebenden Menschen haben geantwortet, dass sich jemand aus ihrer Familie, ihrem Freundeskreis oder aus der Nachbarschaft um sie kümmert, wenn sie krank sind. 72 % aller Befragten sowie 66 % der 60-jährigen und älteren Befragten gehen davon aus, dass sich jemand aus Familie, Freundeskreis oder Nachbarschaft um sie kümmern wird, wenn Pflegebedürftigkeit vorliegt. Auch wenn damit die verbreitete Vorstellung, Pflegebedürftige würden relativ häufig ins Heim abgeschoben, deutlich relativiert wird, sehen sich immerhin zwischen 25% und 33% der Befragten je nach Lebenssituation ohne Unterstützung aus ihrem unmittelbaren sozialen Netzwerk.
• 72 % der Befragten schätzen die Schmerztherapie eines ihnen nahe stehenden Menschen zu Hause als gut ein; im Vergleich dazu haben aber nur 49 % der Befragten die Schmerztherapie im Krankenhaus als gut wahrgenommen, als ein ihnen nahestehender Mensch an starken Schmerzen litt und dort betreut wurde.
• Das Abfassen einer Patientenverfügung ist wichtiges Thema in der Bevölkerung: 26 % der Befragten haben eine Patientenverfügung verfasst, 43 % haben schon einmal ernsthaft darüber nachgedacht.
• Die Befragten würden sich am häufigsten (33 % bzw. 21 %) bei der Suche nach einem Platz in einer Palliativeinrichtung bzw. Hospizeinrichtung an ihre Hausärztin / ihren Hausarzt wenden. Ob dies wirklich den Zugang zu diesen Leistungen gewährleistet ist solange nicht klar, wie auch unter Hausärzten falsche oder unvollständige Kenntnisse über die Hospiz- und Palliativleistungen existieren.
Die "Ergebnisse einer repräsentativen Bevölkerungsbefragung zum Thema "Sterben in Deutschland - Wissen und Einstellungen zum Sterben". Sterben und Tod kein Tabu mehr - Die Bevölkerung fordert eine intensivere Auseinandersetzung mit diesen Themen" sind kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 20.8.12
Was sollten Hygieniker/Politiker bei einem Infektions-"Ausbruch" sein lassen oder "C'est les microbes qui auront le dernier mot"?
 Man muss die These von Louis Pasteur nicht völlig teilen, um daraus Lehren für den aktuellen Umgang mit Infektionen ziehen zu können. Der mit dem "Ausbruch" gefährlicher oder sogar tödlicher Infektionen häufig verbundene Versuch, den beruhigend gemeinten Eindruck zu erwecken, man könne solche Risiken durch das prinzipiell mögliche Entdecken der Erregerquelle und dem dann möglichen Einsatz geeigneter, meist technisch-hygienischer Mittel prinzipiell verhindern, ist zu einem gewissen Teil symbolischer politischer Aktionismus.
Man muss die These von Louis Pasteur nicht völlig teilen, um daraus Lehren für den aktuellen Umgang mit Infektionen ziehen zu können. Der mit dem "Ausbruch" gefährlicher oder sogar tödlicher Infektionen häufig verbundene Versuch, den beruhigend gemeinten Eindruck zu erwecken, man könne solche Risiken durch das prinzipiell mögliche Entdecken der Erregerquelle und dem dann möglichen Einsatz geeigneter, meist technisch-hygienischer Mittel prinzipiell verhindern, ist zu einem gewissen Teil symbolischer politischer Aktionismus.
Das wäre sogar hinzunehmen, wenn damit nicht falsche Erwartungen geweckt oder falsche Sicherheiten versprochen würden. Dies ist jedenfalls das Ergebnis einer etwas gründlicheren Lektüre von Fachbeiträgen, die in der von deutschen Fachwissenschaftlern im Jahr 2001 gegründeten Online-Fachdatenbank "Outbreak" zugänglich sind. Die Datenbank enthält derzeit Berichte über 2.756 Infektions-"Ausbrüche", die zwischen 1956 und 2011 publiziert wurden. Damit liegen relativ differenzierte Informationen über 259 verschiedene Erreger vor. Ergänzt werden diese "Ausbruch"-Berichte durch wissenschaftliche Überblicksarbeiten über die Dynamik von Infektionserkrankungen und die Charakteristika einzelner Erreger.
Unter einem gesundheitsbezogenen "Ausbruch" versteht man das Auftreten von zwei oder mehr gleichartigen Erkrankungen, bei denen ein epidemiologischer Zusammenhang wahrscheinlich ist oder vermutet wird. Wie man am Auftreten und dem Umgang mit dem Auftreten von schweren, d.h. zum Teil lebensbedrohlichen Infektionserkrankungen wie EHEC oder der Verbreitung von teilweise multiresistenten Keimen in diversen "Frühchen-Stationen mehrerer bundesweiter Krankenhäuser sehen konnte, ist trotz dieser Definition für die zuständigen Gesundheitseinrichtungen nicht immer klar, ob es sich um Ausbrüche oder ganz normale, d.h. zunächst nicht dramatische und entsprechende Interventionen verlangende Erkrankungsfälle handelt. Dass die Nichtklassifikation als "Ausbruch" sehr praktische Folgen haben kann, konnte man Ende 2011 an der monatelangen Unterschätzung der von Darmkeiminfektionen in der neonatologischen Abteilung des Bremer Klinikums-Mitte ausgehenden Gefahren für die Frühgeborenen beobachten.
Mit dem Ausbruch von Krankheiten und ihrer Bekämpfung zerbricht einerseits die nicht zuletzt von Gesundheitsdienstleistern mitgeförderte Illusion einer nebenrisikofreien Versorgungs- und Behandlungswelt. Andererseits wird diese Illusion durch das mit dem öffentlichkeitswirksamen Einsatz nationaler Hygiene-Task Force-Einheiten verbundene Versprechen, die Quelle des Ausbruchs zu finden und mit technischen Mitteln auszuschalten, von neuem produziert.
Wer sich mit dem Umgang mit einem "Ausbruch" von Infektionskrankheiten näher beschäftigt, stößt auf zwei zwar verständliche aber letztlich hochproblematische Argumentationsfiguren:
• Die Absicht oder gar das Versprechen, so etwas dauerhaft zu verhindern und
• die Vorstellung, die Erregerquelle rasch finden und sie mit einem Bündel meist technischer Sanierungsmaßnahmen (z.B. Desinfektion der Räumlichkeiten, Hygieneschleusen für Angehörige, neue Vorschriften zur Handhygiene bis hin zu einer Schaffung einer neuen Behandlungslokalität) zum Versiegen bringen zu können.
In der wissenschaftlichen Datenbank "Outbreak" finden sich zahlreiche Beiträge, die zu dem Schluss kommen, dass es allein wegen der Vielzahl von Erregern und deren zum Teil enorme Wandlungs- und Anpassungsfähigkeit illusorisch ist, zumindest bestimmte Erreger "ausrotten" zu können. Eine dort zugängliche Dissertation über das Verhalten einiger Typen der zur normalen Darmflora gehörenden so genannten Klebsiellen zeigt bereits im Titel die Schwierigkeiten an, Erkrankungen zu verhindern, die durch diese weit verbreiten Darmkeime verursacht werden: "Mechanismen, durch die Klebsiella pneumoniae zum Erreger nicht beherrschbarer nosokomialer Infektionen werden kann". Zu diesen Mechanismen gehören z.B. Fähigkeiten des Erregers, auch an nicht so leicht zugänglichen Orten wie Siphons und Abwasserrohren überleben zu können. Die Autorin umschreibt das Risiko-Szenario so: "Während eines nosokomialen Ausbruchs multiresistenter K. pneumoniae konnten SU et al. … die Ausbruchsstämme aus mehreren Siphons isolieren und vermuteten dort die Quelle der Kontaminationen. KAC et al. konnten durch ein Umgebungsscreening auf einer Intensivstation zeigen, dass trockene Oberflächen frei von ESBL-produzierenden Enterobacteriaceae blieben, diese Stämme jedoch für Wochen und Monate in den feuchten Spalten von Abflüssen und Waschbecken überlebten. Bisher (Erstellungsjahr der Dissertation ist 2007) wurde eine Infektion von Patienten über besiedelte Siphons nicht zweifelsfrei nachgewiesen. Es ist jedoch anzunehmen, dass es beim Verspritzen des laufenden Wassers sowohl zur Kontamination von Händen und Kontaktflächen als auch zur Aerosolbildung kommen kann."
Selbst ohne diese Art von Hindernissen vor einem Sieg über diese Art von Erregern entstehen aber ständig durch den immer noch viel zu oft erfolgenden Einsatz von Antibiotika bei Menschen und in der Fleischproduktion neue resistente und damit auch sehr persistente Erreger.
Das Versprechen, die Bedrohung durch einen Erreger "auszurotten", steht und fällt u.a. damit, die Erregerquelle zu finden und alle sie fördernden Bedingungen dauerhaft verändern zu können. Ein in der "Outbreak"-Datenbank zu findender Beitrag über wichtige Details von 225 "Ausbrüchen" unter Beteiligung dreier Erregergruppen (darunter 59 "Ausbrüche" von multiresistenten Enterobakterien ŕ la Klebsiella insbesondere in neonatologischen Krankenhausstationen) aus dem Jahr 2011, weist auf die praktisch durchweg hohe Rate der trotz intensiver Suche unbekannt gebliebenen Erregerquellen zwischen 68% und 37% hin. Die Quelle der Enterobakterien, also der Darmkeime konnte in 58% der Fälle nicht entdeckt werden.
Schließlich sind die mehr oder weniger aufwändigen technisch-hygienischen oder baulichen Veränderungen in Krankenhausstationen mit einem "Ausbruch" zwar notwendig, aber bei weitem nicht hinreichend. Wie aber sowohl Untersuchungen über die Compliance von Hygienevorschriften bei Pflegekräften und vor allem Ärzten zeigen (vgl. dazu den Forums-Beitrag "Schrecklich, mit den Frühchen"! Aber: Ärzte und Pflegekräfte halten sich bei 52% bzw. 66% der Gelegenheiten an Hygienepflichten") aber auch positive Beispiele für eine dauerhafte Absenkung von "Ausbruchs"-Risiken in einzelnen Krankenhäusern (vgl. dazu u.a. die 2011 erschienene Studie von Sillow-Caroll et al.), sind ständige beschäftigtenbezogene und soziale Maßnahmen zur Verinnerlichung von Hygienevorschriften und deren Einbau in tagtägliche Verhaltensroutinen mindestens genauso wichtig. Anders gesagt: Absolut perfekte Handhygienevorrichtungen, das Scannen von Angehörigen und ein einwöchiger Hygienekurs für Pflegekräfte und interessierte Ärzte alleine versprechen Erfolge, die sie nicht erreichen oder halten können.
Die von verschiedenen wissenschaftlichen Einrichtungen an deutschen Kliniken getragene "Outbreak Database" ist kostenlos zugänglich.
Die erwähnte rer nat.-Dissertation "Mechanismen, durch die Klebsiella pneumoniae zum Erreger nicht beherrschbarer nosokomialer Infektionen werden kann" von Sonja Burak ist ebenfalls in ganzer Länge (179 Seiten) kostenlos erhältlich.
Von dem Kongressbeitrag "A systematic review of nosocomial outbreaks caused by multidrug-resistant Gram-negative bacteria von Zhuchenko, K. Graf und R.P. Vonberg gibt es lediglich das Abstract und eine aussagekräftige Tabelle über weitere Details der "Ausbrüche" kostenlos herunterzuladen.
Ein letztes Beispiel zu den aktuell interessanten Beiträgen, auf die man über "Outbreak" Zugriff bekommt, ist die ebenfalls auf einer Dissertation basierende Übersichtsarbeit "Healthcare Associated infections in Pediatrics" der finnischen Medizinerin Emmi Sarvikivi aus dem Jahre 2008.
Die 16-seitige Studie "Eliminating Central Line Infections and Spreading Success at High Performing Hospitals." von Sharon Silow-Carroll und Jennifer Edwards ist als "Commonwealth Fund Publication 1559, Vol. 21" erschienen und kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 2.3.12
Gesundheitsbericht-Ramsch: "Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker" lieber nicht nach "Erinnerungen" zur Gesundheitsentwicklung!
 Es vergeht kaum eine Woche ohne dass ein neuer Report einer Krankenkasse, eines Ärzte- oder Apothekerverbandes über meist "dramatische" Veränderungen der Gesundheit irgendeiner Bevölkerungsgruppe innerhalb der letzten 5, 10 oder 20 Jahren erscheint. Ein Teil dieser Berichte stützt sich immerhin noch auf "objektive", kontinuierlich und nicht nur für den jeweiligen Berichts erfasste Routinedaten von Krankenkassen oder methodisch erprobte repräsentative Bevölkerungsumfragen. Deren mögliche oder gesicherte Verzerrungen oder Schwachstellen wie z.B. die Untererfassung von Angehörigen vulnerabler Gruppen in repräsentativen Umfragen oder die Verkürzung auf die Behandlungsmorbidität in den GKV-Routinedaten sind weitgehend bekannt und kalkulierbar.
Es vergeht kaum eine Woche ohne dass ein neuer Report einer Krankenkasse, eines Ärzte- oder Apothekerverbandes über meist "dramatische" Veränderungen der Gesundheit irgendeiner Bevölkerungsgruppe innerhalb der letzten 5, 10 oder 20 Jahren erscheint. Ein Teil dieser Berichte stützt sich immerhin noch auf "objektive", kontinuierlich und nicht nur für den jeweiligen Berichts erfasste Routinedaten von Krankenkassen oder methodisch erprobte repräsentative Bevölkerungsumfragen. Deren mögliche oder gesicherte Verzerrungen oder Schwachstellen wie z.B. die Untererfassung von Angehörigen vulnerabler Gruppen in repräsentativen Umfragen oder die Verkürzung auf die Behandlungsmorbidität in den GKV-Routinedaten sind weitgehend bekannt und kalkulierbar.
Mittlerweile nimmt allerdings ein Typ der Informationsgenerierung durch Querschnittsbefragungen von "Praktiker-Experten" zu, der schnell und preisgünstig ist, inhaltlich aber hinsichtlich seiner Aussagen über Entwicklungstrends äußerst fragwürdig.
Jüngstes Beispiel ist das "Vivesco Gesundheitsbarometer 2011". Vivesco ist nach eigenen Angaben eine Kooperation aus rund 1.100 Apotheken mit 9.000 Mitarbeitern und eine 100-prozentige Tochter des Pharmagroßhändlers Andreae-Noris Zahn AG (ANZAG). Die Verantwortlichen des "Gesundheitsbarometers" und ihre wissenschaftliche Gallionsfigur, der schon als Finanzwissenschaftler nicht unumstrittene Bernd Raffelhüschen haben natürlich auch das Recht so viel Unsinn zu produzieren und zu publizieren wie ihnen einfällt. Wozu aber dann doch ein Kommentar nötig ist, ist die ihrer "Studie" exemplarisch eigene, durch "Erinnerungen" gestützte Sorgen- oder Panikmache über die weitere Entwicklung der Bevölkerungsgesundheit und ihrer Bewältigung durch das jetzige solidarische Krankenversicherungssystem. Und bevor das Strickmuster der Prognose noch weiter Schule macht - die Herausgeber kündigen eine jährliche Aktualisierung an -, verdient die dabei dominierende Unseriosität mehr Transparenz.
Die selbstbewusste Kernaussage der Studie lautet: "Erstmalig" sei "ausgehend von den zehn wichtigsten Krankheitsbildern … gezeigt (worden), wie sich der Gesundheitszustand der Deutschen in den vergangenen zehn Jahren entwickelt hat…: Wir sind heute weniger gesund als noch vor zehn Jahren. … Das ist ein Grund zur Besorgnis - und ein Anlass zum Handeln. … Aktueller als jede andere Studie bietet das Gesundheitsbarometer … eine klare Orientierung, wohin sich Deutschlands Gesundheit entwickelt."
Um all dies liefern zu können, werteten die Autoren weder Daten einer Gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung noch Daten aus Arztpraxen aus - wie viele andere Gesundheitsreports. Sie fragten auch nicht mit den dazu vorhandenen wissenschaftlich validierten Fragen Patienten oder eine repräsentative Stichprobe der Bevölkerung nach ihrem selbst wahrgenommenen Gesundheitszustand und verglichen dies mit ähnlichen Informationen aus der Vergangenheit.
Stattdessen rührten Vivesco und der gesundheitswissenschaftlich oder epidemiologisch wirklich unbedarfte Finanzwissenschaftler Raffelhüschen einen bunten Cocktail zusammen, dessen Ingredenzien so aussehen:
• Zunächst wird der Gesundheitszustand im Jahr 2001 für die "zehn wichtigsten Krankheitsbilder" Depression, Schlafstörungen, Sodbrennen, Osteoporose oder Bluthochdruck auf der Basis von Angaben der WHO zur Krankheitslast (Indikator sind so genannte "disability adjusted life years" oder DALY [1 DALY entspricht einem verlorenen gesunden Lebensjahr]) gebildet und in einem Index auf 100 gesetzt.
• Im Frühjahr 2011 wurden dann 444 ApothekerInnen aus den 1.100 Apotheken gefragt, wie sich ihrer Ansicht nach der Gesundheitszustand im Bereich der genannten 10 Krankheiten verändert habe. Dazu sollten sich diese u.a. auf ihre "Kompetenz" und die "hautnah" an "vorderster Front im Gesundheitswesen" gewonnenen Eindrücke über die Anzahl der Erkrankungsfälle stützen. So werden die Häufigkeit des Klingelns der Ladentür und die Anzahl der Personen, die den Apotheker fragen, ob "Renni" wirklich "den Magen aufräumt" (gleich Sodbrennen) zum neuesten epidemiologischen Maß. Und man fragt sich, warum es eigentlich noch der ganzen epidemiologischen Expertise in der Gesundheitsberichterstattung bedarf.
• Die so gewonnenen Erkenntnisse werden noch "entsprechend der WHO-Einschätzung zur Krankheitsbelastung der einzelnen Krankheitsbilder gewichtet" und erfahren schließlich noch eine "abschließende Validierung". Dafür werden "sowohl Medikamenten-Verkaufsstatistiken der GESDAT als auch Fallzahlenstatistiken der WHO verwendet".
• Mittels einer hübsch kompliziert anmutenden Formel wird schließlich noch der jeweilige Indexwert berechnet - für 2011 also der Wert 141. Zwar "signalisiert" dieser "keine dramatische Verschlechterung", aber "es geht uns heute schlechter". Und 4 von 10 ApothekerInnen wissen sogar noch mehr und "gehen davon aus, dass sich der allgemeine Gesundheitszustand … in Zukunft weiter verschlechtern wird."
Wie schnell eine Längsschnitt-Gesundheitsberichterstattung, die sich auf die subjektiv wahrgenommene Häufigkeit öffnender Apothekentüren oder auf die Anzahl besetzter Stühle in Arztpraxen stützt, Schule macht, zeigt die jüngste Studie der DAK. Sie kommt zu dem - was auch sonst - "alarmierenden Ergebnis", dass sich der Gesundheitszustand der in Deutschland lebenden Kinder in den vergangenen zehn Jahren verschlechtert hat. Die empirische Basis dieser Feststellung ist eine Umfrage unter hundert Kinderärzten, die u.a. gebeten wurden, sich zu erinnern (!), ob der Gesundheitszustand ihrer jungen PatientInnen sich seit 2000 verschlechtert oder verbessert hat. Die Ärzte werden also noch nicht einmal gebeten, einen Blick in ihre Praxis-Dokumentation oder EDV zu werfen und relativ objektiv vergleichen zu können, wie viele ihrer jungen Patienten beispielsweise 2000 und 2010 wegen der einen oder anderen Erkrankung bei ihnen in Behandlung waren. Zum Wert von Erinnerungen für die Identifizierung zeitlicher Verläufe und Trendanalysen gibt es aber gesicherte Erkenntnisse der empirischen Sozialforschung. Ohne den 100 Kinderärzten zu nahe treten zu wollen: Die Methode der retrospektiven Tatsachenerhebung wird durch eine Fülle von normalen Erinnerungsschwierigkeiten bestimmt und führt meist systematisch zur Über- und Unterschätzungen der Prävalenzen gesundheitlicher Zustände. Da aktuelle Phänomene oder Häufigkeiten am besten erinnert werden, wirken sie größer als dieselben Phänomene in der ferneren Vergangenheit. Die so erhobenen Phänomene nehmen daher fast immer in der Zeit zu.
Das Elend dieser Art von Untersuchungen und die Fragwürdigkeit und/oder den einzigen Zweck der ihnen eigenen Dramatisierung, brachte der Medizinhistoriker Roy Porter bereits gegen Ende seines Standardwerk "Die Kunst des Heilens" für die entwickelten Länder auf den folgenden Punkt: "Ängste und Eingriffe schrauben sich immer höher wie eine außer Kurs geratene Rakete. … Es ist Teil eines Systems, in dem ein wachsendes medizinisches Establishment angesichts einer immer gesünderen Bevölkerung dazu getrieben wird, normale Ereignisse … zu medikalisieren, Risiken zu Krankheiten zu machen und einfache Beschwerden mit ausgefallenen Prozeduren zu behandeln. Ärzte und 'Konsumenten' erliegen zunehmend der Vorstellung, dass jeder irgendetwas hat, dass jeder und alles behandelt werden kann."(Roy Porter [2000]: Die Kunst des Heilens; Heidelberg/Berlin: 717)
Und wer dasselbe aktueller, auf deutlich weniger als 700 Seiten und speziell für die "dramatisch zunehmenden Volkskrankheiten" Depression und Alzheimer nachlesen will, kann dies in dem Aufsatz "Geldmacherei mit Patienten. Die Krankheitserfinder" von Werner Bartens tun, der in der Wochenendausgabe der "Süddeutschen Zeitung" vom 16. Juli 2011 erschienen und kostenlos erhältlich ist.
Wer nun noch wissen will oder Demonstrationsmaterial braucht, um zu zeigen wie man längsschnittliche Gesundheitsberichterstattung nicht betreiben sollte, findet den Originaltext der beiden hier exemplarisch vorgestellten "Studien" kostenlos im Internet:
Das "vivesco-Gesundheitsbarometer" umfasst 19 Seiten.
Die Ergebnisse des DAK-Reports "Meinungen zur Gesundheit der Kinder in Deutschland" sind in einer vierseitigen Zusammenfassung des Forsa-Instituts zu sehen.
Bernard Braun, 16.7.11
IG Nobel Preise 2010: Strümpfe (über den Schuhen getragen) helfen im Winter zur Prävention von Stürzen
 "Unser Ziel ist es, die Leute erst zum Lachen zu bringen - und dann zum Nachdenken!" unter diesem Motto verleihen Mitglieder der Harvard-Universität in Cambridge (USA) für skurrile wissenschaftliche Arbeiten seit dem Jahr 1991 jährlich den "IG Nobel Prize" (mit dem Wortspiel "ignoble" = unedel, unwürdig, schändlich). Über die jährliche Zeremonie und Preisverleihung wird in den Medien mit großem Interesse und ausführlich berichtet. Über die Preisverleihungen in früheren Jahren hatten wir schon berichtet (Mehr Trinkgeld für Striptease-Tänzerinnen an fruchtbaren Tagen, "Fröhliche Wissenschaft").
"Unser Ziel ist es, die Leute erst zum Lachen zu bringen - und dann zum Nachdenken!" unter diesem Motto verleihen Mitglieder der Harvard-Universität in Cambridge (USA) für skurrile wissenschaftliche Arbeiten seit dem Jahr 1991 jährlich den "IG Nobel Prize" (mit dem Wortspiel "ignoble" = unedel, unwürdig, schändlich). Über die jährliche Zeremonie und Preisverleihung wird in den Medien mit großem Interesse und ausführlich berichtet. Über die Preisverleihungen in früheren Jahren hatten wir schon berichtet (Mehr Trinkgeld für Striptease-Tänzerinnen an fruchtbaren Tagen, "Fröhliche Wissenschaft").
Besondere Aufmerksamkeit erhielt der IG Nobel Preis in der Disziplin Physik im Jahre 1996, als der Physiker Robert Matthews auf mathematischem Wege eindeutig bewies, was im Volksmund schon immer vermutet wurde: Wenn ein Butterbrot auf den Boden fällt, dann immer mit der Butterseite bzw. belegten Seite nach unten! Noch allgemeiner gefasst wurde diese Erkenntnis als "Murphy's Gesetz": Was schief gehen kann, geht auch schief. In der mathematischen Abhandlung von Matthews "Tumbling toast, Murphy's Law and the fundamental constants" (veröffentlicht im European Journal of Physics, Volume 16, Number 4, 1995, S. 172ff) wurde dieser Verdacht nun wissenschaftlich bestätigt. Unter Berücksichtigung der zentralen physikalischen Einflussfaktoren wird nachgewiesen, dass das Butter- oder Toastbrot so wie vom Volksmund erfahren fallen muss und dies eben nicht einer 50:50-Chance folgt, mal so, mal so. Erörtert wird in der Abhandlung am Schluss aber auch kurz, dass man die mit dem Naturgesetz "Butterseite fällt nach unten" verbundenen Unanehmlichkeiten vermeiden könnte, wenn man das Brot von einem Tisch herunterfallen lässt, der mindestens drei Meter hoch ist oder wenn man sich Brote schmiert, die maximal 2,5 Quadratzentimeter groß sind. Mathematisch geschulte Leser finden hier die gesamte mathematische Abhandlung.
Auch in nachfolgenden Jahren fanden die Preisverleihungen große Aufmerksamkeit. So wurden im Jahre 2009 unter anderem folgende Arbeiten prämiert:
• Der Friedens-Nobelpreis ging an Stephan Bolliger und Kollegen aus Bern für ihre Untersuchung, ob es gesundheitlich besser ist, eine volle oder leere Bierflasche über den Schädel geschlagen zu bekommen: "Are Full or Empty Beer Bottles Sturdier and Does Their Fracture-Threshold Suffice to Break the Human Skull?"
• Der Physik-Nobelpreis ging an Katherine K. Whitcome aus Cincinnati und Kollegen für ihre Untersuchung, warum schwangere Frauen normalerweise nicht vornüber umkippen: "Fetal Load and the Evolution of Lumbar Lordosis in Bipedal Hominins"
• Der Public-Health-Nobelpreis ging an Elena N. Bodnar und Kollegen für ihre Erfindung eines Büstenhalters, der im Notfall innerhalb weniger Sekunden in zwei Atemschutzmasken umgewandelt werden kann. Die Schutzschrift für den inzwischen patentierten Büstenhalter findet man hier: Garment device convertible to one or more facemask
Auch im Jahre 2010 gab es wieder Auszeichnungen für sensationelle wissenschaftliche Studien.
• Der Medizin-Nobelpreis ging an Simon Rietveld und Ilja van Beest aus den Niederlanden führ ihre Studie, in der sie aufzeigen konnten, dass Asthma-Anfälle durch Achterbahnfahrt therapierbar sind (zumindest vorübergehend): "Rollercoaster Asthma: When Positive Emotional Stress Interferes with Dyspnea Perception"
• Der Physik-Preis hätte auch in der Disziplin Public Health vergeben werden können. Lianne Parkin, Sheila Williams und Patricia Priest aus Neuseeland konnten (in einer randomisierten Kontrollstudie!) nachweisen, dass man im Winter das Risiko von Stürzen auf eisglatten Flächen erheblich reduzieren kann, wenn man außen über den Schuhen noch Strümpfe trägt: "Preventing Winter Falls: A Randomised Controlled Trial of a Novel Intervention"
Sämtliche Preisträger und Links zu ihren wissenschaftlichen Publikationen findet man hier: Improbable Research: Winners of the Ig Nobel Prize
Gerd Marstedt, 23.11.10
Meta-Analyse von 148 Studien zeigt: Soziale Isolation und Einsamkeit sind ein höheres Gesundheitsrisiko als das Rauchen
 Unzureichende soziale Kontakte und Isolation, so hat eine jetzt in der Zeitschrift "PLoS Medicine" veröffentlichte Meta-Analyse gezeigt, erhöhen das Sterblichkeitsrisiko um 50 Prozent im Vergleich zu anderen Bevölkerungsgruppen mit starken sozialen Beziehungen. 148 Studien mit 308.849 Teilnehmern wurden von dem US-amerikanischen Forschungsteam in die Meta-Analyse einbezogen und noch einmal neu bilanziert. Dabei versuchte man, die Effektstärke unterschiedlicher Formen sozialer Kontakte für die Mortalität zu bestimmen.
Unzureichende soziale Kontakte und Isolation, so hat eine jetzt in der Zeitschrift "PLoS Medicine" veröffentlichte Meta-Analyse gezeigt, erhöhen das Sterblichkeitsrisiko um 50 Prozent im Vergleich zu anderen Bevölkerungsgruppen mit starken sozialen Beziehungen. 148 Studien mit 308.849 Teilnehmern wurden von dem US-amerikanischen Forschungsteam in die Meta-Analyse einbezogen und noch einmal neu bilanziert. Dabei versuchte man, die Effektstärke unterschiedlicher Formen sozialer Kontakte für die Mortalität zu bestimmen.
In die Analyse einbezogen wurden nur Studien:
• die über einen längeren Zeitraum als Verlaufsstudie durchgeführt worden waren, die durchschnittliche Verlaufsdauer betrug 7,5 Jahre, die längste Dauer einer Studie war 41 Jahre,
• die Studien mussten auch in quantitativer Form Auskunft geben über den Zusammenhang von sozialen Beziehungen und Mortalität,
• dabei sollten unterschiedliche Operationalisierungen einbezogen sein, strukturelle Aspekte (Single-Status, allein wohnen, verheiratet sein) oder auch funktionelle (Erhalt sozialer Unterstützung, intensive soziale Integration), Studien, die nur Unterschiede zwischen Verheirateten und Singles untersuchten, wurden ausgeschlossen,
• ebenso wurden solche Studien ausgeschlossen, bei denen Mortalitäts-Daten auch oder ausschließlich durch Suizid oder Gewalttaten verursacht waren.
In multivariaten Analysen wurden dann Zusammenhänge untersucht zwischen den verschiedenen, in den Studien fokussierten Formen positiver bzw. negativer sozialer Beziehungen einerseits (Status alleinstehend versus verheiratet oder in fester Beziehung, starke versus schwache soziale Integration aufgrund von Aktivitäten in Vereinen, in der Nachbarschaft, im Freundeskreis etc.) und Sterblichkeitsraten andererseits. Kontrolliert wurden dabei auch andere potenzielle Einflussfaktoren wie Alter, Geschlecht, Gesundheitszustand und Erkrankungen zu Beginn der Verlaufsstudie, Todesursachen.
Als Ergebnis dieser Analysen wurden dann folgende Effektstärken (Odds-Ratios) ermittelt für eine vorzeitige Sterblichkeit:
• Erhalt sozialer Unterstützung: 1,22
• Einsamkeit: 1,45
• allein leben: 1,19
• verheiratet - alleinstehend: 1,33
• soziale Isolation 1,40
• soziale Integration:1,52
• komplexe Messungen sozialer Integration: 1,91
Schlichte und nur zweistufige Erfassungen sozialer Beziehungen (z.B. allein wohnen ja/nein, verheiratet sein ja/nein), so fassen die Wissenschaftler ihre Befunde zusammen, zeigen zwar statistisch signifikante, aber quantitativ doch schwächere Effekte für die Sterblichkeit. Komplexe Studiendesigns andererseits, in denen eine größere Zahl von Indikatoren erfasst wird (Größe und Stärke des sozialen Netzwerks, Art der Freizeitaktivitäten, Gefühle von Einsamkeit etc.) bieten überaus starke Vorhersagen für die Lebenserwartung. Bei Personen mit einer sehr schwachen sozialen Integration, die differenziert erfasst wurde, ist das Mortalitäts-Risiko fast doppelt so hoch (1,91).
Die Wissenschaftler vergleichen in ihrer Studie schließlich auch die Effektstärke von Einsamkeit und sozialer Isolation mit der von anderen gesundheitlichen Risikofaktoren. Dabei wird deutlich, dass solche sozial defizitären Bedingungen (sofern sie auf differenziert gemessen wurden) ein deutlich höheres gesundheitliches Risiko darstellen als konventionelle Einflussfaktoren, wie zum Beispiel das regelmäßige Rauchen von 15 Zigaretten am Tag oder Alkoholkonsum mit 6 oder mehr Drinks täglich.
Die Studie ist als HTML-Datei oder im PDF-Format hier kostenlos verfügbar: Julianne Holt-Lunstad, Timothy B. Smith, J. Bradley Layton: Social Relationships and Mortality Risk: A Meta-analytic Review (PLoS Med 2010; DOI: 10.1371/journal.pmed.1000316)
Die Wissenschaftler weisen zwar darauf hin, dass Gesundheitszustand und Vorerkrankungen zu Beginn der Studien miterfasst und in den statistischen Analysen als mögliche Störfaktoren ("Confounders") miteinbezogen wurden. Gleichwohl kann man einen eindeutigen Kausal-Zusammenhang ("Gute soziale Beziehungen halten gesund und erhöhen die Lebenserwartung") auch für diese Meta-Analyse nicht als gesichert unterstellen. Denn der umgekehrte Verursachungsmechanismus ("Gesunde Personen haben eher Zeit, Ressourcen und Interesse in Bezug auf soziale Beziehungen") ist auch hier zumindest teilweise denkbar, da die zeitliche Entwicklung des Gesundheitszustands nicht überprüft wurde.
In einer unlängst erschienenen deutschen Studie mit Längsschnittdaten des "Sozio-Ökonomischen Panels (SOEP)" hatte sich nämlich gezeigt: Die Ehe hat keine kausal positive gesundheitliche Wirkung im Sinne eines Schutzes vor Stress oder einer Erhöhung des psychischen und somatischen Wohlbefindens. Die bessere Gesundheit von Verheirateten lässt sich stattdessen "vollständig" durch die "Selektion der Gesünderen in die Ehe erklären." Es zeigt sich, "… dass bei schlechter Gesundheit die Heiratswahrscheinlichkeit bei Männern um 45 % niedriger ist als bei guter Gesundheit. Bei den Frauen beträgt der Effekt 49 %. Damit kann davon ausgegangen werden, dass dem Selektionseffekt ein deutlicher Einfluss zukommt: Gesündere heiraten häufiger als Ungesündere."
Vgl. Hält die Ehe gesund oder heiraten Gesündere häufiger als Ungesündere - Protektion oder Selektion?
Gerd Marstedt, 30.7.10
Ein hoher Intelligenzquotient senkt das Suizid-Risiko - außer man ist psychotisch erkrankt
 Männer mit einem hohen Intelligenzquotienten (IQ) begehen seltener Selbstmord als solche mit niedrigem IQ. Lediglich bei psychotisch Erkrankten zeigt sich dieser deutliche Zusammenhang nicht mehr. Verlaufsdaten von über 1,1 Millionen schwedischen Männern bilden die Basis dieser Studie, die jetzt im "British Medical Journal" veröffentlicht wurde.
Männer mit einem hohen Intelligenzquotienten (IQ) begehen seltener Selbstmord als solche mit niedrigem IQ. Lediglich bei psychotisch Erkrankten zeigt sich dieser deutliche Zusammenhang nicht mehr. Verlaufsdaten von über 1,1 Millionen schwedischen Männern bilden die Basis dieser Studie, die jetzt im "British Medical Journal" veröffentlicht wurde.
Die schwedische Forschungsgruppe hatte bereits im Jahre 2005 Untersuchungsergebnisse veröffentlicht, die auf ähnlichen Daten beruhen (vgl. "Suizid ist auch eine Frage der Intelligenz"). Schwedische Männer müssen im Alter von etwa 18 Jahren zur Musterung gehen, um ihre Wehrdiensttauglichkeit zu überprüfen. Bei dieser Gelegenheit werden nicht nur Gesundheitszustand und körperliche Fitness untersucht, sondern auch ein ausführlicher Intelligenztest durchgeführt (verbale Intelligenz, logisches Denken, räumliches Denken, technisches Verständnis). Daten aus diesem Test sind der eine wesentliche Teil der Studie.
Darüber hinaus wurde über einen Zeitraum von durchschnittlich 24 Jahren anhand offizieller staatlicher Daten (Schwedisches Klinik-Entlassungs-Register) verfolgt, ob einer der untersuchten Männer in ein Krankenhaus wegen eines Suizidversuchs eingeliefert worden war. Und kontrolliert wurde auch, ob bei den Betroffenen zuvor eine psychotische Erkrankung diagnostiziert worden war.
Während des Beobachtungszeitraums von 1969 bis 2006 wurden dann 17.736 Suizidversuche festgestellt, die allermeisten (etwa 14.000) waren mit Gift oder Medikamenten durchgeführt worden. Die Untersuchungsgruppe wurde dann auf der Basis der IQ-Messungen in neun Gruppen eingeteilt. Analysiert wurde in multivariaten Analysen der Zusammenhang zur Häufigkeit von Suizid-Versuchen, wobei eine Reihe anderer potentieller Einflussfaktoren mitberücksichtigt wurde, unter anderem: Lebensbedingungen in der Kindheit, Schichtzugehörigkeit in der Kindheit und als Erwachsener, Bildungsniveau (Schulabschluss), Blutdruck, Body Mass Index, Geburtsjahr, Rauchen, Alkoholkonsum und nicht zuletzt die Diagnose einer psychotischen Erkrankung.
Die Gruppe mit dem durchschnittlichen Intelligenzquotienten wurde dann als Vergleichsgruppe definiert. Als Ergebnis zeigte sich: Die Gruppe mit den niedrigsten IQs hatte ein doppelt so hohes Risiko, später einen Selbstmordversuch zu verüben (Hazard Ratio: 1,99). Umgekehrt war das Risiko in der Gruppe mit den höchsten IQs nur etwa halb so groß (Hazard Ratio: 0,57). Diese Zusammenhänge zeigten sich allerdings nur bei psychisch unauffälligen Männern, bei denen die zuvor keine Psychose festgestellt worden war.
Die Wissenschaftler diskutieren mehrere Erklärungsansätze für die gefundenen Zusammenhänge:
• Ein niedriger IQ hat in vielen Studien auch Zusammenhänge gezeigt zu gesundheitsriskanten Verhaltensgewohnheiten (Rauchen, Rauschtrinken), die ihrerseits Zusammenhänge zeigen zu Suizidversuchen. In der statistischen Analyse hat eine Berücksichtigung dieser Faktoren ebenso wie der Schichtzugehörigkeit den Einfluss des Intelligenzquotient nur unerheblich verändert.
• Ein zweiter Erklärungsansatz betrifft individuelle Kompetenzen, solche zur Stressbewältigung und Problemlösung die mit einem niedrigen Intelligenzniveau verknüpft sind und möglicherweise auch in kritischen Lebenssituationen den Blick für praktische Lösungen verstellen.
• Auch die unterschiedliche Kontrollerwartung oder Selbstwirksamkeitserwartung ("Ein Mensch, der daran glaubt, selbst etwas zu bewirken und auch in schwierigen Situationen selbstständig handeln zu können, hat demnach eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung." Wikipedia )
• Eine schlüssige Erklärung dafür, dass psychotische Erkrankungen den gefundenen Zusammenhang auflösen, konnten die Wissenschaftler noch nicht formulieren.
Hier findet man die Studie (Volltext, freier kostenloser Zugang): G David Batty, Elise Whitley, Ian J Deary, Catharine R Gale, Per Tynelius, Finn Rasmussen: Psychosis alters association between IQ and future risk of attempted suicide: cohort study of 1 109 475 Swedish men (BMJ 2010;340:c2506)
Gerd Marstedt, 20.6.10
Fußball ist ohnehin schon ein Gesundheitsrisiko - Und jetzt auch noch die Vuvuzelas bei der Fußball-WM
 Fußball ist für aktive Fußballspieler ein Gesundheitsrisiko ersten Ranges. Kreuzbandriss und Adduktorenzerrung, Kahnbeinbruch und Syndesmosebandriss sind Begriffe, die heute jedem Bundesliga-Fan wie selbstverständlich über die Lippen gehen, weil sie im Kicker oder in der Sportbild fast täglich von den Blessuren ihrer Lieblingsspieler lesen müssen. Doch auch der Fußballfan selbst, sei es im gegnerischen Stadion oder am heimischen Bildschirm lebt nicht ohne Risiko. In der renommierten medizinischen Fachzeitschrift "New England Journal of Medicine (NEJM)" hatten Münchner Mediziner berichtet, dass die Häufigkeit neuer Herzinfarkte während der Fußballl-Weltmeisterschaft 2006 im Vergleich zu vier anderen Zeitphasen in Deutschland deutlich höher lag: An Tagen, an denen die deutsche Mannschaft spielte, war das Neuauftreten von Herzinfarkten und vergleichbar schweren gefährlichen Herzattacken 2,7mal so hoch wie während der Vergleichszeiträume. Die Analysen von über 4.200 Patienten zeigten auch, dass Männer gefährlicher leben, ihr Risiko war um das 3,3fache höher, während das der weiblichen Fans "nur" um das 1,8fache höher lag. Die Studie ist hier kostenlos im Volltext verfügbar: Ute Wilbert-Lampen et al: Cardiovascular Events during World Cup Soccer (N Engl J Med 2008;358:475-83). Zusammenfassung: "Fußballspiele anschauen kann tödlich sein!"
Fußball ist für aktive Fußballspieler ein Gesundheitsrisiko ersten Ranges. Kreuzbandriss und Adduktorenzerrung, Kahnbeinbruch und Syndesmosebandriss sind Begriffe, die heute jedem Bundesliga-Fan wie selbstverständlich über die Lippen gehen, weil sie im Kicker oder in der Sportbild fast täglich von den Blessuren ihrer Lieblingsspieler lesen müssen. Doch auch der Fußballfan selbst, sei es im gegnerischen Stadion oder am heimischen Bildschirm lebt nicht ohne Risiko. In der renommierten medizinischen Fachzeitschrift "New England Journal of Medicine (NEJM)" hatten Münchner Mediziner berichtet, dass die Häufigkeit neuer Herzinfarkte während der Fußballl-Weltmeisterschaft 2006 im Vergleich zu vier anderen Zeitphasen in Deutschland deutlich höher lag: An Tagen, an denen die deutsche Mannschaft spielte, war das Neuauftreten von Herzinfarkten und vergleichbar schweren gefährlichen Herzattacken 2,7mal so hoch wie während der Vergleichszeiträume. Die Analysen von über 4.200 Patienten zeigten auch, dass Männer gefährlicher leben, ihr Risiko war um das 3,3fache höher, während das der weiblichen Fans "nur" um das 1,8fache höher lag. Die Studie ist hier kostenlos im Volltext verfügbar: Ute Wilbert-Lampen et al: Cardiovascular Events during World Cup Soccer (N Engl J Med 2008;358:475-83). Zusammenfassung: "Fußballspiele anschauen kann tödlich sein!"
Eine neuere Studie des Instituts für Gesundheitsökonomie und Klinische Epidemologie der Universität Köln hat jetzt vor kurzem erst diese Erkenntnis über das Gesundheitsrisiko Fußball-Schauen noch einmal ein wenig relativiert. In der Studie wurden Daten von 7,2 Millionen Versicherten ausgewertet und nach akuten Herzerkrankungen während der WM 2006 gesucht. Institutsleiter Markus Lüngen stellte dann gegenüber der Presse fest, dass sich nur im Raum Münchens ein statistischer Zusammenhang zu den Länderspielen herstellen ließe, außerhalb der bayerischen Landeshauptstadt jedoch nicht. Dort läge das Risiko sogar niedriger, vgl. "Fußball fürs Herz - Länderspiele erhöhen Infarkt-Risiko nicht - außer in München" (Jetzt.de SZ Leben 09.06.2010) Warum Münchener nun aber mehr mitleiden als andere Fans - dazu konnte Dr. Lüngen allerdings keine schlüssige Erklärung abgeben.
Doch die Beschwichtigungen, dass Fußballzuschauer außerhalb Münchens kaum gefährdet sind, sollten nun ein Ende haben. Die neue Bedrohung ist in aller Munde, erinnert an den Ex-HSV-Profi und Nationalspieler Uwe Seeler und heißt "Vuvuzela". "Die Vuvuzela", so schreibt Wikipedia, "(auf Setswana manchmal auch Lepatata genannt) ist ein Blasinstrument und ein Symbol des südafrikanischen Fußballs. Das Instrument ist trompetenförmig, bis zu einem Meter lang und kann aus Kunststoff oder Blech gefertigt sein. Sein Klang ähnelt dem Trompeten eines Elefanten. Vielfach in Stadien eingesetzt klingt es wie ein Hornissen-Schwarm." (Wikipedia Vuvuzela)
Sieht man einmal ab von den für Zuschauer zumindest nerv-, für aktive Spieler aber konzentrations- und kommunikationstötenden Eigenschaften, so sind in den letzten Tagen seit Eröffnung der WM in Südafrika jedoch weitaus gravierende Folgen in die Schlagzeilen der Medien geraten.
• Da ist zum Ersten die auch für jeden TV-Zuschauer in Deutschland (obwohl 8000 Kilometer vom Geschehen entfernt) nachvollziehbare Gesundheitsgefährdung durch Lärm. Denn Vuvuzelas können Geräuscheinwirkungen von über 120 Dezibel (A) erreichen, was etwa so laut wie ein Düsentriebwerk ist. In einer südafrikanischen Studie wurden sogar Spitzenwerte von 140 Dezibel gemessen. (vgl. De Wet Swanepoel, James W Hall III: Football match spectator sound exposure and effect on hearing: A pretest-post-test study South African Medical Journal, 2010; 100: 239-242) Dass solche Einwirkungen von 40.000 oder mehr Blasgeräten in einem Stadion auf Dauer nicht gesundheitsförderlich sind, weder für Nerven noch Trommelfell, ist nachvollziehbar.
• Zum Zweiten muss dann auf die Verbreitung von Grippe- und Erkältungs-Erregern hingewiesen werden. Bei einem Schnupfen oder Husten bemüht man sich bekanntlich, dem Nachbarn im Bus nicht direkt ins Gesicht oder in den Nacken zu prusten. Mit der Vuvuzela jedoch wird genau dieses Verhaltensmuster zehntausendfach zur Norm. Und in Südafrika ist derzeit Winter und die Grippewelle voll im Schwung. Durch das Instrument, so erklärte jetzt Dr. Ruth McNerney von der "London School of Hygiene and Tropical Medicine" einer Nachrichten-Agentur, würden Krankheitserreger in weitaus stärkerem Maße verbreitet als durch normales Husten oder Niesen - dies habe auch eine in ihrem Institut durchgeführte Studie gezeigt. (vgl. Study: Vuvuzela Could Spread Colds And Flu)
• Zum Dritten schließlich wird darauf hingewiesen, dass Notfall-Durchsagen in Stadien übertönt werden und so weitere Risiken für Stadionbesucher entstehen, weil sie Rettungs-Hinweise nicht hören können. Vom Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen wurde daher unlängst eine Empfehlung an deutsche Kommunen ausgesprochen, den Gebrauch von Vuvuzelas bei öffentlichen Veranstaltungen (Public Viewing) zu untersagen. Manche Städte folgten der Aufforderung, andere nicht.
• Zum Vierten schließlich wird bislang das Risiko massiver Konflikte und Handgreiflichkeiten zwischen Fußball-Fans viel zu wenig diskutiert, obwohl es in fast allen WM-Diskussionsforen deutlich wird. Einzelne Forumsnutzer, die sich dem Wehklagen der Mehrheit über nervtötendes und stumpfsinniges 90-Minuten-Getröte nicht anschließen wollen und auf kulturelle Traditionen Südafrikas hinweisen, laufen Gefahr, als Kulturbanausen bezeichnet zu werden. (Schließlich habe man während der WM 2006 in Deutschland auch nicht permanent Blasmusik und Dieter Bohlen präsentiert.) "Rassismus" und "Kulturimperialismus" andererseits wird jenen Wortführern an den Kopf geworfen, die die Tröte den Südafrikaner einfach verbieten wollen. Dass es hier nicht bei Wortgefechten bleiben wird, ist absehbar.
Ob es noch zu größeren und methodisch fundierten wissenschaftlichen Langzeit-Studien über das Gesundheitsrisiko Vuvuzela kommt, randomisierte Kontrollstudien, die zumindest Klarheit über die gesundheitlichen Dimensionen des Problems bringen könnten, ist indes ungewiss. Denn die Newsticker fast aller Nachrichtenagenturen vermeldeten heute mittag "FIFA schließt Vuvuzela-Verbot nicht aus".
Gerd Marstedt, 13.6.10
"Todesursache" Nr. 1: Herzstillstand! Wie groß und inhaltlich folgenschwer ist das Elend der Todesursachenstatistik?
 Zu den Klassikern unter den in der weltweiten Gesundheitsberichterstattung verwandten Indikatoren der gesundheitlichen Lage gehören die Häufigkeit und die Ursachen der Sterbefälle. Damit handelt es sich auch um die meistverwendeten Indikatoren in Gesundheitssystemvergleichen.
Zu den Klassikern unter den in der weltweiten Gesundheitsberichterstattung verwandten Indikatoren der gesundheitlichen Lage gehören die Häufigkeit und die Ursachen der Sterbefälle. Damit handelt es sich auch um die meistverwendeten Indikatoren in Gesundheitssystemvergleichen.
Ebenso klassisch ist aber die Bemerkung, man könne zumindest die Verlässlichkeit oder Validität der Hauptinformationsquelle zu den qualitativen Details der Sterbefälle, nämlich die Todesursachenbescheinigungen "vergessen" - vor allem auch, wenn diese von niedergelassenen Ärzten ausgestellt wurden. Dies bestätigte sich auch in Studien, die die attestierten Todesursachen im Rahmen von Obduktionen überprüften. Zusätzlich zu den daraus ableitbaren Unsicherheitsquoten bei den normalen Todesursachenbescheinigungen, gab es aber Hinweise darauf, dass sowohl intertemporale als auch internationale oder -regionale Todesursachenstatistiken wegen einer Vielzahl von Schwächen mit Vorsicht zu nutzen und zu genießen sind. Wie groß die Vorsicht dabei sein sollte, konnte man bisher aber nicht ausreichend quantifizieren.
Eine gerade erschienene Studie von sechs us-amerikanischen Gesundheitsstatistikern der University of Washington in Seattle schafft hier erheblich Abhilfe. Sie benennen nicht nur die Fehlerquellen, sondern quantifizieren auch die durch sie produzierten Fehleinschätzungen.
Wesentliche Ursachen für die fehlerhafte und qualitativ mängelbehaftete Berichterstattung über Todesursachen selbst in den Ländern mit ausgezeichneten Gesundheitsberichterstattungssystemen gibt es nach den AutorInnen mehrere.
Dazu gehören
• die regelmäßigen Veränderungen der "International Statistical Classification of Disease and Related Health problems (ICD)". Wer die Entwicklung der Sterblichkeit im gesamten 20 Jahrhundert untersuchen will, muss Daten verwenden, die auf der Basis von fünf Versionen der "International List of Causes of Death (ILCD)" und danach von weiteren fünf Versionen der ICD (aktuelle Version ICD 10) bestimmt worden sind. Der Übergang von der reinen Todesursachenklassifikation ILCD zu den Mortalitäts- und Morbiditäts-Klassifikationen ICD 6-10 weitete die Anzahl der Ursachen von 179 auf rund 20.000 aus. Die zunehmende Komplexität und Unübersichtlichkeit trug dazu bei, dass weder im selben Land noch international immer die aktuellste Version benutzt wurde oder die differenzierteren Möglichkeiten gar nicht oder nur zeitverzögert ausgenutzt wurden.
• Um das Problem mit der Fülle von Todesursachen praktisch bewältigen zu können, gab es ab der ICD 6 Kurzformen oder "Kitteltaschenversionen" der ICD-Todesursachen. Deren unterschiedliche Zusammensetzungen und die gleichzeitige Anwendung des gesamten ICD-Katalogs machen die Gewinnung von Zeitreihen von Todesursachen nicht einfacher und inaltlich valide.
• Eine dritte Ursache für die inhaltlichen Mängel von Todesursachenstatistiken folgt aus dem Nebeneinander von Mortalitäts- und Morbiditätsursachen in den ICD-Versionen. Dies meint, dass Ärzte Diagnosen als Todesursachen benennen, die weder aus klassisch medizinischer noch aus Public Health-Sicht wirklich zum Tode führen können. Die WHO-VerfasserInnen der ICD-Klassifikationen haben dem sogar selber Rechnung getragen indem sie im Anhang der ICD-Codes eine "List of conditions unlikely to cause death" einfügten. Trotzdem war damit nach Expertenmeinung das Problem der so genannten "garbage codes" oder des "garbage coding" nicht verschwunden.
Wozu diese Fehler-Ursachen quantitativ führten haben die MedizinstatistikerInnen aus Seattle nun auf der Basis von 4.434 Länderjahren mit Todesursachendaten aus 145 Ländern im Zeitraum von 1901 bis 2008 genauer untersucht. Die Datenbasis umfasste 743 Millionen Todesfälle während des Geltungs- und Nutzungszeitraums der ICD-Versionen 1 bis 10. Die Wissenschaftler erstellten damit länderspezifische Todesursachenlisten und eine Public health-orientierte Todesursachenliste mit 56 Ursachen. Für jede Klassifikationsversion identifizierten sie außerdem die Arten und die Anzahl von "Mülldiagnosen oder -ursachen" und versuchten mit aufwändigen Methoden an ihrer Stelle die wirklichen Ursachen zu eruieren. Dabei unterschieden sie vier Arten von "Müll-Todesursachen" zu denen u.a. eindeutig unzutreffende oder die wahren Ursachen verhüllende Sachverhalte wie der Risikofaktor essentieller Bluthochdruck oder das Herzversagen als letztes Ereignis des Wirkens einer Reihe von Ursachen gehören.
Die wesentlichen Ergebnisse dieser Bemühungen sind:
• Der Anteil von Todesfällen, die mit "Müllursachen" fehlklassifiziert wurden, verändert sich über alle Länder hinweg und auch zwischen den einzelnen ICD-Versionen erheblich.
• Untersucht man die Daten sämtlicher Länderjahre ging der Anteil von "Müllursachen" von 43 % während des Geltungszeitraums der ICD 7 auf 24 % innerhalb der noch laufenden ICD 10-Zeit zurück.
• Im Jahr 2005 variierte der Anteil von falschen bzw. unbrauchbaren Todesursachen zwischen 11 % im austral-asiatischen Bereich und mehr als 50 % in Ländern wie Thailand.
• Die Arten der "Müllursachen" variierten zusätzlich noch erheblich nach dem Alter der Gestorbenen.
• Wenn man versucht, die "Müll-Todesursachen" durch wahrscheinlich tatsächliche Todesursachen zu ersetzen und dann z.B. altersstandardisierte Todesraten neu berechnet, verändern sich beispielsweise internationale Rangreihen nicht unwesentlich: In der Rangreihe der ischämischen Herzerkrankungen verändert sich die Rangfolge von 83 Ländern im Jahr 2005 so: Der Rang von 19 Ländern verändert sich um 2-4 Positionen und der von 49 Ländern um 5 oder mehr Rangpositionen nach oben oder unten. Bei den tödlichen Verkehrsunfällen ist der Effekt noch wesentlich stärker. Noch bedeutender wird die Kontrolle und Korrektur falscher Todesursachen aber im Bereich der nichtübertragbaren Erkrankungen wie z.B. Diabetes wo sich durch die genannten Korrekturen etwa Trendrichtungen in der Zeit umkehren. Ähnlich folgenreich erweisen diese Todesursachenkorrekturen sich beim genauen Timing der sozial- und gesundheitspolitisch relevanten epidemiologischen Transition.
Im Aufsatz und in 5 Anhängen legen die WissenschaftlerInnen umfassende Daten zu den Arten und dem Umfang der "Müll-Todesursachen" und den Folgen ihrer inhaltlichen Korrekturen für die Statistik von 56 Public health-relevanten Diagnosebereichen vor.
Nach Kenntnis der Anzahl falschklassifizierter Todesursachen und nach Kenntnis der inhaltlichen Auswirkungen für die Gesundheitsberichterstattung sollte noch mehr und intensiver als in der Vergangenheit versucht werden, die Diagnosequalität der Todesursachenbescheinigungen durch geeignete Qualifizierungsmaßnahmen für Ärzte und andere damit betraute Personen deutlich zu verbessern.
Der Aufsatz "Algorithms for enhancing public health utility of national causes-of-death data" von Mohsen Naghavi, Susanna Makela, Kyle Foreman, Janaki O'Brien, Farshad Pourmalek und Rafael Lozano ist als "Open access"-Beitrag und damit komplett kostenlos in der Fachzeitschrift "Population Health Metrics" (2010, 8:9) erschienen. Die Anhänge sind durch Links im Text zugänglich.
Bernard Braun, 13.6.10
Spanische Längsschnittstudie zeigt: Eine schlechte Lebensmoral erhöht das Sterblichkeitsrisiko
 Wer sich selbst akzeptiert, im Großen und Ganzen zufrieden mit sich selbst ist, und wer das akzeptiert, was ohnehin unabänderlich ist, hat auch eine höhere Lebenserwartung. Diesen Zusammenhang von "Lebensmoral" und Sterblichkeit hat jetzt eine Längsschnittuntersuchung bei etwa 2.500 älteren Spaniern und Spanierinnen (Durchschnittsalter 76 Jahre) gezeigt.
Wer sich selbst akzeptiert, im Großen und Ganzen zufrieden mit sich selbst ist, und wer das akzeptiert, was ohnehin unabänderlich ist, hat auch eine höhere Lebenserwartung. Diesen Zusammenhang von "Lebensmoral" und Sterblichkeit hat jetzt eine Längsschnittuntersuchung bei etwa 2.500 älteren Spaniern und Spanierinnen (Durchschnittsalter 76 Jahre) gezeigt.
Die Teilnehmer stammten aus einer Verlaufsstudie Neurological Disorders in Central Spain (NEDICES), an der Patienten mit unterschiedlichen Erkrankungen und Beschwerden beteiligt waren: Parkinson, Tremor, Schlaganfall und Demenz. Ihnen wurde in den Jahren 1997-1998 ein umfangreicher Fragebogen vorgegeben, in dem eine Vielzahl von Informationen erfragt wurde: Sozialstatistische Angaben (wie Alter, Geschlecht, Bildungsniveau, Familienstand), Informationen zum Gesundheitsverhalten (Rauchen, Alkoholkonsum), medizinische Risikofaktoren und körperliche Erkrankungen (Bluthochdruck, Diabetes, Arthritis, Atemwegserkrankungen). Darüber hinaus wurde auch die Lebensmoral erfasst.
Dieses Persönlichkeitsmerkmal der "Lebensmoral" ("morale") wurde in der Studie mit einem Fragebogen erfasst (Philadelphia Geriatric Center Morale Scale), der drei verschiedene Facetten und 17 Fragen beinhaltet:
• Ängstlichkeit und Erregbarkeit (Fragen wie u.a.: Fürchten Sie sich vor vielen Dingen? Sind Sie leicht erregbar? Ärgern Sie sich in diesem Jahr häufiger?)
• Einstellungen zum Altern (Ändert sich vieles zum Schlechten wenn man älter wird? Sind Sie so glücklich wie früher als Sie noch jung waren?)
• Einsamkeit und Lebenszufriedenheit (Wie einsam fühlen Sie sich? Denken Sie manchmal, das Leben ist nicht lebenswert? Gibt es vieles, über das Sie traurig sind?)
Die Antworten zu den Einzelfragen wurde dann in einen Gesamtwert überführt und auf dieser Basis drei Gruppen mit niedriger, mittlerer und hoher Lebensmoral konstruiert. Seit Beginn der Studien wurden überdies die Sterbefälle aller Teilnehmer protokolliert, durchschnittlich über einen Zeitraum von knapp 6 Jahren. Insgesamt ereigneten sich 489 Todesfälle, die jedoch höchst ungleich verteilt waren: In der Gruppe mit niedriger Moral waren 21,8 Prozent verstorben, bei mittlerer Moral 19,3 Prozent, bei hoher Moral jedoch nur 14,1 Prozent.
Da diese Ergebnisse auch durch eine ungleiche Verteilung anderer Einflussfaktoren verursacht sein könnten, führten die Forscher auch multivariate Analysen durch, in der diese "Störfaktoren" ("Confounder"), wie Rauchen, Alkohol oder andere Erkrankungen mitberücksichtigt waren. Als Ergebnis zeigte sich dann, dass zumindest zwischen der Gruppe mit hoher und jener mit niedriger Lebensmoral ein signifikanter Unterschied hinsichtlich des Sterblichkeitsrisikos bestand, das bei niedriger Moral 1,35mal so hoch war.
Der im Titel der Studie verwendete Begriff der "Moral" ("Low morale is associated with increased risk of mortality in the elderly") ist zunächst ein wenig missverständlich, da im Deutschen hierunter eher das sittliche Empfinden, das auf ethischen Prinzipien gestützte Handeln von Personen gemeint ist - so wie sie der US-amerikanische Psychologe Lawrence Kohlberg mit den Stufen der Moralentwicklung beschrieben hat. Die in der spanische Studie erfasste "Lebensmoral" beschreibt jedoch eher so etwas wie Lebensmut und Optimismus. Die Studie bestätigt insofern Ergebnisse früherer Untersuchungen, über die hier im Forum Gesundheitspolitik auch schon berichtet wurde, vgl. etwa:
• Don't worry, be happy! Menschen mit starken positiven Emotionen sind seltener von Herz-Kreislauf-Erkrankungen betroffen
• Haben glückliche Menschen auch eine höhere Lebenserwartung? Ergebnisse einer Metaanalyse von 30 Längsschnittstudien
• Warum die Dänen im Glücksrausch sind und die Epidemiologen im Erklärungsnotstand.
Hier ist ein Abstract der neueren spanischen Studie zu Lebensmoral und Sterblichkeit: Julian Benito-Leon et al: Low morale is associated with increased risk of mortality in the elderly: a population-based prospective study (NEDICES) (Age and Ageing 2010 39(3):366-373; doi:10.1093/ageing/afq028)
Gerd Marstedt, 30.4.10
Leitlinien zur Händehygiene in Krankenhäusern nur wirksam bei aktiver Implementierung
 Als eine der unbestrittenen Ursachen zahlreicher schwerer bis tödlicher Infektionen bei KrankenhauspatientInnen gilt die fehlende oder mangelhafte Händehygiene von Ärzten, Pflegekräften und auch PatientInnen. Lange Zeit glaubte man, das Problem durch Appelle an ethische oder professionelle Grundsätze wie dem des "zuerst einmal nicht schaden (primum non nocere)" oder an den Reinlichkeitssinn bewältigen zu können. Studien im Ausland wie in Deutschland zeigten einerseits, dass Hygienemaßnahmen und darunter Händehygiene wirksame Maßnahmen zur Prävention zahlreicher Krankenhausinfektionen (darunter auch mit multiresistenten Erregern) sind. Andererseits weist aber der aktuellste HTA-Bericht (Korczak/Schöffmann 2010) auf die "irritierend … stark unterschiedlichen Complianceraten" (S. 1) bei der Händehygiene hin, die sich negativ auf die Gesamtwirkung auswirken dürfte. Frühere Studien zeigen, dass diese mangelnde Hygiene aus Sicht der Handelnden auf einer Reihe gewichtiger Faktoren beruht. Einer der genannten Gründe für die mangelnde Compliance war die mangelnde wissenschaftliche Gewissheit über den Nutzen von mehr Händehygiene im Verhältnis zu dem für sie notwendigen Aufwand.
Als eine der unbestrittenen Ursachen zahlreicher schwerer bis tödlicher Infektionen bei KrankenhauspatientInnen gilt die fehlende oder mangelhafte Händehygiene von Ärzten, Pflegekräften und auch PatientInnen. Lange Zeit glaubte man, das Problem durch Appelle an ethische oder professionelle Grundsätze wie dem des "zuerst einmal nicht schaden (primum non nocere)" oder an den Reinlichkeitssinn bewältigen zu können. Studien im Ausland wie in Deutschland zeigten einerseits, dass Hygienemaßnahmen und darunter Händehygiene wirksame Maßnahmen zur Prävention zahlreicher Krankenhausinfektionen (darunter auch mit multiresistenten Erregern) sind. Andererseits weist aber der aktuellste HTA-Bericht (Korczak/Schöffmann 2010) auf die "irritierend … stark unterschiedlichen Complianceraten" (S. 1) bei der Händehygiene hin, die sich negativ auf die Gesamtwirkung auswirken dürfte. Frühere Studien zeigen, dass diese mangelnde Hygiene aus Sicht der Handelnden auf einer Reihe gewichtiger Faktoren beruht. Einer der genannten Gründe für die mangelnde Compliance war die mangelnde wissenschaftliche Gewissheit über den Nutzen von mehr Händehygiene im Verhältnis zu dem für sie notwendigen Aufwand.
Diese Gewissheit vermitteln nun bereits seit Jahren evidenzbasierte Leitlinien zur Händehygiene, die es in den USA nicht nur seit 2002 gibt, sondern die dort auch bereits flächendeckend eingesetzt wurden. Die von den US-"Centers for Disease Control and Prevention (CDC)" entwickelte Guideline for Hand Hygiene in Healthcare Settings gilt als eine der ersten umfassenden (56 Seiten) und wissenschaftlich gründlichen Leitlinien. Darin wird auch bereits auf die Notwendigkeit hingewiesen, ihre Umsetzung am besten im größeren Rahmen einer Sicherheitskultur zu organisieren. Von internationaler Bedeutung sind die 2009 veröffentlichten WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care First Global Patient Safety Challenge. Clean Care is Safer Care. Auf einem Teil der 270 Seiten dieser Leitlinie beschäftigen sich auch deren Verfasser damit, wie man die Implementierung und die Wirkung solcher wissenschaftlich eindeutig nützlicher und machbarer Handlungsempfehlungen gewährleistet. Danach soll die Händehygiene in die allgemeine Debatte über Indikatoren für Leistung, Ergebnisqualität oder soziales Marketing von Gesundheitseinrichtungen eingebettet werden.
Wie zutreffend und praktisch notwendig solche Hinweise sind, zeigt das Kernergebnis der ersten Studie über die Implementierung der CDC-Leitlinie in US-amerikanischen Krankenhäusern: Von einer schlichten Implementierung als zusätzlichem Informations- oder Wissensangebot darf nicht allzu viel erwartet werden. Die in 40 Krankenhäusern durchgeführte Studie verglich die Raten der versorgungsbedingten Infektionsraten ein Jahr vor und nach der Publikation der Leitlinienempfehlungen. Hierbei war hilfreich, dass die 40 Krankenhäuser Mitglieder des "National Nosocomial Infections Surveillance System" in den USA waren, also sogar deutlich mehr für das Problem der Prävention von Krankenhausinfektionen sensibilisiert waren als der Großteil der Krankenhäuser. Zusätzlich untersuchten die ForscherInnen u.a. durch Befragungen auch sonstige Veränderungen in den Kliniken, die sowohl Folgen als auch Bedingungen für den Erfolg der Leitlinienimplementation sein können. Ergänzt wurde das Bild durch die direkte Beobachtung der Leitlinientreue.
Die wichtigsten Ergebnisse waren:
• Alle Krankenhäuser hatten ihre ausformulierten Hygienegrundsätze der Leitlinie angepasst und auch eine Reihe leitliniengerechter Instrumente und Produkte entwickelt und bereit gestellt.
• Fast 90% der dazu anonym befragten MitarbeiterInnen sagten, sie seien mit den Leitlinien vertraut.
• Auf einer Bewertungsskala für Implementationen erreichte die Händehygiene-Leitlinie 10,5 von 12 maximal möglichen Punkten. Für die Bewertung spielten allerdings Struktur- und Prozessindikatoren wie z.B. die Erhältlichkeit von alkoholischen Mitteln zur Händeinfektion oder die Existenz von Schulungsprogrammen die vorrangige Rolle und lediglich nachrangig Indikatoren für die Ergebnisqualität.
• In 44,2% (19 von 40) der Krankenhäuser existierte aber dennoch kein nachweisbares Programm, das unter Einbeziehung aller Akteure oder Disziplinen die Leitlinientreue verbessern helfen sollte.
• Die Handhygieneraten verharrten bei durchschnittlich 56,6%.
Bei den erhobenen Wirkungen der Handhygiene gab es uneinheitliche Ergebnisse: Die Infektionen durch Arterienkatheter waren in Krankenhäusern mit hohen Handhygieneraten hochsignifikant besser als in Häusern mit niedrigen Raten. Auf alle anderen Möglichkeiten von Behandlungsinfektionen wirkte sich die Implementation der Leitlinie oder der Stand der Händehygiene nicht aus.
Weder die aufwändige und praktikerfreundliche (z.B. Kurzversionen oder so genannte "Kitteltaschen-Versionen") Verbreitung der Leitlinie in den untersuchten Krankenhäusern noch relativ umfangreiche Schulungsmaßnahmen haben allein weder zu multidisziplinären Verbesserungsbemühungen noch zum erhofften Erfolg bei der Senkung von Infektionsraten geführt. Die ForscherInnen sind der Meinung, dass derartige Hygieneleitlinien nur dann ihre unbestrittene Wirksamkeit erreichen können, wenn es multidisziplinär abgestimmte Bemühungen gibt, die Umsetzung so aktiv und vielfältig wie möglich erfolgt und die Umsetzung administrativ und von den leitenden Akteuren aktiv unterstützt wird.
Jüngste Erfahrungen (Schnoor, Maike; Schäfer, Tobias; Welte, Tobias: Leitlinien: Aktive Implementierung zeigt Wirkung (Deutsches Ärzteblatt 2010; 107(12): A-541 / B-472 / C-646;) mit der Implementierung der S3-Leitlinie "Infektionen der unteren Atemwege" innerhalb einer randomisierten kontrollierten Studie an deutschen Krankenhäusern, verweisen für ihr Sachgebiet ebenfalls auf geringere Wirkungen als erwartet wurden. Auch hier werden aber eine bessere Implementierung und höhere Wirkungen erst von einer besonderen, aktiven Form und intensiveren Maßnahmen wie Audits und Qualitätszirkeln erwartet.
Der HTA-Bericht von Korczak und Schöffmann unterstreicht dies für die Prävention der MRSA-Infektionen und schlägt z.B. eine multimodale Kombination von individualisierten Screenings, Schulungen und eines Antibiotika-Managements vor. Ob damit aber die gewünschten und notwendigen Ergebnisse erreicht werden können, kann wegen der bisher fehlenden Evaluation kombinierter Präventions- und Kontrollmaßnahmen nicht verlässlich gesagt werden.
Hier ist ein Abstract: Elaine L. Larson, Dave Quiros und Susan X. Lin (2007): Dissemination of the CDC's Hand Hygiene Guideline and impact on infection rates (American Journal of Infection Control Volume 35, Issue 10: 666-675)
Hier ist die Studie von Korczak/Schöffmann als Volltext: Dieter Korczak, Christine Schöffmann (2010): Medizinische Wirksamkeit und Kosten-Effektivität von Präventions- und Kontrollmaßnahmen gegen Methicillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA)-Infektionen im Krankenhaus (HTA-Schriftenreihe Bd. 100. Köln)
Bernard Braun, 30.4.10
Handwörterbuch und Lehrbuch "Sozialmedizin - Public Health"
 Trotz des im internationalen Vergleich beträchtlichen "Spätstarts" in den 1990er Jahren gibt es mittlerweile an deutschen Hochschulen eine Fülle von Bachelor- und Masterstudiengängen für Public Health, Öffentliche Gesundheitswissenschaften und verwandte Fachgebiete (z. B. Gerontologie). Die nachholende Entwicklung und die tatsächliche oder auch nur vermutete Nachfragesituation für AbsolventInnen dieser Studiengänge tragen dazu bei, dass die Bemühungen um ein eigenständiges Profil dieser wissenschaftlichen Disziplin gegenüber so hegemonialen und wirkmächtigen Disziplinen wie der Medizin oder der Ökonomie zugunsten einer Ausdifferenzierung in erfolgreicher erscheinenden Sub- oder Teildisziplinen vernachlässigt werden. Die Frage, "was alles zu Public Health gehört" und wie man verhindert, dass rein additive Konzepte lediglich zu einer untauglichen Ansammlung von Halb- oder Drittelwissen in drei bis sieben akademischen Fachgebieten führen, wird entweder nicht, nicht mehr oder nicht gründlich genug gestellt.
Trotz des im internationalen Vergleich beträchtlichen "Spätstarts" in den 1990er Jahren gibt es mittlerweile an deutschen Hochschulen eine Fülle von Bachelor- und Masterstudiengängen für Public Health, Öffentliche Gesundheitswissenschaften und verwandte Fachgebiete (z. B. Gerontologie). Die nachholende Entwicklung und die tatsächliche oder auch nur vermutete Nachfragesituation für AbsolventInnen dieser Studiengänge tragen dazu bei, dass die Bemühungen um ein eigenständiges Profil dieser wissenschaftlichen Disziplin gegenüber so hegemonialen und wirkmächtigen Disziplinen wie der Medizin oder der Ökonomie zugunsten einer Ausdifferenzierung in erfolgreicher erscheinenden Sub- oder Teildisziplinen vernachlässigt werden. Die Frage, "was alles zu Public Health gehört" und wie man verhindert, dass rein additive Konzepte lediglich zu einer untauglichen Ansammlung von Halb- oder Drittelwissen in drei bis sieben akademischen Fachgebieten führen, wird entweder nicht, nicht mehr oder nicht gründlich genug gestellt.
Ein Ausdruck dieser Situation sind die geringe Anzahl und die relativ geringe inhaltliche Variation der Überblicks- und Einführungswerke zu Public Health. Für ein Verständnis von Public Health, das sozialmedizinische, epidemiologische, sozialökonomische, sozialrechtliche und medizin- wie organisationssoziologische Sicht- und Handlungsweisen integriert, liegen fast gleichzeitig ein erstmals veröffentlichtes Lehr- und Lernbuch sowie ein im Mai 2010 bereits in zweiter Auflage erscheinendes Handwörterbuch vor, die diesen Anspruch jeweils unter dem Titel "Sozialmedizin und Public Health" erheben.
Das hauptsächlich von dem Sozialmediziner Jens Uwe Niehoff (Berlin), dem Sozialrechtler Felix Welti (Neubrandenburg) und dem Sozial- und Gesundheitswissenschaftler Bernard Braun (Bremen) verfasste "Handwörterbuch Sozialmedizin und Public Health" beschäftigt sich aus nationaler wie zum Teil internationaler Sicht mit den "Grundlagen der Gesundheitssicherung, der Gesundheitsversorgung, des Gesundheitsmanagements, der Steuerung und der Regulation im Gesundheitswesen". In über 500 mehr oder weniger ausführlichen, theoretisch wie empirisch argumentierenden Stichwörtern wollen die Autoren ein "möglichst gutes Instrument für den Gebrauch des eigenen Verstandes" liefern und wollen dazu u.a. durch explizite Kommentierungen zentraler Sachverhalte beitragen. Dem Verständnis von Wissenschaft als Kritik entspricht auch das Selbstverständnis, dass "Übereinstimmung oder die Vermeidung konfligierender Auffassungen … ausdrücklich kein gewählter Maßstab" ist.
Wer sich einen Überblick zu den bearbeiteten Stichwörtern verschaffen will, findet hier das Stichwortregister des Handwörterbuches.
Das samt Stichwortregister 325 Seiten umfassende "Handwörterbuch Sozialmedizin und Public Health" erscheint zu einem Ladenpreis von 29 Euro im Mai 2010 im Nomos-Verlag Baden-Baden.
Obwohl es sich bei dem von dem Sozialmediziner David Klemperer (Regensburg) unter Mitarbeit des Sozial- und Gesundheitswissenschaftlers Bernard Braun (Bremen) verfassten "Lehrbuch für Gesundheits- und Sozialberufe - Sozialmedizin - Public Health" um ein aus sieben großen Kapiteln bestehendes Werk handelt, geht es auch ihm darum "Lust auf mehr zu machen und zu Vertiefung und Eigenstudium anzuregen". Dies ist verbunden mit einem bewussten Verzicht auf Vollständigkeit und einem kritischen verstehenstheoretischen Votum gegen das so genannte "Bulimie-Lernen" in verschulten Massenstudiengängen. Dort erfolgt die Aneignung von Wissen fast ausschließlich mit dem Ziel, "Stoff in großen Mengen ins Kurzzeitgedächtnis zu pressen, ihn in der Prüfung (meist Klausuren mit Multiple Choice-Charakter) von sich zu geben und danach schnell wieder zu vergessen". Dies sei "ineffektiv", einer wissenschaftlichen Hochschule "unwürdig" und eine "Verschwendung von Lebenszeit".
Was stattdessen "Wissenschaftlichkeit" im Bereich von Gesundheit und Krankheit meint und welche Bedeutung dabei Alltagserfahrungen, Zweifel und Skepsis, Fehlschlüsse und unsystematische Beobachtung und nicht zuletzt Interessenkonflikte oder die Kluft von Wissen und Handeln haben, wird bereits im ersten Kapitel dargestellt. Dem schließen sich Kapitel über die Epidemiologie, evidenzbasierte Medizin und Praxis, das Gesundheits- und Krankheitsverständnis, Prävention, soziale Ungleichheit und das Gesundheitssystem wie die Gesundheitspolitik an.
Durch die, wenn möglich durchgängige Verlinkung von Thesen und Argumenten mit Originalquellen, versucht das Buch bequeme Zugänge für ungezügelte Neugier zu schaffen. Daran Interessierte können sich in einer Art Schneeballmethode tiefer in Themen einarbeiten.
Wer sich anschauen will, mit welcher Methodik diese Prinzipien umgesetzt werden, kann sich unter anderem das mit zahlreichen aktiven Links versehene Literaturverzeichnis des Buches und das komplette Kapitel "Soziale Ungleichheit der Gesundheit" auf der Website www.sozmad.de anschauen.
Das 335 Seiten umfassende Buch "Sozialmedizin - Public Health. Lehrbuch für Gesundheits- und Sozialberufe" ist im Februar 2010 mit Unterstützung der Deutschen Gesellschaft für Sozialmedizin und Prävention zum Ladenpreis von 24,95 Euro im Hans Huber Verlag Bern erschienen und wird vom Deutschen Netzwerk Evidenzbasierte Medizin empfohlen.
Gerd Marstedt, 27.4.10
Schweinegrippe im (Rück-)Spiegel einer EU-weiten Bevölkerungsumfrage.
 Der Winter auf der Nordhalbkugel ist vorbei und die hartnäckig von manchen bis heute aufrecht erhaltene Bedrohungskulisse (so scheint es, dass die WHO nie offiziell die höchste Pandemiestufe 6 zurückgenommen hat) erwies sich als modernes Potemkinsches Dorf.
Der Winter auf der Nordhalbkugel ist vorbei und die hartnäckig von manchen bis heute aufrecht erhaltene Bedrohungskulisse (so scheint es, dass die WHO nie offiziell die höchste Pandemiestufe 6 zurückgenommen hat) erwies sich als modernes Potemkinsches Dorf.
Bis zum 23.03. 2010 wurden dem Robert-Koch-Institut für Deutschland maximal 226.018 Erkrankungsfälle von Schweine- oder Neuer Grippe gemeldet und bis 15.00 Uhr an diesem Tag waren es 250 Todesfälle.
Im "Influenza Wochenbericht" des RKI für die 11. Kalenderwooche 2010 wird das Bild durch einige Strukturdaten und eine Prognose abgerundet:
• 80 % der Todesfälle (199) von 250) waren jünger als 60 Jahre. Von den 230 Todesfällen, bei denen Angaben zum Vorliegen von Risikofaktoren ausgewertet werden können, hatten 196 (85 %) einen Risikofaktor und damit eine höhere Wahrscheinlichkeit für einen schweren Krankheitsverlauf.
• "Es wird als wahrscheinlich angenommen, dass das Neue Influenzavirus A/H1N1 weiter zirkulieren wird und auch kleinere Ausbrüche können nicht ausgeschlossen werden, jedoch wird eine weitere Frühjahr-Sommer-Welle als unwahrscheinlich angesehen. Für die kommende Saison wird erwartet, dass das Neue Virus A/H1N1 dominant sein wird."
Nicht nur als Nachklapp, sondern als Beispiel für eine Reihe von Wirkungen dieses bisher einmaligen und zumindest finanziell folgenreichen Pandemie-Bedrohungs-Hypes in Europa und Nordamerika, liegen nun die Ergebnisse einer im Rahmen des EU-"Eurobarometer" im November 2009 zum Thema Schweinegrippe durchgeführten Befragung von 28.00 zufällig ausgewählten BürgerInnen im Alter ab 15 Jahren aus den 27 EU-Mitgliedsstaaten plus Norwegen, die Schweiz und Island vor.
Einblicke gewinnt man dort u.a. in folgende Einstellungen und Verhaltensweisen, die auch dort, wo dies nicht ausdrücklich erwähnt wird, sich zwischen den Ländern deutlich unterscheiden:
• 17% der befragten EuropäerInnen hatten sich zu dem Befragungszeitpunkt bereits gegen die siaisonale Grippe impfen lassen und 14% beabsichtigten sich impfen zu lassen. 65% verneinten eine derartige Absicht.
• 57% der Befragten glaubten nicht (mehr), dass es sich bei Schweinegrippe um eine ernstzunehmende Infektion handele.
• Ebenfalls 57% der Befragten waren der festen Meinung, es sei völlig unwahrscheinlich, dass sie an der Neuen Grippe erkrankten. Dieser Anteil schwankte aber z.B. zwischen 82% in Österreich und 69% in Deutschland.
• 19% der Befragten fühlten sich sehr gut über die Schweinegrippe informiert, 56% charakterisierten ihren Informationsstand als gut.
• Interessant sind die gravierenden Unterschiede des Vertrauens in verschiedene Informationsquellen: Während immerhin 81% den Gesundheitsprofis wie Ärzten und Apothekern als Informationsquelle komplett oder meistens trauten, waren dies gegenüber den nationalen Gesundheitsautoritäten wie Ministerien etc. nur noch 61%, gegenüber den Europaautoritäten 52%, gegenüber den traditionellen Medien vom Fernsehen bis zu den Tageszeitungen noch 35% und gegenüber dem Internet nur noch 29%.
• 50% der EU-BürgerInnen meinten, die Medien hätte der Schweinegrippe zu viel Aufmerksamkeit gespendet. Zu wenig Aufmerksamkeit sahen lediglich noch 9%.
• Auf die Bitte, spontan ihr Wissen zu offenbaren was man als einzelner Bürger präventiv gegen die Schweinegrippenerkrankung tun kann, gaben 33% regelmäßiges Händewaschen an, 11% hoben die Bedeutung der Nasenputzhygiene hervor, ebenfalls 11% empfehlen öffentliche Plätze und Räume zu meiden, 8% wollten Kontakt mit bereits Infizierten vermeiden, 13% hielten eine spezifische Impfung für einen Schutzfaktor und 2% hielten die Impfung gegen die saisonale Grippe für ein gutes Mittel. Nur 1% sahen in der Einnahme von antiviralen Medikamenten wie Tamiflu oder Relenza ein geeignetes Mittel.
• Ebenfalls interessant ist das enorme Gefälle, das zwischen den EU-Staaten besteht, wenn man beispielsweise nach der spontanen Relevanz von regelmäßigem Händewaschen fragt. Während 52% der Finnen sofort und vorrangig das Händewaschen einfiel, passierte dies in Deutschland bei 37%, in Polen bei 15% und beim Schlusslicht Litauen nur noch bei 7% der Befragten.
• 24% der Befragten erklärten, sie hätten ihr Verhalten umgestellt, um eine Erkrankung zu vermeiden.
• Relativ hoch ist der Anteil von 10% und 55% der Befragten, die mit den jeweiligen nationalen Präventionsmaßnahmen sehr zufrieden oder zufrieden waren.
• Für 65% der Befragten stellten TV-Programme, für 36% Artikel in Illustrierten oder Tageszeitungen, für 29% der Arzt, für 25% die Familie, Freunde und Bekannte und für nur 9% die nationale Influenza-Website die hauptsächliche Informationsquelle dar.
• Die Impfung wird von 45% als wirksam und sicher bewertet, 30% bewerteten sie aber genau gegenteilig.
Wer an noch mehr Details interessiert ist, kann sich den 142-Seitenbericht zum Thema "Eurobarometer
on Influenza H1N1" als Ausgabe 287 der Flash EB Series komplett und kostenlos herunterladen. Ein 16-seitiges Summary gibt es ebenfalls kostenlos.
Bernard Braun, 26.3.10
Don't worry, be happy! Menschen mit starken positiven Emotionen sind seltener von Herz-Kreislauf-Erkrankungen betroffen
 Menschen, die häufiger positive Emotionen erleben, sich glücklich, zufrieden oder von etwas begeistert fühlen, sind seltener von koronaren Herzerkrankungen wie zum Beispiel Herzinfarkt oder Angina pectoris betroffen. Dies ist das Ergebnis einer rund zehnjährigen Beobachtungsstudie, der "Nova Scotia Health Survey", bei der Daten von 1.739 gesunden Erwachsenen (etwa gleich viele Männer wie Frauen) ausgewertet wurden.
Menschen, die häufiger positive Emotionen erleben, sich glücklich, zufrieden oder von etwas begeistert fühlen, sind seltener von koronaren Herzerkrankungen wie zum Beispiel Herzinfarkt oder Angina pectoris betroffen. Dies ist das Ergebnis einer rund zehnjährigen Beobachtungsstudie, der "Nova Scotia Health Survey", bei der Daten von 1.739 gesunden Erwachsenen (etwa gleich viele Männer wie Frauen) ausgewertet wurden.
Zu Beginn der Studie im Jahre 1995 wurde bei allen Teilnehmern zunächst der Gesundheitszustand überprüft und es wurden alle Personen ausgeschlossen, bei denen bereits eine Vorerkrankung oder Schädigung (in Bezug auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen) festgestellt wurde. Speziell ausgebildete Krankenpfleger/innen führten dann mit allen Teilnehmern ein etwa 12minütiges Interview durch, das für die Teilnehmer gewisse Stressbelastungen provoziert und ursprünglich dazu konzipiert war, um das Ausmaß negativer Emotionen wie Wut, Ärger oder Stressreaktionen zu messen. In der hier vorliegenden Studie wurde jedoch durch die Krankenpfleger nach dem Interview statt dessen bewertet, in welchem Ausmaß die Teilnehmer positive Reaktionen - wie Freude, Glücklichsein, Begeisterung oder Zufriedenheit - artikuliert hatten. Dies wurde auf einer 5stufigen Skala festgehalten. Die Zuverlässigkeit der Bewertung war zuvor durch Gegenkontrollen überprüft worden.
Zur Analyse des Zusammenhangs von positiven Emotionen und Herzerkrankungen wurden dann verschiedene Kranken- und Sterberegister von Nova Scotia (eine an der Atlantikküste gelegene Provinz von Kanada) überprüft und solche Erkrankungen (mit und ohne tödlichen Verlauf) festgehalten. Überdies wurde in den statistischen Analysen dann auch berücksichtigt, ob die Betroffenen Raucher waren, an Diabetes erkrankt waren, wie hoch ihr Body Mass Index war, ihr Cholesterinspiegel und ihr Blutdruck.
In dem etwa zehnjährigen Beobachtungsfenster seit 1995 wurden dann insgesamt 145 ischämische Herzerkrankungen beobachtet, betroffen waren also etwa 8% der Teilnehmer. In multivariaten Analysen, in denen einerseits das Ausmaß positiver Emotionen berücksichtigt wurde, darüber hinaus aber auch verschiedene andere Risikofaktoren (Rauchen, BMI usw.), zeigte sich dann: Auf der 5stufigen Skala, die von 1 bis 5 das Ausmaß positiver Emotionen beschreibt, war jeder Schritt nach oben (hin zu mehr Glücks- und Zufriedenheitsgefühlen) mit einer etwa 22prozentigen Senkung des Erkrankungsrisikos verbunden. Zwar geben die Autoren keine exakten Zahlen an, ganz grob lässt sich jedoch aus den mitgeteilten unterschiedlichen Erkrankungsrisiken und der absoluten Zahl der Herz-Erkrankungen ableiten: Wenn alle 5 Gruppen gleich stark besetzt wären, würden in der Gruppe mit extrem geringen Positiv-Emotionen 45 Personen sterben, in der Gruppe mit dem höchsten Ausmaß nur 18 Personen.
Die Wissenschaftler weisen darauf hin, dass ihre Beobachtungs- und Verlaufsstudie keine Schlüsse über Kausalzusammenhänge zulässt. In einer Pressemitteilung der European Society of Cardiology und auch in der Bilanz ihrer Befunde erklären sie, dass randomisierte Kontrollstudien bereits in Planung sind, in denen Herz-Kreislauf-Patienten einen positiveren Umgang mit ihren Gefühlen erlernen sollen.
Die Studie ist hier im Volltext kostenlos verfügbar:
Karina W. Davidson, Elizabeth Mostofsky and William Whang: Don't worry, be happy: positive affect and reduced 10-year incident coronary heart disease: The Canadian Nova Scotia Health Survey (European Heart Journal Advance Access published online on February 17, 2010; doi:10.1093/eurheartj/ehp603)
Einige Techniken, um den Menschen mehr Glücksgefühle zu vermitteln (ohne auch nur ein Deut an ihren Arbeits- und Lebensbedingungen zu ändern) hatte im Jahr 2009 schon der englische Psychologe Prof. Richard Wiseman (University of Hertfordshire) in einem großen Internet-Experiment erprobt. An dem Experiment beteiligt haben sich 26.000 Personen, über Ergebnisse hat der Wissenschaftler bis jetzt (Februar 2010) leider noch nicht berichtet. (vgl. Don't worry, be happy! Wissenschaftler will die englische Bevölkerung glücklicher machen)
Dass positive Emotionen und Gesundheit sehr eng miteinander zusammen hängen, hat schon eine bilanzierende Zusammenfassung verschiedener Forschungsstudien unlängst gezeigt. Deutlich wurde in dieser Meta-Analyse aber auch, dass man den Zusammenhang sehr differenziert betrachten muss. Es zeigt sich nämlich: In weniger gesunden Gruppen, also bei chronisch Erkrankten, Behinderten, bei Bewohnern von Alten- und Pflegeheimen usw. gibt es nur einen sehr schwachen Zusammenhang von Glücklichsein und Lebenserwartung. Glücklichsein oder andere positive Emotionen haben bei Kranken keine oder nur eine überaus schwache lebensverlängernde Wirkung. Anders sieht es jedoch aus bei gesunden Untersuchungsgruppen. Hier zeigt sich ganz überwiegend (in 16 von 24 Studien), dass glückliche Personen auch eine höhere Lebenserwartung haben: Im Durchschnitt beträgt dieser Gewinn in den analysierten Studien etwa 7,5 bis 10 Lebensjahre. (vgl. Haben glückliche Menschen auch eine höhere Lebenserwartung? Ergebnisse einer Metaanalyse von 30 Längsschnittstudien)
Gerd Marstedt, 21.2.10
Das Bevölkerungswissen über Risikofaktoren und Warnhinweise für einen Schlaganfall ist erschreckend gering
 Eine irische Studie, in der Interviews mit etwa 2000 älteren Befragungsteilnehmern (Alter über 65 Jahre) durchgeführt wurden, hat erhebliche Wissensdefizite zutage gefördert, was Warnhinweise und Risikofaktoren für einen Schlaganfall anbetrifft. Weniger als die Hälfte der Befragten konnte Symptome benennen, deren Kenntnis wichtig wäre, um unverzüglich medizinische Hilfe zu rufen. Ähnlich ungenügend fiel in der Befragung auch das Wissen über Risikofaktoren für einen Schlaganfall aus.
Eine irische Studie, in der Interviews mit etwa 2000 älteren Befragungsteilnehmern (Alter über 65 Jahre) durchgeführt wurden, hat erhebliche Wissensdefizite zutage gefördert, was Warnhinweise und Risikofaktoren für einen Schlaganfall anbetrifft. Weniger als die Hälfte der Befragten konnte Symptome benennen, deren Kenntnis wichtig wäre, um unverzüglich medizinische Hilfe zu rufen. Ähnlich ungenügend fiel in der Befragung auch das Wissen über Risikofaktoren für einen Schlaganfall aus.
Bereits frühere Studien (vgl. die Forums-Artikel Schweizer Studie über das medizinische Grundwissen der Bevölkerung zeigt erschreckende Unkenntnis, PISA-Test für Erwachsene zeigt: Die Bevölkerungs-Kenntnisse zu Gesundheitsfragen weisen erschreckende Defizite auf) hatten deutlich gemacht: Die allenthalben verkündeten Schlagzeilen vom heutzutage mündigen und informierten Patienten sind höchstwahrscheinlich eine nur für kleinere Bevölkerungsgruppen zutreffende Feststellung, die aber keineswegs einen generellen Trend aufzeigt. Studien, in denen laienmedizinische Kenntnisse der Bevölkerung abgefragt werden, zeigen teilweise erschreckende Irrtümer und Wissenslücken auf.
Eine irische Studie hat diese Erkenntnis jetzt erneut bestätigt. Der Untersuchung zu Grunde liegen 2.033 Interviews mit älteren Iren und Nordiren, die in der Wohnung der Teilnehmer durchgeführt wurden. Die Teilnahmequote war mit 68% außergewöhnlich hoch. Neben vielen gesundheitlichen und sozialstatistischen Informationen (wie unter anderem Alter, Geschlecht, Bildungsniveau, Rauchen etc.) wurden auch Fragen zum Schlaganfall gestellt. Zunächst zeigte sich, dass etwa 6% schon selbst einen Schlaganfall erlitten hatte.
• Bei der Frage nach den Risikofaktoren für einen Schlaganfall war nur Bluthochdruck bei der Mehrheit der Befragten bekannt (75%). Andere Risikofaktoren wurden von weniger als der Hälfte benannt, so zum Beispiel ein hoher Cholesterinspiegel (genannt von 40%), Rauchen (30%), Diabetes (11%), Alkoholmissbrauch (10%).
• Fälschlich als Risikofaktoren benannt, da keine Evidenz hierfür vorliegt, wurden Übergewicht (30%), Bewegungsmangel (18%), Schlaganfall-Vorkommnisse bei Elternteilen (16%).
• Die Frage nach Symptomen und Warnhinweisen ergab folgende Antworten: Sprachstörungen (von 54% genannt), Schwindelgefühle (44%), Taubheitsgefühle (41%), Schwächegefühle (38%), Kopfschmerzen (29%), Sehstörungen (20%).
• Dass Raucher und Befragte mit einer besonders geringen körperlichen Aktivität noch einmal besonders wenig Kenntnisse aufweisen, bewerteten die Wissenschaftler als überaus problematisch.
Hingewiesen wird in der Diskussion der Befunde aber auch noch einmal explizit darauf, dass hier (lebens)wichtige Kenntnisse nur in sehr geringem Ausmaß bei einer Gruppe vorhanden sind, die aufgrund ihres hohen Lebensalters dem Risiko Schlaganfall besonders stark ausgesetzt sind.
Der Aufsatz ist im Volltext von dieser Seite aus verfügbar: Anne Hickey et al: Stroke awareness in the general population: knowledge of stroke risk factors and warning signs in older adults (BMC Geriatrics 2009, 9:35doi:10.1186/1471-2318-9-35)
Gerd Marstedt, 25.1.10
Gesundheitsexperten artikulieren massive Kritik am Weihnachtsmann: Ein überaus negatives Vorbild
 Ronald McDonald, eine 1966 ins Leben gerufene Werbefigur von McDonald's, genießt bei amerikanischen Kindern eine noch höhere Wertschätzung als der Präsident oder der Papst. Als Werbefigur also ein Riesenerfolg! In dieser Hinsicht übertroffen wird er nur noch vom Weihnachtsmann, in englischsprachigen Ländern Santa Claus genannt. Und dieser wurde in einer Vielzahl von TV-Spots und Inseraten von unterschiedlichsten Unternehmen, von Coca-Cola über Camel-Zigaretten bis hin zu Keksen und Tageszeitungen, für Werbezwecke funktionalisiert. Das ginge ja noch in Ordnung, erklären Nathan J. Grills und Brendan Halyday in einem Aufsatz, der jetzt im British Medical Journal (BMJ) veröffentlicht wurde. Nicht mehr in Ordnung sei es jedoch, dass der Weihnachtsmann in der Werbung ebenso wie im Volksmund und in Illustrationen nachhaltig gegen eine Vielzahl von Public-Health-Zielen zum Gesundheitsverhalten verstoße.
Ronald McDonald, eine 1966 ins Leben gerufene Werbefigur von McDonald's, genießt bei amerikanischen Kindern eine noch höhere Wertschätzung als der Präsident oder der Papst. Als Werbefigur also ein Riesenerfolg! In dieser Hinsicht übertroffen wird er nur noch vom Weihnachtsmann, in englischsprachigen Ländern Santa Claus genannt. Und dieser wurde in einer Vielzahl von TV-Spots und Inseraten von unterschiedlichsten Unternehmen, von Coca-Cola über Camel-Zigaretten bis hin zu Keksen und Tageszeitungen, für Werbezwecke funktionalisiert. Das ginge ja noch in Ordnung, erklären Nathan J. Grills und Brendan Halyday in einem Aufsatz, der jetzt im British Medical Journal (BMJ) veröffentlicht wurde. Nicht mehr in Ordnung sei es jedoch, dass der Weihnachtsmann in der Werbung ebenso wie im Volksmund und in Illustrationen nachhaltig gegen eine Vielzahl von Public-Health-Zielen zum Gesundheitsverhalten verstoße.
Deutlich machen ließe sich dies in mehrfacher Hinsicht:
• Übergewicht: Epidemiologisch nachweisbar ist zunächst, dass Länder, in denen der Weihnachtsmann verehrt wird, auch höhere Quoten aufweisen, was übergewichtige und adipöse Kinder anbetrifft. Damit sei zwar kein Kausalzusammenhang bewiesen, aber viele Indizien deuten in diese Richtung: Der Weihnachtsmann (selbst schon meist von recht üppiger Leibesfülle) bringt Kindern Kekse und Schokolade, Erwachsenen Schnaps und dick machende Speisen. Mit dieser Tradition, so die Autoren, solle man schleunigst Schluss machen und ebenso sollte die träge Fortbewegungsart des Weihnachtsmanns (von Rentieren auf einem Schlitten gezogen) baldigst geändert werden, indem er beispielsweise auf einem Fahrrad oder joggend seine Geschenke verteilt.
• Rauchen: Zwar ist in vielen Ländern inzwischen die Werbung für Tabakwaren generell verboten, so dass auch der Weihnachtsmann hier nicht mehr für dieses Gesundheitsrisiko werben kann. Auf vielen alten Postkarten und in Büchern sieht man ihn jedoch immer noch vergnügt eine Pfeife oder dicke Zigarre rauchen. Man stelle sich den Kommentar eines 12jähriges Kindes vor, mahnen Grills und Hallyday, das solche Bilder sieht: "Schau mal, Mutti, ist rauchen wirklich so schlimm? Hier der Weihnachtsmann raucht doch auch, und er ist bestimmt 99 Jahre alt und hat keinen Lungenkrebs!"
• Ein schlechtes Vorbild für mancherlei riskante Verhaltensgewohnheiten: In vielerlei Hinsicht, so die Autoren, steht der Weihnachtsmann immer noch für riskante Verhaltensweisen und fungiert damit als sehr schlechtes Vorbild: Er betreibt Extremsportarten wie das Herumrutschen auf Dächern oder das Hineingleiten in Kaminen. Und trotz der horrenden Geschwindigkeit, mit der er sich im Rentierschlitten fortbewegt, hat man ihn noch niemals einen Schutzhelm oder Sicherheitsgurt tragen sehen.
Und nicht zuletzt geht von der Gewohnheit, dem Weihnachtsmann zur Begrüßung einen Kuss zu geben, auch ein gewaltiges Ansteckungsrisiko für unterschiedlichste Infektionskrankheiten aus, wenn man bedenkt, dass er an Weihnachten wohl von einigen Millionen Männern und Frauen bakterielle verunreinigte Küsse bekommt. In Zeiten von Pandemien wie Hühner- und Schweinegrippe sei diese Tradition daher von besonderem Übel und müsse auf der Stelle gestoppt werden. Allerdings, so das Schlusswort der australischen Autoren, sei die Evidenz zu dieser Thematik eher unbefriedigend und weitere Forschungsarbeit unbedingt nötig.
Leider ist nur ein Auszug des Essay kostenlos verfügbar: Nathan J Grills, Brendan Halyday: Christmas 2009: Christmas Fayre. Santa Claus: a public health pariah? (BMJ 2009;339:b5261; Published 16 December 2009, doi:10.1136/bmj.b5261)
Gerd Marstedt, 21.12.09
Händewaschen: Mit flotten Leuchtschriften in Toiletten von Autobahn-Raststätten lässt sich Hygiene (ein wenig) verbessern
 Händewaschen gilt als eines der effektivsten und zugleich am billigsten und schnellsten durchführbaren Mittel, um sich und andere vor Infektionskrankheiten zu schützen. Gleichwohl fällt es sogar Ärzten und anderen in der medizinischen Versorgung tätigen Berufen schwer, diese Einsicht auch in die Tat umzusetzen (vgl. etwa: Händewaschen gegen Krankenhausinfektionen). Wie man die auch bei Normalbürgern beobachtete Abneigung gegen das Händewaschen auf öffentlichen Toiletten verbessern kann, hat nun eine US-amerikanische Studie untersucht, deren Ergebnisse jetzt in der Zeitschrift "American Journal of Public Health" veröffentlicht wurden. Es zeigte sich, dass der Textinhalt bestimmter kurzer Leuchtschriften, die den Toilettenbesuchern gezeigt wurden, in begrenztem Umfang durchaus effektiv ist.
Händewaschen gilt als eines der effektivsten und zugleich am billigsten und schnellsten durchführbaren Mittel, um sich und andere vor Infektionskrankheiten zu schützen. Gleichwohl fällt es sogar Ärzten und anderen in der medizinischen Versorgung tätigen Berufen schwer, diese Einsicht auch in die Tat umzusetzen (vgl. etwa: Händewaschen gegen Krankenhausinfektionen). Wie man die auch bei Normalbürgern beobachtete Abneigung gegen das Händewaschen auf öffentlichen Toiletten verbessern kann, hat nun eine US-amerikanische Studie untersucht, deren Ergebnisse jetzt in der Zeitschrift "American Journal of Public Health" veröffentlicht wurden. Es zeigte sich, dass der Textinhalt bestimmter kurzer Leuchtschriften, die den Toilettenbesuchern gezeigt wurden, in begrenztem Umfang durchaus effektiv ist.
Die Wissenschaftler beobachteten an 32 Tagen im Zeitraum Juli bis September 2008 etwa 108.000 männliche und 90.000 weibliche Toilettenbenutzer einer Autobahnraststätte in England. Vollautomatisch mit Hilfe von Sensoren protokolliert wurde - in Männer- und Frauentoilette - ob der jeweilige Besucher auch den Seifenspender über dem Waschbecken benutzt hatte. Um die "Studienteilnehmer" zum Händewaschen zu motivieren, wurden ihnen unterschiedliche kurze Botschaften in einer Leuchtschrift am Eingang der Toiletten gezeigt - allerdings nicht immer, sondern nur manchmal, um zu sehen, ob diese Texte überhaupt einen Einfluss haben auf die Benutzung von Wasser und Seife nach dem Toilettengang. Und überdies wurde der Text der Werbebotschaften variiert, zum Einsatz kamen insgesamt 14 verschiedene Mitteilungen.
Diese Kurztexte (mit maximal 48 Zeichen) waren von Psychologen, Gesundheitswissenschaftlern und Marketing-Experten entwickelt worden und beschrieben jeweils eine andere Informationslogik und Anreizqualität. Angesprochen waren unter anderem: Reine Informationsvermittlung (z.B. "Wasser allein zerstört Keime nicht, man benötigt Seife"), Appelle an den Status ("Sei kein schmutziger Seifen-Schwindler!"), Betonung des Komforts ("Seife gibt Dir ein Frischegefühl") oder Hervorrufen von Ekel oder Scham ("Nimm das Klo nicht mit nach draußen, wasch Dich mit Seife").
In der Auswertung der Daten zeigte sich dann, dass bestimmte Botschaften eine Steigerung des Händewaschens um etwa 10 Prozent (im Vergleich zur vorherigen Situation ohne Leuchtbotschaften) bewirkt hatten. Insgesamt schwankte die Steigerungs-Quote für das Händewaschen zwischen 2 und 12 Prozent. Überraschend war, dass Frauen und Männer sich für sehr unterschiedliche Mitteilungen empfänglich zeigten. Während bei Männern Komfort-Hinweise ("Seife gibt Dir ein Frischegefühl") und Ekelappelle ("Nimm das Klo nicht mit nach draußen, wasch Dich mit Seife") überaus erfolgreich waren, zeigten sich Frauen am sensibelsten gegenüber der Vermittlung von reiner Information ("Wasser allein zerstört Keime nicht, man benötigt Seife", "Seife vernichtet Krankheitserreger"). Für beide Geschlechter gleich effektiv (+ 11-12%) war allerdings eine Mitteilung, die auf soziale Kontrolle abzielt: "Wäscht sich die Person neben Dir auch mit Seife?"
Hier ist ein Abstract der Studie: Gaby Judah et al: Experimental Pretesting of Hand-Washing Interventions in a Natural Setting (American Journal of Public Health S405-S411, October 2009, Vol 99, No. S2)
Gerd Marstedt, 18.11.09
Sachlichkeit statt "Pandemie-Hype": Allgemeinarztverband und Arzneimittelkommission zum ob, wer, wie und wie oft der Grippeimpfung
 Generalstabsmäßig meldet seit einigen Tagen Bundesland für Bundesland Vollzug: Zig Millionen von Impfdosen gegen die Schweinegrippe bzw. die angeblich "neue Influenza" liegen in Hunderten von Lagerstätten bereit, um am Tag X in Gesundheitsämtern und Schwerpunktpraxen an genau definierte Bevölkerungsgruppen ausgegeben werden zu können. Doch trotz dieser beeindruckenden Verteidigungskulisse kommt man sich als Beobachter ein wenig wie Loriots Rennbahnbesucher vor: "Ja, wo ist sie denn?"
Generalstabsmäßig meldet seit einigen Tagen Bundesland für Bundesland Vollzug: Zig Millionen von Impfdosen gegen die Schweinegrippe bzw. die angeblich "neue Influenza" liegen in Hunderten von Lagerstätten bereit, um am Tag X in Gesundheitsämtern und Schwerpunktpraxen an genau definierte Bevölkerungsgruppen ausgegeben werden zu können. Doch trotz dieser beeindruckenden Verteidigungskulisse kommt man sich als Beobachter ein wenig wie Loriots Rennbahnbesucher vor: "Ja, wo ist sie denn?"
Denn parallel zum Aufbau der Abwehrmaßnahmen, der immer wieder aufflackernden Debatte über die Verteilung der Impfkosten, der Diskussion möglicher unerwünschter Wirkungen der Impfstoffe und der stetigen Verlängerung der schon jetzt langen Kette inplausibler und intellektuell unredlicher Argumentationen im öffentlichen Schweinegrippe-Diskurs ist und bleibt die Schweinegrippe ein weltweit seltenes, hinsichtlich ihrer Tödlichkeit vergleichsweise "harmloses" Phänomen und dieses wird sogar im Moment in vielen Ländern faktisch kleiner oder verschwindet.
Bei vielen der seit Monaten von Gesundheitspolitikern aber auch einem Teil der Gesundheitsbehörden und Organisationen wie dem nationalen Robert-Koch-Institut (RKI) und der internationalen Weltgesundheitsorganisation (WHO) verbreiteten Prognosen und Szenarien handelt es sich
• im Falle der Erwartung einer "zweiten" und auch gleich noch wesentlich gefährlicheren Welle um eine abenteuerliche Analogie zu der in den letzten 100 Jahren einzigen derartigen Konstellation in den Jahren 1918/19. Dass es seither keinen zweiten Fall einer gefährlicheren zweiten Welle gegeben hat, wird in der eigenartigen "Pandemie-Euphorie" ignoriert und damit die Tatsache ignoriert, dass es zu dieser zweiten Welle wahrscheinlich nur wegen der historisch in der neueren Zeit hoffentlich einmaligen Konstellation einer durch Krieg und Hunger körperlich wie mental geschwächten Bevölkerung in Europa und der eigentlich schon immer geschwächteren Bevölkerung in Ländern der 3. Welt (zur Erinnerung: der Großteil der Toten der "spanischen Grippe" von 1918/19 war nicht in Spanien oder Europa zu beklagen, sondern z.B. in Indien) kommen konnte.
• und bei der Prognose einer viel gefährlicheren Winter-Schweinegrippe oder eines so genannten Reassortements des Schweinegrippe- mit dem Vogelgrippevirus um reine und mit fast keiner Wahrscheinlichkeit ausgestattete Spekulationen. Im Falle der Befürchtung, die normale Wintergrippe könne mit der Schweinegrippe oder gar einem völlig neuen Grippe-Typ zusammen zu einer gewaltigen Risiko- und Risikofolgenkumulation führen, gibt es, wenn man auf das Erkrankungsgeschehen auf der winterlichen Südhalbkugel schaut, gegenläufige oder garantiert keine bestätigende empirische Entwicklungen.
Trotz aller aktueller und mit Sicherheit im Nordhalbkugelwinter zu erwartenden Empirie (wie jedes Jahr wird es im Winter auch ohne Schweinegrippe "ganz normal" zahlreiche Grippefälle und -Tote geben und darunter sind wahrscheinlich auch Personen, die am Schweinegrippevirus versterben) wollen unverständlicherweise weder die WHO noch das RKI die oberste Pandemiestufe 6 und damit auch nationale Pandemiepläne abblasen oder abmildern und insgesamt deeskalierend wirken.
Wie so etwas aussehen könnte und wie man sich dabei trotzdem nicht im anderen Extrem der Verharmlosung befindet, zeigen zwei gerade erschienene Stellungnahmen der Arzneimittel-Kommission der deutschen Ärzteschaft und der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Allgemeinmedizin(DEGAM), die sich schwerpunktmäßig mit den Impfplänen und der kritischen Debatte über unerwünschte Nebenwirkungen auseinandersetzen.
Die Stellungnahme der Arzneimittelkommission fasst auf der Basis von vorhandenen Erkenntnissen aus anderen Ländern die gesicherte Erkenntnislage u.a. so zusammen:
• Die "Übertragungsrate in epidemiologischen Analysen basierend auf Daten aus Peru, Mexiko, Japan und Neuseeland (wird) ähnlich oder sogar höher als bei der saisonalen Influenza eingeschätzt."
• Und: "Derzeit ist nicht auszuschließen, dass die Übertragungswahrscheinlichkeit in Mitteleuropa in den Wintermonaten höher ist als aktuell beobachtet."
• Trotz der spekulativen Annahme über die Existenz von Schweinegrippefällen, die tödlich geendet haben, aber als leichte Fälle eingeschätzt und dokumentiert worden sein sollen, ist die empirisch gesicherte Prognose wieder deutlich harmloser: Eine empirische Untersuchung nämlich "spricht dafür, dass die Sterblichkeit der neuen Influenza etwas höher liegt, jedoch in der gleichen Größenordnung wie bei der saisonalen Influenza"
• Dem schließt sich der aber auch schon für alle anderen Grippeinfektionen geltende und zutreffende Hinweis auf die Existenz der besonders gefährdeten und daher auch möglichst durch Impfen zu schützenden Schwangeren und an anderen schweren chronisch erkrankten Personen an: Sie sind "mit einem höheren Risiko für einen schweren Verlauf einer Erkrankung an neuer Influenza assoziiert."
• Die Wirksamkeit und die Risiken der Impfung beurteilen die Arzneimittelexperten sehr differenziert und verantwortungsvoll zurückhaltend. So ist es für sie "nicht sicher zu beurteilen, ob die jetzige Impfung auch gegen ein verändertes hoch pathogenes H1N1-Virus schützt" also jenes Virus, dessen Auftreten von denselben Akteuren prognostiziert wird, die sich für eine hohe Durchimpfungsrate gegen den aktuellen Schweinegrippevirus stark machen. Auch wenn sie für die genannten Risikopersonen eine Impfung empfehlen, schlagen sie trotzdem vor, dass Schwangeren und Kindern wegen der nicht durch Studien entkräfteten Wirkungen eines dem Impfstoff zugesetzten Wirkungsverstärkers (Adjuvans) "ein nicht-adjuvanzierter Impfstoff angeboten werden."
• Die Kommission schlägt ferner ein engmaschiges Überwachungssystem für erwartete Erscheinungen vor.
Zu der Frage, ob man eigentlich bei einer flächendeckend geplanten Impfung wirklich Impfstoffe mit Wirkverstärkern braucht, um schnell einen hohen Impfstoffwirkspiegel und Schutz erreichen zu können, gibt es fast paradoxe aber hierzulande wenig diskutierte noch gar praktisch aufgegriffene Ergebnisse aus den USA.
Dort entschieden die nationalen Sicherheitsinstitutionen zum einen, nur Impfstoffe ohne Wirkverstärker einzusetzen. Zum anderen aber existieren in den USA und Australien erste Hinweise aus kleinen Studien, dass die eigentlich wirkärmeren traditionell gefertigten Impfstoffe, um ihre volle Wirksamkeit erreichen zu können, nur einmal gespritzt werden müssen und nicht zweimal wie beim angeblich wirkmächtigeren "moderneren" Impfstoff deutscher Prägung
Die Stellungnahme der "Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin (DEGAM) zum Entwurf der STIKO-Empfehlungen bezüglich der Impfung gegen die Neue Influenza A (H1N1" ähnelt der Stellungnahme der Arzneimittelexperten der deutschen Ärzteschaft im Grundtenor, spitzt seine POsitionen aber deutlicher zu.
Zur Epidemiologie erklärt die DEGAM einleitend und sehr gezielt: "Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat bei der Ausrufung der Pandemie für die Neue Influenza (H1N1 09) die seit Jahren bestehende Definition des Begriffs geändert und den entscheidenden Satz, dass "weltweit eine enorme Zahl von Erkrankungen und Toten" aufgetreten sein müssen, weggelassen. Bei dieser Vorgehensweise, welche die Unterschiede zwischen pandemischer und saisonaler Grippe verwischt, haben möglicherweise interessensgeleitete Berater eine wesentliche Rolle gespielt."
Angesichts des harmlosen und unkomplizierten bisherigen Verlaufs von Schweinegrippenerkerankungen heben die Autoren nochmals eigentlich Selbstverständliches hervor:
• "Dieser insgesamt gutartige Verlauf der Erkrankung in Deutschland verpflichtet bei prophylaktischen Maßnahmen zu einer besonders sorgfältige Abwägung von Nutzen und Schaden."
• Und: "An einen für die gesamte Bevölkerung vorgesehenen Impfstoff (sind) ganz besonders strenge Kriterien anzulegen."
Die 8 Seiten umfassende Stellungnahme der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft zur Schutzimpfung gegen die neue Influenza A (H1N1)1 ist am 10. September 2009 erschienen und kostenlos erhältlich.
Dies gilt auch für die vierseitige DEGAM-Stellungnahme.
Die Ergebnisse der zwei Untersuchungen zur Art und Häufigkeit von Impfungen und vor allem der Notwendigkeit und des höheren Schutzes zweier Impfungen finden sich kostenlos herunterladbar im am 10. September 2009 erschienenen Heft des "New England Journal of Medicine (NEJM)". Der Aufsatz "Trial of Influenza A (H1N1) 2009 Monovalent MF59-Adjuvanted Vaccine — Preliminary Report" von Clark et al. hier und der Aufsatz "Response after One Dose of a Monovalent Influenza A (H1N1) 2009 Vaccine — Preliminary Report" von Greenberg et al. hier.
Bernard Braun, 18.9.09
Nutzen von Krebsfrüherkennung wird von Patienten deutlich überschätzt, Deutsche besonders schlecht informiert
 Was wissen Bürger und Patienten in Europa über Nutzen und Risiken der Krebs-Früherkennung? Interviews mit mehr als 10.000 Bürgern aus neun europäischern Ländern gingen in die erste europaweit durchgeführte Studie zu diesem Thema ein. Die Ergebnisse der vom Harding-Zentrum für Risikokompetenz und der Gesellschaft für Konsumforschung durchgeführten Studie überraschen. Die ganz überwiegende Mehrheit der befragten Europäer erweist sich als mangelhaft informiert und viel zu optimistisch in Sachen Früherkennung, allen voran die Deutschen.
Was wissen Bürger und Patienten in Europa über Nutzen und Risiken der Krebs-Früherkennung? Interviews mit mehr als 10.000 Bürgern aus neun europäischern Ländern gingen in die erste europaweit durchgeführte Studie zu diesem Thema ein. Die Ergebnisse der vom Harding-Zentrum für Risikokompetenz und der Gesellschaft für Konsumforschung durchgeführten Studie überraschen. Die ganz überwiegende Mehrheit der befragten Europäer erweist sich als mangelhaft informiert und viel zu optimistisch in Sachen Früherkennung, allen voran die Deutschen.
So fanden die Wissenschaftler heraus, dass 92 % aller befragten Frauen den Nutzen der Mammografie als Mittel zur Vermeidung einer tödlich verlaufenden Brustkrebserkrankung völlig überschätzen oder gar keine Angaben dazu machen können. Und in ähnlicher Weise versprechen sich 89 % aller Männer zu viel vom PSA-Test im Hinblick auf die Reduktion des Risikos einer tödlich verlaufenden Prostatakrebserkrankung oder wissen dies nicht. Aber tatsächlich ist es um den Nutzen der Mammografie wie des PSA-Tests sehr viel schlechter bestellt. Dieses Informationen sind bislang jedoch kaum zu Patienten und Bürgern vorgedrungen. Dies ist kein Wunder, denn schon vor einiger Zeit hatten Wissenschaftler festgestellt: "Nicht nur Patienten, auch Journalisten und Ärzte sind Analphabeten, was Gesundheitsstatistiken anbetrifft".
Frühere Untersuchungen haben ergeben (vgl. Grafik), dass von 1.000 Frauen, die nicht am Mammographie-Sreening teilgenommen hatten, etwa 5 in einem Zeitraum von ca. 10 Jahren an Brustkrebs sterben. Bei einer Gruppe von ebenfalls 1.000 Frauen, die sich für die Früherkennung entschieden haben, verringert sich diese Zahl auf 4. In vielen Informationsbroschüren wird dieser Sachverhalt in die Aussage übersetzt, dass die Mammografie eine Risikoreduktion um 20 % ermögliche (mitunter werden auch 25 % oder 30 % angegeben). Das ist mathematisch korrekt (1 Todesfall von 5 Fällen weniger macht 20 Prozent aus), aber inhaltlich irreführend. Denn häufig schließen Frauen daraus, dass durch Mammografie 20 von 100 oder 200 von 1.000 Frauen "gerettet" werden. Die jetzt präsentierte Studie zeigt: In Deutschland wissen gerade einmal 0,8 % der Frauen, dass Früherkennung die Brustkrebssterblichkeit um etwa eine von je 1.000 Frauen reduziert - das ist europäischer Tiefstwert, allerdings ist das Wissen im europäischen Durchschnitt (1,5%) nicht sehr viel höher. 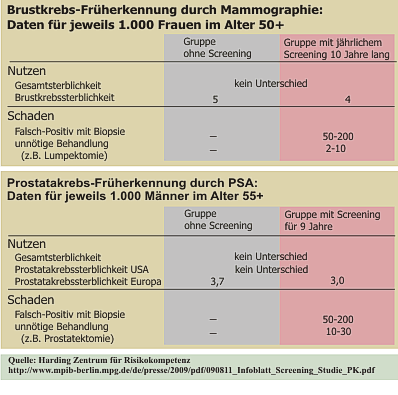
Doch auch bei Männern zeigt sich Ähnliches: Der Nutzen der Prostatakrebsfrüherkennung mit PSA-Tests liegt bei null oder einem von 1.000 Männern. Dies wissen jedoch insgesamt (alle Länder) nur 11 Prozent, und in Deutschland gerade einmal 6 Prozent.
Dafür sind die Deutschen, Männer wie Frauen, "Prospekt-Europameister": 41 % der Befragten informieren sich häufig durch Broschüren von Gesundheitsorganisationen - der europäische Durchschnitt liegt hier bei 21 %. Jene Deutschen, die solche Informationsquellen häufig zu Rate ziehen, sind aber keineswegs besser informiert als andere. Vielmehr überschätzen sie den Nutzen der Früherkennung noch etwas mehr als jene, die die Broschüren nicht lesen. Menschen im Alter von 50-69 Jahren, die besonders gefährdet sind und daher die wichtigste Zielgruppe des Informationsmaterials darstellen, sind keineswegs besser im Bilde als andere Altersgruppen.
Und noch einer weiteren Frage widmet sich die Studie: Sind Menschen, die häufiger Ärzte oder Apotheker konsultieren, besser über den Nutzen der Früherkennung informiert? Die Antwort darauf ist europaweit ein klares "Nein". Insbesondere deutsche Frauen, die ihr Wissen zum Thema Früherkennung bevorzugt aus Gesprächen mit Ärzten und Apothekern beziehen, sind nicht etwa zu einer deutlich genaueren Einschätzung in der Lage, sondern zeigen sich schlechter informiert als andere, die sich weniger bei Ärzten oder Apothekern erkundigen.
Prof. Dr. Gerd Gigerenzer, Direktor des Harding Center for Risk Literacy, zu den Ergebnissen der Studie: "Früherkennung birgt immer die Gefahr von Folgeschäden, wie z. B. unnötige Operationen oder Inkontinenz. Um informiert entscheiden zu können, ob sie teilnehmen möchten oder nicht, müssen Patienten um den möglichen Nutzen der Früherkennung genauso wissen wie um potenzielle Schädigungen. Wenn wir mündige Patienten und kein paternalistisches Gesundheitswesen wollen, dann müssen wir genau hier ansetzen. Wir müssen - gerade in einem immer teurer werdenden System - die Menschen umfassend und präzise informieren und sie so in die Lage versetzen, notwendige Entscheidungen kompetent zu treffen."
• Die neuere Studie mit der Umfrage in Europa (kostenlose PDF-Datei): Gerd Gigerenzer, Jutta Mata und Ronald Frank: Public Knowledge of Benefits of Breast and Prostate Cancer Screening in Europe
• Abstract der Studie im Journal of the National Cancer Institute, Vol. 101, Issue 17
• Informations-Blatt mit Quellen für die genannten epidemiologischen Daten
Frühere Veröffentlichungen:
• Gerd Gigerenzer, Odette Wegwarth: Risikoabschätzung in der Medizin am Beispiel der Krebsfrüherkennung (Zeitschrift für Evidenz, Fortbildung und Qualität im Gesundheitswesen, Volume 102, Issue 9, 2008, Pages 513-519)
• Gerd Gigerenzer u.a.: Helping Doctors and Patients Make Sense of Health Statistics (Psychological Science in the Public Interest, Volume 8 Issue 2, Pages 53 - 96, Published Online: 8 Oct 2008)
Gerd Marstedt, 12.8.09
Don't worry, be happy! Wissenschaftler will die englische Bevölkerung glücklicher machen
 Mit einem bislang einmaligen Experiment möchte der englische Psychologe Prof. Richard Wiseman (University of Hertfordshire) die englische Bevölkerung glücklicher machen. Im Internet können Teilnehmer jetzt einen kurzen Fragebogen ausfüllen, in dem unter anderem gefragt wird, wie glücklich sie sich zur Zeit fühlen. Sie werden dann per Zufall einer von vier Gruppen zugeordnet. In jeder Gruppe wird ein kurzes Video gezeigt, in dem jeweils verschiedene psychologische Techniken zum Glücklichsein kurz vorgestellt werden. Die Teilnehmer sollen dann versuchen, fünf Tage lang (vom 2.-6. August 2009) diese Ratschläge auch in die Tat umzusetzen. Danach soll dann erneut eine Einschätzung der eigenen Glücksgefühle online abgegeben werden. Der Wissenschaftler hofft, auf diese Weise herauszufinden, welche der vielen, vielen von Psychologen beschriebenen Techniken, um sich glücklicher zu fühlen, am effektivsten ist. Und er hofft tatsächlich auch, in der gegenwärtigen Krisensituation das Befinden der Engländer/innen zu bessern, sofern sich genügend Teilnehmer finden. Dies scheint jedoch wahrscheinlich, denn der Versuch wird in zahlreichen englischen Medien (auch seriösen wie der Times Online) vorgestellt.
Mit einem bislang einmaligen Experiment möchte der englische Psychologe Prof. Richard Wiseman (University of Hertfordshire) die englische Bevölkerung glücklicher machen. Im Internet können Teilnehmer jetzt einen kurzen Fragebogen ausfüllen, in dem unter anderem gefragt wird, wie glücklich sie sich zur Zeit fühlen. Sie werden dann per Zufall einer von vier Gruppen zugeordnet. In jeder Gruppe wird ein kurzes Video gezeigt, in dem jeweils verschiedene psychologische Techniken zum Glücklichsein kurz vorgestellt werden. Die Teilnehmer sollen dann versuchen, fünf Tage lang (vom 2.-6. August 2009) diese Ratschläge auch in die Tat umzusetzen. Danach soll dann erneut eine Einschätzung der eigenen Glücksgefühle online abgegeben werden. Der Wissenschaftler hofft, auf diese Weise herauszufinden, welche der vielen, vielen von Psychologen beschriebenen Techniken, um sich glücklicher zu fühlen, am effektivsten ist. Und er hofft tatsächlich auch, in der gegenwärtigen Krisensituation das Befinden der Engländer/innen zu bessern, sofern sich genügend Teilnehmer finden. Dies scheint jedoch wahrscheinlich, denn der Versuch wird in zahlreichen englischen Medien (auch seriösen wie der Times Online) vorgestellt.
Auf der Website The Science of Happiness wird das Experiment kurz beschrieben und auch der Fragebogen präsentiert, der dann online ausgefüllt werden kann. Nur Alter, Geschlecht und Email-Adresse sind anzugeben sowie 4 Fragen zu beantworten, die das Ausmaß des Glücklichseins beschreiben. Dann wird ein kurzes Video gezeigt: Hier wird jeweils eine von 4 Techniken näher vorgestellt, die sich in früheren Forschungsstudien von Richard Wiseman als vermeintlich erfolgreich herausgestellt haben. Darunter:
• der Tipp "Keep smiling", mehrfach an jedem Tag ein Lächeln ins Gesicht bringen und diesen Gesichtsausdruck so lange wie möglich beibehalten. Die Anlässe zum Lächeln können beliebig sein, wenn das Telefon klingelt, wenn man die Wohnung verlässt, ein Geschäft betritt, ....
• der Ratschlag, jeden Tag einen Freund, Kollegen oder Verwandten mit einem Kompliment, einem kleinen Geschenk oder einer positiven Botschaft per Email, Telefon oder SMS zu beglücken,
• der Tipp, sich ganz auf ein Ereignis in den letzten 24 Stunden zu konzentrieren, das positiv und überaus zufriedenstellend verlaufen ist,
• der Rat, Dankbarkeit zu zeigen und auszudrücken für etwas, das im eigenen Leben besonders positiv verlaufen ist.
Am 11. August will Prof. Wiseman dann die Ergebnisse des Massenexperiments vorstellen: a) Ob sich die Befindlichkeit der englischen Nation gebessert hat, und b) welche der vier Techniken am allerglücklichsten macht. Erst vor kurzem hatte der Psychologe in seinem Buch ":59 seconds" eine Reihe von Tipps veröffentlicht, die die Quintessenz seiner bisherigen Forschungsstudien repräsentieren. Empfehlenswert sind danach folgende "10 Tipps zum Glücklichsein":
• Einen Freund/eine Freundin treffen, die man lange nicht gesehen hat
• Eine lustige TV-Sendung oder einen witzigen Film anschauen
• Dreimal in der Woche 30 Minuten Sport betreiben
• Die Zeit vor dem Fernseher auf die Hälfte kürzen
• Erfahrungen erwerben, keine Konsumgüter: Ins Konzert oder Kino gehen, zu einem ungewöhnlichen Ort oder Restaurant
• Neue Herausforderungen beginnen: Ein neues Hobby, einem Verein beitreten, ein Handwerk lernen
• 20 Minuten in der Sonne spazieren gehen
• 10 Minuten entspannende oder aufbauende Musik hören
• Einen Hund streicheln
• Keine Nachrichten mehr lesen oder Nachrichtensendungen betrachten
Prof. Wiseman's Techniken zum Glücklichsein sind zweifellos toll. Aber die Redakteure des Forum Gesundheitspolitik schätzen den Körperzellen-Rock von Mosaro & Astrid Kuby eigentlich noch höher ein. Denn der Körperzellen-Rock macht nicht nur glücklich, sondern auch gesund - Motto: "Jede Zelle meines Körpers ist glücklich, jede Körperzelle fühlt sich wohl!" "Wer bei diesem Lied aktiv mitmacht, kann so Krankheiten heilen," heißt es bei der Vorstellung des Videos auf YouTube, "ein stärkeres, körperliches und geistiges Wohlbefinden bemerken und eine liebevolle Verbindung zu seinem Körper spüren."
Aber natürlich überlässt die Redaktion es jedem 1-Euro-Jobber, Arbeitslosen und Krisengeschädigten selbst, ob er/sie nun den Körperzellen-Rock singt, einen Hund streichelt oder die Nachrichten boykottiert, um ein wenig glücklicher zu sein.
Gerd Marstedt, 2.8.09
An welchen Wochentagen und zu welcher Jahreszeit häufen sich Suizide? US-Studie bringt überraschende Befunde
 Was ist Ihre Vermutung, an welchen Wochentagen ereignen sich die meisten Suizide? Am Sonntag, wegen der erzwungenen Untätigkeit oder Langeweile? Falsch. Am Montag, weil Stress und Zwänge des Berufslebens einen wieder bedrücken? Auch falsch. Es ist der Mittwoch. Und welche Jahreszeit gibt besonders häufig zu Selbsttötungen Anlass? Sagen wir es gleich, es ist nicht der trüb-nasse Herbst und auch nicht der dunkle und kalte Winter. Sondern der Sommer.
Was ist Ihre Vermutung, an welchen Wochentagen ereignen sich die meisten Suizide? Am Sonntag, wegen der erzwungenen Untätigkeit oder Langeweile? Falsch. Am Montag, weil Stress und Zwänge des Berufslebens einen wieder bedrücken? Auch falsch. Es ist der Mittwoch. Und welche Jahreszeit gibt besonders häufig zu Selbsttötungen Anlass? Sagen wir es gleich, es ist nicht der trüb-nasse Herbst und auch nicht der dunkle und kalte Winter. Sondern der Sommer.
Basis dieser Befunde sind Analysen von über 2 Millionen Todesfällen und über 130 Tausend Suiziden aus den Jahren 2000-2004, die den Wissenschaftlerinnen aus einer Datenbank (US Multiple Cause of Death Files (MCDFs) von der US-Behörde "National Center for Health Statistics" zur Verfügung gestellt wurden. Die Autorinnen referieren zunächst ausführlich eine Vielzahl früherer internationaler Studien über zeitliche Einflussfaktoren für Suizidfälle. Sie weisen dann auf entscheidende Schwächen der meisten Analysen hin: Es sind oftmals schlichte Häufigkeitsverteilungen, über die berichtet wird, Todesfälle und Selbsttötungen nach Wochentagen, nach Monaten oder Jahreszeiten. Und auch Analysen, die das traurige Ereignis in Zusammenhang bringen mit dem Stand des Mondes, wobei sich allerdings zeigt: Der Mond hat keinen Einfluss auf die Zahl der Geburten - wohl aber Klinikärzte durch künstliche Einleitung von Geburten.
Unberücksicht bleibt bei all diesen Analysen, so die Kritik der beiden kalifornischen Wissenschaftlerinnen, der Einfluss anderer Faktoren: Die klimatischen Bedingungen der berücksichtigten Länder, die ökonomischen Rahmenbedingungen der herangezogenen Jahre, Unterschiede nach Altersgruppen oder Geschlecht. Viele dieser Faktoren werden in den multivariaten Analysen der neuen Studie auch berücksichtigt. Bei den insgesamt analysierten 2.045.919 Todesfällen und 131.636 Suiziden wurden als potentielle Einflussfaktoren neben dem Wochentag und der Jahreszeit statistisch auch einbezogen: Das Jahr des Ereignisses (zwischen 2000 und 2004, Geschlecht des Verstorbenen, Rasse/Hautfarbe, Familienstand, Bildungsniveau, Größe des Wohnorts, Alter, Berufstätigkeit, Merkmale im jeweiligen US-Bundesstaat wie medizinische Versorgung, Arbeitslosigkeit, ökonomische Bedingungen usw.).
Zentrale Befunde waren dann:
• Am Sonntag ereignen sich die wenigsten, am Mittwoch die häufigsten Suizide. Die Wahrscheinlichkeit (sog. Odds-Ratio) für die einzelnen Wochentage betrug in einer multivariaten Analyse unter Einbezug aller oben genannten Merkmale: Sonntag 1,0, Montag 1,6, Dienstag 1,6, Mittwoch 2,0, Donnerstag 1,5, Freitag 1,3, Samstag 1,6. Oder mit anderen Zahlen: Etwa 25% aller untersuchten Suizide ereigneten sich am Mittwoch, an den übrigen Wochentagen waren dies nur 11-14%.
• Für die Jahreszeiten gilt: Im Winter finden weniger Suizide statt, die meisten ereignen sich im Sommer. Setzt man die Häufigkeit im Winter mit 100% an, dann sind es im Sommer 120%. Aber auch im Frühjahr ist die Quote noch höher als im Herbst oder Winter. Allerdings sind die Differenzen hier geringer als bei den Wochentagen, im Frühjahr und Sommer beträgt die Suizidquote etwa 26%, im Herbst und Winter 24%.
• Männer begehen fast dreimal so oft (Odds Ratio 2,9) Selbsttötungen, weiße US-Amerikaner fast viermal so oft wie schwarze.
• Bei geschiedenen und verwitweten Personen liegt die Quote um etwa 40% höher als bei Verheirateten (Odds-Ratio 1,4).
In der Diskussion ihrer Befunde weisen die Forscherinnen noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass ihre Befunde früheren Untersuchungsergebnissen widersprechen. Sie betonen aber auch, dass ihre Studie methodisch besonders sorgfältig durchgeführt wurde, eine überaus große Stichprobe über mehrere Jahre erfasst und auch eine Vielzahl verborgener Einflussfaktoren ("confounder") mitberücksichtigt. Eine völlig schlüssige Erklärung für den Mittwoch als ganz besonders suizid-gefährdeten Tag haben sie jedoch nicht.
Die Studie ist hier kostenlos im Volltext verfügbar: Augustine J. Kposowa, Stephanie D'Auria: Association of temporal factors and suicides in the United States, 2000-2004 (Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, DOI 10.1007/s00127-009-0082-9)
Gerd Marstedt, 8.7.09
Lug und Trug in der Wissenschaft: "few bad apples" oder "tip of the iceberg"? Ergebnisse einer Meta-Analyse von 18 Surveys
 Wie oft betrügen WissenschaftlerInnen in und bei Forschungsarbeiten und welche Arten des Fehlverhaltens gibt es unter der Berufsgruppe, die in allen Gesellschaften die Funktion und das Image des objektiven Suchers nach Wahrheit zugewiesen bekommt?
Wie oft betrügen WissenschaftlerInnen in und bei Forschungsarbeiten und welche Arten des Fehlverhaltens gibt es unter der Berufsgruppe, die in allen Gesellschaften die Funktion und das Image des objektiven Suchers nach Wahrheit zugewiesen bekommt?
Fragen, die regelmäßig die Öffentlichkeit bewegen, wenn ein Stammzellenforscher aus Renommiersucht oder aus finanziellem Interesse Hirngespinste als Stammzelllinien verkauft oder haufenweise Ergebnisse zur Unwirksamkeit eines Arzneimittels mit Vorsatz nicht veröffentlicht werden. Fragen aber, die sich alle Akteure, die ihre Argumentationen und Vorgehensweisen strikt auf wissenschaftliche Evidenz zu gründen versuchen, auch außerhalb des Skandal-Pulverdampfs systematisch stellen sollten.
Genauso regelmäßig wird die Bedeutung der Skandale aber auch in der Öffentlichkeit wieder dethematisiert. Dabei spielt die Reduktion der Betrügereien oder Fälschereien auf das Werk weniger "schwarzer Schafe" und die Minimalisierung auf "few bad apples" eine wichtige Rolle. Ob das fast reflexartige Gegen-Schlagwort von der "Spitze des Eisbergs" aber zutrifft, wird auch nur selten belegt.
Daher sind die Ergebnisse der ersten weltweit durchgeführten Metaanalyse von 18 Surveys (21 wurden in einen systematischen Review einbezogen), die Wissenschaftler nach ihren Erfahrungen mit und Beurteilungen von Fehlverhalten im Wissenschaftsbereich fragten, von großer Bedeutung und Wichtigkeit.
Die Ergebnisse sehen so aus:
• 2% der befragten Wissenschaftler gaben für sich persönlich eine unmissverständlich ernste Form der Fälschung oder Modifikation von Daten und Ergebnissen ihrer Forschungen zu. Dies umfasste auch die Fabrikation falscher Daten.
• Bis zu 34% der Befragten räumten eine Reihe weiterer fragwürdiger Praktiken in ihrer Forschungstätigkeit ein. Dazu gehörten u.a. Datenauswertungen auf der Basis von "Bauchgefühlen" oder ein Wechsel des Forschungsdesigns, der Methodik oder gar der Resultate unter dem Druck der Forschungsfinanzierer.
• Richtete sich die Frage nach dem bei anderen WissenschaftlerInnen wahrgenommenen Verhalten gaben 14% der Befragten an, sie hätten solch ernsthaftes Fehlverhalten oder Betrug schon beobachtet. Und bis zu 72% gaben dies für die genannten fragwürdigen Praktiken an.
• Es gab noch einige interessante Details: Wenn in den Selbst-Berichten die Worte "Fälschung" oder "Fabrikation" von Ergebnissen auftauchten und nicht auch noch "Veränderung/Modifikation" waren die Häufigkeit der berichteten Fehlverhaltensweisen geringer. Dies traf auch dann zu, wenn die Befragungsergebnisse gemailt werden mussten.
• Forscher aus dem medizinischen und pharmakologischen Bereich berichteten deutlich häufiger von irgendeiner Form des Fehlverhaltens als WissenschaftlerInnen aus anderen Bereichen.
• Während die selbstberichteten Fälschereien im Lauf der letzten Jahre signifikant abnahmen, gab es in Reports, die nicht auf Selbstbewertungen beruhten, keine Abnahme dieser Fehlverhaltensweisen.
Nach einer knappen, inhaltlich differenzierten und sorgfältigen Diskussion der methodischen und inhaltlichen Verzerrungsmöglichkeiten und der Grenzen der Surveys kommt die Autorin der Metaanalyse zu einer Schlussfolgerung, die der Vorstellung von der "Spitze des Eisbergs" entspricht: "It appears likely that this is a conservative estimate of the true prevalence of scientific misconduct."
Was daraus folgt, wird nicht auch noch näher ausgeführt. Dass derartige Forschungsergebnisse nicht verschwinden und dann auch noch in einer Open Access-Zeitschriftenplattform praktisch ungehindert der Öffentlichkeit präsentiert werden, ist sicherlich eine wichtige Voraussetzung, am berichteten Fehlverhalten einer ganzen Menge "schwarzer Schafe" in der Wissenschaft etwas ändern zu können.
Der 11-seitige Aufsatz "How many scientists fabricate and falsify research? A systematic review and meta-analysis of survey data" von Daniele Fanelli von der Universität in Edinburgh ist in der Maiausgabe 2009 der Wissenschaftszeitschrift "PloS ONE" (Volume 4, Heft 5, e5738) erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 4.6.09
Gesundheitsbedrohung durch die Lebensmittel-Industrie? Ähneln die Strategien von "Big Food" denen von "Big Tobacco" ?
 In einem Schwerpunktheft der Zeitschrift "Milbank Quarterly", das sich ganz auf das Thema Übergewicht" konzentriert, findet sich auch ein Aufsatz, der Parallelen zieht zwischen den früheren Strategien der Tabak-Industrie und den aktuellen Vorgehensweisen der Lebensmittel-Industrie. "Risiken, wenn man Geschichte ignoriert. Die Tabak-Giganten spielten falsch und Millionen starben. Handeln die Lebensmittel-Giganten ähnlich?" - lautet der Titel der Veröffentlichung, in der historische Differenzen, aber auch viele Gemeinsamkeiten von "Big Tobacco" und "Big Food" beschrieben werden. ("Big Tobacco" ist im Volksmund ein verächtlicher, abwertender Begriff für die Tabak-Industrie.) Die beiden US-Wissenschaftler Kelly D. Brownell und Kenneth E. Warner der Yale University in New Haven möchten in ihrem Aufsatz auf Gesundheitsrisiken aufmerksam machen, die sich aus den Informations- und Marketingstrategien, aber ebenso aus den Produktionskonzepten von Getränke- und Nahrungsmittel-Konzernen ergeben.
In einem Schwerpunktheft der Zeitschrift "Milbank Quarterly", das sich ganz auf das Thema Übergewicht" konzentriert, findet sich auch ein Aufsatz, der Parallelen zieht zwischen den früheren Strategien der Tabak-Industrie und den aktuellen Vorgehensweisen der Lebensmittel-Industrie. "Risiken, wenn man Geschichte ignoriert. Die Tabak-Giganten spielten falsch und Millionen starben. Handeln die Lebensmittel-Giganten ähnlich?" - lautet der Titel der Veröffentlichung, in der historische Differenzen, aber auch viele Gemeinsamkeiten von "Big Tobacco" und "Big Food" beschrieben werden. ("Big Tobacco" ist im Volksmund ein verächtlicher, abwertender Begriff für die Tabak-Industrie.) Die beiden US-Wissenschaftler Kelly D. Brownell und Kenneth E. Warner der Yale University in New Haven möchten in ihrem Aufsatz auf Gesundheitsrisiken aufmerksam machen, die sich aus den Informations- und Marketingstrategien, aber ebenso aus den Produktionskonzepten von Getränke- und Nahrungsmittel-Konzernen ergeben.
Sie beschreiben in ihrem Artikel einerseits die bedeutsamen Differenzen zwischen Tabak- und Nahrungsmittel-Konzernen: Während Produkte wie Nahrungsmittel lebensnotwendig sind, gilt dies für Tabak und den Giftstoff Nikotin ganz und gar nicht. Der Verkauf von Tabak an Kinder ist verboten, für Nahrungsmittel gibt es bislang (mit Ausnahme alkoholischer Getränke) keine Beschränkungen. Für die süchtig machende Wirkung des Tabak gibt es eine Vielzahl wissenschaftlich fundierter Studien, während die Forschung über Lebensmittel gerade erst begonnen hat. Und auch die Produktstruktur, Größe und Zahl der Unternehmen beider Branchen zeigen massive Unterschiede.
Bedeutsamer erscheinen den beiden Wissenschaftlern jedoch die Gemeinsamkeiten, wobei zunächst auf eine Übereinstimmung hingewiesen wird: Die großen gesundheitlichen Risiken und ökonomischen Folgekosten des Rauchens auf der einen Seite und der durch Lebensmittel verursachten Problematik Übergewicht und Adipositas auf der anderen Seite. Sie diskutieren in ihrem sehr informativen 36seitigen Aufsatz mehrere Aspektes des Themas, bei denen sie Gemeinsamkeiten zwischen "Big Tobacco" und "Big Food" erkennen.
In diesem "Drehbuch des Handelns" sind aktuell folgende charakteristische Handlungsanleitungen und Vorgehensweisen der Lebensmittel-Industrie erkennbar:
• Die persönliche Verantwortung des Einzelnen als Ursache für das ungesunde Ernährungsverhalten der Nation hervorheben
• Die Furcht wecken, dass Maßnahmen der Regierung die persönlichen Freiheiten einschränken
• Kritiker mit totalitärer Sprache verunglimpfen, sie als "Lebensmittel-Polizei", als "Führer eines Nanny-Staates" verunglimpfen oder sie sogar als "Lebensmittel-Faschisten" bezeichnen,
• sie anklagen wegen ihrer Bemühungen, der Bevölkerung ihre bürgerlichen Freiheitsrechte weg zu nehmen
• Studien, die die Lebensmittel-Industrie angreifen, als "Billig-Wissenschaft" ("junk science") kritisieren
• Sport und körperliche Bewegung in gesundheitlicher Hinsicht als weitaus bedeutsamer charakterisieren im Vergleich zur Ernährung
• Hervorheben, dass es weder gute noch schlechte Lebensmittel gibt, daher darf auch nicht gefordert werden, bestimmte Nahrungsmittel (Soft drinks, fast food usw.) zu verändern
• Zweifel anmelden, wenn Besorgnis hinsichtlich der Lebensmittel-Industrie laut wird.
Für diese einzelnen Szenen des "Drehbuchs" werden in der Veröffentlichung viele konkrete Beispiele genannt. Darüber hinaus werden aber auch aktuell realisierte und gesellschaftlich wünschenswerte Strategien einander gegenüber gestellt. Am Beispiel "Koffein in Lebensmitteln" werden dann wiederum Konzepte und Argumentationen der Konzerne deutlich gemacht, die fatal an die Tabak-Industrie erinnern. So ist auffällig, dass Koffein inzwischen einer Vielzahl von Produkten künstlich zugesetzt wird, obwohl Koffein in pharmakologischen Studien deutliche Kennzeichen der Sucht hervorgerufen hat. Zu diesen Produkten gehören neben kaffeehaltigen Getränken und Energie-Drinks unter anderem Chips, Geleebohnen, Sonnenblumenkerne, Schokoladenriegel. Und während die Hersteller betonen, der Koffein-Zusatz diene lediglich als Geschmacksverstärker, zeigen unabhängige wissenschaftliche Studien, dass man Koffein in Lebensmitteln nicht herausschmecken kann.
Wird die Nahrungsmittel-Industrie, so fragen die Wissenschaftler abschließend, zukünftig auf ein Drehbuch setzen, das die Öffentliche Gesundheit in den Vordergrund stellt oder weist ihre Zukunft Merkmale auf, wie sie für die Tabakindustrie in der Vergangenheit galten: Schwerwiegende gesetzlichen Auflagen und überaus hohe finanziellen Bußen? Die Antwort darauf bleibt offen.
Quelle: Kelly D. Brownell, Kenneth E. Warner: The Perils of Ignoring History: Big Tobacco Played Dirty and Millions Died. How Similar Is Big Food?
• Abstract: http://www3.interscience.wiley.com/journal/122250320/abstract}
• {PDF mit Volltext
• oder auf dieser Seite PDF mit Volltext (Milbank Quarterly, Volume 87 Issue 1, Pages 259 - 294, DOI: 10.1111/j.1468-0009.2009.00555.x)
• Das Schwerpunktheft des Milbank Quarterly zum Thema "Obesity"
Gerd Marstedt, 14.4.09
Kukidents! Grufties! Wer in der Jugend negative Altersstereotype pflegt, erkrankt später öfter an Herz-Kreislauferkrankungen
 Vorbei die Zeiten, da Camillo Felgen anno 1961 in einem Schlager noch seine "Ehrfurcht vor schneeweißen Haaren" besang. Sind Begriffe wie "Uhus" (unter Hundert) oder "Üfüs" (über Fünfzig) noch nicht sonderlich despektierlich, so deuten die Wortschöpfungen "Kukidents" und "Grufties" auf einen deutlichen Wertewandel hin. Besonders negativ ausgeprägte Altersstereotype, so hat eine Studie der Yale School of Public Health aus Baltimore jetzt gezeigt, sind aber unter Umständen nicht ohne gesundheitliche Nebenwirkungen im höheren Lebensalter. Männer und Frauen im Alter von 18-49 Jahren, die man seit dem Jahr 1968 im Rahmen einer Längsschnittstudie ("Baltimore Longitudinal Study of Aging") kontinuierlich untersuchte, waren später sehr viel häufiger von Herz-Kreislauf-Erkrankungen betroffen, wenn sie in einer Befragung zu Beginn der Studie besonders negative Urteile über das Alter und Ältere abgegeben hatten. Dieser Zusammenhang ließ sich auch dann bestätigen, wenn man in multivariaten Analysen eine Vielzahl anderer Einflussfaktoren für Erkrankungen mitberücksichtigte.
Vorbei die Zeiten, da Camillo Felgen anno 1961 in einem Schlager noch seine "Ehrfurcht vor schneeweißen Haaren" besang. Sind Begriffe wie "Uhus" (unter Hundert) oder "Üfüs" (über Fünfzig) noch nicht sonderlich despektierlich, so deuten die Wortschöpfungen "Kukidents" und "Grufties" auf einen deutlichen Wertewandel hin. Besonders negativ ausgeprägte Altersstereotype, so hat eine Studie der Yale School of Public Health aus Baltimore jetzt gezeigt, sind aber unter Umständen nicht ohne gesundheitliche Nebenwirkungen im höheren Lebensalter. Männer und Frauen im Alter von 18-49 Jahren, die man seit dem Jahr 1968 im Rahmen einer Längsschnittstudie ("Baltimore Longitudinal Study of Aging") kontinuierlich untersuchte, waren später sehr viel häufiger von Herz-Kreislauf-Erkrankungen betroffen, wenn sie in einer Befragung zu Beginn der Studie besonders negative Urteile über das Alter und Ältere abgegeben hatten. Dieser Zusammenhang ließ sich auch dann bestätigen, wenn man in multivariaten Analysen eine Vielzahl anderer Einflussfaktoren für Erkrankungen mitberücksichtigte.
Knapp 400 Männer und Frauen im Alter von 18 bis 49 Jahren, die alle noch nicht von einer Herz-Kreislauferkrankung betroffen waren, wurden für diese Studie aus einer größeren Längsschnitt-Untersuchung ausgewählt. Alle hatten zu irgendeinem Zeitpunkt seit dem Jahr 1968 auch in einem Fragebogen Auskunft gegeben über ihre Krankheitsgeschichte und ihr Gesundheitsverhalten, ihr Bildungsniveau, Einkommen und weitere sozialstatistische Merkmale. Darüber hinaus waren verschiedene medizinische Untersuchungen bei ihnen durchgeführt worden (Blutdruck, Cholesterin usw.) und schließlich hatten sie in einem Fragebogen auch ihre Meinung über das Alter und Ältere kundgetan. Diese Einstellung wurde anhand von fünf Aussagen erfragt, zu denen man jeweils verschiedene Grade der Zustimmung oder Ablehnung ankreuzte: Es läuft schlechter, wenn man älter wird; Ich habe jetzt genau so viel Elan wie letztes Jahr; Man ist im Alter zunehmend weniger nützlich; Ich bin jetzt genau so glücklich wie ich es früher war; Wenn man älter wird, ist vieles besser als man früher gedacht hat.
Bei den Teilnehmern wurde dann im Zeitraum 1968 bis 2007 kontrolliert, ob Herz-Kreislauf-Erkrankungen auftraten. Es gab insgesamt 89 solcher Ereignisse wie Herzinfarkt oder Schlaganfall. Es zeigte sich dann, dass diese Erkrankungen umso häufiger auftraten, je negativer das Altersbild der Teilnehmer früher gewesen ist. So hatten innerhalb eines Zeitraums von 30 Jahren nur 13 Prozent derjenigen mit einem positiven Altersbild ein Herz-Kreislauf-Ereignis, aber rund doppelt so viele (25 Prozent) derjenigen mit einem ausgeprägt negativen Altersstereotyp. Dieser Zusammenhang blieb auch bestehen, wenn eine multivariaten Analyse durchgeführt wurde, bei der eine Vielzahl weiterer, auch denkbarer Einflussfaktoren mitberücksichtigt wurde: Alter, Geschlecht, Bildung, Familienstand, Body Mass Index, Rauchen, Depressivität, Selbsteinschätzung des Gesundheitszustands, chronische Erkrankungen und andere.
Die Wissenschaftler diskutieren ihre Befunde nur sehr kurz, so dass auch unklar bleibt, wie sich der Zusammenhang zwischen Altersbild und späterer Gesundheit erklären lässt. Ein Erklärungsansatz, wenngleich nicht der einzige, wurde schon in einer früheren Studie der Forschungsgruppe entdeckt: Wer ein negatives Bild vom Alter hat, zeigt auch häufiger gesundheitlich riskante Verhaltensweisen wie wenig Sport und körperliche Bewegung, ungesunde Ernährung. vgl. Becca R. Levy, Lindsey M. Myers: Preventive health behaviors influenced by self-perceptions of aging (Preventive Medicine, Volume 39, Issue 3, September 2004, Pages 625-629) Wie es scheint, würde ein negatives Altersbild bedeuten: Vom Alter erwarte ich ohnehin nur wenig Gutes, dann kann ich jetzt im jüngeren Alter auch ohne Rücksicht auf meine Gesundheit leben.
Die neuere Studie ist in der Zeitschrift "Psychological Science" online vorab veröffentlicht. In Kürze dürfte dazu auch ein kostenloses Abstract verfügbar sein: Becca R. Levy u.a.: Age Stereotypes Held Earlier in Life Predict Cardiovascular Events in Later Life (Psychological Science, Published Online: 13 Feb 2009, doi: 10.1111/j.1467-9280.2009.02298.x)
Gerd Marstedt, 25.2.09
Kapitalistische Revolution ist lebensbedrohlich - vor allem für Männer
 Einer interessanten gesellschafts- und entwicklungspolitischen Fragestellung, die nicht zuletzt in der aktuellen weltweiten Krise des Kapitalismus besondere Relevanz hat, geht eine im Januar 2009 in der britischen Fachzeitschrift Lancet erschienene Studie nach. Unter dem Titel Mass privatisation and the post-communist mortality crisis: a cross-national analysis untersuchen die britischen Wissenschaftler David Stuckler, Laurence King und Adam Coutts, den Zusammenhang zwischen der Einführung des Kapitalismus in ehemals kommunistischen Ländern und dem vielfach beobachteten, teilweise deutlichen Rückgang der Lebenserwartung insbesondere bei Männern.
Einer interessanten gesellschafts- und entwicklungspolitischen Fragestellung, die nicht zuletzt in der aktuellen weltweiten Krise des Kapitalismus besondere Relevanz hat, geht eine im Januar 2009 in der britischen Fachzeitschrift Lancet erschienene Studie nach. Unter dem Titel Mass privatisation and the post-communist mortality crisis: a cross-national analysis untersuchen die britischen Wissenschaftler David Stuckler, Laurence King und Adam Coutts, den Zusammenhang zwischen der Einführung des Kapitalismus in ehemals kommunistischen Ländern und dem vielfach beobachteten, teilweise deutlichen Rückgang der Lebenserwartung insbesondere bei Männern.
Nach dem Niedergang des Sozialismus in Osteuropa und Zentralasien vollzogen die Länder des ehemaligen Ostblocks einen jähen gesellschaftlichen Wandel und führten bereits in der ersten Hälfte der 1990er Jahre kapitalistische Strukturen ein. In dieser Zeit war vielerorts ein dramatischer Rückgang der Lebenserwartung vor allem bei Männern zu beobachten. Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF) geht von 3 Millionen vorzeitigen Todesfällen in dieser Phase aus, Die UN-Entwicklungsbehörde UNDP schätzt die Zahl der vorzeitig verstorbenen Männer sogar auf 10 Millionen. Besonders ausgeprägt war der Anstieg der Sterblichkeit aufgrund von Infektionserkrankungen - allen voran Tuberkulose - und von "Unfällen und Vergiftungen".
Anfangs führten verschiedene ExpertInnen diese besorgniserregende Tendenz auf verschiedene Ursachen wie den Zusammenbruch der Gesundheitsversorgung mit ihren Vorsorge -und Kontrollangeboten zurück. Auch die soziale Absicherung gegen gesellschaftliche Risiken brach zusammen, das Bildungssystem blieb nicht unberührt und tradierte gesellschaftliche Rollen und Zusammenhänge veränderten sich. Der gesellschaftliche Umbruch war sehr tiefgehend und erfasste andere Bereiche der Gesellschaft und Ökonomie. Auswirkungen auf den gesundheitlichen Zustand einer Bevölkerung sind unter solchen Umstände mehr als wahrscheinlich angesichts der umfangreichen empirischen Belege für den Zusammenhang nicht nur zwischen Armut, sondern auch zwischen Bildung, sozialem Kapital, Einkommensverteilung und nicht zuletzt Arbeitslosigkeit und Gesundheit.
Einen Überblick über die gesundheitlichen Folgen beispielsweise von Erwerbslosigkeit liefern die kostenfrei herunterladbaren früheren Ergebnisse der WHO-Arbeitsgruppe zu sozialen Determinanten von Gesundheit sowie der aktuelle Bericht der WHO-Kommission mit dem Titel Closing the gap in a generation. Für Deutschland vermittelt beispielsweise der vierte IAB Kurzbericht des bundeseigenen Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung mit dem Titel: Arbeitslos - Gesundheit los - chancenlos. Auf das vom IAB zusammengetragene und dort verlinkte umfangreiche Hintergrundmaterial gab bereits einen Hinweis im Forum Gesundheitspolitik.
Den primär wirtschaftlichen Ursachen veränderter Mortalitätsraten und anderer gesundheitlicher Indikatoren geht die nun veröffentlichte Studie aus Großbritannien nach. Mit Hilfe einer longitudinalen multivariaten Regressionsanalyse untersuchten die Autoren die Mortalitätsraten bei Männern im arbeitsfähigen Alter zwischen 15 und 59 Jahren. Dabei vergleichen sie die hauptsächlich zur ehemaligen Sowjetunion gehörenden Länder, welche die Schock-Therapie internationaler WirtschaftsberaterInnen und Entwicklungsbanken zur Anwendung brachten, mit solchen, die eine vorsichtigere Reform in Richtung Kapitalismus und Marktwirtschaft umsetzten. Das Kriterium für die Einordnung der Heftigkeit des kapitalistischen Umbruchs war die Privatisierung von mindestens einem Viertel der Staatsunternehmen innerhalb von zwei Jahren. Um die Effekte der Privatisierung zu isolieren, kontrollierten die Autoren dabei auch gegen andere Faktoren wie Preisentwicklung, Handelsliberalisierung, Einkommensschwankungen, Ausgangsbedingungen, strukturelle Ursachen höherer Mortalität, Demografie, Konflikte und andere mögliche Confounder.
Die Autoren fanden heraus, dass die Arbeitslosigkeit in den ehemaligen Sowjetrepubliken bei Anwendung der Schock-Therapie durchschnittlich um 61 % stärker anstieg als in den vorsichtiger privatisierenden Ländern. Ein Anstieg der Arbeitslosigkeit um 10 % war wiederum mit einem Anstieg der standardisierten männlichen Erwachsenenmortalität um 0-3 % assoziiert, wobei insbesondere in den frühen 1990er Jahren der Zusammenhang zwischen Arbeitslosigkeit und Sterblichkeit in den schnell privatisierenden Ländern doppelt so hoch war als bei schrittweisem Umbau der Wirtschaft. Als protektiv gegenüber den Unbillen des hereinbrechenden Kapitalismus erwies sich soziales Kapital in Form, denn wo zumindest annähernd die Hälfte der Bevölkerung einer gesellschaftlichen Organisation angehörte, zeigte sich kein signifikanter Zusammenhang zwischen Privatisierung und Mortalitätsraten.
Die Schlussfolgerung der Autoren ist eindeutig: "The policy implications are clear. Great caution should be taken when macroeconomic policies seek radically to overhaul the economy without considering potential effects on the population's health." Und ihre Empfehlung lautet, man sollte die Lehren aus ihren Erkenntnissen beim gesellschaftlichen und ökonomischen Umbruch für andere Länder wie China, Indien, Ägypten und nicht zuletzt Irak berücksichtigen.
Selbstverständlich werfen solche Untersuchungen etliche Fragen auf, schließlich bewegen sie sich auf einem derart komplexen Gebiet, das Vereinfachungen auch bei multivariaten Analysen unter Einbeziehung vieler Faktoren unvermeidbar macht. Auch konzentrieren sich die Autoren ausschließlich auf die veränderte Mortalität bei Männern, was zwar auf die vorrangig signifikanten Indikatoren eingeht, aber Genderaspekte unbeantwortet lässt. So wirft die Untersuchung von Stuckler, King und McKee unweigerlich die Frage auf, ob Frauen resistent gegen kapitalistische Umbrüche oder tief greifende Privatisierung sind - und wenn ja, warum? Schließlich sind gerade in der Sowjetunion mit einem hohen Anteil erwerbstätiger Frauen genauso viele weibliche Beschäftigte arbeitslos geworden, darunter auch eine Vielzahl allein erziehender Mütter, die im Prinzip sogar höheren Belastungen ausgesetzt sein müssten.
Bei allen Unsicherheiten und offenen Fragen kommt dieser Studie das unzweifelhafte Verdienst zu, gängige Denkschablonen zu hinterfragen und mit empirischen Begründungen auf solche Phänomene hinzuweisen, die wirtschaftstheoretische Analysen ebenso außer Acht zu lassen pflegen wie die Wirtschaftspolitik. Nun zeichnen sich ÖkonomInnen in der Regel nicht dadurch aus, dass sie auch nur wesentliche Erkenntnisse aus anderen Wissenschaftsdisziplinen in ihre Betrachtungen einbeziehen. Aber in Zeiten weltweiter Zweifel am den jahrelang dominierenden marktradikalen Heilslehren unterstreicht diese Untersuchung eindrücklich, das die üblicherweise angelegten Maßstäbe der Ökonomie nur einen Teil der komplexen Wirklichkeit einfangen.
Für Nicht-Abonnenten ist nur das Abstract kostenfrei zugänglich.
Über das Abstract hinausgehende englischsprachige Zusammenfassungen stehen im International Herald Tribune und in der New York Times zum Herunterladen zur Verfügung.
In der Schweizer WochenZeitschrift (WoZ) erschien zuz diesem Thema ein deutschsprachiger Beitrag, den Sie sowohl einzeln unter Lebensbedrohliche Revolution als auch im Verbund mit anderen Artikeln im WoZ-Dossier herunterladen können.
Jens Holst, 18.1.09
Selbsteinschätzung des Gesundheitszustands: Studien bestätigen wieder einmal die Zuverlässigkeit dieses Indikators
 Schon 1982 hatte eine Veröffentlichung mit Daten der sogenannten Manitoba-Studie (eine kanadischen Langzeitstudie über 7 Jahre mit knapp 3.200 Teilnehmern) festgestellt, dass die Selbsteinschätzung des Gesundheitszustands ein besserer Indikator für die zukünftige Lebenserwartung ist als medizinische Risikofaktoren, auch bei Kontrolle von sozialer Schichtzugehörigkeit, Geschlecht usw. Wer bei einer negativen ärztlichen Einstufung des Gesundheitszustands gleichwohl eine optimistische Gesundheits-Einschätzung hat, weist auch ein geringeres Sterbe-Risiko auf. Und umgekehrt: Wenn bei niedrigen medizinischen Risikofakoren gleichwohl eine negative, also pessimistische Gesundheits-Einschätzung vorlag, so ist auch das Sterbe-Risiko höher.
Schon 1982 hatte eine Veröffentlichung mit Daten der sogenannten Manitoba-Studie (eine kanadischen Langzeitstudie über 7 Jahre mit knapp 3.200 Teilnehmern) festgestellt, dass die Selbsteinschätzung des Gesundheitszustands ein besserer Indikator für die zukünftige Lebenserwartung ist als medizinische Risikofaktoren, auch bei Kontrolle von sozialer Schichtzugehörigkeit, Geschlecht usw. Wer bei einer negativen ärztlichen Einstufung des Gesundheitszustands gleichwohl eine optimistische Gesundheits-Einschätzung hat, weist auch ein geringeres Sterbe-Risiko auf. Und umgekehrt: Wenn bei niedrigen medizinischen Risikofakoren gleichwohl eine negative, also pessimistische Gesundheits-Einschätzung vorlag, so ist auch das Sterbe-Risiko höher.
Seit dieser Veröffentlichung von J.M. Mossey and E. Shapiro Self-rated health: a predictor of mortality among the elderly hat eine Vielzahl weiterer Studien diese grundsätzliche Tendenz bestätigt und eine erst 2007 veröffentlichte Meta-Analyse von 22 Studien hat gezeigt, dass die Mortalität bei einer negativen Einschätzung der Gesundheit fast doppelt so hoch war (OR 1,92) wie bei einer sehr guten Bewertung (vgl. Karen B. DeSalvo u.a.: Mortality prediction with a single general self-rated health question. A meta-analysis).
Eine jetzt in der Zeitschrift "Social Science & Medicine" veröffentlichte Verlaufsstudie über einen Zeitraum von 10 Jahren bei mehr als 22 Tausend Männern und Frauen in der englischen Stadt Norfolk hat nun gezeigt, dass der Zusammenhang zwischen Selbsteinstufung und Mortalität auch unabhängig von der jeweiligen sozialen Schichtzugehörigkeit gilt. Man könnte ja vermuten dass die Bezugsgrößen und Vergleiche, aufgrund derer jemand seine Gesundheit bewertet, in der Oberschicht anders ausfallen als in der Unterschicht. Tatsächlich zeigten sich jedoch bei den 39-79jährigen Männern und Frauen, die man in den Jahren 1993-1997 zuerst befragt und dann über einen Zeitraum von 10 Jahren weiter beobachtet hatte, keine solchen Schichtunterschiede. Das Mortalitätsrisiko lag - bei Kontrolle von Alter und Geschlecht - über alle Sozialschichten hinweg 4,35mal so hoch wie bei sehr ungünstiger Selbsteinschätzung.
Hier ist ein Abstract: E. McFadden u.a.: Does the association between self-rated health and mortality vary by social class? (Social Science & Medicine, Article in Press, Corrected Proof, doi:10.1016/j.socscimed.2008.10.012)
Im International Journal of Epidemiology, Volume 36, Number 6, December 2007 waren allerdings mehrere Studien veröffentlicht worden, die zwar den Zusammenhang zwischen Selbsteinstufung des Gesundheitszustands und Sterblichkeit bestätigten, dabei teilweise aber einen modifizierenden Einfluss der Schichtzugehörigkeit fanden. Diese Studien mit Daten aus den USA, Frankreich und den Niederlanden kamen u.a. zu dem Schluss, dass Oberschicht-Angehörige - mit höherem Bildungsniveau und profunderen medizinischen Kenntnissen - möglicherweise eine zuverlässigere Bewertung ihres Gesundheitszustands abgeben, so dass hier der Zusammenhang zum Mortalitätsrisiko auch deutlicher ausfällt. Vgl. als Zusammenfassung der drei Studien das Editorial Amélie Quesnel-Vallée: Self-rated health: caught in the crossfire of the quest for 'true' health? (International Journal of Epidemiology 2007 36(6):1161-1164; doi:10.1093/ije/dym236)
Gerd Marstedt, 3.1.09
Netzwerke als Erklärung gesundheitlicher Unterschiede - Einführung des Sozialen in die Medizin oder nur statistische Mängel?
 Die Wissenschaftler Nicholas Christakis von der Harvard Medical School und James Fowler von der Universität von Kalifornien in San Diego haben jetzt zum dritten Mal Befunde aus der sogenannten Framingham-Studie veröffentlicht, mit denen sie zu dem allgemeinen Fazit kommen: Eine Vielzahl gesundheitlicher Merkmale und Verhaltensweisen ist in sehr starkem Maße durch soziale Normen im Netzwerk einer Person verursacht. Die Framingham-Herz-Studie ist benannt nach einer Kleinstadt aus dem US-Bundesstaat Massachusetts, in der die Einwohner seit dem Jahr 1948 in regelmäßigen Abständen zu ihrem Gesundheitszustand und ihrem Lebensstil befragt wurden. Ziel ist es, Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen näher zu bestimmen.
Die Wissenschaftler Nicholas Christakis von der Harvard Medical School und James Fowler von der Universität von Kalifornien in San Diego haben jetzt zum dritten Mal Befunde aus der sogenannten Framingham-Studie veröffentlicht, mit denen sie zu dem allgemeinen Fazit kommen: Eine Vielzahl gesundheitlicher Merkmale und Verhaltensweisen ist in sehr starkem Maße durch soziale Normen im Netzwerk einer Person verursacht. Die Framingham-Herz-Studie ist benannt nach einer Kleinstadt aus dem US-Bundesstaat Massachusetts, in der die Einwohner seit dem Jahr 1948 in regelmäßigen Abständen zu ihrem Gesundheitszustand und ihrem Lebensstil befragt wurden. Ziel ist es, Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen näher zu bestimmen.
Die Netzwerkstudien von Christakis und Fowler hatten unterschiedliche Themen: In der ersten Veröffentlichung wurde die Verbreitung von Übergewicht und Adipositas im sozialen Netzwerk einer Person näher untersucht (vgl. Ganz dicke Freundschaften - Übergewicht wird beeinflusst von Normen im sozialen Netzwerk einer Person). Es zeigte sich, dass das Übergewichts-Risiko um bis zu 171 Prozent höher liegt, wenn engere Freunde eines Untersuchungsteilnehmers ebenfalls übergewichtig sind. Die Ergebnisse können nach Ansicht der Forscher nicht gedeutet werden nach dem Motto "Gleich und gleich gesellt sich gern". Es ist also nicht so, dass Übergewichtige sich nun einen Freundeskreis aussuchen, der sich aus Personen mit ebenfalls größerer Körperfülle zusammensetzt. Interpretiert wird der Befund vielmehr als Effekt der Verbreitung von Normen und Wertmaßstäben in sozialen Netzwerken.
Nach dieser Untersuchung beobachteten die Forscher dann ein ähnliches Phänomen bei Rauchern bzw. bei Personen, die mit dem Rauchen aufhören wollten: Die Erfolgschancen einer Nikotinabstinenz hingen sehr stark davon ab, ob andere Menschen im sozialen Umfeld es ebenfalls geschafft hatten (vgl: Gesundheit steckt an - Nichtrauchen kein einsamer Entschluss).
Die aktuelle Studie nun stellt das Thema der Lebensfreude oder des Glücklichseins in den Mittelpunkt. Befragt wurden in den Jahren 1983 bis 2003 rund 4.700 Personen, und zwar, ob sie hoffnungsvoll in die Zukunft blicken, sich glücklich fühlen, das Leben genießen und sich ebenso gut wie andere Menschen fühlen. Erfasst wurde überdies - wie auch schon in den Studien zuvor - Kontakthäufigkeit und -intensität zu anderen Studienteilnehmern: Freunden, Kollegen, Nachbarn, Verwandten. Ergebnis auch dieser Analysen war dann: "Happiness" verbreitet sich nahezu virusartig im Netzwerk einer Person, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand intensive Lebensfreude genießt, steigt an, wenn auch der Ehepartner, ein Nachbar oder eine Schwester sich so fühlt.
Diese letzte Veröffentlichung ist nun auf massive Kritik gestoßen. In derselben Ausgabe des British Medical Journal vom 3.1.2009 findet sich auch ein Artikel der Wissenschaftler Fletcher und Cohen-Cole von der Yale Universität in New Haven, der die Befunde von Christakis und Fowler als Effekt unzureichender methodischer Vorgehensweisen kritisiert. Bekanntlich findet man in vielen wissenschaftlichen Studien, die Zusammenhänge zwischen bestimmten Risikofaktoren und Krankheiten untersuchen, auch sogenannte "Confounder" (Störfaktoren), Merkmale, die zwar auch in Beziehung mit einem anderen Merkmal stehen, aber nicht ursächlich sind. Starke Raucher zum Beispiel erkranken auch häufiger an Leberzirrhose, ursächlich dafür ist jedoch, dass starke Raucher auch häufiger Alkohol trinken als Nichtraucher.
Cohen-Cole und Fletcher untersuchten nun an einer anderen Längsschnittstudie (der National Longitudinal Study of Adolescent Health) mit ähnlichen Analysemethoden wie Christakis und Fowler, wie sich bestimmte Merkmale im Netzwerk der Personen zeigen. Diese Merkmale waren die Betroffenheit von Akne, die Körpergröße und das Auftreten von Kopfschmerzen. Tatsächlich zeigte sich auch hier für alle drei Merkmale: Wenn engere Kontaktpersonen im Netzwerk einer Person betroffen sind, ist auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass die Person selbst betroffen ist. Lässt sich dies noch bei Akne und Körpergröße noch dem Motto "Gleich und gleich gesellt sich gern" erklären, so versagt diese Interpretation beim Merkmal der häufigen Betroffenheit von Kopfschmerzen. Fletcher führte deshalb sogenannte multivariate Analysen durch, in der eine Vielzahl potentieller Einflussfaktoren gleichzeitig untersucht wird. Tatsächlich zeigte sich dann, dass bei Berücksichtigung einiger "Umgebungsvariablen" (wie Geschlecht, Alter, Rasse, Bildungniveau der Mutter, eigenes Bildungsniveau, Haushaltseinkommen) die Zusammenhänge auf schlichte und bereits bekannte Faktoren zurückzuführen sind, ohne dass deshalb das soziale Netzwerk bemüht werden muss.
Alle Studien sind im Volltext kostenlos verfügbar:
• Verbreitung von Adipositas im Netzwerk: Nicholas A. Christakis, James H. Fowler: The Spread of Obesity in a Large Social Network over 32 Years (NEJM 2007; 357: 370-379)
• Nikotinverzicht: Nicholas A. Christakis, James H. Fowler: The Collective Dynamics of Smoking in a Large Social Network (NEJM 2008; 358: 2249-2258)
• Lebensfreude: Nicholas A. Christakis, James H. Fowler: Dynamic spread of happiness in a large social network: longitudinal analysis over 20 years in the Framingham Heart Study (BMJ 2008;337:a2338)
• Kritik von Cohen-Cole/Fletcher, Studie zu Akne, Kopfschmerzen, Körpergröße: Ethan Cohen-Cole, Jason M Fletcher: Detecting implausible social network effects in acne, height, and headaches: longitudinal analysis (BMJ 2008;337:a2533, doi:10.1136/bmj.a2533)
Gerd Marstedt, 2.1.09
Der Mond hat keinen Einfluss auf die Zahl der Geburten - wohl aber Klinikärzte durch künstliche Einleitung von Geburten
 Erneut hat ein Wissenschaftler gezeigt, dass der Mond keinen Einfluss hat auf die Zahl der Geburten. Oliver Kuß, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Medizinischen Fakultät in Halle-Wittenberg analysierte mehr als vier Millionen Geburten (genau genommen: 4.071.669) zwischen 1966 und 2003 in Baden-Württemberg. Die Untersuchung hat damit weltweit die größte Anzahl durchlaufener Mondzyklen überprüft, in 37 Jahren 470 Mondzyklen. Eine Häufung der Geburtsquote bei Vollmond oder Neumond oder anderen Stadien im Mondzyklus fand sich nicht.
Erneut hat ein Wissenschaftler gezeigt, dass der Mond keinen Einfluss hat auf die Zahl der Geburten. Oliver Kuß, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Medizinischen Fakultät in Halle-Wittenberg analysierte mehr als vier Millionen Geburten (genau genommen: 4.071.669) zwischen 1966 und 2003 in Baden-Württemberg. Die Untersuchung hat damit weltweit die größte Anzahl durchlaufener Mondzyklen überprüft, in 37 Jahren 470 Mondzyklen. Eine Häufung der Geburtsquote bei Vollmond oder Neumond oder anderen Stadien im Mondzyklus fand sich nicht.
Über den Einfluss des Mondes auf Geburt und Schwangerschaft gibt es zahlreich verbreitete Vorurteile: bei Mondwechsel sollen besonders viele Kinder zur Welt kommen oder wenn bei zunehmendem Mond der Bauchumfang der Mutter mehr als 100 Zentimeter beträgt, soll die Geburt unmittelbar bevorstehen.
Doch diese volkstümlichen Vorurteile über den Mond halten einer wissenschaftlichen Analyse bislang nicht stand. Die Hallesche Studie widerlegte einen Einfluss des Mondes auf die Zahl der Geburten: "Einen Mondzyklus konnte ich bei der Analyse der Daten nicht feststellen", erklärte der Wissenschaftler.
Feststellen konnte er jedoch eine Häufung an bestimmten Wochentagen. Statistisch wurden montags und dienstags die meisten und am Wochenende die wenigsten Kinder geboren. Eine mögliche Ursache: Künstlich eingeleitete Geburten werden in den Kliniken von den Wochenenden weg und auf den Montag oder Dienstag gelegt. Ein Häufungseffekt war auch feststellbar für die Monate im Jahr: Ende September kommen die meisten Kinder zur Welt: "Dies spricht für eine Zeugung in den Weihnachtsferien oder zumindest in der dunklen Jahreszeit", erklärte Dr. Kuß.
Veröffentlicht wurde die Studie in der Fachzeitschrift "Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica": Lunar cycle and the number of births: A spectral analysis of 4,071,669 births from South-Western Germany
Zuvor hatten schon andere Wissenschaftler mögliche Effekte des Mondzyklus (Vollmond, Neumond) auf Lebensereignisse überprüft. Australische Forscher konnten keinen Einfluss feststellen für die Zahl der Geburten oder Todesfälle in Australien zwischen 1975 und 2003: Joshua S. Gans and Andrew Leigh: Does the Lunar Cycle Affect Birth and Deaths?. Und ein Forschungsteam in North-Carolina analysierte noch mehr Ereignisse: Zahl der Geburten, Geburtsmethode, Komplikationen, Geburt von Mehrlingen. Auch hier fand sich jedoch kein Zusammenhang zum jeweiligen Stand im Mondzyklus: J. Arliss , E. Kaplan , S. Galvin: The effect of the lunar cycle on frequency of births and birth complications
Eine Reihe von Vorurteilen über den Einfluss des Mondes wird in einem Aufsatz von FOCUS online diskutiert. Ob Alkoholismus oder Kriminalität, epileptische Anfälle oder Komplikationen bei Operationen - wissenschaftliche Belege, dass diese Ereignisse durch den Mond beeinflusst werden, gab es bislang nicht: Beeinflusst der Mond den Menschen? (Focus Online, 2.11.2007)
Noch detaillierter und umfassender hat der Soziologe und Mondforscher Edgar Wunder das Phänomen untersucht. In seiner "Kommentierten Literaturliste: Mondeinflüsse" diskutiert er eine Reihe von Effekten, die sich tatsächlich bestätigt haben, zum Beispiel im Hinblick auf Verhaltensweisen im Tierreich. Für das menschliche Verhalten, so bilanziert Wunder allerdings, "gehören die allermeisten der behaupteten Mondeinflüsse nur dem Reich der Legenden an." Und dies gilt auch für Komplikationen bei Operationen: Gesellschaft für Anomalistik: Studie des Monats
Gerd Marstedt, 26.11.08
Erhöhtes Asthmarisiko für geplante und Notfall-Kaiserschnittgeborene
 Vor allem bei Kaiserschnittgeburten per Wunsch oder Plan sind sich die betreffenden Eltern und ihre Ärzte meist sicher, dass es sich um eine doch relativ normale, nur etwas beschleunigte und belastungsfreiere aber keineswegs mit gravierenden unerwünschten Folgen für Mutter und/oder Kind verbundene Entbindungsmethode handelt.
Vor allem bei Kaiserschnittgeburten per Wunsch oder Plan sind sich die betreffenden Eltern und ihre Ärzte meist sicher, dass es sich um eine doch relativ normale, nur etwas beschleunigte und belastungsfreiere aber keineswegs mit gravierenden unerwünschten Folgen für Mutter und/oder Kind verbundene Entbindungsmethode handelt.
Angesichts der auch in Deutschland deutlichen anwachsenden Häufigkeit von Kaiserschnittgeburten sollten Ergebnisse, die diese verharmlosende Einstellung irritieren oder massiv widerlegen, mit erhöhter Aufmerksamkeit zur Kenntnis genommen werden.
Dies gilt dann auch für die Ergebnisse des im Juli 2008 in der Fachzeitschrift "The Journal of Pediatrics" (Volume 153, Issue 1: 112-116) veröffentlichten Aufsatzes "Cesarean Section and Risk of Severe Childhood Asthma: A Population-Based Cohort Study" von Tollanes MC, Moster D. Daltveit AK und Irgens LM.
Ausgangspunkt dieser Studie war die Beobachtung einer in Norwegen, wie in anderen westlichen Ländern, parallelen Zunahme der Prävalenz von Kinderasthma und der Rate von Kaiserschnitten. In Norwegen stieg die Kaiserschnittrate von 2% in 1967 auf 15,4% in 2004 und dem folgte in etwa die Häufigkeit des Asthams von Kindern.
Die Ergebnisse beruhen auf einer Auswertung der Daten von 1.756.700 Millionen im "Medical Birth Registry" des Public Health-Instituts Norwegens in der Zeit von 1967 bis 1998 registrierten Erst-Geburtsfälle bzw. Erstgeborenen. Die gesundheitliche Entwicklung und die Behandlungsgeschichte wurde für jeden Teilnehmer bis zu seinem 18. Lebensjahr oder bis zum Jahr 2002 dokumentiert. Die Teilnehmer wurden nach der Art der Geburt unterschieden, d.h. ob sie spontan oder mittels Instrumenten (z.B. Saugglocke) vaginal oder als Notfall oder geplant per Kaiserschnitt geboren wurden. Bei den Teilnehmern wurde gezielt mit Daten der Nationalen Krankenversicherung nach dem Auftreten von Asthma gesucht.
Die kumulative Inzidenz (Neuauftreten) von Asthma betrug insgesamt 4 Fälle pro 1.000 Personen. Kinder, die mit einem Kaiserschnitt entbunden worden waren, hatten ein um 52 % erhöhtes Risiko an Asthma zu erkranken als spontan vaginal, also "natürlich" zur Welt gekommene Kinder bzw. im weiteren Zeitverlauf junge Erwachsene. Das Auftreten von Asthma unterschied sich für die zwischen 1988 und 1998 (nur in diesem Zeitraum wurde nach Notfall- und Plan-Kaiserschnitt unterschieden) per Kaiserschnitt geborenen Personen nochmals deutlich: Notfall-Kaiserschnittgeborene hatten gegen "natürlich" Geborene ein um 59% und Plan-Kaiserschnittgeborene ein um 42% erhöhtes Asthmarisiko. Kinder, die z. B. mit einer Saugglocke geboren wurden, hatten ein leicht erhöhtes Asthmarisiko.
Woran das spürbar höhere Risiko von Kindern, die per Kaiserschnitt auf die Welt kamen, an Asthma zu erkranken liegen könnte, führen die Forscher auf zwei Faktoren zurück:
• Erstens sind Kaiserschnittkinder während der Entbindung nicht den mütterlichen Bakterien im natürlichen Geburtskanal ausgesetzt, die eine wesentliche Funktion bei der Herausbildung und Stärke des kindlichen Immunsystems spielen. Die "initial colonization with the 'wrong' microbes" des Operationssaales bei Kaiserschnittgeburten kann langfristig unerwünschte Auswirkungen auf das kindliche Immunsystem haben.
• Zweitens bewirken bestimmte Bedingungen einer Kaiserschnittentbindung (z.B. eine unvollkommene Entleerung der kindlichen Lungen von bestimmten Gasen) eine Reihe von Atmungsprobleme, die wiederum langfristige Auswirkungen auf das Auftreten von Asthma haben können. Warum Kinder, die per Notfall-Kaiserschnitt entbunden wurden eine höhere Asthmainzidenz haben als per Plan operativ Geborene, ist allerdings mit diesen Theorien nicht zu erklären.
Wie viele anderen methodisch ähnlichen Studien leidet auch diese darunter, dass sie trotz des großen Aufwandes keine weiteren möglichen Risikofaktoren für Asthma berücksichtigt hat. Für eine jüngere Vermutung eines Zusammenhangs von Asthma und Stillen gab es nach Angaben der norwegischen Forscher keine überzeugende empirische Evidenz. Ähnliches trifft auf mögliche Zusammenhänge mit dem Rauchverhalten der Eltern oder für eine nicht berücksichtigte Asthmaerkrankung der Mutter zu. Zu diesen bereits von Tollanes et al. konzedierten Lücken käme noch der soziale Status oder die Wohngegend der heranwachsenden Kinder hinzu, die in anderen Studien auch als mögliche Einflussfaktoren identifiziert wurden.
Trotz allem liefert die Studie wichtige Hinweise auf das Asthmarisikos für Kaiserschnitt-Kinder, das insbesondere bei geplanten Kaiserschnittgeburten ernsthaft thematisiert und abgewogen werden sollten.
Über die Ergebnisse des Aufsatzes "Cesarean Section and Risk of Severe Childhood Asthma: A Population-Based Cohort Study" von Tollanes MC, Moster D. Daltveit AK und Irgens LM gibt es sowohl einAbstract als auch ein 6-seitige Komplettfassung- beide kostenlos.
Bernard Braun, 16.11.08
IG Nobel Preise 2008: Striptease-Tänzerinnen bekommen an ihren fruchtbaren Tagen im Zyklus erheblich mehr Trinkgeld
 Wieder einmal wurde jetzt vom Magazin "Annals of Improbable Research" und Mitgliedern der Universitäten von Harvard und Radcliffe der alternative Nobelpreis vergeben, oder genauer der gemeine Nobelpreis. Der Name für diesen seit 1991 vergebenen "Ig® Nobel Prize" beruht nämlich auf einem Wortspiel mit dem englischen Begriff "ignobel" (gemein, unedel, schändlich, unwürdig). Prämiert werden wissenschaftliche Arbeiten, die bereits in angesehenen Zeitschriften veröffentlicht wurden und bei denen Leute "erst zum Lachen und dann zum Nachdenken bewegt werden". Über die Preisträger 2007 berichteten wir bereits: "Fröhliche Wissenschaft" oder über welche gesundheitsbezogenen Probleme endlich mal geforscht worden ist!.
Wieder einmal wurde jetzt vom Magazin "Annals of Improbable Research" und Mitgliedern der Universitäten von Harvard und Radcliffe der alternative Nobelpreis vergeben, oder genauer der gemeine Nobelpreis. Der Name für diesen seit 1991 vergebenen "Ig® Nobel Prize" beruht nämlich auf einem Wortspiel mit dem englischen Begriff "ignobel" (gemein, unedel, schändlich, unwürdig). Prämiert werden wissenschaftliche Arbeiten, die bereits in angesehenen Zeitschriften veröffentlicht wurden und bei denen Leute "erst zum Lachen und dann zum Nachdenken bewegt werden". Über die Preisträger 2007 berichteten wir bereits: "Fröhliche Wissenschaft" oder über welche gesundheitsbezogenen Probleme endlich mal geforscht worden ist!.
Auch bei den jetzt wieder in 10 Rubriken prämierten neuen Arbeiten kommt beim Leser neben Erstaunen und Verblüffung auch wieder Nachdenklichkeit auf.
• In der Rubrik "Ökonomie" konnten Geoffrey Miller, Joshua Tyber und Brent Jordan von der University of New Mexico aufzeigen, dass es a) ökonomische Gesetzmäßigkeiten gibt, die vom weiblichen Menstruationszyklus abhängen und dass b) dieser Zyklus auch heute noch unser Sozialverhalten bestimmt. In ihrer Studie trugen 18 weibliche Striptease-Tänzerinnen 60 Tage lang auf einer Website verschiedene Angaben ein: Zeitpunkt ihres Zyklus, Dauer der Arbeitsschicht, Höhe des Trinkgelds. In der Auswertung der Daten zeigte sich dann ein statistisch hochsignifikant er Zusammenhang: An den fruchtbaren Tagen bekamen die Damen weit mehr Trinkgeld (im Durchschnitt 335 $) als etwa während der späteren, sog. lutealen Phase des weiblichen Zyklus (260 $), und während der Menstruation war das Trinkgeld besonders gering (185 $). Bei Frauen, die die Pille nahmen, konnten die Wissenschaftler keinen vergleichbaren Zusammenhang feststellen. Offen geblieben ist für die Wissenschaftler, ob Männer auch den Zeitpunkt des Zyklus riechen oder anderweitig wahrnehmen und entsprechend darauf reagieren (mit größeren Lockangeboten an fruchtbaren Tagen) oder ob die Frauen sich an unterschiedlichen Tagen ihres Zyklus auch anders verhalten. Die Studie ist hier im Volltext nachzulesen: Geoffrey Miller u.a.: Ovulatory cycle effects on tip earnings by lap dancers: economic evidence for human estrus? (Evolution and Human Behavior, Volume 28, Issue 6, Pages 375-381, November 2007)
• Diese Striptease-Studie hätte statt in der Kategorie Ökonomie zweifellos auch im Bereich Medizin prämiert werden können. Hier setzte sich jedoch eine andere Arbeit durch, über die wir im Forum Gesundheitspolitik auch schon berichtet haben: Teure Placebo-Pillen werden im Experiment weitaus besser bewertet als billige. Deutlich geworden war in dieser Studie, über die in der renommierten Zeitschrift JAMA ein Bericht erschienen war, dass Versuchsteilnehmer die Wirkung eines Medikaments sehr stark vom Preis abhängig machen. Obwohl zwei Gruppen gleichermaßen wirkungslose Placebos erhalten hatten, wobei nur der Preis einmal mit 2,50 Dollar und einmal mit 10 Cent angegeben wurde, bewerteten die Teilnehmer das teurere Placebo-Medikament erheblich besser.
• Schließlich sei auch noch kurz berichtet über den IG Nobel-Preis für Ernährung: Die Wissenschaftler Massimilian Zampini und Charles Spence von der University of Oxford hatten experimentiert, ob man den wahrgenommenen Geschmack von Kartoffelchips nur dadurch beeinflussen kann, dass man das Geräusch verändert, das beim Zerbeißen entsteht. Und tatsächlich gelang es ihnen: Man muss lediglich, so die Wissenschaftler, die beim Zerbeißen entstehenden hohen Töne (im Bereich 2-20 KHz) verstärken oder die gesamte Lautstärke durch entsprechende Komposition der Chip-Bestandteile erhöhen. In diesen Fällen wird dann nur aufgrund akustischer Eindrücke auch der Geschmack der Chips als frischer, knackiger und leckerer bewertet. Hier ist das Abstract zur Studie: Massimiliano Zampini, Charles Spence: The Role of Auditory Cues in Modulating the Perceived Crispness and Staleness of Potato Chips (Journal of Sensory Studies, 2005, Volume 19 Issue 5, Pages 347 - 363)
• Eine deutschsprachige Zusammenfassung auch der weiteren Auszeichnungen für 2008 findet man hier bei "spektrumdirekt.de": Ig-Nobelpreise 2008: Striptease für die Forschung
• Die Original-Seite des Preisverleihers "Improbable Research" mit allen Preisträgern seit 1991 ist hier zu finden: Winners of the Ig® Nobel Prize - For achievements that first make people LAUGH then make them THINK
Gerd Marstedt, 4.10.2008
Finnland: Preissenkung für alkoholische Getränke führt zu massivem Anstieg der alkoholbedingten Todesfälle
 Eine große epidemiologische Studie, die sämtliche Einwohner Finnlands im Alter über 14 Jahren einbezog, hat jetzt gezeigt, dass die dort im Jahr 2004 umgesetzte deutliche Senkung der Preise für alkoholische Getränke zu einem Anstieg der alkoholbedingten Todesfälle geführt hat. Dieser Anstieg betrug 16 Prozent bei Männern und 31 Prozent bei Frauen. Die Autoren der Studie, die jetzt in der Zeitschrift "American Journal of Epidemiology" veröffentlicht wurde, analysierten Mortalitäts-Daten von über 4 Millionen Finnen, und zwar in zwei Zeiträumen: 2001-2003 und 2004-2005.
Eine große epidemiologische Studie, die sämtliche Einwohner Finnlands im Alter über 14 Jahren einbezog, hat jetzt gezeigt, dass die dort im Jahr 2004 umgesetzte deutliche Senkung der Preise für alkoholische Getränke zu einem Anstieg der alkoholbedingten Todesfälle geführt hat. Dieser Anstieg betrug 16 Prozent bei Männern und 31 Prozent bei Frauen. Die Autoren der Studie, die jetzt in der Zeitschrift "American Journal of Epidemiology" veröffentlicht wurde, analysierten Mortalitäts-Daten von über 4 Millionen Finnen, und zwar in zwei Zeiträumen: 2001-2003 und 2004-2005.
Anfang 2004 war nämlich in Finnland zu beobachten, dass die Preise für alkoholische Getränke merklich billiger waren als zuvor. Dies lag an zwei Gründen: Zum einen war es ab Januar 2004 den Bürgerinnen und Bürgern erlaubt, sich aus anderen EU-Ländern in unbegrenztem Umfang alkoholische Getränke für den persönlichen Bedarf zu beschaffen. Die Preise hierfür lagen in Nachbarländern - wie insbesondere Estland - ganz erheblich unter dem finnischen Niveau. Zum anderen wurden im März 2004 die Alkoholsteuern um durchschnittlich etwa 33% gesenkt. Dies bewirkte sinkende Preise für beispielsweise Wein um 3%, Bier um 13% und andere alkoholische Getränke um 17-25%.
Diese Preissenkungen führten zu einem Anstieg des Alkoholkonsums in Finnland. Im Jahr 2003 hatte jeder Finne im Durchschnitt 9,4 Liter Alkohol getrunken. Ein Jahr später, nachdem die Preise für Alkohol im Jahr 2004 also spürbar gefallen waren, stieg diese Menge um 10 Prozent und 2005 um weitere 2 Prozent. Die Wissenschaftler analysierten dann Daten für alkoholbedingte Todesfälle, worunter sowohl akute wie auch chronische Krankheiten fielen, die Leberzirrhose ist die bekannteste chronische Erkrankung in diesem Zusammenhang.
Es zeigte sich dann im Vergleich der Zeiträume 2001-2003 und 2004-2005, dass diese Todesfälle um 16% bei Männern und um 31% bei Frauen angestiegen waren. Besonders deutliche Steigerungsraten ergaben sich für Todesfälle durch Leberzirrhose. Dieser Anstieg betrug bei Männern 38 Prozent und bei Frauen 41 Prozent. Die Wissenschaftler überprüften auch, ob sich bei bestimmten Bevölkerungsgruppen besonders auffällige Veränderungen zeigten. Tatsächlich war dies der Fall: Die Sterblichkeit zeigte besonders große Anstiege bei Langzeitarbeitslosen und Rentnern.
Die Autoren fassen ihre Ergebnisse dann so zusammen: "Hohe Preise für alkoholische Getränke haben durchaus eine wirksame Schutzfunktion bei Alkoholproblemen für jene Bevölkerungsgruppen, die am schlechtesten dran sind." Gegen das Argument, dass eine Leberzirrhose erst nach einem langjährigen Zeitraum des Alkoholabusus entsteht und ihre eher kurzfristigen Beobachtungszeiträume daher nicht beweiskräftig sind, führen sie ins Feld, dass andere Studien gezeigt haben, dass sich auch kurzfristige Erhöhungen der Alkoholmenge bemerkbar machen. "Man kann hierfür das Bild des Wasserglases verwenden", argumentieren sie, "bei jenen, die an Leberzirrhose während des kurzen Zeitraums nach der Preissenkung starben, war das Wasserglas schon fast randvoll und die dann höhere Verzehrmenge brachte es sehr schnell zum Überlaufen."
Hier ist ein Abstract der Studie: Kimmo Herttua u.a.: Changes in Alcohol-Related Mortality and its Socioeconomic Differences After a Large Reduction in Alcohol Prices: A Natural Experiment Based on Register Data (American Journal of Epidemiology, published online on August 20, 2008, doi:10.1093/aje/kwn216)
Gerd Marstedt, 6.9.2008
Der traditionelle Fahrradsattel mit Nase führt zu Erektionsstörungen und Gefühlsbeeinträchtigungen im Genitalbereich
 "Die Nase des Fahrradsattels entfernen, um den Penis zu schützen" - dies ist der etwas ungewöhnliche Titel einer jetzt veröffentlichten wissenschaftlichen Studie über gesundheitliche Negativeffekte des traditionellen Fahrradsattels und Positiverfahrungen US-amerikanischer Polizisten mit einem anderen, runden Satteltyp. Schon früher hatten Studien gezeigt, dass Fahrradfahrer im Vergleich zu anderen Sportlern nachts sehr viel seltener spontane Erektionen haben und auch häufiger über Erektionsstörungen klagen. In einem Editorial in der Zeitschrift "Journal of Sexual Medicine" fasst der Wissenschaftler Irwin Goldstein den Forschungsstand über die bisherigen Befunde zusammen, die allesamt andeuten: Der traditionelle und fast von jedem Fahrradfahrer benutzte Sattel mit einer Nase vorne, führt oftmals zu gesundheitlichen oder sexuellen Beeinträchtigungen. (vgl.: The A, B, C's of The Journal of Sexual Medicine: Awareness, Bicycle Seats, and Choices).
"Die Nase des Fahrradsattels entfernen, um den Penis zu schützen" - dies ist der etwas ungewöhnliche Titel einer jetzt veröffentlichten wissenschaftlichen Studie über gesundheitliche Negativeffekte des traditionellen Fahrradsattels und Positiverfahrungen US-amerikanischer Polizisten mit einem anderen, runden Satteltyp. Schon früher hatten Studien gezeigt, dass Fahrradfahrer im Vergleich zu anderen Sportlern nachts sehr viel seltener spontane Erektionen haben und auch häufiger über Erektionsstörungen klagen. In einem Editorial in der Zeitschrift "Journal of Sexual Medicine" fasst der Wissenschaftler Irwin Goldstein den Forschungsstand über die bisherigen Befunde zusammen, die allesamt andeuten: Der traditionelle und fast von jedem Fahrradfahrer benutzte Sattel mit einer Nase vorne, führt oftmals zu gesundheitlichen oder sexuellen Beeinträchtigungen. (vgl.: The A, B, C's of The Journal of Sexual Medicine: Awareness, Bicycle Seats, and Choices).
In derselben Ausgabe der Zeitschrift wird das Thema noch einmal aufgegriffen, und zwar anhand einer neueren Studie, an der rund 90 Polizisten aus amerikanischen Großstädten teilnahmen, die zumeist mit Fahrädern ihren Dienst versehen und dabei im Durchschnitt etwa 24 Stunden pro Woche auf ihrem Rad sitzen. Diese Studienteilnehmer füllten zu Beginn und später nach 6 Monaten noch einmal einen Fragebogen aus, in dem sie detailliert Auskunft gaben über Häufigkeit und Anlass von Erektionsproblemen. Darüber hinaus wurden auch verschiedene medizinische Messungen bei den Polizisten durchgeführt, zum Beispiel über Druck- und Taubheitsempfindungen im Urogenitalbereich und ähnliches mehr.
Die Polizisten hatten ihren Dienst bislang mit einem Fahrrad verrichtet, das den üblichen Sattel mit einer Nase vorne hatte. Für die Studie wurde ihnen nun ein runder Sattel ohne Nase zur Verfügung gestellt. 6 Monate lang sollten sie ausschließlich diesen Sattel nutzen. Dem kamen auch alle Studienteilnehmer nach. Nach der Halbjahres-Phase wurden die Polizisten dann gefragt, ob sie den runden Sattel behalten oder zu ihrem alten Nasen-Sattel zurückkehren wollten. Es zeigte sich: 87 der insgesamt 90 Teilnehmer wollten den runden Sattel behalten, nur 3 wollten zu dem alten, gängigen Satteltyp zurückkehren.
Anfänglich, so berichten die Forscher, hatten viele Studienteilnehmer Vorbehalte gegenüber dem nasenlosen Sattel geäußert: Man könne damit nicht schnell fahren, würde das Gleichgewicht verlieren, könne nicht gefahrlos bremsen und laufe Gefahr, vom Sattel zu rutschen und mit den Genitalien schmerzhaft auf der oberen Fahrad-Stange zu landen. Tatsächlich brauchten alle Studienteilnehmer ein wenig Eingewöhnungszeit. Nach Ende der Studie waren jedoch alle von den Vorzügen des runden Sattels überzeugt.
Darüber hinaus zeigte sich in Befragungen und Messungen des 6-monatigen Feldversuchs mit dem runden Sattel:
• Unangenehme Druckgefühle im Bereich des Damms waren um 66 Prozent zurück gegangen.
• Die Empfindungs-Sensibilität im Penis war signifikant besser geworden.
• Erektionsstörungen waren deutlich zurück gegangen aufgrund eines besseren Blutdurchflusses.
• Die Quote derjenigen , die keine Parästhesie-Empfindungen in den letzten 6 Monaten hatten (unangenehme, bisweilen schmerzhafte Körperempfindung mit Kribbeln, Taubheit, Einschlafen der Glieder etc.) war von 27% auf 82% gestiegen.
Hier ist ein Abstract der Studie: Steven M. Schrader u.a.: Cutting Off the Nose to Save the Penis (Journal of Sexual Medicine 2008;5:1932-1940. doi: 10.1111/j.1743-6109.2008.00867.x)
Gerd Marstedt, 17.8.2008
Haben glückliche Menschen auch eine höhere Lebenserwartung? Ergebnisse einer Metaanalyse von 30 Längsschnittstudien
 Dass seelisches Befinden und körperliche Gesundheit sehr eng miteinander zusammenhängen, weiß nicht nur der Volksmund, sondern ist auch durch die Psychosomatische Medizin in vielen Studien eindrucksvoll gezeigt worden. Sogar die Betroffenheit von chronischen Erkrankungen und die Lebenserwartung soll davon abhängig sein, wie glücklich oder zufrieden sich Menschen fühlen. Unklar bleibt hier freilich die Kausalität der Zusammenhänge: Sind Menschen glücklicher, weil sie gesund sind? Oder bleiben sie gesund, weil sie sich glücklich fühlen? Um diesen Fragen ein wenig intensiver auf den Grund zu gehen, hat der an der Universität Rotterdam tätige Sozialwissenschaftler Ruut Veenhoven eine systematische Sichtung schon veröffentlichter Studien über den Zusammenhang Glücklichsein - Gesundheit durchgeführt. Die Meta-Analyse wurde jetzt in der Zeitschrift "Journal of Happiness Studies" veröffentlicht.
Dass seelisches Befinden und körperliche Gesundheit sehr eng miteinander zusammenhängen, weiß nicht nur der Volksmund, sondern ist auch durch die Psychosomatische Medizin in vielen Studien eindrucksvoll gezeigt worden. Sogar die Betroffenheit von chronischen Erkrankungen und die Lebenserwartung soll davon abhängig sein, wie glücklich oder zufrieden sich Menschen fühlen. Unklar bleibt hier freilich die Kausalität der Zusammenhänge: Sind Menschen glücklicher, weil sie gesund sind? Oder bleiben sie gesund, weil sie sich glücklich fühlen? Um diesen Fragen ein wenig intensiver auf den Grund zu gehen, hat der an der Universität Rotterdam tätige Sozialwissenschaftler Ruut Veenhoven eine systematische Sichtung schon veröffentlichter Studien über den Zusammenhang Glücklichsein - Gesundheit durchgeführt. Die Meta-Analyse wurde jetzt in der Zeitschrift "Journal of Happiness Studies" veröffentlicht.
In die Meta-Analyse einbezogen wurden Studien, wenn sie drei Kriterien erfüllten: Es mussten Längsschnittstudien mit mehreren Erhebungen bei denselben Personen sein, das Merkmal "Gesundheit" musste mit dem harten Indikator "Lebenserwartung" erfasst worden sein, und diese Lebenserwartung musste verknüpft sein mit einer früheren Messung des Glücksempfindens. Auf diese Weise fand der Wissenschaftler insgesamt 30 Studien. In etwas mehr als der Hälfte (53%) zeigte sich ein positiver Zusammenhang: Menschen, die ihr Befinden zu einem bestimmten Zeitpunkt als glücklich definierten, lebten später deutlich länger als andere, die sich zuvor als weniger glücklich bezeichnet hatten. Allerdings zeigte sich auch bei 13% ein umgekehrter, negativer Effekt und in 34% der Fälle kein signifikanter Zusammenhang.
Allerdings tritt ein positiver Zusammenhang sehr viel deutlicher hervor, wenn man die in den Studien jeweils untersuchten Gruppen nach ihrem Gesundheitszustand unterscheidet. In weniger gesunden Gruppen, also bei chronisch Erkrankten, Behinderten, bei Bewohnern von Alten- und Pflegeheimen usw. gibt es nur einen sehr schwachen Zusammenhang von Glücklichsein und Lebenserwartung. Kurzum, so resümiert Veenhoven, Glücklichsein hat bei Kranken keine oder nur eine überaus schwache lebensverlängernde Wirkung. Anders sieht es jedoch aus bei gesunden Untersuchungsgruppen. Hier zeigt sich ganz überwiegend (in 16 von 24 Fällen), dass glückliche Personen auch eine höhere Lebenserwartung haben: Im Durchschnitt beträgt dieser Gewinn in den analysierten Studien etwa 7,5 bis 10 Lebensjahre.
Dieser Effekt tritt umso deutlicher hervor, je länger die einzelnen Studien dauern. Diese Zeitspanne variierte zwischen 1 Jahr und 60 Jahren, wobei fünf Studien länger als 20 Jahre dauerten. Veenhoven diskutiert auch ausführlich verschiedene Erklärungsansätze für die gefundenen Effekte: Psychosomatisch erklärbare Körperreaktionen, Effekte des Immunsystems, Zusammenhänge zwischen Glücklichsein und Gesundheitsverhalten und andere, psychologische Theorien.
Der Wissenschaftler diskutiert sogar Möglichkeiten einer Gesundheitsförderung und von Public-Health-Maßnahmen, die direkt darauf zielen, Menschen glücklicher zu machen und auf diesem Weg Gesundheit und Lebenserwartung positiv zu beeinflussen. Die dabei ins Feld geführten Konzepte sind aber, sofern sie gesellschaftliche Dimensionen berühren, relativ platt: So empfiehlt er eine "Mehrung von materiellem Wohlstand, Demokratie und persönlichen Freiheiten". Auf individueller Ebene andererseits laufen die Vorschläge des holländischen Wissenschaftlers sehr stark auf eine Psychologisierung und Pädagogisierung des Alltagslebens hinaus. Mehr Beratungs- und Coaching-Angebote für ein glücklicheres Leben erscheinen ihm als Königsweg. So wie es für Manager ein Coaching für den beruflichen Erfolg gibt, sollte es (für alle) ein Coaching in Sachen Glücklichsein geben. Der holländische Wissenschaftler wäre sicherlich beglückt, wenn er wüsste, dass es an einer Heidelberger Schule bereits ein Unterrichtsfach "Glück" gibt, das sogar für das Abitur zählt, wie SPIEGEL online berichtet.
• Von der Studie gibt es ein Abstract: R. Veenhoven: Healthy happiness: effects of happiness on physical health and the consequences for preventive health care
• Kostenlos verfügbar ist aber auch die Studie im Volltext als PDF-Datei (Journal of Happiness Studies, Volume 9, Number 3 / September 2008)
P.S.:
Gerd Marstedt, 8.8.2008
Migranten und Gesundheit: RKI veröffentlicht längst überfällige Einblicke in die Gesundheit von 20% der deutschen Bevölkerung
 Rund ein Fünftel der Bevölkerung Deutschlands sind Einwohner, die zugewandert oder Kinder von Zuwanderern sind. Über deren gesundheitliche Situation war bislang wenig oder positiv wie negativ lediglich Spekulatives und Verlässliches bekannt.
Rund ein Fünftel der Bevölkerung Deutschlands sind Einwohner, die zugewandert oder Kinder von Zuwanderern sind. Über deren gesundheitliche Situation war bislang wenig oder positiv wie negativ lediglich Spekulatives und Verlässliches bekannt.
Wenn überhaupt wurde über die gesundheitlichen Risiken durch Entwurzelung, mangelhafte Integration und soziale Ghettoisierung und Vereinsamung gesprochen, nicht aber auch über die Chancen der Gesunderhaltung der Migranten. Selbst wenn diese einseitige Betrachtungsweise auch in der Auseinandersetzung mit der gesundheitlichen Situation deutscher BürgerInnen üblich ist, ist die Schließung der gröbsten Wissenslücken über die Gesundheit der Bevölkerungsgruppe mit Migrationshintergrund überfällig gewesen.
Schließen tun sie zwei Veröffentlichungen des Robert-Kochinstituts (RKI) in ihrer Reihe von materialreichen Texten zur Gesundheitsberichterstattung (GBE).
Die wichtigsten Erkenntnisse aus dem von Gesundheitswissenschaftlern der Universität Bielefeld erarbeiteten GBE-Schwerpunktbericht "Migration und Gesundheit" und dem von Berliner Epidemiologen erstellten GBE-Beitrag "Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund in Deutschland" lauten:
• "Menschen mit Migrationshintergrund können im Vergleich zur Mehrheitsbevölkerung ohne Migrationshintergrund erhöhte Gesundheitsrisiken aufweisen ... Dabei ist es nicht die Migration als solche, die krank macht. Es sind vielmehr die Gründe und Umstände einer Migration sowie die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland, die zu einem schlechteren Gesundheitszustand führen können. Menschen mit Migrationshintergrund haben überdurchschnittlich häufig einen niedrigen sozioökonomischen Status, gehen einer die Gesundheit gefährdenden beruflichen Tätigkeit nach oder sind arbeitslos, oder leben in einer ungünstigen Wohnsituation. Jeder einzelne dieser Faktoren kann eine Beeinträchtigung der Gesundheit nach sich ziehen, ganz besonders gilt dies aber für das Zusammentreffen mehrerer dieser Faktoren."
• Menschen mit Migrationshintergrund sind in Deutschland aber trotzdem weder öfter noch seltener krank als der nicht zugewanderte Bevölkerungsteil. Sie erkranken im Großen und Ganzen auch an ähnlichen Leiden wie die Gesamtbevölkerung.
• Migranten verhalten sich sogar in manchen Bereichen vernünftiger, beispielsweise unter den Menschen islamischen Glaubens und moslemischer Kultur beim Alkoholkonsum.
• Ein weiterer schützender Faktor für die Gesundheit der Migranten sei zum Beispiel das zum Teil günstigere Stillverhalten von Müttern.
• Zuwanderer bauten zudem oft soziale Netzwerke auf, die gesundheitsfördernd wirken könnten.
• "Zu den besonderen und überdurchschnittlichen Risiken unter den Migranten gehört aber immer noch die Säuglingssterblichkeit. Auch einige Infektionskrankheiten wie die Tuberkulose kommen häufiger vor sowie Erkrankungen durch psychosoziale Belastungen infolge der Trennung von der Familie oder politischer Verfolgung im Herkunftsland.
• Kinder und Jugendliche mit beidseitigem Migrationshintergrund leben zu einem beträchtlich höheren Ausmaß (53,7 %) in sozial benachteiligter Lage verglichen mit Kindern und Jugendlichen ohne bzw. mit einseitigem Migrationshintergrund (22,1 % bzw. 27,0 %). Allerdings manifestieren sich gravierende Unterschiede hinsichtlich der sozialen Schichtzugehörigkeit innerhalb der Migrantenpopulation. So gehören mit 70,7 % Kinder und Jugendliche aus der Türkei mit Abstand am häufigsten der untersten Sozialschicht an, gefolgt von Kindern und Jugendlichen aus der ehemaligen Sowjetunion (48,2 %) sowie aus den arabisch-islamischen Ländern (44,4 %). Kinder und Jugendliche aus Westeuropa, Kanada und den USA liegen hingegen mit ihrem Anteil von 16 % noch unter jenem der Kinder aus Deutschland. … Das Aufwachsen in sozial benachteiligter Situation vermindert die Chancen für ein gesundes Leben. Dennoch bestätigen die vorliegenden Daten höhere Risiken für Migrantenkinder nur in einigen gesundheitlichen Bereichen, in anderen scheinen Gesundheitsvorteile oder aber keine nennenswerten Unterschiede nach Migrationshintergrund zu bestehen."
Der 138 Seiten umfassende Schwerpunktbericht der Gesundheitsberichterstattung des Bundes "Migration und Gesundheit" ist kostenlos im Internet zu erhalten, kann aber auch als Druckwerk beim RKI bestellt werden.
Der 129-Seitenband Beiträge zur Gesundheitsberichterstattung des Bundes-Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003 - 2006: Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund in Deutschland ist ebenfalls kostenlos als PDF-Datei erhältlich.
Bernard Braun, 27.7.2008
Mehrheit der Amerikaner möchte laut einer Umfrage lieber tot sein als mit einer schweren Behinderung leben
 52 Prozent, also eine knappe Mehrheit der US-Amerikaner möchte lieber tot sein als mit einer schweren Behinderung leben. Dies ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage bei rund 1.000 Amerikanern im Alter über 18 Jahre, die von der gemeinnützigen Einrichtung Disaboom in Auftrag gegeben wurde. Disaboom betreibt hauptsächlich eine Website, auf der Behinderte miteinander kommunizieren können, bietet aber auch zahlreiche Informationen, die das Leben mit einer Behinderung verbessern.
52 Prozent, also eine knappe Mehrheit der US-Amerikaner möchte lieber tot sein als mit einer schweren Behinderung leben. Dies ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage bei rund 1.000 Amerikanern im Alter über 18 Jahre, die von der gemeinnützigen Einrichtung Disaboom in Auftrag gegeben wurde. Disaboom betreibt hauptsächlich eine Website, auf der Behinderte miteinander kommunizieren können, bietet aber auch zahlreiche Informationen, die das Leben mit einer Behinderung verbessern.
Die im Juni 2008 durchgeführte Umfrage bestand aus nur einer Frage: "Which would you choose: Living with a severe disability that forever alters your ability to live an independent life, or death?" (Wofür würden Sie sich entscheiden: Mit einer schweren Behinderung zu leben, die dauerhaft Ihre Fähigkeit einschränkt, ein unabhängiges Leben zu führen, oder zu sterben?") Bei den Antworten zeigten sich keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen, wohl aber ein Einfluss des Alters, der Hautfarbe, des Einkommens und Bildungsniveaus.
• Jüngere entschieden sich häufiger für das Leben mit einer Behinderung: 18-24jährige wählten dies zu 63%, über 65jährige nur zu 44%
• Weiße wählten wesentlich seltener die Behinderung als Schwarze (45% vs. 69%)
• Angehörige oberer Sozialschichten standen der Alternative Behinderung wesentlich distanzierter gegenüber. Dies zeigte sich sowohl für den Indikator Einkommen als auch für das Bildungsniveau. So wählten 70% derjenigen ohne Schulabschluss die Behinderung, aber nur 43% derjenigen mit einem College-Abschluss.
Dr. Glen House, der Gründer von Disaboom, selbst querschnittsgelähmt seit seinem 20.Lebensjahr zeigte sich überrascht, wie stark US-Amerikaner noch von Ängsten und Vorurteilen gegenüber einer Behinderung durchsetzt sind und hofft, dass Informationen auf der Website dazu beitragen, dieses Bild zu korrigieren.
• Hier ist eine Pressemitteilung zur Umfrage: Disaboom Survey Reveals 52 Percent of Americans Would Rather be Dead Than Disabled
• Hier ist die Website von Disaboom
Gerd Marstedt, 15.7.2008
Reichtum schützt vor Schlaganfall - und ist ein besserer Indikator für soziale Ungleichheit als Einkommen oder Bildung
 Bei knapp 20.000 älteren Männern und Frauen (über 50 Jahre), die an der "University of Michigan Health and Retirement Study (HRS)" teilnehmen, hat sich jetzt gezeigt, dass persönlicher Besitz und Reichtum mit einem selteneren Auftreten von Schlaganfällen verbunden ist - zumindest in der Gruppe der 50-64jährigen. Und nicht nur dieses Ergebnis ist bemerkenswert: Es zeigte sich auch, dass Reichtum ein besserer Indikator für die Wahrscheinlichkeit einer Schlaganfall-Erkrankung ist als ähnliche Merkmale, die zumeist zur Bestimmung der sozialen Schichtzugehörigkeit verwendet werden: Das Bildungsniveau oder auch das Monatseinkommen.
Bei knapp 20.000 älteren Männern und Frauen (über 50 Jahre), die an der "University of Michigan Health and Retirement Study (HRS)" teilnehmen, hat sich jetzt gezeigt, dass persönlicher Besitz und Reichtum mit einem selteneren Auftreten von Schlaganfällen verbunden ist - zumindest in der Gruppe der 50-64jährigen. Und nicht nur dieses Ergebnis ist bemerkenswert: Es zeigte sich auch, dass Reichtum ein besserer Indikator für die Wahrscheinlichkeit einer Schlaganfall-Erkrankung ist als ähnliche Merkmale, die zumeist zur Bestimmung der sozialen Schichtzugehörigkeit verwendet werden: Das Bildungsniveau oder auch das Monatseinkommen.
In der Studie wurden Ältere, die noch nicht von einem Schlaganfall betroffen waren, im Durchschnitt über einen Zeitraum von 8,5 Jahren kontrolliert. Im Verlauf dieses Beobachtungszeitraums erlitten etwa 1.500 Teilnehmer einen Schlaganfall. Jeweils zu Beginn der Teilnahme wurden verschiedene Merkmale erfasst: Höchster Schulabschluss, Monatseinkommen, finanzielle und andere Besitztümer, Alter und Geschlecht, aber auch Verhaltensmerkmale wie Rauchen und körperliche Aktivität sowie gesundheitliche Risikofaktoren und Erkrankungen (BMI, Bluthochdruck, Diabetes, Herz-Erkrankungen).
Bei der Analyse der Schlaganfall-Hintergründe zeigte sich dann:
• In der Altersgruppe der 50-64jährigen war das Auftreten der Krankheit eindeutig abhängig von sozioökonomischen Faktoren. Die unteren 10 Prozent der Teilnehmer (im Hinblick auf den materiellen Besitz) waren 2,3mal so oft betroffen wie die oberen 75-90 Prozent - die "Super-Reichen" (90-100%) waren hier noch außen vorgelassen.
• In den Altersgruppen darüber (65-74, über 74) war ein solcher Zusammenhang nicht mehr nachweisbar. Die Zusammenhänge hatten (bei unter 65jährigen) auch Bestand, wenn man in multivariaten Analysen individuelle Verhaltensrisiken wie Rauchen und fehlende körperliche Bewegung oder Krankheitsrisiken wie BMI und Bluthochdruck mitberücksichtigte.
• Für die Wissenschaftler zeigte sich recht überraschend, dass das Merkmal "Reichtum" stärkere Zusammenhänge zum Auftreten von Schlaganfällen aufwies als etwa die Indikatoren "Bildungsniveau" oder "Einkommenshöhe". Sie erklären dies so, dass Reichtum in stärkerem Maße als das aktuelle Einkommen die lebenslange Finanzsituation widerspiegelt und mit ihr auch die dauerhaft verfügbaren materiellen und psychosozialen Ressourcen einer Person.
Dass ab dem Alter von 65 jedoch kein Zusammenhang mehr besteht zwischen verschiedenen Schicht-Indikatoren (Einkommen, Reichtum, Bildung), war auch für die Forscher unerwartet. Entweder, so ihre Erklärung, ist dies dadurch erklärbar, dass Ältere einen besseren Krankenversicherungs-Schutz in den USA haben. Oder aber dies ist ein Artefakt, dadurch hervorgerufen, dass die Stichprobe der über 64jährigen durch spezifische Überlebensraten verzerrt ist.
Hier ist ein Abstract der Studie: Mauricio Avendano, Maria Glymour: Stroke Disparities in Older Americans. Is Wealth a More Powerful Indicator of Risk Than Income and Education? (Stroke. 2008;39:1533.)
Dass Reichtum möglicherweise ein spezieller Indikator für soziale Unterschiede ist, der in gängigen Schichttheorien und darauf basierenden Indikatoren (Einkommenshöhe, höchster Bildungsabschluss, Stellung im Beruf) nicht hinreichend berücksichtigt wird, hatte unlängst bereits eine finnische Studie angedeutet. Dort hatte sich gezeigt: Besitzer von Häusern und Wohnungen haben eine längere Lebenserwartung als Wohnungsmieter. Die Sterblichkeitsrate der Mieter ist bei Männern 2.1mal, bei Frauen 1.7mal so hoch wie bei Eigentümern von Wohnraum. Überraschend ist dieses Ergebnis, da in den multivariaten Analysen eine Reihe von Aspekten statistisch kontrolliert wurde, die auch mit Wohneigentum zusammenhängen und in vielen anderen Studien Einflüsse auf die Mortalitätsrate gezeigt haben: Einkommenshöhe, Stellung im Beruf, Bildungsniveau.
vgl.: Finnische Verlaufsstudie mit 300.000 Teilnehmern zeigt: Hausbesitzer haben eine höhere Lebenserwartung als Mieter
Gerd Marstedt, 30.4.2008
Englische Studie: Internet-Seiten bieten öfter Unterstützung für Selbstmordpläne als Hilfe und Prävention
 Im Februar 2008, hatte eine "unheimliche Selbstmord-Serie" für großes Aufsehen gesorgt: 17 Jugendliche hatten sich innerhalb eines Jahres in der kleinen walisischen Gemeinde Cefn Cribbwr das Leben genommen. Nach wie vor besteht großes Rätselraten über die Motive der Jugendlichen. Auch die Frage, ob die für ein kleines Dorf überaus merkwürdigen Serientat sich daraus erklärt, dass die Jugendlichen sich im Internet kennen gelernt und Kontakt gepflegt haben, ist noch unbeantwortet. Anlass zu einer solchen Vermutung könnten Ereignisse aus Japan sein, als sich im Oktober 2004 zwei Gruppen von Jugendlichen über das Internet zur gemeinsamen Selbsttötung verabredeten.
Im Februar 2008, hatte eine "unheimliche Selbstmord-Serie" für großes Aufsehen gesorgt: 17 Jugendliche hatten sich innerhalb eines Jahres in der kleinen walisischen Gemeinde Cefn Cribbwr das Leben genommen. Nach wie vor besteht großes Rätselraten über die Motive der Jugendlichen. Auch die Frage, ob die für ein kleines Dorf überaus merkwürdigen Serientat sich daraus erklärt, dass die Jugendlichen sich im Internet kennen gelernt und Kontakt gepflegt haben, ist noch unbeantwortet. Anlass zu einer solchen Vermutung könnten Ereignisse aus Japan sein, als sich im Oktober 2004 zwei Gruppen von Jugendlichen über das Internet zur gemeinsamen Selbsttötung verabredeten.
Die seither immer wieder aus Japan berichtete "Verabredung zum Selbstmord im Internet", die von psychologischer Seite als überaus besorgniserregender Effekt der Internet-Verbreitung interpretiert wurde (vgl.: "Suicide pacts and the internet"), war dann Anlass für eine englische Forschungsgruppe aus Oxford, sich mit den im Internet zugänglichen Informationen zum Selbstmord intensiver zu beschäftigen.
Zentrales Ergebnis ihrer Analysen war dann: Für Personen, die im Internet nach praktischen Hinweisen zur Durchführung eines geplanten Selbstmords suchen, werden tatsächlich dazu sehr konkrete Hinweise und Tipps geliefert. Informationen zur Prävention eines Suizids andererseits, durch Berichte oder auch Verweise auf hilfeleistende Einrichtungen, sind sehr viel seltener zu finden. Die Forschungsgruppe recherchierte mit mehreren Suchmaschinen nach englischsprachigen Websites, die sich mit dem Thema Selbstmord beschäftigen. Die verwendeten Suchbegriffe waren dabei "(a) suicide; (b) suicide methods; (c) suicide sure methods; (d) most effective methods of suicide; (e) methods of suicide; (f) ways to commit suicide; (g) how to commit suicide; (h) how to kill yourself; (i) easy suicide methods; (j) best suicide methods; (k) pain-free suicide, and (l) quick suicide."
Die zehn ersten Fundstellen jeder Suche wurden näher ausgewertet, bei 480 Treffern stieß man auf insgesamt 240 verschiedene Seiten. Bei diesen wurde dann unter anderem analysiert, ob die Seite sich mit dem Thema neutral, negativ-ablehnend oder positiv-befürwortend auseinander setzte, ob es sich um Websites speziell zum Thema Selbstmord handelte oder nicht. Bei jenen insgesamt 90 Seiten, die sich speziell dem Thema widmeten, fand man, dass etwa die Hälfte eine zum Suizid ermutigende oder diesen erleichternde Information bot. Umgekehrt boten lediglich 13 Prozent der gefundenen Internetseiten Texte zur Selbstmord-Prävention und nur 12 Prozent versuchten, Benutzer durch Argumente an ihrem Vorhaben zu hindern. Nicht ganz 10 Prozent enthielten neutrale, entweder rein sachliche oder scherzhafte Informationen zum Thema.
Die drei Websites, auf die die Wissenschaftler bei ihrer Suche am meisten stießen, waren durchweg solche, die den Selbstmord durch entsprechende Informationen befürworten oder erleichtern. Darunter war auch die am allerhäufigsten, unter zehn verschiedenen Web-Adressen gefundene Seite "Alt Suicide Holiday (ASH)", in der detailliert und emotionslos eine Vielzahl von Selbstmord-Techniken beschrieben wird, auch mit dem Hinweis wie schnell und wie effektiv diese jeweils wirken. Auch die englischsprachige Wikipedia-Seite zum Selbstmord war unter den Top 10, und auch dort finden sich unter der Unterrubrik Suicide Methods detaillierte Beschreibungen verschiedenster Methoden.
Die Forscher diskutieren auch die Frage, inwieweit ein Verbot solcher Seiten gesellschaftlichen Prinzipien der freien Meinungsäußerung widerspricht bzw. zu einer Vermeidung von Selbstmorden beitragen kann. In Australien ist dies seit 2006 tatsächlich gesetzlich untersagt.
Die Studie ist hier im Volltext nachzulesen: Lucy Biddle u.a.: Suicide and the internet (BMJ 2008;336:800-802 (12 April), doi:10.1136/bmj.39525.442674.AD)
Gerd Marstedt, 14.4.2008
Hält die Ehe gesund oder heiraten Gesündere häufiger als Ungesündere - Protektion oder Selektion?
 In den zahlreichen Studien, die auch in Deutschland eine ungleiche Verteilung von Gesundheit nachweisen, spielen der Bildungsgrad, das Einkommen, soziale Netzwerke oder die Schichtzugehörigkeit aber auch der Familienstand eine bedeutende Rolle. Bei der Erklärung der ehebezogenen Unterschiede koexistierten bisher zwei Erklärungsmuster: Das bisher dominante Kausal- oder Protektionsmodell von "Gesundheit und Ehe" ging von der negativen oder positiven Wirkung der sozialen Einflüsse, also hier des Ledigseins oder der Ehe, aus. Das Selektionsmodell sieht hingegen die Tendenz, dass Personen mit einer schlechteren Gesundheit Schwierigkeiten haben, bestimmte Lebensbedingungen wie etwa die Ehe zu arrangieren, während Gesündere hier weniger Schwierigkeiten haben.
In den zahlreichen Studien, die auch in Deutschland eine ungleiche Verteilung von Gesundheit nachweisen, spielen der Bildungsgrad, das Einkommen, soziale Netzwerke oder die Schichtzugehörigkeit aber auch der Familienstand eine bedeutende Rolle. Bei der Erklärung der ehebezogenen Unterschiede koexistierten bisher zwei Erklärungsmuster: Das bisher dominante Kausal- oder Protektionsmodell von "Gesundheit und Ehe" ging von der negativen oder positiven Wirkung der sozialen Einflüsse, also hier des Ledigseins oder der Ehe, aus. Das Selektionsmodell sieht hingegen die Tendenz, dass Personen mit einer schlechteren Gesundheit Schwierigkeiten haben, bestimmte Lebensbedingungen wie etwa die Ehe zu arrangieren, während Gesündere hier weniger Schwierigkeiten haben.
Die empirische Überprüfung der Gültigkeit beider Modelle war bisher schwierig und konnte erst mit den mittlerweile seit 1984 vorliegenden Längsschnittdaten des "Sozio-Ökonomischen Panels (SOEP)" angegangen werden. Rainer Unger vom "Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB)" untersuchte mit diesen Daten die Gesundheitsentwicklung der Verheirateten vor und im Verlauf der Ehe und führte ergänzende Analysen zum Gesundheitsverhalten von Verheirateten und Ledigen durch.
Die in den BiB-Mitteilungen (Heft 4/2007: 17-22) mitgeteilten Ergebnisse sind überraschend eindeutig:
• Dem sogar in bisherigen Untersuchungen als kumulativ betrachteten Protektionseinfluss und damit einer kausal positiv gesundheitlichen Wirkung der Ehe kommt in dieser Untersuchung "keine Bedeutung" zu.
• Vermutet wurde auch ein gesünderes Verhalten von Verheirateten, das dann mittelbar wiederum zu deren besseren Gesundheit beitragen könnte. Auch hier aber Fehlanzeige: "Auch die Analysen des Gesundheitsverhaltens in den Bereichen Ernährung, Sport und Rauchen zeigen im Wesentlichen keine gravierenden Unterschiede zwischen Ledigen und Verheirateten und tragen dementsprechend nicht zur Erklärung von Gesundheitsunterschieden zwischen Ledigen und Verheirateten bei."
• Die bessere Gesundheit von Verheirateten lässt sich stattdessen "vollständig" durch die "Selektion der Gesünderen in die Ehe erklären." Das heißt: "Hier zeigt sich, dass bei schlechter Gesundheit die Heiratswahrscheinlichkeit bei Männern um 45 % niedriger ist als bei guter Gesundheit. Bei den Frauen beträgt der Effekt 49 %. Damit kann davon ausgegangen werden, dass dem Selektionseffekt ein deutlicher Einfluss zukommt: Gesündere heiraten häufiger als Ungesündere." (S. 18)
• "Die Frage: Gesund durch die Ehe? Ist also dahingehend zu beantworten, dass sich der gesundheitsförderliche Effekt durch die Selektion bei der Eheschließung einstellt und im Verlauf der Ehe weitgehend erhalten wird."
• Der mögliche Einfluss unterschiedlicher Einkommen oder Bildungsabschlüsse von Ledigen und Verheirateten wurde im Übrigen durch entsprechende Kontrollen ausgeschlossen.
Die in einem Aufsatz in den BiB-Mitteilungen (Heft 4/2007: 17-22) von Rainer Unger unter dem Titel "Gesund durch die Ehe? Gesundheitsentwicklung und Gesundheitsverhalten von Verheirateten" veröffentlichten Studienergebnisse sind als PDF-Dokument kostenlos erhältlich.
Wer sich regelmäßig über die gelegentlich gesundheitliche Themen untersuchenden Arbeiten des BiB interessiert, kann dessen Mitteilungen stets zum Quartalsende komplett als PDF-Datei herunterladen.
Bernard Braun, 6.4.2008
Finnische Verlaufsstudie mit 300.000 Teilnehmern zeigt: Hausbesitzer haben eine höhere Lebenserwartung als Mieter
 Eine Studie von Gesundheitswissenschaftler und Soziologen aus Helsinki, in die Daten von 308 Tausend finnischen Männern und Frauen im Alter von 40 bis 80 Jahren eingeflossen sind, hat jetzt ein überraschendes Ergebnis gezeigt: Besitzer von Häusern und Wohnungen haben eine längere Lebenserwartung als Wohnungsmieter. Die Sterblichkeitsrate der Mieter ist bei Männern 2.1mal, bei Frauen 1.7mal so hoch wie bei Eigentümern von Wohnraum. Überraschend ist dieses Ergebnis insofern, als in den multivariaten Analysen eine Reihe von Aspekten statistisch kontrolliert wurde, die auch mit Wohneigentum zusammenhängen und in vielen anderen Studien Einflüsse auf die Mortalitätsrate gezeigt haben: Einkommenshöhe, Stellung im Beruf, Bildungsniveau. Dies bedeutet, dass Wohnungs- und Hauseigentum auch ganz unabhängig von der Einkommenssituation und der Schichtzugehörigkeit Erkrankungsrisiken und damit die Lebenserwartung mitbestimmt. Woran dies nun allerdings liegt, darüber rätseln die finnischen Forscher und können in ihrer Studie keine plausible Erklärung liefern.
Eine Studie von Gesundheitswissenschaftler und Soziologen aus Helsinki, in die Daten von 308 Tausend finnischen Männern und Frauen im Alter von 40 bis 80 Jahren eingeflossen sind, hat jetzt ein überraschendes Ergebnis gezeigt: Besitzer von Häusern und Wohnungen haben eine längere Lebenserwartung als Wohnungsmieter. Die Sterblichkeitsrate der Mieter ist bei Männern 2.1mal, bei Frauen 1.7mal so hoch wie bei Eigentümern von Wohnraum. Überraschend ist dieses Ergebnis insofern, als in den multivariaten Analysen eine Reihe von Aspekten statistisch kontrolliert wurde, die auch mit Wohneigentum zusammenhängen und in vielen anderen Studien Einflüsse auf die Mortalitätsrate gezeigt haben: Einkommenshöhe, Stellung im Beruf, Bildungsniveau. Dies bedeutet, dass Wohnungs- und Hauseigentum auch ganz unabhängig von der Einkommenssituation und der Schichtzugehörigkeit Erkrankungsrisiken und damit die Lebenserwartung mitbestimmt. Woran dies nun allerdings liegt, darüber rätseln die finnischen Forscher und können in ihrer Studie keine plausible Erklärung liefern.
Etwa ein Siebtel der finnischen Bürger und Bürgerinnen im Alter von 40-80 Jahren, nach dem Zufallsprinzip im Jahre 1997 aus dem finnischen Bevölkerungsregister gezogen, bildete die repräsentative Stichprobe, die dann bis Ende 2003 weiter beobachtet wurde im Hinblick auf Sterbefälle und Todesursachen. Exakt 22.721 Todesfälle konnten die Wissenschaftler dann daraufhin analysieren, in welchen Bevölkerungsgruppen Häufungen zu beobachten waren, die über dem statistisch zu erwartenden Durchschnitt lagen. Dabei wurde unterschieden nach Altersgruppen und Geschlecht. Und als Einflussfaktoren berücksichtigt wurden verschiedene sozio-ökonomische Indikatoren: Einkommenshöhe, Stellung im Beruf (unterteilt in sieben Gruppen, darunter angelernte Arbeiter, höhere Angestellte, Landwirte, Selbstständige usw.), höchster Schulabschluss. Zusätzlich berücksichtigte man auch noch einen ansonsten eher selten verwendeten Aspekt: Ob jemand Mieter einer Wohnung ist oder Besitzer eines Hauses oder einer Wohnung.
Überraschendes Ergebnis war dann:
• Für Männer wie Frauen zeigte sich in jeder der Altersgruppen (40-44 Jahre, 45-49 Jahre usw. bis 75-79 Jahre) bei Wohnungsmietern ein deutlich erhöhtes Sterblichkeitsrisiko im Vergleich zu Wohnraumbesitzern. Dieses Risiko war für Männer etwas höher als für Frauen. Noch deutlicher war dabei der Alterseinfluss: Bei 40-44jährigen männlichen Mietern war es 2.9mal so hoch (im Vergleich zu gleichaltrigen männlichen Haus- oder Wohnungsbesitzern), bei 75-79jährigen Männern nur noch 1.6mal so hoch.
• Normalerweise würde man bei diesem Ergebnis vermuten, dass das Merkmal "Haus- oder Wohnungseigentum" nur ein anderer Indikator ist für die soziale Schichtzugehörigkeit, also nicht viel anderes aussagt als das Einkommen oder Bildungsniveau. Tatsächlich zeigte sich dann jedoch in einer multivariaten Analyse, in der auch diese Faktoren statistisch kontrolliert wurden, dass der Effekt zwar geringfügig niedriger ausfiel, aber immer noch statistisch hochsignifikante Werte einnahm - das Sterblichkeitsrisiko lag in diesen Analysen je nach Alter und Geschlecht etwa 1.5 bis 1.6mal höher.
• Bei einer Überprüfung der Mortalitätsrisiken nach unterschiedlichen Erkrankungen und Todesursachen zeigte sich, dass diese sehr unterschiedlich ausfielen. Die Differenz zwischen Mietern und Hausbesitzern fiel bei Prostatakrebs (Männer) oder Brustkrebs (Frauen) sehr niedrig aus, bei alkoholbedingten Erkrankungen oder Atemwegskrankheiten hingegen sehr hoch.
Eine schlüssige Erklärung für ihren Befund, dass Wohneigentum einen positiven Einfluss auf die Gesundheit und Lebenserwartung hat, können die Wissenschaftler nicht liefern. Auch formulieren sie keine Hypothesen, welche Mechanismen sie hinter dem Befund vermuten, sondern schließen ihren Artikel mit der gängigen Formel, dass weitere Forschungsarbeiten nötig sind.
Hier ist ein Abstract der Studie: M Laaksonen u.a.: Home ownership and mortality: a register-based follow-up study of 300.000 Finns (J Epidemiol Community Health 2008; 62: 293-297. doi:10.1136/jech.2007.061309)
Gerd Marstedt, 17.3.2008
18 Studenten/innen essen vier Wochen nur Junk-Food - "Supersize me" unter strenger wissenschaftlicher Kontrolle
 Die Manager von McDonald's und Burger King dürften klammheimliche Freude empfunden haben, als Ernährungswissenschaftler die These aufstellten, Morgan Spurlock habe in seinem Film "Supersize Me" wohl eindeutig herumgetrickst, um zu den für die Junk-Food-Ernährung vernichtenden Ergebnissen zu kommen. Nun hat ein schwedischer Wissenschaftler das Experiment noch einmal mit 12 Studenten und 6 Studentinnen wiederholt, unter strenger wissenschaftlicher Kontrolle und mit Erfassung einer Vielzahl medizinischer Daten.
Die Manager von McDonald's und Burger King dürften klammheimliche Freude empfunden haben, als Ernährungswissenschaftler die These aufstellten, Morgan Spurlock habe in seinem Film "Supersize Me" wohl eindeutig herumgetrickst, um zu den für die Junk-Food-Ernährung vernichtenden Ergebnissen zu kommen. Nun hat ein schwedischer Wissenschaftler das Experiment noch einmal mit 12 Studenten und 6 Studentinnen wiederholt, unter strenger wissenschaftlicher Kontrolle und mit Erfassung einer Vielzahl medizinischer Daten.
Heraus kam Erstaunliches: Die Leberwerte der meisten Teilnehmer zeigten bedrohliche Werte, zugleich ergaben sich für Blutfettwerte eher positive Entwicklungen. Manche Teilnehmer nahmen in 4 Wochen gewaltig zu, andere kaum. Und alle verloren später ihr Übergewicht. Wieder können die Burger-Ketten befriedigt auf die Wissenschaftler verweisen, die da gezeigt haben: Einige nehmen halt sehr stark zu, andere nicht - alles eine Frage der Gene und der Veranlagung und bei jedem anders.
Frederik Nyström von der schwedischen Universität Linköping hatte 18 Studenten an einem Experiment teilnehmen lassen. 4 Wochen lang sollten sie sich nur mit Junk-Food ernähren, Cola und Shake-Getränke, Burger und Pizzas. Sie sollten nach einem exakten Ernährungsplan tagtäglich doppelt so viele Kalorien zu sich nehmen wie sie eigentlich benötigten, am Schluss der Studie etwa 5.000. Und zusätzlich wurde gefordert: So wenig körperliche Bewegung wie möglich, maximal eine Stunde in der Woche. Sobald ein Teilnehmer 15% seines Körpergewichts zusätzlich auf die Waage brachte, schied er aus der Studie aus. Die Ergebnisse zeigten dann Erstaunliches:
• Die Gewichtszunahme fiel bei den einzelnen Teilnehmern höchst unterschiedlich aus, manche nahmen 5-6 Kilo zu, ein Teilnehmer sogar 12 kg, andere nur minimal 1-2 kg.
• Bei 11 von 18 Teilnehmern zeigte ein bestimmter Laborwert für die Ausschüttung von Leber-Enzymen extrem bedrohliche Werte, die normalerweise auf eine Leberschädigung hindeuten, wie sich durch Alkoholmissbrauch oder Hepatitis verursacht wird.
• Am meisten überrascht waren die Wissenschaftler jedoch darüber, dass ein bestimmter Blutfett-Wert (HDL, das sogenannte "gute Cholesterin") innerhalb des Studienzeitraums größer wurde - im Prinzip ein gutes Zeichen, da dieses HDL das "böse" und gesundheitsschädliche Cholesterin LDL in Grenzen hält.
Die Studie ist bislang noch nicht veröffentlicht, die Wissenschaftler wollen zunächst noch einmal die Vielzahl ihrer Daten prüfen und auch deren Bedeutung für den Zusammenhang von Ernährung und Übergewicht. Schon jetzt lässt sich jedoch die Frage stellen, welche wissenschaftliche Aussagekraft und welchen praktischen Nutzen für die Präventionspolitik wohl eine Studie hat, die nicht von realen Lebensbedingungen und Alltagsgewohnheiten von Menschen ausgeht, sondern diesen ein vollkommen irreales Verhaltensraster aufzwängt:
• Obwohl alle Teilnehmer Ekel oder Widerwillen empfanden, die geforderten fünf- oder sechstausend Kalorien täglich zu essen, folgten sie dieser Pflicht, oft mit Tricks, etwa indem eine Teilnehmerin die am Tagesende noch fehlenden tausend Kalorien durch ein Gläschen Olivenöl zu sich nahm.
• Obwohl alle Teilnehmer während der gesamten Studiendauer immer wieder einen unbändigen Drang verspürten, sich körperlich zu bewegen oder anderweitig körperlich aktiv zu werden, mussten sie diesen Impuls massiv unterdrücken - mit Ausnahme von einer Stunde Training pro Woche.
• Obwohl eine ungesunde und zu kalorienreichem Ernährung ein Problem übergewichtiger und fettleibiger Personen ist, nahmen an der Studie junge, gesunde, normalgewichtige Studenten teil, die bislang das Gegenteil von Burger- oder Pizza-Fans waren: Dr. Nyström schaffte es nicht, die ursprünglich vorgesehene Teilnehmerzahl von 10 Studenten und 10 Studentinnen zu rekrutieren, als er mitteilte, was an Ernährungs-Zumutungen vorgesehen war.
Dr. Nyström will nun vor einer Veröffentlichung seiner Befunde erst noch einmal alle Daten prüfen. Man ahnt schon, wohin die Reise gehen wird, wenn er das vorläufige Fazit zieht: "Einige Menschen sind vermutlich sehr viel anfälliger für Übergewicht als andere."
• Ein ausführlicher Bericht über die Studie findet sich in der Zeitschrift "New Scientist", der Zugang ist aber leider kostenpflichtig: Douglas K: "Super size me" revisited - under lab conditions (New Scientist 2007; 27. Januar}
• Eine Zusammenfassung findet man auch hier im "Guardian": Only another 5,500 calories to go ...
• und auch hier (Deutschlandradio): Supersize me revisited
Übrigens: Erst vor kurze hatten Forscher der Universität Münster gewarnt, Olivenöl sei weitaus weniger gesund als landläufig angenommen. Arteriosklerose würde nicht verhindert, sondern womöglich ganz im Gegenteil sogar begünstigt. Hintergrund der Studie: Die Wissenschaftler hatten Meerschweinchen, deren Grundnahrungsmittel ganz überwiegend Heu ist, 4 Monate lang mit einer Diät aus Ölsäure gefüttert. vgl.: Wissenschaftler kritisieren: Leitlinien und Ratschläge zur gesunden Ernährung verursachen oft mehr Schaden als Nutzen
Gerd Marstedt, 14.2.2008
Sex and Drugs and Rap-Music! Studie findet in U-Musik sehr viele Texte über Drogenkonsum, besonders im Rap
 Erst vor kurzem hatten mehrere Studien gezeigt, dass Kinder und Jugendliche, die in Kinofilmen häufiger ihre Stars beim Rauchen beobachtet hatten, selber auch häufiger zur Zigarette griffen (vgl. "Aber der Brad Pitt raucht doch auch"). Forscher erkennen darin zumindest plausible Hinweise für eine durch das Kino mitverursachte Verführung Minderjähriger zur Nikotinabhängigkeit. Nun hat sich in einer anderen Studie eine Forschungsgruppe aus Pittsburgh (USA) die Texte von Rock-, Pop- und Rap-Musik vorgenommen und analysiert, wie oft und mit welchen Botschaften dort über den Konsum von Drogen erzählt wird.
Erst vor kurzem hatten mehrere Studien gezeigt, dass Kinder und Jugendliche, die in Kinofilmen häufiger ihre Stars beim Rauchen beobachtet hatten, selber auch häufiger zur Zigarette griffen (vgl. "Aber der Brad Pitt raucht doch auch"). Forscher erkennen darin zumindest plausible Hinweise für eine durch das Kino mitverursachte Verführung Minderjähriger zur Nikotinabhängigkeit. Nun hat sich in einer anderen Studie eine Forschungsgruppe aus Pittsburgh (USA) die Texte von Rock-, Pop- und Rap-Musik vorgenommen und analysiert, wie oft und mit welchen Botschaften dort über den Konsum von Drogen erzählt wird.
Zentrales Ergebnis dieser Analyse ist, dass durchschnittliche US-Jugendliche im Alter von 15-18 Jahren etwa zweieinhalb Stunden am Tag Musik hören und dabei rund 84mal Textpassagen über den Konsum legaler wie illegaler Drogen (Tabak, Alkohol, Marihuana, Kokain usw.) mithören. Umgerechnet sind dies im Jahr etwa 30.000 Text-Zitate. Auf diese Zahl kamen die Wissenschaftler einerseits durch eine andere Studie, die den Musikkonsum Jugendlicher untersucht hatte. Andererseits hatten sie selbst die Texte der 279 populärsten Musiktitel des Jahres 2005 (berechnet nach den Charts der Zeitschrift "Billboard") einer akribischen Textanalyse unterzogen.
Dabei fanden Sie heraus:
• In etwa jedem drittem Musiktitel kam zumindest eine Textpassage vor, die sich auf das Rauchen, Alkoholgenuss oder den Gebrauch unterschiedlicher illegaler Drogen (Marihuana/Cannabis, Kokain, Opiate, Halluzinogene etc.) bezog. Umgerechnet auf eine Stunde Musikkonsum ergaben sich so 35 Textstellen zum Drogenkonsum.
• Am häufigsten tauchte dabei der Alkohol auf (24%), danach der Joint (Marihuana/Cannabis: 14%), am seltensten die Zigarette (3%).
• Erhebliche Unterschiede zeigten sich für die jeweilige Stilrichtung der Musik. Fast jeder Titel, den man der Richtung Rap zuordnete, enthielt auch Textpassagen über Drogen (90%). Country-Musik lag überraschender Weise auf Platz 2 (41%), dahinter folgten Rhythm & Blues sowie Hip-Hop (27%), Rock-Musik (23%) und am Schluss fand sich die Pop-Musik (14%).
• Die Forschungsgruppe überprüfte auch, welche Anlässe und Hintergründe für die Erwähnung des Alkohol- und Drogenkonsums in den Musiktexten eine Rolle spielten. Dabei war sozialer Druck durch Freunde oder Familie der bedeutendste Anlass (48%), gefolgt von Sex (30%).
• Hinsichtlich der Effekte des Drogen-Konsums waren positive Gefühle oder Erfahrungen deutlich in der Mehrheit (68%), nur halb so oft tauchten negative Konsequenzen (wie gesundheitliche Beschwerden, Bestrafung, Isolation) auf.
In Anbetracht der Tatsache, dass Jugendliche etwa 50-60mal am Tag beim Musikhören zwar kurze, aber im Tenor gleich lautende Botschaften mitbekommen über positive Effekte des Alkohol- und Drogengenusses raten die Wissenschaftler zu vermehrten Forschungsanstrengungen, wie sich diese Erfahrung auf die Betroffenen auswirkt und wie man möglichen Gesundheitsgefährdungen begegnen könnte.
Hier ist ein Abstract der Studie: Brian A. Primack u.a.: Content Analysis of Tobacco, Alcohol, and Other Drugs in Popular Music (Arch Pediatr Adolesc Med. 2008;162(2):169-175)
Gerd Marstedt, 12.2.2008
Suizid im Spiegel der Epidemiologie - Selbstmord-Analysen im Stile der "Klapperstorch-Statistik"
 Die Epidemiologie untersucht laut Wikipedia-Eintrag "... jene Faktoren, die zu Gesundheit und Krankheit von Individuen und Populationen beitragen und ist deshalb die Basis aller Maßnahmen, die im Interesse der Volksgesundheit unternommen werden." Mit dieser allgemein gebräuchlichen, aber überaus breiten Definition rückt natürlich eine unendliche Vielzahl sozialer, biologischer und psychologischer Faktoren ins Zentrum des statistisch-analytischen Interesses, Faktoren, die man nicht von vornherein als Ursachen von Erkrankungen oder so betrüblichen Ereignissen wie Selbstmord vermutet hätte.
Die Epidemiologie untersucht laut Wikipedia-Eintrag "... jene Faktoren, die zu Gesundheit und Krankheit von Individuen und Populationen beitragen und ist deshalb die Basis aller Maßnahmen, die im Interesse der Volksgesundheit unternommen werden." Mit dieser allgemein gebräuchlichen, aber überaus breiten Definition rückt natürlich eine unendliche Vielzahl sozialer, biologischer und psychologischer Faktoren ins Zentrum des statistisch-analytischen Interesses, Faktoren, die man nicht von vornherein als Ursachen von Erkrankungen oder so betrüblichen Ereignissen wie Selbstmord vermutet hätte.
Rauchen zum Beispiel ist nach einer neueren Münchener Studie keineswegs nur ein Selbstmord in kleinen Schritten, verursacht durch die Inhalation von Schadstoffen und krebserregenden Substanzen, sondern steht direkt und unmittelbar im Zusammenhang mit Selbstmordversuchen des Rauchers. 1995 hatten die Wissenschaftler etwa 3.000 Münchener Jugendliche (Alter 14-24 Jahre) nach ihren Rauchgewohnheiten und ihrer seelischen Verfassung befragt. Einige Jahre später wurde die Befragung noch einmal wiederholt. Es zeigte sich, dass fast jeder dritte Raucher schon einmal über Selbstmord nachgedacht hatte, aber nur 15 Prozent der Nichtraucher, also halb so viele. Bei der Frage, ob man tatsächlich schon einmal einen Selbstmordversuch unternommen habe, waren die Differenzen noch größer. Das Suizid-Risiko lag im 4 Jahre dauernden Untersuchungszeitraum für regelmäßige Raucher vier Mal so hoch. Einen tatsächlich erfolgten Selbstmord konnten die Forscher allerdings bei keinem Studienteilnehmer nachträglich feststellen. Eine Erklärung hierfür konnten die Wissenschaftler nicht finden. Ihre Vermutung geht jedoch dahin, das durch das Nikotin biochemische Prozesse im Gehirn ausgelöst werden (vermittelt über das Serotonin), die ein depressiv-impulsives Verhalten begünstigen. Es könnte aber auch ganz anders sein.
Thomas Bronisch u.a.: Smoking predicts suicidality: Findings from a prospective community study (Journal of Affective Disorders, Article in Press, Corrected Proof, doi:10.1016/j.jad.2007.10.010)
Auf einen von ihnen neu entdeckten, ganz anderen Zusammenhang zu Selbstmorden machten in den letzten Tagen schwedische Wissenschaftler aufmerksam. Die Körpergröße des Säuglings, so ihre Befund, hat einen deutlichen statistischen Einfluss auf spätere Selbstmordversuche: Wer nur als Winzling mit einer unterdurchschnittlichen Körpergröße auf die Welt kommt, neigt später sehr viel häufiger zu Selbstmordgedanken und Selbstmordversuchen. Über 300.000 schwedische Bürger verfolgte man hierzu einige Jahre lang, sammelte Daten aus dem schwedischen Geburtsregister und ermittelte spätere Suizidversuche. Ergebnis: Das Risiko lag bei früheren Säuglingen mit unterdurchschnittlicher Körpergröße (weniger als 47 cm) etwa zweieinhalbmal so hoch. Für "Frühchen" war logischerweise das Risiko noch höher, nämlich viermal so hoch. Auch diese Studie liefert nur sehr vage Erklärungsversuche und spekuliert - wie schon die Raucher-Studie - über Einflüsse des Serotonin.
E. Mittendorfer-Rutz u.a.: Fetal and childhood growth and the risk of violent and non-violent suicide attempts: a cohort study of 318 953 men (Journal of Epidemiology and Community Health 2008;62:168-173; doi:10.1136/jech.2006.057133)
Ist man durch diese Studien neugierig geworden und möchte schauen, zu welchen Variablen die wissenschaftliche Neugier von Epidemiologen sonst noch geführt hat, so stößt man auf ein abendfüllendes Programm von Forschungsergebnissen.
• Schlafstörungen und Alpträume wurden von einem schwedischen Forschungsteam aus Göteborg als Faktoren entdeckt, die mit Selbstmordversuchen zusammenhängen. Bei Interviews mit 165 Patienten, die einen solchen Versuch unternommen hatten, zeigte sich: 89% berichteten über Schlafstörungen, 66% über Alpträume.
Nisse Sjöström u.a.: Nightmares and Sleep Disturbances in Relation to Suicidality in Suicide Attempters (Sleep, Volume 30, Issue 01, Pages 91-95)
• Brust-Implantate bei Frauen wiederum erwiesen sich nach einer Studie aus der Zeitschrift "Annals of Plastic Surgery" als Risikofaktor. 3.500 Schwedinnen, die sich ihre Brüste kosmetisch hatten vergrößern lassen, wurden über einen Zeitraum von 8 Jahren beobachtet. Im Vergleich zur Normalbevölkerung war das Suizid-Risiko in dieser Gruppe dreimal so hoch. Aber auch Drogen- und Alkoholmissbrauch waren bei diesen Frauen wesentlich höher, was die Forscher zu der durchaus nachvollziehbaren Schlussfolgerung anregte, dass die kosmetische Brustchirurgie nicht Suizidursache sei, sondern ihrerseits durch große psychische Probleme der Frauen veranlasst.
Lipworth, Loren u.a.: Excess Mortality From Suicide and Other External Causes of Death Among Women With Cosmetic Breast Implants (Annals of Plastic Surgery. 59(2):119-123, August 2007)
• Ein niedriger Intelligenzquotient ist ebenfalls als Einflussfaktor gefunden worden. Basis dieser Studie waren 987.308 schwedische Männer, die über einen Zeitraum von 5-26 Jahren beobachtet wurden. Im Beobachtungszeitraum wurden 2.811 Selbstmorde registriert. Die Häufigkeit des Suizids lag dabei in der Gruppe derjenigen mit den niedrigsten Testergebnissen in verschiedenen Intelligenztests dreimal so hoch wie in der Gruppe mit den besten Ergebnissen. Die stärksten Zusammenhänge fand man für den Intelligenzfaktor "logisches Verständnis und allgemeine Intelligenz".
D Gunnell u.a.: Low intelligence test scores in 18 year old men and risk of suicide: cohort study (BMJ 2005;330:167 (22 January), doi:10.1136/bmj.38310.473565.8F)
• Ein unterdurchschnittliches Körpergewicht wurde in einer Studie mit Selbstmordversuchen in Zusammenhang gebracht. Erfreuen dürfte dieser Befund all jene, die zuletzt durch stets neue Pressemeldungen über die Gesundheitsgefahren von Übergewicht und Adipositas verstört wurden. Denn Übergewichtige neigen am seltensten zum Suizid, fand man heraus, als man Daten von rund 1,3 Millionen schwedischer Militärangehöriger in den Computer gab.
Patrik K. E. Magnusson u.a.: Association of Body Mass Index with Suicide Mortality: A Prospective Cohort Study of More than One Million Men (American Journal of Epidemiology 2006 163(1):1-8; doi:10.1093/aje/kwj002)
• Ganz am Rande sei schließlich auch noch berichtet, dass psychische Belastungen im Berufsleben des Vaters auch noch bei den Kindern mit erhöhten Suizid-Risiken in Verbindung steht. Zumindest dann, wenn die Väter in kanadischen Sägemühlen arbeiteten, konnte dies in einer Studie aus dem Jahr 2006 eindeutig belegt werden.
Ostry Aleck1u.a.: The impact of fathers' physical and psychosocial work conditions on attempted and completed suicide among their children (BMC Public Health 2006, 6:77doi:10.1186/1471-2458-6-77)
Dass zwischen der Anzahl von Störchen in einer Region und der dortigen Geburtenquote ein sehr enger statistischer Zusammenhang besteht, ist durch viele Analysen eindeutig belegt, zuletzt etwa durch eine Studie von Thomas Höfer: "In Niedersachsen sank sowohl die Anzahl der Störche als auch der Neugeborenen von 1970 bis 1985, danach blieben beide Werte etwa konstant. In Berlin, wo es praktisch keine Störche gibt, verzeichneten sie einen Anstieg außerklinischer Geburten zwischen 1990 und 2000. Wie war nun das mit null Storch zu vereinbaren? Die Forscher bezogen das Umland mit ein - und siehe da, dort wuchs die Storchenpopulation just in dem Maße, wie die Berliner Hausgeburten zunahmen. Der logische Schluss: Brandenburger Störche bringen die Babys in die Stadt." (Quelle: ZEIT-Rubrik "Stimmt's?", die Studie von Höfer: New evidence for the Theory of the Stork). Allerdings belehren uns Statistiker, dass hier schlichte Korrelationen, aber keine Kausalzusammenhänge bestehen. Ein Großteil epidemiologischer Forscher, so scheint es indes, ist gleichwohl auch schon zufrieden mit Klapperstorch-Statistiken, ganz egal, was diese nun bedeuten mögen.
Gerd Marstedt, 18.1.2008
Babies nach medizinisch nicht notwendigen Kaiserschnitt-Geburten weisen ein höheres Risiko von Atemwegs-Erkrankungen auf
 Säuglinge, die im Rahmen eines gewünschten, medizinisch aber nicht erforderlichen Kaiserschnitts zur Welt gebracht wurden, weisen nach einer neuen dänischen Studie eine mehrfach erhöhtes Risiko von Atemwegserkrankungen auf. Das Forschungsteam untersuchte alle Geburten an der Universitätsklinik von Aarhus in den Jahren 1998 bis 2006. Für die Analyse berücksichtigt wurden jedoch nur Geburten innerhalb der 37. bis 41. Schwangerschaftswoche. Überdies wurde eine Reihe von Fällen ausgeschlossen, bei denen sich in den Voruntersuchungen vor der Geburt Krankheitssymptome (wie Diabetes, Bluthochdruck, Wachstumsverzögerungen) gezeigt hatten.
Säuglinge, die im Rahmen eines gewünschten, medizinisch aber nicht erforderlichen Kaiserschnitts zur Welt gebracht wurden, weisen nach einer neuen dänischen Studie eine mehrfach erhöhtes Risiko von Atemwegserkrankungen auf. Das Forschungsteam untersuchte alle Geburten an der Universitätsklinik von Aarhus in den Jahren 1998 bis 2006. Für die Analyse berücksichtigt wurden jedoch nur Geburten innerhalb der 37. bis 41. Schwangerschaftswoche. Überdies wurde eine Reihe von Fällen ausgeschlossen, bei denen sich in den Voruntersuchungen vor der Geburt Krankheitssymptome (wie Diabetes, Bluthochdruck, Wachstumsverzögerungen) gezeigt hatten.
In die Datenanalyse einbezogen wurden dann knapp 35.000 Fälle, bei denen man unterschied, ob es sich um Vaginalgeburten handelte, medizinisch erforderliche Kaiserschnitt-Geburten oder gewünschte Kaiserschnitt-Geburten ohne medizinische Indikation. Bei diesen drei Gruppen überprüfte man dann anhand der Krankenhaus-Entlassungsdaten, ob bestimmte Atemwegserkrankungen vorlagen, wobei mehrere Diagnosen nach der internationalen Klassifikation von Krankheiten (ICD 10) einbezogen wurden.
Im Vergleich der Krankheitshäufigkeiten zeigte sich dann im Vergleich von Vaginalgeburten und gewünschten Kaiserschnittgeburten ohne medizinische Indikation:
• Das Risiko einer Atemwegserkrankung des Neugeborenen lag bei allen Kaiserschnittgeburten vor der 40.Schwangerschaftswoche deutlich höher. Dieses Risiko betrug in der 39. Woche das 1.9fache, in der 38.Woche das 3.0fache und in der 37.Woche das 3.9fache.
• Noch höher fielen die Risiken aus, wenn man schwerwiegende Fälle von Atemwegserkrankungen betrachtete. Hier war das Risiko beispielsweise in der 37.Woche bei 5.0.
Bei der Analyse der Risiken wurde eine Reihe von Faktoren bei den Müttern statistisch mitberücksichtigt, darunter Rauchen, Alkoholkonsum, Body-Mass-Index, Lebensalter, Familienstand, Bildungsniveau. Die Forschergruppe vermutet in der Diskussion der Ergebnisse, dass die Kaiserschnitt-Babies einen wichtigen Entwicklungsprozess im Rahmen der Geburt nicht mitmachen. So würden während einer normalen Vaginalgeburt bestimmte Hormone freigesetzt, durch die die Lungen von Flüssigkeiten befreit werden. Darüber hinaus könne auch der mechanische Druck auf den Körper des Kindes während der Vaginalgeburt eine Funktion haben, die sich positiv auf die Atemfunktion auswirkt.
Ein kostenloses Abstract der Studie ist hier zu finden: Anne Kirkeby Hansen u.a.: Risk of respiratory morbidity in term infants delivered by elective caesarean section: cohort study (BMJ, doi:10.1136/bmj.39405.539282.BE, published 11 December 2007)
Erst unlängst hatten Studien gezeigt, dass Kaiserschnitt-Geburten wahrscheinlich bei weitem nicht so problemlos sind, wie vielfach von Ärzten behauptet und werdenden Müttern erhofft wird. Bei einer Analyse von rund 100.000 Geburten in Lateinamerika hatten sich für Kaiserschnittgeburten höhere Risiken für unterschiedliche Indikatoren (Dauer des Krankenhausaufenthalts, Notwendigkeit einer Antibiotika-Behandlung, Einweisung in eine Intensivstation) gezeigt. vgl.: "Doppelt so hohe Krankheitsrisiken für Mütter nach geplanten Kaiserschnitt-Geburten". Diese Befunde bestätigten noch einmal das Ergebnis einer anderen Studie aus Kanada und den USA. vgl. "Geplante Kaiserschnitt-Geburten: Höhere Risiken als bislang angenommen".
Gerd Marstedt, 26.12.2007
"Irren ist ärztlich" oder wo man lieber nicht seinem Arzt glauben sollte: Medizinische Mythen an die sogar Ärzte glauben.
 Mythen gehören zum Grundrepertoire der argumentativen Auseinandersetzungen in zahlreichen gesellschaftlichen Bereichen und beherrschen auch die Sicht- und Handlungsweise der unterschiedlichsten professionellen Akteure im Gesundheitswesen.
Mythen gehören zum Grundrepertoire der argumentativen Auseinandersetzungen in zahlreichen gesellschaftlichen Bereichen und beherrschen auch die Sicht- und Handlungsweise der unterschiedlichsten professionellen Akteure im Gesundheitswesen.
Erinnert sei nur an die "Kostenexplosion", die "Lohnnebenkosten-Bedrohung", den "Leistungsmissbrauch" oder die "demografische Bedrohung". Der Beschäftigung mit der Existenz von Mythen und ihre Dekonstruktion geht es dabei nicht oder zumindest nicht vorrangig darum, ihre Propagandisten als intellektuell dumm oder unredlich zu entlarven oder zu blamieren, sondern über das Verständnis ihres Zustandekommens, ihrer enormen Plausibilität und Glaubwürdigkeit und ihrer argumentativen Absicherung mehr über die wirklichen Entwicklungen und Strukturen im Gesundheitswesen zu erfahren. Wenn man die Bedingungen der Möglichkeit solcher Mythen verstanden hat, versteht man außerdem sein eigenes Denken sowie das Innenleben des Gesundheitswesens wesentlich besser.
Dies alles gilt auch für Ärzte, die man zwar trotzdem weiter zu allen gesundheitsbezogenen Problemen fragen kann oder sollte, nur nicht mit der uneingeschränkten und naiven Erwartung nur Richtiges und Evidentes geantwortet zu bekommen.
Der Blick in die Weihnachtsausgabe der medizinischen Fachzeitschrift "British Medical Journal (BMJ)" (2007, 22. Dezember; 335: 1288-1289) und den dortigen Aufsatz "Medical Myths. Sometimes even doctors are duped" von Rachel Vreeman und Aaron Carroll gibt "a light hearted reminder that we (Ärzte) can be wrong and need to question what other falsehoods we unwittingly propagate as we practice medicine."
Dafür stellten die an der Indiana University School of Medicine forschenden Verfasser eine Liste zusammen, die sieben, oft von Ärzten und der allgemeinen Öffentlichkeit verkündeten und auch zur Handlungsorientierung genutzten Statements über scheinbar sichere medizinische oder gesundheitliche Erkenntnisse enthält. Mit Hilfe von Medline bzw. PubMed und Google suchten die Forscher nach empirischer oder systematischer Evidenz für oder gegen die Gültigkeit und Stimmigkeit der ausgewählten Behauptungen und Annahmen.
Fehlende Evidenz oder sogar Gegenevidenz finden sich dabei für
• den Ratschlag mindestens acht Gläser Wasser mit einem Volumen von rund 2,5 Liter täglich zu trinken,
• den Glauben, dass Menschen nur 10% ihres Gehirns nutzen,
• die Annahme, dass Haare und Fingernägel auch nach dem Tod weiterwachsen (wer sich über Weihnachten Fred Vargas neuen Kriminalroman "Die dritte Jungfrau" gönnen will, sollten dies ganz schnell vergessen und sich die spannende Lektüre trotzdem gönnen), die - apropos Lesen -
• ängstigende Idee, Lesen bei gedimmten Licht würde die Lesekraft ruinieren,
• die ebenfalls für manche schreckliche Annahme, das Rasieren von Haaren führte zwangsläufig dazu, dass sie schneller und derber nachwachsen,
• die Annahme, dass Mobiltelefone in Krankenhäusern gefährlich seien und nicht nur für US-BürgerInnen
• die Angst, dass der bevorzugt weihnachtliche Verzehr von Truthähnen eine spezielle einschläfernde Wirkung hat.
Worauf sich die Bewertung dieser 7 medizinischen Überzeugungen als unbewiesen oder unwahr stützt, wird jeweils knapp dargestellt. In einigen Fällen wird auch gezeigt, welches die Quelle für die verblüffende Gewissheit der Überzeugung ist.
Die "conclusions" des Aufsatzes lassen sich daher auch schon als vorgezogene Wünsche für den rationalen öffentlichen medizinischen Diskurses in 2008 lesen: "Despite their popularity, all of these medical beliefs range from unproved to untrue. Although this was not a systematic review of either the breadth of medical myths or of all available evidence related to each myth, the search methods produced a large number of references. While some of these myths simply do not have evidence to confirm them, others have been studied and proved wrong. Physicians would do well to understand the evidence supporting their medical decision making. They should at least recognise when their practice is based on tradition, anecdote, or art. While belief in the described myths is unlikely to cause harm, recommending medical treatment for which there is little evidence certainly can. Speaking from a position of authority, as physicians do, requires constant evaluation of the validity of our knowledge."
Wer über der Anzahl von "nur" sieben falschen Überzeugungen oder gewissen Annahmen doch wieder schnell zum heilen und bequemen "…fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker"-Idyll zurückkehren will, machen bereits Vreeman und Carroll einen Strich durch die Rechnung. Sie arbeiten an einem Buch, das über 100 weitere vergleichbare Mythen enthält und 2008 erscheinen soll.
Wer aber schon jetzt etwa wissen will, welche Evidenz es für den ärztlichen und populären Ratschlag an Schwangere gibt, Katzen wegen möglicher Geburtsdefekte zu meiden, ob das menschliche Herz wirklich bei kräftigem Nießen aufhört zu schlagen, ob zuckerreiche Süßigkeiten bei Kindern zu hyperaktivem Verhalten führen, die Einnahme großer Mengen Vitamin C eine Erkältung vermeiden hilft oder man mit einer großen Menge heißem und schwarzen Kaffee die Folgen erhöhten Alkoholkonsums kompensieren kann - also vielfach jahreszeitgerechte Merksätze -, kann seine Neugier auf der Website "Find the Truth Behind Medical Myths" der University of Arkansas for Medical Sciences befriedigen.
Bernard Braun, 23.12.2007
Neue Langzeitstudie über 65 Jahre zeigt: Religiöse Gläubigkeit ist kein Schutz gegen Krankheit
 In den vergangenen Jahren wurde in den Medien regelmäßig über sensationell anmutende Forschungsergebnisse berichtet mit dem Fazit: Religion und Glauben bieten auch Schutz vor Krankheit und erhöhen die Lebenserwartung. Eine jetzt veröffentlichte Langzeit-Studie, in der über 200 ehemalige Collegeschüler 65 Jahre lang wissenschaftlich begleitet wurden, kam jedoch zu einem anderen Schluss. Weder die Lebenserwartung noch die Betroffenheit von chronischen Erkrankungen wird nach diesen Befunden davon beeinflusst, ob jemand gottesgläubig ist oder atheistisch gesinnt.
In den vergangenen Jahren wurde in den Medien regelmäßig über sensationell anmutende Forschungsergebnisse berichtet mit dem Fazit: Religion und Glauben bieten auch Schutz vor Krankheit und erhöhen die Lebenserwartung. Eine jetzt veröffentlichte Langzeit-Studie, in der über 200 ehemalige Collegeschüler 65 Jahre lang wissenschaftlich begleitet wurden, kam jedoch zu einem anderen Schluss. Weder die Lebenserwartung noch die Betroffenheit von chronischen Erkrankungen wird nach diesen Befunden davon beeinflusst, ob jemand gottesgläubig ist oder atheistisch gesinnt.
Mehrfach wurden in den letzten Jahren Forschungsergebnisse veröffentlicht, die einen engen Zusammenhang von Religion (oder Gläubigkeit) und Gesundheit aufzeigten. Depressionen und sogar Lungenerkrankungen waren dort bei gottesgläubigen Studienteilnehmer weitaus seltener verbreitet als bei Gottlosen. Spätere Analysen machten dann aber deutlich, dass diese Studien sehr grobe methodische Schnitzer enthielten. Eine dänische Sekundäranalyse etwa konnte zeigen, dass die ausschlaggebende Einflussdimension nicht der Glaube, sondern die soziale Unterstützung war. Kirchgänger und Gläubiger hatten in der Regel ein sehr viel dichteres soziales Netzwerk. Wenn man diese Variable analytisch mitberücksichtigte, ging der Einfluss des Glaubens auf den Gesundheitszustand fast auf Null zurück. (vgl.: LaCour, P. u.a.: Religion and survival in a secular region. A twenty-year follow-up of 734 Danish adults born in 1914 (Social Science & Medicine, 2006, 62(1), 157-164).
In anderen Studien fand man, dass dort der Einfluss des gesundheitlichen Risikoverhaltens völlig unberücksichtigt geblieben war: Bei Gläubigen findet man jedoch sehr viel seltener gesundheitsriskante Verhaltensgewohnheiten wie Rauchen, Drogen- oder Alkoholmissbrauch. Auch wurden in diesen Studien, die überaus häufig von amerikanischen Sekten und Glaubensgemeinschaften finanziert waren, meist nur sehr weiche Indikatoren wie die Selbsteinstufung des Gesundheitszustands, nicht aber die Betroffenheit von schwerwiegenden Erkrankungen oder die Lebenserwartung mit erfasst.
In der jetzt in der Zeitschrift "Social Science & Medicine" veröffentlichten Studie wurden 268 männliche College-Absolventen über einen Zeitraum von 65 Jahren wissenschaftlich begleitet. Ausführliche Untersuchungen durch Ärzte und Psychologen fanden statt, als die Teilnehmer 25, 30, 50 und - sofern sie noch lebten - 65 und 85 Jahre alt waren. Darüber hinaus wurde alle ab einem Alter von 45 Jahren alle zwei Jahre schriftlich befragt. In diesen Befragungen wurden umfangreiche Daten erhoben: Sozialstatistische Aspekte, Gesundheitsverhalten und Erkrankungen, stressauslösende Lebensereignisse, psychische Beeinträchtigungen wie Neurotizismus und Depressivität. Auch die sozialen Lebendbedingungen (Umfang und Qualität von Freundschaften, Ehe und Partnerschaft) sowie die Religiosität wurden berücksichtigt. Dieser religiöse Glaube wurde anhand von 10 Fragen erfasst, wie z.B.: "Ich glaube an ein Leben nach dem Tode" oder "Ich glaube an eine universelle Macht oder einen Gott". Als abhängige Variablen gingen dann in die Analyse ein: Der von Internisten aufgrund körperlicher Untersuchungen beurteilte Gesundheitszustand sowie die Mortalität.
Als Ergebnis der Analysen, in der alle diese möglichen Einflussfaktoren für die Gesundheit berücksichtigt wurden, zeigte sich dann, dass für den Gesundheitszustand im höheren Lebensalter und ebenso für die Mortalität (zum Studienende 2007 waren 112 Teilnehmer gestorben) eine große Zahl von Einflussfaktoren nachgewiesen werden konnte: Frühere Erkrankungen, das gesundheitliche Risikoverhalten, soziale Unterstützung. Der Effekt des Gläubigkeit jedoch blieb gleich Null, auch wenn man solche Faktoren wie Voerkrankungen, Rauchen und Alkoholkonsum gleichzeitig mitberücksichtigte.
Ein kostenloses Abstract ist hier zu finden: George Vaillant u.a: The natural history of male mental health: Health and religious involvement (Social Science & Medicine, Article in Press, doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.socscimed.2007.09.011)
Gerd Marstedt, 22.11.2007
US-Kriegsheimkehrer Das wahre Ausmaß psychischer Schäden wird erst allmählich sichtbar
 Schon im März 2006 hatte eine Studie mit knapp 90.000 US-Soldaten, die aus Kriegseinsätzen im Irak und in Afghanistan zurückgekehrt waren, gezeigt, dass etwa jeder fünfte schwere psychische Beeinträchtigungen als Folge des Kriegseinsatzes im Irak aufwies, bei Heimkehrern aus Afghanistan etwa jeder zehnte. Eine erneute Befragung der früher im Irak eingesetzten Soldaten zu einem späteren Zeitpunkt, etwa 3-6 Monate nach der Rückkehr, hat nun deutlich gemacht, dass die Erstbefragung das Ausmaß psychischer Beeinträchtigung und psychiatrischer Erkrankungen massiv unterschätzt hat.
Schon im März 2006 hatte eine Studie mit knapp 90.000 US-Soldaten, die aus Kriegseinsätzen im Irak und in Afghanistan zurückgekehrt waren, gezeigt, dass etwa jeder fünfte schwere psychische Beeinträchtigungen als Folge des Kriegseinsatzes im Irak aufwies, bei Heimkehrern aus Afghanistan etwa jeder zehnte. Eine erneute Befragung der früher im Irak eingesetzten Soldaten zu einem späteren Zeitpunkt, etwa 3-6 Monate nach der Rückkehr, hat nun deutlich gemacht, dass die Erstbefragung das Ausmaß psychischer Beeinträchtigung und psychiatrischer Erkrankungen massiv unterschätzt hat.
In der Erst- und auch in der Wiederholungsbefragung wurde eine Vielzahl von Indikatoren verwendet, um psychische Störungen näher zu erfassen, unter anderem wurde nach post-traumatischen Störungen gefragt, Depressionen, Angstzuständen, Alkohol- und Medikamentenmissbrauch, Suizidabsichten und -versuche, zwischenmenschliche Konflikte sowie auch die Inanspruchnahme medizinischer und psychotherapeutischer Hilfe gegen solche Probleme.
Im Vergleich der Ergebnisse aus beiden Erhebungen zeigte sich dann durchgängig ein sehr viel höheres Maß an Betroffenheit in der zweiten Befragung, einige Monate nach der Rückkehr in die USA. Besonders deutlich fiel dieser Anstieg aus für die Indikatoren:
• Sorgen über zunehmende zwischenmenschliche Konflikte (Anstieg von 4% auf 14%)
• Post-traumatische Stress-Syndrome (Anstieg bei jetzt noch in der Armee aktiven Soldaten von 12% auf 17%, bei nicht mehr aktiven von 13% auf 25%)
• Depressionen (Anstieg von 5% auf 11% bei noch aktiven, von 4% auf 13% bei nicht mehr aktiven Soldaten).
• Gesamtindex für psychische Störungen (Anstieg von 17% auf 27% bzw. 18% auf 36%)
Nach Einschätzungen der Wissenschaftler bedürften etwa 20% der noch aktiven Soldaten und etwa 42% der nicht mehr aktiven Kriegsveteranen psychotherapeutischer Hilfe. Man kann wohl ausschließen, dass die mitgeteilten Ergebnisse die Problematik zu übersteigert darstellen, da das Wissenschaftler-Team, das die Studie durchführte, in zwei militäreigenen Forschungseinrichtungen tätig ist (US Army Medical Research and Materiel Command, US Army Center for Health Promotion and Preventive Medicine).
Die Studie ist kostenlos im Volltext verfügbar: Charles S. Milliken u.a.: Longitudinal Assessment of Mental Health Problems Among Active and Reserve Component Soldiers Returning From the Iraq War (JAMA. 2007;298(18):2141-2148)
Unmittelbar vor Veröffentlichung der Studie war in den USA ein Report erschienen, in dem Wissenschaftler und Ärzte die Kosten für die zukünftige medizinische Versorgung der Kriegsveteranen auf bis zu 650 Milliarden Dollar beziffert hatte. "Dieser Bericht sollte die Amerikaner und ihre Regierung endlich aufwecken", erklärte einer der Autoren, Dr. Evan Kanter. "Während wird endlos debattieren, wozu wir im Irak im Einsatz sind, sterben Hunderttausende von Soldaten oder sind Opfer posttraumatischer Stress-Syndrome und haben lebenslang mit den körperlichen und seelischen Folgen ihres Kriegseinsatzes zu kämpfen." Der Bericht ist hier zu finden:
Shock and Awe - U. S. HealtH Costs of the War in Iraq
Gerd Marstedt, 20.11.2007
Doppelt so hohe Krankheitsrisiken für Mütter nach geplanten Kaiserschnitt-Geburten
 Knapp 100.000 Geburten hat jetzt ein internationales Forschungsteam näher analysiert. Erneut wurde deutlich, dass die immer häufiger angewendete Geburtmethode per Kaiserschnitt nicht so problemlos ist, wie viele Ärzte oder auch werdende Mütter unterstellen. Mütter, die per Kaiserschnitt entbunden hatten (sowohl bei einem zuvor geplanten wie auch beim sog. "intrapartum" Vorgehen, das erst während der Geburt aufgrund von Komplikationen beschlossen wird), wiesen nach der Geburt ein doppelt so hohes Risiko von Komplikationen auf. Die Sterberate war insgesamt zwar sehr niedrig, lag bei geplanten Kaiserschnitt-Geburten aber gleichwohl mehr als dreimal so hoch wie bei natürlichen Geburten. Die Forscher fanden allerdings auch heraus, dass die Kaiserschnittgeburt bei einer Steißlage des Kindes Komplikationsrisiken senkt.
Knapp 100.000 Geburten hat jetzt ein internationales Forschungsteam näher analysiert. Erneut wurde deutlich, dass die immer häufiger angewendete Geburtmethode per Kaiserschnitt nicht so problemlos ist, wie viele Ärzte oder auch werdende Mütter unterstellen. Mütter, die per Kaiserschnitt entbunden hatten (sowohl bei einem zuvor geplanten wie auch beim sog. "intrapartum" Vorgehen, das erst während der Geburt aufgrund von Komplikationen beschlossen wird), wiesen nach der Geburt ein doppelt so hohes Risiko von Komplikationen auf. Die Sterberate war insgesamt zwar sehr niedrig, lag bei geplanten Kaiserschnitt-Geburten aber gleichwohl mehr als dreimal so hoch wie bei natürlichen Geburten. Die Forscher fanden allerdings auch heraus, dass die Kaiserschnittgeburt bei einer Steißlage des Kindes Komplikationsrisiken senkt.
In der Studie wurden knapp 100.000 Datensätze von Geburten ausgewertet, die in über 120 Kliniken in acht Ländern Lateinamerikas in den Jahren 2004 und 2005 stattgefunden hatten. Die Daten wurden von insgesamt 15 Wissenschaftlern in den beteiligten Ländern erhoben und zentral in einem Forschungsinstitut in Stockholm in Kooperation mit der WHO aufbereitet und Analysiert. Bei der Auswahl der Kliniken achtete man auf eine Berücksichtigung unterschiedlicher Merkmale wie Finanzierung (Privatklinik oder Öffentliche Klinik), technische und personelle Ausstattung, Zahl der Geburten, Quote der Kaiserschnitt-Geburten usw.
Zentrale Befunde der Analyse, in der zahlreiche Faktoren auf Seiten der Mütter wie auch auf Seiten der Kliniken mitberücksichtigt und statistisch kontrolliert wurden, waren dann:
• Über alle ausgewerteten Indikatoren für medizinische Komplikationen hinweg (einschl. Todesfälle), weisen geplante Kaiserschnittgeburten ein 2,3 mal so hohes Risiko auf, Notfall-Kaiserschnitte ein 2 mal so hohes
• Die Sterbequote ist zwar mit 0.04% bzw. 0.06% sehr niedrig, gleichwohl aber 4-6mal so hoch wie bei Vaginalgeburten
• Das Risiko, nach der Geburt länger als 7 Tage in der Klinik bleiben zu müssen, ist um das 2.5fache erhöht
• Mütter müssen nach einer Kaiserschnittgeburt 2-3mal häufiger in eine Intensivstation eingewiesen werden
• Noch höher fällt die Quote für die Quote der Antibiotika-Behandlung aus (4-5mal höher)
• Lediglich bei einer Steißlage des Kindes erkennen die Wissenschaftler deutliche Vorteile der Kaiserschnitt-Geburtsmethode, die eine Senkung der Todesfälle bei den Säuglingen und das Risiko medizinischer Komplikationen bei den Müttern reduziert.
Die Wissenschaftler verweisen zwar darauf, dass ihre Studie einige Beschränkungen durch die Auswahl der Länder aufweist, machen aber zugleich deutlich, dass ihre Befunde sehr stark übereinstimmen mit Ergebnissen, die erst vor kurzem in den USA und Kanada veröffentlicht worden waren (vgl. "Geplante Kaiserschnitt-Geburten: Höhere Risiken als bislang angenommen").
Hier ist ein kostenloses Abstract der Studie zu finden: José Villar u.a.: Maternal and neonatal individual risks and benefits associated with caesarean delivery: multicentre prospective study (BMJ 2007;335:1025 (17 November), doi:10.1136/bmj.39363.706956.55, published 30 October 2007)
Gerd Marstedt, 18.11.2007
Meta-Analyse deckt neue Präventionsbarriere auf: Bei schlechtem Wetter gehen die Leute weniger spazieren
 Wer sich körperlich kaum bewegt, wird dick. Und Dicke bekommen eher Krankheiten wie Diabetes oder Bluthochdruck. So viel wusste man schon. Doch was hindert die Leute daran, körperlich aktiv zu werden? Nicht nur der "innere Schweinehund" oder die allgegenwärtige Verführung durch Fahrstühle und Rolltreppen sind schuld. Es gibt eine weitere Präventionsbarriere, die eine gehörige Portion mitschuldig ist für den Bewegungsmangel in unserer Zivilisation: Das schlechte Wetter. Dies hat jetzt eine Meta-Analyse von insgesamt 37 Studien gezeigt, die in der Zeitschrift "Public Health" veröffentlicht wurde.
Wer sich körperlich kaum bewegt, wird dick. Und Dicke bekommen eher Krankheiten wie Diabetes oder Bluthochdruck. So viel wusste man schon. Doch was hindert die Leute daran, körperlich aktiv zu werden? Nicht nur der "innere Schweinehund" oder die allgegenwärtige Verführung durch Fahrstühle und Rolltreppen sind schuld. Es gibt eine weitere Präventionsbarriere, die eine gehörige Portion mitschuldig ist für den Bewegungsmangel in unserer Zivilisation: Das schlechte Wetter. Dies hat jetzt eine Meta-Analyse von insgesamt 37 Studien gezeigt, die in der Zeitschrift "Public Health" veröffentlicht wurde.
Im Grunde sagt einem schon der gesunde Menschenverstand, so die Wissenschaftler, dass "Tageslicht, Extremtemperaturen oder starker Regen durchaus die körperliche Aktivität beeinflussen können, und dabei insbesondere auch das Spazierengehen, die bei allen Völkern wohl häufigste körperliche Betätigung. Daher ist das Wetter ein sehr bedeutsamer Einflussfaktor für das Bewegungsverhalten." Doch welche evidenz-basierten wissenschaftlichen Befunde gibt es hierzu? Bislang wenig. Daher führten die Forscher von der University of Ontario (Kanada) dazu eine systematische Literatur-Recherche durch und fanden Erstaunliches heraus. In insgesamt 37 Veröffentlichungen fanden sich empirische Belege, die ganz eindeutig nur den Schluss zulassen: Bei schlechtem Wetter, also wenn es stark regnet, hagelt oder stürmt, findet man ein sehr viel geringeres Maß an körperlicher Aktivität, ganz gleich, ob man das Joggen, Radfahren oder Spazierengehen als Indikator nimmt. In jenen Monaten hingegen, in denen das Wetter ganz schön ist, steigt augenblicklich auch der Bewegungslevel.
An den 37 näher inspizierten Studien nahmen insgesamt 291.883 Bürgerinnen und Bürger teil, 140.482 Männer und 152.085 Frauen aus acht Ländern. Und in 27 dieser Studien, also 73%, finden sich ganz eindeutige statistische Belege für den Einfluss des Wetters. Die Wissenschaftler fanden darüber hinaus jedoch auch noch einige spannende Detailbefunde:
• Die meisten Studien fanden heraus, dass das höchste Aktivitäts-Niveau in den Sommermonaten (mit meist schönem Wetter) zu finden ist. Dass eine einzelne Studie genau das Gegenteil herausfand (geringste Aktivität im Sommer) ließ sich nach eingehender Prüfung später dadurch erklären, dass diese Studie im Städtchen Galveston in Texas (bekannt durch den gleichnamigen Song von Glen Campbell "Galveston, oh Galveston, ...) durchgeführt wurde, wo im Sommer Temperaturen von 30 Grad Celsius und darüber herrschen.
• Während sich für die meisten Länder ein relativ homogenes Muster findet (im Sommer durchweg hohes Jogging-Aufkommen und vergleichbare Aktivitätsmuster), unabhängig von Bezirken, Distrikten usw., weicht die USA hiervon markant ab. Auch dies ließ sich jedoch später klären: Einige US-Bundessstaaten wie z.B. Alaska und Hawaii zeigen doch recht markante Klima-Abweichungen.
• Bei Kindern ist der Einfluss des Wetters besonders stark. Dies erklären die Wissenschaftler daraus, dass Kindern im Freien meist größere Bewegungsräume zur Verfügung stehen, im Vergleich zu eher einengenden Treppenhäusern, Garagen und Wohnzimmern, die auch bei schlechtem Wetter zum Spielen verfügbar sind.
In der Diskussion ihrer wissenschaftlichen Befunde formulieren die Forscher auch einige gesundheitspolitische Vorschläge, die bislang sträflich vernachlässigt wurden und im Rahmen zukünftiger Projekte zur Gesundheits- und Bewegungs-Förderung unbedingt berücksichtigt werden sollten.
• "In Regionen", so heißt es in ihrer Zusammenfassung, "wo längere Perioden mit schlechtem Wetter an der Tagesordnung sind, wären auch Indoor-Einrichtungen sinnvoll, Angebote, die körperliche Bewegung ermöglichen und zugleich vor Wettereinflüssen schützen."
• Und weiter heißt es: "Um mehr Bewegung bei Kindern zu erreichen, haben Wissenschaftler vorgeschlagen, man solle sie dazu ermuntern, mehr im Freien zu spielen. Leider ist es so, dass Kinder in diesem Alter meist beaufsichtigt werden müssen und Eltern haben zumeist wenig Lust, ihre Zeit auch bei Kälte und Nässe im Freien zu verbringen."
• Vorgeschlagen wird weiterhin, dass "in Gegenden mit häufigem und heftigem Regen Ressourcen für Indoor-Aktivitäten bereitgestellt werden sollten (z.B. Schwimmhallen). Für Monate mit kaltem Wetter sollten Angebote gemacht werden, die in diese Jahreszeit passen (z.B. Skilaufen)."
Ein kostenloses Abstract der Meta-Analyse ist hier nachzulesen: P. Tucker, J. Gilliland: The effect of season and weather on physical activity: A systematic review (Public Health (2007), Article in press, doi:10.1016/j.puhe.2007.04.009)
Gerd Marstedt, 13.11.2007
Erwerbstätigkeit, Arbeitslosigkeit, Einkommensniveau und das psychische Wohlbefinden von jungen Menschen
 Seit den 1990er Jahren sind konstant rund eine halbe Million Jugendliche arbeitslos. Vor allem gering qualifizierte junge Menschen haben überdurchschnittlich häufig Schwierigkeiten, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Dabei sind Jüngere in Ostdeutschland mit einer angespannteren Lage konfrontiert als die Gleichaltrigen in Westdeutschland. Während in Westdeutschland im Jahr 2001 - dem Vergleichszeitraum der hier näher betrachteten Studie - die Arbeitslosenquote der 15- bis 19-Jährigen bei 8 Prozent und der 20- bis 25- Jährigen bei 10 Prozent lag, erreichte sie im Osten 16 bzw. 23 Prozent.
Seit den 1990er Jahren sind konstant rund eine halbe Million Jugendliche arbeitslos. Vor allem gering qualifizierte junge Menschen haben überdurchschnittlich häufig Schwierigkeiten, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Dabei sind Jüngere in Ostdeutschland mit einer angespannteren Lage konfrontiert als die Gleichaltrigen in Westdeutschland. Während in Westdeutschland im Jahr 2001 - dem Vergleichszeitraum der hier näher betrachteten Studie - die Arbeitslosenquote der 15- bis 19-Jährigen bei 8 Prozent und der 20- bis 25- Jährigen bei 10 Prozent lag, erreichte sie im Osten 16 bzw. 23 Prozent.
Aus Sicht des Sozialstaats stellen Eintrittsprobleme von derartig vielen jungen Menschen in das Erwerbsleben sowohl eine Herausforderung seiner Problemverarbeitungsfunktion als auch seiner Finanzierung dar. Finanziell bedeutet ein späterer oder mit materiellen Einschränkungen verbundener Eintritt in das Erwerbsleben auch spätere und/oder niedrigere Beitragszahlungen bei gleichen Leistungsrechten dar. Die möglichen körperlichen und psychischen Befindlichkeitsstörungen oder Erkrankungen von Mitgliedern dieses Personenkreises können kurz- und mittelfristig zu einer höheren oder verstärkten Inanspruchnahme gesundheitlicher Versorgungsangebote oder auch langfristigen latenten Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit führen. Insofern ist auch aus Sicht sozialstaatlicher Gesundheitsvorsorge die Arbeitslosigkeit von Jugendlichen ein relevantes Problem.
Wie groß dieses Problem ist und worin es im Kern wirklich besteht, wurde bisher in Deutschland relativ selten oder in Fallstudien untersucht. Daher sind die Ergebnisse einer jetzt gerade veröffentlichten Studie des "Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB)", die auf der Analyse von Daten aller 15 bis 24-jährigen jungen Menschen basiert, die 1998 und 1999 für mindestens 90 Tage arbeitslos waren von großer Bedeutung.
Die Datenbasis der Untersuchung ist die deutsche Teilstichprobe der europäischen Vergleichsstudie "Übergänge aus Jugendarbeitslosigkeit". Dort wurden die TeilnehmerInnen zweimal sehr gründlich zu ihrer sozialen Situation und ihrem psychischen Wohlbefinden befragt. Die Befragungen fanden erstmals ein Jahr nach der Arbeitslosigkeit im Winter 1999/2000 statt und wurden 2001 telefonisch wiederholt. Bei der ersten Welle konnten insgesamt 1.918 Interviews realisiert werden. Davon nahmen 1.035 Jugendliche auch an der zweiten Befragung teil. Damit liegt eine so genannte Panelmortalität von 46 Prozent vor, die durchaus im Rahmen derartiger Studiendesigns liegen.
Die Studie stellt die Frage, wie sich das psychische Wohlbefinden (dieses umfasst Komponenten wie Kompetenz, Autonomie, Zielstrebigkeit und funktionierende soziale Netzwerke und hat zwei Dimensionen: die Zufriedenheit einer Person und wie viel Energie sie hat) von arbeitslosen Jugendlichen im Vergleich zu Jugendlichen in einem anderen Erwerbsstatus (z. B. Erwerbstätigkeit, Schule oder Ausbildung) unterscheidet und welche Rolle die finanzielle Situation dabei spielt.
"Die Haupthypothese ist, dass Erwerbstätigkeit sowohl eine Einkommensquelle als auch eine zentrale Ressource für soziale und psychische Bedürfnisse ist. Im Falle von Arbeitslosigkeit können diese Bedürfnisse nicht bzw. nicht ausreichend erfüllt werden, was sich in einem beeinträchtigen psychischen Wohlbefinden zeigt."
"Entgegen dieser Annahmen deuten die Befunde darauf hin, dass Arbeitslosigkeit das psychische Wohlbefinden eher in einem geringen Ausmaß beeinträchtigt. Dagegen stellt Erwerbstätigkeit eine zentrale Ressource dar...Die Längsschnittperspektive erlaubt kausale Rückschlüsse: Bei den jungen Männern steigert allein schon der neue Job das Wohlbefinden. Nehmen junge Frauen eine Erwerbstätigkeit auf, so stärkt dies in erster Linie ihr psychisches Wohlbefinden, wenn sich zugleich ihre subjektiv empfundene finanzielle Lage verbessert. Die Analysen zeigen, dass Erwerbstätigkeit ein zentraler Faktor für ein ausgeglichenes psychisches Wohlbefinden der jüngeren Männer ist. Bei den jungen Frauen steht der Einkommenserwerb im Vordergrund. Sie sind es jedoch auch, die überdurchschnittlich oft im Vergleich zu den Männern von relativer Einkommensarmut und finanziellen Restriktionen betroffen sind. Insbesondere diese jungen Frauen werden auf das Erwerbseinkommen angewiesen sein. Für die jungen Männer scheint Erwerbstätigkeit nicht nur zum Einkommenserwerb zu dienen sondern auch als Quelle sozialer Kontakte, Anerkennung und als Schritt in die Selbstständigkeit. Dieses Ergebnis widerlegt die Annahme, dass Erwerbstätigkeit und Einkommen gleichermaßen das psychische Wohlbefinden der jungen Männer und Frauen bestimmen."
Den 51 Seiten umfassenden IAB-Forschungsbericht, 13/2007 "Jugendarbeitslosigkeit und psychisches Wohlbefinden" von Brigitte Schels ist komplett und kostenlos als PDF-Datei von der IAB-Homepage herunterladbar.
Bernard Braun, 11.11.2007
Der natürliche Schlaf- und Wach-Rhythmus akzeptiert die Sommerzeit nicht
 Wenn in vielen Teilen der Welt im Frühjahr die Uhren wegen der Sommerzeit vorgestellt werden, dann stellt dies den menschlichen Körper vor erhebliche Probleme. Der natürliche Schlaf- und Aktivitätsrhythmus wird auch in den Sommermonaten durch den Sonnenaufgang gesteuert, egal, ob die Uhr nun eine Stunde vorgestellt wird oder nicht. Die von etwa einem Viertel der Weltbevölkerung vollzogene Zeitverschiebung um eine Stunde ist für das menschliche Gehirn eine so weit reichende Anforderung, dass daraus möglicherweise auch unerwünschte physiologische Reaktionen entstehen, die bis heute allerdings nicht erforscht sind. Ein Team von Chronobiologen hat jetzt die größte bislang durchgeführte Studie zu den biologischen Problemen der Sommerzeit durchgeführt und die Ergebnis in der Zeitschrift "Current Biology" veröffentlicht.
Wenn in vielen Teilen der Welt im Frühjahr die Uhren wegen der Sommerzeit vorgestellt werden, dann stellt dies den menschlichen Körper vor erhebliche Probleme. Der natürliche Schlaf- und Aktivitätsrhythmus wird auch in den Sommermonaten durch den Sonnenaufgang gesteuert, egal, ob die Uhr nun eine Stunde vorgestellt wird oder nicht. Die von etwa einem Viertel der Weltbevölkerung vollzogene Zeitverschiebung um eine Stunde ist für das menschliche Gehirn eine so weit reichende Anforderung, dass daraus möglicherweise auch unerwünschte physiologische Reaktionen entstehen, die bis heute allerdings nicht erforscht sind. Ein Team von Chronobiologen hat jetzt die größte bislang durchgeführte Studie zu den biologischen Problemen der Sommerzeit durchgeführt und die Ergebnis in der Zeitschrift "Current Biology" veröffentlicht.
Im Rahmen einer Fragebogen-Erhebung untersuchten Till Roenneberg und Thomas Kantermann, Biologen an der Münchener Ludwig-Maximilians-Universität, zusammen mit zwei niederländischen Kollegen die zeitlichen Schlafstrukturen von 55.000 Menschen in Mitteleuropa. Ihre Befragung hat nun gezeigt, dass die Umstellung auf Sommerzeit von der inneren menschlichen Uhr nicht nachvollzogen wird. Die Umfrageteilnehmer mussten sowohl für ihre Arbeitstage, als auch für freie Tage am Wochenende genaue Zeitangaben machen zu ihren Schlaf- und Aufsteh-Zeiten. In der Auswertung der Ergebnisse zeigte sich dann, dass die Aufstehzeit an freien Tagen, an denen man also nicht durch die Arbeit zu einem bestimmten Verhalten gezwungen war, sich nach dem Zeitpunkt von Sonnenaufgang und Dämmerung richtete - und nicht nach der durch die Sommerzeit verschobenen Uhrzeit.
Im Rahmen einer kleineren experimentellen Untersuchung überprüfte man dann noch bei 50 Personen mit Messgeräten die exakten Schlaf- und Aktivitätsmuster. Dabei wurden Personen mit sehr unterschiedlichen Gewohnheiten berücksichtigt, Frühaufsteher ebenso wie Langschläfer und "Nachteulen". Auch hier zeigte sich: Der 24-Stunden-Rhythmus der Teilnehmer passte sich an den zeitlich frei planbaren Tagen und insbesondere am Wochenende nicht an die Sommerzeit an. Genauso wie im Tierreich - so das Fazit der Wissenschaftler - orientiert sich der sogenannte "zirkadiane Rhythmus", also die "innere Uhr" des Menschen am Tageslicht - und dies auch über die Jahreszeiten mit dem unterschiedlichen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang hinweg.
Die Forschergruppe spricht die Befürchtung aus, dass die in jedem Jahr vollzogene Umstellung der Sommerzeit auf lange Sicht hin sogar gesundheitsgefährlich sein könnte. Zwar haben sie in ihrer Studie nach solchen Hinweisen nicht gesucht, betrachten solche Folgen aber nicht als eine rein theoretische Möglichkeit. Denn die Umstellung der Zeit um "nur eine Stunde" hat sehr viel weiter reichende Effekte, wenn man die erforderlichen zeitlichen Umstellungen im Jahresrhythmus mitberücksichtigt. Im Frühjahr wird die innere Uhr des Menschen mit einem Schlag um vier Wochen zurückgeworfen, so als ob der Kalender plötzlich wieder auf den Monat Februar zurück geblättert wird. Und im Herbst wird dann noch einmal eine schlagartige Anpassung um 6 Wochen verlangt.
Diese Umstellungen lassen sich in ihrer Tragweite etwa so veranschaulichen, so die Forscher, als wenn man die deutsche Bevölkerung im Frühjahr nach Marokko transportiert und im Herbst wieder zurück. Die Studie ist hier im Volltext (PDF) nachzulesen: Thomas Kantermann u.a.: The Human Circadian Clock's Seasonal Adjustment Is Disrupted by Daylight Saving Time (Current Biology 17, 1-5, November 20, 2007)
Gerd Marstedt, 26.10.2007
Junge Forscher entlarven pseudo-wissenschaftlichen Hokuspokus in der Werbung für Gesundheits-Produkte
 Wussten Sie eigentlich, dass in diesem Augenblick, da Sie im Internet surfen und auf Ihren Monitor schauen, gefährliche elektromagnetische Strahlung auf Ihren Körper einwirkt? Und dass es dagegen ein einfaches Mittel gibt, eine Software nämlich namens "Computer Clear", die auf dem PC im Hintergrund läuft und über den Monitor rund 34.000 homöopathische Mittel ausstrahlt, so dass die gesundheitsgefährliche Wirkung der Strahlen gebannt wird? Wussten Sie nicht? Macht nichts, denn es handelt sich um pseudo-wissenschaftlichem Hokuspokus, den viele Unternehmen in ihrer Werbung verbreiten, um Gesundheitsängste in der Bevölkerung für den Absatz ihrer Produkte auszunutzen. Eine Initiative junger englischer Wissenschaftler hat jetzt einige besonders dummdreiste Werbebotschaften aufgegriffen und bei den Hersteller-Firmen telefonisch nachgefragt. Heraus kam Erstaunliches.
Wussten Sie eigentlich, dass in diesem Augenblick, da Sie im Internet surfen und auf Ihren Monitor schauen, gefährliche elektromagnetische Strahlung auf Ihren Körper einwirkt? Und dass es dagegen ein einfaches Mittel gibt, eine Software nämlich namens "Computer Clear", die auf dem PC im Hintergrund läuft und über den Monitor rund 34.000 homöopathische Mittel ausstrahlt, so dass die gesundheitsgefährliche Wirkung der Strahlen gebannt wird? Wussten Sie nicht? Macht nichts, denn es handelt sich um pseudo-wissenschaftlichem Hokuspokus, den viele Unternehmen in ihrer Werbung verbreiten, um Gesundheitsängste in der Bevölkerung für den Absatz ihrer Produkte auszunutzen. Eine Initiative junger englischer Wissenschaftler hat jetzt einige besonders dummdreiste Werbebotschaften aufgegriffen und bei den Hersteller-Firmen telefonisch nachgefragt. Heraus kam Erstaunliches.
"Sense about Science" (etwa: "Wissenschaft mit klarem Verstand") heißt die Initiative junger englischer Forscher, die sich einigen Jahren für rationale Argumente und mehr "Evidenz" in wissenschaftlichen Diskussionen ebenso wie in der journalistischen Berichterstattung engagiert. Sie sind gegen Medienberichte über Handy-Strahlen angegangen, die "unser Gehirn braten" und über Berichte zu "genetisch manipulierten Frankenstein-Nahrungsmitteln". Auf ihrer Website "Sense about Science" räumen sie mit Irrtümern und Fehlinformationen auf, über homöopathische Arzneimittel gegen Malaria und über die vermeintliche Objektivität der Begutachtung ("Peer-Reviews") wissenschaftlicher Veröffentlichungen.
Jetzt haben sie sich der Vielzahl von Werbebotschaften angenommen, in denen Unternehmen mit den Gesundheitsängsten der Bevölkerung spielen und ihnen mit viel pseudo-wissenschaftlichem Getöse gesunde oder gesunderhaltende Produkte verkaufen wollen. Dazu haben sie sich 11 größere Firmen ausgesucht, die ihre Produkte mit hahnebüchenen wissenschaftlichen Informationen bewerben, und bei diesen Firmen telefonisch um nähere Auskünfte zu diesen Informationen gebeten. In einer 16seitigen Broschüre werden die Produkte und Werbebotschaften kurz vorgestellt und dann detailliert die Telefongespräche wiedergegeben.
Da ist etwa das Produkt "Computer Clear", eine Software zum Preis von etwa 60 Euro, die auf dem PC installiert dann im Hintergrund läuft und "etwa 34.000 homöopathische Mittel aussendet, um das körperliche Ungleichgewicht zu harmonisieren". "Computer Clear", so die Werbebotschaft auf der Website, "reduziert Ängste und Stress dramatisch, verbessert Aufmerksamkeit und Konzentration, reduziert Kopfschmerzen". Im Telefongespräch, das der Computer-Experte Tom Sheldon dann mit einem leitenden Mitarbeiter der Hersteller-Firma führt, werden dann zumindest ebenso groteske Erklärungen gegeben wie in der Werbung selbst. Bei den "homöopathischen Mitteln", die das Programm aussendet, handelt es sich danach um "Bioresonanz Muster", bei denen sich der Körper jene aussucht, die sein Gleichgewicht wieder herstellen.
Oder da wäre das Produkt "Champneys Detox Patches", ein Pflaster, das verspricht, "über Nacht gefährliche Giftstoffe aus dem Körper heraus zu lösen", Gifte, wie zum Beispiel Fettsäuren, Cholesterol, Zucker oder Koffein. Das Pflaster (die Packung mit 14 Pflastern zu 30 Euro) soll nachts an den Fußsohlen aufgelegt werden, dann ist es noch ganz weiß. Am Morgen aber, wenn man es wieder abnimmt, ist es braun verfärbt - ein Beweis, dass die Giftstoffe herausgelöst wurden! Am Telefon erfährt die Biologin Aarathi Prasad dann noch mehr Kuriositäten, aber auch die betrübliche Botschaft, dass es bis zu zehn Jahren dauern kann, bis alle Gifte aus dem Körper entfernt sind.
11 ausführliche Telefongespräche werden von Mitgliedern der Initiative "sense about science" geführt, über das Marketing für "Parasite Cleanse Kit", ein aus drei Kräutern bestehendes Reinigungs-Set gegen Parasiten, über die Werbebotschaft der Sandwich-Hersteller "Pret a Manger", man habe "obskure Chemikalien" aus seinen Produkten entfernt. Die von den Wissenschaftlern ins Visier genommenen Produkte stammen dabei von durchaus namhaften und renommierten Unternehmen wie beispielsweise dem Nahrungsmittel-Konzern Nestlé, der Supermarkt-Kette Coop oder der Sandwich-Kette "Pret a Manger", was deutlich macht, dass wissenschaftlicher Hokuspokus im Marketing keineswegs ein Markenzeichen kleiner Gauner und windiger Internet-Abzocker ist.
Die Mitschriften der Telefonate sind überaus amüsant und erheiternd, man muss immer wieder schmunzeln, wenn man die windigen Ausreden und hohlen Phrasen der Unternehmens-Mitarbeiter liest, die von jungen, sachkundigen Wissenschaftlern befragt werden. Das Bemühen von "sense about science" allerdings war weniger darauf ausgerichtet, Real-Satire zu dokumentieren, sondern durchaus ernst: "Wir werden überfüttert mit pseudo-wissenschaftlichen Behauptungen, es werden Mythen und Fehlinformationen über Produkte und Dienstleistungen verbreitet, die sich Ängste der Bevölkerung zunutze machen. Warum eigentlich, wenn wissenschaftliche Veröffentlichungen begutachtet und kontrolliert werden, geschieht dies nicht auch mit den Behauptungen in der Werbung?"
Hier ist die Broschüre mit der Dokumentation der Telefongespräche "There Goes the Science Bit"
Gerd Marstedt, 20.10.2007
Schlechte Beziehungen zur am nächsten stehenden Person erhöhen das Risiko für Herzerkrankungen um ein Drittel.
 Dem Volksmund ist der hier aufwändig analysierte Zusammenhang zwischen einem negativen Zustand der Beziehungen mit den engsten verwandten oder befreundeten Personen und Herzerkrankungen längst bekannt, nämlich dann, wenn er beispielsweise vom "gebrochenen Herzen" spricht.
Dem Volksmund ist der hier aufwändig analysierte Zusammenhang zwischen einem negativen Zustand der Beziehungen mit den engsten verwandten oder befreundeten Personen und Herzerkrankungen längst bekannt, nämlich dann, wenn er beispielsweise vom "gebrochenen Herzen" spricht.
Britische Wissenschaftler wollten es noch etwas präziser wissen und untersuchten dazu im Rahmen der prospektiven "Whitehall II"-Kohortenstudie über einen Zeitraum von durchschnittlich 12,2 Jahren das Auftreten von Herzerkrankungen und die Qualität der engsten interpersonalen Beziehungen (erfasst mit dem "Close Persons Questionnaire") von 9.011 (6.114 Männer und 2.897 Frauen) britischen Staatsbediensteten. Diese hatten zu Beginn der Studie keine Vorgeschichte mit Herzerkrankungen.
Über deren soziodemografischen Charakteristika (z. B. Alter, Geschlecht, Familienstand und Beschäftigungsniveau), ihre biologische Verfassung (z. B. Übergewicht, Bluthochdruck, Diabetes oder erhöhte Cholesterinwerte), psychosoziale Verfassung (z. B. Depression, Arbeitsstress) und ihr Gesundheitsverhalten (z. B. Rauchen, Alkoholkonsum, Bewegungsverhalten und den Konsum von Früchten und Gemüse), also alle möglichen tatsächlichen oder vermutlichen Einflussfaktoren oder Confounder gibt es zusätzlich umfangreiche Informationen. Durch Adjustierung und damit eine Kontrolle bzw. den Ausschluss des Einflusses der genannten zusätzlichen Einflussfaktoren konnten die Forscher den speziellen Einfluss des Zustands der engsten persönlichen Beziehungen auf Herzerkrankungen messen.
Übrig blieben folgende Zusammenhänge:
• Personen mit einem negativen Zustand der Beziehungen (meistens zu ihrem Lebenspartner) hatten unter Kontrolle der soziodemografischen und biologischen Faktoren und einiger Dimensionen der sozialen Unterstützung ein um rund 34 % höheres und statistisch signifikantes Risiko für eine Herzerkrankung als Personen ohne derartige Probleme (hazard ratio: 1,34).
• Die Beziehung wird etwas schwächer, bleibt aber weiterhin statistisch signifikant, wenn auch noch der Einfluss einer Depression oder neurotischen Störung ("negative affectivity") kontrolliert wird (hazard ratio: 1,25).
• Das Geschlecht und die soziale Position wirken sich zwar auf die Häufigkeit negativer enger Beziehungen aus, haben aber keinen statistisch signifikanten Einfluss auf die Herzerkrankungs-Inzidenz.
• Interessant ist schließlich auch noch, dass der Zusammenhang der Qualität zwischenmenschlicher Beziehungen mit Herzerkrankungen auch dann praktisch gleich blieb ("remained virtually unchanged"), wenn man die gesundheitlichen Verhaltensweisen kontrollierte. Selbst wenn man also den Einfluss möglicherweise unterschiedlicher Verhaltensweisen rechnerisch ausschloss, blieb das um 34 % höhere Risiko für die Untersuchungsgruppe erhalten.
Kostenfrei erhält man das Abstract des Aufsatzes "Negative Aspects of close relationships and heart disease" von Roberto De Vogli, Tarani Chandola und Gideon Marmot aus der aktuellen Ausgabe der us-amerikanischen Fachzeitschrift "Archives of Internal Medicine" (2007; 167(18): 1951-1957 vom 8. Oktober 2007).
Bernard Braun, 13.10.2007
"Fröhliche Wissenschaft" oder über welche gesundheitsbezogenen Probleme endlich mal geforscht worden ist!
 Wer zwischen all den wichtigen Forschungsergebnissen aus randomisierten kontrollierten Studien (RCT) und den geballten Kenntnissen über "Evidence based medicine", Lohnnebenkosten und Krankenhausführer mal nach etwas Entspannung sucht, findet sie - auch noch in der Wissenschaft. Und da ja angeblich Lachen gesund ist, kann der folgende Ausflug sogar unter der Überschrift "Stärkung der Eigenverantwortung" rubriziert werden.
Wer zwischen all den wichtigen Forschungsergebnissen aus randomisierten kontrollierten Studien (RCT) und den geballten Kenntnissen über "Evidence based medicine", Lohnnebenkosten und Krankenhausführer mal nach etwas Entspannung sucht, findet sie - auch noch in der Wissenschaft. Und da ja angeblich Lachen gesund ist, kann der folgende Ausflug sogar unter der Überschrift "Stärkung der Eigenverantwortung" rubriziert werden.
Aufhänger sind die gerade eben zum 17. Mal von Mitgliedern der Harvard University in Cambridge/Boston (Mass.), der Radcliffe University und dem Magazin "Annals of Improbable Research" im Vorfeld der "ernsten" Nobelpreise vergebenen so genannten Ig-Nobelpreise.
"Ig" steht für "ignoble=unwürdig, schmachvoll, schändlich" und meint eine "satirische Auszeichnung...für unnnütze, unwichtige oder skurrile wissenschaftliche Arbeiten... Bedingung für eine Nominierung ist, dass die Errungenschaft "nicht wiederholt werden kann oder wiederholt werden sollte". Weiterhin muss das Forschungsthema neuartig sein - niemand darf vorher eine ähnliche wissenschaftliche Arbeit abgeliefert haben. Nach der Wissenschaftszeitschrift "Nature" werden die Preise für Arbeiten verliehen, die einen 'zuerst zum Lachen, dann zum Nachdenken bringen'" (Wikipedia).
Und da sich, wen wundert das, viele der so ausgezeichneten Forschungsarbeiten im weiten Bereich von "Gesundheit" bewegen, sollen den Forums-Lesern entsprechende Hinweise nicht vorenthalten bleiben.
Zu den preiswürdigen Arbeiten gehörten u.a.:
• Der Nachweis, dass Viagra zumindest Hamstern auch gegen Jetlag hilft. Solange es aber den Hamstern nur bei ostwärts gerichteten Flügen hilft, wird die Folgeuntersuchung bei Schichtarbeitern und Vielfliegern noch ein Weilchen auf sich warten lassen. Die Perspektive Viagra und vergleichbare Mittel demnächst als Hilfsmittel der betrieblichen Gesundheitsförderung per Nachttarifvertrags-Zulage und auf Krankenschein zu erhalten, könnte aus dem heutigen Spaß schnell Ernst werden lassen. Der "Gemeinsame Bundesausschuss" wird dann neu über die Aufnahme in den Arzneimittelkatalog der GKV nachdenken müssen!
• Eine bis auf die Ebene von Milben (das weiß aber schon fast jedes Kind), und außerdem der Insekten, Spinnen, Pseudoskorpione, Krebstiere, Algen, Farne und Pilze detaillierte Analyse des Ökosystems Bett - in niederländischen Matratzen.
• Der an der Uni Barcelona gelungene Nachweis, dass Ratten rückwärts gesprochenes Japanisch nicht von rückwärts gesprochenem Holländisch unterscheiden können. Wie es mit Deutsch oder Spanisch ist könnten wir bis nächstes Jahr auch noch untersuchen lassen, um nur ja keine Kommunikationsmöglichkeit außer acht zu lassen.
• Die Entwicklung eines speziellen Gases durch die US-Luftwaffe, das gegnerische Soldaten in Sextaumel versetzen kann: "Fruchtlose Kriege durch furchtlose Triebe"!?
• Gesundheitliche Risikoforschung bei Schwertschluckern: Welche medizinischen Probleme (und welche Nebenwirkungen) entstehen beim schneidigen Genuss der mindestens zwei Zentimeter breiten und 48 Zentimeter langen Stahlklinge?
• Ein ernährungswissenschaftliches Projekt, das durch geschicktes Nachfüllen einen scheinbar unstillbaren Appetit auf Suppe nachwies, wenn man unbemerkt nachfüllt und obwohl benachbarte Esser schon längst fertig sind.
Weitere Preisbeiträge, Einzelheiten und Links zu den Abstracts oder Beiträgen in nicht selten renommierten Fachzeitschriften (z. B. Nature, British Medical Journal, Proceedings of the National Academy of Scienes) finden sich unter der Überschrift "Vanille, Viagra und Wanzen im Bett" in einem am 6. Oktober 2007 veröffentlichten und kostenfreien vierseitigen Beitrag im Online-Dienst "Wissenschaft-online".
Und hier ist die Homepage des Preis-Kommittees: Improbable Research: The Ig® Nobel Prizes
Bernard Braun, 7.10.2007
Über die hundertjährigen Wurzeln, Aus- und Umtriebe der Sozialhygiene, Sozialmedizin und Public Health in Deutschland
 Wer nicht der irrigen Meinung ist, Public Health sei eine Erfindung in den USA oder gäbe es in Deutschland inhaltlich erst seit den 1990er Jahren, tut sich manchmal schwer mit dem Finden der langen und weiten Wurzeln z. B. der Beschäftigung mit dem Verhältnis von Krankheit und sozialer Lage oder der Gesundheitsgefährdung aufgrund von Lebens- und Arbeitsbedingungen einzelner Bevölkerungsgruppen und der sich daraus ergebenden Präventionsstrategien.
Wer nicht der irrigen Meinung ist, Public Health sei eine Erfindung in den USA oder gäbe es in Deutschland inhaltlich erst seit den 1990er Jahren, tut sich manchmal schwer mit dem Finden der langen und weiten Wurzeln z. B. der Beschäftigung mit dem Verhältnis von Krankheit und sozialer Lage oder der Gesundheitsgefährdung aufgrund von Lebens- und Arbeitsbedingungen einzelner Bevölkerungsgruppen und der sich daraus ergebenden Präventionsstrategien.
Anlässlich der Würdigung der 1905 gegründeten "Gesellschaft für sociale Medizin, Hygiene und Medicinalstatistik" als einer Vorgängerin der heutigen "Deutschen Gesellschaft für Sozialmedizin und Prävention (DGSMP)" legten zwei Sozialmedizinhistoriker, Udo Schagen und Sabine Schleiermacher, bereits 2005 eine interessante und hilfreiche Materialsammlung auf CD vor.
Anhand von Dokumenten, Aufsätzen und Biographien werden
• Entwicklungslinien, Selbstverständnis und ProtagonistInnen sozialer Medizin (u.a. von Alfred Grotjahn, Erwin Jahn, Salomon Neumann, Hans Schaefer, Ludwig Teleky oder Kurt Winter) in Deutschland vorgestellt.
• Einzelne Beiträge (z. B. von Bernt-Peter Robra, Dietrich Milles, Jens-Uwe Niehoff) widmen sich der aktuellen Standortbestimmung von Sozialmedizin.
• Ausgewählte Originaltexte (z. B. Ludwig Teleky [1910], Die Aufgaben und Ziele der sozialen Medizin; Mosse/Tugendreich [1913], Krankheit und soziale Lage; Manfred Pflanz [1956], Aufgaben und Ziele sozialwissenschaftlicher Forschung in der Medizin oder Friedrich Wilhelm Schwartz [1995], Entwicklung von Public Health in Deutschland) , biographische und bibliographische (z.B. Bibliographie ausgewählter Literatur zur deutschen Sozialmedizin von Robra oder Die Geschichte der Zeitschrift "Das Gesundheitswesen" von 1888 bis 2000 von Gostomzyk) Informationen erleichtern den Zugang zu historischen Basisinformationen für Lehr- und Unterrichtszwecke.
Weitere Einzelheiten zum Inhalt der CD finden Sie hier.
Bestellen kann man die CD-Rom "100 Jahre Sozialhygiene, Sozialmedizin und
Public Health in Deutschland" herausgegeben von Udo Schagen und Sabine Schleiermacher (ISSN: 1432 - 3958) für 12 Euro (einschließlich Verpackung und Versand) beim Institut für Geschichte der Medizin (Sabine Selle), Klingsorstr. 119, 12203 Berlin (Tel.: 030/83009230 oder Fax: 030/83009258).
Nachtrag 2012: Die Beiträge sind jetzt auf einer Website veröffentlicht und als PDF downloadbar
Website 100 Jahre Sozialhygiene, Sozialmedizin und Public Health in Deutschland
Bernard Braun, 7.9.2007
"Ulm ist die gesündeste deutsche Stadt" - Oder: Welch schöne Spielerei mit Statistik möglich ist
 Claudia Diederichs, Ärztin und Dozentin an der Medizinischen Hochschule Hannover, hat im Auftrag der Deutschen Angestellten Krankenkasse (DAK) und der Zeitschrift "Healthy Living" einen Gesundheitsatlas erstellt, in dem 81 deutsche Großstädte nach ihrem "Gesundheitswert" eingestuft werden. Dutzende statistischer Indikatoren wurden dazu verwendet, die Sonnenscheindauer in der Stadt und die Altersstruktur, die Lebenserwartung der Einwohner und die Zahl ihrer Theaterbesuche, die Feinstaub- und Stickstoffdioxidbelastung, die Zahl der Sozialhilfeempfänger und Arbeitslosen. Sieben unterschiedliche Rubriken wurden zur Bewertung verwendet, für die jeweils eine große Zahl einzelner Indikatoren herangezogen wurde: Gesundheitszustand, Umwelt, Wohnen und Erholung, medizinische und soziale Versorgung, soziale und wirtschaftliche Lage, Klima, Freizeit und Beziehungen, Altersstruktur.
Claudia Diederichs, Ärztin und Dozentin an der Medizinischen Hochschule Hannover, hat im Auftrag der Deutschen Angestellten Krankenkasse (DAK) und der Zeitschrift "Healthy Living" einen Gesundheitsatlas erstellt, in dem 81 deutsche Großstädte nach ihrem "Gesundheitswert" eingestuft werden. Dutzende statistischer Indikatoren wurden dazu verwendet, die Sonnenscheindauer in der Stadt und die Altersstruktur, die Lebenserwartung der Einwohner und die Zahl ihrer Theaterbesuche, die Feinstaub- und Stickstoffdioxidbelastung, die Zahl der Sozialhilfeempfänger und Arbeitslosen. Sieben unterschiedliche Rubriken wurden zur Bewertung verwendet, für die jeweils eine große Zahl einzelner Indikatoren herangezogen wurde: Gesundheitszustand, Umwelt, Wohnen und Erholung, medizinische und soziale Versorgung, soziale und wirtschaftliche Lage, Klima, Freizeit und Beziehungen, Altersstruktur.
Herausgekommen ist dann wieder einmal das schon aus Arbeitsmarktstatistiken und PISA-Tests hinlänglich bekannte Nord-Süd-Gefälle. Ulm rangiert auf der Hitliste der gesündesten deutschen Städte ganz vorne auf Rang 1, dicht gefolgt von Erlangen und Heidelberg. Ganz am Schluss rangiert die Stadt Herne. Aber der Kohlenpott schneidet insgesamt mehr als schlecht ab. Auf den Plätzen 71-81, also ganz weit unten bei den kränkesten deutschen Gemeinden liegen gleich sieben Ruhrgebiets-Städte.
Für die verwendeten sieben Rubriken gibt es unterschiedliche Gewichtungsfaktoren, so wie bei der Stiftung Warentest die technische Ausstattung eines Elektroherds anders gewichtet wird als die Sicherheit oder der Service. Das Klima geht im Städtetest nur mit 4,35% in die Berechnungen ein, Freizeitbedingungen mit 10,14% schon etwas mehr. Am meisten schlagen jedoch die soziale und wirtschaftliche Lage mit 36,23 % zu Buche, also Abiturientenquote und Weiterbildungsmöglichkeiten, Einkommensstruktur und Sozialhilfeempfänger. Leider erfährt man nirgends, wie diese hochgenauen Prozentwerte zustande gekommen sind, auch wenn man seine Vermutungen hat über zugrunde liegende statistische Regressionsanalysen.
Aber irgendwie hat tatsächlich alles, was hier an statistischen Indikatoren versammelt wurde, schon mit Gesundheit zu tun. Denn viel Feinstaub ist ebenso wenig gesund wie fehlende Arbeitsplätze oder zu wenig Ärzte und Klinikbetten. Andererseits tauchen dann auch wieder Fragen auf: Warum wird die Zahl der Theaterbesuche als besonders gesund bewertet und nicht die Besuche von Trab- und Galopprennbahnen? Warum ist die Zahl der Sonnenscheinstunden so besonders gesund - liest man in letzter Zeit nicht immer wieder über Hautkrebsrisiken?
Doch das sind Detailaspekte in Anbetracht der Kardinalfrage: Was ist denn bitteschön eine "gesunde Stadt"? Eine, die lebendig und laut und vital ist, oder eine, die Pop-Konzerte nach 22 Uhr wegen der Lärmbelästigung von Anwohnern verbietet? Eine, die ihre Asylanten, Obdachlosen und Junkies in der City betreut oder sie (hygienisch begründet) in menschenleere Außenquartiere verbannt? Eine, die "Lebensqualität" insbesondere in Schrebergärten und Naherholungsgebieten sieht, oder eine, die voll auf Wirtschaftsförderung und Industrialisierung setzt, das Gesundheitsrisiko "Arbeitslosigkeit" gravierender einschätzt als die Folgen von Flugzeug- und Autolärm, von Industrieabgasen und Wald-Zerstörung? Die Antwort wird je nach politischem Standort, nach Lebensalter und Familienstand, nach kulturellen und sozialen Interessenprioritäten sehr unterschiedlich ausfallen. Und auch wenn der politisch "vernünftige" Kompromiss als Konflikt-Lösung zitiert wird, ändert dies nichts daran, dass "die" Stadtbewohner äußerst divergente Ansprüche im Hinblick auf Lebensqualität, sehr diskrepante Kriterien für gesundheitsförderliche Wohn- und Freizeitbedingungen haben. Im Städte-Ranking von Claudia Diederichs wird alles ein bisschen berücksichtigt und nebeneinandergestellt, mit Gewichtungsfaktoren, die im Dunkeln bleiben.
Noch problematischer ist jedoch, dass der "Gesundheitswert" einer Stadt völlig undiskutiert bleibt. Ist das politische Bemühen einer Kommune gemeint, ihren Einwohnern gesundheitsförderliche Lebensbedingungen zu schaffen? Dann sind hier Kriterien wie Temperatur und Sonnenscheinstunden, aber auch die Altersstruktur und Lebenserwartung fehl am Platz. Und wann sind die Bürger einer Stadt besonders gesund? Wenn sie eine hohe Lebenserwartung haben, seltener chronisch erkranken, besonders glücklich und mit dem Leben zufrieden sind, ein hohes Einkommen oder Bildungsniveau aufweisen, seltener zum Arzt gehen? All dies sind keineswegs neue Fragen, sie wurden in der Vergangenheit schon häufig diskutiert, auch im Rahmen der "Gesunde-Städte-Initiativen", die dann aufzeigten, wie kontrovers unterschiedliche politische Maßnahmen zur Gesundheitsförderung bewertet werden. Die neue Flughafen-Startbahn schafft Arbeitsplätze (Arbeitslosigkeit ist ein hohes Erkrankungsrisiko), aber bringt auch massive Lärmbelästigungen mit sich.
Leider bietet das Städte-Ranking nicht einen einzigen Satz, um diese Diskussion zu beleben, sondern bietet nur ein buntes Statistik-Potpourri, das Ulmer Kommunal-Politiker jubeln lässt und ihre Herner Kollegen missmutig macht. Dass eine Zeitschrift wie "Healthy Living" damit ihren Bekanntheitsgrad steigern möchte, kann man akzeptieren. Dass eine große Angestellten-Krankenkassen sich hier ohne jeden Kommentar und Einmischung beteiligt, wirft Fragen auf.
• Hier ist eine kurze Pressemitteilung der DAK: Erster Gesundheits-Atlas für Deutschland: Ulm erhält HEALTHY LIVING-PREIS "Gesündeste Stadt 2007"
• Die Übersichtskarte der Städte in der Zeitschrift "Healthy Living"
• Die kompletten Ergebnisse der Städte-Bewertung als PDF-Datei
• Die wissenschaftliche Basis für das große Städte-Ranking
• Ein kritischer Kommentar von Prof. Johannes Haerting, Direktor des Institut für Medizinische Epidemiologie, Biometrie und Informatik der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg: Professor Haerting übt Kritik am "Gesundheitsatlas"
Gerd Marstedt, 28.8.2007
Investitionen in die Medizin oder ins Bildungssystem: Was hätte größeren Einfluss auf die Senkung der Mortalitätsraten?
 Dass die steigende Lebenserwartung der letzten 200 Jahre weniger auf Fortschritte der Medizin, sondern sehr viel mehr auf allgemeine Verbesserungen der Arbeits- und Lebensbedingungen zurückzuführen ist (Hygiene, sanitäre Anlagen, Ernährung), hat Thomas McKeown 1976 in seinem Buch "The Role of Medicine: Dream, Mirage, or Nemesis?" eindrücklich dargestellt. In dieser durchaus medizinkritischen (aber nicht medizinfeindlichen) Tradition diskutieren jetzt vier amerikanische Wissenschaftler der Universitäten Richmond und Washington in einer Veröffentlichung im "American Journal of Public Health" die Frage: Wären vermehrte Investitionen ins Bildungs- und Erziehungssystem nicht möglicherweise sehr viel eher geeignet, die Lebenserwartung zu verbessern als staatliche Ausgaben für medizinisch-technischen Forschungsprojekte und Versorgungseinrichtungen?
Dass die steigende Lebenserwartung der letzten 200 Jahre weniger auf Fortschritte der Medizin, sondern sehr viel mehr auf allgemeine Verbesserungen der Arbeits- und Lebensbedingungen zurückzuführen ist (Hygiene, sanitäre Anlagen, Ernährung), hat Thomas McKeown 1976 in seinem Buch "The Role of Medicine: Dream, Mirage, or Nemesis?" eindrücklich dargestellt. In dieser durchaus medizinkritischen (aber nicht medizinfeindlichen) Tradition diskutieren jetzt vier amerikanische Wissenschaftler der Universitäten Richmond und Washington in einer Veröffentlichung im "American Journal of Public Health" die Frage: Wären vermehrte Investitionen ins Bildungs- und Erziehungssystem nicht möglicherweise sehr viel eher geeignet, die Lebenserwartung zu verbessern als staatliche Ausgaben für medizinisch-technischen Forschungsprojekte und Versorgungseinrichtungen?
Die Antwort der Wissenschaftler ist ein klares "ja". Als Begründung hierfür führen sie die Ergebnisse eines statistisches Experiments an, bei dem sie Mortalitäts-Daten des National Center for Health Statistics (NCHS) aus den Jahren 1996-2002 verwendet haben. Dort aufgeführt sind für die USA repräsentative Zahlenangaben über Todesfälle und sozialstatistische Angaben der Verstorbenen, wobei die Forschungsgruppe das Bildungsniveau der Verstorbenen in ihren Analysen verwendete.
In der statistischen Analyse wurde dann zwei Fragen nachgegangen:
• Wie viele Leben wurden im Beobachtungszeitraum 1996-2002 aufgrund des medizinisch-technischen Fortschritts gerettet? Als Indikator hierfür galt der generelle Rückgang der Mortalität in diesen Jahren, der (altersstandardisiert) ein Minus von etwa 25.000 Sterbefällen im Jahr ausmachte. Dabei erkennen die Forscher zwar, dass diese Senkung der Todesfälle keineswegs allein der Medizin zuzuschreiben ist, räumen der Medizin aber im Rahmen ihrer Argumentation diese Alleinverantwortung zunächst einmal ein. Insgesamt kommen sie damit für die siebenjährige Phase auf eine Summe von etwa 178.000 "Leben, die durch den medizinischen Fortschritt gerettet wurden."
• Auf der anderen Seite berechneten die Wissenschaftler dann: "Wie viele Leben hätten gerettet werden können, wenn die Sterbequote bei erwachsenen US-Bürgern (18-64 Jahre) mit einem sehr niedrigen Bildungsniveau (ohne College-Abschluss) genauso ausgefallen wäre wie bei Bürgern mit höherem Bildungsabschluss (mindestens ein Jahr College)?" Das Ergebnis war für sie frappierend: In diesem Falle hätte die Zahl der vermiedenen Todesfälle bei rund 1.4 Millionen gelegen, also achtmal so hoch wie bei der ersten Vergleichszahl.
Bei näherer Betrachtung erscheint ihnen dieser Befund dann überaus plausibel: "Es ist durchaus naheliegend, dass eine bessere Bildung auch die Gesundheit verbessert. Besser ausgebildete Bürger haben besseren Zugang zu medizinisch wichtigen Informationen, verstehen auch eher die Folgen eines gesundheitsriskanten Lebensstils (Rauchen, körperliche Inaktivität). Sie können eine bessere Auswahl treffen der für sie und ihre Kinder sinnvollen und notwendigen Maßnahmen im Versorgungssystem. Ein höheres Bildungsniveau ist auch Voraussetzung für bessere Jobs, die wiederum erst eine Krankenversicherung und gesundheitliche bessere Lebensbedingungen ermöglichen (Wohnen, Ernährung, Gewalt)."
Um keine Missverständnisse entstehen zu lassen, weisen die Wissenschaftlern noch einmal explizit darauf hin: Es geht ihnen keinesfalls darum, nun eine radikale Umschichtung staatlicher Investitionen vorzuschlagen, weg vom Medizinsystem, hin zu Bildung und Erziehung. Zwei Botschaften sind ihnen wichtig. Zum einen wollen sie die weithin unbekannten oder falsch eingeschätzten Proportionen verdeutlichen, jenen Beitrag, den Bildung einerseits und Medizin andererseits für die Lebenserwartung innehaben. Zum anderen heben sie hervor, dass ihnen diese Botschaft wichtig erscheint in der gegenwärtigen politischen Landschaft. Kostensteigerungen für die medizinische Forschung und Versorgung haben dazu geführt, dass Ausgaben für soziale Einrichtungen, für Bildung und Erziehung gesenkt wurden. Die Ausgaben für "Medicaid" (das staatliche Krankenversicherungssystem der USA, in dem allerdings nur etwa jeder vierte Amerikaner versichert ist) sind inzwischen weit höher als die für das Bildungssystem, und eine Vielzahl von Reformen und Vorhaben in diesem Bereich wurde zuletzt aus Kostengründen storniert.
Die Datenbasis der Studie und auch ihr politischer Hintergrund sind ohne Zweifel sehr spezifisch für die USA. Durchaus auf andere Länder übertragbar erscheint indes der Kerngedanke der Veröffentlichung, der wiederum in der sozialmedizinischen Tradition von McKeown steht: Eine Verbesserung der allgemeinen Lebensbedingungen der Bürger und insbesondere auch ihrer Bildungschancen trägt weitaus mehr zur Verbesserung der Gesundheit und Lebenserwartung bei als dies in der Öffentlichkeit, in Medien und der Arena politischer Entscheidungen derzeit erkannt wird.
Ein Abstract der Studie ist hier zu finden: Giving Everyone the Health of the Educated: An Examination of Whether Social Change Would Save More Lives Than Medical Advances (Am J Public Health 2007 97: 679-683, 10.2105/AJPH.2005.084848)
Gerd Marstedt, 15.7.2007
Struktur-, Prozess-, Ergebnis-Qualität: Ihre Aussagekraft zur Evaluation von Versorgungsprozessen
 Seit der Veröffentlichung von Avedis Donabedian "Evaluating the Quality of Medical Care" orientiert man sich auch in der Medizin und in den Gesundheitswissenschaften bei der Evaluation unterschiedlichster Maßnahmen (Gesundheitsförderung, ärztliche Therapien, Pflege) an der von ihm konzipierten Unterscheidung zwischen Strukturqualität, Prozessqualität und Ergebnisqualität. Eine schwedische Studie hat nun erstmals empirisch und an einer größeren Studie von etwa 400 Kliniken und stationären Versorgungseinrichtungen überprüft, inwieweit diese drei unterschiedlichen Bewertungsebenen miteinander zusammenhängen. Bedeutsam ist diese Frage insofern, als vielen Studien aus finanziellen oder organisatorischen Gründen die Ergebnisqualität (also z.B. in der medizinischen Versorgung der direkte Therapieerfolg, der Gesundheitszustand danach) nicht gemessen wird und daher Indikatoren der anderen beiden Bewertungsebenen hilfsweise herangezogen werden.
Seit der Veröffentlichung von Avedis Donabedian "Evaluating the Quality of Medical Care" orientiert man sich auch in der Medizin und in den Gesundheitswissenschaften bei der Evaluation unterschiedlichster Maßnahmen (Gesundheitsförderung, ärztliche Therapien, Pflege) an der von ihm konzipierten Unterscheidung zwischen Strukturqualität, Prozessqualität und Ergebnisqualität. Eine schwedische Studie hat nun erstmals empirisch und an einer größeren Studie von etwa 400 Kliniken und stationären Versorgungseinrichtungen überprüft, inwieweit diese drei unterschiedlichen Bewertungsebenen miteinander zusammenhängen. Bedeutsam ist diese Frage insofern, als vielen Studien aus finanziellen oder organisatorischen Gründen die Ergebnisqualität (also z.B. in der medizinischen Versorgung der direkte Therapieerfolg, der Gesundheitszustand danach) nicht gemessen wird und daher Indikatoren der anderen beiden Bewertungsebenen hilfsweise herangezogen werden.
• Unter der Strukturqualität einer Einrichtung versteht man z.B. die personelle Ausstattung und Qualifikation der Mitarbeiter, die Qualität und Quantität der anderen Ressourcen, die zur Leistungserbringung notwendig sind (Organisation, finanzielle Voraussetzungen, Infrastruktur, Gebäude und Technikausstattung, Management, Systeme der Qualitätssicherung usw.)
• Mit Prozessqualität angesprochen sind die Eigenschaften der Kernprozesse (z.B. Therapie, Pflege, Beratung) und Hilfsprozesse (z.B. Verwaltung, Fortbildung) in der jeweiligen Einrichtung, ihre Effektivität und Abstimmung untereinander.
• Die Ergebnisqualität ist die wichtigste Dimension für die Evaluation der erbrachten Leistungen in einer Einrichtung, die im Prinzip anhand objektiver Veränderungen (Krankheitsbild, Symptome, Funktionswerte) oder auch anhand anderer Kriterien (Patientenzufriedenheit, Arbeitsunfähigkeit) gemessen werden kann. Oftmals bereitet eine Erhebung jedoch (z.B. bei Prävention aufgrund erst langfristiger Effekte) Schwierigkeiten.
Von den in der Studie etwa 600 angeschrieben Einrichtungen beteiligten sich 75 Prozent und beantworteten den Fragenbogen, der unterschiedliche Fragen zu den drei Bewertungsebenen enthielt. So wurde zur Strukturqualität etwa gefragt, ob Mitarbeiter und Leiter genug Zeit finden, um sich mit Systemen zur Qualitätsverbesserung zu beschäftigen, ob es eine Dokumentation zur Qualitätssicherung gibt usw. Im Abschnitt Prozessqualität zielten Fragen darauf, ob Mitarbeiter unerwünschte Zwischenfälle auch tatsächlich mitteilen, ob Mitarbeiter auch genügend Unterstützung von Vorgesetzten und Kollegen erhalten, wenn sie organisatorische Verbesserungen einführen möchten. Und im Fragenblock zur Ergebnisqualität sollte angegeben werden, ob die Klinik exakt formulierte Qualitätsziele hat, ob die Erreichung dieser Ziele regelmäßig geprüft wird, ob dies auch dokumentiert wird usw.
In der Analyse der Antworten aus den Kliniken wurde dann festgestellt, dass der Zusammenhang zwischen den drei Bewertungskriterien recht hoch ausfällt. Ausgedrückt in Korrelationen heißt dies:
• Struktur und Prozess korrelierten mit 0.72
• Struktur und Ergebnis korrelierten mit 0.60
• Prozess und Ergebnis korrelierten eher schwach mit 0.20
• Der Zusammenhang von Prozess und Struktur (gleichzeitig) mit Ergebnis betrug 0.75
Die Ergebnisse der Studie sind wahrscheinlich eine nachträgliche Legitimation für viele Evaluations-Projekte, die sich aufgrund zeitlicher Einschränkungen oder organischer Schwierigkeiten nur mit Struktur- oder Prozessdaten beschäftigen konnten. Gleichwohl sollten die Befunde nicht ohne Weiteres als methodische Richtschnur genommen werden. In zweierlei Hinsicht lässt die Befragungsstudie Wünsche offen. Zum einen wurden keine externen Bewertungen vorgenommen, sondern Aussagen der jeweiligen Mitarbeiter. Hier ist jedoch davon auszugehen, dass solche Urteile auch eine hohe Konsistenz aufweisen. Es ist wenig wahrscheinlich, dass ein Mitarbeiter die Ergebnisqualität überaus positiv, die Strukturqualität jedoch weniger gut einschätzt. Von daher sind die hohen Korrelationen zumindest teilweise ein Effekt der Methodik durch Befragung. Zum anderen wurden keine tatsächlichen "Outcome"-Indikatoren erfasst (Daten zur Versorgungsqualität: Mortalität, unerwünschte Vorkommnisse und Komplikationen, medizinische Messwerte, Wiedereinweisungs-Quoten usw.), sondern lediglich Angaben, ob hierzu bestimmte Voraussetzungen vorhanden sind (Qualitätsmanagement, Dokumentation).
Die Studie ist hier im Volltext nachzulesen:
• The structure of quality systems is important to the process and outcome, an empirical study of 386 hospital departments in Sweden (BMC Health Services Research 2007, 7:104; doi:10.1186/1472-6963-7-104)
• Hier ist ein Abstract der Studie
Gerd Marstedt, 10.7.2007
"Taking Vioxx for a year is much more risky than a year travel, swimming, or being a firefighter"
 Mit der provokativen Frage "What’s More Dangerous, Your Aspirin Or Your Car? Thinking Rationally About Drug Risks (And Benefits)" startet in der neuesten Ausgabe der renommierten Public-Health-Zeitschrift "Health Affairs" (2007. Volume 26, Number 3: 636-646) ein ungewöhnlicher Vergleich, der verblüffende Ergebnisse zutage fördert.
Mit der provokativen Frage "What’s More Dangerous, Your Aspirin Or Your Car? Thinking Rationally About Drug Risks (And Benefits)" startet in der neuesten Ausgabe der renommierten Public-Health-Zeitschrift "Health Affairs" (2007. Volume 26, Number 3: 636-646) ein ungewöhnlicher Vergleich, der verblüffende Ergebnisse zutage fördert.
Die Autoren, Joshua Cohen und Peter J. Neumann, beide Mediziner an der Tufts-Universität in Massachussetts, wollen die weltweit geführte Debatte über die gesundheitlichen und ökonomischen Risiken von Arzneimitteln ergänzen oder anreichern. Dies wollen sie durch einen Vergleich der Mortalitätsrisiken anstellen, die mit ganz normalen Arzneimittel und mit anderen Lebensbereichen oder Produkten verbunden sind, mit denen Menschen heute zu tun haben, wie der Arbeitswelt, dem Transport oder Verkehr und dem Freizeit- und Erholungsbereich.
Wichtig sind den Autoren solche Vergleiche u.a. für die inner-amerikanische Debatte über die Kontrolle von Medikamentenrisiken durch die dafür zuständige US-Behörde "Federal Food and Drug Administration (FDA)". Nachdem zwischen 1975 und 1999 56 von 548 der von der FDA zugelassenen Arzneimittel wegen unerwünschten Wirkungen zurückgezogen oder mit "black box"-Warnungen versehen werden mussten und hierzu nach 2000 noch die großen Probleme mit weiteren wichtigen Arzneimitteln wie Vioxx oder Tysabri kamen, bekundeten in einer 2006 durchgeführten Umfrage des Instituts "Harris Interactive" 60 % der Erwachsenen eine negative Wahrnehmung der Fähigkeiten der FDA, die Sicherheit und Wirksamkeit von Arzneimitteln zu gewährleisten.
Unter Nutzung zahlreicher Statistiken und des ausgewählten ("useful starting point"), also keineswegs einzig möglichen Indikators "fatality risk / annual risk per 100.000 person-years" zeigen sich interessante Risikobilder:
• Zunächst einmal variiert das hier betrachtete Risiko innerhalb der betrachteten Risikobereiche erheblich: Bei den Medikamenten zwischen 0,07 für die Pockenschutzimpfung und 76 bei der Einnahme von Vioxx, wobei Aspirin mit 10,4 einen Mittelplatz einnimmt; Beschäftigungsrisiken schwanken zwischen 0,4 für Bürotätigkeiten und 357,6 von Holzfällern, mit Feuerwehrleuten mit 10,6 auf einem Mittelplatz; Bahnfahrten haben mit 0,11 tödlichen Ereignissen pro 100.000 Personenjahren das geringste Sterblichkeitsrisiko, Motorradfahren mit 450 das höchste und hier liegt das Risiko des Telefonierens (ohne Freisprecheinrichtung) während der Autofahrt mit 1,3 zwischen den Extremwerten; den maximalen Unterschied des Sterblichkeitsrisikos gibt es bei den "recreation"-Tätigkeiten, bei denen "Football"-spielen in der Highschool mit 0,058 am unteren und Bergsteigen im Himalaya mit 13.000 am oberen Ende der Skala liegen. Normales Felsklettern hat ein Risiko von 36 und Radfahren eines von 2,1.
• Die Arzneimittelrisiken liegen meist gleichauf mit den Verkehrsrisiken oder übersteigen sie sogar. Nur Motorradfahren ist risikoträchtiger als alle hier ausgewählten Arzneimittel (Pockenimpfstoff, Aspirin, erste Generation von Antihistaminen, Clozapine zur Behandlung von Schizophrenie, Tysabri zur Behandlung von multipler Sklerose und Vioxx zur Behandlung von arthritischen Schmerzen).
• Die Einnahme der Medikamente ist im Schnitt vergleichbar mit dem Sterblichkeitsrisiko von Feuerwehrleuten.
• Die meisten Freizeitaktivitäten haben ein deutlich geringeres Sterblichkeitsrisiko als die Einnahme der ausgewählten Medikamente.
Da die Bezugsgröße oder der Nenner der Berechnung beim Berufs-, Transport- und Erholungs/Freizeit-Risiko jeweils die Personen sind, die sich den verschiedenen Risiken exponieren, also z. B. Motorradfahren aber bei den Arzneimitteln die gesamte US-Bevölkerung, unterschätzen die Berechnungen mit Sicherheit das Risiko der Arzneimittel. Auf weitere Schwierigkeiten der Indikatorenbildung wird in dem Aufsatz eingegangen.
Nach diesem ersten Versuch eines etwas ungewöhnlichen Risikovergleichs sind die Autoren überzeugt, dass seine Ergebnisse auch die gesundheitspolitische Diskussion stimulieren und beflügeln kann: "The finding that taking Vioxx for a year is much more risky than a year travel, swimming, or being a firefighter suggests that greater scrutiny of drug risks may be warranted."
Eine wichtige wissenschaftliche Aufgabe ist ihres Erachtens die Weiterarbeit an den Problemen der Indikatorenbildung und die Entwicklung besserer Tools zur Risiko- und Nutzenmessung.
Der FDA schlagen sie vor, künftig bei der Bewertung der Sicherheit von Medikamenten Nutzen und Risiken systematischer darzustellen und zu vergleichen.
Ein Abstract des Aufsatzes von Cohen und Neumann "What’s More Dangerous, Your Aspirin Or Your Car? Thinking Rationally About Drug Risks (And Benefits)" finden Sie hier.
Zumindest der Zugang zu den Volltexten der teils kritischen elektronischen Leserbriefe ist über die Abstract-Seite möglich.
Der Volltext des Artikels ist leider nicht kostenlos zugänglich. Wer ihn aber haben will, kann sich hier online einen 24-Stundenzugang zu ihm für 12.95 US-$ kaufen.
Wem dies zu teuer erscheint und gleichzeitig weiß, dass er öfter auf diese Weise einen Artikel aus dieser Zeitschrift erstehen will oder muss, sollte sich überlegen, ob er als "individual subscriber" nicht bedeutend besser fährt. Ein Jahresabonnement für die gedruckte und die Online-Fassung von "Health Affairs" kostet für diese Art des Abonnenten nämlich im Moment mit 165 US-$ vielleicht weniger als mancher Interessent intuitiv befürchtet. Damit verbunden ist natürlich u.a. auch der Zugang zu dem umfangreichen Archiv der Zeitschriftenbeiträge.
Bernard Braun, 30.6.2007
Fragebögen als Informationsquelle der Versorgungsforschung - Wie erhöht man den Rücklauf?
 Eine wachsende Anzahl von gesundheitswissenschaftlichen Surveys und Analysen beruhen auf den Ergebnissen schriftlich standardisierter Befragungen von Versicherten, Patienten und Nutzern mit Fragebögen. Dazu gehören etwa die umfangreiche Variante des inhaltlich vom Robert Koch-Institut betreuten "Bundesgesundheitssurveys", die Befragungen von Patienten und Beschäftigten im Gesundheitswesen über die Qualität der Versorgung und die Arbeitsbedingungen in Krankenhäusern oder Arztpraxen durch zahlreiche inhaltlich und methodisch kompetente universitäre und private Institute (z. B. IGES, ISEG, ZeS, Picker, WIdO).
Eine wachsende Anzahl von gesundheitswissenschaftlichen Surveys und Analysen beruhen auf den Ergebnissen schriftlich standardisierter Befragungen von Versicherten, Patienten und Nutzern mit Fragebögen. Dazu gehören etwa die umfangreiche Variante des inhaltlich vom Robert Koch-Institut betreuten "Bundesgesundheitssurveys", die Befragungen von Patienten und Beschäftigten im Gesundheitswesen über die Qualität der Versorgung und die Arbeitsbedingungen in Krankenhäusern oder Arztpraxen durch zahlreiche inhaltlich und methodisch kompetente universitäre und private Institute (z. B. IGES, ISEG, ZeS, Picker, WIdO).
Wegen des im Vergleich mit mündlichen face-to-face-Interviews oder auch CATI-Interviews (Computer-assisted-telephone-interviews) meist unaufwändigeren Verfahrens, sind Fragebogenbefragungen auch aus Gründen der Forschungsökonomie "erste Wahl".
Der geringere direkte Aufwand an Interviewern hat aber oft den Nachteil, dass ein mehr oder weniger großer Teil der versandten Fragebögen nicht beantwortet wird und beim Sinken unter eine 50 %-Beteiligung oder Responserate die Aussagekraft der Ergebnisse schnell schwächelt und die daraus zulässigen verallgemeinernden Schlüsse immer spekulativer werden.
Die Bemühungen, einen möglichst weit über der 50 %-Hürde liegenden Rücklauf zu schaffen, sind daher von enormer Bedeutung für die Anerkennung der Fragebogenmethode und die Nutzung der Antworten in Politik und Wissenschaft. In jedem halbwegs ordentlichen Lehr- oder Handbuch der empirischen Sozialforschung finden sich daher auch Tipps wie man das schaffen könnte.
Wie "sicher" diese Hinweise sind und mit welchen Effekten man jeweils rechnen kann, das sind Fragen, auf die sich häufig keine besonders belastbaren Antworten finden lassen. Ob es sich dabei um so genannten "Gobsat" (good old boys sat around the table) handelt oder ob die Evidenz einer rücklauferhöhenden Vorgehensweise in eigenen Studien als überzufällig und wissenschaftlich kontrolliert nachgewiesen wurde, bleibt oftmals im Unklaren.
Ein Teil dieser Unklarheiten und praktischen Unsicherheiten verringert sich nach der Lektüre eines dazu jüngst erschienenen Reviews einer Arbeitsgruppe der durch ihre Pionierarbeiten im Bereich evidenter Medizin und Gesundheitsinterventionen angesehenen Cochrane Collaboration erheblich.
Der 243 Seiten umfassende und in der Cochrane Liberary 2007, Issue 2 veröffentlichte Review "Methods to increase response rates to postal questionnaires (Review)" von Edwards P, Roberts I, Clarke M, DiGuiseppi C, Pratap S, Wentz R, Kwan I und Cooper R. wertet nach einer gründlichen Suche nach wissenschaftlichen, d.h. im Cochranezusammenhang randomisierte und kontrollierte Studien über Strategien und Instrumente mit denen man die Beantwortung von postalisch versandten Fragebögen erhöhen und verbessern kann 372 solcher Arbeiten aus. Dort sind insgesamt 98 verschiedene Wege untersucht worden, von denen sich 62 auch auf empirische Angaben von mehr als 1.000 TeilnehmerInnen stützen können.
Aus der Vielzahl der Ergebnisse und Hinweise seien folgende erwähnt:
• Die Hälfte der untersuchten Strategien unterscheiden sich erheblich,
• Die Antwortwahrscheinlichkeit lässt sich durch finanzielle Anreize, werbenden Hinweisen auf dem Briefumschlag des Fragebogens oder eine interessante Aufmachung der Fragen wenigstens verdoppeln.
• Durch eine Vorankündigung der Befragung, durch offene nicht antwortabhängige Anreize oder durch die Mitträgerschaft einer Universität war der beantwortete Rücklauf an Fragebögen substanziell höher.
• Personalisierte Fragebögen, farbig gedruckte Fragebögen und mit Briefmarken freigemachte statt freigestempelte Umschläge erhöhen auch noch die Antwortbereitschaft.
• Die Antwortwahrscheinlichkeit wird schließlich durch sehr persönliche Fragen, durch mit allgemeinsten Fragen eröffnete Fragebögen und zu explizite Möglichkeiten, aus der Studie "auszusteigen" gesenkt.
Ein kostenloses Abstract dieses Cochrane-Reviews ist hier erhältlich.
Wer einen bezahlten Zugang zur Cochrane Library in einer Bibliothek oder auch privat hat, kann sich die knapp 1 MB große PDF-Datei über diese Adresse (aber auch nur unter der genannten Voraussetzung!!!) herunterladen.
Einen Überblick über die gesamten Angebote der Cochrane Library und die Bestellmöglichkeiten findet sich hier.
Bernard Braun, 12.6.2007
Gewalt in den USA: Jährlich 70 Milliarden Dollar Kosten, 2.2 Millionen Opfer, 50 Tausend Tote
 In Zeiten, da eher ökonomische als soziale Kriterien Richtschnur gesellschaftlicher Veränderung sind, erscheint es auch für Wissenschaftler bisweilen opportun, Politikdefizite oder soziale Probleme nicht unter dem Banner von Humanität oder sozialer Gerechtigkeit zu kritisieren, sondern auf unerwünschte finanzielle Kosten hinzuweisen - wenn möglich mit beeindruckenden Zahlen. So dürften sich wohl auch die Wissenschaftler einer Studie aus Maryland, North Carolina und Georgia gedacht haben, dass sie die Schlagzeilen der Medien kaum erreichen können, wenn sie allein auf das physische und psychische Leiden all jener verweisen, die in den USA durch Gewalttaten verletzt oder gar getötet werden. Und daher berechneten sie die volkswirtschaftlichen Kosten der jährlichen Morde und Gewaltdelikte, Körperverletzungen und Suizide in den USA. 70 Milliarden Dollar kamen am Ende heraus.
In Zeiten, da eher ökonomische als soziale Kriterien Richtschnur gesellschaftlicher Veränderung sind, erscheint es auch für Wissenschaftler bisweilen opportun, Politikdefizite oder soziale Probleme nicht unter dem Banner von Humanität oder sozialer Gerechtigkeit zu kritisieren, sondern auf unerwünschte finanzielle Kosten hinzuweisen - wenn möglich mit beeindruckenden Zahlen. So dürften sich wohl auch die Wissenschaftler einer Studie aus Maryland, North Carolina und Georgia gedacht haben, dass sie die Schlagzeilen der Medien kaum erreichen können, wenn sie allein auf das physische und psychische Leiden all jener verweisen, die in den USA durch Gewalttaten verletzt oder gar getötet werden. Und daher berechneten sie die volkswirtschaftlichen Kosten der jährlichen Morde und Gewaltdelikte, Körperverletzungen und Suizide in den USA. 70 Milliarden Dollar kamen am Ende heraus.
Mit dieser Summe liegen die Kosten knapp über dem Etat des US-Bildungsministeriums und knapp unter jenen Kosten, die in den südöstlichen Teilen der USA, insbesondere im Großraum New Orleans, im August 2005 durch den Hurrikan "Katrina" verursacht wurden, Schäden, die auf 80 Milliarden Dollar geschätzt werden. Die durch Gewalt verursachten hohen Kosten errechneten die Wissenschaftler, indem sie einerseits die auf der Basis von statistischen Durchschnittswerten hochgerechneten medizinischen Behandlungskosten (ambulante und stationäre Kosten, Transport des Opfers, Rehabilitation usw.) in Höhe von 5.6 Milliarden Dollar berücksichtigten. Diese Summe erschien möglicherweise jedoch zu wenig spektakulär, so dass auch noch "Produktivitätsverluste im Rahmen von Erwerbs- und Hausarbeit" ermittelt wurden, was zur stolzen Summe von weiteren 65 Milliarden Dollar an Kosten durch Gewalttaten führte.
Die Berechnung erfolgte so (Übersetzung durch Forum Gesundheitspolitik): "Produktivitätsverluste wurden für tödliche und nicht-tödliche Schädigungen getrennt errechnet. Für jemandem mit einem bestimmten Alter und Geschlecht, der eine tödliche oder andauernde Schädigung erlitten hat, wurde der aktuelle Nettoverdienst (einschl. Sozialleistungen, Einkommenssteigerungen und zu berücksichtigende Verluste der Produktivität im Haushalt) als Kalkulationsbasis für entgangene und im weiteren Leben nicht mehr zu erwartende Einkünfte benutzt. Dabei wurde das durchschnittliche Einkommen einschl. Sozialleistungen aus der nationalen Bevölkerungs-Studie 2000 herangezogen. Für nicht-tödliche Schädigungen wurde der Produktivitätsverlust so kalkuliert, dass er der Summe entsprach, die während der Arbeitsunfähigkeitszeit verloren ging durch nicht erhaltene Verdienste."
Zur Ehrenrettung der Wissenschaftler sei allerdings auch gesagt, dass sie sich zum Schluss ihres Aufsatzes der ökonomischen Logik entziehen und auch die humanitären Aspekte ihres Themas behandeln, indem sie auf vielfältige Negativfolgen der Gewalt für die Betroffenen hinweisen, auf dauerhafte Ängste und post-traumatische Stress-Erfahrungen, auf Beeinträchtigungen der sozialen Kontakte und Partnerschafts-Störungen und vieles mehr. Allein dies scheint aber wenig schlagzeilenträchtig im Vergleich zu "70 Milliarden Dollar Kosten".
Ein Abstract der Studie ist hier nachzulesen: Medical Costs and Productivity Losses Due to Interpersonal and Self-Directed Violence in the United States (American Journal of Preventive Medicine, Volume 32, Issue 6, June 2007, Pages 474-482.e2)
Gerd Marstedt, 10.6.2007
Auch Bremer Wissenschaftler erhielten verdeckte Forschungsgelder der Tabakindustrie
 Thilo Grüning und Nicolas Schönfeld berichteten im März 2007 in der Titelstory des Deutschen Ärzteblatts (Heft 12) darüber, wie die Tabakindustrie in Deutschland über viele Jahre hin, systematisch versucht hat, Einfluss auf die Forschung zu nehmen, um die Gefahren des Aktiv- und Passivrauchens herunterzuspielen oder gar zu verharmlosen. (vgl.: Tabakindustrie und Ärzte: "Vom Teufel bezahlt..."). Dieser eindeutige Nachweis kann seit längerem erbracht werden, weil im Jahr 1998 führende Tabakkonzerne durch Schadensersatzprozesse in den USA gezwungen wurden, ihre internen Unterlagen im Internet der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Im Vergleich zu anderen Ländern wie beispielsweise den USA und England sind in Deutschland erst mit einiger Verspätung von verschiedenen Stellen (z.B. dem Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg) intensive Recherchen darüber angestellt worden, in welchem Maße auch deutsche Wissenschaftler von der Tabakindustrie für ihre Zwecke eingespannt worden.
Thilo Grüning und Nicolas Schönfeld berichteten im März 2007 in der Titelstory des Deutschen Ärzteblatts (Heft 12) darüber, wie die Tabakindustrie in Deutschland über viele Jahre hin, systematisch versucht hat, Einfluss auf die Forschung zu nehmen, um die Gefahren des Aktiv- und Passivrauchens herunterzuspielen oder gar zu verharmlosen. (vgl.: Tabakindustrie und Ärzte: "Vom Teufel bezahlt..."). Dieser eindeutige Nachweis kann seit längerem erbracht werden, weil im Jahr 1998 führende Tabakkonzerne durch Schadensersatzprozesse in den USA gezwungen wurden, ihre internen Unterlagen im Internet der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Im Vergleich zu anderen Ländern wie beispielsweise den USA und England sind in Deutschland erst mit einiger Verspätung von verschiedenen Stellen (z.B. dem Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg) intensive Recherchen darüber angestellt worden, in welchem Maße auch deutsche Wissenschaftler von der Tabakindustrie für ihre Zwecke eingespannt worden.
Für die Tabakindustrie war es laut ihrer eigenen Aussagen von großer Bedeutung, möglichst renommierte Wissenschaftler für eine Zusammenarbeit zu gewinnen. Dies ist ihr auch gelungen. Aus dem Public-Health-Umfeld wurden in der Vergangenheit in diesem Zusammenhang immer wieder Namen von vier prominenten Professoren genannt: Prof. Überla (München), Prof. von Troschke (Freiburg), Prof. Siegrist (Düsseldorf) und Prof. Gostomzyk (Augsburg). Weitere Recherchen haben nun gezeigt, dass auch zwei Bremer Wissenschaftler in den 80er bzw. 90er Jahren Gelder vom Verband der deutschen Zigarettenindustrie (VDC) für Forschungsvorhaben erhalten haben, ohne dass sie dies offen gelegt haben. Dabei handelt es sich um den Mathematiker Prof. Jürgen Timm, den ehemaligen Rektor der Universität Bremen, und den Biometriker Prof. Karl-Heinz Jöckel, den damaligen stellvertretenden Leiter des Bremer Instituts für Präventionsforschung und Sozialmedizin (BIPS). Prof. Timm erstellte Auswertungen für das VDC-Projekt 4/1983 "Ermittlung der Rauchgewohnheiten in der derzeitigen Marksituation in der Bundesrepublik Deutschland" und Prof. Jöckel führte das VDC-Projekt 1/1992 "Pilotstudie für eine epidemiologische Fall-Kontrollstudie zu arbeits- umweltbedingten Risikofaktoren" durch. Für das erstere Projekt wurde vom VDC ein Betrag von 13.800 DM ausgezahlt, für das zweite ein Betrag von 110.000 DM.
Die Problematik der Zusammenarbeit von Wissenschaftlern mit der Tabakindustrie wird international bereits seit vielen Jahren heftig diskutiert. So warnte der Herausgeber der angesehen Medizinerzeitschrift "British Medical Journal" bereits 1985 unter dem Titel "Taking money vom the devil" eindringlich vor jedweder Kooperation von Wissenschaftlern mit Organisationen der Tabakindustrie.
Auch in Deutschland setzt nun erfreulicherweise, allerdings erst vergleichsweise spät, eine Diskussion darüber ein, welche Gefahren eine Kooperation von Wissenschaftlern mit der Tabakindustrie bergen. Ein Beleg dafür ist der Artikel von Grüning & Schönfeld im Deutschen Ärzteblatt. Als erste medizinische Fachgesellschaft hat die Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin (DGP) 2006 einen ethischen Kodex verabschiedet, in dem jede Zusammenarbeit mit der Tabakindustrie abgelehnt wird. Gemäß diesem Kodex wird es abgelehnt, finanzielle Mittel der Tabakindustrie für Forschungsvorhaben, Gutachtertätigkeiten, Vortragshonorare und Reisekosten anzunehmen.
Auch das Deutsche Krebsforschungszentrum hat 2005 einen ethischen Kodex verabschiedet, in dem der jede Zusammenarbeit mit der Tabakindustrie abgelehnt wird. Dort heißt es: "1. Das Deutsche Krebsforschungszentrum und seine Mitarbeiter lehnen jegliche finanziellen Mittel der Tabakindustrie für Forschungsförderung, Gutachterhonorare, Vortragshonorare, Reisekosten, Wissenschafts- und andere Preise ab. 2. Das Deutsche Krebsforschungszentrum und seine Mitarbeiter lehnen die Mitwirkung an Veranstaltungen der Tabakindustrie oder Dritter, die von der Tabakindustrie maßgeblich gesponsert werden, ab." Es wäre zu wünschen, dass weitere Universitäten, Forschungseinrichtungen, medizinische Fakultäten und Fachgesellschaften diesen positiven Beispielen folgen.
• HTML-Datei: Thilo Grünung & Nicolas Schönfeld (2007): Tabakindustrie und Ärzte: "Vom Teufel bezahlt..." (Deutsches Ärzteblatt 104, Ausgabe 12 vom 23.03.2007, Seite A-790 / B-695 / C-669)
• PDF-Datei
gm/uh, 24.4.2007
Zwischen Religion und real existierendem Sozialismus - Ursachen der Selbsttötungen in der DDR
 Sollten die Besucher des mit dem diesjährigen Oscar für den besten ausländischen Film ausgezeichneten Films "Das Leben der Anderen" beim zentralen Plot eher an einen gelungenen Einfall der Filmemacher als an die epidemiologische Wirklichkeit gedacht haben, haben sie sich geirrt.
Sollten die Besucher des mit dem diesjährigen Oscar für den besten ausländischen Film ausgezeichneten Films "Das Leben der Anderen" beim zentralen Plot eher an einen gelungenen Einfall der Filmemacher als an die epidemiologische Wirklichkeit gedacht haben, haben sie sich geirrt.
Dieser Plot, der in der DDR unerwünschten Berichterstattung über die hohe Anzahl der Selbsttötungen und der dennoch erfolgenden Mitarbeit eines der Filmprotagonisten an einer anonymen Titelgeschichte des SPIEGELS, entspricht nämlich im Kern der Wirklichkeit.
Sie ist ausführlich in der 2006 unter dem Titel "In einem Anfall von Depression ..." Selbsttötungen in der DDR" veröffentlichten Doktorarbeit des Leipziger Historikers und Biochemikers Udo Grashoff beschrieben. Sie ist nicht nur als eine Art "Hintergrunds-Buch zum Film" interessant, sondern auch wegen der darin enthaltenen Überlegungen zu den komplexen Ursachen der dort aufgearbeiteten epidemiologischen und gesundheitlichen Wirklichkeit.
Zunächst dokumentiert Grashoff die weit über der vergleichbaren Selbsttötungsrate z.B. der alten BRD liegende Entwicklung in der DDR:
• Nach 1961, dem Jahr des Mauerbaus, nahmen sich in der DDR jährlich fast doppelt so viele Menschen das Leben wie in der Bundesrepublik - nämlich 35 je 100 000 Einwohner. Darunter viele ältere Menschen über 60 sowie Jugendliche.
• Interessanterweise war die Suizidrate in den Gefängnissen und in der Armee der DDR niedriger als anderswo.
• Da die DDR damit an der Spitze vergleichbarer Länder lag, verbot die politische Führung in der DDR auch, diese Daten an internationale Einrichtungen weiterzugeben.
Die zunächst naheliegende Erklärung, die Selbstmordrate sei im wesentlichen Folge der politischen, sozialen und ökonomischen Verhältnisse bzw. der Unterdrückung in der DDR (zwischen Repression und Depression), hinterfragt der Autor mit einem Blick auf die Suizidstatistik vor der Existenz der DDR. Seine Ergebnisse sind eindeutig und verwerfen derartig kurzatmige und einfache Erklärungsmuster:
• Zum einen weist er darauf hin, dass Selbstmordraten sehr stabil sind, d.h. sich weder positiv noch negativ entlang von ökonomischen oder sozialen Konjunkturen verändern.
• Auch wenn der Autor detailliert und faktenreich die Zusammenhänge zwischen politischen Situationen und Selbsttötungsveränderungen schildert, kommt er insgesamt dann doch zu folgendem Ergebnis: "Die sehr hohe Selbsttötungshäufigkeit in der DDR lässt sich (zum Großteil) nicht auf politische oder ökonomische Bedingungen zurückführen. Vielmehr muss sie angesehen werden als Ausdruck langfristig relativ stabiler mentaler Prägungen sowie als Folge der durch unterschiedliche Konfessionen geprägten Milieus."
• Zu den wirkmächtigsten Milieufaktoren gehört in diesem Kontext die Religiosität und spezifische Religionszugehörigkeit. So war bereits im 19. Jahrhundert die Selbsttötungsrate in protestantischen Industriegebieten und Städten, etwa in Sachsen, höher als in ländlichen und meist katholisch geprägten Gegenden wie dem Münsterland. Im Jahr 1900 lag die Zahl von Selbstmorden in der protestantischen Industrie- und Handelsstadt Hamburg genau so hoch wie in der DDR.
• Ein Rezensent, Manfred Vasold in der Zeitschrift "Gehirn und Geist 4/2007", fasst Grashoffs historische Betrachtung so zusammen: "Die Selbstmordrate in Sachsen und Thüringen sei lange zuvor schon höher gewesen als etwa im Münsterland, einem traditionell ausgerichteten, katholischen Gebiet. Dieser Trend hätte sich in der DDR fortgesetzt und unter der Diktatur verstärkt."
Es handelt sich um das Buch: Udo Grashoff (2006): "In einem Anfall von Depression ..." Selbsttötungen in der DDR. Forschungen zur DDR-Gesellschaft, 2006. Es ist im Umfang von über 500 Seiten im Verlag LINKS erschienen, hat die ISBN: 9783861534204 und kostet 29,90 EUR.
Bernard Braun, 22.4.2007
Internationale Studien zeigen: Wo Waffen leicht verfügbar sind, steigt die Mord- und Selbstmordquote
 In Europa ist die Verwunderung groß, dass nach dem Amoklauf an der Hochschule von Blacksburg und den 32 Mordopfern keine neue Debatte einsetzt über die für unser Verständnis allzu liberale Handhabung des Waffenbesitzes. Doch die Amerikaner pochen auf ihren Verfassungsgrundsatz. Allerdings wird die Argumentation zunehmend löchriger in Anbetracht neuerer Studien, die eindeutig zeigen: Wo Schusswaffen leicht verfügbar sind, ist auch die Mord- und Selbstmordquote deutlich höher.
In Europa ist die Verwunderung groß, dass nach dem Amoklauf an der Hochschule von Blacksburg und den 32 Mordopfern keine neue Debatte einsetzt über die für unser Verständnis allzu liberale Handhabung des Waffenbesitzes. Doch die Amerikaner pochen auf ihren Verfassungsgrundsatz. Allerdings wird die Argumentation zunehmend löchriger in Anbetracht neuerer Studien, die eindeutig zeigen: Wo Schusswaffen leicht verfügbar sind, ist auch die Mord- und Selbstmordquote deutlich höher.
Bereits im Januar dieses Jahres hatte eine für die USA repräsentativen Studie von Wissenschaftlern des "Harvard Injury Control Research Center" an der Harvard School of Public Health auf der Basis von 200.000 Befragten gezeigt, dass die Mordraten bei Kindern, Frauen und Männern aller Altersstufen in jenen Bundesstaaten der USA mit einer größeren Anzahl von Waffen eindeutig höher ausfallen. Dabei wurde auch der Einfluss vieler immer wieder bei Gewalt genannter Einflussfaktoren, wie etwa der Arbeitslosigkeit, des Alkoholkonsum oder des Wohnens in städtischen Ballungsgebieten kontrolliert. Innerhalb der einzelnen Bundesstaaten hatten jene, die im obersten Viertel der Waffenbesitz-Skala lagen um 114 Prozent höhere Morde mit Waffen als jene im niedrigsten Viertel des Waffenbesitzes. Die Mordraten in allen Staaten mit hohem Waffenbesitz war 60 % höher als in allen Staaten mit einem niedrigerem Besitz an Waffen.
vgl. Forum Gesundheitspolitik: "Todesart Mord" eindeutig abhängig von der "Freiheit" des Waffenbesitzes
Hier ist die Presseerklärung der Harvard- Universität zur Studie: State-level homicide victimization rates in the US in relation to survey measures of household firearm ownership, 2001-2003
Eine jetzt veröffentlichte neuere Studie, ebenfalls durchgeführt an der Harvard School of Public Health (HSPH) fand nun für die USA repräsentativ heraus, dass auch die Selbstmordrate direkt zusammenhängt mit der Verfügbarkeit von Waffen: In jenen 15 Bundesstaaten mit der im Vergleich zur Bevölkerungszahl höchsten Quote von Feuerwaffen im Haushalt begingen doppelt so viele Bürger Selbstmord wie in Bundesstaaten mit einer eher niedrigen Waffenquote. Selbstmord ist in den USA einer der 15 am häufigsten vorkommenden Todesursachen, bei Personen unter 30 rangieren Suizide sogar innerhalb der drei häufigsten Ursachen. Dabei spielen Feuerwaffen eine zentrale Rolle: Etwa die Hälfte jener 32.000 US-Bürger, die sich im Jahre 2004 das Leben nahmen, benutzten eine Pistole oder ein Gewehr.
Ein Abstract er Studie ist hier nachzulesen: Household Firearm Ownership and Rates of Suicide Across the 50 United States (The Journal of Trauma, April 2007, 62: 1029-1035)
Argumente gegen eine zu liberale Politik des Waffenbesitzes kommen jetzt auch aus Österreich. Denn seit Inkrafttreten eines strengeren Gesetzes im Jahre 1997 ist in der Alpenrepublik die Zahl der Selbstmorde und Morde mit Schusswaffen in Österreich erheblich zurückgegangen. Die Wissenschaftler von der Medizinischen Universität Wien (Universitäts Klinik für Psychoanalyse und Psychotherapie) haben in ihrer Studie zeigen können, dass sich einerseits Zahl der Waffenpässe, Waffenscheine und Waffenbesitzkarten in Österreich im Zeitraum 1997-2005 um 24% verringert hat. Parallel dazu ist die Zahl der Selbstmorde mit Schusswaffen um mehr als 26 Prozent gesunken und die Zahl der Morde mit Pistolen oder Gewehren sogar um über 67 Prozent. Die Studie erscheint in Kürze im British Journal of Psychiatry. Vor dem Erscheinungstermin dürfen die Forscher noch keine Details ihrer Studie bekannt geben. In einem Artikel von ORF erklären sie jedoch, dass "Waffenprävention tatsächlich die von der Waffenlobby häufig geleugnete positive Wirkung zeigt. Die höhere Verfügbarkeit von Waffen erhöht das Risiko für Waffen-Suizide und -Morde."
Hier ist die Meldung von ORF: Neues Waffengesetz senkte Mordrate
Schon ein Jahr zuvor hatten die Wissenschaftler eine Studie veröffentlicht, die eindeutig nachwies: Selbstmorde mit Schusswaffen sind in Österreich in jenen Bundesländern häufiger, in denen es - bezogen auf die Bevölkerungszahl - auch eine höhere Zahl an Waffen gibt. Im Abstract zu dieser Studie heißt es: "Wir fanden eine starke Korrelation zwischen der durchschnittlichen Rate (1990-2000) an Waffenpässen und Suiziden durch Erschießen, und nur sehr schwache und für einige der untersuchten Jahre negative Korrelationen mit anderen Suizidmethoden bzw. der Gesamtsuizidrate. Da Erschießen als Suizidmethode in Österreich in den letzten Jahrzehnten stark angestiegen ist und eine Methode mit hoher Letalität darstellt, verdient dieses Ergebnis besondere Beachtung, besonders, da Evidenz darüber besteht, dass Einschränkung von Waffenbesitz ein wichtiger Aspekt der Suizidprävention sein kann."
Das Abstract ist hier nachzulesen: Suizide durch Erschießen korrelieren mit der Waffenpassrate in den österreichischen Bundesländern
Gerd Marstedt, 19.4.2007
Jeder vierte US-Kriegsveteran leidet unter psychischen Störungen
 Eine neue US-amerikanische Studie hat jetzt gezeigt, dass etwa ein Viertel aller Kriegsveteranen, die aus Afghanistan oder dem Irak zurückgekehrt sind, unter psychischen Störungen leiden. In der jetzt in den "Archives of Internal Medicine" veröffentlichten Studie wurden die ärztlichen Diagnosen von fast 104.000 Kriegsheimkehrern aus den Jahren 2001-2005 näher betrachtet. Es zeigte sich, dass ein erheblicher Teil noch immer unter den Stresserfahrungen und psychischen Belastungen der Kriegserfahrung leidet. Am häufigsten festgestellt wurden post-traumatische Belastungsstörungen, wie sie auch bei Überlebenden des Holocaust festgestellt wurden. Rund 13% zeigten dieses Syndrom, das sich in sehr unterschiedlichen körperlichen und psychischen Beeinträchtigungen äußern kann, wie zum Beispiel Schlafstörungen, Depressionen, Persönlichkeitsveränderungen, Gefühlskälte, Suchtverhalten, Aggression und Selbstverletzungen, Panikattacken und Suizidversuche.
Eine neue US-amerikanische Studie hat jetzt gezeigt, dass etwa ein Viertel aller Kriegsveteranen, die aus Afghanistan oder dem Irak zurückgekehrt sind, unter psychischen Störungen leiden. In der jetzt in den "Archives of Internal Medicine" veröffentlichten Studie wurden die ärztlichen Diagnosen von fast 104.000 Kriegsheimkehrern aus den Jahren 2001-2005 näher betrachtet. Es zeigte sich, dass ein erheblicher Teil noch immer unter den Stresserfahrungen und psychischen Belastungen der Kriegserfahrung leidet. Am häufigsten festgestellt wurden post-traumatische Belastungsstörungen, wie sie auch bei Überlebenden des Holocaust festgestellt wurden. Rund 13% zeigten dieses Syndrom, das sich in sehr unterschiedlichen körperlichen und psychischen Beeinträchtigungen äußern kann, wie zum Beispiel Schlafstörungen, Depressionen, Persönlichkeitsveränderungen, Gefühlskälte, Suchtverhalten, Aggression und Selbstverletzungen, Panikattacken und Suizidversuche.
Nicht ganz so häufig festgestellt wurden Angstzustände und Anpassungsstörungen (6%) sowie Depressionen, Drogenabhängigkeit und Suchtverhalten (5%). Etwa jeder dritte Kriegsheimkehrer macht von der Möglichkeit Gebrauch, sich zwei Jahre lang kostenlos in Einrichtungen des "Department of Veterans Affairs (VA)" medizinisch betreuen und psychologisch beraten zu lassen. Bei all diesen Patienten wurde in den Jahren 2001-2005 auf der Basis der in Kliniken oder Arztpraxen erstellten ärztlichen Anamnese für die Studie eine Diagnose nach dem weltweit gebräuchlichen ICD-Schema (International Classification of Diseases) erarbeitet.
Als ein weiteres Ergebnis der Studie zeigte sich, dass jüngere Soldaten (Alter 18-24 Jahre) weitaus häufiger von psychischen Störungen betroffen waren. Die Wissenschaftler erklären dies damit, dass Jüngere zumeist niedrigere Dienstgrade aufweisen und deshalb auch häufiger in direkte Kampfhandlungen einbezogen waren als ältere Soldaten (ab 40). Sie weisen auch darauf hin, dass ihre Ergebnisse vermutlich nicht repräsentativ sind für die US-Army, da die untersuchten Soldaten, die medizinische und psychologische Hilfe in Anspruch genommen haben, vermutlich einen schlechteren Gesundheitszustand und auch eine stärker in Mitleidenschaft genommene psychische Verfassung aufweisen.
Ein Abstract der Studie ist hier zu lesen: Bringing the War Back Home - Mental Health Disorders Among 103 788 US Veterans Returning From Iraq and Afghanistan Seen at Department of Veterans Affairs Facilities (Arch Intern Med. 2007;167:476-482)
Gerd Marstedt, 13.3.2007
Weltbevölkerung wächst schneller als erwartet: 2050 gibt es über 9 Milliarden Menschen
 Trotz leicht sinkender Kinderzahlen wächst die Weltbevölkerung jährlich immer noch um 78 Millionen Menschen. Nach der mittleren Variante der neuesten Projektionen der Vereinten Nationen wird es bis zum Jahr 2050 einen Zuwachs von 2,5 Milliarden Menschen geben. Zur Jahrhundertmitte werden dann 9,2 Milliarden Menschen auf der Erde leben - heute sind es 6,7 Milliarden. So lauten die Ergebnisse aktueller Modellrechnungen der UN-Bevölkerungsabteilung, die die Deutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW) jetzt vorstellte.
Trotz leicht sinkender Kinderzahlen wächst die Weltbevölkerung jährlich immer noch um 78 Millionen Menschen. Nach der mittleren Variante der neuesten Projektionen der Vereinten Nationen wird es bis zum Jahr 2050 einen Zuwachs von 2,5 Milliarden Menschen geben. Zur Jahrhundertmitte werden dann 9,2 Milliarden Menschen auf der Erde leben - heute sind es 6,7 Milliarden. So lauten die Ergebnisse aktueller Modellrechnungen der UN-Bevölkerungsabteilung, die die Deutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW) jetzt vorstellte.
Das Bevölkerungswachstum findet nach diesen Modellrechnungen in Zukunft ausschließlich in den Entwicklungsländern statt. Dort wird die Bevölkerung in den nächsten 43 Jahren von 5,4 auf 7,9 Milliarden Menschen anwachsen. In den Industrieländern dagegen bleibt die Bevölkerungszahl bei etwa 1,2 Milliarden nahezu konstant. "Vor allem die am wenigsten entwickelten Länder wachsen immer noch rasant", erklärte DSW-Pressesprecherin Catherina Hinz. "In den 50 ärmsten Ländern der Welt wird sich die Bevölkerung bis 2050 von 0,8 auf 1,7 Milliarden Menschen mehr als verdoppeln." In Ländern mit junger Altersstruktur wie Afghanistan, Uganda, Niger oder dem Kongo, wird sich die Bevölkerung in den nächsten 43 Jahren sogar verdreifachen. "Es ist dringend notwendig, dass in diesen Ländern Maßnahmen der Familienplanung stärker gefördert werden. Nur wenn sich das Bevölkerungswachstum verlangsamt, können diese Länder die Armut erfolgreich bekämpfen. Die rasant wachsende Bevölkerung überfordert bereits heute die Gesundheits- und Bildungssysteme dieser Staaten", hob Hinz hervor.
Die UN-Projektionen gehen davon aus, dass die durchschnittliche Geburtenrate in den Entwicklungsländern bis 2050 von heute 2,75 auf 2,05 Kinder pro Frau sinken wird. "Um dieses Ziel zu erreichen, wären allein in Afrika zusätzliche Investitionen von 70 Millionen US-Dollar pro Jahr in Familienplanungsdienste notwendig", sagte Hinz. Obwohl die Anzahl der Aids-Erkrankten, die eine antiretrovirale Therapie erhalten, deutlich gestiegen ist, wirkt sich Aids immer noch stark auf die Lebenserwartung in vielen Entwicklungsländern aus. Im südlichen Afrika, wo die HIV-Infektionsraten am höchsten sind, ist die Lebenserwartung aufgrund der Immunschwächekrankheit von 62 Jahren im Zeitraum 1990-1995 auf nur noch 49 Jahre in 2005-2010 gesunken. Voraussichtlich wird die Lebenserwartung erst um 2045 wieder eine den Anfang der 1990er Jahren vergleichbare Höhe erreichen. Trotz der hohen Mortalitätsrate steigt das Bevölkerungswachstum im südlichen Afrika jedoch noch um 0,6 Prozent pro Jahr. "Neben der Behandlung der Aids-Kranken ist es für die Zukunft wichtig, weitere Infektionen zu verhindern. Dafür ist es notwendig, die HIV-Prävention stärker auszubauen und mit anderen Maßnahmen der reproduktiven Gesundheit wie Familienplanung und Schwangerschaftsbetreuung stärker zu verschränken", so Hinz.
Ein weiterer Trend, der aus den neuen Zahlen der Vereinten Nationen hervorgeht, ist die deutliche Alterung der Weltbevölkerung bis zur Jahrhundertmitte. Weltweit wird sich die Anzahl von Personen im Alter von über 60 Jahren bis 2050 von 673 Millionen auf zwei Milliarden verdreifachen. In den Industrieländern wird der Anteil der über 60-Jährigen von 20 Prozent auf 33 Prozent im Jahr 2050 steigen. Auf jedes Kind kommen dann mehr als zwei Personen über 60. Europa wird bis 2050 um 67 Millionen Menschen schrumpfen. Schon heute können 28 Industrieländer aufgrund niedriger Geburtenraten einen Bevölkerungsrückgang nur durch die Aufnahme von Migranten verhindern oder zumindest moderate Zuwächse verzeichnen. Auch Deutschland gehört mit jährlich 150.000 Einwanderern zu dieser Gruppe.
Eine Vielzahl von Excel-Tabellen mit Daten zur Lebenserwartung, Kindersterblichkeit usw. nach Ländern und Weltregionen sind hier herunterzuladen: Bevölkerungsprojektionen der Vereinten Nationen
Die DSW-Grafiken "Weltbevölkerungprojektionen für 2050", "Die Welt altert", "Entwicklung der Kinderzahlen in Kenia, Uganda und Thailand", "Zu- und Abnahme der Bevölkerung in den Weltregionen" und "Die demographischen Auswirkungen von HIV/Aids" ist hier: Deutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW) Weltbevölkerungsprojektionen für 2050
Gerd Marstedt, 13.3.2007
Psychische Gewalt hat ebenso grausame Folgen wie körperliche Folter
 "Ein bösartiger Umgang mit Gefangenen, etwa in Form von psychologischer Manipulation, Demütigung und Erniedrigung sowie künstlich herbeigeführtem Stress unterscheidet sich nicht nennenswert von körperlicher Folter, wenn man berücksichtigt, welchen Schweregrad das dadurch verursachte seelische Leiden hat, welche Mechanismen traumatischer Stresserfahrungen dahinterstehen und was die langfristigen psychologischen Schäden sind. Diese Vorgehensweisen gleichen daher weitgehend einer Folterung und sollten durch internationale Gesetze verboten werden."
"Ein bösartiger Umgang mit Gefangenen, etwa in Form von psychologischer Manipulation, Demütigung und Erniedrigung sowie künstlich herbeigeführtem Stress unterscheidet sich nicht nennenswert von körperlicher Folter, wenn man berücksichtigt, welchen Schweregrad das dadurch verursachte seelische Leiden hat, welche Mechanismen traumatischer Stresserfahrungen dahinterstehen und was die langfristigen psychologischen Schäden sind. Diese Vorgehensweisen gleichen daher weitgehend einer Folterung und sollten durch internationale Gesetze verboten werden."
Mit diesen Worten fasst der Psychologe Metin Basoglu von der University of London die Ergebnisse seiner Studie zusammen, in der er 279 Opfer von Folter und Gewalt im Rahmen der Bürgerkriege im früheren Jugoslawien ausführlich interviewt hatte. Die Studie wurde jetzt in der Zeitschrift "Archives of General Psychiatry" veröffentlicht und stieß international auf große Beachtung. Besonderes Gewicht erhalten die Ergebnisse nach Aussage des Wissenschaftlers dadurch, dass das US-Justizministerium in einem Memorandum für seine Militärtruppen "Memorandum for James B. Comey, Deputy Attorney General, re: legal standards applicable under 18 USC §§ 2340-2340A" eine so enge Definition von Folter gegeben hatte, dass dadurch eine Vielzahl psychischer Grausamkeiten als legitim anerkannt war: Die Augen verbinden, Kapuzen über dem Kopf, Isolation, Zwang zu längerem aufrechtem Stehen, Fesseln, Entzug von Schlaf, Verdunkelung, Entzug von Getränken oder Medikamenten, Nahrungsentzug, psychologische Drohungen und Manipulationen, um den Willen einer Person zu brechen. Erst auf internationalen Druck hin änderte die US-Regierung 2006 ihre Position und anerkannte die Genfer Konvention auch für Gefangene von US-Truppen (vgl. Washington Post: U.S. Shifts Policy on Geneva Conventions).
Basoglu befragte in den Jahren 2000-2002 insgesamt 279 aus Folterherrschaft Überlebende aus Belgrad, Rijeka, Sarajevo und Banja Luka. Dabei erfasste er zunächst, welche Foltermethoden die Betroffen erleiden mussten. Die in seinem Aufsatz veröffentlichte Statistik hierüber liest sich wie ein Schreckensarsenal aus dem Mittelalter: Vergewaltigung, Elektroschocks, Zähneziehen, Nadeln unter den Fingernagel pressen, Verbrennungen von Körperteilen, Beinahe-Erstickungen, An den Haaren Aufhängen. Genau so brutal und unmenschlich erscheinen die psychologischen Foltermethoden wie Scheinerschießungen, Verabreichung von Fäkalien im Essen, Aussetzung unter extreme Hitze oder Lärm, Zwang zum dauerhaften Aufrechtstehen.
Deutlich wurde in der Analyse dann, dass die psychische Gewalt für die betroffenen Gefangenen genau so stark oder sogar noch stärker als Stress erlebt wurde wie körperliche Torturen. Das Stress-Erlebnis wurde dabei anhand mehrerer Fragebögen erfasst, die schon in früheren Untersuchungen über Erfahrungen von Kriegsheimkehrern erprobt worden waren. Gemessen wurde das Ausmaß von Ängsten, Todesfurcht, Scham und anderen belastenden Gefühlen. Welche der einzelnen Foltermethoden von den Betroffenen am bedrohlichsten erlebt wurde, konnte in der Studie nicht geprüft werden: Fast alle ehemaligen Gefangenen hatten eine solche große Vielzahl unterschiedlichster Qualen und Demütigungen erlitten, dass diese "zu einer unauflöslichen traumatischen Erfahrung" wurden.
Dass jedoch psychische Gewalt genau so schlimme langfristige Folgen hat wie körperliche Folter, schließt der Wissenschaftler aus mehreren Ergebnissen. Zwar zeigt es sich, so führt er aus, dass einige körperliche Foltermethoden, insbesondere solche, die große Schmerzen verursachten, als etwas höhere Stressbelastung eingestuft wurden. Andererseits jedoch zeigte sich auch für eine große Zahl nicht-körperliche Folterarten, dass diese als genauso starke Peinigung und Qual erlebt wurden. Dies gilt etwa für Scheinerschießungen, Androhungen der Vergewaltigung, das erzwungene Miterleben des Folterns anderer Personen oder das Verbinden der Augen oder längerfristigen Schlafentzug. Darüber hinaus hat sich auch gezeigt, dass die langfristigen psychischen Folgen nicht so gravierend ausfallen, wenn jemand ausschließlich körperliche Qualen erlitten hatte.
Der Wissenschaftler schließt seine Veröffentlichung mit dem Hinweis, dass jene Unterscheidung, die in einer Konvention der UN getroffen wird, nämlich zwischen Folter und anderen Formen grausamer, unmenschlicher, erniedrigender Behandlung oder Bestrafung, schnellstmöglich abgeschafft werden sollte. Auch wenn beide Formen in der Konvention verboten sind, würde dadurch eben doch der Eindruck erweckt, körperliche Folter sei etwas anderes als psychische Gewalt.
Die Studie ist hier im Volltext nachzulesen: Torture vs Other Cruel, Inhuman, and Degrading Treatment - Is the Distinction Real or Apparent? (Arch Gen Psychiatry. 2007;64:277-285)
Gerd Marstedt, 7.3.2007
Der "Irak-Effekt" - Unerwünschte physische und psychosoziale Folgen eines "Befreiungskrieges" für den Irak und die Welt
 Wie vor wenigen Tagen berichtet, haben mit teilweise zunehmender Tendenz immer mehr Menschen weltweit und besonders in Deutschland Ängste vor der Zukunft. Einer der Gründe dieser Ängste ist die Erwartung, Opfer eines Anschlags des "internationalen, vorrangig islamistischen Terrorismus" zu werden - auch wenn er sich bisher in Europa nur relativ selten manifestiert hat (z.B. in London oder Madrid).
Wie vor wenigen Tagen berichtet, haben mit teilweise zunehmender Tendenz immer mehr Menschen weltweit und besonders in Deutschland Ängste vor der Zukunft. Einer der Gründe dieser Ängste ist die Erwartung, Opfer eines Anschlags des "internationalen, vorrangig islamistischen Terrorismus" zu werden - auch wenn er sich bisher in Europa nur relativ selten manifestiert hat (z.B. in London oder Madrid).
Dass es sich bei der Furcht vor "mehr" Terrorismus nicht um ein mediales Phantom handelt und dabei politische, also auch weiterhin beeinflussbare Entscheidungen eine gewichtige Rolle spielen, weist ein für die März-Ausgabe der us-amerikanische Internet-Zeitschrift "Mother Jones" erstellter Report zweier Terrorismus-Forscher des "Center on Law and Security" an der "New York University School of Law" nach. Peter Bergen and Paul Cruickshank haben durch eine Analyse von Daten des eher konservativen Think-Tanks "RAND Corporation" nämlich den so genannten "Iraq effect" quantifiziert. Darunter verstehen sie vor allem "incidents of jihadist violence".
Nach ihrer Statistik hat diese Art von Zwischenfällen seit der Invasion der Truppen der USA und ihrer Verbündeter im Irak weltweit um 607 % zugenommen (von vorher jährlich 28.3 Attacken auf 199.8 Anschläge danach). Die Anzahl der dadurch getöteten Menschen stieg um 237 % (von vorher 501 Getöteten pro Jahr auf danach 1.689 Tote pro Jahr) an. Ohne entsprechende Ereignisse im Irak und in Afghanistan fanden die Forscher eine weltweite Zunahme der Zahl von jihadistischer Attacken von 35 %. Allein auf westliche Interessen und Bürger gerichtete Angriffe nahmen um beinahe 25 % zu.
Der Vollständigkeit halber dürfen aber auch die sozialen und auch gesundheitlichen Auswirkungen auf die irakische Bevölkerung nicht übersehen werden.
Die beiden Experten präsentieren in ihrer Studie dazu folgende Daten:
• Der "neueste Exportartikel" des Irak sind danach Flüchtlinge: 1,8 Millionen Bürger haben den Irak verlassen (allein 700.000 irakische Flüchtlinge wohnen in Jordanien, 60.000 in Schweden), 1,6 Millionen haben ihren Wohnort innerhalb des Iraks unfreiwillig wechseln müssen. Aktuell beträgt die tägliche Anzahl beider Arten von Flüchtlingen 3.000 Personen. Makaberes Detail: Im gesamten Jahr 2006 erhielten gerade einmal 202 irakische Flüchtlinge die Erlaubnis, die USA zu betreten. Saudiarabien baut außerdem gerade einen 560 Meilen langen Grenzzaun, um Flüchtlinge aus dem Irak fernzuhalten.
• 40 % aller hochqualifizierten Berufstätigen sind geflohen, darunter ein Drittel aller Ärzte. Ein harter Grund: Seit 2003 sind rund 2.000 Ärzte ermordet worden.
• Besuchten vor dem Krieg fast 100 % der irakischen Kinder eine Schule, waren es 2006 gerade noch 30 %.
• Eine im Jahre 2006 durchgeführter Kindersurvey in Bagdad zeigte, dass 47 % der Kinder ein großes traumatisches Erlebnis hinter sich hatten. 14 % litten an einer posttraumatischen stressbedingten Störung
Der komplette Report "The Iraq Effect: War Has Increased Terrorism Sevenfold Worldwide" aus der "Mother Jones"-Ausgabe vom 1. März 2007 kann hier heruntergeladen werden.
Bernard Braun, 28.2.2007
Intakte Blutdruckwerte - der Schlüssel zum Glücklichsein? Deutsche sind in einer EU-Studie Schlusslicht
 Wer keine Probleme mit hohem Blutdruck hat, der ist auch mit seinem Leben hoch zufrieden. Diesen direkten Zusammenhang zwischen Lebensfreude und medizinischen Messwerten fanden jetzt Forscher in einer großen Studie in 16 EU-Ländern heraus. Bei einem Vergleich der Länder untereinander zeigte sich darüber hinaus, dass Deutsche zusammen mit Portugiesen und Finnen am unteren Ende der Skala anzutreffen sind: Sie berichten am häufigsten über zu hohen Blutdruck und sind am seltensten mit ihren Lebensbedingungen zufrieden. Am oberen Ende der Skala findet man Irländer, Dänen, Niederländer und Schweden.
Wer keine Probleme mit hohem Blutdruck hat, der ist auch mit seinem Leben hoch zufrieden. Diesen direkten Zusammenhang zwischen Lebensfreude und medizinischen Messwerten fanden jetzt Forscher in einer großen Studie in 16 EU-Ländern heraus. Bei einem Vergleich der Länder untereinander zeigte sich darüber hinaus, dass Deutsche zusammen mit Portugiesen und Finnen am unteren Ende der Skala anzutreffen sind: Sie berichten am häufigsten über zu hohen Blutdruck und sind am seltensten mit ihren Lebensbedingungen zufrieden. Am oberen Ende der Skala findet man Irländer, Dänen, Niederländer und Schweden.
Die Wissenschaftler von der University of Warwick (England) hatten aus einer Routine-Erhebung der EU, dem sog. "Eurobarometer" Daten von 15.000 zufällig ausgewählten Personen aus 16 EU-Ländern näher analysiert und dabei insbesondere den Zusammenhang von Bluthochdruck und Lebenszufriedenheit näher betrachtet. Blutdruck-Probleme wurde nicht objektiv gemessen, sondern anhand einer Frage erfasst: "Würden Sie sagen, dass Sie schon einmal Probleme wegen zu hohen Blutdrucks hatten?" Die Forscher gingen davon aus, dass die Teilnehmer bei der Antwort Informationen Ihres Arztes berücksichtigen würden. Die Frage nach dem Glücklichsein, bzw. genauer: nach der Lebenszufriedenheit lautete: "Würden Sie sagen, Sie sind sehr zufrieden, einigermaßen zufrieden, nicht so zufrieden oder ganz und gar nicht zufrieden mit dem Leben, das Sie jetzt führen?"
Bei der Gegenüberstellung dieser beiden Informationen zeigte sich dann für die Forscher ein überraschend hoher Zusammenhang: Teilnehmer, die über sehr starke Probleme mit ihrem Bluthochdruck berichteten, stuften zugleich auch ihre Lebenszufriedenheit sehr viel geringer ein. So zeigte eine Gegenüberstellung der Befragten mit Bluthochdruck-Problemen und dem Anteil der Befragten (in %), die mit ihrem Leben eher oder sehr zufrieden sind:
• keine Blutdruck-Probleme: 63% hohe Lebenszufriedenheit
• geringe: 18%
• eher große: 6%
• sehr große: 1%
Die Forscher gingen jedoch noch einen Schritt weiter und überprüften auch, ob sich in den 16 EU-Ländern das Ausmaß der Blutdruckprobleme oder der Zufriedenheit unterschiedlich darstellt. Tatsächlich fanden sie, auch bei einer statistischen Kontrolle der Altersstruktur und Geschlechtszugehörigkeit in den einzelnen Ländern, dass es hier sehr große Differenzen gab. In der obersten Gruppe (mit wenig Bluthochdruck-Problemen und hoher Lebenszufriedenheit) finden sich Teilnehmer aus Schweden, Dänemark, Großbritannien und den Niederlanden, in der Gruppe mit den meisten medizinischen Problemen und der geringsten Zufriedenheit waren Ost- und Westdeutsche anzutreffen, zusammen mit Portugiesen und Finnen. So äußerten nur 58% der Westdeutschen und 50% der Ostdeutschen keinerlei Blutdruckprobleme (zum Vergleich: Dänen 79%). Und nur 27% der Westdeutschen und 18% der Ostdeutschen waren mit ihrem Leben sehr zufrieden (Dänen 66%).
Genau erklären können die Wissenschaftler den Zusammenhang nicht: Bewirkt eine positive Einstellung zur eigenen Lebenssituation nun auch eine Einpendelung körperlicher Funktionswerte im Normalbereich? Oder überträgt sich die Wahrnehmung eines guten Gesundheitszustandes auf die Lebensfreude? Oder werden beide Indikatoren ihrerseits von einem dritten Einflussfaktor gesteuert? Auch erfährt man in der Studie recht wenig darüber, inwieweit von den Wissenschaftlern unterschiedliche Rahmenbedingungen der Gesundheitsversorgung als Einflussgröße berücksichtigt wurden: Wird Bluthochdruck in den einzelnen Ländern von Ärzten unterschiedlich definiert und ernst genommen? Ist die Inanspruchnahme von Ärzten und die Information der Ärzte etwa gleich?
Trotz vieler offener Fragen beschrieben die Forscher die Bedeutung ihrer ihre Befunde recht vollmundig: "Auch wenn es etwas merkwürdig klingt, dies im Jahre 2007 zu erklären, meinen wir dennoch: Vielleicht werden Blutdruckwerte eines Tages Kennwerte wie das Bruttoinlandsprodukt als Maßstab für den Erfolg eines Landes ersetzen oder ergänzen." Objektiv feststellbar bleibt zumindest, dass Bluthochdruck ein überaus relevanter Risikofaktor für viele Folgeerkrankungen ist und zugleich weltweit sehr stark verbreitet: Der World Health Report 2002 definiert Bluthochdruck (mit Blutdruckwerten über 140/90 mmHg) als zentralen Faktor für die Lebenserwartung und Lebensqualität und schätzt, dass weltweit etwa 1 Milliarde Menschen betroffen sind.
• Eine Pressemitteilung mit den wichtigsten Befunden ist hier zu finden:
University of Warwick: Germany & Portugal come near bottom of new blood pressure based happiness league
• Die komplette Veröffentlichung findet man hier (PDF, 34 Seiten):
David G. Blanchflower und Andrew J. Oswald: Hypertension and Happiness across Nations
Erst vor kurzem hatte ein deutsch-dänisches Wissenschaftsteam sich in einem Aufsatz im British Medical Journal der Frage gewidmet, warum sich die Dänen als "Weltmeister im Glücklichsein" erweisen (vgl. Artikel in dieser Rubrik "Warum die Dänen im Glücksrausch sind und die Epidemiologen im Erklärungsnotstand"). Die Dänen, so erläuterten die Wissenschaftler das überdurchschnittlich hohe Maß an Lebenszufriedenheit unserer Nachbarn, sind in Bezug auf ihre Lebens-Ansprüche und Erwartungen eher bescheiden und sie genießen die augenblicklich zufriedenstellenden Bedingungen, ohne sie maßlos in die Zukunft zu verlängern.
Gerd Marstedt, 20.2.2007
Muttermilch - ein Wunderelixier auch für die Intelligenz und soziale Karriere des Kindes?
 In den medizinischen Fachzeitschriften sind klinische und epidemiologische Studien zum Stillen und zu den Effekten der Säuglings-Ernährung mit Muttermilch schon seit Jahrzehnten gang und gäbe. In populären Online- und Print-Zeitschriften jedoch fand man in den letzten Tagen eine verblüffende Häufung von Berichten über die Segnungen des Stillens: Ein sozialer Aufstieg der brustgenährten Kinder wurde damit in Verbindung gebracht oder auch ein höherer Intelligenzquotient, zumindest aber ein gesenktes Risiko für Krebserkrankungen.
In den medizinischen Fachzeitschriften sind klinische und epidemiologische Studien zum Stillen und zu den Effekten der Säuglings-Ernährung mit Muttermilch schon seit Jahrzehnten gang und gäbe. In populären Online- und Print-Zeitschriften jedoch fand man in den letzten Tagen eine verblüffende Häufung von Berichten über die Segnungen des Stillens: Ein sozialer Aufstieg der brustgenährten Kinder wurde damit in Verbindung gebracht oder auch ein höherer Intelligenzquotient, zumindest aber ein gesenktes Risiko für Krebserkrankungen.
Die Amerikanische Akademie der Kinderärzte zählt in ihrer vielzitierten Veröffentlichung Breastfeeding and the Use of Human Milk einige Dutzend Erkrankungen auf, gegen die Kinder geschützt sind, wenn sie nicht mit dem Fläschchen, sondern mit Muttermilch ernährt wurden: Durchfall und Atemwegsinfektionen, Diabetes und Infektionen der Harnwege, Allergien und Hirnhautentzündungen. Auch die englische Wikipedia-Website liefert unter dem Stichwort Breastfeeding (Stillen) eine beeindruckende Liste von Studien, die suggeriert: Muttermilch ist ein präventives Allheilmittel gegen jedwede Art späterer Erkrankung. Doch ein Großteil der zitierten Studien steht auf eher wackligem methodischen Boden. Die Ergebnisse basieren auf oftmals nur sehr geringfügigen Risiko-Differenzen und es bleibt meist offen, ob tatsächlich das Stillen die Ursache ist oder nicht eher bestimmte körperliche oder soziale Merkmale der Mütter, die ihrerseits dafür maßgeblich sind, ob eine junge Mutter stillt oder nicht.
So hatten mehrere Studien zunächst auch nahegelegt, dass Stillen förderlich ist für die Intelligenz des Kindes. Eine im Jahr 2002 veröffentlichte dänische Studie The association between duration of breastfeeding and adult intelligence hatte untersucht, ob und wie lange Säuglinge gestillt worden waren und später im Alter von 19 bzw. 27 Jahren in einem Test ihre Intelligenz gemessen. Fazit der Wissenschaftler: "Es wurde ein statistisch signifikanter Zusammenhang beobachtet zwischen der zeitlichen Dauer des Stillens und der Intelligenz, beobachtet in zwei unabhängigen Stichproben jüngerer Erwachsener und gemessen mit zwei verschiedenen Intelligenztests".
In einer späteren großen Studie hingegen, 2006 veröffentlicht im renommierten "British Medical Journal", zeigte die Untersuchung von mehr als 5000 Kindern und über 3000 Müttern andere Befunde. Die Studie Effect of breast feeding on intelligence in children: prospective study, sibling pairs analysis, and meta-analysis ergab: "Stillen hat nur einen geringen oder gar keinen Effekt für die Intelligenz der Kinder." Deutlich wurde allerdings: "Der Intelligenzquotient der Mutter beeinflusst in sehr starkem Maße ihr Stillverhalten, deutlich mehr als andere Merkmale wie Rasse, Bildung, Alter, materielle Verhältnisse, Rauchen, die häusliche Umgebung, das Geburtsgewicht des Kindes oder die Geburtsfolge." Einfacher ausgedrückt: Mütter mit hohem Intelligenzquotienten (IQ) stillen öfter als solche mit niedrigem. Da Intelligenz teilweise auch vererbt wird, haben auch die Kinder öfter einen hohen IQ.
Die Studien zum Stillen und damit zusammenhängenden Merkmalen der Kinder sind ein Paradebeispiel dafür, wie stark in klinischen und epidemiologischen Studien die Tendenz besteht, komplexe soziale Zusammenhänge auf schlichte biologische oder auch genetische Wirkungsmechanismen zu reduzieren. Ein jüngstes Beispiel dafür ist die Studie über Zusammenhänge zwischen dem Stillen der Mutter und der späteren sozialen Stellung des Kindes. So berichtete jetzt eine Forschergruppe an der Universität von Bristol: Kinder, die früher gestillt worden sind, schaffen später den Aufstieg in einer höhere soziale Schicht (im Vergleich zum Elternhaus) öfter als Kinder, die nicht gestillt wurden.
Aus einer großen Datenerhebung in England Ende der 30er Jahre hatte man Befunde von fast 3.200 Familien darüber vorliegen, ob die Säuglinge gestillt wurden oder nicht. Bei knapp der Hälfte dieser Familien konnte man später auch die Kinder ausfindig machen und feststellen, zu welcher sozialen Schicht (Bildungsniveau, berufliche Stellung, Einkommen) sie jetzt gehören und früher gehörten. Resultat der Analyse war: Säuglinge, die früher gestillt wurden, erreichten später zu 58% eine höhere soziale Stellung als ihre Eltern, bei Flaschenkindern war dies nur bei 50% der Fall. Im Rahmen einer statistischen Kontrolle auch anderer Einflussfaktoren wie Alter, Geschlecht oder Dauer des Stillens blieb dieser Effekt erhalten. Allerdings räumen die Wissenschaftler ein: Es ist möglich, dass sich stillende Frauen zu jener Zeit von den heutigen Müttern unterscheiden. Wir können nicht ausschließen, dass es hinter diesen statistischen Zusammenhängen Einflussfaktoren gibt, die wir nicht erfasst haben.
Der Aufsatz ist hier im Volltext als PDF-Datei verfügbar:
Breastfeeding in infancy and social mobility: 60 year follow-up of the Boyd Orr cohort
Gerd Marstedt, 19.2.2007
Potenzstörungen: Bewegungsfaule Männer sind erheblich öfter betroffen
 Etwa jeder fünfte Mann in den USA im Alter über 20 ist zumindest gelegentlich von Potenzstörungen betroffen. Besonders häufig fanden die Wissenschaftlicher solche Probleme bei Rauchern, Bluthochdruck-Patienten, Übergewichtigen und auch bei Männern, die keinerlei Sport treiben oder körperliche Bewegung haben. Eine daraus abgeleitete Empfehlung der Forscher an Ärzte war daher, dass in einer großen Zahl von Fällen möglicherweise die Anregung zu körperlicher Betätigung sinnvoller sei als eine Verschreibung von potenzsteigernden Medikamenten.
Etwa jeder fünfte Mann in den USA im Alter über 20 ist zumindest gelegentlich von Potenzstörungen betroffen. Besonders häufig fanden die Wissenschaftlicher solche Probleme bei Rauchern, Bluthochdruck-Patienten, Übergewichtigen und auch bei Männern, die keinerlei Sport treiben oder körperliche Bewegung haben. Eine daraus abgeleitete Empfehlung der Forscher an Ärzte war daher, dass in einer großen Zahl von Fällen möglicherweise die Anregung zu körperlicher Betätigung sinnvoller sei als eine Verschreibung von potenzsteigernden Medikamenten.
Die Wissenschaftler aus Baltimore hatten mit einer repräsentativen Stichprobe von rund 2.100 US-Amerikanern im Alter von über 20 Jahren Befragungen und bei einer etwas kleineren Gruppe (1400) auch körperliche Untersuchungen zur Messung von Bluthochdruck, Körpergewicht und anderen medizinischen Indikatoren durchgeführt. Als allgemeines Ergebnis zur Betroffenheit von Potenzstörungen zeigte sich, dass nicht ganz jeder Fünfte (18%) zumindest gelegentlich von solchen Problemen betroffen ist. Dabei wurden auch Unterschiede im Schweregrad deutlich: 65% gaben an, sie seien immer potent, 17% sind es meistens, 12% sind zumindest gelegentlich potent und 6% gar nicht. Als Indikator hierfür galt die Antwort auf die Frage: "Wie würden Sie Ihre Fähigkeit beschreiben, eine Erektion zu bekommen und diese für einen befriedigenden Geschlechtsverkehr aufrecht zu erhalten?"
Nicht überraschend zeigten sich bei der Auswertung der Daten auch Altersunterschiede. Immer potent sind nach der Studie 85% der Befragten unter 40 Jahren, 65% derjenigen im Alter von 40-59, aber nur noch 29% der 60-69jährigen und lediglich noch 11% der 70jährigen und Älteren. Umgekehrt steigt die Quote dauerhafter Impotenz von 5% in der jüngsten Altersgruppe (unter 40) auf 44% bei 60-69jährigen und 70% bei 70jährigen und Älteren.
Interessanter als diese Ergebnisse zum Alterseinfluss waren in der Untersuchung jedoch die Effekte anderer Faktoren. So zeigte sich, dass die Antwort "nie potent" oder "nur manchmal potent" von mehreren medizinischen Einflussgrößen und auch von Verhaltensaktivitäten abhängig war. Für gelegentliche oder dauerhafte Erektionsprobleme zeigten sich zwischen folgenden Gruppen Unterschiede:
• Noch-Nie-Raucher waren zu 14% betroffen, frühere Raucher zu 19%, gegenwärtige Raucher zu 21%
• Befragte mit Bluthochdruck zu 28%, ohne Bluthochdruck zu 15%
• bei Übergewichtigen (BMI über 30) waren 20% betroffen (Normalgewichtige zu 14%)
• Diabetiker waren mit 39% besonders auffällig
• Aber auch beim Merkmal "Sport und körperliche Bewegung" zeigten sich deutliche Unterschiede. In jener Gruppe, die keinerlei Aktivität betreibt, hatten 23% Potenzprobleme, also fast doppelt so viele wie in der Gruppe mit intensiver körperlicher Betätigung (13%).
Bei diesen Gruppenvergleichen wurde der Alterseinfluss mitberücksichtigt und statistisch bereinigt (altersstandardisiert).
Das Fazit der Wissenschaftler lautete: "Der Zusammenhang zwischen Erektionsstörungen und unzureichender körperlicher Aktivität legt nahe, dass Änderungen im Lebensstil insbesondere im Bereich Bewegung eine effektive, nicht-medikamentöse Therapieform sind. Der Zusammenhang zwischen Potenzstörungen und Diabetes und anderen Risikofaktoren für Herz-Kreislauferkranken (wie Bluthochdruck) sollte Patienten verdeutlichen, wie wichtig für sie Änderungen ihres Lebensstils und ihrer Ernährung sein können. Unsere Daten legen nahe, dass körperliche Bewegung (...) ein Nachlassen der Erektionsfähigkeit verzögern oder verhindern können."
Die Studie ist im Volltext hier kostenlos nachzulesen: Prevalence and Risk Factors for Erectile Dysfunction in the US (American Journal of Medicine, Volume 120, Issue 2, Pages 151-157, Februar 2007)
Gerd Marstedt, 2.2.2007
Warum die Dänen im Glücksrausch sind und die Epidemiologen im Erklärungsnotstand
 Die Dänische Bevölkerung ist Weltmeister im Glücklichsein, und dies seit über 30 Jahren. Unlängst veröffentlichte die University of Leicester eine Weltkarte der Lebenszufriedenheit. Noch deutlicher als dort kann man auf einem Diagramm zur Lebenszufriedenheit im Eurobarometer erkennen, dass die Dänen seit Beginn der europaweiten Erhebungen im Eurobarometer unangefochten auf Platz 1 liegen. Im Jahr 2005 gaben rund 65% an, sie seien mit ihrem Leben vollkommen zufrieden. Recht dicht dahinter rangieren Schweden, Holländer und Luxemburger (mit 40-50%). Im Vergleich dazu schneiden die Deutschen nur als Trauerklöße ab: Nur 20% sind sehr zufrieden.
Die Dänische Bevölkerung ist Weltmeister im Glücklichsein, und dies seit über 30 Jahren. Unlängst veröffentlichte die University of Leicester eine Weltkarte der Lebenszufriedenheit. Noch deutlicher als dort kann man auf einem Diagramm zur Lebenszufriedenheit im Eurobarometer erkennen, dass die Dänen seit Beginn der europaweiten Erhebungen im Eurobarometer unangefochten auf Platz 1 liegen. Im Jahr 2005 gaben rund 65% an, sie seien mit ihrem Leben vollkommen zufrieden. Recht dicht dahinter rangieren Schweden, Holländer und Luxemburger (mit 40-50%). Im Vergleich dazu schneiden die Deutschen nur als Trauerklöße ab: Nur 20% sind sehr zufrieden.
Ein deutsch-dänisches Wissenschaftsteam (Odense und Rostock) hat sich nun in einem Aufsatz im British Medical Journal der hochspannenden Frage gewidmet, woraus diese überdurchschnittliche Lebenszufriedenheit der Dänen resultieren könnte. Sie haben dabei eine Vielzahl von Faktoren analysiert, so wie es auch Epidemiologen machen. Sie stellten Hypothesen auf über den möglichen Einfluss unterschiedlichster Faktoren: Gene und Ernährung, Alkohol- und Tabakkonsum, Klima und Familienverhältnisse, Leistungen des Wohlfahrtsstaates, Gesundheitszustand und viele andere mehr. Tatsächlich zeigte sich jedoch, dass all diese epidemiologischen Hypothesen fast keine oder gar keine Erklärungskraft haben. So rangieren die Dänen beispielsweise bei der Selbsteinstufung des Gesundheitszustands nur an 13.Stelle, bei den Familienverhältnissen zeigt sich, dass Heiraten in Dänemark zwar sehr oft vorkommen - aber auch Scheidungen. Für den Alkohol- und Tabakgenuss zeigen Daten sogar, dass Dänen hinsichtlich dieses ungesunden Verhaltens in Europa ganz weit oben rangieren. Fazit der Wissenschaftler war demzufolge, dass die ins Auge gefassten klassischen epidemiologischen Faktoren zur Erklärung der dänischen Lebenszufriedenheit versagen.
Sie diskutieren dann einen Aspekt, der ihrer Meinung nach eine überaus wichtige Rolle spielen könnte: Der Erwartungshorizont und die Ansprüche in Bezug auf das, was ein gutes Leben ist. Ihre Beobachtungen sind zwar nicht gerade harte und unanfechtbare empirische Belege für ihre Hypothese, sie dürften aber für zukünftige Studien durchaus anregende Fragestellungen bieten. Die Dänen, so führen die Wissenschaftler aus, sind in Bezug auf ihre Lebens-Ansprüche und Erwartungen eher bescheiden und sie genießen die augenblicklich zufriedenstellenden Bedingungen, ohne sie maßlos in die Zukunft zu verlängern. Dies zeigt sich einerseits auf eine andere Frage im Eurobarometer, wo nach den Erwartungen für das nächste Jahr gefragt wird. Hier liegen die Dänen trotz ihres aktuellen Glücksgefühls sehr weit unten, mit eher bescheidenen Zukunftsansprüchen. Ganz im Gegensatz übrigens zu Italienern und Griechen, deren aktuelle Lebenszufriedenheit extrem niedrig ausfällt, während die Erwartungen für das nächste Jahr ganz oben an der Spitze der europäischen Länder liegen. "Es geht uns gut", so berichten die Wissenschaftler schließlich, sei ein Spruch, der in Dänemark oft zu hören ist, aber mit einem kleinen Zusatz: "Lige nu" - jetzt im Augenblick, wie es mal sein wird, weiß man nicht.
Der Aufsatz ist hier als Volltext nachzulesen:
• Why Danes are smug: comparative study of life satisfaction in the European Union (BMJ 2006;333:1289-1291, 23.Dezember 2006)
• Hier findet man die Datenerhebungen des Eurobarometer
Gerd Marstedt, 23.1.2007
Beschäftigte im Gesundheitswesen 2005: Zwischen "Jobmotor" und "Personalmangel"
 "Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, waren zum 31. Dezember 2005 knapp 4,3 Millionen Menschen in Deutschland und damit etwa jeder neunte Beschäftigte im Gesundheitswesen tätig. Während die Beschäftigung in der Gesamtwirtschaft zwischen 2004 und 2005 nahezu stagnierte, ist sie im Gesundheitswesen um 27 000 Beschäftigte oder 0,6% gestiegen."
"Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, waren zum 31. Dezember 2005 knapp 4,3 Millionen Menschen in Deutschland und damit etwa jeder neunte Beschäftigte im Gesundheitswesen tätig. Während die Beschäftigung in der Gesamtwirtschaft zwischen 2004 und 2005 nahezu stagnierte, ist sie im Gesundheitswesen um 27 000 Beschäftigte oder 0,6% gestiegen."
Wer sich nach diesem rundum positiven Einstiegsabsatz einer Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes vom 18.1. 2007 zufrieden zurücklehnt und Meldungen über Personalmangel im Gesundheitswesen in das Reich des "üblichen Gejammers" verweist, verpasst die ganze Wahrheit um 10 Zeilen oder findet sie in seiner Tageszeitung gar nicht.
Denn ebenso wie die absolute Anzahl der Beschäftigten im Gesundheitswesen in dem zitierten Umfang gestiegen ist, setzte sich ein anderer Trend, nämlich die Abnahme der so genannten vollzeitäquivalenten Stellen fort.
In den Worten des Statistischen Bundesamtes sah dies so aus: "Nicht alle der 4,3 Millionen Beschäftigten im Gesundheitswesen besaßen eine Vollzeitstelle: Die Zahl der auf die volle tarifliche Arbeitszeit umgerechneten Beschäftigten im Gesundheitswesen, die so genannten Vollzeitäquivalente, lag bei 3,3 Millionen. Sie ging zwischen 2004 und 2005 wie schon im Vorjahreszeitraum weiter zurück (- 26 000 beziehungsweise - 0,8%). Grund hierfür war der Rückgang der Vollzeitbeschäftigung um 2,2%. Dies konnte auch durch den Anstieg der Teilzeit- beziehungsweise geringfügig Beschäftigten um 4,2% beziehungsweise 9,4% nicht ausgeglichen werden."
Die Beschäftigungssituation im Gesundheitswesen ist also weder mit dem Schlagwort "Jobmaschine" noch mit dem des "Personalmangels" allein angemessen zu beschreiben und zu bewerten, sondern erfordert differenziertere und ergebnisoffene Analysen z. B. über die Auswirkungen der Zunahme von Teilzeittätigkeit auf die Versorgungsqualität und die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten.
Wer über die quantitative Entwicklung noch Genaueres wissen will und zwar seit 1997 und nach Geschlecht sowie Berufen und Teilbereichen des Gesundheitswesens differenziert, kann dies interaktiv mit so genannten Ad hoc-Tabelellen des Statistischen Bundesamt machen.
Bernard Braun, 18.1.2007
Studie zum Sexualverhalten in 59 Ländern zeigt überraschende Befunde
 Eine neue bahnbrechende Studie der "London School of Hygiene & Tropical Medicine", unter Leitung von Prof. Kaye Wellings, zum Sexualverhalten und zu sexuell übertragenen Krankenheiten, zu Empfängnisverhütung und Schwangerschaftsabbrüchen, Gewalt gegen Frauen und zu vielen anderen Fragen im Zusammenhang mit dem Thema Sexualität ist jetzt veröffentlicht worden. Zusammengetragen und analysiert wurden Veröffentlichungen der Jahre 1996-2006 aus einer Vielzahl von Datenbanken und Internet-Bibliotheken weltweit. Ergebnisse aus diesem globalen neuen "Kinsey-Report" wurden jetzt in mehreren Aufsätzen in der renommierten Zeitschrift "The Lancet" veröffentlicht. Die Ergebnisse der Studie widerlegen eine Reihe von Vorurteilen, zeigen aber auch, welch große Bedeutung das Thema "Sexualität" für die Gesundheit innehat und wie groß die Probleme in Entwicklungsländern sind.
Eine neue bahnbrechende Studie der "London School of Hygiene & Tropical Medicine", unter Leitung von Prof. Kaye Wellings, zum Sexualverhalten und zu sexuell übertragenen Krankenheiten, zu Empfängnisverhütung und Schwangerschaftsabbrüchen, Gewalt gegen Frauen und zu vielen anderen Fragen im Zusammenhang mit dem Thema Sexualität ist jetzt veröffentlicht worden. Zusammengetragen und analysiert wurden Veröffentlichungen der Jahre 1996-2006 aus einer Vielzahl von Datenbanken und Internet-Bibliotheken weltweit. Ergebnisse aus diesem globalen neuen "Kinsey-Report" wurden jetzt in mehreren Aufsätzen in der renommierten Zeitschrift "The Lancet" veröffentlicht. Die Ergebnisse der Studie widerlegen eine Reihe von Vorurteilen, zeigen aber auch, welch große Bedeutung das Thema "Sexualität" für die Gesundheit innehat und wie groß die Probleme in Entwicklungsländern sind.
Die Aufsätze zeigen anhand einer Vielzahl von Grafiken und Tabellen in beeindruckender Weise das Gefälle auf, das zwischen wohlhabenden Industrienationen und Dritte-Welt-Ländern besteht. Eine Vielzahl von Indikatoren wird hier herangezogen: Gesundheitsriskante und unprofessionelle Schwangerschaftsabbrüche, Genitalverstümmelung bei Frauen, HIV- und AIDS-Raten sowie andere sexuell übertragene Krankheiten, ungewollte Schwangerschaften bei Jugendlichen.
Die Studie hat auch einige Ergebnisse geliefert, von denen die Forscher selbst überrascht waren. So zeigt sich:
• Entgegen landläufiger Meinung hat sich der Zeitpunkt erster sexueller Erfahrungen (Geschlechtsverkehr) in den letzten 20 Jahren nicht nach vorne, zu einem früheren Lebensalter verschoben. Im Gegenteil zeigt sich für alle Länder, für die Daten verfügbar waren, dass sich dieser Zeitpunkt bei Frauen sogar ein wenig nach hinten, zu einem höheren Alter verlagert hat. Die Forscher erklären dies mit einem zugleich angestiegenen Heiratsalter, das nach wie vor für viele erst die Möglichkeit zu sexuellen Erfahrungen bietet. Für Männer zeigt sich überwiegend, dass der Anteil derjenigen, der vor dem Alter von 15 zum ersten Mal Sex hat, stabil geblieben ist oder (insbesondere in Lateinamerika und Afrika) geringfügig gestiegen ist.
• Die Quote für sexuelle Promiskuität, also Sexualkontakte mit mehreren Partnern, fällt deutlich höher aus in wohlhabenden Staaten und nicht in Ländern der "Dritten Welt". Da in diesen Entwicklungsländern jedoch andererseits der Anteil der von AIDS und HIV Betroffenen deutlich höher liegt, folgern die Autoren: Die Problematik der durch Sexualität übertragenen Krankheiten ist sehr viel weniger begründet in einem "unmoralischen", promiskuitiven Sexualverhalten, als sehr viel eher in sozialen und ökonomischen Defiziten wie Armut, erzwungene Mobilität (Flucht vor Bürgerkrieg oder Armut) und Diskriminierung von Frauen.
• Die Quote ungewollter Schwangerschaften bei Teenagern ist in den USA auch im Vergleich zu anderen industrialisierten Nationen überdurchschnittlich hoch. Allerdings ist diese Quote im letzten Jahrzehnt gesunken, von 117 Schwangerschaften pro 1.000 weibliche Teenager im Jahre 1990 auf 82 im Jahre 2001. Als Erklärung hierfür wird in einigen Studien nicht nur die gestiegene Anwendung von Verhütungsmethoden und ein Effekt von Wohlfahrts-Programmen der Clinton-Regierung genannt, sondern auch die (von der Bush-Regierung geförderte) zunehmende sexuelle Enthaltsamkeit Jugendlicher.
Die im "Lancet" veröffentlichten Aufsätze bieten noch eine Vielzahl weiterer Informationen, die auch für Public-Health-Aktivitäten ebenso wie für politische Konzepte überaus fruchtbare Anregungen bringen. Die Aufsätze sind kostenlos auch als Volltext abrufbar, sofern man sich zuvor registriert hat oder schon registriert ist.
• Sexual and reproductive health: a matter of life and death (The Lancet 2006; 368:1595-1607)
• Sexual behaviour in context: a global perspective (The Lancet 2006; 368:1706-1728)
• Family planning: the unfinished agenda (The Lancet 2006; 368:1810-1827)
• Unsafe abortion: the preventable pandemic (The Lancet 2006; 368:1908-1919)
• Global control of sexually transmitted infections (The Lancet 2006; 368:2001-2016)
Gerd Marstedt, 18.1.2007
"Ein Haustier ist gesundheitsförderlich": Neue Forschungsergebnisse lassen Zweifel aufkommen
 "Menschen mit Haustieren leben ungesünder", so meldete Spiegel-Online jetzt unter Berufung auf eine neuere finnische Studie. "Hund, Katze und Kaninchen im Haus verbessern nicht die Gesundheit ihrer Halter. Im Gegenteil: Menschen ohne Tiere leben offenbar etwas gesünder." Die Meldung verblüfft, denn bislang galt in der wissenschaftlichen Szene das Gegenteil als gesicherte Erkenntnis.
"Menschen mit Haustieren leben ungesünder", so meldete Spiegel-Online jetzt unter Berufung auf eine neuere finnische Studie. "Hund, Katze und Kaninchen im Haus verbessern nicht die Gesundheit ihrer Halter. Im Gegenteil: Menschen ohne Tiere leben offenbar etwas gesünder." Die Meldung verblüfft, denn bislang galt in der wissenschaftlichen Szene das Gegenteil als gesicherte Erkenntnis.
So heißt es etwa zusammenfassend im Themenheft 19 des Robert-Koch-Instituts zur Gesundheitsberichterstattung Heimtierhaltung - Chancen und Risiken für die Gesundheit vom Dezember 2003: "...finden sich eine Reihe von Ergebnissen aus Forschungsvorhaben, die ebenfalls eine positive gesundheitliche Wirkung der Heimtierhaltung aufzeigen, darunter Hinweise auf geringere Blutdruckwerte und günstigere Cholesterin- und Blutfettwerte, mehr körperliche Bewegung und einen geringeren Medikamentenkonsum bei
Personen mit Heimtieren im Vergleich zu Personen ohne Heimtiere. Die dargestellten Effekte wurden jeweils im Vergleich zu ähnlichen Gruppen von Menschen ohne Tierhaltung ermittelt. Es kann jedoch nicht ganz ausgeschlossen werden, dass Menschen, die gesünder sind oder sich stärker fühlen, eher ein Tier anschaffen als schwerer Erkrankte oder Beeinträchtigte." (ebenda, S.9).
Besonderes Gewicht für die Annahme, dass Heimtiere der Gesundheit des Halters förderlich sind, kam bislang zwei Längsschnittstudien in Australien und Deutschland zu. In der deutschen Studie auf der Basis des "SOEP" (Sozio-ökonomisches Panel) wurde bei rund 10.000 Personen zu mehreren Zeitpunkten zwischen 1996 und 2001 unterschieden, ob der Betreffende ein Haustier hält oder nicht. Kontrolliert wurden in der Analyse das Alter, Geschlecht, Partnerschaft und Einkommen. Kriterium für "Gesundheit" war die Zahl der Arztbesuche. Als Ergebnis zeigte sich, dass Personen, die zu allen Untersuchungs-Zeitpunkten ein Haustier hielten, am seltensten zum Arzt gingen, verglichen mit den anderen Gruppen. Fazit der Autoren war: "So weisen die deutschen und australischen Befunde deutlich darauf hin, dass es der eigenen Gesundheit nützt, ein Haustier zu haben. Und weil die Daten auf großen und repräsentativen nationalen Stichproben basieren, läßt sich argumentieren, dass daraus auch Ersparnisse für das Gesundheitssystem resultieren." Die Ergebnisse der australischen und deutschen Studie sind hier als PDF verfügbar: (Headey B., Grabka, M., 2003) Pet ownership is good for your health and saves public expenditure too: australien and german evidence
In der finnischen Studie wird dieser Zusammenhang nun nicht mehr statistisch eindeutig belegt, es zeigen sich in der Tendenz eher gegenteilige Zusammenhänge, wonach Haustierbesitzer ungesünder leben (Übergewicht, Rauchen) und auch ihre Gesundheit negativer bewerten. In die Untersuchung einbezogen waren rund 21.000 Finnen zwischen 20 und 54 Jahren, die bis 1998 an einer 15 Jahre dauernden Befragung teilgenommen hatten. Erfasst wurde die Selbsteinschätzung der Gesundheit, Betroffenheit von Erkrankungen sowie verschiedene Aspekte des Gesundheitsverhaltens. Kontrolliert wurden Alter und Geschlecht der Befragungsteilnehmer. Zentraler Befund war: "Der Besitz eines Haustieres zeigt einen (sehr schwachen) negativen Zusammenhang zu verschiedenen Gesundheits- und Krankheits-Indikatoren." In der Diskussion ihrer Ergebnisse räumen die Wissenschaftler ein, dass die genwärtige Forschungslage unbefriedigend und widersprüchlich ist und weitere Untersuchungen nötig sind, um die Kausalzusammenhänge besser zu klären. Der Aufsatz zur Studie ist hier in der Zeitschrift "Plos One" frei verfügbar: Leena K. Koivusilta, Ansa Ojanlatva: To Have or Not To Have a Pet for Better Health?
Gerd Marstedt, 30.12.2006
Das Phantom "Jobmotor Gesundheitswesen" - Mehr geringfügiger Beschäftigte!
 Auf 92 Seiten legte das Statistische Bundesamt im August 2006 eine Datensammlung zu den Gesundheitsausgaben, den Krankheitskosten und dem Personal im Gesundheitswesen im Jahre 2004 vor. Die aktuellen Indikatoren werden bei Bedarf mit den Daten des Jahres 1995 verglichen.
Auf 92 Seiten legte das Statistische Bundesamt im August 2006 eine Datensammlung zu den Gesundheitsausgaben, den Krankheitskosten und dem Personal im Gesundheitswesen im Jahre 2004 vor. Die aktuellen Indikatoren werden bei Bedarf mit den Daten des Jahres 1995 verglichen.
Dabei kommt die Personalstatistik zu einem verglichen mit dem auf den zahllosen Gesundheitswirtschafts-Kongressen zweckoptimistischen Gerede vom "Jobmotor Gesundheitswesen" sehr differenzierten und realistischen Bild.
Zunächst stellen die Wiesbadener Statistiker ebenfalls fest, dass zur Leistungserstellung im Gesundheitswesen viel Personal benötigt wird. Entsprechend waren zum Jahresende 2004 4,2 Millionen Personen im Gesundheitswesen tätig, das entspricht 10,6% aller Beschäftigten in Deutschland. Mit 3,9 Millionen Personen waren dabei 93,0% im Gesundheitswesen im engeren Sinne beschäftigt.
Während im Gesundheitswesen ein Anstieg der Beschäftigtenzahl um 3,6% zu verzeichnen war, gab es in der Gesamtwirtschaft 0,9% Beschäftigte weniger. Im Gesamtzeitraum 1997 bis 2004 fand im Gesundheitswesen ein Beschäftigungszuwachs von 3,1% statt. In der Gesamtwirtschaft ist in der gleichen Zeit die Zahl der Beschäftigten aber um mehr, nämlich 4,0% angestiegen. Der Zuwachs des Gesundheitspersonals setzte sich wie folgt zusammen: Während sich die Zahl der Beschäftigten in den Gesundheitsdienst- und den sozialen Berufen kontinuierlich erhöht hat, war bei den Gesundheitshandwerkern, den sonstigen Gesundheitsfachberufen und den anderen Berufen im Gesundheitswesen ein Rückgang der Beschäftigten zu verzeichnen.
Bei der Art der Beschäftigungsverhältnisse sind deutliche Abweichungen von der Gesamtwirtschaft feststellbar. Der Anteil der Vollzeitbeschäftigten lag im Jahr 2004 mit knapp zwei Dritteln (63,5% beziehungsweise 2,7 Millionen Personen) im Gesundheitswesen etwas niedriger als in der gesamten Wirtschaft (69,8%). Mehr als doppelt so hoch wie in der Gesamtwirtschaft (14,8%) war im Gesundheitswesen dagegen der Anteil der Teilzeitbeschäftigten mit gut einem Viertel (27,1% beziehungsweise 1,1 Millionen Personen).
Neben den drei Beschäftigungsarten werden auch die so genannten Vollzeitäquivalente ausgewiesen. Vollzeitäquivalente geben die Anzahl der auf die volle tarifliche Arbeitszeit umgerechneten Beschäftigten an. Ein Vollzeitäquivalent entspricht dabei einem Vollzeitbeschäftigten. Die Zahl der Vollzeitäquivalente betrug im Jahr 2004 rund 3,3 Millionen. Zwischen 1997 und 2004 unterlagen die Vollzeitäquivalente damit keinen größeren Schwankungen.
Bis zum Jahr 2000 sank die Zahl der Vollzeitäquivalente stetig um 2,1% und stieg seit 2001 um 1,0% an. Insgesamt blieben die Vollzeitäquivalente im Jahr 2004 um 11 000 (- 0,3%) hinter denen von 1997 zurück. Obwohl also seit 1997 ein Anstieg des Gesundheitspersonals um rund 128.000 Beschäftigte zu verzeichnen ist (+ 3,1%), zeigen die Vollzeitäquivalente, dass das Beschäftigungsvolumen insgesamt leicht rückläufig ist.
Hier gibt es die PDF-Datei: Gesundheit - Ausgaben, Krankheitskosten und Personal 2004.
Bernard Braun, 6.11.2006
Neuer Gesundheitsbericht: Gesundheit von Frauen und Männern im mittleren Lebensalter
 Das Robert-Koch-Institut bietet einen neuen Gesundheitsbericht als PDF-Datei (110 Seiten) zum Download an: "Gesundheit von Frauen und Männern im mittleren Lebensalter". Als "mittleres Lebensalter" wird dabei die Lebensspanne von 30 bis 65 Jahren definiert. Die Autorinnen (Julia Lademann, Petra Kolip) legen in dieser Literaturstudie besonderes Gewicht auf geschlechtsspezifische Unterschiede. Die aufgezeigten gesundheitsbezogenen Daten von Männern und Frauen im mittleren Lebensalter geben erste Hinweise auf Bereiche der Über-, Unter- und Fehlversorgung beider Geschlechter und bieten Ansatzpunkte zur Verbesserung einer männer- und frauengerechten Versorgung. Im Alter zwischen 30 und 65 Jahren ist die Sterblichkeit bei Männern doppelt so hoch wie bei Frauen, was vor allem auf Herzkreislauferkrankungen sowie Unfälle und Suizide zurückzuführen ist. Frauen geben dagegen eine schlechtere körperliche und psychische Befindlichkeit an.
Das Robert-Koch-Institut bietet einen neuen Gesundheitsbericht als PDF-Datei (110 Seiten) zum Download an: "Gesundheit von Frauen und Männern im mittleren Lebensalter". Als "mittleres Lebensalter" wird dabei die Lebensspanne von 30 bis 65 Jahren definiert. Die Autorinnen (Julia Lademann, Petra Kolip) legen in dieser Literaturstudie besonderes Gewicht auf geschlechtsspezifische Unterschiede. Die aufgezeigten gesundheitsbezogenen Daten von Männern und Frauen im mittleren Lebensalter geben erste Hinweise auf Bereiche der Über-, Unter- und Fehlversorgung beider Geschlechter und bieten Ansatzpunkte zur Verbesserung einer männer- und frauengerechten Versorgung. Im Alter zwischen 30 und 65 Jahren ist die Sterblichkeit bei Männern doppelt so hoch wie bei Frauen, was vor allem auf Herzkreislauferkrankungen sowie Unfälle und Suizide zurückzuführen ist. Frauen geben dagegen eine schlechtere körperliche und psychische Befindlichkeit an.
Der Bericht geht auf zahlreiche Aspekte ein, unter anderem:
• Gesundheitliche Lage (Körperliche, psychische und psychosomatische Beschwerden, Krankheitsfolgen, Arbeitsunfähigkeit, Verminderte Erwerbsfähigkeit, Behinderungen und Pflegebedürftigkeit)
• Gesundheitsbeeinflussende Lebensweisen und Lebenslagen (Tabak, Alkohol, Bewegung, Ernährung etc.)
- Bedeutende Gesundheitsprobleme (Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Psychische Erkrankungen, Unfälle, Suizide und Gewalt).
Diskutiert werden aber auch medizinsoziologische Aspekte wie geschlechtsspezifische Erfahrungen mit dem Gesundheitssystem oder Medikalisierungstenzen im Gesundheitssystem am Beispiel der Hormontherapie für Frauen in den Wechseljahren oder des PSA-Tests (zur Früherkennung von Prostatakrebs) bei Männern.
RKI-Gesundheitsbericht (PDF-Datei) "Gesundheit von Frauen und Männern im mittleren Lebensalter"
Gerd Marstedt, 8.2.2006
Suizid ist auch eine Frage der Intelligenz: Weniger Schlaue begehen dreimal so oft Selbstmord
 Selbstmord, so fanden schwedische Wissenschaftler jetzt heraus, findet man deutlich häufiger bei Menschen mit geringem Intelligenzquotienten. Basis der Studie waren 987.308 schwedische Männer, die über einen Zeitraum von 5-26 Jahren beobachtet wurden. Im Beobachtungszeitraum wurden 2.811 Selbstmorde registriert. Die Häufigkeit des Suizids lag dabei in der Gruppe derjenigen mit den niedrigsten Testergebnissen in verschiedenen Intelligenztests dreimal so hoch wie in der Gruppe mit den besten Ergebnissen. Die stärksten Zusammenhänge fand man für den Intelligenzfaktor "logisches Verständnis und allgemeine Intelligenz". Für andere Faktoren (wie räumliches Wahrnehmungsvermögen oder mathematisch-physikalische Fähigkeiten) waren die Effekte schwächer ausgeprägt. Sehr hohe Selbstmord-Risiken fanden die Wissenschaftler D. Gunnell, P.K.E. Magnusson und F.Rasmussen von den Universitäten Bristol und Uppsala bei Teilnehmern mit niedriger Intelligenz, die aber aus einem höher gebildeten Elternhaus abstammen.
Selbstmord, so fanden schwedische Wissenschaftler jetzt heraus, findet man deutlich häufiger bei Menschen mit geringem Intelligenzquotienten. Basis der Studie waren 987.308 schwedische Männer, die über einen Zeitraum von 5-26 Jahren beobachtet wurden. Im Beobachtungszeitraum wurden 2.811 Selbstmorde registriert. Die Häufigkeit des Suizids lag dabei in der Gruppe derjenigen mit den niedrigsten Testergebnissen in verschiedenen Intelligenztests dreimal so hoch wie in der Gruppe mit den besten Ergebnissen. Die stärksten Zusammenhänge fand man für den Intelligenzfaktor "logisches Verständnis und allgemeine Intelligenz". Für andere Faktoren (wie räumliches Wahrnehmungsvermögen oder mathematisch-physikalische Fähigkeiten) waren die Effekte schwächer ausgeprägt. Sehr hohe Selbstmord-Risiken fanden die Wissenschaftler D. Gunnell, P.K.E. Magnusson und F.Rasmussen von den Universitäten Bristol und Uppsala bei Teilnehmern mit niedriger Intelligenz, die aber aus einem höher gebildeten Elternhaus abstammen.
Die Autoren diskutieren verschiedene Erklärungen für ihre Ergebnisse. Zum einen erscheint es ihnen denkbar, dass Menschen mit niedrigerer Intelligenz in Lebenskrisen und scheinbar ausweglosen Situationen weniger in der Lage sind, noch eine Problemlösung zu erkennen, so dass ein Selbstmord für sie als einzig angemessene Lösung naheliegender erscheint. Zum anderen könnten hinter den gefundenen Ergebnissen auch andere Zusammenhänge stehen: Eine schlechte psychosoziale Integration und Identitätsentwicklung in Kindheit und Jugend führt in der Regel auch eher zu schlechten Schulleistungen und zu geringeren intellektuellen Leistungen. Dieser Faktor der mißlungenen sozialen Anpassung, der auch Suizide wahrscheinlicher macht, wäre dann die eigentliche Ursache.
• Hier gibt es die PDF-Datei des Artikels: D Gunnell, P K E Magnusson, F Rasmussen: Low intelligence test scores in 18 year old men and risk of suicide
• Hier ist ein Abstract
Gerd Marstedt, 21.11.2005
Gesundheit und Krankheit bei Migranten
 Der Bericht von Johannes Korporal und Bärbel Dangel "Die Gesundheit von Migrantinnen und Migranten als Voraussetzung für Beschäftigungsfähigkeit im Alter" entstand als Expertise für den 5.Altenbericht der Bundesregierung im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Der Altenbericht selbst wird der Öffentlichkeit erst Anfang 2006 vorgestellt, die dazu erstellten Expertisen stehen jedoch als PDF-Dateien schon jetzt zur Verfügung: Expertisen zum Projekt "Potenziale des Alters in Wirtschaft und Gesellschaft".
Der Bericht von Johannes Korporal und Bärbel Dangel "Die Gesundheit von Migrantinnen und Migranten als Voraussetzung für Beschäftigungsfähigkeit im Alter" entstand als Expertise für den 5.Altenbericht der Bundesregierung im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Der Altenbericht selbst wird der Öffentlichkeit erst Anfang 2006 vorgestellt, die dazu erstellten Expertisen stehen jedoch als PDF-Dateien schon jetzt zur Verfügung: Expertisen zum Projekt "Potenziale des Alters in Wirtschaft und Gesellschaft".
Auf rund 140 Seiten tragen die Autoren Ergebnisse unterschiedlichster Quellen zusammen. Im Zentrum steht dabei die Frage, ob gesundheitliche Indikatoren ausländischer Mitbürger sich von denen der Deutschen unterscheiden. Untersucht wird beispielweise die Sterblichkeit an Unfällen nach der Nationalität, die Morbidität an Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten, Sterblichkeit an Neubildungen und an Krankheiten des Herz-Kreislauf-Systems, Häufigkeit der medizinischen Rehabilitation, Gesundheitsstörungen und Diagnosen, Pflegebedürftigkeit. Ein Ergebnis der Studie zeigt: Das durchschnittlich erreichte Lebensalter der gestorbenen türkischen Arbeitnehmer liegt mit 58,3 Jahren um neun Jahre unter demjenigen der deutschen Arbeitnehmer. Die Autoren stellen hierzu die Frage, ob türkische Mitarbeiter in gleicher Weise und mit vergleichbarem Erfolg Adressaten betrieblicher Prävention und arbeitsplatzbezogener Arbeitssicherheit sind. Der Bericht schließt nach Darstellung der statistischen Daten mit einer Reihe vonb Schlussfolgerungen und Empfehlungen ab.
PDF-Datei des Gutachtens Die Gesundheit von Migrantinnen und Migranten
Gerd Marstedt, 31.8.2005