



Home | Patienten | Gesundheitssystem | International | GKV | Prävention | Epidemiologie | Websites | Meilensteine | Impressum
Sämtliche Rubriken in
"Patienten"
Verhaltenssteuerung (Arzt, Patient), Zuzahlungen, Praxisgebühr |
Klinikführer, Ärztewegweiser |
Alle Artikel aus:
Patienten
Klinikführer, Ärztewegweiser
USA: Öffentliche Berichte über Mortalitätsrisiken in Krankenhäusern wirken sich nicht oder nur mäßig auf Risikoentwicklung aus.
 Öffentliche Berichte über wichtige Maße der Qualität der Krankheitsbehandlung in Krankenhäusern oder Arztpraxen üben durch das Abwandern von Patienten oder auch indirekt so viel Druck auf die Anbieter aus, bei denen das Sterbe- oder Komplikationsrisiko vergleichsweise hoch ist, dass die Risiken deutlich sinken - so weit die Theorie vom Patienten als "König Kunde" und der "Macht von Daten".
Öffentliche Berichte über wichtige Maße der Qualität der Krankheitsbehandlung in Krankenhäusern oder Arztpraxen üben durch das Abwandern von Patienten oder auch indirekt so viel Druck auf die Anbieter aus, bei denen das Sterbe- oder Komplikationsrisiko vergleichsweise hoch ist, dass die Risiken deutlich sinken - so weit die Theorie vom Patienten als "König Kunde" und der "Macht von Daten".
In den USA begann die staatliche Krankenversicherung Medicare im Jahre 2005 mit der Veröffentlichung einer Vielzahl von Qualitätsindikatoren für die meisten Akutkrankenhäuser in den USA. Ob dieses Programm, "Hospital Compare", wirklich den erwarteten Nutzen hatte, war lange unbekannt. Eine Gruppe von Gesundheitswissenschaftlern und Medizinern beendete diesen Zustand und untersuchte mit Routinedaten von Medicare für die Jahre 2000 bis 2008 die Veränderungen der 30-Tagesmortalität für die drei Indikationen Herzinfarkt, Herzinsuffizienz/-versagen und Lungenentzündung.
Der mögliche Vergleich der Sterblichkeitstrends vor und nach der Veröffentlichung der krankenhausspezifischen Sterblichkeitsrisiken erbrachte für diese Indikationen folgende Ergebnisse:
• Die Berichterstattung beeinflusste das Risiko an einem Herzinfarkt oder einer Lungenentzündung innerhalb der 30 Tage nach der Krankenhausentlassung zu sterben nicht zusätzlich zu den unabhängig von der Publikationsintervention oder bereits vor ihr ablaufenden Trends.
• Die Sterblichkeit wegen Herzversagens wurde dagegen durch die Berichterstattung mäßig reduziert.
• Ein Nebenergebnis der Studie zeigt für die untersuchte Zeit und die USA, dass die Veröffentlichung der Qualitätsindikatoren zu keiner erkennbaren Veränderung der Patientenströme führte, also keine nennenswerte Anzahl von PatientInnen durch die "Hospital Compare"-Qualitätsindikatoren ein qualitativ höherwertiges Krankenhaus ausgewählt hat.
Warum dies so war und ist, kann mit den Daten nicht erklärt werden, sollte aber ein Kernanliegen aller Ersteller und Vertreiber solcher Vergleiche sein - egal ob sie Medicare, "Weiße Liste" oder Krankenhaus-Navigator heißen. Den Autoren ist zuzustimmen, dass diese Ergebnisse nicht als Begründung für die Beendigung der Berichterstattung mit Mortalitätsindikatoren dienen sollten. Und sie bedeuten auch nicht, dass es in dem einen oder anderen Fall nicht doch zu den erwarteten Wirkungen kommen wird.
In Deutschland wäre es sogar wünschenswert, dass Mortalitäts-Qualitätsindikatoren endlich für jedes Krankenhaus existierten und veröffentlicht werden. Nur die allein auf solche Indikatoren begründeten gewaltigen Hoffnungen auf spürbare Effekte in den Krankenhäusern und bei den PatientInnen müssen wohl reduziert und über andere Steuerungsmöglichkeiten für beide nachgedacht werden.
Der Aufsatz " Medicare's Public Reporting Initiative On Hospital Quality Had Modest Or No Impact On Mortality From Three Key Conditions" von Andrew M. Ryan, Brahmajee K. Nallamothu und Justin B. Dimick ist in der Märzausgabe 2012 der Public Health-Fachzeitschrift "Health Affairs" (31, no.3 (2012): 585-592) erschienen. Leider ist nur das Abstract kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 21.3.12
"Schwarm-Weisheit" im Gesundheitswesen oder Wie objektiv sind die Bewertungen unabhängig entscheidender Individuen?
 Immer mehr Krankenkassen, Stiftungen und Verbraucherorganisationen richteten in den letzten Jahren Internetplattformen ein oder planen sie für die Zukunft, auf denen PatientInnen ihre Erfahrungen in Arztpraxen oder Krankenhäusern dokumentieren und bewerten konnten. Auch wenn diese öffentlichen Informationsquellen aus verschiedenen Gründen (u.a. nutzen ältere Personen, also der Großteil der PatientInnen, das Internet relativ wenig) noch weniger NutzerInnen haben als ihre Anbieter es sich wünschen, halten PatientInnen diese Art von "subjektiven" Informationen für aussagekräftiger und nützlicher als "objektive" oder "harte" Daten wie z.B. die Rate der standardisierten Sterblichkeit, Komplikations- oder Wiedereinweisungsraten.
Immer mehr Krankenkassen, Stiftungen und Verbraucherorganisationen richteten in den letzten Jahren Internetplattformen ein oder planen sie für die Zukunft, auf denen PatientInnen ihre Erfahrungen in Arztpraxen oder Krankenhäusern dokumentieren und bewerten konnten. Auch wenn diese öffentlichen Informationsquellen aus verschiedenen Gründen (u.a. nutzen ältere Personen, also der Großteil der PatientInnen, das Internet relativ wenig) noch weniger NutzerInnen haben als ihre Anbieter es sich wünschen, halten PatientInnen diese Art von "subjektiven" Informationen für aussagekräftiger und nützlicher als "objektive" oder "harte" Daten wie z.B. die Rate der standardisierten Sterblichkeit, Komplikations- oder Wiedereinweisungsraten.
Dennoch zweifeln nicht nur Leistungsanbieter, die von ihren PatientInnen schlecht bewertet worden sind, daran, ob und wie verlässlich "subjektive" Aussagen über die Qualitäten eines Anbieters gesundheitsbezogener Leistungen sind oder möglicherweise rachsüchtige Fehlbewertungen überwiegen.
Ein gerade abgeschlossener Vergleich der in der Zeit von Januar 2009 bis Dezember 2010 abgegebenen 10.274 "subjektiven" Patienten-Bewertungen der 166 Akutkrankenhäuser des National Health Service (NHS) in England auf der seit 2008 existierenden Website "NHS Choices" mit sieben "objektiven" klinischen Ergebnisqualitätsindikatoren (z.B. neben mehreren Mortalitätsindikatoren die Rate der MRSA- und Clostridium difficile-Infektionen), erlaubt eine bisher einmalige und vorurteilsfreie Antwort. Dies ist u.a. auch dadurch gewährleistet, dass für die 166 Krankenhäuser durchschnittlich 62 (Mittelwert) oder 46 (Median) Ratings vorlagen.
Die wichtigsten Ergebnisse lauten:
• Von den Ex-PatientInnen, die überhaupt eine Empfehlung für oder gegen das Krankenhaus aussprechen (n=9.349), empfehlen 68% das Krankenhaus einem Freund. Solche positiven Empfehlungen waren signifikant mit den in diesen Kliniken erhobenen niedrigeren Sterblichkeitsraten (p=0,01), einer niedrigen Sterblichkeit bei Hochrisikoerkrankungen (p=0,01) und einer niedrigen Wiedereinweisungsrate (p=<0,001) assoziiert bzw. korrelierten stark mit diesen. Keine Assoziationen gab es dagegen zwischen positiven Empfehlungen und zwei weiteren Mortalitätsindikatoren.
• Die Ex-PatientInnen konnten auf der "NHS Choices"-Website auch die Sauberkeit des Krankenhauses bewerten. Auf einer Skala von 1 (dreckig) bis 5 (außerordentlich sauber) wurden Werte zwischen 2,6 und 5 erreicht. Der Durchschnittswert betrug 3,6. Der Vergleich der subjektiven mit objektiven Daten zeigt: Je besser die Sauberkeit von den PatientInnen bewertet wurde desto niedriger war die "objektiv" gemessene MRSA- (p<0,001) oder C. difficile-Rate (p=0,04).
• Wenn die 25% der auf "NHS Choices" am besten von Patienten bewerteten Krankenhäuser mit den 25% am schlechtesten bewerteten Kliniken verglichen werden, waren die Sterblichkeitsraten in ihnen um 5% niedriger und die Wiedereinweisungsraten um 11% niedriger. Die 25% der Kliniken mit dem besten Sauberkeits-Rating hatten sogar eine um 42% niedrigere MRSA-Rate als das Viertel der Kliniken mit den schlechtesten Sauberkeitsbewertungen.
Auch wenn diese Studie nicht alle Pro- und Contra-Argumente zur Bedeutung "subjektiver" Bewertungen der Versorgungsqualität abschließend und eindeutig geklärt hat, erlauben ihre Ergebnisse aus Sicht der StudienautorInnen zwei empirisch gesicherte Schlussfolgerungen: Patientenbewertungen auf einer elektronischen Plattform "may be a more useful tool than previously considered for both patients and health care workers." Und: "If patients are making choices based on this informations, they can be reassured that the ratings are not entirely misleading and may be providing relevant information about health care quality."
Das Etikett "subjektive Daten" ist jedenfalls nach diesen Vergleichen nicht mehr geeignet, Patientenbewertungen von Gesundheitsanbietern zu ignorieren und stattdessen allein auf "objektive" Daten oder Statements von Chefärzten, PR-Agenten und Expertenmeinungen zu setzen.
Der Hinweis der WissenschaftlerInnen, dass solche Ratings im Hotel- und Restaurantgewerbe mittlerweile üblich sind, macht aber auch aus aktuellem Anlass auf ein trotzdem mögliches Desinformations-Risiko dieser Informationsquelle aufmerksam. Der aktuelle Anlass sind die bekanntgewordenen Manipulationsversuche der Touristik-Rating-Website Tripadvisor durch in der Touristikbranche Beschäftigte. Die Qualität und Nützlichkeit gesundheitsbezogener PatientInnen-Ratings hängt daher auch entscheidend von nachweisbaren Vorsorgemaßnahmen gegen Manipulationsversuche durch Anbieter oder andere Akteure ab. Dass so etwas auch im Gesundheitsbereich vorkommt, zeigen z.B. die bekanntgewordenen Fälle der Gründung und des Sponsorings von Selbsthilfeorganisationen durch Pharmafirmen.
Der diese Forschungsergebnisse veröffentlichende "Research Letter" "Associations between web-based patient ratings and objective measures of hospital quality" von Felix Greaves et al. ist am 13. Februar 2012 in der Onlineausgabe der Fachzeitschrift "Archives of internal medicine" erschienen und leider bis auf einige Zeilen nicht kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 18.2.12
Wie sieht die "digitale Spaltung" Deutschlands im Jahr 2011 aus? Nachdenkliches zum Setzen auf wirksame Internet-Gesundheitsinfos
 Angesichts der schier ungebremsten Zunahme von gesundheitsbezogenen Informationsangeboten im Internet, ob Qualitätsberichte der Krankenhäuser, Krankenhaus- oder Arztnavigatoren und Listen, bleiben auch die kritischen Hinweise auf ihre möglicherweise eingeschränkte Bedarfsgerechtigkeit oder Reichweite aktuell.
Angesichts der schier ungebremsten Zunahme von gesundheitsbezogenen Informationsangeboten im Internet, ob Qualitätsberichte der Krankenhäuser, Krankenhaus- oder Arztnavigatoren und Listen, bleiben auch die kritischen Hinweise auf ihre möglicherweise eingeschränkte Bedarfsgerechtigkeit oder Reichweite aktuell.
So verwies ein Forums-Beitrag im Jahre 2007 auf folgende empirisch belegbaren Probleme: "Ein Einwand gegen eine zu starke Konzentration der Informationsbemühungen auf derartige Angebote war schon lange der, dass möglicherweise die Bevölkerungsgruppen mit dem höchsten praktischen Bedarf an Informationen, d.h. Kranke, Ältere und Angehörige unterer sozialer Schichten, zu den Nicht- oder Geringnutzern des Internet gehören oder auch nur mit Schwierigkeiten etwas mit der speziellen Art der Informationsvermittlung dieses Medium anfangen können."
Die Ergebnisse des "(N)onliner Atlas 2010" ließen eine praktische Warnung vor der tatsächlichen Wirkkraft von Internet-Angeboten realistisch erscheinen: "Wer glaubt, eine relevante Anzahl von überwiegend älteren NutzerInnen von gesundheitsbezogenen Versorgungsangeboten … allein über dieses Medium (Internet) ausreichend informieren zu können, irrt sich grundsätzlich."
Die 72 Seiten des gerade erschienenen 2011er-Bandes des sich als "Topographie des digitalen Grabens durch Deutschland" bezeichnenden Atlanten, begründet keine grundsätzliche Abkehr von den bisherigen Bewertungen.
Auch wenn jetzt 74,7% aller Deutschen über 14 Jahren online sind, war dies gerade noch ein Zuwachs von 2,7% gegenüber 2010 und in Prozentpunkten ein geringerer Zuwachs als in allen Jahren seit 2001. Knapp 18 Millionen BürgerInnen benutzen egal für welche Fragen und Interessen weiterhin kein Internet.
Eine Reihe nach Alter, Geschlecht, Bildungsabschluss und Einkommen differenzierte Angaben, belegen trotz gradueller Zunahme der Nutzungsverhältnisse die prinzipielle Ungleichverteilung zu Ungunsten der Menschen mit überdurchschnittlichem Bedarf an Gesundheitsonformationen und -leistungen:
• Auch im Frühjahr 2011 gehen nur 52,5% der über 50-Jährigen ins Internet. Umgekehrt gehören abetrotz überdurchschnittlichen Zuwachsraten 37% der 60-69-Jährigen und 71,8% der über 70-Jährigen zu den Offlinern.
• Während 90,2 % aller Abiturienten und Studenten das Internet nutzen, surfen von den Volks- und Hauptschülern gerade mal 60,5% - immerhin 3,9% mehr als 2010.
• 80,7% der Männer aber lediglich 68,9% der Frauen - häufig die Gesundheitsexperten in Familien - gegen überhaupt ins Internet.
• Den 53% aller Haushalte mit einem Nettoeinkommen von unter 1.000 Euro, die überhaupt einen Internetzugang haben, stehen 92,3% unter den Personen mit mehr als 3.000 Euro gegenüber.
• Die regionale Ungleichheit wird nach unten durch Sachsen-Anhalt mit insgesamt 64,2% und nach oben Bremen mit einem Onlineranteil von 80,2% markiert.
Der materialreiche (N)onliner Atlas 2010 ist als PDF-Datei kostenlos erhältlich. Wann sich Krankenkassen, Verbände oder Patientenorganisationen keine Gedanken mehr über andere Disseminationsformen für ihre Informationen machen müssen, wird frühestens der nächste Atlas zeigen.
Bernard Braun, 11.7.11
Befragungen von und Informationsangebote für Krankenversicherte im Internet? Zahlreiche Nachteile für ältere Versicherte!
 Immer mehr setzen gesetzliche Krankenkassen bei Erhebungen über die gesundheitlichen Bedürfnisse und Bedarfe ihrer Versicherten, deren Gesundheitskompetenzen oder auch bei der Unterstützung ihrer Versicherten bei der Auswahl von Leistungsanbietern auf Onlinemethoden oder internetbasierte Informationsquellen.
Immer mehr setzen gesetzliche Krankenkassen bei Erhebungen über die gesundheitlichen Bedürfnisse und Bedarfe ihrer Versicherten, deren Gesundheitskompetenzen oder auch bei der Unterstützung ihrer Versicherten bei der Auswahl von Leistungsanbietern auf Onlinemethoden oder internetbasierte Informationsquellen.
Gegen skeptische Hinweise, im Internet erreiche man nur eine einseitige Auswahl eher jüngerer Versicherten und kaum ältere Versicherte, also Versicherte mit dem relativ stärksten Bedarf an und Inanspruchnahme von gesundheitlichen Versorgungsangebote und damit auch dem größten Informations- oder Orientierungsbedarf, wird häufig eingewandt, diese Unterschiede verschwänden aktuell rasch und umfassend.
Mehrere große empirische Untersuchungen der generellen Nutzung der EDV und des Internets sowie der speziellen Nutzung bei der Suche nach einem geeigneten Krankenhaus zeigen aber dagegen eine auch aktuell extrem ungleiche Nutzung dieser Informationshilfsmittel und -foren.
In einer im November 2009 im Auftrag des BKK-Bundesverbandes durchgeführten, für die deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahren repräsentativen telefonischen Befragung von 6.016 Personen, wurden diese nach der Nutzung von Krankenhaussuchmaschinen im Internet befragt.
Die Ergebnisse sahen folgendermaßen aus:
• 8 % gaben an, eine oder mehrere solcher Suchmaschinen schon einmal genutzt zu haben. 63 % verneinten dies und 28 % antworteten, sie nutzten das Internet nicht oder hätten keinen Internetanschluss.
• Unter den Haupt-Inanspruchnehmern von stationärer Versorgung, den 60 Jahre und ääteren BürgerInnen, hatten noch 7 % eine Krankenhaussuchmaschine genutzt, 31 % verneinten dies und 62 % nutzten das Internet nicht bzw. hatten gar keinen Internetanschluss.
Betrachtet man nur die Suchmaschinennutzung derjenigen Personen, die nicht angaben, das Internet generell nicht zu nutzen bzw. nutzen zu können, verändert sich an den relativ geringen Nutzerzahlen nur graduell etwas:
• Insgesamt nutzten diese Informationsmöglichkeit dann 11 %. Unter den Personen mit einem Krankenhaus-Aufenthalt in den letzten 3 Jahren waren es 16 %.
• Der Nutzeranteil bei allen Befragten mit der technischen Möglichkeit des Zugangs stieg nach Altersgruppen von 7 % bei den 14-29-Jährigen auf 18 % unter den 60+-Befragten. Selbst unter den Personen mit einem Aufenthalt bewegte sich der Nutzeranteil in den beiden Altersgruppen zwischen 11 % und 23 %.
Damit bestätigt sich etwas, was Anfang 2010 erstmals in der von TNS Infratest im Auftrag der IT-Initiative D21 durchgeführten Studie "Digitale Gesellschaft in Deutschland - Sechs Nutzertypen im Vergleich" durch die Befragung einer repräsentativen Gruppe von 1.014 Personen allgemein schlüssig belegt wurde. Eine Typologie der NutzerInnen moderner Informations- und Kommunikationstechniken zeigt nämlich auf, dass mit 35 % digitalen Außenseitern und 30 % Gelegenheitsnutzern eine deutliche Mehrheit der deutschen Bevölkerung entweder gar nicht oder nur bedingt an einer digitalen Gesellschaft teilhat.
"Wir sprechen bereits seit geraumer Zeit von einer digitalen Gesellschaft, sehen aber anhand der jetzt vorliegenden Ergebnisse recht deutlich, dass in Deutschland ein Großteil noch nicht darin angekommen ist. Diese Teilung der Gesellschaft in Teilnehmer und Nichtteilnehmer an den neuen Informations- und Kommunikationstechniken und ihren Möglichkeiten ist angesichts des einhergehenden Strukturwandels für eine Wissensgesellschaft das zentrale Zukunftsproblem", so der Repräsentant des Auftraggebers.
Die wesentlichen NutzerInnentypen sind:
• Die digitalen Außenseiter sind mit 35 % Anteil an der Gesamtbevölkerung "die größte und gleichzeitig mit einem Durchschnittsalter von 62,4 Jahren die älteste Gruppe. Im Vergleich zu den anderen Typen haben sie das geringste digitale Potenzial, die geringste Computer- und Internetnutzung sowie die negativste Einstellung gegenüber digitalen Themen. Nur ein Viertel verfügt bei der digitalen Infrastruktur über eine Basisausstattung (Computer und Drucker). Kompetenzen im Umgang mit den digitalen Medien sind folglich kaum vorhanden. Selbst Begriffe wie E-Mail, Betriebssystem oder Homepage sind den digitalen Außenseitern weitgehend unbekannt und nur ein Fünftel der digitalen Außenseiter ist in der Lage, sich im Internet zu Recht zu finden."
• Die 30 % Gelegenheitsnutzer sind durchschnittlich 41,9 Jahre alt. Sie nehmen im Vergleich zu den digitalen Außenseitern zumindest teilweise am Geschehen in der digitalen Gesellschaft teil. 98 Prozent besitzen einen PC oder ein Notebook, drei Viertel bereits eine Digitalkamera. Passend dazu verbringen nahezu alle Gelegenheitsnutzer Zeit mit Computer und Internet - vor allem für private Zwecke. Der Gelegenheitsnutzer kennt bereits viele Basisbegriffe der digitalen Welt, hat aber besonders beim Thema Sicherheit großen Nachholbedarf. Insgesamt erkennt dieser Typ klar die Vorteile des Internets, fördert aber nicht seine Weiterentwicklung und bevorzugt eher klassische Medien.
• Nach der 9 % großen Gruppe der Berufsnutzer und den 11 % Trendnutzern gehören aktuell noch 12 % der Bevölkerung zu den digitalen Profis. Der durchschnittliche digitale Profi ist 36,1 Jahre alt, meist männlich und berufstätig. Dieser Typus verfügt sowohl Zuhause als auch im Büro über eine sehr gute digitale Infrastruktur. Seine Kompetenzen sind umfangreich, was sich insbesondere in ihren professionellen Fähigkeiten widerspiegelt. Ob Makroprogrammierung oder Tabellenkalkulation, der digitale Profi fühlt sich auch auf diesem komplexen Terrain zuhause. Eher selten suchen die digitalen Profis im Vergleich zu den Trendnutzern und der digitalen Avantgarde Zerstreuung in der digitalen Welt oder nutzen diese zur Selbstdarstellung. Bei der Nutzungsvielfalt stehen daher nützliche Anwendungen, wie z.B. Online Shopping, Preisrecherche und Nachrichten lesen, im Vordergrund.
• Die mit 3 % kleinste und jüngste (Durchschnittsalter 30,5 Jahre) Gruppe ist die digitale Avantgarde. Die digitale Avantgarde hat dabei ein eher geringes Einkommen und lebt oft in einem Singlehaushalt. Ihre digitale Infrastruktur lässt kaum Wünsche offen. Auffällig hoch sind dabei die mobile und geschäftliche Internetnutzung. In allen Bereichen verfügt die digitale Avantgarde über sehr hohe Kompetenzen und bildet bei den komplexen digitalen Themen die Spitze der Gesellschaft. Ihr Wissensstand um die digitale Welt ist dagegen nicht ganz so ausgeprägt wie bei den digitalen Profis. Mehr durch "trial and error" statt das Lesen von Anleitungen eignet sich der digitale Avantgarde seine Kompetenzen an. Von den digitalen Medien lässt diese Gruppe kaum ab: Durchschnittlich elf Stunden verbringen sie täglich vor dem Computer. Neben der Arbeit ist daher auch das Freizeitverhalten oft von den digitalen Medien bestimmt.
Wer glaubt, eine relevante Anzahl von überwiegend älteren NutzerInnen von gesundheitsbezogenen Versorgungsangeboten via Internet mit der Erwartung repräsentativer Ergebnisse befragen oder allein über dieses Medium ausreichend informieren zu können, irrt sich grundsätzlich. Die dafür verwendete Zeit und das hier investierte Geld sind verschwendet und stehen den viel häufiger genutzten und wirksameren, aber wahrscvheinlich etwas aufwändigeren Informations- und Beratungsinstrumenten nicht mehr zur Verfügung.
Eine Zusammenfassung der BKK-Bevölkerungsumfrage "Krankenhaus" erhält man kostenlos.
Die Studie "Digitale Gesellschaft in Deutschland - Sechs Nutzertypen im Vergleich" steht zum kostenfreien Herunterladen zur Verfügung.
Bernard Braun, 31.5.10
Kanada: Fast keine Auswirkungen veröffentlichter Performance-"Report cards" auf die Versorgungsqualität in Krankenhäusern
 Aussagefähige Indikatoren für die Versorgungsqualität, vergleichbar und in verständlicher Form veröffentlicht, fördern den Wettbewerb zwischen Gesundheitseinrichtungen um die beste Performance und damit die Versorgungsqualität - so weit das Mantra entsprechender Berichtswesen und -formen.
Aussagefähige Indikatoren für die Versorgungsqualität, vergleichbar und in verständlicher Form veröffentlicht, fördern den Wettbewerb zwischen Gesundheitseinrichtungen um die beste Performance und damit die Versorgungsqualität - so weit das Mantra entsprechender Berichtswesen und -formen.
Auch von dem in Nordamerika weit verbreiteten System der "public report cards" über die Leistungsqualität in Krankenhäusern wurde dies behauptet, angenommen und in einigen unkontrollierten Beobachtungsstudien auch belegt.
Die jetzt in der US-Fachzeitschrift "JAMA" veröffentlichten Ergebnisse der bevölkerungsbezogenen clusterrandomisierten und kontrollierten Studie EFFECT (Enhanced Feedback for Effective Cardiac Treatment) an 86 Krankenhäusern und Krankenhausketten im kanadischen Ontario kommt aber für den Bereich der Versorgung von PatientInnen mit akutem Herzinfarkt (5.676=Baseline/4.165=Follow up in Interventions- und 5.070/3.581 in Krankenhäusern, die zur Kontrollgruppe gehörten) oder chronischer Herzinsuffizienz (5.073/4.316 und 4.220/3.935 zu einem deutlich anderen Ergebnis: Die frühe Veröffentlichung der Qualitätsindikatoren einer Baseline-Untersuchung der Qualität bei einer Gruppe von Krankenhäusern hat gegenüber einer für eine zweite Krankenhausgruppe um 1 ½ Jahre späteren Veröffentlichung weder signifikant zur Verbesserung der mit 12 Indikatoren gemessenen Versorgungsqualität beim Herzinfarkt noch der mit 6 Indikatoren abgebildete Versorgungsqualität von Patienten mit chronischer Herzinsuffizienz beigetragen.
So verbesserten sich die insgesamt betrachteten Werte aller 12 Qualitätsindikatoren für die Behandlung des Herzinfarkts in der frühen Gruppe von 57,4% zum Zeitpunkt der Baselinemessung (1999) auf 65,6% zum Zeitpunkt des Follow-up im Jahr 2005, also um absolut 8,2 Prozentpunkte. Ähnliches tat sich aber in der Kontrollgruppe: Der Wert der Qualitätsindikatoren verbesserte sich von 56,5% auf 63,6%, d.h. um 7,1 Prozentpunkte. Die absolute Differenz der beiden Krankenhausgruppen betrug zwischen beiden Krankenhaustypen betrug 1,5%, war aber mit p=0.43 sehr weit von einem akzeptablen Signifikanzwert entfernt. Nur bei einem der 12 individuellen Qualitätsindikatoren gab es einen statistisch signifikanten Unterschied zugunsten der Krankenhäuser mit früh einsetzender Qualitätsberichterstattung. Bei der Qualität der Versorgung von an chronischer Herzinsuffizienz erkrankten Menschen waren die absoluten Unterschiede in den Veränderungsraten aller der 6 Indikatorenwerte mit 0,6% (p=0.81) noch geringer und zufälliger. Detailliert betrachtet verbesserte sich einer der 6 Indikatoren statistisch signifikant.
Beim Vergleich harter Werte für die Ergebnisqualität (z.B. 30-Tage-Sterblichkeit nach akutem Herzinfarkt oder 1-Jahres-Sterblichkeit bei chronischer Herzinsuffizienz) gab es in der Gruppe, deren Qualitätswerte früh veröffentlicht wurde, fast durchweg bessere Ergebnisse. Nur bei den Werten für die 1-Jahressterblichkeit für die Herzinsuffizienz war aber die absolute Veränderung in der Interventionsgruppe signifikant besser geworden (p=0.007) als in der Kontrollgruppe, in der sich dieser Wert sogar verschlechterte.
Obwohl die ForscherInnen selber keine Erklärung für den fehlenden Beitrag öffentlicher Qualitätsberichterstattung mit "report cards" liefern, lassen sich mehrere Schlüsse ziehen, die zum Teil auch erklärenden Charakter haben: Veränderungen in solch komplexen sozialen Systemen wie einem Krankenhaus sind meist nicht Folge eines einzelnen Faktors oder einer noch so gut gemachten und qualitativ aussagefähigen Transparenz, sondern die einer Vielzahl von kognitiven Einwirkungen und sozialen Aushandlungs- und Entscheidungsprozessen.
Der 9-seitige Aufsatz "Effectiveness of Public Report Cards for Improving the Quality of Cardiac Care. The EFFECT Study: A Randomized Trial" von Jack Tu; Linda Donovan; Douglas Lee; Julie Wang; Peter C. Austin; David A. Alter; Dennis Ko erschien in der Zeitschrift JAMA. (published online Nov 18, 2009; (doi:10.1001/jama.2009.1731)) und ist komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 18.11.09
"Privat" und "groß" gleich gut; "öffentlich" und "klein" gleich schlecht oder wie sieht die Klinik-Versorgungsqualität aus?
 Gibt es auch in Deutschland "gute" und "schlechte" Krankenhäuser, wie sehen diese Unterschiede aus und wie kann man sie erfahren? Für diese im Gegensatz z.B. zu den USA (vgl. dazu den Überblick über die in den USA regelmäßig veröffentlichten Krankenhausvergleiche) überhaupt erst seit kurzer Zeit stellbaren Fragen liegen mittlerweile genügend Antworten vor, welche die Notwendigkeit und den Nutzen einer regelmäßigen Berichterstattung belegen.
Gibt es auch in Deutschland "gute" und "schlechte" Krankenhäuser, wie sehen diese Unterschiede aus und wie kann man sie erfahren? Für diese im Gegensatz z.B. zu den USA (vgl. dazu den Überblick über die in den USA regelmäßig veröffentlichten Krankenhausvergleiche) überhaupt erst seit kurzer Zeit stellbaren Fragen liegen mittlerweile genügend Antworten vor, welche die Notwendigkeit und den Nutzen einer regelmäßigen Berichterstattung belegen.
Dazu gehört auch die im Rahmen eines größeren Forschungsprojekts konzipierte und durchgeführte, im September 2009 als Arbeitspapier Nr. 86 des Instituts für Genossenschaftswesen der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster veröffentlichte Auswertung der Daten zur externen vergleichenden Qualitätssicherung.
Seit dem Jahr 2001 veröffentlicht die Bundesgeschäftsstelle für Qualitätssicherung gGmbH (kurz: BQS) Qualitätsdaten deutscher Krankenhäuser. Diese ermöglichen es im Prinzip jedem Krankenhaus sich im Bereich der erfassten medizinischen und pflegerischen Qualitätsindikatoren mit allen in Deutschland zugelassenen Krankenhäusern3 zu vergleichen. Damit erhalten aber auch Patienten, niedergelassene Ärzte etc. einen Überblick über die erbrachte Qualität der Krankenhäuser.
Diese Vergleichsmöglichkeit wurde bisher auch, ob in den seit einiger Zeit auch gesetzlich vorgeschriebenen Qualitätsberichten oder in anderen Auswertungen, genutzt. In den Qualitätsberichten sollen die Krankenhäuser laut § 137 Abs. 3 lit. 4 SGB V "Inhalt, Umfang und Datenformat eines im Abstand von zwei Jahren zu veröffentlichenden strukturierten Qualitätsberichts der zugelassenen Krankenhäuser" darstellen. "Der Bericht hat auch Art und Anzahl der Leistungen des Krankenhauses auszuweisen und ist in einem für die Abbildung aller Kriterien geeigneten standardisierten Datensatzformat zu erstellen."
Die Vergleiche bestanden bisher aber durchweg darin, dass sich einzelne Häuser mit allen anderen Krankenhäusern verglichen. Vergleiche zwischen homogenen Teilgruppen, also etwa zwischen ost- und süddeutschen, großen und kleinen oder privaten und öffentlichen Kliniken existierten nicht, obwohl solche Vergleiche z.B. für eine anspruchsvolle regionale Krankenhausplanung wichtig wären.
Den möglichen Nutzen derartiger Vergleiche und ihre Machbarkeit versuchte nun die Münsteraner Studie mit Daten des Jahres 2006 zu demonstrieren. Aus den 24 Leistungsbereichen der BQS-Qualitätsmessung mit ihren 180 Qualitätsindikatoren und 282 Qualitätskennzahlen wurden diejenigen Leistungsbereiche ausgewählt, welche nach Einschätzung von Medizinern, Pflegenden und Patientenvertretern für die Patienten und einweisenden Ärzte die geeignetsten Informationen über die jeweilige Qualität des Krankenhauses liefern.
Zu den wichtigsten Qualitätsunterschiede zwischen den unterschiedlich aggregierten oder geclusterten Krankenhäusern zählten:
• "Krankenhäuser in privater Trägerschaft belegten fünfundzwanzigmal den ersten Platz, viermal den zweiten und einmal den dritten Platz. Krankenhäuser in öffentlicher Trägerstruktur belegten den ersten Platz zweimal und Rang zwei und drei jeweils vierzehnmal. Freigemeinnützige Krankenhäuser belegten achtmal Rang eins, neunmal
Rang zwei und dreizehnmal Rang drei." Dabei gab es indikatorenspezisch teilweise enorme Unterschiede: "Die größte Amplitude von 21,44% Punkten innerhalb eines Qualitätsindikators kann bei der internen Nummer 14 "Komplikation: Verrutschen der Vorhofsonden" im Leistungsbereich Herzschrittmacher Implantation abgelesen werden. Bei diesem Indikator erreichen private Träger einen Prozentsatz von 61,11% gegenüber Krankenhäusern in freigemeinnütziger Trägerschaft die nur 39,67% erzielen. Dies kann wie folgt interpretiert werden: in sechs von zehn Krankenhäusern in privater Trägerschaft wird gute Qualität geleistet und in nur vier von zehn Krankenhäusern in freigemeinnütziger Trägerschaft wird gute Qualität erbracht. Auch Krankenhäuser in öffentlicher Trägerschaft erreichen nur einen Anteil von 42,66%."
Wichtig ist, dass es keineswegs immer derselbe Trägertyp ist, der qualitativ hochwertige Leistungen erbringt, sondern dass dies je nach Leistung variiert.
• Bei dem Merkmal der Größe eines Krankenhauses gibt es die Tendenz, dass größere Krankenhäuser bei vielen Qualitätsindikatoren häufiger eine gute Qualität leisten als kleinere Krankenhäuser.
• Im Vergleich der "alten" Bundesländer mit den "neuen" Bundesländern ist erkennbar, dass die neuen Bundesländer (inkl. Berlin) häufiger gute Qualität erbringen als die "alten" Bundesländer. Dabei ist aber bemerkenswert, dass bei rund der Hälfte der Qualitätsindikatoren kein Einfluss der geografischen Lage der Krankenhäuser nachgewiesen werden konnte. Bei den übrigen Indikatoren konnte dagegen statistisch signifikante Unterschiede festgestellt werden.
• Zu den inhaltlich am wenigsten erwarteten Ergebnisse der regionalen Analyse gehört ein Nord-Süd-Qualitätsgefälle und zwar wider Erwarten ein Gefälle vom qualitativ guten zum nicht guten Süden der Republik. Auch hier zeigt sich aber bei zwölf Indikatoren eine Beeinflussung zwischen den Merkmalen "Qualität" und "geografische Position" bei achtzehn der untersuchten Indikatoren dagegen keine signifikanten Unterschiede.
Auch wenn die Autoren wichtige Belege für den Nutzen derartiger Analysen und Hinweise für die Versorgungsforschung und -planung liefern, werden sie nicht darum herum kommen, weitere möglicherweise erklärungskräftige Merkmale in ihre Analysen aufzunehmen. Eine weitere Beschränkung ihrer bisherigen Analysen liegt schließlich in der im Vergleich zum gesamten stationären Versorgungsgeschehen begrenzten Anzahl der von der BQS dokumentierten Qualitätsindikatoren.
Die 50 Seiten umfassende Studie "Qualitätsvergleich deutscher Krankenhäuser. Eine Studie anhand der Daten zur externen vergleichenden Qualitätssicherung" von Christoph Heller ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 4.11.09
Die "Weisse Liste" veröffentlicht neue Qualitäts-Daten der deutschen Krankenhäuser
 Die "Weisse Liste", ein nicht-kommerzielles Internetportal, hat jetzt neue Informationen zum Leistungsangebot und zur Behandlungsqualität von etwa 2.000 Krankenhäusern in Deutschland veröffentlicht. Das Portal wird von der Bertelsmann Stiftung und den Dachverbänden der größten Patienten- und Verbraucherorganisationen herausgegeben: Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe, Deutsche Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen, Forum chronisch kranker und behinderter Menschen im Paritätischen Gesamtverband, Sozialverband Deutschland (SoVD), Sozialverband VdK Deutschland, Verbraucherzentrale Bundesverband. Die Website greift auf neu erschienene Qualitätsberichte der Kliniken für das Jahr 2008 zurück.
Die "Weisse Liste", ein nicht-kommerzielles Internetportal, hat jetzt neue Informationen zum Leistungsangebot und zur Behandlungsqualität von etwa 2.000 Krankenhäusern in Deutschland veröffentlicht. Das Portal wird von der Bertelsmann Stiftung und den Dachverbänden der größten Patienten- und Verbraucherorganisationen herausgegeben: Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe, Deutsche Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen, Forum chronisch kranker und behinderter Menschen im Paritätischen Gesamtverband, Sozialverband Deutschland (SoVD), Sozialverband VdK Deutschland, Verbraucherzentrale Bundesverband. Die Website greift auf neu erschienene Qualitätsberichte der Kliniken für das Jahr 2008 zurück.
Um Patienten und Angehörige bei der Suche nach dem für sie passenden Krankenhaus zu unterstützen, werden die Berichte in der Weissen Liste für Patienten verständlich und nutzerfreundlich aufbereitet. Zudem bietet das Portal ab heute verschiedene neue Funktionen und Services, darunter eine individuell erstellbare PDF-Broschüre, die auf den jeweiligen Nutzer persönlich zugeschnitten ist und alle wichtigen Informationen seiner Krankenhaussuche zusammenfasst. Die Broschüre lässt sich mit einem Klick erstellen, nachdem die Suche abgeschlossen ist.
Weiterhin neu ist die neue Funktion der "Markierhilfe". Diese erleichtert das Markieren von Krankenhäusern. So kann man zum Beispiel angeben, dass alle Kliniken markiert werden, die eine bestimmte Fachabteilung anbieten. Oder man lässt alle Krankenhäuser markieren, die eine bestimmte Anzahl von Patienten mit einer Erkrankung behandelt haben.
Patienten können sich in der Weissen Liste über die Qualifikation der Krankenhausärzte, die vorhandenen medizinischen Geräte oder die Erfahrung der Kliniken mit speziellen Behandlungen informieren. Zudem fließen Informationen zur Zufriedenheit ehemaliger Patienten in das Portal ein. Alle Kliniken können an einer standardisierten Patientenbefragung teilnehmen. Ein integrierter Diagnosen-Dolmetscher, rund 4.000 allgemeinverständlich übersetzte Fachbegriffe und ein spezieller, interaktiver Suchassistent machen es möglich, dass die Nutzer auch ohne Fachkenntnisse suchen und Krankenhäuser direkt miteinander vergleichen können.
Übergeordnetes Ziel des Portals ist es, das Gesundheitssystem transparenter und verständlicher zu machen. Die Krankenhaussuche ist der erste Schritt, Informationen über weitere Gesundheitsanbieter sollen folgen. Das Portal ist seit Juni vergangenen Jahres online zugänglich. Alle gesetzlichen Krankenkassen haben die Möglichkeit, die Krankenhaussuche in ihren Internetauftritt einzubinden. Neben der Barmer, der Siemens-Betriebskrankenkasse (SBK) und der KKH-Allianz veröffentlichen neuerdings auch die AOK die Weisse Liste in ihrem Internetangebot. Die Kassen informieren insgesamt rund 34 Millionen Versicherte mithilfe des Portals.
Die Weisse Liste
Gerd Marstedt, 30.9.09
Was taugen Selbsteinstufungen von Krankenhäusern über die Patientensicherheit in ihren Häusern? Nichts.
 Die Leapfrog Gruppe ist eins von vielen US-Unternehmen, das für Patienten Informationen und Ranglisten über Krankenhäuser anbietet. Die große Vielfalt der US-Klinikführer bewirkt nicht selten, dass die Informationen unübersichtlich sind und teilweise sogar einander widersprechen (vgl. Kritik an Klinikführern in den USA: Völlig abweichende Bewertungen für ein und dasselbe Krankenhaus). Auf ein weiteres Problem der Klinikführer hat jetzt eine Studie aufmerksam gemacht, die in der Zeitschrift JAMA (Journal of the American Medical Association) veröffentlicht wurde: Die Unzuverlässigkeit von Informationen, die von den Kliniken selbst geliefert werden.
Die Leapfrog Gruppe ist eins von vielen US-Unternehmen, das für Patienten Informationen und Ranglisten über Krankenhäuser anbietet. Die große Vielfalt der US-Klinikführer bewirkt nicht selten, dass die Informationen unübersichtlich sind und teilweise sogar einander widersprechen (vgl. Kritik an Klinikführern in den USA: Völlig abweichende Bewertungen für ein und dasselbe Krankenhaus). Auf ein weiteres Problem der Klinikführer hat jetzt eine Studie aufmerksam gemacht, die in der Zeitschrift JAMA (Journal of the American Medical Association) veröffentlicht wurde: Die Unzuverlässigkeit von Informationen, die von den Kliniken selbst geliefert werden.
In Klinikführern der Leapfrog-Gruppe werden derzeit Angaben zur Patientensicherheit gemacht, die auf Indikatoren beruhen, die von den Kliniken selbst berichtet werden. Dabei handelt es sich um etwa ein Dutzend Indikatoren zur Struktur- und Prozess-Qualität in den Häusern, die bestimmte Routinen und Maßnahmen betreffen etwa zur Arzneimittelvergabe, zur Vorgehensweise bei Infektionen usw. Aufgrund dieser Angaben erhalten Krankenhäuser in der Kategorie "Patientensicherheit" eine bestimmte Punktzahl und werden danach einer von 4 Gruppen zugeordnet, Kliniken mit sehr hohen, eher hohen, eher niedrigen, sehr niedrigen Punktwerten. Es gibt auch noch andere Verfahren zur Bewertung der Patientensicherheit, aber die Klinik-Selbstangaben werden häufig verwendet, insgesamt etwa 1100 Kliniken sind auf diese Weise bewertet.
Eine kalifornische Forschungsgruppe hat nun untersucht, wie zuverlässig diese Klassifizierungen sind. Dazu wurden alle Kliniken ausgewählt, für die in den verschiedenen US-Bundesstaaten objektive Daten zur Mortalität (während des Klinik-Aufenthalts) vorlagen. Für die Analysen kamen so Daten aus dem Jahr 2005 von insgesamt 155 Kliniken und knapp 1,7 Millionen Patienten zusammen. Dabei wurden etwa 37 Tausend Todesfälle beobachtet.
Die Wissenschaftler stuften die erfassten 155 Kliniken dann hinsichtlich ihrer Patientensicherheit in vier Gruppen ein - entsprechend der Leapfrog-Klassifizierung und überprüften dann, ob sich die Mortalitäts-Raten in den vier Gruppen unterschied. Festgestellt wurden dann folgende risiko-adjustierten Quoten, also unter Berücksichtigung von Art und Schweregrad der Erkrankung, Risiko des Eingriffs etc.:
• Gruppe 1 (sehr hohe Patientensicherheit) Mortalität 1,97%
• Gruppe 2: 2,04%
• Gruppe 3: 1,96%
• Gruppe 4 (sehr niedrige Patientensicherheit): 2,00%
Das heißt: Es gab keinerlei statistisch signifikante Unterschiede zwischen den Klinik-Gruppen hinsichtlich der Mortalitätsquote. Die von Leapfrog gebotenen Informationen zur Patientensicherheit sind also völlig wertlos. Die Wissenschaftler diskutieren dann, dass die Mortalitätsrate während des Klinik-Aufenthalts nicht der einzige Indikator ist, um "Patientensicherheit" zu messen, auch Infektionsraten oder Komplikationen sind zweifellos Hinweise. Nicht zu Unrecht argumentieren sie allerdings, dass Aussagen darüber, wie oft in einer Klinik der Tod auf dem OP-Tisch zu verzeichnen ist, nach wie vor der für Patienten relevanteste Indikator ist. Die Wissenschaftler diskutieren auch, was ursächlich sein könnte für ihre Ergebnisse. Eine Möglichkeit wäre naheliegend: Kliniken teilen zwar mit, dass bestimmte Sicherheitsvorschriften oder Routinen eingeführt worden sind, nicht aber, ob diese auch in der Alltagspraxis auch immer eingehalten werden.
Studie im Volltext (kostenlos): Leslie P. Kernisan et al: Association Between Hospital-Reported Leapfrog Safe Practices Scores and Inpatient Mortality (JAMA. 2009;301(13):1341-1348)
Gerd Marstedt, 1.4.09
Qualitätsberichte deutscher Kliniken: Verständlich nur mit Abitur
 Böse Zungen könnten behaupten, dass Krankenhäuser in Deutschland nun eine Retourkutsche fahren gegen die ihnen gesetzlich auferlegte, bisweilen als lästig empfunde Pflicht, im Abstand von zwei Jahren Qualitätsberichte zu veröffentlichen: Indem sie die Berichte sprachlich so grausam gestalten, dass niemand sie lesen mag. Doch dass wäre natürlich üble Nachrede.
Böse Zungen könnten behaupten, dass Krankenhäuser in Deutschland nun eine Retourkutsche fahren gegen die ihnen gesetzlich auferlegte, bisweilen als lästig empfunde Pflicht, im Abstand von zwei Jahren Qualitätsberichte zu veröffentlichen: Indem sie die Berichte sprachlich so grausam gestalten, dass niemand sie lesen mag. Doch dass wäre natürlich üble Nachrede.
Allerdings kommt jetzt erneut eine Studie zu einem sehr harschen Urteil über die Qualitätsberichte. Die Untersuchung "Zur Verständlichkeit der Qualitätsberichte deutscher Krankenhäuser: Systematische Auswertung und Handlungsbedarf " kommt zu dem Fazit: "Um die Texte zu verstehen, bedarf es (...) mindestens der Allgemeinen Hochschulreife. Ihr Schwierigkeitsgrad ist vergleichbar mit dem philosophischer Abhandlungen. Die meisten Qualitätsberichte deutscher Krankenhäuser sind für die meisten Patienten nicht lesbar und nachvollziehbar."
Bereits im Jahre 2007 hatte eine Studie 84 Qualitätsberichte, die bis zum Stichtag am 31. Dezember 2006 veröffentlicht worden waren, unter den drei Aspekten Inhalt, Gestaltung und Sprache analysiert. Schon damals kam man zu einer vehementen Kritik und das Fazit der Studienautoren ging dahin, dass die Berichterstellung für die Kliniken nur eine lästige Pflichterfüllung darstellt und die Chancen des Marketing nicht erkennt. Zentrale Adressaten jedenfalls, potentielle Patienten, würden als Zielgruppe der Publikationen nicht angesprochen. (vgl. Studie kritisiert "Strukturierte Qualitätsberichte" der Krankenhäuser: "Patienten rücken nicht in den Blickpunkt")
Die jetzt in der deutschen Fachzeitschrift "Das Gesundheitswesen" veröffentlichte Studie von J. Friedemann, H.-J. Schubert und D. Schwappach (Institut Universität Witten/Herdecke, Medizinische Fakultät, Management von Gesundheits- und Sozialeinrichtungen) hat den im Internet veröffentlichten schriftlichen Systemteil von 200 Berichten auf sprachliche Verständlichkeit hin analysiert. Die ausgewählten Kliniken entsprechen im Hinblick auf Merkmale wie Bettenzahl und Trägerschaft im Wesentlichen der Gesamtstruktur des deutschen Krankenhauswesens. Die Auswertung erfolgte dann computergestützt und erfasste alle formalen Textmerkmale und Fremdwörter. Für jeden Text wurde dann ein sogenannter "Lesbarkeitsindexwert" berechnet.
Als Ergebnis zeigte sich: "Die Qualitätsberichte deutscher Krankenhäuser sind nur für Patienten lesbar, die über überdurchschnittliche Lese- und Sprachfähigkeiten verfügen. Sie enthalten über 10% Fremdworte, 17 % der gewählten Worte und 60 % der gebauten Sätze sind zu lang. 10 % der Sätze sind zu komplex und 25 % enthalten mehr als drei Fremdworte. Um die Texte zu verstehen, bedarf es gemäß Lesbarkeitsindizes mindestens der Allgemeinen Hochschulreife." Bedeutsame Unterschiede zwischen Kliniken je nach Bettenzahl oder Trägerschaft hinsichtlich der Lesbarkeit konnten die Wissenschaftler nicht feststellen.
Einige besonders typische und misslungene Beispiele werden im Aufsatz auch zitiert, so die folgende Information: "Unterstützend zum Aufbau und Umsetzung des Qualitätsmanagementsystems, das durch die Mitarbeit aller Mitarbeiter unserer Klinik erfolgt, wurde ein Organigramm, das die Führungsstruktur der Klinik und die Tätigkeitsbereiche aufzeigt, erstellt, ein Qualitätsbeauftragter ernannt, ein Verfahren zur kontinuierlichen Verbesserung etabliert, unsere internen Prozesse identifiziert und in einer Prozesslandschaft dargestellt."
Leider ist zur Studie kostenlos nur ein Abstract verfügbar: J. Friedemann, H.-J. Schubert, D. Schwappach: Zur Verständlichkeit der Qualitätsberichte deutscher Krankenhäuser: Systematische Auswertung und Handlungsbedarf (Gesundheitswesen 2009; 71: 3-9; DOI: 10.1055/s-0028-1086010)
Gerd Marstedt, 5.2.09
Das Interesse an Arzt- und Klinik-Wegweisern zur Versorgungsqualität ist bei US-Bürgern deutlich gesunken
 Die in den USA schon länger als ein Jahrzehnt gängigen Vergleichslisten und Bewertungen der Versorgungsqualität von Ärzten, Kliniken und Versorgungszentren finden zunehmend weniger Interesse bei US-Bürgern. Nach einer vorübergehend in den Jahren 2004 und 2006 gestiegenen Nutzung solcher im Internet veröffentlichten Wegweiser liegt das Interesse jetzt im Jahre 2008 wieder auf demselben eher niedrigen Niveau wie 1996. Die jetzt veröffentlichte Studie der Kaiser Family Foundation basiert auf Telefoninterviews mit gut 1.500 repräsentativ ausgewählten US-Amerikanern im Alter von 18 Jahren und älter. Im einzelnen zeigte sich bei der Befragung:
Die in den USA schon länger als ein Jahrzehnt gängigen Vergleichslisten und Bewertungen der Versorgungsqualität von Ärzten, Kliniken und Versorgungszentren finden zunehmend weniger Interesse bei US-Bürgern. Nach einer vorübergehend in den Jahren 2004 und 2006 gestiegenen Nutzung solcher im Internet veröffentlichten Wegweiser liegt das Interesse jetzt im Jahre 2008 wieder auf demselben eher niedrigen Niveau wie 1996. Die jetzt veröffentlichte Studie der Kaiser Family Foundation basiert auf Telefoninterviews mit gut 1.500 repräsentativ ausgewählten US-Amerikanern im Alter von 18 Jahren und älter. Im einzelnen zeigte sich bei der Befragung:
• Etwa jeder dritte Befragte (30%) gab an, dass er im letzten Jahr auch Informationen gelesen hat, in denen über Qualitätsunterschiede zwischen Krankenversicherungen, Kliniken oder Ärzten berichtet wurde. Arzt-Wegweiser sind dabei weniger zur Kenntnis genommen worden.
• Nur 14 Prozent gaben jedoch an, dass sie solche Bewertungen sowohl gesehen als auch genutzt haben. Das heißt, dass Kenntnis und Nutzung weit auseinander klaffen.
• Waren es 1996 noch 39% der Amerikaner, die einen Arzt-, Klinik- oder Kassen-Wegweiser gelesen haben, so liegt diese Zahl 2008 nur noch bei 30%.
• Die Nutzung ist dabei auch abhängig vom Bildungsniveau, aber in viel geringerem Maße als man vermuten könnte (College-Abschluss 18%, unterstes Bildungsniveau 11%)
• Eine Erklärung für diese Befunde könnte darin liegen, dass weniger als die Hälfte der befragten US-Amerikaner große Qualitätsunterschiede zwischen Ärzten und Kliniken wahrnimmt. Überdies ist der Anteil solch kritischer Wahrnehmungen in den letzten Jahren gesunken. 2008 erkennen große Qualitätsunterschiede: bei Krankenkassen und Versorgungstarifen 44%, bei Krankenhäusern in der Region 41%, bei Fachärzten in der Region 33%, bei Allgemeinärzten 30%.
• Die Frage, ob man bei der Wahl bestimmter Leistungen eher dem Rat von Freunden und Verwandten folgen oder auf das Abschneiden in medizinischen Bewertungslisten vertrauen würde, wird unterschiedlich beantwortet, je nachdem um welche Leistung es geht. Bei Krankenkassen und Versorgungstarifen vertraut die Mehrheit (52%) objektiven Listen, bei der Auswahl einer Klinik traut man eher dem Rat von Freunden und Verwandten (59%) und bei der Wahl eines Chirurgen sind die Meinungen geteilt.
Die Studie mit Ergebnis-Zusammenfassung und Diagrammen: Kaiser Family Foundation: 2008 Update on Consumers' Views of Patient Safety and Quality Information - Summary & Chartpack
In der Studie werden leider keine Überlegungen angestellt, wodurch das sinkende Interesse verursacht sein könnte. Einer der Gründe könnte jedoch darin liegen, dass in den USA durch die Vielzahl der Listen eine große Unübersichtlichkeit herrscht und überdies vor kurzem in den Medien berichtet wurde, dass diese Listen teilweise völlig unterschiedlich ausfallen und bei demselben Krankenhaus zu konträren Bewertungen kommen.
Gerd Marstedt, 5.12.08
Kritik an Klinikführern in den USA: Völlig abweichende Bewertungen für ein und dasselbe Krankenhaus
 Schon seit einiger Zeit wird in den USA Kritik laut über die große Unübersichtlichkeit der Qualitätsbewertungen und Ranglisten von Kliniken in den USA. In einem jetzt in der Zeitschrift "Health Affairs" veröffentlichten Aufsatz hat ein Forschungsteam in Massachusetts diese Kritik noch einmal anhand eigener empirischer Untersuchungsbefunde verstärkt. Die Wissenschaftler verglichen die Klinikbewertungen von fünf großen Einrichtungen für einige ausgewählte medizinische Eingriffe bei insgesamt 25 Kliniken im Großraum von Boston. Ihr Fazit fällt überaus negativ aus: Die Bewertungen unterscheiden sich teilweise wie Tag und Nacht, jeder Klinikführer hat andere Indikatoren zur Struktur-, Prozess- oder auch Ergebnisqualität. Selbst dann, wenn harte Indikatoren wie die 30-Tage-Mortalität herangezogen werden, gibt es noch massive Abweichungen in der Einstufung, wie eine Klinik bei diesem Aspekt abschneidet.
Schon seit einiger Zeit wird in den USA Kritik laut über die große Unübersichtlichkeit der Qualitätsbewertungen und Ranglisten von Kliniken in den USA. In einem jetzt in der Zeitschrift "Health Affairs" veröffentlichten Aufsatz hat ein Forschungsteam in Massachusetts diese Kritik noch einmal anhand eigener empirischer Untersuchungsbefunde verstärkt. Die Wissenschaftler verglichen die Klinikbewertungen von fünf großen Einrichtungen für einige ausgewählte medizinische Eingriffe bei insgesamt 25 Kliniken im Großraum von Boston. Ihr Fazit fällt überaus negativ aus: Die Bewertungen unterscheiden sich teilweise wie Tag und Nacht, jeder Klinikführer hat andere Indikatoren zur Struktur-, Prozess- oder auch Ergebnisqualität. Selbst dann, wenn harte Indikatoren wie die 30-Tage-Mortalität herangezogen werden, gibt es noch massive Abweichungen in der Einstufung, wie eine Klinik bei diesem Aspekt abschneidet.
Die Wissenschaftler wählten im August 2007 alle Krankenhäuser mit mindestens 250 Betten im Großraum von Boston, Massachusetts, aus und berücksichtigten für ihre Analysen dann 25 Kliniken. Weiterhin wählten sie fünf große Klinikführer aus, die ihre Ergebnisse auch im Internet veröffentlichen, und zwar:
• die staatliche Klinikbewertung Hospital Compare
• das private Forschungsunternehmen Health-Grades
• die Qualitätsbewertungen der Leapfrog Group
• die Rangliste der Zeitung U.S News sowie
• den regionalen Klinikführer Massachusetts Healthcare Quality and Cost.
Festgestellt wurde zunächst, dass die hier verwendeten Bewertungssysteme eine außerordentlich große Heterogenität aufweisen: Im Hinblick auf die berücksichtigten Qualitätsindikatoren, ihre Spezifik (Struktur-, Prozess-, Ergebnisqualiät), den zur Bewertung berücksichtigten Zeitraum, die Stichprobengröße und anderes mehr.
Für eine Reihe medizinischer Eingriffe, wie unter anderem koronare Bypass-Operationen oder kompletter Ersatz eines Hüftgelenks, wurden dann die Bewertungen der Klinikführer für die einzelnen Krankenhäuser miteinander verglichen. Das Fazit heißt: "Für alle Diagnosen bzw. Eingriffe gab es zwischen den Bewertungen nur eine sehr geringe Übereinstimmung. So wurden beispielsweise die beiden Kliniken, die beim Bypass zumindest einmal als beste eingestuft waren, zugleich auch in einer anderen Bewertung als schlechteste bewertet." 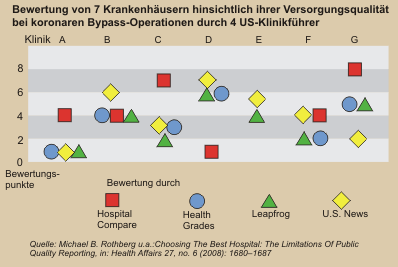
Die abgebildete Grafik zeigt für das Beispiel koronare Bypass-Operationen für 7 Kliniken die große Streuweite der Bewertungen. Auch für andere Eingriffe sind die Differenzen in der Bewertung ähnlich groß. Und selbst bei der Berücksichtigung "harter Indikatoren" wie 30-Tage-Mortalitätsraten und ihrer Einstufung ergaben sich ganz erhebliche Unterschiede zwischen den verschiedenen Bewertungssystemen.
Die Wissenschaftler machen verschiedene Vorschläge, um die überaus problematische und für Patienten verwirrende Situation zu überwinden. Zum einen, so sagen sie, müssten die Krankenhäuser endlich aus ihrer passiven Rolle herauskommen und sich darüber einigen, welche Indikatoren wirklich aussagekräftig und vergleichbar sind und daher zukünftig erfasst und veröffentlicht werden sollten. Zum zweiten sind aber auch mehr Forschungsanstrengungen nötig, um endlich herauszufinden, was Patienten nun wirklich interessiert: Möchten sie tatsächlich 30-Tage-Überlebensraten der einzelnen Kliniken miteinander vergleichen oder interessieren sie sich eher für Zufriedenheitsurteile anderer Patienten? Weitgehend ungelöst ist nach Auffasung der Forscher bisher auch das Problem der Risikoadjustierung, also der Berücksichtigung unterschiedlicher Vor- und Begleiterkrankungen von Patienten.
Für die Studie ist kostenlos leider nur ein Abstract verfügbar: Michael B. Rothberg u.a.: Choosing The Best Hospital: The Limitations Of Public Quality Reporting (Health Affairs, 27, no. 6 (2008): 1680-1687; doi: 10.1377/hlthaff.27.6.1680)
Gerd Marstedt, 13.11.08
Wissen=Handeln? Sehr gemischtes, zum Teil paradoxes oder gegenläufiges Bild der Wirkungen von öffentlichen Qualitätsvergleichen
 Zu den berechtigten Kritikpunkten an den auch nur langsam häufiger erstellten und veröffentlichten Berichten über ausgewählte Aspekte der gesundheitlichen Versorgung im deutschen Gesundheitswesen gehören seit langem die dort fehlenden, reduzierten oder anonymisierten Informationen über die Ergebnisqualität.
Zu den berechtigten Kritikpunkten an den auch nur langsam häufiger erstellten und veröffentlichten Berichten über ausgewählte Aspekte der gesundheitlichen Versorgung im deutschen Gesundheitswesen gehören seit langem die dort fehlenden, reduzierten oder anonymisierten Informationen über die Ergebnisqualität.
Berichte wie die jedem Krankenhaus gesetzlich vorgeschriebenen "Krankenhaus-Qualitätsberichte" enthalten bisher meist nur Angaben zur Struktur- und Prozessqualität und keine Angaben über die Anzahl im Krankenhaus verstorbenen Patienten, unerwünschte Komplikationen oder die Häufigkeit von Krankenhausinfektionen, die methodisch und inhaltlich verlässliche Vergleiche zwischen Kliniken erlauben würden. Da wo es zumindest einen Teil dieser harten Indikatoren gibt, werden sie, wie im Falle der Berichte der "Bundesgeschäftsstelle Qualitätssicherung (BQS)" weder flächendeckend noch nicht-anonym veröffentlicht.
Bevor man meint, mit der Forderung nach deutlichen Verbesserungen in diesen Sachmerkmalen, wirklich Berichte zu erhalten, die dem nach Behandlungsorten suchenden Patienten bei u.U. lebensrelevanten Entscheidungen helfen, sollte aber auch noch zum wirklichen und massenhaften Nutzen der Berichte gefragt werden. Ziehen also überhaupt entscheidungsfähige Patienten Berichte über die Qualität einer Krankenhausbehandlung heran und fällen ihre Entscheidung auf dieser Informationsbasis?
Folgt man den Ergebnissen einer Ende 2007 in der "Deutschen Medizinischen Wochenschrift" veröffentlichten Sekundäranalyse von über 40 veröffentlichten Studien zu diesen Fragen, lautet die Antwort auf beide Fragen fast uneingeschränkt "nein".
Diese klaren und etwas deprimierenden Ergebnisse lauten beispielsweise so:
• "Die Mehrzahl der empirischen Untersuchungen zeigen, dass die Publikation von Qualitätsdaten nahezu keinen Einfluss auf das Verhalten von Patienten, z. B. die Wahl des Krankenhauses, hat. Analysen nach der Veröffentlichung von Mortalitäts- und Komplikationsraten aus den USA zeigen, dass selbst bei umfangreicher Publikation der Daten allenfalls sporadische, inkonsistente und geringfügige Zu- bzw. Abnahmen der Leistungsmengen in Krankenhäusern mit 'Ausreißer'-Status, also besonders guten oder besonders schlechten Ergebnissen, zu beobachten sind." (2639) Und: "Die Validität von Qualitätsvergleichen muss vielfach bezweifelt werden. Für viele der geäußerten positiven Erwartungen existiert keine, oder sogar nachteilige Evidenz."
• "...hatten die Informationen (eines Bypass-Infoportals in Pennsylvania) nur bei 2% der Patienten einen 'gewissen Einfluss' auf ihre Entscheidung für ein Krankenhaus. 1% der Patienten konnte das Rating des Krankenhauses, in dem sie behandelt wurden, korrekt wiedergeben." (ebd.)
• Was beobachtet werden kann und plausibel wirkt, sind "positive Effekte auf die Qualitätsbemühungen von Leistungsanbietern". Dem gegenüber fürchten die Autoren "gleichzeitig "starke Selektionseffekte, bei denen durch strategische Veränderungen in den Patientengruppen bessere Qualitätsdaten erzielt werden sollen."
• Und die krönende abschließende Bewertung lautet dann: "Dennoch mag die Offenlegung in der derzeitigen Situation wichtig sein, um Vertrauen zwischen Krankenhäusern und der Bevölkerung und eine Atmosphäre der Offenheit und Verantwortlichkeit herzustellen. Die Tatsache, dass überhaupt offengelegt wird, mag in dieser Hinsicht wichtiger sein als das, was durch eine Offenlegung an positiven Wirkungen erwartet werden kann."
Von dem dreiseitigen Aufsatz "Offenlegen oder nicht? Chancen und Risiken der Veröffentlichung von medizinischen Qualitätsvergleichen" von David Schwappach und H.-J. Schubert in der "DMW" (132: 2633-2636) gibt es kostenfrei leider nur eine kurze Zusammenfassung. Die PDF-Datei des kompletten Beitrags kostet den stolzen Betrag von 25 US-Dollar.
Bernard Braun, 7.5.2008
USA: Daten einer bundesweiten Befragung von Krankenhaus-Patienten jetzt öffentlich zugänglich
 In den USA können Patienten, die eine Klinik für eine planbare medizinische Behandlung suchen, jetzt auch auf Befragungsdaten zur Patientenzufriedenheit aus über 2.500 Kliniken im gesamten Land zurückgreifen. Die US-Behörde "Department of Health & Human Services" erweitert damit ihr Informationssystem "Hospital Compare" und informiert auch darüber, wie zufrieden Patienten mit der Behandlung waren. Basis dafür war eine Umfrage bei Patienten, die aus der Klinik entlassen wurden. Ihnen wurden insgesamt 22 Fragen gestellt, unter anderem zur Kommunikation und Information: Wurden sie durch Krankenpfleger und Ärzte mit Achtung und Respekt behandelt, hörte man ihnen aufmerksam zu, wurde alles verständlich erklärt? Aber auch andere Aspekte des Krankenhaus-Aufenthalts waren Gegenstand der Befragung: Hilfe bei Schmerzen, Informationen über verabreichte Arzneimittel, Sauberkeit und Ruhe in den Krankenräumen, Verhaltenhinweise für die Zeit nach der Entlassung, Zufriedenheit insgesamt und Empfehlung der Klinik.
In den USA können Patienten, die eine Klinik für eine planbare medizinische Behandlung suchen, jetzt auch auf Befragungsdaten zur Patientenzufriedenheit aus über 2.500 Kliniken im gesamten Land zurückgreifen. Die US-Behörde "Department of Health & Human Services" erweitert damit ihr Informationssystem "Hospital Compare" und informiert auch darüber, wie zufrieden Patienten mit der Behandlung waren. Basis dafür war eine Umfrage bei Patienten, die aus der Klinik entlassen wurden. Ihnen wurden insgesamt 22 Fragen gestellt, unter anderem zur Kommunikation und Information: Wurden sie durch Krankenpfleger und Ärzte mit Achtung und Respekt behandelt, hörte man ihnen aufmerksam zu, wurde alles verständlich erklärt? Aber auch andere Aspekte des Krankenhaus-Aufenthalts waren Gegenstand der Befragung: Hilfe bei Schmerzen, Informationen über verabreichte Arzneimittel, Sauberkeit und Ruhe in den Krankenräumen, Verhaltenhinweise für die Zeit nach der Entlassung, Zufriedenheit insgesamt und Empfehlung der Klinik.
Die Datenbasis, die jetzt auch von Laien kostenlos als Datenbank heruntergeladen werden kann, umfasst jetzt für über 2.500 US-Kliniken Angaben zur (risiko-adjustierten) 30-Tage-Mortalität und ebenso Indikatoren zur Versorgungsqualität, derzeit allerdings noch beschränkt auf wenige Erkrankungen. Auch die Datenbasis zur Patientenzufriedenheit ist noch nicht komplett, was die Stichprobengröße anbetrifft: Angestrebt wird für die Zukunft eine Mindestbeteiligung von 300 entlassenen Patienten pro Klinik. Wie die US-Behörde mitteilte, haben einige wenige Kliniken die Patientenbefragung verweigert. Die Beteiligungsquote soll zukünftig jedoch durch finanzielle Anreize noch weiter erhöht werden.
In einem Artikel in der New York Times werden einige Gesamtergebnisse der Patientenbefragung mitgeteilt: So zeigt sich für die Gesamtzufriedenheit der Patienten, dass bundesweit 63 Prozent die Punktzahl 9 oder 10 (auf einer zehnstufigen Skala) vergeben, also sehr zufrieden sind. Dabei finden sich allerdings erhebliche Schwankungen sowohl zwischen einzelnen Kliniken, also auch zwischen Bundesstaaten. Während der Durchschnittswert für hochzufriedene Klinikpatienten in Alabama bei 73 Prozent liegt, beträgt er im Staate New York oder in Hawaii nur knapp über 50 Prozent.
• Pressemitteilung des U.S. Department of Health & Human Services: New Web Site Helps Patients Shop for Hospital Care Based On Quality and Price CMS Web Site
• Website zur Suche eines Krankenhauses mit Daten zu Versorgungsqualität, Patientenzufriedenheit und Kosten: Hospital Compare
• Details und FAQs zu den veröffentlichten Klinik-Daten: Hospital Compare: Information for Consumers and Professionals
• Artikel in der New York Times mit Zusammenfassung des Hintergrunds und bundesweiter Befragungsergebnisse: Robert Pear: Study Finds Many Patients Dissatisfied With Hospitals (New York Times, March 29, 2008)
Gerd Marstedt, 31.3.2008
Veröffentlichung von Qualitätsdaten medizinischer Versorgungseinrichtungen: Zeigen sich Effekte für die Versorgungsqualität?
 Die Veröffentlichung der Qualitätsdaten von Kliniken, so wie dies jetzt erstmals in den Strukturierten Qualitätsberichten geschehen ist bzw. in aufbereiteten Übersichten von Krankenkassen (BKK Klinikfinder, VdAK-Klinik-Lotse, AOK-Krankenhaus-Navigator) war wesentlich motiviert durch die Überlegung, damit einen Druck zur Qualitätsverbesserung zu erzeugen. Patienten sollten angeregt werden, die Krankenhaus-Daten zu vergleichen und sich dann für Kliniken mit besserer Versorgungsqualität zu entscheiden, so dass Einrichtungen mit schlechteren Ergebnissen einen Image- und Nachfrageverlust, und damit auch einen Druck zur Verbesserung ihrer Versorgungsprozesse verspüren. Ob die in dieser Überlegung implizit unterstellten Mechanismen sich tatsächlich auch in der Realität so entfalten, hat jetzt eine Meta-Analyse kalifornischer Wissenschaftler untersucht, die in der Zeitschrift "Annals of Internal Medicine" veröffentlicht wurde.
Die Veröffentlichung der Qualitätsdaten von Kliniken, so wie dies jetzt erstmals in den Strukturierten Qualitätsberichten geschehen ist bzw. in aufbereiteten Übersichten von Krankenkassen (BKK Klinikfinder, VdAK-Klinik-Lotse, AOK-Krankenhaus-Navigator) war wesentlich motiviert durch die Überlegung, damit einen Druck zur Qualitätsverbesserung zu erzeugen. Patienten sollten angeregt werden, die Krankenhaus-Daten zu vergleichen und sich dann für Kliniken mit besserer Versorgungsqualität zu entscheiden, so dass Einrichtungen mit schlechteren Ergebnissen einen Image- und Nachfrageverlust, und damit auch einen Druck zur Verbesserung ihrer Versorgungsprozesse verspüren. Ob die in dieser Überlegung implizit unterstellten Mechanismen sich tatsächlich auch in der Realität so entfalten, hat jetzt eine Meta-Analyse kalifornischer Wissenschaftler untersucht, die in der Zeitschrift "Annals of Internal Medicine" veröffentlicht wurde.
Die Wissenschaftler bilanzierten in ihrer Studie insgesamt 45 Veröffentlichungen aus dem Zeitraum 1986-2006, die sich allesamt mit dem Thema "Effekte einer Veröffentlichung von Qualitätsdaten medizinischer Versorgungseinrichtungen" beschäftigt hatten, wobei allerdings unterschiedliche Effekte berücksichtigt worden waren: Das Such- und Auswahlverhalten von Patienten, Aktivitäten der Einrichtungen zur Qualitätsverbesserung, klinische Befunde der Einrichtungen vor und nach der Daten-Veröffentlichung (Therapiererfolg, Patientensicherheit, Patientenzentrierung), unerwünschte Folgen der Daten-Veröffentlichung.
Als Ergebnis dieser Meta-Analyse zeigte sich:
• Hinsichtlich des Einflusses auf das Patientenverhalten zeigt sich kein klares Bild, zumindest nicht in dem erhofften Sinne, dass Patienten sich nach einer Veröffentlichung von Qualitätsdaten eindeutig den dort besser bewerteten Kliniken oder Versorgungseinrichtungen und -programmen zuwenden, und die schlechter bewerteten links liegen lassen. Eine Studie fand heraus, dass eine qualitativ hochwertige Berichterstattung über 30-Tage-Sterbequoten in Kliniken nur einen sehr geringen Effekt hatte für die Patientennachfrage, während andererseits Zeitungsberichte über einzelne, spektakuläre und ungewöhnliche Todesfälle in einem Krankenhaus einen sehr drastischen Effekt innehatten. Insgesamt zeigen die verschiedenen Studien hierzu, die teilweise mit Mortalitätsraten, teilweise mit Qualitätsindikatoren gearbeitet hatten, ein überaus widersprüchliches Bild. Einige dokumentierten einen deutlichen Effekt auf das Patientenverhalten, andere zeigen keinerlei signifikante Einflüsse.
• Recht eindeutig sind hingegen Ergebnisse, die Reaktionen und Aktivitäten der Kliniken bzw. Versorgungseinrichtungen betreffen. Hier zeigt sich in fast allen dazu herangezogenen Studien (insgesamt 11), dass nach einer Veröffentlichung schlechter Qualitätsdaten oder hoher Mortalitätsraten die Einrichtungen verschiedene Maßnahmen zu einer Qualitätsverbesserung in Gang setzen. In einer Studie zeigte sich sogar, dass die zuvor sehr unterschiedlich hohen Klinik-Mortalitätsraten einige Zeit nach der Veröffentlichung kaum noch Unterschiede aufwiesen.
• In vier Studien war überprüft worden, ob sich durch die Daten-Offenlegung auch unerwünschte Folgen ergaben, beispielsweise durch eine Selektion von Patienten, also eine Ablehnung solcher Fälle, die besonders schwerwiegend waren oder viele Begleiterkrankungen aufwiesen und die somit ein höheres Risiko bedeuteten. Die Befunde hierzu waren nicht einheitlich - allerdings gab es in einer Reihe von Studien doch ernst zu nehmende Beobachtungen über eine solche Risikoselektion.
• Hinsichtlich der Effekte für den Therapieerfolg und andere Indikatoren (Patientensicherheit, Patientenzentrierung) wird von den Wissenschaftlern keine Bilanz gezogen, da die Zahl der Studien hierzu viel zu niedrig ist, obwohl gerade dieser Aspekt ja eigentlich im Zentrum des Interesses stehen müsste. Die Kardinal-Frage ist ja, ob sich eine Veröffentlichung von Qualitätsdaten positiv auf die Versorgungsqualität auswirkt.
In der Bilanz ihrer Befunde kritisieren die Wissenschaftler, dass es bislang keine Studien gab, die unterschiedliche Berichtsformen miteinander verglichen haben. Die Zahl der Quellen und Auskunftsmöglichkeiten ist ja insbesondere in den USA, aber auch in England überaus groß. (vgl.: Qualitätsbewertungen und Ranglisten von Kliniken in den USA: Die große Unübersichtlichkeit) Dass die Effekte der Veröffentlichung auf das Patientenverhalten so wenig einheitlich sind, erklären sie so, dass bislang offensichtlich noch sehr große Unsicherheit bei den Herausgebern der Informationen besteht, welche Art von Datenpräsentation bei welchen Nutzergruppen von Interesse ist. Hier erkennen sie einen sehr großen Forschungsbedarf.
Hier ist ein Abstract der Meta-Analyse: Constance H. Fung u.a.: Systematic Review: The Evidence That Publishing Patient Care Performance Data Improves Quality of Care (Annals of Internal Medicine, 15 January 2008, Volume 148 Issue 2, Pages 111-123)
Gerd Marstedt, 28.1.2008
Reagieren medizinische Versorgungseinrichtungen überhaupt auf eine Veröffentlichung von Qualitätsindikatoren?
 Eine Veröffentlichung von Qualitätsindikatoren für niedergelassene Ärzte, Kliniken oder auch Pflegeheime im Rahmen von Klinikführern oder Ärztelisten wird zumeist damit begründet, dass dies auch die Versorgungsqualität verbessert - durch eine stärkere Nachfrage von Patienten bei besseren Anbietern. Es stellt sich allerdings die Frage, inwieweit einerseits Patienten solche Veröffentlichungen überhaupt wahrnehmen und als Entscheidungsgrundlage berücksichtigen, und andererseits, inwieweit Versorgungseinrichtungen es überhaupt für nötig halten, ihre Organisations- oder Versorgungsstruktur nur deshalb zu verändern. Am Beispiel von Pflegeheimen ist nun eine US-amerikanische Forschungsgruppe der Frage nachgegangen, unter welchen Voraussetzungen diese Einrichtungen auf solche Veröffentlichungen im Rahmen ihrer strategischen Marktausrichtung reagieren und welche Mittel sie dazu einsetzen.
Eine Veröffentlichung von Qualitätsindikatoren für niedergelassene Ärzte, Kliniken oder auch Pflegeheime im Rahmen von Klinikführern oder Ärztelisten wird zumeist damit begründet, dass dies auch die Versorgungsqualität verbessert - durch eine stärkere Nachfrage von Patienten bei besseren Anbietern. Es stellt sich allerdings die Frage, inwieweit einerseits Patienten solche Veröffentlichungen überhaupt wahrnehmen und als Entscheidungsgrundlage berücksichtigen, und andererseits, inwieweit Versorgungseinrichtungen es überhaupt für nötig halten, ihre Organisations- oder Versorgungsstruktur nur deshalb zu verändern. Am Beispiel von Pflegeheimen ist nun eine US-amerikanische Forschungsgruppe der Frage nachgegangen, unter welchen Voraussetzungen diese Einrichtungen auf solche Veröffentlichungen im Rahmen ihrer strategischen Marktausrichtung reagieren und welche Mittel sie dazu einsetzen.
Qualitätsindikatoren von Pflegeheimen werden in den USA seit 2002 auf der Website "Nursing Home Compare" veröffentlicht, in vielen Zeitungsberichten wurde landesweit darüber berichtet. Für die Studie wurde eine repräsentative nationale Stichprobe von über 700 Heimen schriftlich befragt. Überprüft wurde, ob eine sofortige Reaktion erfolgte oder nicht und welche Maßnahmen im Einzelnen daraufhin in Gang gesetzt wurden, wie zum Beispiel
• Informationen für Heimbewohner und Angehörige, in denen die einzelnen Indikatoren erklärt werden
• interne Analysen und Kontrollen, um Ursachen für das schlechte Abschneiden in bestimmten Kategorien zu klären
• Umstrukturierungen bei den Arbeitsaufgaben und Zuständigkeiten der Pflegekräfte
• Investitionen in neue Technologien
• Änderungen der Prioritäten für einzelne Pflegeaufgaben.
Als unabhängige und zentrale Einflussgröße für die Reaktionsmuster der Heime wurde deren Unternehmensphilosophie und strategisches Konzept untersucht. Dabei orientierte sich die Forschergruppe an einer von Miles & Snow schon 1978 entwickelten Typologie, die unterschiedliche Marktstrategien von Betrieben unterscheidet und vier Typen identifiziert, die seither in vielen Studien überprüft wurden und sich als sehr trennscharf und erklärungskräftig erwiesen haben.
• "Goldschürfer" ("Prospectors") ändern ihre Produkte und Dienstleistungen sehr häufig, versuchen stets, innovativ zu sein und die sich bietenden Marktchancen als erste zu nutzen
• "Verteidiger" ("Defenders") sind demgegenüber sehr konservativ eingestellt, versuchen, in jenen Feldern, in denen sie sich sehr gut auskennen und viele Erfahrungen haben, ihre Position mit Qualität und niedrigen Preisen zu festigen
• "Analysten" ("Analyzers") sind betriebliche Mischtypen, die in ihren angestammten Unternehmensbereichen konservativ agieren, aber in kleineren Handlungsfeldern durchaus auch Innovationen ausprobieren
• "Reaktive" ("Reactors") schließlich sind Unternehmen, die nach Ansicht von Miles & Snow auf Dauer nicht wettbewerbsfähig sind, da sie ständig ihre Strategien und Unternehmensprinzipien ändern.
Im Rahmen einer multivariaten Datenanalyse wurde dann überprüft, inwieweit diese Typen, aber auch andere potentielle Einflussfaktoren (Bettenzahl des Heims, öffentliche oder private Einrichtung, Bewertung des Wettbewerbsdrucks usw.) die jeweilige Reaktion auf veröffentlichte Qualitätsdaten beeinflusst. Wesentliche Ergebnisse waren dabei unter anderem:
• Eine Veröffentlichung von Daten über die unterschiedliche Versorgungsqualität von Pflegeheimen führt bei weniger als der Hälfte der Einrichtungen überhaupt zu Reaktionen.
• Dabei unterscheiden sich Einrichtungen ganz erheblich, je nach ihrer Marktstrategie. Verteidiger antworten zu 43%, Analysten zu 33%, Goldschürfer zu 19% und Reaktive nur zu 7% auf das Bekanntwerden solcher Daten mit unternehmensinternen Maßnahmen unterschiedlicher Art.
• Bei Verteidigern zeigt sich am häufigsten die Tendenz, solche Veröffentlichungen zu ignorieren.
• Goldschürfer initiieren am häufigsten Maßnahmen, die eine Veränderungen bei Arbeitplatzbeschreibungen oder Pflegeprioritäten betreffen.
Festgestellt wurde allerdings auch, dass der von den jeweiligen Einrichtungen erlebte Konkurrenzdruck einen nachhaltigen Einfluss auf die Einleitung von Veränderungsmaßnahmen hat. Die Studie diskutiert sehr ausführlich die mit der Typologie zusammenhängenden organisationssoziologischen Aspekte, macht aber auch deutlich, dass nur ein sehr kleiner Teil der Heime auf eine Veröffentlichung von Qualitäts-Bewertungen reagiert und erst eine schärfere Wettbewerbssituation - die keineswegs für alle Heime zutrifft - zu Veränderungen drängt.
Hier ist ein Abstract der Studie: Jacqueline S. Zinn u.a.: Strategic Orientation and Nursing Home Response to Public Reporting of Quality Measures: An Application of the Miles and Snow Typology (Health Services Research, published article online: 10-Sep-2007, doi: 10.1111/j.1475-6773.2007.00781.x)
Gerd Marstedt, 26.11.2007
Paradoxe Patienten-Einsicht: Die Qualität der Ärzte ist sehr unterschiedlich. Aber es gibt kaum Möglichkeiten der Information.
 Patienten hierzulande machen derzeit noch eine überaus paradoxe Erfahrung: Einerseits erkennt die große Mehrheit, dass die Qualität der niedergelassenen Ärzte im Hinblick auf fachliche oder soziale Qualifikationen sehr unterschiedlich ist. Andererseits müssen viele von ihnen jedoch dann, wenn sie - aufgrund eines Wohnungswechsels oder der Unzufriedenheit mit ihrem bisherigen Arzt - einen neuen Arzt suchen, zur Kenntnis nehmen: Die Möglichkeiten, sich über die Qualität eines Arztes zu informieren, sind mehr als dürftig. Dies sind Befunde, einer Repräsentativ-Befragung, über die jetzt ein neuer Newsletter des "Gesundheitsmonitor" der Bertelsmann Stiftung berichtet.
Patienten hierzulande machen derzeit noch eine überaus paradoxe Erfahrung: Einerseits erkennt die große Mehrheit, dass die Qualität der niedergelassenen Ärzte im Hinblick auf fachliche oder soziale Qualifikationen sehr unterschiedlich ist. Andererseits müssen viele von ihnen jedoch dann, wenn sie - aufgrund eines Wohnungswechsels oder der Unzufriedenheit mit ihrem bisherigen Arzt - einen neuen Arzt suchen, zur Kenntnis nehmen: Die Möglichkeiten, sich über die Qualität eines Arztes zu informieren, sind mehr als dürftig. Dies sind Befunde, einer Repräsentativ-Befragung, über die jetzt ein neuer Newsletter des "Gesundheitsmonitor" der Bertelsmann Stiftung berichtet.
Während sich im Bereich der stationären Versorgung und der Informationsmöglichkeiten über Kliniken in den letzten Jahres einiges bewegt hat (vgl. Forum Gesundheitspolitik Klinikführer & Ärztewegweiser) und zumindest auf regionaler Ebene einige Klinikführer auch Indikatoren zur Versorgungsqualität bieten, sind vergleichbare Auskunftssysteme für niedergelassene Ärzte nicht in Sicht. Zwar häufen sich Internet-Portale mit Patientenurteilen über Ärzte, doch ist die Zahl der Arztbewertungen noch überaus überschaubar und die Bewertungsbasis reduziert auf soziale und kommunikative Aspekte.
Vor diesem Hintergrund wurden im Herbst 2006 insgesamt 1.574 deutschlandweit repräsentativ ausgewählte Personen im Alter von 18 bis 79 Jahren mit Hilfe eines Fragebogens schriftlich befragt. Wissen wollte man in dieser Erhebung des "Gesundheitsmonitor":
• Nehmen die Versicherten Qualitätsunterschiede zwischen Ärzten wahr und wenn ja, worin bestehen diese?
• Wie beurteilen Versicherte die Möglichkeiten, sich über die Qualität von Leistungsanbietern zu informieren?
• Welche Strategien nutzen Versicherte bislang bei der Arztsuche und welche Informationen fänden sie darüber hinaus hilfreich, um sich über Ärzte zu informieren?
• Welche Anforderungen sollten Qualitätsinformationen für Versicherte erfüllen?
Einige wesentliche Ergebnisse werden im Newsletter vorgestellt. Es zeigt sich:
• Ein großer Teil der Versicherten nimmt Qualitätsunterschiede zwischen Ärzten im Hinblick auf die Behandlungserfolge, den Umgang mit Patienten und die Aktualität der medizinischen Fachkenntnisse wahr. 42 Prozent sind der Meinung, dass es hierbei sehr große Unterschiede gibt. Weitere 40 Prozent stellen zumindest einige Differenzen fest.
• Auf Platz 1 der Unterschiede zwischen einem guten und einem weniger guten Arzt stehen nach Einschätzung der Befragten vor allem kommunikative und soziale Kompetenzen wie Einfühlungsvermögen, Menschenkenntnis und sich Zeit nehmen für den Patienten. Es folgt auf Platz 2 die Fähigkeit, verständlich erklären zu können. Erst auf Platz 3 werden der Umfang und die Aktualität der medizinischen Fachkenntnisse genannt.
• Die derzeitigen Möglichkeiten, sich über die Qualität von Ärzten zu informieren, werden von den meisten Befragten als nicht ausreichend oder sogar völlig unzureichend eingeschätzt. Dies ist besonders bemerkenswert, da gleichzeitig eine große Mehrheit von 82 Prozent deutliche Qualitätsunterschiede zwischen Ärzten wahrnimmt. Das heißt: Die Befragten erkennen, dass es gute und weniger gute Mediziner gibt (wie in anderen Berufen auch), können aber nach eigener Einschätzung kaum herauszufinden, wo sie gut behandelt werden.
• Insgesamt 28 Prozent der Versicherten haben in den letzten Jahren einen neuen Allgemein- bzw. Hausarzt gesucht, 42 Prozent einen Facharzt. Die mit Abstand am häufigsten verwendete Informationsquelle sind in beiden Fällen Empfehlungen aus dem Freundes- und Kollegenkreis.
• Die bisher verfügbaren Informationen für die Arztsuche decken nicht den Bedarf aller Versicherten. So antworten auf die Frage "Als Sie einen neuen Arzt gesucht haben, hätten Sie in der Situation gern genauere Informationen über ihn gehabt oder hat Ihnen die Empfehlung bzw. Kenntnis von Namen und Praxisanschrift ausgereicht?" 27 Prozent der Versicherten mit "Ich hätte gerne mehr Informationen gehabt". Dies sind vor allem Informationen über Komplikationen und Behandlungsfehler, die Erfahrungen anderer Patienten mit diesem Arzt sowie die Frage, ob er sich ausreichend Zeit für seine Patienten nimmt. Auch die Berufserfahrung des Arztes, die Regelmäßigkeit der Fortbildung sowie Beurteilungen durch Fachkollegen werden als wichtig eingestuft.
Als Fazit formulieren die Autoren Robert Amhof und Celina Galkowski: "Die Befragungsergebnisse des Gesundheitsmonitor haben gezeigt, dass viele Versicherte Qualitätsunterschiede zwischen Leistungserbringern wahrnehmen (vor allem in den fachlichen und sozialen Kompetenzen). Gleichzeitig fühlen sich die Versicherten unzureichend informiert und vermissen verlässliche Informationsmöglichkeiten über die Behandlungsqualität von Ärzten. Somit ist auf Seiten der Nutzer des Gesundheitswesens ein deutlicher Bedarf nach mehr Transparenz erkennbar."
Der Newsletter bietet darüber hinaus einen Blick ins Ausland und informiert, welche weitergehenden Möglichkeiten der Patienteninformation dort geboten werden.
Download: Bertelsmann Stiftung, Gesundheitsmonitor, Newsletter 3-2007: Mehr Transparenz über die Qualität der ambulanten medizinischen Versorgung
Gerd Marstedt, 24.11.2007
Gewünschte Informationen zur Wahl eines neuen Arztes: Patienten-Bedürfnisse unterscheiden sich erheblich
 Die Kassenärztliche Bundesvereinigung hat für 2008 angekündigt, Qualitätsindikatoren für die Arbeit niedergelassener Ärzte in Deutschland zu ermitteln und sie in Pilotpraxen testen zu lassen. Daraus soll ein "Ärzte-TÜV" resultieren, eine Art Praxis-Siegel, die Patienten verrät, ob ein Arzt bestimmte Kriterien bei der Qualitäts-Kontrolle erfüllt hat oder nicht. Während dessen wächst die Zahl der Internetportale mit Patienten-Urteilen über Ärzte kontinuierlich. Welche Art von Informationen über Ärzte wünschen sich Patienten, wenn sie auf der Suche nach einem "guten Arzt" sind oder den Arzt wechseln möchten? Zwei Studien haben jetzt vor allem gezeigt, dass es keine pauschale Antwort hierauf gibt, weil die individuellen Informationsinteressen höchst unterschiedlich sind.
Die Kassenärztliche Bundesvereinigung hat für 2008 angekündigt, Qualitätsindikatoren für die Arbeit niedergelassener Ärzte in Deutschland zu ermitteln und sie in Pilotpraxen testen zu lassen. Daraus soll ein "Ärzte-TÜV" resultieren, eine Art Praxis-Siegel, die Patienten verrät, ob ein Arzt bestimmte Kriterien bei der Qualitäts-Kontrolle erfüllt hat oder nicht. Während dessen wächst die Zahl der Internetportale mit Patienten-Urteilen über Ärzte kontinuierlich. Welche Art von Informationen über Ärzte wünschen sich Patienten, wenn sie auf der Suche nach einem "guten Arzt" sind oder den Arzt wechseln möchten? Zwei Studien haben jetzt vor allem gezeigt, dass es keine pauschale Antwort hierauf gibt, weil die individuellen Informationsinteressen höchst unterschiedlich sind.
Eine kalifornische Studie hatte über 2.200 Patienten einer Krankenkasse mit eigenen Ärzten und Versorgungseinrichtungen eine Email geschickt und sie eingeladen, eine Website zu besuchen, auf der sie nähere Informationen über die in Frage kommenden Ärzte finden würden. Auf der Website wurden unterschiedliche Informationen über die Ärzte präsentiert:
• berufliche Merkmale (Berufsjahre, Spezialisierungen usw.)
• persönliche Merkmale (Alter, Geschlecht, Fremdsprachen usw.)
• Öffnungszeiten der Praxis
• Ergebnisse einer Patientenbefragung über fünf Aspekte, darunter Kommunikationsverhalten und soziales Verständnis, Wartezeiten, Kooperation mit anderen Ärzten, Gesundheitsförderung sowie die generelle Bewertung und Weiterempfehlung des Arztes.
Nach dem Besuch der Website wurden die Patienten gebeten, einen Fragebogen auszufüllen. Rund 80% befolgten auch diese Bitte (wohl nicht zuletzt wegen einer dafür gewährten Prämie von 20 Dollar). In diesem Fragebogen sollte einerseits angegeben werden, welchen Arzt man wählen würde, andererseits, aufgrund welcher Informationen man diese Wahl getroffen hatte. Neben den Angaben auf der Website konnten dabei auch zwei zusätzliche Kriterien genannt werden, nämlich Empfehlungen von Freunden und Empfehlungen von Ärzten.
In der Datenauswertung zeigte sich dann:
• Die Ergebnisse der Patientenbewertung waren das wichtigste Kriterium zur Arztwahl, von 51% genannt
• Die geringste Bedeutung hatten persönliche Merkmale des Arztes sowie Empfehlung von Ärzten oder Freunden (jeweils ca. 25%)
• Innerhalb der verschiedenen Aspekte der Patientenbewertung hatten Wartezeiten den größten Einfluss, dicht gefolgt vom Kommunikationsverhalten und der Weiterempfehlung.
• Wohl noch bedeutsamer als diese Befunde war jedoch, dass sich zwischen verschiedenen Patientengruppen ganz erhebliche Differenzen zeigten. So war beispielsweise bei Älteren, Patienten mit mehreren Erkrankungen und Patienten mit hohem Bildungsniveau die persönliche Empfehlung eines Arztes sehr viel bedeutsamer.
Die Studie ist hier im Volltext nachzulesen: Gary Fanjiang u.a.: Providing Patients Web-based Data to Inform Physician Choice: If You Build It, Will They Come? (Journal of General Internal Medicine, Volume 22, Number 10 / Oktober 2007, 1463-1466, DOI: 10.1007/s11606-007-0278-1)
In dieser Untersuchung waren für Patienten leider keine Informationen zur Bewertung verfügbar, die Qualitätsindikatoren betrafen, so dass unklar geblieben ist, wie Patienten mit solchen, für Laien relativ schwer interpretierbaren Daten umgehen. Hinweise zur Beantwortung dieser Frage finden sich jedoch in einer anderen, bereits 2005 veröffentlichten Studie aus Kalifornien. Dort waren etwa 300 Erwachsene in einem Experiment gebeten worden, sich folgende Situation vorzustellen: Sie seien in eine neue Stadt umgezogen und suchten einen neuen Arzt. Ihre bisherige Suche hätte zwei Ärzte ergeben, die weitestgehend ähnliche Merkmale aufweisen wie zum Beispiel Warte- und Öffnungszeiten, Beruferfahrung, Praxisausstattung und -personal.
Man gab ihnen dann Kärtchen, auf denen noch weitergehende Informationen über die beiden Ärzte zu finden waren, und sie sollten danach entscheiden, welchen Arzt sie auswählen würden. Die Angaben auf den Kärtchen betrafen einerseits Qualitäts-Indikatoren in zusammen gefasster Form, also Bewertungen (nicht so gut, durchschnittlich, gut), wie dieser Arzt im Bereich der Therapie akuter und chronischer Erkrankungen ist und ebenso im Bereich der Prävention. Andererseits waren auch Bewertungen von Patienten über soziale Umgangsformen zu finden (Kommunikation, Höflichkeit und Respekt, Pünktlichkeit). Die Studienteilnehmer erhielten mehrfach hintereinander immer zwei Kärtchen mit unterschiedlichen Angaben zu diesen Aspekten und mussten jeweils einen Arzt auswählen.
Als Ergebnis zeigte sich dann: In etwa zwei Drittel aller Paarvergleiche waren für Untersuchungsteilnehmer die fachlichen Qualitäten des Arztes wichtiger als die sozialen Merkmale. Dass in einem Drittel aller Fälle hiervon abgewichen wurde und sozial-kommunikative Merkmale wichtiger für Patienten waren, ließ sich nicht aufklären. Sozialstatistische Merkmale der Teilnehmer (Alter, ethnische Zugehörigkeit, Geschlecht, Bildung usw.) waren hierfür aber nicht maßgeblich, sondern bestimmte Patienten-Merkmale, die in der Studie nicht erfasst waren. Unter dem Strich zeigte sich aber auch hier, dass Informationsbedürfnisse von Patienten über Ärzte sehr unterschiedliche Aspekte betreffen und es keine generell gültige Antwort auf die Frage gibt: Welche Informationen möchten Patienten bekommen, wenn sie auf der Suche nach einem Arzt sind?
Hier ist ein Abstract der Studie zu finden: Fung C.H. u.a.: Patients' preferences for technical versus interpersonal quality when selecting a primary care physician (Health Serv Res. 2005 Aug;40(4):957-77)
Gerd Marstedt, 4.11.2007
Klinikführer und Ranglisten in den USA: Studien decken Inkonsistenzen und Widersprüche auf
 Ranglisten von Kliniken und vergleichende Übersichten mit Qualitäts-Indikatoren sind in den USA anders als in Deutschland fast im Überfluss verfügbar. Einige Dutzend solcher Internet-Seiten gibt es, herausgegeben von kommerziellen, gemeinnützigen und auch staatlichen Einrichtungen. (vgl. hierzu auch: Qualitätsbewertungen und Ranglisten von Kliniken in den USA: Die große Unübersichtlichkeit). Dass dieses ausufernde Angebot für Patienten nicht unbedingt einen Informationsvorteil bringt, haben jetzt zwei neuere Studien gezeigt. Wer sich nicht auf einen Klinikführer verlassen möchte und zwei oder gar mehr Informationsangebote heranzieht, so das Ergebnis beider Analysen, wird zwangsläufig auf widersprüchliche und inkonsistente Ergebnisse stoßen.
Ranglisten von Kliniken und vergleichende Übersichten mit Qualitäts-Indikatoren sind in den USA anders als in Deutschland fast im Überfluss verfügbar. Einige Dutzend solcher Internet-Seiten gibt es, herausgegeben von kommerziellen, gemeinnützigen und auch staatlichen Einrichtungen. (vgl. hierzu auch: Qualitätsbewertungen und Ranglisten von Kliniken in den USA: Die große Unübersichtlichkeit). Dass dieses ausufernde Angebot für Patienten nicht unbedingt einen Informationsvorteil bringt, haben jetzt zwei neuere Studien gezeigt. Wer sich nicht auf einen Klinikführer verlassen möchte und zwei oder gar mehr Informationsangebote heranzieht, so das Ergebnis beider Analysen, wird zwangsläufig auf widersprüchliche und inkonsistente Ergebnisse stoßen.
Zum zweiten Mal nach der Erstveröffentlichung 2005 werden in diesem Jahre Strukturierte Qualitätsberichte deutscher Kliniken veröffentlicht, dieses Mal sogar unter Einschluss von Qualitätsindikatoren und mit der Möglichkeit zum direkten Vergleich einzelner Krankenhäuser. Dieser bundesweite Klinikbericht wird dann weitgehend konkurrenzlos sein, lediglich in einigen wenigen deutschen Regionen oder Großstädten (Rhein-Ruhr, Berlin, Hamburg, Bremen) könnten Interessenten dann einen Vergleich der Ergebnisse mit ihren regionalen Klinikführern anstellen. In den USA sind solche Vergleichsmöglichkeiten weitaus größer, auf über 30 Websites gibt es entweder für die gesamte USA oder für einzelne Bundesstaaten oder Regionen solche Qualitätsübersichten.
Eine jetzt in der Zeitschrift "Archives of Surgery" veröffentlichte Studie hat im Internet nach solchen Websites gesucht und schließlich sechs von ihnen nach bestimmten Kriterien ausgewählt: Sie mussten Kliniken für die gesamte USA bewerten, für alle potentiellen Nutzer verfügbar sein und Qualitätsindikatoren für chirurgische Eingriffe veröffentlichen. Eine Website wurde in staatlicher Regie betreiben, zwei von gemeinnützigen Einrichtungen, drei waren privatwirtschaftlich. Zur Bewertung der Portale wurden verschiedene Kriterien herangezogen:
• Zugangsmöglichkeiten (Bewertung nach den Aspekten: kostenlose oder kostenpflichtige Benutzung, Registrierungspflicht, Bekanntheitsgrad - festgelegt anhand der Position bei Google-Suchergebnissen)
• Transparenz (Bekanntmachung der Datenquellen, Offenlegung der statistischen Analyse-Methoden, Verwendung einer Risiko-Adjustierung, also Berücksichtigung der unterschiedlichen Vor- und Parallelerkrankungen von Patienten)
• Daten-Qualität (Spektrum der einbezogenen Daten, Berücksichtigung von Struktur-, Prozess- und Ergebnis-Indikatoren, Angabe auch eingriffs-spezifischer Indikatoren)
• Aktualität der Daten
Als Ergebnis zeigte sich dann, dass kein Klinikführer hinsichtlich aller Kriterien positiv eingestuft werden konnte. Bei den Zugangsmöglichkeiten und der Transparenz schnitten staatliche und gemeinnützige Portale am besten ab, dafür wiesen sie jedoch Schwächen bei der Datenqualität ab. Bei diesem Kriterium waren die privatwirtschaftlich geführten Angebote besser, weil sie umfangreichere und detailliertere Informationen bieten. Durchgängig ein Mangel war jedoch, dass bestimmte Ergebnisse (wie z.B. "Komplikationen") nicht nachvollziehbar und eindeutig erklärt waren. Überdies waren auch die meisten Daten älter als zwei Jahre.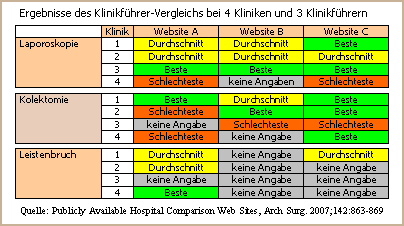
Um zu überprüfen, ob und in welchem Grad die Bewertungen der verschiedenen Klinikführer übereinstimmen, wurden dann vier verschiede Kliniken in Los Angeles ausgewählt und bei ihnen überprüft, inwieweit die Urteile für die Behandlungsqualität bei drei chirurgischen Eingriffen übereinstimmen: Laparoskopie (Bauchspiegelung mit Endoskop), Operation eines Leistenbruchs, Kolektomie (operative Entfernung des gesamten Dickdarms). Die Ergebnisse waren ernüchternd und zeigten ein hohes Maß an Inkonsistenz. Teilweise waren auch Daten nicht verfügbar, so dass nur unvollständige Vergleichsmöglichkeiten bestanden. Gravierender war jedoch noch das geringe Maß an Übereinstimmung: So zeigte sich etwa bei der Kolektomie (vgl. Abbildung), dass zwei der vier Krankenhäuser einige Male Bestnoten erhielten, parallel dazu aber auch überaus schlechte Bewertungen bekamen.
Die Studie ist hier im Volltext kostenlos verfügbar: Michael J. Leonardi u.a.: Publicly Available Hospital Comparison Web Sites (Arch Surg. 2007;142:863-869)
Eine in der Zeitschrift "Archives of Internal Medicine" kurz zuvor veröffentlichte Studie war im Prinzip zu ähnlichen Ergebnissen gekommen. Allerdings beschränkte sich die Aussagekraft dieser Studie auf nur eine Klinik-Rangliste (der US-Boulevard-Zeitschrift "U.S. News & World Report") und auf nur einen Indikator, nämlich die 30-Tages-Sterberate nach einem Herzinfarkt. Überprüft wurde dann anhand verfügbarer Daten, ob die in der Rangliste aufgeführten 50 besten Kliniken bei diesem Indikator tatsächlich besser abschnitten als 3.800 andere dort nicht aufgeführte Krankenhäuser. Als Ergebnis zeigte sich: 35 der 50 in der Hitliste aufgeführten besten Kliniken hatten überaus gute Ergebnisse hinsichtlich der 30-Tage-Sterblichkeit. Es gab aber auch 11 Kliniken mit einem durchschnittlichen und 2 Kliniken mit einem schlechten Ergebnis in der Bestenliste. Umgekehrt bedeutete dies: 28 Kliniken mit einem Spitzenresultat bei der Sterblichkeitsquote waren nicht in der Liste aufgeführt. Die Erklärung ist einfach: Die Zeitschrift "U.S. News & World Report" verwendete neben dem Sterblichkeits-Indikator auch noch andere Kriterien für ihre Einstufung, wie zum Beispiel Empfehlungen von Kardiologen.
Auch diese Studie ist kostenlos im Volltext nachzulesen Oliver J. Wang u.a.: "America's Best Hospitals" in the Treatment of Acute Myocardial Infarct (Arch Intern Med. 2007;167:1345-1351)
Bislang sind solch widersprüchliche und inkonsistente Ergebnisse zur Behandlungsqualität von Kliniken noch kein Problem für deutsche Patienten, die sich vorab über eine in Frage kommende Einrichtung informieren möchten. Es scheint jedoch absehbar, dass mit zunehmendem öffentlichen Interesse neben den bislang schon veröffentlichten Klinikführern von Krankenkassen und Ärzteverbänden sowie den Strukturierten Qualitätsberichten auch kommerzielle Internetseiten hier ein Geschäft wittern. Zwar verfügen sie nicht über die Originaldaten zur Behandlungsqualität. Es dürfte jedoch ein leichtes sein, diese Daten ein wenig benutzerfreundlicher aufzubereiten, individuelle Gewichtungsmöglichkeiten einzubauen und die Informationen womöglich auch zu ergänzen um Arztempfehlungen oder Patientenurteile. Es steht zu befürchten, dass dann die Unübersichtlichkeit hierzulande ähnliche Ausmaße annimmt wie jetzt schon in den USA zu beobachten ist.
Gerd Marstedt, 1.10.2007
Die Zahl der Internetportale mit Patienten-Urteilen über Ärzte wächst kontinuierlich
 Die Zahl der Internetportale, in denen Patienten öffentlich zugängliche Schulnoten für ihren Arzt abgeben, wächst zunehmend. Durchweg verantwortlich für diese Websites sind privatwirtschaftliche, kommerzielle GmbHs oder GbRs, wie die "vollgesund GmbH (in Kürze imedo GmbH)", "ArztData GmbH" oder die "Helpster GmbH", was zweierlei deutlich macht. Zum einen: Krankenkassen oder Ärzteverbände, denen man eigentlich die Aufgabe zuerkennt, mehr Transparenz herzustellen über die Qualität der medizinischen Versorgung bei niedergelassenen Ärzten, vertrauen Patienten-Urteilen noch nicht so recht. Zum anderen: Hier wittern Privatunternehmen wohl einen nicht unerheblichen Bedarf in der Bevölkerung und zumindest mittel- oder langfristig auch Renditechancen.
Die Zahl der Internetportale, in denen Patienten öffentlich zugängliche Schulnoten für ihren Arzt abgeben, wächst zunehmend. Durchweg verantwortlich für diese Websites sind privatwirtschaftliche, kommerzielle GmbHs oder GbRs, wie die "vollgesund GmbH (in Kürze imedo GmbH)", "ArztData GmbH" oder die "Helpster GmbH", was zweierlei deutlich macht. Zum einen: Krankenkassen oder Ärzteverbände, denen man eigentlich die Aufgabe zuerkennt, mehr Transparenz herzustellen über die Qualität der medizinischen Versorgung bei niedergelassenen Ärzten, vertrauen Patienten-Urteilen noch nicht so recht. Zum anderen: Hier wittern Privatunternehmen wohl einen nicht unerheblichen Bedarf in der Bevölkerung und zumindest mittel- oder langfristig auch Renditechancen.
Am Bewertungsportal "helpster.de" hat sich Anfang des Jahres der Medienkonzern Holtzbrinck (u.a.: Fischer- und Rowohlt-Verlag, Die Zeit, Handelsblatt) über seine Tochter "Elab" beteiligt und unlängst auch noch die Gesundheitsplattform Netdoktor.de erworben, das mit 1,3 Millionen Besuchern größte deutsche Gesundheitsportal - ein Hinweis, dass die Rubrik Gesundheits-Informationen inzwischen auch bei großen Konzernen Begehrlichkeiten weckt.
Tatsächlich ist der Bedarf von Patienten an Informationen über die fachliche Qualität von Ärzten und auch deren soziale Kompetenz überaus groß. Hier hat zuletzt etwa die Studie "Ratlose Patienten?" gezeigt, dass ein Großteil der Bevölkerung in einem Dilemma steht. Einerseits erkennen 46% sehr große Qualitätsunterschiede zwischen Ärzten, weitere 47% einige Unterschiede. Andererseits bewerten 72% das Informationsangebot über Ärzte als nicht ausreichend. (vgl. Informationsflut in Gesundheitsfragen überfordert Patienten) Daher verwundert es nicht, wenn die in der Befragung vorgegebenen Möglichkeiten einer detaillierteren Information über Ärzte allesamt auf großes Interesse stoßen. Ein Ärzte-Verzeichnis mit Tätigkeitsschwerpunkten und Spezialisierungen ("Dr. med. Mustermann, Spezialgebiete: Rückenbeschwerden, Raucherentwöhnung, Kopfschmerzen") würde von über 90 Prozent begrüßt, ein sogenannter "Ärzte-TÜV", der nach einer Qualitätsprüfung für begrenzte Zeit vergeben wird, von knapp 70 Prozent, Informationen von Ärzten selbst über ihre Tätigkeitsschwerpunkte (in Praxisprospekten, Zeitungen, den Gelben Seiten) von über 60 Prozent. Nachdenklich stimmen sollte allerdings, dass der Vorschlag "eine öffentlich zugängliche Kartei, in der Patienten ihr Urteil über eine Arztpraxis abgeben" mit 50% die allergeringste Resonanz findet. Wie es scheint, vertrauen Patienten einem von medizinischer Seite vergebenen Qualitätssiegel doch sehr viel mehr als der Urteilskraft und Erfahrungsbasis anderer Patienten, so dass der kommerzielle Erfolg der Patienten-Portale keineswegs absehbar ist.
Internetportale zur Arztbewertung scheren sich zunächst einmal nicht um diese Interessenprioritäten. Auf "Helpster" können Arztbesucher (neben einer freien Schilderung von persönlichen Eindrücken) zwei Aspekte mit jeweils 1-5 Sternen bewerten, die fachliche Qualität ("Wie beurteilen Sie subjektiv den Erfolg der Behandlung?") und die Gesamtzufriedenheit ("Wie zufrieden waren Sie mit der Betreuung in der Praxis insgesamt? z.B. Gründlichkeit, Freundlichkeit, Wartezeit, Sauberkeit, ..."). Imedo hat immerhin vier Bewertungskriterien (Terminverfügbarkeit, Pünktlichkeit, Zwischenmenschliches, Mitarbeiter) und Topmedic sogar fünf.
Wenn man Patienten durchaus zutrauen kann, dass sie einigermaßen objektiv Wartezeiten und Freundlichkeit der Mitarbeiter, Hygiene in der Praxis und auch noch soziale Kompetenzen des Arztes einschätzen können, so sind hier für die Bewertung der fachlichen Qualität und des Therapieerfolgs doch etliche Fragezeichen angebracht. Fachliche Kompetenz bedeutet für Patienten doch lediglich: Ich bin schnell wieder gesund geworden, meine Beschwerden sind besser geworden, es hat keine Komplikationen gegeben. Und hier meldet sich dann das Problem der sogenannten "Risiko-Adjustierung".
Schon bei Krankenhäusern, die eine erheblich größere Zahl von Patienten aufweisen als niedergelassene Ärzte, bereitet dies großes Kopfzerbrechen. Zu berücksichtigen ist ja, dass Patienten medizinischer Einrichtungen sich ganz erheblich voneinander unterscheiden können: Beim Lebensalter und Gesundheitszustand, im Hinblick auf Vorerkrankungen, Behinderungen und chronische Erkrankungen, die zusätzlich zum Behandlungsanlass bestehen. All dies kann jedoch ganz erheblichen Einfluss darauf haben, ob eine Therapie erfolgreich ist oder ob Komplikationen auftreten. Bei einer großen Zahl von Patienten mit ein und derselben Diagnose kann man diese unterschiedlichen Voraussetzungen auf statistischem Wege halbwegs kontrollieren. Was jedoch bei niedergelassenen Ärzten, die meist wenige Patienten mit einer Vielzahl von Diagnosen behandeln? Jede Arztpraxis in einem Wohngebiet mit vielen älteren und multimorbiden Patienten, wird daher auf den Portalen von helpster und imedo von vornherein schlechtere Karten haben. Und dies selbst dann noch, wenn für einen Arzt Hunderte von Bewertungen vorliegen und nicht wie derzeit überwiegend 1-2. Helpster, Topmedic & Co. können insofern im besten Fall einmal langfristig Auskunft geben über Wartezeiten und Freundlichkeit eines Arztes. Was Patienten nach vielen Umfragen am allermeisten interessiert, nämlich die fachliche Kompetenz und sein durch Weiterbildung erworbenes Wissen auch über neuere medizinische Erkenntnisse, bleibt jedoch im Verborgenen.
In vielen Pressemeldungen zu den neuen Portalen wird das Problem möglicher Manipulierbarkeit der Arztbewertungen angesprochen, und zwar die Manipulation durch tatsächliche oder scheinbare Patienten. Eine ganz andere Manipulations-Gefahr ist bislang kaum erkannt worden, nämlich die durch Ärzte. Aus den USA kommen bereits Berichte, dass Kliniken bestimmten "Risiko-Patienten" die Behandlung verweigern oder sie (medizinisch wohlbegründet) an andere Einrichtungen überweisen. Dies, um ihre positiven Statistiken und Bewertungen nicht zu beeinträchtigen. Denn bei älteren, multimorbiden Patienten bestehen immer höhere Risiken der Komplikation oder gar Mortalität - was sich negativ auswirkt auf die veröffentlichten Rankings. Es bedarf keiner großen Phantasie, um sich auszumalen, dass Ärzte bei unbequemen, "schwierigen" Patienten sehr schnell zum Überweisungsformular greifen, wenn Patientenbewertungen zukünftig tatsächlich einmal sehr viel mehr Resonanz finden sollten als derzeit.
Insofern scheint der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) angekündigte "Ärzte-TÜV" tatsächlich der sinnvollere Weg zu sein, der überdies auch Patienteninteressen stärker entgegen kommt. (vgl. KBV kündigt den "Ärzte-TÜV" für niedergelassene Haus- und Fachärzte an). Eingerichtet wurde eine Projektgruppe, die Qualitätsindikatoren für die Arbeit niedergelassener Ärzte in Deutschland ermitteln und sie in Pilotpraxen testen lassen soll, unter anderem auf Aussagekraft und Praktikabilität hin. Das Pilotprojekt soll auch internationale Erfahrungen berücksichtigen und auch eine Befragung von mehr als 200 Berufsverbänden, medizinischen Fachgesellschaften und Bundesverbänden der Patientenorganisationen ist vorgesehen. Offen gelassen wird in der KBV-Mitteilung "Die Qualität der Ärzte sichtbar machen" allerdings, ob die ermittelten Daten nur eine intern zu handhabende Kontrollfunktion bieten oder auch veröffentlicht werden sollen. Damit würde für kritische oder informationswillige Patienten die Möglichkeit bestehen, sich über das Abschneiden ihres Haus- oder Facharztes zu informieren oder bei der Arztsuche gezielter als bislang möglich vorzugehen.
Hier finden Sie die Arztbewertungs-Portale:
• Helpster
• Imedo
• früher "Patienten empfehlen Ärzte", übernommen von DocInsider
• Topmedic
Gerd Marstedt, 4.9.2007
Studie kritisiert "Strukturierte Qualitätsberichte" der Krankenhäuser: "Patienten rücken nicht in den Blickpunkt"
 Eine repräsentative Bevölkerungsumfrage des "Gesundheitsmonitor" der Bertelsmann-Stiftung hatte erst vor kurzem gezeigt, dass nur ein Bruchteil der Versicherten die Strukturierten Qualitätsberichte von Kliniken zur Kenntnis nimmt und zur Krankenhauswahl nutzt (vgl.: Qualitätsberichte deutscher Krankenhäuser und Qualitätsvergleiche von Einrichtungen des Gesundheitswesens aus Versichertensicht). Woran es liegt, dass Patienten die auch für sie veröffentlichten Berichte links liegen lassen, hat jetzt eine Studie des Kommunikationsunternehmens Kuhn, Kammann & Kuhn näher untersucht. Fazit der Studie: Krankenhäuser erfüllen lediglich den gesetzlichen Auftrag, nutzen die Chance des Marketing überhaupt nicht und rücken Patienten als potentielle Kunden medizinischer Dienstleistungen auch nicht näherungsweise in den Mittelpunkt.
Eine repräsentative Bevölkerungsumfrage des "Gesundheitsmonitor" der Bertelsmann-Stiftung hatte erst vor kurzem gezeigt, dass nur ein Bruchteil der Versicherten die Strukturierten Qualitätsberichte von Kliniken zur Kenntnis nimmt und zur Krankenhauswahl nutzt (vgl.: Qualitätsberichte deutscher Krankenhäuser und Qualitätsvergleiche von Einrichtungen des Gesundheitswesens aus Versichertensicht). Woran es liegt, dass Patienten die auch für sie veröffentlichten Berichte links liegen lassen, hat jetzt eine Studie des Kommunikationsunternehmens Kuhn, Kammann & Kuhn näher untersucht. Fazit der Studie: Krankenhäuser erfüllen lediglich den gesetzlichen Auftrag, nutzen die Chance des Marketing überhaupt nicht und rücken Patienten als potentielle Kunden medizinischer Dienstleistungen auch nicht näherungsweise in den Mittelpunkt.
84 Qualitätsberichte, die bis zum Stichtag am 31. Dezember 2006 veröffentlicht worden waren, wurden in der Studie unter den drei Aspekten Inhalt, Gestaltung und Sprache analysiert. Erkenntnisinteresse für die Autoren war es, "ob sich die Autoren der Qualitätsberichte an Patienten und potenziellen Patienten orientieren - sowohl bei der Darstellung ihres Leistungsspektrums als auch bei der Aufbereitung der Daten zur medizinischen Ergebnisqualität. Rücken dabei allgemeine Fragen nach Betreuung, Begleitung und Seelsorge oder Anfahrt und Parkplätzen in den Blickpunkt? Aus ärztlicher Sicht mögen derartige Informationen nicht entscheidend sein. Für Patienten und potenzielle Patienten sind sie es - und damit auch ein Qualitätsmerkmal."
Die Ergebnisse der Studie waren unter anderem:
• Für das Kriterium "Inhalte" der Berichte wird festgestellt: "Jeder Hotelprospekt liefert mehr Informationen als die Qualitätsberichte. Auf die Serviceangebote gehen die Krankenhäuser mit 39 Prozent unzureichend ein. Für die von uns fokussierte Zielgruppe sind Fakten jenseits des medizinischen Leistungsspektrums von großem Interesse. Ein Hinweis auf die Homepage genügt in diesem Zusammenhang nicht. Bei einem Vergleich von privaten, öffentlichen und gemeinnützigen Trägern fällt auf, dass private Krankenhäuser dem Service offenbar eine geringere Bedeutung beimessen. Das gilt auch für die Eigendarstellung."
• Ähnlich harsch fällt die Kritik aus, was die Gestaltung der Berichte anbetrifft. Insbesondere wird das Fehlen von Bildern und Informationsgrafiken bemängelt. Fotos und Illustrationen würden kaum oder gar nicht, Informationsgrafiken eher selten eingesetzt. "Inhaltliche Ideen sind mit den wenigen vorhandenen Bildern nicht verknüpft. Bei ihrer Verwendung lassen sich keine Konstanten erkennen. Bei weniger als einem Drittel der Einrichtungen wirken die ausgewählten Fotos glaubwürdig."
• Auch hinsichtlich der Sprache werden für die Autoren viele Mängel offenbar. Kritisiert wird, dass vielfach medizinische Fachbegriffe ohne Erläuterung verwendet werden. So entsteht der Eindruck, dass die Autoren der Qualitätsberichte ihre primäre Zielgruppe, nämlich Patienten und potenzielle Patienten, nicht im Blick haben. Zwar würde das Bemühen, komplexe medizinische Sachverhalte zu erklären, durchaus deutlich, doch gelänge es nicht, aus dem medizinisch-fachlichen Vokabular auszubrechen.
Das Fazit der Studienautoren geht dahin, dass die Berichtserstellung für die Kliniken nur eine lästige Pflichterfüllung darstellt und dass die Chancen des Marketing nicht erkannt wurden. Zentrale Adressaten jedenfalls, potentielle Patienten, werden als Zielgruppe der Publikationen nicht angesprochen. "Denn sie wissen nicht, was sie tun ... Aus Dienstzimmer und OP kommen die Autoren der Qualitätsberichte nicht heraus. Die Binnensicht dominiert, was nicht allein die ausgeprägte Verwendung von Fachbegriffen belegt. Anders als vom Gemeinsamen Bundesausschuss in §1 der Vereinbarung über Inhalt und Umfang des Qualitätsberichts formuliert, rücken Patienten und potenzielle Patienten nicht in den Blickpunkt. Vielmehr entsteht der Eindruck, mit den Qualitätsberichten sollten ausschließlich die gesetzlichen Anforderungen erfüllt werden. Die Potenziale des Qualitätsberichts im Sinne eines Kommunikationsinstruments wurden nicht erkannt. Das Ergebnis überrascht, denn Gegenstand unserer Untersuchung waren ausschließlich freiwillige Qualitätsberichte."
• Der Bericht ist im Internet auf mehreren HTML-Seiten veröffentlicht:
Kuhn, Kammann & Kuhn AG: Qualitätsberichte - Kommunikation für Krankenhäuser
• Hier findet man das Ranking der 84 einbezogenen Kliniken
Die Studie bestätigt damit, was auch schon andere Analysen als Merkmal von Patienten-Informationen festgestellt hatten, nämlich dass diese nach Prinzipien gestaltet sind, die Experten des Gesundheitswesens aus ihrer Perspektive für Patienten und Nutzer für wichtig erachten. Informationen sind mehr an der Outsiderperspektive (Experten, Mediziner, Wissenschaftler) als der Insiderperspektive (Patienten) orientiert - ein Mangel, der unter anderem daraus resultiert, dass Nutzer an der Gestaltung so gut wie nie beteiligt werden. vgl.: Bertelsmann Stiftung (Hrsg.): Bedarf an Patienteninformationen über das Krankenhaus - Eine Literaturanalyse erstellt von Prof. Dr. Doris Schaeffer
Gerd Marstedt, 29.8.2007
Neuer Klinikführer der Techniker Krankenkasse: Kassen-PR sehr gut, Patienteninformation mangelhaft
 Nachdem in den vergangenen Wochen und Monaten immer neue Wegweiser für Patienten zur Auswahl eines Krankenhauses auf den Markt gekommen waren, zog (nach der Handelskrankenkasse Bremen) nun die Techniker Krankenkasse (TK) mit einem im Internet verfügbaren bundesweiten Klinikführer nach und stellte das Projekt auf einer Pressekonferenz vor. Als Besonderheit wurde hervorgehoben, dass erstmals auch Urteile und Erfahrungen von Patienten veröffentlicht werden. Die PR-Aktion hat gewirkt. Schon am Abend hatten fast alle überregionalen Tageszeitungen und eine Vielzahl von Websites die Botschaft verkündet - meist leider ohne Prüfung der Substanz und teilweise auch noch mit falschen Daten.
Nachdem in den vergangenen Wochen und Monaten immer neue Wegweiser für Patienten zur Auswahl eines Krankenhauses auf den Markt gekommen waren, zog (nach der Handelskrankenkasse Bremen) nun die Techniker Krankenkasse (TK) mit einem im Internet verfügbaren bundesweiten Klinikführer nach und stellte das Projekt auf einer Pressekonferenz vor. Als Besonderheit wurde hervorgehoben, dass erstmals auch Urteile und Erfahrungen von Patienten veröffentlicht werden. Die PR-Aktion hat gewirkt. Schon am Abend hatten fast alle überregionalen Tageszeitungen und eine Vielzahl von Websites die Botschaft verkündet - meist leider ohne Prüfung der Substanz und teilweise auch noch mit falschen Daten.
So meldete etwa "BILD T-Online" mit der Schlagzeile Größte Umfrage zur Patienten-Zufriedenheit - Die 100 besten Kliniken: Für die Studie wurden Patienten in bundesweit 2000 Krankenhäusern nach ihren Erfahrungen während der Behandlung befragt." Leider falsch. Zwar werden Daten von gut 2000 Kliniken veröffentlicht, die von der TK in den Mittelpunkt gerückten Urteile von Patienten beziehen sich jedoch nur auf insgesamt 202 Krankenhäuser in 20 deutschen Großstädten. Ebenso falsch war die inhaltliche Botschaft in einer Vielzahl von Schlagzeilen, die suggerierten, der Klinikführer biete einen Überblick zur Behandlungsqualität der Kliniken. Hier hatte man in den Online- und Print-Redaktionen schlicht und ungeprüft die Schlagzeile der TK-Pressemitteilung paraphrasiert "Neuer Klinikführer bietet Qualitätsüberblick per Mausklick".
Auch im Text der Pressemitteilung wird angedeutet, dass der Krankenhaus-Wegweiser Indikatoren zur unterschiedlichen Behandlungsqualität öffentlich macht. Zitat: "Bei manchen Diagnosen wie Darmkrebs gibt es beträchtliche Unterschiede in der Qualität der Behandlung. Hier ist es für den Patienten sehr wichtig, das richtige Krankenhaus zu finden", so Straub. Mit dem Klinikführer sei es gelungen, einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Transparenz von Behandlungsqualität zu unternehmen." Was im TK-Klinikführer tatsächlich geboten wird, sind jedoch lediglich die in den (gesetzlich vorgeschriebenen "Strukturierten Qualitätsberichten") mitgeteilten Angaben, wie häufig eine bestimmte Diagnose oder Behandlung durchgeführt wurde.
Dieser Indikator ist jedoch methodisch überaus fragwürdig. Die Tatsache, dass eine Klinik A eine Operation 1.000 mal durchgeführt hat, belegt keineswegs eine bessere Behandlungsqualität im Vergleich zur Klinik B, die diesen Eingriff nur 300 mal vollzogen hat. Vgl. zur Kritik etwa den Artikel aus dem Deutschen Ärzteblatt: Jonitz, Günther; Klakow-Franck, Regina: Qualitätsberichte der Krankenhäuser: Information versus Marketing. Aufgrund dieser Einsicht werden zukünftig in den neuen Strukturierten Qualitätsberichten auf Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses neben der puren Mengenangabe auch erstmals Indikatoren zur Behandlungsqualität veröffentlicht, und zwar unter Einschluss einer Risikoadjustierung, also der statistischen Berücksichtigung der unterschiedlichen gesundheitlichen Verfassung von Patienten aufgrund von Begleiterkrankungen oder Lebensalter.
Und auch die als Neuerung der Klinikführers herausgestellte neue "Perspektive, die für Verbraucher hilfreich ist, nämlich die Erfahrungen anderer Patienten" offenbart bei näherer Betrachtung nicht unerhebliche Mängel. Vorgestellt wird ein allgemeines Urteil der Patientenzufriedenheit mit der Klinik. Die Problematik ist hier nur, dass Urteile über sämtliche Abteilungen eines Krankenhauses in einem Wert zusammenfließen. So wird denn auch bei der Ergebnisausgabe indirekt davor gewarnt, diese Information allzu ernst zu nehmen für die persönliche Suche: "Der angegebene Wert in der Spalte 'Patientenzufriedenheit' spiegelt ausschließlich das Befragungsergebnis für das Kriterium "Allgemeine Zufriedenheit mit dem Krankenhaus" wider. Er basiert auf persönlichen Eindrücken von TK-Patienten und berücksichtigt nicht eventuelle Unterschiede zwischen den Fachabteilungen. Der Wert eignet sich nicht zum Aufstellen einer Rangfolge." Dass es auch anders geht, hat der "Klinik-Führer Rhein-Ruhr" gezeigt, in dem Patientenurteile nicht nur gegliedert nach einzelnen Fachabteilungen aufgeführt werden, sondern zusätzlich auch noch nach einzelnen Kriterien (Zufriedenheit mit den Ärzten, mit der Pflege, mit dem Erfolg).
Auch handwerkliche Fehler muss man beim neuen TK-Angebot bemängeln. Wenn man die Mengenangabe "Zahl der durchgeführten Behandlungen" in einer Klinik als Qualitäts-Indikator ernst nimmt, so sollte der Wert für die verschiedenen in Frage kommenden Häuser sich auf die jeweilige, vom Patienten gesuchte Behandlung in der zuständigen Fachabteilung beziehen. In der Vergleichsübersicht zwischen verschiedenen Kliniken, taucht jedoch stattdessen der Wert "Stationäre Fälle gesamt" auf. Erst nach zwei weiteren Mausklicks wird dann der tatsächlich interessierende Indikator (Fallzahl für die gesuchte Behandlungsmethode oder Diagnose in der spezifischen Abteilung) präsentiert. Oder die Überforderung des Nutzers mit medizinischem Fachjargon: Wer nicht genau weiß, welche Operation bei ihm durchgeführt werden soll, bekommt ein Hilfsmenü, das noch mehr verwirren dürfte. So bietet die Suche nach "Prostata", um nur ein Beispiel zu nennen, als Optionen etwa an "Perkutan-zystoskopische Biopsie an Harnorganen und Prostata", "Transrektale und perkutane Destruktion von Prostatagewebe" oder auch "Inzision der Prostata".
Die TK war und ist in vielen Bereichen durchaus vorbildlich, wenn es darum ging, Patienteninteressen im Versorgungssystem zu vertreten - im Rahmen von Forschungsprojekten, Modellvorhaben oder Informationsmaterialien. So ist etwa der unlängst gestartete "virtuelle Patientendialog" als innovativer Ansatz überaus positiv hervorzuheben. Patienten können sich hier interaktiv und in individuellen Lernschritten über Rückenschmerzen oder auch den Nutzen einer Partizipativen Entscheidungsfindung in der Arztpraxis informieren. Der TK-Klinikführer jedoch ist in Anbetracht der zuletzt erschienenen regionalen Krankenhauswegweiser und des Vorhabens zur Neugestaltung der Strukturierten Qualitätsberichte eher ein Rückschritt: Viel PR für die Kasse, wenig Nutzen für Patienten und Versicherte.
• Hier ist das Online-Portal zum TK-Klinikführer
Hier ist der Methodenbericht zur Patientenbefragung: Qualitätstransparenz im Krankenhaus
Gerd Marstedt, 5.7.2007
Kritik an Klinikführern und Strukturierten Qualitätsberichten: Nutzer werden viel zu wenig beteiligt
 Seit 2003 sind Kliniken gesetzlich verpflichtet, regelmäßig sogenannte "strukturierte Qualitätsberichte" zu veröffentlichen. Kritiker erhoben den Vorwurf des "Etikettenschwindels", weil die ersten Berichte keinerlei Angaben zur Ergebnisqualität enthielten, im Unterschied etwa zu regionalen Krankenhausführern (Rhein-Ruhr, Berlin, Hamburg, Bremen), die für besonders häufig vorkommende medizinische Eingriffe solche Indikatoren veröffentlichten. Das soll nun anders werden. In einer Pressemitteilung vom 22. Juni 2007 kündigte der Gemeinsame Bundesausschuss an: "Die Qualitätsberichte der etwa 2000 deutschen Krankenhäuser werden in Zukunft auch Informationen darüber enthalten, mit welcher Qualität bestimmte Behandlungen in einzelnen Krankenhäusern vorgenommen wurden." (vgl. Behandlungsqualität in Krankenhäusern: Künftig mehr Transparenz für Patientinnen und Patienten).
Seit 2003 sind Kliniken gesetzlich verpflichtet, regelmäßig sogenannte "strukturierte Qualitätsberichte" zu veröffentlichen. Kritiker erhoben den Vorwurf des "Etikettenschwindels", weil die ersten Berichte keinerlei Angaben zur Ergebnisqualität enthielten, im Unterschied etwa zu regionalen Krankenhausführern (Rhein-Ruhr, Berlin, Hamburg, Bremen), die für besonders häufig vorkommende medizinische Eingriffe solche Indikatoren veröffentlichten. Das soll nun anders werden. In einer Pressemitteilung vom 22. Juni 2007 kündigte der Gemeinsame Bundesausschuss an: "Die Qualitätsberichte der etwa 2000 deutschen Krankenhäuser werden in Zukunft auch Informationen darüber enthalten, mit welcher Qualität bestimmte Behandlungen in einzelnen Krankenhäusern vorgenommen wurden." (vgl. Behandlungsqualität in Krankenhäusern: Künftig mehr Transparenz für Patientinnen und Patienten).
In einem Aufsatz für die Zeitschrift "Gesundheit und Gesellschaft (G+G)" widmet sich Bernard Braun nun der Thematik etwas grundsätzlicher und greift eine Reihe von Kritikpunkten auf, die von Wissenschaftlern, aber auch Einrichtungen im Gesundheitswesen gegenüber den bislang veröffentlichten Berichten vorgebracht wurden.
• So kritisierte etwa die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen die Überfrachtung der Texte mit medizinischem Fachjargon, der für Nutzer unverständlich bleibt: "Die Qualitätsberichte richten sich an Ärzte sowie Fachpersonal und an Patienten. Aufgrund der häufigen Verwendung von Fachbegriffen sind einzelne Passagen und Tabellen für medizinische Laien jedoch schwer verständlich." (vgl. Tipps für den Umgang mit Qualitätsberichten der Krankenhäuser)
• Problematisch erscheint dem Autor die alleinige Veröffentlichung der Berichte im Internet, denn "viele potenzielle Klinikpatienten sind Rentner und gehören der sozialen Unterschicht an. Da aber die Qualitätsberichte im Internet präsentiert werden, können die Informationen nur einen Teil der Zielgruppe erreichen. Der Gesundheitsmonitor der Bertelsmann Stiftung ergab, dass unter den über 60-Jährigen nur rund die Hälfte das Internet als Informationsquelle nutzt und von den Angehörigen der untersten Sozialschichten etwas mehr als 60 Prozent."
• Die bisherige Nutzung der Qualitätsberichte ist außerordentlich gering. Dies ist jedoch eher ein Effekt der mangelhaften Präsentation und kein Ausdruck fehlenden Interesses, denn es "sagen 86 Prozent der Befragten, sie wünschten vor einer Krankenhausbehandlung Informationen über die Klinik und 22 Prozent würden Vergleichslisten nutzen wollen."
• Unzureichend erscheint auch die uniforme Darbietung der Informationen, die unterstellt, dass eine einzige Berichtsform für Nutzer mit hohem und niedrigem Bildungsniveau, mit fehlenden oder relativ hohen medizinischen Vorkenntnissen gleichermaßen von Interesse ist: "Für ein Informationsangebot, das eine möglichst große Wirksamkeit erreichen will, muss man also beim Inhalt wie der Vermittlungsform wesentlich differenzierter vorgehen. Das 'Einer-für-alle'-Konzept der Qualitätsberichte könnte gerade Patienten mit hohem Informationsbedarf verfehlen."
• Kritisiert wird von Wissenschaftlern auch, dass die Nutzerperspektive bei der Erstellung der Berichte bislang weitgehend unberücksichtigt geblieben ist. Experten erarbeiten für Laien Informationen, die sie (die Experten) als nützlich erachten für potentielle Nutzer. Es fehlt an einer systematischen Beteiligung von Patienten und Versicherten und auch an einer Evaluation der schon vorgelegten Berichte, inwieweit diese den Bedürfnissen von Nutzern tatsächlich entsprechen.
Der komplette Aufsatz ist hier im Volltext (PDF-Datei) nachzulesen: Bernard Braun: Qualitätsberichte - Klartext für Klinikkunden?
(G+G, Ausgabe 5/07, 10. Jg, S. 24-30)
Gerd Marstedt, 2.7.2007
Qualitätsbewertungen und Ranglisten von Kliniken in den USA: Die große Unübersichtlichkeit
 Das Informationsangebot für Patienten über die Behandlungsqualität deutscher Kliniken ist noch eher bescheiden und regional begrenzt. Der "Klinik-Führer Rhein-Ruhr", veröffentlichte 2005 als erster Informationen, die deutlich hinausgingen über die in den "Strukturierten Qualitätsberichten" mitgeteilten Mengenangaben (Häufigkeit einzelner medizinischer Eingriffe) und Selbstdarstellungen: Qualitätsbewertungen auch unter Berücksichtigung der jeweiligen Patienten-Morbidität, Zufriedenheitsurteile von Patienten, Empfehlungen von Ärzten. Mittlerweile gibt es in drei norddeutschen Großstädten Klinikführer, die mit ähnlichen Qualitätsindikatoren arbeiten und teilweise als Broschüre verfügbar sind (Bremer Klinikführer), teilweise ihre Infos im Internet veröffentlicht haben (Hamburger Krankenhausspiegel, Der große Berliner Klinikvergleich).
Das Informationsangebot für Patienten über die Behandlungsqualität deutscher Kliniken ist noch eher bescheiden und regional begrenzt. Der "Klinik-Führer Rhein-Ruhr", veröffentlichte 2005 als erster Informationen, die deutlich hinausgingen über die in den "Strukturierten Qualitätsberichten" mitgeteilten Mengenangaben (Häufigkeit einzelner medizinischer Eingriffe) und Selbstdarstellungen: Qualitätsbewertungen auch unter Berücksichtigung der jeweiligen Patienten-Morbidität, Zufriedenheitsurteile von Patienten, Empfehlungen von Ärzten. Mittlerweile gibt es in drei norddeutschen Großstädten Klinikführer, die mit ähnlichen Qualitätsindikatoren arbeiten und teilweise als Broschüre verfügbar sind (Bremer Klinikführer), teilweise ihre Infos im Internet veröffentlicht haben (Hamburger Krankenhausspiegel, Der große Berliner Klinikvergleich).
Das Informationsangebot für deutsche Kliniken ist nicht nur in regionaler Hinsicht eher begrenzt, auch die Zahl der bewerten medizinischen Eingriffe ist noch sehr überschaubar. Berlin bewertet in diesem Jahr zehn verschiedene Interventionen (von Geburtshilfe bis Implantation vob Herzschrittmachern), in Bremen sind es neun, die insgesamt etwa 15 Prozent aller Krankenhaus-Eingriffe umfassen. Wirft man einen Blick über den großen Teich in die USA, wo solche Qualitäts-Berichte und Rankings schon zwei Jahrzehnte, etwa seit Mitte der 80er Jahre gebräuchlich sind, so entsteht allerdings nicht unbedingt Neid. Wo hierzulande spärliches Informationswachstum zu beobachten ist, wuchert drüben die große Unübersichtlichkeit.
In einem Artikel in der Washington Post macht sich jetzt - nicht zum ersten Mal - ein renommierter Journalist Gedanken zum Informationsangebot, das aus seiner Sicht immer stärker zum Informationsproblem wird. Mit leicht ironischem Unterton nimmt er sich der verschiedenen Ranglisten für US-Kliniken an, "die jene Konkurrenz-Jagd an die Spitze verursachen, von denen gesundheitspolitische Reformer seit Jahrzehnten träumen." Zwar wird anerkannt, dass die Veröffentlichung der Ranglisten mit Angaben zu Spitzenpositionen und Ferner-Liefen-Ergebnissen wichtig sind, um Qualität und Kosten der Gesundheitsversorgung zu verbessern. Das große Problem sind jedoch nach Ansicht von Steven Pearlstein die überaus verwirrenden Unterschiede zwischen verschiedenen Ranglisten und Bewertungssystemen, von denen es in den USA eine große Zahl gibt. "Eine Klinik", so schreibt er, "schneidet in einer Rangliste hervorragend ab. Schaut man sich jedoch eine andere an,. dann sieht das Urteil unter Umständen schon wieder völlig anders aus."
Der Artikel ist hier nachzulesen: Steven Pearlstein: Hospitals Check Their Charts - Rankings Push Them to Improve Care (Washington Post, Friday, April 20, 2007; Page D01)
Eine Kurzfassung findet man hier bei der Kaiser Family Foundation: Hospital Quality Rankings Lead Hospitals To Improve Care, But Can Be 'Baffling,' Columnist Writes (KFF Daily Health Policy Report, Apr 20, 2007)
Tatsächlich ist das Angebot der teilweise von Privatfirmen, teils aber auch von staatlicher Seite erarbeiteten und im Internet veröffentlichten Klinikführer überbordend. Nur für einzelne Bundesstaaten wie z.B. Ohio findet man im WWW etwa ein Dutzend Ranglisten und Bewertungen für Ohio-Krankenhäuser. Unterschiedlich sind die Bewertungssysteme, die teilweise für Kliniken Punktzahlen liefern und diese in Top-50 oder Top-100 Ranglisten veröffentlichen, teilweise aber auch nur eine Zusammenfassung aller Datenauswertungen in einem System mit 1-5 Sternen liefern. Auch die den Bewertungen zugrunde liegenden Daten und Indikatoren zeigen deutliche Abweichungen. Verwendung finden zwar fast durchgängig offizielle Statistiken über Todesfälle, darüber hinaus sind die herangezogenen Indikatoren wie Komplikationen, Behandlungsfehler, Infektionen oder telefonisch ermittelte Bewertungen von Ärzten jedoch höchst verschieden.
Die vier größten Bewertungssysteme mit Informationsangeboten für Kliniken in allen US-Bundesstaaten sind:
• Health Grades, ein privates Forschungsunternehmen, das eine größere Zahl von Indikatoren zur Behandlungsqualität und Patientensicherheit verwendet - unter Berücksichtigung der jeweiligen Patienten-Vorerkrankungen. Diese Basisinformationen sind kostenlos, zusätzliche Informationen (wie Klinik-Service, Daten zur Patientensicherheit, Behandlungskosten) kosten allerdings 17.95 $. Daten sind für insgesamt 28 Diagnosen und Eingriffe verfügbar. Veröffentlicht wird ein zusammenfassendes Gesamturteil, das von 1 Stern bis zu 5 Sternen reicht.
• Solucient ist ebenfalls ein privates Unternehmen im Bereich medizinischer Informationsleistungen. Es veröffentlicht jährlich eine Liste "100 Top Hospitals: Benchmarks for Success." Für die Rangordnung berücksichtigt werden nicht nur Daten zur Behandlungsqualität, sondern auch Behandlungskosten pro Fall und Kostenentwicklungen. Die Kliniken werden nach ihren medizinischen Schwerpunkten und Aufgabenbereichen aufgegliedert. Die Grundinformationen sind für Patienten kostenlos. Für detaillierte Berichte mit einzelnen Benchmark-Daten verlangt die Firma allerdings 125-150 $.
• U.S. News ist eine auch im WWW präsente Zeitung, die jährlich eine Rangliste der besten (25-50) Kliniken veröffentlicht, aufgegliedert nach Fachrichtungen (Krebs, Psychiatrie usw.). Verwendung finden dabei unterschiedliche Kriterien wie Mortalitätsraten, Pflegequalität oder technische Ausstattung. Darüber hinaus werden auch Ergebnisse einer schriftlichen Umfrage bei rund 3.000 medizinischen Spezialisten berücksichtigt. Die Listen sind kostenlos zugänglich.
• Hospital Compare ist das staatliche Informationssystem des Department of Health and Human Services. Es ist sehr viel differenzierter hinsichtlich der Veröffentlichung einzelner Indikatoren für ausgewählte Kliniken, für Patienten deshalb aber auch schwieriger in den Ergebnissen zu bewerten. So sind für das Krankheitsbild "Herzattacke" beispielsweise rund zwei Dutzend Indikatoren auswählbar , angefangen vom Prozentsatz der Patienten, denen bei der Ankunft Aspirin gegeben wurde bis hin zum Prozentsatz derjenigen, die eine Beratung zur Raucherentwöhnung erhielten. Für alle angeklickten Indikatoren und für die ausgewählten Krankenhäuser werden sodann die Daten tabellarisch dargestellt. Für viele Patienten ist hier dann wohl eine Überforderungsgrenze erreicht: Wie sollen diese zum Teil widersprüchlichen Informationen gewichtet und zu einem Gesamturteil zusammengefasst werden? Viele werden dann wohl wieder zum einfacheren, wenngleich intransparenten 1-5-Sterne-Testurteil einer anderen Website gehen.
Die in Deutschland zukünftig zu aktualisierenden oder auch regional ganz neu erscheinenden Klinikführer dürften alsbald vor einem ähnlichen Problem stehen. Welchen Weg sollen sie beschreiten: Ein für Laien einfach zu handhabendes, aber höchst intransparentes 1-5-Sterne-System, Top-10-Ranglisten für Städte oder Kreise oder auch Testurteile, wie sie die Stiftung Warentest vergibt? Ein System also, das für unterschiedliche Interessen und Kriterien (Behandlungsqualität, Service und Komfort, Nähe zur Wohnung und zu Verwandten, Patientenzufriedenheit, Arztbewertungen) oft allzu pauschal gerät? Oder doch differenzierte Tabellen mit Daten zu einer Vielzahl einzelner Indikatoren, die aber womöglich für viele eine Überforderung darstellen? Eine einfache Antwort fällt schwer. Zu bedauern ist allerdings, dass bislang keine Forschungsstudien begonnen wurden oder in Planung sind, die hierzu einmal unterschiedliche Nutzergruppen, deren Interessen und Umgangsweisen mit den schon vorhandenen Klinikführern näher analysieren. Es scheint wieder mal so zu sein, dass Informationen für Patienten auf den Markt gebracht werden, aber in paternalistischer Manier hoch über ihre Köpfe hinweg.
Gerd Marstedt, 24.4.2007
Hamburger Klinik-Daten zur Versorgungsqualität: Für Patienten mehr Verwirrspiel als Entscheidungshilfe
 Nachdem im vergangenen Jahr erstmals mit dem "Klinik-Führer Rhein-Ruhr" Krankenhäuser einer Region Daten zu ihrer Versorgungsqualität in Buchform veröffentlicht haben, ist jetzt der "Hamburger Krankenhausspiegel" nachgezogen und hat im Internet wichtige Informationen für Patienten zur Auswahl eines Krankenhauses in Hamburg veröffentlicht. Es werden Indikatoren für vier besonders häufig vorkommende medizinische Eingriffe veröffentlicht: Gallenblasenoperationen, Einsatz eines künstlichen Hüftgelenks, Brustkrebsoperationen und Herzkatheter-Untersuchungen. Schon in Kürze sollen jedoch weitere Klinikeingriffe dokumentiert werden (Herzschrittmacher, künstliche Kniegelenke, Operationen an der Halsschlagader, Brüche des Schenkelhalses und Geburtshilfe), so dass dann Informationen zu den neun häufigsten Krankenhaus-Operationen und Untersuchungen vorliegen.
Nachdem im vergangenen Jahr erstmals mit dem "Klinik-Führer Rhein-Ruhr" Krankenhäuser einer Region Daten zu ihrer Versorgungsqualität in Buchform veröffentlicht haben, ist jetzt der "Hamburger Krankenhausspiegel" nachgezogen und hat im Internet wichtige Informationen für Patienten zur Auswahl eines Krankenhauses in Hamburg veröffentlicht. Es werden Indikatoren für vier besonders häufig vorkommende medizinische Eingriffe veröffentlicht: Gallenblasenoperationen, Einsatz eines künstlichen Hüftgelenks, Brustkrebsoperationen und Herzkatheter-Untersuchungen. Schon in Kürze sollen jedoch weitere Klinikeingriffe dokumentiert werden (Herzschrittmacher, künstliche Kniegelenke, Operationen an der Halsschlagader, Brüche des Schenkelhalses und Geburtshilfe), so dass dann Informationen zu den neun häufigsten Krankenhaus-Operationen und Untersuchungen vorliegen.
An dem Projekt beteiligt sind insgesamt 19 Kliniken, die fast die komplette stationäre Krankenversorgung (90%) der Hansestadt abdecken. Projektpartner sind neben der Techniker Krankenkasse die Ärztekammer Hamburg und die Verbraucherzentrale Hamburg. Im Internet für jedermann abrufbar sind nun neben der Zahl der durchgeführten Eingriffe auch verschiedene Indikatoren der Versorgungsqualität, und dies im direkten Vergleich der einzelnen Krankenhäuser. So werden beispielsweise für Brustkrebsoperationen Daten zu insgesamt 10 Qualitätsindikatoren genannt, unter anderem: Treffsicherheit bei der (teilweise gesundheitsriskanten) Entnahme von Gewebeproben, Einhaltung des Sicherheitsabstands zu gesundem Gewebe, Quote der durchgeführten brust-erhaltenden statt brust-entfernenden OPs oder Einhaltung einer angemessenen, nicht zu kurzen und nicht zu langen Bedenkzeit (5-16 Tage) zwischen Diagnose und Operation.
Vergleicht man die Informationen im "Hamburger Krankenhaus-Spiegel" mit den inhaltlich dürftigen, wenngleich mit Zahlen und Worten ungeheuer aufgeblähten, für Patienten unübersichtlichen und oft unverständlichen Darstellungen der "Strukturierten Qualitätsberichte" der Krankenhäuser, die seit dem vergangenen Jahr für Krankenhäuser verpflichtend sind, so sind tatsächlich einige Fortschritte erkennbar. Es werden nicht Angaben zur zu Betten-, Personal- und Fallzahlen, zur apparativen und therapeutischen Ausstattung gemacht, sondern es wird der für Patienten zentrale Aspekt behandelt: Arbeitet das Krankenhaus in hochwertiger Qualität, so dass der medizinische Eingriff mit hoher Wahrscheinlichkeit auch zu einer Besserung meiner Beschwerden führt?
Allerdings sind die Fortschritte bei näherer Betrachtung dann doch eher bescheiden. Auch für den Hamburger Krankenhausspiegel ist jene Kritik zutreffend, die unlängst in einer Expertise für die Bertelsmann Stiftung "Bedarf an Patienteninformationen über das Krankenhaus - Eine Literaturanalyse erstellt von Prof. Dr. Doris Schaeffer" formuliert wurde: Patienteninformationen sind bislang nach Prinzipien gestaltet, die Experten des Gesundheitswesens aus ihrer wissenschaftlichen Perspektive für Patienten und Nutzer für wichtig erachten, sind also mehr an der Outsiderperspektive (Experten, Mediziner, Wissenschaftler) als der Insiderperspektive (Patienten) orientiert.
Deutlich wird dies beim Hamburger Krankenhausspiegel etwa an folgenden Merkmalen,
• Gleich auf der Startseite wird die Aussagekraft der Informationen relativiert und in Frage gestellt. So heißt es dort: "Ein auffälliges Ergebnis in einem Bereich für eine Klinik muss nicht zwangsläufig heißen, dass dort die Behandlungsqualität schlecht ist. Denn einige Kliniken haben sich auf besonders komplizierte Fälle spezialisiert." Und unmittelbar darauf werden "Dokumentationsprobleme" als mögliche Ursachen des schlechten Abschneidens erwähnt oder auch "schicksalhafte Ereignisse, die zu auffälligen Ergebnissen führen können." So mancher Nutzer wird sich daher gleich zu Beginn fragen, wozu er sich die Mühe des Lesens machen soll, wenn die Daten nur eine äußerst begrenzte Aussagekraft für die Behandlungsqualität haben.
• Patienten werden durch Zahlen verwirrt, die auf hohe Qualitätsunterschiede deuten, dann aber als nicht aussagekräftig interpretiert werden. So heißt es beispielsweise: "Der Zweck des künstlichen Hüftgelenks besteht darin, die Hüfte wieder beweglich und belastbar zu machen, ohne dass Schmerzen auftreten. (...) Gute Behandlungsqualität liegt vor, wenn viele Patienten die oben genannte Beweglichkeit erreichen." Es folgt dann ein Diagramm, das auf massive Qualitätsunterschiede deutet, da die 19 Kliniken zwischen 1.1% und 98.6% Beweglichkeit erreichen. Dann folgt jedoch der Hinweis: "Das unabhängige Kontrollgremium hat hier Probleme mit der Dokumentation festgestellt, weil einige Kliniken die Beweglichkeit noch nicht regelmäßig bestimmen."
• Die Daten sollten unterschiedliche Risikofaktoren der behandelten Patienten berücksichtigen (sog. "Risikoadjustierung"), sind es aber nicht oder nur teilweise. Dadurch bleibt bei Patienten völlige Unsicherheit zurück, ob das schlechte Abschneiden der von ihm ins Augen gefassten Klinik nun qualitätsbedingt ist oder nicht. So zeigt sich für das Merkmal "Allgemeine Komplikationen" beim Eingriff Hüftgelenksersatz: "Im Schnitt liegen die Hamburger Krankenhäuser bei der Häufigkeit solcher Komplikationen mit 5,9 Prozent deutlich unter der Obergrenze des Referenzbereichs von 14,6 Prozent. Sie sind aber um einen Prozentpunkt schlechter als der Bundesdurchschnitt. Die Ergebnisse der einzelnen Krankenhäuser unterscheiden sich zum Teil stark voneinander. Das liegt zum einen daran, dass manche Krankenhäuser von besonders vielen alten und kranken Patienten aufgesucht werden. Zum anderen werden weniger schwere Komplikationen von den Kliniken möglicherweise unterschiedlich streng dokumentiert."
• Bei den vier vorgestellten Eingriffen werden jeweils 8-14 unterschiedliche Indikatoren aufgeführt, hinzu kommt eine Angabe zur Zahl durchgeführter OPs. Wie soll ein Laie hieraus einen Gesamtwert bilden, zu welchem Urteil kommt ein Patient, wenn seine Klinik einige Male besser, dann aber wieder schlechter abschneidet als der Durchschnitt? Die (zugegeben schwierige) Aufgabe einer Gewichtung von Einzelmerkmalen der Versorgungsqualität zu einem Gesamturteil wird Laien aufgebürdet, die dazu absolut nicht in der Lage sind.
Unter dem Strich stellt der Hamburger Krankenhausspiegel damit für Patienten eher ein Verwirrspiel dar als eine echte Entscheidungshilfe. Man darf gespannt sein, ob bei der in Berlin geplanten neuen Ausgabe des Klinikführers Der große Berliner Klinikvergleich, bei dem auch Urteilen von Ärzten und Patienten mitgeteilt werden sollen, im Sommer 2007 diese Fehler vermieden werden.
Die in den verschiedenen Klinikführern verwendeten Daten zur Versorgungsqualität müssen in Kliniken routinemäßig dokumentiert werden und werden dann seit einigen Jahren von der Bundesgeschäftsstelle Qualitätssicherung (BQS) ausgewertet. Die Qualitätsberichte der BQS werden veröffentlicht, allerdings anonymisiert, ohne Nennung der Klinik-Namen. Nur die Kliniken selbst erhalten ihre Leistungs- und Qualitäts-Daten. In den Qualitätsberichten der BQS und auch im Hamburger Krankenhausspiegel werden die angegebenen Daten teilweise einer sog. "Risikoadjustierung" unterzogen, d.h. es werden Risikofaktoren wie z.B. Gesundheitszustand und Vorerkrankungen von Patienten mitberücksichtigt, so dass eine Klinik, die besonders viele ältere Patienten mit weiteren Erkrankungen behandelt, nicht von vornherein schlechter abschneidet. Bei auffälligen Häufungen von Problemen und möglichen Qualitätsmängeln findet im Rahmen eines "strukturierten Dialogs" zwischen Klinik und Experten eine Klärung statt, worauf die festgestellten Abweichungen von Qualitätsstandards beruhen könnten (Mängel in der Dokumentation, Besonderheiten der behandelten Patienten usw.)
Gerd Marstedt, 26.2.2007
Der Informationsbedarf von Patienten zur Auswahl eines Arztes oder Krankenhauses ist groß, das Angebot jedoch mangelhaft
 Seit September 2005 können sich Versicherte und Patienten im Internet strukturierte Qualitätsberichte über Krankenhäuser anschauen. Dass diese Berichte noch erhebliche Mängel aufweisen und wenig benutzerfreundlich sind, wurde vielfach kritisiert, so dass auch der Gemeinsame Bundesausschuss (GBA) unlängst beschlossen hat, die Berichte ab dem Jahr 2007 übersichtlicher und für Patienten noch verständlicher zu gestalten. Drei Studien im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung haben das vorliegende Informationsangebot jetzt näher analysiert und auch Empfehlungen zur zukünftigen Gestaltung formuliert. Das Fazit der im Rahmen des Projekts "Patienten unabhängig informieren" durchgeführten Studien heißt: Es gibt einen großen Bedarf an solchen Informationen und zugleich massive Defizite beim aktuellen Angebot.
Seit September 2005 können sich Versicherte und Patienten im Internet strukturierte Qualitätsberichte über Krankenhäuser anschauen. Dass diese Berichte noch erhebliche Mängel aufweisen und wenig benutzerfreundlich sind, wurde vielfach kritisiert, so dass auch der Gemeinsame Bundesausschuss (GBA) unlängst beschlossen hat, die Berichte ab dem Jahr 2007 übersichtlicher und für Patienten noch verständlicher zu gestalten. Drei Studien im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung haben das vorliegende Informationsangebot jetzt näher analysiert und auch Empfehlungen zur zukünftigen Gestaltung formuliert. Das Fazit der im Rahmen des Projekts "Patienten unabhängig informieren" durchgeführten Studien heißt: Es gibt einen großen Bedarf an solchen Informationen und zugleich massive Defizite beim aktuellen Angebot.
"Was wollen Patienten wissen, wenn sie sich über Krankenhäuser oder andere Versorgungseinrichtungen informieren möchten? (...) Bei wem informieren sie sich, und wie muss die Information beschaffen sein?" Diesen Fragen geht Doris Schaeffer im Rahmen einer sehr detaillierten Literaturstudie nach. Ein wesentlicher Befund ihrer Analyse ist, dass trotz der Vielzahl der in den letzten Jahren entstandenen neuen Informationsmöglichkeiten (Callcenter von Krankenkassen, Patientenberatungsstellen, Internetwegweiser) Patienten nach wie vor herkömmliche Quellen und Medien nutzen: Vorrangig wenden sie sich an den behandelnden (Haus-) Arzt oder Familienangehörige, Freunde oder Bekannte, weil ihnen andere Informationsquellen nicht bekannt sind oder auch, weil sie ihnen nicht vertrauenswürdig genug erscheinen. Ein Grund für diese mangelnde Vertrauenswürdigkeit und Glaubwürdigkeit ist, dass neue Quellen und Medien eher als verwirrend, denn als hilfreich empfunden werden. Als Fazit daraus wird empfohlen, die Konzipierung und Erstellung von Patienteninformation gemeinsam mit Patienten und Nutzern zu erstellen, zumindest aber sie begleitend und evaluativ in den Prozess einzubeziehen, um nicht unversehens an den aus ihrer Perspektive wichtigen Belangen vorbeizuagieren.
Als besonderen Mangel der derzeit angebotenen Informationen erkennt Schaeffer, dass diese nach Prinzipien gestaltet sind, die Experten des Gesundheitswesens aus ihrer Perspektive für Patienten und Nutzer für wichtig erachten. Informationen sind also mehr an der Outsiderperspektive (Experten, Mediziner, Wissenschaftler) als der Insiderperspektive (Patienten) orientiert. Damit Informationen von Patienten auch genutzt werden, nennt die Wissenschaftlerin eine Reihe von Kriterien. So sollten die Informationen leicht zugänglich sein, übersichtlich sein und Detailfülle vermeiden, grafisch einleuchtend dargestellt sein, nicht zu hohe kognitive Anforderungen stellen, (sprachlich) verständlich sein, nicht nur Sach- und Leistungsinformation, sondern auch (narrative) Erfahrungsberichte enthalten und nicht zuletzt zielgruppenspezifisch ausgerichtet sein. Letzteres, so wird hervorgehoben, "ist ein nicht in seiner Bedeutung zu unterschätzender Hinweis, der vor allem dann von Belang ist, wenn Zielgruppen erreicht werden sollen, die Patienteninformationsangeboten - im Internet - bislang eher mit Vorbehalten begegnen. Dazu gehören u. a. auch alte und hochbetagte Menschen, die zugleich die Mehrheit der Patienten im Krankenhaus ausmachen. Wie auch andere bislang schwer erreichbare Zielgruppen (z. B. Migranten) benötigen sie Informationsangebote, die auf ihre besondere lebensweltliche Situation zugeschnitten sind und ihren Rezeptionsgewohnheiten folgen."
• Hier ist die Studie zum Download: Bertelsmann Stiftung (Hrsg.): Bedarf an Patienteninformationen über das Krankenhaus - Eine Literaturanalyse erstellt von Prof. Dr. Doris Schaeffer
In einer zweiten Studie im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung hat das Picker-Institut Deutschland im Rahmen von Gruppendiskussionen mit Patienten untersucht, welche Informationen Patienten benötigen, um sich für einen Leistungserbringer (Klinik, Hausarzt, ambulanter Pflegedienst, Reha-Klinik) zu entscheiden und wie groß der objektive Bedarf an Informationen zur Ergebnisqualität von Leistungserbringern ist. Als zentrales Ergebnis zeigt sich, dass für alle vier Situationen derzeit erhebliche Defizite im Informationsangebot feststellbar sind: "Alle Entscheidungsprozesse für die vier untersuchten Leistungserbringer sind durch hohen Informationsmangel geprägt." Allerdings fällt der Informationsbedarf je nach Leistungserbringer recht unterschiedlich aus. Für die Suche nach einem Hausarzt ist dieser Bedarf eher niedrig, da "keine hohen Erwartungen an Hausärzte bestehen. Hausärzte werden als 'Durchgangsärzte' gesehen und gelten als austauschbar." Auf der anderen Seite zeigt sich, dass das Informationsbedürfnis bei der Entscheidung für ein Krankenhaus sehr hoch ist. Denn diese Situation ist sehr stark durch Ängste und Befürchtungen geprägt, da die Krankheit bzw. der Verlauf und der Ausgang einer evtl. erforderlichen Operation Unsicherheit mit sich bringen.
• Hier ist der Bericht: Picker Institut Deutschland: Qualitative Evaluation von patienten- und bedarfsgerechten Informationen über Gesundheitseinrichtungen - Ergebnisbericht
In einer weiteren Studie schließlich (veröffentlicht im "Gesundheitsmonitor 2006") geht Prof. Max Geraedts anhand von Ergebnissen einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage des "Gesundheitsmonitor" der Frage nach, ob Versicherte und Patienten die im Internet vorliegenden Qualitätsberichte überhaupt nutzen, ob die gebotenen Informationen ihren Interessen entsprechen oder ob möglicherweise ganz andere Informationen notwendig wären. Als Ergebnis zeigt sich, dass nur ein Bruchteil der Versicherten die Qualitätsberichte im ersten Halbjahr nach der Veröffentlichung kennengelernt hat und dass diese Berichte nur von einer verschwindend geringen Anzahl von Personen zur Krankenhauswahl genutzt wurden. Trotz dieser bislang geringen Resonanz zeigt sich jedoch auch, dass fast alle Versicherten sich mehr Informationen über die Qualität der Versorgung von Gesundheitseinrichtungen und medizinischen Leistungsanbietern wünschen. Darauf aufbauende Vergleiche von Gesundheitseinrichtungen, so empfiehlt Geraedts, sollten vor allem von Institutionen des Verbraucherschutzes oder der Selbsthilfe durchgeführt werden, die im Allgemeinen als unabhängig gelten.
• Hier finden Sie den Aufsatz: Max Geraedts: Qualitätsberichte deutscher Krankenhäuser und Qualitätsvergleiche von Einrichtungen des Gesundheitswesens aus Versichertensicht
Gerd Marstedt, 9.2.2007
Patienteninformation über Krankenhausqualität auch in den USA nicht problemlos
 Wer mit der Qualität der so genannten Qualitätsberichte der deutschen Krankenhäuser nicht zufrieden ist, also beispielsweise umfassende, leicht zugängliche, verständliche und zuverlässige Informationen über die Struktur-, Prozess- und vor allem die Ergebnisqualität vermisst, wird auch in den USA nicht befriedigende Verhältnisse oder gar uneingeschränkte Vorbilder finden.
Wer mit der Qualität der so genannten Qualitätsberichte der deutschen Krankenhäuser nicht zufrieden ist, also beispielsweise umfassende, leicht zugängliche, verständliche und zuverlässige Informationen über die Struktur-, Prozess- und vor allem die Ergebnisqualität vermisst, wird auch in den USA nicht befriedigende Verhältnisse oder gar uneingeschränkte Vorbilder finden.
Zwar sind Daten über die Angebotspalette, den Zugang zu, die Versorgungsqualität und die Kosten einer Behandlung mittlerweile für nahezu alle Krankenhäuser in den USA im Internet erreichbar, aber der Gebrauch kann nach aktuellen Berichten für viele Nutzer schwierig sein und viele Informationen machten keinen Sinn.
Dies gilt ausdrücklich auch für die vom Regierungs-Departement of Health and Human Services angebotene bundesweite Krankenhausvergleichs-Datenbank ""Hospitalcompare". Die Bundesdatenbank wird durch Länderdatenbanken wie die von Florida ("Floridacomparecare") ergänzt, die bereits seit November 2005 als erste in den USA Infektionsraten und Sterblichkeitsraten der Krankenhäuser und seit Juni 2006 auch Qualitätsdaten zur Versorgung von Kindern veröffentlicht.
Die Kritik an der US-Krankenhausinformation fasst ein Vertreter des Center for Practical Health Reform so zusammen: "It's still a tower of Babel out there. We're getting data. We're not getting information. Information is data made understandable." Auf das Problem, dass viele der Qualitätsdaten aus Abrechnungsbelegen der Krankenhäuser entnommen werden und die Reliabilität der Daten dadurch zweifelhaft ist, weisen andere Kritiker hin.
Híer finden Sie einige weitere aktuelle Einblicke in die kritische Debatte über Krankenhausqualitätssysteme in den USA.
Bernard Braun, 28.11.2006
Wegweiser durch das Gesundheitssystem für Migranten
 In Deutschland verfügt mittlerweile jeder achte Einwohner über einen Migrationshintergrund. Trotzdem haben Migranten noch immer erheblich schlechtere Gesundheitschancen als die übrige Bevölkerung. Die notwendige Orientierung im Alltag eines fremden Landes lässt die Vorsorge für die eigene Gesundheit oft in den Hintergrund rücken. Hinzu kommen nicht selten kulturelle Barrieren, so dass Ärzte zu spät oder gar nicht aufgesucht werden. Aus diesem Grund haben der BKK-Bundesverband und das Ethno-Medizinische Zentrum Hannover jetzt einen Gesundheitswegweiser für Migranten vorgelegt. Die Broschüre erscheint zunächst auf Deutsch, Türkisch, Russisch, Serbisch, Kroatisch, Bosnisch, Englisch, Französisch und Arabisch. Ausgaben in weiteren Sprachen sind in Vorbereitung.
In Deutschland verfügt mittlerweile jeder achte Einwohner über einen Migrationshintergrund. Trotzdem haben Migranten noch immer erheblich schlechtere Gesundheitschancen als die übrige Bevölkerung. Die notwendige Orientierung im Alltag eines fremden Landes lässt die Vorsorge für die eigene Gesundheit oft in den Hintergrund rücken. Hinzu kommen nicht selten kulturelle Barrieren, so dass Ärzte zu spät oder gar nicht aufgesucht werden. Aus diesem Grund haben der BKK-Bundesverband und das Ethno-Medizinische Zentrum Hannover jetzt einen Gesundheitswegweiser für Migranten vorgelegt. Die Broschüre erscheint zunächst auf Deutsch, Türkisch, Russisch, Serbisch, Kroatisch, Bosnisch, Englisch, Französisch und Arabisch. Ausgaben in weiteren Sprachen sind in Vorbereitung.
Die Broschüre solle einen Beitrag zur Integration leisten. Bildung und Gesundheit seien der Schlüssel, um sich in der Gesellschaft zu bewegen, sagte Klaus-Dieter Voß, Vorstand des BKK Bundesverbandes bei der Vorstellung des Wegweisers in Berlin. Der Migranten-Wegweiser informiert auf 52 Seiten und in 7 Kapiteln über das deutsche System der Krankenversicherung, Arztbesuche, Apotheken, das Krankenhaus, den Öffentlichen Gesundheitsdienst und Verhaltensregeln im Notfall. Angefügt sind ferner Adressen vieler Gesundheitseinrichtungen, Verbände und Beratungsstellen.
Die Broschüre kann man in 9 Sprachen als PDF-Datei herunterladen: Das deutsche Gesundheitssystem - Wegweiser für Migranten/innen
Gerd Marstedt, 30.10.2006
Klinik-Führer Rhein-Ruhr erhält Auszeichnung für Patieninformationen
 Für den Klinik-Führer Ruhrgebiet erhielten der Initiativkreis Ruhrgebiet und The Boston Consulting Group jetzt internationale Anerkennung: Das innovative Nachschlagewerk zur Qualität von Krankenhäusern wird mit dem Ehrenpreis des Picker Instituts Boston, USA, ausgezeichnet. Gewürdigt wird der Klinik-Führer Rhein-Ruhr als wegweisende Initiative, welche die Betreuung der Patienten stärker ins Blickfeld der medizinischen Versorgung rückt.
Für den Klinik-Führer Ruhrgebiet erhielten der Initiativkreis Ruhrgebiet und The Boston Consulting Group jetzt internationale Anerkennung: Das innovative Nachschlagewerk zur Qualität von Krankenhäusern wird mit dem Ehrenpreis des Picker Instituts Boston, USA, ausgezeichnet. Gewürdigt wird der Klinik-Führer Rhein-Ruhr als wegweisende Initiative, welche die Betreuung der Patienten stärker ins Blickfeld der medizinischen Versorgung rückt.
Der Klinik-Führer Rhein-Ruhr untersucht insgesamt 13 Fachbereiche und deckt so einen Großteil der häufigsten Erkrankungen ab. Untersucht wurden unter anderem 3 Teilbereiche der Chirurgie, 4 Disziplinen der Inneren Medizin sowie die frauenheilkundlichen Fächer. Alle 131 Krankenhäuser der Region Rhein-Ruhr, welche die untersuchten Fachbereiche anbieten, waren eingeladen worden, sich am neuen Klinik-Führer zu beteiligen. Von diesen Häusern haben 74 mit insgesamt 392 Fachabteilungen teilgenommen.
Innovativ und für Patienten besonders aufschlussreich und informativ sind bei dem Klinik-Führer die Ergebnisse einer Ärzte- und einer Patientenbefragung. Während die derzeit von Krankenkassen veröffentlichten und auch zentral abrufbaren strukturierten Qualitätsberichte deutscher Kliniken sich vorwiegend auf das Merkmal "Häufigkeit durchgeführter Eingriffe" konzentrieren, bietet das Handbuch auch Beurteilungen von Patienten und Ärzten. Die Patientenbefragung wurde unter der Leitung des Picker Instituts Deutschland durchgeführt. Pro teilnehmender Fachabteilung wurden 200 Patienten angeschrieben, die in den ersten Monaten des Jahres 2005 entlassen worden waren. Per Post erhielten sie einen Fragebogen mit insgesamt 88 Fragen zu verschiedenen Aspekten ihres Krankenhausaufenthalts wie Aufnahme, die Betreuung durch Ärzte und Pflegepersonal, Qualität des Essens und Sauberkeit der Zimmer. Von 65.000 angeschriebenen Patienten haben gut 40.000 den Fragebogen an das Picker Institut zurückgesandt, was einer Rücklaufquote von 62 % entspricht.
Neu ist auch die Ärztebefragung des Handbuchs. Mediziner aus der Region haben für jeden der Fachbereiche drei typische Krankheitsbilder ausgewählt. Zu jedem Krankheitsbild sollten die befragten Ärzte dann angeben, in welchem Krankenhaus sie sich im Falle einer Erkrankung selbst behandeln lassen würden. Von gut 9.000 durch das Picker Institut angeschriebenen Ärzten haben 2.500 den Fragebogen ausgefüllt zurückgesandt. Dies entspricht einer Rücklaufquote von 26 % - ein für Ärztebefragungen außergewöhnlich gutes Ergebnis, das im Vergleich zur letztjährigen Ausgabe des Klinik-Führers eine Steigerung bedeutet. Den Angaben der niedergelassenen Ärzte lässt sich die Reputation einer Fachabteilung bei der Ärzteschaft entnehmen.
Der Klinik-Führer ist im Buchhandel erhältlich oder bei den Kliniken Rhein-Ruhr, ausführliche Informationen in Form einer Pressemappe sind hier als PDF-Datei abrufbar.
Gerd Marstedt, 30.10.2006
Checkliste: "Woran erkennt man eine gute Arztpraxis?"
 In dem seit 2001 durchgeführten "Gesundheitsmonitor" geben durchweg 30 Prozent der Bevölkerung an, dass sie ihren Arzt wegen inhaltlicher Differenzen bereits einmal gewechselt haben. Unter der Oberfläche des Wechsels existieren differenzierte Kommunikations- und Interaktionsdefizite, die möglicherweise die genannten Differenzen und den Wechsel begründen. So geben konstant 20 Prozent an, sie wären in einer diagnostischen oder therapeutischen Frage anderer Meinung als ihr Arzt, würden aber nicht mit ihm darüber reden. Ein von 25 auf 18 Prozent sinkender zusätzlicher Anteil der befragten Patienten hatte einen Dissens mit ihrem Arzt und sprachen mit diesem darüber. An welchen Fragen die Unzufriedenheit von Patienten und ihr erklärter oder unerklärter Dissens mit dem Arzt entstehen könnte, zeigen weitere Ergebnisse des "Gesundheitsmonitors": Zwischen 2001 und 2004 berücksichtigten Ärzte in der Wahrnehmung ihrer Patienten nie bei mehr als 60 Prozent von ihnen die Lebensumstände, durchschnittlich 60 Prozent der Patienten gaben an, dass sie über Vor- und Nachteile der Behandlung informiert worden sind, maximal 39 Prozent forderte ihr Arzt auf, Fragen zu stellen und nur durchschnittlich 23 Prozent erhielten zusätzliches Informationsmaterial von ihrem Arzt. Weitere Details der Wahrnehmungen der Patienten über die Behandlung in Hausarztpraxen finden sich in einem demnächst gedruckt erscheinenden Aufsatz über "Wunsch und Wirklichkeit der Rolle von Versicherten- und Patientenwahrnehmungen in der Gesundheitspolitik".
In dem seit 2001 durchgeführten "Gesundheitsmonitor" geben durchweg 30 Prozent der Bevölkerung an, dass sie ihren Arzt wegen inhaltlicher Differenzen bereits einmal gewechselt haben. Unter der Oberfläche des Wechsels existieren differenzierte Kommunikations- und Interaktionsdefizite, die möglicherweise die genannten Differenzen und den Wechsel begründen. So geben konstant 20 Prozent an, sie wären in einer diagnostischen oder therapeutischen Frage anderer Meinung als ihr Arzt, würden aber nicht mit ihm darüber reden. Ein von 25 auf 18 Prozent sinkender zusätzlicher Anteil der befragten Patienten hatte einen Dissens mit ihrem Arzt und sprachen mit diesem darüber. An welchen Fragen die Unzufriedenheit von Patienten und ihr erklärter oder unerklärter Dissens mit dem Arzt entstehen könnte, zeigen weitere Ergebnisse des "Gesundheitsmonitors": Zwischen 2001 und 2004 berücksichtigten Ärzte in der Wahrnehmung ihrer Patienten nie bei mehr als 60 Prozent von ihnen die Lebensumstände, durchschnittlich 60 Prozent der Patienten gaben an, dass sie über Vor- und Nachteile der Behandlung informiert worden sind, maximal 39 Prozent forderte ihr Arzt auf, Fragen zu stellen und nur durchschnittlich 23 Prozent erhielten zusätzliches Informationsmaterial von ihrem Arzt. Weitere Details der Wahrnehmungen der Patienten über die Behandlung in Hausarztpraxen finden sich in einem demnächst gedruckt erscheinenden Aufsatz über "Wunsch und Wirklichkeit der Rolle von Versicherten- und Patientenwahrnehmungen in der Gesundheitspolitik".
Um zu vermeiden, dass unnötig Unzufriedenheit und Dissens zwischen Patienten und Ärzten entstehen und daraus dann evtl. sogar unerwünschte gesundheitlichen Folgen, haben das von der Bundesärztekammer und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung getragene "Ärztliche Zentrum für Qualität in der Medizin" sowie das von den großen Selbsthilfedachverbänden eingerichtete "Patientenforum" die Checkliste "Woran erkenne ich eine gute Arztpraxis?" erarbeitet und veröffentlicht.
Zu den von den Ärzten einforderbaren Verhaltensweisen oder Qualitätsmerkmalen gehören beispielsweise
• eine umfassende und verständliche Aufklärung,
• der Erhalt weiterführenden Informationsmaterials,
• die Möglichkeit einer gemeinsamen Entscheidung von Patient und Arzt über die Behandlung,
• der Schutz der persönlichen Daten,
• eine Praxisorganisation, die den Besuch für den Patienten erleichtert und
• ein freundlicher und respektvoller Umgang.
Für jedes dieser Merkmale werden detaillierte Hinweise gegeben, was sie bedeuten und woran man sie konkret erkennen kann. Links zu weiteren allgemeinen Checklisten, nationalen Institutionen zur Qualitätssicherung und krankheitsbezogenen Checklisten runden den Nutzwert der Liste ab.
PDF-Datei der Checkliste
Bernard Braun, 10.8.2005