



Home | Patienten | Gesundheitssystem | International | GKV | Prävention | Epidemiologie | Websites | Meilensteine | Impressum
Sämtliche Rubriken in
"Patienten"
Verhaltenssteuerung (Arzt, Patient), Zuzahlungen, Praxisgebühr |
Versorgungsforschung: Übergreifende Studien |
Alle Artikel aus:
Patienten
Versorgungsforschung: Übergreifende Studien
Wie viele der in Cochrane Reviews bewerteten 1.567 Leistungen sind qualitativ hochwertig? 5,6 %!
 Die von einer Vielzahl unabhängiger Expert:innengruppen erstellten systematischen Reviews der Cochrane Collaboration über die in hochwertigen Studien identifizierte Evidenz der Qualität, des Nutzens und der möglichen unerwünschten Behandlungseffekten einer Vielzahl von gesundheitsbezogenen Interventionen, Eingriffen und Behandlungen gelten seit langem als Goldstandard. Dies liegt zum einen daran, dass in den Reviews in der Regel nur randomisierte und kontrollierte Studien berücksichtigt werden und zum andern an der zur Berechnung der Evidenz genutzten einheitlichen GRADE-Methodik Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation.
Die von einer Vielzahl unabhängiger Expert:innengruppen erstellten systematischen Reviews der Cochrane Collaboration über die in hochwertigen Studien identifizierte Evidenz der Qualität, des Nutzens und der möglichen unerwünschten Behandlungseffekten einer Vielzahl von gesundheitsbezogenen Interventionen, Eingriffen und Behandlungen gelten seit langem als Goldstandard. Dies liegt zum einen daran, dass in den Reviews in der Regel nur randomisierte und kontrollierte Studien berücksichtigt werden und zum andern an der zur Berechnung der Evidenz genutzten einheitlichen GRADE-Methodik Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation.
In einem aktuellen systematischen Review über die Ergebnisse einer Reihe von Cochrane Reviews wurden zufällig ausgewählte 2.428 oder 35 % aller Cochrane Reviews, die zwischen 2008 und 2021 veröffentlicht wurden genauer untersucht. In ihnen fanden sich 1.567 Behandlungsinterventionen, deren Wirkungen mit denen von Placebos, mit keiner oder mit üblicher Behandlung verglichen wurden und deren Ergebnisqualität mittels der GRADE-Methodik bewertet wurde. Für diese Interventionen wurde dann berechnet wie viele von ihnen gemessen an den selbst gewählten primären Endpunkten die höchstmögliche oder beste Wirksamkeit und statistisch signifikante positive Effekte hatten und von den Autor:innen des aktuellen Reviews als nützlich bewertet wurden. Außerdem wurde untersucht in wie vielen der Cochrane Reviews unerwünschte oder negative Behandlungswirkungen genannt wurden.
Die Ergebnisse lauten:
• Von den 1.567 Behandlungen, Eingriffen etc. hatten 87 oder 5,6 % "high quality evidence on first-listed primary outcomes, positive, statistically significant results and were rated by review authors as beneficial." Bei 73,6 % dieser Interventionen handelte es sich um Arzneimittel.
• Schädliche Wirkungen fanden die aktuellen Reviewer in 577 oder 36,8 % der Cochrane Reviews erwähnt. Bei 8,1 % von ihnen oder 127 Interventionen war die negative Wirkung statistisch signifikant.
In gewisser Weise bestätigt der aktuelle Review über Cochrane Reviews u.a. die wesentlichen Erkenntnisse eines von Autor:innen des "British Medical Journals" erstellten Handbuchs zur klinischen Evidenz von über 3.000 Gesundheitsleistungen aus dem Jahr 2013 siehe dazu den Forums-Beitrag zum "Clinical Evidence Handbook". Die Zusammenfassung der Ergebnisse in dem Forums-Beitrag lautete: "Die Wirksamkeit von 50 % der 3.000 Behandlungsleistungen für die wichtigsten Erkrankungen ist mangels qualitativ hochwertigen Studien unbekannt, für 11 % der Leistungen zeigen randomisierte kontrollierte Studien (RCT) Evidenz für ihre uneingeschränkte Nützlichkeit ("beneficial") und weitere 24 % sind evidenzbasiert wahrscheinlich nützlich ("likely to be beneficial"). Für 7 % der Leistungen belegen RCTs einen Zielkonflikt zwischen Nutzen und Schädlichkeit ("trade-off between benefits and harms"), bei 5 % der Leistungen ist es unwahrscheinlich, dass sie nützlich sind ("unlikely to be beneficial") und 3 % der 3.000 Leistungen sind wahrscheinlich nachweisbar unwirksam oder schädlich ("likely to be ineffective or harmful")."
Wegen der Bedeutung ihrer Ergebnisse für die Debatte über die möglichst beste Qualität und Wirksamkeit von Therapien und den Wert der Ergebnisse von Cochrane Reviews in der Gesundheitsversorgungsdebatte setzt sich die Autor:innengruppe ausführlich mit acht möglichen Limitationen ihrer Untersuchung auseinander. Zu diesen durchweg lesenswerten Limitationen zählen z.B. Zweifel an der Reliabilität des Einsatzes der GRADE-Methodik, die nach einer Überprüfung aber verworfen werden. Außerdem wird die Überlegung diskutiert, GRADE sei zu hart, Patient:innen "may be happy to use interventions whose effects are supported by moderate quality evidence" und auch "clinicians at the coalface may be happy with moderate quality evidence", weswegen evtl. über "a radical overhaul of the GRADE system" nachgedacht werden müsse.
Der Aufsatz Most healthcare interventions tested in Cochrane Reviews are not effective according to high quality evidence: a systematic review and meta-analysis von Jeremy Howick et al. - einer internationalen Autor:innengruppe aus Großbritannien, Deutschland, der Schweiz und den USA wurde im "Journal of Clinical Epidemiology" Volume 148, August 2022: 160-169 veröffentlicht, ist aber nicht kostenlos erhältlich.
Eine inhaltlich aber nicht seitenidentische 24-seitige pre-proof-Fassung kann aber auf der Archivseite der University of Oxford kostenlos heruntergeladen werden.
Bernard Braun, 20.9.23
Zwei neue Studien: COVID-19 ist gef�hrlicher als die saisonale Influenza
 Eine Studie aus Frankreich befasst sich mit der Frage, wie sich COVID-19 und Influenza bezüglich Morbidität und Mortalität unterscheiden. Verglichen wurden dazu Krankenhauspatient*innen zum Zeitpunkt der Entlassung. Dazu wurden die Daten von 89.530 COVID-19-Patient*innen aus dem Zeitraum 1.3.-30.4.2020 mit 45.819 Influenza-Patienten aus dem Zeitraum 1.12.2018 bis 28.2.2019 verglichen. Es handelt sich um eine retrospektive Kohortenstudie. Die Diagnosen und Prozeduren (abrechenbare Behandlungsmaßnahmen) aller Patienten, die in öffentlichen und privaten Krankenhäusern in Frankreich behandelt werden, stehen in einer nationalen Datenbank (Programme de médicalisation des systèmes d'information) zur Verfügung.
Eine Studie aus Frankreich befasst sich mit der Frage, wie sich COVID-19 und Influenza bezüglich Morbidität und Mortalität unterscheiden. Verglichen wurden dazu Krankenhauspatient*innen zum Zeitpunkt der Entlassung. Dazu wurden die Daten von 89.530 COVID-19-Patient*innen aus dem Zeitraum 1.3.-30.4.2020 mit 45.819 Influenza-Patienten aus dem Zeitraum 1.12.2018 bis 28.2.2019 verglichen. Es handelt sich um eine retrospektive Kohortenstudie. Die Diagnosen und Prozeduren (abrechenbare Behandlungsmaßnahmen) aller Patienten, die in öffentlichen und privaten Krankenhäusern in Frankreich behandelt werden, stehen in einer nationalen Datenbank (Programme de médicalisation des systèmes d'information) zur Verfügung.
Im Krankenhaus verstarben 15.104 der 89.530 COVID-19-Patienten (16,9%) und 2640 der 45.819 Influenza-Patient*innen (5,8%). Das Sterberisiko war also 2,9 mal höher für COVID-19-Patient*innen als für Influenza-Patient*innen, altersadjustiert war das Risiko mit 2,82 geringfügig niedriger.
Auf die Intensivstation (ICU) wurden mehr COVID-19-Patient*innen aufgenommen (16,3% vs. 10,8%), die Dauer des ICU-Aufenthaltes war länger (15 vs. 8 Tage), der Anteil der mechanisch Beatmeten unter den ICU-Patient*innen war höher (71,5% vs. 61,0%).
Der Anteil der Verstorbenen (Fallsterblichkeitsrate) war erhöht bei
• ICU-Patienten (27,1% vs. 18%),
• ICU-Patienten mit mechanischer Beatmung (31,8% vs. 26)
• ICU-Patienten ohne mechanische Beatmung (17,2% vs. 5,4%).
Das Durchschnittsalter der COVID-19-Patient*innen war höher (65 vs. 59 Jahre), insbesondere war der Anteil jüngerer Patienten niedriger, so waren 1,4% der COVID-19-Patient*innen unter 18 Jahre im Vergleich zu 19,5% der Influenza-Patient*innen. Der Anteil der Männer war bei COVID-19 höher (53,0% vs. 48,3%).
Folgende Ko-Morbiditäten waren bei COVID-19-Patient*innen mit statistischer Signifikanz erhöht: Bluthochdruck (33,1% vs. 28,2%), Übergewicht (11,3% vs. 6,1%), Adipositas (9,6% vs. 5,4%), Diabetes (19,0% vs. 16,0%), Fettstoffwechselstörung (5,0% vs. 4,5%). Bei der Influenza waren mit statistischer Signifikanz häufiger: chronische Atemwegserkrankungen (4,0% vs. 1,6%), Immunschwäche (4,4% vs. 3,8%).
Folgende Ereignisse während des Krankenhausaufenthaltes waren bei COVID-19-Patient*innen erhöht: akutes Lungenversagen (27,2% vs. 17,4%), Lungenembolie (3,4% vs. 0,9%), septischer Schock (2,8% vs. 2,0%), akutes Nierenversagen (6,4% vs. 4,9%). Bei Influenza waren häufiger: Herzinfarkt (Herzinfarkt 1,1% vs. 0,6% und Vorhofflimmern (15,8% vs. 12,4%).
Zusammenfassend hat COVID-19 in Frankreich in 2 Monaten im Jahr 2020 zu fast doppelt so vielen Krankenhausaufenthalten geführt, als die Influenza in 3 Monaten um die Jahreswende 2018/19. Die Komplikationsraten waren höher, die Verläufe ungünstiger und die Sterblichkeit (Fallsterblichkeitsrate) im Krankenhaus fast 3fach erhöht.
Eine methodisch ähnliche amerikanische Studie mit den Daten der mehr als 9 Mio. Personen, die über das US Department of Veterans Affairs gesundheitlich versorgt werden, ergab ähnliche Ergebnisse (Xie et al. 15.12.2020). Verglichen wurden 3641 COVID-19-Patient*innen, die zwischen dem 1.2. und 17.6 2020 ins Krankenhaus aufgenommen wurden mit 12.676 Influenza-Patient*innen zwischen 2017 und 2019. Bei Patient*innen mit der Diagnose COVID-19 war das Sterberisiko um den Faktor 4,97 erhöht, Die Wahrscheinlichkeit für mechanische Beatmung 4,01fach und die Wahrscheinlichkeit für die Verlegung auf die ICU 2,41fach (alle Werte für Alter und weitere Einflussfaktoren adjustiert).
Zusammenfassend handelt es sich um zwei Studien mit soliden Daten einer jeweils großen Population (alle Krankenhauspatienten in Frankreich bzw. alle Veterans Affairs-Versicherten in den USA). Der Vergleich der Patient*innen mit der Diagnose COVID-19 und Influenza ergibt in beiden Populationen eine deutlich erhöhte Sterblichkeit und ein höheres Risiko für Komplikationen und schwere Verläufe für COVID-19.
Im Zusammenhang mit der Übersterblichkeit der ersten und jetzt auch zweiten SARS-CoV-2-Infektionswelle dürfte für die These, COVID-19 sei nicht gefährlicher als eine Grippe, kein Raum mehr bleiben.
Piroth L, Cottenet J, Mariet A-S, Bonniaud P, Blot M, Tubert-Bitter P, et al. Comparison of the characteristics, morbidity, and mortality of COVID-19 and seasonal influenza: a nationwide, population-based retrospective cohort study. The Lancet Respiratory Medicine. Veröffentlicht 17.12. 2020. Download
Xie Y, Bowe B, Maddukuri G, Al-Aly Z. Comparative evaluation of clinical manifestations and risk of death in patients admitted to hospital with covid-19 and seasonal influenza: cohort study. BMJ. 2020;371:m4677. Veröffentlicht am 15.12.2020 Link
Vertiefung: Zusatzkapitel Corona (fortlaufende Aktualisierung) zum Lehrbuch Sozialmedizin - Public Health - Gesundheitswissenschaften. 4. Auflage März 2020.
Download: www.sozmad.de
David Klemperer, 25.12.20
"Closing borders is ridiculous" (A. Tegnell), und zahlreiche Studien bestätigen dies seit vielen Jahren.
 Gerade weil selbst die noch vor wenigen Tagen und Wochen wortstärksten Protagonisten von Grenzschließungen und jeglichen Reisebeschränkungen in ihren laufenden Meinungsumschwung Bemerkungen einfließen lassen, es gäbe eigentlich keine oder nur schwache Evidenz für die präventive Wirksamkeit dieser Maßnahmen, muss daran erinnert werden, dass dafür nicht erst seit Mai 2020 Belege existieren.
Gerade weil selbst die noch vor wenigen Tagen und Wochen wortstärksten Protagonisten von Grenzschließungen und jeglichen Reisebeschränkungen in ihren laufenden Meinungsumschwung Bemerkungen einfließen lassen, es gäbe eigentlich keine oder nur schwache Evidenz für die präventive Wirksamkeit dieser Maßnahmen, muss daran erinnert werden, dass dafür nicht erst seit Mai 2020 Belege existieren.
Wenn im weiteren Verlauf der Kommunikation über und des Umgangs mit Covid-19 nach Beispielen für folgenreiches Handeln entgegen vorhandenem Wissen gesucht wird, eignen sich die Grenzschließungen im besonderen Maße.
Dass Grenzschließungen bei einer Epidemie "in den meisten Fällen ineffektiv" sind, also weder die Ausbreitung zu Beginn der Pandemie noch nach einer weltweiten Verbreitung des Virus eine zweite, dritte oder weitere Wellen höchstens etwas verzögert aber nicht verhindert werden könnte, wird in zahlreichen Studien und systematischen Reviews seit vielen Jahren nachgewiesen. Dass trotz minimal möglichen positiven Effekten diese stets auch noch gegen mögliche negative Effekte von Schließungen (z.B. sozialer und wirtschaftlicher Art) abgewogen werden müssen, gehört zu den Standards des Umgangs mit Studienergebnissen.
Für die Schließungs-Protagonisten in Deutschland besonders peinlich ist, dass zu diesem Schluss- allerdings noch vor der Sars-Cov-2-Pandemie - die Autor*innen des vom Robert-Koch-Institut (RKI) herausgegebenen Nationaler Pandemieplan Teil II. Wissenschaftliche Grundlagen seit 2007 und auch noch in seiner letzten Fassung aus dem Jahr 2016 kamen. Der damalige Forschungsstand wurde so zusammengefasst: "Zum Thema Grenzschließungen als Maßnahme der Übertragung von Influenza wurde ein Review des ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC): Guide to public health measures to reduce the impact of influenza pandemics in Europe: 'The ECDC Menu' 2009) identifiziert. In diesem wird von Grenzschließungen klar abgeraten. Zusammenfassung: An den Grenzen ist ebenfalls eine Vielzahl an Maßnahmen denkbar. Bezüglich des Einreise- und Ausreise-Screening (Entry- und Exit-Screening) besteht theoretische und empirische Einigkeit, dass diese Maßnahme aufwendig und ineffektiv ist. Es ist allenfalls, selbst bei sehr gewissenhafter und lückenloser Durchführung eine Verzögerung der pandemischen Welle von 1 - 2 Wochen zu erwarten. Als Alternative vorgeschlagen wurde die Durchführung gleichzeitiger, mehrerer informativer Maßnahmen sowohl für Reisende als auch primärversorgende Ärzte. Von Grenzschließungen wird abgeraten."
Da dies schlicht und einfach überlesen oder stillschweigend ignoriert wurde, kam es noch nicht einmal zu einer durchaus zulässigen Diskussion, ob dies auch für das "neuartige" Sars-CoV-2-Virus gilt oder nicht.
Ein im "Bulletin of the World Health Organization" 2014 veröffentlichter systematischer Review über 23 seit den Nuller Jahren durchgeführten Studien fand für sämtliche Formen der Reisebeschränkungen durch Grenzschließungen oder den Stopp von Flugverbindungen lediglich "limited effectiveness", wobei der minimale Nutzen mögliche zeitliche Verzögerungen der Verbreitung waren.
Zusammengefasst: "It seems likely that, for delaying the spread and reducing the magnitude of an epidemic in a given geographical area, a combination of interventions would be more effective than isolated interventions. Travel restrictions per se would not be sufficient to achieve containment in a given geographical area, and their contribution to any policy of rapid containment is likely to be limited."
Der Review Effectiveness of travel restrictions in the rapid containment of human influenza: a systematic review von Ana LP Mateus , Harmony E Otete , Charles R Beck , Gayle P Dolan und Jonathan S Nguyen-Van-Tam ist im "Bulletin of the World Health Organization" (2014;92:868-880) erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Für diejenigen aber, die meinen (könnten), dies gelte für das grenzüberschreitende Potenzial des Sars-Cov-2-Virus nicht, lieferte eine im März 2020 veröffentlichte Publikation über die Verbreitung des Virus zu Beginn der Covid-19-Pandemie mit Daten aus China in der Zeitschrift "Science" (komplett erhältlich: The effect of travel restrictions on the spread of the 2019 novel coronavirus (COVID-19) outbreak von Matteo Chinazzi et al. in "Science" (Vol. 368, Issue 6489: 395-400)) folgende Erkenntnisse: "The travel quarantine around Wuhan has only modestly delayed the spread of disease to other areas of mainland China. This finding is consistent with the results of separate studies on the diffusion of SARS-CoV-2 in mainland China. The model indicates that although the Wuhan travel ban was initially effective at reducing international case importations, the number of imported cases outside mainland China will continue to grow after 2 to 3 weeks. Furthermore, the modeling study shows that additional travel limitations (up to 90% of traffic) have only a modest effect unless paired with public health interventions and behavioral changes that can facilitate a considerable reduction in disease transmissibility. The model also indicates that, despite the strong restrictions on travel to and from mainland China since 23 January 2020, many individuals exposed to SARS-CoV-2 have been traveling internationally without being detected. Moving forward, we expect that travel restrictions to COVID-19-affected areas will have modest effects and that transmission reduction interventions will provide the greatest benefit for mitigating the epidemic."
Eine Gruppe US-amerikanischer Wissenschaftler*innen von der Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health mahnte in ihrem "integrative review of the limited evidence on international travel bans" bei politischen Entscheidungen Folgendes zu beachten: "When assessing the need for, and validity of, a travel ban, given the limited evidence, it's important to ask if it is the least restrictive measure that still protects the public's health, and even if it is, we should be asking that question repeatedly, and often."
Der Integrative review of the limited evidence on international travel bans as an emerging infectious disease disaster control measure von Nicole A. Errett et al. ist in der Januar/Februar-Ausgabe 2020 des "Journal of Emergency Management" (2020; 18 (1): 7-14) erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
14 renommierte Spezialist*innen für Infektionskrankheiten aus der gesamten Welt veröffentlichten schließlich im April 2020 in der Fachzeitschrift "International Journal of Infectious Diseases" einen dringenden Appell für die künftige Erforschung der Umstände von Reisebeschränkungen unter Pandemiebedingungen. Ihren Überlegungen zugrunde liegt die folgende Erkenntnis: "Travel bans to affected areas or denial of entry to passengers coming from affected areas are usually not effective in preventing the importation of cases but have a significant economic and social impact."
Auch der kurze Aufruf COVID-19 travel restrictions and the International Health Regulations - Call for an open debate on easing of travel restrictions in der Zeitschrift "International Journal of Infectious Diseases" (94 (2020) 88-90) ist kostenlos zugänglich.
Leider nur für Abonnenten komplett zugänglich ist eine ausgezeichnete Zusammenfassung der Erkenntnisse zu Grenzschließungen Grenzen auf von Christina Berndt und Markus Grill in der "Süddeutschen Zeitung" vom7. Mai 2020. Die Autoren weisen dort u.a. darauf hin, dass Flugreisebeschränkungen bis hin zur Einstellung des Flugverkehrs auch völlig unerwünschte negative Auswirkungen haben kann. Impfstoffe gegen andere Krankheiten und andere Hilfsgüter kommen dann nämlich auch nicht mehr z.B. in Ländern der Dritten Welt an.
Bernard Braun, 18.5.20
Warum beteiligen sich nur wenige ÄrztInnen an gesundheitsbezogenen Befragungen? Auch Nonresponderbefragung liefert wenig Antworten
 Für die Darstellung und Bewertung gesundheitlicher Versorgung ist ihre Wahrnehmung und Beurteilung durch ÄrztInnen neben oder zusätzlich zu der von PatientInnen unabdingbar. Diese Informationen erhält man in der Regel durch mündliche oder schriftliche Befragungen - jedenfalls gehört dies zum Standardrepertoire gesundheitswissenschaftlicher Untersuchungen. So oft wie solche Befragungen gemacht werden, so oft nehmen ÄrztInnen nicht an solchen Befragungen teil, sind also Nonresponder. Auch wenn hohe Antwortquoten nicht zwingend für die Repräsentivität der Antworten und Ergebnisse notwendig sind, erschweren Antwortquoten von unter 50% Schlussfolgerungen für praktische Fragen oder dienen als Totschlagargument gegen unliebsame Ergebnisse.
Für die Darstellung und Bewertung gesundheitlicher Versorgung ist ihre Wahrnehmung und Beurteilung durch ÄrztInnen neben oder zusätzlich zu der von PatientInnen unabdingbar. Diese Informationen erhält man in der Regel durch mündliche oder schriftliche Befragungen - jedenfalls gehört dies zum Standardrepertoire gesundheitswissenschaftlicher Untersuchungen. So oft wie solche Befragungen gemacht werden, so oft nehmen ÄrztInnen nicht an solchen Befragungen teil, sind also Nonresponder. Auch wenn hohe Antwortquoten nicht zwingend für die Repräsentivität der Antworten und Ergebnisse notwendig sind, erschweren Antwortquoten von unter 50% Schlussfolgerungen für praktische Fragen oder dienen als Totschlagargument gegen unliebsame Ergebnisse.
WissenschaftlerInnen, die solche Erfahrungen sammeln mussten, versuchen daher herauszubekommen, warum die von ihnen befragten ÄrztInnen nicht antworteten, um evtl. künftig bekanntgewordene Barrieren zu vermeiden. Dies geschieht am besten mit einer so genannten Nonresponderbefragung.
Eine Gruppe von Gesundheitswissenschaftlern und Medizinsoziologen des IMVR - Institut für Medizinsoziologie, Versorgungsforschung und Rehabilitationswissenschaft der Universität Köln hat dies nun mit den Hausärzten und Onkologen gemacht, die eine Befragung zur Palliativversorgung nicht beantwortet hatten.
Aus den wenigen vergleichbaren Studien sind als Gründe für die Nichtteilnahme oder Nichtbeantwortung von Fragebögen die fehlende Zeit, fehlendes Interesse, Bedenken bzgl. des Datenschutzes, die Fragebogenlänge und die grundsätzliche Verweigerung von wissenschaftlichen Befragungen bekannt.
Als Hauptgründe für die Nicht-Teilnahme gaben 72,3% der mit einem Kurz(!)fragebogen befragten NonresponderInnen fehlende zeitliche Ressourcen, 28,5% die Fragebogenlänge an. Nur 3,7% gaben fehlendes thematisches Interesse an. Von den 1.708 befragten HausärztInnen und OnkologInnen antworteten aber trotz Kurzfragebogen, dem damit geringen zeitlichen Aufwand für seine Beantwortung und trotz der mit der Nachfrage deutlich signalisierten sozialen Erwünschtheit einer Antwort nur 379 oder 22,2%. Wie üblich erfährt man erneut nicht, welche Gründe für die Mehrheit der Nonresponder eine Rolle spielen und würde sie wahrscheinlich auch nicht durch eine Non-Nonresponderbefragung erfahren.
So wahrscheinlich die explizit genannten oder angekreuzten Gründe für Nonresponding auch sind, so sicher gibt es weitere gewichtige Gründe, die mit anderen Methoden entdeckt werden müssen - oder ÄrztInnen und die interessierte Öffentlichkeit müssen damit leben und ringen, dass ihre Erfahrungen als die einer nicht repräsentativen Minderheit bewertet und nicht ernstgenommen werden.
Die Ergebnisse der Studie Ursachen für die Nicht-Teilnahme an einer postalischen Befragung zum Thema Palliativversorgung: Eine Nonresponse-Analyse unter Hausärzten und Onkologen von Peter S, Volkert A, Pfaff H et al. wurden auf der Gemeinsamen Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Medizinische Soziologie (DGMS) und der Deutschen Gesellschaft für Sozialmedizin und Prävention (DGSMP) 2019 präsentiert. Das Abstract ist in der Zeitschrift "Das Gesundheitswesen" (2019; 81(08/09): 660 - 660) veröffentlicht worden und kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 28.9.19
Bewegung und Gesundheit: Es ist selten zu wenig und zu kurz, um positive gesundheitliche Wirkungen zu erzielen
 Fitness-Studios, die Verfasser mancher Ratgeber für möglichst viel, lange und anstrengende Joggingstrecken oder andere Bewegungsübungen und wahrscheinlich auch die Hersteller von Geräten zur Messung der Dauer, Intensität und Wirkungen, die nur Sinn machen, wenn sie täglich längere Zeit genutzt werden, sind sicherlich mit den Ergebnissen der am 19.März 2019 zuerst online veröffentlichten Studie über die Evidenz für Wirkungen von zeitlich sehr geringen oder sehr großen körperlichen Aktivitäten in der Freizeit auf das Risiko an einer kardiovaskulären Erkrankung oder an einer Krebserkrankung zu sterben.
Fitness-Studios, die Verfasser mancher Ratgeber für möglichst viel, lange und anstrengende Joggingstrecken oder andere Bewegungsübungen und wahrscheinlich auch die Hersteller von Geräten zur Messung der Dauer, Intensität und Wirkungen, die nur Sinn machen, wenn sie täglich längere Zeit genutzt werden, sind sicherlich mit den Ergebnissen der am 19.März 2019 zuerst online veröffentlichten Studie über die Evidenz für Wirkungen von zeitlich sehr geringen oder sehr großen körperlichen Aktivitäten in der Freizeit auf das Risiko an einer kardiovaskulären Erkrankung oder an einer Krebserkrankung zu sterben.
Einer der Ausgangspunkte dieser Studie ist, dass viele Menschen aus verschiedenen Gründen (vom "inneren Schweinehund", den Arbeitszeiten bis zu familiären Verpflichtungen) nicht in der Lage sind, den Standards der WHO oder ihrer Krankenkasse folgend sich regelmäßig täglich oder mindestens fünfmal die Woche längere Zeit durch ihren Stadtwald oder auf den Laufbändern des nächsten Fitnessstudios zu bewegen. In der Annahme oder durch die Übernahme der Zielwerte in Ratgebern etc., dass sie bei wenigeren und kürzeren Bewegungsmaßnahmen den gewünschten gesundheitlichen Effekt nicht mehr erreichen, verzichten viele Menschen dann auf sämtliche Bewegungsaktivitäten.
Eine Auswertung von 12 Wellen des "National Health Interview Surveys (1997-2008)" und des nationalen Sterblichkeitsindex der USA aus dem Jahr 2011, konnte sich auf die individuellen Daten zum Bewegungsverhalten und zur Sterblichkeit von 88.140 BürgerInnen im Alter von 40 bis 85 Jahren stützen. In der neunjährigen Beobachtungszeit starben 9% der Untersuchungspopulation.
Die wichtigsten adjustierten (nach Rauchstatus und anderen potenziellen Confoundern) Ergebnisse lauten:
• Im Vergleich mit bewegungsmäßig inaktiven Personen reduzierten die Personen, die sich 150 bis 299 Minuten pro Woche intensiver bewegten ihr Gesamtmortalitätsrisiko ("hazard ratio") um 31%.
• Im selben Vergleich stieg die Reduktion des Sterblichkeitsrisikos bei den Personen auf auf 46% und mehr, die sich 1.500 Minuten und mehr pro Woche aktiv bewegten.
• Diejenigen Personen, die sich nur 10 bis 59 Minuten pro Woche aktiv bewegten, also möglicherweise am gesundheitlichen Nutzen zweifeln, reduzieren das Risiko wegen irgendeiner Ursache zu sterben im Vergleich mit völlig inaktiven Personen immer noch um 18%.
• Ähnliche Ergebnisse gibt es für das Risiko wegen Kreislauferkrankungen oder Krebs zu sterben.
Die AutorInnen der Studie empfehlen daher die Motivation zu körperlicher Bewegung "of any intensity and amount is an important approach to reducing mortality risk in the general population."
Und selbstverständlich sollte jede/jeder die/der dann doch noch etwas mehr Zeit für Jogging oder einen intensiven Spaziergang mit oder ohne das Profi-Equipment findet, diese nutzen. Da selbst 10 bewegte Minuten pro Woche einen gesundheitlichen Nutzen haben, sollte schließlich das oben beschriebene Resignieren wegen "zu kurzen" Bewegungszeiten rasch vergessen werden.
Die Studie Beneficial associations of low and large doses of leisure time physical activity with all-cause, cardiovascular disease and cancer mortality: a national cohort study of 88.140 US adults von Min Zhao, Sreenivas P Veeranki, Shengxu Li, Lyn M Steffen, Bo Xi ist im März 2019 "online first" in der Fachzeitschrift "British Journal of Sports Medicine" erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 20.3.19
Kosten der Medikalisierung nichtmedizinischer Probleme - Eine defensive Schätzung für die USA und nicht nur für sie.
 Die Pathologisierung und Medikalisierung von nichtmedizinischen Problemen zu medizinisch oder pharmakologisch behandlungsbedürftigen Erkrankungen oder Störungen - auch als "disease mongering" bezeichnet - ist ein weltweit nicht seltenes Phänomen.
Die Pathologisierung und Medikalisierung von nichtmedizinischen Problemen zu medizinisch oder pharmakologisch behandlungsbedürftigen Erkrankungen oder Störungen - auch als "disease mongering" bezeichnet - ist ein weltweit nicht seltenes Phänomen.
Um welche Probleme es sich handelt und wie hoch die Kosten dieser eigentlich nicht notwendigen medizinischen Versorgung sind, berechneten us-amerikanische Soziologen für die USA im Jahr 2005. Da diese Art von Medikalisierung mit Sicherheit nicht ab- sondern eher noch zugenommen hat, sind die berechneten Zahlen auch 2019 noch von Relevanz.
In Übereinstimmung mit zahlreichen dazu durchgeführten Studien bezogen die Autoren neun Arten von Störungen ("disorders") und Erkrankungen ("medical conditions") in ihre Analysen ein, die ihres Erachtens Resultat erfolgreicher Medikalisierung sind. Dazu gehören verschiedene Formen von Angst-, Schlaf- und Verhaltensstörungen, normale Traurigkeit, Teile einer normalen Schwangerschaft, Körperbildprobleme, Potenzstörungen, Teile der Probleme in der Menopause, bestrimmte Probleme mit dem Körpergewicht und mit Störungen aufgrund des Konsums von legalen oder illegalen Stoffen.
Die direkten Kosten für die medizinische Behandlung dieser Gruppe von medikalisierten Zuständen betrugen in den USA im Jahr 2005 77,1 Milliarden US-Dollar. Dies entsprach einem Anteil von 3,9% an den gesamten Gesundheitsausgaben. Am meisten wurde mit 18,3 Mrd. $ und 12,4 Mrd. $ für medizinisch nicht notwendige Behandlungen von normal Schwangeren und kosmetische plastische Chirurgie ausgegeben. Zur möglichen Meinung, dass 77,1 Mrd. $ nicht besonders viel wären, weisen die Autoren darauf hin, dass im selben Jahr für die Behandlung von Herzerkrankungen "nur" 56,7 Mrd. $ und für die Krebsbehandlung 39,9 Mrd. $ ausgegeben wurden.
Abschließend weisen die Autoren darauf hin, dass es auch noch indirekte Kosten der Medikalisierung geben dürfte, welche die volkswirtschaftliche Bedeutung von Medikalisierung noch ein Stück vergrößern dürfte. Außerdem habe Medikalisierung auch noch gesellschaftliche Wirkungen, indem sie eine Grundlage der objektiv falschen Behauptung darstellt, die gesundheitliche Situation der Bevölkerung in Ländern wie den USA oder Deutschlands verschlechtere sich ständig und/oder epidemisch.
Würde man die Berechnungen aktualisieren und auch noch z.B. die vielfältige Medikalisierung des Alterns (z.B. das meiste was die Basis von Anti-Ageing darstellt) aber auch des Erwachsenwerdens (z.B. Teile der Auslöser von kieferorthopädischen Behandlung für Kinder und Jugendliche) einbeziehen, könnten die Kosten von Medikalisierung wahrscheinlich zu einem zweistelligen Anteil an sämtlichen Gesundheitsausgaben anwachsen.
Und wie sieht es in Deutschland aus: Es gibt keine vergleichbaren Studien, die darauf hindeuten, dass sowohl das Phänomen der Medikalisierung als auch die daraus resultierenden Kosten und gesellschaftlichen Effekte in Deutschland nicht existieren oder wesentlich geringer wären - im Gegenteil.
Der Aufsatz Estimating the costs of medicalization von Peter Conrad, Thomas Mackie und Ateev Mehrotra ist in der Zeitschrift "Social Science & Medicine" (Volume 70, Issue 12, June 2010, Pages 1943-1947) erschienen. Ein Abstract und eine Videozusammenfassung der Ergebnisse durch Peter Conrad sind kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 21.2.19
Wodurch könnte die Lebenserwartung der 50-jährigen US-Bevölkerung um 14 oder 12 Jahre verlängert werden?
 Da die us-amerikanische Bevölkerung trotz der weltweit höchsten Gesundheitsausgaben im Vergleich mit anderen entwickelten Ländern eine geringere und teilweise sogar abnehmende Lebenserwartung hat, gibt es mehrere Studien zur Erforschung von möglichen Ursachen oder zur Suche nach Präventionsmöglichkeiten.
Da die us-amerikanische Bevölkerung trotz der weltweit höchsten Gesundheitsausgaben im Vergleich mit anderen entwickelten Ländern eine geringere und teilweise sogar abnehmende Lebenserwartung hat, gibt es mehrere Studien zur Erforschung von möglichen Ursachen oder zur Suche nach Präventionsmöglichkeiten.
Eine, in deren Mittelpunkt die Rolle und Wirkung von 5 überwiegend verhaltensbezogenen Faktoren auf die Sterblichkeit in frühen Lebensjahren und die Lebenserwartung steht, ist nun am 30. April 2018 in der Fachzeitschrift "Circulation" veröffentlicht worden.
Auf der Basis der "National Health and Nutrition Examination Surveys 2013-2014" bestimmten die WissenschaftlerInnen zunächst die Werte für 5 möglicherweise die Lebenserwartung fördernden Faktoren: niemals RaucherIn gewesen, BMI von 18,5 bis 24,9, mindestens 30 Minuten pro Tag mäßige bis kräftige körperliche Bewegung, mäßiger Alkoholkonsum und ein höherer Wert von über 40% auf einer in den USA verbreiteten Standardskala für gesunde Ernährung (dem sogenannten Health Eating Index).
Mit den für einen Zeitraum bis zu 34 Jahren vorhandenen Daten der "Nurses' Health Study" (1980-2014; n=78 865) und der "Health Professionals Follow-up Study" (1986-2014, n=44 354) identifizierten die WissenschaftlerInnen dann die Sterblichkeitshäufigkeit (42.167 Todesfälle) nach der Höhe des Gesamtwertes der verhaltensbezogenen Faktoren.
Die wichtigsten Ergebnisse sahen so aus:
• Jeder der Faktoren wirkte sich signifikant auf die Gesamtsterblichkeit und das Risiko an Krebs oder einem kardiovaskulären Ereignis zu versterben aus.
• Wer bei allen 5 Faktoren positive Werte hatte, verringerte sein Gesamtsterblichkeits-Risiko gegenüber denjenigen, die dies bei allen Faktoren nicht schafften, um 74%.
• Die weitere Lebenserwartung von 50-jährigen Personen, die rauchten, übermäßig Alkohol tranken, Übergewicht hatten, sich zu wenig bewegten und sich schlecht ernährten, betrug 29 Jahre für Frauen und 25,5 Jahre für Männer. Frauen, die sämtliche dieser Risiken vermieden, hatten dagegen eine weitere Lebenserwartung von 43,1 Jahren, lebten also rund 14 Jahre länger. Männer mit ebenfalls geringem Verhaltensrisiko lebten durchschnittlich noch 37,6 Jahre, also noch rund 12 Jahre länger als Männer mit hohen Verhaltensrisiken.
Obwohl der Schwerpunkt der empirischen Analyse auf den möglichen Auswirkungen von Faktoren des Gesundheitsverhaltens liegt, weisen die AutorInnen zusätzlich auf die Bedeutung anderer eher verhältnisbezogener Faktoren hin: "There is still much potential for improvement in health and life expectancy, which depends not only on an individual's efforts but also on the food, physical, and policy environments."
Im Diskussionsteil des Aufsatzes deuten die AutorInnen unter Bezug auf andere Studien an, dass ähnliche Effekte auch in anderen Ländern wie z.B. in Deutschland existieren könnten.
Der mit Anhang 28 Seiten umfassende Aufsatz Impact of Healthy Lifestyle Factors on Life Expectancies in the US Population von Yanping Li, An Pan, Dong D. Wang, Xiaoran Liu, Klodian Dhana, Oscar H. Franco, Stephen Kaptoge, Emanuele Di Angelantonio, Meir Stampfer, Walter C. Willett, Frank B. Hu ist online in der Zeitschrift "Circulation" (137) erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 1.5.18
Wie häufig ist die Überversorgung mit nutzlosen oder schädlichen Leistungen und wie viel kostet das? Antworten aus WA und VA (USA)
 Über- und Fehlversorgung mit gesundheitlich nicht notwendigen, im besten Fall nutzlosen, im schlimmsten Fall aber für die PatientInnen schädlichen diagnostischen Tests und therapeutischen Interventionen ist eines der international wie national seit vielen Jahren beschriebenen (Haupt-)Probleme der Gesundheitssysteme entwickelter Länder.
Über- und Fehlversorgung mit gesundheitlich nicht notwendigen, im besten Fall nutzlosen, im schlimmsten Fall aber für die PatientInnen schädlichen diagnostischen Tests und therapeutischen Interventionen ist eines der international wie national seit vielen Jahren beschriebenen (Haupt-)Probleme der Gesundheitssysteme entwickelter Länder.
Bei aller Einigkeit wird die Anzahl der davon Betroffenen und der finanzielle Umfang der Überversorgung aber unterschiedlich bewertet, wenn dazu überhaupt halbwegs präzise Zahlen genannt werden.
Hier etwas Abhilfe zu schaffen, war das Anliegen einer Untersuchung der Behandlungsdaten von rund 2,4 Millionen bei privaten Krankenversicherungen versicherten Personen im US-Bundesstaat Washington im Zeitraum von Juli 2015 bis Juni 2016. Für diese Personen wurde mittels des Analyseinstruments "Health Waste Calculator" untersucht, wie häufig 47 diagnostische und therapeutische Leistungen erbracht wurden, die im Rahmen der "choosing wisely"-Initiative zahlreicher us-amerikanischen medizinischen Fachgesellschaften als potenziell unnütz oder schädlich bewertet wurden. Die Liste der Leistungen reicht von der wahllosen Verordnung von Antibiotika bei komplikationslosen Infektionen der oberen Atemwege über die Erstellung von Elektrokardiogrammen (EKG) bei symptomlosen und "low risk"-Patienten bis zu arthroskopischen Operationen zur Behandlung von Knien mit Osteoarthritis (die gesamte Liste findet sich im Anhang der hier vorgestellten Studie). Auf Basis der gesamten Behandlungsdaten wurde für jede dieser Leistungen bewertet, ob sie nützlich oder klinisch angemessen, wahrscheinlich verschwenderisch oder unangemessen oder sehr wahrscheinlich nicht notwendig bzw. Verschwendung war.
Die wichtigsten Ergebnisse lauten:
• 1,298 Millionen Personen erhielten eine oder mehrere der 47 Leistungen. 46,4% von ihnen erhielten Leistungen, die eindeutig unangemessen waren. Bei weiteren 1,5% waren sie wahrscheinlich unangemessen.
• Von den 758 Millionen US-Dollar, die sämtliche 47 Leistungen kosteten, wurden 32,9% für eindeutig unangemessene Leistungen ausgegeben.
• 11 der 47 Leistungen wurden als Schlüsselleistungen der Überversorgung bewertet. Darunter waren zu häufige Screenings auf Gebärmutterhalskrebs und alle bildgebenden Untersuchungen bei komplikationslosen Kopfschmerzen. Diese 11 Leistungen trugen zu 93% aller wahrscheinlich oder gesichert geringwertigen oder nutzlosen Leistungen bei. 578.503, also rund ein Viertel der 2,4 Millionen in der Studie betrachteten Personen erhielten mindestens eine dieser 11 Leistungen.
• So wurden ungefähr drei von vier jährlichen Screeninguntersuchungen auf Gebärmutterhalskrebs bei Frauen durchgeführt, die bereits vorher angemessen untersucht worden waren.
• Rund 85% aller Labortests, gesunde Patienten auf geringfügige und risikofreien Operationen vorzubereiten waren nicht notwendig.
• Bei 35% der 103.332 Personen, die screeningmäßig auf einen Vitamin D-Mangel untersucht wurden, war diese Untersuchung mangels Indikation völlig nutzlos und reine Verschwendung von 12 Millionen US-Dollar.
Weitere Beispiele für Überversorgung, aber auch Hinweise auf Limitationen der Daten und Vorschläge für das weitere Vorgehen finden sich in dem 27 Seiten umfassenden und im Februar 2018 veröffentlichten Bericht First, Do No Harm. Calculating Health Care Waste in Washington State erstellt von der "Washington Health Alliance" und der "Choosing Wisely initiative in Washington state", der komplett kostenlos erhältlich ist.
Für das weitere Vorgehen schlagen die VerfasserInnen der Studie u.a. vor:
• "The concepts of "choosing wisely" and shared decision-making must become the bedrock of provider-patient communications.
• We need to keep our collective "foot on the gas" to transition from paying for volume to paying for value in health care.
• Value-based provider contracts must include measures of overuse, and not just measures of access and underuse of evidence-based care."
Wer jetzt vielleicht meint, diese Verhältnisse seien regionaler Art oder in Washington State gäbe es eben viele "schwarze Schafe", muss diesen Gedanken zumindest für die USA aufgeben.
Beim einem vergleichbaren Einsatz des "Health Waste Calculator" bei 5,5 Millionen bei privaten Krankenversicherungen aber auch bei den öffentlichen Versicherungen Medicare und Medicaid versicherten Personen im US-Bundesstaat zeigte sich, dass 2014 1,7 Millionen Personen nutzlose Leistungen erhielten. Die Überversorgungs- oder Verschwendungsrate betrug 31%. Der Aufsatz Low-Cost, High-Volume Health Services Contribute The Most To Unnecessary Health Spending von John N. Mafi et al. ist im Oktober 2017 in der Zeitschrift "Health Affairs" (10: 1701-1704) erschienen. Ein Abstract ist kostenlos erhältlich.
Ob die Überversorgungsrate in Deutschland gleich hoch ist oder derartiges im "besten Gesundheitssystem der Welt" nicht existiert, lässt sich abschließend erst nach inhaltlich vergleichbaren Untersuchungen mit Abrechnungsdaten der GKV und der PKV beantworten. Die hohen Raten von sofortigen bildgebenden Untersuchungen bei Rückenschmerzen oder die immer noch große Anzahl von Antibiotikaverordnungen bei Atemwegsinfektionen sollten aber Anlass sein genauso intensiv hinzuschauen wie in Washington und Virginia.
Zum Schluss: Wie gesamte Überversorgungsraten aussehen, wenn also nicht nur die 47 Leistungen, sondern alle gesundheitsbezogen erbrachten Leistungen berücksichtigt würden, muss erst in umfassenderen Untersuchungen ermittelt werden.
Bernard Braun, 4.2.18
"Want a healthier population? Spend less on health care and more on social services" - in Kanada und anderswo
 Eigentlich ist das im Titel zugespitzte Ergebnis einer großen aktuellen Studie in Kanada über den Beitrag von medizinischer Versorgung und Sozialausgaben zur Gesundheit der Bevölkerung seit den Studien von Thomas McKeown (vgl. dazu als einen knappen Überblick zu den Positionen McKeown und ihre Debatte das komplett kostenlos erhältliche International Journal of Epidemiology, Volume 34, Issue 3, 1 June 2005), Michael Marmot (vgl. u.v.a. als Überblick den 2010 veröffentlichten 242-Seiten-Report The Marmot review final report: Fair society, healthy lives oder Richard Wilkinson (u.a. die WHO-Publikation Social determinants of health: the solid facts) ein sozialepidemiologisch "alter Hut".
Eigentlich ist das im Titel zugespitzte Ergebnis einer großen aktuellen Studie in Kanada über den Beitrag von medizinischer Versorgung und Sozialausgaben zur Gesundheit der Bevölkerung seit den Studien von Thomas McKeown (vgl. dazu als einen knappen Überblick zu den Positionen McKeown und ihre Debatte das komplett kostenlos erhältliche International Journal of Epidemiology, Volume 34, Issue 3, 1 June 2005), Michael Marmot (vgl. u.v.a. als Überblick den 2010 veröffentlichten 242-Seiten-Report The Marmot review final report: Fair society, healthy lives oder Richard Wilkinson (u.a. die WHO-Publikation Social determinants of health: the solid facts) ein sozialepidemiologisch "alter Hut".
Das Krankenversorgungssystem trägt danach nur mit deutlich unter 50% oder gar 30% zum gesundheitlichen Outcome entwickelter Gesellschaften bei. Da aber die geballte Macht der gesamten Gesundheitswirtschaft von niedergelassenen Ärzten über Kliniken und deren gesamtem Personal bis zu den Herstellern von gesundheitsbezogenen Produkten und Dienstleistungen diese Ergebnisse bewusst oder unbewusst ignoriert oder ganz simpel mit dem Hinweis auf individuelle Behandlungserfolge kranker Menschen das Gegenteil suggeriert und immer mehr "Geld ins System" zur Lösung gesundheitlicher Probleme als richtig propagiert, sind Replikationen auf aktueller empirischer Basis notwendig und hilfreich.
Die kanadische Studie ist eine retrospektive Längsschnittstudie über die Ausgaben für die traditionelle Gesundheitsversorgung und für soziale Maßnahmen für die BewohnerInnen von 9 der 10 kanadischen Provinzen über den Zeitraum von 1981 bis 2011. Als anerkannte abhängige Indikatoren für den gesundheitsbezogenen Outcome bzw. die Performanz von Gesundheitssystemen und der Bevölkerungsgesundheit wurden die potenziell vermeidbare Sterblichkeit (altersstandardisiert pro 100.000 EinwohnerInnen), die Kindersterblichkeit (pro 1.000 Lebendgeborene) und die Lebenserwartung zum Zeitpunkt der Geburt (in Jahren) untersucht.
Zu den zahlreichen nachdenkenswerten Ergebnissen (die differenzierten Berechnungen können in drei kostenlos erhältlichen zahlenmächtigen Anhängen im Detail nachvollzogen werden) der Vergleiche der Effekte beider Ausgabenarten gehört folgendes: Ein Anstieg der Sozialausgaben ist mit einer Abnahme der vermeidbaren Sterblichkeit um 0,034% und einer Zunahme der Lebenserwartung um 0,006% verbunden. Steigen die Gesundheitsausgaben um 1% steigt (!) die vermeidbare Sterblichkeit um 0,064% und gibt es keinen Effekt bei der Lebenserwartung.
Trotz einiger selbst referierten Einschränkungen zu der Möglichkeit kausaler Aussagen auf der Basis der benutzten Daten ("reverse causality" ist aber ausgeschlossen) und zur Verallgemeinerbarkeit für ein gesamtes Land halten die AutorInnen zweierlei fest:
• "Our sensitivity analysis … showed that social spending is associated with improvements in the population health variables, evidence of the notion that further spending on health may not improve population health outcomes as effectively as social spending. If social spending addresses the social determinants of health, then it is a form of preventive health spending and changes the risk distribution for the entire population rather than treating those who present with disease."
• Und die politische Empfehlung lautet daher konsequent: "Redirecting resources from health to social services, at the margin, is an efficient way to improve health outcomes." Was dies bedeutet zeigen die Angaben zu den jährlichen Prokopfausgaben von 930 CA-Dollar für soziale Leistungen und 2.900 CA-Dollar für Gesundheitsausgaben im Jahr 2011. Die Gesundheitsausgaben hatten im Untersuchungszeitraum zehnmal mehr zugenommen wie die Sozialausgaben.
Ob die Ergebnisse dieser Studie zumindest in Kanada die Prioritätensetzung bei öffentlichen Leistungen zur Verbesserung der Bevölkerungsgesundheit beeinflussen bleibt abzuwarten. In Deutschland ist dagegen der Lärm von Kassenärztlicher Bundesvereinigung oder Deutscher Krankenhausgesellschaft nach "mehr Geld ins System" oder Aufhebung der Budgetierung bestimmter ambulanter Leistungen dominant, gab die Gesetzliche Krankenversicherung im letzten Jahr noch nicht mal alle gesetzlich vorgeschriebenen Euros für Verhältnis/Setting-Prävention aus (1,63 Euro pro Versicherten statt der vorgeschriebenen 2 Euro) und sind viele Kommunen nicht (mehr) in der Lage den Status quo ihrer Sozialausgaben zu halten, geschweige denn ihn kräftig auszubauen.
Und wenn man ganz böse werden will, stehen in der GKV den knapp 500 Millionen Euro für Prävention (laut Präventionsbericht 2017) die rund 700 Millionen Euro gegenüber, welche die GKV in diesem Jahr für die scheinbar never-ending "Vorbereitung" der digitalen Infrastruktur für die elektronische Gesundheitskarte bezahlt.
Der Aufsatz Effect of provincial spending on social services and health care on health outcomes in Canada: an observational longitudinal study von Daniel J. Dutton, Pierre-Gerlier Forest, Ronald D. Kneebone und Jennifer D. Zwicker ist in der anerkannten Fachzeitschrift "Canadian Medical Association Journal (CMAJ)" vom 22. Januar 2018 erschienen (Volume 190, Issue 3: E66-E71) und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 23.1.18
Alter=schwere Sehbehinderung oder Blindheit? Inzidenz von Sehbehinderung und Erblindung durch Makuladegeneration nimmt stetig ab!
 Zum Inventar der Debatten über die altersbedingte "kränker werdende Gesellschaft" gehören eine Reihe von chronischen oder degenerativen Erkrankungen mit mehr oder weniger gravierenden Einschränkungen körperlicher, geistiger und sozialer Funktionen.
Zum Inventar der Debatten über die altersbedingte "kränker werdende Gesellschaft" gehören eine Reihe von chronischen oder degenerativen Erkrankungen mit mehr oder weniger gravierenden Einschränkungen körperlicher, geistiger und sozialer Funktionen.
Dazu gehört auch die so genannte Makuladegeneration, eine Erkrankung der Netzhaut des Auges, die im besseren Fall zu Sehunschärfen, im schlimmsten und nicht seltenen Fall zu hochgradiger Sehbehinderung und Blindheit führen kann.
Dass es sich dabei nicht um eine stetig wachsende und unvermeidliche Entwicklung oder gar eine alternsassoziierte Epidemie handelt, zeigt eine gerade veröffentlichte Studie in den USA.
Dort wurde das Risiko einer Makuladegeneration in mehreren Altersgruppen mit insgesamt 4.819 Personen untersucht, die entweder 1987/88 zwischen 43 und 84 Jahren oder in den Jahren 2005/2008 zwischen 21 und 84 Jahre alt waren. Mit der letzten Gruppe, der so genannten Baby-Boomer-Gruppe, verbinden sich generell die größten Befürchtungen für die Krankheitsentwicklung älter werdenden Menschen.
Die jeweilige mehrfach adjustierte (z.B. nach Alter, Geschlecht, Gesundheitszustand und Lebensgewohnheiten) 5-Jahres-Inzidenz für alternsassoziierter Makuladegeneration sank von 8,8% in der zwischen 1901-1924 geborenen ersten Gruppe, über 3% in der 1925-1945 geborenen Gruppe auf 1% in der zwischen 1946 und 1964 geborenen Baby-Boomergruppe und sogar auf 0,3% in der so genannten Generation X (zwischen 1965 und 1984 geboren). Da die StudienteilnehmerInnen überwiegend Weiße waren, können die Ergebnisse allerdings - so die AutorInnen - nicht ohne weiteres für Angehörige anderer Ethnien verallgemeinert werden.
Zur gesundheitspolitischen Relevanz halten die AutorInnen folgendes fest: "Factors that explain this decline in risk are not known. However, this pattern is consistent with reported declines in risks for cardiovascular disease and dementia, suggesting that aging Baby Boomers may experience better retinal health at older ages than did previous generations."
Die Studie Generational Differences in the 5-Year Incidence of Age-Related Macular Degeneration. von
K.J. Cruickshank et al. ist "online first" am 16. November 2017 in der Fachzeitschrift "JAMA Ophthalmology" erschienen.
Bernard Braun, 27.11.17
Grenzen des Zugangs zur gesundheitlichen Versorgung von objektiv Bedürftigen im "sozialen Europas" größer als erwartet.
 In vielen bevölkerungsrepräsentativen Studien über die gesundheitliche Versorgung sind die ärmsten und eigentlich versorgungsbedürftigsten EinwohnerInnen aus verschiedenen Gründen unter- oder gar nicht repräsentiert.
In vielen bevölkerungsrepräsentativen Studien über die gesundheitliche Versorgung sind die ärmsten und eigentlich versorgungsbedürftigsten EinwohnerInnen aus verschiedenen Gründen unter- oder gar nicht repräsentiert.
Was damit gar nicht in den Blick selbst kritischer Analysen gerät, zeigt nun eine Veröffentlichung der Ergebnisse von Befragungen oder anderen Erhebungs- und Dokumentationsmethoden von europaweit 43.286 Personen bzw. PatientInnen, die in irgendeiner Weise mit Mitgliedern der Initiative "Ärzte der Welt" und vergleichbarer Nichtregierungsorganisationen standen.
Die NutzerInnen der Dienste dieser Einrichtungen sind bereits ein Beleg, dass die Annahme, alle europäischen Länder gewährleisteten einen ungehinderten Zugang zur gesundheitlichen Versorgung für viele dort Lebenden nicht stimmt.
Die allgemeinste Erkenntnis der Befragung dieser Menschen bestätigt dies drastisch: 55,2% von ihnen sagten, sie hätten überhaupt keinen gesicherten Zugang zur Gesundheitsversorgung in ihren jeweiligen Aufenthaltsländern.
Mit 79,1% stellten die MigrantInnen aus Nicht-EU-Ländern (13% aus Syrien) die bei weitem die stärkste und auch am meisten durch Zugangsprobleme betroffene Gruppe. Aber auch 12,1% der StaatsbürgerInnen der jeweiligen Länder und 7,5% der Migranten aus EU-Ländern mussten um den Zugang zur Gesundheitsversorgung kämpfen oder erhielten ihn nicht.
Neben einer Fülle weiterer sozio-demografischer Charakteristika und des Gesundheitszustandes dieser Personen liefert der Report ähnlich wie die Reports in den letzten Jahren auch eine differenzierte Einblicke in die Lebensumstände dieser noch laufend wachsenden Personengruppe mitten in Europa.
Diese sahen u.a. so aus:
— 38,9% der PatientInnen hatten kein verlässliches soziales Netzwerk,
— 54,6% hatten lediglich begrenzte Kenntnisse der Landessprache.
— Die Migranten aus EU-Ländern sind am ärmsten und leben am häufigsten in sozialer Isolation und ohne Wohnung.
— 61,7% waren von ihren Kindern unter 18 Jahren getrennt.
— Auf die Frage nach den Ursachen oder Gründen für den fehlenden Zugang zur Gesundheitsversorgung gaben 18,9% an, sie würden es gar nicht (mehr) versuchen und von denjenigen, die es versuchten, scheiterten 17% an administrativen Hürden oder an ihrer Unfähigkeit, das Gesundheitssystem zu verstehen und dann nutzen zu können.
In Kenntnis dieser Befragung und selbst dann, wenn sie inhaltliche und methodische Mängel und Schwachstellen enthält, kann niemand mehr sagen, man wisse nichts über die gesundheitsbezogenen Lebensumstände dieser Menschengruppe im "sozialen Europa".
Der 50 Seiten umfassende äußerst detaillierte 2017 Observatory Report Falling through the cracks: The failure of Universal Healthcare Coverage in Europe von Ärzte der Welt und anderen (European Network to Reduce Vulnerabilities in Health) ist komplett kostenlos herunterladbar.
Bernard Braun, 16.11.17
Welche Erwartungen haben Ärzte zum Nutzen und zu Nachteilen von Screenings, Behandlungen und Tests und sind sie korrekt? Oft nicht
 Bei Entscheidungen von Ärzten über die Diagnostik und Behandlung von PatientInnen spielen u.a. auch ihre Erwartungen zu deren möglichem Nutzen und Nachteilen oder unerwünschten Wirkungen eine wichtige Rolle. Wie viel der Ärzte aber welche Erwartungen haben und daraus möglicherweise praktische Handlungsschritte ableiten, war bisher nicht klar.
Bei Entscheidungen von Ärzten über die Diagnostik und Behandlung von PatientInnen spielen u.a. auch ihre Erwartungen zu deren möglichem Nutzen und Nachteilen oder unerwünschten Wirkungen eine wichtige Rolle. Wie viel der Ärzte aber welche Erwartungen haben und daraus möglicherweise praktische Handlungsschritte ableiten, war bisher nicht klar.
Dies ändern jetzt die Ergebnisse eines systematischen Reviews von 48 Studien, an denen 13.011 überwiegend us-amerikanische ÄrztInnen beteiligt waren, erheblich.
Die Ergebnisse im Einzelnen:
• 20 der 48 Studien konzentrierten sich auf Behandlungen, 8 auf Screening, und weitere 20 auf bildgebende Diagnostik.
• 67% der Studien bewerteten ausschließlich Erwartungen von Nachteilen, 20% Erwartungen von Nutzen und 13% Erwartungen von Nutzen und Nachteilen.
• In den Studien, welche die Häufigkeit der Erwartungen von Nutzen mit der aus wissenschaftlich-medizinischer Sicht korrekten Antwort verglichen, lieferten die meisten der StudienteilnehmerInnen nur bei 3 von 28 untersuchten Behandlungen, Tests etc. (11%) eine korrekte Bewertung oder Einschätzung.
• Beim Vergleich der Erwartung von unerwünschten Wirkungen der befragten Ärzte bei 69 Outcomes mit den korrekten Antworten bewertete die Mehrheit der Ärzte nur bei 9 (13%) der Outcomes die nachteilige Wirkung korrekt.
• Alles in allem überschätzten die ÄrztInnen den Nutzen von 32% näher betrachteten Maßnahmen und unterschätzten den Nutzen bei 9% dieser Maßnahmen. Genau umgekehrt sah es bei erwarteten Nachteilen aus: Bei 34% der dazu untersuchten Maßnahmen unterschätzten die Ärzte die Nachteile und überschätzten den Nachteil bei 5% der Tests etc.
Die australischen Wissenschaftler fassen diese Ergebnisse so zusammen: "Clinicians rarely had accurate expectations of benefits or harms, with inaccuracies in both directions. However, clinicians more often underestimated rather than overestimated harms and overestimated rather than underestimated benefits. Inaccurate perceptions about the benefits and harms of interventions are likely to result in suboptimal clinical management choices."
Der in der programmatischen Rubrik "Less is more" im März 2017 veröffentlichte Aufsatz Clinicians' Expectations of the Benefits and Harms of Treatments, Screening, and Tests. A Systematic Review von Tammy C. Hoffmann und Chris Del Mar ist in der Fachzeitschrift "JAMA Intern Med." (2017;177(3):407-419) veröffentlicht worden und das Abstract ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 8.5.17
Serie zur Geschichte, Methodik und Leistungsfähigkeit klinischer Studien im "New England Journal of Medicine" gestartet
 Im Juni 2016 startete in der Medizin-Fachzeitschrift "New England Journal of Medicine" unter dem Titel "The Changing Face of Clinical Trials" und u.a. mit dem Beitrag Clinical Trials Series von Janet Woodcock, James H. Ware, Pamela W. Miller, John J.V. McMurray, David P. Harrington und Jeffrey M. Drazen (NEJM 375: 501-504) eine Publikationsreihe zur Methodik, Leistungsfähigkeit und Geschichte klinischer Studien.
Im Juni 2016 startete in der Medizin-Fachzeitschrift "New England Journal of Medicine" unter dem Titel "The Changing Face of Clinical Trials" und u.a. mit dem Beitrag Clinical Trials Series von Janet Woodcock, James H. Ware, Pamela W. Miller, John J.V. McMurray, David P. Harrington und Jeffrey M. Drazen (NEJM 375: 501-504) eine Publikationsreihe zur Methodik, Leistungsfähigkeit und Geschichte klinischer Studien.
Eine große Rolle spielen dabei die sogenannten randomisierten kontrollierten Studien (RCTs). So beschäftigte sich bereits ein erster Aufsatz von Laura Bothwell et al. in der NEJM-Ausgabe vom 2. Juni 2016 (374: 2175-2181) mit dem Thema Assessing the Gold Standard — Lessons from the History of RCTs. Ein Beitrag von Laura Bothwell und Scott Podolsky beschäftigt sich im Schwerpunkt "History of Clinical Trials" in der NEJM-Ausgabe vom 11. August 2016 (375:501-504) mit dem Thema The Emergence of the Randomized, Controlled Trial. Der Text wird durch ein Interview über die Entwicklung der wesentlichen Methoden von RCTs zwischen dem Autor Podolksky und Stephen Morrissey, dem NEJM-Managing Editor, ergänzt.
Wer sich schnell einen Überblick über die verschiedenen Methoden klinischer Studiuen verschaffen will, sollte auf die genannten und die weiteren Beiträge der Serie achten.
Bernard Braun, 12.8.16
Weniger fettes Essen=weniger Herzinfarkttote!? Beispiel für von Beginn an fehlende Evidenz für zu einfache Gesundheitsempfehlungen
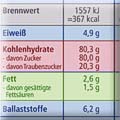 Es vergeht kein Jahr in dem nicht mit diversen methodisch einfachen Studien ein Nahrungsmittel oder seine wesentlichen Bestandteile, eine Bewegungsart oder sonstige Stoffe und Verhaltensweisen als lebensqualitätsverbesserndes oder lebensverlängerndes Mittel angepriesen wird. Und wenn dies nur lang genug und werbewirksam geschieht, tauchen viele dieser Mittel auch in Leitlinien und offiziösen Empfehlungen staatlicher Gesundheitsinstitute und in einer schier unüberschaubaren Vielzahl von Gesundheitsratgebern oder Krankenkassen-Magazinen auf. Und wenn sie erst einmal dort stehen, wird der tatsächliche Nutzen von "low cholesterol", "low fat", "no fat", Broccoli oder "no saturated fat" nicht mehr überprüft.
Es vergeht kein Jahr in dem nicht mit diversen methodisch einfachen Studien ein Nahrungsmittel oder seine wesentlichen Bestandteile, eine Bewegungsart oder sonstige Stoffe und Verhaltensweisen als lebensqualitätsverbesserndes oder lebensverlängerndes Mittel angepriesen wird. Und wenn dies nur lang genug und werbewirksam geschieht, tauchen viele dieser Mittel auch in Leitlinien und offiziösen Empfehlungen staatlicher Gesundheitsinstitute und in einer schier unüberschaubaren Vielzahl von Gesundheitsratgebern oder Krankenkassen-Magazinen auf. Und wenn sie erst einmal dort stehen, wird der tatsächliche Nutzen von "low cholesterol", "low fat", "no fat", Broccoli oder "no saturated fat" nicht mehr überprüft.
Dass dies Millionen von Menschen desinformiert, zu weitgehend nutzlosem Verhalten verführt und warum eine systematische Überprüfung der Evidenz solcher Gesundheitstipps auf der Basis von methodisch guten Studien viel Unsinn vermeiden oder korrigieren kann, zeigt ein jetzt veröffentlichter systematischer Review der Studienlage zu Beginn der Einführung von Nahrungsmittelfett-Leitlinien in den USA und Großbritannien in den Jahren 1977 und 1983. Die an damals 220 Millionen US-Amerikaner und 56 Millionen Briten gerichteten nationalen und regierungsamtlichen Empfehlungen basierten auf der festen Annahme, dass eine Reduktion der Aufnahme von Fett durch Nahrungsmittel zu einer Reduktion der Sterblichkeit an der koronaren Herzkrankheit führen würde.
Schottische und walisische Wissenschaftler untersuchten im Jahr 2015, also 39 und 33 Jahre nach der Veröffentlichung und dem Start einer Erfolgsgeschichte dieser Leitlinien, in einem systematischen Review, ob Daten aus randomisierten kontrollierten Studien oder prospektiven Kohortenstudien vor der Erstellung dieser Empfehlungen die Evidenz für sie lieferten bzw. hätten liefern können.
Ihr Schluss nach der Sichtung von 6 Studien mit 31.445 Teilnehmern: "we found no support for the recommendations to restrict dietary fat", da keine dieser Studien eine statistisch signifikante Beziehung zwischen der Sterblichkeit an koronarer Herzkrankheit und der gesamten Aufnahme von Nahrungsmittelfetten - auch von so genannten gesättigten Fettsäuren - aufzeigte. Hinzu kommt, dass die damals vorliegenden Studien ausschließlich mit Männern gemacht wurden. Selbst wenn ihre Ergebnisse also anders ausgesehen hätten, hätten daraus keine bevölkerungsweiten Empfehlungen abgeleitet werden dürfen.
Angesichts der existierenden Fülle ähnlicher Empfehlungen lohnen sich vergleichbare systematische Reviews vor allem für diejenigen Kranken oder Gesunden, die ihnen mit hohen präventiven oder kurativen Erwartungen folgen und darüber möglicherweise wirklich hilfreiche Mittel nicht nutzen. Dies bedeutet nicht, dass umgekehrt die folgenlose Aufnahme großer Mengen von Fett jedweder Art gerechtfertigt ist, sondern nur, dass dies nicht todsicher zum Herzinfarkt führt.
Die aktuellste Fassung des Reviews Evidence from prospective cohort studies did not support the introduction of dietary fat guidelines in 1977 and 1983: a systematic review von Zoë Harcombe et al. ist am 29. Juni 2016 online in der Zeitschrift "British Journal of Sports Medicine" erschienen. Sein Abstract ist kostenlos.
Eine komplett kostenlose, etwas ältere und inhaltlich leicht unterschiedliche Fassung des Reviews ist bereits 2015 unter dem Titel Evidence from randomised controlled trials did not support the introduction of dietary fat guidelines in 1977 and 1983: a systematic review and meta-analysis ebenfalls mit den AutorInnen Zoë Harcombe et al. in der Zeitschrift "Open Heart" (2(1) erschienen.
In derselben Ausgabe weist der Autor Rahul Bahl auf die methodischen (z.B. Grenzen der Ergebnisfähigkeit von RCTs durch zu geringe Teilnehmeranzahl oder zu kurze Interventionszeit- und follow-up-Zeit; Schwäche von Meta-Analysen aufgrund der Schwäche der inkludierten Einzelstudien) und inhaltlichen Schwachstellen der Studie von Harcombe et al. hin und (The evidence base for fat guidelines: a balanced diet), bestätigt aber im Grunde die Kritik an den vielfach evidenzfreien oder zu einfach gestrickten oder einfaktoriellen Empfehlungen und verbaut auch gleich das beliebte Spiel, bei Kritik an der Evidenz für den Nutzen des einen Stoffes auf einen anderen umzusteigen: "There is certainly a strong argument that an overreliance in public health on saturated fat as the main dietary villain for cardiovascular disease has distracted from the risks posed by other nutrients such as carbohydrates. Yet replacing one caricature with another does not feel like a solution. It is plausible that both can be harmful or indeed that the relationship between diet and cardiovascular risk is more complex than a series of simple relationships with the proportions of individual macronutrients." Dieser Kommentar ist ebenfalls komplett kostenlos erhältlich.
Ähnliche Argumente finden sich in dem materialreichen Beitrag Saturated fat: guidelines to reduce coronary heart disease risk are still valid des britischen Ernährungswissenschaftlers Bruce Griffin in der Zeitschrift der britischen "Royal Pharmaceutical Society" "The Pharmaceutical Journal" vom 8. April 2015. Dessen Schluss steht nicht nur im Gegensdatz zu manchen vorherigen methodischen Einwänden, sondern wirkt dann aber doch zu salomonisch: "Despite recent studies suggesting no link between saturated fat and CHD (koronare Herzerkrankungen), once you scrutinise the evidence, there is no question that too much saturated fat is bad for your health. Of course, a balanced nutritious diet remains the best way to prevent CHD and metabolic diseases (z.B. Diabetes)." Wie der Titel des Beitrags signalisiert, plädiert Griffin aber uneingeschränkt für die Fortexistenz der bisherigen Fett-Leitlinien in den USA und Großbritannien.
Dass Harcombe et al. mit ihrer Kritik an der mangelnden Evidenz der US-/UK-Fettleitlinien nicht allein sind, zeigen schließlich auch noch die Ergebnisse eines weiteren aktuellen systematischen Reviews und einer Meta-Analyse von neueren Beobachtungsstudien über mögliche Zusammenhänge des Verzehrs gesättigter Fettsäuren und ungesättigter so genannten Trans-Fettsäuren oder Transfetten mit der Gesamtsterblichkeit bzw. der Sterblichkeit an koronaren Herzerkrankungen, Schlaganfall und Typ 2 Diabetes.
Die Ergebnisse lauten zusammengefasst so: "The certainty of associations between saturated fat and all outcomes was "very low." The certainty of associations of trans fat with CHD outcomes was "moderate" and "very low" to "low" for other associations."
In Kenntnis der bisherigen Debatten weisen die AutorInnen vorsorglich darauf hin, bei künftigen Vorschlägen z.B. zum Ersatz von gesättigten Fettsäuren oder Transfetten sorgfältig die gesundheitlichen Effekte der Alternativprodukte zu prüfen.
Die am 12. August 2015 online in der Fachzeitschrift "British Medical Journal" veröffentlichte Studie Intake of saturated and trans unsaturated fatty acids and risk of all cause mortality, cardiovascular disease, and type 2 diabetes: systematic review and meta-analysis of observational studies von Russell de Souza et al. ist komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 4.7.16
Ungleichheit in der palliativen Behandlung am Beispiel von Schlaganfall- und Krebspatienten in Schweden
 Bei einer Reihe von schweren Erkrankungen ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ein Teil der Erkrankten innerhalb kurzer Zeit sterben wird. Sowohl professionelle Helfer aber auch Laien sind daher auf palliative Unterstützung vorbereitet und wissen womit diesen Patienten in der Zeit vor ihrem Tod geholfen werden kann. Zu erwarten wäre, dass dies für sämtliche schwer Erkrankten der Fall ist.
Bei einer Reihe von schweren Erkrankungen ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ein Teil der Erkrankten innerhalb kurzer Zeit sterben wird. Sowohl professionelle Helfer aber auch Laien sind daher auf palliative Unterstützung vorbereitet und wissen womit diesen Patienten in der Zeit vor ihrem Tod geholfen werden kann. Zu erwarten wäre, dass dies für sämtliche schwer Erkrankten der Fall ist.
Eine in Schweden durchgeführte Studie mit Daten des "Palliative Care Registers" (hier werden eine Fülle von Details der palliativen Behandlung aller Patienten dokumentiert) zeigt aber, dass dies nicht immer der Fall ist bzw. sein muss. Beim Vergleich der "End of Life"-Behandlung von je 1.626 Krebs- und Schlaganfallpatienten zeigten sich erhebliche Wissens- und Behandlungsunterschiede zu Ungunsten der letzteren.
Dass der Bedarf für Personen, die einen Schlaganfall erleiden vorhanden ist, zeigt die Tatsache, dass rund 20 Prozent von ihnen innerhalb einer Woche sterben und 40 Prozent innerhalb eines Jahres.
Bei Schlaganfallpatienten hatten die Helfer laut der Studie u.a. Schwierigkeiten zu berücksichtigen, ob die Patienten jemand hatten, den sie in den letzten Tagen bei sich haben wollten, sie wussten wesentlich seltener als bei Krebspatienten ob die Patienten Wünsche zum Ort ihres Sterbens hatten oder ob sie Schmerzen hatten. Letzteres ist auf dem Hintergrund problematisch, weil andere Studien zeigten, dass 43 oder sogar mehr Prozent der Patienten mit Schlaganfall Schmerzen haben, in dem analysierten Register war dies aber nur für 5 Prozent eingetragen und damit wahrscheinlich auch behandlungsrelevant. Schließlich wurde mit diesen Patienten und ihren Angehörigen auch wesentlich seltener als mit Krebskranken so genannte "turning point"-Gespräche zu dem Zeitpunkt geführt, wo an Stelle einer kurativen die palliative Behandlung tritt. Diese Gespräche wurden bei 69 Prozent der Schlaganfallpatienten und bei 24 Prozent der Krebspatienten nicht geführt.
Die bei ausländischen Studien obligatorische Frage, ob deren Ergebnisse auch für Deutschland gelten, ist mangels vergleichbarer Registerdaten seriös nicht zu beantworten. Trotzdem sollten sie Anlass sein, derartige Ungleichheiten auch in der palliativen Versorgung in Deutschland nicht auszuschließen oder mit geeigneten Methoden sie zu identifizieren oder auszuschließen.
Die Studie End of Life Care for Patients Dying of Stroke: A Comparative Registry Study of Stroke and von Heléne Eriksson, Anna Milberg, Katarina Hjelm, Maria Friedrichsen ist im März 2016 in der Fachzeitschrift "PLOS ONE" (11 (2)) erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 13.3.16
Wissenschaftliche Fachgesellschaften: Eigeninteressen vor Evidenz?
 Führt eine neue Behandlung oder Vorgehensweise im Vergleich zum bisherigen Standard zu besseren Ergebnissen, sollte dies unmittelbar in die Praxis umgesetzt werden. Die besseren Vorgehensweisen sollten in die Praxis "diffundieren" und die überholten aus der Praxis verschwinden ("undiffusion"). Der Begriff "undiffusion" ist dem Konzept von Rogers nachempfunden, der das Konzept der Diffusion von Innovationen entwickelt hat (Diffusionstheorie). Vielleicht macht es in deutscher Übersetzung Sinn vom Hineindiffundieren von Innovationen in ein System und dem Hinausdiffundieren überholter Praktiken aus dem System zu sprechen.
Führt eine neue Behandlung oder Vorgehensweise im Vergleich zum bisherigen Standard zu besseren Ergebnissen, sollte dies unmittelbar in die Praxis umgesetzt werden. Die besseren Vorgehensweisen sollten in die Praxis "diffundieren" und die überholten aus der Praxis verschwinden ("undiffusion"). Der Begriff "undiffusion" ist dem Konzept von Rogers nachempfunden, der das Konzept der Diffusion von Innovationen entwickelt hat (Diffusionstheorie). Vielleicht macht es in deutscher Übersetzung Sinn vom Hineindiffundieren von Innovationen in ein System und dem Hinausdiffundieren überholter Praktiken aus dem System zu sprechen.
Im JAMA Internal Medicine wurden am 15.3.2015 3 Studien zum Thema "undiffusion of established practices" veröffentlicht. Diese Studien zeigen, dass der Vorgang der "undiffusion", also die Abkehr von überholten Praktiken, häufig nicht geradlinig verläuft, zum Nachteil der Patienten.
Die Aufgabe von medizinischen Fachgesellschaften besteht darin, neues wissenschaftliches Wissen zu verbreiten und zu einer bestmöglichen Versorgung der Patienten beizutragen. Sie spielen somit eine entscheidende Rolle beim Transfer von Evidenz in die Praxis.
Anhand von 20 Forschungsergebnissen, die eine Abkehr von der bisherigen Praxis nahelegten, hat eine australische Forschergruppe untersucht, inwieweit medizinische Fachgesellschaften diesem Auftrag nachkommen. Sie überprüften, ob Fachgesellschaften in ihren ersten Stellungnahmen nach Veröffentlichung der entsprechenden Studie, die neuen Erkenntnisse befürwortete oder die Beibehaltung des bisherigen überholten Standards empfahlen.
Drei Beispielen seien genannt.
• Die Hormontherapie in den Wechseljahren galt aufgrund der Ergebnisse einer Kohortenstudie als effektiv in der Minderung des Herzinfarktrisikos. Eine randomisierte kontrollierte Studie (RCT) aus dem Jahr 1998 widerlegte dieses Ergebnis, eine weitere RCT aus 2002 zeigte gravierende Schäden auf.
• Das Einsetzen von Paukenröhrchen (Tympanostomie), ist eine lange geübte Praxis bei chronischer Mittelohrentzündung bei Kindern zur Verhinderung von Entwicklungsstörungen, die sich allein auf pathophysiologische Annahmen gründete. Eine RCT aus 2001 ergab, dass der Eingriff ineffektiv ist.
• Das Einsetzen einer Gefäßprothese (Stent) bei stabiler koronare Herzkrankheit galt als effektiv in der Minderung des Sterberisikos und des Herzinfarktrisikos. Die Annahme war abgeleitet aus der in RCTs erwiesenen Effektivität des Stents bei der akuter koronarer Herzkrankheit. Eine RCT aus dem Jahr 2007 widerlegte diese Annahme für die nicht-akute, stabile koronare Herzkrankheit (s.a. Forum).
Bei den 20 Beispielen handelt es sich um 12 medizinische Therapien, 5 prozedurale Standards und 3 Früherkennungsuntersuchungen.
Ausgewertet wurden insgesamt 156 Reaktionen von Fachgesellschaften, davon 77 Leitlinien, 54 Stellungnahmen, 17 Pressemitteilungen, 5 Reports und 3 Reviews.
In 77 der Reaktionen befürworteten die jeweiligen Fachgesellschaften den etablierten (aber überholten) Standard, 31 waren neutral und 48 unterstützten die neuen Erkenntnisse.
Das alle oder zumindest einige der Patienten weiterhin nach dem bisherigen Standard behandelt werden sollten, war die Aussage von 85 Reaktionen, 23 waren diesbezüglich neutral und 48 empfahlen, keinen Patienten wie bisher zu behandeln.
Vorab waren die bisherigen Standards danach bewertet worden, ob sie für die Mitglieder der Fachgesellschaften von geringer, mittlerer oder hoher Wichtigkeit waren. Der Widerstand gegen Veränderung war bei hoher Bedeutung für die Mitglieder deutlich stärker.
Die Untersuchung zeigt somit, dass medizinische Fachgesellschaften an etablierten aber durch neue Evidenz widerlegten oder in Frage gestellten Praktiken häufig festhalten, und zwar in besonderem Maße, wenn es sich um für sie selbst wichtige Praktiken handelt. Das Evidenzniveau zeigt keinen Einfluss auf die Urteilsbildung.
Wang MM, Gamble G, Grey A. Responses of specialist societies to evidence for reversal of practice. JAMA Internal Medicine 2015 Abstract
In einer weiteren Studie zeichnen Eagle et al. einige Beispiele der Hinein- und Hinausdiffusion von Untersuchungsmethoden in der perioperativen Medizin in den letzten 3 Jahrzehnten nach, so z.B. den "Aufstieg und Fall" der präoperativen Untersuchung auf das Vorliegen einer koronaren Herzkrankheit bei Patienten, die keine Herzbeschwerden haben.
Eagle KA, Vaishnava P, Froehlich JB. Perioperative cardiovascular care for patients undergoing noncardiac surgical intervention. JAMA Internal Medicine 2015. Abstract
Niven etv al. belegen mit den Daten eines großen Registers die über Jahre allmähliche Zunahme einer strikten Blutzuckerkontrolle bei Patienten auf Intensivstationen nach Veröffentlichung einer Studie im Jahr 2001, die eine Minderung der Sterblichkeit bei strikter Blutzucker-Kontrolle zu ergeben schien. Nach Veröffentlichung einer größeren und verlässlicheren Studie im Jahr 2009, die eine Erhöhung der Sterblichkeit bei strikter Blutzucker-Kontrolle ergab, stoppte der bis dahin kontinuierliche Anstieg plötzlich, ohne aber zu sinken.
Niven DJ, Rubenfeld GD, Kramer AA, et al. Effect of published scientific evidence on glycemic control in adult intensive care units. JAMA Internal Medicine 2015. Abstract
In einem Kommentar weist Frank Davidoff vom Dartmouth Institute auf das geringe Interesse der Forschung am Hinausdiffundieren überholter Praktiken aus dem Versorgungssystem hin. Eine auf rationaler Analyse beruhende Urteilsbildung scheine bei Ärzten (wie bei den meisten Menschen) und ihren Fachgesellschaften anfällig für Bias zu sein, wie Leugnung, Peer pressure, Optimismus, Patientenerwartungen und finanzielle Erwägungen. Auch die Verlustaversion spiele eine Rolle.
Um die Notwendigkeit des Hinausdiffundierens zu minimieren, empfiehlt er die schrittweise Einführung von Innovationen unter Studienbedingungen. Weiterhin sollten Studien untersuchen, ob die Interventionseffekten Heterogenität zeigen, also in unterschiedlichen Untergruppen von Patienten unterschiedlich ausfallen.
Davidoff F. On the undiffusion of established practices. JAMA Internal Medicine 2015 Abstract
David Klemperer, 19.8.15
Wie intensiv wird das Gesundheitssystem in Anspruch genommen und geschieht dies zu oft? Daten aus Österreich, Schweden und den USA
 Zur Diskussion über die Inanspruchnahme ambulanter und stationärer gesundheitlicher Dienstleistungen insbesondere in Sozialversicherungssystemen ŕ la Deutschland und Österreich gehört häufig das Stereotyp, dort würden viel zu viele Versicherte viel zu oft mit jedem Wehwechen eine Arztpraxis oder ein Krankenhaus aufsuchen. Ob es die behauptete Über- oder Fehl-Inanspruchnahme bzw. den Missbrauch wirklich gibt, wird meist nur plausibel suggeriert und selten differenziert empirisch belegt.
Zur Diskussion über die Inanspruchnahme ambulanter und stationärer gesundheitlicher Dienstleistungen insbesondere in Sozialversicherungssystemen ŕ la Deutschland und Österreich gehört häufig das Stereotyp, dort würden viel zu viele Versicherte viel zu oft mit jedem Wehwechen eine Arztpraxis oder ein Krankenhaus aufsuchen. Ob es die behauptete Über- oder Fehl-Inanspruchnahme bzw. den Missbrauch wirklich gibt, wird meist nur plausibel suggeriert und selten differenziert empirisch belegt.
Die im Jahr 2011 durchgeführte Studie "Ecology of Medical Care - Utilisation of Health Care in Austria (ECOHCARE)" und ihre am 23. November 2014 veröffentlichten Ergebnisse liefern hierzu aber nun eine Menge interessanter Daten.
Zu den wesentlichen Charakteristika des österreichischen Gesundheitssystems gehört ein umfassender Versicherungsschutz und die praktisch uneingeschränkte Freiheit der Arzt- bzw. Behandlerwahl. Hinzu kommt, dass das primärärztliche Behandlungssystem anders als in einigen anderen privatwirtschaftlichen oder steuerfinanzierten Gesundheitssystemen keine "gate keeping"- bzw. Steuerungsfunktionen für den Zugang zu anderen Behandlungssektoren hat.
Wie die Inanspruchnahme verschiedener Gesundheitsleistungen unter diesen Bedingungen aussieht, untersuchte die ECOHCARE-Studie für die Dauer eines Monats durch die systematische Befragung von 3.500 Österreichern über 16 Jahren.
Die wichtigsten Ergebnisse sehen so aus:
• 64,6% (n=646) der 1.000 Befragten berichten innerhalb des Untersuchungsmonats irgendeine Art von Gesundheitsbeschwerde.
• 53% (n=530) der Befragten überlegten, sich in medizinische Behandlung zu begeben.
• 460 oder 46% der Befragten suchten dann wirklich eine medizinische Behandlungsmöglichkeit und erhielten sie wahrscheinlich auch. Dies bedeutet zunächst, dass keineswegs alle, sondern nur 71,2% der Befragten mit einer gesundheitlichen Beschwerde das Behandlungssystem in Anspruch genommen haben. Jedes Wehwehchen landet also auch unter den Bedingungen der freien Arztwahl nicht automatisch in einer Arztpraxis.
• 336 der Befragten suchten dann eine allgemeinärztliche Praxis, 206 eine fachärztliche ambulante Praxis auf. 78 konsultierten einen Facharzt in einer Krankenhausambulanz und 3 lagen zur Behandlung in einem Universitätsklinikum.
• Dank methodisch nahezu identischer Studien in andersartigen Gesundheits- und Behandlungssystemen zeigt ein Vergleich der österreichischen mit us-amerikanischen und schwedischen 1-Monatsprävalenzen der genannten Arten von Behandlungskontakten in Schweden und den USA deutlich geringere Häufigkeiten: In den USA litten 1996 zwar mit 800 von 1.000 StudienteilnehmerInnen mehr Personen innerhalb des Untersuchungsmonats an einer gesundheitlichen Störung. Von ihnen überlegten sich 327, medizinische Behandlung in Anspruch zu nehmen. 113 gingen zu einem Allgemeinarzt, 104 zu einem ambulanten Facharzt, 65 zu einem Anbieter alternativer medizinischer Leistungen, 13 suchten eine Notfallstation auf, 8 waren in stationärer Behandlung und weniger als ein Patient lag in einer Universitätsklinik. Im Jahr 2006 sah die Inanspruchnahme von 1.000 schwedischen BürgerInnen innerhalb eines durchschnittlichen Monats so aus: Nur 87 suchten einen allgemeinärztlichen Familienarzt auf, 44 sahen einen Facharzt in einer Krankenhausambulanz, 20 einen Arzt in einer Notfallstation, 12 lagen in einem örtlichen Krankenhaus und weniger als einer in einer Universitätsklinik.
Als einen Hauptgrund für die ihres Erachtens eindeutige und gesundheitlich nicht unproblematische (z.B. Risiko von Krankenhausinfektionen und Arzneimittelwechselwirkungen) Über-Inanspruchnahme insbesondere des fachärztlichen ambulanten und des stationären Sektors in Österreich, nennen die österreichischen Autoren die dortige Steuerungsschwäche des primärärztlichen Sektors (z.B. keine gate-keeper-Funktion) in Verbindung mit dem freien Zugang zu allen und insbesondere dem sekundären und tertiären Behandlungssektoren. Mit einer Stärkung der Primärärzte u.a. durch verbindliche "patient panels" und "practice lists" in Kombination mit inhaltlich fundiertem gate-keeping könnte die Zufriedenheit der Patienten zwar sinken, "but objective health measures should improve."
Der Aufsatz Unregulated access to health-care services is associated with overutilization—lessons from Austria von Otto Pichlhöfer und Manfred Maier ist am 23. November 2014 in der Fachzeitschrift "European Journal of Public Health" erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Der Aufsatz Ecology of medical care in a publicly funded health care system: A registry study in Sweden von Alberto Ferro und Per Kristiansson erschien bereits 2011 in der Zeitschrift "Scandinavian Journal of Primary Health Care" (29: 187-192) und ist ebenfalls komplett kostenlos erhältlich.
Der neuere (ein methodischer und inhaltlicher Vorläufer war bereits 1961 erschienen) Aufsatz The Ecology of Medical Care Revisited von Larry A. Green et al. ist 2001 im "New England Journal of Medicine" (344:2021-2025) erschienen. Ein Abstract ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 15.12.14
Der Datenfriedhof ist mittlerweile ganz schön lebendig oder Routinedaten in der Gesundheitsforschung
 Seitdem in den 1970er Jahren personenbezogene Daten zur Soziodemografie, ausgewählten Charakteristika der gesundheitlichen Lage und der gesundheitlichen Versorgung wie Behandlung für die rund 90% der Bevölkerung, die in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) versichert waren und sind, in elektronischer Form gespeichert werden, gab es Bemühungen, diesen Datenschatz nicht nur als Datenablage und für Abrechnungszwecke zu nutzen.
Seitdem in den 1970er Jahren personenbezogene Daten zur Soziodemografie, ausgewählten Charakteristika der gesundheitlichen Lage und der gesundheitlichen Versorgung wie Behandlung für die rund 90% der Bevölkerung, die in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) versichert waren und sind, in elektronischer Form gespeichert werden, gab es Bemühungen, diesen Datenschatz nicht nur als Datenablage und für Abrechnungszwecke zu nutzen.
Welche Möglichkeiten und Aktivitäten es gab und gibt, fasst nun ein rund 130 Seiten umfassendes Gutachten einer Reihe von Routine- oder Sekundärdatenforscher aus Köln und Magdeburg zusammen.
Es enthält u.a.
• eine Beschreibung der Daten der Sozialversicherungsträger GKV, SPV, GRV und GUV
• die Darstellung der Daten der amtlichen Statistik inklusive der Forschungsdatenzentren und der Gesundheitsberichterstattung des Bundes (z.B. Krankenhausstatistik, Todesursachenstatistik, Pflegestatistik, Schwerbehindertenstatistik sowie die Daten der Bundesanstalt für Arbeit
• eine Information über den Datenbeistand bei der Privaten Krankenversicherung
• eine kurze Darstellung der Datenbestände, die von einzelnen Akteuren oder Institutionen im Gesundheitswesen erhoben und gepflegt werden und die, sofern es sich um Primärerhebungen handelt, z.T. für Wissenschaftler für eine Sekundärnutzung zur Verfügung stehen (z.B. Daten der Kassenärztlichen Vereinigung, Daten des DAPI (Deutsches Arzneimittelprüfinstitut), Daten des Instituts für das Entgeltsystem im Krankenhaus - InEK-Institut, Survey- und Paneldaten, Nationale Kohorte
• Information über die Umsetzung des Datentransparenzparagraphen und den Datenbestand nach §§ 303a-e SGB V und
• Hinweise auf datenschutzrechtliche Regelungen, die Leitlinie Gute Praxis Sekundärdatenanalyse sowie auf ausgewählte Aspekte des Datenmanagements und der Operationalisierung von Fragestellungen.
Das im Auftrag des "Deutschen Instituts für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI)" erstellte Gutachten: Daten für die Versorgungsforschung. Zugang und Nutzungsmöglichkeiten von Ingrid Schubert et al. ist im Juli bzw. Oktober 2014 erschienen und kostenlos erhältlich.
Zu hoffen ist, dass nicht nur weitere NutzerInnen dieser Daten und Nutznießer der damit erhältlichen Erkenntnisse gewonnen werden, sondern deren Analysen auch dem dazu verfügbaren Stand des Wissens entsprechen.
Bernard Braun, 3.12.14
"Wenn Sie so weiter machen, kriegen Sie wahrscheinlich ohne Statine bald einen Herzinfarkt …." oder Irrtum des Risikokalkulators!?
 Bei der Kommunikation über die Folgen kardiologischer Risikofaktoren wie Blutdruck, Cholesterinwert und Übergewicht und bei Empfehlungen von entsprechenden als präventiv angesehenen Aktivitäten, spielen in Patient-Arztgesprächen relativ übersichtliche und leicht zu handhabende Kalkulatoren des Risikos an einer artheriosklerotischen Herzkreislauferkrankung zu erkranken oder durch ein ernstes kardiologisches Ereignis seine durchschnittliche Lebenserwartung zu verkürzen eine wichtige Rolle. Sie dienen auch dazu, zu entscheiden welchem Patienten z.B. Statine zur Senkung des Choilesterinspiegels verordnet werden. Die prädiktive Autorität solcher Kalkulatoren wird auch dadurch unterstrichen, dass ihr Einsatz von zahlreichen Fachgesellschaften, darunter auch durch das "American College of Cardiology (ACC)" und die "American Heart Association (AHA)" empfohlen werden - zuletzt in Leitlinien aus dem Jahr 2013.
Bei der Kommunikation über die Folgen kardiologischer Risikofaktoren wie Blutdruck, Cholesterinwert und Übergewicht und bei Empfehlungen von entsprechenden als präventiv angesehenen Aktivitäten, spielen in Patient-Arztgesprächen relativ übersichtliche und leicht zu handhabende Kalkulatoren des Risikos an einer artheriosklerotischen Herzkreislauferkrankung zu erkranken oder durch ein ernstes kardiologisches Ereignis seine durchschnittliche Lebenserwartung zu verkürzen eine wichtige Rolle. Sie dienen auch dazu, zu entscheiden welchem Patienten z.B. Statine zur Senkung des Choilesterinspiegels verordnet werden. Die prädiktive Autorität solcher Kalkulatoren wird auch dadurch unterstrichen, dass ihr Einsatz von zahlreichen Fachgesellschaften, darunter auch durch das "American College of Cardiology (ACC)" und die "American Heart Association (AHA)" empfohlen werden - zuletzt in Leitlinien aus dem Jahr 2013.
Zusätzlich zu der langjährigen Kritik an der Risikofaktorenbasierung und damit der überwiegenden Nutzung von Surrogatparametern für derartig harte Prognosen, häufen sich in den letzten Jahren Studien, die gravierende Mängel der Prädiktionskraft der Kalkulatorenprognosen nachweisen. Die mittlerweile siebte ist am 6. Oktober 201 online im us-amerikanischen Fachjournal "JAMA Internal Medicine" erschienen.
Deren empirische Basis sind Daten der großen "Women's Health Study" (WHS). Teilnehmerinnen dieser Kohortenstudie sind 39.876 us-weite Frauen zwqischen 45 und 79 Jahren, die zu Beginn der Studie im Zeitraum von 1992 bis 1995 weder an einer Herz-Kreislauferkrankung, noch an Krebs oder einer anderen schweren Krankheit litten. Von diesen Frauen wurden regelmäßig eine Reihe von Risikofaktoren, darunter alle Körperwerte, die in den kardiologischen Risikokalkulator eingehen (Blutdruck, Cholesterinwerte), und gesundheitsbezogene Verhaltensweisen sowie das Eintreten von Herzinfarkten; Schlaganfällen und anderen Herz-Kreislauf- oder Gefäßerkrankungen erfasst oder abgefragt. Dies erfolgte ebenfalls für die medikamentöse Behandlung der Risikofaktoren z.B. durch Lipide und operative Eingriffe im Bereich Herz-Kreislauf. Die Studie dauerte im Durchschnitt 10,2 Jahre.
In der jetzt vorgelegten Studie berechneten die AutorInnen mit den Risikoannahmen des aktuell verwendeten Risikokalkulators und den Werten der WHS-Teilnehmerinnen aus den Startjahren der WHS-Studie deren Risiko für das Eintreten einer Herz-Kreislauferkrankung im Verlaufe der 10 Studienjahre. Es betrug bzw. es hätte laut des Kalkulators durchschnittlich 3,6% betragen sollen. Die tatsächliche oder beobachtete Rate kardiovaskulärerer Ereignisse betrug dagegen durchschnittlich 2,2%. Die beträchtliche Überschätzung des Risikos durch den Kalkulator zeigte sich auch in einer Reihe von Teilanalysen. Dazu gehört vor allem die Untersuchung, ob das Auseinanderklaffen von Prädiktions- und Beobachtungswerten möglicherweise ein Effekt der zunehmenden Einnahme von Statinen, von gefäßerweiternden Operationen, der Untererfassung von kardiovaskulären Ereignissen oder der Gesamtheit der Studieninterventionen ist. Die empirische Häufigkeit von unerwünschten Ereignissen blieb weiter deutlich geringer als die der prognostizierten.
In einem Kommentar zu der Studienveröffentlichung weist dessen Autor auf die enormen gesundheitlichen und finanziellen Folgen der Risikoüberschätzung hin: "The implications of the overestimation of risk are profound. A 50% overestimation by the guideline risk equations would likely add millions of Americans to the roles of patients for whom statins are recommended."
Der Vorschlag des Kommentators, künftige Leitlinien und Risikokalkulatoren sollten frühzeitig öffentlich in Fachzeitschriften präsentiert und diskutiert werden, ist sicher nicht falsch. Die Reaktion des Präsidenten der AHA zeigt allerdings kaum Interesse und Bereitschaft für eine wissenschaftlich fundierte Debatte: "These comments are the same that we heard and addressed when we published the guidelines last year. Multiple publications since that time have validated the concepts and the utility of the risk assessment tool and cholesterol guidelines. In addition, we continue to receive positive feedback from healthcare providers who use the guidelines as a tool to drive discussions with their patients about appropriate care." Wahrscheinlich werden noch zahlreiche weitere unabhängige Querschnitts- und Langzeitstudien durchgeführt werden müssen, um die selbstzufriedene Feedback-Evidenz zu erschüttern. Das mögliche Risiko, dass Millionen von Menschen zu Unrecht Angst vor einem Herzinfarkt gemacht wird und sie jahrelang für sie nutzlose Medikamente einnehmen, reicht offensichtlich weder fürs Nachdenken noch fürs Umsteuern aus.
Dennoch rechtfertigt diese Studie samt ihren 7 Vorgängerinnen, die systematische Skepsis gegenüber Prognosen des Eintretens schwerer gesundheitlichen Ereignisse auf der Basis von Risikofaktoren und der daraus abgeleiteten Notwendigkeit langwieriger therapeutischer oder präventiver Interventionen.
Der Aufsatz Further Insight Into the Cardiovascular Risk CalculatorThe Roles of Statins, Revascularizations, and Underascertainment in the Women's Health Study von Nancy R. Cook und Paul M Ridker ist online first als Beitrag der Zeitschrift "JAMA Internal Medicine" am 6.10. 2014 erschienen. Ein Abstract ist frei erhältlich.
Am selben Tag und in derselben Zeitschrift erschien der Kommentar Prevention Guidelines Bad Process, Bad Outcome von Steven E. Nissen.
Bernard Braun, 15.10.14
4 Jahre nach Beendigung Ergebnisse von 30% der klinischen Studien in USA nicht veröffentlicht - industriefinanzierte allen voran
 Ergebnisse von wissenschaftlichen Studien spielen eine immer gewichtigere und letztlich entscheidende Rolle in der institutionalisierten Zulassung von gesundheitsbezogenen Diagnostika und Therapeutika sowie in öffentlichen Debatten. Wie einige jüngeren Kontroversen gezeigt haben (z.B. die um das Influenza-Präparat Tamiflu der Firma Roche), spielen dabei die Veröffentlichung der Ergebnisse aller Studien, d.h. positiver wie negativer und der freie Zugang zu deren Daten eine oftmals entscheidende Bedeutung, wenn es um die Bewertung ihres Nutzens oder Schadens geht.
Ergebnisse von wissenschaftlichen Studien spielen eine immer gewichtigere und letztlich entscheidende Rolle in der institutionalisierten Zulassung von gesundheitsbezogenen Diagnostika und Therapeutika sowie in öffentlichen Debatten. Wie einige jüngeren Kontroversen gezeigt haben (z.B. die um das Influenza-Präparat Tamiflu der Firma Roche), spielen dabei die Veröffentlichung der Ergebnisse aller Studien, d.h. positiver wie negativer und der freie Zugang zu deren Daten eine oftmals entscheidende Bedeutung, wenn es um die Bewertung ihres Nutzens oder Schadens geht.
Nachdem zum einen seit einiger Zeit gewährleistet ist, dass Studienprotokolle und der zeitliche Ablauf solcher Studien in öffentlich zugänglichen Datenbanken erfasst werden und zum anderen mehrere Male kritisch über die selektive Veröffentlichung von Ergebnissen berichtet wurde, war anzunehmen, dass es damit Schluss sei.
Dass dies ein quantitativ relevanter Irrtum ist und daran auch die alten "Täter" maßgeblich mitwirken, zeigt eine am 15. Juli 2014 veröffentlichte Auswertung der us-amerikanischen Studiendatenbank ClinicalTrials.gov (CTG) bzw. der Veröffentlichungen auf ihrer Website durch ForscherInnen der Boston University School of Public Health (BUSPH).
In diese Auswertung gingen 400 zufällig ausgewählte klinische Studien ein, die im Jahr 2008 laut ihres eigenen Studienprotokolls beendet wurden.
Die wichtigsten Ergebnisse lauten so:
• 4 Jahre nach Beendigung gab es bei 118, d.h. 29,5% dieser Studien keinerlei Veröffentlichung von Ergebnissen in einer Fachzeitschrift oder auf der CTG-Website.
• Die Ergebnisse der restlichen 282 Studien wurden im Durchschnitt erst nach 602 Tagen veröffentlicht.
• Studienergebnisse wurden dann, wenn es sich um solche in früheren Studienphasen (2 versus 3 / 4), nur mit erwachsenen Personen, solche mit Randomisierung oder kleinem Umfang handelte, signifikant weniger veröffentlicht.
• Schließlich wurden die Ergebnisse der von der Industrie finanzierten Studien signifikant weniger veröffentlicht als die ohne Industriesponsoren.
Die Bostoner WissenschaftlerInnen sehen einen auch aktuell beträchtlichen "reporting bias", dessen Niveau und Entwicklung ihres Erachtens "threatens the validity of the clinical research literature in the U.S.". Hinzu kommt das ethische Problem, dass die TeilnehmerInnen an solchen Studien oft aus einer altristischen Grundhaltung heraus teilnehmen und daher auch die völlige Transparenz über jedes Resultat erwarten.
Der Aufsatz How Frequently Do the Results from Completed US Clinical Trials Enter the Public Domain? - A Statistical Analysis of the ClinicalTrials.gov Database. von Hiroki Saito und Christopher J. Gill ist in der Fachzeitschrift "PLoS ONE" (2014; 9 (7): e101826) erschienen und komplett kostenlos zugänglich.
Bernard Braun, 21.7.14
Bedeutung der Therapietreue für den Behandlungserfolg weiter unbestritten
 Wiederholt hat das Forum Gesundheitspolitik das Thema Adherence aufgegriffen und den Forschungsstand auf diesem relativ neuen gesundheitswissenschaftlichen bzw. -politischen Gebiet zusammengefasst, zuletzt in den Beiträgen Therapietreue - vorrangiges Ziel von Gesundheitsreformen und Therapietreue - Ansatz zu verbesserter Gesundheit und zur Kostendämpfung. Seither sind einige neue erwähnenswerte Untersuchungen zu diesem Thema veröffentlicht, die im Wesentlichen die bisher vorliegenden Ergebnisse bestätigen oder untermauern.
Wiederholt hat das Forum Gesundheitspolitik das Thema Adherence aufgegriffen und den Forschungsstand auf diesem relativ neuen gesundheitswissenschaftlichen bzw. -politischen Gebiet zusammengefasst, zuletzt in den Beiträgen Therapietreue - vorrangiges Ziel von Gesundheitsreformen und Therapietreue - Ansatz zu verbesserter Gesundheit und zur Kostendämpfung. Seither sind einige neue erwähnenswerte Untersuchungen zu diesem Thema veröffentlicht, die im Wesentlichen die bisher vorliegenden Ergebnisse bestätigen oder untermauern.
Nennenswert ist dabei eine im Jahr 2012 in Medical Care veröffentlichte Arbeit aus Los Angeles. Zur Erfassung der Therapietreue und ihrer Auswirkungen auf die beiden großen Volkskrankheiten Bluthochdruck und Zuckerkrankheit werteten Forscher von der University of Southern California die Abrechnungsdaten sowie elektronischen Krankenakten von über 2.300 Ärzten eines großen Versorgungsnetzes aus. So konnten sie etwa 770.000 Patientenleben von Diabetikern und Hypertonikern in ihre große retrospektive Beobachtungsstudie aufnehmen. Endpunkte waren alle mikro- und makrovaskulären Komplikationen einschließlich Myokardinfarkt, Schlaganfall, Nierenversagen und diabetische Retinopathie. Die Datenauswertung erfolgte mittels multivariater logistischer Regression und einer instrumentellen Variablen-Bewertung an Hand arztbezogener Größen zur Abschätzung kausaler Zusammenhänge.
Dabei zeigte sich, dass gute Therapietreue bei einer Arzneimittelmehrfachbehandlung durchblutungsbedingte Komplikationen bei beiden Patientengruppen signifikant senkt: Eine Steigerung der Einnahmerate von 50 auf 80 % verringerte die Auftrittswahrscheinlichkeit solcher Ereignisse um fast ein Drittel (29,5 %), optimale Einnahme sogar um fast die Hälfte (46,9 %). Bei kardiovaskulären Komplikationen zeigte sich der gleiche Trend in geringerer Ausprägung (23 % bei guter Adherence). Die Studie von Jae-Jin An und Michael Nichol mit dem Titel Multiple Medication Adherence and its Effect on Clinical Outcomes Among Patients With Comorbid Type 2 Diabetes and Hypertension in Med Care 51 (10), S. 879-887 steht nur als Abstract kostenfrei zur Verfügung.
Bereits aus dem Jahr 2010 stammt eine retrospektive Längsschnittskohortenstudie mit insgesamt 4.708 Typ-2-Diabetikern. Im Rahmen einer 7,5-jähriger Verlaufskontrolle mit vierteljährlichen Erhebungen zur Arzneimittel-Adherence und multiplen anderen, zeitlich variablen Confoundern zeigten mehr als die Hälfte (2.644 bzw. 56,2 %) Komplikationen in Folge mikroangiopathischer Veränderungen. Bei der Anwendung des marginalen strukturellen Modells, einer Methode zur Wirksamkeitsmessung medizinischer Interventionen mit Hilfe der Gewichtung der inversen Wahrscheinlichkeit für erfolgte Behandlung, und nach Adjustierung nach zeitvariablen Faktoren reduzierte gute Adherence gegenüber Antidiabetika die Häufigkeit mikrovaskulärer Komplikationen signifikant um ein Viertel (Hazard Ratio 0,76 (95 % bootstrap KI: 0,60, 0,92). Der Artikel Estimating the effect of medication adherence on health outcomes among patients with type 2 diabetes - an application of marginal structural models von Andrew Yu, Yanny Yu und Michael Nichol aus in Value in Health: S.1038-1045, steht in voller Länge kostenfrei zum Download zur Verfügung.
Auch bei Personen mit schwer behandelbarem Asthma bronchiale besteht ein erkennbarer Zusammenhang zwischen der Zuverlässigkeit bei der Anwendung ihrer die Bronchen erweiternden Medikation und dem Verlauf der Erkrankung. Dies zeigen Anna Murphy, Amandine Proeschal, Christopher Brightling, Andrew Wardlaw, Ian Pavord, Peter Bradding und Ruth Green in ihrer 2012 in der Zeitschrift Thorax publizierten Studie The relationship between clinical outcomes and medication adherence in difficult-to-control asthma. Geringere Therapietreue führte nicht nur zu einer schlechteren Lungenfunktion gemessen an der Einsekundenausatmungskapazität (75,5 % (Standardabweichung 20,9) bei wenig gegenüber 84,3 % (St.abw.23,5) bei sehr therapietreuen Asthmatikern, p= 0,049). Klinisch relevant war dabei, dass mit schlechterem Einnahmeverhalten das Risiko beatmungspflichtiger Asthmakrisen signifikant ansteigt (Odds Ratio 0,054; 95 % KI 0,01-0,47; p=0.008). Demnach steigt mit einer zehnprozentigen Abnahme der Therapietreue gegenüber bronchodilatatorischen Arzneimitteln die Wahrscheinlichkeit auf beatmungspflichtige Komplikationen um 35 %. Der Artikel von Murphy und Kollegen steht Abonnenten als Volltext und Nicht-Abonnenten als Abstract zur Verfügung.
Im Oktober 2013 publizierte das American Journal of Medicine eine Metaanalye zum Zusammenhang zwischen Therapietreue und Verlauf sowie Kosten bei Erkrankungen der Herzkranzgefäße. Die Forscher Asaf Bitton, Niteesh Choudhry, Olga Matlin, Kellie Swanton, und William Shrank aus Boston werteten im Rahmen ihrer systematischen Literaturanalyse letztlich 25 Studien aus, die sämtliche Einschlusskriterien erfüllten und von hoher Qualität waren. Ein Fünftel der Untersuchungen gingen den primärpräventiven Effekten nach, während 20 die Beziehungen zwischen Adherence und Ausgaben oder klinischem Verlauf analysierten, die meisten davon bei blutdrucksenkender Therapie und Einnahme von Aspirin. Zwar erfolgte bei der Mehrzahl der Studien eine Adjustierung nach Begleiterkrankungen und soziodemografischen Faktoren, aber nur bei wenigen nach dem "healthy adherer effect" genannten Placebo-Effekt. Drei Studien zeigten, dass gute Therapietreue die klinischen Ergebnisse signifikant verbessert und die Ausgaben für die Sekundärprävention bei koronarer Herzkrankheit um knapp 300 bis fast 870 US-Dollar pro Person senkt; daraus ergeben sich bei Therapietreue Einsparungen zwischen 10 und knapp 18 % gegenüber unzuverlässiger Medikamenteneinnahme. Der Artikel The Impact of Medication Adherence on Coronary Artery Disease Costs and Outcomes: A Systematic Review ist nur für Abonnenten in voller Länge zugänglich; kostenfrei steht das Abstract zur Verfügung.
Der Vollständigkeit halber sei zu guter Letzt eine Studie genannt, die erneut die unerwünschten Folgen von Selbstbeteiligungen auf die Adherence und damit auf den klinischen Verlauf bei chronischen Erkrankungen bestätigt. Zuzahlungssenkungen z. B. im Rahmen wirksamkeitsbasierter Versicherungspläne (value-based benefit design) um durchschnittlich ein Drittel (bei gleichzeitiger geringfügiger Erhöhung des Eigenanteils um knapp 5 % in der Kontrollgruppe) erhöhten die Wahrscheinlichkeit zuverlässiger Medikamenteneinnahme bei Diabetikern von 75,3 auf 82,6 %, während die Adhärenz bei der Kontrollgruppe im Vergleichszeitraum sogar diskret von 79,1 auf 78,5 % sank. Anders ausgedrückt: Sinkende Zuzahlungen erhöhten die Wahrscheinlichkeit zuverlässiger Medikamenteneinnahme auf mehr als das Anderthalbfache (Odds Ratio = 1,56, P=0,03, 95 % Konfidenzintervall 1,04-2,34). Die lesenswerte Studie der kalifornischen Forschergruppe um Zeng steht kostenfrei zum Download zur Verfügung: The Impact of Value-Based Benefit Design on Adherence to Diabetes Medications:A Propensity Score-Weighted Difference in Difference Evaluation.
Jens Holst, 17.2.14
USA: Interregionale Unterschiede beim Zuviel und Zuwenig von Arzneiverordnungen mit der Kumulation nachteiliger Verordnungsmuster
 Die Altmeister der "small area variation"-Forschung vom Dartmouth Atlas Projekt der gleichnamigen US-Universität veröffentlichen immer noch regelmäßig Reports, welche die regionale Ungleichverteilung wichtiger Gesundheitsleistungen insbesondere unter den Versicherten der staatlichen Krankenversicherung Medicare für Rentner und bestimmte arme Personen. Diese Forschungsarbeiten wirkten weltweit ansteckend und ihre Kernhypothese und Methodik liegen mittlerweile in Deutschland z.B. den Arbeiten in der von der Bertelsmann Stiftung gegründeten und gesponsorten Berichtsreihe "Faktencheck" zugrunde.
Die Altmeister der "small area variation"-Forschung vom Dartmouth Atlas Projekt der gleichnamigen US-Universität veröffentlichen immer noch regelmäßig Reports, welche die regionale Ungleichverteilung wichtiger Gesundheitsleistungen insbesondere unter den Versicherten der staatlichen Krankenversicherung Medicare für Rentner und bestimmte arme Personen. Diese Forschungsarbeiten wirkten weltweit ansteckend und ihre Kernhypothese und Methodik liegen mittlerweile in Deutschland z.B. den Arbeiten in der von der Bertelsmann Stiftung gegründeten und gesponsorten Berichtsreihe "Faktencheck" zugrunde.
Der aktuellste, am 15. Oktober 2013 veröffentlichte Report des Dartmouth Atlas Project untersucht die regionalen Variationen der Verordnung von Arzneimitteln. Der Report stellt zum ersten fest, dass viele Medicare-Versicherte Medikamente, die bei ihrer Behandlung wirksam wären, nicht erhalten und gleichzeitig eine andere Gruppe von Versicherten Arzneimittel verordnet bekommen, die bekannterweise hohe Nebenwirkungsrisiken haben und nicht notwendigerweise wirksam sind. Zum zweiten stellt der Report fest, dass beide Verordnungsmuster je nach Region sehr unterschiedlich sind und dabei auch Konstellationen bzw. Risikokumulationen von zu geringer Verordnung wirksamer Arzneimittel und zu häufiger Verordnung von riskanten Arzneimitteln auftreten.
Die Spannbreiten bei Medikamenten, die sehr spezifisch eingesetzt werden sollten und für deren Zweck es auch Alternativen gibt, zeigt sich bei Protonenpumpenhemmern, die u.a. bei nicht selten schmerzmittelbedingtem Sodbrennen und Geschwüren im Verdauungstrakt angezeigt sind. Der Prozentsatz der Patienten, denen diese Arzneimittel verordnet wurden schwankte zwischen 15,8% in Grand Junction, Colorado und 45,5% in Miami.
Die tatsächlichen Gründe für diese Unterschiede sind den ForscherInnen unbekannt. Es handle sich um "the million dollar question". Sie schließen nach ihrer Analyse allerdings einen bestimmenden Einfluss von unterschiedlichen Einkommen und unterschiedlichen Gesundheitzuständen aus. Obwohl die Mehrheit der Verordnungen ambulant erfolgt, weisen sie für das Krankenhaus auf die Bedeutung einer guten Vorbereitung auf die nachstationäre Verordnung von Medikamenten und deren Einnahme im Rahmen des Entlassungsmanagements hin. Beispielsweise ende die Therapietreue von stationär behandelten Herz-/Kreislaufpatienten bei der Einnahme von gesundheitlich notwendigen Betablockern häufig ohne gezielte Vorbereitung und Aufklärung bereits sechs Monate nach der Entlassung, obwohl bis zu drei Jahre für die erwünschte Wirkung notwendig wären.
Die Studie schließt mit einer knappen Darstellung der Bedeutung ihrer Ergebnisse für die Gesundheitspolitik. Dabei betonen die in solchen Analysen ja bereits seit Jahren erfahrenen ForscherInnen, der kritische Blick sollte nicht nur auf die mangelhaften Zustände in vielen Regionen, sondern auch auf die positiven Regionen gerichtet werden. Es ginge vielleicht sogar vorrangig darum "successful regions that provide effective care efficiently" genauer zu betrachten und dabei "determine what factors lead to this success, and disseminate these systems more broadly."
Der Report The Dartmouth Atlas of Medicare Prescription Drug Use von Jeffrey C. Munson, David C. Goodman, Luca F. Valle und John E. Wennberg ist 59 Seiten lang, enthält interessante Grafiken und Verteilungsdarstellungen und komplett kostenlos erhältlich.
Das jüngste Beispiel der deutschen Variante der "small area variation"-Berichterstattung ist der im Oktober 2013 erschienene Faktencheck Gesundheit: Knieoperationen (Endoprothetik) - Regionale Unterschiede und ihre Einflussfaktoren Zusammenfassung einer Studie der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und orthopädische Chirurgie (DGOOC) im Auftrag der Bertelsmann Stiftung, basierend auf Daten der AOK von Chr. Lühring et al.
Zwei herausragende und gesundheitspolitisch brisante Ergebnisse lauten:
• "Bei Kniegelenkersatz-Operationen, Folgeoperationen und Arthroskopien gibt es z. T. erhebliche regionale Unterschiede: Auf der Ebene der Bundesländer unterscheidet sich die Rate der Kniegelenkersatz-Operationen um das 1,8-Fache, auf der Ebene der Kreise um das Dreifache, bezogen nur auf Männer sogar um das Vierfache. Bei der Häufigkeit von Folgeoperationen gibt es Unterschiede bis zum Fünffachen, bei Arthroskopien bis zum 65-Fachen.
• Patienten im Südosten Deutschlands erhalten im Verhältnis fast doppelt so häufig ein neues Kniegelenk wie Patienten im Nordosten."
Was diese gleichzeitige Über- und Unterversorgung innerhalb weniger hundert Kilometer bewirkt und was daran verändert werden kann, wissen aber auch die deutschen ExpertInnen nicht.
Bernard Braun, 23.10.13
Wie gut oder schlecht werden Public Health-Großrisiken gemanagt? Die Beispiele Schweinegrippe-Pandemie und EHEC-Ausbruch
 Vollständige, verlässliche und sachliche Transparenz über das Risiko und seine Entwicklung, umfassende Ursachenerforschung sowie der gesicherte Nutzen von Gegenmaßnahmen gehören zu den Essentials des politischen Managements von Großrisiken für die Bevölkerungsgesundheit.
Vollständige, verlässliche und sachliche Transparenz über das Risiko und seine Entwicklung, umfassende Ursachenerforschung sowie der gesicherte Nutzen von Gegenmaßnahmen gehören zu den Essentials des politischen Managements von Großrisiken für die Bevölkerungsgesundheit.
Das was bei zwei der jüngsten Großrisiken, der von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) proklamierten aber nie faktischen Schweinegrippe-Pandemie und dem EHEC (Enterohämorrhagische Escherichia coli)-Ausbruch im Frühjahr 2011, passiert ist und teilweise erst nach hartnäckigen Analysen und Recherchen an die Öffentlichkeit gelangt ist, zeigt massive Defizite der eingangs genannten Essentials bei verschiedenen internationalen und nationalen Public Health-Akteuren.
Beim Umgang mit den Schweinegrippe-Infektionen vom Typ H1N1 in den Jahren 2009/10 bleibt bis heute nicht nur die Frage offen, warum die WHO hier eine Pandemie ausgerufen hat, sondern stellt sich vor allem die Frage, wie es zu der Empfehlung kam, zur Prävention und zur Behandlung von Schweinegrippe vor allem das Medikament Tamiflu des Schweizer Pharmaunternehmens Roche zu propagieren, einsetzen zu wollen oder einzusetzen (einen nachwievor konkurrenzlos guten Überblick über die WHO-Politik und die eigentlich bis heute nicht beendete Debatte über das Medikament Tamiflu gibt die exzellente Website Tamiflu campaign der Fachzeitschrift "British Medical Journal (BMJ)"). Letzteres führte dazu, dass öffentliche Gesundheitseinrichtungen zahlreicher Länder Millionen von Packungen für Hunderte von Millionen Euro einkauften, einlagerten und letztlich fast alle mangels Nachfrage vernichten mussten. Nachdem öffentlich wurde, dass zumindest ein Autor dieser WHO-Empfehlungen finanzielle Kontakte zu Roche hatte und dies auch ehrlicherweise der WHO mitgeteilt hatte, ist das Zustandekommen der Empfehlung weniger rätselhaft. Offen interessenorientiert ist dann auch das Verhalten von Roche, nach der Veröffentlichung von Zweifeln an dem Nutzen ihres Arzneimittels, die Herausgabe einer Vielzahl nicht veröffentlichter Studiendaten an unabhängige Wissenschaftler jahrelang zu verschleppen. Zu dieser Strategie passt nahtlos, dass Roche auch nach Beendigung dieser Blockade nichts Anrüchiges daran findet, dass in einem jetzt existierenden "unabhängigen" vierköpfigen Untersuchungsgremium zwei Mitglieder vielfache offene Verbindungen mit der Firma Roche hatten. Das Schlimme an diesen und weiteren Merkwürdigkeiten ist, dass z.B. die WHO eine Menge Glaubwürdigkeit und Vertrauen in ihre Unabhängigkeit verspielt hat. In dem Fall, dass ein neues und wirklich weltweit bedrohliches Großrisiko kommen sollte, könnte es deswegen dazu kommen, dass dann möglicherweise völlig richtige Daten und Empfehlungen nicht geglaubt und befolgt werden - mit erheblichen Folgen für die öffentliche Gesundheit.
Nicht arg viel besser agierten das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) und das Robert-Koch-Institut (RKI), die zentrale Einrichtung der Bundesregierung auf dem Gebiet der Krankheitsüberwachung und -prävention, bei der Aufklärung und Nachbereitung des weltweit größten EHEC-Ausbruchs im Jahr 2011. Dies geht jedenfalls aus einem Ende September 2013 von der Nichtregierungsorganisation "foodwatch" veröffentlichten Brief des RKI über die Ursachenforschung und das Management der Erkrankungswelle hervor.
Offiziell erweckten das zuständige Bundesministerium für Ernährung, das RKI und das BVL den Eindruck, sie hätten einen Sprossenerzeugungsbetrieb in Niedersachsen und die dortige Saat aus Ägypten eindeutig als praktisch exklusiven Auslöser der für 53 Personen tödlich endenden Epidemie identifiziert.
Dies war aber offenbar eine Täuschung oder extrem verzerrte Information der Öffentlichkeit, da nach den jetzigen Angaben des RKI nur bei 500 der mehr als 3.800 bekannt gewordenen Fälle die Ursache aufgedeckt worden ist. 87% der Fälle blieben also ungeklärt.
Außerdem konnte erst nach einem Antrag auf Akteneinsicht für "foodwatch" die Behauptung der amtlichen Public Health-Einrichtungen, sie hätte eine nicht veröffentlichte Gesamtliste aller EHEC-Ausbruchsorte und damit auch genügend Klarheit über das Geschehen gehabt, als falsch nachgewiesen werden. Eine solche Liste mit der damit verbundenen eindeutigen Identifikation der Auslöser hat es laut des RKI-Schreibens maximal für 500 Fälle gegeben. Wodurch, durch wen oder woher die Majorität der Fälle stammte, blieb damit ungeklärt. Zurück bleibt daher auch hier ein erschüttertes Vertrauen in die Sorgfalt und Verlässlichkeit der Handlungen anerkannter Public Health-Institutionen für den Ernstfall.
Das Antwortschreiben des Robert-Koch-Instituts an foodwatch vom 17.6.2013 ist mittels eines extrem lange dauernden Ladevorgang kostenlos erhältlich.
Den ausführlichen foodwatch-Report zur EHEC-Krise "Im Bockshorn" vom Mai 2012 gibt es ebenfalls kostenlos.
Die umfängliche Pressemitteilung von Verbraucherministerin Ilse Aigner und Gesundheitsminister Daniel Bahr zur EHEC-Krise vom 3. Mai 2012 ist auch noch kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 8.10.13
Wenig TeilnehmerInnen in randomisierten Studien= Überschätzung von Therapieerfolgen?!
 Auch wenn es sich um randomisierte Studien handelt, bedeutet dies noch nicht die uneingeschränkte Verlässlichkeit ihrer Ergebnisse. Kritisch wird nämlich oft deren Größee, d.h. die Anzahl der teilnehmenden PatientInnen angemerkt, die möglicherweise die Ergebnisse verfälsche und damit die Wirkung des untersuchten Medikaments oder einer anderen Behandlungsart zweifelhaft ist. Wie die Verfälschung genau aussieht wird aber oft nicht gesagt.
Auch wenn es sich um randomisierte Studien handelt, bedeutet dies noch nicht die uneingeschränkte Verlässlichkeit ihrer Ergebnisse. Kritisch wird nämlich oft deren Größee, d.h. die Anzahl der teilnehmenden PatientInnen angemerkt, die möglicherweise die Ergebnisse verfälsche und damit die Wirkung des untersuchten Medikaments oder einer anderen Behandlungsart zweifelhaft ist. Wie die Verfälschung genau aussieht wird aber oft nicht gesagt.
Hierzu geben aber nun die Ergebnisse einer im Sommer 2013 veröffentlichten Metaanalyse, die selber 93 Metaanalysen mit insgesamt 735 randomisierten Studien umfasste, umfassend Auskunft. Die Anzahl der TeilnehmerInnen in den einzelnen Studien reichte von weniger als 50 bis zu 1.000 und mehr.
Die Metaanalyse zeigt, dass verglichen mit randomisierten Studien mit 1.000 und mehr TeilnehmerInnen Studien mit kleineren Fallzahlen (500 bis 999 PatientInnen) die Therapie-Wirksamkeit der untersuchten Medikamente/Interventionen um 10% und Studien mit weniger als 50 TeilnehmerInnen diese bis zu 48% überschätzen. Hierbei handelt es sich nicht um Zahlenspielereien, sondern hinter solchen Überschätzungen stecken eventuell vergebliche Versuche einer Therapie oder das Verschieben einer möglicherweise wirksameren Therapie und entsprechende negativen Folgen für die Gesundheit.
Die AutorInnen schlagen als erstes für zuverlässigere Resultate randomisierter Studien eine Größenordnung der Teilnehmerschaft von 500 bis 1.000 und mehr Personen vor. Ein zusätzliches methodisches Gegenmittel sieht dann so aus: "More generally, our results raise questions about how meta-analyses are currently performed, especially whether all available evidence should be included in meta-analyses because it could lead to more beneficial results."
Die Meta-Metaanalyse Influence of trial sample size on treatment effect estimates: Meta-epidemiological study von Dechartres A et al. ist am 24. April 2013 im "British Medical Journal (BMJ)" (346: f2304) erschienen und im Rahmen der vorbildlichen Open Acess-Politik des BMJ kostenlos und komplett erhältlich.
Bernard Braun, 6.10.13
Weltweit enorme Krankheitslasten und Verluste an Lebensjahren allein durch 7 unerwünschte Behandlungsereignisse in Krankenhäusern
 Regelmäßig auftretende, mehr oder weniger spektakuläre Behandlungsfehler, Hygieneskandale, MRSA-Infektionen oder Druckgeschwüre machen deutlich, dass medizinische Behandlungen trotz allen technischen Fortschritts unsicher sein und Patienten bis zum vorzeitigem Tode schaden können. Ob dies das Werk "einzelner schwarzer Schafe" oder "seltene Ausnahmen" sind, könnte nur durch die größtmögliche Transparenz über die Häufigkeit derartiger unerwünschter Ereignisse geklärt werden.
Regelmäßig auftretende, mehr oder weniger spektakuläre Behandlungsfehler, Hygieneskandale, MRSA-Infektionen oder Druckgeschwüre machen deutlich, dass medizinische Behandlungen trotz allen technischen Fortschritts unsicher sein und Patienten bis zum vorzeitigem Tode schaden können. Ob dies das Werk "einzelner schwarzer Schafe" oder "seltene Ausnahmen" sind, könnte nur durch die größtmögliche Transparenz über die Häufigkeit derartiger unerwünschter Ereignisse geklärt werden.
Ein Forscherteam in den USA hat dazu in Zusammenarbeit mit WHO-Wissenschaftlern am 18. September 2013 die Ergebnisse einer aufwändigen Untersuchung der "global burden of unsafe medical care" in Ländern mit niedrigem oder mittlerem und hohem Einkommen vorgelegt. Als Grundlage ihrer Studie führten sie eine Suche nach entsprechender Beobachtungsstudien in englischer Sprache durch, fanden in der Zeit nach 1976 über 16.000 Artikel und nahmen davon über 4.000 Beiträge genauer unter die Lupe. Sie konzentrierten sich dabei auf sieben unerwünschte, schädliche Ereignisse innerhalb der stationären gesundheitlichen Versorgung, wie z.B. unerwünschte Arzneimittelwirkungen, im Krankenhaus erworbene Lungenentzündungen und Druckgeschwüre, Stürze im Krankenhaus, Thrombosen und verschiedene Blutinfektionen.
Heraus kamen u.a. die folgenden Informationen und Erkenntnisse:
• 2009 hatten die rund 1,1 Milliarden BürgerInnen in "high-income countries (HIC)" ungefähr 117,8 Millionen Krankenhausaufenthalte. Bei den rund 5.5 Milliarden Einwohner der "low- and middle-income countries (LMIC)" waren es 203,1 Millionen Krankenhausaufenthalte.
• In den HICs lag die Krankenhausrate bei 10,8 Aufenthalten je 100 BürgerInnen und Jahr, während die Rate in den LMICs mit 3,7/100 BürgerInnen/Jahr wesentlich niedriger lag.
• Während der insgesamt 421 Millionen Krankenhausbehandlungen traten rund 42,7 Millionen unerwünschter Ereignisse auf, 16,8 Millionen in HICs und 25,9 Millionen in LMICs. Je 100 Krankenhausbehandlungen waren dies in HICs rund 14,2 und in LMICs rund 12,7 unerwünschte Ereignisse.
• Die Inzidenz der sieben ausgewählten unerwünschten Ereignisse unterschied sich nicht nur untereinander erheblich, sondern auch zwischen den beiden Länderarten. Sie betrug bei den unerwünschten Arzneimittelwirkungen in den HICs 5% und in LMICs 2,9%. Das häufigste unerwünschte Ereignis war in HICs das Auftreten unerwünschter Arzneimittelwirkungen (5% pro 100 Krankenhausbehandlungen) und in LMICs das Auftreten von venösen Thrombosen (3% pro 100 Krankenhausbehandlungen).
• Rechnet man die Ereignisse in Verluste an behinderungsbereinigten Lebensjahren (so genannte "disability-adjusted life years (DALYs)") um, verloren die BürgerInnen in den HICs 7,2 Millionen Jahre, die in den LMICs mehr als doppelt so viel, nämlich15,5 Millionen. Der Großteil dieser Verluste beruht auf vorzeitigem Tod (insgesamt=80,2%; HIC=78,6%; LMICs=80,7%). Der Anteil kurzfristiger und langanhaltender Behinderungen betrug insgesamt 14,4% und 5,3%.
• Damit stellen allein diese sieben Ereignisse die zwanzighäufigste Ursache für Morbidität und Mortalität dar. Die Bedeutung der unerwünschten Behandlungswirkungen würde noch steigen, wenn weitere bekannte Ereignisarten in die Analyse einbezogen würden. Hinzu kommt nach Meinung der AutorInnen eine nicht dokumentierte Dunkelziffer dieser Ereignisse in allen Gesundheitssystemen.
Die Schlussfolgerung der WissenschaftlerInnen lautet folgerichtig, es ginge weltweit zwar darum, den Zugang zur gesundheitlichen Versorgung möglichst zu verbessern, dies müsse aber Hand in Hand mit Investitionen einher gehen, das Risiko unerwünschter Behandlungsfolgen zu senken.
Die Studie The global burden of unsafe medical care: an observational study von Ashish K. Jha, Itzia Larizgoitia, Carmen Audera-Lopez, Nittita Prasopa-Plaizier, Hugh Water und David W. Bates ist am 18. September 2013 online als Beitrag der Zeitschrift "BMJ Quality & Safety" (22: 809-815) erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 21.9.13
Multiresistente Erreger in Krankenhäusern: Hysterie oder ernstes aber vermeidbares Problem. Ergebnisse einer Krankenkassen-Analyse
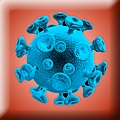 Problematische Hygieneverhältnisse in Krankenhäusern, langwierig und aufwändig behandlungsbedürftige Infektionen und Todesfälle durch Erkrankungen mit multiresistenten Keimen waren in den vergangenen Jahren immer wieder Gegenstand der Medienberichterstattung. Ob es sich dabei um medial betriebene "Hysterie" oder darum handelt, dass "wer moderne Medizin will, … ein bestimmtes Infektionsrisiko in Kauf nehmen (muss)" und "die meisten Krankenhausinfektionen … unvermeidbar" sind, so der seit kurzem pensionierte Infektionsexperte Daschner 2012 im "Deutschen Ärzteblatt", sollte u.a. durch eine Auswertung der Routinedaten der in Nordwestdeutschland aktiven gesetzlichen Krankenkasse "hkk" etwas genauer beleuchtet werden.
Problematische Hygieneverhältnisse in Krankenhäusern, langwierig und aufwändig behandlungsbedürftige Infektionen und Todesfälle durch Erkrankungen mit multiresistenten Keimen waren in den vergangenen Jahren immer wieder Gegenstand der Medienberichterstattung. Ob es sich dabei um medial betriebene "Hysterie" oder darum handelt, dass "wer moderne Medizin will, … ein bestimmtes Infektionsrisiko in Kauf nehmen (muss)" und "die meisten Krankenhausinfektionen … unvermeidbar" sind, so der seit kurzem pensionierte Infektionsexperte Daschner 2012 im "Deutschen Ärzteblatt", sollte u.a. durch eine Auswertung der Routinedaten der in Nordwestdeutschland aktiven gesetzlichen Krankenkasse "hkk" etwas genauer beleuchtet werden.
Laut einer Hochrechnung der 2012 veröffentlichten ALERTS-Studie am Sepsis-Forschungs- und Behandlungszentrum der Universität Jena erkranken in Deutschland 4,3 Prozent aller Krankenhauspatienten während ihres dortigen Aufenthaltes an einer Infektion. Dies entspricht jährlich zwischen 400.000 und 600.000 Fällen, die bei 10.000 bis 15.000 Patienten zum Tod führen. Davon werden schätzungsweise 15 Prozent durch multiresistente Krankheitserreger (MRE) verursacht. Weitere Studien bestätigen diese Ergebnisse im Wesentlichen. MRE verdanken ihren Namen der Eigenschaft, dass sie gegen zahlreiche Antibiotika immun sind. MRE kommen nicht nur im Krankenhaus, sondern in der gesamten Umwelt vor und stellen für gesunde Menschen meist keine Gefahr dar - ganz im Gegensatz zu Menschen mit einem geschwächten Immunsystem. Unter allen MRE tritt der MRSA-Erreger (Methicillin-Resistenter Staphylococcus Aureus) am häufigsten auf. Der Report weist eingangs auf die Notwendigkeit hin, die unterschiedlichen Erreger, Messmethoden und vor allem die Vielzahl der von verschiedenen nationalen und internationalen Institutionen verwandten Indikatoren genau zu beachten.
In die empirische Untersuchung durch den Gesundheitswissenschaftler Bernard Braun vom Zentrum für Sozialpolitik der Universität Bremen wurden alle hkk-Versicherten einbezogen, die zwischen 2007 und 2011 im Krankenhaus behandelt wurden und bei denen eine Infektion mit MRE diagnostiziert wurde.
Die wichtigsten Ergebnisse lauteten:
• Im Untersuchungszeitraum verdoppelte sich der Anteil der im Krankenhaus behandelten hkk-Versicherten, die dort eine Infektion erlitten, von 3,1 auf 6,3 Prozent. Mit den genutzten Daten kann nicht definitiv unterschieden werden, ob es sich dabei um ein zunehmendes Infektionsrisiko oder um den Effekt verstärkter Aufmerksamkeit und Messung handelt. Es dürfte wahrscheinlich eine Mischung beider Effekte sein. Betrachtet man nur die Zahl der MRE-Infektionen, so wurden diese im Jahr 2007 in 271 Krankenhausfällen nachgewiesen, während es 2011 bereits 619 Fälle waren. Damit hat sich auch der Anteil der MRE-Infektionen an allen Krankenhausfällen in von fünf Jahren von 0,465 auf 0,941 Prozent mehr als verdoppelt. Der Anteil der MRSA-Infektionen stieg von 0,299 auf 0,526 Prozent. Zu 65,6 Prozent handelte es sich dabei um MRSA-Infektionen, die ohne Krankheitssymptome verliefen. Betroffen waren vorwiegend ältere Menschen: 49 Prozent aller MRE-infizierten Krankenhausfälle betrafen Patienten im Alter von 70 bis 89 Jahren.
• MRE-infizierte Krankenhaus-Patienten verursachen erhebliche Folgekosten, die auf längere Liegezeiten, Personal- und Sachkosten für qualifiziertes Hygienepersonal, Isolier- und Sanierungsmaßnahmen sowie Schutzkleidung zurückgehen. Überraschenderweise sank aber der Anteil der diesen Aufwand im Prinzip finanzierenden Komplexbehandlungen an allen MRE-Fällen im Untersuchungszeitraum von 58 auf rund 42 Prozent, beziehungsweise bei MRSA-Infektionen von 73 auf 58 Prozent. Offen muss, ob dies daran liegt, dass die Schwere der Fälle abgenommen hat, so dass aufwendige Maßnahmen aus Sicht der Krankenhäuser nicht notwendig sind oder viele Krankenhäuser weder personell noch baulich und infrastrukturell in der Lage sind, derartige Leistungen zu erbringen."
• Ein Blick ins Ausland zeigt, dass mindestens 20-30% der MRE-Erkrankungen und damit auch viele Todesfälle vermeidbar sind. Während der Anteil von MRSA an allen nachgewiesenen Staphylococcus Aureus-Proben in Deutschland mehr als 20 Prozent beträgt, liegt er in Skandinavien, Estland und den Niederlanden weit unter 5 Prozent. Selbst im chronisch unterfinanzierten britischen Gesundheitswesen wurde die Rate innerhalb von fünf Jahren von 44 auf heute knapp 22 Prozent gesenkt.
• Um dies zu erreichen bedarf es allerdings eines mehrschichtigen, interdisziplinären Ansatzes.
• So umfasst die im Report u.a. kurz dargestellte erfolgreiche niederländische Anti-MRSA-Strategie ("search and destroy") ein Maßnahmenbündel vom Komplettscreening in Risikobereichen, über die Quarantäne des Patienten bis zum Negativergebnis, die systematische Präsenz von infektionsmedizinischen Experten sowie eine rigorose Politik zur Vermeidung nicht notwendiger Antibiotika-Verordnungen im ambulanten Bereich. Weitere Positivbeispiele aus den USA umfassen technische, organisatorische und vor allem auch soziale (z.B. gemeinsame Hygieneschulungen von Pflegekräften und Ärzten, Hygiene-Tagesziele) Maßnahmen. Die in Deutschland jahre- wenn nicht gar jahrzehntelange Vernachlässigung der Ausbildung und Beschäftigung qualifizierter Hygieneärzte und -pflegekräfte und die Geringschätzung von Hygiene stellt aber eine erhebliche Barriere für sofortige Abhilfe dar.
Die Tatsache, dass es mittlerweile bereits Erreger gibt, die auch gegen das letzte im Moment zur Verfügung stehende Antibiotikum resistent sind (vgl. dazu den Beitrag Was kosten multiresistente Bakterien wirklich und wie gefährlich ist es, kein Antibiotikum-" Ass mehr in der Hinterhand" zu haben?), sollte Anlass sein die hier vorgestellten Maßnahmen so rasch wie möglich umzusetzen.
Der 29 Seiten umfassende hkk-Report Multiresistente Erreger im Krankenhaus Eine Analyse mit hkk-Routinedaten von Bernard Braun ist komplett kostenlos erhältlich.
Jens Holst, 1.9.13
Was kosten multiresistente Bakterien wirklich und wie gefährlich ist es, kein Antibiotikum-" Ass mehr in der Hinterhand" zu haben?
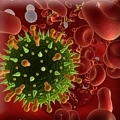 Während deutsche Gesundheits- und Landwirtschaftspolitiker oder Krankenhausexperten eher gemächlich über den Sinn oder Unsinn der Übernahme niederländischer Hygienestandards ("search and destroy") zur Bekämpfung der etwas prominenter gewordenen antibiotikaresistenten "Methycillin-resistenten Staphylococcus aureus (MRSA)-Erreger in deutschen Krankenhäusern beraten und der flächendeckende Einsatz von Antibiotika in der Massen-Tiermast in deutschen Fleischfabriken bisher vor allem mit einer Meldepflicht "bekämpft" werden soll, reden die Leiter der britischen wie us-amerikanischen Gesundheitsbehörde von einem richtigen "Albtraum" jenseits von MRSA.
Während deutsche Gesundheits- und Landwirtschaftspolitiker oder Krankenhausexperten eher gemächlich über den Sinn oder Unsinn der Übernahme niederländischer Hygienestandards ("search and destroy") zur Bekämpfung der etwas prominenter gewordenen antibiotikaresistenten "Methycillin-resistenten Staphylococcus aureus (MRSA)-Erreger in deutschen Krankenhäusern beraten und der flächendeckende Einsatz von Antibiotika in der Massen-Tiermast in deutschen Fleischfabriken bisher vor allem mit einer Meldepflicht "bekämpft" werden soll, reden die Leiter der britischen wie us-amerikanischen Gesundheitsbehörde von einem richtigen "Albtraum" jenseits von MRSA.
Es geht um den raschen Anstieg (der Anteil an allen resistenten Erregern stieg in den USA zwischen 2001 und 2012 von 1% auf 4%) einer anderen, weit weniger bekannten Klasse von Bakterien, die gegen Antibiotika resistent sind: den so genannten "Carbapenem-resistenten Enterobakterien (CRE)" zu denen u.a. die im Zusammenhang mit dem Tod von Frühchen in verschiedenen Kliniken bekannter gewordenen Klebsiella-Bakterien gehören. Diese befinden sich wie die meisten anderen Erreger auch im Darm vieler Personen, die weder Symptome haben noch daran erkranken müssen. CRE sind deshalb besonders bedrohlich, weil Carbapeneme Reserve-Antibiotika oder das bisher letzte "Ass in der Hinterhand" der modernen Infektionsmedizin sind bzw. waren. Wer an CRE erkrankt, kann daher nicht mehr wirksam mit Antibiotika behandelt werden und hat ein hohes Sterblichkeitsrisiko.
Über die bisherige Entwicklung mit Schwerpunkt in den USA berichtet der gerade frei zugänglich in deutscher Übersetzung erschienene Fachaufsatz "Antibiotic resistance: The last resort" von Maryn McKenna in dem renommierten Wissenschaftsmagazin "Nature" (Nr. 499. 2013: 394-396) ausführlich. Ohne das "Ass" der Carbapeneme oder ohne dass irgendwelche anderen Reserve-Antibiotika am Horizont oder gar auf dem Markt sind, bleibt Ärzten nichts anders übrig als mit "wilden" Kombination alter und zum Teil schädlicher Mittel gegen diese Erreger und ihre potenziell tödlichen Wirkungen vorzugehen.
Die Autorin weist dabei auf einen relevanten und fatalen Zirkel hin: Will man die Resistenzbildungen von Bakterien gegenüber alten und neuen Antibiotika so lang wie möglich vermeiden, müssen sie am besten sehr sparsam eingesetzt sein. Damit lohnt sich aber die Neuentwicklung von Antibiotika für privatwirtschaftliche Pharmaunternehmen tendenziell nicht mehr.
Damit gewinnen sämtliche Maßnahmen der technischen und personalen Krankenhaushygiene wie beispielsweise der Handhygiene eine noch wesentlich größere Bedeutung als sie auch jetzt schon haben. Der Hinweis, auch hier würde viel zu wenig untersucht, "ob und wie sich solche Standardprozeduren noch verbessern lassen" und im Ernstfall würde "einfach dem Pflegepersonal die Schuld in die Schuhe geschoben", zeigt aber auch, dass diese Bedeutung keineswegs überall angekommen ist.
Wie die jüngsten Expertenschätzungen für Europa zeigen, hilft das hierzulande übliche Abwarten bereits jetzt nicht mehr.
Am 11. Juli 2013 wurden nämlich die Ergebnisse eines im Frühjahr durchgeführten Surveys bei nationalen Experten aus 39 europäischen Ländern veröffentlicht, die zweierlei beinhalteten:
• Auch in Europa verbreiten sich die CRE oder auch CPE ("carbapenemase-producing Enterobacteriaceae") nach den Schätzungen der Experten in den letzten drei beobachteten Jahren immer weiter bzw. treten häufiger auf.
• 21 von den 39 Staaten, deren Experten befragt wurden, sind nach deren Meinung so gut koordiniert, dass sie eine Epidemie dieser Erreger bewältigen könnten. Deutschland gehört zu diesen Ländern.
Für diejenigen, die seit Jahren oder Jahrzehnten nichts für eine ausreichende Anzahl qualifizierter Hygienefachkräfte in deutschen Krankenhäusern getan haben und auch jetzt eher diskutieren und dokumentieren als handeln, liefert ein in dem "Nature"-Aufsatz zitierter Review zweier britischer Gesundheitsökonomen einige drastische Zahlen zu den Folgen anhaltender Passivität beim Abbau gesundheitlich nicht notwendiger Antibiotikaverordnungen und bei der Krankenhaushygiene.
Nach der Analyse von 24 aus 192 seit 2000 erschienenen Einzelstudien kommen sie zu dem Schluss, dass die "wahren Kosten" und Folgen multiresistenter Bakterien weit unterschätzt werden und die Situation für die gesamte Gesundheitsversorgung wesentlich ernster ist als bisher angenommen.
Dies beruht generell darauf, dass die Prävention und Behandlung von bakteriellen Entzündungen durch Antibiotika bei vielen Operationen und Prozeduren standardmäßig erfolgt und ohne sie entweder viele Operationen nicht durchgeführt würden oder das Erkrankungs- und Sterberisiko deutlich anstiege. Bei vielen Operationen würde in jedem Fall der notwendige Aufwand (z.B. technische Hygienemaßnahmen, Liegezeitverlängerung durch Komplikationen) wesentlich höher sein als bisher.
Was der Ausfall des letzten "Asses" konkret bedeuten könnte, zeigen die beiden Ökonomen in einer einfachen literaturgestützten Analyse über die Folgen für eine der derzeit häufigsten Operationen, dem Ersatz eines Hüftgelenks. Ohne wirksame Antibiotika stiege die nachoperative Infektionsrate auf 40-50% und von diesen PatientInnen würden rund 30% sterben. Und wenn ohne Antibiotika die Anzahl der Hüft-Endoprothesen-Operationen wahrscheinlich sänke, stiege die Morbiditätslast durch schmerzende und bewegungseinschränkende Hüftgelenksarthrosen erheblich an.
Mehr über die "wahren" Risiken und Kosten bakterieller Resistenzen gegenüber allen Antibiotika findet man in dem im März 2013 erschienenen kurzen Aufsatz The true cost of antimicrobial resistance. von Smith R. und J. Coast (2013) - erschienen im British Medical Journal;346: f1493.
Zur Vertiefung der Erkenntnisse steht der ebenfalls im Frühjahr 2013 erschienene 34 Seiten umfassende Review The economic burden of antimicrobial resistance. Why it is more serious than current studies suggest. derselben Autoren komplett kostenlos zur Verfügung.
Die deutsche Übersetzung des "Nature"-Aufsatzes Kein Ass mehr in der Hinterhand von Maryn McKenna erhält man nach einer möglicherweise notwendigen Kurzanmeldung auf der Website der Zeitschrift "Spektrum der Wissenschaft" kostenlos.
Wer auch die am 24. Juli 2013 erschienene englische Fassung des "Nature"-Aufsatzes Antibiotic resistance: The last resort. Health officials are watching in horror as bacteria become resistant to powerful carbapenem antibiotics — one of the last drugs on the shelf. lesen will, kann dies ebenfalls kostenlos.
Den aktuellen Überblick über die CRE-Situation in 39 europäischen Ländern kann man sich in der Schnellmitteilung Carbapenemase-producing Enterobacteriaceae in Europe: a survey among national experts from 39 countries, February 2013 von C. Glasner und weiteren Mitglieder der "European Survey on Carbapenemase-Producing Enterobacteriaceae (EuSCAPE) working group" verschaffen, der in der Fachserie "Eurosurveillance" (Volume 18, Issue 28) erschienen ist.
Bernard Braun, 31.8.13
Vorsicht "Bluttests": Über- und Fehlversorgung durch umfassende und wiederholte Leberfunktionstests
 Umfassende Untersuchungen des Blutes und anderer Körperstoffe sowie diverser physikalischer oder seelischer Funktionen tragen zu einem Boom diagnostischer Leistungen als Kassen- oder Privatleistung bei. Dafür verantwortlich sind zum einen Ärzte, die eine "Null-Risiko"- oder Defensivmedizin betreiben aber auch PatientInnen, die glauben, ihr Erkrankungsrisiko durch möglichst umfassendes Durchchecken oder Früherkennen ebenfalls auf Null senken zu können. Ein fördernder Faktor sind außerdem die Fortschritte der Labor- und Analysetechnik der letzten Jahre, die innerhalb kürzester Zeit umfassende, exakt bewertete und Gewissheit versprechende Testergebnisse liefern. Dass dadurch möglicherweise eine gesundheitlich nicht notwendige oder nützliche aber teure Über- oder Fehlversorgung oder gar gesundheitliche Nachteile entstehen, ist Gegenstand zahlreicher versorgungswissenschaftlicher Analysen der letzten zehn bis fünfzehn Jahre.
Umfassende Untersuchungen des Blutes und anderer Körperstoffe sowie diverser physikalischer oder seelischer Funktionen tragen zu einem Boom diagnostischer Leistungen als Kassen- oder Privatleistung bei. Dafür verantwortlich sind zum einen Ärzte, die eine "Null-Risiko"- oder Defensivmedizin betreiben aber auch PatientInnen, die glauben, ihr Erkrankungsrisiko durch möglichst umfassendes Durchchecken oder Früherkennen ebenfalls auf Null senken zu können. Ein fördernder Faktor sind außerdem die Fortschritte der Labor- und Analysetechnik der letzten Jahre, die innerhalb kürzester Zeit umfassende, exakt bewertete und Gewissheit versprechende Testergebnisse liefern. Dass dadurch möglicherweise eine gesundheitlich nicht notwendige oder nützliche aber teure Über- oder Fehlversorgung oder gar gesundheitliche Nachteile entstehen, ist Gegenstand zahlreicher versorgungswissenschaftlicher Analysen der letzten zehn bis fünfzehn Jahre.
Was dies konkret bedeuten kann, zeigt ein im Juli 2013 in Großbritannien veröffentlichter Health-Technology-Assessement (HTA)-Report über den in der Regel sechs bis acht Werte untersuchenden Leberfunktionstest (LFT). Der Report und seine Schlussfolgerungen basieren im Wesentlichen auf der so genannten "Birmingham and Lambeth Liver Evaluation Testing Strategies (BALLETS)"-Studie, in der die Resultate der auch in Großbritannien weitverbreiteten Leberfunktionstests von 1.290 PatientInnen mit abnormalen Testergebnissen untersucht wurden. Die gesundheitliche Entwicklung dieser PatientInnen wurde über zwei Jahre beobachtet.
Die wesentlichen Ergebnisse der BALLETS-Studie lauteten:
• Weniger als 5% der Personen mit abnormalen LFT-Ergebnissen hatten eine spezifische Lebererkrankung. Eine ernsthafte Lebererkrankung, die eine sofortige Therapie verlangte, wurde in 1,3% aller Fälle entdeckt. Die Wissenschaftler fassen dies so zusammen: "It is unusual for an abnormal LFT result to signify a serious treatable disease of which the doctor was previously unaware."
• Die Mehrheit ernsthafter oder potenziell ernsthafter Erkrankungen können durch die Bestimmung von zwei Leberwerten entdeckt werden, erfordern also keinen umfassenden LFT. Dabei handelt es sich um die Bestimmung des Aminotransferase (ALT) und Alkalische Phosphatase (ALP)-Werts.
• Am häufigsten abnormal war das so genannte Gamma-Glutamyltransferase- oder GGT-Enzym eines LFT. Hier gab es aber auch die höchste falsch-positive Rate.
• Die in Leitlinien enthaltene Empfehlung, den LFT nach abnormalen Ergebnissen "zur Sicherheit" zu wiederholen, ist laut der BALLETS-Studie unsinnig und erhöht eher die negativen Folgen wie z.B. die Angst der untersuchten Personen vor den meist schweren Lebererkrankungen. Bei der Wiederholung innerhalb des ersten Monats nach dem Erst-Test lieferten 84% weiterhin abnormale Werte und sogar nach 2 Jahren blieben 75% aller Tests abnormal. Die WissenschaftlerInnen empfehlen dagegen die Durchführung weniger spezifischer Tests aus einem stufenweisen "dropdown"-Menu vorhandener Tests.
• LFTs sollten in der primärärztlichen Versorgung sparsam eingesetzt werden. Das Standardrepertoire von fünf bis acht Einzeltests "is obsolete".
• LFTs werden nach den Erkenntnissen der Studienverantwortlichen meist aus sozialen und psychologischen, weniger aus klinischen Gründen durchgeführt. Zu den wesentlichen Motiven von Ärzten LFTs durchzuführen, gehört die Absicht eine "defensive practice" zu betreiben und "to meet perceived patient need for a 'blood test'".
• Dafür, dass die Kenntnis einzelner abnormaler Ergebnisse von LFTs und Ultraschalluntersuchungen der Leber eine gesündere Lebensweise (Stichwort Alkoholkonsum) fördern, gibt es keine gute Evidenz. Ganz im Gegenteil: "the use of serial LFTs to promote behaviour change is an unproven therapy that might do more harm than good."
• Ob Bluttests bei chronisch Kranken oder PatientInnen mit diversen unklaren Symptomen generell einen Wert haben, ist nach Meinung der WissenschaftlerInnen unklar und sollte in weiteren Studien gründlicher untersucht werden.
Der gesamte 326 Seiten lange Report oder ein kurzerScientific summary der Studie "Birmingham and Lambeth Liver Evaluation Testing Strategies (BALLETS): a prospective cohort study" von Lilford R, Bentham L, Girling A, Litchfield I, Lancashire R, Armstrong D, Jones R, Marteau T, Neuberger J, Gill P, Cramb R, Olliff S, Arnold D und Khan K [Health Technol Assess 2013;17(28)] sind kostenlos zu erhalten.
Bernard Braun, 29.8.13
Guten Appetit beim regelmäßigen Fischmahl: Das Geld dafür kann man durch Verzicht auf Omega-3-Nahrungsergänzungsmittel ansparen.
 Trotz zahlreicher guter Untersuchungen über den nicht vorhandenen Nutzen oder sogar die gesundheitlich nachteilige Wirkung einer Vielzahl von zusätzlich zur normalen Ernährung aufgenommenen Nahrungsergänzungsmitteln bzw. Vitaminen für die Prävention oder gar Behandlung schwerer, d.h. oft tödlicher Herz-Kreislauf- oder Krebserkrankungen gelten einige von ihnen weiter als wahre "Wundermittel". Dazu gehören z.B. die u.a. in Fischen natürlich vorkommenden mehrfach ungesättigten Omega-3-Fettsäuren, die man daher am besten gleich in Kapseln oder durch eine Diät mit Lebensmitteln zu sich nehmen sollte, in denen diese Fettsäure enthalten ist. Ein systematischer Review und eine Metaanalyse von 20 randomisierten kontrollierten Studien mit 68.680 TeilnehmerInnen aus verschiedenen Ländern und Esskulturkreisen (z.B. Japan) sowie einem Zeitraum von vor 1989 bis heute kommt aber zu einem deutlich anderen Ergebnis: Mehrfach ungesättigte Omega-3-Fettsäuren als Nahrungsergänzungsmittel senken das Risiko der Gesamtsterblichkeit, des plötzlichen Todes, des Herztodes, Herzinfarkts oder des Schlaganfalls nicht signifikant. Ihre Einnahme als Nahrungsergänzungsmittel ist zwar nach den Daten dieser Studie auch nicht risikoerhöhend, aber auf Dauer eine vermeidbare Belastung der Haushaltskassen. Um sicher zu stellen, dass sich überhaupt Effekte der Fettsäure einstellen konnten, waren z.B. nur RCTs aufgenommen worden, in denen die Teilnehmer mindestens ein Jahr eine entsprechende Diät durchführten oder Nahrungsergänzungsmittel aufnahmen. Als Wirkungsindikatoren wurden das relative Risiko und die absolute Risikoreduktion bei den oben genannten Erkrankungs- bzw. Sterberisiken ermittelt. Die durchschnittliche tägliche Aufnahme der Fettsäure betrug 1,41 Gramm und dies im Durchschnitt 2 Jahre lang (Maximum 6,2 Jahre). Das häufigste Anwendungsgebiet von Omega-3-Fettsäuren war die Sekundärprävention bei kardiovaskulären Erkrankungen. Die Ergebnisse beziehen sich aber nur auf die fehlenden Wirkungen von Omega-3-Fettsäure-Nahrungsergänzungsmittel und -Diäten auf die untersuchten Erkrankungen und raten nicht vom Genuss von normalen Nahrungsmitteln mit einem spürbaren Gehalt an dieser Art von Fettsäuren ab. So sollten Fische also durchaus regelmäßig gegessen werden - weil sie schmackhaft und bekömmlich sind und auch die für das normale Leben notwendige Omega-3-Fettsäure enthalten. Im Kommentar setzen sich die AutorInnen dieser Studie auch ausführlich mit den Defiziten und Grenzen der Studien auseinander, die schon bisher und mit Sicherheit auch künftig von den Anbietern von Omega-3-Fettsäure-Kapseln und den Propagandisten entsprechender Diäten als Beleg für ihre Empfehlungen zitiert werden. Der Aufsatz "Association between omega-3 fatty acid supplementation and risk of major cardiovascular disease events: a systematic review and meta-analysis." von Rizos EC, Ntzani EE, Bika E, et al. ist am 12. September 2012 in der US-Fachzeitschrift "JAMA" (308(10):1024-33) erschienen. Das Abstract ist kostenlos erhältlich.
Trotz zahlreicher guter Untersuchungen über den nicht vorhandenen Nutzen oder sogar die gesundheitlich nachteilige Wirkung einer Vielzahl von zusätzlich zur normalen Ernährung aufgenommenen Nahrungsergänzungsmitteln bzw. Vitaminen für die Prävention oder gar Behandlung schwerer, d.h. oft tödlicher Herz-Kreislauf- oder Krebserkrankungen gelten einige von ihnen weiter als wahre "Wundermittel". Dazu gehören z.B. die u.a. in Fischen natürlich vorkommenden mehrfach ungesättigten Omega-3-Fettsäuren, die man daher am besten gleich in Kapseln oder durch eine Diät mit Lebensmitteln zu sich nehmen sollte, in denen diese Fettsäure enthalten ist. Ein systematischer Review und eine Metaanalyse von 20 randomisierten kontrollierten Studien mit 68.680 TeilnehmerInnen aus verschiedenen Ländern und Esskulturkreisen (z.B. Japan) sowie einem Zeitraum von vor 1989 bis heute kommt aber zu einem deutlich anderen Ergebnis: Mehrfach ungesättigte Omega-3-Fettsäuren als Nahrungsergänzungsmittel senken das Risiko der Gesamtsterblichkeit, des plötzlichen Todes, des Herztodes, Herzinfarkts oder des Schlaganfalls nicht signifikant. Ihre Einnahme als Nahrungsergänzungsmittel ist zwar nach den Daten dieser Studie auch nicht risikoerhöhend, aber auf Dauer eine vermeidbare Belastung der Haushaltskassen. Um sicher zu stellen, dass sich überhaupt Effekte der Fettsäure einstellen konnten, waren z.B. nur RCTs aufgenommen worden, in denen die Teilnehmer mindestens ein Jahr eine entsprechende Diät durchführten oder Nahrungsergänzungsmittel aufnahmen. Als Wirkungsindikatoren wurden das relative Risiko und die absolute Risikoreduktion bei den oben genannten Erkrankungs- bzw. Sterberisiken ermittelt. Die durchschnittliche tägliche Aufnahme der Fettsäure betrug 1,41 Gramm und dies im Durchschnitt 2 Jahre lang (Maximum 6,2 Jahre). Das häufigste Anwendungsgebiet von Omega-3-Fettsäuren war die Sekundärprävention bei kardiovaskulären Erkrankungen. Die Ergebnisse beziehen sich aber nur auf die fehlenden Wirkungen von Omega-3-Fettsäure-Nahrungsergänzungsmittel und -Diäten auf die untersuchten Erkrankungen und raten nicht vom Genuss von normalen Nahrungsmitteln mit einem spürbaren Gehalt an dieser Art von Fettsäuren ab. So sollten Fische also durchaus regelmäßig gegessen werden - weil sie schmackhaft und bekömmlich sind und auch die für das normale Leben notwendige Omega-3-Fettsäure enthalten. Im Kommentar setzen sich die AutorInnen dieser Studie auch ausführlich mit den Defiziten und Grenzen der Studien auseinander, die schon bisher und mit Sicherheit auch künftig von den Anbietern von Omega-3-Fettsäure-Kapseln und den Propagandisten entsprechender Diäten als Beleg für ihre Empfehlungen zitiert werden. Der Aufsatz "Association between omega-3 fatty acid supplementation and risk of major cardiovascular disease events: a systematic review and meta-analysis." von Rizos EC, Ntzani EE, Bika E, et al. ist am 12. September 2012 in der US-Fachzeitschrift "JAMA" (308(10):1024-33) erschienen. Das Abstract ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 27.9.12
Sechsmal mehr Gesundheit? Der Faktencheck Gesundheit
 In Bremerhaven ist die Wahrscheinlichkeit, bis zum 19. Lebensjahr die Mandeln entfernt zu bekommen, sechsmal höher als in Rosenheim. Die Häufigkeit im Kreis mit der höchsten Rate an Bypass-Operationen am Herzen unterscheidet sich vom Kreis mit der niedrigsten Rate um den Faktor 8.
In Bremerhaven ist die Wahrscheinlichkeit, bis zum 19. Lebensjahr die Mandeln entfernt zu bekommen, sechsmal höher als in Rosenheim. Die Häufigkeit im Kreis mit der höchsten Rate an Bypass-Operationen am Herzen unterscheidet sich vom Kreis mit der niedrigsten Rate um den Faktor 8.
Regionale Versorgungsunterschiede werfen Fragen nach den Ursachen auf und weisen auf Über-, Unter- und Fehlversorgung hin. Eindeutige Antworten lassen sich aus den Zahlen allein nicht ableiten, aber die Suche nach den Ursachen kann wertvolle Erkenntnisse über die Versorgungsqualität liefern.
Im Rahmen ihrer Initiative für eine gute Gesundheitsversorgung hat die Bertelsmann-Stiftung die Versorgungsunterschiede für 16 Indikatoren aufarbeiten und erklären lassen. Als interaktive Karten sind die ersten Ergebnisse seit Oktober 2011 im Internet verfügbar. Vor Kurzem ist die erste Printausgabe des Faktencheck mit umfangreicherer Erläuterung der Methodik und Diskussion möglicher Ursachen erschienen (Download als PDF)
Der Faktencheck Gesundheit bezieht sich ausdrücklich auf den amerikanischen Dartmouth Atlas of Healthcare (wir berichteten mehrfach) und auf den englischen NHS Atlas of Variation (wir berichteten) und bezieht - im Gegensatz zum Versorgungsatlas des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung - alle Aspekte der Versorgung in sein Fragestellungen ein.
Die Initiative für gute Gesundheitsversorgung (INIgG) der Bertelsmann Stiftung soll nach eigenem Bekunden dazu beitragen,
• dass Gesundheitsleistungen stärker am tatsächlichen Bedarf der Patienten ausgerichtet und die begrenzten Ressourcen sachgerechter eingesetzt werden
• dass sich die Menschen aktiv damit auseinandersetzen, welche Leistungen ihrem Bedarf entsprechen und wie die Versorgung besser gestaltet werden kann
• dass die Bürger sich stärker mit der Gesundheitsversorgung in ihrer Region auseinandersetzen, das Gesundheitssystem sowie notwendige politische Reformen besser verstehen und ihr Vertrauen in unser Gesundheitswesen und die Politik steigt
Forschung zu Fragen der regionalen Versorgungsunterschiede hat in Deutschland bis auf wenige Ausnahmen bis vor Kurzem praktisch nicht stattgefunden. Das Thema Über-, Unter- und Fehlversorgung ist selbst für die deutsche Versorgungsforschung eher ein Nicht-Thema. Daher sind die Initiativen der Bertelsmann Stiftung und des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung verdienstvoll. Schon die ersten Ergebnisse zeigen, dass hier relevante Probleme aufgedeckt werden, deren Lösung eine offene und vorbehaltlose Erörterung durch Experten und Bürger erfordert.
Faktencheck Gesundheit
Website mit interaktiven Karten
Bericht als PDF Download
Video Sechsmal mehr Gesundheit? Link
Video Antibiotika bei Kindern Link
Dartmouth Atlas of Healthcare
Website
Forum Gesundheitspolitik
The NHS Atlas of Variation
Website
Forum Gesundheitspolitik
Versorgungsatlas des ZI
Website Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung (ZI)
Forum Gesundheitspolitik
Eine vergleichbare Initiative für Spanien:
Atlas VPM - Atlas de Variaciones en la Practica Medica en el Sistema Nacional De Salud Website
Wennberg International Collaborative Website
The Wennberg International Collaborative is a research network committed to improving healthcare by examining organizational and regional variation in health care resources, utilization, and outcomes.
David Klemperer, 11.3.12
Kinder sind nicht nur "süß", sondern können ihre Väter auch vor dem Herztod bewahren - je mehr Kinder desto besser!
 Während der positive Zusammenhang zwischen der Fruchtbarkeit der Frauen und einigen Aspekte ihrer Gesundheit vielfach nachgewiesen ist, gab es bisher sehr wenige Untersuchungen, die ähnliche Zusammenhänge bei den Männern untersuchten oder gar nachwiesen.
Während der positive Zusammenhang zwischen der Fruchtbarkeit der Frauen und einigen Aspekte ihrer Gesundheit vielfach nachgewiesen ist, gab es bisher sehr wenige Untersuchungen, die ähnliche Zusammenhänge bei den Männern untersuchten oder gar nachwiesen.
Mit einer Auswertung der Gesundheits- und Sterbedaten von 137.903 US-Amerikanern im Alter zwischen 50 und 71 Jahren, die zu Beginn der Beobachtungszeit nicht an einer kardiovaskulären Erkrankung litten, liegen nun aber eine Reihe von Hinweisen vor, dass auch die Männer von ihrem bzw. ihrer "fertility potential and reproductive fitness" gesundheitlich profitieren. Die Daten wurden im Rahmen der "NIH-AARP Diet and Health Study" in den USA über eine Zeit von 10,2 Jahren erhoben.
92% der Studienteilnehmer hatten wenigstens ein Kind und 50% drei oder mehr Nachkommen. Das Durchschnittsalter der Männer betrug 62 Jahre und fast 95% waren Weiße.
Die Ergebnisse sahen so aus:
• Wenn man die Männer bzw. Väter nach Alter, Ausbildung, Rasse, Personenstand, Einkommen, nach diversen Gesundheitsverhaltensfaktoren und ihrem selbst wahrgenommen Gesundheitszustand adjustiert, also den möglichen Einfluss dieser Faktoren auf den untersuchten gesundheitlichen Effekt ausschließt, haben 50 Jahre und älteren Männer ohne Kinder eine im Vergleich mit Männern mit einem oder mehreren Kindern signifikant um 17% erhöhte Risikorate, wegen einer kardiovaskulären Erkrankung zu sterben.
• Die Untersuchungen zeigen auch, dass die protektive oder lebensverlängernde Wirkung von Kindern mit deren Anzahl zunimmt: Wenn kinderlose Männer mit Vätern von fünf oder mehr Kindern verglichenen werden, ist die genannte Risikorate um 21% erhöht. Das kardiovaskuläre Sterberisiko sinkt zwar stetig, aber nicht linear mit der Anzahl der Kinder.
Trotz einiger von den AutorInnen selber genannten Limitationen ihrer Studie (relativ geringe Dauer und Messprobleme für das reproduktive Potenzial), dürfte der beobachtete Zusammenhang bei künftigen Studien, die z.B. längere Beobachtungszeiten haben, aber eher noch deutlicher und größer werden.
Von dem am 26. September 2011 vorab veröffentlichten Aufsatz "Fatherhood and the risk of cardiovascular mortality in the NIH-AARP Diet and Health Study. von Michael L. Eisenberg et al. aus der Fachzeitschrift "Human Reproduction" ist ein Abstract kostenlos zugänglich.
Bernard Braun, 24.10.11
Spät aber endlich! Mehr Transparenz über die regionale gesundheitliche Versorgung in Deutschland.
 Auch wenn es im § 70 des Sozialgesetzbuch V seit 1989 verpflichtend heißt, Krankenkassen und Leistungserbringer "haben eine bedarfsgerechte und gleichmäßige … Versorgung der Versicherten zu gewährleisten" und "auf eine humane Krankenbehandlung ihrer Versicherten hinzuwirken" entspricht die aktuelle Wirklichkeit der folgenden Feststellung des Vorsitzenden der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Köhler: "Im Hinblick auf die Frage, wie gut die Bevölkerung einer Region insgesamt versorgt ist, tappen wir nach wie vor weitgehend im Dunkeln". Weder werde der regionale Versorgungsbedarf systematisch erhoben, noch existiere für die Entscheidungsträger im Gesundheitswesen eine allgemeine Informationsquelle, um regionale Unterschiede in der Inanspruchnahme verschiedener Versorgungsstrukturen oder in der Qualität der Versorgungsprozesse zu erkennen, fasst das "Deutsche Ärzteblatt" die weiteren Ausführungen Köhlers zusammen.
Auch wenn es im § 70 des Sozialgesetzbuch V seit 1989 verpflichtend heißt, Krankenkassen und Leistungserbringer "haben eine bedarfsgerechte und gleichmäßige … Versorgung der Versicherten zu gewährleisten" und "auf eine humane Krankenbehandlung ihrer Versicherten hinzuwirken" entspricht die aktuelle Wirklichkeit der folgenden Feststellung des Vorsitzenden der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Köhler: "Im Hinblick auf die Frage, wie gut die Bevölkerung einer Region insgesamt versorgt ist, tappen wir nach wie vor weitgehend im Dunkeln". Weder werde der regionale Versorgungsbedarf systematisch erhoben, noch existiere für die Entscheidungsträger im Gesundheitswesen eine allgemeine Informationsquelle, um regionale Unterschiede in der Inanspruchnahme verschiedener Versorgungsstrukturen oder in der Qualität der Versorgungsprozesse zu erkennen, fasst das "Deutsche Ärzteblatt" die weiteren Ausführungen Köhlers zusammen.
Der Anlass dieser für ein Gesundheitssystem, das allein die gesetzlich Krankenversicherten seit Jahren jährlich mehr als 150 Milliarden Euro kostet, deprimierenden Defizitanalyse, ist das frisch gestartete Projekt eines Versorgungsatlas, das in einigen Jahren vielleicht in die Nähe der international zum Teil seit Jahrzehnten vorbildlich funktionierenden Berichterstattungssysteme wie des Dartmouth-Atlas in den USA gelangen könnte.
Zu den Zielen des von Beginn an im Internet zugänglichen Werkes gehört "die alltagstaugliche Darstellung wissenschaftlicher Ergebnisse", die von Einrichtungen wie dem Zentralinstitut für kassenärztliche Versorgung der KBV (ZI), Krankenkassen, Universitäten und anderen Einrichtungen "eingestellt" werden können.
Der Versorgungsatlas
• "bietet eine öffentlich zugängliche Informationsquelle zu einer stetig wachsenden Anzahl ausgewählter Themen aus der medizinischen Versorgung in Deutschland. Schwerpunkt des Versorgungsatlas sind regionale Unterschiede in der medizinischen Versorgung und deren Ursachen."
• Auf der Website soll man "Forschungsergebnisse und Analysen zu regionalen Besonderheiten und Unterschieden in den Strukturen, Abläufen und Ergebnissen der medizinischen Versorgung (finden), die Anhaltspunkte für Möglichkeiten der Verbesserung der Versorgung bieten."
• Feedback und Ergänzungen zu bereits vorhandenen Informationen sind ausdrücklich erwünscht.
Das Startpaket liefert das ZI mit Studien über die Inanspruchnahme der Polysomnographie im regionalen Vergleich, Influenza-Impfraten bei Patienten > 60 Jahre im Jahr 2007, Influenza-Impfraten im Jahr 2007 und einem methodischen Beitrag zu den Unschärferelationen patientenbezogener Abrechnungsdaten gemäß § 295 SGB V im regionalen Vergleich (Verdünnungsquote).
Eine Aussage eines ersten Beitrag zeigt aber auch, dass das Veröffentlichen von Studien alleine noch lange kein theoretisch solider und für Nutzer des Versorgungssystems qualitativ hochwertig praktisch orientierender Beitrag zur Versorgung sein muss. So gibt es zu der Behauptung "Influenza-Impfungen stellen eine wirksame Maßnahme zum Schutz gegen die Influenza dar" je nachdem was unter Schutz verstanden wird, kontroverse oder relativierende wissenschaftliche Positionen (vgl. dazu z.B. einen Forums-Beitrag über Ergebnisse der internationalen Forschung).
Wen das Startpaket interessiert oder wer sich laufend über den Fortschritt der Initiative informieren will, findet den Versorgungsatlas ab sofort kostenlos im Internet.
Bernard Braun, 31.8.11
"Darf's ein wenig mehr sein"? Blutarmut durch Blutabnahme als jüngstes Beispiel der Fehlversorgung durch Überversorgung
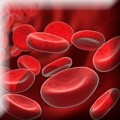 Der Blutverlust bei der Blutabnahme für diagnostische Zwecke ist bei Patienten, die wegen eines akuten Herzinfarkts stationär behandelt werden, mit einem im Krankenhaus erworbenen Mangel an roten Blutkörperchen (Anämie) assoziiert. Die Folge, eine unzureichende Sauerstoffversorgung des gesamten Körpers, ist gerade bei Menschen mit bereits vorgeschwächtem Organismus ungesund und daher eigentlich systematisch zu vermeiden.
Der Blutverlust bei der Blutabnahme für diagnostische Zwecke ist bei Patienten, die wegen eines akuten Herzinfarkts stationär behandelt werden, mit einem im Krankenhaus erworbenen Mangel an roten Blutkörperchen (Anämie) assoziiert. Die Folge, eine unzureichende Sauerstoffversorgung des gesamten Körpers, ist gerade bei Menschen mit bereits vorgeschwächtem Organismus ungesund und daher eigentlich systematisch zu vermeiden.
Trotzdem zeigte eine Untersuchung bei 17.676 Herzinfarkt-Patienten, die im Zeitraum von 2000 bis 2008 bei ihrer Einweisung in eines von 57 us-bundesweiten Krankenhäusern nicht an Blutarmut litten, dass rund 20% von ihnen während ihres Krankenhausaufenthaltes eine moderate bis ernste Form einer Anämie entwickelten. Der Hauptgrund war die während des Aufenthalts und insbesondere während der ersten beiden Tage für diagnostische Zwecke entnommene Menge Blut: Bei den anämischen Personen betrug diese Menge 175 mL, bei den nchtanämischen Patienten lediglich 85 mL. Und auch bei den Patienten mit nachstationärer Anämie variierte die entnommene Blutmenge zwischen 119 mL bei moderater Blutarmut bis zu 246 mL Blut bei schwerer Blutarmut. Menschen mit keiner oder einer leichten Form der Blutarmut hatten zwischen 53 und 110 mL abgenommen bekommen. Dies alles zeigt auch, dass es bei vergleichbar erkrankten Personen große Mengen Blut keineswegs gesundheitlich notwendig sind, sondern man auch "mit ein bisschen weniger" diagnostizieren und behandeln kann.
Wer der Meinung ist, es käme bei der Menge Blut im Körper nicht auf ein paar Tropfen an, kann sich durch die Ergebnisse dieser Studie eines Besseren belehren lassen. Mit jeden 50 mL entnommenen Blutes steigt das Risiko für leichte bis schwere Blutarmut und damit auch der Folgen um 18%, multivariat adjustiert immer noch signifikant um 15%.
Die Autoren schlagen auch noch zwei eigentlich triviale Mittel vor, um die Entnahmemenge generell zu reduzieren: Blutröhrchen aus der Pädiatrie zu verwenden oder einfach die Erwachsenenbehälter mit weniger als der höchstmöglichen Menge zu füllen. Nachzudenken wäre aber auch noch über den Sinn und Zweck mancher Blutentnahme. Ob auch bei anderen Behandlungsanlässen für eine stationäre Behandlung so viel zu viel Blut abgenommen wird, dass Blutarmut die Folge ist und ob dies ohne Nachteile für die Diagnostik und Therapie reduziert werden kann, sollte weiter untersucht werden.
Der unter der Rubriküberschrift "Online First. Less is more" stehende Aufsatz "Diagnostic Blood Loss From Phlebotomy and Hospital-Acquired Anemia During Acute Myocardial Infarction von Salisbury et al. ist in der Fachzeitschrift "Archives of Internal Medicine" am 8. August 2011 erschienen (Seiten E1 bis E8) und komplett kostenlos erhältlich.
Ein weiterer "online first" veröffentlichter Kommentar ist unter der Überschrift "Comment on 'Diagnostic Blood Loss From Phlebotomy and Hospital-Acquired Anemia During Acute Myocardial Infarction' von Stephanie Rennke und Margaret C. Fang ist in derselben Ausgabe der Zeitschrift erschienen und ebenfalls kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 9.8.11
NHS Atlas zeigt Versorgungsunterschiede auf
 3 von 1.000 Patienten mit Diabetes erhalten eine Amputation in der Region mit der höchsten Amputationsrate, 1,5 pro Tausend in der Region mit der niedrigsten Rate. Die Notfall-Einweisungsrate für Erwachsene mit Asthma unterscheidet sich in den Versorgungsregionen um den Faktor 3, der Anteil der Kinder, die mit Kaiserschnitt auf die Welt kommen um den Faktor 2, die Rate an Hüftgelenksersatzoperationen um den Faktor 4.
3 von 1.000 Patienten mit Diabetes erhalten eine Amputation in der Region mit der höchsten Amputationsrate, 1,5 pro Tausend in der Region mit der niedrigsten Rate. Die Notfall-Einweisungsrate für Erwachsene mit Asthma unterscheidet sich in den Versorgungsregionen um den Faktor 3, der Anteil der Kinder, die mit Kaiserschnitt auf die Welt kommen um den Faktor 2, die Rate an Hüftgelenksersatzoperationen um den Faktor 4.
An insgesamt 34 Indikatoren zeigt der "The NHS Atlas of Variation in Healthcare" Versorgungsunterschiede in den 52 englischen Versorgungsregionen (Strategic Health Authorities) auf. Die Unterschiede werden als Quintilen auf einer Landkarte sowie als Balkengrafik dargestellt.
Beispiele für weitere Indikatoren sind die Anzahl der stationär verbrachten Tage von Krebspatienten, die Suizidrate, Verweildauer im Krankenhaus bei Hüftgelenksfraktur, Notfallaufnahmen ins Krankenhaus bei über 75-Jährigen, Anteil der Todesfälle im Krankenhaus und Anteil der Personen, die eine Computertomographie erhielten.
Unterschiede in der Versorgung, wie sie durch derartige Indikatoren aufgezeigt werden, können gerechtfertigt sein, wenn sie auf unterschiedlichen regionalen Krankheitshäufigkeiten oder auf unterschiedlichen Patientenpräferenzen beruhen. Im Blickpunkt stehen Unterschiede, die medizinisch nicht gerechtfertigt sind. Diese bieten Chancen für eine bessere Versorgung. Nicht gerechtfertigte Unterschiede finden sich häufig in Regionen mit hohen Durchführungsraten - hier würde die Verbesserung der Qualität also mit einer Senkung der Kosten einhergehen.
Die Autoren verstehen den Atlas als eine Karte, die den Entscheidern im Gesundheitswesen einen Kurs aufzeigen soll, der zu höherer Versorgungsqualität führt. Bezug genommen wird ausdrücklich auf den Dartmouth Atlas of Healthcare, über den wir mehrfach berichtet haben, zuletzt hier.
The NHS Atlas of Variation in Healthcare
Website
Download
The Dartmouth Atlas of Healthcare - Website
David Klemperer, 2.5.11
Wie gut vorbereitet sind Krankenhäuser auf schwere Katastrophen ŕ la Japan? Beunruhigende Ergebnisse einer US-Krankenhausbefragung
 Wie schnell sich die "Alles-ist-sicher"- und "Wir-haben-alles-im-Griff"-Rhetorik von Unternehmen und Politik im Bereich technischer Verfahren im wahrsten Sinne des Wortes in lebensgefährlichen Rauch auflösen kann, konnte und kann man an den Folgen des Erdbebens, Tsunamis und der gewaltigen Störfälle im Atomkraftwerk Fukushima leider in allen Details studieren.
Wie schnell sich die "Alles-ist-sicher"- und "Wir-haben-alles-im-Griff"-Rhetorik von Unternehmen und Politik im Bereich technischer Verfahren im wahrsten Sinne des Wortes in lebensgefährlichen Rauch auflösen kann, konnte und kann man an den Folgen des Erdbebens, Tsunamis und der gewaltigen Störfälle im Atomkraftwerk Fukushima leider in allen Details studieren.
Wer dabei sieht, dass in einem der reichsten Industrieländer der Welt, gebrechliche und kranke Personen in unterkühlten Turnhallen oder zuletzt auch in Tokioter 5-Sterne-Hotels notdürftig untergebracht wurden, sollte sich fragen, wie die gesundheitliche Versorgung in vergleichbaren Katastrophenfällen eigentlich in anderen, ärmeren wie reicheren Ländern aussehen würde.
Welche Funde eine entsprechende Recherche zu Tage fördern kann, zeigt ein gerade für die USA veröffentlichter offizieller Bericht, der sich auf Daten des "National Hospital Ambulatory Medical Care Survey" aus dem Jahr 2008 stützt. Dessen spezifischen Fragen nach der Vorbereitung auf sechs näher bezeichnete Typen von Katastrophen wurde von 294 der insgesamt 395 befragten repräsentativen Krankenhäuser beantwortet zurückgeschickt. Bei den Katastrophenkonstellationen handelt es sich um den pandemischen Ausbruch von Krankheiten, Bioterror-Attacken, chemischen Unfällen oder Angriffen, nukleare, mit Strahlung verbundene Ereignisse, große Explosionen und Feuersbrünste sowie große Naturkatastrophen wie z.B. Erdbeben.
Die Ergebnisse lauten im Einzelnen:
• Nahezu alle befragten Krankenhäuser hatten für irgendeine der Katastrophen Aktionspläne.
• Nur 68% der Krankenhäuser hatten aber Pläne für den Umgang mit allen sechs Katastrophensorten.
• Am wenigsten Pläne gab es für den Fall und die Folgen eines nuklearen Unfalls mit Verstrahlungen und eine große Brandsatzexplosion. Sie fehlten in jeweils gut 20 % der Krankenhäuser. Obwohl der einzige große AKW-Unfall vor Tschernobyl in den USA stattfand, und einige kalifornische AKW in vergleichbaren Erbebenrisikogebieten stehen wie das jetzt am Rande des GAU stehende japanische AKW war auch in den USA offensichtlich die Meinung verbreitet, die eigenen AKWs seien "sicher".
• Mehr als 95% der Kliniken hatten aber Pläne für den Fall von Naturkatastrophen und Chemieunfälle.
• Ein Hauptmangel war die Dominanz von Plänen welche die beim Anstrum zu vieler Patienten notwendige Zusammenarbeit mit anderen Krankenhäusern und anderen Gesundheitsversorgungseinrichtungen vernachlässigten bzw. nicht geregelt hatten. Beispielsweise hatte ein Viertel der Kliniken keine Pläne wie die örtlichen Kapazitäten im Falle einer großen Anzahl von zu versorgenden Katastrophenopfer mobilisiert werden könnten. Ferner hatten 40% der Kliniken keine Vereinbarungen mit spezialisierten Zentren zur Behandlung von Verbrennungspatienten.
• Während immerhin 88% der Krankenhäuser angaben, sie hätten schriftliche Arrangements mit anderen Kliniken, bei Überfüllung erwachsene Patienten zu übernehmen, hatten nur 56,2 % aller Häuser solche Vereinbarungen zur Übernahme von Kindern. Die potenzielle Versorgung von Kindern (dazu gehören z.B. auch Hilfen bei der Wiederzusammenführung von Familien) und Behinderten sah insgesamt bei mehr als der Hälfte der Krankenhäuser schlecht aus.
• Schließlich gab es bei beinahe 40 % aller Krankenhäuser keinen Plan, wie man ihre Kapazität zur Lagerung von Leichen erweitern kann.
• Dennoch gibt es aber auch Positives zu berichten: Die große Mehrheit der Krankenhäuser hat in ihre Planungen andere lokale Akteure wie die Feuerwehr oder die örtlichen öffentlichen Gesundheitseinrichtungen einbezogen.
Bevor man weiter sagt oder hofft, in Deutschland träten natürlich nie solche Katastrophen ein und selbst im eigentlich unmöglichen Fall sähe dann versorgungsmäßig alles gut aus und funktioniere, wäre ein dem US-Beispiel ähnelnder nationaler Bericht beruhigender.
Den von den staatlichen "Centers of Disease Control (CDC)" verbreiteten 15-seitigen "Report "Hospital Preparedness for Emergency Response: United States, 2008" von Richard W. Niska und Iris M. Shimizu (National Health Statistic Reports 24. März 2011; Nummer 37) gibt es kostenlos im Internet.
Bernard Braun, 28.3.11
Bericht des US-"Surgeon General": Egal ob "nur zwei Zigarettchen" oder "extra light", Rauchen gefährdet die Gesundheit!
 Diejenigen, denen beim Thema gesundheitliche Risiken von Rauchen immer noch die kerngesunde 98-jährige Großmutter einfällt, die ein Leben geraucht hat oder die denken, dass doch drei, vier Zigaretten nichts schaden würden, können sich auf den mehr als 700 Seiten eines gerade veröffentlichten Berichts des "Surgeon General" der USA eines Besseren belehren lassen. Der "surgeon general" ist der operative Leiter des "United States Public Health Services", vom Präsidenten und Parlament für vier Jahre eingesetzt und nimmt regelmäßig zu allen Angelegenheiten des öffentlichen Gesundheitsdienstes Stellung.
Diejenigen, denen beim Thema gesundheitliche Risiken von Rauchen immer noch die kerngesunde 98-jährige Großmutter einfällt, die ein Leben geraucht hat oder die denken, dass doch drei, vier Zigaretten nichts schaden würden, können sich auf den mehr als 700 Seiten eines gerade veröffentlichten Berichts des "Surgeon General" der USA eines Besseren belehren lassen. Der "surgeon general" ist der operative Leiter des "United States Public Health Services", vom Präsidenten und Parlament für vier Jahre eingesetzt und nimmt regelmäßig zu allen Angelegenheiten des öffentlichen Gesundheitsdienstes Stellung.
In seinem jetzt vorgelegten Bericht "How Tobacco Smoke Causes Disease: The Biology and Behavioral Basis for Smoking-Attributable Disease" untermauert er auf der Basis entsprechender Forschungsergebnisse faktenreich sechs zentrale Sachverhalte im Kontext von Tabakrauchen:
• Nach den vorliegenden Kenntnissen über die Mechanismen welche durch das Rauchen von Tabakwaren Rauchen Krankheiten auslösen gibt es kein risikofreies Niveau der Exposition gegenüber Tabakrauch.
• Die Inhalation der komplexen Mischung von Stoffen im Tabakrauch löst eine Fülle von Krebs-, Herz-Kreislauf- und Atemwegserkrankungen aus. Dies erfolgt über eine Vielzahl von Mechanismen bis hin zur Schädigung der DNA und so genanntem oxidativem Stress.
• Das Risiko und die Schwere unerwünschter gesundheitlicher Ergebnisse hängen direkt von der Dauer und der Intensität der Exposition gegenüber Tabakrauch.
• Anhaltender Konsum und lang anhaltende Exposition gegenüber Tabakrauch sind für die massiven Sucht- bzw. Abhängigkeitserscheinungen bei Rauchern verantwortlich. Suchtverstärkend können vielleicht auch weitere chemische Beimengungen zum Tabak wirken.
• Bereits niedrige Levels der Exposition, welche das Passivrauchen einschließen, führen zu einem schnellen und kräftigen Anstieg von Fehlfunktionen und Entzündungen in den Gefäßwänden, die wiederum maßgeblich zu akuten kardiovaskulären Ereignissen und Thrombosen beitragen.
• Für die von den Herstellern der Tabakwaren und einigen Wissenschaftlern verbreitete Hoffnung, dass die technische Reduktion einiger spezifischer Giftstoffe im Tabakrauch das Risiko der wesentlichen unerwünschten Ergebnisse des Rauchens reduzieren, gibt es keine ausreichende Evidenz.
Trotz des Umfangs bleibt der Bericht u.a. wegen eines detaillierten Stichwortverzeichnisses übersichtlich und anschaulich. Die ausführlichen Literaturverzeichnisse ermöglichen die Vertiefung der gewonnenen Erkenntnisse.
Der 2010 vom "U.S. Department of Health and Human Services" herausgegebene 732-Seiten-Bericht "How Tobacco Smoke Causes Disease: The Biology and Behavioral Basis for Smoking-Attributable Disease: A Report of the Surgeon General." ist komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 12.12.10
Atheistisch gesinnte Ärzte sind bei todkranken Patienten häufiger zu lebensverkürzenden Maßnahmen bereit
 Im Vergleich zu tief religiösen Ärzten sind atheistisch gesinnte Ärzte eher bereit, todkranken Patienten medizinische Maßnahmen zukommen zu lassen, die ihr Leben mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit verkürzen. Zu diesem Ergebnis kommt eine im United Kingdom durchgeführte Befragung von rund 4.000 Ärzten unterschiedlicher Fachrichtungen, die jetzt im "Journal of Medical Ethics" veröffentlicht wurde.
Im Vergleich zu tief religiösen Ärzten sind atheistisch gesinnte Ärzte eher bereit, todkranken Patienten medizinische Maßnahmen zukommen zu lassen, die ihr Leben mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit verkürzen. Zu diesem Ergebnis kommt eine im United Kingdom durchgeführte Befragung von rund 4.000 Ärzten unterschiedlicher Fachrichtungen, die jetzt im "Journal of Medical Ethics" veröffentlicht wurde.
Die Ergebnisse der Studie basieren auf einer postalischen Befragung von 3.733 Ärzten aus dem United Kingdom, Ärzten sehr unterschiedlicher Fachrichtungen (von Neurologie über Geriatrie und Allgemeinmedizin bis hin zur Palliativmedizin) und auch aus unterschiedlichen beruflichen Feldern (Einzel- und Gemeinschaftspraxen, Pflegeheime, Kliniken). An der Umfrage beteiligt haben sich 42 Prozent von insgesamt etwa 8.500 angeschriebenen Medizinern - die Beteiligungsrate ist damit für diese Berufsgruppe im Vergleich zu anderen Studien recht hoch. (Forschungsprojekte, die eine postalische oder telefonische Befragung von Ärzten umfassen, müssen sich oft mit Response-Quoten von 10-20% begnügen.) Die überwiegende Mehrheit der teilnehmenden Ärzte (N= 2923, 78%) konnte dabei auch über einen zumindest einen Patienten berichten, der bei ihnen in Behandlung war und dann verstarb.
Im Fragebogen wurde eine Reihe von Informationen erfragt: Die Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft, die Intensität der religiösen Überzeugungen, Meinungen zu Euthanasie und Sterbehilfe, Details der Behandlung des oder der verstorbenen Patienten wie z.B. Verordnung von Schmerz- und Beruhigungsmitteln, Gespräche mit Patienten über lebensverkürzende Maßnahmen bei einer unheilbaren Krankheit usw.
In der Analyse dieser Daten zeigte sich dann:
• Religionszugehörigkeit und medizinische Fachrichtung sind nicht unabhängig voneinander: Geriatrisch spezialisierte Mediziner, die also häufiger mit älteren Patienten in Kontakt kamen, waren eher Hindus oder Muslime. Palliativmediziner waren häufiger Christen.
• Die ethnische Zugehörigkeit der Ärzte zeigte keinen Zusammenhang zu persönlichen Einstellungen, was ethisch kontroverse Fragen anbetraf.
• Etwa 13% der Ärzte bezeichneten sich selbst als "sehr gläubig" (in der Bevölkerung im UK sind dies mit 6,5% nur halb so viele) und 20% als "stark ungläubig" (Bevölkerung: 15%).
Palliativmediziner zeigten die geringste Bereitschaft, lebensverkürzende Maßnahmen (aus Mitleid oder anderen Gründen) einzusetzen. Ganz unabhängig von der medizinischen Fachrichtung zeigte sich ein enger Zusammenhang zum persönlichen religiösen Glauben der Ärzte mit verschiedenen Verhaltensweisen im Rahmen der Behandlung. Bei Ärzten, die sich selbst als ungläubig oder atheistisch definierten, zeigte sich eine etwa zweimal so große Wahrscheinlichkeit:
• dass diese über einen längeren Zeitraum bis zum Tod des Patienten massiv Schmerz- und Beruhigungsmittel verordnet hatten,
• therapeutische Maßnahmen durchgeführt hatten, von denen sie annahmen, dass sie auch das Leben verkürzen könnten,
• mit Patienten, die sie als geistig wach einschätzten, über solche Maßnahmen und damit verbundene Risiken geredet und sie in die Entscheidung einbezogen hatten.
Kurzkommentar des Wissenschaftlers Prof. Seale: "Wenn Sie schwer erkrankt oder sogar todkrank sind, fragen Sie Ihren Arzt, ob er an Gott glaubt."
Hier ist ein Abstract: Clive Seale: The role of doctors' religious faith and ethnicity in taking ethically controversial decisions during end-of-life care (J Med Ethics, doi:10.1136/jme.2010.036194)
Gerd Marstedt, 10.9.10
Therapietreue - Ansatz zu verbesserter Gesundheit und zur Kostendämpfung
 Zwei Studien aus Kanada liefern überzeugende Hinweise auf die große Bedeutung der Adherence sowohl für das Auftreten und den klinischen Verlauf chronischer Krankheiten als auch für die Ausgabenentwicklung eines Gesundheitswesens. Adherence lässt sich im Deutschen am treffendsten als Therapietreue übersetzen und umfasst sowohl den Aspekt fortgesetzter Behandlung (Persistenz) als auch die Einnahme nach empfohlener Dosierung (Compliance). Nicht zuletzt die wachsende Diskrepanz zwischen medizinisch-pharmakologischem Fortschritt und der hinterher hinkenden Eindämmung der Volkskrankheiten wie Bluthochdruck, Diabetes mellitus, koronare Herzkrankheit oder Schlaganfall lenkt die Aufmerksamkeit zunehmend auf die Frage, wie Gesundheitssysteme den in vielfachen Studien erwiesenen Nutzen evidenzbasierter Behandlungen zuverlässig der wachsenden betroffenen Bevölkerung zukommen lassen kann. Die beiden kanadischen Studien bestätigen nicht nur unübersehbare Mängel bei der Einnahme wirksamer Medikamente, sondern untermauern vor allem eindrücklich, dass dabei der Therapietreue bzw. Adherence eine entscheidende Funktion zukommt.
Zwei Studien aus Kanada liefern überzeugende Hinweise auf die große Bedeutung der Adherence sowohl für das Auftreten und den klinischen Verlauf chronischer Krankheiten als auch für die Ausgabenentwicklung eines Gesundheitswesens. Adherence lässt sich im Deutschen am treffendsten als Therapietreue übersetzen und umfasst sowohl den Aspekt fortgesetzter Behandlung (Persistenz) als auch die Einnahme nach empfohlener Dosierung (Compliance). Nicht zuletzt die wachsende Diskrepanz zwischen medizinisch-pharmakologischem Fortschritt und der hinterher hinkenden Eindämmung der Volkskrankheiten wie Bluthochdruck, Diabetes mellitus, koronare Herzkrankheit oder Schlaganfall lenkt die Aufmerksamkeit zunehmend auf die Frage, wie Gesundheitssysteme den in vielfachen Studien erwiesenen Nutzen evidenzbasierter Behandlungen zuverlässig der wachsenden betroffenen Bevölkerung zukommen lassen kann. Die beiden kanadischen Studien bestätigen nicht nur unübersehbare Mängel bei der Einnahme wirksamer Medikamente, sondern untermauern vor allem eindrücklich, dass dabei der Therapietreue bzw. Adherence eine entscheidende Funktion zukommt.
Die Arbeitsgruppe um Sylvie Perreault von der Universität Montreal verwendete die umfangreiche öffentliche Krankenversicherungsdatenbank Régie de l'Assurance Maladie der Provinz Québec, die detaillierte Angaben zu den Versicherten, Abrechnungendaten sämtlicher ambulanten und stationären Therapien sowie Kodierung und Kosten aller Behandlungen beinhaltet, und die Med-Echo-Datenbank, die stationäre Akutbehandlungen erfasst, für eine retrospektive Beobachtungsstudie mit eingebetteter Fall-Kontroll-Untersuchung. Dafür suchten sie insgesamt 112.092 Patienten zwischen 45 und 85 Jahren (Durchschnittsalter 63 Jahre) heraus, die an keiner kardiovaskulären Krankheit litten und zwischen dem 1. Januar 1999 und dem 31. Dezember 2004 eine Statintherapie begannen. 41 % der Personen waren männlich, 54 % von ihnen litten an Bluthochdruck und 26 % an Diabetes mellitus. Primärer Endpunkt war das Auftreten zerebrovaskulärer Erkrankungen (ischämischer oder hämorrhagischer Hirninfarkt, ICD 9: 431, 433, 434, 436, 437) zwischen dem Eintritt in die Kohorte und dem Ende der Studienperiode, dem 30. Juni 2005, wobei die mittlere Beobachtungszeit bei 2,95 Jahren lag.
3,5 % der Kohorte erlitten in diesem Zeitraum ein zerebrovaskuläres (1,2/100 Personenjahre) und 12,5 % ein kardiovaskuläres Ereignis (4.2/100 Personenjahre), 4,0 % erkrankten an chronischer Herzinsuffizienz (1,4/100 Personenjahre), 3,6 % am peripherer arterieller Verschlusskrankheit(1,2/100 Personenjahre), 10,6 % an anderen kardiovaskulären Erkrankungen (3.6/Personenjahre 100 Personenjahre) und 32,9 % nahmen Thrombozytenaggregationshemmer (11,1/100 Personenjahre) ohne vorhergehende Diagnose eine koronare Herzkrankheit. Die kardiovaskuläre Mortalität lag bei 0,4 % und die ursachenunabhängige Gesamtsterblichkeit bei 2,9 %.
Die Adherence erfassten die kanadischen ForscherInnen als Anteil der Therapietage, an denen den Versicherten laut Rezepteinlösung die verordneten Medikamente zur Verfügung standen (Medication Possession Ratio - MPR), die sie in 20er Schritten zwischen weniger als 20 und über 80 % einteilten. Nur gut die Hälfte der eingeschlossenen PatientInnen (55 %) wiesen eine gute Therapietreue mit einer MPR von 80 % oder mehr auf, wobei die durchschnittliche Adherence in dieser Gruppe im ersten Jahr nahezu 98 % und im Anschluss immerhin noch 95 % betrug; in der Gruppe mit eingeschränkter Therapietreue lag der Durchschnittswert im ersten Jahr bei 13 % und im weiteren Verlauf bei 9 %.
Mit Hilfe konditionaler logistischer Regressionsmodelle und Fall-Kontroll-Vergleiche zwischen PatientInnen mit sehr guter und mit schlechter Adherence ermittelten die ForscherInnen aus Montreal das relative Risiko zerebrovaskulärer Erkrankungen und adjustierten ihre Ergebnisse nach verschiedenen Kovariablen. Demnach senkt regelmäßige Einnahme von Statinen in empfohlener Dosierung (MPR ≥ 80 %) das relative Risiko des Auftretens zerebrovaskulärer Erkrankungen um 26 % (relative Rate 0,74; 95 % KI, 0,65 - 0,84) im Vergleich zu solchen PatientInnen, die nur geringe Therapietreue an den Tag legten (MPS < 20 %). Dies gilt allerdings nur für ischämische Schlaganfälle (RR 0,67; 95 % KI, 0,58-0,77), nicht aber für hämorrhagische Ereignisse (RR 0,97; 95 % KI, 0,59 - 1,58), was von pharmakologischer Wirkung und Pathogenese nachvollziehbar erscheint. Außerdem war die Risikominderung bei Personen unter 65 Jahren nicht signifikant (RR 0,80; 95 % KI, 0,65-1,00), wohl aber für über 65-Jährige (28 % Reduktion, RR 0,72; 95 % KI, 0,63 - 0,84). Kein nennenswerter Unterschied bestand dabei zwischen Hochrisiko-PatientInnen, die nicht nur an Hyperlipoproteinämie, sondern zugleich an Bluthochdruck und Diabetes mellitus litten (RR 0.71, 95% KI, 0.60-0.83) und solchen geringen Risikos (RR 0.72; 95 % KI, 0,58 - 0,89). Bemerkenswert auch im Hinblick auf andere Studien und die Untersuchung zwischen Adherence und klinischem Verlauf bei Lipidsenkern ist die Beobachtung, dass die positiven Effekte einer Statin-Therapie erst nach mindestens einem Jahr sichtbar werden. Insgesamt liefert diese kanadische Studie weitere Belege für die unzureichende Therapietreue gegenüber Statinens sowohl in der primär- als auch in der Sekundärprävention sowie Einblicke in die Ursachen mangelhafter Adherence (vgl. auch Bates et al. 2009, S. 2982).
Die gleiche kanadische Arbeitsgruppe, diesmal unter Federführung von Alice Dragomir, publizierteAnfang 2010die Ergebnisse einer weiteren großen Kohortenstudie auf Grundlage der Datenbanken Régie de l'Assurance Maladie der Provinz Québec und Med-Echo. Dabei analysierten sie die Daten von insgesamt 55.134 PatientInnen zwischen 45 und 85 Jahren ohne vorbestehende kardiovaskuläre Erkrankung, die zwischen dem 1. Januar 1999 und dem 30. Juni 2002 eine Statintherapie aufnahmen. Die Studienperiode begann am 1. Juli 2002 und erstreckte sich bis zum 30. Juni 2005; Endpunkte waren die Entstehung kardiovaskulärer Erkrankungen, relevante stationäre Aufnahmen wegen kardiovaskulärer Ereignisse sowie die dadurch verursachten Kosten. In dem dreijährigen Beobachtungszeitraum erfolgten 7.326 stationäre Behandlungen wegen akuter Koronar-, 2.189 wegen zerebrovaskulärer Ereignissen und 2.171 wegen chronischer Herzinsuffizienz.
Die Adherence erfassten die kanadischen ForscherInnen als Anteil der Tage, an denen den PatientInnen laut Rezeptausstellung Arzneimittel zur Verfügung standen, an der gesamten Beobachtungszeit und unterschieden zwischen therapietreuen Personen mit mindestens 80 % und mit weniger als 80 % eingenommen Medikamenten. Die mittlere Adherencerate lag bei den therapietreuen ProbandInnen bei 96 % und bei den nicht therapietreuen bei 42 %.
Eine nach diversen Unteraspekten durchgeführte logistische Analyse (polytomous logistic analysis) zeigte, dass gegenüber Statinen wenig therapietreue PatientInnen mit größerer Wahrscheinlichkeit an KHK (OR 1.07; 95 % KI, 1.01-1.13), zerebrovaskulären Ereignissen (OR 1.13; 95 % KI 1.03-1.25) und chronischer Herzinsuffizienz (OR 1.13; 95 % KI 1.01-1.26) erkrankten. Außerdem war eingeschränkte Therapietreue mit einem um 4 % erhöhten Risiko von Krankenhausaufnahmen (OR 1.04; 95 % CI 1.01-1.09) und in der dreijährigen Beobachtungszeit bei jedem/r stationär behandelten PatientIn durchschnittlich mit ca. 1.060 Kanadischen Dollar höheren Krankenhauskosten verbunden. Die durch schlechte Compliance verursachten zusätzlichen Kosten berechneten die kanadischen ForscherInnen auf 9,5 und die potenziellen Einsparungen durch gute Adherence auf 10,2 Millionen Kanadische Dollar. Damit liefern sie Belege dafür, dass eingeschränkte Therapietreue nicht nur das Auftreten von Krankheiten und Komplikationen fördert, sondern auch die Ausgaben steigen lässt.
Für Nicht-Abonnenten des American Journal of Medicine ist von der Studie von Sylvie Perreault, Laura Ellia, Alice Dragomir, Robert Côté, Lucie Blais, Anick Bérard und Lyne Lalonde Effect of statin adherence on cerebrovascular disease in primary prevention über die Ausgabe 122 (7) auf den Seiten 647-655 nur das Abstract kostenfrei zugänglich, während sich die Untersuchung von Alice Dragomir, Robert Côté, Michel White, Line Lalonde, Lucie Blais, Amik Bérard und Sylvie Perreault Relationship between Adherence Level to Statins, Clinical Issues and Health-Care Costs in Real-Life Clinical Setting aus Value in Health (13 (1), S. 87-94) als Volltext einsehen lässt.
Jens Holst, 15.8.10
Therapien mit Antibiotika: Meta-Analyse von 24 Studien stellt erneut massive Risiken der Resistenzbildung fest
 Die Verschreibung von Antibiotika bei Atemwegs-Erkrankungen oder anderen, ganz überwiegend nicht bakteriell verursachten Krankheiten ist wohl ein besonders prägnantes Beispiel für die im Gesundheitswesen immer noch verbreiteten Wege medizinischer Über- und Fehlversorgung. Die Verschreibung von Antibiotika hat zwar bei vielen Patienten eine emotional beruhigende Wirkung. Dies führt aber bei Infektionskrankheiten durch Viren zu keiner schnelleren Rekonvaleszenz und birgt das Risiko, dass damit Krankheitserreger zunehmend gegen Antibiotika resistent werden.
Die Verschreibung von Antibiotika bei Atemwegs-Erkrankungen oder anderen, ganz überwiegend nicht bakteriell verursachten Krankheiten ist wohl ein besonders prägnantes Beispiel für die im Gesundheitswesen immer noch verbreiteten Wege medizinischer Über- und Fehlversorgung. Die Verschreibung von Antibiotika hat zwar bei vielen Patienten eine emotional beruhigende Wirkung. Dies führt aber bei Infektionskrankheiten durch Viren zu keiner schnelleren Rekonvaleszenz und birgt das Risiko, dass damit Krankheitserreger zunehmend gegen Antibiotika resistent werden.
Eine jetzt in der renommierten Fachzeitschrift "British Medical Journal" veröffentlichte Literaturübersicht, in der Ergebnisse aus 24 Studien mit 15.505 Erwachsenen und 12.103 Kindern berücksichtigt wurden, zeigte sich erneut, dass eine eindeutige Verbindung besteht zwischen der Verschreibung von Antibiotika und der Entwicklung einer Resistenz gegen eben diese Antibiotika. Schlichter gesagt: Antibiotika versagen bei der zweiten oder dritten Verschreibung oftmals. Der beobachtete Effekt, die Arzneimittel-Resistenz, war in den Studien einen Monat nach der Therapie am stärksten ausgeprägt, nahm im Verlauf der Zeit auch ab, hielt aber bis zu 12 Monate an.
Bereits mehrfach wurde im Forum Gesundheitspolitik berichtet
• über die überaus häufige Verbreitung medizinisch nutzloser Antibiotikaverordnungen (Altes und Neues von der gefährlichen Dauer-Fehlversorgung von Erwachsenen und Kindern mit Antibiotika, Mehrheitlich Über- und Fehlversorgung mit Antibiotika durch Hausärzte bei Nasennebenhöhlenentzündungen),
• über den fehlenden Nutzen und die Risiken (Die Verschreibung von Antibiotika bei Husten variiert erheblich in Europa - und bewirkt nirgends eine schnellere Rekonvaleszenz, Früher aber nicht notwendiger Einsatz von Antibiotika bei Kindern - Kein Nutzen der Antibiotikaprophylaxe bei Harnwegsinfekten)
• oder auch über Hintergründe und ärztliche Motive dieser Fehlversorgung (Der Kunde ist König: Kinderärzte verschreiben öfter Antibiotika, wenn sie vermuten, dass die Eltern dies von ihnen erwarten, Antibiotika-Niedrigverbrauchsregion Ostdeutschland: Woran liegt es?).
Die jetzt veröffentlichte Meta-Analyse bezog lediglich solche Studien ein, in denen ein Zusammenhang untersucht worden war zwischen Antibiotika-Verschreibungen in der ambulanten medizinischen Grundversorgung einerseits und der Resistenzentwicklung beim einzelnen Patienten andererseits. Fünf der einbezogenen Studien waren randomisierte Kontrollstudien (mit zufälliger Zuweisung der Teilnehmer zu einer Interventions- oder auch Kontrollgruppe), 19 waren Beobachtungsstudien (17 davon retrospektiv erhoben). Die meisten Studien betrafen entweder Patienten mit Harnwegs-Infektionen (N=8) oder Atemwegs-Infektionen (N=9).
Das Forschungsteam aus Bristol und Oxford kam dann zu folgenden zentralen Befunden bei der erneuten Auswertung der Studien:
• Der Effekt, die Resistenz, war am stärksten einen Monat nach der Therapie, nahm im Laufe der Zeit ab, war teilweise aber auch noch einem Jahr noch zu beobachten.
• Die Risiken einer Resistenzbildung waren im Durchschnitt zwei Monate nach der Einnahme 2,5mal so hoch (Odds-Ratio) und nach 12 Monaten noch 1,3mal so hoch.
• Eine methodisch sehr fundierte Langzeit-Studie zeigte einen sehr markanten zeitlichen Effekt: Das Risiko der Resistenz fiel von 12,5 nach einer Woche auf 6,1 nach einem Monat und 2,2 nach 6 Monaten.
• Es gibt einen Zusammenhang zwischen der verordneten Menge an Antibiotika und der Einnahmedauer und dem Resistenz-Risiko. Ebenso wirken sich zeitlich gestaffelte mehrfache Verordnungen aus.
• Es gab keine einheitlichen Befunde, was die Art der Antibiotika bzw. den Wirkstoff anbetrifft. Auch wenn die Zahl der hierzu vorliegenden Studien recht klein ist, kann man vermuten, dass es keine grossen Unterschiede zwischen den einzelnen Klassen von Antibiotika gibt.
In der zusammenfassenden Bilanz und Interpretation der Daten formulieren die Wissenschaftler auch einige Empfehlungen. Da in einigen Studien ein Zusammenhang deutlich wurde zwischen Einnahmedauer eines Medikaments und Resistenzbildung, empfehlen sie eine möglichst kurze Dauer der Behandlung mit Antibiotika ("… the fewest number of antibiotic courses should be prescribed for the shortest period possible"). Patienten, die im vergangenen Jahr eine oder mehrere Behandlungen mit Antibiotika erhielten, sollten bei einer erneut notwendigen weiteren Therapie ein anderes Antibiotikum verschrieben bekommen.
Die Studie ist kostenlos im Volltext verfügbar: Céire Costelloe et al: Effect of antibiotic prescribing in primary care on antimicrobial resistance in individual patients: systematic review and meta-analysis (BMJ 2010;340:c2096, doi:10.1136/bmj.c2096)
Gerd Marstedt, 27.6.10
Placebo-Effekt: Es kommt darauf an, was Patienten in medizinischen Studien zu bekommen glauben, nicht was sie tatsächlich bekommen
 Der Prozess der "Verblindung" gilt als methodisch wichtige Voraussetzung für zuverlässige Untersuchungsergebnisse in medizinischen Studien. Weder Patienten noch Ärzte, die an der Studie beteiligt sind, sollen wissen, welcher Teilnehmer nun eine bestimmte Arznei bekommt und wer ein Placebo. Damit soll sichergestellt werden, dass nicht Erwartungshaltungen des Patienten oder Suggestionen und Einflussnahmen der Forscher die Ergebnisse beeinflussen, sondern dass diese einzig und allein als Effekt der verabreichten Substanz gewertet werden müssen. Dass diese theoretische und methodische Annahme möglicherweise eine wirklichkeitsfremde Fiktion ist, hat jetzt eine australische Studie nahegelegt.
Der Prozess der "Verblindung" gilt als methodisch wichtige Voraussetzung für zuverlässige Untersuchungsergebnisse in medizinischen Studien. Weder Patienten noch Ärzte, die an der Studie beteiligt sind, sollen wissen, welcher Teilnehmer nun eine bestimmte Arznei bekommt und wer ein Placebo. Damit soll sichergestellt werden, dass nicht Erwartungshaltungen des Patienten oder Suggestionen und Einflussnahmen der Forscher die Ergebnisse beeinflussen, sondern dass diese einzig und allein als Effekt der verabreichten Substanz gewertet werden müssen. Dass diese theoretische und methodische Annahme möglicherweise eine wirklichkeitsfremde Fiktion ist, hat jetzt eine australische Studie nahegelegt.
Bei vier Gruppen alkoholabhängiger Patienten, die unterschiedliche Medikamente zur Dämpfung des Suchtverhaltens erhielten, bekamen die Teilnehmer in zwei Gruppen auch ein Placebo. Nach 12 Wochen zeigten sich zwischen den vier Gruppen allerdings keine Unterschiede, was die Medikamentenwirkung und den Alkoholkonsum anbetraf. Die Untersuchungsteilnehmer waren nun zuvor aber auch nach ihrer Meinung befragt worden, ob sie nun ein Medikament oder ein Placebo bekommen würden. Und hier zeigten sich dann sehr große Unterschiede: Teilnehmer mit der Vermutung, sie würden ein "richtiges" Medikament bekommen, konsumierten sehr viel weniger alkoholische Getränke und zeigten auch sehr viel geringere Anzeichen von Abhängigkeit - und dies ganz unabhängig von der Teilnehmergruppe und davon, ob sie nun ein "richtiges" Medikament oder ein Placebo bekommen hatten.
Randomisierte Kontrollstudien mit doppelter Verblindung gelten als Königsweg und Goldstandard bei der Durchführung medizinischer Studien. Die Randomisierung soll sicherstellen, dass Teilnehmer nicht jene Therapie oder Intervention auswählen, von deren Wirksamkeit sie schon zuvor fest überzeugt sind. Und auch die Verblindung soll den Einfluss des Patientenglaubens und der bewussten oder unbewussten Einflussnahme von Wissenschaftlern ausschließen. Damit sollen "Störfaktoren" für das Experiment wie unterschiedliche kognitive und emotionale Prozesse ausgeschlossen oder zumindest stark reduziert werden. Die Ergebnisse des Experiments, häufig also Veränderungen medizinischer Indikatoren, sollen einzig und allein auf die Wirksamkeit der verabreichten Substanz zurückgeführt werden.
Eine australische Studie hat die Gültigkeit dieser Annahmen nun zwar noch nicht eindeutig widerlegt, aber doch einige Fragezeichen aufgeworfen. Teilnehmer an der Studie waren 169 alkoholabhängige Patienten. Sie sollten vor Studienbeginn drei Tage abstinent bleiben. Dann wurden sie nach dem Zufallsprinzip einer von vier Gruppen zugewiesen. Teilnehmer in allen Gruppen erhielten zwölf Wochen lang ein Medikament (Acamprosat oder Naltrexon) oder ein Acamprosat- oder Naltrexon-Placebo. Parallel wurden in allen Gruppen mehrere Kurse zur Erhöhung der Compliance, also der regelmäßigen Medikamenten-Einnahme abgehalten. Und schließlich wurden die Teilnehmer gefragt, ob sie ihrer Meinung nach ein echtes Medikament oder einen Placebo-Wirkstoff erhielten.
Die Wissenschaftler überprüften dann drei verschiedene Indikatoren, um die Wirksamkeit der Medikamente zu überprüfen: Gesamtzahl der hintereinander verbrachten abstinenten Tage ohne jeden Alkohol, Alkoholabhängigkeit und Verlangen nach Alkohol, beides gemessen anhand von Fragebögen. Für die Ergebnisse hinsichtlich dieser drei Indikatoren zeigte sich dann (siehe Abbildung): 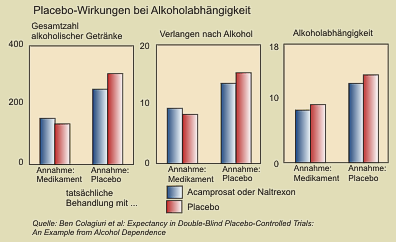
• Zwischen den Gruppen mit Medikament (im Diagramm blaue Säulen) und Gruppen mit Placebo (rote Säulen), zeigten sich keine statistisch signifikanten Unterschiede, ganz gleich, um welches Medikament (Acamprosat oder Naltrexon) oder Placebo es sich handelte.
• Für alle drei Indikatoren zeigten sich jedoch Differenzen, je nachdem ob ein Teilnehmer glaubte, er würde ein echtes Medikament bekommen (im Diagramm: "Annahme Medikament") oder nur ein Placebo ("Annahme Placebo"). Beim Indikator "Gesamtzahl alkoholischer Getränke" beispielsweise nahmen Patienten nur etwa halb so viele Drinks ein, wenn sie vermuteten, sie bekämen ein echtes Medikament, das demzufolge auch das Verlangen nach Alkohol unterdrückt oder zumindest senkt.
Die Wissenschaftler diskutieren ihre Untersuchungsbefunde primär hinsichtlich ihrer Bedeutung für klinische Studien und machen deutlich, dass bei Studien mit Placebo die Annahmen der Patienten bislang viel zu wenig systematisch berücksichtigt wurden und teilweise Untersuchungsergebnisse verfälscht oder quantitativ beeinflusst haben könnten. Die Befunde machen aber auch deutlich, dass methodische Konzepte wie "Verblindung" und "Randomisierung" zwar sinnvoll sind, aber der Komplexität des Alltagsgeschehens in der medizinisch-therapeutischen Praxis und der überaus großen Bedeutung von menschlicher Erwartungen und Motivationen für den Heilungsprozess kaum gerecht werden.
Hier ist ein kostenloses Abstract: Ben Colagiuri, Kirsten Morley, Robert Boakes, Paul Haber: Expectancy in Double-Blind Placebo-Controlled Trials: An Example from Alcohol Dependence (Psychotherapy and Psychosomatics 2009;78:167-171, DOI: 10.1159/000206871)
Gerd Marstedt, 12.7.09
Auch deutsche Klinikärzte setzen gelegentlich Placebos ein - und sind von der Wirkung voll überzeugt
 Zwei im Jahre 2008 veröffentlichte Studien aus den USA über die ärztliche Verwendung von Placebos hatten bereits deutlich gemacht, dass Ärzte sehr viel häufiger solche Placebos einsetzen als vermutet. Hier war in Befragungen von Rheumatologen und Internisten bzw. Ärzten, die an Universitätskliniken in der Medizinerausbildung tätig sind deutlich geworden, dass etwa die Hälfte der befragten Mediziner schon einmal Patienten mit einem Placebo-Heilmittel bedient hat.
Zwei im Jahre 2008 veröffentlichte Studien aus den USA über die ärztliche Verwendung von Placebos hatten bereits deutlich gemacht, dass Ärzte sehr viel häufiger solche Placebos einsetzen als vermutet. Hier war in Befragungen von Rheumatologen und Internisten bzw. Ärzten, die an Universitätskliniken in der Medizinerausbildung tätig sind deutlich geworden, dass etwa die Hälfte der befragten Mediziner schon einmal Patienten mit einem Placebo-Heilmittel bedient hat.
Die Auswertung einer anonymen schriftliche Umfrage an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) hat nun gezeigt, dass ein großer Teil auch deutscher Ärzte - in diesem Fall Ärzte aus unterschiedlichen Abteilungen einer Klinik der Maximalversorgung - zumindest gelegentlich, teilweise auch häufig Placebos einsetzt. Und mehr als jeder vierte Arzt (28%) ist überzeugt, dass die verwendeten Mittel immer oder oft wirksam sind, weitere 44% meinen, dass sie zumindest manchmal wirken.
An der Studie beteiligt waren 71 Ärztinnen und Ärzte sowie 107 Pfleger/innen, die Beteiligungsquote an der Befragung lag mit 79 Prozent sehr hoch. Die Ergebnisse im Einzelnen:
• 47% der Ärzte/innen haben noch nie Placebos verwendet, 53% verwenden sie in unterschiedlicher Häufigkeit: 40% zumindest 1-2mal im Jahr, 9% ein- bis zweimal monatlich und 4% ein- bis zweimal wöchentlich.
• Bei Pflegern/innen liegen die Quoten höher: 88% setzen die Mittel ein, darunter: 45% zumindest 1-2mal im Jahr, 33% ein- bis zweimal monatlich und 9% ein- bis zweimal wöchentlich.
• Schmerzen wurden am häufigsten als Grund für eine Placebogabe angeben, danach folgen: Schlaflosigkeit, depressive Verstimmung, Verdauungsstörungen.
• Etwa 44% aller Placebos wurden den Patienten mit der Angabe, "Das ist eine Medizin", überreicht und etwa der gleiche Anteil mit der Aussage "Das hilft Ihnen". Dabei gibt Unterschiede zwischen den Berufsgruppen. Ärzte sagen als Erklärung am häufigsten "Das hilft Ihnen", Pfleger/innen "Das ist eine Medizin".
• Pfleger/innen sind überaus stark von der Wirkung überzeigt. 64% von ihnen meinen, diese würden immer oder oft wirken, weitere 39% sagen "manchmal".
• Bei Ärzten haben diese starke Überzeugung 29%, die meisten Ärzte/innen (44%) meinen aber, die Mittelchen würden zumindest manchmal wirken.
• Bei der Frage nach dem unmittelbaren Anlass der Placebogabe erklärten Ärzte/innen wie Pfleger/innen am häufigsten (57% bzw. 66%), "Der Patient hat ein Medikament verlangt". Zweithäufigste Angabe (35% bzw. 38%) war "Zur Beruhigung eines ängstlichen Patienten".
Fazit der Autoren: "Die erfolgreiche Verwendung medikamentöser Placebos ist offensichtlich fester Bestandteil des Therapierepertoires an einem Krankenhaus der Maximalversorgung. In einer stärkeren Betrachtung von Placeboeffekten liegen hohe Potenziale. Während der Einsatz medikamentöser Placebos im klinischen Alltag ethische Probleme aufwirft, können die Optimierung der Therapeuten-Patienten-Interaktion und die Verwendung positiver Suggestionen eine ideale Ergänzung aktiver Therapieformen darstellen."
Die Studie ist kostenlos hier im Volltext verfügbar: M. Bernateck et al: Placebotherapie - Analyse von Umfang und Erwartung in einer Klinik der Maximalversorgung (Der Schmerz, DOI 10.1007/s00482-008-0733-x)
Gerd Marstedt, 6.7.09
Mythos Wissensgesellschaft: Körperorgan-Wissen britischer Patienten seit fast 40 Jahren konstant gering!
 Ältere Studien aus dem Vor-Internet- und Gesundheitsportale-Zeitalter hatten immer wieder belegt, dass viele PatientInnen noch nicht einmal rudimentäre Vorstellungen über die Lage und Funktion ihrer eigenen Organe hatten. Damit verbunden hatten sie natürlich Mühe, Ausführungen ihrer Ärzte z.B. über Organsymptomatiken zu folgen.
Ältere Studien aus dem Vor-Internet- und Gesundheitsportale-Zeitalter hatten immer wieder belegt, dass viele PatientInnen noch nicht einmal rudimentäre Vorstellungen über die Lage und Funktion ihrer eigenen Organe hatten. Damit verbunden hatten sie natürlich Mühe, Ausführungen ihrer Ärzte z.B. über Organsymptomatiken zu folgen.
Nach dem Boom an elektronischen und gedruckten Informationsmöglichkeiten schien es an der Zeit zu sein, zu überprüfen, ob und in welchem Maße sich an diesen Defiziten etwas geändert hat und vor allem spezifisch erkrankte PatientInnen zumindest über das bei ihnen erkrankte Organ besser Bescheid wissen als die Allgemeinheit.
Dazu befragten britische und neuseeländische Wissenschaftler mittels eines Fragebogens, der u.a. Körpersilhouetten mit auswählbaren Lagen von 11 Körperorganen (Herz, Lungen, Magen, Nieren, Darm, Harnblase, Schilddrüse, Leber, Bauchspeicheldrüse, Gallenblase und Eierstöcke) enthielt, insgesamt 722 Personen, von denen sie je 100 einer bestimmten Krankengruppe zuordnen konnten (dies waren ambulant behandelte PatientInnen Londoner Krankenhäuser) während 133 in einer allgemeinen, relativ heterogenen Gruppe (diese wurden aus den Besuchern einer öffentlichen Bibliothek, also einer lesefähigen und eher gebildeten Gruppe im Londoner Süden gewonnen) zusammengefasst wurden. Ausgewählt wurden Personen, die am Herzen, den Nieren, der Leber, dem Verdauungstrakt und an der Bauchspeicheldrüse bzw. an der Stoffwechselerkrankung Diabetes erkrankt waren.
Das Ergebnis einer Querschnittsbefragung aller StudienteilnehmerInnen sah so aus:
• Über alle Gruppen hinweg sah das Wissen über die Lage von Körperorganen mager aus und hat sich vor allem seit einer fast 40 Jahre alten vergleichbaren Studie nicht signifikant verbessert.
• Beispielsweise wussten nur 27,1% der allgemeinen Gruppe die korrekte Lage ihrer Nieren anzugeben. Besser, aber keineswegs optimal wussten Personen, die an einem Nierenleiden erkrankt waren, wo ohre Nieren lagen: 42,2%. 55,6% der Befragten der allgemeinen Gruppe wussten anzugeben, wo ihr Herz liegt. Dies konnten von den HerzpatientInnen nur 50,5%.
• Während in der Vergleichsstudie aus dem Jahr 1970 durchschnittlich 51,4% der Befragten die korrekte Lage der abgefragten Organe angeben konnten, waren es 2007/2008 52,5%.
• Die TeilnehmerInnen in den sechs speziellen Erkranktengruppen unterschieden sich hinsichtlich ihres geringen Gesamtwissens nicht wesentlich. Lediglich Befragte, die eine Erkrankung der Leber oder Diabetes hatten, hatten ein genaueres Wissen über die Lage ihres erkrankten Organs.
• Das Wissen älterer Befragter war signifikant schlechter und Personen mit höherer Bildung hatten ein besseres Anatomiewissen als Befragte mit niedrigerer Bildung.
• Auch wenn es insgesamt keine Wissensunterschiede zwischen Männern und Frauen gab, konnten Frauen die Lage der "weiblichen Organe" signifikant besser identifizieren.
Angesichts der seit fast 40 Jahren trotz der quantitativ expandierenden Wissens- und Informationsgesellschaft im Wesentlichen unveränderten fundamentalen Wissensmängel über die menschliche Anatomie warnen die ForscherInnen Ärzte vor falschen Annahmen über wichtige Vorverständnisse und Grundwissen ihrer PatientInnen, auf die sie glauben in Arzt-Patientgesprächen setzen zu können. Dies gilt ausdrücklich auch für das Wissen von PatientInnen mit speziellen oft chronischen Organerkrankungen, die gelegentlich für "die besten Experten für ihre eigene Erkrankung" gehalten werden.
Solange es keine vergleichbaren Untersuchungen mit deutschen PatientInnen gibt, sollte die Tatsache, dass die Befragung in Großbritannien stattfand, kein Anlass sein, für Deutschland ähnliche Verhältnisse auszuschließen.
Die sechsseitige Studie "How accurate is patients' anatomical knowledge: a cross-sectional, questionnaire study of six patient groups and a general public sample" von John Weinman, Gibran Yusuf, Robert Berks, Sam Rayner und Keith J Petrie ist 2009 in der Fachzeitschrift "BMC Family Practice" (2009, 10: 10-43) erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 5.7.09
Wie viel Prozent der Arbeitszeit verbringt ein Krankenhausarzt mit Patienten, Angehörigen und der Verwaltung? 11,8%, 0,9%, 12,5%!
 Von Ärzten aber auch Pflegekräften an Krankenhäusern sind in den letzten Jahren immer häufiger Klagen zu hören, sie hätten dank des mit den DRGs verbundenen Kodier- und Dokumentationsaufwands immer weniger Zeit für Gespräche mit Patienten und deren Angehörigen oder für die Behandlung der Patienten. Darüber ob dies wirklich so ist und wie viel der täglichen Arbeitszeit für die verschiedenen Tätigkeiten verwendet werden, gibt es aber nicht allzu viele Untersuchungen aus Deutschland oder sie beschäftigen sich, und dies gilt auch für die meisten internationalen Studien, fast nur mit der Gesprächszeit in Allgemeinpraxen. Die letzte Untersuchung über die Zeitaufwände von Krankenhausärzten in DEutschland stammt aus dem Jahr 1999, also aus einer Zeit mit deutlich anderen Rahmenbedingungen und hat eine Beobachtungsbasis von 5 Ärzten.
Von Ärzten aber auch Pflegekräften an Krankenhäusern sind in den letzten Jahren immer häufiger Klagen zu hören, sie hätten dank des mit den DRGs verbundenen Kodier- und Dokumentationsaufwands immer weniger Zeit für Gespräche mit Patienten und deren Angehörigen oder für die Behandlung der Patienten. Darüber ob dies wirklich so ist und wie viel der täglichen Arbeitszeit für die verschiedenen Tätigkeiten verwendet werden, gibt es aber nicht allzu viele Untersuchungen aus Deutschland oder sie beschäftigen sich, und dies gilt auch für die meisten internationalen Studien, fast nur mit der Gesprächszeit in Allgemeinpraxen. Die letzte Untersuchung über die Zeitaufwände von Krankenhausärzten in DEutschland stammt aus dem Jahr 1999, also aus einer Zeit mit deutlich anderen Rahmenbedingungen und hat eine Beobachtungsbasis von 5 Ärzten.
Welche Bedeutung Gespräche mit PatientInnen auch für Krankenhausärzte haben zeigt die Tatsache, dass sie in einem 40-jährigen Arbeitsleben nach entsprechenden Studien 150.000 bis 200.000 solcher Gespräche führen und der psychosomatisch orientierte Mediziner und Psychoanalytiker Balint mit guten Argumenten das Gespräch zwischen Arzt und Patient als das zentrale diagnostische und therapeutische Instrument bezeichnete.
Deshalb verdient auch eine bereits etwas ältere, nämlich 2007 veröffentlichte Studie Beachtung, die als Dissertationsprojekt bei immerhin 32 Ärzten auf 34 Stationen aus den Bereichen Innere Medizin, Chirurgie, Gynäkologie, Neurologie und Strahlenheilkunde am Universitätsklinikum Freiburg durchgeführt wurde und in deren Mittelpunkt die möglichst detaillierte Erfassung der Gesprächszeiten mit Patienten und Angehörigen stand.
Dazu begleitete die Jungforscherin die Ärzte jeweils einen Arbeitstag lang und maß mittels einer Stoppuhr die Dauer verschiedener ärztlicher Tätigkeiten. Zusätzlich wurde jeder teilnehmende Arzt gebeten, einen Fragebogen auszufüllen, in dem er eigene Schätzwerte bezüglich der Dauer verschiedener ärztlicher Tätigkeiten angeben und seine persönliche Zufriedenheit mit der zur Verfügung stehenden Zeit für bestimmte ärztliche Tätigkeiten benoten sollte. Schließlich wurde eine Querschnitterhebung durchgeführt, in dem eine Ärztin auf einer chirurgischen Station eine Arbeitswoche lang begleitet wurde.
Der Arbeitstag eines Arztes betrug durchschnittlich 659 Minuten und war damit länger als in einigen vergleichbaren Untersuchungen mit anderem Facharztspektrum und in anderen Behandlungsinstitutionen.
Auf diese Zeit verteilten sich die verschiedenen ärztlichen Aufgaben wie folgt: 11,8% Kommunikation mit Patienten, 0,9% Kommunikation mit Angehörigen, 4,9% Ärztliche Besprechungen, 1,7% DRG, 7,6% Briefe schreiben, 0,5% Berichtswesen, 5,9% Praktische Tätigkeiten, 4,3% Befundbewertung, 0,4% Konsilanforderungen, 22,8% Besprechung mit Kollegen, 6,2% Kurvenvisite, 2,8% Anmeldung für weitere Untersuchungen, 5,9% Lehre und Forschung, 6,3% OP-Zeit, 0,3% Schreiben von OP-Berichten, 12,5% Verwaltung und Sonstiges und 5% Pausen.
Pro Arbeitstag sprach also ein Arzt durchschnittlich 4 Minuten 17 Sekunden mit einem Patienten und durchschnittlich 20 Sekunden mit einem Angehörigen.
Die Dauer der Gespräche zwischen Krankenhausarzt und Krankenhaus-Patient kommentiert die Freiburger Medizinerin: "Fraglich bleibt insgesamt, ob 4 Minuten 17 Sekunden genügend Zeit dafür bieten, dass sowohl die medizinischen als auch die psychosozialen Sorgen und Probleme eines Patienten, die im Rahmen einer physischen Erkrankung entstehen können, genügend Beachtung finden können."
Dieser Gedanke wird in einer Literaturpassage der Dissertation vertieft: Wenn der Arzt unter Zeitdruck steht hat er immer das Gefühl, das ihm bei Gesprächen Zeit für andere Aufgaben "geraubt" wird. Dies hat manchmal auch damit zu tun, dass sich Patienten spontan an den Arzt wendet und ihn oft in einer anderen Tätigkeit unterbrecht. Alles zusammen genommen erscheint die Dauer solcher Gespräche länger als sie in Wirklichkeit ist. Dies wiederum führt zu der in mehreren Studien beobachteten arzttypischen Unterbrechung des Redeflusses von Patienten nach durchschnittlich 18 oder 23 Sekunden (in den 1980er Jahren) und der damit verbundenen Gefahr, dass "diese frühen Unterbrechungen der Patienten dazu führen könnten, dass wichtige gesundheitliche Probleme des Patienten nicht zur Sprache und damit auch nicht in Behandlung kommen."
Zu der Annahme, dass der Redefluss von Patienten jeglichen Zeitplan durcheinander brächte, wenn man sie so lange reden ließe wie sie wollten, untersuchten frühere Studien "wie lange Patienten tatsächlich reden, wenn man sie reden lässt. Ergebnis war, dass von '335 Patienten 78% weniger als zwei Minuten für ihr Anliegen benötigten und nur 2% länger als fünf Minuten sprachen'. Weiterhin stellten die Ärzte, die die untersuchten Gespräche führten, fest, dass alle Patienten wichtige Informationen mitzuteilen hatten und nicht unterbrochen werden sollten."
In der Freiburger Studie und in dort zitierten anderen Studien werden als Ursachen der kurzen Arzt-Patientengespräche der ständige Zeitdruck, der steigende Verwaltungsaufwand und die organisatorische Rahmenbedingungen des Zwangs zum Multitasking genannt.
Bereits etwas resignativ schließt die Studienautorin den entsprechenden Abschnitt mit den Worten: "Die Gründe für kurz gehaltene Gespräche mit Patienten und Angehörigen sind also eigentlich bekannt. Eine mögliche Lösung des Problems wäre es, einen Teil der administrativen Aufgaben und auch der einfacheren praktischen Tätigkeiten, wie Blutentnahmen, an andere Arbeitskräfte zu delegieren."
Die gemessenen Zeiten für Arbeiten, die durch die DRG nötig waren, betrugen durchschnittlich elf Minuten pro Arzt und Arbeitstag. Die Spannweite der benötigten Arbeitszeit lag aber zwischen 0 und über 67 Minuten.
Sowohl die gemessenen Zeiten als auch die Ergebnisse aus den Fragebögen wurden anhand verschiedener Merkmale der Ärzte, wie zum Beispiel konservatives versus operatives Tätigkeitsfeld, Geschlecht des Arztes und Länge der Berufserfahrung des Arztes, in Gruppen unterteilt und miteinander verglichen. Dabei zeigte sich, dass ein berufserfahrenerer Arzt mehr Zeit mit Patientengesprächen und mit praktischen Tätigkeiten verbrachte als ein unerfahrenerer Arzt. Mit zunehmender Berufserfahrung zeigte sich ebenfalls eine signifikante Verbesserung der Zufriedenheit des Arztes mit der zur Verfügung stehenden Zeit für Angehörigengespräche.
Der damit mögliche Vergleich zwischen gemessener und "gefühlter" Arbeitszeit förderte eine Reihe interessanter Divergenzen zu Tage: Die Ärzte schätzten im Fragebogen z. B. ihre Kommunikationszeit mit Patienten fast doppelt so hoch ein wie die tatsächlich gemessene Zeit. Sie gaben im Durchschnitt eine geschätzte Zeit für ihre Kommunikation mit Patienten von 133 Minuten pro Arbeitstag an deutlich mehr als die gemessene Zeit von 79 Minuten.
Für die Kommunikationszeit mit Angehörigen gaben die Ärzte eine geschätzte Zeit an, die siebenmal so lang war wie die eigentlich gemessene Zeit. Die geschätzte Zeit betrug durchschnittlich 43 Minuten pro Tag, gemessen wurden 6 Minuten.
Für die gesamte Arbeitszeitverwendungsdebatte ist interessant, dass die Ärzte auch den Anteil der auf die als "unliebsam" empfundene Dokumentation, also das Berichtswesen, OP-Berichte, Briefe schreiben, Verwaltung (Sonstiges) und DRG entfällt, kräftig überschätzen: Gemessenen 146 Minuten pro Tag stehen 226 eingeschätzte Minuten gegenüber. Fast keine Diskrepanz gab es aber immerhin bei der täglichen Gesamtarbeitszeit.
Ärztinnen waren schließlich mit der ihnen zur Verfügung stehenden Zeit für praktische Tätigkeiten deutlich zufriedener als Ärzte und hatten auch eine längere Gesprächszeit mit PatientInnen - allerdings nur im Sekundenbereich.
Natürlich kann man diese Studie an einem süddeutschen Uniklinikum und bei 32 Ärzten nicht als repräsentativ ansehen. Dies sollte allerdings nicht dazu dienen, die weitere Debatte und empirische Klärung totzuschlagen. Warum nämlich die für Deutschland zum Teil erstmaligen und spannenden Ergebnisse trotz der Problemartikulation und den nachgewiesenermaßen gesundheitlichen wie ökonomischen Auswirkungen schlechter Arzt-Patient-Kommunikation bisher nicht als Hypothesen für eine umfassendere Studie gedient haben, ist unverständlich und ein weiteres Beispiel für die gut gehegte Diskrepanz zwischen öffentlichem Problemgetöse und der Bereitschaft, dessen Substanz zu belegen oder gar nach Lösungen gegen z.B. den Zeitdruck zu suchen.
Die 79 Seiten umfassende medizinische Dissertation "Untersuchung der Gesprächszeit mit Patienten und Angehörigen unter Zugrundelegung der Arbeitszeitverteilung von Krankenhausärzten" von Dorothee Kempf ist komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 18.6.09
Wie wirken sich die DRG in Deutschland auf die Versorgungsqualität aus? Patientenwahrnehmungen vor und während der DRG-Einführung
 Jahre nach dem verpflichtenden Start der DRGs bzw. Fallpauschalen für den Großteil der stationären Behandlungen gibt es immer noch keine Informationen über die Auswirkungen dieser neuen prospektiven Vergütungsordnung auf Beschäftigte und vor allem Patienten aus der gesetzlich vorgeschriebenen, aber ernsthaft erst Ende 2008 gestarteten Begleitforschung.
Jahre nach dem verpflichtenden Start der DRGs bzw. Fallpauschalen für den Großteil der stationären Behandlungen gibt es immer noch keine Informationen über die Auswirkungen dieser neuen prospektiven Vergütungsordnung auf Beschäftigte und vor allem Patienten aus der gesetzlich vorgeschriebenen, aber ernsthaft erst Ende 2008 gestarteten Begleitforschung.
Daher sind weiterhin die Ergebnisse aus wissenschaftlichen Studien über diese Auswirkungen auch aus früheren Jahren für aktuelle Diskurse von Bedeutung bzw. können Anhaltspunkte für weitere Studien oder Gegenmaßnahmen zu unerwünschten Effekten liefern. Dazu können auch die Ergebnisse zweier Patientenbefragungen aus den Jahren 2002 (also im Vorfeld des offiziellen und flächengreifenden Starts der DRG) und 2005 (also mitten in der Einführungsphase, die noch bis 2010 laufen wird) dienen, die bereits 2006 veröffentlicht wurden.
Die Ergebnisse der zwei schriftlich standardisierten bundesweiten Befragungen von jeweils mehreren tausend Versicherten der Gmünder Ersatzkasse (GEK) zwischen 30 und 80 Jahren, die gerade einen Krankenhausaufenthalt hinter sich hatten, wurden durch Analysen der Daten der Krankenhausstatistik des Statistischen Bundesamtes sowie von Routinedaten der GEK aus den Jahren 1990 bis 2005 ergänzt.
Die wichtigsten Ergebnisse lauteten:
• Die Fallzahlen vollstationärer Behandlungen sind langfristig steigend. Ganz gegen die Erwartung eines zunehmenden Fallsplitting oder von erneuten Aufnahmen von zu früh oder "blutig" entlassenen Patienten, sanken seit der obligatorischen Einführung der DRGs die Fallzahlen vollstationärer Behandlungen. Ein Grund: Eine steigende Zahl vollstationärer Behandlungen ist durch ambulante Operationen an oder außerhalb von Krankenhäusern ersetzt worden.
• Die durchschnittlichen Falldauern gehen schon langfristig zurück. Ein spezieller DRG-Effekt ist nicht erkennbar. Aus der Patientenbefragung entsteht nicht der Eindruck, die Verkürzung der Aufenthaltszeiten sei unangemessen. Allerdings werden die kürzeren Falldauern vermehrt bis an die untere Grenzverweildauer verlängert, um Abschläge bei der Abrechnung zu vermeiden.
• Die Aufnahme ins Krankenhaus ist seit der optionalen Einführung der DRGs in der Wahrnehmung von Patienten mit einer geringeren Wartezeit verbunden. Außerdem ist die Zahl der Patienten, die angaben, zuvor nicht von einem anderen Krankenhaus abgewiesen worden zu sein, relativ klein geblieben. Dennoch gibt es auch Umstände bei der Aufnahme, die verbesserungswürdig sind und sich nicht gebessert haben. Trotz des von den DRG ausgehenden Anreiz, Patienten so schnell und bedarfsgerecht zu behandeln, existiert nahezu ungebrochen ein nicht ausreichender Informationsstand der Krankenhausärzte sowohl über den Gesundheitszustand der Patienten als auch über die vorangegangenen Behandlungen.
• Die Erfahrungen der Patienten mit dem Krankenhaus-Personal sind weiterhin sehr gut. Die Zufriedenheit verwundert etwas, da in den Jahren 2003 und 2004 deutlich Personal abgebaut wurde und der Arbeitsaufwand für die Pflegekräfte deutlich gestiegen ist. Jüngere Patienten haben allerdings häufiger als Ältere schlechte oder kritische Erfahrungen mit Kostenkalkülen oder einer nicht rücksichtsvollen Behandlung gemacht.
• Vor allem in privaten Krankenhäusern werden seit 2002 Verschlechterungen in der Beurteilung der Behandlungssituation erkennbar. Zum Teil handelt es sich dabei lediglich um das Verschwinden der 2002 überdurchschnittlich guten Verhältnisse und das Erreichen des Durchschnittsniveaus. Teilweise sind die ihren Erfahrungen zugrunde liegenden Versorgungsbedingungen aber auch schlechter geworden als die von Patienten in öffentlichen und freigemeinnützigen Krankenhäusern.
• Am auffälligsten sind die zwischen 2002 und 2005 verbreitet schlechter werdenden Erfahrungen und Bewertungen ihrer Behandlung durch die multimorbiden (3 und mehr Behandlungsanlässe) Patienten und zwar innerhalb dieser Patientengruppe als auch im Vergleich mit den Patienten, die "nur" wegen einer Krankheit in Behandlung waren.
• Andere Ergebnisse als erwartet zeigen sich auch über den wahrgenommenen Zustand des Entlassungs- oder Überleitungsmanagement. Dazu wurden die Patienten nach dem Erhalt von 5 Entlassungsleistungen gefragt: die "verständliche" Erklärung von "Sinn und Zweck der Medikamenteneinnahme nach der Entlassung" durch Ärzte, die Erklärung, wie sich die Patienten "nach der Entlassung verhalten und auf welche Warnsignale sie achten sollen", durch Ärzte, die Besprechung "wann und wie" Patienten "ihre gewohnten Alltagsaktivitäten wieder aufnehmen können", die "ausführliche" Erklärung, wie sich die Patienten "bei ihrer Genesung selber helfen können" und schließlich die Information der Angehörigen oder anderer nahe stehender Personen, wie dem Patienten "bei der Genesung geholfen werden kann".
In beiden Jahren existiert erstens ein im Prinzip stabiles Gefälle beim Nichterhalt zwischen medizinisch-ärztlichen, sozialmedizinischen und nichtmedizinisch-nichtärztlichen Leistungen zu Lasten Letzterer. Zweitens haben in beiden Jahren zwischen rund 10 und 60 % der befragten Patienten Leistungen nicht erhalten, deren Sinn und Wert vielfach anerkannt ist und deren Substanz oder Ziel z. B. in den gesundheitspolitischen Debatten über "mehr Eigenverantwortung" seit Jahren von den Patienten eingefordert werden und deren Erhalt theoretisch durch die DRGs forciert werden sollte. Drittens verringert sich der Anteil der Patienten, welche die Leistungen nicht erhalten haben, bei einigen der ausgewählten Leistungen innerhalb des dreijährigen Untersuchungszeitraums graduell um 3 bis knapp 5 Prozentpunkte.
• Die Routinedatenanalyse zeigt folgendes: Die Liegezeitverkürzung folgt einem schon lang anhaltenden Trend, der sich in 2005 eher abschwächt als sich im Zuge der DRG-Einführung zu beschleunigen. In der grob aggregierten Betrachtung lassen sich keine großen Veränderungen in der Rezidiv- oder Rehospitalisierungsrate feststellen. Auch der Blick auf einzelnen Diagnosen hat keine dramatischen Entwicklungen gezeigt. Zweimal gab es keine Veränderungen zu sehen. Den Verdacht des Fallsplittings kann man bis 2005 nach allen vorliegenden Ergebnissen zurückweisen.
Trotz einiger Hinweise, dass sich an diesen Ergebnissen in der Wahrnehmung der Patienten nach 2005 nichts Grundlegendes geändert hat, ist zu bedauern, dass es aus verschiedenen Gründen (paradoxerweise das bisherige Fehlen "dramatischer" oder "knackigerer" Ergebnisse und der verbreitete Schwund des Interesses an Betroffenenbefragungen) keine krankenhausübergreifende oder bundesweite Fortsetzung der Befragung von Krankenhauspatienten gab und auch absehbar nicht geben wird. Die theoretische Möglichkeit, solche Befragungen auch ohne Unterstützung einer oder mehrerer gesetzlichen Krankenkassen durchzuführen, scheitert an der Forschungsökonomie. So viel zum Thema "der Patient steht im Mittelpunkt" und "nichts ist für ihn zu teuer".
Die 154 Seiten umfassende 2006 erschienene Studie "Versorgungsqualität im Krankenhaus aus der Perspektive der Patienten" von Bernard Braun und Rolf Müller vom Zentrum für Sozialpolitik (ZeS) der Universität Bremen erhält man kostenlos als PDF-Datei.
Bernard Braun, 13.6.09
Ein Allgemeinarzt als fester Ansprechpartner auch in Versorgungszentren und Gemeinschaftspraxen erhöht die Versorgungsqualität
 Medizinische Versorgungszentren und Gemeinschaftspraxen haben im ambulanten Versorgungssystem der USA (und ebenso in England) eine weitaus höhere Bedeutung als bei uns in Deutschland, auch wenn beide Organisationsformen für niedergelassene Ärzte auch hier immer stärker an Bedeutung gewinnen. Patienten, die sich in solche Praxen begeben, geraten u.U. allerdings an wechselnde Ärzte. Und dies wiederum, so hat eine jetzt veröffentlichte US-amerikanische Studie gezeigt, ist mit einer schlechteren, weniger an Leitlinien orientierten Versorgungsqualität verbunden. Positiv formuliert: Die Verbundenheit ("connectedness") eines Patienten über einen längeren Zeitraum mit ein und demselben Arzt erweist sich als therapeutisch vorteilhaft für diese Patienten.
Medizinische Versorgungszentren und Gemeinschaftspraxen haben im ambulanten Versorgungssystem der USA (und ebenso in England) eine weitaus höhere Bedeutung als bei uns in Deutschland, auch wenn beide Organisationsformen für niedergelassene Ärzte auch hier immer stärker an Bedeutung gewinnen. Patienten, die sich in solche Praxen begeben, geraten u.U. allerdings an wechselnde Ärzte. Und dies wiederum, so hat eine jetzt veröffentlichte US-amerikanische Studie gezeigt, ist mit einer schlechteren, weniger an Leitlinien orientierten Versorgungsqualität verbunden. Positiv formuliert: Die Verbundenheit ("connectedness") eines Patienten über einen längeren Zeitraum mit ein und demselben Arzt erweist sich als therapeutisch vorteilhaft für diese Patienten.
Die Studie basiert auf einer Auswertung von Patientendaten aus dem Massachusetts General Hospital Network in Boston, Massachusetts, einem Versorgungsnetzwerk mit ambulanten und stationären Einrichtungen. In die Studie einbezogen waren Patienten, die in den Jahren 2003 bis 2005 ambulante medizinische Hilfe des Netzwerks mindestens einmal in Anspruch genommen hatten. Diese wurden anhand der Patientendaten einer von zwei Gruppen zugeordnet: Patienten, die immer denselben Allgemeinarzt einer Praxis in Anspruch genommen hatten, und solche, die zwar dieselbe Praxis besucht hatten, dort aber von verschiedenen Ärzten behandelt worden waren. Patienten, die verschiedene Praxen besucht hatten, wurden aus der Analyse ausgeschlossen. In der ersten Gruppe (mit festem Arzt) waren dann 92.000 Patienten zu finden, in der zweiten Gruppe (mit fester Praxis aber wechselndem Arzt) knapp 54.000 Patienten. Die Patienten hatten über beide Gruppen hinweg 181 verschiedene Ärzte in 13 verschiedenen Praxen besucht, wobei es sich um 4 kommunale Versorgungszentren handelte und 9 ambulante Einrichtungen an Kliniken.
In der Auswertung der Patientendaten wurde dann überprüft, inwieweit sich für die Patienten in den beiden Gruppen unterschiedliche Vorgehensweisen nachweisen lassen, was die Beachtung medizinischer Leitlinien anbetrifft.
• Dabei wurden einerseits Maßnahmen zur Früherkennung berücksichtigt, soweit diese für die Patienten (hinsichtlich Alter und Geschlecht) in Frage kamen: Mammographie, Gebärmutterhals-Untersuchung, Darmkrebsspiegelung.
• Andererseits wurden die medizinischen Leistungen im Rahmen von Disease Management Programmen bei zwei Arten chronischer Erkrankung erfasst (Diabetes, Koronare Herzerkrankung): Messung des HbA1c-Werts (Blutzuckerwerte der letzten acht Wochen), Cholesterin-Spiegel usw.
Die beiden Patientengruppen wiesen allerdings einige Unterschiede auf, etwa was die Zahl der Arztbesuche in den letzten drei Jahren anbetrifft. Dieser Wert lag im Durchschnitt bei 8 Besuchen (bei festem Arzt) bzw. 4 Besuchen (feste Praxis mit wechselndem Arzt). In ähnlicher Weise war auch die Zeit seit dem letztem Arztbesuch unterschiedlich und betrug in der Gruppe mit festem Arzt 4 Monate, in der mit fester Praxis 13 Monate. Aufgrund dieser Unterschiede wurden dann multivariate Datenanalysen durchgeführt, in denen auch diese Besonderheiten und weitere Merkmale (Alter, Geschlecht, Rasse, Zahl der Arztbesuche usw.) berücksichtigt wurden.
Dabei zeigte sich, dass bei der Mehrzahl der einbezogenen 9 Indikatoren (Früherkennung: 3; diagnostische Leistungen bei chronischer Erkrankung: 6) signifikante Unterschiede zwischen den beiden Gruppen vorzufinden waren. Diese Differenzen blieben auch dann bestehen, wenn man die Zahl der Arztbesuche in Rechnung stellte. Durchgängig war zu finden: Patienten mit einem festen Arzt bekommen häufiger Früherkennungs-Untersuchungen und diagnostische Leistungen, sofern sie an einer chronischen Erkrankung leiden. Es ist also nicht die Häufigkeit der Kontakte im Versorgungssystem, was hier eine Rolle spielt, sondern wohl die auf ärztlicher Seite profundere Kenntnis des Patienten und seiner Krankengeschichte.
Hier ist ein Abstract zur Studie: Steven J. Atlas u.a.: Patient-Physician Connectedness and Quality of Primary Care (Annals of Internal Medicine, 3 March 2009, Volume 150, Issue 5, Pages 325-335)
Vor kurzem hatten zwei andere Veröffentlichungen empirische Befunde erbracht, die in eine ähnliche Richtung weisen. Deutlich geworden war einerseits, dass eine feste Anlaufstelle im medizinischen Versorgungssystem für viele Patienten eine bessere Versorgungsqualität bewirkt. In einer Auswertung von Daten des Bertelsmann Gesundheitsmonitor waren Patienten danach unterschieden worden, ob sie einen Hausarzt als reguläre Erstinstanz bei gesundheitlichen Beschwerden nutzen und der Arzt ihre Krankengeschichte gut kennt. Sofern dies der Fall war, zeigten sich diese Patienten deutlich zufriedener hinsichtlich der Kommunikation mit dem Arzt und der Gesprächsatmosphäre in der Sprechstunde, haben Früherkennungsuntersuchungen (Gesundheits-Checkup, Krebsfrüherkennung) häufiger in Anspruch genommen und sind auch häufiger mit der Gesundheitsversorgung insgesamt zufrieden und kritisieren seltener, dass in der medizinischen Versorgung die Zeit für das Arzt-Patient-Gespräch zu kurz ausfällt. vgl.: Eine feste Anlaufstelle im medizinischen Versorgungssystem bewirkt für viele Patienten eine bessere Versorgungsqualität
In einer anderen, international vergleichenden Studie von etwa 11.000 Erwachsenen in sieben Ländern war untersucht worden, ob bei Patienten mit einem "medizinischen Zuhause" ("medical home") Vorteile in der medizinischen Versorgung zu finden sind. Auch hier zeigte sich, dass solche Patienten zufriedener mit der Therapie und auch der Arzt-Patient-Kommunikation sind und nach eigener Meinung auch seltener Behandlungsfehler oder unnötige Doppeluntersuchungen erleben. vgl. hierzu: Ein "medizinisches Zuhause" bietet nach Patientenurteilen eine bessere Behandlungsqualität
Gerd Marstedt, 5.3.09
Leitliniengerechte Behandlung von Herzinsuffizienz: Ärzte benachteiligen Frauen, Ärztinnen aber Männer nicht!
 Wer Genderaspekte oder geschlechtsspezifische Ungleichheiten bei der Diagnose und Behandlung von Krankheiten für unmöglich oder eine etwas überzogene Wichtigtuerei von Frauenbeauftragten gehalten hat, wird in einer gerade veröffentlichten Studie über die Behandlung von Männern und Frauen, die an Herzinsuffizienz litten, durch Ärzte und Ärztinnen eines Besseren belehrt. Dabei stand die Frage im Mittelpunkt, ob die Behandlung den Leitlinien der "European Society of Cardiology" entsprach. Nach diesen Leitlinien sollte bei manifester Herzinsuffizienz mit ACE-Hemmern, Angiotensinrezeptorblockern (ARB) oder Betablocker behandelt werden.
Wer Genderaspekte oder geschlechtsspezifische Ungleichheiten bei der Diagnose und Behandlung von Krankheiten für unmöglich oder eine etwas überzogene Wichtigtuerei von Frauenbeauftragten gehalten hat, wird in einer gerade veröffentlichten Studie über die Behandlung von Männern und Frauen, die an Herzinsuffizienz litten, durch Ärzte und Ärztinnen eines Besseren belehrt. Dabei stand die Frage im Mittelpunkt, ob die Behandlung den Leitlinien der "European Society of Cardiology" entsprach. Nach diesen Leitlinien sollte bei manifester Herzinsuffizienz mit ACE-Hemmern, Angiotensinrezeptorblockern (ARB) oder Betablocker behandelt werden.
Bei der Untersuchung der Behandlung von 1.857 Patienten mit chronischer Herzinsuffizienz im Jahr 2006 durch 829 Ärzte von denen 65 % Allgemeinärzte, 27 % Internisten und 7 % Kardiologen waren, durch eine Forschergruppe an der Universität Homburg/Saar, gab es folgende relevante Ergebnisse:
• Erstens wurde auch in Behandlungseinrichtungen in städtischen Ballungszentren Ostdeutschlands eine bereits mehrmals erkannte Benachteiligung von Frauen bei der Diagnostik und Therapie von kardiologischen Erkrankungen nachgewiesen. Die Frauen in der untersuchten Gruppe erhielten bei vergleichbarer Krankheitssituation weniger der empfohlenen Medikamente und die Mittel, die sie verordnet bekamen, waren dann niedriger dosiert als bei Männern.
• Neu war, dass dies umso ausgeprägter ist, wenn der verordnende Arzt ein Mann war. ACE-Hemmer oder Angiotensinrezeptorblocker wurden signifikant seltener verordnet, wenn eine weibliche Patientin von einem männlichen Arzt behandelt wurde. Völlig anders und erheblich leitlinienkonformer fielen die Verordnungen aus, wenn ein männlicher Patient von einer Ärztin behandelt wurde. Dann waren auch die verordneten Dosen am höchsten.
• In einer multivariaten Analyse der die medikamentöse Behandlung von Herzinsuffizienz-PatientInnen beeinflussenden Krankheitsfaktoren und soziodemografischen Charakteristika waren das Geschlecht der Patienten und das der Ärzte die stärksten und jeweils statistisch höchst signifikanten Risikofaktoren.
• Zum widerholten Male erwiesen sich Ärztinnen in dieser Studie nicht nur als kommunikativer (vgl. dazu bereits die Untersuchung "Phycisian gender effects in medical communication" von Roter et al in JAMA 2002: 288: 756-764) aus dem Jahr 2002, die komplett kostenlos erhältlich ist) oder mehr an psychosozialen Problemen ihrer PatientInnen interessiert, sondern es konnte das erste Mal nachgewiesen werden, auch eine medikamentöse Behandlung "is more complete when female phycisians are taking care of patients." Weder bei der Verordnung noch der Dosierung behandelten Ärztinnen ihre Patienten bei ACE-Hemmern und ARBs nach Geschlecht unterschiedlich - ganz im Gegensatz zu ihren Kollegen.
Trotz einiger selbst eingeräumter methodischer Schwächen (z.B. Selektion "guter" Ärzte und Patienten, Beobachtungsstudie) sollte in weiteren Studien nach Erklärungen für diesen Zusammenhang von Geschlecht beider Akteursgruppen und Behandlungsqualität gesucht werden. Der Hinweis, Ärztinnen würden häufiger in Teilzeit arbeiten und dadurch produktiver arbeiten und eine höhere Zufriedenheit ihrer Patienten auslösen, weisen möglicherweise in die richtige Richtung, sind aber noch bei weitem zu eindimensional.
Der Aufsatz "Influence of gender of physicians and patients on guideline-recommended treatment of chronic heart failure in a cross-sectional study" von Magnus Baumhäkel, Ulrike Müller und Michael Böhm wurde am 21. Januar 2009 im Onlineteil des "European Journal of Heart Failure" veröffentlicht. Den interessierten LeserInnen steht ein Abstract oder der komplett fünfseitige Aufsatz in einer PDF-Version kostenlos zur Verfügung.
Bernard Braun, 31.1.09
Internationaler Vergleich der Versorgung von chronisch Kranken in acht Ländern: Deutschland - wie gewohnt - im Mittelfeld!
 Der Zugang zu Versorgungsleistungen, die Koordination einer meist komplexen und multisektoralen Versorgung und medizinische Irrtümer bei Medikamenten und bei Laboruntersuchungen gehören für Personen mit komplexen gesundheitlichen Problemen bzw. chronisch Kranken zu den wichtigsten Leistungen, die sie von ihrem Gesundheitssystem erwarten.
Der Zugang zu Versorgungsleistungen, die Koordination einer meist komplexen und multisektoralen Versorgung und medizinische Irrtümer bei Medikamenten und bei Laboruntersuchungen gehören für Personen mit komplexen gesundheitlichen Problemen bzw. chronisch Kranken zu den wichtigsten Leistungen, die sie von ihrem Gesundheitssystem erwarten.
Wie es damit im internationalen Vergleich in Australien, Kanada, Frankreich, Deutschland, Niederlanden, Neuseeland, Großbritannien und den USA aussieht erforschten im Auftrag des us-amerikanischen "Commonwealth Fund" C. Schoen, R. Osborn, S. K. H. How, M. M. Doty und J. Peugh und veröffentlichten ihre Ergebnisse in der neuesten (13. November 2008) Web Exclusive-Ausgabe von "Health Affairs" (Seite 1-16) unter dem Titel, In Chronic Condition: Experiences of Patients with Complex Health Care Needs, in Eight Countries, 2008".
Dazu interviewten die AutorInnen von März bis Mai 2008 innerhalb des "Commonwealth Fund International Health Policy Survey of Sicker Adults" in den genannten 8 Ländern 7.500 (darunter z.B. 867 deutsche und 1.007 US-BürgerInnen) chronisch an mindestens einer der an 7 Erkrankungen (Hochdruck, Herzerkrankungen, Diabetes, Arthritis, Lungenprobleme, Krebs und Depression) leidenden Personen per Telefon.
Zu den wichtigsten Ergebnissen zählen:
• Zwischen 7 (Niederlande) und 54 % (USA) der Befragten hatten kostenbedingte Probleme beim Zugang zur Versorgung (Deutschland=26 %).
• Zwischen 14 (NL) und 34 % (USA) hatten mit Koordinationsproblemen (u.a. Doppeluntersuchungen aufgrund mangelnder Transparenz) zu tun (D=26%, d.h. der zweithöchste Wert). 32 % der in Deutschland Befragten sagten, dass ihre in den letzten 2 Jahren besuchten Fachärzte keine Informationen über ihre Behandlungsgeschichte gehabt hätten. In Neuseeland betrug diese Subgruppe lediglich 12 %.
• 17 % der Befragten in den Niederlanden und 34 % in den USA hatten mit Irrtümern im medizinischen, Arzneimittel- und Laborbereich zu tun (D=19%).
• Während 41 % der chronisch Kranken in den USA im Jahr vor der Befragung mehr als 1.000 US-Dollar aus eigener Tasche für ihre Versorgung ausgeben mussten, waren britische (4 %) und niederländische Patienten (8 %) vor solchen Lasten relativ geschützt. In Deutschland belief sich dieser Anteil auf 13 %.
• In den vergangenen zwei Jahren mussten 64 % der kanadischen Chroniker eine Notfallstation aufsuchen, dicht gefolgt von den 59 % der US-Chroniker, die dies ebenfalls machen mussten und dann mit großem Abstand 39 % der deutschen Chroniker. Rund 20% von diesen Patienten suchten die Notfallstation deswegen auf, weil sie trotz der im Grunde ambulant behandelbaren Störung keinen verfügbaren Arzt gefunden hatten.
• Nur ein Viertel der Chroniker in den USA und Kanada erhielten bei Bedarf eine Behandlung am selben Tag ("same-day access") und mussten teilweise sehr lange warten. Dagegen erhielten 60% der holländischen, 54 % der neuseeländischen, 48 % der britischen und 43 % der deutschen chronisch Kranken einen sofortigen Behandlungstermin.
• An der Spitze der Länder, in denen chronisch Kranke 6 und mehr Tage auf einen Arzttermin warten mussten oder ihn sogar nie erhielten lag Kanada mit 34 %, dicht gefolgt von Deutschland mit 26 % und mit dem Schlusslicht Niederlande mit 3 % der Befragten.
• Ganz am Rande zeigen sich auch solch interessante Unterschiede der Behandlung wie der, dass 50% der deutschen Befragten in den zwei vergangenen Jahren 4 und mehr Ärzte in Anspruch nahmen während dies in Großbritannien nur 31 % berichteten.
• In Deutschland war der Anteil der Chroniker, die einen kompletten Umbau des Versorgungssystems für notwendig erachteten, mit 26 % am zweithöchsten (nach den US-Bürgerinnen mit 33 %) während er in den Niederlanden mit 9 % am niedrigsten lag.
Die ebenfalls vom Commonwealth Fund unterstützte spezielle Analyse der OECD Health Data 2008, im November 2008 veröffentlicht unter der Überschrift "Multinational Comparisons of Health Systems Data, 2008" von Gerard F. Anderson und Patricia Markovich (Johns Hopkins University) unterstreicht und hinterlegt wichtige Erkenntnisse der Interviewbefragung.
Ein 36 Seiten umfassendes Chartpack über die Ergebnisse des Surveys zu den wichtigsten Zentraleffekte und Trends im Versorgungsszenario gibt es kostenlos als PDF-und Powerpointdatei.
Die 16 Seiten eines weiteren Chartpacks zum internationalen Vergleich wichtiger Eckziffern im OECD-Health-Data-Report von Anderson und Markovich sind ebenfalls kostenlos erhältlich.
Und schließlich erhält man auch den 16 umfassenden kompletten Aufsatz von Schoen et al. kostenlos als PDF-Datei.
Bernard Braun, 21.11.08
Rund die Hälfte us-amerikanischer Internisten und Rheumatologen führt ohne ethische Bedenken Placebo-Behandlungen durch
 Dass Placebos (Placebo lat. "ich werde gefallen") im Alltag der medizinischen Behandlung von Krankheiten eine bedeutende Rolle spielen, ist ein immer wieder bestätigtes Ergebnis vieler kontrollierter Studien. Dass sich Ärzte der Placebos in ihren Einstellungen und Verhaltensweisen aktiv bedienen und wie häufig sie mit Vorsatz zu Placebos greifen, ist dagegen bisher nicht bekannt.
Dass Placebos (Placebo lat. "ich werde gefallen") im Alltag der medizinischen Behandlung von Krankheiten eine bedeutende Rolle spielen, ist ein immer wieder bestätigtes Ergebnis vieler kontrollierter Studien. Dass sich Ärzte der Placebos in ihren Einstellungen und Verhaltensweisen aktiv bedienen und wie häufig sie mit Vorsatz zu Placebos greifen, ist dagegen bisher nicht bekannt.
Die Ergebnisse einer landesweiten Befragung von 1.200 praktizierenden us-amerikanischen Internisten und Rheumatologen nach der Rolle, die Placebos für ihr ärztliches Selbstverständnis und Handeln spielen, bringen mehr Licht in dieses Dunkel.
Die Behandlung mit Placebos wurde in dieser postalischen Einmal-Befragung definiert als "a treatment whose benefits derive from positive patient expectations and not from the physiological mechanism of the treatment itself". Sie folgen einem weiteren Verständnis von Placebos. Eigentlich Im engeren Sinne handelt es sich bei einem Placebo um ein medizinisches Präparat, das keinen pharmazeutischen Wirkstoff enthält und damit auch keine spezifische pharmazeutische Wirkung verursachen kann. In der hier dargestellten Studie gelten aber auch therapeutische Mittel mit einem bekannten spezifischen Wirkstoff als Placebo bezeichnet, von denen ohne naturwissenschaftlichen Nachweis einer spezifischen Wirkung für das damit behandelte medizinische Problem trotzdem eine positive Reaktion erwartet wird.
Gefragt wurden die Ärzte nach ihrem praktischem Verhalten und ihren Einstellungen zu Placebos, wie oft sie eine "Placebo-Behandlung" durchführten und was diese umfasste, die ethische Bewertung ihrer Praxis und wie sie typischerweise mit ihren Patienten über ihre Behandlungspraxis kommunizierten.
Die 679 Ärzte, die den Fragebogen beantworteten (57 %), machten folgende Angaben:
• 46 bis 58 % der Befragten - abhängig von der konkreten Formulierung - führten im Jahr vor der Befragung Placebo-Behandlungen durch.
• Die meisten Ärzte (399 = 62 %) hielten diese Praxis als ethisch zulässig bzw. unbedenklich.
• Nur wenige der Ärzte gaben an, Salz- oder Zuckerpillen als Placebos eingesetzt zu haben. Wesentlich mehr, nämlich 267 und 243 setzten frei verkäufliche Schmerzmittel oder Vitamine zur Placebo-Behandlung ein. Immerhin 86 = 13 % der Internisten und Rheumatologen setzten aber auch Antibiotika und sedierende Arzneimittel als Placebos ein.
• Auf die ausdrückliche Frage, ob sie die von ihnen gewählten Placebostoffe gegenüber dem Patienten als potenziell nützliche Medizin oder Behandlung beschrieben, die typischerweise nicht für die Behandlung deren Erkrankungen eingesetzt würden, antworteten 241 = 68 %, sie hätten dies so vermittelt. Nur 18 Befragte (5 %) beschrieben sie gegenüber ihren Patienten explizit als Placebos.
Da es keine Hinweise gibt, dass andere Arztgruppen wesentlich andere Einstellungen zu Placebos haben und sich anders verhalten, handelt es sich beim Einsatz von Placebos hochwahrscheinlich um ein alltägliches und weit verbreitetes Geschehen bzw. eine nicht zu vernachlässigende Stütze der medizinischen Versorgung, des ärztlichen Handelns und seiner Wirksamkeit. Interessant wäre zu wissen, ob und wie diese Placebo-Behandlung für die Patienten aus deren Sicht von Nutzen waren und ob das Wissen oder Nichtwissen über den Charakter der Behandlung etwas an dem subjektiv wahrgenommenen Nutzen der Behandlung ändert.
Der in der Ausgabe des "British Medical Journal (BMJ)" (BMJ 2008;337:a1938) vom 23. Oktober 2008 erschienene Aufsatz "Prescribing "placebo treatments": results of national survey of US internists and rheumatologists" von Jon C Tilburt, Ezekiel J Emanuel, Ted J Kaptchuk, Farr A Curlin und Franklin G Miller ist komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 28.10.08
Koronare Herzerkrankungen: Deutsche Ärzte schneiden schlechter ab bei Diagnostik, Medikamentenverordnung und Prävention
 Welche diagnostischen Schritte und welche therapeutischen Maßnahmen bei koronaren Herzerkrankungen, aber auch bei anderen Krankheiten ergriffen werden, hängt auch ab von Merkmalen des Patienten und des behandelnden Arztes. Dass es indes auch länderspezifische Unterschiede gibt, hat jetzt eine Studie gezeigt, die in der Open-Access-Zeitschrift BMC Health Services Research veröffentlicht wurde. Sogenannte "standardisierte Patienten", also professionelle Schauspieler, die einen Patienten mit einer bestimmten Erkrankung spielen, wurden auf Video gefilmt. Diese Videos wurden niedergelassenen Ärzten (Internisten, Allgemeinärzte) aus den USA, dem United Kingdom und Deutschland vorgeführt. In den Filmszenen erzählten die Schauspieler-Patienten über ihre Beschwerden, und zwar solche, die typischerweise bei einer koronaren Herzerkrankung auftreten, wie unter anderem: Druckgefühle in der Brust, Zunahme der Druckgefühle bei Kraftanstrengung, seit über drei Monaten Unwohlsein, überhöhter Blutdruck.
Welche diagnostischen Schritte und welche therapeutischen Maßnahmen bei koronaren Herzerkrankungen, aber auch bei anderen Krankheiten ergriffen werden, hängt auch ab von Merkmalen des Patienten und des behandelnden Arztes. Dass es indes auch länderspezifische Unterschiede gibt, hat jetzt eine Studie gezeigt, die in der Open-Access-Zeitschrift BMC Health Services Research veröffentlicht wurde. Sogenannte "standardisierte Patienten", also professionelle Schauspieler, die einen Patienten mit einer bestimmten Erkrankung spielen, wurden auf Video gefilmt. Diese Videos wurden niedergelassenen Ärzten (Internisten, Allgemeinärzte) aus den USA, dem United Kingdom und Deutschland vorgeführt. In den Filmszenen erzählten die Schauspieler-Patienten über ihre Beschwerden, und zwar solche, die typischerweise bei einer koronaren Herzerkrankung auftreten, wie unter anderem: Druckgefühle in der Brust, Zunahme der Druckgefühle bei Kraftanstrengung, seit über drei Monaten Unwohlsein, überhöhter Blutdruck.
Die Videos wurden mit verschiedenen Schauspielern gedreht, wobei man Merkmale wie Alter, Geschlecht, Hautfarbe und sozialer Status variierte. Sie wurden dann insgesamt 384 zufällig ausgewählten Ärzten gezeigt, 128 aus jedem der drei Länder. Dabei wurden Arztmerkmale wie Geschlecht und Berufserfahrung variiert. Danach wurden die an der Studie teilnehmenden Ärzte anhand eines Fragebogens zu einer Vielzahl von Aspekten befragt: Welche Fragen sie den Patienten stellen würden, welche diagnostischen Tests sie durchführen und welche Medikamente sie verschreiben würden, welche Diagnose sie vorläufig stellen würden und wie sicher sie mit dieser Diagnose seien, ob sie den Patienten bestimmte Ratschläge geben würden, was ihr Gesundheitsverhalten anbetrifft, und vieles andere mehr.
In der Auswertung der Antworten zeigte sich dann:
• Für die Zahl der Fragen, die der Arzt einem Patienten stellt, um zu einer fundierteren Diagnose zu kommen, zeigen sich erhebliche Unterschiede. US-Ärzte stellen die meisten, deutsche Ärzte die wenigsten Fragen. Die Durchschnittswerte betrugen: USA 8,7 Fragen - UK 5,5 - D 3,1. Dieses Ergebnis zeigte sich durchgängig für alle Fragenbereiche (Krankheitsgeschichte, Gesundheitsverhalten, Schmerzen usw.)
• Die (korrekte) Diagnose koronare Herzerkrankung wurde am häufigsten von US-Ärzten gestellt (95%), am zweithäufigsten von Ärzten aus dem United Kingdom (88%) und von deutschen Ärzten am seltensten (74%). Dieselbe Reihenfolge zeigte sich auch für die Selbsteinstufung, wie sicher man bei dieser Diagnose sei.
• Bei der jeweils vorgeschlagenen Therapie sind deutsche Ärzte erneut nur an dritter Stelle zu finden, was die korrekte Medikamenten-Verschreibung anbetrifft (D 17% - UK 48% - USA 67%). Dafür überweisen sie Patienten sehr viel häufiger an Spezialisten (52% im Vergleich zu 5% der US-Ärzte, UK 30%)
• Und schließlich zeigen sich auch Differenzen, was Verhaltensratschläge zu einer gesunden Lebensweise anbetrifft. Nur 9% der deutschen Ärzte gehen auf den Risikofaktor Rauchen ein (UK: 55%, USA: 32%) und dasselbe gilt für das Eingehen auf den Alkoholkonsum des Patienten.
Die Wissenschaftler geben keine zusammenfassende Bewertung der diagnostischen und therapeutischen Qualifikationen ab. Durchgängig zeigt sich jedoch, dass die deutschen Ärzte sehr viel schlechter abschneiden im Vergleich zu ihren Kollegen aus dem United Kingdom und den USA. Woran dies liegt, bleibt in der Studie offen. Einer von vielen möglichen Erklärungsansätzen könnte jedoch in den Aussagen liegen, wie viel Zeit sich die Ärzte in den einzelnen Ländern für einen solchen Patienten nehmen, wie er in den Videos zu sehen war. Hier lagen die Werte in den USA bei 18 Minuten, UK-Ärzte sagten im Durchschnitt 10 Minuten und deutsche Ärzte: fünfeinhalb Minuten .
Die Studie ist hier im Volltext kostenlos nachzulesen: Olaf von dem Knesebeck u.a.: Country differences in the diagnosis and management of coronary heart disease - a comparison between the US, the UK and Germany (BMC Health Services Research 2008, 8:198doi:10.1186/1472-6963-8-198)
Gerd Marstedt, 15.10.2008
Placebo wirkt auch bei einem Reizdarmsyndrom. Aber noch besser wirkt Placebo plus emotionale Unterstützung durch den Arzt
 Die sogenannten SHAM-Akupunktur, also eine unechte, nur scheinbar durchgeführte Nadel-Akupunktur, hat sich bereits in einer Reihe von Studien als durchaus effektiv erwiesen, etwa was die Behandlung von chronischen Kreuz- und Knieschmerzen oder Migräne anbetrifft (vgl. Akupunktur hilft, sowie: GERAC-Akupunkturstudien). Teilweise wurde dabei vermutet, dass der beobachtete Placebo-Effekt in sehr starkem Maße auf die vom Therapeuten ausgehende Wirkung (Kommunikation, soziale Unterstützung) zurückzuführen ist. Tatsächlich hat jetzt eine neuere Studie gezeigt, die ebenfalls mit einer SHAM-Akupunktur bei einem Reizdarmsyndrom gearbeitet hat: Es gibt einen Placebo-Effekt, zurückzuführen auf die scheinbare Akupunktur und daran geknüpfte Erwartungen. Und es gibt darüber hinaus einen Therapeuten-Effekt, der zusätzliche Beschwerdelinderungen beim Patienten hervorruft, und zwar dann, wenn der Arzt den Patienten emotional und kommunikativ in sehr starker Weise unterstützt.
Die sogenannten SHAM-Akupunktur, also eine unechte, nur scheinbar durchgeführte Nadel-Akupunktur, hat sich bereits in einer Reihe von Studien als durchaus effektiv erwiesen, etwa was die Behandlung von chronischen Kreuz- und Knieschmerzen oder Migräne anbetrifft (vgl. Akupunktur hilft, sowie: GERAC-Akupunkturstudien). Teilweise wurde dabei vermutet, dass der beobachtete Placebo-Effekt in sehr starkem Maße auf die vom Therapeuten ausgehende Wirkung (Kommunikation, soziale Unterstützung) zurückzuführen ist. Tatsächlich hat jetzt eine neuere Studie gezeigt, die ebenfalls mit einer SHAM-Akupunktur bei einem Reizdarmsyndrom gearbeitet hat: Es gibt einen Placebo-Effekt, zurückzuführen auf die scheinbare Akupunktur und daran geknüpfte Erwartungen. Und es gibt darüber hinaus einen Therapeuten-Effekt, der zusätzliche Beschwerdelinderungen beim Patienten hervorruft, und zwar dann, wenn der Arzt den Patienten emotional und kommunikativ in sehr starker Weise unterstützt.
Basis der jetzt im "British Medical Journal" veröffentlichten Studie war eine dreiarmige Kontrollstudie, bei der insgesamt 262 Patienten (Durchschnittsalter 39, überwiegend Frauen) per Zufall einer von drei Therapie-Gruppen zugewiesen wurden. Alle Studienteilnehmer litten an einem Reizdarmsyndrom.
• In der ersten Gruppe (Wartegruppe) wurden die Teilnehmer lediglich zu Beginn und nach 3 Wochen und 6 Wochen untersucht.
• In der zweiten Gruppe erhielten die Teilnehmer zweimal wöchentlich eine Placebo-Therapie in Form einer Schein-Akupunktur, bei der acht Nadeln für 20 Minuten auf der Haut platziert wurden. Tatsächlich traten die Nadeln durch eine besondere Konstruktion aber nicht in die Haut ein, so wie dies für eine Akupunktur nach den Regeln der TCM erforderlich ist.
• In der dritten Gruppe schließlich wurde ebenfalls diese Scheinakupunktur durchgeführt. Zusätzlich erhielten die Teilnehmer jedoch ein ganz besonders intensive Zuwendung und emotionale Unterstützung durch Therapeuten. Die Patienten dieser Gruppe wurden detailliert und verständnisvoll über ihre Beschwerden befragt, die Therapeuten hatten die Anweisung, sich mehrfach sehr mitfühlend zu äußern und sich während des "Nadelns" verständnisvoller und "wärmer" zu verhalten.
Nach drei Wochen und für einen Teil der Studienteilnehmer nach 6 Wochen wurden dann insgesamt vier verschiedene Effekte erfasst durch Befragung der Teilnehmer. Diese bezogen sich auf: Gesamtveränderungen der Krankheit, Ausmaß der Beschwerdelinderung, Veränderungen im Schweregrad der Symptome, Veränderungen bei der eempfundenen Lebensqualität. Dabei zeigte sich: Für alle vier Indikatoren war eine Besserung feststellbar. Diese fiel jedoch am geringsten aus für die Wartegruppe, war mittelstark für die zweite Gruppe und am allerstärksten für die dritte Gruppe. So fiel die Veränderung im Symptomschweregrad in der dritten Gruppe doppelt so hoch aus wie in der zweiten Gruppe und noch deutlicher waren die Ergebnisse für die wahrgenommene Lebensqualität.
• Die Studie ist hier im Volltext kostenlos abzurufen: Ted J Kaptchuk u.a.: Components of placebo effect: randomised controlled trial in patients with irritable bowel syndrome (BMJ 2008;336:999-1003 (3 May), doi:10.1136/bmj.39524.439618.25)
• Hier ist ein Diagramm aus der Studie mit den Ergebnissen nach 6 Wochen).
Gerd Marstedt, 16.5.2008
Ein etwas anderes Gesundheitsmanagementbuch: Kann man Gesundheit wie Kühlschränke managen? Nein, sondern ...!
 Wie Pilze nach einem warmen Regen schießen seit einigen Jahren zahlreiche Aufbaustudien-, Bachelor- und Masterstudiengänge in die Höhe, in deren Mittelpunkt das Gesundheitsmanagement steht. Alle diese Angebote gehen von der Notwendigkeit einer eigenständigen Professionalisierung der Managementleistungen im Gesundheitswesen aus und lehren sie.
Wie Pilze nach einem warmen Regen schießen seit einigen Jahren zahlreiche Aufbaustudien-, Bachelor- und Masterstudiengänge in die Höhe, in deren Mittelpunkt das Gesundheitsmanagement steht. Alle diese Angebote gehen von der Notwendigkeit einer eigenständigen Professionalisierung der Managementleistungen im Gesundheitswesen aus und lehren sie.
Neben den zahllosen Vorlesungsskripts gibt es mittlerweile auch diverse Lehrbuchreihen und Lehrbücher, die sich mit dem Themenkomplex beschäftigen. Diese Entwicklung sollte man aber in mehrfacher Hinsicht kritisch begleiten und über die "déformations professionelles" oder Reduktionen vieler Managementtheorien und -ansätze frühzeitig nachzudenken beginnen.
Der Boom der meist auf sechs Semester begrenzten und bewusst praktisch orientierten Studiengängen und der die sie begleitenden Publikationen verdankt sich nicht zuletzt auch einer unvermindert anhaltenden öffentlichen Euphorie der Erwartungen zur Arbeitsplatzentwicklung im Gesundheitswesen. Die seit Mitte der 1990er Jahre allerdings tatsächlich stagnative Entwicklung der Vollarbeitsplätze im Gesundheitswesen, sollte dagegen wenigstens die völlig unreflektierte Ausdehnung solcher Ausbildungs-Angebote bremsen.
Zum anderen erzeugen oder vermitteln eine Reihe der Studiengänge und Grundlagentexte zwei Orientierungen und Erwartungen, die zu kurz greifen und möglicherweise auch die Wirksamkeit oder die Akzeptanz dieses Managements selber einschränken.
Dies betrifft Ansätze, die nach dem Motto "alles ist machbar und zu managen" verfahren und die versprechen, den Erfolg im Wesentlichen durch einzelbetriebliche Problemlösungszirkel oder durch Instrumente wie Checklisten zu erreichen. Dabei werden die Bedeutung sowie die hemmende oder fördernde Rolle von sozialen, politischen, kulturellen Makro-Bedingungen entweder nie bewusst berücksichtigt oder rasch aus den Augen verlieren.
Zu diesen Bedingungen gehören beispielsweise die von der Politik und ihren jeweiligen Gestaltungszielen vorgegebenen Rahmenbedingungen, die Eigeninteressen der Dienstleister und schließlich die soziale Verteilung der Versorgungsbedarfe, der öffentlichen Wahrnehmung und Interpretation dieser Verteilungen. Nicht- oder unterthematisiert werden vor allem die erste und dritte Rahmenbedingung bzw. Einschränkung der Freiheitsgrade von Gestaltung durch Management.
Dies hat auch mit dem häufig eng unternehmensbezogenen oder betriebswirtschaftlichen Touch mancher Managementkonzepte zu tun. Dies wird dann zum Problem, wenn man glaubt, alle Probleme auf betrieblicher Ebene und ausschließlich oder überwiegend mit Managementtechniken lösen zu können und noch nicht einmal über die Existenz eines Suppentellerrandes nachdenkt geschweige denn über ihn hinaus schaut oder tritt. Selbstverständlich heißt dies nicht, dass Managementtechniken, welche die Wirtschaftlichkeit der Versorgung zu verbessern beabsichtigen, nicht notwendig und erfolgreich sein können.
Und natürlich gibt es auch Publikationen oder Studiengängen, die versuchen, den Horizont weiter zu fassen, über das einzelne Krankenhaus oder die Einzelpraxis und den einzelnen Patienten hinausschauen und auch nicht nur auf das Vermitteln kurzfristig wirksamer Rezepte und Methoden erpicht sind.
Dazu zählt in besonderem Maße die jüngste Neuerscheinung dieses Genres: "Gesundheitssicherung - Gesundheitsversorgung - Gesundheitsmanagement. Grundlagen, Ziele, Aufgaben, Perspektiven" von Jens-Uwe Niehoff (Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, Berlin 2007). Hierbei handelt es sich zugleich um den zweiten Band der von H. Naegler und Th. Kersting herausgegebenen Reihe "Health Care Management".
Der Verfasser, gelernter Sozialmediziner und langjährig erfahren in der Weiterbildung von Medizinern, geht sein Thema aus drei Richtungen an:
• Vermittlung von Basiswissen zu Strukturen und Interaktionen des Gesundheitssystems, der Gesundheitssicherung und -versorgung,
• Erläuterung der gesundheitswissenschaftlichen Leitbegriffe für das Gesundheitsmanagement und mit einem
• kritischen Blick auf die Einführung von Markt und Wettbewerb.
Die Neuerscheinung geht durch ihre grundsätzlichen Ausführungen zu zentralen Entwicklungen im System der Gesundheitssicherung und -versorgung der Bundesrepublik weit über das Ziel der Wissensvermittlung hinaus. Besonderer Wert wird neben der Vermittlung von Sachinformationen darauf gelegt, aus einer sozialmedizinischen, gesundheitswissenschaftlichen und versorgungsanalytischen Perspektive zentrale Konflikte oder ihre Hintergründe zu erläutern und die sie speisenden Interessen um Gegenwart und Zukunft der "Branche" verständlich zu machen. Das Buch dürfte für die Lehre wie als griffbereites Lesewerk für die Praxis sehr nützlich sein.
Wer sich einen ersten Eindruck verschaffen will, wie Niehoff versucht, den komplexen Ansprüchen gerecht zu werden, kann dies mit einer Leseprobe aus dieser Neuerscheinung zum Themenbereich "Managed Competition" tun. Die Komplexität des inhaltlichen Feldes und der zu seiner Darstellung notwendigen vielschichtigen Darstellung aufzulockern und verständlicher zu machen, schaffen der Verfasser und die Buchmacher im gesamten Buch durch systematisch eingefügte Kernfragen und -antworten sowie in Textkästen vorgestellten Praxisbeispiele.
Das Buch "Gesundheitssicherung - Gesundheitsversorgung - Gesundheitsmanagement. Grundlagen, Ziele, Aufgaben, Perspektiven" von Jens-Uwe Niehoff, umfasst 261 Seiten, 5 Abbildungen und 36 Tabellen und kostet € 34,95.
Lockeres zum Nachdenken zum Schluss: Im "ABC der Kultdeutschen" taucht "das Management" von Beschwerdemanagement bis Zuchtmanagement auf. Angesichts der Flut dessen was Management zu machen verspricht schließt der Absatz mit den Worten "Das wird immer mehr. Hier müssen wir aufpassen (Aufpaßmanagement)." (Michael Rudolf (2007): Atmo. Bingo. Credo. Das ABC der Kultdeutschen, Berlin: 75).
Bernard Braun, 13.4.2008
Ein "medizinisches Zuhause" bietet nach Patientenurteilen eine bessere Behandlungsqualität
 Ein "medizinisches Zuhause" ("medical home"), also eine feste Anlaufstelle im Versorgungssystem, etwa in der Art, wie sie im Hausarztmodell der Gesetzlichen Krankenkassen umgesetzt ist, bietet für Patienten erhebliche Vorteile in der medizinischen Versorgung. Dieses Ergebnis zeigt sich im internationalen Vergleich trotz der teilweise gravierenden Unterschiede zwischen den Gesundheitssystemen beispielsweise von Deutschland, Großbritannien und den USA. Patienten, die ein solches "medizinisches Zuhause" gewählt haben, sind zufriedener mit der Therapie und auch Arzt-Patient-Kommunikation und erleben nach eigener Meinung auch seltener Behandlungsfehler oder unnötige Doppeluntersuchungen. Dies sind zentrale Befunde einer Befragung von etwa 11.000 Erwachsenen in sieben Ländern (Australien, Neuseeland, USA, Kanada, Großbritannien, Niederlande und Deutschland), über die jetzt in der Zeitschrift "Health Affairs" berichtet wurde.
Ein "medizinisches Zuhause" ("medical home"), also eine feste Anlaufstelle im Versorgungssystem, etwa in der Art, wie sie im Hausarztmodell der Gesetzlichen Krankenkassen umgesetzt ist, bietet für Patienten erhebliche Vorteile in der medizinischen Versorgung. Dieses Ergebnis zeigt sich im internationalen Vergleich trotz der teilweise gravierenden Unterschiede zwischen den Gesundheitssystemen beispielsweise von Deutschland, Großbritannien und den USA. Patienten, die ein solches "medizinisches Zuhause" gewählt haben, sind zufriedener mit der Therapie und auch Arzt-Patient-Kommunikation und erleben nach eigener Meinung auch seltener Behandlungsfehler oder unnötige Doppeluntersuchungen. Dies sind zentrale Befunde einer Befragung von etwa 11.000 Erwachsenen in sieben Ländern (Australien, Neuseeland, USA, Kanada, Großbritannien, Niederlande und Deutschland), über die jetzt in der Zeitschrift "Health Affairs" berichtet wurde.
Die Finanzierung der Studie erfolgte über den Commonwealth Fund und verschiedene nationale Einrichtungen, in Deutschland durch das Institut für "Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen". Die Telefon-Interviews wurden Anfang 2007 durchgeführt. Dabei wurde eine Vielzahl von Fragen gestellt zur Bewertung des Gesundheitssystems und persönlichen Erfahrungen in der medizinischen Versorgung. Im Zentrum der späteren Analysen stand dann die Unterscheidung, ob Patienten eine feste Anlaufstelle im Medizinsystem haben oder nicht. Definiert wurde dies über vier Indikatoren:
• Jemand hat einen Haus- oder Allgemeinarzt oder eine Versorgungseinrichtung, zu der er gewöhnlich als erstes geht
• Der dort besuchte Arzt kennt die Krankengeschichte des Patienten
• Der Arzt oder die Einrichtung ist während der normalen Praxiszeiten telefonisch einfach zu erreichen
• Der Arzt oder die Einrichtung übernimmt die Koordination mit anderen Medizinern, Einrichtungen oder Kliniken.
Sofern alle diese Fragen bejaht wurden, stufte man Befragungsteilnehmer als "Patienten mit fester Anlaufstelle" ein. In den einzelnen Ländern lag die Quote dieser Gruppe zwischen 45 und 61 Prozent und war dabei in Deutschland mit 45% am niedrigsten.
Beim Vergleich der beiden Gruppen mit und ohne feste Anlaufstelle zeigen sich dann erhebliche Unterschiede für die Qualität der medizinischen Versorgung, und dies auch bei einer getrennten Betrachtung der einzelnen Länder. Diese Differenzen werden bei einer Vielzahl von Indikatoren deutlich. Im Folgenden sind Daten nur für Deutschland angegeben, die Unterschiede sind jedoch auch in anderen Ländern in ähnlicher Form zu finden. Teilweise fallen die Vorteile des "medizinischen Zuhause" in den USA am deutlichsten auf. Einige Beispiel aus der sehr großen Zahl der in der Studie veröffentlichten Differenzen:
• Verständlichkeit der ärztlichen Informationen: 81% der Patienten mit fester Anlaufstelle sagen, dass dies meist der Fall ist, aber nur 61% derjenigen ohne feste Anlaufstelle
• Arzt nimmt sich ausreichend Zeit: 82% vs. 59%
• Arzt bezieht den Patienten bei Entscheidungen mit ein: 72% vs. 52%
• Bewertung der ärztlichen Leistungen als gut oder sehr gut: 65% vs. 40%
• Durchführung unnötiger, doppelter Diagnostik nach Patientenansicht: 11% vs. 18%
• Probleme bei der Zusammenarbeit mehrerer Ärzte: 16% vs. 23%
• guter Informationsfluss nach Klinikaufenthalt: 89% vs. 79%
Bei einer Teilgruppe chronisch erkrankter Patienten wurden überdies noch folgende Differenzen deutlich:
• Informations- oder Erinnerungsschreiben für mögliche Teilnahme an Früherkennung: 67% vs. 48%
• Widersprüchliche Informationen von verschiedenen Ärzten: 14% vs. 24%
• Medizinische Behandlungsfehler: 11% vs. 19%
Die Studie zeigt damit unter dem Strich und zumindest aus der Perspektive von Patientenerfahrungen, dass ein "Lotse" im Versorgungssystem erhebliche Vorteile mit sich bringt. In Deutschland ist das Angebot eines Hausarztmodells inzwischen für alle Gesetzlichen Krankenkassen verpflichtend vorgeschrieben. Die Diskussion, ob dieses Modell nun in gesundheitlicher oder auch ökonomischer Hinsicht überhaupt Vorteile mit sich bringt, ist hierzulande noch immer im Gange und nicht selten eher von Standesinteressen als gesundheitspolitischer Weitsicht getragen (vgl.: Hausarztmodelle der Krankenkassen: Bessere Versorgung zu höheren Kosten oder nur höhere Kosten?). Die jetzt vorgelegten Ergebnisse sollten diese Diskussion mit ein wenig mehr Fakten anreichern.
Die Studie ist hier im Volltext nachzulesen: Cathy Schoen u.a.: Toward Higher-Performance Health Systems: Adults’ Health Care Experiences In Seven Countries, 2007 (Health Affairs, 26, no. 6 (2007): w717-w734)
Hier ist die PDF-Datei zur Studie
Gerd Marstedt, 2.11.2007
"In Health Care, Cost Isn't Proof of High Quality" zeigt Herzchirurgie-Studie in Pennsylvania
 Mit dieser nüchternen und wahrscheinlich für manchen Leser ernüchternden Formulierung überschrieb die New York Times (NYT) vom 14. Juni 2007 ihren Artikel über die vom staatlichen Pennsylvania Health Care Cost Containment Council (PHC4) an den 60 Krankenhäusern des US-Bundesstaates Pennsylvania durchgeführte Studie "Cardiac Surgery in Pennsylvania 2005. Information about hospitals and cardiothoracic surgeons".
Mit dieser nüchternen und wahrscheinlich für manchen Leser ernüchternden Formulierung überschrieb die New York Times (NYT) vom 14. Juni 2007 ihren Artikel über die vom staatlichen Pennsylvania Health Care Cost Containment Council (PHC4) an den 60 Krankenhäusern des US-Bundesstaates Pennsylvania durchgeführte Studie "Cardiac Surgery in Pennsylvania 2005. Information about hospitals and cardiothoracic surgeons".
Für alle 60 namentlich genannten Krankenhäuser sammelten die Forscher die Anzahl verschiedener herzchirurgischer Interventionen (Bypass-Operation und Herzklappenoperation), die Sterberaten während des Behandlungsaufenthalts und innerhalb eines 3o-Tagezeitraums nach der Operation, die Wiedereinweisungen nach 7 und 30 Tagen, die postoperative Liegezeit und die durchschnittlichen Kosten der Eingriffe. Zusammen waren es Daten von 17.331 Personen.
Die wesentliche Erkenntnis der Studie ist eine unverhüllte Evidenz ("stark evidence") dafür, dass mit hohen Behandlungszahlungen nicht notwendigerweise qualitativ hochwertige Behandlung verbunden ist. So gab es z. B. zwischen einem Krankenhaus, das fast 100.000 US-Dollar für eine Bypassoperation abrechnete und einem Haus, in dem dieselbe Operation weniger als 20.000 US-Dollar kostete, weder Liegezeit- noch Sterblichkeitsunterschiede. Es ist sogar so, dass unter den 20 Krankenhäusern in der Metropole Philadelphia zwei der teuersten höhere Sterblichkeitsraten aufwiesen als erwartet wurde. Die Argumente der Krankenhäuser, es handle sich immer um Effekte seltener aber ganz schwerer Fälle, können lediglich einen Bruchteil der Unterschiede erklären.
Die Daten dieser Untersuchung sind geeignet die in den USA weitverbreitete Grundhaltung oder -bereitschaft, mit mehr Geld gute Behandlung einzukaufen, zu erschüttern. In den Worten der NYT: "Expensive medicine may, in fact, be poor medicine" und zitiert einen Versicherungsmanager folgendermaßen: "For most consumers, the fact that there is no connection between quality and cost is one of the dirty secrets of medicine."
Ganz nebenbei förderte die Studie auch noch ein paar andere Hinweise auf die Bedeutung mancher Seite der Qualitätssicherung zu Tage:
• Patienten, die gleichzeitig Bypässe gelegt bekamen und an den Herzklappen operiert wurden, hatten die höchste Sterblichkeit- und Wiedereinweisungsrate. Patienten, die "nur" eine Bypassoperation hatten, hatten dagegen die niedrigsten Werte der beiden Raten.
• Von allen Herzpatienten traten bei insgesamt 4,4 % so genannte Krankenhausinfektionen ("hospital-acquired infection" [HAI]) auf. 8 % unter den Doppel-Operierten und 3,6 % bei den Bypass-Patienten.
• Von allen HAI-Patienten starben 13,5 % im Krankenhaus wohingegen es unter den Patienten ohne HAI "nur" 2,4 % waren.
• Mit HAI lagen Patienten noch 21,7 Tage lang im Krankenhaus, während die Patienten ohne Infektionen das Krankenhaus schon nach 7,1 Tagen verlassen konnten.
• Und schließlich kosten die HAI auch noch sehr viel Geld: Patienten mit Infektionen und privater kommerzieller Versicherung bezahlten im Durchschnitt 65.514 US-$, denen 32.764 US-$ bei Nichtinfizierten standen. Die durchschnittliche Zahlung lag bei Medicare-Patienten mit HAI bei 57.883 US-$ und 32.911 US-$ bei Patienten ohne HAI.
Den 40-seitigen Report "Cardiac Surgery in Pennsylvania 2005. Information about hospitals and cardiothoracic surgeons" kann man hier kostenlos herunterladen.
Bernard Braun, 21.6.2007
Finanzielle Beziehungen zur Industrie auch bei Reviewern von Protokollen klinischer Studien in Hochschulen
 Die gerade im "Forum-Gesundheitspolitik" vorgestellte Analyse zu den meist finanziellen Beziehungen von us-amerikanischen Ärzten und der Pharmaindustrie kann unverzüglich um eine weitere problematische Facette der Beziehungen zwischen der klinischen Medizin- und Behandlungsforschung und der involvierten Industrie ergänzt werden.
Die gerade im "Forum-Gesundheitspolitik" vorgestellte Analyse zu den meist finanziellen Beziehungen von us-amerikanischen Ärzten und der Pharmaindustrie kann unverzüglich um eine weitere problematische Facette der Beziehungen zwischen der klinischen Medizin- und Behandlungsforschung und der involvierten Industrie ergänzt werden.
In einer bereits am 30. November 2006 im Medizin-Fachorgan "New England Journal of Medicine (NEJM)" (Volume 355. No. 22: 2321-2329) veröffentlichten Studie con Campbell, Weissman et al. über die "Financial Relationships between Institutional Review Board Members and Industry" in den USA wurden dazu 893 Mitglieder solcher so genannter IRB aus 100 akademischen Institutionen gefragt. In einem von immerhin 67,2 % dieser Befragten beantworteten Fragebogen, fragten die Forscher direkt nach den finanziellen Beziehungen der Mitglieder der institutionellen Reviewer-Gruppen in Gestalt von Beschäftigung, Mitgliedschaft in anderen Ausschüssen oder Kommissionen, Beratungstätigkeit, Honorare oder bezahlte Vorträge.
Warum derartige Beziehungen aus Sicht der Öffentlichkeit und Patienten hochproblematisch und nicht zu rechtfertigen sind, haben die Forscher am Anfang ihres Aufsatzes unmissverständlich festgestellt. Dabei spielen für sie folgende Aspekte die zentrale Rollen: "The clinical research enterprise rests on a belief in the integrity of both researchers and the results of their research. Relationships with industry at the level of the individual and the institution have the potential to undermine this confidence. ...Of additional interest is the extent to which relationships with industry may affect members of institutional review boards (IRB). Because IRB’s are responsible for overseeing and protecting the safety and well-being of research participants, they should be free of undue influence by financial interests or by the appearance of such interests."
Die Ergebnisse der Befragung liefern aber zum ersten Mal für die USA ein deutlich kritischeres Bild:
• 36,2 % der befragten IRB-Mitglieder gaben für das letzte Jahr wenigstens eine der erfragten Beziehungsarten zur Industrie an. 22,6 % erhielten etwa Forschungsgelder von der Industrie, 17,4 % Geld für die Teilnahme an Meetings und Konferenzen oder 14,5 % hatten als Berater Geld erhalten.
• 85,5 % sagten, sie hätten niemals gedacht, dass die Industriebeziehungen anderer Mitglieder deren IRB-beziogenen Entscheidungen in unangemessener Weise berührt hätten. 11,9 % dachten, diese passiere selten, 2,4 % sahen dies öfters geschehen und 0,2 % dachten, dies geschehe oft.
• 15,1 % berichteten, dass während des letzten Jahres mindestens ein Protokoll einer industrie-gesponsorten klinischen Studie auf den Tisch ihres IRB kam, bei dem es um ein Produkt der Firma ging, die auch finanzielle Beziehungen mit Mitgliedern dieses Boards unterhielt oder um das Produkt eines Konkurrenten dieses Sponsors, also in beiden Fällen Interessenkonflikte vorhanden gewesen sein könnten.
• Von den Befragten, die ausdrücklich einen Interessenkonflikt bestätigten (6,9 % aller IRB-Mitglieder), waren statistisch signifkant mehr als Industrieberater tätig.
• Von diesen 15,1 % der Befragten (n=78) berichteten 57,7 % immer der Leitung des IRB über ihre Beziehung, 7,7 % machten dies manchmal, 11,5 % eher selten und 23,1 % machten dies niemals.
• 45,8 % der Befragten berichteten, sie hätten in ihrer Institution eine schriftliche Definition davon, was Interessenkonflikte konstituiere, bei 12,1 % existierte eine solche Definition nicht und 42,2 % wussten davon nichts.
Die Forscher schließen ihre Studienergebnisse mit dem Hinweis ab, die Risiken derartiger Beziehungen durch die uneingeschränkte Transparenz über derartige Beziehungen und durch die Identifikation von Interessenkonflikten durch klare Standards abzumildern.
Das Abstract des NEJM-Aufsatzes "Financial Relationships between Institutional Review Board Members and Industry" ist hier erhältlich.
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist auch die PDF-Version des kompletten 9-seitigen Aufsatzes über den Server der Brown University kostenlos zugänglich.
Bernard Braun, 1.5.2007
Wartezeiten können negative gesundheitliche Folgen haben: Das Beispiel Kataraktoperation.
 Längere Wartezeiten für medizinische Versorgung können nicht nur unkomfortabel sein, sondern auch negative gesundheitliche Folgen haben. Dies hat nun eine Metaanalyse von 27 nach 1990 durchgeführten Studien für die Auswirkungen des Wartens auf eine Operation des so genannten "Grauen Stars", einer der häufigsten Augenoperationen, gezeigt, die am 24. April 2007 unter der Überschrift "The consequences of waiting for cataract surgery: a systematic review" in der kanadischen Fachzeitschrift "Canadian Medical Association Journal (CMAJ)" (176 (9): 1285-90) erschienen ist.
Längere Wartezeiten für medizinische Versorgung können nicht nur unkomfortabel sein, sondern auch negative gesundheitliche Folgen haben. Dies hat nun eine Metaanalyse von 27 nach 1990 durchgeführten Studien für die Auswirkungen des Wartens auf eine Operation des so genannten "Grauen Stars", einer der häufigsten Augenoperationen, gezeigt, die am 24. April 2007 unter der Überschrift "The consequences of waiting for cataract surgery: a systematic review" in der kanadischen Fachzeitschrift "Canadian Medical Association Journal (CMAJ)" (176 (9): 1285-90) erschienen ist.
Die Ergebnisse sind bei allen von den Autoren selbst geäußerten methodischen Problemen (z.B. sehr wenige Studien mit oft wenigen Patienten) eindeutig:
• Bei Patienten, die sechs und mehr Monate auf ihre Star-Operation warten müssen, können in der Wartezeit negative Auswirkungen wie Sehverluste, eine reduzierte Lebensqualität und eine steigende Anzahl von Stürzen auftreten.
• Die Forschergruppe um William Hodge und Tanya Horsley fand außerdem eine interessante Dichotomie der Wartezeit-Outcome-Relation zwischen Patienten, die bis zu 6 Wochen und mehr als 6 Monate auf eine Operation warten mussten: Die länger wartenden Patienten hatten deutlich mehr und intensivere Auswirkungen zu ertragen als die kürzer wartenden Patienten.
• Die meisten Patienten waren in den Studien, die dies überhaupt erhoben haben, mit Wartezeiten bis zu drei Monaten noch zufrieden und erst danach stieg das Level der Unzufriedenheit deutlich an.
• Eine für den praktischen Nutzen der Versorgungsforschung nicht unwichtige Frage blieb in dieser Studie offen: Wie wirken sich Wartezeiten zwischen 6 Wochen und 6 Monaten aus? Mangels empirischer Forschung könnte es theoretisch entweder keinen Unterschied zwischen dem Outcome mit den beiden Wartezeiten geben oder es könnte ein linearer oder exponentieller Zusammenhang existieren. Im letzteren Fall wäre z.B. die Verkürzung jeden Tags wichtig.
Hier erhalten Sie kostenlos die PDF-Version des Aufsatzes von William Hodge, Tanya Horsley, David Albiani, Julia Baryla, Michel Belliveau, Ralf Buhrmann, Michael O'Connor, Jason Blair und Elizabeth Lowcock in CMAJ, April 24, 2007; 176 (9).
Bernard Braun, 28.4.2007
Selbstbestimmte Rationierung durch eigenverantwortliche Patienten?
 Mängel in der Verschreibung und -einnahme sind in allen Industrieländern ein großes Problem. Auch in Deutschland landet ein erheblicher, wenn nicht der Großteil, verschriebener Arzneimittel im Abfall oder vergammelt in Medikamentenschränken. Bei jährlichen Arzneimittelausgaben der Gesetzlichen Krankenkassen von rund 25 Milliarden Euro schlummert hier ein erkleckliches Einsparpotenzial. Das ist zwar eine Form von Vergeudung, gleichzeitig drängt sich aber der Verdacht auf, die Realität bestätige die zurzeit vorherrschenden gesundheitsökonomischen Vorstellungen und Ansätze. Diese gehen davon aus, dass Patientinnen und Patienten nach rationalen Kriterien entscheiden, ob sie verschriebene Medikamente einnehmen und gegebenenfalls anfallende Zuzahlungen aufbringen wollen, dass sie sind ausreichend gut informiert, sicher die Konsequenzen abwägen können und über die Mehrung des eigenen zum gesellschaftlichen Wohlstand beitragen.
Mängel in der Verschreibung und -einnahme sind in allen Industrieländern ein großes Problem. Auch in Deutschland landet ein erheblicher, wenn nicht der Großteil, verschriebener Arzneimittel im Abfall oder vergammelt in Medikamentenschränken. Bei jährlichen Arzneimittelausgaben der Gesetzlichen Krankenkassen von rund 25 Milliarden Euro schlummert hier ein erkleckliches Einsparpotenzial. Das ist zwar eine Form von Vergeudung, gleichzeitig drängt sich aber der Verdacht auf, die Realität bestätige die zurzeit vorherrschenden gesundheitsökonomischen Vorstellungen und Ansätze. Diese gehen davon aus, dass Patientinnen und Patienten nach rationalen Kriterien entscheiden, ob sie verschriebene Medikamente einnehmen und gegebenenfalls anfallende Zuzahlungen aufbringen wollen, dass sie sind ausreichend gut informiert, sicher die Konsequenzen abwägen können und über die Mehrung des eigenen zum gesellschaftlichen Wohlstand beitragen.
Vor diesem Hintergrund könnte man sich angesichts bestehender Probleme bei der Compliance und Therapieeinhaltung getrost zurücklehnen, die Hände in den Schoß legen und sich auf die steuernde Effekte des Gesundheitsmarktes verlassen. Allerdings nur so lange, wie man nicht genauer hinsieht. Wesentlich besorgniserregender als die unmittelbare Verschwendung sind nämlich die durch unzureichende Medikamenteneinnahme verursachten Mehrausgaben aufgrund von Folgekrankheiten, Komplikationen, Notfall- und Krankenhausaufenthalten. Gar nicht zu reden von dem vermeidbaren Leid und unnötigen Todesfällen, die schwer quantifizierbar sind und deshalb in gängigen Debatten leicht unter den Tisch fallen.
In besonderem Maße sind sozial benachteiligte Personen betroffen, denn ärmere und weniger gebildete Patienten tendieren eher dazu, Verordnungen nicht einzuhalten - also genau die Gruppe, die häufiger und früher an chronischen Krankheiten leidet und im Vergleich zu Bessergestellten eine geringere Lebenserwartung aufweist. Gerade für sozial Benachteiligte bietet die medikamentöse Sekundärprävention daher einen Erfolg versprechenden Ansatz, sofern sie effektiv und ausreichend ist. Doch in der gesundheitspolitischen Debatte versperren immer wieder die Schuldfrage und die Vorstellung selbst verschuldeter Gesundheitsprobleme den Blick auf Systemprobleme.
In seiner Ausgabe vom 13. April 2007 widmet sich das Deutsche Ärzteblatt diesem Thema, das in der Wahrnehmung des Gesundheitswesens und üblichen Reformdebatten vielfach zu kurz kommt. Hier finden Sie den Artikel Therapietreue: "Auch eine Bringschuld des Versorgungssystems aus dem Deutschen Ärzteblatt.
Vor wenigen Monaten befasste sich die von der American Medical Association (AMA) herausgegebenen Zeitschrift Archives of Internal Medicine mit den Folgen unzureichender Medikamenteneinnahme in der Normalbevölkerung. Eine Studie zeigte, dass jeder achte Herzinfarktpatient bereits im ersten Monat nach der Krankenhausentlassung die medikamentöse Therapie beendet. Besonders der Übergang zwischen stationärer und ambulanter Behandlung erweist sich als Hürde, und vor allem ältere und weniger gebildete Patienten halten sich nicht an ärztliche Anordnungen. Dadurch steigen die Komplikationsraten mit der Erfordernis weiterer Interventionen, und die Lebenserwartung sinkt: Ho et al. kommen in der Untersuchung über Herzinfarktpatienten zu dem Schluss, dass in den USA jeder 17. Todesfall im ersten Jahr nach dem akuten Ereignis bei konsequenter Behandlung vermeidbar wäre.
Hier finden Sie das Abstract des entsprechenden Artikels aus den Archives of Internal Medicine.
Mehr als jeder fünfte Diabetiker der größten us-amerikanischen Krankenkasse Kaiser Permanente behandelt seine Stoffwechselkrankheit nicht entsprechend den ärztlichen Anweisungen, wobei vor allem jüngere Patienten zu unvollständiger Medikation neigen. Die Folge sind schlechtere Laborparameter, mehr Komplikationen und eine höhere Sterblichkeit. Hier finden Sie ein Abstract des Artikels Effect of Medication Nonadherence on Hospitalization and Mortality Among Patients With Diabetes Mellitus von Ho et al. zu den Konsequenzen inkonsequenter Diabetes-Behandlungen Archives of Internal Medicine.
Eine wesentliche, aber in der Regel gesundheitspolitisch unterschätzte Ursache für mangelhafte "Compliance" stellen anfallende Kosten dar. So zeigt eine weitere Untersuchung aus der Ausgabe 166 (17) der Archives of Internal Medicine, das Medikamentenzuzahlungen gerade für Menschen geringen Einkommen und mit chronischen Erkrankungen eine große Hürde darstellen Soumerai et al. Archives of Internal Medicine.
Vergleichbare Ergebnisse erbrachte eine Analyse der Folgen von Deckelungen der Kostenübernahme für Arzneimittel bei chronisch Kranken, die im Juni 2006 im nachzulesen war. Hier finden Sie ein Abstract des Beitrags von Hsu et al. Im New England Journal of Medicine.
Speziell im Hinblick auf Herzinfarktpatienten publizierte das Journal of the American Medical Association (JAMA). In dem Artikel Financial Barriers to Health Care and Outcomes After Acute Myocardial Infarction zeigen Rahimi et al., dass Patienten, für die Medikamentenkosten eine spürbare finanzielle Belastung darstellen, signifikant häufiger unter Angina-pectoris-Beschwerden leiden und deutlich häufiger stationäre Behandlungen in Anspruch nehmen müssen. Hier finden Sie das Abstract des Beitrags über Zuzahlungsfolgen bei Infarktpatienten: JAMA.
Eine kürzlich veröffentlichte Arbeit von Rottländer et al. bestätigt die große Bedeutung von Compliance-Problemen auch bei deutschen Patienten mit Herz-Kreislauferkrankungen. Dabei zeigte sich, dass die Nicht-Einhaltung der Verordnungen mit der Zahl der Medikamente steigt und fast die Hälfte der Betroffenen die Indikation der Verordnungen nicht kannte. Hier finden Sie das Abstract der Untersuchung Multimedikation, Compliance und Zusatzmedikation bei Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen aus Deutschland in der Deutschen Medizinischen Wochenschrift.
Mediziner, Ökonomen und Gesundheitspolitiker sind sich vielfach allzu einig in der Frage, wer für "schlechte Compliance" verantwortlich ist, nämlich die uneinsichtigen Patienten, die einfach nicht die Verantwortung für ihr Handeln übernehmen wollen. Doch diese einseitige Sichtweise blendet nicht nur die Folgen von Selbstbeteiligungen aus, die mit der großen Gefahr verbunden sind, vermeidbare Folgeerkrankungen zu verursachen und somit das Gesundheitssystem mit erheblichen Mehrkosten zu belasten. Vielmehr tragen auch die Behandler eine gehörige Portion "Schuld" an der Misere, die neben Kosten auch erhebliches Leid für die Betroffenen bedeutet. Oft genug klären Ärzte ihre Patienten nicht ausführlich genug über neu verschriebene Arzneimittel und vor allem über die Dauer der Einnahme und mögliche unerwünschten Wirkungen auf.
Einen Extrakt des Leitartikels aus der mehrfach genannten Archives-Ausgabe Improving Medication Adherence - Challenges for Physicians, Payers, and Policy Makers - können Sie hier herunterladen: Archives of Internal Medicine, das Abstract des Artikels Physician Communication When Prescribing New Medications von Tarn et al. finden Sie unter Archives of Internal Medicine.
Jens Holst, 21.4.2007
"So viel wie möglich und wie normal" muss bei chronisch Kranken nicht immer "gut" sein.
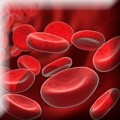 Auf diesen knappen Nenner lassen sich die Ergebnisse mehrerer seit November 2006 in zwei medizinischen Fachzeitschriften veröffentlichten gründlichen Analysen von vorliegenden Studien bringen, die sich mit den Auswirkungen der Anhebung des Spiegels roter Blutkörperchen bei Personen mit Blutarmut und einer chronischen Nierenerkrankung auf das für Gesunde normale Niveau beschäftigen. Im November-Heft 2006 des "New England Journal of Medicine" kommen sowohl Singh et al. ("Correction of Anemia with Epoetin Alfa in Chronic Kidney Disease") als auch Drueke et al. ("Normalization of Hemoglobin Level in Patients with Chronic Kidney Disease and Anemia") zu dem Schluss, der Hämoglobinspiegel sollte nicht auf das normale Niveau erhöht werden. Wenn dies doch geschieht zeigen beide Studien ein erhöhtes Risikos für frühzeitigen Tod, Schlaganfall, Herzinfarkten und Krankenhausaufenthalten wegen Herzproblemen oder für Dialyse. Fast durchweg nehmen diese Risiken zu, ohne dass zuvor die Lebensqualität der Patienten erhöht worden wäre.
Auf diesen knappen Nenner lassen sich die Ergebnisse mehrerer seit November 2006 in zwei medizinischen Fachzeitschriften veröffentlichten gründlichen Analysen von vorliegenden Studien bringen, die sich mit den Auswirkungen der Anhebung des Spiegels roter Blutkörperchen bei Personen mit Blutarmut und einer chronischen Nierenerkrankung auf das für Gesunde normale Niveau beschäftigen. Im November-Heft 2006 des "New England Journal of Medicine" kommen sowohl Singh et al. ("Correction of Anemia with Epoetin Alfa in Chronic Kidney Disease") als auch Drueke et al. ("Normalization of Hemoglobin Level in Patients with Chronic Kidney Disease and Anemia") zu dem Schluss, der Hämoglobinspiegel sollte nicht auf das normale Niveau erhöht werden. Wenn dies doch geschieht zeigen beide Studien ein erhöhtes Risikos für frühzeitigen Tod, Schlaganfall, Herzinfarkten und Krankenhausaufenthalten wegen Herzproblemen oder für Dialyse. Fast durchweg nehmen diese Risiken zu, ohne dass zuvor die Lebensqualität der Patienten erhöht worden wäre.
Bestätigt werden diese Befunde durch den in der Zeitschrift "The Lancet" veröffentlichten Aufsatz Mortality and target haemoglobin concentrations in anaemic patients with chronic kidney disease treated with erythropoietin: a meta-analysis von Phrommintikul et al.
Im Editorial dieser "Lancet"-Ausgabe findet sich die folgende Schlussfolgerung: "The question has been answered: higher haemoglobin target concentrations increase mortality via cardiovascular endpoints. ...Part rather than complete correction of anaemia is appropriate, although commercially less attractive, and it is time to move on." Dies sollte durch eine rasche Änderung der bisherigen Leitlinien und eine klare jetzt evidenzbasierte Empfehlung erfolgen, bei den beschriebenen Nierenpatienten nicht über einen bestimmten unter dem normalen Wert liegenden Wert hinauszugehen (nicht höher als 13.0 g/dL).
Sofern man sich kostenfrei bei "Lancet" einträgt, kann man das Abstract des Aufsatzes von Phrommintikul et al. herunterladen.
Bernard Braun, 3.2.2007
Wiederholte Knochendichtemessungen: Überversorgung durch Wiederholungsuntersuchungen trotz fehlenden Nutzens.
 "Viel hilft viel" oder "für alle Fälle nochmal nachschauen" sind bei Ärzten aber auch Patienten weit verbreitete Mottos mit entsprechenden Anhäufungen diagnostischer und therapeutischer Aktivitäten in der Krankenbehandlung aber auch der Früherkennung gesundheitlicher Risiken. Vielfach und im besten Falle dürfte es sich dabei um medizinische Überversorgung ohne einen erkennbaren Nutzen handeln. Unmilder betrachtet, handelt es sich um eine permanente Medikalisierung und Risikoängstigung der betreffenden durchgemessenen Personen. Hinzu kommen die Belastungen durch die falsch-positiven und -negativen Messergebnisse.
"Viel hilft viel" oder "für alle Fälle nochmal nachschauen" sind bei Ärzten aber auch Patienten weit verbreitete Mottos mit entsprechenden Anhäufungen diagnostischer und therapeutischer Aktivitäten in der Krankenbehandlung aber auch der Früherkennung gesundheitlicher Risiken. Vielfach und im besten Falle dürfte es sich dabei um medizinische Überversorgung ohne einen erkennbaren Nutzen handeln. Unmilder betrachtet, handelt es sich um eine permanente Medikalisierung und Risikoängstigung der betreffenden durchgemessenen Personen. Hinzu kommen die Belastungen durch die falsch-positiven und -negativen Messergebnisse.
Eines der in den letzten Jahren systematisch geschürten und hochgeschriebenen Risiken für Frauen nach der Menopause ist die Osteoporose zu dem dann gleich die sreeningmäßige Messung des Kalksalzgehalts der Knochen (daher "bone mineral density srenning (BMD)") oder auch Osteodensitometrie propagiert wurde. Der Nutzen dieser Messung ist in Deutschland immerhin so umstritten, dass die Kosten der Messung (aktuell rund 45 Euro) aufgrund eines Beschlusses des damaligen (2000) "Bundesausschusses Ärzte und Krankenkassen" nur dann von den gesetzlichen Krankenkassen gezahlt werden, wenn der oder die betreffende Versicherte bereits einen Knochenbruch aufgrund von Kalksalzmangel hinter sich hat. Für prophylaktische Zwecke sollen gründliche anamnestische Informationen genutzt werden.
Zumindest für diejenigen, die aufgrund dieser Rechtslage nun Knochendichtemessungen von ihrem Arzt praktisch routinemäßig-mehrmals als so genannte "Individuelle Gesundheitsleistung (IgeL)", also auf Privatrechnung angeboten bekommen, ist das Ergebnis einer jetzt in der Fachzeitschrift "Archives of Internal Medicine" (2007;167:155-160) veröffentlichten prospektiven Beobachtungsstudie zum Thema "Evaluating the Value of Repeat Bone Mineral Density Measurement and Prediction of Fractures in Older Women The Study of Osteoporotic Fractures" von Teresa Hillier et al. von hohem Interesse. Die Forschergruppe hat nämlich bei 4.000 Frauen im Alter von 65 und mehr Jahren herausgefunden, dass, wenn überhaupt, eine einzige Messung nach der Menopause einen gleich hohen Voraussagewert für Brüche der Hüftknochen, der Rückgratknochen oder anderer Knochen hat wie eine zusätzliche zweite Messung nach 8 Jahren und danach alle 5 Jahre, weitere Messungen - insgesamt also eine stetig anwachsende Menge von Messungen.
Beim Vergleich des Nutzens der unterschiedlichen Anzahl von Messungen kommen die Forscher zu dem eindeutigen Schluss: "We did not find any improvement in the overall predictive value ... in a second measure of BMD ... in prediction of hip, spine, or overall nonspine fracture risk."
Gegen den behaupteten oder erwarteten Nutzen wiederholter Messungen als Screeninginstrument gewandt, spitzen sie ihre Erkenntnisse noch weiter zu: "Our results do suggest that, for the average healthy older woman 65 years or older, a repeat BMD measurement has little or no value in classifying risk for future fracture."
Hier finden Sie kostenlos das Abstract des Aufsatzes.
Bernard Braun, 25.1.2007
Autorenlisten wissenschaftlicher Aufsätze als vierte Stufe der Lüge? Arzneimittelstudien zwischen Geist und Ghostwritern
 Für den landläufigen Spruch "trau keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast" ist dies ein gefundenes Fressen: An zahlreichen wissenschaftlichen Arzneimittelstudien arbeiteten Statistiker mit, die von den Herstellern bezahlt, aber nicht als Mitautor der veröffentlichten Studienergebnisse genannt wurden, also klassische Ghostwriter waren.
Für den landläufigen Spruch "trau keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast" ist dies ein gefundenes Fressen: An zahlreichen wissenschaftlichen Arzneimittelstudien arbeiteten Statistiker mit, die von den Herstellern bezahlt, aber nicht als Mitautor der veröffentlichten Studienergebnisse genannt wurden, also klassische Ghostwriter waren.
Dies ist das Kernergebnis einer von dänischen, britischen und kanadischen Wissenschaftlern, darunter u.a. Mitglieder des "Nordic Cochrane Centre" in Kopenhagen aktuell durchgeführten Untersuchung über "Ghost Authorship in Industry-Initiated Randomised Trials", deren Ergebnisse in der Januarausgabe der Open-Access-Zeitschrift PloS Medicine (2007, Volume 4, 1-e19) veröffentlicht wurden.
Für insgesamt 44 Studien, von denen 43 von Herstellern von Medikamenten initiiert und in Dänemark in den 1990er Jahren durchgeführt wurden, konnten die Wissenschaftler Einblick in Anträge und Protokolle der in die Arzneimittelstudien involvierten Ethik-Kommissionen nehmen und diese mit Veröffentlichungen vergleichen. Bei 33 dieser Studien, das sind drei Viertel aller Studien, fanden sie Evidenz für die Existenz von Ghostwritern, die bei Herstellerfirmen angestellt waren. Sie definierten dabei "ghost authorship as present if individuals who wrote the trial protocol, performed the statistical analyses, or wrote the manuscript, were not listed as authors of the publication, or as members of a study group or writing committee, or in an acknowledgement".
Nimmt man noch all die Fälle hinzu, wo einer Person, die nach allen inhaltlichen Kriterien als Autor geeignet gewesen wäre, lediglich im Vorwort gedankt worden ist, steigt der Anteil von Studien mit Ghostwritern auf 91 % an. In 31 der 33 zufallsgesteuerten Studien mit Ghostwritern handelte es sich um Statistiker, die eine wichtige inhaltliche Rolle in solchen Studien spielen. In der kritischen Analyse von Peter C. Gřtzsche et al. werden im übrigen weitere Studien zitiert, die bereits in der Vergangenheit die Existenz derartiger "Geister" nachgewiesen hatten. Alle Studien über ein derartig bewusstes heimliches Treiben drohen außerdem das Problem eher zu unterschätzen.
Das Resumee der Ghostwriter-Forscher lautet, dass die Mitwirkung von Ghostwritern aus den Herstellerfirmen "is very common, and we believe that this practice serves commercial purposes."
Um die Glaubwürdigkeit von Studien wieder herzustellen oder zu erhöhen, schlagen sie vor, dass endlich
• verbindlich und überall die existierenden Publikationsleitlinien angewandt werden, die ein solches geisterhaftes Mitwirken verbieten, dass
• wissenschaftliche Zeitschriften ausdrücklich Angaben zu allen an der Studie beteiligten Personen verlangen,
• speziell nach dem Namen und dem Beschäftigungshintergrund der Statistiker fragen und
• Studienprotokolle öffentlich verfügbar sind.
Wer noch etwas mehr über die Perspektiven der Undurchsichtigkeit auch wissenschaftlicher Veröffentlichungen lesen will, kann dies im Aufsatz von Wagner machen, der ebenfalls im Januarheft von PloS Medicine erschienen ist, und den hintergründigen Titel "Authors, Ghosts, Damned Lies and Statisticians" trägt. Darin schlägt sie ironisch vor, den Disraeli oder Twain zugeschriebenen Aphorismus von den drei Stufen der Lüge, nämlich Lügen, verdammte Lügen und Statistik um eine vierte Stufe zu erweitern: "authorship lists of scientific papers".
Über ihre persönlichen Erfahgrungen als Ghostwriter im Auftrag der Pharma-Industrie berichtet auch die Fachjournalistin Karen Dente in einem Aufsatz in der ZEIT. Dort heißt es: "In den meisten Ländern der Welt, darunter Deutschland, ist es verboten, mit Arzneimitteln direkt bei Patienten zu werben. So müssen sich die Pharmafirmen an die Ärzte wenden. Eine Form sind kostenlose Nachrichtenblätter, möglichst praxisnah und relevant geschrieben, um viel beschäftigte Ärzte nicht mit komplizierten Sachverhalten zu langweilen. Manche Ärzte ziehen sie den Fachjournalen mit ihren schwer verdaulichen Texten vor. Andere lesen lieber die Journale. Was viele nicht wissen: In beiden Publikationen ist eine wachsende Zahl der Berichte gekauft. Sie sind Schleichwerbung der Pharmakonzerne." Der Artikel ist hier online nachzulesen: Karen Dente: Big Pharma is watching you
Hier finden sie den sechsseitigen Aufsatz "Ghost Authorship in Industry-Initiated Randomised Trials" von Peter C. Gřtzsche, Asbjřrn Hro´ bjartsson, Helle Krogh Johansen, Mette T. Haahr, Douglas G. Altman und An-Wen Chan.
Bernard Braun, 17.1.2007
"Evidence based self care"? - Unbequeme und ernüchternde Wahrheiten zu Wirksamkeit und Nutzen
 Der 34. Health-Technology-Assessment (HTA)-Report des "Centre for Reviews and Dissemination" an der Universität York von Nerys Woolacott et al. zum Thema "Systematic Review of the Clinical Effectiveness of Self Care Support Networks in Health and Social Care" aus dem September 2006 fördert ein paar ernüchternde und unbequeme Wahrheiten zu Tage. Bei den notwendigen und richtigen Fragen nach der wissenschaftlichen Evidenz bzw. dem nachgewiesenen gesundheitlichen Nutzen der medizinischen und anderen professionellen Angebote wird allzu leicht und fast automatisch angenommen, "alternative" oder Selbsthilfe-Aktivitäten und Unterstützungssysteme seien nicht nur humaner und sozialer, sondern auch per se nützlich und wirksam. Die dort aktiven Patienten sind auch häufig mit ihrer Selbsthilfegruppe zufrieden und fühlen sich gesünder. Trotzdem müssen sich auch diese Unterstützungsformen und -netzwerke auf den Prüfstand für "evidence based self care" stellen lassen.
Der 34. Health-Technology-Assessment (HTA)-Report des "Centre for Reviews and Dissemination" an der Universität York von Nerys Woolacott et al. zum Thema "Systematic Review of the Clinical Effectiveness of Self Care Support Networks in Health and Social Care" aus dem September 2006 fördert ein paar ernüchternde und unbequeme Wahrheiten zu Tage. Bei den notwendigen und richtigen Fragen nach der wissenschaftlichen Evidenz bzw. dem nachgewiesenen gesundheitlichen Nutzen der medizinischen und anderen professionellen Angebote wird allzu leicht und fast automatisch angenommen, "alternative" oder Selbsthilfe-Aktivitäten und Unterstützungssysteme seien nicht nur humaner und sozialer, sondern auch per se nützlich und wirksam. Die dort aktiven Patienten sind auch häufig mit ihrer Selbsthilfegruppe zufrieden und fühlen sich gesünder. Trotzdem müssen sich auch diese Unterstützungsformen und -netzwerke auf den Prüfstand für "evidence based self care" stellen lassen.
Der vorliegende über 300 Seiten umfassende Reviewband wertet die Ergebnisse wissenschaftlicher Studien über Unterstützungsnetzwerke und Gruppen aus, die sich mit begrenztem Einsatz von Gesundheits-Professionals nicht nur mit Gesundheitserziehung oder Training, sondern auch mit praktischen Hilfen und Ratschlägen befassen. Selbsthilfegruppen von Abhängigen oder reine Internet-Gruppen wurden nicht berücksichtigt. Der Review beschränkte sich außerdem auf prospektive Längsschnittstudien mit wenigstens 10 Teilnehmern pro Gruppe und einem Minimum von drei Monaten Nachlaufzeit nach der Teilnahme an einem "self care"-Programm.
Nach Anwendung aller genannten und einiger weiterer Kriterien blieben von den anfangs 48.000 Hinweisen auf möglicherweise themenrelevante Studien mit Schwerpunkt in den angelsächsischen Ländern 46 Studien übrig, von denen 23 in den USA und lediglich eine in Großbritannien durchgeführt wurden. Die Mehrheit der Studien (29 von 46) beinhalteten Interventionen und Programme, die von Gruppenmitgliedern, also Betroffenen, geleitet wurden. Professionals spielten lediglich eine nebensächliche Rolle. Wechselseitige Hilfe war daher auch am verbreitetsten. 32 der 46 Studien erfolgten im übrigen in Selbsthilfe-Unterstützungsnetzwerken, die von den Forschern in Gang gebracht worden waren.
Die Wirksamkeitsergebnisse sehen alles in allem so aus:
• Abnehmprogramme, die von Gruppenmitgliedern geleitet werden, führen zu einem statistisch signifikanten, aber klinisch bescheidenen Gewichtsverlust, haben also eine gewisse wissenschaftliche Evidenz. Für Unterschiede an Wirksamkeit zwischen von Laien oder Experten geleiteten Programmen gibt es keine klare Evidenz.
• Selbsthilfeunterstützung für Hilfeleistende oder Verwandte von Kranken hat nur bei Personen einen klaren Nutzen ("could clearly demonstrate beneficial effects"), die sich um schizophrene und demente Menschen oder Patienten kümmern.
• Bei Menschen mit anderen Erkrankunge wie z.B. Diabetes, Arthritis, Bulimie oder Depression gibt es einige ("some") Evidenz für nützliche Wirkungen.
• Für die Wirkung von Interventionen zur Veränderung des Lebenswandels, der Psoriasis und zur Erholung nach einem schweren Herzereignis liefern einige Studien eine eher schwache Evidenz ("some weak evidence").
• Ganz allgemein mangelt es an Evidenz ("lack of evidence") für einen nützlichen Effekt der Selbsthilfeunterstützung für Patienten mit schweren chronischen Schmerzen, Epilepsie, Verletzungen und Problemen mit der geistigen Gesundheit.
• Vielen Aussagen mangelt es letztlich an Aussagefähigkeit, weil die ihnen zugrundeliegenden Studien methodische und inhaltliche Mängel haben, die das Vertrauen in ihre Qualität unterminieren.
Entsprechend fallen die "conclusions" der ReviewerInnen aus: "Overall the evidence for a beneficial effect of self care support networks as a generic intervention is very weak. The more reliable findings from comparisons with control in the better quality studies suggest that some self care support networks in certain settings can be beneficial. However, as these studies comprised a trial of Weight Watchers, three trials of carers in Hong Kong and one of a TB Club in Ethopia, the generalisability of the findings to the UK healthcare environment can at best be limited".
Derartige Probleme der Verallgemeinerbarkeit gibt es sicherlich auch für Deutschland.
Hier finden Sie den 311 Seiten langen und sehr materialreichen HTA-Bericht "Systematic Review of the Clinical Effectiveness of Self Care Support Networks in Health and Social Care" im PDF-Format.
Bernard Braun, 11.1.2007
Unter-, Über- und Fehlversorgung in Deutschland: Immer noch aktuell - Das Jahresgutachten 2000/2001 des Sachverständigenrates für Gesundheit
 In Deutschland hat sich der "Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen" in seinem Jahresgutachten 2000/2001 zum ersten und bisher auch zum letzten Mal umfassend mit der Existenz und dem Umfang von Über-, Unter- und Fehlversorgung in der gesundheitlichen Versorgung befasst.
In Deutschland hat sich der "Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen" in seinem Jahresgutachten 2000/2001 zum ersten und bisher auch zum letzten Mal umfassend mit der Existenz und dem Umfang von Über-, Unter- und Fehlversorgung in der gesundheitlichen Versorgung befasst.
Seine zuerst in einer 616-seitigen Bundestagsdrucksache (Nr. 14/6871) veröffentlichten Ergebnisse beruhen im Kern auf einer Befragung "der Nutzer, der Finanzierer, der Leistungserbringer, der wissenschaftlichen Fachgesellschaften und der Körperschaften mit gesetzlichen Bedarfsplanungsaufträgen (Länder und Kassenärztliche Vereinigungen in Verbindung mit den Krankenkassen) durchzuführen. Die Befragung diente somit einer ersten Bestandsaufnahme der gesundheitlichen Versorgungssituation in Deutschland aus der Sicht unterschiedlicher Akteure und unter weitestgehendem Einbezug wissenschaftlich-medizinischen Sachverstandes."
Quantitativ sah die Beteiligung folgendermaßen aus: "Von den in die Befragungsaktion einbezogenen 300 Organisationen haben 201 Organisationen . teilweise auch gemeinsam . eine Stellungnahme abgegeben, 16 Organisationen sagten ab und 83 Organisationen haben nicht geantwortet. Damit ergibt sich eine Rücklaufquote von 67 %, die jedoch zwischen den einzelnen Adressatengruppen variiert".
Der Fragestellung und Klassifizierung der erhobenen Versorgungsindikatoren lagen folgende Definitionen von Unter-, Über- und Fehlversorgung zugrunde:
• "Die teilweise oder gänzliche Verweigerung einer Versorgung trotz individuellen, professionell, wissenschaftlich und gesellschaftlich anerkannten Bedarfs, obwohl an sich Leistungen mit hinreichend gesichertem Netto-Nutzen und . bei medizinisch gleichwertigen Leistungsalternativen in effizienter Form, also i. e. S. wirtschaftlich, zur Verfügung stehen, ist eine Unterversorgung.
• Eine Versorgung über die Bedarfsdeckung hinaus ist Überversorgung, d. h. eine Versorgung mit nicht indizierten Leistungen, oder mit Leistungen ohne hinreichend gesicherten Netto-Nutzen (medizinische Überversorgung) oder mit Leistungen mit nur geringem Nutzen, der die Kosten nicht mehr rechtfertigt, oder in ineffizienter, also unwirtschaftlicher Form erbracht werden (ökonomische Überversorgung).
• Fehlversorgung ist jede Versorgung, durch die ein vermeidbarer Schaden entsteht. Folgende Unterfälle lassen sich unterscheiden: Versorgung mit Leistungen, die an sich bedarfsgerecht sind, die aber durch ihre nicht fachgerechte Erbringung einen vermeidbaren Schaden bewirken; Versorgung mit nicht bedarfsgerechten Leistungen, die zu einem vermeidbaren Schaden führen; unterlassene oder nicht rechtzeitige Durchführung an sich bedarfsgerechter, indizierter Leistungen im Rahmen einer Behandlung."
Die Schwerpunkte von Erhebungen und Gutachten lagen in den Bereichen Versorgung chronisch Kranker, ischämische Herzerkrankungen, Zerebrovaskuläre Erkrankungen (insbesondere Schlaganfall), chronisch-obstruktive Kungenerkrankungen, Rückenleiden, onkologische Erkrankungen, depressive Störungen sowie Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten.
Hier finden Sie den immer noch lesenswerten und an vielen Punkten unvermindert sachlich relevanten Band III des Gutachtens 2000/2001 des Sachverständigenrates für die Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen: Bedarfsgerechtigkeit und Wirtschaftlichkeit Über-, Unter- und Fehlversorgung
Bernard Braun, 11.12.2006
Studien zur Versorgungsforschung decken Mängel auf
 Die Spitzenverbände der gesetzlichen Krankenkassen haben mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung und Bundesministerium für Gesundheit vereinbart, Forschungsprojekte über einen Zeitraum von sechs Jahren zu fördern. In einer nun herausgegebenen Broschüre "Versorungsforschung werden" 21 Forschungsprojekte (13 abgeschlossene aus der ersten und acht laufende aus der zweiten Phase) kurz vorgestellt, ihre Ergebnisse bilanziert und Schlussfolgerungen für Arztpraxen und Kliniken aufgezeigt.
Die Spitzenverbände der gesetzlichen Krankenkassen haben mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung und Bundesministerium für Gesundheit vereinbart, Forschungsprojekte über einen Zeitraum von sechs Jahren zu fördern. In einer nun herausgegebenen Broschüre "Versorungsforschung werden" 21 Forschungsprojekte (13 abgeschlossene aus der ersten und acht laufende aus der zweiten Phase) kurz vorgestellt, ihre Ergebnisse bilanziert und Schlussfolgerungen für Arztpraxen und Kliniken aufgezeigt.
Die in der Broschüre mit Fragestellung, Ergebnissen, Praxisanregungen und Ansprechpartnern vorgestellten Projekte waren drei thematischen Schwerpunkten zugeordnet: Patienten mit starker Inanspruchnahme des Versorgungssystems, Versorgungsverläufe bei multimorbiden älteren Menschen und Behandlungsvariationen in Deutschland.
Einige Projekte:
• Muster der Inanspruchnahme gesundheitlicher Versorgung von Personen mit psychosomatischen Erkrankungen
• Inanspruchnahme des Versorgungssystems durch Patienten mit unklaren körperlichen Beschwerden
• Bestimmung und Quantifizierung nichtmorbiditäts-induzierter Ursachen für Unterschiede bei der Inanspruchnahme des Versorgungssystems
• Analyse individueller und systembedingter Determinanten überdurchschnittlicher Inanspruchnahme psychiatrischer Versorgungsleistungen
• Entwicklung eines Screening- Instruments zur Identifikation von High Utilizern unter schizophrenen Patienten
• Alte Frauen und Männer mit starker Inanspruchnahme des Gesundheitswesens
• Unterschiede in der Inanspruchnahme klinischer Notfallambulanzen durch deutsche Patienten und Migranten
• Problembeschreibung, Ursachenanalyse, Lösung Identifizierung und Charakterisierung von Kindern und Jugendlichen mit starker Inanspruchnahme des Gesundheitssystems (high utilizer) im Land Berlin
• Pharmakotherapie im Alter: Konsistenz der Medikation bei Wechsel der Versorgungseinrichtungen
• Untersuchungen zur Inanspruchnahme ambulanter und stationärer Krankenhausleistungen durch Alten- und Pflegeheimbewohner
• Sektorenübergreifende Evaluation der Versorgungsqualität bei der Behandlung der Schenkelhalsfraktur.
In den Projektberichten werden nicht unerhebliche Mängel in der medizinischen Versoregung deutlich. So zeigte sich z.B. im Projekt "Pharmakotherapie im Alter: Konsistenz der Medikation bei Wechsel
der Versorgungseinrichtungen", dass chronisch kranke alte Patienten zum Zeitpunkt der Entlassung aus dem Krankenhaus durchschnittlich sechs bis sieben Medikamente erhielten. Zwar wird dies als "überwiegend angemessen" bewertet, es zeigen sich jedoch auch Defizite: "Pharmakologisch unzureichend war die Statintherapie, die Blutdruckeinstellung, die Gerinnungseinstellung und die Diabeteseinstellung."
Im Projekt "Inanspruchnahme des Versorgungssystems durch Patienten mit unklaren körperlichen Beschwerden" zeigte sich: "War das Arztverhalten darauf ausgerichtet, das organische Krankheitsverständnis der Patienten in ein psychosomatisches Krankheitsverständnis zu verwandeln, verminderte sich im Erfolgsfall in der Folgezeit die Inanspruchnahme ärztlicher Behandlung durch die Patienten."
Download der Broschüre (32 Seiten): Versorgungsforschung - Ergebnisse der gemeinsamen Förderung durch das BMBF und die Spitzenverbände der gesetzlichen Krankenkassen
Gerd Marstedt, 3.11.2006
Kanada: Teure Diagnoseverfahren werden Oberschicht-Patienten häufiger verordnet
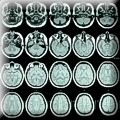 Eine Analyse von über 300.000 medizinischen Diagnose-Leistungen im kanadischen Winnipeg hat jetzt gezeigt: Bei Oberschicht-Angehörigen werden sehr viel häufer teure Diagnoseverfahren wie Computertomographie (CT) und Kernspintomographie (MRI) durchgeführt im Vergleich zu Unterschicht-Patienten (mit niedrigerem Einkommen und Bildungsniveau). Diese müssen sich oftmals mit eher "billigen" Verfahren begnügen. Berücksichtigt wurde dabei sowohl das Alter der Patienten als auch deren Morbidität (Gesundheitszustand).
Eine Analyse von über 300.000 medizinischen Diagnose-Leistungen im kanadischen Winnipeg hat jetzt gezeigt: Bei Oberschicht-Angehörigen werden sehr viel häufer teure Diagnoseverfahren wie Computertomographie (CT) und Kernspintomographie (MRI) durchgeführt im Vergleich zu Unterschicht-Patienten (mit niedrigerem Einkommen und Bildungsniveau). Diese müssen sich oftmals mit eher "billigen" Verfahren begnügen. Berücksichtigt wurde dabei sowohl das Alter der Patienten als auch deren Morbidität (Gesundheitszustand).
Bei insgesamt 21 von 36 Paarvergleichen (relative Häufigkeit der Anwendung von radiologischen Verfahren, Kernspintomographie, Computertomographie, Ultraschall u.a.) zeigten sich statistisch signifikante Unterschiede zwischen Oberschicht- und Unterschichtangehörigen mit jeweils vergleichbarem Gesundheitszustand und in derselben Altersgruppe. Diese Quote lag in acht Fällen sogar über dem Wert 2, was bedeutet, dass Angehörige der oberen Einkommensgruppen mehr als doppelt so häufig mit dem jeweiligen Verfahren untersucht wurden. Gerade bei schwer erkrankten Patienten fielen die Unterschiede am höchsten aus.
Ob die Ergebnisse der Studie übertragbar sind, wird von den Autoren (Sandor Demeter u.a., Winnipeg Regional Health Authority, Winnipeg) offen gelassen, in der Analyse wurden nur Daten aus Winnipeg, Hauptstadt der kanadischen Provinz Manitoba, aus dem Jahr 2002 verwendet.
In einem Interview mit Forum Gesundheitspolitik äußerte sich Dr. Sandor Demeter vom Health Sciences Centre in Winnipeg, Hauptautor der Studie, zu einigen Fragen:
Forum Gesundheitspolitik: Soweit man sehen kann, sind es keine finanziellen Anreize oder Zuverdienste, die das Verhalten der Ärzte erklären könnten?
Sandor Demeter: Richtig. In Manitoba sind alle diese von uns analysierten Diagnoseverfahren öffentlich finanziert und für Patienten kostenlos. Es gibt dort keine privaten Einrichtungen, die Computer- oder Kernspintomographien durchführen könnten. Zwar gibt es in einigen kanadischen Provinzen solche Einrichtungen, aber unsere Daten kommen nur aus Manitoba.
FG: Welche Erklärungen haben Sie für die Befunde, liegt es an den Ärzten, an Forderungen der Patienten?
SD: Im Augenblick können wir nur Hypothesen aufstellen und Soziologen dazu ermuntern, weiter zu forschen. Wir vermuten unter anderem, dass Oberschicht-Angehörige auch mehr Durchblick in medizinischen Fragen haben und dementsprechend höhere Ansprüche auch an die Diagnostik. Denkbar ist auch ein Entscheidungsverhalten der Ärzte, ohne dass Patienten "Druck machen". Allerdings glaube ich persönlich nicht, dass dies etwa aus Furcht vor Entschädigungsklagen von besser informierten Patienten aus der Oberschicht geschieht. Solche Klagen gegen Ärzte sind in Kanada im Gegensatz zu den USA ausgesprochen selten.
FG: Haben Sie eine Vermutung, ob die teureren Diagnoseverfahren auch bessere medizinische Effekte zeigen oder umgekehrt: Führt die ärztliche Diagnosepraxis zu schlechteren Therapiechancen für Unterschicht-Angehörige?
SD: Es ist ja hinlänglich bekannt, dass Morbidität [Erkrankungen und Gesundheitsbeschwerden] und Mortalität in Unterschichten schlechtere Werte zeigen. Mehr und aufwändigere Diagnoseverfahren bedeuten jedoch noch nicht, dass dies zu einem besseren Gesundheitszustand führt. Tatsächlich könnte ja die höhere Diagnosequote in Oberschichten auch zu mehr Falsch-Positiv-Befunden führen, Ergebnissen, die eine Erkrankung andeuten, ohne dass dies auch stimmt. Und solche Befunde wiederum könnte dann eine Kaskade weiterer Diagnostik in Gang setzen, wobei auch sehr invasive Verfahren mit hohen Gesundheitsrisiken Verwendung finden. Die Zusammenhänge hier sind wirklich sehr komplex. Von Einfluss sind da Faktoren wie: Wann geht ein Patient mit Beschwerden zum Arzt, gibt es da Sprachbarrieren, freien Zugang zu medizinischen Einrichtungen, Möglichkeiten der Notfallbehandlung und Hausbesuche, wie lange kennt der Arzt den Patienten usw.? In Anbetracht der Vielzahl von Einflussfaktoren, die man für den Zusammenhang von Armut und Gesundheit kennt, möchte ich nicht spekulieren, ob der von uns untersuchte schichtspezifische Einsatz von Diagnoseverfahren da eine zentrale Rolle spielt.
Der Aufsatz ist hier PDF-Datei verfügbar: Socioeconomic status and the utilization of diagnostic imaging in an urban setting
Gerd Marstedt, 14.11.2005