



Home | Patienten | Gesundheitssystem | International | GKV | Prävention | Epidemiologie | Websites | Meilensteine | Impressum
Sämtliche Rubriken in
"Patienten"
Verhaltenssteuerung (Arzt, Patient), Zuzahlungen, Praxisgebühr |
Versorgungsforschung: Andere Erkrankungen |
Alle Artikel aus:
Patienten
Versorgungsforschung: Andere Erkrankungen
Rehabilitation und Vorsorge für Mütter, Väter, Kinder und pflegende Angehörige - Bedarf, Wirkungen, Reformbedarf
 Die Datenbasis für diese Studie lieferten vor Beginn der Covid-19-Pandemie eine repräsentative bundesweite Befragung von 1.330 Müttern, Vätern und pflegenden Angehörigen und eine Befragung aller 960 Beratungsstellen (Rücklauf: 346 Stellen). Unter den Bedingungen der Pandemie wurden außerdem 73 Einrichtungen aus dem Verbund des Müttergenesungswerks (Rücklauf n=48), 1.050 niedergelassene Ärztinnen und Ärzte (Rücklauf n=139), 1.650 ehemalige Patient*innen aus 55 MGW-Einrichtungen (Rücklauf n=671) und15 Expert*innen aus Politik, Wissenschaft und Beschäftigten in Einrichtungen befragt bzw. interviewt. Da das Projekt nicht verschoben werden konnte (unklar war aber auch, wann das "Ende der Pandemie" zu erwarten war und ob dies dann die Rückkehr zur vorherigen Normalität bedeuten würde), beeinflussen die Erfahrungen mit der Pandemie mit Sicherheit viele Antworten der befragten Väter und Mütter - ohne dass dieser Einfluss quantifiziert werden kann. Projektbegleitend tagte ein Begleitkreis aus Vertreter*innen der Trägerorganisationen (z.B. Caritas) der MGW-Einrichtungen und Angehörigen der Fachabteilung des BMFSFJ und war u.a. an der Erstellung von Fragebögen beteiligt.
Die Datenbasis für diese Studie lieferten vor Beginn der Covid-19-Pandemie eine repräsentative bundesweite Befragung von 1.330 Müttern, Vätern und pflegenden Angehörigen und eine Befragung aller 960 Beratungsstellen (Rücklauf: 346 Stellen). Unter den Bedingungen der Pandemie wurden außerdem 73 Einrichtungen aus dem Verbund des Müttergenesungswerks (Rücklauf n=48), 1.050 niedergelassene Ärztinnen und Ärzte (Rücklauf n=139), 1.650 ehemalige Patient*innen aus 55 MGW-Einrichtungen (Rücklauf n=671) und15 Expert*innen aus Politik, Wissenschaft und Beschäftigten in Einrichtungen befragt bzw. interviewt. Da das Projekt nicht verschoben werden konnte (unklar war aber auch, wann das "Ende der Pandemie" zu erwarten war und ob dies dann die Rückkehr zur vorherigen Normalität bedeuten würde), beeinflussen die Erfahrungen mit der Pandemie mit Sicherheit viele Antworten der befragten Väter und Mütter - ohne dass dieser Einfluss quantifiziert werden kann. Projektbegleitend tagte ein Begleitkreis aus Vertreter*innen der Trägerorganisationen (z.B. Caritas) der MGW-Einrichtungen und Angehörigen der Fachabteilung des BMFSFJ und war u.a. an der Erstellung von Fragebögen beteiligt.
Mit einer Vielzahl von Fragen, die bereits 2007 in einer ersten Studie zur Ermittlung des Bedarfs an Mutter-, Vater-Kind-Rehabilitations- und Vorsorgemaßnahmen nach §§ 24 und 41 SGB V gestellt, und für die aktuelle Studie nur noch z.B. um Fragen zu psychischen Beschwerden ergänzt wurden, wurde der Gesundheitszustand und die Belastungssituation von 1.330 Angehörigen dieser Zielgruppen als objektiver Bedarf für stationäre Rehabilitations- oder Vorsorgemaßnahmen erhoben.
Der Anteil der Personen mit Bedarf sah differenziert nach Untergruppen so aus:
• 18,9 % aller Mütter, Väter und pflegenden Angehörigen,
• 23,9 % der Frauen und 13,8 % der Männer,
• 33 % der Mütter und Väter, die Angehörige pflegen und
• 75 % der Eltern von Kindern mit einer Behinderung
hätten aufgrund ihrer gesundheitlichen und Belastungssituation eine Rehabilitations- oder Vorsorgemaßnahme benötigt.
Trotzdem überlegten sich nur 21,9 % dieser Personen, eine stationäre Maßnahme jedweder Art zu beantragen.
Zu den Gründen zählt weniger die Unkenntnis des Angebots (62,5 % gaben an, es zu kennen), sondern z.B. die im Vergleich mit "richtig Kranken" Unterschätzung des eigenen Bedarfs, Nachteile am Arbeitsplatz, die Scheu Pflegebedürftige während der Inanspruchnahme einer eigenen Maßnahme nicht in "fremde Hände" zu übergeben oder nicht den/die, Partner(in) allein zu lassen.
Weitere wichtige Ergebnisse der Studie lauten:
• 51 % der ehemaligen Patient*innen nutzten vor einer Maßnahme eine Beratungsstelle und 92 % von ihnen bewerteten deren Beratungsleistung mit gut/sehr gut
• rund 20 % der für eine Vorsorgemaßnahme zugewiesenen Patient*innen erwiesen sich nach der Eingangsuntersuchung in der Einrichtung als eine Person mit Rehabilitationsbedarf.
• Zu dem für die Nachhaltigkeit der Maßnahmewirkungen wichtigen Erhalt von Hinweisen über Nachsorgeangebote (schon seit längerem mit dem Begriff der "therapeutischen Kette" thematisiert) und ihrer Nutzung im Alltag nach der Maßnahme, gibt es u.v.a. folgende Ergebnisse: In ihrer Wahrnehmung erhielt die Mehrheit der zum Maßnahmezeitpunkt mehrheitlich schwer kranken und vielfach belasteten Patient*innen keine systematischen und breiten Hinweise auf gesundheits- und belastungsbezogene Nachsorgeangebote. Bei Gesundheitsangebote (z.B. Ernährung, Bewegung) sah dies etwas besser, bei Angeboten zur Bewältigung von erneuten Belastungen (z.B. Kindererziehung, Geschlechterrollen) etwas schlechter aus. Sofern solche Angebote überhaupt bekannt waren, wurden sie bis zum Zeitpunkt der Befragung nur gering bis sehr gering genutzt. Ein Teil der Befragten wollten sie aber später nutzen. Auch wenn es schon zahlreiche Hinweise auf Gründe der Nicht- oder Nochnichtnutzung gibt (z.B. Zeitmangel, keine Kinderbetreuungsmöglichkeit und die Nichtexistenz von Angeboten vor Ort) sollte das gesamte Nachsorgegeschehen noch gründlicher untersucht werden. Dies ist insbesondere deshalb notwendig, weil die Nutzung diverser Nachsorgeangebote statistisch signifikante positive Effekte auf den Gesundheits- und Belastungszustand der ehemaligen Patient*innen hat.
• Die Wirkungen der Maßnahmen sahen aus Sicht der ehemaligen Patient*innen so aus: Es gibt eine deutliche Verbesserung des Gesundheits- und Belastungszustands am Ende der Maßnahme (vor Maßnahme: Gesundheit mangelhaft/schlecht=71 % und Belastungssituation sehr/eher belastet=95 %; am Ende der Maßnahme: 6 %; 27 %). Zum Befragungszeitpunkt, also rund 6 Monate nach Beendigung der Maßnahme finden sich aber deutliche Reboundeffekte (Gesundheit mangelhaft/schlecht : 18 %; Belastungssituation sehr/eher belastet: 52 %).
• Zu den versorgungspolitischen Schlussfolgerungen der Studie gehören u.a. die angesichts des Bedarfs (evtl. noch verstärkt durch die Langfristauswirkungen der Pandemie) notwendige Ausweitung der Kapazitäten für Rehabilitations- und Vorsorgemaßnahmen für Mütter, Väter und pflegende Angehörige, die Organisation und Vergütung von Beratungsleistungen vor und nach der Maßnahme als Leistungsbestandteil, die systematische Vorbereitung aller Beteiligten auf neue Zielgruppen, die Verbesserung der spezifischen Informationen für Angehörige der neuen Zielgruppen (Väter und pflegende Angehörige), die Qualifizierung der Beratungsstellen für neue Zielgruppen, Ausbau der Kooperation in multiprofessionellen Teams, die bessere Berücksichtigung der Spezifika von Mütter/Väter/pflegende Angehörigen-Maßnahmen im QS Reha®-Verfahren, die deutliche Verbesserung der Nachsorgeangebote als Bedingung für Nachhaltigkeit: Nachsorgeberatung Pflichtleistung, Evaluation der Nicht-Inanspruchnahme und Modellversuche und der verstärkte Auf- und Ausbau interministerieller Verantwortung und Kooperation zwischen dem Bundesministerium für Gesundheit (BMG) und dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ).
Der Endbericht der im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend erstellten Studie zur Untersuchung der Bedarfe von Müttern/Vätern und pflegenden Frauen und Männern (mit und ohne Kinder im Haushalt) in Vorsorge- und Reha-Maßnahmen in Einrichtungen des Müttergenesungswerkes verfasst von Jörn Sommer, Bernard Braun und Stefan Meyer, ist komplett und kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 8.7.21
Schlaganfallpatient*innen in Covid-19-Zeiten: 39% Rückgang! Ursachen unklar, aber Covid-19-Kollateralschaden nicht auszuschließen.
 Seit einigen Wochen melden einzelne Krankenhäuser in Deutschland und Europa einen Rückgang von Notfall-Patient*innen mit - so die Einschätzung - leichten bis mittelschweren Schlaganfallsymptomen bzw. Erkrankungen und vermuten Zusammenhänge mit der aktuellen Covid-19-Pandemie. Schlaganfälle sind eine ernste und stationär zu behandelnde Erkrankung und eine verzögerte oder nicht erfolgende Behandlung kann zu langfristigen schweren Schäden und Schwerstbehinderung oder gar zum Tod führen. Umso wichtiger ist, den beobachteten Rückgang genauer zu quantifizieren und die Ursachen zu identifizieren.
Seit einigen Wochen melden einzelne Krankenhäuser in Deutschland und Europa einen Rückgang von Notfall-Patient*innen mit - so die Einschätzung - leichten bis mittelschweren Schlaganfallsymptomen bzw. Erkrankungen und vermuten Zusammenhänge mit der aktuellen Covid-19-Pandemie. Schlaganfälle sind eine ernste und stationär zu behandelnde Erkrankung und eine verzögerte oder nicht erfolgende Behandlung kann zu langfristigen schweren Schäden und Schwerstbehinderung oder gar zum Tod führen. Umso wichtiger ist, den beobachteten Rückgang genauer zu quantifizieren und die Ursachen zu identifizieren.
Dies hat nun eine Gruppe US-amerikanischer Gesundheitsforscher*innen und Krankenhausärzt*innen versucht und die Ergebnisse am 8. Mai 2020 in der Fachzeitschrift "New England Journal of Medicine (NEJM)" veröffentlicht.
Dazu untersuchten sie wie oft eine Software (RAPID) bei mit Schlaganfallsymptomatik eingelieferten Patient*innen eingesetzt wird, d.h. anhand von Gehirn-Scans die Art des Schlaganfalls und seine wirksamste Behandlung bestimmt wird. In die Untersuchung gingen die Daten von 856 USA-weiten Krankenhäusern (ohne New Hampshire) mit 231.753 im Februar 2020, also vor Beginn der Covid-19-Pandemie und in der Zeit vom 26. März und 8.April 2020 untersuchten Patient*innen ein.
Während vor der Pandemie die Software bei 1,18 Patient*innen pro Tag und Krankenhaus zum Einsatz kam, sank dieser Wert Ende März/Anfang April auf 0,72 RAPID-Untersuchungen pro Tag und Krankenhaus, also um 39%.
Anders als u.a. in deutschen Krankenhäusern beobachtet oder vermutet, ging die Anzahl behandelter Patient*innen in allen Altersgruppen, bei Männern wie Frauen und vor allem sowohl bei leichten wie schweren Schlaganfällen zurück. Der Rückgang erfolgte auch in allen Bundesstaaten, im ländlichen wie städtischen Bereich und auch unabhängig von regionalen Covid-19-Inzidenzen.
Zur Erklärung dieser gravierenden Kollateralschäden der Covid-19-Pandemie weist der Hauptautor der Studie auf Folgendes hin:
• "I suspect we are witnessing a combination of patients being reluctant to seek care out of fear that they might contract COVID-19, and the effects of social distancing,"
• Und: "The response of family and friends is really important when a loved one is experiencing stroke symptoms. Oftentimes, the patients themselves are not in a position to call 911, but family and friends recognize the stroke symptoms and make the call. In an era when we are all isolating at home, it may be that patients who have strokes aren't discovered quickly enough."
Zwar schwer denkbar, aber auch nicht ausschließbar ist, dass es sich bei einem Teil der Schlaganfallfälle in der Vor-Pandemiezeit um Über- oder Fehlversorgung handelte, bei der Symptome wie partielle Lähmungen oder Verwirrung automatisch aber fälschlicherweise für Schlaganfallsymptome gehalten wurden.
Eine spontane Abnahme des Risikos, einen Schlaganfall zu erleiden, schließen die Forscher*innen allerdings definitiv aus.
Ähnlich differenzierte Ergebnisse für Deutschland gibt es bisher nicht. Die eingangs zitierten Beobachtungen lassen aber vermuten, dass es auch in Deutschland ähnliche Entwicklungen gibt.
Der 2 Seiten umfassende Forschungsbrief Collateral Effect of Covid-19 on Stroke Evaluation in the United States von Akash P. Kansagra, Manu S. Goyal, Scott Hamilton und Gregory W. Albers und ein 12-seitiger Tabellenanhang sind in der Zeitschrift NEJM erschienen und beide komplett und kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 13.5.20
Internationale Studie: Sommerliche Temperaturen werden COVID-19 nicht verringern, Public Health-Maßnahmen dagegen schon.
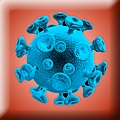 Wer vielleicht doch noch auf steigende Temperaturen oder darauf gehofft hat, dass geographisch südlichere Breitengrade die Verbreitung von COVID-19 natürlich bremsen würde, muss diese Hoffnung aufgeben und stattdessen über andere, vor allem Public Health-Methoden nachdenken.
Wer vielleicht doch noch auf steigende Temperaturen oder darauf gehofft hat, dass geographisch südlichere Breitengrade die Verbreitung von COVID-19 natürlich bremsen würde, muss diese Hoffnung aufgeben und stattdessen über andere, vor allem Public Health-Methoden nachdenken.
Zu diesem Schluss kommt eine gerade im Fachjournal "Canadian Medical Association Journal (CMAJ)" veröffentlichte Studie kanadischer Wissenschaftler. Diese hatten die Entwicklung der COVID-19-Infektionen (insgesamt 375.609), die dagegen gerichteten Maßnahmen und die jeweiligen klimatischen Bedingungen in 144 geopolitischen Räumen in Australien, Kanada und den USA und in anderen Teilen der Erde für den März 2020 zusammengeführt und auf Zusammenhänge untersucht. China, Südkorea, Iran und Italien wurden wegen ihrer Sonderbedingungen nicht berücksichtigt. Die möglichen Einflussfaktoren waren der Breitengrad, die Temperaturen, Luftfeuchtigkeit, Schulschließungen, Einschränkungen von Großveranstaltungen und soziale bzw. physikalische Distanzierung.
Die Ergebnisse:
• Zwischen dem geographischen Breitengrad, der Lufttemperatur und der Entwicklung von COVID-.19 gibt es keine oder nur eine sehr kleine Assoziation.
• Eine schwache Assoziation gibt es zwischen der Luftfeuchtigkeit und COVID-19.
• Richtig einflussreich und wirksam waren dagegen die Public Health-Maßnahmen.
Die Autoren weisen aber auch auf zahlreiche Limitationen derartiger internationaler Vergleiche hin. Dazu gehören je nach Land andere Testpraktiken, die Schwierigkeiten bei der Messung der COVID-19-Prävalenz und die unterschiedliche Compliance mit sozialer Distanzierung.
Und dass beim Umgang mit COVID-19 nicht nur einzelne Messwerte und Maßnahmen zu beachten sind und dies ihn weltweit aufwändig macht, fassen die Autoren so zusammen: "When deciding how to lift restrictions, governments and public health authorities should carefully weigh the impact of these measures against potential economic and mental health harms and benefits."
Die Studie Impact of climate and public health interventions on the COVID-19 pandemic: A prospective cohort study von Peter Jüni, Martina Rothenbühler, Pavlos Bobos, Kevin E. Thorpe, Bruno R. da Costa, David N. Fisman, Arthur S. Slutsky und Dionne Gesink ist am 8. Mai in der Zeitschrift CMAJ erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 12.5.20
Hilft Vitamin C Lungenentzündungen zu verhindern oder zu behandeln? Nein, "insufficient" wie bei vielen anderen Erkrankungen!
 Da Lungenentzündungen auch ohne Coronaviren zu den häufigsten und schwersten Erkrankungsarten mit Todesfolge (weltweit die fünfthäufigste Todesursache) gehören, wundert es nicht, wenn auch für ihre Prävention und Behandlung Nahrungsergänzungsmittel und Vitamine ins Spiel gebracht werden. Dazu gehört auch das Vitamin C dessen Nutzen durch mehrere Beobachtungsstudien oder Erfahrungsberichte gestützt zu werden scheint.
Da Lungenentzündungen auch ohne Coronaviren zu den häufigsten und schwersten Erkrankungsarten mit Todesfolge (weltweit die fünfthäufigste Todesursache) gehören, wundert es nicht, wenn auch für ihre Prävention und Behandlung Nahrungsergänzungsmittel und Vitamine ins Spiel gebracht werden. Dazu gehört auch das Vitamin C dessen Nutzen durch mehrere Beobachtungsstudien oder Erfahrungsberichte gestützt zu werden scheint.
Ob es sich dabei ebenfalls um Effekte dieser ohne Randomisierung und ohne Kontrollgruppen durchgeführten und damit systematisch verzerrten und Fehlschlüsse begünstigende Art von "Studien" handelt, untersucht nun ein am 27. April 2020 veröffentlichter "Cochrane Systematic Review".
Dazu wurden gemäß den hohen methodischen Cochranestandards 5 randomisierte kontrollierte Studien (RCT) und 2 quasi-RCTS mit insgesamt 2.774 Teilnehmer*innen untersucht, die in Großbritannien, den USA und Chile aber auch in Bangladesh und Pakistan durchgeführt wurden.
Da einer der oft gehörten Einwände gegen die Ergebnisse vergleichbarer Studien die zu geringe Menge der Vitamingaben oder die Gabe nur einer Menge war, ist bemerkenswert, dass sowohl wenn es um die präventiven als auch die kurativen Wirkungen ging, unterschiedliche Dosen für längere Zeit verabreicht wurden.
Die wichtigsten, für Studien über therapeutische Wirkungen von Vitaminen und Nahrungsergänzungsmitteln typische Ergebnisse lauten:
• Vier der sieben Studien waren von Pharmafirmen bezahlt worden und die drei anderen Studien machten keine Angaben zu ihrer Finanzierung.
• "We judged the included studies to be at overall high or unclear risk of bias. We rated the quality of the evidence as very low due to study limitations, variations amongst the studies, small sample sizes and uncertainty of estimates."
• Detailliert: "Evidence was insufficient to determine the effect of vitamin C for preventing pneumonia." Und: "Evidence was insufficient to determine the effect of vitamin C for treating pneumonia."
• Positiv: Keine Anzeichen von unerwünschten Effekten. Und sicherlich wirkt sich Vitamin C und dann auch noch in natürlicher Form in vielerlei anderer Hinsicht positiv auf das Wohlbefinden und die Gesundheit aus - nur nicht auf Lungenentzündungen.
Der 44-seitige systematische Cochrane-Review Vitamin C supplementation for prevention and treatment of pneumonia. - Intervention von Zahra Ali Padhani et al. ist am 27. April 2020 erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 5.5.20
Mangelnde Lese- und Schreibfähigkeiten und Demenz: Ein Zusammenhang, der oft vergessen wird!
 Auch wenn die "Demenz-Epidemie" als ständig steigendes individuelles Risiko, dement zu werden ins Reich der Mythen gehört, ist eine drängende Frage für die trotzdem große Anzahl von Demenzkranken, ob und wodurch die Erkrankung zu vermeiden ist.
Auch wenn die "Demenz-Epidemie" als ständig steigendes individuelles Risiko, dement zu werden ins Reich der Mythen gehört, ist eine drängende Frage für die trotzdem große Anzahl von Demenzkranken, ob und wodurch die Erkrankung zu vermeiden ist.
Eine am 13. November 2019 erschienene Studie weist nun darauf hin, dass Menschen die nicht oder nicht richtig lesen und schreiben können, ein dreimal so hohes Risiko haben dement zu werden wie eine nach anderen sozialen Merkmalen vergleichbare Gruppe von voll alphabetisierten Personen.
Dies ist das Ergebnis einer über vierjährigen Untersuchung der Inzidenz und Prävalenz von Demenz in einer Gruppe von insgesamt 983 erwachsenen Personen größer/gleich 65 Jahre alt, Durchschnittsalter 77 Jahre, kleiner/gleich 4 Jahre Schulbesuch, ein Teil der TeilnehmerInnen sind Immigranten aus Ländern mit schlechter Bildungsinfrastruktur) aus einem Stadtteil New Yorks.
Zu Beginn der Studie konnten 237 Personen nicht lesen und schreiben, 746 konnten dies. Von den 237 Analphabeten oder illiteraten Personen waren zu diesem Zeitpunkt 83 oder 35% dement, von den Nicht-Analphabeten waren dies 134 oder 18%. Nach der Adjustierung mehrerer sozialer und medizinischer Merkmale war das Demenzrisiko der illiteraten Personen nahezu dreimal höher als das der Personen, die lesen und schreiben konnten.
In den vier Folgejahren werden alle TeilnehmerInnen der Studie regelmäßig medizinisch untersucht ebenso ihre Gedächtnisleistung und ihre Fähigkeiten zu lesen und zu schreiben.
Nach den vier Jahren waren 114 der 237 Analphabeten oder 48% dement. Von den Nicht-Analphabeten waren es 134 von 746 oder 18%. Nach der erneuten Adjustierung mussten die ForscherInnen feststellen, dass das Risiko während der Studienlaufzeit dement zu werden, bei den Analphabeten immer noch doppelt so hoch war wie bei den Nicht-Analphabeten.
Einschränkend weisen die ForscherInnen u.a. darauf hin, dass die Feststellung, ob jemand lesen und schreiben gelernt hat, auf Selbsteinschätzungen beruht. Sie wünschen sich weiter, dass in künftigen Studien untersucht wird, welchen Einfluss auf die Inzidenz von Demenz verstärkte Investitionen im Schulbereich aber auch gezielt in die Erwachsenenweiterbildung haben.
Dass man den Zusammenhang von Lese- und Schreibfähigkeiten und Demenz durchaus auch anders beurteilen kann, zeigen erste Kommentare zu der Veröffentlichung der Studienergebnisse im "Deutschen Ärzteblatt" vom 15. November. Unter der Überschrift "Schöpfungsziel verfehlt" schreibt etwa ein eifriger Kommentator "Oh Gott, Affen sind dement!"
Um es nicht zu vergessen: In Deutschland besaßen 2011 7,5 Millionen Erwachsene mit Deutsch als Muttersprache (14,5% der Erwachsenenbevölkerung) keine oder nur sehr geringe Lese- und Schreibfähigkeiten bzw. waren funktionale Analphabeten. 2018 sank die Anzahl auf 6,2 Millionen (7,2% der Erwachsenenbevölkerung). Die Schulabbrecherquote und damit möglicherweise sowohl eine Ursache wie Folge von Schreib-Leseschwäche stieg von 5,7% im Jahr 2017 auf 6,3 Prozent im Jahr 2018 - unter Ausländern sogar von 14,2 auf 18,1 Prozent.
Ein nicht unbeträchtlicher Teil der Neuerkrankungen an Demenz wäre also durch gezielte und im Prinzip inhaltlich als wirksam bekannte bildungspolitische Interventionen zu vermeiden.
Die Studie Illiteracy, dementia risk, and cognitive trajectories among older adults with low education. von Miguel Arce Rentería et al. ist online vorab vor dem Druck in der Fachzeitschrift "Neurology" erschienen und das Abstract ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 16.11.19
Wie selten sind eigentlich seltene Krankheiten und wann gilt eine Krankheit als selten? Es betrifft um die 4% der Weltbevölkerung!
 Auch wenn seltene Krankheiten mit entsprechenden selten oder nie gelesenen "exotischen" Bezeichnungen seit einiger Zeit intensiver öffentlich diskutiert werden, fehlt ein Gesamtbild und wird allein wegen der vermuteten geringen Betroffenheit gar nicht versucht es zu erarbeiten.
Auch wenn seltene Krankheiten mit entsprechenden selten oder nie gelesenen "exotischen" Bezeichnungen seit einiger Zeit intensiver öffentlich diskutiert werden, fehlt ein Gesamtbild und wird allein wegen der vermuteten geringen Betroffenheit gar nicht versucht es zu erarbeiten.
Eine gerade veröffentlichte Analyse der in der speziellen Datenbank Orphanet gesammelten Daten aus weltweit erstellten Studien über 6.172 seltene Krankheiten (für 5.304 gab es Angaben zur Prävalenz), macht diesem Nichtstun und der Geringschätzung bzw. der Unterschätzung ein Ende.
Zu den wichtigsten Ergebnissen zählt:
• 71,9% sind genetischer Natur, und 69,9% treten bereits im Kindesalter auf.
• 84,5% der Krankheiten mit Prävalenzangaben hatten eine Punktprävalenz, die kleiner als 1 Fall pro 1.000.000 Personen ist - waren also wirklich selten.
• 77,3% bis 80,7% der durch seltene Krankheiten verursachten Erkrankungslast der Bevölkerung resultieren aus den 4,2% oder 149 seltenen Krankheiten, deren Prävalenz zwischen einem und fünf Fällen pro 10.000 Personen beträgt.
• An Stelle der weit verbreiteten Definition der Seltenheit von Krankheiten zwischen 5 und 80 Fällen pro 100.000 Personen orientieren sich die ForscherInnen an der europäischen Definition von weniger als 5 Fällen pro 10.000 Personen. Ausgeschlossen werden aus der Analyse seltene Krebsarten, Infektionserkrankungen und Vergiftungen.
• Die ForscherInnen gehen auf ihrer Datenbasis davon aus, dass zwischen 3,5% und 5,9% der Weltbevölkerung an seltenen Krankheiten leiden. Dies entspricht einer Anzahl von 253 bis 446 Millionen Personen.
Der 9-seitige Aufsatz Estimating cumulative point prevalence of rare diseases: analysis of the Orphanet database. von den am französischen "Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM)" forschenden Stéphanie Nguengang Wakap, Deborah M. Lambert, Annie Olry, Charlotte Rodwell, Charlotte Gueydan, Valérie Lanneau, Daniel Murphy, Yann Le Cam und Ana Rath ist am 24.10.2019 online veröffentlicht worden und wird im "European Journal of Human Genetics" erscheinen. Der Text ist als Open Access-Text komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 25.10.19
Erhalt einer leitliniengerechten Behandlung von Knie-Arthrose hängt vom Zeitpunkt und vom Facharzt ab - nur in den USA?!
 Wie die nicht seltene und daher auch bereits in Leitlinien bearbeitete Kniearthrose behandelt wird, hängt erheblich davon ab bei welchem Arzt und wann die Behandlung erfolgt. Das ist jedenfalls das Ergebnis einer im Oktober 2019 in der Fachzeitschrift "Arthritis Care & Research" Studie über die Art der Behandlung von 2.297 PatientInnen mit dieser Erkrankung in den Jahren 2007 bis 2015. Die Datenquelle war der regelmäßig durchgeführte "National Ambulatory Medical Care Survey". Dabei sollten sowohl mögliche arztspezifische Therapieunterschiede identifiziert werden als beobachtet werden, ob sich Behandlungskonzepte in Dreijahreszeiträumen - also unter dem möglichen Einfluss von Behandlungs-Leitlinien - verändert haben. An Behandlungsmaßnahmen wurde zwischen der Überweisung zu einer physikalischen Therapie, Lebensstilberatung (z.B. sportliche Übungen und Gewichtsmanagement), NSAIDs bzw. nichtsteroidale Schmerzmittel mit entzündungshemmender Wirkung und Narkotika bis hin zu Opioiden unterschieden.
Wie die nicht seltene und daher auch bereits in Leitlinien bearbeitete Kniearthrose behandelt wird, hängt erheblich davon ab bei welchem Arzt und wann die Behandlung erfolgt. Das ist jedenfalls das Ergebnis einer im Oktober 2019 in der Fachzeitschrift "Arthritis Care & Research" Studie über die Art der Behandlung von 2.297 PatientInnen mit dieser Erkrankung in den Jahren 2007 bis 2015. Die Datenquelle war der regelmäßig durchgeführte "National Ambulatory Medical Care Survey". Dabei sollten sowohl mögliche arztspezifische Therapieunterschiede identifiziert werden als beobachtet werden, ob sich Behandlungskonzepte in Dreijahreszeiträumen - also unter dem möglichen Einfluss von Behandlungs-Leitlinien - verändert haben. An Behandlungsmaßnahmen wurde zwischen der Überweisung zu einer physikalischen Therapie, Lebensstilberatung (z.B. sportliche Übungen und Gewichtsmanagement), NSAIDs bzw. nichtsteroidale Schmerzmittel mit entzündungshemmender Wirkung und Narkotika bis hin zu Opioiden unterschieden.
Die Ergebnisse sahen so aus:
• Wenn PatientInnen sich bei einem Orthopäden behandeln ließen erhielten am Anfang der Beobachtungszeit noch 158 von 1.000 eine physikalische Therapie und am Ende waren es nur noch 88 von 1.000. Und auch die Anzahl der PatientInnen, die Lebensstilempfehlungen erhielten sank von 184 pro 1.000 auf 86/1.000 PatientInnen.
• Im gleichen Zeitraum stieg die Anzahl der PatientInnen, die von Orthopäden in Übereinstimmung mit der Leitlinie NSAIDs erhielten von 132/1.000 auf 278/1.000 PatientInnen. Die Anzahl, welche nicht mit der Leitlinie übereinstimmende Narkotika oder Opioide verordnet erhielten, stieg von 77 auf 236/1.000 PatientInnen.
• Die Therapien der AllgemeinärztInnen (primary care) veränderten sich zwar auch im Beobachtungszeitraum, aber statistisch nicht signifikant. Der Anteil der PatientInnen, die physikalische Therapien verordnet bekamen stieg von 26 auf 46 pro 1.000 und der Anteil mit Lebensstilempfehlungen sank von 243 auf 221 pro 1.000 PatientInnen. Signifikant stieg dagegen die Verordnung von NSAIDs an und zwar von 221 auf 498 von 1.000 PatientInnen.
• Die Behandlungsempfehlungen waren nicht nur mit der Art des Arztes, sondern auch mit einer Reihe von nichtmedizinischen Faktoren wie z.B. der Praxistyp assoziiert.
- Insgesamt wurden PatientInnen mit einer Arthrose des Knie mit physikalischen Therapien und therapeutischen Empfehlungen für den Lebensstil zunehmend unterversorgt und mit Schmerzmittel überversorgt.
Der Hauptautor der Studie, S. Khoja, fasste das Ergebnis so zusammen: "Our major takeaway from this research is that patients might not be receiving optimum care for knee osteoarthritis. Physicians seem more focused on helping their patients manage their pain with medications, but it is also important to consider the long-term benefits of exercise for mitigating declines in physical health,…Despite being part of clinical practice guidelines, exercise-based interventions are still being prescribed at a very low rate."
Die Studie Recommendation Rates for Physical Therapy, Lifestyle Counseling and Pain Medications for Managing Knee Osteoarthritis in Ambulatory Care Settings. Cross‐sectional Analysis of the National Ambulatory Care Survey (2007‐2015) von Samannaaz S. Khoja, Gustavo J. Almeida, Janet K. Freburger wird in der Zeitschrift "Arthritis Care & Research" erscheinen. Das Abstract ist kostenlos erhältlich. Eine wahrscheinlich nicht lange erhältliche "accepted article"-Version ist auch noch kostenlos und lediglich online zu lesen.
Bernard Braun, 12.10.19
Evidenz jenseits von Medizin und Pharmazie: Häufige soziale Kontakte mit Freunden im mittleren Lebensalter senken Demenzrisiko
 Während in regelmäßigen Abständen Meldungen zu einem möglichen Arzneimittel zur Verhinderung von Demenz oder zu deren Linderung auftauchen und meist folgenlos wieder verschwinden, gibt es immer wieder ebenfalls hoffnungsverbreitende Meldungen von außerhalb der Medizin und Arzneimittelentwicklung. Ihr gemeinsamer Nenner sind bessere kognitive Fähigkeiten. Da die meisten dazu durchgeführten Beobachtungsstudien ihre UntersuchungsteilnehmerInnen nur eine relativ kurze Zeit beobachten, galten sie nicht nur als untauglich zur Gewinnung kausaler Zusammenhänge, sondern auch als problematisch zur Identifizierung so langer Prozesse wie der Entstehung von Demenz. Selbst Studienergebnisse, die zeigten, dass weniger häufige soziale Kontakte mit einem höheren Demenzrisiko assoziiert waren, konnten wegen des kurzen Untersuchungszeitraum nicht klären, ob soziale Isolation eine Konsequenz oder die Ursache von Demenz darstellt.
Während in regelmäßigen Abständen Meldungen zu einem möglichen Arzneimittel zur Verhinderung von Demenz oder zu deren Linderung auftauchen und meist folgenlos wieder verschwinden, gibt es immer wieder ebenfalls hoffnungsverbreitende Meldungen von außerhalb der Medizin und Arzneimittelentwicklung. Ihr gemeinsamer Nenner sind bessere kognitive Fähigkeiten. Da die meisten dazu durchgeführten Beobachtungsstudien ihre UntersuchungsteilnehmerInnen nur eine relativ kurze Zeit beobachten, galten sie nicht nur als untauglich zur Gewinnung kausaler Zusammenhänge, sondern auch als problematisch zur Identifizierung so langer Prozesse wie der Entstehung von Demenz. Selbst Studienergebnisse, die zeigten, dass weniger häufige soziale Kontakte mit einem höheren Demenzrisiko assoziiert waren, konnten wegen des kurzen Untersuchungszeitraum nicht klären, ob soziale Isolation eine Konsequenz oder die Ursache von Demenz darstellt.
Eine Anfang August 2019 in der Open Access-Fachzeitschrift "PLOS Medicine" veröffentlichte retrospektive Neuauswertung der so genannnten Whitehall II-Studie, einer prospektiven Kohortenstudie von 10.308 Beschäftigten im öffentlichen Dienst Londons im Zeitraum von 1985-88 (TeilnehmerInnen waren damals 35-55 Jahre alt) bis 2017, verbesserte die Erkenntnisgrundlage erheblich.
In den Untersuchungsjahren 1985 bis 2013 wurden die TeilnehmerInnen sechsmal zur Häufigkeit ihrer sozialen Kontakte mit Freunden und Verwandten befragt. Zwischen 1997 und 2017 wurden fünfmal umfangreiche Tests zu ihren kognitiven Fähigkeiten durchgeführt. Bis 2017 wurde mit Routinedaten aus der gesundheitlichen Versorgung ermittelt, ob die TeilnehmerInnen an Demenz litten.
Die wichtigsten Ergebnisse dieser Studie lauteten:
• Wer mit 60 häufige soziale Kontakte hatte, hatte im weiteren Lebensalter ein signifikant geringeres Demenzrisiko. Wer in diesem Alter Freunde praktisch jeden Tag sah, hatte ein 12% geringeres Risiko dement zu werden als jemand, der ein oder zwei Freunden alle paar Monate begegnete. Darauf, dass es sich um kausale Zusammenhänge handelt, weist hin, dass das Demenzrisiko mit jeder Erhöhung der sozialen Kontakte sank. Dieser Zusammenhang von Effektstärke und Wirkung zeigte sich auch im Alter von 50 und 70, war aber statistisch nicht signifikant.
• Die Assoziation zwischen sozialen Kontakten und der Demenz-Inzidenz wurde von Kontakten zu Freunden gefördert, nicht aber von Kontakten zu Verwandten.
• Häufige soziale Kontakte im mittleren Lebensalter waren mit einer höheren kognitiven Leistungsfähigkeit verbunden, mit deutlichen kognitiven Unterschieden zwischen Personen mit geringen und hohen sozialen Kontakten. Dieser Zusammenhang war über 14 Jahre stabil vorhanden.
• Diese Funde lassen nach Meinung der AutorInnen den Schluss zu, dass häufigere soziale Kontakte im mittleren Lebensabschnitt eine Art kognitive Reserve aufbauen, die sich präventiv auf das Demenzrisiko im weiteren Lebensverlauf auswirkt.
• Die alternative Erklärung, dass frühe kognitive Unterschiede die Fähigkeiten von Menschen, soziale Beziehungen aufzubauen, beeinflussen und so die Anfälligkeit für Demenz fördern, schließen die AutorInnen nicht aus.
• Durch die lange Beobachtungszeit konnte aber weitgehend die Möglichkeit ausgeschlossen werden, dass der Beginn des Abbaus von kognitiven Fähigkeiten dazu führte, dass Personen weniger andere Personen zu sehen bekommen.
• Zu den Beschränkungen dieser Studie gehört, dass die Kenntnisse über Demenz aus Gesundheitsdaten gewonnen wurden, die potenziell zu wenig Fälle von schwer sozial isolierten Personen enthalten, was wiederum zu einer Unterschätzung der Assoziation von sozialen Kontakten und Demenz führen könnte.
Die 18-seitige Studie Association of social contact with dementia and cognition: 28-year follow-up of the Whitehall II cohort study. von Andrew Sommerlad, Séverine Sabia, Archana Singh-Manoux, Glyn Lewis und Gill Livingston ist in "PLOS Medicine" (2019; 16 (8)) erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 5.8.19
Senken Nahrungsergänzungsmittel das Risiko kardiovaskulärer Erkrankungen/Sterblichkeit? Mit wenigen Ausnahmen nicht!!!
 Allein in diesem Forum finden sich in den letzten Jahren Hinweise auf 24 Studien überwiegend hoher methodischer Güte (Suche mit dem Begriff "Nahrungsergänzungsmittel"), die den allgemeinen und krankheitsspezifischen Nutzen vieler Nahrungsergänzungsmittel inklusive Vitamine untersucht haben. Dabei überwogen Studien, die den jeweiligen spezifischen Nutzen nicht belegen konnten.
Allein in diesem Forum finden sich in den letzten Jahren Hinweise auf 24 Studien überwiegend hoher methodischer Güte (Suche mit dem Begriff "Nahrungsergänzungsmittel"), die den allgemeinen und krankheitsspezifischen Nutzen vieler Nahrungsergänzungsmittel inklusive Vitamine untersucht haben. Dabei überwogen Studien, die den jeweiligen spezifischen Nutzen nicht belegen konnten.
Einen noch wesentlich umfassenderen Überblick liefert nun ein im Juli 2019 veröffentlichter "umbrella review and evidence map", der die Ergebnisse von 9 systematischen Reviews mit insgesamt 277 Studien, 24 Interventionsstudien mit 992.129 TeilnehmerInnen, 4 neuen randomisierten kontrollierten Studien und insgesamt auf dieser Basis 105 erstellten Metaanalysen zusammenfasst. Untersucht wurden in allen Studien die Effekte von Nahrungsergänzungsmitteln und Hinweisen zur Nahrungsaufnahme auf die Gesamtsterblichkeit und kardiovaskuläre Outcomes (z.B. Herzinfarkt, Schlaganfall) bei Erwachsenen.
Die Ergebnisse:
• Dafür, dass die geringere Aufnahme von Salz bei TeilnehmerInnen mit normalem Blutdruck das Risiko der Gesamtsterblichkeit senkt, gibt es gemäßigte Evidenz. Das gleiche gilt für die kardiovaskuläre Sterblichkeit bei Personen mit erhöhtem Blutdruck.
• Niedrige Evidenz gibt es für den positiven Zusammenhang der Einnahme von Omega-3-Fettsäuren und einem geringeren Risiko einen Herzinfarkt zu erleiden oder an einer kardiovaskulären Krankheit zu erkranken.
• Folsäre war mit einer geringen Sicherheit mit dem Risiko eines Schlaganfalls assoziiert. Kalzium plus Vitamin D war dagegen mit moderater Sicherheit mit einem höheren Schlaganfallrisiko assoziiert.
• Andere Nahrungsergänzungsmittel wie die Vitamine B6, A oder Multivitaminpräparate, Antioxidantien, eisenhaltige Nahrungsmittel und andere Ernährungsweisen wie z.B. eine reduzierte Aufnahme von Fett, hatten mit sehr geringer bis moderater Evidenz keinen statistisch signifikanten Effekt auf die Sterblichkeit oder kardiovaskuläre Outcomes.
Dies bedeutet zum einen die von Herstellern und auf medialen Ratgeberseiten für eine Reihe von Ergänzungsmitteln und Ernährungsweisen verbreiteten Hoffnungen kardiovaskulär wirksam zu sein, erheblich zu reduzieren. Zum anderen bedeutet dies aber nicht, dass es nicht sinnvoll und hilfreich ist, Vitamine (hier aber nachgewiesenermaßen am wirkungsvollsten in Natur- [Fisch oder Orangen] statt in Pillen-/Kapselform) oder andere Mittel aufzunehmen und damit die Lebensqualität oder auch die nicht-kardiovaskuläre gesundheitliche Befindlichkeit zu verbessern.
Der systematische Review Effects of Nutritional Supplements and Dietary Interventions on Cardiovascular Outcomes: An Umbrella Review and Evidence Map von Khan SU, Khan MU, Riaz H, et al. ist im Juli 2019 in der Fachzeitschrift "Annals of Internal Medicine" erschienen. Das Abstract ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 4.8.19
Erleichtern, manchmal ja! Vorbeugen oder merklich heilen, nein! Evidenz zur Wirksamkeit von Mitteln bei gewöhnlicher Erkältung
 Für kaum eine Erkrankung gibt es derartig viele unterschiedliche traditionell medizinische, alternative und Haus-Mittel wie zur Prävention und Heilung/Linderung der gewöhnlichen Erkältung. Und da diese Erkrankung eine häufige Begleiterscheinung des Winters ist, lohnt sich zu dieser Jahreszeit ein Blick hinter die Kulissen der marktschreierischen Werbung, das Vertrauen auf "die Natur" oder die Ratschläge der eigenen Oma.
Für kaum eine Erkrankung gibt es derartig viele unterschiedliche traditionell medizinische, alternative und Haus-Mittel wie zur Prävention und Heilung/Linderung der gewöhnlichen Erkältung. Und da diese Erkrankung eine häufige Begleiterscheinung des Winters ist, lohnt sich zu dieser Jahreszeit ein Blick hinter die Kulissen der marktschreierischen Werbung, das Vertrauen auf "die Natur" oder die Ratschläge der eigenen Oma.
Die besten hierfür zur Verfügung stehenden Erkenntnisquellen sind auch hier Cochrane-Reviews, die auf methodisch hochwertigem Niveau (überwiegend durch die Analyse randomisierter kontrollierter Studien) die Wirksamkeit einer Vielzahl von als hilfreich geltenden Mittel untersucht haben. Einen kurzen Überblick liefert dazu unter der Überschrift "Just pass the issues…Evidence on remedies for the common cold ein im September 2017 veröffentlichter Blog-Beitrag einer Wissenschaftlerin auf der Website von Cochrane UK.
Derartige Reviews gibt es danach u.a. zu Vitamin C, oralen Antihistaminika, Medikamenten, die das Abschwellen der Schleimhäute fördern, Schmerzmedikamenten im allgemeinen und insbesondere Paracetamol, nichtsteroidalen entzündungshemmenden Medikamente, Antihistaminika generell, Antibiotika, Mitteln die speziell das Abschwellen der Nasenschleimhäute fördern, zu Echinacea (Sonnenhut), Dampfinhalation, Knoblauch und Impfungen.
Zusammenfassend wird festgestellt: "As things stand, we are destined to continue to suffer from colds. There is as yet no effective vaccine available and no conclusively proven preventative measure that can help keep us immune. OTC antihistamine and decongestant preparations taken alone or in combination may help a little in relieving symptoms."
Wer sich noch genauer mit dem Stand der Forschung beschäftigen möchte kann einem Literaturlink folgen, der auf drei Seiten eine Menge fast durchweg verlinkter Literaturhinweise enthält.
Natürlich erhebt sich gegen die eine oder andere Feststellung auch von Cochrane-Reviews Widerspruch oder wird insbesondere für Naturheilmittel auf Wirksamkeit gepocht.
Empfehlenswert ist aber auch dann, dem in einem kurzen Kommentar zur Cochrane UK-Website gemachten Hinweis, Zink sei doch nützlich, bis zur Quelle zu folgen. Wer dies dann z.B. für oral aufgenommenes Zink macht, landet bei den "5 Tips: Natural products for the flu and colds: What does the science say" des "National Center for Complementary and Integrative Health" - einer staatlichen Einrichtung der "National Institutes of Health" der USA.
Die Bewertung von Zink fällt aber dort wesentlich differenzierter aus als es der Kommentar erwarten ließ: Oral aufgenommenes Zink verkürzt danach möglicherweise die Dauer der Erkältung, kann aber auch eine Reihe von unerwünschten Nebenwirkungen haben. Für nicht-oral aufgenommenes Zink weisen die Verfasser der Tipps sogar auf einen "severe side effect (irreversible loss of the sense of smell)" hin und meinen diese Art von Zink "should not be used".
Bestätigt wird aber auch auf dieser Seite, dass Vitamin C oder Echinacea keine nachgewiesene oder spürbare Wirkung gegen Erkältungen hat. Und ergänzend wird auf die schwache Evidenz für die Wirksamkeit von probiotischen Produkten und das geringe Wissen über deren Langzeitsicherheit hingewiesen.
Zur Wirksamkeit von Naturprodukten gegen die Virusgrippe stellt die US-Website schließlich unmissverständlich fest: "There is currently no strong scientific evidence that any natural product is useful against the flu."
Bernard Braun, 11.2.18
Wie viel Erkrankte und Tote kostete die Reduktion eines Anti-Malariaprogramms der US-Regierung um 44%?
 Bei vielen Gesundheitsprojekten ist weder bei ihrer Entwicklung und Implementation noch dann, wenn sie vor allem durch Mittelkürzungen abgebaut werden, klar, welche konkreten gesundheitlichen Auswirkungen damit zu erwarten sind.
Bei vielen Gesundheitsprojekten ist weder bei ihrer Entwicklung und Implementation noch dann, wenn sie vor allem durch Mittelkürzungen abgebaut werden, klar, welche konkreten gesundheitlichen Auswirkungen damit zu erwarten sind.
Für einen aktuellen Fall wurden die wahrscheinlichen Effekte auf die Erkrankungshäufigkeit und die Sterblichkeit in einer Modellberechnung im Department of Infectious Disease Epidemiology im Imperial College London ermittelt. Es geht um die für 2018 in der Haushaltsplanung des US-Kongress vorgeschlagene Reduktion des Budgets der so genannten "President's Malaria Initiative (PMI)" um 44%, d.h. von etwas über 700 Millionen im Jahr 2017 auf 424 Millionen US-Dollar. Das PMI existiert seit 2005, wurde also noch während der Präsidentschaft von Georg W. Bush gestartet, unterstützt Anti-Malariaprogramme in 19 afrikanischen Ländern und ist der größte bilaterale Förderer von Programmen zur Prävention und Behandlung von Malaria als einer der häufigsten schweren Krankheiten in der Dritten Welt.
Als erstes berechneten die britischen WissenschaftlerInnen, welchen positiven Nutzen der Weiterbestand des PMI auf dem bisherigen Niveau zwischen 2017 und 2020 hätte. Gegenüber dem völligen Fehlen dieses Programms könnten 162.000.000 Malaria-Erkrankungsfälle abgewendet und 692.589 Leben gerettet werden.
Die 44%-Reduktion führte im Vergleich zum Weiterbestand des bisherigen Programmvolumen im selben Zeitraum zu zurückhaltend geschätzten 67.000.000 zusätzlichen Malariafällen und zu 290.649 zusätzlichen Todesfällen.
Die Fortschritte von 15 Jahren, die selbst aus der Sicht von Ökonomen äußerst kosteneffektives erreicht werden konnten, wären nach Ansicht der AutorInnen mit der Reduktion in wenigen Jahren verschwunden. Anwachsen könnte aber dadurch die Anzahl afrikanischer BürgerInnen, die versuchen u.a. diesen Risiken durch die Flucht in Richtung Europa zu entkommen.
Die Ergebnisse der Studie The US President's Malaria Initiative, Plasmodium falciparum transmission and mortality: A modelling study. von Peter Winskill, Hannah C. Slater, Jamie T. Griffin, Azra C. Ghani, Patrick G. T. Walker sind in der Zeitschrift "PLOS Medicine" (2017; 14 (11)) erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 23.11.17
Wirkungen von "choosing wisely"-Empfehlungen geringer als erwartet
 Zu den innerprofessionellen Konzepten die Qualität der Gesundheitsversorgung durch Empfehlungen notwendiger und nachgewiesen wirksamen und Warnungen vor nicht notwendigen und unnützen diagnostischen und therapeutischen Leistungen zu verbessern, gehört "choosing wisely". Die überwiegend durch medizinische Fachgesellschaften erstellten Entscheidungslisten sind zuerst in den USA mittlerweile aber unter dem Titel "klug entscheiden" auch in Deutschland verbreitet.
Zu den innerprofessionellen Konzepten die Qualität der Gesundheitsversorgung durch Empfehlungen notwendiger und nachgewiesen wirksamen und Warnungen vor nicht notwendigen und unnützen diagnostischen und therapeutischen Leistungen zu verbessern, gehört "choosing wisely". Die überwiegend durch medizinische Fachgesellschaften erstellten Entscheidungslisten sind zuerst in den USA mittlerweile aber unter dem Titel "klug entscheiden" auch in Deutschland verbreitet.
Ob "choosing wisely" sein Ziel erreicht und in welchem Umfang, ist bisher wenig untersucht worden. Umso interessanter sind die Ergebnisse einer Studie über die Entwicklung potenzieller "low value" d.h. nicht notwendiger bildgebenden Diagnostik (z.B. Röntgen, Computertomogramm) bei Rückenschmerzen. Für diese sehr häufigen Beschwerden liefert die entsprechende "choosing wisely"-Liste sehr präzise evidenzbasierte Empfehlungen, in der Mehrzahl der Fälle zunächst oder auf Dauer auf bildgebende Diagnostik zu verzichten.
Mit Daten eines privaten US-Krankenversicherungsunternehmens verglich nun eine Gruppe us-amerikanischer Versorgungsforscher die Häufigkeit dieser "low value"Diagnostik vor und zweieinhalb Jahre nach der Entwicklung und Veröffentlichung der Empfehlungen.
Mit wenigen regionalen Unterschieden nahm die Häufigkeit nur um 4% ab. Anders als erwartet, nahm die Häufigkeit auch in so genannten "consumer-directed health plans", wo Patienten in den Worten der Forscher ihre "skin in game" haben, nicht wesentlich mehr ab.
Ob es für die Wirkung mehr Zeit verlangt und die Diffusion auch dieser Art von Behandlungsempfehlungen zusätzlicher Qualifikations- und Beratungsbemühungen bedarf, sollt in weiteren Wirkungsanalysen genauer angesprochen und überprüft werden.
Die Studie Small Decline In Low-Value Back Imaging Associated With The 'Choosing Wisely' Campaign, 2012-14 von A.S. Hong et al. ist in der Aprilausgabe 2017 der Zeitschrift "Health Affairs" (vol. 36 no. 4 671-679) erschienen. Das Abstract ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 24.4.17
Alt, älter, dement???? Neues zur altersspezifischen Inzidenz von Demenz
 Wie hoch das Risiko dement zu werden fürälterwerdende Personen ist und wie stark bei einem noch bis rund 2040 anwachsenden Anteil der Älteren an der Gesamtbevölkerung die damit verbundende soziale und finanzielle Krankheitslast zunimmt oder explodiert, gehört seit Jahren zu den Spitzenthemen der gesundheitswissenschaftlichen und -politischen Debatten und Auseinandersetzungen.
Wie hoch das Risiko dement zu werden fürälterwerdende Personen ist und wie stark bei einem noch bis rund 2040 anwachsenden Anteil der Älteren an der Gesamtbevölkerung die damit verbundende soziale und finanzielle Krankheitslast zunimmt oder explodiert, gehört seit Jahren zu den Spitzenthemen der gesundheitswissenschaftlichen und -politischen Debatten und Auseinandersetzungen.
Die Vertreter und Anhänger eher düsterer Prognosen oder Szenarien stützen sich zum einen auf die Annahme einer zumindest konstanten Häufigkeit der Neuerkrankungen (Inzidenz) an Demenz oder Alzheimer. Zum anderen folgt daraus und aus der vorübergehend wachsenden Anzahl von älteren Menschen ein mehr oder weniger dramatisch ausgemaltes und scheinbar unvermeidbares Anwachsen des Bestandes dementer Menschen (Prävalenz).
Auch wenn insbesondere die in Deutschland aktiven und wirksamen Gestalter solcher Szenarien diese für so plausibel halten, dass sie am liebsten auf jegliche empirische Überprüfung verzichten würden, werden diese und andere Annahmen in einigen europäischen und nordamerikanischen, d.h. vergleichbaren Ländern seit einiger Zeit empirisch durchleuchtet.
Ein Überblick zu den Ergebnissen einiger dieser Studien, z.B. die der Rotterdam-Studie, wurde bereits 2013 im "forum-gesundheitspolitik" gegeben: Viel Krach um die "stille Epidemie" der Demenz versus wissenschaftlicher Evidenz zu ihrer sinkenden Inzidenz und Prävalenz. Ihre Tendenzen lassen sich der Überschrift dieses Überblicks entnehmen, blieben aber entweder unbeachtet, verpassten die statistische Signifikanz und konnten als möglicherweise zufällig ignoriert werden.
Daran ändern die Ergebnisse einer Auswertung von seit 1975 für drei Jahrzehnte erhobenen Daten zum mit dem Standardtest "Mini-Mental State Examination (MMSE)" gemessenen Demenzstatus von 5.205 TeilnehmerInnen an der in den USA durchgeführten "Framingham Heart Study" im Alter von 60 und mehr Jahren sank sie einiges:
• Die für mehrere rund 10 Jahre umfassende Zeiträume ermittelte alters- und geschlechtsadjustierte kumulative Rate des Risikos an Demenz zu erkranken, belief sich zwischen 1970 und 1980 auf 3,6 Fälle pro 100 Personen. Sie fiel zwischen 1981 und 1990 auf 2,8 Fälle pro 100 Personen, weiter auf 2,2 Fälle bis zum Jahr 2000 und schließlich auf 2 Fälle im Zeitraum von 2000 bis 2010.
• Bezogen auf die Inzidenzrate im ersten Jahrzehnt sank die Rate neu aufgetretenener Demenzfälle um 22%, 38% und 44% in den drei Jahrzehnten danach.
• Diese enorme Risikoreduktion konnte allerdings nur für die Personen nachgewiesen werden, die wenigstens über einen High-School-Abschluss, also in etwa über die allgemeine Hochschulreife verfügen.
• Da im Mittelpunkt der Framingham-Studie das Interesse an Herz-Kreislauferkrankungen stand, berichten die AutorInnen der Demenz-Inzidenzstudie zusätzlich, dass die Prävalenz der meisten vaskulären Risikofaktoren (außer Diabetes und Fettsucht) sowie die Prävalenz des Schlaganfalls oder der Herzschwäche im Untersuchungszeitraum abgenommen hat. Die AutorInnen sehen zwar eine Assoziation zwischen abnehmenden vaskulären Erkrankungsrisiken und Demenz, stellen aber fest, dass die Entwicklung der Demenz-Inzidenz nicht vollständig erklärt werden kann.
• Der Schulabschluss oder Bildungsstand schützt zwar für die ForscherInnen nicht für sich genommen vor Demenz, wirkt sich aber häufig auf die soziale Lage und das Gesundheitsverhalten (z.B. Rauchen, Bewegung, Ernährung) und damit auf Faktoren aus, die mit Demenz und anderen Krankheiten assoziiert sind.
Die AutorInnen sprechen angesichts der stabilen Abnahme der altersspezifischen Demenzinzidenz zumindest für Westeuropa von einer "possible stabilization of dementia occurrence", nicht aber in Ländern, deren EinwohnerInnen noch eine kräftige Verlängerung der Lebenserwartung vor sich haben oder für ökonomisch und sozial schlechtgestellte Personen in allen Ländern.
Zusammen mit dem Hinweis, dass trotz aller Prognosewut noch viel zu wenig über zeitliche Trends von Demenz und anderen Erkrankungen sowie die Faktoren bekannt ist, die z.B. sinkende Inzidenzraten beeinflussen, kommen die AutorInnen zu folgendem differenzierten Schluss: "In conclusion, although projections suggest an exploding burden of dementia over the next four decades owing to an increasing number of older persons at risk, primary and secondary prevention might be key to diminishing the magnitude of this expected increase. Our study offers cautious hope that some cases of dementia might be preventable or at least delayed."
Von dem Aufsatz Incidence of Dementia over Three Decades in the Framingham Heart Study von Claudia L. Satizabal, Alexa S. Beiser, Vincent Chouraki, Geneviève Chêne, Carole Dufouil und Sudha Seshadri, am 11. Februar 2016 in der Fachzeitschrift "New England Journal for Medicine" (374: 523-532) eröffentlicht, gibt es kostenlos nur das Abstract.
Bernard Braun, 26.2.16
Ist die Ergebnisqualität teurer high-end-Leistungen besser oder "hilft viel, viel"? Das Beispiel der Hörgeräteversorgungsreform
 Obwohl in Deutschland seit längerem kein Jahr ohne mehr oder weniger tiefgreifende gesetzliche und vertragliche Reformen der Strukturen und Leistungen im Gesundheitswesen vergeht, mangelt es häufig an methodisch höherwertigen Untersuchungen ihrer Wirkungen oder Nutzen. Methodisch anspruchsvoller und ertragreicher sind z.B. Untersuchungen, die nicht nur Wahrnehmungen und Erfahrungen nach einer Reform messen, sondern sich darum bereits im Vorfeld einer Reform kümmern, um dann durch den Vergleich zweier Querschnittsanalysen und nicht allein durch häufig verzerrte Erinnerungen solide Erkenntnisse über Veränderungen gewinnen zu können. Zu einer praktisch relevanten Politikfolgenforschung gehört aber außerdem, dass die Wahrnehmungen, Erfahrungen und Bewertungen von Betroffenen oder Nutznießer von Reformen oder der patienten- und versichertenbezogene Nutzen die entscheidende empirische Grundlage sind.
Obwohl in Deutschland seit längerem kein Jahr ohne mehr oder weniger tiefgreifende gesetzliche und vertragliche Reformen der Strukturen und Leistungen im Gesundheitswesen vergeht, mangelt es häufig an methodisch höherwertigen Untersuchungen ihrer Wirkungen oder Nutzen. Methodisch anspruchsvoller und ertragreicher sind z.B. Untersuchungen, die nicht nur Wahrnehmungen und Erfahrungen nach einer Reform messen, sondern sich darum bereits im Vorfeld einer Reform kümmern, um dann durch den Vergleich zweier Querschnittsanalysen und nicht allein durch häufig verzerrte Erinnerungen solide Erkenntnisse über Veränderungen gewinnen zu können. Zu einer praktisch relevanten Politikfolgenforschung gehört aber außerdem, dass die Wahrnehmungen, Erfahrungen und Bewertungen von Betroffenen oder Nutznießer von Reformen oder der patienten- und versichertenbezogene Nutzen die entscheidende empirische Grundlage sind.
Dass diese Art Politikfolgenforschung inhaltlich, organisatorisch und relativ unaufwändig möglich ist, zeigen diverse in den letzten Jahren mit Routinedaten der GKV-Krankenkassen oder mit Daten aus Befragungen von Krankenkassenversicherten erstellte Surveys zu krankheitsspezifischen Behandlungen oder gruppenspezifischen Interventionen.
Ein aktuelles Beispiel ist eine auf zwei inhaltlich identische Befragungen gestützte Analyse verschiedener Folgen einer Reform der technischen Leistungen für Hörgeminderte auf die finanzielle Situation und die Hörqualität der HörgerätenutzerInnen. Zum 1. November 2013 haben die gesetzlichen Krankenkassen ihren Festbetrag für Hörhilfen deutlich erhöht. Dadurch sollten Versicherte von den zum Teil mehrere Tausend Euro betragenden Eigenanteilen finanziell entlastet und gleichzeitig die Leistungsanforderungen an die Hörgeräte deutlich erhöht werden, was sich u.a. aus der Streichung von rund 2.500 Hörgeräten aus dem GKV-Hilfsmittelverzeichnis führte, welche die höheren technischen Anforderungen nicht mehr erfüllten. Von der Hörgeräteversorgung betroffen sind jährlich rund 500.000 gesetzlich Krankenversicherte, wobei die Anzahl der Personen, die eigentlich ein Hörgerät tragen sollten deutlich größer ist, die Nachfrage aber u.a. wegen der Stigmatisierung des Tragens von Hörgeräten oftmals erst mit großen Verzögerungen erfolgt. So dauert es auch aktuell fast bei der Hälfte der Befragten 18 Monate oder länger bis sie sich nach der Wahrnehmung der Hörminderung für ein Hörgerät entscheiden.
Die Wirkungen der Leistungsreform wurden in zwei Erhebungswellen mit insgesamt 1.481 Versicherte der Bremer Handelskrankenkasse (hkk) über 18 Jahre erhoben, denen vor oder nach der Erhöhung der Festbeträge für Hörhilfen am 1. November 2013 eine Hörhilfe verordnet wurde. Die Befragung erfolgte mit einem schriftlichen Fragebogen. Der Rücklauf betrug 77,8 Prozent (Welle 1) und 51,4 Prozent (Welle 2).
Die wesentlichen Ergebnisse der von dem Gesundheitswissenschaftler Dr. Bernard Braun vom Zentrum für Sozialpolitik der Universität Bremen durchgeführten Studie lauten:
• Versicherte zahlen weiterhin hohe Eigenanteile für Hörgeräte: Auch wenn der Anteil der Befragten, die einen Eigenanteil leisten, von 80,6 auf 74,1 Prozent nach der Festbetragserhöhung gesunken ist, zahlen weiterhin knapp 40 Prozent der überwiegend Rente beziehenden HörgerätenutzerInnen einen Eigenanteil von 500 bis 2.000 Euro. Lediglich im hochpreisigen Segment mit Eigenanteilen über 2.000 Euro ist der Anteil deutlich von 25,5 Prozent auf 13,7 Prozent gesunken. Obwohl sich die Ausgaben der GKV für Hörgeräte seit Erhöhung der Festbeträge erwartungsgemäß und zwar um 60% erhöht haben, tragen Hörgeräteempfänger immer noch beträchtliche Eigenanteilslasten.
• Teuer ist nicht besser oder "viel muss nicht viel bringen": Die oft bei gesundheitsbezogenen Leistungen mit hohen Preisen und damit auch mit dieser Reform verknüpfte Erwartung an eine bessere Erlebnisqualität bestätigt sich in der Befragung für Höregeräte bis auf winzige Ausnahmen nicht. Die durch zahlreiche erprobte Indikatoren für verschiedenste Hörsituationen gemessene subjektiv wahrgenommene Hörqualität unterscheidet sich weder zwischen den beiden Wellen noch zwischen Eigenanteilszahlern und -nichtzahlern signifikant.
• Diskrepanz zwischen Leistungsversprechen und Nutzen: Rund 80 Prozent der Befragten bewerten zwar den durch ein Hörgerät realisierten Nutzen für Gespräche mit einzelnen Personen oder vor dem heimischen Fernsehgerät uneingeschränkt positiv. Aber der Anteil, der diesen Nutzen zum Beispiel bei Unterhaltungen im größeren Kreis oder in weitläufigen, offenen Räumen wahrnimmt, sinkt auf ein Drittel und weniger. Mindestens zwei Drittel der Befragten nehmen also in Situationen, die für ihre aktive soziale Teilhabe wichtig sind, keinen wesentlichen Nutzen durch ein Hörgerät wahr. Dabei leisten teure Geräte "in den Ohren" ihrer Träger - trotz aller Werbeversprechen von Hörgeräteherstellern und -akustikern - nicht wesentlich mehr als preisgünstige beziehungsweise eigenanteilsfreie Hörgeräte.
• Defizite bei der Compliance: Da das regelmäßige Tragen des Hörgeräts die entscheidende Voraussetzung für den Versorgungserfolg und die Wiederherstellung bestimmter Hörfähigkeit ist, sind die 40 Prozent der Hörgerätebesitzer, die angaben das Gerät auch außerhalb der Schlafenszeit zu entfernen ein bedenklich hoher Anteil. Sie gefährden damit sich und andere. Als Hauptgrund geben die Befragten an, dass die Geräte nicht funktionieren oder stören, was bedeutet, dass ein Teil dieser riskanten Noncompliance vermeidbar ist.
Der ausführliche, im März 2015 erschienene hkk-Gesundheitsreport Hörhilfen: Ergebnisse einer Versichertenbefragung kann kostenlos heruntergeladen werden.
Jens Holst, 30.3.15
2002-14: Persistenz der Unterrepräsentation von Frauen, Älteren und ethnischen Minderheiten in kardiologischen RCTs und Leitlinien
 Die Ergebnisse randomisierter kontrollierter Studien gelten seit Jahren, und dies immer mehr als eine der wichtigsten Grundlagen von evidenzbasierter gesundheitlicher Behandlung mit Hilfe von wissenschaftlichen Behandlungs-Leitlinien. Umso wichtiger ist damit aber die methodische Validität und Reliabilität dieser Studien. Dazu gehört, dass die TeilnehmerInnen solcher Studien möglichst exakt der aller mit dem untersuchten Medikament oder der Methode behandelten PatientInnen entspricht. Platt ausgedrückt: Erkenntnisse zur Wirksamkeit einer bestimmten Medikamentendosis, die mit jungen oder mit mittelaltrigen Personen gewonnen worden sind, müssen diese Wirkung nicht ohne weiteres bei älteren oder jugendlichen PatientInnen erzielen.
Die Ergebnisse randomisierter kontrollierter Studien gelten seit Jahren, und dies immer mehr als eine der wichtigsten Grundlagen von evidenzbasierter gesundheitlicher Behandlung mit Hilfe von wissenschaftlichen Behandlungs-Leitlinien. Umso wichtiger ist damit aber die methodische Validität und Reliabilität dieser Studien. Dazu gehört, dass die TeilnehmerInnen solcher Studien möglichst exakt der aller mit dem untersuchten Medikament oder der Methode behandelten PatientInnen entspricht. Platt ausgedrückt: Erkenntnisse zur Wirksamkeit einer bestimmten Medikamentendosis, die mit jungen oder mit mittelaltrigen Personen gewonnen worden sind, müssen diese Wirkung nicht ohne weiteres bei älteren oder jugendlichen PatientInnen erzielen.
Deshalb gibt es seit Jahren oder gar Jahrzehnten warnende Hinweise auf derartige Diskrepanzen zwischen Studien- und NormalpatientInnen-Populationen.
So fasste zum Beispiel eine im Jahr 2002 veröffentlichte Studie über die Zusammensetzung der TeilnehmerInnen in Studien über die Behandlung von Herzinsuffizienz (frei erhältlich: Representation of the Elderly, Women, and Minorities in Heart Failure Clinical Trials FREE von Asefeh Heiat et al. in der Zeitschrift "Archives of Internal Medicine" (162(15)) ihre Erkenntnisse zu den möglichen unerwünschten praktischen Konsequenzen so zusammen: "Clinical trials are focusing on a relatively small segment of the HF (heart failure) population. The consequences of underrepresenting minorities, women, and elderly are unknown but may be particularly important for HF. Future clinical trials should adequately include populations that carry the burden of the disease."
Ein mit zahlreichen Links zu weiteren spezifischen Studien versehener Kommentar fasst den Sachstand im Jahr 2011 so zusammen: "A case in point is HF, which is overwhelmingly a disease of old age. More than 85% of patients hospitalized with HF are 65 years and older; nearly three-quarters of those individuals are 75 years and older. However, clinical trials assessing treatment modalities in patients with HF published before the year 2000 frequently excluded older patients. … In this issue of the Archives ( siehe den komplett kostenlos zugänglichen Aufsatz von Cherubini et al. The Persistent Exclusion of Older Patients From Ongoing Clinical Trials Regarding Heart Failure in "Archives of Internal Medicine" (2011;171(6): 550-556)) and colleagues provide convincing evidence that the underrepresentation of elderly men and women in clinical trials of cardiovascular disease remains a continuing concern. On the basis of data extracted from the World Health Organization Clinical Trials Registry, more than one-quarter of 251 ongoing clinical trials of HF were found to exclude study participants based on explicit age-based criteria." (siehe dazu das Abstract zu Age-Based Exclusions From Cardiovascular Clinical Trials: Implications for Elderly Individuals (and for All of Us). Comment on 'The Persistent Exclusion of Older Patients From Ongoing Clinical Trials Regarding Heart Failure' von Jerry H. Gurwitz et al. in "Archives of Internal Medicine" (2011;171(6): 557-558)).
Weitere drei Jahre später kommt ein am 29. September 2014 in der Fachzeitschrift "JAMA Internal Medicine" veröffentlichter Forschungsbrief zur Repräsentanz von Frauen, Älteren und ethnischen Minderheiten in den RCTs, die in den Leitlinien zweier us-amerikanischen kardiologischen Fachgesellschaften für drei häufige kardiologische Erkrankungen (darunter erneut die Herzinsuffizienz) von zentraler Bedeutung sind, zu folgendem Ergebnis:
• Trotz kleiner Verbesserungen belief sich der Frauenanteil in allen spezifischen RCTs im Moment auf 30%. In den 1980er betrug er 24%, stieg in den 1990er auf 28% und lag zwischen 2000 und 2009 bei 31%. In Studien über das Vorhofflimmern sinkt aber der Frauenanteil seit Jahren.
• Zur ethnischen Zusammensetzung machen zunächst nur 23,4% aller RCTs überhaupt Angaben - allerdings mit positiver Tendenz. In den Studien mit solchen Angaben waren je nach Erkrankung zwischen 73% und 86% der TeilnehmerInnen Weiße, was zumindest für die USA ein enormer Unterschied zur Wirklichkeit ist. Hinzu kommt, dass 94% aller RCTs zu diesen Erkrankungen nur PatientInnen aus Nordamerika oder Europa umfassten. Und selbst wenn es afrikanische TeilnehmerInnen gab (in 4% aller Studien) kamen diese dann ausschließlich aus Südafrika.
• In nur 2% der Studien waren die TeilnehmerInnen im Durchschnitt 75 Jahre alt oder älter, d.h. in einem Alter in dem der Anteil von Personen, die an einer der drei Erkrankungen leiden und behandelt werden müssen, relativ hoch ist.
Die Schlussfolgerung ähnelt stark der weiter oben zitierten aus dem Jahr 2002, der Appell an zukünftige Forschung klingt allerdings schon etwas ohnmächtig: "These findings raise concerns about clinical trial enrollment and the applicability of the guidelines in these underrepresented populations. Investigators should enroll and report more women, elderly patients, and minorities in future trials to improve the evidence base for patient care as well as the professional society guidelines."
Der "Research Letter" Underrepresentation of Women, Elderly Patients, and Racial Minorities in the Randomized Trials Used for Cardiovascular Guidelines von Muhammad Rizwan Sardar et al. ist in der Zeitschrift "JAMA Internal Medicine" online first am 29. September erschienen.
Bernard Braun, 3.10.14
Ist die medizinische Rehabilitation chronischer Rückenschmerzen wirksamer als Urlaub? Mangels Studien ist dies im Moment offen!
 "Die Frage nach der Wirksamkeit der medizinischen Rehabilitation im Indikationsgebiet "chronische Rückenschmerzen" im Vergleich zu einer Nicht-Intervention, einem Urlaub, einer Selbstbehandlung bzw. einer ambulanten Behandlung durch Praxisärzte bleibt somit weiter offen."
"Die Frage nach der Wirksamkeit der medizinischen Rehabilitation im Indikationsgebiet "chronische Rückenschmerzen" im Vergleich zu einer Nicht-Intervention, einem Urlaub, einer Selbstbehandlung bzw. einer ambulanten Behandlung durch Praxisärzte bleibt somit weiter offen."
Mit dieser Feststellung fassen die Lübecker Sozialmediziner Heiner Raspe und Angelika Hüppe ihren Bericht an den "Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen" zum Thema "Evidenzbasierung in der medizinischen Rehabilitation: eine systematische Literaturübersicht am Beispiel der Indikation chronischer Rückenschmerz" zusammen.
Sie untersuchten und bewerteten u.a. die methodische Qualität von 28 aus einer mehrere Hundert umfassenden Anzahl von interventionellen und vergleichenden Primärstudien, die in einem "wissenschaftlichen Fachjournal im Zeitraum 2000 bis 10/2013 in deutscher oder englischer Sprache publiziert wurden und die Aussagen zu differentiellen Effekten, Wirksamkeit, (Netto)Nutzen oder Effizienz von Rehabilitationskonzepten oder -modulen treffen".
Die Bedeutung dieser Untersuchung rührt u.a. aus der Tatsache, dass sich der "größte Teil der von der Deutschen Rentenversicherung (DRV) gewährten regelmäßig multidisziplinären und multimodalen Leistungen … auf Versicherte mit muskuloskelettalen Erkrankungen (31 %) und hier vor allem auf unspezifische Rückenschmerzen (ICD M50-54: 54 %, d.h. 17 % vom Gesamt)" bezieht. Diese Leistungen werden im Moment in bundesweit mehr als 500 Fach-Rehakliniken erbracht.
Als wesentliche Defzite der Erkenntnislage zur Rehabilitation der Volkskrankheit unspezifische chronische Rückschmerzen nennen die Autoren u.a. folgende:
• Das Fehlen von Untersuchungen zur "absoluten" Wirksamkeit der medizinisch-beruflichen Rehabilitation
• "Eine wissenschaftliche Aktivierung und Selbstständigkeit einer größeren Zahl von Rehabilitationskliniker bzw. -kliniken hat sich durch die annähernd zehnjährige Förderung der Rehaforschungsverbünde offensichtlich nicht erreichen lassen."
• Die aus den Studien zu gewinnende Evidenzbasis der Rehabilitation chroinischer Rückenschmerzen wird "nur als 'befriedigend'" eingestuft. "Die Studienlage zur absoluten Wirksamkeit ist 'ungenügend'."
• "In kaum einem Fall scheinen" die Studien "zu einer Umgestaltung der Verwaltungs- und Organisationsroutinen der Rehabilitationsträger geführt zu haben, wenn man von der zunehmenden Betonung der ambulanten Rehabilitationsformen in unserem Indikationsbereich absieht. Dies wäre z.B. bei den Ergebnissen der beiden Untersuchungen zu Zuweisungsmodalitäten sowie der einen zum Nachsorgeprogramm zu erwarten gewesen."
• "Studien zur Kosteneffizienz … sind insgesamt selten; die auffindbaren sind deskriptiv und berücksichtigen nur die Kostenträgerperspektive. Interventionelle Studien zu Erhöhung der Effizienz fehlen."
• Fast sämtliche Studien konzentrierten sich auf Reha-Leistungen der DRV und damit überwiegend auf die Leistungen für noch erwerbstätige Personen. Für nicht mehr erwerbstätige, ältere Personen, für deren Reha nach dem SGB IX die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) der verantwortliche Träger ist, fehlen also die wissenschaftlichen Belege für den Nutzen dieser Leistungen in hohem Maße.
• Die eingangs des Gutachtens formulierte These, "nach allem, was wir über die Wirksamkeit und den Nutzen der medizinischen Rehabilitation bei chronischen Rückenschmerzen wissen", sei "bisher nur mit durchschnittlich schwachen bis moderaten Effekten zu rechnen" wird durch ihre Ergebnisse bestätigt.
Das Gutachten kritisiert nicht nur die Methodik oder den Approach der Studien, sondern skizziert auch noch sehr detailreich ein optimiertes methodisches Design für zukünftige Evaluationen.
Den 40-seitigen
Bericht gibt es kostenlos auf der Website des Sachverständigenrat.
Bernard Braun, 17.9.14
Stabile KHK und PCI 4: Dramatische Fehleinschätzung des Nutzens auf Seiten der Patienten
 Dieser Beitrag befasst sich mit der vierten von 4 neuen Studien über die perkutane Intervention bei stabiler koronarer Herzkrankheit, die ersten 3 sind am 25.8.2014 im JAMA Internal Medicine erschienen, die 4. am 8.9.2014 im British Medical Journal.
Dieser Beitrag befasst sich mit der vierten von 4 neuen Studien über die perkutane Intervention bei stabiler koronarer Herzkrankheit, die ersten 3 sind am 25.8.2014 im JAMA Internal Medicine erschienen, die 4. am 8.9.2014 im British Medical Journal.
Zum Verständnis der Studien ist wesentlich, dass die perkutane Intervention (PCI), also die Aufdehnung einer verengten Herzkranzarterie mit Einsetzen eines Stents, bei Patienten ohne oder mit leichten Angina pectoris-Beschwerden ("stabile KHK") weder das Herzinfarktrisiko noch das Sterberisiko senkt, wenn sie zusätzlich zur in jedem Fall erforderlichen "optimalen medikamentösen Therapie" (OMT) durchgeführt wird. Die PCI hat lediglich einen eher geringen Effekt auf etwaige Angina pectoris-Beschwerden.
Patienten ist dies zumeist nicht bewusst: Es besteht eine therapeutische Fehleinschätzung ("therapeutic misconception"), in deren Folge der Patient eine Behandlung erhält, die er bei zutreffender Information abgelehnt hätte. Zur ausführlicheren Einführung in die Problematik überflüssiger Stents siehe Forum Beitrag.
In einer Querschnittstudie untersuchten Kureshi et al., wie Patienten die Dringlichkeit und den Nutzen einer gerade durchgeführten perkutanen Intervention einschätzten und wie sich die Einschätzung zwischen Krankenhäusern und Untersuchern unterschied.
Die Studie wurde zwischen 2009 und 2011 in neun Universitätskliniken und großen kommunalen Krankenhäusern in den USA durchgeführt. Dabei wurden 991 Patienten mit stabiler koronarer Herzkrankheit befragt, die 4 bis 6 Stunden zuvor eine PCI erhalten hatten. Der Kardiologe war nicht anwesend.
44% der Patienten hatten früher schon einmal eine PCI erhalten; 85% hatten vor der PCI Angina-pectoris-Symptome angegeben.
Die 135 Kardiologen waren im Durchschnitt 50,7 Jahre alt und hatten durchschnittlich 17,6 Jahre Praxiserfahrung; 127 waren männlich, 8 weiblich.
Die Patienten wurden gefragt, ob es sich bei der PCI um einen dringenden oder geplanten (elektiven) Eingriff gehandelt habe. Zur Überprüfung ihres Wissens erhielten sie eine Auswahl an Antwortmöglichkeiten zum Ankreuzen.
Die Ergebnisse lauten:
20% der Patienten bezeichneten die PCI als dringend, obwohl es sich um einen geplanten Eingriff handelte. Der Anteil in den Krankenhäusern lag zwischen 4 und 38%.
Als Nutzen gaben die Patienten an (in Klammern der niedrigste und höchste Wert in den Krankenhäusern):
• Verlängerung des Lebens 90% (80-97%)
• künftige Herzinfarkte verhüten 88% (79-97%),
• das Leben retten 69% (31-85%)
• Linderung von Symptomen 67% (52-87%)
Nur 1% gab zutreffend die Symptomlinderung als einzigen Nutzen an.
Die unterschiedlichen Vorgehensweisen beim Einholen des Einverständnisses auf Ebene der Krankenhäuser beeinflussten das Antwortverhalten nicht. Unterschiede waren vielmehr auf die einzelnen Ärzte zurückzuführen.
Fazit
Die Studie, durchgeführt an Patienten, die vor kurzem eine PCI erhalten hatten, bestätigt und ergänzt das Wissen darüber, dass die meisten Patienten mit stabiler koronarer Herzkrankheit grundlegend falsche Vorstellungen über den Nutzen der PCI haben und fälschlich annehmen, Herzinfarkt vermeiden und die Lebenserwartung verlängern zu können. 1% beantwortete die Frage nach dem Nutzen zutreffend.
Auch hier wird offensichtlich, dass der Prozess der Aufklärung im Sinne des Shared Decision Making zu gestalten ist:
- Nutzen und Risiken der PCI müssen zutreffend, klar und nicht-direktiv kommuniziert werden.
- Der Arzt muss das Verständnis prüfen.
- Der Patient muss die Gelegenheit erhalten, seine Präferenz bezüglich der PCI zu klären.
Kureshi F, Jones PG, Buchanan DM, et al. Variation in patients' perceptions of elective percutaneous coronary intervention in stable coronary artery disease: cross sectional study. BMJ 2014;349 Abstract
David Klemperer, 13.9.14
Stabile KHK und PCI 3: Nutzlose Stents als Folge überflüssiger Herzkatheteruntersuchungen
 Dieser Beitrag befasst sich mit der dritten von 4 neuen Studien über die perkutane Intervention bei stabiler koronarer Herzkrankheit, die ersten 3 sind am 25.8.2014 im JAMA Internal Medicine erschienen, die 4. am 8.9.2014 im British Medical Journal.
Dieser Beitrag befasst sich mit der dritten von 4 neuen Studien über die perkutane Intervention bei stabiler koronarer Herzkrankheit, die ersten 3 sind am 25.8.2014 im JAMA Internal Medicine erschienen, die 4. am 8.9.2014 im British Medical Journal.
Zum Verständnis der Studien ist wesentlich, dass die perkutane Intervention (PCI), also die Aufdehnung einer verengten Herzkranzarterie mit Einsetzen eines Stents, bei Patienten ohne oder mit leichten Angina pectoris-Beschwerden ("stabile KHK") weder das Herzinfarktrisiko noch das Sterberisiko senkt wenn, wenn sie zusätzlich zur in jedem Fall erforderlichen "optimalen medikamentösen Therapie" (OMT) durchgeführt wird. Die PCI hat lediglich einen eher geringen Effekt auf etwaige Angina pectoris-Beschwerden. Patienten ist dies zumeist nicht bewusst, es besteht eine therapeutische Fehleinschätzung ("therapeutic misconception"), in deren Folge der Patient eine Behandlung erhält, die er bei zutreffender Information abgelehnt hätte. Zur ausführlicheren Einführung in die Problematik überflüssiger Stents siehe Forum Beitrag.
Bei einem nennenswerten Anteil der Patienten, die eine geplante (elektive) perkutane Intervention (Dehnung einer verengten Herzkranzarterie, zumeist mit Einsetzen eines Stents) erhalten, ist der Eingriff unangemessen (inappropriate).
Als Maß für die Angemessenheit der PCI hat eine Task Force der American College of Cardiology Foundation im Jahr 2012 Kriterien für die klinische Indikation veröffentlicht (Link). Nach diesen Kriterien wird eine PCI als unangemessen bezeichnet, wenn es unwahrscheinlich ist, dass sie den Gesundheitszustand (Symptome, Funktion, Lebensqualität) oder die Lebenserwartung des Patienten verbessert.
Eine frühere Studie (Chan et al. 2011) hatte gezeigt, dass die PCI in Akutsituationen (z.B. Herzinfarkt) fast immer angemessen war, in nicht-akuten Situationen jedoch in knapp der Hälfte der Fälle die Indikation unangemessen bzw. unklar war. Auf Krankenhauseben lag der Anteil unangemessener PCIs zwischen 0 und 55%.
In einer neuen Studie untersuchten Bradley et al. den Zusammenhang zwischen der Patientenauswahl für die geplante (elektive) diagnostische Koronarangiographie und der Angemessenheit der PCI.
Der Untersuchung lag die Annahme zugrunde, dass Krankenhäuser, die einen hohen Anteil von beschwerdefreien Patienten angiographieren auch in größerem Ausmaß unangemessene PCIs durchführen. Die Auswahlentscheidungen zur Koronarangiographie könnten dann als Hebel zur Vermeidung unangemessener PCIs dienen.
Die Daten für die Studie lieferte das CathPCI Registry, dem größten Register für diagnostische Koronarangiographie und für PCI in den USA mit Beteiligung von mehr als 1400 Zentren.
Ausgewertet wurden die Angaben zu 1.225.562 Patienten elektiven Koronarangiographien sowie 203.158 elekiven PCIs, die zwischen 2009 und 2013 in 544 Krankenhäuser durchgeführt wurden.
Die Beurteilung jeder PCI bezüglich der klinischen Indikation erfolgte anhand der oben genannten Kriterien für die Angemessenheit der klinischen Indikation. Jede PCI wurde einer der Kategorien "angemessen", "unsicher", "nicht angemessen" zugeordnet.
308.083 (25.1%) der Koronarangiographien wurden an beschwerdefreien Patienten durchgeführt. Bezogen auf die Krankenhäuser lag der Anteil beschwerdefreier Patienten an der Gesamtzahl zwischen 1% und 73,6%. Für einen beschwerdefreien Patienten mit Verdacht auf eine koronare Herzkrankheit unterscheidet sich somit die Wahrscheinlichkeit, eine Koronarangiographie zu erhalten, von Krankenhaus zu Krankenhaus ganz erheblich.
Krankenhäuser mit höheren Raten von beschwerdefreien Patienten bei der Koronarangiographie hatten auch höhere Anteile von PCIs, die wegen der Beschwerdefreiheit der Patienten unangemessen waren.
Dieses Ergebnis bestätigt die Annahme, dass die Qualität der Indikationsstellung zur elektiven diagnostischen Koronarangiographie mit der Angemessenheit der PCI zusammenhängt.
Das Phänomen, dass mehr Diagnostik fast zwangsläufig zu mehr Therapie führt aber nicht zu mehr Patientennutzen, wurde schon Mitte der 1980er-Jahre nachgewiesen und als diagnostisch-therapeutische Kaskade bezeichnet (Mold und Stein 1986). Eine diagnostisch-therapeutische Kaskade für Koronarangiographie in dem Sinne, dass eine überflüssige Untersuchung zu einer überflüssigen Therapie führt, wurde in einer früheren Studie belegt (Lucas et al. 2008).
Diese diagnostisch-therapeutische Kaskade ist in erster Linie auf die Fehlannahmen über den Nutzen der PCI auf Seiten der Patienten durch die Fehlinformationen der Ärzte zurückzuführen. Hier liegt ein Hebel zur Lösung des Problems.
Die hier besprochene Studie zeigt, dass die diagnostisch-therapeutische Kaskade auch durch die überlegtere Indikationsstellung zur Koronarangiographie verhindert werden kann. Angesprochen sind hier die im Primärbereich tätigen Ärzte, die Patienten mit KHK nur dann zur Koronarangiographie überweisen sollten, wenn das Ergebnis für die Patienten eine vorteilhaftere Behandlung ermöglichen kann. Nutzen und Risiken sollten bei dieser präferenzsensitiven Entscheidung im Rahmen eines Shared Decision Making vermittelt werden. Die Ärzte sollten dabei den Patienten verdeutlichen, dass mit der PCI Herzinfarkte nicht verhindert werden und das Sterberisiko nicht gesenkt wird.
Bradley SM, Spertus JA, Kennedy KF, et al. Patient selection for diagnostic coronary angiography and hospital-level percutaneous coronary intervention appropriateness: Insights from the national cardiovascular data registry. JAMA Internal Medicine 2014 Abstract
David Klemperer, 9.9.14
Stabile KHK und PCI 2: Kardiologen informieren überwiegend falsch
 Dieser Beitrag befasst sich mit der zweiten von 4 neuen Studien über die perkutane Intervention bei stabiler koronarer Herzkrankheit, die ersten 3 sind am 25.8.2014 im JAMA Internal Medicine erschienen, die 4. am 8.9.2014 im British Medical Journal.
Dieser Beitrag befasst sich mit der zweiten von 4 neuen Studien über die perkutane Intervention bei stabiler koronarer Herzkrankheit, die ersten 3 sind am 25.8.2014 im JAMA Internal Medicine erschienen, die 4. am 8.9.2014 im British Medical Journal.
Zum Verständnis der Studien ist wesentlich, dass die perkutane Intervention (PCI), also die Aufdehnung einer verengten Herzkranzarterie mit Einsetzen eines Stents, bei Patienten ohne oder mit leichten Angina pectoris-Beschwerden ("stabile KHK") weder das Herzinfarktrisiko noch das Sterberisiko senkt wenn, wenn sie zusätzlich zur in jedem Fall erforderlichen "optimalen medikamentösen Therapie" (OMT) durchgeführt wird. Die PCI hat lediglich einen eher geringen Effekt auf etwaige Angina pectoris-Beschwerden. Patienten ist dies zumeist nicht bewusst, es besteht eine therapeutische Fehleinschätzung ("therapeutic misconception"), in deren Folge der Patient eine Behandlung erhält, die er bei zutreffender Information abgelehnt hätte. Zur ausführlicheren Einführung in die Problematik überflüssiger Stents siehe Forum Beitrag.
Goff und Kolleginnen untersuchten, welchen Einfluss Kardiologen auf die unter Patienten verbreitete falsche Einschätzung des Nutzens der perkutanen Intervention (PCI), also der Aufdehnung einer verengten Herzkranzarterie mit Einsetzen eines Stents, bei stabiler koronare Herzkrankheit hat. Dazu analysierten sie die Tonbandaufzeichnungen von 40 Gesprächen über die Entscheidungsfindung zur Koronarangiographie und zur perkutanen Intervention (qualitative Inhaltsanalyse). Diese Gespräche wurden zwischen 2008 und 2012 von 20 Kardiologen geführt, die über 7 bis 31 Jahre Praxiserfahrung verfügten.
Die Patienten waren im Mittel 64 Jahre alt, die Hälfte war wegen Angina pectoris-Beschwerden zugewiesen, die übrigen wegen anderer Fragen, wie z.B. auffälligem Belastungstest.
Die Gesprächsinhalte wurden unter 5 Überschriften wie folgt zusammengefasst.
1. Gründe für die Empfehlung zu Angiographie und PCI
Alle Kardiologen gaben an, warum ihrer Meinung nach eine Angiographie notwendig sei.
20 Patienten waren beschwerdefrei, 11 von ihnen waren - trotzdem - zur Angiographie und PCI zugewiesen. Diesen Patienten gegenüber - die von einer PCI keinen Nutzen zu erwarten hatten - äußerten die Kardiologen zumeist, dass ein Problem vorliege, dass weiter abgeklärt werden müsse.
Die Medikation der meisten Patienten entsprach nicht dem Standard der optimalen medikamentösen Therapie (OMT), einer Behandlungsform, welche die Lebenserwartung und die Lebensqualität der Patienten verbessert In den wenigen Fällen, in denen Kardiologen dies ansprachen, ließen sie die OMT als geringer wertige Maßnahme im Vergleich zu Angiographie und PCI erscheinen.
Einige Kardiologen äußerten als Grund für die Empfehlung zur Angiographie, ihren Wunsch, die Anatomie der Herzkranzgefäße zu kennen ohne jedoch auf die klinische Bedeutung dieses Wissens einzugehen.
2. Nutzen von Angiographie und PCI
Der Nutzen wurde in allen Gesprächen angesprochen.
Nur 2 der 40 Patienten erhielten die zutreffende Information, dass eine PCI Angina-pectoris-Symptome bessern kann aber die Mortalität und das Herzinfarktrisiko nicht mindert.
In 5 Gesprächen gaben die Kardiologen explizit und fälschlich an, dass die PCI einen künftigen Herzinfarkt und den plötzlichen Herztod verhindern könne.
Häufig übertrieben die Kardiologen den Nutzen implizit, indem sie z.B. von Verengungen der Herzkranzgefäße und deren Beseitigung sprachen ohne den klinischen Nutzen zu erwähnen. Dazu benutzen sie Bilder wie "ein verstopftes Rohr durchgängig machen". Teils formulierten sie auch ganz allgemein, dass ein Problem zu lösen sei. Auch kleideten einige Kardiologen ihre Information in ein Verlust-Framing: die Nicht-Durchführung könne zum Tod führen.
3. Risiken von Angiographie und PCI
Die meisten Kardiologen gingen - wenn überhaupt - nur kurz auf die Risiken ein. Eine Quantifizierung der Risiken z.B. für kontrastmittelbedingtes Nierenversagen, war nicht üblich, vielmehr benutzten die Kardiologen qualitative Beschreibungen wie "selten" bzw. "eine extrem sichere Untersuchung" oder auch dass der Nutzen die Risiken bei weitem überwiegen - überwiegend also verharmlosende Formulierungen.
4. Kommunikationsstil des Arztes
Ein Kommunikationsstil, der Patienten eher entmutigte, sich aktiv an der Entscheidung zu beteiligen, wurde in 30 der 40 Gespräche festgestellt. Dazu zählte der Gebrauch von Fachbegriffen ("anatomic lesion", "distal vessel," "pretest likelihood",), sowie den Patienten zu unterbrechen, seine Fragen zu ignorieren, eine Frage zu stellen und die Antwort nicht abzuwarten, auf Anliegen des Patienten nicht einzugehen. Die Kardiologen schienen ein volles Verständnis der Angiographie und der PCI Vorgehensweisen auf Seiten des Patienten vorauszusetzen.
Die Frage, ob der Patient noch Fragen habe, stellten die Kardiologen regelmäßig. In keinem Fall überprüfte der Kardiologe jedoch, ob der Patient die Informationen verstanden hatte. In 14 Gesprächen fanden sich Elemente, die den Patienten dazu ermutigten, sich an der Entscheidung zu beteiligen, wie z.B. Äußern von Verständnis für die Anliegen und Sorgen des Patienten.
5 Beitrag von Patienten und Familienangehörigen zum Gespräch
Die wenigen Patienten, die von sich aus inhaltliche Fragen stellten, erhielten ausführlichere Informationen. Die meisten Patientenfragen bezogen sich jedoch auf technische und organisatorische Aspekte. Die Anwesenheit eines Familienmitglieds ging mit einer höheren Zahl von Fragen einher.
Das Fazit: Die meisten Patienten mit stabiler koronarer Herzkrankheit haben in dieser Studie die für eine Entscheidung relevanten Informationen nicht erhalten. Was die Kardiologen den Patienten mitgeteilt haben, war überwiegend unvollständig, einseitig, verzerrt und falsch. Auch der Kommunikationsstil entsprach zumeist nicht den Erfordernissen für eine informiert Entscheidung. In der Folge stimmen Patienten einer invasiven Behandlung zu, die sie ablehnen würden, wenn sie zutreffend informiert wären.
Goff SL, Mazor KM, Ting HH, et al. How cardiologists present the benefits of percutaneous coronary interventions to patients with stable angina: A qualitative analysis. JAMA Internal Medicine 2014. Abstract
David Klemperer, 9.9.14
Stabile KHK und PCI 1: Schlechte Information - schlechte Entscheidungen, gute Informationen - gute Entscheidungen
 Dieser Beitrag befasst sich mit der ersten von 4 neuen Studien über die perkutane Intervention bei stabiler koronarer Herzkrankheit, die ersten 3 sind am 25.8.2014 im JAMA Internal Medicine erschienen, die 4. am 8.9.2014 im British Medical Journal.
Dieser Beitrag befasst sich mit der ersten von 4 neuen Studien über die perkutane Intervention bei stabiler koronarer Herzkrankheit, die ersten 3 sind am 25.8.2014 im JAMA Internal Medicine erschienen, die 4. am 8.9.2014 im British Medical Journal.
Zum Verständnis der Studien ist wesentlich, dass die perkutane Intervention (PCI), also die Aufdehnung einer verengten Herzkranzarterie mit Einsetzen eines Stents, bei Patienten ohne oder mit leichten Angina pectoris-Beschwerden ("stabile KHK") weder das Herzinfarktrisiko noch das Sterberisiko senkt wenn, wenn sie zusätzlich zur in jedem Fall erforderlichen "optimalen medikamentösen Therapie" (OMT) durchgeführt wird. Die PCI hat lediglich einen eher geringen Effekt auf etwaige Angina pectoris-Beschwerden. Patienten ist dies zumeist nicht bewusst, es besteht eine therapeutische Fehleinschätzung ("therapeutic misconception"), in deren Folge der Patient eine Behandlung erhält, die er bei zutreffender Information abgelehnt hätte. Zur ausführlicheren Einführung in die Problematik überflüssiger Stents siehe Forum Beitrag.
Wie sich Patienten mit stabiler KHK entscheiden, wenn sie die Informationen zur PCI in unterschiedlichen Formen erhalten, untersuchten Rothberg et al. in einer kürzlich erschienenen Studie.
An der Studie nahmen 1257 gesunde Probanden ab 50 Jahren teil. Diese versetzten sich über ein schriftliches Szenario in die Situation eines Patienten mit stabiler KHK, der leichte Angina pectoris-Beschwerden verspürt. Alle erhielten die selben Informationen über die technischen Aspekte und die Risiken einer PCI sowie über den Nutzen und die Risiken einer OMT.
Anschließend wurden sie per Zufallszuteilung in 3 Gruppen eingeteilt, in denen ein hypothetischer Kardiologe sie folgendermaßen informierte:
Gruppe 1: keine Informationen über die Effekte der PCI auf einen Herzinfarkt
Gruppe 2:. explizite Information darüber, dass die PCI das Herzinfarktrisiko nicht reduziert
Gruppe 3: erklärende Information, in der über die explizite Information hinaus erläutert wurde, warum die PCI das Herzinfarktrisiko nicht mindert.
Anschließend wurden die Probanden mit Hilfe eines Fragebogens nach ihrem Verständnis gefragt und nach den Konsequenzen, die sie ziehen würden.
Die Ergebnisse:
Ohne Information (Gruppe 1) nahmen 71% fälschlich an, dass eine PCI einen Herzinfarkt verhindern kann. Bei expliziter (Gruppe 2) und bei erklärender Information (Gruppe 3) lag der Anteil deutlich niedriger, aber immer noch bei 30,7% bzw. 30,6%.
Weniger besorgt, in der Zukunft einen Herzinfarkt zu erleiden, waren 64,6% in Gruppe 1, 40,2% in Gruppe 2 und 34,6% in Gruppe 3.
Für eine PCI würden sich entscheiden:
Gruppe 1: 69,4%
Gruppe 2: 48,7%
Gruppe 3: 45,7%
Für eine medikamentöse Therapie (OMT) würden sich entscheiden:
Gruppe 1: 83,1%
Gruppe 2: 87,4%
Gruppe 3: 92,3%
Der Anteil der Probanden, welche die Informationen zutreffend erinnerten, betrug in
Gruppe 1: 22,1%
Gruppe 2: 63,6% und in
Gruppe 3: 69%.
Eine falsche Erinnerung (der Arzt habe mitgeteilt, dass die PCI einen Herzinfarkt verhindern könne) gaben an:
Gruppe 1: 51,9%
Gruppe 2: 20%
Gruppe 3: 17,9%
Die als vom Arzt erhalten erinnerte Information entsprach zumeist auch der Annahme der Probanden, ob die PCI einen Herzinfarkt verhindern könne oder nicht.
Prädiktoren dafür, sich der PCI zu unterziehen, waren die Annahme, dadurch das Herzinfarktrisiko zu mindern, die Sorge einen Herzinfarkt zu erleiden und diese Sorge durch eine PCI zu verringern sowie ein höherer Bildungsgrad.
Prädiktor für eine Entscheidung gegen PCI war die zutreffende Annahme über die Wirksamkeit der medikamentösen Therapie.
Ein wichtiger Prädiktor für die Entscheidung war auch die Erinnerung an das, was der Arzt gesagt hat: diejenigen, die fälschlicherweise erinnerten, der Arzt habe gesagt, dass eine PCI das Herzinfarktrisiko mindere, stimmten der PCI eher zu, als diejenigen, die korrekt erinnerten, dass dies nicht der Fall sei.
Kernpunkte der Studie:
In einem Szenario von Patienten mit stabiler koronarer Herzkrankheit
• verstehen Patienten den Nutzen eines Stents (perkutane Intervention) besser, wenn er ihnen explizit und erklärend mitgeteilt wird,
• versteht ein relevanter Teil der Probanden die Information falsch,
• hängt die Entscheidung für oder gegen die PCI stark von der erinnerten Information ab.
Eine bedarfsgerechte Versorgung von Patienten mit stabiler koronarer Herzkrankheit erfordert somit zwingend, ihnen das Wissen zu vermitteln und das Verständnis sicherzustellen, dass sie ihr Herzinfarktrisiko mit einer PCI nicht mindern, also der therapeutischen Fehleinschätzung entgegenzuwirken. Shared Decision Making ist das hierfür angemessene Konzept der Arzt-Patient-Kommunikation. Informationen in einem Umfang von wenigen Zeilen haben sich als hocheffektiv erwiesen.
Rothberg MB, Scherer L, Kashef M, et al. The effect of information presentation on beliefs about the benefits of elective percutaneous coronary intervention. JAMA Internal Medicine 2014. Abstract
David Klemperer, 9.9.14
Vier neue Studien zur Überversorgung mit Stents
 Im JAMA Internal Medicine sind kürzlich 3 Studien und im British Medical Journal ist eine Studie erschienen, die sich mit der Frage der Einsetzung eines Stents bei Patienten mit stabiler koronarer Herzkrankheit befassen, ein Thema über das wir wiederholt berichtet haben.
Im JAMA Internal Medicine sind kürzlich 3 Studien und im British Medical Journal ist eine Studie erschienen, die sich mit der Frage der Einsetzung eines Stents bei Patienten mit stabiler koronarer Herzkrankheit befassen, ein Thema über das wir wiederholt berichtet haben.
Im Folgenden wird ein Überblick über die Problematik gegeben und dann auf die Forum-Beiträge zu den 4 neuen Studien verwiesen.
Bei einem Teil der Patienten mit nicht akuter, stabiler koronarer Herzkrankheit (KHK), also mit Verengungen an Herzkranzgefäßen, treten Angina pectoris-Beschwerden auf, andere Patienten mit stabiler KHK sind beschwerdefrei.
Durch eine Kombination von Medikamenten, die sog. optimale medikamentöse Therapie (OMT) können KHK-Beschwerden, wie Engegefühl im Brustkorb bei Belastung (Angina pectoris), effektiv gemindert und die Prognose verbessert werden. Die zusätzlich zur OMT durchgeführte Aufdehnung verengter Herzkranzgefäße mit einem Katheter mit Einsetzen einer Gefäßprothese (Stent), auch als perkutane Intervention (PCI) bezeichnet, bewirkt eine eher geringe zusätzliche Beschwerdebesserung, wie u.a. die amerikanische COURAGE-Studie gezeigt hat (Weintraub et al. 2008) - die Prognose wird jedoch nicht gebessert, d.h. der Eingriff hat keinen Effekt auf die Sterblichkeit, die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Herzinfarktes oder das Risiko eines Schlaganfalls (Boden et al. 2007, s.a. Beitrag im Forum).
Somit ist die PCI, also das Einsetzen eines Stents, bei der stabilen KHK nur in einer Situation indiziert: der Patient bzw. die Patientin hat trotz OMT Angina pectoris-Beschwerden, welche die Lebensqualität so stark beeinträchtigen, dass sie oder er die Aussicht auf Beschwerdeminderung durch PCI höher bewertet als die Risiken und Unannehmlichkeiten der PCI. Die Entscheidung für oder gegen die PCI kann also sinnhaft nur der Patient nach Klärung seiner Präferenz treffen.
Eine amerikanische Studie (Fowler et al. 2012, s.a. Beitrag im Forum):
• die Mehrheit der Patienten (54%), die eine PCI erhalten, ist beschwerdefrei - der Eingriff ist also eindeutig nicht indiziert
• Ärzte legen zumeist Gründe für die PCI dar (77%) aber eher selten (16%) Gründe, die dagegen sprechen
• andere Vorgehensweisen, wie z.B. die PCI nicht durchzuführen, erwähnen die Ärzte zumeist nicht (nur in 10% der Fälle)
• nur eine Minderheit (16%) wird nach ihrer Präferenz befragt.
Eine weitere Studie zeigte, dass nur bei einer Minderheit der Patienten (43,5%), die eine PCI erhielten, vor der PCI eine OMT durchgeführt worden war. Somit war auch in dieser Studie die Mehrzahl der Eingriffe nicht indiziert, weil eine Indikation erst besteht, wenn die medikamentösen Maßnahmen ausgeschöpft sind (Borden et al. 2011, s.a. Beitrag im Forum).
Eine Arbeitsgruppe um Rothberg hatte 2010 in einer Befragung von 153 KHK-Patienten und 17 Kardiologen festgestellt, dass fast 90% der Patienten sowie einige der Kardiologen fälschlich annahmen, dass eine PCI das Herzinfarktrisiko mindere. Die Mehrheit (70%) der Kardiologen sahen in 2 Fallbeschreibungen keinen Nutzen durch eine PCI, 43% würden sie trotzdem durchführen.
Eine andere Studie zeigte, dass Ärzte bei der Indikationsstellung für eine kardiologische Untersuchung empfindlich auf finanzielle Anreize reagieren und zwar im Sinne einer Dosis-Wirkungsbeziehung - je stärker der finanzielle Anreiz, desto häufiger wird die Untersuchung durchgeführt (Shah et al 2011, siehe auch Beitrag im Forum).
Im Ergebnis erhalten tagtäglich zahlreiche Patienten eine invasive und teure Behandlung, die sie abgelehnt hätten, wenn sie zutreffend informiert wären. Von Seiten der Patienten herrscht ein therapeutische Fehleinschätzung ("therpeutic misconception"). Von Seiten der Ärzte kann von einer "stummen Präferenzfehldiagnose" ("silent misdiagnosis", siehe Beitrag im Forum) gesprochen werden.
Die 4 neuen Studien ergeben deutliche Hinweise für die Lösung des Problems überflüssiger Koronarangiographien und überflüssiger PCIs.
1 Rothberg und Kolleginnen haben in einer randomisierten kontrollierten Studie den Effekt von 3 unterschiedlichen Informationsstrategien zum Nutzen eines Stents bei koronarer Herzkrankheit auf die Patientenentscheidung getestet. Die Entscheidung für einen Stent ist häufiger, wenn der tatsächliche Nutzen vorenthalten und niedriger, wenn er als Fakt oder auch mit Erklärung mitgeteilt wird. Beitrag im Forum
2 Goff und Kolleginnen haben anhand von 40 aufgezeichneten Arzt-Patient-Gesprächen analysiert, wie Kardiologen Patienten mit stabiler KHK informieren. Nur 2 der 40 Patienten erhielten realistische Angaben über Nutzen und Risiken, im Allgemeinen wurde der Nutzen übertrieben dargestellt und die Risiken wurden verharmlost. Beitrag im Forum
3 Bradley und Kollegen befassten sich mit der Frage, wie es sich mit der Angemessenheit der PCI Krankheiten verhält, wenn ein hoher Anteil der Patienten, die eine Koronarangiographie erhalten, beschwerdefrei ist. Tatsächlich ist in diesen Krankenhäuser der Anteil der nicht angemessenen, bzw. überflüssigen PCIs höher. Beitrag im Forum
4 Kureshi et al. befragten Patienten kurz nach einer durchgeführten PCI danach, welchen Nutzen sie sich von der Intervention versprachen. Das Ergebnis ist eine kaum zu übertreffende Fehleinschätzung: nur 1% gab zutreffend die Beschwerdelinderung als Nutzen der PCI an, 90% meinten fälschlich, der Eingriff verhindere Herzinfarkte und verlängere das Leben. Beitrag im Forum
David Klemperer, 9.9.14
Das "Ebola Ressource Center" der Zeitschrift "The Lancet" startet mit kritischer Darstellung zur Ethik des Umgangs mit Ebola
 Nach einer ersten im Forum Gesundheitspolitik vorgestellten Sammlung wissenschaftlicher Literatur zu Ebola in Verantwortung der Redaktion des "New England Journal of Medicine (NEJM)" gibt es nun vom ebenso renommierten Medizinjournal "The Lancet" eine eigene Sammlung zum Thema. Das Ebola Ressource Center "wishes to assist health workers and researchers working under difficult and dangerous conditions to bring this outbreak to a close. This Ebola hub contains all related resources from The Lancet family of journals offered with free access to support their vital work."
Nach einer ersten im Forum Gesundheitspolitik vorgestellten Sammlung wissenschaftlicher Literatur zu Ebola in Verantwortung der Redaktion des "New England Journal of Medicine (NEJM)" gibt es nun vom ebenso renommierten Medizinjournal "The Lancet" eine eigene Sammlung zum Thema. Das Ebola Ressource Center "wishes to assist health workers and researchers working under difficult and dangerous conditions to bring this outbreak to a close. This Ebola hub contains all related resources from The Lancet family of journals offered with free access to support their vital work."
Der im Moment aktuellste Beitrag befasst sich mit dem in vielen gesundheitspolitischen und -wissenschaftlichen Veröffentlichungen heftig und zum Teil kontrovers diskutierten Thema des experimentellen Einsatzes des bisher nicht zugelassenen Medikaments bzw. Wirkstoffs Zmapp bei an Ebola erkrankten Personen. Auf dem Hintergrund des bisherigen, sehr selektiven Einsatzes an wenigen Personen, des zweimaligen "Erfolges" und einmaligen "Misserfolgs" der Behandlung ohne einen Nachweis von Kausalität, der Forderung nach der Behandlung möglichst aller Erkrankter und des aktuellen Mangels an ZMapp, kommen die beiden angesehenen Bioethiker Ezekiel Emanuel von der University of Pennsylvania in Philadelphia und Annette Rid vom King's College in London zu zwei Feststellungen:
• Sie setzen sich zum einen kritisch mit der bisherigen und möglicherweise auch künftigen Praxis des Einsatzes solcher Mittel auseinander. Aus ethischer Sicht kommen sie zu folgendem Schluss: "Consequently, these interventions should not be distributed for compassionate use outside clinical trials—which might also undermine the feasibility of trials. If compassionate use nonetheless occurs, transparency is key and data about patient outcomes should be collected and shared in full. Of concern, it appears that the existing stock of Zmapp has been used only for compassionate use, and details about patient outcomes are not (yet) readily available. To ensure that data from compassionate use and clinical trials are rapidly integrated, a neutral body should oversee the use of experimental interventions during this epidemic."
• Zum anderen weisen sie auf die nach dem Ebolaausbruch ethisch adäquate Konzentration der gesundheitspolitischen Interventionen auf die Stärkung des Gesundheits- und Versorgungsystems hin: "Now that the response is picking up, the international community needs more focus on strengthening of health systems and infrastructure and less on experimental treatments. Adoption of containment measures with a view to strengthen health systems and infrastructure is the most effective way to curb this epidemic and prevent future ones; it has positive externalities for health promotion and offers fair benefits to communities who engage in research in this outbreak."
Über den aktuellen Anlass des Ebolaausbruchs hinaus lesenswert sind die im Aufsatz zusammengestellten "Ethical principles for trials of experimental treatments or vaccines for Ebola (selected implications)".
Der Aufsatz Ethical considerations of experimental interventions in the Ebola outbreak. von Annette Rid und Ezekiel J Emanuel ist in der Zeitschrift "The Lancet" im August 2014 erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 24.8.14
Anteil falsch positiver Diagnosen auch bei prognostisch schweren Erkrankungen teilweise groß: Das Beispiel Morbus Parkinson
 Ein zentrales Problem der medizinisch-ärztlichen Diagnostik sind falsch positive Diagnosen, also Diagnosen von Erkrankungen, die nicht der Wirklichkeit entsprechen. Dass es sich dabei nicht um ein verzeihbares "Irren ist menschlich"- oder Bagatellproblem handelt, sondern dadurch die Lebensqualität und Gesundheit der zu Unrecht als krank diagnostizierten Personen dramatisch belastet und verschlechtert wird, verdeutlicht eine gerade veröffentlichte Studie über die Diagnosequalität bei Morbus Parkinson.
Ein zentrales Problem der medizinisch-ärztlichen Diagnostik sind falsch positive Diagnosen, also Diagnosen von Erkrankungen, die nicht der Wirklichkeit entsprechen. Dass es sich dabei nicht um ein verzeihbares "Irren ist menschlich"- oder Bagatellproblem handelt, sondern dadurch die Lebensqualität und Gesundheit der zu Unrecht als krank diagnostizierten Personen dramatisch belastet und verschlechtert wird, verdeutlicht eine gerade veröffentlichte Studie über die Diagnosequalität bei Morbus Parkinson.
Die Schwere der Fehldiagnose ergibt sich durch die damit prognostizierte oder assoziierte Hauptcharakteristika dieser Erkrankung: Parkinson ist nicht heilbar, ihre Entwicklung ist medikamentös nicht zu stoppen und sowohl der körperliche (z.B. zittrige Hände oder die maskenartige Veränderung des Gesichts) als auch der psychische (z.B. Depressionen) Zustand der Erkrankten verschlechtert sich mit hoher Wahrscheinlichkeit in späteren Phasen der Erkrankung.
Das diagnostische Dilemma ist aber auch, dass eine absolut sichere Diagnose im Moment nur durch Gewebeuntersuchungen aus bestimmten Gehirnbereichen möglich ist, d.h. erst nach dem Tod der erkrankten Person. Davor erfolgt eine Diagnose anhand einer Reihe von äußeren Veränderungen wie der Verlangsamung von Bewegungen, Steifheit von Muskeln z.B. im Gesicht, dem Zittern anderer Muskeln und der Reaktion auf einen Arzneimittelwirkstoff.
Die an der Mayo-Klinik in den USA durchgeführte Studie mit Daten der "Arizona Study of Aging and Neurodegenerative Disorders" untersuchte nun, ob und wie stark die ärztlichen Diagnosen von Parkinson mit dem Ergebnis der Gewebeuntersuchung nach dem Tod dieser Personen übereinstimmten:
• Bei 97 Patienten, deren Erkrankung nach der gesamten Symptomatik und ihrer Dauer für "wahrscheinlich" gehalten wurde, stimmten 82% der Diagnosen mit dem Befund überein. Es gab aber je nach Dauer der Erkrankung auch deutliche Unterschiede,: Erfolgte die Diagnose bei einer Erkrankungs-/Symptomzeit unter 5 Jahren stimmten nur 57% der Diagnosen mit dem Gewebebefund überein. Waren es mehr als 5 Jahre stieg dieser Wert auf 88%.
• Bei den 34 Patienten, deren Parkinsonerkrankung nach den Symptomen für "möglich" gehalten wurde, wurden lediglich 26% der Diagnosen durch den Gewebebefund bestätigt.
• In der dritten Gruppe von Personen bei denen eine Parkinsonerkrankung nach den Symptomen diagnostisch ausgeschlossen wurde, stimmte diese Diagnose in 91% der Fälle. Der Anteil falsch negativer Fälle betrug daher nur 9%.
Selbst wenn die Studienverantwortlichen anmerken, dass die Behandlung auch bei einer anderen Diagnose nicht völlig anders ausgesehen hätte - ein Teil der Patienten litt an einer anderen neurodegenerativen Krankheit -, halten sie wegen der oben beschriebenen psychischen Beeinträchtigung der Patienten durch eine Parkinsondiagnose die Suche nach weiteren Symptomen (z.B. Beeinträchtigung des Geruchssinns) und nach verlässlichen Biomarkern für unbedingt notwendig. Dies ist umso nötiger, weil sich an dem hohen Anteil falsch positiver Parkinsondiagnosen seit geraumer Zeit nichts geändert hat.
Der Aufsatz Low clinical diagnostic accuracy of early vs advanced Parkinson disease. Clinicopathologic study. von C.H. Adler, et al. ist am 29. Juli 2014 in der Zeitschrift "Neurology" (83 (5): 406-412) erschienen und ein Abstract ist kostenlos verfügbar.
Bernard Braun, 23.8.14
NEJM-Journal Watch: Wissenschaftliche Publikationen über Ebola 1995-2014
 Nachdem die Weltgesundheitsorganisation WHO den aktuellen Ausbruch von Ebola zum dritten internationalen Gesundheitsnotfall ("Public Health Emergency of International Concern, PHEIC") der letzten 10 Jahre (die beiden anderen Erkrankungsnoptfälle waren die befürchteten Schweinegrippe- und Kinderlähmungs-Epidemien) erklärt hat, hilft u.a. die Beschäftigung mit den wissenschaftlichen Veröffentlichungen über das Entstehen, die Prävention und die Behandlung von Ebolainfektionen bzw. der daran erkrankten Personen den bisherigen Verlauf und das Bedrohungspotenzial zu bewerten.
Nachdem die Weltgesundheitsorganisation WHO den aktuellen Ausbruch von Ebola zum dritten internationalen Gesundheitsnotfall ("Public Health Emergency of International Concern, PHEIC") der letzten 10 Jahre (die beiden anderen Erkrankungsnoptfälle waren die befürchteten Schweinegrippe- und Kinderlähmungs-Epidemien) erklärt hat, hilft u.a. die Beschäftigung mit den wissenschaftlichen Veröffentlichungen über das Entstehen, die Prävention und die Behandlung von Ebolainfektionen bzw. der daran erkrankten Personen den bisherigen Verlauf und das Bedrohungspotenzial zu bewerten.
Auf der von AutorInnen der Zeitschrift "New England Journal of Medicine" verfassten Website "Journal Watch" gibt es hierzu eine erste Zusammenstellung von 34 zwischen 1995 und 2014 in verschiedenen Fachzeitschriften und bei "Journal Watch" veröffentlichten Beiträge.
Die meisten, fast immer über Links erreichbaren Beiträge sind frei zugänglich. Wahrscheinlich wird die Textsammlung in der weiteren Zukunft noch erweitert.
Hierüber erreicht man die "Ebola-Literatur-Website".
Bernard Braun, 12.8.14
Opioide=Patentmittel gegen chronische Schmerzen? Nebenwirkungsarme Alternativen genauso wirksam oder Nutzen zweifelhaft
 Opioide, sind eine dem Opium ähnliche "uneinheitliche Gruppe natürlicher und synthetischer Substanzen, die morphinartige Eigenschaften aufweisen" (Wikipedia). Sie gehören zu den stärksten Mitteln gegen schwere chronische Schmerzen, die durch einen Tumor oder andere schmerzintensive Erkrankungen hervorgerufen werden.
Opioide, sind eine dem Opium ähnliche "uneinheitliche Gruppe natürlicher und synthetischer Substanzen, die morphinartige Eigenschaften aufweisen" (Wikipedia). Sie gehören zu den stärksten Mitteln gegen schwere chronische Schmerzen, die durch einen Tumor oder andere schmerzintensive Erkrankungen hervorgerufen werden.
Da diese Mittel eine erhebliche Menge schwerer Nebenwirkungen haben, gibt es zahlreiche Untersuchungen, die zu klären versuchen, ob Opioide z.B. bei rheumatischen Erkrankungen wie Arthritis, Erkrankungen des Nervensystems oder Problemen mit der Rückenmuskulatur oder Wirbelsäule gegenüber anderen Therapien wirklich so viel wirksamer sind, dass die Nachteile vernachlässigt werden können. Bei den anderen Therapien handelt es sich vor allem um psychologische und physiotherapeutische Verfahren. Die praktische Bedeutung dieses Vergleichs ergibt sich u.a. daraus, dass rund ein Viertel der Bevölkerung an chronischen Schmerzen leidet, die nicht Folge einer Krebserkrankung sind.
Eine von Wissenschaftlern der Berliner Charité und der Technischen Universität Darmstadt durchgeführte Meta-Analyse von 46 randomisierten kontrollierten Studien (RCTs) mit insgesamt 10.742 TeilnehmerInnen aus insgesamt 3.647 dazu durchgeführten Studien zeigten ein unerwartetes Ergebnis:
• Starke Schmerzmittel, die über einen längeren Zeitraum gegen nicht tumorbedingte chronische Schmerzen eingenommen werden, haben den gleichen Effekt wie eine Behandlung ohne Medikamente, d.h. mit Placebos, psychologischen oder physiotherapeutischen Verfahren. Bei längerfristigen Opioidbehandlungen ist der Anteil der Behandlungsabbrecher außerdem sehr hoch und erschwert unverzerrte Nutzenbewertungen.
• Die Schlussfolgerung des Charité-Autors Stein lautet daher: "Bei der Behandlung chronischer Schmerzen, die nicht durch einen Tumor hervorgerufen werden, sollte ein multidisziplinärer Ansatz, also einer, der nicht nur die medizinischen, sondern auch die psycho-sozialen und physiotherapeutischen Aspekte berücksichtigt, im Vordergrund stehen".
Die Studienergebnisse wurden in dem Aufsatz Analgesic efficacy of opioids in chronic pain - recent meta-analyses von Reinecke H, Weber C, Lange K, Simon M, Stein C und Sorgatz H. in der Fachzeitschrift "British Journal of Pharmacology" am 15. Februar 2014 online veröffentlicht. Das Abstract ist kostenlos erhältlich.
Ebenfalls auf methodisch hohem Niveau beschäftigte sich bereits am 29. August 2013 ein gegenüber einer älteren Version aus dem Jahr 2006 aktualisierter Cochrane Review damit, welchen Nutzen und welche gesundheitlich unerwünschten Wirkungen eine Opioidbehandlung neuropathischer Schmerzen hat. In den Review gingen 31 RCTs ein. Die VerfasserInnen weisen generell darauf hin, dass es sich dabei häufig um sehr kurzzeitige Behandlungen von wenigen Stunden und Tagen handelt, Untersuchungen der Wirkungen längerer Behandlungen also fehlen. Außerdem sind an den meisten Studien nur sehr wenige PatientInnen beteiligt.
Die Studienlage fassen die Cochrane-Reviewer so zusammen: "Short-term studies provide only equivocal (zweifelhaft, mehrdeutig) evidence regarding the efficacy of opioids in reducing the intensity of neuropathic pain. Intermediate-term studies demonstrated significant efficacy of opioids over placebo, but these results are likely to be subject to significant bias because of small size, short duration, and potentially inadequate handling of dropouts. Analgesic efficacy of opioids in chronic neuropathic pain is subject to considerable uncertainty. Reported adverse events of opioids were common but not life-threatening." Und: "All these features are likely to make effects of opioids look better in clinical trials than they are in clinical practice. We cannot say whether opioids are better than placebo for neuropathic pain over the long term."
Von dem Cochrane Review Opioids for neuropathic pain von McNicol ED, Midbari A und Eisenberg E. (Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 8) ist die Zusammenfassung kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 5.4.14
Mehr Herzinfarkte in ärmeren Stadtteilen. Ergebnisse aus dem Bremer Herzinfarktregister
 In Bremer Stadteilen mit einer ungünstigen sozialen Bevölkerungsstruktur gibt es deutlich mehr Herzinfarkte als in sozial privilegierteren Bezirken. Infarktpatienten aus sozial schwachen Vierteln sind außerdem jünger als ihre Leidensgenossen aus den besser gestellten Gegenden der Stadt und haben ein höheres Risiko, innerhalb eines Jahres nach dem Infarkt zu sterben.
In Bremer Stadteilen mit einer ungünstigen sozialen Bevölkerungsstruktur gibt es deutlich mehr Herzinfarkte als in sozial privilegierteren Bezirken. Infarktpatienten aus sozial schwachen Vierteln sind außerdem jünger als ihre Leidensgenossen aus den besser gestellten Gegenden der Stadt und haben ein höheres Risiko, innerhalb eines Jahres nach dem Infarkt zu sterben.
Das berichtete die Studienkoordinatorin Susanne Seide vom Klinikum Links der Weser auf dem Kongress der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie (ESC) im September 2013 in Amsterdam. Ihre Forschungsgruppe analysierte 2.061 Herzinfarkt-Patienten des Bremer Herzinfarktregisters im Hinblick auf den Sozialstatus. Dabei teilte sie die Stadtteile der Patienten nach dem sogenannten Allgemeinen Bremer Benachteiligungsindex (BI) und der Einkommensstatistik in vier Gruppen ein. Der BI berücksichtigt Kriterien wie Arbeitslosigkeit oder Beschäftigung, Migrationshintergrund, Schulbildung, Kriminalität, Wahlbeteiligung oder Geschlecht und Alter der Bevölkerung.
In den Teilen der Stadt mit dem niedrigsten Sozialstatus gab es 66 Herzinfarkte pro 100.000 Einwohner, in den sozial stärksten Gegenden betrug dieses Verhältnis 47 pro 100.000 Einwohner. Die Infarktpatienten aus den sozial schwächsten Bezirken waren mit durchschnittlich 62 Jahren signifikant jünger als die sozial besser gestellten Patienten. Diese waren durchschnittlich 67 Jahre alt.
Einen gewissen Hinweis auf die Ursachen liefern die erfassten kardiovaskulären Risikofaktoren. Die Patienten mit dem geringsten Sozialstatus rauchten häufiger regelmäßig Zigaretten als die aus den besten Stadtvierteln (51 versus 36 Prozent) und hatten häufiger starkes Übergewicht (26 versus 17 Prozent).
Bremen hat eine lange Tradition in der erfolgreichen Erforschung der Bedeutung sozialer Faktoren für die gesundheitliche Lage der Bevölkerung. Die Datenlage für Bremen wie auch bundesweit ist sehr konsistent. Das hat auch das Robert-Koch-Institut aus Berlin bereits vor vielen Jahren erkannt und gab die Parole aus "Taten statt Daten". Zumindest hat sich allmählich die Erkenntnis durchgesetzt, dass es manifeste wissenschaftliche Nachweise dafür gibt, dass soziale Begleitumstände bei Herzinfarkten eine weitaus größere Rolle spielen als von Ärzten gemeinhin angenommen wird.
Die Ergebnisse der Studie von Seide et al. finden sich im ESC Abstract 1968 - Socially disadvantaged city districts show a higher incidence of acute ST-Elevation myocardial infarctions due to elevated risk factors-results from the Bremen STEMI registry, die einer Pressemitteilung der "Deutschen Gesellschaft für Kardiologie (DKG)" vom September 2013 zugrundeliegen.
Uwe Helmert, 22.1.14
Wie häufig erhielten GKV-Versicherte 2008-2012 Hüft-/Knie-Endoprothesen und welche Leistungen erhielten sie vor- und nachoperativ?
 Die Endoprothetik - der operative Einsatz von Implantaten in den Körper, um Arthrose-geschädigte Gelenke dauerhaft zu ersetzen - verbessert die Lebensqualität vieler Patienten mit degenerativen Gelenkerkrankungen und ist aus der modernen Medizin nicht mehr wegzudenken. Experten sind jedoch überzeugt, dass rund zehn Prozent der Operationen in Deutschland unnötig sind. Im Vergleich zu anderen Ländern ist Deutschland nach einem im Frühjahr 2013 veröffentlichten Bericht der "Organisation für Economic Co-operation and Development (OECD)" Spitzenreiter oder liegt nach anderen Berichten bei der endoprothetischen Versorgung mit Hüft- und Kniegelenken auf einem der Medaillenränge. Ärzte und Krankenhäuser müssen sich mit dem Vorwurf auseinandersetzen, das eigene wirtschaftliche Interesse über das ihrer Patienten zu stellen. Wird in Deutschland zu schnell operiert?
Die Endoprothetik - der operative Einsatz von Implantaten in den Körper, um Arthrose-geschädigte Gelenke dauerhaft zu ersetzen - verbessert die Lebensqualität vieler Patienten mit degenerativen Gelenkerkrankungen und ist aus der modernen Medizin nicht mehr wegzudenken. Experten sind jedoch überzeugt, dass rund zehn Prozent der Operationen in Deutschland unnötig sind. Im Vergleich zu anderen Ländern ist Deutschland nach einem im Frühjahr 2013 veröffentlichten Bericht der "Organisation für Economic Co-operation and Development (OECD)" Spitzenreiter oder liegt nach anderen Berichten bei der endoprothetischen Versorgung mit Hüft- und Kniegelenken auf einem der Medaillenränge. Ärzte und Krankenhäuser müssen sich mit dem Vorwurf auseinandersetzen, das eigene wirtschaftliche Interesse über das ihrer Patienten zu stellen. Wird in Deutschland zu schnell operiert?
Diese und weitere Versorgungsdetails zur Prävalenz von endoprothetischen Operationen des Knie- und Hüftgelenks in den Jahren 2008 bis 2012 untersucht Bernard Braun, Gesundheitswissenschaftler am Zentrum für Sozialpolitik der Universität Bremen anhand von Routinedaten in einem Ende November 2013 veröffentlichten Gesundheitsreport für die überwiegend in Nordwestdeutschland lebenden Versicherten der gesetzlichen Krankenkasse hkk.
Zusätzlich zu den vor kurzem auch bereits mit den Routinedaten anderer GKV-Kassen - z.B. denen der AOK im Faktencheck Gesundheit Knieoperationen (Endoprothetik) - Regionale Unterschiede und ihre Einflussfaktoren der Bertelsmann Stiftung - untersuchten Häufigkeiten dieser Operationen analysierte der hkk-Report auch erstmalig die in den Kassendaten dokumentierte vor- und nachoperative (jeweils 6 Monate) Inanspruchnahme ausgewählter Leistungen wie ambulant-ärztliche Behandlungsfälle, Heil- und Hilfsmittel sowie Arzneimittel.
Die Ergebnisse lauten u.a. so:
• Im Untersuchungszeitraum steigt die Anzahl der Operationen bei hkk-Versicherten nahezu kontinuierlich an. Während im Jahr 2008 noch 598 operierte Hüft-Endoprothesen registriert wurden, waren es 2012 bereits 723 - ein Anstieg von 21 Prozent. Ein ähnliches Bild zeigt sich bei den Knie-Endoprothesen mit 347 Fällen in 2008 sowie 432 Fällen in 2012, was einer Steigerung von 24,5 Prozent entspricht.
• Bundesweit stagniert laut Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) die Anzahl der erstimplantierten Hüft- und Knie-Endoprothesen seit 2009 auf dem erreichten hohen Niveau. Um die Vergleichbarkeit der hkk-Daten mit anderen Studien zu gewährleisten, nutzt die Studie die Zahl der Fälle pro 100.000 Versichertenjahre (VJ) als gemeinsame Berechnungsgrundlage. Dabei ergibt sich erwartungsgemäß, dass die durchschnittlich jüngeren hkk-Versicherte im Vergleich zum bundesweiten Behandlungsgeschehen seltener eine Knie-Prothese erhalten: Im Referenzjahr 2011 waren es 118,2 Erstimplantationen je 100.000 VJ, während der bundesweite Vergleichswert bei AOK-Versicherten 129,5 betrug. Im gleichen Jahr wurden bei der hkk 175,8 Hüft-Endoprothesen je 100.000 VJ erstmals eingesetzt. In diesem Fall liegen jedoch keine Referenzzahlen für den Bundesdurchschnitt vor.
• Der hkk Gesundheitsreport zeigt einen deutlichen Anstieg von Revisionen und Wechseln bei hkk-Versicherten: Von 2008 bis 2012 zeigte sich bei Hüft-Endoprothesen ein prozentualer Anstieg von 75 Prozent; bei Knie-Endoprothesen lag dieser Wert bei 45 Prozent. Bundesweit nahmen die Revisionen und Wechsel bei Knie-Endoprothesen im Vergleichszeitraum mit 43 Prozent ähnlich stark zu; die Anzahl der Hüft-Endoprothesen ist jedoch seit 2009 leicht rückläufig.
• Bei der Analyse der Inanspruchnahme ausgewählter Leistungen fällt vor-operativ der im Vergleich mit dem gesamten vor- und nachoperativen Leistungsvolumen relativ geringe Umfang der nachweislich hilfreichen (vgl. dazu den entsprechenden Forum-Beitrag "Evidenz für den Nutzen von Gewichtsabnahme, Bewegungssport und Muskelaufbau als Methoden für Patienten mit Knie-/Hüft-Arthrose") Heilmittelleistungen, also von Physiotherapie etc. auf. Hier könnte es sich um eine Unter- und Fehlversorgung handeln. Für die 6 Monate nach der Operation ist besonders der noch lang andauernde spezifische Behandlungsbedarf gegen offensichtich starke (indiziert durch die Verordnung von Opioden) Schmerzen und Bewegungsprobleme auffällig.
• Die zum Teil in diesem Umfang nicht erwarteten Häufigkeiten des vor- und nachoperativen Befindens und Behandlungsgeschehens begründen die Notwendigkeit einer noch besseren Information und Aufklärung der an Arthrose erkrankten Personen über die konservativen Behandlungsmöglichkeiten und die realistischen Erfolge einer Operation. Personell könnte dies durch unabhängige Ärzte erfolgen. Als Instrument könnten so genannte evidenzbasierte Entscheidungshilfen oder "decision aids" eingesetzt werden, die sich bei der Vermeidung noch nicht notwendiger Operationen bzw. der Initiierung konservativer Behandlung von Gelenkerkrankungen bereits als erfolgreich erwiesen haben (siehe dazu den entsprechenden Forumbeitrag "Der Boom der Knie- und Hüftgelenks-Endoprothesen-Operationen kann durch "decision aids" signifikant gebremst werden").
• Unabhängig von den genannten Maßnahmen unterstützt der Verfasser des Reports und die hkk die Bemühungen um den Aufbau und eine zeitnahe Auswertung eines Endoprothesenregisters.
Den hkk-Gesundheitsreport zum Thema Knie- und Hüft-(Total-)Endoprothesen 2008 bis 2012 von Bernard Braun ist komplett kostenlos erhältlich.
Ein Interview mit Dr. Bertram Regenbrecht, Zentrum für Endoprothetik, Fußchirurgie, Kinder- und Allgemeine Orthopädie der Roland Klinik, Bremen, das aus Sicht des klinischen Praktikers die Ergebnisse des Reports kommentiert und erweitert, ist ebenfalls kostenlos erhältlich.
Jens Holst, 1.1.14
Evidenz für den Nutzen von Gewichtsabnahme, Bewegungssport und Muskelaufbau als Methoden für Patienten mit Knie-/Hüft-Arthrose
 Eine Arthrose der Kniegelenke ist häufige Ursache von chronischen Schmerzen und eingeschränkter Gehfähigkeit. Durch eine insbesondere in Deutschland immer häufigere operative Lösung werden Teile oder das gesamte Kniegelenk durch eine Teile- oder Total-Endoprothese ersetzt. Es gibt Anzeichen dafür, dass eine Reihe von konservativen nichtoperativen Behandlungsmöglichkeiten mit dem Schwerpunkt auf Bewegungsübungen und Muskelaufbau relativ wenig genutzt werden. Dies hängt nicht zuletzt von Annahmen über die geringe Nützlichkeit für die Linderung von Schmerzen und Erleichterung der Beweglichkeit oder gar die Schädlichkeit z.B. von Bewegungs- oder Physiotherapien ab.
Eine Arthrose der Kniegelenke ist häufige Ursache von chronischen Schmerzen und eingeschränkter Gehfähigkeit. Durch eine insbesondere in Deutschland immer häufigere operative Lösung werden Teile oder das gesamte Kniegelenk durch eine Teile- oder Total-Endoprothese ersetzt. Es gibt Anzeichen dafür, dass eine Reihe von konservativen nichtoperativen Behandlungsmöglichkeiten mit dem Schwerpunkt auf Bewegungsübungen und Muskelaufbau relativ wenig genutzt werden. Dies hängt nicht zuletzt von Annahmen über die geringe Nützlichkeit für die Linderung von Schmerzen und Erleichterung der Beweglichkeit oder gar die Schädlichkeit z.B. von Bewegungs- oder Physiotherapien ab.
Ob diese Annahmen berechtigt sind oder das Gegenteil zutrifft, wurde in mehreren aktuellen wissenschaftlichen Studien genauer untersucht.
In einer in der Zeitschrift "Journal of the American Medical Association" im September 2013 veröffentlichten randomisierten Studie wurden die Auswirkungen einer gewichtsreduzierenden und damit belastungsreduzierenden Diät auf die Funktion der Kniegelenke und deren Entzündung untersucht.
Dazu wurden 454 übergewichtige (BMI 27-41) und über 55 Jahre alten Erwachsene, die an Schmerzen und einer eindeutig diagnostizierten Kniearthrose litten, zufällig drei Gruppen zugewiesen: einer Gruppe Intensivdiät plus Sport, einer Nur-Intensivdiät- sowie einer Nur-Sport-Gruppe.
Nach 18 Monaten hatten die Angehörige der ersten Gruppe am meisten (10,6 kg), die der dritten Gruppe am wenigsten abgenommen (1,8 kg), was zu einer mehr oder weniger starken Verringerung des messbaren Drucks auf die Kniegelenke führte. Ferner nahm die Konzentration von Entzündungsmarkern ab - in den beiden ersten Gruppen mehr als in der Sportgruppe. Bei den für den weiteren Umgang mit der Arthrose und darunter besonders für die Entscheidung für oder gegen eine Endoprothesen-Operation besonders wichtigen Knieschmerzen und die Beweglichkeit der Kniegelenke sah die Situation in der Diät-Sport-Gruppe signifikant besser aus als in den Mono-Maßnahmengruppen.
Eine Gewichtsreduktion von rund 10% des Körpergewichts durch Diät und Sport hat also zumindest für die 18 Monate Laufzeit der Studie gereicht, um die gesundheitsbezogene Lebensqualität zu verbessern und den subjektiven Druck in Richtung einer Operation zu mindern.
Auch wenn die AutorInnen dieser Studie keine Empfehlungen für wirksame Sportarten geben, ist davon auszugehen, dass dabei besonders kniebelastende Arten wie das Joggen gemieden und knieschonende wie das Radfahren bevorzugt werden sollten.
Ebenfalls im September 2013 veröffentlichte eine Autorengruppe aus Großbritannien einen systematischen Review samt einer Metaanalyse zu den Ergebnissen von 60 Studien über die Wirkung von sportlichen Übungen und Muskelaufbauprogrammen bei 8.218 PatientInnen mit einer Knie- (44 Studien), Hüft- (2 Studien) oder Knie- und Hüftgelenksarthrose (14 Studien). In diesen meist randomisierten und kontrollierten Studien wurden die positiven Effekte verschiedener konservativer Sport- und Aufbauprogramme auf Schmerzen und Funktion der arthrotisch erkrankten Gelenke mit den Effekten in einer Patientengruppe verglichen, die an keinem der Programme teilnahm.
In einer selten abschließenden Art und Weise ("further trials are unlikely to overturn this result") kommen die AutorInnen zu dem Ergebnis, es gäbe ausreichende Evidenz dafür, dass Patienten mit einer Hüft- und besonders mit einer Kniegelenksarthrose durch die Teilnahme an den genannten Programmen einen signifikanten gesundheitlichen Nutzen gegenüber Patienten ohne ein solches Programm haben. Dabei tragen Übungen zum Muskelaufbau, der Förderung von Beweglichkeit und Aerobic-Training besonders zur Schmerzlinderung und Wiederherstellung von Beweglichkeit bei. Eine Kombination dieser Maßnahmen scheint den Nutzen zu erhöhen.
Anstatt weiter am Nutzen dieser Art von Maßnahmen zu zweifeln, sollte nach Ansicht der AutorInnen der Schwerpunkt weiterer Debatten darauf liegen, wie PatientInnen für sie zu gewinnen sind bzw. ihre "Angstschwelle" zu überwinden ist und wie sie diese dauerhaft in Anspruch nehmen. Dies gilt mit Sicherheit auch für die PatientInnen, die mit einem Diätprogramm starten wollen und es durchhalten wollen.
Der Aufsatz Effects of Intensive Diet and Exercise on Knee Joint Loads, Inflammation, and Clinical Outcomes Among Overweight and Obese Adults With Knee Osteoarthritis: The IDEA Randomized Clinical Trial von Stephen P. Messier et al. ist am 25. September 2013 in JAMA (310(12): 1263-1273) erschienen - ein Abstract ist frei erhältlich.
Der Review Exercise for lower limb osteoarthritis: systematic review incorporating trial sequential analysis and network meta-analysis von Olalekan A Uthman et al. erschien am 20. September 2013 in der Fachzeitschrift BMJ {347: f5555) und ist komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 16.12.13
"Das dauert 7 Tage oder eine Woche" - Auch Volksmund, Großmütter und Ratgeber täuschen sich bei der Dauer von Kinderkrankheiten
 Die mehr anekdotischen oder volksmundigen Angaben zur Dauer der nicht seltenen akuten Infektionen der oberen Atemwege ihrer Kinder beruhigen Eltern nicht unbedingt und lassen sie häufig nach massiveren Interventionen von Ärzten rufen. Geben diese u.a. auch wegen ihres mangelnden gesicherten Wissens über die Leidensdauer von Kind und Eltern diesem Ruf nach, hat man eine der Ursachen für die Über- und Fehlversorgung von Kindern und Jugendlichen mit Antibiotika.
Die mehr anekdotischen oder volksmundigen Angaben zur Dauer der nicht seltenen akuten Infektionen der oberen Atemwege ihrer Kinder beruhigen Eltern nicht unbedingt und lassen sie häufig nach massiveren Interventionen von Ärzten rufen. Geben diese u.a. auch wegen ihres mangelnden gesicherten Wissens über die Leidensdauer von Kind und Eltern diesem Ruf nach, hat man eine der Ursachen für die Über- und Fehlversorgung von Kindern und Jugendlichen mit Antibiotika.
Wie lange eine dieser Erkrankungen minimal und maximal dauert, untersuchten nun us-amerikanische Sozialmediziner auf der Basis von 23 randomisierten kontrollierten Studien und 25 Beobachtungsstudien, die sie aus 22.182 zu diesem Thema in den letzten Jahren veröffentlichten Untersuchungen auswählten.
Bei 90% der Kinder (in Klammern stehen die Tage nach denen bei 50% der Kinder keine Symptome mehr vorhanden sind) waren
• Ohrenschmerzen nach 7 bis 8 Tagen (nach 3 Tagen),
• Halsentzündungen nach 2 bis 7 Tagen,
• starker Husten oder Pseudokrupp nach 2 Tagen (nach einem Tag),
• Bronchiolitis nach 21 Tagen (nach 13 Tagen),
• akuter Husten nach 25 Tagen (nach 10 Tagen),
• normale Erkältungen nach 15 Tagen (nach 10 Tagen) und
• unspezifische Infektionen der oberen Atemwege nach 16 Tagen (nach 7 Tagen)vorbei.
Die AutorInnen merken an, dass einige dieser Erkrankungen länger dauern als in den derzeit in den USA und in Großbritannien verbreiteten Ratgeber zu lesen ist oder der Volksmund annimmt, bei anderen dagegen die Ratgeberangaben bestätigt werden. Um Fehlreaktionen der genannten Art zu verhindern und Grundlagen für eine evidenzbasierte Behandlungsentscheidung oder eben auch den Verzicht auf Behandlung zu schaffen, schlagen sie eine entsprechende Korrektur der Angaben vor.
Der Aufsatz Duration of symptoms of respiratory tract infections in children: systematic review von Matthew Thompson et al. ist am 11. Dezember 2013 im "British Medical Journal" (347: f7027) als open-access-Veröffentlichung erschienen.
Bernard Braun, 14.12.13
"Wer hat noch nicht, wer will noch mal": Ist die "Statinisierung" der Weltbevölkerung zwingend, sinnvoll oder vermeidbar?
 Nach der im November 2013 erfolgten Veröffentlichung einer neuen, von zahlreichen renommierten Experten erarbeiteten Leitlinie der beiden seriösen US-Fachgesellschaften "American College of Cardiology" und "American Heart Association" zur Bewertung des individuellen kardiovaskulären Risikos und zur Senkung erhöhter "böser" oder LDL-Cholesterinwerte (low-density lipoprotein cholesterol) insbesondere mit Statinen merkt die interessierte Öffentlichkeit erst langsam deren quantitative und qualitative Bedeutung.
Nach der im November 2013 erfolgten Veröffentlichung einer neuen, von zahlreichen renommierten Experten erarbeiteten Leitlinie der beiden seriösen US-Fachgesellschaften "American College of Cardiology" und "American Heart Association" zur Bewertung des individuellen kardiovaskulären Risikos und zur Senkung erhöhter "böser" oder LDL-Cholesterinwerte (low-density lipoprotein cholesterol) insbesondere mit Statinen merkt die interessierte Öffentlichkeit erst langsam deren quantitative und qualitative Bedeutung.
Im Mittelpunkt dieser Leitlinie steht eine selbst nach Meinung der Leitlinienkritiker monumentale Aufarbeitung der wissenschaftlichen Evidenz für einen Nutzen der Statintherapie. So taucht allein der Begriff "evidence" im Teil der Leitlinien über die Bewertung des kardiovaskulären Risikos 346 mal und im Teil, in dem es um die Behandlung geht sogar 522 mal auf. Die Anzahl der zitierten randomisierten kontrollierten Studien, die den Sinn und Nutzen einer Senkung des "bösen" Cholesterins und die Möglichkeiten der Prävention von Herzinfarkt und Schlaganfall untersucht haben, ist entsprechend groß.
Die Problematik der Leitlinie und ihrer praktischen Konsequenzen spitzt der Präventionsexperte J. Ioannidis vom "Stanford Prevention Research Center" in einem Kommentar ("viewpoint") in der Ausgabe des "Journal of the American Medical Association" vom 2. Dezember 2013 so zu: "It is uncertain whether this would be one oft he greatest achievements or one oft the worst disasters of medical history".
Die für ihn dabei leitenden Folgen und Umstände der Leitlinie und ihres Risikoberechnungsmodells sind u.a. folgende:
• Von den 101 Millionen Angehörigen der Bevölkerung in den USA, die aktuell an keiner kardiovaskulären Erkrankung leiden und zwischen 40 und 79 Jahre alt sind, hätten 33 Millionen nach dem Modell für die folgenden 10 Jahre ein Risiko für einen Herzinfarkt, Schlaganfall etc. von 7,5% und höher. Ihre intensive Behandlung mit Statinen wäre nach der Leitlinie in höchstem Maße empfehlenswert. Für 13 Millionen mit einem Risiko zwischen 5% und 7,4% empfiehlt die Leitlinie, die Einnahme von Statinen zu erwägen. Fast die Hälfte der aktuell kardiovaskulär gesunden Bevölkerung müsste bzw. könnte also dauerhaft mit Stationen behandelt werden.
• Der Autor berechnet schließlich nach demselben Modell und mit eher zurückhaltenden Annahmen, dass weltweit mindestens 920 Millionen kardiovaskulär gesunder Menschen mit Statinen behandlungsbedürftig wären. Berücksichtigt man dann noch, dass weltweit auch ein paar hundert Millionen kardiovaskulär kranker oder Menschen mit extrem hohen Cholesterinwerten schon mit Statinen behandelt werden, wird die quantitative Wirkung der Leitlinie und deren qualitative Relevanz für die Dauermedikation von weltweit mindestens anderthalb Milliarden Personen noch deutlicher.
• Die Kritik des Kommentators richtet sich vor allem auf die wissenschaftliche Qualität des der Leitlinie zu Grunde liegenden Modells der Risikovorhersage sowie die Unabhängigkeit eines Teils ihrer Verfasser. So hatten laut eines 2013 im "British Medical Journal" erschienenen Aufsatzes 8 der 15 Leitlinienautoren Beziehungen zu Pharmaunternehmen.
• Die Kritik am Modell richtet sich vor allem darauf, dass es zwar randomisierte kontrollierte Studien zur Wirkung von Statinen auf das LDL gibt, aber "no randomized evidence that this particular risk model, rather than any of its predecessors built with the same, similar, or other predictors, would identify the patients who benefit most from statin therapy and that the optimal treatment threshold is 5%, 7,5%, or even 2,5% or 15%." Zwischen jedem dieser Risiko-Schwellenwerte liegen mehrere hundert Millionen behandelter oder unbehandelter gesunder Menschen und natürlich mindestens genauso hohe Summen erzielter oder nicht erzielter Umsätze der Statinhersteller.
• Nicht zuletzt müssten nach Ansicht des Autors bei den Schwellenwerten für die Behandlungsnotwendigkeit aber auch die bekannten unerwünschten Wirkungen bei Statinen (stärker) berücksichtigt werden.
• Der Kommentar endet mit dem Appell, es müsse angesichts der bisherigen und künftigen Umsätze mit Statinen doch möglich sein, einen im Verhältnis kleinen Betrag einzusetzen um das beste Modell zur Prädiktion und der Behandlungsschwellenwerten von kardiovaskulären Erkrankungen zu erforschen und dafür genügend StudienteilnehmerInnen zu finden.
Die rund 50-seitige Leitlinie 2013 ACC/AHA Guideline on the Assessment of Cardiovascular Risk. A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines von Goff Jr DC, Lloyd-Jones DM, Bennett G, O'Donnell CJ, Coady S, Robinson J, D'Agostino Sr RB, Schwartz JS, Gibbons R, Shero ST, Greenland P, Smith Jr SC, Lackland DT, Sorlie P, Levy D, Stone NJ, Wilson PWF ist am 12. November 2013 online und komplett kostenlos in der Zeitschrift "Journal of the American College of Cardiology" und in der Zeitschrift "Circulation" erschienen.
Die jüngste und mit Sicherheit nicht letzte kritische Auseinandersetzung mit der Leitlinie More Than a Billion People Taking Statins?Potential Implications of the New Cardiovascular Guidelines von John Ioannidis ist am 2. Dezember 2013 online und ebenfalls kostenlos im "Journal of the American Medical Association" erschienen. Der Autor verweist auf eine Reihe für die weitere Debatte lehr- und hilfreiche Veröffentlichungen.
Bernard Braun, 3.12.13
Telemonitoring bei der Behandlung von COPD-PatientInnen: kostenträchtig und unwirksam!
 Zu den zukunftsträchtigen Lieblingsentwicklungen mancher Medizinproduktehersteller, Gesundheitspolitiker, Krankenkassenvertreter und auch mancher Patientenvertreter gehören in jüngster Zeit die Telemedizin und darunter besonders das Telemonitoring. Und als ob es die Über- und Fehlversorgung mit hunderten oder gar tausenden Leistungen nicht gäbe, die meist auch nur durch die Akklamation dieser Angehörigen eines gesundheitsindustriellen und -politischen Netzwerks in die Leistungskataloge gekommen sind und jetzt mühselig daraus entfernt werden müssen, wird auch beim Telemonitoring kritische empirische Überprüfung durch Herstellerprospektwissen oder die einseitige Betrachtung positiver Studien ersetzt. Ohne die spezifischen positiven Wirkungen des Einsatzes von Telemedizin oder Telemonitoring bei bestimmten Problemen und Personengruppen zu ignorieren, ist die Kenntnisnahme der nicht wenigen kontrollierten Untersuchungen mindestens genauso wichtig, die entweder für andere spezifische Krankheiten oder Lebenslagen nur einen geringen oder gar keinen Nutzen finden.
Zu den zukunftsträchtigen Lieblingsentwicklungen mancher Medizinproduktehersteller, Gesundheitspolitiker, Krankenkassenvertreter und auch mancher Patientenvertreter gehören in jüngster Zeit die Telemedizin und darunter besonders das Telemonitoring. Und als ob es die Über- und Fehlversorgung mit hunderten oder gar tausenden Leistungen nicht gäbe, die meist auch nur durch die Akklamation dieser Angehörigen eines gesundheitsindustriellen und -politischen Netzwerks in die Leistungskataloge gekommen sind und jetzt mühselig daraus entfernt werden müssen, wird auch beim Telemonitoring kritische empirische Überprüfung durch Herstellerprospektwissen oder die einseitige Betrachtung positiver Studien ersetzt. Ohne die spezifischen positiven Wirkungen des Einsatzes von Telemedizin oder Telemonitoring bei bestimmten Problemen und Personengruppen zu ignorieren, ist die Kenntnisnahme der nicht wenigen kontrollierten Untersuchungen mindestens genauso wichtig, die entweder für andere spezifische Krankheiten oder Lebenslagen nur einen geringen oder gar keinen Nutzen finden.
Dies gilt auch für die am 17. Oktober 2013 im "British Medical Journal" erschienene verblindete, multizentrische und randomisiert kontrollierte Studie über den Nutzen den heimisches Telemonitoring bei der Behandlung und dem Selbstmanagement der relativ häufigen chronisch-obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) gegenüber der üblichen Behandlung hinzufügt. Die Indikatoren für Nutzen waren die Verzögerung einer Krankenhauseinweisung wegen eines schweren Krankheitsschubes und die Verbesserung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität.
Durchgeführt wurde die Studie zwischen 2009 und 2011 in Schottland und mit PatientInnen, die im Jahr vor dem Studienbeginn an COPD erkrankt waren. Die 128 PatientInnen in der Telemonitoringgruppe konnten über entsprechende technische Einrichtungen wichtige krankheitsspezifische Körperwerte und Symptome täglich an ihre ärztliche Zentrale melden. Die 128 Angehörigen der Kontrollgruppe erhielten die übliche Behandlung in mehreren Arztkonsultationen. Alle Studienteilnehmer erhielten umfassende Anleitungen zum Selbstmanagement.
Nach einem Jahr dauerte es bei den Angehörigen der Telemonitoringgruppe nicht signifikant länger bis zum nächsten Krankheitsschub mit notwendiger stationärer Behandlung (362 Tage gegenüber 361 Tagen in der Kontrollgruppe). Auch die durchschnittliche Anzahl der Krankenhauseinweisungen differierte mit 1,2 in der Interventionsgruppe gegenüber 1,1 in der Kontrollgruppe kaum. Und auch die Liegedauer im Krankenhaus unterschied sich mit 9,5 zu 8,8 Tagen praktisch nicht bzw. sogar etwas zu Gunsten der in üblicher Form behandelten PatientInnen. Und schließlich hatte Telemonitoring auch keinen bzw. keinen signifikanten Einfluss auf Angst, Depression, Selbstwirksamkeitsüberzeugung, das Wissen, die Therapietreue und ein paar andere Lebensqualitätsindikatoren.
Zusammenfassend stellen die AutorInnen die interessante Hypothese auf, dass der in anderen Studien beobachtete Nutzen oder die positive Wirkung von Telemonitoring weniger auf dessen spezifischer Wirkung beruhe, sondern mehr mit der mit der Einführung von Telemonitoring einhergehenden Verstärkung der personellen Ausstattung und ihrer Kommunikationsbereitschaft. Telemonitoring stelle also eher einen Hebel für Personalerweiterungen mit den entsprechenden positiven Wirkungen bei Patienten dar. Selbstverständlich muss dies erst noch in anderen Studien mit überprüft werden.
Der Kommentar eines Editors mündet in der für die COPD-Behandlung erst einmal schlüssig belegten Feststellung, "the addition of telemonitoring ... is costly and ineffective".
Der Aufsatz Effectiveness of telemonitoring integrated into existing clinical services on hospital admission for exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease: researcher blind, multicentre, randomised controlled trial von Hilary Pinnock et al. ist im "British Medical Journal (BMJ)" (2013; 347:f6070} als Open Access-Beitrag erschienen und daher komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 23.10.13
USA: Über 80% aller Antibiotika-Verordnungen bei Halsentzündungen sind nicht notwendig und zu viele Breitband-Antibiotika
 Um verstehen zu können warum Antibiotika bei vielen Krankheiten nicht helfen aber trotzdem durch Resistenzbildungen schädliche Auswirkungen haben können und man bei bestimmten Erkrankungen lieber Penicillin statt Breitband-Antibiotika verordnet und einnimmt, braucht man keine komplexen Risikoraten rechnen oder Dreisatzaufgaben bewältigen. Es reichen regelmäßige Blicke in die medizinische und pharmakologische Fachliteratur, gute Tageszeitungen oder TV-Magazine in denen seit Jahren vor der herrschenden Verordnungs- und Behandlungspraxis bei Antibiotika mit immer drastischeren Eckzahlen gewarnt wird.
Um verstehen zu können warum Antibiotika bei vielen Krankheiten nicht helfen aber trotzdem durch Resistenzbildungen schädliche Auswirkungen haben können und man bei bestimmten Erkrankungen lieber Penicillin statt Breitband-Antibiotika verordnet und einnimmt, braucht man keine komplexen Risikoraten rechnen oder Dreisatzaufgaben bewältigen. Es reichen regelmäßige Blicke in die medizinische und pharmakologische Fachliteratur, gute Tageszeitungen oder TV-Magazine in denen seit Jahren vor der herrschenden Verordnungs- und Behandlungspraxis bei Antibiotika mit immer drastischeren Eckzahlen gewarnt wird.
Trotzdem scheinen diese Informationen und Szenarien nicht bei verordneten Ärzten und ihren PatientInnen anzukommen - in den USA. Dies ist jedenfalls das Ergebnis einer Analyse der Verordnung von Antibiotika bei banalen Halsentzündungen ("sore throat") in den Jahren 1997 bis 2010, über die am 3. Oktober 2013 in einem "Research letter" in der Fachzeitschrift "JAMA Internal Medicine" berichtet wird.
Für die weitere Bewertung sind zwei gesicherte Erkenntnisse wichtig: Erstens werden lediglich rund 10% aller Halsentzündungen durch einen mit Antibiotika überhaupt behandelbaren Erreger verursacht. Dieser Erreger ist zweitens am besten mit dem "schmalen" und preisgünstigen Antibiotika-Klassiker Penicillin behandelbar und braucht nicht den Einsatz eines wesentlich teureren Breitband-Antibiotikums.
Wie sich die Verschreibungshäufigkeiten von Ende der 1980er Jahre bis 1993, 1998 und zuletzt 2010 verändert haben, wie also der Public Health-Diskurs zu den Antibiotika bei Ärzten und PatientInnen angekommen ist, untersuchten zwei Gesundheitswissenschaftler mit Daten aus zwei repräsentativen Surveys zur ambulanten Versorgung in den USA.
Dabei kam mehrerlei heraus:
• Der Anteil der Besuche bei Allgemeinärzten wegen einer Halsentzündung sank von 1997 bis 2010 signifikant von 7,5% auf 4,3%. Der Anteil von Halsentzündungen an sämtlichen Besuchen einer stationären Notfallstation bewegte sich zwischen 2,2% und 2,3%.
• Bis 1993 sank die Rate der PatientInnen, die einen niedergelassenen Arzt mit einer Halsentzündung konsultierten und von ihm Antibiotika verordnet bekamen, von rund 80% auf 70%. Im Jahr 2000 war die Rate noch einmal auf 60% gefallen - also gemessen an der versorgungsepidemiologischen Notwendigkeit von rund 10% immer noch auf ein völlig unangemessenes Niveau.
• Trotz verstärkter Aufklärungsbemühungen über den nicht notwendigen Antibiotika-Einsatz betrug die Rate 2010 aber immer noch 60%.
• 2010 wurde die von Leitlinien unentwegt empfohlene Verordnung von Penicillin mit stabiler Tendenz während 9% der Arztbesuche wegen einer Halsentzündung verordnet, ein Breitband-Antibiotikum dagegen mit steigender Tendenz während 15% der Besuche.
• Allein die nicht notwendige Verordnung von Antibiotika kostete zwischen 1997 und 2010 konservativ geschätzt 500 Millionen US-Dollar. Hinzu kommen noch erhebliche Ausgaben im Zusammenhang mit den unerwünschten Wirkungen der Antibiotika-Einnahme.
Offensichtlich kann die enorme Resistenz gegen allgemeine wissenschaftliche oder populärwissenschaftliche Aufklärung bei Ärzten selbst nach jahrelange Bemühungen nicht beseitigt werden. Die bereits in Modellversuchen getestete direkte und datengestützte Information der einzelnen Ärzte über ihre Antibiotika-Verordnungspraxis könnte u.U. wirklich die einzige Methode sein, an ihrer gesundheitlich problematischen Praxis etwas zu ändern. Das Problem ist nur, dass kein Arzt verpflichtet werden kann, diese Information zu erhalten und auch umzusetzen.
Der Forschungsbrief Antibiotic Prescribing to Adults With Sore Throat in the United States, 1997-2010 von Michael L. Barnett und Jeffrey A. Linder ist in der Fachzeitschrift "JAMA Internal Medicine" zuerst online erschienen und kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 7.10.13
Der Boom der Knie- und Hüftgelenks-Endoprothesen-Operationen kann durch "decision aids" signifikant gebremst werden
 Der teilweise oder komplette Ersatz von Knie- und Hüftgelenken, die überwiegend durch Arthrose zerstört wurden oder massiv in ihrer Funktion beeinträchtigt sind, durch künstliche Endoprothesen gehört mittlerweile zu den häufigsten Operationen in deutschen Krankenhäusern. Nach einer Statistik der OECD belegt Deutschland im Vergleich mit den OECD-Ländern bei der Häufigkeit von Knie-Endoprothesen-Operationen Platz 2 und bei der Häufigkeit implantierter künstlicher Hüftgelenke sogar Platz 1. Darüber, ob dies zu viel ist, also eigentlich gesundheitlich nicht notwendige Operationen vor allem aus ökonomischen Kalkülen verstärkt durchgeführt werden, wird gestritten und soll erst eine weitere Studie Klarheit schaffen.
Der teilweise oder komplette Ersatz von Knie- und Hüftgelenken, die überwiegend durch Arthrose zerstört wurden oder massiv in ihrer Funktion beeinträchtigt sind, durch künstliche Endoprothesen gehört mittlerweile zu den häufigsten Operationen in deutschen Krankenhäusern. Nach einer Statistik der OECD belegt Deutschland im Vergleich mit den OECD-Ländern bei der Häufigkeit von Knie-Endoprothesen-Operationen Platz 2 und bei der Häufigkeit implantierter künstlicher Hüftgelenke sogar Platz 1. Darüber, ob dies zu viel ist, also eigentlich gesundheitlich nicht notwendige Operationen vor allem aus ökonomischen Kalkülen verstärkt durchgeführt werden, wird gestritten und soll erst eine weitere Studie Klarheit schaffen.
Selbst stationär tätige Orthopäden scheuen aber bereits heute nicht vor der Behauptung zurück, in Deutschland würde zu schnell operiert. Konkret sagte der Direktor der Orthopädischen Klinik der Universität Regensburg, Joachim Grifka, in einem Interview am 18.9.2013 folgendes: "Ich schätze, dass jede zehnte Gelenkoperation unnötig ist. Bei etwa 200.000 Hüftoperationen im Jahr und rund 160.000 Knie-Ops kommt da einiges zusammen", nämlich rund 36.000 unnötige Operationen, die trotzdem ein hohes Risiko von gefährlichen und teuren Komplikationen oder Krankenhausinfektionen haben.
Bereits vor dem per Gutachten möglichen Ende der Diskussion in mehreren Jahren sollte aber ein erfolgreicher Versuch zur Kenntnis genommen werden, die Häufigkeit der Knie- und Hüftgelenks-OPs und damit das Auftreten unerwünschter Folgen der Operationen und die damit verbundenen Kosten argumentativ zu senken.
In einer Beobachtungsstudie wurden 820 bzw. 3.510 Versicherten eines großen Krankenversicherungsunternehmens im US-Bundesstaat Washington, die eine endoprothetische Operation eines Hüft- bzw. Kniegelenks als elektive Leistung vorhatten, über ihre behandelnden Aerzte so genannte "decision aids" angeboten. "Decision aids" sind medial verständliche und auf der Basis des bestmöglichen Wissens über die Art der Erkrankung und die Folgen einer Operation verfasste Entscheidungshilfen für Patienten und Aerzte.
Sie enthielten realistische Darstellungender vor-operativen Interventionsmöglichkeiten, der nach-operativen Gesundheits- und Lebensqualität und relativieren unrealistische Heilungserwartungen bzw. Erwartungen zum raschen Verschwinden spezifischer Beschwerden wie vor allem der Schmerzen und anhaltender Beweglichkeitsprobleme. Sie beabsichtigen außerdem durch entsprechende Hinweise auf die Dauer der nach-operativen erkrankungsspezifischen Behandlung von vornherein die Therapietreue der Endoprothesen-PatientInnen zu verbessern.
Im Vergleich mit einer Kontrollgruppe von PatientInnen, die ebenfalls an Kox- oder Gonarthrose litten und eine Endoprothesenoperation planten, ging die Nutzung der Behandlungs-Entscheidungshilfen mit einer über 6 Monate anhaltenden signifikanten Verringerung der Hüft-Endoprothesen-Operationen um enorm viele 26% und der Knie-Endoprothesen-Operationen um 38% einher. In den 6 Beobachtungsmonaten waren die Kosten in der "decision aids"-Gruppe um 12 bis 21% niedriger als in der Patientengruppe ohne Entscheidungshilfen mit einer entsprechend höheren Operationswahrscheinlichkeit.
Eine Schwäche dieser Interventionsstudie ist ihre kurze Beobachtungszeit von 6 Monaten. Möglicherweise haben sich also alle Personen, die unter dem Einfluss der "decision aids" auf eine Hüft- oder Kniegelenks-Operationen verzichtet haben, ab dem siebten Monat doch operieren lassen. Niemand hält die Kritiker des Designs und Zweifler am Nutzen dieser Interventionsart aber davon, die Interventionsmethode zu replizieren und die Untersuchungsgruppe deutlich länger zu beobachten.
Die Studie von Arterburn D. et al. ist bereits im September 2012 unter dem Titel Introducing Decision Aids at Group Health was linked to sharply lower hip and knee surgery rates and costs in der Fachzeitschrift "Health Affairs" (31, No. 9: 2094-2104) erschienen. Davon ist kostenlos das Abstract erhältlich.
Bernard Braun, 18.9.13
Leitliniengerechte schnelle Behandlung von Herzinfarktpatienten durch Gefäßerweiterung senkt nicht das Sterblichkeitsrisiko
 Aktuelle Leitlinien zur Behandlung von Herzinfarktpatienten empfehlen, dass der zeitliche Abstand zwischen dem Infarkt und der Erweiterung von Herzkranzgefäßen mit einem Ballonkatheter (perkutane Koronararterien-Erweiterung [PCI]) 90 oder weniger Minuten betragen sollte. Diese so genannte "door-to-balloon-time" gilt daher auch als Maß für eine optimale Behandlung und als Richtschnur für Maßnahmen, diese Zeit so weit wie möglich zu verkürzen. Ob eine "door-to-balloon-time" von 90 und weniger Minuten die Sterblichkeit der Patienten innerhalb des Krankenhauses oder die Sterblichkeit innerhalb der 30 Tage nach dem Herzinfarkt senkt, war bisher nicht bekannt oder klar.
Aktuelle Leitlinien zur Behandlung von Herzinfarktpatienten empfehlen, dass der zeitliche Abstand zwischen dem Infarkt und der Erweiterung von Herzkranzgefäßen mit einem Ballonkatheter (perkutane Koronararterien-Erweiterung [PCI]) 90 oder weniger Minuten betragen sollte. Diese so genannte "door-to-balloon-time" gilt daher auch als Maß für eine optimale Behandlung und als Richtschnur für Maßnahmen, diese Zeit so weit wie möglich zu verkürzen. Ob eine "door-to-balloon-time" von 90 und weniger Minuten die Sterblichkeit der Patienten innerhalb des Krankenhauses oder die Sterblichkeit innerhalb der 30 Tage nach dem Herzinfarkt senkt, war bisher nicht bekannt oder klar.
Um diesen Zustand zu beenden untersuchten nun us-amerikanische WissenschaftlerInnen mit Daten des so genannten "CathPCI Registry", ob und wie die Sterblichkeit bei 96.738 Herzinfarktpatienten, bei denen eine PCI durchgeführt wurde, mit der Zeitdauer zwischen Infarkt und PCI zusammenhängt. Die Daten stammen aus 515 Krankenhäusern, die an diesem Register mitarbeiten und aus dem Zeitraum Juli 2005 bis Juni 2009.
Zu den wichtigsten Ergebnissen zählen:
• Die mittlere "door-to-balloon-time" sank in den ersten 12 Monaten des Beobachtungszeitraums signifikant von durchschnittlich 83 Minuten auf 67 Minuten in den letzten 12 beobachteten Monaten.
• Entsprechend nahm der Anteil der Patienten mit einer "door-to-balloon-time" von 90 und weniger Minuten ebenfalls signifikant von 59,7% im ersten auf 83,1% im letzten Jahr zu.
• Trotz dieser Verbesserungen des Zeitraums zwischen Infarkt und Gefäßerweiterung veränderte sich die Sterblichkeit im Krankenhaus unadjustiert nur geringfügig (von 4,8% auf 4,7%) und nicht signifikant. Daran änderte sich auch nach einer Risikoadjustierung der Patienten nichts: Die Sterblichkeitsrate innerhalb des Krankenhauses sank von 5% auf 4,7% und verfehlte die Signifikanz erneut erheblich (p=0,34).
• Die mit Daten der staatlichen Krankenversicherung Medicare durchgeführte Analyse der 30-Tage-Sterblichkeit nach Herzinfarkt und PCI identifizierte sogar trotz der beträchtlichen Abnahme der "door-to-balloon-time" einen leichten Anstieg von 9,7% auf 9,8%, der allerdings auch nicht statistisch signifikant war (p=0,64).
Diese Ergebnisse sollten zwar nicht zum Anlass genommen werden, die Zeit zwischen Infarkt und PCI oder anderen klinischen Interventionen nicht noch weiter zu verkürzen. Sie sollten aber Motivation sein auch noch über andere Maßnahmen für Infarktpatienten nachzudenken, die deren Sterblichkeitsrisiko senken können.
Der Aufsatz Door-to-Balloon Time and Mortality among Patients Undergoing Primary PCI von Daniel S. Menees et al. ist am 5. September 2013 im "New England Journal of Medicine" (369: 901-909) erschienen von dem das Abstract kostenlos erhältlich ist.
Bernard Braun, 6.9.13
Finger weg von Makrolidantibiotika bei Herzkranken
 Antibiotika vom Typ der Makrolide erfreuen sich wegen Ihrer einfachen Anwendung und eher leichten unerwünschten Arzneimittelwirkungen insbesondere im ambulanten Bereich seit Jahren größter Beliebtheit bei der Behandlung von Atemwegs- und anderen Infektionen. Nach dem Arzneimittelverordnungs-Report 2012 gehören Makrolide in Deutschland mit 56,7 Mio. verordneten Tagesdosen zu dem am häufigsten verordneten Antibiotika (nach Amino-Penicillinen, Cephalosporinen und Tetrazyklinen (59,1 Mio.)). Die breite massenhafte Anwendung von Makrolidantibiotika nicht nur in Deutschland lässt auch seltene unerwünschte Wirkungen zu Tage treten, die vor allem für die Verordnungspraxis und therapeutische Verwendung von großer Bedeutung sind.
Antibiotika vom Typ der Makrolide erfreuen sich wegen Ihrer einfachen Anwendung und eher leichten unerwünschten Arzneimittelwirkungen insbesondere im ambulanten Bereich seit Jahren größter Beliebtheit bei der Behandlung von Atemwegs- und anderen Infektionen. Nach dem Arzneimittelverordnungs-Report 2012 gehören Makrolide in Deutschland mit 56,7 Mio. verordneten Tagesdosen zu dem am häufigsten verordneten Antibiotika (nach Amino-Penicillinen, Cephalosporinen und Tetrazyklinen (59,1 Mio.)). Die breite massenhafte Anwendung von Makrolidantibiotika nicht nur in Deutschland lässt auch seltene unerwünschte Wirkungen zu Tage treten, die vor allem für die Verordnungspraxis und therapeutische Verwendung von großer Bedeutung sind.
Lange Zeit galten Antibiotika und insbesondere Makrolide auch als Ansatz zur medizinischen Prävention oder sogar Behandlung der koronaren Herzkrankheit (KHK). Bereits Ende der 1980er Jahre war zunächst in Finnland aufgefallen, dass Patienten mit KHK häufiger als bei Vergleichspersonen einen positiven Titer von Antikörpern gegen Chlamydia pneumoniae aufwiesen. Mit ihrem Artikel Serological Evidence of an Association of a Novel Chlamydia, TWAR, with Chronic Coronary Heart Disease and Acute Myokardial Iinfarction, von dem kostenfrei nur das Abstract zur Verfügung steht, erweckte die Helsinkier Forschungsgruppe um Pekka Saikku Hoffnungen, die KHK nicht mehr nur symptomatisch, sondern auch antibiotisch und damit ursächlich behandeln zu können. Später gelang den finnischen Experten auch der Nachweis von Clamydien in atheromatösen Plaques - die 1993 in der Zeitschrift Circulation (87 (4), S: 1130-1134) veröffentlichte Studie von Eila Linnanmäki und Kollegen mit dem Titel Chlamydia pneumoniae-specific circulating immune complexes in patients with chronic coronary heart disease steht allen Interessierten als Volltext zur Verfügung. Da Makrolide gegen Chlamydien wirksam sind, folgten alsbald erste Untersuchungen zur Behandlung der Arteriosklerose mit Azithromycin oder Roxithromycin unter der sich anfangs abzeichnenden Erwartung, unter den behandelten Patienten die Häufigkeit koronarer Ereignisse senken zu können.
Allerdings waren die Fallzahlen waren eher klein, die Befunde waren insgesamt uneinheitlich und blieben folglich umstritten, wie aus einer Übersichtsarbeit der drei Epidemiologen John Danesh, Rory Collins und Richard Peto aus Oxford hervorgeht. Ihre Studie mit dem Titel Chronic infections and coronary heart disease: is there a link? erschien 1997 im Lancet, kostenfrei ist hier für Nicht-Abonenten wiederum nur das Abstract einsehbar. Ihre Zusammenfassung spricht für sich: "The available evidence about chronic infections and CHD is still sparse and its interpretation is limited by potential biases. For H(elicobacter) pylori , residual confounding by causal risk factors may account entirely for the rather weak epidemiological associations that have been reported. For C(hlamydia) pneumoniae, the evidence of association is stronger, but the temporal sequence of infection and CHD is uncertain." Eine deutschsprachige Zusammenfassung der damaligen Studienlage findet sich in dem mittlerweile frei zugänglichen Artikel Behandlung der Koronaren Herzerkrankung mit Antibiotika? aus dem Arzneimittelbrief Nr 31 von 1997 (AMB 1997, 31, 75b).
Einer Reihe größerer kontrollierter Studien zur Wirksamkeit von Makroliden bei KHK bestätigte in der Folgezeit zunehmend die Zweifel an der These einer wirksamen Behandlung von Durchblutungsstörungen des Herzens mit chlamydien-wirksamen Antibiotika. Eine Metaanalyse dieser Untersuchungen kam zu dem Ergebnis, dass Makrolide auf den Verlauf der Erkrankung keinen wesentlichen Einfluss nehmen. Das Journal of the American Medical Association stellt den Beitrag Effects of Antibiotic Therapy on Outcomes of Patients With Coronary Artery Disease: A Meta-analysis of Randomized Controlled Trialsder New Yorker Kardiologen Richard Andraws, Jeffrey Berger und David Brown kostenfrei als Volltext zum Download bereit.
Spätestens seit 2006 kam zusätzlich zu den Zweifeln an der Wirksamkeit einer antiobiotischen KHK-Behandlung der Verdacht auf, die Gabe von Makroliden an Patienten mit manifester Erkrankung der Herzkranzgefäße könnte sogar deren Sterblichkeit erhöhen. Verschiedene kürzlich erschienen epidemiologische Studien bestätigen nun die Hinweise aus kleineren Studien, dass antibiotische Behandlungen mit Makroliden, insbesondere mit Clarithromycin und Azithromycin, kardiovaskuläre Risikopatienten gefährlichen Komplikationen aussetzen.
Im Rahmen der Randomisierten, placebokontrollierten multizentrischen Studie zur Bewertung einer kurzfristigen Clarithromycin-Gabe bei Patienten mit stabiler koronarer Herzkrankheit berichtete eine Forschergruppe der Universität Kopenhagen über eine signifikant gesteigerte Letalität unter Makrolid-Behandlung. In einem doppeltblinden Ansatz und hatten sie randomisiert insgesamt 4.373 Patienten nach ihrer Entlassung aus stationärer Behandlung wegen akuten Myokardinfarkts oder Koronarsyndroms sowie nach Bypass-Operation zwei Wochen lang entweder mit Clarithromycin (2.172 Personen) oder Placebo (2.201 Patienten) behandelt. Im Anschluss verfolgten sie über drei Jahre personenbezogen den Krankheitsverlauf an Hand des dänischen Krankenhaus- und Sterberegisters. Endpunkte des CLARICOR trial waren Gesamtletalität, Myokardinfarkt oder instabile Angina pectoris sowie Letalität aufgrund von Durchblutungsstörungen des Herzens, Myokardinfarkt oder instabile Angina pectoris. Bei der Häufigkeit dieser beiden Endpunkte zeigten beide Gruppen keinen bedeutsamen Unterschied, aber die kardiovaskuläre Letalität war in der mit Clarithromycin behandelten Gruppe signifikant erhöht (5,1 % vs. 3,5 %; p = 0,01). Dieser Unterschied zeigte sich allerdings nicht kurzfristig, sondern erst ab dem zweiten Jahr. Auf der Homepage der angesehenen Medizinerzeitschrift British Medical Journal (BMJ) steht die CLARICOR-Studie von Christian Jespersen und Kollegen in voller Länge kostenfrei zum Download zur Verfügung.
Eine bereits im Mai 2012 publizierte Studie aus Nashville in Tennessee hatte ebenfalls einen Zusammenhang zwischen einer Azithromycin-Therapie und der anschließenden kardiovaskulären Sterblichkeit aufgezeigt. Die Auswertung von mehr als 3 Millionen Medicaid-Patienten hatte gezeigt, dass das Risiko, nach 5-tägiger Behandlung mit diesem Makrolid an einem kardiovaskulären Ereignis zu sterben, mit 85,1 Fällen pro 1 Million zwar insgesamt gering, aber dennoch signifikant höher als in der Kontrollgruppe (29,8 / 1 Million) und im Vergleich zu der mit einem Penicillin behandelten (31,5 / 1 Million). Auch dabei zeigte sich, dass eine Azithromycon-Behandlung vor allem bei Patienten mit vorbestehender KHK das Sterblichkeitsrisiko erhöhte. Die Studie der Nashviller Forscher um Wayne Ray stellt das New England Journal of Medicine allen Interessenten kostenfrei zum Download zur Verfügung: Azithromycin and the Risk of Cardiovascular Death
Im März 2013 publizierte nun das BMJ die Ergebnisse einer Untersuchung über das kardiovaskuläre Risiko einer kurzzeitigen Therapie mit Clarithromycin bei Patienten mit akuter Exazerbation einer chronisch-obstruktiven Lungenerkrankung und mit ambulant erworbener Lungenentzündung. Das britisch-australische Forscherteam wertete dafür die Daten zweier prospektiver multizentrischer Beobachtungsstudien mit insgesamt etwa 3.000 Teilnehmern aus, und zwar der Edinburgh-Pneumonie-Kohortenstudie und der EXODUS-Studie (Exacerbations of Obstructive Lung Disease managed in UK Secondary care). Dabei betrachteten Stuart Schembri und seinen Kollegen einen kombinierten Endpunkt aus Krankenhausaufnahme infolge akuten Koronarsyndroms, dekompensierter Herzinsuffizienz, bedrohlichen Rhythmusstörungen oder plötzlichem Herztod im ersten Jahr nach der Akuttherapie. Ein multivariater Vergleich der Patienten der Verum- mit denen der Kontrollgruppe, die ein anderes Antibiotika erhalten hatten, aber hinsichtlich Alter, Geschlecht, Anamnese, Schweregrad ihrer Erkrankung und Begleittherapie den Patienten entsprachen, die eine Makrolid-Therapie erhalten hatten, zeigten sich interessante Befunde.
Bei Patienten mit chronisch-obstruktiver Lungenerkrankung traten im Verlauf des ersten Jahres insgesamt 268 bedrohliche kardiovaskuläre Ereignisse auf, die unter Clarithromycin signifikant häufiger als in der Kontrollgruppe waren. Ebenso waren akute Koronarereignisse in der Verum-Gruppe häufiger und die kardial bedingte Sterblichkeit höher. Der kombinierte Endpunkt war zwar bei den durchschnittlich jüngeren und gesünderen Pneumonie-Patienten insgesamt seltener, aber auch zeigte sich bei den Clarithromycin-Behandelten eine erhöhte Inzidenz. Das galt nicht nur beim Koronarsyndrom und der kardialen Letalität, sondern eine Subgruppen-Analyse zeigte eine Korrelation zwischen Dauer und Schwere der Herzkrankheit und der Häufigkeit des Auftretens kardiovaskulärer Komplikationen. Zudem ergaben sich Hinweise, dass das Komplikationsrisiko mit der dem Alter der Patienten und der Dauer der Einnahme von Makroliden steigt.
Im Zuge seiner Open-Access-Politik stellt das BMJ den vollständigen Bericht über die Studie Cardiovascular events after clarithromycin use in lower respiratory tract infections: analysis of two prospective cohort studies zum Download zur Verfügung.
Zu etwas anderen Ergebnissen kommt eine im Mai 2013 ebenfalls im New England Journal of Medicine 368 (18): 1704-1712 publizierte Studie auf Grundlage des umfangreichen dänischen Patientenregisters mit Daten von fast 5 Millionen Bürgern zwischen 18 und 64 Jahren. Die Untersuchung bezog Arzneimittelverordnungen, die kardiovaskuläre Letalität sowie mehr als sechzig Daten zu Diagnostik und Therapie ein und wertete sie retrospektiv unter multivariater Adjustierung aus. Die Kopenhagener Forscher analysierten die Sterblichkeit wegen Durchblutungsstörungen des Herzens während und bis 35 Tage nach Gabe von Azithromycin und verglichen mehr als 1,1 Millionen Behandlungsperioden mit der von gleich vielen Kontrollen ohne antibiotische Therapie sowie 7.364.292 Patienten, die während der 13-jährigen Beobachtungszeit teilweise wiederholt Penicillin eingenommen hatten. Dabei konnten sie nachweisen, dass die kardiovaskuläre Letalität während der Behandlungsphasen mit dem Makrolidantibiotikum signifikant höher war als bei Patienten, die kein Antibiotikum erhalten hatten. Ein signifikantes Zusatzrisiko der AM-Therapie gegenüber der Penicillin- Therapie war dabei nicht erkennbar.
Dies scheint auf den ersten Blick im Widerspruch zu den Ergebnissen aus und Tennessee und Großbritannien zu stehen. Bei genauerer Analyse zeigt sich aber, dass die Patienten der dänischen Registerstudie durchschnittlich neun Jahre jünger waren und entsprechend seltener an einer Herzkreislauferkrankung litten. Betrachtet man die Ergebnisse älterer und kränkerer Patienten isoliert, belegt auch die dänische Kohorte eine höhere Letalität nach Azithromycin-Behandlung. Die aktuelle Studienlage lässt nur einen Schluss zu: Je höher das kardiovaskuläre Ausgangsrisko eines Patienten, desto größer ist die Gefährdung durch Makrolidgaben. Also: Finger weg von diesem Antibiotikum bei älteren Koronarpatienten!
Von der dänischen Kohortenstudie mit dem Titel Use of Azithromycin and Death from Cardiovascular Causes steht nur das einigermaßen ausführliche Abstract kostenfrei zum Download zur Verfügung.
Jens Holst, 4.8.13
Mehr Schaden als Nutzen oder Fehlversorgung? Antidepressiva und Hüftfrakturen im höheren Lebensalter
 Die Heilung von Knochenfrakturen aller Art und die Wiederherstellung der vorherigen Beweglichkeit und Sicherheit zahlreicher körperlicher Prozesse dauert insbesondere bei älteren Menschen sehr lange, belastet die Lebensqualität (z.B. Schmerzen und Schmerzbehandlung) oder kommt teilweise auch gar nicht mehr zustande.
Die Heilung von Knochenfrakturen aller Art und die Wiederherstellung der vorherigen Beweglichkeit und Sicherheit zahlreicher körperlicher Prozesse dauert insbesondere bei älteren Menschen sehr lange, belastet die Lebensqualität (z.B. Schmerzen und Schmerzbehandlung) oder kommt teilweise auch gar nicht mehr zustande.
Die Hüftfraktur gehört zu den Erkrankungen mit den gravierendsten Folgen und sollte daher möglichst verhindert werden. Eine verminderte Knochendichte und -stabilität sowie Stürze gehören zu den wichtigsten Ursachen und damit auch präventiven Ansatzpunkten.
Eine landesweite prospektive Kohortenstudie mit allen 906.422 in Norwegen vor 1945 geborenen Personen untersuchte jetzt, ob nicht auch Arzneimittel und dabei insbesondere die für ältere Personen relativ häufig verordneten Antidepressiva eine wichtige Rolle als Risikofaktor spielen.
Die ForscherInnengruppe erhielt für ihre Untersuchung sämtliche Informationen über alle zwischen 2004 und 2010 erfolgten Verordnungen von Antidepressiva und Angaben über alle Hüftfrakturen im Zeitraum 2005-10. Der für den Vergleich des Neueintretens einer Hüftfraktur bei PatientInnen mit oder ohne Antidepressiva-Verordnungen genutzte Indikator war die standardisierte Inzidenzrate (SIR).
Die Ergebnisse:
• 4,4% dieser Kohorte oder 39.938 Personen hatten im Untersuchungszeitraum eine Hüftfraktur.
• Dieses Risiko war bei Menschen mit der Verordnung irgendeines Antidepressivums signifikant höher als bei Personen ohne die Einnahme eines solchen Medikaments. Die SIR lag bei 1,7.
• Bei trizyklischen Antidepressiva lag SIR etwas niedriger, und zwar bei 1,4. Unter der Einnahme von selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (selective serotonin reuptake inhibitors [SSRIs]) war die Rate mit 1,8 am höchsten. Alle anderen Antidepressiva hatten eine SIR von 1,6.
• Daraus ergibt sich für Hüftfrakturen insgesamt ein zusätzliches oder attributives Risiko der Exposition gegen Antidepressiva von 4,7%.
Wer nicht der Meinung ist, Hüftfrakturen gehörten zum normalen stofflichen Altersrisiko und seien daher nicht vermeidbar, sollte sich nach dieser und weiteren Studien mit ähnlichen Ergebnissen intensiver mit der Art und dann auch noch der Menge der verordneten Arzneimittel (Stichwort Polypharmazie) kümmern. Auch wenn mit dieser Studie kein abschließender Beleg für einen ursächlichen Zusammenhang vorliegt, sollten die Ergebnisse trotzdem zu einer defensiveren Verordnung dieser Art von Arzneimittel Anlass sein und weitere Studien die jetzige signifikante Assoziation zu einem Ursache-Wirkungszusammenhang verdichten.
Der Aufsatz Increased risk of hip fracture among older people using antidepressant drugs: data from the Norwegian Prescription Database and the Norwegian Hip Fracture Registry von Marit Stordal Bakken et al. ist am 24. Februar 2013 in der Online-Ausgabe der Zeitschrift "Age Ageing" erschienen. Ein Abstract ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 1.3.13
Kostensparen durch Magenverkleinerung!!? Wie oft wollen Politik und Krankenkassen noch auf "Kostenwunder" hereinfallen?
 Zu den verlockendsten und meistgeglaubten Versprechungen der Anbieter von gesundheitsbezogenen Leistungen gehört es, mit geringeren Kosten bessere Qualität zu liefern oder zumindest die Kosten zu senken. Und genauso regelmäßig wie dies Gesundheitspolitiker und Krankenkassen glaubten, wuchs der Leistungskatalog mit dieser Art von Angeboten, die sich dann aber häufig als weder qualitativ hochwertig, noch wirksam und kostensparend erwiesen.
Zu den verlockendsten und meistgeglaubten Versprechungen der Anbieter von gesundheitsbezogenen Leistungen gehört es, mit geringeren Kosten bessere Qualität zu liefern oder zumindest die Kosten zu senken. Und genauso regelmäßig wie dies Gesundheitspolitiker und Krankenkassen glaubten, wuchs der Leistungskatalog mit dieser Art von Angeboten, die sich dann aber häufig als weder qualitativ hochwertig, noch wirksam und kostensparend erwiesen.
Das jüngste Beispiel, so eine in der Fachzeitschrift "JAMA Surgery" gerade veröffentlichte Studie, ist die als radikale und mit Sicherheit mittel- wie langfristig kostensparende Therapie für extrem Übergewichtige seit einigen Jahren propagierte und auch durchgeführte operative Verkleinerung des Magens. Angesichts der großen und zum Teil zunehmenden Anzahl von adipösen Personen und deren praktischen Schwierigkeiten dies durch ein anderes Ess- und Bewegungsverhalten zu ändern, schien die auch Adipositaschirurgie genannte Reihe von Verkleinerungstechniken eine Art Patentlösung zu sein.
Eine Untersuchung von anfänglich 29.820 Personen, die bariatrisch operiert worden waren, über 6 Jahre (2002 bis 2008) und der Vergleich ihrer gesundheitlichen Versorgung und deren Kosten mit den in gesundheitlicher Sicht ähnlichen (z.B. Betroffenheit von Übergewicht) Angehörigen einer nichtoperierten Vergleichsgruppe, zeigte aber ein wesentlich unpatenteres Bild.
Die gesamten Gesundheitsausgaben der operierten Personen waren bis zum dritten Jahr der Untersuchung größer als die der Kontrollgruppenangehörigen. In den weiteren Jahren ähneln sich die Ausgaben.
Dabei waren die Ausgaben der bariatrisch operierten Personen für Medikamente und Arztbesuche niedriger, die für stationäre Behandlung aber höher als in der Kontrollgruppe. Letztere entstanden überwiegend durch unerwünschte und zum Teil erst nach Jahren auftretenden Komplikationen und Folgen der überwiegenden Operationstechnik, einer so genannten laparoskopischen Operation.
Zusammenfassend betonten die AutorInnen und der Verfasser eines Editorials zwei Aspekte:
• "We were unable to identify any short- or long-term reductions in overall health care costs associated with surgery."
• Ein Herausgeber der Zeitschrift weist in seiner "invited critique" stattdessen auf eine qualitative völlig andere Herangehens- und Bewertungsweise für diese und andere Behandlungsangebote hin: "The indications for bariatric surgery should be viewed in terms of individual patient benefit without anticipating that there will be cost savings to a health care system by offering this treatment." Zum patientenbezogenen Nutzen und zu den Entscheidungskriterien für eine Operation gehört für die ForscherInnen auch noch das "well-being" der betroffenen Personen.
Der am 20. Februar 2013 zuerst online veröffentlichte Aufsatz Impact of Bariatric Surgery on Health Care Costs of Obese Persons. A 6-Year Follow-up of Surgical and Comparison Cohorts Using Health Plan Data von Jonathan P. Weiner et al. ist in der Fachzeitschrift "JAMA Surgery" (2013;():1-8) erschienen und komplett kostenlos zugänglich.
Der komplette Text der "Invited Critique" Is Bariatric Surgery Worth It? Comment on "Impact of Bariatric Surgery on Health Care Costs of Obese Persons" von Edward H. Livingston ist ebenfalls kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 22.2.13
Metaanalyse zeigt: Vitamine und antioxidative Nahrungsergänzungsmittel nützen nichts gegen Herz-Kreislaufkrankheiten.
 In der Fülle der zum Teil auch bereits im "forum-Gesundheitspolitik" vorgestellten Studien über den präventiven und therapeutischen Nutzen einer Reihe von industriell gefertigten Vitaminen und antioxidativen Nahrungsergänzungsmittel, überwiegen hochwertige Studien, die keine Evidenz dafür fanden, dass diese Produkte das Risiko einer Herz-Kreislauferkrankung signifikant verringern oder sich auf die Sterblichkeit auswirken. Es gab aber auch einige andere hochwertige Studien, die bei dem einen oder anderen Vitamin oder Nahrungsergänzungsmittel einen signifikanten Nutzen für die Prävention von Herz-Kreislauferkrankungen behaupteten. Was für die weitere Bewertung dieser Produkte und entsprechende praktische Schlussfolgerungen für die Prävention und die Versorgung von Kranken bisher fehlte, war eine umfassende Metaanalyse, die gleichzeitig die Ergebnisse möglichst aller hochwertigen aber inhaltlich uneinigen Studien zu diesem Bereich insgesamt berechnet.
In der Fülle der zum Teil auch bereits im "forum-Gesundheitspolitik" vorgestellten Studien über den präventiven und therapeutischen Nutzen einer Reihe von industriell gefertigten Vitaminen und antioxidativen Nahrungsergänzungsmittel, überwiegen hochwertige Studien, die keine Evidenz dafür fanden, dass diese Produkte das Risiko einer Herz-Kreislauferkrankung signifikant verringern oder sich auf die Sterblichkeit auswirken. Es gab aber auch einige andere hochwertige Studien, die bei dem einen oder anderen Vitamin oder Nahrungsergänzungsmittel einen signifikanten Nutzen für die Prävention von Herz-Kreislauferkrankungen behaupteten. Was für die weitere Bewertung dieser Produkte und entsprechende praktische Schlussfolgerungen für die Prävention und die Versorgung von Kranken bisher fehlte, war eine umfassende Metaanalyse, die gleichzeitig die Ergebnisse möglichst aller hochwertigen aber inhaltlich uneinigen Studien zu diesem Bereich insgesamt berechnet.
Hieran versuchte sich jetzt eine ForscherInnengruppe aus Südkorea und schuf sich dazu aus insgesamt 2.240 bis zum November 2012 veröffentlichten wissenschaftlichen Beiträgen zur primär- oder sekundärpräventiven Wirksamkeit von Vitaminen und antioxidativen Ergänzungsmitteln (z.B. Vitamin A, B-6, B-12, C, D, E, Betacarotin, Selen, Folsäure) eine Basis von 50 randomisierten kontrollierten Studie mit insgesamt 294.478 TeilnehmerInnen (156.663 TeilnehmerInnen in den Interventionsgruppen und 137.815 TeilnehmerInnen in Kontrollgruppen).
Die damit durchgeführte umfassende Metaanalyse einschließlich einiger Subgruppen-Metaanalysen, kommt zu folgenden Erkenntnissen:
• Die zusätzlich zur Aufnahme über die Nahrung konsumierten industriell gefertigten Vitamine und Antioxidantien waren nicht mit einem niedrigeren Risiko großer kardiovaskulärer Ereignisse (z.B. Herzinfarkt) assoziiert (relatives Risiko 1,00).
• Auch Subgruppen-Metaanalysen in denen z.B. der Typ der Prävention, einzelne Vitamine oder Ergänzungsmittel, der Typ des kardiovaskulären Ereignisses, das Design der Studie, die methodische Qualität, die Behandlungsdauer, der Finanzier der Studie jeweils gesondert berücksichtigt wurde, konnten keinen statistisch signifikanten Nutzeneffekt der untersuchten Produkte belegen.
• Bei Metaanalysen mit einigen kleineren Studien zeigten sich sowohl unerwünschte wie erwünschte Effekte: So stieg mit der Einnahme einiger Vitamine das Risiko einer Angina pectoris marginal an. Die Aufnahme niedriger Dosen von Vitamin B-6 war mit einem leicht niedrigeren Risiko schwererer Herz-Kreislauferkrankungen assoziiert. Sowohl nützliche wie schädliche Effekte verschwanden aber fast immer dann, wenn die Analysen mit den Daten von qualitativ hochwertigen RCTs wiederholt wurden.
• Wenn dann doch die Metaanalyse hochwertiger Studien z.B. eine Assoziation der Einnahme von Vitamin B-6 mit einem niedrigeren Risiko der kardiovaskulären Sterblichkeit oder eine Assoziation der Einnahme von Vitamin E mit einem niedrigeren Herzinfarktrisiko zeigte, handelte es sich immer und ausschließlich um Studien, in denen die Ergänzungsmittel von Pharmaherstellern bereitgestellt worden waren. Diese Effekte tauchten aber markant in RCTs nicht auf, die nicht von Herstellern oder mit deren Unterstützung durchgeführt worden waren. In den Worten der ForscherInnen zeigten sich die genannten nützlichen Effekte "only in trials with supplements provided by the pharmaceutical industry." Und der vorsichtige Versuch, dieses Phänomen zu erklären, lautet so: "So we cannot completely exclude the possibility that this might have influenced the respective trial design, results, or interpretations."
• Die WissenschaftlerInnen lassen keinen Zweifel daran aufkommen, dass sie ihre Ergebnisse und die einer Reihe anderer im Text zitierten AutorInnen für so gesichert und ernst halten, dass sie eigentlich zu gesetzgeberischen Schlussfolgerungen für den Konsumentenschutz führen müssten: "Most countries permit the pharmaceutical or food industry to sell these supplements under the name of functional food or medical food, and many people take vitamin or antioxidant supplements in the belief that they improve their health. Based on recent meta-analyses of randomised controlled trials, including the current study, however, governments and regulating agencies for food and drugs should consider vitamin and antioxidant supplements as medicinal products and strictly evaluate their efficacy and safety before marketing."
• Abschließend halten die WissenschaftlerInnen aber dennoch weitere Studien für notwendig, um zum Beispiel zu klären, ob die ergänzende Zufuhr von Vitaminen zumindest den Personen hilft, die zu Beginn einer solchen Studie eine mangelhafte Versorgung mit dem einen oder anderen Vitamin hatten.
• Und hier der obligatorische Hinweis: Auch diese Ergebnisse sind kein Plädoyer gegen den Nutzen von Obst. Nur besteht er nicht in der Prävention von Herzinfarkten!
Warum aber nimmt man die Hersteller zahlreicher "Gesundheits"Produkte der boomenden Gesundheitswirtschaft nicht beim Wort und verlangt von ihnen alles das an Nutzennachweis und Nachweis der Schädigungsfreiheit, was die Hersteller eines Teils der Gesundheits- und Medizinprodukte des ersten Gesundheitsmarktes immer mehr erbringen müssen, wenn sie mit dem Begriff "Gesundheit" Konsumenten zu gewinnen versuchen?!
Die Ergebnisse der umfassenden Metaanalysen von Myung SK, Ju W, Cho B, et al. sind am 18. Januar 2013 unter dem Titel Efficacy of vitamin and antioxidant supplements in prevention of cardiovascular disease: systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. im renommierten "British Medical Journal" (2013; 346: f10) veröffentlicht worden und im Rahmen der "open access"-Politik dieser Zeitschrift komplett kostenlos zugänglich. Als wahre Fundgruppe für zahlreiche weitere interessante Ergebnisse erweisen sich die umfänglichen Tabellen im Anhang zu diesem Aufsatz.
Bernard Braun, 1.2.13
Auch bei akuter Bronchitis Älterer schaden Antibiotika mehr als sie nutzen, außer bei begründetem Verdacht auf Lungenentzündung
 Die geläufigsten Argumente, bei Infektionen der oberen und besonders der unteren Atemwege Antibiotika zu verordnen, waren, dass dies "für alle Fälle" zur Verhinderung einer Lungenentzündung erfolge, man ja nie wisse ob es statt eines Virus- ein bakterieller Infekt sei bzw. die Klärung der Infektionsverursachers so aufwändig ist, dass "im Zweifelsfall" lieber Antibiotika verordnet werden und es z.B. bei Bronchitis "gut wäre" ein schnelles Ende zu erreichen, um eine Chronifizierung zu verhindern. Untersucht wurden der Wahrheitsgehalt bzw. die Evidenz für diese Annahmen und der Nutzen dieser Therapie bisher eher selten. Für die möglichen unerfreulichen Nebenwirkungen und vor allem das Risiko von Resistenzbildungen gab es dagegen bereits zahlreiche empirische Belege.
Die geläufigsten Argumente, bei Infektionen der oberen und besonders der unteren Atemwege Antibiotika zu verordnen, waren, dass dies "für alle Fälle" zur Verhinderung einer Lungenentzündung erfolge, man ja nie wisse ob es statt eines Virus- ein bakterieller Infekt sei bzw. die Klärung der Infektionsverursachers so aufwändig ist, dass "im Zweifelsfall" lieber Antibiotika verordnet werden und es z.B. bei Bronchitis "gut wäre" ein schnelles Ende zu erreichen, um eine Chronifizierung zu verhindern. Untersucht wurden der Wahrheitsgehalt bzw. die Evidenz für diese Annahmen und der Nutzen dieser Therapie bisher eher selten. Für die möglichen unerfreulichen Nebenwirkungen und vor allem das Risiko von Resistenzbildungen gab es dagegen bereits zahlreiche empirische Belege.
Eine aktuelle Studie mit 1.038 (Interventionsgruppe) und 1.023 (Kontroll-/Placebogruppe) über 60-jährigen PatientInnen mit Infektionen der unteren Atemwege untersuchte nun den Nutzen und Schaden des bei Bronchitis etc. häufig eingesetzten Antibiotikums Amoxicillin. Ausgeschlossen wurden PatientInnen mit nichtinfektiösen Ursachen ihrer Atemwegsinfekte und Personen bei denen der Verdacht auf eine bereits vorhandene Lungenentzündung bestand.
Die Ergebnisse:
• Mit Symptomen, die im Krankheitsverlauf auftraten oder sich verschlechterten, hatten die Antibiotika-PatientInnen statistisch signifikant weniger häufig zu kämpfen (15,9%) als die Angehörigen der Kontrollgruppe (19,3%). Der Unterschied war aber absolut recht gering.
• Bei der Dauer der Symptome gab es keine Unterschiede.
• Die StudienautorInnen sahen daher keine Evidenz für einen selektiven Nutzen des Antibiotikums Amoxicillins bei über 60-jährigen PatientInnen und empfehlen bei akuter Bronchitis, kein Antibiotikum zu verordnen und einzunehmen. Davon raten sie nur dann ab, wenn ein diagnostisch oder durch den Gesamtzustand des Patienten begründeter Verdacht auf eine Lungenentzündung vorliegt.
• Bei den mit dem Antibiotika behandelten PatientInnen traten Übelkeit, Hautausschläge oder Durchfall statistisch signifikant häufiger auf.
Die Autoren setzen sich selber mit einigen anderslautenden Ergebnissen und Empfehlungen in dem 2004 erschienen und 2010 geupdateten Cochrane-Review "Antibiotics for acute bronchitis" von Smith S, Fahey T, Smucny J, Becker L. auseinander und liefern plausible Begründungen für die Ursache der Unterschiede und für die höhere Gültigkeit ihrer Ergebnisse.
Trotzdem waren auch die Cochrane-Reviewer gegenüber dem Einsatz sämtlicher Antibiotika eher zurückhaltend: "There is limited evidence to support the use of antibiotics in acute bronchitis. Antibiotics may have a modest beneficial effect in some patients with acute bronchitis though data on subsets of patients who may benefit more from treatment is lacking. However, the magnitude of this benefit needs to be considered in the broader context of potential side effects, medicalisation for a self limiting condition, increased resistance to respiratory pathogens and cost of antibiotic treatment."
Von dem Aufsatz "Amoxicillin for acute lower-respiratory-tract infection in primary care when pneumonia is not suspected: a 12-country, randomised, placebo-controlled trial" von Paul Little et al., erschienen in der Februarausgabe 2013 der Fachzeitschrift "The Lancet Infectious Diseases" (Volume 13, Issue 2, Pages 123 - 129) gibt es kostenlos das Abstract.
Bernard Braun, 28.1.13
Viele, die "uns" am Hindukusch oder sonstwo verteidigen, werden schwer krank! Erfahrungsvorsprung der USA könnte Leid verkürzen!
 Auch hierzulande wird bei jeder irgendwie international bedeutsam erscheinenden kriegerischen Auseinandersetzung - zuletzt nach dem Einsatz französischer Truppen in Mali - fast automatisch überlegt, ob man Deutschland nicht nur am Hindukusch sondern z.B. auch vor Timbuktu in Gestalt von Soldaten verteidigen müsse.
Auch hierzulande wird bei jeder irgendwie international bedeutsam erscheinenden kriegerischen Auseinandersetzung - zuletzt nach dem Einsatz französischer Truppen in Mali - fast automatisch überlegt, ob man Deutschland nicht nur am Hindukusch sondern z.B. auch vor Timbuktu in Gestalt von Soldaten verteidigen müsse.
Was der Einsatz in diesen zum Teil so genannten asymmetrischen Kriegen für die Soldaten bedeutet und dass die Probleme nicht mit dem Abzug der entsandten Soldaten vorbei sind, wird spätestens seit der Beteiligung deutscher Soldaten am Afghanistankrieg auch in Deutschland in ersten Studien oder in Fernseh-Spielfilmen immer deutlicher gezeigt und bedacht.
Wer dies für übertrieben oder zu literarisch hält, kann sich mit der Lektüre der Anfang 2013 auf neun Bände angewachsenen Reihe der u.a. vom "Institute of Medicine" der USA herausgegebenen Erkenntnisse über die Spätfolgen des 1991 relativ schnell beendeten Golfkriegs gegen irakische Invasionstruppen gründlich eines Anderen belehren lassen.
22 Jahre nach Beendigung dieses Krieges zeigen Untersuchungen der staatlichen Krankenversicherung Veteran Affairs für aktive und ehemalige SoldatInnen der USA zweierlei:
• Von den in diesem Krieg eingesetzten rund 700.000 militärischen Personen leiden 175.000 bis 250.000 noch heute an einer Vielzahl langwieriger und medizinisch auch noch nicht richtig erklärten Symptomen, die als chronisch multisymptomatische Krankheit ("chronic multisymptom illness (CMI)") bezeichnet werden. 2001 lautete die Bezeichnung für diese Art von Krankheit noch "medically unexplained physical symptoms" oder MUPS.
• MUPS oder CMI sind weit mehr als die mittlerweile auch unter deutschen SoldatInnen erkannte, anerkannte aber ansonsten nur zum Teil ausreichend behandelte so genannte posttraumatische Belastungsstörung. CMI ist derartig vielgestaltig, dass das Krankheitsbild von Person zu Person andersartig sein kann. Eine Behandlung nach dem Ansatz "one size fits all" halten die us-amerikanischen ExpertInnen für völlig nutzlos.
Der Band 9 der Reihe beschäftigt sich daher vor allem damit Evidenz für die Behandlungsmöglichkeiten von CMI zusammenzutragen. Ein Studienreview zeigte, dass im Rahmen des notwendigen individuellen Krankheitsmanagement dem einen Ex-Soldaten eine kognitive Verhaltenstherapie, anderen Soldaten dagegen auch noch Serotonin-haltige Arzneimittel und weiteren erkrankten KriegsteilnehmerInnen Biofeedback, Akupunktur, St. John's wort (Johanniskraut), Aerobic-Training, Motivationsgespräche und/oder eine Fülle multimodaler Therapien geholfen haben. Für deren generelle Wirkung gibt es dagegen meist (noch) keine robuste wissenschaftliche Evidenz. Die von den IOM-AutorInnen angeregten Evidenzstudien dürften wahrscheinlich für die erkrankten Golfkriegs-TeilnehmerInnen kaum mehr von Nutzen sein.
Auch ohne das Ergebnis der Studien schlagen die CMI-ExpertInnen aber die Bildung von streng patientenbezogenen Behandlungsteams ("patient-aligned care teams") aus Allgemeinmedizinern, Fachärzten, Pflegekräften, Psychiatern, Sozialarbeitern und anderen Spezialisten vor. In jeder Veteran Affairs-Klinik sollen außerdem so genannte behandlungserfahrene "CMI-champions" gewonnen werden, welche die behandelnden Aerzte unterstützen sollen. Dabei spielt auch die Tatsache eine entscheidende Rolle, dass 2011/12 mindestens 2,6 Millionen militärische US-Amerikaner in Kriegen involviert waren, die nicht minder gesundheitsbelastend sind als der Golfkrieg.
Es kann nicht erwartet werden, dass es in Afghanistan stationierten Bundeswehrsoldaten nach ihrer Rückkehr gesundheitlich besser geht als den US-Soldaten. Vermutlich ist dies auch nicht der letzte Kriegseinsatz deutscher SoldatInnen. Daher sollten diese SoldatInnen nicht ihrem Schicksal oder der normalen GKV-basierten Behandlung überlassen bleiben. Und es sollte auch nicht erst auf jeden weiteren Fall gewartet werden, bevor diejenigen, die gestern und heute am Schreibtisch in Berlin oder Brüssel über Auslandseinsätze entscheiden sich des Erfahrungsschatzes der Veteran Affairs-Krankenversicherung und ihrer Behandlungsexperten bedienen und parallel zu ihren kriegerischen Entscheidungen für eine umfassende Behandlung und Versorgung der erkrankten Rückkehrer sorgen.
Die ausführliche Zusammenfassung der Ergebnisse des aktuellen Band 9 der IOM-Schriftenreihe "Gulf War and Health: Treatment for Chronic Multisymptom Illness." erhält man kostenlos. Dies gilt auch für die "summaries" acht vorher erschienenen Bände.
Bernard Braun, 26.1.13
1953, 1971, 2011: US-Soldaten (sterben) mit immer gesünderen Gefäßen. Ursachen: Gesünderes Verhalten oder Selektion?!
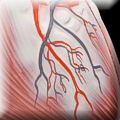 Für die solide und valide statt "gefühlte" Darstellung der Entwicklung der Inzidenz und Prävalenz von Krankheiten sollte möglichst auf Längsschnittuntersuchungen zurückgegriffen werden, die ihrerseits möglichst mit objektiven Daten angelegt sind. Viele "Epidemien" oder "dramatische Zunahmen" von Krankheiten beruhen nur auf den Ergebnissen von ein oder zwei in kurzen Abständen und mit unterschiedlichen Fragen durchgeführten Querschnittsbefragungen und viel ihrer angeblichen Dynamik basiert auf einem Detektions- oder Publikationsbias oder der Entstigmatisierung bestimmter Krankheiten mit anschließender Zunahme spezifischer Diagnosen und öffentlicher Kommunikation. Prominente aktuelle Beispiele sind die "Zunahme" psychischer Erkrankungen und ein Teil der "Zunahme" von übergewichtigen und adipösen Kindern und Jugendlichen.
Für die solide und valide statt "gefühlte" Darstellung der Entwicklung der Inzidenz und Prävalenz von Krankheiten sollte möglichst auf Längsschnittuntersuchungen zurückgegriffen werden, die ihrerseits möglichst mit objektiven Daten angelegt sind. Viele "Epidemien" oder "dramatische Zunahmen" von Krankheiten beruhen nur auf den Ergebnissen von ein oder zwei in kurzen Abständen und mit unterschiedlichen Fragen durchgeführten Querschnittsbefragungen und viel ihrer angeblichen Dynamik basiert auf einem Detektions- oder Publikationsbias oder der Entstigmatisierung bestimmter Krankheiten mit anschließender Zunahme spezifischer Diagnosen und öffentlicher Kommunikation. Prominente aktuelle Beispiele sind die "Zunahme" psychischer Erkrankungen und ein Teil der "Zunahme" von übergewichtigen und adipösen Kindern und Jugendlichen.
Ein interessantes Beispiel, was bezogen auf eine seit vielen Jahren breit diskutierte krankhafte Veränderung der Gefäße mit hohem Risiko von schweren Folgeerkrankungen bei einer zugegebenermaßen etwas ungewöhnlichen Datenbasis herauskommt, liefert eine vergleichende Analyse des Auftretens von Koronarsklerose bei gefallenen Soldaten der US-Armee im Korea-, Vietnam- sowie in den Golf- und Afghanistankriegen.
Bei den immer deutlich unter 30 Jahren alten Soldaten sank der Anteil an erkennbarer Koronarsklerose Leidenden bei der routinemäßigen Obduktion von 77% bei den in Korea (Anfang der 1950er Jahre) Gefallenen, über 45% bei den obduzierten Gefallenen im Vietnamkrieg (1960 und Anfang der 1970er Jahre) auf 8,5% bei den in diesem Jahrhundert im Golf- und Afghanistankrieg Gefallenen. Die Häufigkeit von Stenosen, welche die Koronararterie um mehr als 50% verengten, bewegte sich zwischen 15%, 0% und 2,3%. Die Soldaten mit einer Koronarsklerose litten auch deutlich häufiger als ihre Altersgenossen an Fettstoffwechselstörungen, Bluthochdruck oder Adipositas.
Unter Würdigung aller von den Autoren zum großen Teil selbst diskutierten Limitationen ihrer Studienmethodik kommt ein Editorialist zu zwei Schlussfolgerungen. Erstens: "Consequently, it is highly likely that the main finding of this study is valid: the prevalence of atherosclerosis in young men today is much lower than the prevalence in the Korean or Vietnam War eras. If these findings are generalizable to the US population as a whole, then the cardiovascular health of the US population may have improved appreciably over the past 6 decades." Zweitens: "Advances in primary (but not secondary) prevention are likely to explain the declines in coronary atherosclerosis across the 3 autopsy studies."
Zu den zahlreichen sensibilisierenden und fruchtbaren Hinweisen, welche diese Studie für die aktuelle Versorgungsforschung liefert, gehört z.B. die Schwierigkeit solide Längsschnittstudien über viele Jahrzehnte durchzuführen. Dies gilt besonders dann, wenn es sich um ein retrospektives Design handelt, das die Ergebnisse von sich methodisch in mehreren Details unterscheidenden Studien nutzt. Außerdem ist die Erklärung, es handle sich um Effekte eines gesünderen Lebensstils und einer positiv wirkenden Primärprävention, nicht zwingend. Erste Kommentare weisen auf die Möglichkeit einer Art "healthy soldier"-Effekt hin. Danach könnten durch entsprechende Musterungsuntersuchungen immer gesündere junge Männer in die Armee eingetreten und gefallen sein. Solche Selektionseffekte könnten allerdings auch bei randomisierten Studien mit unterschiedlichen Rekrutierungszeitpunkten in beide Richtungen (immer gesündere oder immer kränkere StudienteilnehmerInnen) existieren, ohne dass dies auf den ersten Blick auffällt.
Was eine gründliche Beschäftigung mit dem Ergebnis also auf jeden Fall mit sich bringt, ist eine verschärfte Nachdenklichkeit über die Beschränktheit und Schlüssigkeit mancher Querschnitts-Szenarien und den notwendigen, aber nicht einfachen methodischen Aufwand solider Verlaufsstudien.
Der am 26. Dezember 2012 erschienene Aufsatz Prevalence of and Risk Factors for Autopsy-Determined Atherosclerosis Among US Service Members, 2001-2011 von Bryant J. Webber et al. (JAMA. 2012;308(24): 2577-2583) ist komplett kostenlos zugänglich.
Dies ist ebenso bei dem Editorial Combating the Epidemic of Heart Disease von Daniel Levy (JAMA. 2012; 308(24): 2624-2625) der Fall.
Der am 18. Juli 1953 erschienene Korea-Aufsatz CORONARY DISEASE AMONG UNITED STATES SOLDIERS KILLED IN ACTION IN KOREA PRELIMINARY REPORT von William F. Enos; Robert H. Holmes, James Beyer (JAMA. 1953;152(12): 1090-1093) ist auch kostenlos erhältlich.
Den am 17. Mai 1971 veröffentlichten Aufsatz Coronary Artery Disease in Combat Casualties in Vietnam von J. Judson McNamara et al. (JAMA. 1971;216(7): 1185-1187) gibt es ebenfalls kostenlos.
Bernard Braun, 29.12.12
Vitamin D-Einnahme senkt Risiko der kardiovaskulären Morbidität!? Zunächst einmal Fehlanzeige und Warnung vor zu hohen Erwartungen
 In vielen Beobachtungsstudien waren niedrigere Vitamin D-Werte mit höheren kardiovaskulären Risikofaktoren wie einem hohen Fettsäurespiegel und Bluthochdruck assoziiert. Daraus schlossen zahlreiche Ärzte, zum Teil auch durch einen Report des "Institute of Medicine (IOM)" aus dem Jahr 2010 ermuntert, ihren PatientInnen trotz fehlender randomisierter kontrollierter Studien mit harten Endpunkten zu raten, zusätzlich zu der mit der normalen Nahrung und Lebensweise aufgenommenen Menge des Vitamins noch Ergänzungsmittel zu sich zu nehmen - um das Risiko kardiovaskulärer Erkrankungen zu senken.
In vielen Beobachtungsstudien waren niedrigere Vitamin D-Werte mit höheren kardiovaskulären Risikofaktoren wie einem hohen Fettsäurespiegel und Bluthochdruck assoziiert. Daraus schlossen zahlreiche Ärzte, zum Teil auch durch einen Report des "Institute of Medicine (IOM)" aus dem Jahr 2010 ermuntert, ihren PatientInnen trotz fehlender randomisierter kontrollierter Studien mit harten Endpunkten zu raten, zusätzlich zu der mit der normalen Nahrung und Lebensweise aufgenommenen Menge des Vitamins noch Ergänzungsmittel zu sich zu nehmen - um das Risiko kardiovaskulärer Erkrankungen zu senken.
Ob die Grundannahme zu den Wirkungen des Vitamin D stimmt, untersuchten jetzt britische ForscherInnen in einer randomisierten kontrollierten Studie mit 305 postmenopausalen Frauen im Alter von durchschnittlich 64 Jahren, von denen keine kardiovaskuläre Erkrankung bekannt war. Die TeilnehmerInnen der Interventionsgruppe bekamen täglich ein Jahr lang entweder 400 oder 1.000 standardisierte Einheiten des Vitamins.
Das Ergebnis der Studie war klar:
• Zu Studienbeginn war der durchschnittliche Level des Vitamins im Körper aller TeilnehmerInnen mit 13,5 ng/mL ähnlich hoch bzw. niedrig.
• Nach einem Jahr hatte sich dieser Level in beiden Interventionsgruppen verdoppelt und war in der Kontrollgruppe unverändert hoch.
• Entgegen den Erwartungen veränderte der deutlich höhere Vitamin D-Wert bei den weiblichen Angehörigen der Vitamin-Gruppen im Vergleich mit den Angehörigen der Placebogruppe nicht signifikant die Werte der kardiovaskulären Risikofaktoren oder -werte.
• Ungeklärt bleibt die Frage, ob Vitamin D nicht auf andere Weise als über die Risikofaktoren auf das Risiko einer kardiovaskulären Erkrankung einwirkt. Aber selbst wenn dies so ist, berechtigt dies nicht, die Einnahme von Vitamin D mit diesem Ziel zu fördern.
Die ForscherInnen empfehlen auf der Basis ihrer Studie, die zusätzliche Auf-/Einnahme von Vitamin D als Mittel zur Veränderung oder Absenkung von kardiovaskuären Risikofaktoren so lange nicht zu empfehlen bzw. zu unterlassen bis weitere entsprechende methodisch geeignete Analysen zeigen, dass diese Vitaminergänzung wirklich die kardiovaskuläre Morbidität absenkt. Ob die Zusammensetzung der Interventionsgruppe aus relativ gesunden Frauen oder andere Faktoren den Mangel an Ein-/Auswirkung auf die spezielle kardiovaskuläre Morbidität erklärt, wird angesprochen, aber nicht abschließend geklärt. Auch solche offenen Fragen rechtfertigen aber nicht die mit festen Erwartungen dieser Effekte verbundene Aufnahme von Vitaminkapseln.
Die in diesem Zusammenhang erwähnte "VITamin D and OmegA-3 TriaL (VITAL)"-Studie beendet noch oder erst in diesem Jahr die Aufnahme von TeilnehmerInnen und wird daher erst in mehreren Jahren die Erkenntnisse über den primär-präventiven Nutzen des Vitamin D gewinnen und verbreiten können.
Von dem Aufsatz "Vitamin D3 supplementation has no effect on conventional cardiovascular risk factors: A parallel-group, double-blind, placebo-controlled RCT" von Wood AD et al. - erschienen im Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism(2012 Oct; 97: 3557) - ist ein Abstract kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 31.10.12
Akupunktur ist bei vier Arten von chronischen Schmerzen wirksam durch eine Mischung von spezifischen und unspezifischen Effekten.
 Eine tatsächlich durchgeführte Behandlung von vier verschiedenen Arten chronischen Schmerzes mit Akupunktur ist im Vergleich zur Schein-Akupunktur (Placebo) und zu gar keiner Akupunkturbehandlung klinisch wirksam und eine Überweisung zur Akupunktur empfehlenswert. Dies ist jedenfalls das belastbare ("most robust evidence") Ergebnis einer methodisch hochwertigen auf der Basis von Individualdaten (andere Metaanalysen benutzen meist Gruppendaten) von 17.922 Schmerz-PatientInnen aus 29 selber qualitativ hochwertigen randomisierten kontrollierten Studien (RCTs) gerade publizierten Metaanalyse von Mitgliedern der international besetzen "Acupuncture Trialist Collaboration". Damit ist eine längere Reihe von zum Teil kontroversen Resultaten aus oft qualitativ schlechten Studien zu einem vorläufigen Ende gekommen. Die PatientInnen litten an chronischen Rücken- und Nackenschmerzen, Osteoarthritis, chronischem Kopfschmerz und Schulterschmerzen. Das "vorläufig" beruht darauf, dass auch diese Studie das bereits öfters beobachtete Phänomen des relativ geringen Unterschieds ("relatively modest") zwischen den Effekten von Akupunktur und Scheinakupunktur belegt und offensichtlich nicht nur spezifische Wirkungen der Akupunktur (z.B. das lehrbuchgerechte Setzen von Nadeln), sondern auch unspezifische Effekte des Setzens von Nadeln und nichtspezifische psychologische oder auch Placeboeffekte zum Wirkeffekt beitragen: "The total effects of a acupuncture…include both the specific effects associated with correct needle insertion according to a acupuncture theory, nonspecific physiologic effects of needling, and nonspecific psychological (placebo) effects related to the patient's belief that treatment will be effective." Der Aufsatz "Acupuncture for Chronic Pain: Individual Patient Data Meta-analysis." von Vickers AJ, Cronin AM, Maschino AC, et al. wird in der Fachzeitschrift "Archives of Internal Medicine" erscheinen und ist am 10. September 2012 online veröffentlicht worden. Ein Abstract ist kostenlos erhältlich.
Eine tatsächlich durchgeführte Behandlung von vier verschiedenen Arten chronischen Schmerzes mit Akupunktur ist im Vergleich zur Schein-Akupunktur (Placebo) und zu gar keiner Akupunkturbehandlung klinisch wirksam und eine Überweisung zur Akupunktur empfehlenswert. Dies ist jedenfalls das belastbare ("most robust evidence") Ergebnis einer methodisch hochwertigen auf der Basis von Individualdaten (andere Metaanalysen benutzen meist Gruppendaten) von 17.922 Schmerz-PatientInnen aus 29 selber qualitativ hochwertigen randomisierten kontrollierten Studien (RCTs) gerade publizierten Metaanalyse von Mitgliedern der international besetzen "Acupuncture Trialist Collaboration". Damit ist eine längere Reihe von zum Teil kontroversen Resultaten aus oft qualitativ schlechten Studien zu einem vorläufigen Ende gekommen. Die PatientInnen litten an chronischen Rücken- und Nackenschmerzen, Osteoarthritis, chronischem Kopfschmerz und Schulterschmerzen. Das "vorläufig" beruht darauf, dass auch diese Studie das bereits öfters beobachtete Phänomen des relativ geringen Unterschieds ("relatively modest") zwischen den Effekten von Akupunktur und Scheinakupunktur belegt und offensichtlich nicht nur spezifische Wirkungen der Akupunktur (z.B. das lehrbuchgerechte Setzen von Nadeln), sondern auch unspezifische Effekte des Setzens von Nadeln und nichtspezifische psychologische oder auch Placeboeffekte zum Wirkeffekt beitragen: "The total effects of a acupuncture…include both the specific effects associated with correct needle insertion according to a acupuncture theory, nonspecific physiologic effects of needling, and nonspecific psychological (placebo) effects related to the patient's belief that treatment will be effective." Der Aufsatz "Acupuncture for Chronic Pain: Individual Patient Data Meta-analysis." von Vickers AJ, Cronin AM, Maschino AC, et al. wird in der Fachzeitschrift "Archives of Internal Medicine" erscheinen und ist am 10. September 2012 online veröffentlicht worden. Ein Abstract ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 26.9.12
"Burnout" - keine valide Diagnostik und kein Wirksamkeitsnachweis für die meisten Therapien
 Zu den positiven Leistungen der medizinisch-ärztlichen Versorgung gehört es, körperlichen oder psychischen Störungen Namen zu geben bzw. Diagnosen zuzuweisen und damit einen Teil der mit solchen Störungen verbundenen und auch zusätzlich krankheitsfördernden Ungewissheit oder diffuse Angst zu beenden und außerdem den Eindruck zu vermitteln, es gäbe auch eine Lösung. Problematisch wird es, wenn Diagnosen lediglich Wortgeklingel sind (z.B. psychovegetatives Syndrom), natürliche oder soziale Phänomene medikalisiert (so genanntes "disease mongering") oder schwer fassbare und unterschiedliche Krankheitsphänomene mit einem diagnostischen Begriff zu fassen versucht werden.
Zu den positiven Leistungen der medizinisch-ärztlichen Versorgung gehört es, körperlichen oder psychischen Störungen Namen zu geben bzw. Diagnosen zuzuweisen und damit einen Teil der mit solchen Störungen verbundenen und auch zusätzlich krankheitsfördernden Ungewissheit oder diffuse Angst zu beenden und außerdem den Eindruck zu vermitteln, es gäbe auch eine Lösung. Problematisch wird es, wenn Diagnosen lediglich Wortgeklingel sind (z.B. psychovegetatives Syndrom), natürliche oder soziale Phänomene medikalisiert (so genanntes "disease mongering") oder schwer fassbare und unterschiedliche Krankheitsphänomene mit einem diagnostischen Begriff zu fassen versucht werden.
Das aktuelle Paradebeispiel ist das "Burnout"-Syndrom, das in der "Internationalen Klassifikation der Erkrankungen" (ICD-10) als "Ausgebranntsein" und "Zustand der totalen Erschöpfung" bezeichnet oder umschrieben wird. In der Systematik des ICD-10 handelt es sich damit um "Probleme mit Bezug auf Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung". Zu den Entstehungsbedingungen von Burnout gehören arbeitsplatzbezogene Faktoren, eine Vielzahl individueller Faktoren oder Auslöser und auch bereits bestehende körperliche und psychische Krankheiten. Diese dynamischen Zusammenhänge erschweren sowohl die Diagnostik aber auch die Therapie der subjektiv zum Teil erheblich belastenden und die soziale Existenz gefährdenden Symptome.
Dies bestätigen auch zwei im Auftrag des "Deutschen Instituts für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI)" erstellten "Health Technology Assessment (HTA)"-Berichte zur "Differentialdiagnostik des Burnout-Syndroms" (erschienen 2010) und "Therapie des Burnout-Syndroms" (erschienen 2012).
Für den ersten HTA-Bericht wurden alle zwischen 2004 und 2009 in deutscher oder englischer Sprache veröffentlichten Studien zur medizinischen Diagnostik und Differentialdiagnostik, zu den ökonomischen Auswirkungen und den ethischen Aspekten des Burnout erfasst. Von den 852 Funden gingen 25 medizinische Publikationen in die weitere Untersuchung ein. Das "zentrale Ergebnis" ihres Berichts lautet, "dass es bisher kein standardisiertes, allgemeines und international gültiges Vorgehen gibt, um eine Burnout-Diagnose zu stellen. Derzeit liegt es im ärztlichen Ermessen, Burnout zu diagnostizieren. Die Schwierigkeit besteht darin, etwas zu messen, das nicht eindeutig definiert ist. Die bisher diskutierten Burnout-Messinstrumente erfassen größtenteils verlässlich ein dreidimensionales Burnout-Konstrukt. Die bisher gelieferten Cutoff-Punkte erfüllen jedoch nicht den Anspruch der diagnostischen Gültigkeit, da die Generierung dieser Werte nicht der wissenschaftlichen Testkonstruktion entspricht. Die verwendeten Burnout-Messinstrumente sind nicht differentialdiagnostisch validiert. Von differentialdiagnostischer Bedeutung sind vor allem Depressionen, Alexithymie, Befindlichkeitsstörungen und das Konzept der anhaltenden Erschöpfung. Ein phasenhafter Zusammenhang der Konzepte ist denkbar. Burnout geht zudem mit verschiedenen Beschwerden wie z. B. Schlafstörungen einher und kann sich durch eine Beeinträchtigung der Arbeitsleistung auf andere (z. B. auf Patienten) negativ auswirken. Es liegen keine Anhaltspunkte für eine Stigmatisierung Burnout-Betroffener vor."
Zusätzlich wurde die Qualität der Studien insgesamt schlecht bewertet. Kritisch vermerkt wurde außerdem der überwiegende Einsatz von Selbstbeurteilungsinstrumenten, vor allem des Maslach Burnout-Inventars (MBI): "Objektive Daten wie z. B. Gesundheitsparameter, Gesundheitszustand, Krankmeldungen oder Beurteilungen durch Dritte werden extrem selten in die Untersuchungen einbezogen. Die Sample-Auswahl ist meist zufällig und enthält oft niedrige Rücklaufraten. Zudem fließen kaum longitudinale Studien in die Auswertung ein. Hierdurch können keine zeitlichen Zusammenhänge verschiedener Symptome und Konzepte eruiert werden. Die definitorischen Unklarheiten in der Diagnosestellung werden in den Studien weitgehend vernachlässigt."
Auch wenn sich an der Diagnostik von Burnout seitdem einiges geändert haben dürfte, beschäftigt sich die zum Teil personenidentische Wissenschaftlergruppe in ihrem jüngsten Bericht damit, ob und wenn ja welche Therapien eine nachweisbare Wirkung auf ein - wie auch immer diagnostiziertes Burnout-Syndrom haben.
Für den Bericht wurden 17 Studien ausgewertet, die insgesamt eine hohe methodische Qualität besitzen (vier Reviews, acht randomisierte kontrollierte Studien).
Die wesentlichen Ergebnisse sehen so aus:
• Als zur Behandlung von Burnout geeignete Therapien werden derzeit Psychotherapie, insbesondere Kognitive Verhaltenstherapie (KVT), Phytotherapie, Physiotherapie, adjuvante Pharmakotherapie und komplementäre Verfahren, wie Musiktherapie oder körperzentrierte Therapien angeboten.
• "13 der 17 Studien befassen sich mit der Wirkung von Psychotherapie und psychosozialen Interventionen (teilweise in Kombination mit anderen Techniken) auf die Reduktion von Burnout. Der Einsatz kognitiver Verhaltenstherapie (KVT) führt in der Mehrheit der Studien zu Verbesserungen der emotionalen Erschöpfung. Die Evidenz der Wirkung von Stressmanagementtraining auf die Reduktion des Burnout ist ebenso wie die Wirkung von Musiktherapie uneinheitlich. Zwei Studien zur Wirksamkeit der Qigong-Therapie kommen zu keinem eindeutigen Ergebnis. Durch eine Studie mit dem Evidenzgrad 1B wird die Wirksamkeit von Rhodiola rosea (Rosenwurz) belegt. Physiotherapie wird nur in einer Studie isoliert untersucht und ist dort der Standardtherapie nicht überlegen."
• "Einige Autoren berichten beträchtliche Effekte natürlicher Erholung."
• Auch in diesem Bericht wird bemängelt, dass sich die Diagnostik und die Messung der Outcomes von Burnout-Therapien überwiegend auf das Maslach Burnout Inventar beschränkt, "dessen klinische Validität" nach Ansicht der Autoren "nicht bewiesen" ist.
• Kritisch merken die HTA-Autoren ferner an, dass in den untersuchten Studien ethische, soziale (z.B. die generelle Leistungsorientierung in der Arbeitswelt) und rechtliche Rahmenbedingungen nicht berücksichtigt werden.
• Angesichts der großen Rolle, die die Arbeitsbedingungen anerkanntermaßen bei der Entstehung von Burnout spielen, verwundert es umso mehr, dass bisher nicht hinreichend untersucht ist, welche Bedeutung sie für die Wirksamkeit von Therapien spielen - ob sie also den Erfolg verhindern oder auch fördern können.
Der 2010 erschienene HTA-Bericht 105 "Differentialdiagnostik des Burnout-Syndroms" von Korczak D; Kister C und Huber B und der 2012 erschienene HTA-Bericht 120 "Therapie des Burnout-Syndroms" von Dieter Korczak, Monika Wastian und Michael Schneider sind komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 2.7.12
Die Mär vom "guten" Cholesterin: Ursachen und Prävention des Herzinfarkt-Risikos sind komplexer.
 Komplexitätsreduktion bis auf eine einzige oder letzte Ursache oder die Dichotomisierung von Lösungen oder Lösungswegen in "gut" oder "schlecht" gehören zum Alltag gesundheitswissenschaftlicher oder -politischer Diskurse. So verständlich dies angesichts tausender Studien, des Gewimmels von "multifaktoriellen Ursachengefügen", dem Wunsch "zu helfen" und nicht zuletzt der Verkaufsinteressen von Unternehmen der Gesundheitswirtschaft sein mag, so problematisch erweist sich dies nicht selten, wenn die Richtigkeit der Annahmen für diese Vorgehensweisen überprüft werden.
Komplexitätsreduktion bis auf eine einzige oder letzte Ursache oder die Dichotomisierung von Lösungen oder Lösungswegen in "gut" oder "schlecht" gehören zum Alltag gesundheitswissenschaftlicher oder -politischer Diskurse. So verständlich dies angesichts tausender Studien, des Gewimmels von "multifaktoriellen Ursachengefügen", dem Wunsch "zu helfen" und nicht zuletzt der Verkaufsinteressen von Unternehmen der Gesundheitswirtschaft sein mag, so problematisch erweist sich dies nicht selten, wenn die Richtigkeit der Annahmen für diese Vorgehensweisen überprüft werden.
Das neueste Beispiel stammt aus der Forschung über die Bedeutung des Cholesterinspiegels für das Risiko einer Herz-/Kreislauferkrankung. Seit vielen Jahren wird dazu zwischen einem "bösen" (LDL-Wert=Low Density Lipoprotein) und einem "guten" (HDL-Wert=High Density Lipoprotein) Cholesterinwert unterschieden.
Bereits seit längerem wird allerdings am kausalen Zusammenhang eines hohen Gesamt-Cholesterinspiegels mit der Plaquebildung in Blutgefäßen als Einflussfaktor auf das Risiko von Herz-/Kreislauferkrankungen und damit am Nutzen cholesterinwertsenkender Interventionen durch spezielle Lebensmittel und Medikamente gezweifelt. Mit der Differenzierung nach HDL- und LDL-Werten schien ein Teil der Zweifel ausgeräumt zu sein und spezifischere risikovermeidende oder -senkende Interventionen doch möglich zu sein. Eine Senkung des "bösen" und eine Anhebung des "guten" Wertes versprach präventive Wunder.
Eine im Mai 2012 in der Fachzeitschrift "Lancet" veröffentlichte Studie zahlreicher internationaler WissenschaftlerInnen hält nun aber auch die Annahme, das "gute" Cholesterin und damit auch die Anhebung seines Werts durch Vitamine und andere Hilfsmittel wirkten kausal auf das Risiko kardiovaskulärer Erkrankungen, für zweifelhaft.
Sie stützen sich dabei u.a. darauf, dass es Personen gibt, die mit Genen ausgestattet sind, die ihnen lebenslänglich einen natürlich hohen Spiegel des "guten" Cholesterols verschaffen und umgekehrt Personen, deren genetische Ausstattung ebenfalls natürlich zu einem leicht niedrigeren Level des "guten" Cholesterols führen. Drei große, in den letzten Jahren abgeschlossene randomisierte Studien und weitere Analysen der Forschergruppe zeigen nun, dass die Personen mit dem natürlich höheren Niveau von "gutem" Cholesterol kein geringeres Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen wie einen Herzinfarkt haben.
Sie bestätigen ausdrücklich, "that genetically raised plasma HDL cholesterol is not associated with risk of myocardial infarction". Und jenseits der genetischen Disposition folgern sie auf der Basis der Gen- und Erkrankungsdaten von 53.500 Personen noch praktischer: "These results show that some ways of raising HDL cholesterol might not reduce risk of myocardial infarction in human beings. Therefore, if an intervention such as a drug raises HDL cholesterol, we cannot automatically assume that risk of myocardial infarction will be reduced."
Dabei bestreiten die VerfasserInnen nicht, dass das Niveau des LDL oder des HDL in vielen Beobachtungsstudien immer wieder im Zusammenhang mit dem Herzinfarktrisiko auftaucht und assoziiert erscheint. Der von der "New York Times" zu dieser Studie interviewte Direktor des staatlichen Instituts für kardiovaskuläre Erkrankungen, Michael Lauer", vergleicht den HDL-Wert mit dem "Stau-/Unfall-Voraus"-Warnschild bei Verkehrsunfällen. Nicht dieses Schild sei die Ursache für den Stau, sondern der Unfall und niemand käme auf die Idee, sich zur Staubeseitigung gegen das Schild zu wenden. Ebenso träten neben einem niedrigen HDL-Wert noch zahllose Faktoren auf, die überwiegend das erhöhte Infarktrisiko bedingten: "Our hypothesis ist hat much of the association may be due to these other factors."
Hinter die einfache, natürlich massiv von Herstellern und vielen Gesundheitsberatern erzeugte oder geförderte Vorstellung mittels Vitaminen (z.B. Niacin) oder Medikamenten den HDL-Spiegel heben und das Infarktrisiko senken zu können, müssen daher mehrere Fragezeichen gesetzt werden.
Ob und wie die sicherlich komplexen Ergebnisse der von den US National Institutes of Health, dem The Wellcome Trust, der European Union, der British Heart Foundation und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten in den Präventions- und Behandlungsalltag Eingang finden oder ob sich die Hersteller von "guten" HDL-erhöhenden Arzneimittel durchsetzen, verdient für die nächste Zeit besondere Aufmerksamkeit.
In dem in derselben Ausgabe des "Lancet" veröffentlichten Kommentar "Mendelian randomisation, lipids, and cardiovascular disease" von S. Harrison et al. unterstreichen dessen Autoren, die gewählte genetische Forschungsmethode "mendelian randomisation" der HDL-Wirkungsforscher sei "likely to yield insights that can both guide public health policy and prioritise potential therapeutic targets."
Der Aufsatz "Plasma HDL cholesterol and risk of myocardial infarction: a mendelian randomisation study" von Benjamin F Voight et al. ist am 17. Mai 2012 als "early online publication" der Zeitschrift "The Lancet" erschienen. Das Abstract ist kostenlos erhältlich.
Der Artikel "Doubt Cast on the 'Good' in 'Good Cholesterol'" von Gina Kolata ist in der "New York Times" vom 16. Mai 2012 erschienen und kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 17.5.12
Ist die Entwicklung von Demenz wirklich nicht oder nicht ohne unerwünschte Nebenwirkungen zu verlangsamen?
 Das regelmäßige Angebot einer nichtmedikamentösen komplexen Behandlung kann die Entwicklung milder bis mäßiger und schwerer Demenz bei einer Personengruppe verlangsamen, die für die BewohnerInnen von Pflegeheimen repräsentativ ist. Dabei werden ihre kognitiven Funktionen und ihre Fähigkeiten für Aktivitäten des täglichen Lebens (ADL) positiv beeinflusst. Dies ist jedenfalls das Ergebnis einer einjährigen randomisierten, kontrollierten und für die 98 TeilnehmerInnen verblindeten Verlaufsstudie in 5 bayrischen Pflegeheimen.
Das regelmäßige Angebot einer nichtmedikamentösen komplexen Behandlung kann die Entwicklung milder bis mäßiger und schwerer Demenz bei einer Personengruppe verlangsamen, die für die BewohnerInnen von Pflegeheimen repräsentativ ist. Dabei werden ihre kognitiven Funktionen und ihre Fähigkeiten für Aktivitäten des täglichen Lebens (ADL) positiv beeinflusst. Dies ist jedenfalls das Ergebnis einer einjährigen randomisierten, kontrollierten und für die 98 TeilnehmerInnen verblindeten Verlaufsstudie in 5 bayrischen Pflegeheimen.
Solange es keine wirksame ursächliche Behandlung oder Prävention der degenerativen Demenz gibt, gilt das Hauptaugenmerk pharmakologischen und nicht-pharmakologischen Interventionen, die den Erkrankungsprozess verlangsamen. Eine Reihe von so genannten Acetylcholinesterase-Präparaten ist zur symptomatischen Behandlung der Alzheimererkrankung als der häufigsten Form von Demenz zugelassen und sie erweisen sich zum Teil auch als wirksam. Wegen der letztlich doch geringen oder nur bei milden Erkrankungsformen spürbaren Wirksamkeit und der Fülle von dosisabhängigen unerwünschten Wirkungen, werden seit einiger Zeit nichtmedikamentöse Behandlungsformen gesucht und erprobt. Positive Effekte zeigten sich bei ihnen aber auch nur bei milden Formen der kognitiven Beeinträchtigung durch Demenz und meist auch nur für kurze Zeiträume.
Die Intervention mit dem mehrere qualitativ unterschiedliche Komponenten umfassenden so genannten MAKS-Programm unterscheidet sich konzeptionell von den bisherigen nichtmedikamentösen Behandlungsformen erheblich und ist in mehrerlei Hinsicht erfolgreicher. Die Intervention von MAKS besteht aus den durch kurze Pausen unterbrochenen Komponenten Motorische Stimulation (z.B. 30 Minuten Bowling oder das Balancieren eines Tennisballs auf einer Frisbeescheibe samt Weitergabe an andere TeilnehmerInnen), einer 30 Minuteneinheit mit Kognitiven Aufgaben, einer 40-Minuteneinheit mit Übungen zu den Aktivitäten des täglichen Lebens (z.B. Zubereitung eines Snacks) und einer 10-minütigen Spirituellen Einstimmung in die rund zweistündige Gesamtübung (z.B. ein Gespräch über Glück oder das Singen einer Hymne). Die rund zweistündige standardisierte Behandlung erfolgte geleitet durch zwei Therapeuten in Zehnergruppen mit einem vergleichbaren Erkrankungsniveau an sechs Tagen pro Woche über 12 Monate. Die Therapiekosten lagen unter 10 Euro pro Tag und PatientIn und waren damit nach Angaben der Studienverantwortlichen nicht wesentlich höher als die der medikamentösen Behandlung - allerdings ohne deren Nebenwirkungen.
Die Angehörigen der Kontrollgruppe konnten die gewöhnlicherweise in den Pflegeheimen angebotenen Nicht-MAKS-Leistungen (z.B. Gedächtnistraining, Anti-Sturztraining oder Beschäftigungstherapie) in Anspruch nehmen und nutzten durchschnittlich auch zwei von ihnen pro Woche. Die Angehörigen der MAKS-Gruppe konnten diese Angebote ebenfalls zusätzlich besuchen und taten dies auch durchschnittlich einmal die Woche.
Die Wirksamkeit der MAKS-Behandlung wurde mit zwei Standardinstrumente erhoben: Der "Alzheimer Disease Assessment Scale—Cognitive Subscale (ADAS-Cog)" für die Messung der kognitiven Fähigkeiten und dem "Erlangen Test of Activities of Daily Living (E-ADL)" für die Messung der Alltagsaktivitäten. Die Skalen der beiden Tests reichen von 0 bis 70, wobei der höhere Wert eine größere kognitive Behinderung anzeigt, und von 0 bis 30 Punkten, wobei hier der höhere Wert eine geringere Behinderung anzeigt.
Während 12 Monate nach Beginn der Studie die beiden Werte bei allen Angehörigen der Interventionsgruppe unverändert geblieben waren, hatten sich bei den Angehörigen der Kontrollgruppe der adjustierte Wert für die kognitiven Fähigkeiten um signifikante 7,7 Punkte und der Wert für die Alltagsfähigkeiten um 3,6 Punkte verschlechtert. Die Wirkung war zwar bei den TeilnehmerInnen mit milder oder mäßiger Demenz stärker, aber auch bei den Angehörigen der Untergruppe mit schwerer Demenz deutlich zu erkennen.
Obwohl die Studienverantwortlichen auf einige Grenzen der Studie wie z.B. die geringe Anzahl von TeilnehmerInnen, das Fehlen einer Placebo-Kontrollgruppe und den möglichen unspezifischen Einfluss der allgemeinen Aufmerksamkeit für die Angehörigen der Interventionsgruppen hinwiesen, halten sie die positiven Wirkungen ihrer nichtmedikamentösen Intervention für gesichert. In zukünftigen Studien sollte dies mit mehr TeilnehmerInnen bestätigt werden und auch die Wirkung einer Kombination medikamentöser und nichtmedikamentöser Behandlung untersucht werden.
Sowohl die englischsprachige Originalarbeitals auch eine deutschsprachige Fassung der Studienveröffentlichung sind frei zugänglich: Graessel E, Stemmer R, Eichenseer B, Pickel S, Donath C, Kornhuber J, Luttenberger K: "Non-pharmacological, multicomponent group therapy in patients with degenerative dementia: a 12-months randomized, controlled trial" - erschienen in "BMC Medicine" 9 (2011).
Bernard Braun, 17.4.12
Rasche Aufnahme von Nahrung schadet durchfallkranken Kindern in der 3. Welt nicht. Nachdenkliches zu einem Cochrane Review
 Manche noch so korrekten und aufschlussreichen wissensachaftlichen Erkenntnisse hinterlassen einen bitteren Geschmack, erzeugen Ratlosigkeit und ein Gefühl davon, wo der Sinn von Wissenschaft endet. Dies ist leider auch im folgenden Beispiel eines gerade erschienenen Cochrane-Reviews über die richtige Ernährung durchfallerkrankter Kinder in der Dritten Welt der Fall.
Manche noch so korrekten und aufschlussreichen wissensachaftlichen Erkenntnisse hinterlassen einen bitteren Geschmack, erzeugen Ratlosigkeit und ein Gefühl davon, wo der Sinn von Wissenschaft endet. Dies ist leider auch im folgenden Beispiel eines gerade erschienenen Cochrane-Reviews über die richtige Ernährung durchfallerkrankter Kinder in der Dritten Welt der Fall.
Wer jemals ein Land in der Dritten Welt besucht hat und sich außerhalb der Touristenghettos bewegte, wird selbst in den Hauptstädten mit den mehr oder weniger dramatischen Symptome des akuten infektiösen Durchfalls konfrontiert worden sein - als einer der verbreitesten Erkrankungen und Todesursachen von Millionen von Kindern in der Dritten Welt. Und auch die gerade wieder einmal zyklisch in den Nachrichten auftauchenden abgemagerten oder verhungernden Kinder in Ostafrika litten oder leiden u.a. an Durchfallerkrankungen mit dem damit verbundenen beträchtlichen Flüssigkeitsverlust.
Sofern es überhaupt etwas zu essen gibt(!!!), war bisher ungeklärt, ob akut durchfallerkrankten Kindern zusätzlich zu der absolut notwendigen Wiederaufnahme und -anreicherung mit Flüssigkeit feste Nahrung bereits sehr früh (unmittelbar nach Beginn oder innerhalb der ersten 12 Stunden nach Beginn der Rehydration) oder erst nach einiger Zeit (12 bis 48 Stunden nach Beginn der Dehydration) angeboten werden durfte. Insbesondere diejenigen welche die frühe Aufnahme praktizierten, befürchteten häufig massive und ebenfalls unerwünschte bis lebensbedrohende Abwehrreaktionen wie Erbrechen, die Notwendigkeit außerplanmäßiger intravenöser Flüssigkeitszufuhr oder auch eine Chronifizierung des Durchfalls.
Seit dem 7. Juli 2011 liefert ein diese Frage bearbeitender Cochrane-Review eine Antwort: Es gab bezogen auf die befürchteten Risiken bei Kindern unter 10 Jahren keinen signifikanten Folgen-Unterschied zwischen früher und späterer Aufnahme fester Nahrung. Positiv ausgedrückt gibt es keine Evidenz dafür, dass ein früher Beginn der Aufnahme fester Nahrung parallel zur Flüssigkeitsaufnahme die befürchteten Risiken oder unerwünschten Folgewirkungen erhöht.
Ungeklärt blieb aber und damit beginnen die Schattenseiten, welche Art von fester Nahrung den größten gesundheitlichen Nutzen erzielt. Es ist zu befürchten, dass zu dieser Frage weitere Jahre vergehen, um sie auf dem methodisch hohen Niveau eines Cochrane-Reviews, also auf der Basis einer Metaanalyse von randomisierten kontrollierten Studien beantworten zu können.
Wie unwahrscheinlich dies aber möglicherweise ist, zeigt sich, wenn man die empirische Basis für den immerhin erstellten Review näher betrachtet. Denn für ein Problem, das wahrscheinlich für mehr als 100 Millionen Kinder in der Dritten Welt und die Zukunft ihrer Länder existentielle Bedeutung hat, fanden die Cochrane-Reviewer gerade einmal 12 RCTs mit 1.283 TeilnehmerInnen. Und dies reichte quantitativ bereits im jetzigen Review nicht aus, um alle wichtigen Fragen abschließend zu beantworten. Während es zu den seltensten Erkrankungen bei Bewohnern Westeuropas und Nordamerikas in der Regel eine ausreichende Anzahl von Studien und natürlich Therapieangebote gibt, werden die in der Dritten Welt vorherrschenden Erkrankungen nicht nur unzulänglich versorgt (vgl. hierzu allein die Unterbewertung- und beachtung der Malaria), sondern auch bereits forschungsmäßig unterversorgt. Vielleicht reagieren aber Forscher auch angesichts des Nahrungsmangels in der Dritten Welt nur zynisch und meinen, es sei sinn- und nutzlos unter diesen Bedingungen über die richtige Ernährung zu forschen.
Und angesichts der Tatsache, dass weltweit alle fünf Sekunden ein Kind unter 10 Jahren verhungert und dabei meist eine Durchfallerkrankung die Auszehrung beschleunigt, stellt sich auch ernsthaft die Frage, welche Bedeutung hier Gesundheitsforschung und -versorgung haben. Denn für Kinder, die wegen absoluten Nahrungsmangels unterernährt sind, ist die Frage ob sie früh oder spät die eine oder andere Nahrung aufnehmen dürfen schlicht und einfach sinnlos.
Um was es dabei jenseits von Gesundheitsforschung und -politik mit Vorrang geht, hat der Schweizer Soziologie Jean Ziegler in der ihm eigenen drastischen Diktion in einer "nicht gehaltenen Rede zur Eröffnung der Salzburger Festspiele" gestützt auf die Berichte der Welternährungsorganisation der UN, u.a. so zusammengefasst: "Die Weltlandwirtschaft (könnte) in der heutigen Phase ihrer Entwicklung problemlos das Doppelte der Weltbevölkerung normal ernähren …. Schlussfolgerung: Es gibt keinen objektiven Mangel, also keine Fatalität für das tägliche Massaker des Hungers, das in eisiger Normalität vor sich geht. Ein Kind, das an Hunger stirbt, wird ermordet."
Zu dem Cochrane-Review "Early versus Delayed Refeeding for Children with Acute Diarrhoea" von Gregorio GV, Dans LF und Silvestre MA (Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 7) gibt es kostenlos nur das gewohnt längere Abstract.
Die Rede von Jean Ziegler kann komplett und kostenlos von der Website der Süddeutschen Zeitung vom 24.7. 2011 heruntergeladen werden.
Bernard Braun, 27.7.11
Es müssen nicht immer teure High-Tech-Interventionen sein! Ein Beispiel aus der Schlaganfall-Rehabilitation.
 Zu den wichtigsten Bestandteilen der Rehabilitation von Schlaganfallpatienten, die noch eine gewisse Restbeweglichkeit behalten oder schon wieder erreicht haben, gehören systematische Bewegungsübungen. Die Nutzung eines kostspieligen mechanischen Heimtrainers oder Laufgeräts ("tread mill") samt einer aufwändigen und wartungsintensiven Einrichtung, welche von seinem Körpergewicht abhängig und mittels eines Sicherheitsgürtels für die Standsicherheit des Rehabilitanden beim Training sorgt (so genanntes Locomotor-System), ist normalen abwechslungsreichen Bewegungsübungen unter Anleitung eines Physiotherapeuten nicht überlegen. Und zwar auch in allen möglichen Untergruppen.
Zu den wichtigsten Bestandteilen der Rehabilitation von Schlaganfallpatienten, die noch eine gewisse Restbeweglichkeit behalten oder schon wieder erreicht haben, gehören systematische Bewegungsübungen. Die Nutzung eines kostspieligen mechanischen Heimtrainers oder Laufgeräts ("tread mill") samt einer aufwändigen und wartungsintensiven Einrichtung, welche von seinem Körpergewicht abhängig und mittels eines Sicherheitsgürtels für die Standsicherheit des Rehabilitanden beim Training sorgt (so genanntes Locomotor-System), ist normalen abwechslungsreichen Bewegungsübungen unter Anleitung eines Physiotherapeuten nicht überlegen. Und zwar auch in allen möglichen Untergruppen.
Das ist das Ergebnis einer Studie aus den USA, in der 408 Personen, die zwei Monate vor dem Start der Rehabilitation einen Schlaganfall erlitten hatten, einer von drei Rehabilitationsgruppen zugewiesen wurden. Einer so genannten Locomotor-Gruppe, die bereits 2 Monate nach dem Schlaganfall mit dem Training begann, einer Gruppe, die erst 6 Monate nach dem Ereignis mit dieser Art der Rehabilitation begann und einer dritten Gruppe, die 2 Monate nach dem Schlaganfall mit einem traditionellen Heimübungsprogramm unter Begleitung eines Physiotherapeuten startete. Jede Intervention schloss 36 Sitzungen à 90 Minuten im Verlaufe von 12 bis 16 Wochen ein. Der primäre Endpunkt der Studie war eine Verbesserung der Fähigkeit funktional zu gehen spätestens ein Jahr nach dem Schlaganfall.
Diesen Zustand erreichten 52% aller TeilnehmerInnen. Weder zwischen der früh gestarteten noch der spät gestarteten Locomotor-Gruppe und der Heimübungsgruppe gab es statistisch signifikante Unterschiede z.B. bei der Gehgeschwindigkeit, dem Balanciervermögen und der Lebensqualität. Weder Verzögerungen beim späteren Beginn des Heimtrainer- bzw. "Tretmühlen"trainings noch die Ernsthaftigkeit der initialen Behinderung oder Schädigungen wirkten sich signifikant auf das Beweglichkeitsergebnis nach einem Jahr aus.
Insgesamt kam es während der Rehabilitationsmaßnahmen lediglich zu zehn ernsthaften unerwünschten Wirkungen. Im Vergleich mit der Heimübungsgruppe hatten beide Heimtrainer-Gruppen eine signifikant größere (p=0.008) Häufigkeit von Schwindelgefühlen und Ohnmachten. Mehrfachstürze waren unter den Patienten mit ernsten Gehbehinderungen in der Heimtrainer-Gruppe, die schon 2 Monate nach dem Schlaganfall mit der Rehabilitation begannen, mehr verbreitet als in beiden Vergleichsgruppen.
Von der im "New England Journal of Medicine (NEJM)" (364 (21): 2026-36) am 26. Mai 2011 erschienenen randomisierten und kontrollierten Studie "Body-weight-supported treadmill rehabilitation after stroke" von Duncan PW et al. ist lediglich das Abstract kostenlos erhältlich.
Mit dieser Studie wird aktuell die Gesamtbewertung des Cochrane Reviews "Treadmill training and body weight support for walking after stroke" von Moseley et al. aus den Jahren 2003 und 2005 bestätigt und untermauert. Dessen Conclusio lautete: "Overall no statistically significant effect of treadmill training with or without body weight support was detected. Although individual studies suggested that treadmill training with body weight support may be more effective than treadmill training alone and that treadmill training plus task-oriented exercise may be more effective than sham exercises, further trials are required to confirm these findings."
Bernard Braun, 11.7.11
Warum sich ältere Frauen nicht darauf verlassen sollten, ihr Risiko für Herzdefekte durch Grill- oder Backfisch senken zu können?
 Frauen nach den Wechseljahren, die fast jeden Tag gegrillten oder gebackenen Fisch essen, können ihr Risiko für Herzversagen senken, diejenigen, die ihren Fisch in der Pfanne braten, könnten dagegen dasselbe Risiko erhöhen - das sind die Quintessenzen einer Teilstudie in der wissenschaftlich anerkannten "Women's Health Initiative Observational Study (WHI-OS)" mit insgesamt 93.676 multiethnischen Teilnehmerinnen im Alter von 50-79 Jahren. Die gleichzeitig erfolgte Kontrolle von vergleichbaren Effekten von Omega-3-Fettsäure und anderen vergleichbaren Fetten auf die Inzidenz von Herzerkrankungen fand weder positive noch negative Auswirkungen.
Frauen nach den Wechseljahren, die fast jeden Tag gegrillten oder gebackenen Fisch essen, können ihr Risiko für Herzversagen senken, diejenigen, die ihren Fisch in der Pfanne braten, könnten dagegen dasselbe Risiko erhöhen - das sind die Quintessenzen einer Teilstudie in der wissenschaftlich anerkannten "Women's Health Initiative Observational Study (WHI-OS)" mit insgesamt 93.676 multiethnischen Teilnehmerinnen im Alter von 50-79 Jahren. Die gleichzeitig erfolgte Kontrolle von vergleichbaren Effekten von Omega-3-Fettsäure und anderen vergleichbaren Fetten auf die Inzidenz von Herzerkrankungen fand weder positive noch negative Auswirkungen.
Bevor wir einige Details der Studienergebnissen vorstellen, sei schon jetzt auf etwas nicht zum ersten und einzigen Mal Ärgerliches dieses Typs von Studien über die Auswirkungen einzelner Nahrungsmittel oder ihnen beigefügten Stoffe auf dioe Gesundheit der EsserInnen hingewiesen: Am Ende ihrer Ergebnisse entlassen die AutorInnen die LeserInnen nämlich mit dem Hinweis ins Ungewisse, der häufige Konsum gegrillten oder gebackenen Fisches könne auch nur ein Surrogatparameter für einen insgesamt gesünderen Lebensstil sein und damit wären einige Ausprägungen der Esskultur die Ursache für das geringere Herzerkrankungsrisiko. Diese Selbstzweifel sind zwar inhaltlich vollkommen korrekt, ärgerlich ist es trotzdem, weil dieselben AutorInnen diese systematischen Grenzen ihrer Studie eigentlich von Beginn an hätten wissen können oder gar müssen. Wäre es dann nicht besser, Studien dieser Methodik sein zu lassen oder alles zu tun, um Indikatoren für das "gesündere Leben" zu gewinnen und in solche Analysen einzubeziehen? Dies ist auch deshalb zu überlegen, weil die Ergebnisse solcher Studien in den Massenmedien meist auf Schlagzeilenformate wie "5x pro Woche Fisch verhindert Herzinfarkt" gebracht werden, Menschen über den zu erwartenden Nutzen täuschen und möglicherweise von wirklich präventiven Maßnahmen abgalten.
Nachdem die letztlich an dieser Studie teilnehmenden 84.493 postmenopausalen Frauen (Durchschnittsalter 63 Jahre) in mehrere Gruppen mit unterschiedlichem Fisch- und Fettsäurekonsum aufgeteilt wurden und ihre weitere Entwicklung nach dem Studienstart für 10 Jahre untersucht wurde, sahen die wesentlichen Ergebnisse so aus:
• Frauen, die zu Beginn der Studie mindestens 5mal pro Woche gebackenen oder gegrillten Fisch aßen hatten ein um 30% niedrigeres Herzschwächerisiko (hazard ratio 0,70) als andere Frauen, die den so zubereiteten Fisch weniger als einmal pro Monat zu sich nahmen.
• Frauen, die mindestens einmal pro Woche gebratenen Fisch aßen, hatten dagegen ein um 48% höheres Risiko für die Inzidenz einer Herzschwäche.
• Das Risiko einer Herzschwäche war bei denjenigen Frauen, die mindestens einmal in der Woche gegrillten oder gebackenen Lachs, Makrelen oder "bluefish" (ein dunkelfleischiger öliger Fisch) verzehrten, gerade noch auf dem 10%-Niveau der Irrtumswahrscheinlichkeit signifikant niedriger als bei den Esserinnen von weniger fetthaltigen Fische wie dem Snapper oder dem Cod-Fisch.
• Insgesamt trat bei 1.858 Teilnehmerinnen, dies entspricht 2,2% der Kohorte, ein neuer Fall von Herzdefekt oder -versagen auf. Die Vielesserinen von gebackenem oder gegrillten Fisch waren es 19,4 Fälle pro 10.000 Personenjahre, bei den Wenigesserinnen dieser Fischgerichte waren es dagegen 26,7 Fälle. Spitzenreiterinnen waren die Frauen, die mehr als einmal die Woche gebratenen Fisch aßen - mit 39,4 Fällen. Aßen die Frauen aber weniger als einmal im Monat gebratenen Fisch, sank ihr Herzversagens-Risiko auf 20,8 pro 10.000 Personenjahre.
Der Aufsatz "Fish intake and the risk of incident heart failure: The Women's Health Initiative" von Belin R. et al. erschien am 24.5. 2011 vor seiner Druckveröffentlichung in der Schwerpunktausgabe "Heart Failure" der US-Fachzeitschrift "Circulation" online und ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 29.5.11
Preiselbeerprodukte und die Prävention von Harnwegsinfekten: natürlich, erschwinglich, erhältlich ohne Rezept - aber wirksam????
 In den USA leiden rund 20 % aller Frauen mindestens einmal in ihrem Leben an einer Harnwegsinfektion. Von ihnen trat die Erkrankung bei 3 % mehrmals auf. Entsprechend erhielten Millionen von Frauen Arzneimittel und darunter mit Vorrang Antibiotika verordnet, die sowohl das erstmalige Auftreten der schmerzhaften Infektion als auch das wiederholte Auftreten verhindern sollten als auch wesentlich zur Behandlung der Infektion beitragen sollen.
In den USA leiden rund 20 % aller Frauen mindestens einmal in ihrem Leben an einer Harnwegsinfektion. Von ihnen trat die Erkrankung bei 3 % mehrmals auf. Entsprechend erhielten Millionen von Frauen Arzneimittel und darunter mit Vorrang Antibiotika verordnet, die sowohl das erstmalige Auftreten der schmerzhaften Infektion als auch das wiederholte Auftreten verhindern sollten als auch wesentlich zur Behandlung der Infektion beitragen sollen.
Um die Einnahme von zu viel Antibiotika zu vermeiden und damit deren gesicherten Nachteile, propagierten und propagieren Hersteller, "Omas" und diverse Naturheilmittel-Gesundheitsratgeber relativ regelmäßig "natürliche" Alternativen als nützlich, preisgünstiger, unaufwändiger zu beschaffen und "natürlich" nebenwirkungsfrei. Dabei spielten nahezu alle Zubereitungen (z.B. Bonbons, Saft) eine zentrale Rolle in denen Preiselbeeren verarbeitet wurden.
Die ebenfalls schon seit einiger Zeit angestellten Versuche, die Wirksamkeit valide nachzuweisen, hinterlassen einen mehrspältigen Eindruck und vermitteln im aktuellsten Fall tiefe und leicht ratlose Einblicke in die Schwierigkeiten, den Nutzen von Nahrungsergänzungsmitteln wasserdicht nachzuweisen oder zu widerlegen.
Bereits 2004 suchte der Cochrane-Review "Cranberries for treating urinary tract infections" von Jepson RG, Mihaljevic L, Craig J. vergebens nach randomisierten kontrollierten Studien über die Wirksamkeit von Preiselbeersaft zur Behandlung von Harnwegsinfekten. Jepson et al. zogen daraus den Schluss, dass es keine Evidenz gibt, den Einsatz des Saftes zu diesem Zweck zu unterstützen. Gleichzeitig waren andere Experten aber der Meinung, es fänden sich immerhin eine Menge von evidenzbasierten Informationen über den Nutzen von Preiselbeer-Produkten bei der Prophylaxe von Harnwegsinfekten.
Der Schlusskommentar eines in der Zeitschrift "American Family Physician" (70 (11): 2175-2177) 2004 erschienenen Übersichtsaufsatz resumierte den damaligen Stand der Kenntnisse über den prophylaktischen Nutzen von Preiselbeerprodukten so: "Cranberry appears to be a safe, herbal choice for UTI prophylaxis and has relatively good tolerability. The most recent studies have found that the use of cranberry for up to 12 months is safe and moderately effective. More evidence is necessary to recommend its use for clinical indications other than UTI prophylaxis."
Die wesentlichen Ergebnisse des Aufsatzes "Cranberry for Prevention of Urinary Tract Infections" von Darren Lynch in der Zeitschrift "American Family Physician" gibt es kostenlos.
In einer Zusammenfassung zum Stand der Forschung über die prophylaktischen Möglichkeiten das mit dem Alter zunehmende Risiko wiederholter Harnwegsinfektionen zu senken, kommen schließlich Sumukades et al. 2009 zu zwei weiteren Feststellungen:
• Die Einnahme niedrig dosierter Antibiotika hat zum einen nur bescheidene Erfolge und birgt die üblichen akuten und langfristigen unerwünschten Folgen der Einnahme von Antibiotika in sich. Die spezifischen Wirkungen der Antibiotikaeinnahme sind auf niedrigem Niveau nur geringfügig höher als die von Preiselbeer-Extrakten in Bonbonform.
• Mit der Feststellung, Preiselbeerprodukte seien "natural, affordable and available without prescription" verknüpfen die Autoren den Vorschlag, Ratschläge mit dem potenziellen Nutzen dieser Produkte zu erstellen und damit die Menschen zu befähigen "to make informed choices". Dies hält sie aber selber nicht davon ab, unmittelbar anschließend dann doch lieber weitere längerfristige und vergleichende Studien zu empfehlen, um grundlegend die Annehmbarkeit und die Wirkung der Preiselbeer-Zubereitungen gegenüber verschiedenen prophylaktisch wirkenwollenden Antibiotika zu untersuchen.
Wer diese Argumentations-Achterbahn noch etwas intensiver genießen will, kann dazu den Aufsatz "Recurrent urinary tract infections in older people: the role of cranberry products" von Deepa Sumukadas, Peter Davey und Marion E. T. McMurdo aus der Fachzeitschrift "Age Ageing" (38 (3): 255-257) vollständig und kostenlos herunterladen.
Die von Sumukades et al. 2009 veröffentlichte Forderung, in weiteren Studien mehr über die Wirksamkeit von Preiselbeerpräparaten zu erforschen, ging dann aber relativ zügig in Erfüllung.
War der prophylaktische Nutzen von Preiselbeeren für Menschen mit Harnwegsinfektionen bereits 2004 insgesamt eher bescheiden, weist eine aktuelle randomisierte kontrollierte Studie über ihren Nutzen bei der Prävention von Wiederholungsinfektionen der Harnwege nach, dass dieser Nutzen von Preiselbeersaft nicht höher ist als der von Placebos oder dass andersherum auch Placebos helfen.
In der doppelblinden RCT wurde dafür 155 gesunden jüngeren Frauen nach Abschluss einer Antibiotikabehandlung 6 Monate lang zweimal täglich rund ein Viertelliter kalorienarmer Preiselbeersaft verabreicht. 164 vergleichbare Frauen erhielten ein flüssiges Placebo, das dem Preiselbeersaft äußerlich ähnelte. Das Placebo enthielt lediglich nicht den Wirkstoff Proanthocyanidin, der als der eigentliche prophylaktische antibakterielle Wirkstoff galt. Dieser Stoff soll auf die Interaktion des Erregers Escherichia coli mit bestimmten menschlichen Zellen wirken bzw. diese unterbinden.
Nach 6 Monaten unterschieden sich die Wiedererkrankungsraten statistisch nicht signifikant und lagen bei 19 % in der Preiselbeer- und 15 % in der Placebogruppe. Damit waren aber beide Raten niedriger als die erwarteten 30 %. Unerwartet war angesichts der vermuteten Wirkung des bereits genannten Preiselbeerwirkstoffs auch, dass die Rate der Infektion mit Escherichia coli (diese verursachen 80 % aller Harnwegsinfektionen) in der Preiselbeergruppe höher (93 % aller Infektionen) als in der Placebogruppe (58 %) waren - also genau das Gegenteil, was man von einer Intervention mit Proanthocyanidin erwartete.
Wer glaubt, dass mit dieser erneut negativen Studie über einen auch bei der Prophylaxe von Harnwegsinfektionen fehlenden Nutzen des ansonsten natürlich durchaus bekömmlichen Beerensaftes, die Debatte ein vorläufiges Ende habe, irrt.
Was wäre nämlich - so ein offensichtlich mit den nicht endenvollenden Debatten über derartige Mittel erfahrene Kommentar eines Experten -, wenn der wirkliche und nützliche Wirkstoff nicht Proanthocyanidin, sondern ein anderer Stoff ist, der sowohl im Preisebeersaft als auch in der Placeboflüssigkeit enthalten war???
Solange dies möglich sein kann, wird es weiterhin Empfehlungen zum prophylaktischen Genuss von Preiselbeerprodukten gegen Harnwegsinfekte und andere Infektionserkrankungen geben und viele Gesunde und bereits einmal Erkrankte werden sie kaufen und konsumieren.
Den achtseitigen Aufsatz "Cranberry juice fails to prevent recurrent urinary tract infection: Results from a randomized placebo-controlled trial" von Barbosa-Cesnik C et al. aus der Zeitschrift "Clinical Infectious Diseases" (2011; 52: 23-30) gibt es komplett kostenlos.
Bernard Braun, 23.1.11
Warum verordnen Ärzte erkälteten Patienten "gegen besseres Wissen" immer noch viel zu viele Antibiotika?
 Mit der kühleren Jahreszeit steigt die Anzahl erkälteter Kinder, Jugendlicher und Erwachsener schlagartig an. Damit steigt auch die Anzahl der Verordnungen von Antibiotika an und damit eine ursächlich meist nutzlose aber mittel- bis langfristig zu unerwünschten oder gar gefährlichen Effekten führende Fehlversorgung.
Mit der kühleren Jahreszeit steigt die Anzahl erkälteter Kinder, Jugendlicher und Erwachsener schlagartig an. Damit steigt auch die Anzahl der Verordnungen von Antibiotika an und damit eine ursächlich meist nutzlose aber mittel- bis langfristig zu unerwünschten oder gar gefährlichen Effekten führende Fehlversorgung.
Nutzlos, weil es sich bei Erkältungskrankheiten und verwandten Erkrankungen meist um Virusinfektionen handelt, Antibiotika aber nur bei bakteriellen Infektionen wirksam und nützlich sind.
Gefährlich, weil auch nutzlose Antibiotika zur Entwicklung resistenter Erreger führen und damit das Risiko künftig nicht mehr behandelbarer Erreger mit erhöhen.
Dass dieses Problem nicht nur in Deutschland besteht, sondern auch in europäischen Nachbarländern, zeigt ein soeben im Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics (Volume 35, Issue 6 Page 617-736) veröffentlichter Artikel aus Polen. Unter dem Titel Antibiotics in the treatment of upper respiratory tract infections in Poland. Is there any improvement?, von dem das Abstract kostenfrei erhältlich ist, hinterfragen Wissenschaftler verschiedener polnischer Universitäten den ungerechtfertigten und potenziell schädlichen Einsatz von Antibiotika bei Infektionen der oberen Luftwege.
Warum viele Ärzte trotz dieses hinlänglich wissenschaftlich belegten und auch verbreiteten Wissens Antibiotika bereits ab dem Kleinkindalter zu häufig verordnen, liegt nach ihrer hartnäckig vertretenen Ansicht und Erfahrung an den Patienten oder ihren Eltern selber. Diese drängten Ärzte derart massiv, Antibiotika zu verordnen und drohten dabei auch, den Arzt zu wechseln, dass ihnen gar nichts übrig bliebe auch "wider besseres Wissen" doch Antibiotika zu verordnen.
An dieser "Schlachtordnung" weckt oder fördert die Lektüre einer bereits im September 2010 veröffentlichten Befragungsstudie in der deutschen Bevölkerung erhebliche Zweifel. Bereits 2008 versuchten nämlich Wissenschaftler des Robert Koch-Instituts (RKI) genauer zu ermitteln, inwieweit die deutsche Bevölkerung von ihren Ärzten erwartet, bei einer normalen Erkältung Antibiotika verschrieben zu bekommen. Dazu wurden 1.778 zufällig aus rund 30.000 Internetnutzern ausgewählte Personen online befragt.
Die wichtigsten Befragungsergebnisse lauten:
• Nur 7,7 Prozent der Befragten sagten, sie würden gerne ein Antibiotikum erhalten und brächten diese Erwartung auch zu einem Arztbesuch mit.
• 47,3 Prozent wollen zuerst einmal untersucht werden und dann einen Rat für den weiteren Umgang mit der Erkrankung sowie bei Bedarf eine Krankschreibung erhalten.
• 44,4 Prozent möchten Mittel zur Beseitigung der Erkältungssymptome, beispielsweise schmerzstillende Mittel oder Hustenbonbons. 18,2 Prozent erwarten pflanzliche oder alternative Therapeutika. Ebenso viele meinen, ihr Arzt solle entscheiden, was zu tun sei.
• Unter den wenigen, die erklärtermaßen eine Antibiotika-Verordnung erwarten, würde sich der Großteil (70,8%) passiv verhalten und dem Arzt vertrauen, wenn dieser eine solche Verordnung von sich aus aktiv für unnötig halten würde. 7,1 Prozent wären zwar unzufrieden, würden aber die Entscheidung ihres Arztes akzeptieren. 12,4 Prozent würden an ihrem Wunsch festhalten aber nur 2,7 Prozent einen anderen Arzt konsultieren. Da sich dieser Anteil nur auf die 7,7 Prozent derjenigen bezieht, die überhaupt ein Antibiotikum erwarten, sind es also gerade einmal 0,21 Prozent aller erkälteten Patienten, die ein Arzt nach der Ablehnung einer Antibiotika-Verschreibung vermutlich verlieren würde. Nur bei 0,95 Prozent träfe ein Arzt, der kein Antibiotikum verordnen will, auf hartnäckigen Widerstand, der ihn u.U. viel Zeit kosten würde.
• Die Befragungsergebnisse zeigen außerdem, dass viele Patienten fast durchweg ein fachlich korrektes Wissen um den Sinn und die Risiken von Antibiotika haben. Trotzdem stimmt immer noch eine starke Minderheit der Behauptung zu, Antibiotika seien gegen Viren wirksam und daher geeignet, Erkältungserkrankungen zu behandeln. Die somit offensichtliche Bereitschaft, im Krankheitsfall "für alle Fälle" nach jedem "Strohhalm" zu greifen, zeigt den Aufklärungsbedarf durch Krankenkassen und Ärzte. Dies gilt auch für die Befragten, die auf bestimmte Fragen keine Antworten geben können.
• Eine weitere wichtige Frage war, ob die Einstellungen und Verhaltensweisen von erkälteten Personen möglicherweise von ihrem Wissensstand abweichen. So stimmen rund 94 Prozent der Be-fragten "voll" oder "eher" der Aussage zu, Antibiotika nur einzunehmen, wenn sie absolut nötig sind. Welche Notwendigkeiten dies sein könnten, zeigen die weiteren Fragen und Antworten. Hier stimmen dann immerhin 32 Prozent der Aussage zu, dass Antibiotika bei wichtigen Ereignissen wie einer Prüfung oder Hochzeit hilfreich und daher angebracht seien. Am wenigsten, nämlich nur rund sieben Prozent der Befragten waren der Meinung, Antibiotika würden bei Halsschmerzen "Schlimmeres verhindern".
• Ein für die Patientenaufklärung wichtiges Ergebnis ist der niedrigere aber immerhin noch durchaus respektabel vorhandene Wissensstand über Antibiotika und ihren richtigen Gebrauch bei Jugendlichen. Alle Befragten beantworteten im Durchschnitt 5,18 der acht Wissensfragen zu den Mitteln richtig. Die jüngste Gruppe der 15- bis 19-Jährigen gab 4,17 richtige Antworten. Auf die acht Fragen zum verantwortungsvollen Gebrauch der Mittel gaben alle Befragten im Durchschnitt 6,29 korrekte Antworten, bei den 15- bis 19-Jährigen nur 5,77. Doch auch diese Unterschiede bieten keinen Anlass zu der Befürchtung, dass Jugendliche besonders aggressiv auf die Verordnung von Antibiotika drängen. Auch für die Kinder unter 15 Jahren ergeben sich keine Hinweise auf eine besonders hohe aktive Nachfrage nach Antibiotika. Und auch für erhebliche Wissenslücken und Fehleinstellungen in der Elterngeneration gibt es keine Hinweise, im Gegenteil: In der Altersgruppe der 30- bis 49-Jährigen werden Wissensfragen sogar überdurchschnittlich gut (5,35 und 5,62 richtige Antworten) beantwortet. Dies trifft auch für die Anzahl richtig beantworteter Gebrauchsfragen zu (6,34 bis 6,50 richtige Antworten).
Die Untersuchung könnte einige methodische Verzerrungen haben (z.B. die Durchführung mit Internet-Usern) und es kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass ein Teil der Befragten als sozial erwünscht betrachtete Antworten "kontra Antibiotika" gegeben hat und ihr Verhalten in der Arztpraxis von ihrem Befragungsverhalten abweicht. Trotzdem ist es völlig unwahrscheinlich, dass sämtliche Befragten in der Praxissituation plötzlich enthemmt und gegen ihre ja durchaus artikulierten kognitiven Vorbehalte Antibiotika fordern. Und selbst, wenn man sich das Verhalten der in dieser Studie evtl. unterrepräsentierten Personen vorstellt, kann dies nicht nur aus "Antibiotika-Gier" bestehen und würde auch quantitativ nicht ausreichen, das von Ärzten bemühte Verhalten der Mehrzahl ihrer Patienten zu bestätigen.
Internationale Studien, die auch noch ausführlicher im Forum vorgestellt werden, zeigen außerdem, dass selbst dann ärztliche Aufklärung und die Kommunikation über positive konkrete Behandlungspläne (Vermeidung von reiner Verbotskommunikation!) Patienten umstimmen können.
Die Studie "Antibiotics for the common cold: expectations of Germany's general populati-on" von Faber MS, Hecken-bach K, Velasco E und Eckmanns T. ist in der Fachpublikation "Euro Surveillance" (2010; 15(35):pii=19655) veröffentlicht und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 2.11.10
Schwedische ADHS-Studie: Medikamente werden häufiger verschrieben bei unterprivilegierten Müttern
 Eine große schwedische Studie, in der jetzt Daten von 1,1 Millionen Kindern und Jugendlichen (Alter 6-19 Jahre) analysiert wurden, hat gezeigt: Das sogenannte Aufmerksamkeitsdefizit- Hyperaktivitäts-Syndrom findet sich sehr viel häufiger bei Kindern, wenn Mütter aus unterprivilegierten sozialen Milieus kommen, also eine geringe Schulbildung aufweisen, alleinerziehend sind oder von Sozialhilfe leben. Genauer gesagt, wurde die Verteilung von ADHS nicht anhand ärztlicher Krankheitsdiagnosen untersucht, sondern die Verschreibung bestimmter, für die Krankheit typischer Medikamente wie Ritalin analysiert.
Eine große schwedische Studie, in der jetzt Daten von 1,1 Millionen Kindern und Jugendlichen (Alter 6-19 Jahre) analysiert wurden, hat gezeigt: Das sogenannte Aufmerksamkeitsdefizit- Hyperaktivitäts-Syndrom findet sich sehr viel häufiger bei Kindern, wenn Mütter aus unterprivilegierten sozialen Milieus kommen, also eine geringe Schulbildung aufweisen, alleinerziehend sind oder von Sozialhilfe leben. Genauer gesagt, wurde die Verteilung von ADHS nicht anhand ärztlicher Krankheitsdiagnosen untersucht, sondern die Verschreibung bestimmter, für die Krankheit typischer Medikamente wie Ritalin analysiert.
1.162.524 schwedische Kinder und Jugendliche im Alter von 6-19 Jahren wurden von einem Forschungsteam aus Stockholm und Uppsala anhand mehrerer Nationaler Register in die Analysen einbezogen. Erfasst wurde einerseits anhand des schwedischen Medikamenten-Registers, ob den Studienteilnehmern im Jahre 2005 ein Medikament verschrieben wurde, das einen für ADHS charakteristischen Wirkstoff wie Methylphenidat ("Ritalin") enthält. Andererseits wurde eine Reihe sozialstatistischer Daten der Mütter erfasst, so unter anderem Geschlecht, Alter, Region des Wohnsitzes, Schulbildung, Art der Einkünfte (Sozialhilfe ja oder nein), ob alleinerziehend. Ferner wurde berücksichtigt, ob eine psychiatrische Erkrankung oder Suchterkrankung vorliegt.
Insgesamt fand man 7.960 Fälle, bei denen ADHS-Medikamente verschrieben wurden, dabei überwogen männliche Kinder und Jugendliche mit 1.06 % der Gesamtstichprobe im Vergleich zu 0.29 % Mädchen. Methylphenidate (wie "Ritalin") wurden am häufigsten verschrieben (88%), gefolgt von Atomoxetin (wie "Strattera") (9%) and Amphetaminen (3%).
In multivariaten Analysen (unter gleichzeitiger Berücksichtigung aller dieser Einflussfaktoren) zeigte sich dann, dass drei dieser Merkmale besonders stark mit der Verschreibung von ADHS-Medikamenten zusammenhängen.
• Den deutlichsten Effekt zeigte das Bildungsniveau der Mutter. Bei niedriger Schulbildung (0-9 Schulklassen absolviert) war die Wahrscheinlichkeit ("Odds-Ratio"), dass das Kind ADHS-Medikamente einnimmt, 2,3mal so hoch wie bei Müttern mit sehr hoher Schulbildung.
• Wenn die Mutter alleinerziehend war, lag das Risiko bei 1,45 und wenn sie von Sozialhilfe lebte, betrug es 2,06.
• Ein niedriges Bildungsniveau der Mutter erklärt 33 Prozent der ADHS-Fälle bzw. Medikamenten-verschreibungen, 14 Prozent gehen auf das Konto der Alleinerziehung.
Zur Studie gibt es kostenlos nur ein kurzes Abstract: A Hjern, GR Weitoft, F Lindblad: Social adversity predicts ADHD-medication in school children - a national cohort study (Acta Pædiatrica, Volume 99 Issue 6, Pages 920 - 924)
ADHS ist eine im Kindesalter beginnende psychische Erkrankung, die sich durch leichte Ablenkbarkeit und Konzentrationsstörungen, geringes Durchhaltevermögen, sowie gesteigerte Aktivität und Impulsivität auszeichnet. Die Ursachen der Erkrankung sind nicht restlos geklärt, man vermutet eine Kombination aus angeborenen und umwelt- bzw. sozialisationsbedingten Faktoren. Etwa drei bis zehn Prozent aller Kinder zeigen Symptome im Sinne einer ADHS. Jungen sind deutlich häufiger betroffen als Mädchen. Man geht davon aus, dass ein multifaktoriell bedingtes Störungsbild mit einer erblichen Disposition vorliegt. Unklar ist, in welchem Umfang eine ADHS-Diagnose gestellt wird, obwohl nur ein vergleichsweise harmloses und oft reversibles kindliches Sozialverhalten vorliegt.
Frühere Studien hatten nämlich gezeigt:
• Wenn Eltern sich scheiden lassen und das Kind danach Symptome des sogenannten "Zappelphilipp-Syndroms" zeigt (Aufmerksamkeitsdefizit - Hyperaktivitäts - Syndrom - ADHS), dann besteht ein doppelt so großes Risiko wie bei zusammen lebenden und verheirateten Eltern, dass dieses Kind ein Medikament wie Ritalin verschrieben bekommt, um die Verhaltensauffälligkeiten zu behandeln.
• Durch Aggressivität oder "Hyperaktivität" verhaltensauffällige Kinder, die bei nur einem Elternteil leben, werden doppelt so oft mit Medikamenten (mit dem Wirkstoff Methylphenidat) behandelt wie wenn sie in der Obhut von zwei Elternteilen sind.
• Auch für Kinder, die bei Stiefeltern leben, hatten sich ähnliche Ergebnisse gezeigt.
• Eine neuere Studie hat jetzt angedeutet, dass möglicherweise nicht das Fehlen eines Elternteils der eigentliche Risikofaktor ist, sondern der durch die Scheidung bei Eltern wie Kindern gleichermaßen ausgelöste Stress.
vgl. zum Thema auch:
• Therapie des "Zappelphilipp-Syndroms": Kinder geschiedener Eltern bekommen häufiger Medikamente verordnet)
• Der Einsatz von Medikamenten zur Behandlung "hyperaktiver" Kinder hat sich weltweit verdreifacht
• Aggression im Kindergartenalter - Eine Studie zeigt: Es geht auch ohne Medikamente
Gerd Marstedt, 11.7.10
Wie verallgemeinerbar sind Ergebnisse von und Empfehlungen aus RCT? Externe Validität am Beispiel Asthma.
 Leitlinien oder therapeutische Empfehlungen auf der Basis evidenter Ergebnisse, die aus den bestmöglichen Studien gewonnen werden, gehören zu den wichtigsten Voraussetzungen für eine wirksame und wirtschaftliche gesundheitliche Versorgung. Randomisierte kontrollierte Studien (RCT) stellen dabei den "Goldstandard" dar.
Leitlinien oder therapeutische Empfehlungen auf der Basis evidenter Ergebnisse, die aus den bestmöglichen Studien gewonnen werden, gehören zu den wichtigsten Voraussetzungen für eine wirksame und wirtschaftliche gesundheitliche Versorgung. Randomisierte kontrollierte Studien (RCT) stellen dabei den "Goldstandard" dar.
Trotzdem ist weder die Praxis (z.B. Verbreitung im Behandlungsalltag) noch die Methodik der evidenzbasierten Leitlinien und RCTs problemlos.
Zu einem für die praktische Anwendung von Behandlungsempfehlungen in Arztpraxen und Kliniken wesentlichen Problem gehört die Gültigkeit der Erkenntnisse aus RCT oder deren externe Validität. Mit anderen Worten: Sind die TeilnehmerInnen in RCTs so repräsentativ für die Gesamtheit oder Mehrheit der PatientInnen mit der untersuchten Erkrankung, dass die in diesen Studien gewonnenen Vorgehensweisen auch außerhalb von ihnen sinnvoll und erfolgreich sind?
Eine bereits 2007 erschienene Studie begründet einen berechtigten Zweifel und quantifiziert die Unterschiede zwischen den Innenverhältnissen in RCTs und dem Behandlungsalltag am Beispiel des Asthma, einer Krankheit mit einer bekanntermaßen breiten Palette von klinischen Erscheinungsweisen.
Aus einer insgesamt befragten Gruppe von 3.500 zufällig ausgewählten neuseeländischen BürgerInnen im Alter von 25 bis 75 Jahren wurden mittels eines speziellen Fragebogens und eines Atemfunktionstests zunächst die 179 Personen herausgefiltert, die aktuell an Asthma litten und die 127 Personen, die an Asthma litten und deswegen in Behandlung waren. Für diese Personen wurde geprüft, ob sie den individuellen und krankheitsspezifischen Kriterien ("inclusion criteria") entsprochen hätten, um Teilnehmer einer der 17 großen RCTs gewesen zu sein, deren Ergebnisse wiederum den wesentlichen Input für die "Global Initiative for Asthma (GINA)"-Leitlinien geliefert hatten. Von den Personen, die ohne behandelt zu werden an Asthma litten, wären durchschnittlich 4 % (zwischen 0 % und 36 %) RCT-TeilnehmerIn geworden. Von den behandelten Asthmatikern hätten dies im Schnitt 6 % geschafft, wobei der Anteil je nach RCT zwischen 0 % und 43 % geschwankt hätte.
Die Studie zeigt zum einen, dass die großen Asthma-RCTs mit einer hochselektierten Teilnehmerschaft durchgeführt wurden. Zum anderen besitzen ihre Ergebnisse aber trotz ihrer starken wissenschaftlichen Evidenz nur mehr oder weniger eingeschränkte Aussagekraft und Gültigkeit außerhalb der RCT. Dies bedeutet u.a. konkret, dass sich kein Arzt völlig sicher sein kann, dass z.B. seine PatientInnen auf ein Medikament genauso reagieren wie die RCT-PatientInnen. Zumindest der Grad der Verallgemeinerbarkeit der RCT-Ergebnisse ist unsicher. Die neuseeländischen ForscherInnen fordern daher zu Recht, dass in künftigen RCTs zum Asthma und anderen Erkrankungen eine breitere Palette von Inklusionskriterien zur Anwendung kommen als bisher.
Die Studie "External validity of randomised controlled trials in asthma: to whom do the results of the trials apply?" von Justin Travers, Suzanne Marsh et al. ist in der Fachzeitschrift "Thorax" erschienen (2007;62:219-223). Kostenlos erhältlich ist nur das Abstract.
Bernard Braun, 9.7.10
Ist es sporadisch und selten, wenn in Japan 99,7 % der Schweinegrippeviren gegen Tamiflu resistent sind? Die WHO meint ja!
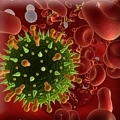 Die interessierte Welt hat durch einen Aufsatz in renommierten Medizinjournal "British Medical Journal (BMJ)" (vgl. dazu auch eine Zusammenfassung der Aussagen dieses Aufsatzes und anderer Texte im "forum-gesundheitspolitik") erfahren, dass mehrere Experten mit der WHO bekannten finanziellen Verbindungen zu Pharmafirmen, die finanzielle Interessen an einer bestimmten medikamentösen Art der Schweinegrippebekämpfung hatten, bei der Abfassung von WHO-Richtlinien beteiligt waren, die z.B. allen Nationalstaaten empfahlen, bestimmte antivirale Medikamente millionenfach anzuschaffen und kurativ und prophylaktisch im Kampf gegen die Vogelepidemie und Schweinegrippe-Pandemie einzusetzen.
Die interessierte Welt hat durch einen Aufsatz in renommierten Medizinjournal "British Medical Journal (BMJ)" (vgl. dazu auch eine Zusammenfassung der Aussagen dieses Aufsatzes und anderer Texte im "forum-gesundheitspolitik") erfahren, dass mehrere Experten mit der WHO bekannten finanziellen Verbindungen zu Pharmafirmen, die finanzielle Interessen an einer bestimmten medikamentösen Art der Schweinegrippebekämpfung hatten, bei der Abfassung von WHO-Richtlinien beteiligt waren, die z.B. allen Nationalstaaten empfahlen, bestimmte antivirale Medikamente millionenfach anzuschaffen und kurativ und prophylaktisch im Kampf gegen die Vogelepidemie und Schweinegrippe-Pandemie einzusetzen.
Dabei war u.a. auch der WHO stets die Gefahr bewusst, eine allzu häufige und vor allem prophylaktische Einnahme der Wirkstoffe Oseltamivir (die bekannteste und verbreiteste Arzneimittelmarke ist Tamiflu von der Firma Roche) und Zanamivir (bekannt durch das allerdings seltener eingesetzte Markenmedikament Relenza der Firma GlaxoSmithKline) könne zur raschen Resistenzbildung führen und damit die weitere Bekämpfung des Virus eher erschweren. In der WHO-Empfehlung "Antiviral use and the risk of drug resistance. Pandemic (H1N1) 2009 briefing note 12" vom 25. September 2009 wird dies auch bereits im Titel zum Ausdruck gebracht.
Die noch immer uneingeschränkt (geprüft am 18.6.2010) auf der WHO-Website stehenden Empfehlungen bagatellisieren aber in ihren Schlussfolgerungen das Risiko erheblich. Insbesondere werden Resistenzfälle als "sporadisch und selten" dargestellt und es gäbe keine Evidenz, dass oseltamivir-resistente Schweinegrippeviren in bestimmten Regionen oder gar weltweit zirkulierten.
Trotzdem brauchen sich die Public Health-Akteure keine Sorgen zu machen: "WHO and its network of collaborating laboratories are closely monitoring the situation and will issue information and advice on a regular basis as indicated."
Schon zum Zeitdruck der ersten Veröffentlichung dieser Empfehlungen hätte der WHO aber eigentlich die Existenz eines erheblichen Resistenzbildungsproblems vor allem in Japan bekannt sein müssen. Offensichtlich waren aber die damaligen Daten noch zu schwach um gegen die Verharmlosungsrhetorik der auch am Umsatzwohl der beiden Pharmariesen interessierten Expertenschar und gegen die sorgsam gehegte Furcht vor einer "1918/1919 II"-Pandemie mit zig Millionen Personen anwirken zu können.
Spätestens mit der Veröffentlichung einer Studie der "Working group for Influenza Virus Surveillance in Japan" in der Juni-2010-Ausgabe der renommierten Fachzeitschrift "Emerging infectious diseases" (Heft 6 Juni 2010; Volume 16, Number 6-June 2010), hätten diese industriefreundlichen Grundeinstellungen aber schlagartig und radikal verändert werden müssen.
Diese Studie stellt nämlich eine Reihe empirischer Zustände in Japan vor, die angesichts der weltseit Millionen eingelagerter Packungen Tamiflu, mal wirklich als dramatisch bezeichnet werden können:
• Als erstes wird nämlich berichtet, dass die Resistenzrate für Tamiflu und Produkte mit demselben Wirkstoff in Japan zwischen der 2007/08- und der 2008/2009-Grippesaison von 2,6 % auf 99,7 % angestiegen ist. Tamiflu ist damit zumindest zur Prophylaxe und Behandlung von Menschen, die an einer H1N1-Infektion leiden, praktisch wertlos.
• Dafür ist evtl. auch der geballte Einsatz von Tamiflu u. Co. maßgeblich verantwortlich, da Japan den weltweit höchsten Pro-Kopf-Verbrauch von Medikamenten dieser Wirkstoffgruppe hatte.
• Positiv wird immerhin vermeldet, dass u.a. das H1N1-Virus nicht zugleich gegen alle anderen Wirkstoffe resistent geworden ist. Dies sollte aber nicht als Freibrief für den Umstieg in den Masseneinsatz dieser Wirkstoffe verstanden werden, wenn man bedenkt, wie schnell sich unter einem massiven prophylaktischen und kurativen Einsatz Resistenzen entwickeln können.
• Die wesentliche Schlussfolgerung aus der japanischen Wissenschaftler lautet: "Although oseltamivir remains a valuable drug for treatment of pandemic (H1N1) 2009, many ORVs (Oseltamivir-resistente Viren) were isolated after prophylaxis with a half dose of the drug. Therefore, prophylaxis with oseltamivir may not be recommended as stated by WHO".
• Eine weitere Beobachtung der japanischen Virologen relativiert allerdings mindestens die aktuelle gesundheitliche Bedeutung der Entstehung von resistenten Viren etwas. Die Symptome und die Einweisungsraten in Krankenhäuser unterscheiden sich nämlich nicht zwischen Menschen mit ORVs und Menschen mit OSV, d.h. Oseltamivir-sensitiven Viren. Selbst wenn dies für den Moment etwas Dramatik aus den Folgen der Resistenzbildung nimmt, kann es nicht als Plädoyer für den weiteren üppigen Gebrauch dieses Wirkstoffs interpretiert werden.
In keinem Fall sollte eine Public Health-Einrichtung wie die WHO weiter die Häufigkeit der Resistenzbildung ignorieren oder kleinschreiben und dem prophylaktischen Einsatz unkritisch gegenüber stehen oder ihn gar fördern. Wenn, ja wenn da nicht die erwiesene Nähe maßgeblicher Ratgeber und Richtlinienverfasser zu der Firma wäre, die natürlich bald wieder weltweit die Lagerhallen mit "Kampfmitteln" gegen die nächste Grippewelle füllen möchte.
Der Aufsatz "Oseltamivir-resistant influenza A (H1N1) viruses during 2007-2009 influenza seasons, Japan" von Ujike M, Shimabukuro K, Mochizuki K, Obuchi M, Kageyama T, Shirakua M, et al. ist in "Emerging Infectious Diseases" erschienen, einer Zeitschrift, die von den "Centers for Disease Control and Prevention (CDC)" herausgegeben wird, einer wissenschaftlichen Einrichtung des US-Gesundheitsministeriums.
Bernard Braun, 18.6.10
Senken körperliche Trainingsprogramme die Krankmeldungen von Rückenschmerzpatienten?
 Tragen körperbezogene Konditionsprogramme für Erwerbstätige mit Rückenschmerzen im Vergleich zur normalen, überwiegend symptomatischen medizinischen Behandlung dazu bei, dass diese Beschäftigten weniger oder kürzer krankgemeldet sind? Diese Frage konnte auch durch die jetzt veröffentlichte, bis 2008 reichende Aktualisierung eines erstmals 2003 erarbeiteten Cochrane-Reviews nicht eindeutig und fundiert beantwortet werden. In den dafür zu Rate gezogenen 23 randomisierten Kontrollstudien fanden die Wissenschaftler bei Erwerbstätigen mit akuten Rückschmerzen keine Wirkung der Konditionsprogramme. Bei Personen mit subakuten Rückenschmerzen war das Wirkungsbild nicht einheitlich. Gab es aber positive Wirkungen, dann nur geringe und auch erst dann, wenn Arbeitsplatzbedingungen mitberücksichtigt wurden. Kombinationen von Körpertrainingsprogrammen mit einer kognitiven Verhaltenstherapie erhöhten deren Wirksamkeit nicht.
Tragen körperbezogene Konditionsprogramme für Erwerbstätige mit Rückenschmerzen im Vergleich zur normalen, überwiegend symptomatischen medizinischen Behandlung dazu bei, dass diese Beschäftigten weniger oder kürzer krankgemeldet sind? Diese Frage konnte auch durch die jetzt veröffentlichte, bis 2008 reichende Aktualisierung eines erstmals 2003 erarbeiteten Cochrane-Reviews nicht eindeutig und fundiert beantwortet werden. In den dafür zu Rate gezogenen 23 randomisierten Kontrollstudien fanden die Wissenschaftler bei Erwerbstätigen mit akuten Rückschmerzen keine Wirkung der Konditionsprogramme. Bei Personen mit subakuten Rückenschmerzen war das Wirkungsbild nicht einheitlich. Gab es aber positive Wirkungen, dann nur geringe und auch erst dann, wenn Arbeitsplatzbedingungen mitberücksichtigt wurden. Kombinationen von Körpertrainingsprogrammen mit einer kognitiven Verhaltenstherapie erhöhten deren Wirksamkeit nicht.
Angesichts der zahlreichen Studien, die in letzter Zeit den generellen gesundheitlichen Nutzen von körperlichen Aktivitäten bestätigen, sollten die Ergebnisse dieses Cochrane-Reviews Anlass für intensivere Forschung über die Zusammenhänge von Körpertrainingsprogrammen und Arbeitsunfähigkeit wegen Rückenschmerzen Anlass für intensivere Studien sein und zunächst einmal das Erwartungsniveau bei derartigen Programmen absenken helfen.
Die Cochrane-Studie aus dem Jahre 2003 war zu dem Schluss gekommen, dass körperliche Trainingsprogramme in Kombination mit kognitiver Verhaltenstherapie überaus erfolgreich sind für Arbeitnehmer mit chronischen Rückenschmerzen. Die Quintessenz aus 18 seinerzeit bilanzierten Studien war: Solche eng mit Arbeitsplatz und Betrieb verknüpften Interventionen senken die Dauer der Arbeitsunfähigkeit, und zwar im Durchschnitt um 45 Tage in einem Jahr im Vergleich zu Beschäftigten, die eine konventionelle medizinische Therapie erfahren. Dieses recht eindeutige Fazit führte seither zu einem Boom entsprechender Interventionen.
Parallel dazu gab es jedoch auch eine Reihe von Veröffentlichungen, in denen dieser eindeutige Zusammenhang und die bessere Wirksamkeit von körperlichen Trainingsprogrammen in Kombination mit kognitiver Verhaltenstherapie in Frage gestellt wurden. Die Cochrane-Forscher führten daher jetzt noch einmal eine neue Literaturbilanz durch, in der einige nach ihrer früheren Veröffentlichung erschienene Studien neu aufgenommen und noch einmal die Gesamtbewertungen für die schon früher berücksichtigten Studien überprüft wurden.
Einbezogen wurden dann randomisierte Kontrollstudien (mit Individuen oder Gruppen), die männliche und weibliche Erwerbstätige mit körperlichen Einschränkungen aufgrund von Rückenschmerzen umfassten, und bei denen in der Interventionsgruppe körperliche Trainingsprogramme (mit oder ohne kognitive Verhaltenstherapie) durchgeführt wurden. Unterschieden wurden dabei akute Rückenschmerzen (akute Symptome, Dauer seit weniger als 6 Wochen), subakute (Dauer 6-12 Wochen) und chronische (Dauer über 12 Wochen). 23 Studien mit 3.676 Beschäftigten wurden so erfasst, wobei etwas mehr als die Hälfte methodisch fundiert und ohne Risiko auf Verzerrungen eingestuft wurde.
Die Interventionen und körperlichen Übungen in den Studien waren sehr unterschiedlich. Es gab solche, die explizit auf einzelne muskuläre und/oder neurologische Fähigkeiten zielten, andere, die eher unspezifische Zielsetzungen hatten (Verbesserung von Körperkraft, Ausdauer, Atmung). Einige umfassten Rückenschulen oder Techniken zum Umgang mit Schmerzen. Als Erfolgskriterien wurden drei Indikatoren berücksichtigt: Der Zeitraum zwischen Intervention und Rückkehr zur Arbeit, der Krankmeldungsstatus zu einem definierten Zeitpunkt, der Zeitraum bis zu einer Veränderung der Arbeitsanforderungen.
Die Bewertung der Interventionen fiel dann sehr heterogen aus:
• Bei akuten Rückenschmerzen fand man keinen Effekt der Interventionen auf die Arbeitsunfähigkeit (Fälle oder Dauer)
• Bei subakuten Beschwerden waren die Ergebnisse widersprüchlich. Eine detaillierte Analyse von Untergruppen legte dann den Schluss nahe, dass Interventionen, in denen auch Arbeitsanforderungen und Belastungen verändert wurden, möglicherweise einen positiven Effekt zeitigen.
• Bei Beschäftigten mit chronischen Rückenschmerzen gab es aus fünf Studien Hinweise, dass auf längere Sicht gesehen (12-18 Monate) ein positiver Einfluss auf die Krankmeldungen deutlich wird. Auf sehr lange Sicht andererseits (2-3 Jahre) zeigten andere Studien dann wieder, dass keine Effekte im Vergleich zu konventioneller Therapie zu finden sind.
• Ein zusätzlicher Einbezug von konventioneller Verhaltenstherapie brachte in keiner der Studien signifikante Vorteile.
In der zusammenfassenden Diskussion ihrer Befunde weisen die Forscher darauf hin, dass insbesondere die Heterogenität der Studien, was Art und Dauer der Intervention, einbezogene Beschäftigten-Gruppe, Art der Beschwerden, Zeitpunkt der Erfolgskontrolle usw. es erschwert, eine fundierte Bilanz zu ziehen, so dass hier wieder einmal das bekannte "Ceterum censeo" vieler Cochrane-Studien hervorzuheben ist: Weitere Forschungsarbeiten sind nötig.
Hier ist ein kostenloses Abstract: Schaafsma F, Schonstein E, Whelan KM, et al. Physical conditioning programs for improving work outcomes in workers with back pain
Oder hier: Cochrane Database Syst Rev. 2010 Jan 20;(1):CD001822. (Review)
Gerd Marstedt, 3.6.10
Schweinegrippe im (Rück-)Spiegel einer EU-weiten Bevölkerungsumfrage.
 Der Winter auf der Nordhalbkugel ist vorbei und die hartnäckig von manchen bis heute aufrecht erhaltene Bedrohungskulisse (so scheint es, dass die WHO nie offiziell die höchste Pandemiestufe 6 zurückgenommen hat) erwies sich als modernes Potemkinsches Dorf.
Der Winter auf der Nordhalbkugel ist vorbei und die hartnäckig von manchen bis heute aufrecht erhaltene Bedrohungskulisse (so scheint es, dass die WHO nie offiziell die höchste Pandemiestufe 6 zurückgenommen hat) erwies sich als modernes Potemkinsches Dorf.
Bis zum 23.03. 2010 wurden dem Robert-Koch-Institut für Deutschland maximal 226.018 Erkrankungsfälle von Schweine- oder Neuer Grippe gemeldet und bis 15.00 Uhr an diesem Tag waren es 250 Todesfälle.
Im "Influenza Wochenbericht" des RKI für die 11. Kalenderwooche 2010 wird das Bild durch einige Strukturdaten und eine Prognose abgerundet:
• 80 % der Todesfälle (199) von 250) waren jünger als 60 Jahre. Von den 230 Todesfällen, bei denen Angaben zum Vorliegen von Risikofaktoren ausgewertet werden können, hatten 196 (85 %) einen Risikofaktor und damit eine höhere Wahrscheinlichkeit für einen schweren Krankheitsverlauf.
• "Es wird als wahrscheinlich angenommen, dass das Neue Influenzavirus A/H1N1 weiter zirkulieren wird und auch kleinere Ausbrüche können nicht ausgeschlossen werden, jedoch wird eine weitere Frühjahr-Sommer-Welle als unwahrscheinlich angesehen. Für die kommende Saison wird erwartet, dass das Neue Virus A/H1N1 dominant sein wird."
Nicht nur als Nachklapp, sondern als Beispiel für eine Reihe von Wirkungen dieses bisher einmaligen und zumindest finanziell folgenreichen Pandemie-Bedrohungs-Hypes in Europa und Nordamerika, liegen nun die Ergebnisse einer im Rahmen des EU-"Eurobarometer" im November 2009 zum Thema Schweinegrippe durchgeführten Befragung von 28.00 zufällig ausgewählten BürgerInnen im Alter ab 15 Jahren aus den 27 EU-Mitgliedsstaaten plus Norwegen, die Schweiz und Island vor.
Einblicke gewinnt man dort u.a. in folgende Einstellungen und Verhaltensweisen, die auch dort, wo dies nicht ausdrücklich erwähnt wird, sich zwischen den Ländern deutlich unterscheiden:
• 17% der befragten EuropäerInnen hatten sich zu dem Befragungszeitpunkt bereits gegen die siaisonale Grippe impfen lassen und 14% beabsichtigten sich impfen zu lassen. 65% verneinten eine derartige Absicht.
• 57% der Befragten glaubten nicht (mehr), dass es sich bei Schweinegrippe um eine ernstzunehmende Infektion handele.
• Ebenfalls 57% der Befragten waren der festen Meinung, es sei völlig unwahrscheinlich, dass sie an der Neuen Grippe erkrankten. Dieser Anteil schwankte aber z.B. zwischen 82% in Österreich und 69% in Deutschland.
• 19% der Befragten fühlten sich sehr gut über die Schweinegrippe informiert, 56% charakterisierten ihren Informationsstand als gut.
• Interessant sind die gravierenden Unterschiede des Vertrauens in verschiedene Informationsquellen: Während immerhin 81% den Gesundheitsprofis wie Ärzten und Apothekern als Informationsquelle komplett oder meistens trauten, waren dies gegenüber den nationalen Gesundheitsautoritäten wie Ministerien etc. nur noch 61%, gegenüber den Europaautoritäten 52%, gegenüber den traditionellen Medien vom Fernsehen bis zu den Tageszeitungen noch 35% und gegenüber dem Internet nur noch 29%.
• 50% der EU-BürgerInnen meinten, die Medien hätte der Schweinegrippe zu viel Aufmerksamkeit gespendet. Zu wenig Aufmerksamkeit sahen lediglich noch 9%.
• Auf die Bitte, spontan ihr Wissen zu offenbaren was man als einzelner Bürger präventiv gegen die Schweinegrippenerkrankung tun kann, gaben 33% regelmäßiges Händewaschen an, 11% hoben die Bedeutung der Nasenputzhygiene hervor, ebenfalls 11% empfehlen öffentliche Plätze und Räume zu meiden, 8% wollten Kontakt mit bereits Infizierten vermeiden, 13% hielten eine spezifische Impfung für einen Schutzfaktor und 2% hielten die Impfung gegen die saisonale Grippe für ein gutes Mittel. Nur 1% sahen in der Einnahme von antiviralen Medikamenten wie Tamiflu oder Relenza ein geeignetes Mittel.
• Ebenfalls interessant ist das enorme Gefälle, das zwischen den EU-Staaten besteht, wenn man beispielsweise nach der spontanen Relevanz von regelmäßigem Händewaschen fragt. Während 52% der Finnen sofort und vorrangig das Händewaschen einfiel, passierte dies in Deutschland bei 37%, in Polen bei 15% und beim Schlusslicht Litauen nur noch bei 7% der Befragten.
• 24% der Befragten erklärten, sie hätten ihr Verhalten umgestellt, um eine Erkrankung zu vermeiden.
• Relativ hoch ist der Anteil von 10% und 55% der Befragten, die mit den jeweiligen nationalen Präventionsmaßnahmen sehr zufrieden oder zufrieden waren.
• Für 65% der Befragten stellten TV-Programme, für 36% Artikel in Illustrierten oder Tageszeitungen, für 29% der Arzt, für 25% die Familie, Freunde und Bekannte und für nur 9% die nationale Influenza-Website die hauptsächliche Informationsquelle dar.
• Die Impfung wird von 45% als wirksam und sicher bewertet, 30% bewerteten sie aber genau gegenteilig.
Wer an noch mehr Details interessiert ist, kann sich den 142-Seitenbericht zum Thema "Eurobarometer
on Influenza H1N1" als Ausgabe 287 der Flash EB Series komplett und kostenlos herunterladen. Ein 16-seitiges Summary gibt es ebenfalls kostenlos.
Bernard Braun, 26.3.10
Kognitive Verhaltenstherapie hilft gegen Rückenschmerzen - aber jeder neunte hat Vorurteile und meidet Psychotherapie
 Rückenschmerzen sind eine unliebsame, aber fast universelle Erfahrung von Männern wie Frauen. Fast jeder erfährt dieses Symptom mindestens einmal im Leben. Zu einem beliebigen Zeitpunkt geben etwa 30-40% der erwachsenen Bevölkerung an, unter Rückenschmerzen zu leiden. Etwa 70 % haben die Schmerzen mindestens einmal im Jahr und etwa 80 % klagen mindestens einmal im Leben über Rückenschmerzen. Etwa 90 % aller chronischen Rückenschmerzen sind unspezifisch, bei ärztlichen Untersuchungen finden sich keine Hinweise, um die Beschwerden der Patienten hinreichend erklären.
Rückenschmerzen sind eine unliebsame, aber fast universelle Erfahrung von Männern wie Frauen. Fast jeder erfährt dieses Symptom mindestens einmal im Leben. Zu einem beliebigen Zeitpunkt geben etwa 30-40% der erwachsenen Bevölkerung an, unter Rückenschmerzen zu leiden. Etwa 70 % haben die Schmerzen mindestens einmal im Jahr und etwa 80 % klagen mindestens einmal im Leben über Rückenschmerzen. Etwa 90 % aller chronischen Rückenschmerzen sind unspezifisch, bei ärztlichen Untersuchungen finden sich keine Hinweise, um die Beschwerden der Patienten hinreichend erklären.
Zwar sind die Prognosen meist positiv, denn bei einem Großteil der Patienten verschwinden die Schmerzen innerhalb von 1-2 Wochen. Andererseits sind Rückenschmerzen oft "rezidivierend", das heißt, der Patient erleidet einen Rückfall, die Schmerzen kehren wieder zurück. Die Palette unterschiedlicher therapeutischer Maßnahmen, von Akupunktur und schmerzlindernden Arzneimitteln bis hin zu autogenem Training und Pysiotherapie, wurde in einer jetzt in der Zeitschrift "Lancet" veröffentlichten Studie um eine weitere Option bereichert: Kognitive Verhaltenstherapie.
Basis der Studie waren etwa 600 Patienten mit chronischen Rückenschmerzen, die man in insgesamt 56 Allgemeinarztpraxen zur Mitarbeit gewonnen hatte. Nach dem Zufallsprinzip wurden zwei Drittel von ihnen der Interventionsgruppe, die übrigen der Kontrollgruppe zugeordnet. Alle Teilnehmer bekamen eine etwa 15minütige anfängliche Unterweisung über Krankheitsursachen und wurden insbesondere auch darüber belehrt, dass die in der Bevölkerung verbreitete Meinung, bei Rückenschmerzen seien körperliche Schonung und Bettruhe günstig, vollkommen falsch sei und zu einer Beschwerdeverschlimmerung führt. Alle Teilnehmer bekamen überdies eine Broschüre zu Rückenschmerzen ausgehändigt, "The Back Book", erstellt vom Royal College of General Practitioners.
In der Kontrollgruppe geschah weiter nichts. In der Interventionsgruppe wurde (in kleineren Gruppen von 8 Personen) das sog. "Back Skills Training (BeST) Programm umgesetzt. Dieses bestand aus einer ein- bis fünfstündigen individuellen Beratung und Diagnose, danach dann aus sechs Gruppensitzungen zu anderthalb Stunden. Dort versuchte man, negative Kognitionen (Wahrnehmungen und Bewertungen) gegenüber Rückenschmerzen bewusst zu machen und auch abzubauen, unter anderem durch Aktivitätsplanungen und Entspannungstechniken.
Zu Beginn der Intervention und später nach 3, 6 und 12 Monaten sollten die Teilnehmer Fragebögen ausfüllen, in denen insbesondere Qualität und Intensität ihrer Schmerzen erfasst wurden. Nach 12 Monaten zeigte sich dann, dass die Teilnehmer an der Interventionsgruppe (N=399) im Vergleich zur Kontrollgruppe (N=199) deutlich höhere Linderungen ihrer Beschwerden aufwiesen. Auch in einer Befragung der Teilnehmer zeigte sich dies: 31% der Kontrollgruppe aber fast doppelt so viele (59%) in der Interventionsgruppe berichteten über eine Genesung. Vergleichbar große Unterschiede ergaben sich auch für die Zufriedenheit mit der Behandlung und mehrere andere Testergebnisse (Vermeidungsverhalten, Selbstwirksamkeitserwartung, körperliche Beschwerden).
Auch in ökonomischer Hinsicht erkennen die Wissenschaftler Vorteil der Verhaltenstherapie: Im Vergleich zu Akupunktur oder auch Physiotherapie sei ihr Vorgehen erheblich kostengünstiger. Ein Problem allerdings wird von den Autoren auch genannt: Vorbehalte von Patienten gegenüber Psychotherapie führten dazu, dass 50 der ursprünglich ins Auge gefassten 468 Interventions-Teilnehmer (11%) sich den Gruppensitzungen komplett verweigerten.
Hier ist ein kostenloses Abstract: Sarah E Lamb et al: Group cognitive behavioural treatment for low-back pain in primary care: a randomised controlled trial and cost-effectiveness analysis (The Lancet, Early Online Publication, 26 February 2010, doi:10.1016/S0140-6736(09)62164-4)
Gerd Marstedt, 28.2.10
Australische Studie stellt große soziale Ungleichheit fest bei der Versorgung von Patienten mit Angina pectoris
 Eine große Zahl von Studien aus den USA hat gezeigt, dass dort ein hohes Maß an sozialer Ungleichheit feststellbar ist, was die Qualität der medizinischen Versorgung anbetrifft. Angehörige unterer Sozialschichten und ethnischer Minderheiten werden dort bei einer Vielzahl von Erkrankungen benachteiligt (vgl. hier die Kurzfassungen vieler Studien im Forum Gesundheitspolitik, Rubrik: USA: Soziale Ungleichheit). Ein zentraler Grund dafür ist allerdings der fehlende Krankenversicherungsschutz dieser Bevölkerungsgruppen. In Staaten, die für alle Bürger eine Krankenversicherungspflicht eingeführt haben oder ein umfassendes Recht auf medizinische Versorgung, findet man daher kaum einmal Studien, die solche soziale Ungleichheiten in der medizinischen Versorgung nachweisen, die ausschließlich mit der sozio-ökonomischen Stellung der Patienten zusammenhängen.
Eine große Zahl von Studien aus den USA hat gezeigt, dass dort ein hohes Maß an sozialer Ungleichheit feststellbar ist, was die Qualität der medizinischen Versorgung anbetrifft. Angehörige unterer Sozialschichten und ethnischer Minderheiten werden dort bei einer Vielzahl von Erkrankungen benachteiligt (vgl. hier die Kurzfassungen vieler Studien im Forum Gesundheitspolitik, Rubrik: USA: Soziale Ungleichheit). Ein zentraler Grund dafür ist allerdings der fehlende Krankenversicherungsschutz dieser Bevölkerungsgruppen. In Staaten, die für alle Bürger eine Krankenversicherungspflicht eingeführt haben oder ein umfassendes Recht auf medizinische Versorgung, findet man daher kaum einmal Studien, die solche soziale Ungleichheiten in der medizinischen Versorgung nachweisen, die ausschließlich mit der sozio-ökonomischen Stellung der Patienten zusammenhängen.
Einige wenige Ausnahmen hierzu fand man bislang unter anderem in Kanada, wo man herausfand: Teure Diagnoseverfahren werden Oberschicht-Patienten häufiger verordnet oder in Schweden, wo eine Studie ergab: Oberschicht-Angehörige erhalten nach einem Herzinfarkt öfter eine bessere medizinische Versorgung - und leben danach länger.
Jetzt hat eine australische Studie diese Liste erweitert und gezeigt: Patienten mit Angina pectoris erhalten bestimmte, therapeutisch sinnvolle, aber relative kostenträchtige Diagnose- und Therapieverfahren deutlich häufiger, wenn sie einen hohen sozialen Status haben, also der Oberschicht und nicht der Mittel- oder Unterschicht angehören. Dieser Effekt zeigte sich auch dann, wenn die Wissenschaftler in sogenannten multivariaten Analysen den potentiellen Einfluss anderer Faktoren (unter anderem: Art des Krankenhauses, private oder andere Krankenversicherung des Patienten, Alter, Geschlecht, Begleiterkrankungen usw.) mitberücksichtigten.
Basis der Studie waren medizinische Versorgungsdaten von knapp 2 Millionen Menschen aus West-Australien. Herausgefiltert wurden Daten von Patienten, die in den Jahren 2001-2003 wegen eines Herzinfarkts oder Angina pectoris in einem Krankenhaus behandelt worden sind. Bei ihnen wurde dann überprüft, welche diagnostischen und therapeutischen Verfahren im weiteren Verlauf eingesetzt wurden. Dabei konzentrierte man sich auf einige wenige Prozeduren: Bypass-Operation (Überbrückung verengter oder verstopfter Herzkranzgefäße durch eine Umleitung), Angiographie (Darstellung von Blutgefäßen durch diagnostische Bildgebungsverfahren) und Angioplastie (Erweiterung verengter Blutgefäße durch dort eingeführte Katheter).
In der Auswertung der Daten zeigte sich dann in multivariaten Analysen, die auch andere Einflussfaktoren mitberücksichtigten:
• Bei einem Herzinfarkt (Myokardinfarkt) ergaben sich keine Unterschiede des weiteren medizinischen Vorgehens, die allein auf den sozio-ökonomischen Status der Patienten zurückzuführen waren
• Bei der Diagnose "Angina pectoris" waren solche Unterschiede jedoch durchaus feststellbar: Im Vergleich zu Unterschicht-Patienten erhielten solche aus der Oberschicht häufiger angiographische Verfahren (etwa um 11% häufiger), um 30% häufiger Bypass-Operationen und um 52% häufiger angioplastische Maßnahmen.
• Die Unterschiede waren nur begrenzt darauf zurückzuführen, dass mit dem sozioökonomischen Status auch die Häufigkeit einer privaten Krankenversicherung stieg.
• Darüber hinaus fand die Studie auch heraus, dass Unterschicht-Patienten ohne private Krankenversicherung erheblich länger auf eine medizinische Behandlung warten mussten.
Die Wissenschaftler diskutieren in der Bilanz ihrer Befunde eine Vielzahl potentieller Erklärung, von denen jedoch keine völlig befriedigend ist. So beziehen sie hier auch folgende Merkmale von Unterschicht-Patienten als mögliche Einflussfaktoren ein: Höhere Risikofaktoren (Rauchen, Übergewicht, spätere Klinikeinweisung), geringere Nutzung von Fachärzten, die eher Empfehlungen aussprechen für die genannten speziellen Verfahren. Auch unterschiedliche Ein stellungen von Ärzten gegenüber Unter- bzw. Oberschicht-Patienten könnten nach Meinung der Studien-Autoren eine Rolle spielen.
Die Studie ist im Volltext von dieser Seite aus verfügt: Rosemary J Korda, Mark S Clements, Chris W Kelman: Universal health care no guarantee of equity: Comparison of socioeconomic inequalities in the receipt of coronary procedures in patients with acute myocardial infarction and angina (BMC Public Health 2009, 9:460doi:10.1186/1471-2458-9-460)
Gerd Marstedt, 13.1.10
Behandlungs-Tagebuch hilft bei Atemwegsinfekten von Kindern, unnötige Antibiotikaverordnungen zu reduzieren
 Bei den überaus häufig auftretenden Atemwegsinfekten von Kindern kommt es oftmals zu einer Über- und Fehlversorgung im allgemeinärztlichen Bereich. Die Überversorgung besteht in einer hohen Anzahl von Eltern- und Kind-Kontakten mit dem Arzt, in Kombination mit einer kurz- und vor allem langfristigen Fehlversorgung mit Antibiotika. Diese sind bei den meist vorliegenden Virusinfektionen medizinisch nicht angebracht: Sie sind wirkungslos und fördern allein die Bildung resistenter bakterieller Erreger. Eine der Ursachen dieser problematischen Kombination von Versorgungsfehlern oder -mängeln ist fehlendes Wissen über die Eigenart dieser Erkrankungen bei den wegen der oft heftigen Symptome verständlicherweise besorgten und übervorsichtigen Eltern und ein Mangel an umfassender Kommunikation zwischen Arzt und Eltern.
Bei den überaus häufig auftretenden Atemwegsinfekten von Kindern kommt es oftmals zu einer Über- und Fehlversorgung im allgemeinärztlichen Bereich. Die Überversorgung besteht in einer hohen Anzahl von Eltern- und Kind-Kontakten mit dem Arzt, in Kombination mit einer kurz- und vor allem langfristigen Fehlversorgung mit Antibiotika. Diese sind bei den meist vorliegenden Virusinfektionen medizinisch nicht angebracht: Sie sind wirkungslos und fördern allein die Bildung resistenter bakterieller Erreger. Eine der Ursachen dieser problematischen Kombination von Versorgungsfehlern oder -mängeln ist fehlendes Wissen über die Eigenart dieser Erkrankungen bei den wegen der oft heftigen Symptome verständlicherweise besorgten und übervorsichtigen Eltern und ein Mangel an umfassender Kommunikation zwischen Arzt und Eltern.
Dass diese Versorgungsmängel mit relativ einfachen Mitteln beeinflussbar und weitgehend vermeidbar sind, hat nun eine Studie in 61 englischen und walisischen Arztpraxen mit 558 Kindern zwischen 6 Monaten und 14 Jahren gezeigt. Per Zufall wurden die Teilnehmer einer Interventions- oder Kontrollgruppe zugeordnet.
In der Interventionsgruppe wurde ein persönliches interaktives Behandlungstagebuchs eingesetzt, in das der Arzt bei Behandlungsbeginn alle wichtigen Daten des erkrankten Kindes eintrug. Ferner wurden wichtige wissenschaftlich gestützte Hinweise auf die Eigenart der Erkrankung und ihrer Behandlung kurz erläutert. Das Tagebuch blieb dann für die gesamte Behandlungszeit im Besitz der Eltern und ihres Kindes. Die Ärzte in der Kontrollgruppe behandelten vergleichbar erkrankte PatientInnen und ihre Eltern wie gewohnt und ohne ein solches Buch.
Die Auswirkungen auf die Häufigkeit der Arztkontakte und der Antibiotika-Verordnungen sahen so aus:
• 12,9% der TeilnehmerInnen in der Interventionsgruppe und 16,2% in der Kontrollgruppe hatten eine oder mehrere Folgekonsultationen. Der Unterschied ist statistisch nicht signifikant.
• Hochsignifikante Unterschiede gab es dagegen bei den Verordnungen von Antibiotika beim ersten Arztbesuch und der Einnahme von Antibiotika innerhalb der ersten zwei Wochen nach diesem Termin: Den 19,5% der Kinder in der Interventionsgruppe, die eine Verordnung erhielten, standen 40,8% in der Kontrollgruppe gegenüber.
Da viele Ärzte meinen, durch eine abwartende oder zurückhaltende Verordnung von Arzneimitteln Patienten zu verlieren oder zu enttäuschen, ist hervor zu heben, dass dies offenkundig in dieser Studie nicht der Fall war. D.h. es gab keine Unterschiede, was Zufriedenheit und Beruhigung der Eltern anbetrifft. In Zukunft beabsichtigen die so aufgeklärten und einbezogenen Eltern sogar, mit einem erkälteten Kind nicht mehr so schnell einen Arzt aufzusuchen.
Vom Artikel gibt es eine vollständige Version als PDF-Datei kostenlos: Nick A Francis et al.: Effect of using an interactive booklet about childhood respiratory tract infections in primary care consultations on reconsulting and antibiotic prescribing: a cluster randomised controlled trial (British Medical Journal, 2009; 339: b2885)
Bernard Braun, 11.11.09
Der Kunde ist König: Kinderärzte verschreiben öfter Antibiotika, wenn sie vermuten, dass die Eltern dies von ihnen erwarten
 Dass viele Ärzte in unangemessener Weise Antibiotika verschreiben, obwohl dies therapeutisch wirkungslos und längerfristig sogar gesundheitsriskant ist, wurde schon vielfach belegt und ist auch im Forum Gesundheitspolitik öfter beschrieben worden (vgl. u.a.: Meta-Analyse stellt erneut Überversorgung mit Antibiotika fest). Über zugrunde liegende Ursachen und damit indirekt auch über Veränderungsmöglichkeiten ist weitaus weniger gesichert. Eine italienische Studie hat jetzt bei Kinderärzten nach Motiven gesucht und wurde fündig. Ärzte orientieren sich danach auch an den (vermuteten) Elternwünschen. Wenn sie annahmen, dass Eltern von ihnen ein Rezept für ein Medikament wünschten und nicht nur weitere diagnostische Maßnahmen oder Erklärungen für eine abwartende Haltung, dann verschrieben Sie auch sehr viel häufiger ein Antibiotikum.
Dass viele Ärzte in unangemessener Weise Antibiotika verschreiben, obwohl dies therapeutisch wirkungslos und längerfristig sogar gesundheitsriskant ist, wurde schon vielfach belegt und ist auch im Forum Gesundheitspolitik öfter beschrieben worden (vgl. u.a.: Meta-Analyse stellt erneut Überversorgung mit Antibiotika fest). Über zugrunde liegende Ursachen und damit indirekt auch über Veränderungsmöglichkeiten ist weitaus weniger gesichert. Eine italienische Studie hat jetzt bei Kinderärzten nach Motiven gesucht und wurde fündig. Ärzte orientieren sich danach auch an den (vermuteten) Elternwünschen. Wenn sie annahmen, dass Eltern von ihnen ein Rezept für ein Medikament wünschten und nicht nur weitere diagnostische Maßnahmen oder Erklärungen für eine abwartende Haltung, dann verschrieben Sie auch sehr viel häufiger ein Antibiotikum.
Die in der italienischen Emilia-Romagna rund um Bologna durchgeführte Studie umfasste zwei Teilerhebungen, über die die Wissenschaftler jetzt in der Zeitschrift "BMC Pediatrics" berichteten. In der ersten Phase wurden mit einem Fragebogen Meinungen und Kenntnisse von rund 750 Kinderärzten erhoben, die im ambulanten wie stationären Sektor tätig sind. Der Rücklauf war dabei mit rund 84 Prozent überdurchschnittlich hoch. Gefragt wurde unter anderem, welche Faktoren nach Meinung der Ärzte am stärksten eine Verschreibung von Antibiotika beeinflussen und welches Vorgehen sie selbst bei Mittelohrentzündungen wählen. Weiterhin wurden ihnen Ergebnisse von drei (hypothetischen) Diagnosen bei Kindern vorgegeben und gefragt, welches therapeutische oder diagnostische Vorgehen zu wählen ist, wenn man den neueren Forschungsstand berücksichtigt.
Hier zeigte sich dann: Von den Ärzten am häufigsten als Grund für die Antibiotika-Verschreibung genannt (von 56%) wurde "diagnostische Unsicherheit", im Vergleich dazu wurde der Grund "Erwartungen der Eltern" eher selten genannt (von 20%). Obwohl "diagnostische Unsicherheit" als Begründung überwog, zeigte sich gleichzeitig, dass nur eine Minderheit der Ärzte (21-36%, je nach Symptomatik) diagnostische Antigentests einsetzt, um dies zu überwinden. Auch die in vielen Fällen sinnvolle Vorgehensweise "abwartende Beobachtung" wurde von weniger als der Hälfte der Ärzte eingesetzt.
In einer zweiten Phase der Studie wurden über 4.000 Arztbesuche von Eltern mit erkrankten Kindern näher untersucht. Hier zeigte sich, dass in 38 Prozent der Fälle ein Antibiotikum verschrieben worden war. Hierzu wurden dann Ärzte befragt, unter anderem auch danach, ob sie bei den Eltern eine Erwartung gespürt hätten, dass dem Kind ein Medikament oder Antibiotikum verschrieben wird. Das wichtigste Ergebnis dieses Teilprojekts war dann: Neben einigen medizinischen Faktoren (insbesondere Ottorhoe, Ohrausfluss) war der wichtigste Einflussfaktor für eine Antibiotikum-Verschreibung die von Ärzten vermutete Erwartung der Eltern.
Auf Seiten der Eltern fanden die Wissenschaftler in der ersten Phase der zwei Gründe, die eine hohe Verschreibung von Antibiotika mit verursachen: Ein überaus defizitäres Wissen über die Wirkungsweise von Antibiotika, über die Grenzen ihrer Wirksamkeit und Risiken ihres zu häufigen Einsatzes, ferner eine große Überbesorgtheit von Eltern, die auch schon bei einfachen Erkältungen ärztliche Hilfe suchen.
Die Studie ist kostenlos im Volltext verfügbar: Maria Luisa Moro et al: Why do paediatricians prescribe antibiotics? Results of an Italian regional project (BMC Pediatrics 2009, 9:69, doi:10.1186/1471-2431-9-69, Published: 6 November 2009)
Gerd Marstedt, 9.11.09
Sachlichkeit statt "Pandemie-Hype": Allgemeinarztverband und Arzneimittelkommission zum ob, wer, wie und wie oft der Grippeimpfung
 Generalstabsmäßig meldet seit einigen Tagen Bundesland für Bundesland Vollzug: Zig Millionen von Impfdosen gegen die Schweinegrippe bzw. die angeblich "neue Influenza" liegen in Hunderten von Lagerstätten bereit, um am Tag X in Gesundheitsämtern und Schwerpunktpraxen an genau definierte Bevölkerungsgruppen ausgegeben werden zu können. Doch trotz dieser beeindruckenden Verteidigungskulisse kommt man sich als Beobachter ein wenig wie Loriots Rennbahnbesucher vor: "Ja, wo ist sie denn?"
Generalstabsmäßig meldet seit einigen Tagen Bundesland für Bundesland Vollzug: Zig Millionen von Impfdosen gegen die Schweinegrippe bzw. die angeblich "neue Influenza" liegen in Hunderten von Lagerstätten bereit, um am Tag X in Gesundheitsämtern und Schwerpunktpraxen an genau definierte Bevölkerungsgruppen ausgegeben werden zu können. Doch trotz dieser beeindruckenden Verteidigungskulisse kommt man sich als Beobachter ein wenig wie Loriots Rennbahnbesucher vor: "Ja, wo ist sie denn?"
Denn parallel zum Aufbau der Abwehrmaßnahmen, der immer wieder aufflackernden Debatte über die Verteilung der Impfkosten, der Diskussion möglicher unerwünschter Wirkungen der Impfstoffe und der stetigen Verlängerung der schon jetzt langen Kette inplausibler und intellektuell unredlicher Argumentationen im öffentlichen Schweinegrippe-Diskurs ist und bleibt die Schweinegrippe ein weltweit seltenes, hinsichtlich ihrer Tödlichkeit vergleichsweise "harmloses" Phänomen und dieses wird sogar im Moment in vielen Ländern faktisch kleiner oder verschwindet.
Bei vielen der seit Monaten von Gesundheitspolitikern aber auch einem Teil der Gesundheitsbehörden und Organisationen wie dem nationalen Robert-Koch-Institut (RKI) und der internationalen Weltgesundheitsorganisation (WHO) verbreiteten Prognosen und Szenarien handelt es sich
• im Falle der Erwartung einer "zweiten" und auch gleich noch wesentlich gefährlicheren Welle um eine abenteuerliche Analogie zu der in den letzten 100 Jahren einzigen derartigen Konstellation in den Jahren 1918/19. Dass es seither keinen zweiten Fall einer gefährlicheren zweiten Welle gegeben hat, wird in der eigenartigen "Pandemie-Euphorie" ignoriert und damit die Tatsache ignoriert, dass es zu dieser zweiten Welle wahrscheinlich nur wegen der historisch in der neueren Zeit hoffentlich einmaligen Konstellation einer durch Krieg und Hunger körperlich wie mental geschwächten Bevölkerung in Europa und der eigentlich schon immer geschwächteren Bevölkerung in Ländern der 3. Welt (zur Erinnerung: der Großteil der Toten der "spanischen Grippe" von 1918/19 war nicht in Spanien oder Europa zu beklagen, sondern z.B. in Indien) kommen konnte.
• und bei der Prognose einer viel gefährlicheren Winter-Schweinegrippe oder eines so genannten Reassortements des Schweinegrippe- mit dem Vogelgrippevirus um reine und mit fast keiner Wahrscheinlichkeit ausgestattete Spekulationen. Im Falle der Befürchtung, die normale Wintergrippe könne mit der Schweinegrippe oder gar einem völlig neuen Grippe-Typ zusammen zu einer gewaltigen Risiko- und Risikofolgenkumulation führen, gibt es, wenn man auf das Erkrankungsgeschehen auf der winterlichen Südhalbkugel schaut, gegenläufige oder garantiert keine bestätigende empirische Entwicklungen.
Trotz aller aktueller und mit Sicherheit im Nordhalbkugelwinter zu erwartenden Empirie (wie jedes Jahr wird es im Winter auch ohne Schweinegrippe "ganz normal" zahlreiche Grippefälle und -Tote geben und darunter sind wahrscheinlich auch Personen, die am Schweinegrippevirus versterben) wollen unverständlicherweise weder die WHO noch das RKI die oberste Pandemiestufe 6 und damit auch nationale Pandemiepläne abblasen oder abmildern und insgesamt deeskalierend wirken.
Wie so etwas aussehen könnte und wie man sich dabei trotzdem nicht im anderen Extrem der Verharmlosung befindet, zeigen zwei gerade erschienene Stellungnahmen der Arzneimittel-Kommission der deutschen Ärzteschaft und der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Allgemeinmedizin(DEGAM), die sich schwerpunktmäßig mit den Impfplänen und der kritischen Debatte über unerwünschte Nebenwirkungen auseinandersetzen.
Die Stellungnahme der Arzneimittelkommission fasst auf der Basis von vorhandenen Erkenntnissen aus anderen Ländern die gesicherte Erkenntnislage u.a. so zusammen:
• Die "Übertragungsrate in epidemiologischen Analysen basierend auf Daten aus Peru, Mexiko, Japan und Neuseeland (wird) ähnlich oder sogar höher als bei der saisonalen Influenza eingeschätzt."
• Und: "Derzeit ist nicht auszuschließen, dass die Übertragungswahrscheinlichkeit in Mitteleuropa in den Wintermonaten höher ist als aktuell beobachtet."
• Trotz der spekulativen Annahme über die Existenz von Schweinegrippefällen, die tödlich geendet haben, aber als leichte Fälle eingeschätzt und dokumentiert worden sein sollen, ist die empirisch gesicherte Prognose wieder deutlich harmloser: Eine empirische Untersuchung nämlich "spricht dafür, dass die Sterblichkeit der neuen Influenza etwas höher liegt, jedoch in der gleichen Größenordnung wie bei der saisonalen Influenza"
• Dem schließt sich der aber auch schon für alle anderen Grippeinfektionen geltende und zutreffende Hinweis auf die Existenz der besonders gefährdeten und daher auch möglichst durch Impfen zu schützenden Schwangeren und an anderen schweren chronisch erkrankten Personen an: Sie sind "mit einem höheren Risiko für einen schweren Verlauf einer Erkrankung an neuer Influenza assoziiert."
• Die Wirksamkeit und die Risiken der Impfung beurteilen die Arzneimittelexperten sehr differenziert und verantwortungsvoll zurückhaltend. So ist es für sie "nicht sicher zu beurteilen, ob die jetzige Impfung auch gegen ein verändertes hoch pathogenes H1N1-Virus schützt" also jenes Virus, dessen Auftreten von denselben Akteuren prognostiziert wird, die sich für eine hohe Durchimpfungsrate gegen den aktuellen Schweinegrippevirus stark machen. Auch wenn sie für die genannten Risikopersonen eine Impfung empfehlen, schlagen sie trotzdem vor, dass Schwangeren und Kindern wegen der nicht durch Studien entkräfteten Wirkungen eines dem Impfstoff zugesetzten Wirkungsverstärkers (Adjuvans) "ein nicht-adjuvanzierter Impfstoff angeboten werden."
• Die Kommission schlägt ferner ein engmaschiges Überwachungssystem für erwartete Erscheinungen vor.
Zu der Frage, ob man eigentlich bei einer flächendeckend geplanten Impfung wirklich Impfstoffe mit Wirkverstärkern braucht, um schnell einen hohen Impfstoffwirkspiegel und Schutz erreichen zu können, gibt es fast paradoxe aber hierzulande wenig diskutierte noch gar praktisch aufgegriffene Ergebnisse aus den USA.
Dort entschieden die nationalen Sicherheitsinstitutionen zum einen, nur Impfstoffe ohne Wirkverstärker einzusetzen. Zum anderen aber existieren in den USA und Australien erste Hinweise aus kleinen Studien, dass die eigentlich wirkärmeren traditionell gefertigten Impfstoffe, um ihre volle Wirksamkeit erreichen zu können, nur einmal gespritzt werden müssen und nicht zweimal wie beim angeblich wirkmächtigeren "moderneren" Impfstoff deutscher Prägung
Die Stellungnahme der "Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin (DEGAM) zum Entwurf der STIKO-Empfehlungen bezüglich der Impfung gegen die Neue Influenza A (H1N1" ähnelt der Stellungnahme der Arzneimittelexperten der deutschen Ärzteschaft im Grundtenor, spitzt seine POsitionen aber deutlicher zu.
Zur Epidemiologie erklärt die DEGAM einleitend und sehr gezielt: "Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat bei der Ausrufung der Pandemie für die Neue Influenza (H1N1 09) die seit Jahren bestehende Definition des Begriffs geändert und den entscheidenden Satz, dass "weltweit eine enorme Zahl von Erkrankungen und Toten" aufgetreten sein müssen, weggelassen. Bei dieser Vorgehensweise, welche die Unterschiede zwischen pandemischer und saisonaler Grippe verwischt, haben möglicherweise interessensgeleitete Berater eine wesentliche Rolle gespielt."
Angesichts des harmlosen und unkomplizierten bisherigen Verlaufs von Schweinegrippenerkerankungen heben die Autoren nochmals eigentlich Selbstverständliches hervor:
• "Dieser insgesamt gutartige Verlauf der Erkrankung in Deutschland verpflichtet bei prophylaktischen Maßnahmen zu einer besonders sorgfältige Abwägung von Nutzen und Schaden."
• Und: "An einen für die gesamte Bevölkerung vorgesehenen Impfstoff (sind) ganz besonders strenge Kriterien anzulegen."
Die 8 Seiten umfassende Stellungnahme der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft zur Schutzimpfung gegen die neue Influenza A (H1N1)1 ist am 10. September 2009 erschienen und kostenlos erhältlich.
Dies gilt auch für die vierseitige DEGAM-Stellungnahme.
Die Ergebnisse der zwei Untersuchungen zur Art und Häufigkeit von Impfungen und vor allem der Notwendigkeit und des höheren Schutzes zweier Impfungen finden sich kostenlos herunterladbar im am 10. September 2009 erschienenen Heft des "New England Journal of Medicine (NEJM)". Der Aufsatz "Trial of Influenza A (H1N1) 2009 Monovalent MF59-Adjuvanted Vaccine — Preliminary Report" von Clark et al. hier und der Aufsatz "Response after One Dose of a Monovalent Influenza A (H1N1) 2009 Vaccine — Preliminary Report" von Greenberg et al. hier.
Bernard Braun, 18.9.09
Bandscheibenversorgung mit Lücken - Versorgungsforschung im Zeitverlauf mit GKV-Routinedaten
 Jeder 20. Versicherte der Gmünder Ersatzkasse (GEK) erhält einmal im Jahr eine Bandscheibendiagnose, jeder 60. Versicherte wird deswegen zeitweise oder dauerhaft arbeitsunfähig. Je nach Schweregrad und Therapieform entstehen jährlich direkte Kosten von 200 bis 4.500 Euro pro Fall. Hierbei handelt es sich auch nicht um ein stagnierendes Geschehen, sondern ums genaue Gegenteil: Allein das Neuauftreten (Inzidenz) einer ambulant neu diagnostizierten Bandscheibenverlagerung im Bereich der Lendenwirbelsäule (lumbal) stieg zwischen 2004 und 2007 um 20 Prozent. Die Häufigkeit von Krankenhausaufenthalten aufgrund eines Bandscheibenschadens im selben Rückenbereich nahm im selben Zeitraum um 40 Prozent zu. In beiden Fällen ist der denkbare Effekt unterschiedlicher Alters- und Geschlechtsstrukturen ausgeschlossen.
Jeder 20. Versicherte der Gmünder Ersatzkasse (GEK) erhält einmal im Jahr eine Bandscheibendiagnose, jeder 60. Versicherte wird deswegen zeitweise oder dauerhaft arbeitsunfähig. Je nach Schweregrad und Therapieform entstehen jährlich direkte Kosten von 200 bis 4.500 Euro pro Fall. Hierbei handelt es sich auch nicht um ein stagnierendes Geschehen, sondern ums genaue Gegenteil: Allein das Neuauftreten (Inzidenz) einer ambulant neu diagnostizierten Bandscheibenverlagerung im Bereich der Lendenwirbelsäule (lumbal) stieg zwischen 2004 und 2007 um 20 Prozent. Die Häufigkeit von Krankenhausaufenthalten aufgrund eines Bandscheibenschadens im selben Rückenbereich nahm im selben Zeitraum um 40 Prozent zu. In beiden Fällen ist der denkbare Effekt unterschiedlicher Alters- und Geschlechtsstrukturen ausgeschlossen.
Grundlage dieser Ergebnisse war die in Deutschland erstmals durchgeführte individuenbezogene Längsschnittanalyse von ambulanten und stationären Routinedaten zu vier Bandscheiben-Diagnosen (Schäden und Verlagerungen im unteren [lumbalen] und oberen [zervikalen] Rückenbereich) von 1,1 Millionen GEK Versicherten aus den Jahren 2005 bis 2007. Da die GEK-Versicherten durchschnittlich jünger als die Versicherten in der GKV sind und Bandscheibenerkrankungen im Lebensalter zwischen 50 und 59 Jahren kumulieren, sind die Versicherten einer Reihe von gesetzlichen Krankenkassen eher mehr von den hier dokumentierten Problemen betroffen und garantiert nicht weniger.
In dem am 14. September 2009 veröffentlichten "Bandscheiben-Report" finden sich außerdem eine Reihe weiterer wichtiger Hinweise für das seit kurzem eingeführte Recht der Versicherten auf ein Versorgungsmanagement (§ 11 Abs. 4 SGB V):
• So haben Patienten mit der ambulanten Diagnose "Rückenschmerzen" eine um 90% bis 127% höhere Wahrscheinlichkeit an einer der vier Bandscheibenerkrankungen zu leiden als Personen ohne "Rückenschmerzen". Diese nicht ernst zu nehmen kann also weitreichende Folgen haben.
• Bei 65 Prozent der Patienten, die im ersten Jahr nach Erstdiagnose weiterhin spezifische Diagnosen erhielten, aber ohne Therapie blieben, leiden auch noch im zweiten Jahr an der Erkrankung bzw. bekommen entsprechende Diagnosen ohne erkennbare Therapie.
Bewertet man die gefundenen Versorgungswirklichkeiten mit Hilfe der in Leitlinien konsentierten Behandlungsempfehlungen von medizinischen Fachgesellschaften und Versorgungsträgern, zeigen sich sowohl erfreuliche Übereinstimmungen oder leitlinienkonforme Behandlungsmuster als auch erhebliche Verbesserungsbedarfe:
• Das verbreitet zu findende eher abwartende und primär auf Schmerzreduktion und Entspannung setzende Behandeln ist leitlinienkonform. Ebenso die insgesamt nur selten zu beobachtenden Lagerungen und Immobilisationen der Patienten.
• Zu gering und nicht leitlinienkonform ist der relativ geringe Anteil der Bandscheibenerkrankten, die eine Rehabilitation durchführen: 22 Prozent der operierten Bandscheibenpatienten erhalten nach dem Krankenhausaufenthalt eine Anschlussheilbehandlung oder eine aktivierende Reha-Maßnahme.
• Bei bis zu 40 Prozent der stationär eingewiesenen Patienten ist keine anschließende stationäre oder ambulante Behandlung dokumentiert.
• Obwohl die Empfehlung, die Abfolge von notwendigen kurativen und rehabilitativen Leistungen möglichst nahtlos und zügig durchzuführen, eindeutig ist, sieht es in Wirklichkeit zum Teil etwas anders aus: Auffällig ist z.B. die durchschnittlich vierwöchige Lücke zwischen klinischer und postklinischer Behandlung bei über 40 Prozent der Patienten. Erst nach zwölf Wochen reduziert sich deren Anteil auf 20 Prozent.
• Ein großer Verbesserungsbedarf besteht bei der Durchführung von präventiven Leistungen, die sehr selten in den Versorgungsdaten zu finden sind.
• Ähnliches gilt für explizit erbrachte spezielle rehabilitative Leistungen zur schnellen Reintegration in Beruf und Alltag - einem der wichtigsten Mittel, Chronifizierung zu verhindern.
• Der Anteil von Erkrankten, die nur passive oder passivierende statt aktivierende Leistungen erhalten, ist mit rund einem Viertel im Lichte der Leitlinienempfehlungen zu hoch.
Schließlich zeigten die Analysen eine Reihe von ungleichen Behandlungen bei gleichen Diagnosen oder auch Unterversorgung:
• Erwerbspersonen erhalten generell häufiger und mehr Rehabilitationsleistungen als Nichterwerbspersonen. Dies erklärt zum Teil, dass Frauen diese Leistungen seltener erhalten als Männer.
• Kräftige Unterschiede gibt es aber auch zwischen Erwerbstätigen mit höherem beruflichen Status und ihren KollegInnen mit geringerer Qualifikation: Die Wahrscheinlichkeit für versicherte Techniker und qualifizierte Angestellte dann, wenn sie an lumbalen Bandscheibenschäden oder -verlagerungen leiden, eine Rehamaßnahme zu erhalten ist 1,9-mal bis 2,5-mal so hoch wie bei Geringerqualifizierten und nicht Erwerbstätigen.
Zeigt der Report einerseits die Machbarkeit solcher Analysen mit Routinedaten, so greift eine ausschließlich auf diesen Daten beruhende Analyse manchmal zu kurz und erlaubt z.B. keine weiterreichende Identifikation von Ursachen der schlechteren Versorgung und Inanspruchnahme von Rehabilitationsmaßnahmen bei den weiblichen Erkrankten. Um mehr über Hintergründe und Einflussfaktoren auf Entscheidungen zu erfahren, bedarf es aber mündlicher Befragungen von Leistungserbringern, Krankenkassensachbearbeitern und Patienten.
Der von Wissenschaftlern des Zentrums für Sozialpolitik (ZeS) der Universität Bremen (Maren Bauknecht, Bernard Braun und Rolf Müller) erstellte 141 Seiten umfassende "GEK-Bandscheiben-Report" ist komplett und kostenlos als PDF-Datei erhältlich.
Bernard Braun, 15.9.09
Deutsche Studie kritisiert: Ärzte verordnen bei Rückenschmerzen viel zu oft passive Therapieformen
 Medizinische Leitlinien zur Therapie von Rückenschmerzen empfehlen eine Aktivierung des Patienten und raten dazu, passive Behandlungsmethoden und insbesondere die Verordnung von Bettruhe zu vermeiden. In der ärztlichen Praxis herrschen jedoch nach wie vor diese veralteten Therapieempfehlungen vor. "Noch viel zu häufig werden Bettruhe, Spritzen, Wärme- oder Kälteanwendungen als sog. passive Therapiemaßnahmen verordnet", so fassen Heidelberger Wissenschaftler Ergebnisse einer Patientenbefragung zusammen und empfehlen mehr Aufklärung für Patienten und Fortbildungen für Ärzte.
Medizinische Leitlinien zur Therapie von Rückenschmerzen empfehlen eine Aktivierung des Patienten und raten dazu, passive Behandlungsmethoden und insbesondere die Verordnung von Bettruhe zu vermeiden. In der ärztlichen Praxis herrschen jedoch nach wie vor diese veralteten Therapieempfehlungen vor. "Noch viel zu häufig werden Bettruhe, Spritzen, Wärme- oder Kälteanwendungen als sog. passive Therapiemaßnahmen verordnet", so fassen Heidelberger Wissenschaftler Ergebnisse einer Patientenbefragung zusammen und empfehlen mehr Aufklärung für Patienten und Fortbildungen für Ärzte.
Chronische Rückenschmerzen sind eine überaus häufige Erkrankung. Sie verursachen in Deutschland knapp 4% aller medizinischen Versorgungskosten, machen 15% aller Arbeitsunfähigkeitstage aus und 18% aller Ursachen für Frühverrentungen. Von Rückenschmerzen sind bei Erhebungen zu einem bestimmten Stichtag jeweils 30-40% der erwachsenen Bevölkerung betroffen, innerhalb eines Jahres machen 70% diese Krankheitserfahrung. Entgegen der in den letzten Jahrzehnten üblichen passiven Therapie mit Bettruhe und Schonung haben sich die Therapieempfehlungen auch in medizinischen Leitlinien in den letzten Jahren radikal gewandelt.
Forscher an der Universitätsklinik Heidelberg haben nun die aktuelle Praxis der Therapie analysiert. Dazu wurden deutschlandweit jeweils 10 Fragebögen an 225 orthopädische Praxen versandt mit der Bitte, diese solchen Patienten auszuhändigen, die an unspezifischen Rückenschmerzen leiden. Ein zweiter Fragebogen wurde dann Patienten, die sich an der ersten Erhebung beteiligt hatten, sechs Monate später zugeschickt. In die spätere Datenanalyse einbeziehen konnten die Wissenschaftler dann Daten von 630 Rückenschmerzpatienten. Dabei zeigten sich folgende Befunde:
• Neben Physiotherapie (47% der Fälle) wurden vor allem Spritzen (44%) und Medikamente (33%) verordnet, sowie Wärme- oder Kältetherapien und Massagen (jew. 27%). Aber auch Ruhe/Bettruhe und Krankschreibungen waren noch sehr häufig (9%, 16%)
• Je höher der Chronifizierungsgrad, desto mehr Therapien nahmen die Patienten parallel in Anspruch, allerdings auch desto mehr passive.
• Die subjektiv wirksamste Therapie bei fast 80% der befragten Patienten war Ruhe/Bettruhe. Auch Physiotherapie und Spritzen waren aus Sicht der Patienten mit 70% bzw. 63% subjektiv überaus erfolgreich.
• Dass dieser subjektive Eindruck einer Schmerzlinderung durch passive Therapien eine Selbsttäuschung ist, zeigte die Wiederholungs-Befragung nach 6 Monaten. Bei 66 Prozent der Patienten, deren Schmerzen anfangs noch nicht chronisch gewesen waren, verschlechterte sich die Lage. Bei über der Hälfte der Patienten mit chronischen Rückenschmerzen änderte sich nichts an ihren Beschwerden, bei knapp 13 Prozent verschlechterten sie sich sogar. Nur ein Drittel profitierte von der Behandlung.
In ihrem Fazit fordern die Wissenschaftler mehr Information und Aufklärung - für Patienten wie Ärzte gleichermaßen: "Die Untersuchungen dieser Studie zeigen, dass in Deutschland passive Therapieelemente immer noch einen bedeutenden Anteil bei der Behandlung des chronischen Rückenschmerzes ausmachen. Dies steht konträr zu den aktuellen nationalen und internationalen Therapieempfehlungen. Trotz hoher Patientenzufriedenheit und subjektiv positiver Therapieeffekte war der objektiv gemessene Therapieerfolg relativ gering: Etwa die Hälfte der Patienten hat ihr Chronifizierungsstadium nicht verbessern können, Verschlechterungen und Verbesserungen haben sich über alle Stadien hinweg die Waage gehalten. Als Konsequenz bedarf es einer umfassenden öffentlichen Aufklärung der Bevölkerung zum Thema chronische Rückenschmerzen und einer Fortbildungsoffensive für Allgemeinmediziner, Fachärzte und Therapeuten sowie einem Mehrangebot an interdisziplinär arbeitenden Therapieeinrichtungen."
Hier ist ein Abstract: E.-K. Renker, J. Schlüter, E. Neubauer, M. Schiltenwolf: Therapie bei Patienten mit Rückenschmerzen. Verordnungsverhalten - subjektive Zufriedenheit - Effekte (Schmerz 2009, 23:284-291, DOI: 10.1007/s00482-009-0785-6)
Gerd Marstedt, 15.7.09
Die Verschreibung von Antibiotika bei Husten variiert erheblich in Europa - und bewirkt nirgends eine schnellere Rekonvaleszenz
 Dass Antibiotika bei vielen Infektionen von Ärzten verschrieben werden, ohne dass dies medizinisch sinnvoll ist und Patienten hilft, ist seit langem bekannt, ebenso wie das damit verbundene große Problem, dass Krankheitserreger zunehmend resistent werden gegen Medikamente. Eine Forschungsgruppe mit Wissenschaftlern aus 14 europäischen Ländern hat nun untersucht, ob diese Praxis überall in Europa gleich verbreitet ist und ob dies zumindest einigen Patienten hilft.
Dass Antibiotika bei vielen Infektionen von Ärzten verschrieben werden, ohne dass dies medizinisch sinnvoll ist und Patienten hilft, ist seit langem bekannt, ebenso wie das damit verbundene große Problem, dass Krankheitserreger zunehmend resistent werden gegen Medikamente. Eine Forschungsgruppe mit Wissenschaftlern aus 14 europäischen Ländern hat nun untersucht, ob diese Praxis überall in Europa gleich verbreitet ist und ob dies zumindest einigen Patienten hilft.
Ihre Studie, die jetzt im "British Medical Journal" veröffentlicht wurde, kam zu drei zentralen Befunden : 1.) Die Verschreibungsquote für Antibiotika bei einfachen Atemwegsinfektionen variiert erheblich in Europa, und zwar zwischen 20 und 90 Prozent. 2.) Der jeweilige Schweregrad einer Erkrankung, festgemacht an Symptomen wie Husten, Fieber, Atemnot usw. hat keinen Einfluss auf die Verschreibungspraxis. Und 3.): Antibiotika kürzen den Heilungsprozess keineswegs ab, ob mit oder ohne Penicillin: Erst nach 11 Tagen berichten Patienten im Durchschnitt über eine deutliche Besserung der Symptome.
Anstoß für die Durchführung der Studie und organisatorische Hilfen gab das sogenannte "GRACE-Netzwerk", das es sich zur Aufgabe gemacht hat, gegen die zunehmende Resistenz von Krankheitserregern gegen Antibiotika wissenschaftlich anzukämpfen. Mit Hilfe des Netzwerks wurden in 14 europäischen Städten (in Belgien, Finnland, Deutschland, Niederlande, Ungarn, Italien, Norwegen, Polen, Slowakei, Spanien, Schweden, United Kingdom) ärztliche Praxen (Allgemeinärzte) um ihre Mitarbeit gebeten. Diese untersuchten Anfang 2006 bis März 2007 Patienten, die mit einer Atemwegsinfektion in die Sprechstunde kamen, ausführlich und dokumentierten verschiedene Angaben auf einem Berichtsbogen: sozialstatistische Daten, Krankheitsgeschichte, Medikamenten-Verschreibung oder andere Therapie. Darüber hinaus wurden die Krankheitssymptome (Husten, Sputum, Fieber, Kurzatmigkeit, Schlafstörungen, Durchfall, Schmerzen in der Brust, Kopfschmerzen und anderes mehr) genau dokumentiert und später zusammengefasst, je nach Schweregrad der Symptome. Dabei wurden vier Bewertungen abgegeben: Kein Problem, leichtes, mittleres oder schweres Problem.
Den Patienten selbst wurde ein Beobachtungs-Tagebuch mitgegeben, in dem sie über einen Zeitraum von vier Wochen jeweils täglich den Schweregrad ihrer Symptome bewerteten - derselben Symptome, die auch der Arzt beurteilt hatte. Insgesamt sammelte man ärztliche Daten von über 3.400 Patienten und von gut 2.700 Patienten lagen später zusätzlich auch noch die Tagebücher mit Beobachtungsdaten zum Krankheitsverlauf vor.
In der Auswertung dieser Daten wurden dann auch multivariate statistische Verfahren eingesetzt, die es erlauben, simultan den Effekt verschiedener Einflüsse zu messen (z.B. Patientenmerkmale wie Alters- oder Geschlechtseinflüsse, Effekte durch die ärztliche Praxis). Die wichtigsten Ergebnisse der Analyse waren dann:
• Die Antibiotika-Verschreibung variierte in den 14 einbezogenen Städten ganz erheblich, sie lag am niedrigsten in den einbezogenen Städten in Belgien, Norwegen und Spanien (mit Medikamenten-Verschreibungen in 20-30 Prozent der Fälle) und am höchsten in den Städten in Ungarn, Italien, Polen (Verschreibungsquote 70-75%). Spitzenreiter waren Arztpraxen in Bratislava (Slowakei), die in 88% aller Fälle Antibiotika verschrieben.
• Insgesamt lag die Quote für eine Antibiotika-Verordnung bei 53%, Deutschland lag mit 35% (Arztpraxen in Rotenburg) recht weit unten.
• In einer multivariaten Analyse unter Berücksichtigung nicht nur der Nationalität, sondern auch weiterer Faktoren, verschärften sich diese Unterschiede dann noch einmal. Danach zeigte sich dann etwa, dass Antibiotika in Bratislava (Odds-Ratio 11,2) etwa 50 mal häufiger verschrieben wurden als in Antwerpen (Odds-Ratio 0,22).
• Der jeweils anhand verschiedener Symptome festgestellte Schweregrad der Erkrankung hatte nur einen absolut minimalen Einfluss darauf, ob ein Antibiotikum verschrieben wurde oder nicht.
• Das wohl wichtigste Ergebnis der Studie lautete dann jedoch: Patienten, denen ein Antibiotikum verschrieben worden war, kurierten ihre Krankheit keineswegs schneller aus als andere. Die fehlende Wirkung des Medikaments bestätigte sich auch dann, wenn man den jeweiligen Symptom-Schweregrad und weitere Merkmale (Raucher/Nichtraucher, weitere Erkrankungen) statistisch mitberücksichtigte. Im Durchschnitt spürten die Patienten nach 11 Tagen ein deutliches Abklingen der Beschwerden und nach 15 Tagen eine völlige Beschwerdefreiheit.
Die Studie ist kostenlos im Volltext verfügbar: C.C. Butler et al: Variation in antibiotic prescribing and its impact on recovery in patients with acute cough in primary care: prospective study in 13 countries (BMJ 2009;338:b2242, doi: 10.1136/bmj.b2242)
Gerd Marstedt, 30.6.09
Bewegungsprogramme nach Bandscheibenoperation: Nachweisbarer Nutzen ohne nachweisbare Nachteile für die Genesung
 Unabhängig davon, dass es keineswegs bei jeder Bandscheibenbeschwerde einer Operation bedarf, stellt sich die Frage, wie die operierten PatientInnen nach der Operation wieder zu ihren Alltagsaktivitäten zurückkommen können. Dies gilt insbesondere für die 10 bis 40 % der operierten Personen, bei denen die Operation zu keiner sofortigen Verbesserung ihrer Symptome (z.B. Schmerzen und Einschränkungen der Beweglichkeit) geführt hat oder gar jene 3 bis 12 % der Patienten, die z.B. einen erneuten Bandscheibenvorfall erleiden und eine weitere Operation benötigen.
Unabhängig davon, dass es keineswegs bei jeder Bandscheibenbeschwerde einer Operation bedarf, stellt sich die Frage, wie die operierten PatientInnen nach der Operation wieder zu ihren Alltagsaktivitäten zurückkommen können. Dies gilt insbesondere für die 10 bis 40 % der operierten Personen, bei denen die Operation zu keiner sofortigen Verbesserung ihrer Symptome (z.B. Schmerzen und Einschränkungen der Beweglichkeit) geführt hat oder gar jene 3 bis 12 % der Patienten, die z.B. einen erneuten Bandscheibenvorfall erleiden und eine weitere Operation benötigen.
Während ein Teil der behandelnden Ärzte wegen der von ihnen befürchteten Risiken für die Genesung eine längere Ruhephase für geboten halten, fordern andere Therapeuten eine möglichst frühe Reaktivierung der PatientInnen und entsprechende Rehabilitationsangebote. Wie in vielen anderen Therapiefeldern gibt es aber für beide Strategien bisher wenig wissenschaftliche Evidenz. Einem Teil dieses Blindflugs macht jetzt der aktualisierte Review "Rehabilitation after lumbar disc surgery" der Cochrane Reviewer Group um RW Costelo für die an einer Bandscheibe im Lendenwirbelbereich operierten PatientInnen ein Ende.
In dem Review von 14 randomisierten kontrollierten Studien mit 1.927 TeilnehmerInnen zwischen 18 und 65 Jahren (darunter aber nur 7 Studien bei denen Verzerrungen ausgeschlossen werden konnten) wurden drei unterschiedliche Therapien verglichen: bewegungsorientierte Trainingsprogramme mit keiner Behandlung, Intensivprogramme mit Programmen geringer Intensität und Trainingsprogramme unter ständiger fachlicher Aufsicht oder Anleitung mit Heim-Trainingsprogrammen. Die untersuchten Trainingsprogramme starteten fast alle vier bis sechs Wochen nach der Operation und dauerten zwischen zwei Tagen und 12 Monaten. Über die Wirkungen der Programme, die sofort nach der Operation starteten, gibt es nur sehr wenig Untersuchungen und daher keine verlässlichen Erkenntnisse.
Generell beklagen sich die Reviewer wie in vielen anderen Bewertungen der Forschungslage über die Wirksamkeit und den Nutzen von Therapien über die niedrige Qualität selbst der noch relativ besten Studien.
Trotzdem kommen sie zu einigen praktisch wichtigen Erkenntnissen:
• Patienten, die an irgendeinem der Trainings- oder Bewegungsprogramme teilnahmen, litten kurzfristig etwas weniger an Schmerzen und Behinderungen als die Patienten ohne eine derartige Behandlung.
• Patienten, die an sehr intensiven Bewegungsprogrammen teilnahmen hatten ebenfalls schon in kurzer Zeit weniger Schmerzen und Behinderungen als TeilnehmerInnen an Programmen mit niedriger Intensität.
• Keine statistisch signifikanten Unterschiede beim Auftreten von Schmerzen oder Behinderungen gab es zwischen TeilnehmerInnen an fachlich geführten oder zu Hause in Eigenregie durchgeführten Übungsprogrammen.
• In keiner der untersuchten Studien fanden sich Anzeichen, dass irgendein aktivierendes Programm zu einer erhöhten Re-Operationsrate geführt hätte. Daraus ist zu schließen, dass es keine negativen Folgen hat, wenn Bandscheibenoperierte nach ihrer Operation so schnell wie möglich wieder aktiv sind und längere passive Phasen nach der Operation nicht notwendig sind.
• Auch wenn unglücklicherweise in fast allen Studien über häusliche oder angeleitete Trainingsprogramme nicht danach geschaut wurde, ob und wie lange die TeilnehmerInnen sich an das Trainingsschema halten, gibt es in einer Studie über häusliche Programme Hinweise auf eine gewisse Non-Compliance: So hielten sich in dem untersuchten Fall nach zwei Monaten nur noch 50 bis 60 % der TeilnehmerInnen an die vereinbarten Therapieziele. Dieser Anteil fiel nach 6 von 12 Monaten auf 30 %. Offensichtlich muss eine Langzeit-Rehabilitation stärker begleitet und ihre Teilnehmerinnen intensiver motiviert werden. In einer Untersuchung beschleunigte der sehr frühe Einsatz eines so genannten "medical adviser" des Sozialversicherungsträgers die Rückkehr der so betreuten Versicherten in die Arbeit beträchtlich.
• Die allerdings wiederum nur einzige Studie, welche die Wirkung eines bio-psychosozialen Programms mit der eines normalen physiotherapeutischen Programms verglich, zeigte keine qualitativen Unterschiede. Dies gilt auch für die Ergänzung des normalen Bewegungsprogramms um neurale Mobilisierung, die weder kurz- noch langfristig zusätzliche Wirkung auf Schmerzen und Beweglichkeit zeigte.
• Dafür ob jeder Patient mit einer Bandscheibenoperation an einem der genannten Rehabilitationsprogrammen teilnehmen soll oder nur diejenigen welche nach vier oder sechs Wochen noch Symptome wie Schmerz oder Bewegungseinschränkungen aufweisen, liefert aber auch dieser Review keine evidenten Erkenntnisse.
Hier ist ein Abstract des Cochrane-Reviews: "Rehabilitation after lumbar disc surgery" (Cochrane Database Systematic Review 8. Oktober 2008; [4]: CD003007) von Ostelo, Costa, Maher, de Vet und van Tulder. Die komplette PDF-Fassung umfasst 46 Seiten und kann nur kostenpflichtig eingesehen und heruntergeladen werden.
Bernard Braun, 28.2.09
Röntgen, CT und MRI bei Rückenschmerzen: Therapeutisch unnötig, aber von Patienten gewünscht und für Ärzte finanziell attraktiv
 Rückenschmerzen im unteren Bereich der Wirbelsäule (sogenannte "Lumbalgie" oder "Lumbago") sind überaus häufige Beschwerden, über die zwei von drei Deutschen zumindest einmal im Jahr klagen. Zugleich sind die genauen Ursachen trotz sehr sorgfältiger und ausführlicher Untersuchungen meist nicht auszumachen, so dass auch therapeutische Empfehlungen schwer fallen. In dieser Situation lassen viele Ärzte bildgebende Verfahren durchführen: Röntgenaufnahmen, Kernspintomografie (MRI) oder Computertomografie (CT). Eine jetzt in der Zeitschrift "The Lancet" veröffentlichte Meta-Analyse hat jedoch gezeigt: Im Vergleich zu einer Routine-Therapie verbessern solche diagnostischen Maßnahmen den Behandlungserfolg überhaupt nicht. Auch wird dadurch die genaue Diagnosestellung für den Arzt nicht leichter.
Rückenschmerzen im unteren Bereich der Wirbelsäule (sogenannte "Lumbalgie" oder "Lumbago") sind überaus häufige Beschwerden, über die zwei von drei Deutschen zumindest einmal im Jahr klagen. Zugleich sind die genauen Ursachen trotz sehr sorgfältiger und ausführlicher Untersuchungen meist nicht auszumachen, so dass auch therapeutische Empfehlungen schwer fallen. In dieser Situation lassen viele Ärzte bildgebende Verfahren durchführen: Röntgenaufnahmen, Kernspintomografie (MRI) oder Computertomografie (CT). Eine jetzt in der Zeitschrift "The Lancet" veröffentlichte Meta-Analyse hat jedoch gezeigt: Im Vergleich zu einer Routine-Therapie verbessern solche diagnostischen Maßnahmen den Behandlungserfolg überhaupt nicht. Auch wird dadurch die genaue Diagnosestellung für den Arzt nicht leichter.
Auf der anderen Seite finden sich jedoch für die Patienten überaus negative Begleiterscheinungen, einerseits durch die Strahlenbelastungen, andererseits erkennen Patienten, denen man die Bilder zeigt, überdeutlich die Verschleißerscheinungen an der Wirbelsäule. Diese Wahrnehmungen können sich dann negativ auswirken auf den Patienten und seine Zuversicht in die Heilungschancen.
Die Meta-Analyse der Wissenschaftler aus Baltimore und Portland, USA, fußt auf sechs schon veröffentlichten medizinischen Studien mit insgesamt etwa 1.800 Patienten. In vier Studien wurden bei den Patienten mit Rückenschmerzen Röntgenaufnahmen durchgeführt, in zwei Studien Kernspintomografie oder Computertomografie. Parallel dazu wurden in allen sechs Studien Patienten nach dem Zufallsprinzip auch Kontrollgruppen zugeordnet, bei denen man auf solche bildgebenden Verfahren verzichtete.
In der Analyse der Ergebnisse und dem Gruppenvergleich zeigte sich dann für eine Vielzahl von Indikatoren, dass weder nach drei Monaten noch nach 6-12 Monaten in den Patientengruppen mit Röntgen, MRI oder CT der Behandlungserfolg besser war. Vielmehr gab es keine signifikanten Unterschiede zwischen den Gruppen im Hinblick auf die Schmerzintensität, Funktionseinschränkungen durch die Schmerzen, subjektiv wahrgenommene Lebensqualität, psychische Beeinträchtigungen oder Einschätzungen des Behandlungsfortschritts. Ärzte, so mahnen die Wissenschaftler, sollten daher darauf verzichten, Patienten bei den hier beschriebenen Rückenschmerzen routinemäßig zu röntgen oder zum MRI oder zur CT zu überweisen, es sei denn, sie hätten den Verdacht auf eine zugrunde liegende schwerwiegende Erkrankung wie Krebs oder eine Infektion.
Obwohl die allermeisten Leitlinien inzwischen auch von radiologischen Untersuchungen im ersten Monat abraten, äußert sich eine Forschungsgruppe an der Universität Göttingen in einem kurzen Begleitartikel zur Metaanalyse skeptisch, dass sich die gängige Praxis bald ändern wird. Einerseits dürften Ärzte auch in Zukunft der Neugier ihrer Patienten nach einem Bild ihrer Beschwerden kaum Widerstand entgegensetzen, andererseits dürften viele Ärzte auch den finanziellen Anreizen des Gesundheitssystems nicht widerstehen.
Hier ist ein kostenloses Abstract: Roger Chou u.a.: Imaging strategies for low-back pain: systematic review and meta-analysis (The Lancet, Volume 373, Issue 9662, Pages 463 - 472, 7 February 2009)
Gerd Marstedt, 16.2.09
Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) oder "Heimkehrertrauma": Liegt die "Hardthöhe" im Tal der Ahnungslosen?
 Es bedurfte erst des am 2. Februar 2009 in der ARD ausgestrahlten Fernsehfilms "Willkommen zu Hause" um die ersten realistischen Zahlen der an einer kriegsbedingten PTBS erkrankten in Afghanistan eingesetzten Bundeswehrsoldaten aus den Verantwortlichen des immer noch auf der Bonner Hardthöhe residierenden Bundesverteidigungsministeriums herauszulocken und über ein bereits seit dem Vietnamkrieg in den USA dokumentiertes und diskutiertes Erkrankungsbild bei in kriegerische Auseinandersetzungen verwickelten Soldaten offen zu diskutieren. Die Zahl der PTBS-Fälle bei diesen Bundeswehrsoldaten stieg nach offiziellen Angaben von 55 im Jahr 2006 über 130 in 2007 auf 226 in 2008 (laut Süddeutscher Zeitung vom 3. Februar 2009).
Es bedurfte erst des am 2. Februar 2009 in der ARD ausgestrahlten Fernsehfilms "Willkommen zu Hause" um die ersten realistischen Zahlen der an einer kriegsbedingten PTBS erkrankten in Afghanistan eingesetzten Bundeswehrsoldaten aus den Verantwortlichen des immer noch auf der Bonner Hardthöhe residierenden Bundesverteidigungsministeriums herauszulocken und über ein bereits seit dem Vietnamkrieg in den USA dokumentiertes und diskutiertes Erkrankungsbild bei in kriegerische Auseinandersetzungen verwickelten Soldaten offen zu diskutieren. Die Zahl der PTBS-Fälle bei diesen Bundeswehrsoldaten stieg nach offiziellen Angaben von 55 im Jahr 2006 über 130 in 2007 auf 226 in 2008 (laut Süddeutscher Zeitung vom 3. Februar 2009).
Offensichtlich saßen die ministerialen Strategen lange ihrer eigenen Propaganda vom "friedlichen Einsatz" auf, bei dem die Soldaten eigentlich nur Entwicklungshelfer in Uniform sind und "Deutschland am Hindukusch" verteidigen. "Kriegsbedingte" oder wie man dies seit dem Balkankrieg nennt kollaterale Schäden bei Bundeswehrangehörigen - unmöglich!!
Wer nicht warten will bis das vom Bundesverteidigungsministerium eigens dafür angekündigte "Kompetenz- und Forschungszentrum" der Bundeswehr die Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten auch für die im Bundeswehr-Kriegseinsatz befindlichen jungen Deutschen zusammengetragen hat, sollte sich lieber gleich oder parallel in der umfänglichen und bemerkenswert realistischen us-amerikanischen Fachliteratur umsehen.
Diese kann auf die Erfahrungen mit mehreren massiven militärischen Interventionen der USA in Vietnam, am Golf, im Irak und eben auch in Afghanistan zurückgreifen in denen Hunderttausende wenn nicht gar Millionen von US-Amerikanern über Jahre und Jahrzehnte in brutale und assymmetrische Kriege verwickelt waren und körperlich wie seelisch litten.
Das eigens für die gesundheitlichen, wirtschaftlichen und sozialen Belange von Ex-Soldaten in den USA eingerichtete staatliche Department of Veterans Affairs (VA) gehört zu den Hauptauftraggebern mehrerer großer Studien und Reports über die physischen und psychischen Folgen der Teilnahme an diesen Kriegen. In einer mehrbändigen Serie beschäftigt sich das "Committee on Gulf War and Health: Physiologic, Psychologic, and Psychosocial Effects of Deployment-Related Stress" im 2008 erschienenen Band 6 unter der Überschrift "Gulf War and Health: Physiologic, Psychologic, and Psychosocial Effects of Deployment-Related Stress" auf 360 Seiten vor allem mit der seit 1980 in das "Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-III)" aufgenommenen Erkrankung des "posttraumatic stress disorder (PTSD)".
Akribisch und sehr differenziert und zurückhaltend listet das Komitee, dem auch das US-"Institute of Medicine (IOM)" angehört, die wissenschaftliche Evidenz für eine Assoziation zwischen dem Aufenthalt in einer kriegerischen Zone und den PTSD-Symptomen auf. So heißt es beispielsweise im "exekutive summary" des Buches:
• "Evidence from available studies is sufficient to conclude that there is a causal relationship between deployment to a war zone and a specific health effect in humans."
• "Evidence from available studies is sufficient to conclude that there is a positive association. That is, a consistent positive association has been observed between deployment to a war zone and a specific health effect in human studies in which chance and bias, including confounding, could be ruled out with reasonable confidence."
• "Evidence from available studies is suggestive of an association between deployment to a war zone and a specific health effect, but the body of evidence is limited by the inability to rule out chance and bias, including confounding, with confidence. For example, at least one high-quality study reports a positive association that is sufficiently free of bias, including adequate control for confounding, and other corroborating studies provide support for the association (corroborating studies might not be sufficiently free of bias, including confounding). Alternatively, several studies of lower quality show consistent positive associations, and the results are probably not due to bias, including confounding."
Der gesamte Report kann, wie viele anderen Publikationen der "National Academies press" auch kostenlos online gelesen werden. Wem dies zu zu augenbelastend ist, kann außerdem ein 29 Seiten umfassendes Summary samt Inhaltsangabe kostenlos als PDF-Datei herunterladen.
Neben dem evidenten Zusammenhang von kriegerischen Einsätzen und PTBS oder PTSD haben sich die amerikanischen Experten auch schon über andere Zusammenhänge Gedanken gemacht. Im Band 7 der Reihe "Gulf War and Health" geht es um "Long-Term Consequences of Traumatic Brain Injury" und seinen langfristigen gesundheitlichen Auswirkungen.
Auch hier ist der Zugang zur Online-Lektüre des gesamten, 2008 erschienenen Buches und weiteren inhaltlichen Kurzfassungen kostenlos.
Bei allen gute Ideen zur besseren Vorbereitung, gezielten Untersuchung und spezifischen Behandlung von psychisch traumatisierten Soldaten vor künftigen oder nach vergangenen kriegerischen Einsätzen ist zu hoffen, dass auch primärpräventive Forderungen, derartige Kriegseinsätze künftig am besten zu unterlassen, nicht mehr länger als pazifistisches Gutmenschentum abgetan werden.
Bernard Braun, 3.2.09
Ärzte sind auch nur Menschen: Bei ängstlichen Kopfschmerz-Patienten wird sehr viel mehr kostenträchtige Diagnostik betrieben
 Patienten, die seit Tagen an Kopfschmerzen leiden und beim Arzt einen überaus ängstlichen und besorgten Eindruck machen, erhalten von ihrem Arzt nicht mehr Zuwendung und Mitgefühl und auch die Zeitdauer der Kommunikation mit dem Arzt ist nicht länger als bei anderen Patienten, die ihr Leiden eher sachlich und neutral schildern. In einem Punkt aber zeigten sich in einer jetzt veröffentlichten deutschen Studie deutliche Unterschiede: Bei ängstlichen Patienten wurden sehr viel häufiger teure diagnostische Untersuchungen durchgeführt und auch Überweisungen zu einem Facharzt veranlasst.
Patienten, die seit Tagen an Kopfschmerzen leiden und beim Arzt einen überaus ängstlichen und besorgten Eindruck machen, erhalten von ihrem Arzt nicht mehr Zuwendung und Mitgefühl und auch die Zeitdauer der Kommunikation mit dem Arzt ist nicht länger als bei anderen Patienten, die ihr Leiden eher sachlich und neutral schildern. In einem Punkt aber zeigten sich in einer jetzt veröffentlichten deutschen Studie deutliche Unterschiede: Bei ängstlichen Patienten wurden sehr viel häufiger teure diagnostische Untersuchungen durchgeführt und auch Überweisungen zu einem Facharzt veranlasst.
Bei der vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Studie waren insgesamt 53 männliche Hausärzte im Großraum Düsseldorf beteiligt. Diese Ärzte hatten sich einverstanden erklärt, an einer Studie teilzunehmen, bei der sie irgendwann in den nächsten Wochen ohne vorherige Anmeldung den Besuch eines sogenannten "standardisierten Patienten" bekommen würden. Dabei handelt es sich um Amateure oder auch professionelle Schauspieler, die entweder im Rahmen wissenschaftlicher Studien, teilweise aber auch innerhalb der medizinischen Berufsausbildung, einen Patienten mit ganz bestimmten Krankheitssymptomen mimen, über die sie vorher ausgiebig instruiert wurden.
Die standardisierten Patienten in dieser Studie waren durchweg jüngere Frauen, die über Kopfschmerzen klagten, welche seit 3 Tagen bestehen und bei denen Schmerztabletten nicht wirkten. Andere Begleitsymptome gab es nicht. Die Kopfschmerzen wurden so beschrieben, dass sie entweder durch einen Spannungskopfschmerz erklärbar gewesen wären als auch auf schwerwiegendere Ursachen hinweisen konnten. Das Arzt-Patient-Gespräch wurde durchweg mit folgendem Satz eingeleitet: "Ich komme zu Ihnen, weil ich seit Tagen fast unerträgliche Kopfschmerzen habe. Hier vorne (zeigt auf die vordere rechte Kopfhälfte ) ganz schlimm. So was kenne ich sonst gar nicht. Manchmal ist mir richtig übel vor Schmerzen."
Alle Ärzte wurden nacheinander von zwei verschiedenen standardisierten Patienten besucht, die sich in ihrer medizinischen und sozialen Fallgeschichte überhaupt nicht, aber in der Darstellung ihrer Gefühle deutlich unterschieden. Patiententyp A war ängstlich und besorgt, zeigte Unwohlsein und drückte in Gestik, Mimik und Wortwahl Ängstlichkeit wegen der Ursachen der Beschwerden aus. (z.B. " Könnte es etwas Schlimmes sein? Sind Sie sicher, dass es nicht doch etwas anderes ist?") Typ B hingegen war neutral, sachlich und akzeptierte die Erklärungsbemühungen und Vorschläge des Arztes und stellte sie nicht in Frage.
Anhand von Audio-Mitschnitten der Arzt-Patient-Gespräche und später durchgeführten Interviews mit den Ärzten wurde dann überprüft, wovon das diagnostische und therapeutische Vorgehen der Ärzte am meisten beeinflusst war. Denn in dieser Hinsicht zeigten sich massive Unterschiede: Bei der Anamneseerhebung erfragten die Hausärzte unter anderem Schwere, Lokalisation und Dauer der Schmerzen, Begleiterscheinungen, Krankheits-Vorgeschichte, Familie, psychosoziale Aspekte, Medikamentengebrauch. Dabei wurde eine Spannweite von 2 bis 14 dieser Kriterien erfragt. Weiterhin nahmen sie teilweise körperliche Untersuchungen vor, die je nach Patient aus 1 - 12 Einzeluntersuchungen bestanden, es gab keine körperliche Einzeluntersuchung die in jeder Konsultation vorgenommen wurde. Die Gespräche dauerten zwischen 1,5 und 26 Minuten, im Mittel knapp 10 Minuten. Es gab also eine sehr breite Variation zwischen den Ärzten hinsichtlich des Umfangs der Anamneseerhebung, der Anzahl durchgeführter Einzeluntersuchungen und der jeweiligen zeitlichen Dauer.
Die Wissenschaftler hatten erwartet, dass bei ängstlichen Patienten a) die Zeitdauer der Konsultation länger ist (wegen längerer oder detaillierterer Informationen und Erklärungen) und dass b) die Zahl körperlicher Untersuchungen größer ausfallen würde, um Patienten zu beruhigen und ihr Vertrauen zu gewinnen. Tatsächlich zeigte sich jedoch: Weder bei der Zeitdauer noch bei der Zahl der Einzeluntersuchungen fanden sich signifikante Unterschiede zwischen den Patiententypen. Ein Unterschied fand sich jedoch: "Bei den ängstlich-besorgten Patientinnen kommt es in 39 %, bei den neutral-akzeptierenden in 7 % zu Schritten zu einer kostenintensiven Diagnostik." Hierunter fallen unter anderem Überweisungen zu einem Spezialisten (Neurologe oder Radiologe) oder sogar in eine Klinik.
Die Wissenschaftler fassen ihre Befunde so zusammen: "... weder die Anzahl noch die Verteilung der Untersuchungshandlungen differierten in den beiden Gruppen. Statt solcher die emotionale Färbung der Arzt-Patient- Beziehung reflektierenden, angemessenen Vorgehensweisen wurden bei den ängstlich gespielten Patienten mehr kostenträchtige und eingreifende weitere Untersuchungen und Überweisungen veranlasst. Angesichts der identischen medizinischen Fälle lässt sich diese Differenz nicht durch eine medizinische Notwendigkeit erklären."
Ein kostenloses Abstract der Studie ist hier nachzulesen: S. Wilm , S. Brockmann, C. Spannaus-Sakic, A. Altiner, B. Hemming, H.-H. Abholz: Machen Hausärzte Unterschiede, wenn sie mit Kopfschmerzpatienten umgehen? Eine Querschnittsstudie mit ängstlich oder neutral gespielten standardisierten Patienten (Z Allg Med 2008; 84: 273-279; DOI: 10.1055/s-2008-1081468)
Gerd Marstedt, 26.1.09
Dreh- und Angelpunkt von "chronic care management"-Programmen: Multidisziplinäres Team und persönliche Kommunikation
 Angesichts des hohen und wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch wachsenden Anteils chronischer Erkrankungen bzw. Erkrankter am gesamten Morbiditäts- und Versorgungsgeschehen gibt es weltweit Konzepte und Programme, die Qualität, Wirksamkeit und Kosten der Versorgung dieser Patientengruppe durch spezielle "chronic care management programs" oder auch spezielle Disease Managementprogramme zu verbessern.
Angesichts des hohen und wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch wachsenden Anteils chronischer Erkrankungen bzw. Erkrankter am gesamten Morbiditäts- und Versorgungsgeschehen gibt es weltweit Konzepte und Programme, die Qualität, Wirksamkeit und Kosten der Versorgung dieser Patientengruppe durch spezielle "chronic care management programs" oder auch spezielle Disease Managementprogramme zu verbessern.
Die zentrale Frage nach dem Nutzen dieser Programme insgesamt und möglicherweise auch noch gravierende Nutzenunterschiede zwischen unterschiedlich aufgebauten Programmen ist aber bisher noch nicht ausreichend untersucht und beantwortet worden.
Einen wichtigen Beitrag, diesen Zustand zu beenden, liefert eine Studie, die die Daten von zehn randomisierten kontrollierten Studien über die Wirksamkeit und den Nutzen von Versorgungsmanagementprogrammen für Patienten mit Herzinsuffizienz poolte und durch eine Gruppe von Spezialisten für die Behandlung von Herzinsuffizienz nach sieben Kriterien reanalysieren ließ. Dabei kam die von der "American Heart Association's (AHA's) Writing Group" entwickelte "Taxonomy of Disease Management" zum Einsatz. Die Studien wurden zwischen 1990 und 2004 mit insgesamt 2.028 Fällen in den USA (6 Studien), Australien (2), den Niederlanden (1) und Großbritannien (1) durchgeführt. 961 der TeilnehmerInnen in diesen Studien erhielten spezielle Chronikerversorgungen und 1.067 erhielten eine Routineversorgung. Die Maßstäbe oder Indikatoren für den Nutzen eines Programms war die Häufigkeit der raschen Wiedereinweisung mit derselben Erkrankung in ein Krankenhaus und die Anzahl der Wiedereinweisungstage.
Die in den Studien unterscheidbaren Versorgungskonzepte waren zum einen eine Art Routineversorgung durch einen einzigen Herzexperten bzw. Ansprechpartner (in den meisten Studien war dies eine registrierte Krankenschwester (nurse) mit klinischer Sachkunde in Kardiologie und Herzinsuffizienz) und Beratung per Telefon, diese Routineversorgung mit persönlicher Kommunikation zwischen Patient und einer Fachkrankenschwester und schließlich die Programm-Versorgung durch ein multidisziplinäres Team und standardmäßig persönliche Kommunikationsmöglichkeiten. Die letzte Versorgungsvariante entspricht dem Kerngehalt aller Chronic-care-management-Programme.
Die Relevanz der Untersuchungsergebnisse ergibt sich allein schon aus dem Faktum, dass Herzinsuffizienz weltweit zu den führenden Ursachen von Klinikaufenthalten älterer Menschen gehört und in den USA 10 % aller Krankenhausausgaben der staatlichen Versicherung Medicare auf die Versorgung der an dieser Erkrankung leidenden Personen entfielen, was einem Anteil an den Gesamtausgaben von Medicare von 5 % entspricht.
Die durch logistische Regressionsanalysen gewonnenen Ergebnisse sahen so aus:
• Die Patienten in der Routineversorgung unterschieden sich von den Patienten in der "chronic care"-Versorgung hinsichtlich ihrer soziodemografischen und klinischen Charakteristika kaum.
• Weniger Programmpatienten (42 %) wurden innerhalb der follow up-Periode nach einem Krankenhausaufenthalt wieder in ein Krankenhaus eingewiesen als Routineversorgungspatienten (49 %).
• Programmpatienten hatten 25 % weniger Krankenhauswiedereinweisungen und 30 % weniger Krankenhaustage wegen einer Wiedereinweisung als Patienten mit einer Routineversorgung.
• Wenn Chronic-Care-Management-Programme als strukturierte Versorgung durch einen einzelnen Experten und Kommunikation per Telefon erfolgte, unterschieden sich die Ergebnisse nicht von denen bei Patienten in der Routineversorgung.
• Wenn die Versorgung zwar durch einen einzelnen Experten aber zumindest auf der Basis persönlicher Kommunikation erfolgte, wurde die Wiedereinweisungshäufigkeit im Vergleich mit der Routineversorgungsgruppe um 2 % pro Monat und die Anzahl der dadurch veranlassten Krankenhaustage um über 4 % pro Monat reduziert.
• Patienten, die in Chronikerprogrammen mit einem multidisziplinären Team und persönlicher Kommunikation waren, hatten noch einen etwas größeren Nutzen als die Routineversorgten, nämlich eine statistisch hoch signifikante Reduktion der Wiedereinweisungshäufigkeit um 2,9 % pro Monat und der damit ausgelösten Tagezahl um 6,4 % pro Monat.
• Rechnet man diese Effekte in die Anzahl von Fällen stationärer Behandlung um, sind in den Ländern mit komplexen Chronic-Care-Programmen zwischen 14.700 und 29.140 pro Jahr weniger Krankenhaushalte notwendig.
Selbst wenn sich einige Strukturen und Gewohnheiten schon zwischen den Studienländern (z.B. zwischen Großbritannien und den USA) und erst recht von den beispielsweise in Deutschland existierenden Rahmenbedingungen unterscheiden, geben sie mit Sicherheit die relativ einfache Richtung vor, in der auch in Deutschland spezielle Versorgungsprogramme für chronisch Kranke verstärkt vorgehen sollten.
Ein sehr knappes Abstract des in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift "Health Affairs" (Januar/Februar 2009 28(1):179-89) erschienenen elfseitigen Aufsatzes "What Works in Chronic Care Management: The Case of Heart Failure" von J. Sochalski, T. Jaarsma, H. M. Krumholz et al. gibt es kostenlos.
Bernard Braun, 9.1.09
Reizdarmsyndrom: Flohsamen, Korkholzbaumblätter oder gar Pfefferminzöl als wirksame Mittel?!
 Die Prävalenz von Reizdarmsyndromen liegt in Bevölkerungsstudien zwischen 5 und 20 % und ist als oft chronifizierte und anfallweise wiederkehrende Störung des Verdauungssystems nicht nur unangenehm, sondern auch schmerzhaft und schwer zu behandeln.
Die Prävalenz von Reizdarmsyndromen liegt in Bevölkerungsstudien zwischen 5 und 20 % und ist als oft chronifizierte und anfallweise wiederkehrende Störung des Verdauungssystems nicht nur unangenehm, sondern auch schmerzhaft und schwer zu behandeln.
Zur Behandlung des Reizdarmsyndroms empfehlen die hier meist therapeutisch tätigen Allgemeinmediziner initial die vermehrte Aufnahme von Ballaststoffen, von denen Wirkungen auf die Verdauungszeiten erwartet werden. Sollten die Beschwerden anhalten, gab es bis vor kurzem eine Reihe von meist teuren Arzneimittel, die aber aus Sicherheitsgründen vom Markt zurückgezogen wurden. Daher gab und gibt es einen starken Druck, andere sichere und wirksame Behandlungsalternativen zu finden.
Diese wurden zum Teil bereits seit längerem in drei unterschiedlichen Gruppen von Stoffen gesehen und auch therapeutisch eingesetzt. Wie so oft geschah dies aber ohne hinreichende wissenschaftliche Evidenz über ihre Wirksamkeit bzw. beruhten entsprechende Annahmen und Vermutungen auf älteren, methodisch schwachen Untersuchungen.
Ein systematischer Review bzw. eine Metananalyse von randomisierten kontrollierten Studien, in denen die Wirksamkeit einer bestimmten Pflanzenfaser (12 RCTs), krampfstillender Medikamente (22 RCTs) und von Pfefferminzöl (4 RCTs) gegen jeweilige Placebos oder zum Teil auch gegen keine Behandlung untersucht wurde, liefert jetzt eine Reihe überraschender Ergebnisse.
Auch wenn Pfefferminzöl bisher weder in den Leitlinien des "National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)" noch der "British Society of Gastroenterology" als wirksames Mittel gegen Reizdarmsymptome auftaucht, zeigen die gerade im "British Medical Journal (BMJ)" veröffentlichten Ergebnisse einer randomisierten kontrollierten Studie, dass dieses Öl genauso wirksam ist wie Mittel, die bestimmte Pflanzenfasern (hier besonders Ispaghula oder Flohsamen, der die Samenhülle der indischen Ispaghula-Pflanze enthält) oder krampfstillende Medikamente (hier in erster Linie der Wirkstoff Hyoscine, der u.a. aus den Blättern von Korkholzbäumen [Duboisia] gewonnen wird).
Alle diese Stoffe senken das relative Risiko eines anhaltenden Reizdarmsyndroms beträchtlich: Es betrug bei allen Flohsamenpräparaten zusammen 0.87 mit einem 95% Konfidenzintervall zwischen 0.76 und 1.00 (bei Ispaghula 0,78), bei allen krampfstillenden Medikamenten 0.68 (0.57 to 0.81) (das Risiko schwankte je nach Mittel zwischen 0,55 und 0,68) und bei Pfefferminzöl 0.43 (0.32 to 0.59).
Für die Beurteilung der Wirksamkeit ist aber auch die so genannte "number needed to treat", d.h. die Anzahl von Menschen, die man behandeln muss, um einem Menschen helfen zu können, wichtig. Sie ist bei allen hier untersuchten Mitteln relativ niedrig, schwankt aber zwischen 11 bei Flohsamenpräparaten, 5 bei krampfstillenden Arzneimitteln und 2,5 bei Pfefferminzöl.
Egal was die weitere Pharmaforschung noch an neuen und dann auch möglicherweise sichereren Arzneimitteln bescheren wird, sollten, so die AutorInnen der aktuellen Studie, die drei traditionellen und meist verschreibungsfrei erhältlichen Mittel als gesichert wirksam und im Fall des Pfefferminzöls überhaupt in die nationalen Leitlinien zum Reizdarmsyndrom aufgenommen werden.
Auch wenn möglicherweise konkurrierende Interessen in dieser Studie nach Wahrnehmung des Autors dieses Textes keine Rolle gespielt haben, zeigt die Lektüre der Angaben zu den "Competing interests" der Auoren dieses Aufsatzes die weltweit engen wirtschaftlichen Verbindungen zwischen Pharmaherstellern und einigen -forscherinnen in aller Ausführlichkeit: "NJT (Autoreninitialen - siehe unten) has received consultancy fees from Procter and Gamble, Lexicon Genetics, Astellas Pharma US, Pharma Frontiers, Callisto Pharmaceuticals, AstraZeneca, Addex Pharma, Ferring Pharma, Salix, M GI Pharma, McNeil Consumer,Microbia, Dynogen, Conexus, Novartis, and Metabolic Pharmaceuticals, and has received research support from Novartis, Takeda, GlaxoSmithKline, Dynogen, and Tioga. EMMQ has received consultant's and speaker's bureau fees from Nycomed, Boehringer Ingelheim, Procter and Gamble, Reckitt Benckiser, and Prometheus, and holds equity in Alimentary Health. PM holds a chair at McMaster University partly funded by an unrestricted donation by AstraZeneca, and has received consultant's and speaker's bureau fees from AstraZeneca, AxCan Pharma, Nycomed, and Johnson and Johnson."
Dass die Therapie des Reizdarmsyndroms für die Pharmaindustrie zumindest nicht uninteressant war (!) zeigen spezielle Aufklärungskampagnen, die vor einigen Jahren insbesondere "down under" Furore machten: Wie das pharmakritische "Arznei-Telegramm" bereits 2002 (a-t 7/2002; 33: 71-2) berichtete, gehörte zu Beginn dieses Jahrzehnt das Reizdarmsyndrom zu einem der Anwendungsfelder für das so genannte "disease mongering" (Handeln mit Krankheiten). Konkret wurde damals ein dreijähriges Schulungsprogramm in Australien bekannt, das dieses Syndrom als eine anerkannte Erkrankung etablieren sollte und damit die Markteinführung von wirkidentischen Medikamenten der Firmen GlaxoSmithKline und Novartis systematisch und durch die Beeinflussung von Ärzten, Selbsthilfeorganisationen (insbesondere in den USA) und Patienten fördern sollte. Das Medikament Alosetron wurde aber zur Behandlung von Reizdarmsyndromen bereits 2000 in den USA wegen schwerer Nebenwirkungen vom Markt genommen.
Der komplette 12 Seiten lange Aufsatz "Effect of fibre, antispasmodics, and peppermint oil in the treatment of irritable bowel syndrome: systematic review and meta-analysis." von Alexander C Ford, Nicholas J Talley (NJT), Brennan M R Spiegel, Amy E Foxx-Orenstein, Lawrence Schiller, Eamonn M M Quigley (EMMQ) und Paul Moayyedi (PM) ist im BMJ am 18. November 2008 erschienen und frei erhältlich.
Bernard Braun, 21.12.08
Abnehmen durch Einwerfen!? Gewichtsreduktion mit Medikamenten zwischen Euphorie, schweren Nebenwirkungen und Verbot.
 Während einer der seit Jahren wegen erheblicher Nebenwirkungen kritisierten Appetithemmer, nämlich der anfänglich euphorisch zum bequemen Ersatz für Verhaltensänderungen gegen schweres Übergewicht erkorene Cannabis-Antagonist Rimonabant (Acomplia®) im Oktober 2008 wegen starker psychiatrischer Nebenwirkungen vom Markt genommen werden musste und auch der Serotonin- und Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer Sibutramin (Reductil®) aufgrund unerwünschter Wirkungen (wie Blutdruckanstieg, kardiovaskuläre Komplikationen) von der Markteinführung in den USA an schon immer umstritten war - vgl. dazu eine Zusammenfassung im "Arznei-Telegramm" im September 2003, steht der nächste Wunderstoff - ebenfalls ein Hemmer der Wiederaufnahme von bestimmten körpereigenen Boten- und Regulierungsmitteln - vor der Tür.
Während einer der seit Jahren wegen erheblicher Nebenwirkungen kritisierten Appetithemmer, nämlich der anfänglich euphorisch zum bequemen Ersatz für Verhaltensänderungen gegen schweres Übergewicht erkorene Cannabis-Antagonist Rimonabant (Acomplia®) im Oktober 2008 wegen starker psychiatrischer Nebenwirkungen vom Markt genommen werden musste und auch der Serotonin- und Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer Sibutramin (Reductil®) aufgrund unerwünschter Wirkungen (wie Blutdruckanstieg, kardiovaskuläre Komplikationen) von der Markteinführung in den USA an schon immer umstritten war - vgl. dazu eine Zusammenfassung im "Arznei-Telegramm" im September 2003, steht der nächste Wunderstoff - ebenfalls ein Hemmer der Wiederaufnahme von bestimmten körpereigenen Boten- und Regulierungsmitteln - vor der Tür.
Noch nicht als Arzneimittel zugelassen, d.h. noch vor der gesetzlich vorgeschriebenen Phase III der klinischen Versuche vor einer Zulassungsentscheidung, beflügeln die ersten seiner im wissenschaftlich anerkannten britischen Medizinjournal "The Lancet" veröffentlichten Wirksamkeitsdaten aus Dänemark die diversen Begehrlichkeiten.
Nach den Ergebnissen des Studienaufsatzes "Effect of tesofensine on bodyweight loss, body composition, and quality of life in obese patients: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial" von Arne Astrup, Sten Madsbad, Leif Breum, Thomas J Jensen, Jens Peter Kroustrupund Thomas Meinert Larsen (The Lancet, Volume 372, Issue 9653: 1906 - 1913, 29. November 2008) soll der Wirkstoff Tesofensin bei Übergewichtigen mit einem Body Mass Index (BMI) zwischen 30 und 40 einen doppelt so hohen Gewichtsverlust verursachen wie die bisherigen Appetitzügler.
In einer randomisierten, doppelt-blinden und placebo-kontrollierten Phase-II-Studie in fünf dänischen Adipositas-Management-Zentren wurde der Wirkstoff bei zu Beginn 203 und am Ende noch 161 teilnehmenden schwer übergewichtigen Personen 24 Wochen lang gegen Placebos getestet. Außerdem variierte noch die Menge des Wirkstoffs. Alle TeilnehmerInnen erhielten schließlich nach einer zweiwöchigen Vorbereitungsphase eine kalorienreduzierte Diät. Nach den 24 Wochen hatten die Patienten, die Tesofensin erhielten, nicht nur doppelt so viel Gewicht abgebaut wie die Einnehmer von Sibutramin (Reductil) und Rimonabant (Acomplia). Je mehr vom neuen Wirkstoff eingenommen wurde desto höher waren außerdem die Gewichtsverluste: ¼ mg des Wirkstoffs führte zu einem Verlust von 6,7 kg und 1 mg zu einem von 12,8 kg Körpergewicht.
In der Studiengruppe, die lediglich die kalorienreduzierte Diät und ein Placebo erhielt, verringerte sich das Gewicht nach 24 Wochen zwar auch, aber "nur" um 2 %.
Abgesehen davon, dass vor einer möglichen Zulassung noch Phase-III-Studien durchgeführt werden müssen, gibt es aber auch in den bisherigen Ergebnissen eine Reihe frühzeitiger Hinweise auf Schattenseiten auch dieses Ersatzmittels für unbequemere und individuell aufwändigere Methoden, Fettsüchtigkeit zu reduzieren.
So werden in dem Aufsatz als unerwünschte Nebenwirkungen trockener Mund, Übelkeit, Obstipation, harte Stuhlgänge, Durchfall und Schlaflosigkeit berichtet. In einer Kombination erhöhte sich auch die Anzahl der Herzschläge. Über Langzeit-Nebenwirkungen und deren Folgeeffekte lassen sich nach der kurzen Untersuchungszeit keine belastbaren Angaben gewinnen. Unklar bleibt auch, warum 21 % der ursprünglichen TeilnehmerInnen die Studie bereits innerhalb des Zeitraums von 24 Wochen verlassen haben. Wichtig wird außerdem noch sein, ob sich der vergleichsweise hohe Gewichtsverlust auch über mehr als 6 Monate hält, ein Jo-Jo-Effekt einen Teil der Wunderwirkungen zurückholt oder gar weitere Nebenwirkungen auftreten.
Ob gegen alle diese euphoriebremsenden Hinweise schließlich doch die Einstellung gewinnt, man müsse gegen die "Volksseuche Übergewicht" auch medikamentös vorgehen, kann jedermann durch die aufmerksame Lektüre von Fachjournalen aber vor allem auch der publikumswirksamen und werbeeinnahmenabhängigen Gesundheits-Yellow-Press-Blätter selbst ab sofort erkunden.
Von dem Aufsatz "Effect of tesofensine on bodyweight loss, body composition, and quality of life in obese patients: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial" gibt es kostenlos lediglich ein Abstract.
Bernard Braun, 15.12.08
EKG und Belastungs-EKG bei Angina pectoris: Grenzen technischer Diagnostik und Nutzen von Anamnese und körperlicher Untersuchung.
 Das Elektrokardiogramm (EKG) oder gar das Belastungs-EKG gehören zu den Standardinstrumenten in der kardiologischen Diagnostik. Die Messungen der elektrischen Aktivitäten am Herzen, ob im Normalzustand oder unter definierten Belastungen, werden für unentbehrlich zur Klärung der Ursachen von unklaren Schmerzen in der Herzgegend oder gar zur Bestimmung des Risikos oder der Prognose einer symptomatisch voll entfalteten Angina pectoris gehalten.
Das Elektrokardiogramm (EKG) oder gar das Belastungs-EKG gehören zu den Standardinstrumenten in der kardiologischen Diagnostik. Die Messungen der elektrischen Aktivitäten am Herzen, ob im Normalzustand oder unter definierten Belastungen, werden für unentbehrlich zur Klärung der Ursachen von unklaren Schmerzen in der Herzgegend oder gar zur Bestimmung des Risikos oder der Prognose einer symptomatisch voll entfalteten Angina pectoris gehalten.
Seit einigen Jahren gehört das EKG auch zum Diagnostik-Repertoire der so genannten "Gesundheitsuntersuchung" nach § 25 SGB V.
Mindestens bei Personen, die zum ersten Mal wegen einer Angina pectoris untersucht wurden und vorher an keiner Herz-/Kreislauferkrankung erkrankt waren, erwies sich jetzt aber das EKG und auch das Belastungs-EKG in einer britischen Kohortenstudie mit 8.176 Patienten mit akuten Brustbeschwerdenals lediglich von begrenztem prognostischen Wert. In der Studie erfolgte neben der Anamnese (Alter, Geschlecht, ethnische Herkunft, Dauer der Symptome, Schmerzmuster, Raucherstatus, Hypertonie und Medikamente) bei allen Patienten ein EKG. Bei 60 % der Patienten folgte meist in kurzem zeitlichen Abstand ein Belastungs-EKG.
Die im "British Medical Journal (BMJ)" im November 2008 veröffentlichten Ergebnisse zeigen mehrerlei:
• Generell gingen nur bei jedem zweiten Patienten mit einer späteren koronaren Erkrankung EKG-Veränderungen voraus. Dies trägt zu einem enorm hohen Anteil von falsch-negativen Befunden bei. Dies bedeutet: Personen, die tatsächlich ein erhöhtes Risiko für eine koronare Erkrankung in sich tragen, wird auf der alleinigen Basis von EKGs gesagt, sie seien gesund.
• Umgekehrt zeigte die gründliche Nachbeobachtung der StudienteilnehmerInnen, dass 47 % aller koronaren Fälle bei PatientInnen auftraten, die bei den EKG-Untersuchungen keinerlei Befunde hatten.
• Für die Prognose der Erkrankung und damit für die Entscheidung wie die Personen weiterbehandelt werden, spielte weder das einfache noch das Belastungs-EKG eine wichtige und entscheidende Rolle bzw. erbrachte keinen Zugewinn gegenüber einer gründlichen Anamnese und körperlichen Untersuchung. Dies wird dann problematisch und zeitigt möglicherweise unerwünschte Folgen für die Patienten, wenn die Anamnese und körperliche Untersuchung zugunsten des EKG in die zweite Reihe geschoben oder gar durch die technische Diagnostik ersetzt wird.
Wer mehr über diese Studie erfahren will, kann hierzu den kompletten Text des Aufsatzes "Incremental prognostic value of the exercise electrocardiogram in the initial assessment of patients with suspected angina: cohort study" (BMJ 2008; 337: a 2240) von Neha Sekhri, Gene S Feder, Cornelia Junghans, Sandra Eldridge, Athavan Umaipalan, Rashmi Madhu, Harry Hemingway und Adam D Timmis kostenlos heranziehen.
Bernard Braun, 11.12.08
Arthroskopie des Knies: Es wird zuviel operiert, die therapeutische Wirkung ist nicht besser als bei Physiotherapie allein
 Nach einer englischen Studie aus dem Jahre 2004 leidet bei den 50jährigen und Älteren fast jeder zweite (48%) einmal im Jahr oder öfter unter Kniebeschwerden. Kein Wunder also, dass der minimal-invasive medizinische Eingriff der Kniegelenks-Arthroskopie, bei der das Gelenk mit einer speziellen Flüssigkeit gespült und Entzündungen entfernt werden, ein überaus häufiger Eingriff ist. "Jährlich werden in Deutschland mehr als 250.000 arthroskopische Operationen ambulant durchgeführt - Tendenz steigend", heißt es in einem Referat auf der Jahrestagung 2003 der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie. Und weiter dann "Die Indikationen zur ambulanten Arthroskopie - insbesondere Kniegelenk / Ellenbogengelenk / Sprunggelenk / Schultergelenk sehen wir sehr weit gesteckt."
Nach einer englischen Studie aus dem Jahre 2004 leidet bei den 50jährigen und Älteren fast jeder zweite (48%) einmal im Jahr oder öfter unter Kniebeschwerden. Kein Wunder also, dass der minimal-invasive medizinische Eingriff der Kniegelenks-Arthroskopie, bei der das Gelenk mit einer speziellen Flüssigkeit gespült und Entzündungen entfernt werden, ein überaus häufiger Eingriff ist. "Jährlich werden in Deutschland mehr als 250.000 arthroskopische Operationen ambulant durchgeführt - Tendenz steigend", heißt es in einem Referat auf der Jahrestagung 2003 der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie. Und weiter dann "Die Indikationen zur ambulanten Arthroskopie - insbesondere Kniegelenk / Ellenbogengelenk / Sprunggelenk / Schultergelenk sehen wir sehr weit gesteckt."
Nach einer neuen, jetzt im renommierten "New England Journal of Medicine" veröffentlichten Studie könnte die Zahl der Arthroskopien zukünftig allerdings sinken: Zeigt die Studie doch, dass bei Patienten mit einer Arthrose (chronischer, mit Schmerzen einhergehender und fortschreitenden Gelenkverschleiß) dieser Eingriff, auch Schlüsselloch-Chirurgie genannt, nicht besser hilft als Krankengymnastik.
Die Wissenschaftler wiesen 172 Patienten mit Arthrose im Kniegelenk nach dem Zufallsprinzip zwei Gruppen zu, die eine Hälfte erhielt Schmerz-Medikamente und eine gezielte Physiotherapie, die übrigen erhielten ebenfalls Schmerzmittel und Physiotherapie, darüber hinaus wurde bei ihnen jedoch auch noch eine Arthroskopie durchgeführt. Nach einem Zeitraum von zwei Jahren wurden die Patienten dann untersucht und sie gaben zu Auskunft zu empfundenen Schmerzen, Bewegungseinschränkungen und zur wahrgenommenen Lebensqualität. Eingesetzt wurden dazu zwei Fragebögen, der "Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC)" und eine Kurzform des SF-36 ("Short Form (36) Health Survey"), mit dem Funktionsbeeinträchtigungen sowie physische Beschwerden und psychische Störungen erfasst werden.
Es zeigte sich dann, dass es zwischen den beiden Gruppen keine Unterschiede gab. Beim WOMAC lagen die Werte bei 874 bzw. 897, was eine statistisch nicht signifikante Differenz bedeutet, beim SF-36 war es mit 37,0 und 37,2 Punkten ähnlich. Das kanadische Ärzteteam, das die Studie durchführte, fordert in der Diskussion der Ergebnisse dann, die Voraussetzungen für eine Arthroskopie sehr viel strenger als bislang zu überprüfen.
Ein Abstract des Artikels ist hier: Alexandra Kirkley u.a.: A Randomized Trial of Arthroscopic Surgery for Osteoarthritis of the Knee (New England Journal of Medicine, Vol 359:1097-1107, September 11, 2008)
Auf der Website der Vereinigung amerikanischer Physiotherapeuten (APTA) werden die Ergebnisse der Studie naturgemäß mit Stolz kommentiert. Und es werden einige frühere Studien aus dem Jahr 2000 und vom Januar 2008 zitiert, die bereits zu ähnlichen Befunden gekommen waren: New Research Shows Physical Therapy as Effective as Arthroscopic Knee Surgery
Gerd Marstedt, 14.9.2008
Unter-, Über- und/oder Fehlversorgung? Asthmabehandlung bei Kindern: individuelle Flexibilität und weniger Standardisierung!
 Ob eine bestimmte Behandlung oder eine Behandlungsweise "richtig" und "nützlich" ist, ist oft nicht so eindeutig und patentrezepthaft zu sagen, wie sich dies manche Ärzte und Patienten wünschen.
Ob eine bestimmte Behandlung oder eine Behandlungsweise "richtig" und "nützlich" ist, ist oft nicht so eindeutig und patentrezepthaft zu sagen, wie sich dies manche Ärzte und Patienten wünschen.
Dies zeigen auch die gerade veröffentlichten Ergebnisse einer randomisierten, kontrollierten und doppelblinden Studie über die Behandlung von mildem aber hartnäckigen Asthma bei finnischen Kindern im Alter von 5 bis 10 Jahren.
Dabei ging es vor allem um den Vergleich der Wirkungen einer täglichen Inhalation des Kortikosteroids Budesonide und der Anwendung dieses Wirkstoffs bei Bedarf. Die antiasthmatische Wirkung der inhalierten Kortikosteroide war in Langzeitstudien bereits zuvor verlässlich nachgewiesen worden. Allerdings sind dabei auch unerwünschte Wirkungen erkannt worden, wie etwa die gerade bei Kindern wichtige Reduktion der Größenwachstumsgeschwindigkeit. Hinzu kommt, dass die Daueranwendung derartiger Therapien bei Kleinkindern eine Art Medikalisierungseffekt hat und außerdem spezielle Complianceprobleme auftreten können. Letztere treten natürlich bei Kindern auch bei einer Medikation nach Bedarf auf.
Für die vorliegende Studie wurden in der "The Helsinki early intervention childhood asthma study" 176 Kinder im fraglichen Alter per Zufall in drei Interventionsgruppen aufgeteilt: Die Teilnehmer der ersten Gruppe nahmen kontinuierlich und zweimal am Tag einen Monat lang eine 400 mg-Dosis des Medikaments ein, erhielten vom zweiten bis sechsten Monat regelmäßig eine 200 mg-Dosis und schließlich in den Monaten 7 bis 18 nur noch eine 100 mg-Dosis; in der zweiten Gruppe sah die Behandlung für den ersten bis zum sechsten Monat so aus wie in der ersten Gruppe, bestand in den restlichen 12 Studienmonaten aber aus einem Placebo; die Teilnehmer der dritten Gruppe erhielten das Antiallergikum Natriumcromoglicat (DSCG) dreimal täglich über die gesamten 18 Monaten der Studienlaufzeit. Sofern sich Verschlechterungen des Gesundheitszustands ergaben bzw. Asthmaanfälle auftraten, wurden die betreffenden Kinder in der zweiten und dritten Gruppe zusätzlich für zwei Wochen mit zweimal täglich 400 mg Budesonide behandelt.
Zur Wirkungsanalyse wurden die Lungenfunktion, die Anzahl der Verschlechterungen und die Wachstumsgeschwindigkeit der Kinder untersucht.
Die Ergebnisse dieser Messungen sahen folgendermaßen aus:
• Beim Vergleich der Ergebnisse der Anfänge der DSCG-Behandlung mit der mit Kortikosteroiden führte letztere zu einer signifikant verbesserten Lungenfunktion und zu weniger Anfällen. Außerdem war das Größenwachstum etwas aber signifikant geringer.
• Nach 18 Monaten unterschied sich aber die Lungenfunktion aller jungen Patienten in den drei Gruppen nicht mehr.
• Zwischen dem siebten und achtzehnten Monat der unterschiedlichen Behandlungsweisen hatten die kontinuierlich mit dem Kortikosteroid behandelten Teilnehmer der ersten Gruppe signifikant weniger Asthmaanfälle als die Teilnehmer mit anderen Behandlungsmustern. Die Anzahl der asthmafreien Tage und eine Reihe weiterer Indikatoren unterschieden sich aber zwischen der Gruppe mit regelmäßiger und der mit der Inhalation nach Bedarf nicht. Die Verringerung des Größenwachstums normalisierte sich in der Gruppe mit regelmäßiger Einnahme bei geringer werdender Dosis und war in der "Bei-Bedarfs-Gruppe" praktisch nie ein Problem.
Die finnischen ForscherInnen sehen zunächst den positiven Einfluss der kontinuierlichen Kortikosteroidbehandlung auf die Anzahl der Asthmaanfälle als gesichert an. Wegen der systemischen und gerade bei Kindern unerwünschten systemischen Wirkungen empfehlen sie aber für Kinder, die nach einer anfänglichen kontinuierlichen Behandlung mit Kortikosteroiden ihr Asthma gut unter Kontrolle haben, mit der Dauerinhalation aufzuhören und nur noch bei Bedarf auf den Einsatz dieser Mittel zurück zu greifen. Hier wie sicherlich bei der Behandlung vieler anderer Krankheiten sollte daher stärker als bisher auch auf die "evolution of individual disease" geachtet werden.
Den fünfseitigen Aufsatz "Daily versus as-needed inhaled corticosteroid for mild persistent asthma (The Helsinki early intervention childhood asthma study" von Turpeinen M, Nikander K, Pelkonen AS, Syvänen P, Sorva R, Raitio H, Malmberg P, Juntunen-Backman K und Haahtela T aus den "Archives of Disease in Childhood (2008;93:654-659) erhält man komplett kostenlos.
Bernard Braun, 7.9.2008
"Bevor ich’s vergesse": Antidemenz-Mittel kann man bei milden Gedächtnisstörungen vergessen; tägliche Spaziergang wirken merklich.
 Während es für die Wirkung der angeblich auch für die Behandlung milder Gedächtnisstörungen besonders geeigneten Antidementiva bisher keinen eindeutigen Wirkungsnachweis gibt, liefern ihn jetzt die im neuesten us-amerikanischen Fachjournal "Journal of the American Medical Association (JAMA) (JAMA 2008; 300: 1027-1037) veröffentlichten Ergebnisse einer randomisierten kontrollierten Studie für tägliche 20-Minuten-Spaziergänge oder ähnliche bewegungsorientierten Betätigungen.
Während es für die Wirkung der angeblich auch für die Behandlung milder Gedächtnisstörungen besonders geeigneten Antidementiva bisher keinen eindeutigen Wirkungsnachweis gibt, liefern ihn jetzt die im neuesten us-amerikanischen Fachjournal "Journal of the American Medical Association (JAMA) (JAMA 2008; 300: 1027-1037) veröffentlichten Ergebnisse einer randomisierten kontrollierten Studie für tägliche 20-Minuten-Spaziergänge oder ähnliche bewegungsorientierten Betätigungen.
Dazu wurden in der im westaustralischen Perth zwischen 2004 und 2007 durchgeführten so genannten "Fitness for the Ageing Brain Study" mittels spezieller Telefoninterviews 311 Personen im Alter von 50 und mehr Jahren identifiziert, die an leichten, auch noch von ihnen selbst bemerkten Gedächtnisstörungen litten, die klinisch noch unterhalb des Niveaus einer beginnenden Demenz lagen. Auf einer Skala von 0 für gesund und 70 für schwer dement lagen die hier genauer untersuchten Personen zu Beginn der Studie bei durchschnittlich 7 Punkten.
In der Studie wurden sie auf zwei Gruppen randomisiert. In einer Gruppe wurden ihnen drei wöchentliche Trainingseinheiten zu jeweils 50 Minuten verordnet. Die meisten entschieden sich für stramme Spaziergänge, aber auch tanzen oder schwimmen war möglich. Am Ende hatten die Teilnehmer der Gruppe im Durchschnitt 142 Minuten pro Woche, d.h. täglich rund 20 Minuten Sport getrieben. In der Vergleichsgruppe wurde kein Sport vereinbart und lediglich gezielt über die Präventionsmöglichkeiten gegen Demenz informiert und ansonsten die normale, d.h. in der Regel medikamentöse Behandlung durchgeführt.
Das Bewegungsprogramm lief über 24 Wochen und am Ende hatte der "(Prä-)Demenzwert" der TeilnehmerInnen 0,26 Punkte abgenommen, während es in der Vergleichsgruppe zu einer Zunahme um 1,04 Punkte gekommen war, insgesamt also eine Differenz der Angehörigen der beiden Gruppen von 1,3 Punkten bestand. Die TeilnehmerInnen der Interventionsgruppe wurden angehalten, weiter in Bewegung zu bleiben und erhielten dazu noch 4 Informationsbriefe.
Nach Beendigung der Interventionen untersuchten die ForscherInnen nach 6, 12 und 18 Monaten die weitere Entwicklung der Angehörigen beider Gruppen. Zunächst näherten sich beide Gruppen langsam wieder an. Ein Jahr nach dem Ende der Trainingsphase war aber noch ein Unterschied von 0,69 Punkten vorhanden. Auch in einzelnen Gedächtnistests und in den "Clinical Dementia Rating Scores" wurden Unterschiede gefunden.
Damit steht nach Ansicht einer der Verantwortlichen der Studie, Nicola Lautenschlager, erstmals eine bescheiden nutzvolle Behandlung der Alzheimervorstufe zur Verfügung.
Der von der Forschergruppe vermutete Wirkmechanismus einer durch Sport oder andere Bewegung verbesserten kardiovaskulären Fitness und damit der Hirndurchblutung, gibt zur Hoffnung Anlass, dass davon auch Menschen ohne erkennbaren Gedächtnisstörungen profitieren könnten.
Eine der Hauptschlussfolgerungen zum Nutzen der Studie lautet daher auch: "An important merit of this trial was to demonstrate the potential benefit of a simple intervention that is almost universally available".
Den 12 Seiten umfassenden Aufsatz "Effect of Physical Activity on Cognitive Function in Older Adults at Risk for Alzheimer Disease: A Randomized Trial" von Nicola T. Lautenschlager; Kay L. Cox; Leon Flicker; et al. kann man als PDF-Dokument kostenlos herunterladen.
Bernard Braun, 4.9.2008
Literatur und Forschungsstand zum Thema Demenz
 Demenzerscheinungen gelten als Störungen im kognitiven und emotionalen Bereich, die, in unterschiedlichen Ausformungen, zu Beeinträchtigungen im Denkvermögen, in der Sprache, in der Motorik und nicht selten auch in der Persönlichkeitsstruktur eines Menschen führen. Da sich das Demenzrisiko mit zunehmendem Alter erhöht, gilt die Krankheit in Zeiten steigender Lebenserwartung und einer wachsenden Zahl an Senioren inzwischen als gesellschaftliches Problem.
Demenzerscheinungen gelten als Störungen im kognitiven und emotionalen Bereich, die, in unterschiedlichen Ausformungen, zu Beeinträchtigungen im Denkvermögen, in der Sprache, in der Motorik und nicht selten auch in der Persönlichkeitsstruktur eines Menschen führen. Da sich das Demenzrisiko mit zunehmendem Alter erhöht, gilt die Krankheit in Zeiten steigender Lebenserwartung und einer wachsenden Zahl an Senioren inzwischen als gesellschaftliches Problem.
Im 2002 erschienenen (aktuellster Bericht ist der 2006 veröffentlichte fünfte Bericht) "Vierten Altenbericht" bzw. dessen Empfehlungsteil heißt es zur Epidemiologie der Demenz: "Bleibt ein Durchbruch in der Prävention und Therapie der Demenzerkrankung aus, so wird entsprechend dem Anstieg der älteren Menschen die Zahl der Demenzkranken bis zum Jahr 2020 auf fast 1,4 Millionen und bis zum Jahr 2050 auf mehr als 2 Millionen ansteigen."
Die Versorgungslage der Demenzkranken wirft auch eine Reihe kritischer Fragen auf: Drei Viertel der Erkrankten werden zu Hause von ihren Angehörigen versorgt, die dadurch oft selbst an die Grenzen der eigenen körperlichen und psychischen Substanz stoßen; so ist häufig das Leben der ganzen Familie enormen Belastungen ausgesetzt. Die reformierte Pflegereform, die am 1. Juli 2008 in Kraft tritt, soll hier Abhilfe schaffen. Erstmals erhalten altersverwirrte Menschen bis zu 200 € monatlich für ihre Betreuung aus der Pflegeversicherung. Mit diesem Geld können die Angehörigen zumindest stundenweise durch zusätzliches Pflegepersonal entlastet werden. Ob dies wirklich die Lösung der komplexen Versorgungsprobleme darstellt bleibt abzuwarten.
Hilfreich bei der gezielten Klärung der Probleme ist sicherlich, das mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung geförderte Deutsche Demenzzentrum, das die einschlägige Kompetenz bündelt.
Das Helmholtz-Zentrum in Bonn als Speerspitze, wird bei der Forschung nach innovativen Präventionsmaßnahmen und Therapiemöglichkeiten eine entscheidende Rolle einnehmen.
Wer sich zumindest mal einen aktuellen Überblick über den Stand der sozialwissenschaftlichen Forschung zur Thematik Demenz machen will, kann dies auf 96 Seiten im Band 3/2008 der "Recherche Spezial-Reihe" von GESIS (Gesellschaft Sozialwissenschaftlicher Infrastruktureinrichtungen e.V.) tun, der von Christian Kolle bearbeitet wurde.
Die oft mit kurzen Abstracts angereicherte Dokumentation ist in die Themenfelder "Versorgung,
stationäre Betreuung, Wohngruppen, Heimbewohner Altenhilfe, Altenpflege", "Pflege durch Angehörige, freiwillige Helfer", "Therapien, kognitives Training, Prävention, Modellprojekte und -vorhaben" und "Krankheitsbilder, Symptomatik, Ursachenforschung, Leben mit Demenz" gegliedert.
Die Literatur- und Forschungsnachweise entstammen den GESIS-Datenbanksystemen SOLIS und SOFIS sowie sechs englischsprachigen Datenbanken des Herstellers Cambridge Scientific Abstracts (CSA).
Die Ausgabe "Recherche Spezial 03/2008. Ein Überblick über aktuelle sozialwissenschaftliche Forschung zur Thematik "Demenz" kann wie alle anderen Themenbände dieser Reihe (z. B. aktuell zum Internetverhalten von Jugendlichen) als PDF-Datei kostenlos heruntergeladen werden.
Bernard Braun, 1.5.2008
BZgA: Erhebliche Mängel bei den Versorgungsangeboten für übergewichtige und adipöse Kinder und Jugendliche in Deutschland
 Angesichts der hohen Anzahl übergewichtiger Kinder und Jugendlicher (rund 15 %) in Deutschland, von denen 6 % unter starkem Übergewicht (Adipositas) leiden, besteht in der öffentlichen Debatte seit geraumer Zeit Einigkeit über den hohen Präventions- und Behandlungsbedarf.
Angesichts der hohen Anzahl übergewichtiger Kinder und Jugendlicher (rund 15 %) in Deutschland, von denen 6 % unter starkem Übergewicht (Adipositas) leiden, besteht in der öffentlichen Debatte seit geraumer Zeit Einigkeit über den hohen Präventions- und Behandlungsbedarf.
Auch wenn die internationalen und vor allem nationalen Untersuchungen der Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Vielzahl von einschlägigen Angeboten für Kinder und Jugendlichen teils zu skeptischen Bewertungen kommen und nur wenige, meist sehr aufwändige Interventionen wirklich ihren Nutzen bewiesen haben (Einzelheiten zeigt eine bereits im Forum-Gesundheitspolitik vorgestellte Überblicksarbeit zur internationalen Forschungslage über Anti-Übergewichts- und Adipositaprogramme), gab es bisher in Deutschland noch nicht einmal genügend Transparenz über die wesentlichen Angebote, geschweige denn ihre Qualität.
Diesem Zustand hat nun eine im Auftrag der "Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)" am Universitätsklinikum Eppendorf Hamburg durchgeführte bundesweite Bestandsaufnahme ein Ende bereitet.
Die wesentlichen Teilziele der Studie waren:
• Erfassung des Versorgungsangebots.
• Einschätzung der Qualität der Angebote und ihrer Verteilung auf ambulante, teilstationäre und stationäre Behandlungen sowie die wichtigsten Träger (Kliniken, Ernährungsberatungsstellen, ärztliche Praxen, Gesundheitsämter u. a.).
• Bestimmung von Stärken und Schwächen verschiedener Angebote.
• Aufzeigen von Optimierungsmöglichkeiten der Versorgung.
Die vorliegende Studie liefert einen Überblick über die Versorgungslage, die Angebotsdichte sowie die Qualität von Angeboten zur Therapie von Übergewicht und Adipositas bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland in den Jahren 2004-2005. Der Datensatz über die bundesweite Versorgungslage umfasst 492 Angebote und bietet damit die breiteste und differenzierteste Datenbasis für Versorgungsanalysen des Feldes. Insgesamt ist von der Existenz von rund 700 Angeboten auszugehen.
Die Hauptergebnisse der Analyse waren:
• Zwei Drittel der Einrichtungen ambulant arbeiten. Dabei handelt es sich um Angebote, die die Kinder und Jugendlichen ein- bis dreimal pro Woche aufsuchen und ansonsten den gewohnten Alltag in ihrer Familie verbringen.
• Knapp 20 % der Einrichtungen sind stationäre Maßnahmen, in denen die Betroffenen über mehrere Wochen auch über Nacht bleiben.
• Die restlichen Angebote sind gemischte Formen und Maßnahmen, die in Kindergärten, Schulen und Sportvereinen stattfinden.
• Zu den größten Anbietern in der Adipositastherapie von jungen Menschen gehören Kliniken und Ernährungsberatungsstellen. Psychotherapeutische Praxen, Gesundheitsämter, Sportvereine, Krankenkassen, sozialpädiatrische Zentren sowie Kinder- und allgemeinärztliche Praxen halten nur wenige Angebote vor.
• Die Qualität der Angebote wurde anhand von Qualitätskriterien ermittelt, die zuvor in einem intensiven Austausch zwischen dem Bundesministerium für Gesundheit, der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und den führenden Fachgesellschaften und Wissenschaftlern entwickelt wurden.
• Die Studie zeigt deutliche Defizite in der Qualität der Angebote: So erfüllen nur etwa 51 % der Maßnahmen die zugrunde gelegten Qualitätsmerkmale. Insgesamt weisen stationäre Angebote die höchste Qualität auf, gefolgt von teilstationären und ambulanten Maßnahmen, wobei es bei allen Versorgungstypen gute und schlechte Maßnahmen gibt. Die Kosten der jeweiligen Maßnahme weisen nur einen geringen Zusammenhang zur Qualität auf. Konkret heißt das, dass es teure Maßnahmen mit geringer Qualität und preiswerte Maßnahmen mit guter Qualität gibt.
Die BZgA will sich daher künftig gezielt darum kümmern, die Qualität der Angebote zu verbessern und auch künftig genügend Transparenz herzustellen.
Bei der BzGA sind auch kostenlos weitere Informationsmaterialien erhältlich und stehen weitere Informationen zum Qualitätssicherungsprozess in der Versorgung übergewichtiger Kinder und Jugendlicher zur Verfügung.
Die als Band 8 ihrer Fachheftreihe zur "Gesundheitsförderung Konkret" 2007 erschienene 115 Seiten umfassende Studie "Die Versorgung übergewichtiger und adipöser Kinder und Jugendlicher in Deutschland" ist ebenfalls kostenlos u.a. als PDF-Datei erhältlich.
Bernard Braun, 26.4.2008
Schlechte Nachricht für Asthma-Patienten: Matratzenbezüge helfen zur Bekämpfung von Milben ebenso wenig wie Chemikalien
 Etwa 4-8 Millionen Deutsche, so schätzt man, leiden unter einer Hausstaub-Allergie mit Schnupfen und Niesanfällen, Augen- oder Ohrenjucken, Anschwellen der Nasenschleimhaut. Ausgelöst wird die allergische Reaktion nicht durch Staub, sondern durch eiweißhaltige Kotballen von Hausstaubmilben, die bevorzugt in Matratzen, Teppichen oder Polstermöbeln leben. Es liegt daher nahe, dass Allergiker und Asthmatiker sich darum bemühen, den Kontakt zu den Milben und ihren Ausscheidungen in Grenzen zu halten, zumal die erfolgreichste Therapie, die Desensibilisierung, erst nach mehreren Jahre und nicht bei jedem funktioniert. Die vielfältigen Mittel im Kampf gegen die Milben, Chemikalien und Staubsauger-Filter, spezielle Matratzen- und Kissenbezüge, zeigen jedoch keinen durchschlagenden Erfolg, so hat jetzt eine neue Cochrane-Studie gezeigt.
Etwa 4-8 Millionen Deutsche, so schätzt man, leiden unter einer Hausstaub-Allergie mit Schnupfen und Niesanfällen, Augen- oder Ohrenjucken, Anschwellen der Nasenschleimhaut. Ausgelöst wird die allergische Reaktion nicht durch Staub, sondern durch eiweißhaltige Kotballen von Hausstaubmilben, die bevorzugt in Matratzen, Teppichen oder Polstermöbeln leben. Es liegt daher nahe, dass Allergiker und Asthmatiker sich darum bemühen, den Kontakt zu den Milben und ihren Ausscheidungen in Grenzen zu halten, zumal die erfolgreichste Therapie, die Desensibilisierung, erst nach mehreren Jahre und nicht bei jedem funktioniert. Die vielfältigen Mittel im Kampf gegen die Milben, Chemikalien und Staubsauger-Filter, spezielle Matratzen- und Kissenbezüge, zeigen jedoch keinen durchschlagenden Erfolg, so hat jetzt eine neue Cochrane-Studie gezeigt.
Der einfache Grund dafür: Zwar wird die Menge der allergieauslösenden Partikel durch einige der untersuchten Methoden um 50 Prozent oder sogar mehr reduziert. Aber selbst eine Reduzierung um 90 Prozent würde nach Ansicht des Wissenschaftlers Peter Gotzsche nicht ausreichen, denn die in den Wohn- und Schlafzimmern vorhandene Allergenmenge ist meist so groß, dass sie auch nach der Behandlung mit Chemikalien oder Staubsaugern immer noch ausreicht, um Asthmaanfälle auszulösen.
Analysiert wurden in dem jetzt veröffentlichten neuen Cochrane-Bericht 54 Studien mit insgesamt 3000 Patienten. Dabei handelte es sich durchweg um Studien, in denen jeweils eine (nach Zufallsprinzipien zusammen gestellte) Kontroll-Gruppe auch ein Placebo erhielt oder keinerlei Intervention. Bei allen Teilnehmern war von einem Arzt Bronchial-Asthma festgestellt worden, ihre Allergie war durchweg durch einen Hauttest überprüft worden. In 36 Studien waren physikalische Methoden angewendet worden, überwiegend die Verwendung spezieller Matratzen- und Kissenbezüge, aber auch Heiz- und Friermethoden, Ionisierung, Vakuum-Reinigung und ähnliches mehr. In 10 Studien kamen chemische Präparate und in 8 Studien kombinierte Vorgehensweisen zum Einsatz. Der am häufigsten verwendete Indikator, um medizinische Effekte zu messen, war das Ausatmungsvolumen ("peak-flow") am Morgen nach dem Aufstehen.
Obwohl die methodische Qualität der allermeisten Studien überaus dürftig war und man von daher schon einen deutlich positiven Effekt der überprüften Methoden hätte erwarten können, schreiben die beiden Forscher, zeigten die Studien keinen statistisch signifikanten Einfluss. Für den am häufigsten überprüften Indikator, das Ausatmungsvolumen, war der Mittelwert-Unterschied zwischen Interventions- und Kontrollgruppe 0.00 - bei 1565 Patienten . Auch für andere Kriterien, etwa Asthma-Symptome, Beschwerdebesserungen, Arztbesuche oder Medikamentengebrauch, zeigten sich keine Unterschiede.
Die Wissenschaftler vom Nordic Cochrane Center in Kopenhagen ziehen das Fazit: Wir können mit Sicherheit feststellen, dass teure Staubsauger, Matratzenbezüge oder chemische Mittel gegen Hausstaubmilben nicht funktionieren. Und es ist sehr zweifelhaft, ob zukünftige Studien in der Art wie unsere, ein anderes Ergebnis bringen und sich zukünftig daher überhaupt lohnen. Wenn überhaupt, so sollten Kontrollstudien durchgeführt werden, die methodisch sehr viel besser fundiert sind.
Das Abstract der Cochrane-Metaanalyse ist hier verfügbar: PC Gotzsche, HK Johansen: House dust mite control measures for asthma (Cochrane Database of Systematic Reviews 2008 Issue 2, DOI: 10.1002/14651858.CD001187.pub3)
In Deutschland wird für das vom Pharma-Unternehmen "Hexal" erstellte Präparat "milbiol®" stark geworben. Der dort enthaltene Stoff, das "Niembaumsamenöl" wirkt nach Aussage des Herstellers "genial einfach: Er macht die Nahrungsgrundlage der Milben ungenießbar. Die Hautschuppen "schmecken" den Milben dann einfach nicht mehr, sie nehmen keine Nahrung mehr auf." Zweifel an dieser Wirksamkeit äußerten aber auch schon deutsche Wissenschaftler mehrfach. So findet sich in einer Veröffentlichung in der Zeitschrift Pädiatrische Allergologie (2002; 5 (3) 31-34) unter anderem die Kritik:
• "die Milbenallergene bleiben, wenn nicht parallel gewaschen, gesaugt und abgewartet wird, d.h. es gibt keine Sofortwirkung für den Milbenallergiker"
• es "fehlen wissenschaftliche Studien zur Effektivität und Sicherheit der Langzeitanwendung (Innenraumbelastung, Sensibilisierung)"
• "es gibt vor allem keine Studien zur Wirksamkeit des Präparats auf klinische Parameter des Patienten".
vgl. Aktuelles von der Kinderumwelt. Neembaumöl gegen Hausstaubmilben?"
Gerd Marstedt, 21.4.2008
Meta-Analyse stellt erneut Überversorgung mit Antibiotika am Beispiel von Entzündungen der Nasennebenhöhlen fest
 In einer jetzt in der Zeitschrift "The Lancet" veröffentlichten Meta-Analyse stellten Wissenschaftler vom Basel Institut für klinische Epidemiologie (BICE) am Baseler Universitätsspital anhand einer Auswertung von neun Studien mit über 2.500 Patienten erneut fest, dass eine Verschreibung von Antibiotika bei einer Rhinosinusitis (entzündliche Erkrankung der Nasennebenhöhlen) medizinisch nicht angemessen ist. Alle berücksichtigten Studien hatten neben der Interventionsgruppe mit einer Antibiotika-Verschreibung auch eine Kontrollgruppe, in der Placebos verabreicht wurden. Im Ergebnis zeigte sich jedoch, dass die therapeutische Wirkung von Antibiotika nur minimal und statistisch zumeist nicht signifikant besser war als Placebos.
In einer jetzt in der Zeitschrift "The Lancet" veröffentlichten Meta-Analyse stellten Wissenschaftler vom Basel Institut für klinische Epidemiologie (BICE) am Baseler Universitätsspital anhand einer Auswertung von neun Studien mit über 2.500 Patienten erneut fest, dass eine Verschreibung von Antibiotika bei einer Rhinosinusitis (entzündliche Erkrankung der Nasennebenhöhlen) medizinisch nicht angemessen ist. Alle berücksichtigten Studien hatten neben der Interventionsgruppe mit einer Antibiotika-Verschreibung auch eine Kontrollgruppe, in der Placebos verabreicht wurden. Im Ergebnis zeigte sich jedoch, dass die therapeutische Wirkung von Antibiotika nur minimal und statistisch zumeist nicht signifikant besser war als Placebos.
Bereits mehrfach hatten wir im Forum Gesundheitspolitik über Studien berichtet, die auf eine medizinisch unangemessene Überversorgung bei Rhinosinusitis hingewiesen hatten: Mehrheitlich Über- und Fehlversorgung mit Antibiotika durch Hausärzte bei Nasennebenhöhlenentzündungen, Fehl- und Überversorgung: Röntgenuntersuchung und Antibiotika bei einfachen Entzündungen der Nasennebenhöhlen, Altes und Neues von der gefährlichen Dauer-Fehlversorgung von Erwachsenen und Kindern mit Antibiotika.
Infektionen der oberen Atemwege sind die dritthäufigste Ursache einer ärztlichen Konsultation und etwa ein Drittel dieser Infektionen werden als akute Rhinosinusitiden diagnostiziert. Da es jedoch sehr schwierig ist, zwischen der bakteriellen und der viralen Form der Erkrankung zu unterscheiden, verschreiben Ärzte weiterhin zu häufig Antibiotika. Die Verschreibung von Antibiotika auch bei dieser Erkrankung ist dabei in Europa nahezu der Regelfall. Wie die Baseler Wissenschaftler berichten, fand man in Finnland, dem United Kingdom und den Niederlanden Verschreibungsquoten von 72-92 Prozent. Die Problematik dieser Standardtherapie: In den Ländern mit dem höchsten Einsatz von Antibiotika wird eine zunehmende Antibiotika-Resistenz beobachtet, die weltweit auch zu erhöhten Erkrankungsraten und Todesfällen führt.
In der Auswertung der Ergebnisse bei über 2.500 Patienten in kontrollierten Studien mit Kontrollgruppe und Placebo-Vergabe fanden die Schweizer Forscher jetzt nur minimal bessere Therapie-Effekte bei einer Antibiotika- Verschreibung. Die Forscher stellten fest, dass 15 Rhinosinusitis-Patienten mit Antibiotika behandelt werden müssten, damit ein weiterer Patient geheilt würde. Bei Patienten mit schleimartigen Absonderungen aus dem Rachen reduzierte sich dieser Wert (NNT = "Numbers Needed to Treat") auf 8. Ältere Patienten, die von länger andauernden oder von ernsthafteren Symptomen berichteten, benötigten zwar mehr Zeit zur Heilung, zogen jedoch keinen größeren Nutzen aus der antibiotischen Behandlung als andere Patienten.
Die Autoren fassen ihre Befunde so zusammen: "Die Folgerungen für eine Erstversorgung sind, dass Antibiotika für Patienten mit akuten Rhinosinusitis-ähnlichen Beschwerden einen nur geringen Nutzen bringen. Allgemeine klinische Anzeichen und Symptome können die eine Untergruppe, für die eine Behandlung eindeutig gerechtfertigt wäre, nicht ausweisen, wenn man Kosten, ungünstige Abläufe und mit der Verwendung von Antibiotika einhergehende bakterielle Resistenzen in Betracht zieht. Antibiotika sind auch dann nicht gerechtfertigt, wenn Patienten von länger als 7 bis 10 Tage anhaltenden Symptomen berichten."
Hier ist ein Abstract der Meta-Analyse: J Young u.a.: Antibiotics for adults with clinically diagnosed acute rhinosinusitis: a meta-analysis of individual patient data (Lancet 2008; 371: 908-914)
Gerd Marstedt, 17.3.2008
Oberschicht-Angehörige erhalten nach einem Herzinfarkt öfter eine bessere medizinische Versorgung - und leben danach länger
 Erst vor kurzem hatte eine Studie gezeigt, dass schwarzafrikanische Patienten in den USA nach einem akuten Herzinfarkt oder schweren Herzattacken deutlich schlechter versorgt werden als Weiße (vgl.: Grundmerkmale des US-Gesundheitswesens: Qualitativ ungleiche Krankenhausbehandlung von weißen und schwarzen Patienten). Die Annahme, dies sei nun ein spezifischer Auswuchs von Rassendiskriminierung in den USA, wurde nun durch eine große schwedische Studie widerlegt. Auch im skandinavischen Wohlfahrtsstaat fand man heraus, dass Angehörige unterer Sozialschichten eine deutlich schlechtere medizinische Versorgung nach einem Herzinfarkt bekommen als Patienten der Oberschicht.
Erst vor kurzem hatte eine Studie gezeigt, dass schwarzafrikanische Patienten in den USA nach einem akuten Herzinfarkt oder schweren Herzattacken deutlich schlechter versorgt werden als Weiße (vgl.: Grundmerkmale des US-Gesundheitswesens: Qualitativ ungleiche Krankenhausbehandlung von weißen und schwarzen Patienten). Die Annahme, dies sei nun ein spezifischer Auswuchs von Rassendiskriminierung in den USA, wurde nun durch eine große schwedische Studie widerlegt. Auch im skandinavischen Wohlfahrtsstaat fand man heraus, dass Angehörige unterer Sozialschichten eine deutlich schlechtere medizinische Versorgung nach einem Herzinfarkt bekommen als Patienten der Oberschicht.
Basis der Studie waren Daten aus dem Schwedischen Herzinfarkt Register. Dort wurde die Daten aller 45-84jährigen Patienten erfasst, die in den Jahren 1993-1996 einen Herzinfarkt für 4 Wochen überlebten. Insgesamt waren dies etwa 16.000 Frauen und 30.000 Männer. Für die Analysen herangezogen wurden noch weitere Angaben, wie insbesondere das Haushaltseinkommen und Angaben dazu, ob der Patient im Zeitraum von 5 Jahren nach dem Infarkt verstorben war oder noch lebte. Als Indikator für die Versorgungsqualität wurde herangezogen, ob bei den Patienten eine sogenannte "Revaskularisierung" nach der Herzattacke durchgeführt worden war. Darunter versteht man das Einpflanzen von feinen Blutgefäßen in ein krankheitsbedingt nicht durchblutetes Herz oder auch die Auflösung einer Verstopfung im Herzbereich, also Maßnahmen, die bei Herzinfarktpatienten oft gesundheitlich absolut notwendig sind und sich lebensverlängernd auswirken.
Als Ergebnis zeigte sich dann:
• Bei Patienten aus oberen Einkommensgruppen hatten Mediziner zwei- bis dreimal so häufig eine Revaskularisierung durchgeführt wie bei den Patienten mit dem niedrigsten Einkommen.
• Vermutlich als Folge dieser besseren Versorgung war die 5-Jahres-Überlebensquote bei den einkommensstarken Patienten doppelt so groß.
• Diese Ergebnisse hatten auch dann noch Bestand, wenn man andere Variablen wie das Alter, Begleiterkrankungen oder Art der Klinik bei der Einweisung mitberücksichtigte.
Über mögliche Ursachen dieser Ungleichbehandlung und Hintergründe der schwedischen Zwei-Klassen-Medizin erfährt man im Aufsatz leider nichts: "Die Gründe für diese Selektionsprozesse bleiben im Dunkeln, aber ihre Existenz ist eine der vielen Herausforderungen für das Schwedische Gesundheitssystem und sein Grundprinzip der Gleichbehandlung aller."
Hier ist ein Abstract der Studie: Maria Rosvall u.a.: The association between socioeconomic position, use of revascularization procedures and five-year survival after recovery from acute myocardial infarction (BMC Public Health 2008, 8:44doi:10.1186/1471-2458-8-44)
Kostenlos verfügbar ist auch eine vorläufige PDF-Datei
Gerd Marstedt, 5.2.2008
Die Delphin-Therapie: Ihr medizinischer Nutzen ist überaus fraglich
 Für Kinder mit Entwicklungs- und Verhaltensstörungen, teilweise aber auch für Erwachsene, ist die sogenannte "Delphin-Therapie" in den letzten Jahren zunehmend populärer geworden. Zwei Wissenschaftler der Emory University (Atlanta, USA) haben nun noch einmal wissenschaftliche Veröffentlichungen der letzten Jahre über diese neue, überaus teure Behandlungsmethode unter die Lupe genommen. Ihr Fazit: Auch neuere Studien weisen schwerwiegende methodische Fehler auf, die Evidenz für einen therapeutischen Effekt ist mangelhaft. Überdies ist die Therapie auch unter Aspekten des Tierschutzes sehr problematisch. Die Jagd nach lebenden Tieren, die dann zu Vorführzwecken in Tierparks oder zu therapeutischen Zwecken in private Einrichtungen gebracht werden, ist überaus brutal. Die Delphine erleben dabei einen immensen Stress, viele ältere Tiere kommen dabei um.
Für Kinder mit Entwicklungs- und Verhaltensstörungen, teilweise aber auch für Erwachsene, ist die sogenannte "Delphin-Therapie" in den letzten Jahren zunehmend populärer geworden. Zwei Wissenschaftler der Emory University (Atlanta, USA) haben nun noch einmal wissenschaftliche Veröffentlichungen der letzten Jahre über diese neue, überaus teure Behandlungsmethode unter die Lupe genommen. Ihr Fazit: Auch neuere Studien weisen schwerwiegende methodische Fehler auf, die Evidenz für einen therapeutischen Effekt ist mangelhaft. Überdies ist die Therapie auch unter Aspekten des Tierschutzes sehr problematisch. Die Jagd nach lebenden Tieren, die dann zu Vorführzwecken in Tierparks oder zu therapeutischen Zwecken in private Einrichtungen gebracht werden, ist überaus brutal. Die Delphine erleben dabei einen immensen Stress, viele ältere Tiere kommen dabei um.
Die beiden Wissenschaftler Marino und Lilienfeld hatten bereits im Jahre 1998 eine Analyse vorliegender Studienberichte über die Delphin-Therapie vorgenommen und waren zu dem Ergebnis gekommen, dass es aufgrund methodischer Defizite in den veröffentlichten Studien keine zureichenden Belege gibt, was den therapeutischen Nutzen der Therapie anbetrifft. In den letzten Jahren hat die Methode jedoch vor allem in den USA gleichwohl immer stärker an Popularität gewonnen. Private Einrichtungen bieten für einen Preis von oftmals mehreren tausend Dollar Therapien an, nach einem Bericht des WDR kostet die zweiwöchige Behandlung in Europa sogar 10-15.000 Euro.
Die beiden Wissenschaftler haben nun noch einmal wissenschaftliche Studien aus den Jahren 1999-2005 näher unter die Lupe gekommen. Alle Studien kamen zu einer positiven Schlussfolgerung, was den therapeutischen Nutzen der Behandlung. Alle Studien, so die Bilanz von Marino und Lilienfeld, weisen jedoch so schwerwiegende methodische Fehler auf, dass man diese Schlussfolgerung in Frage stellen muss.
So wird beispielsweise in keiner einzigen Studie der "Placebo-Effekt" oder der sogenannte "Neuigkeits-Effekt" hinreichend kontrolliert. Während der Placebo-Effekt aus den positiven Vorannahmen eines Patienten resultiert (man glaubt fest an die Wirkung der Therapie), ergibt sich der "Neuigkeits-Effekt" aus neuen, ungewohnten Wahrnehmungen und Gefühlen, die eine positiv stimulierende Wirkung auch in medizinischer Hinsicht haben könnten. In den Studien hätte man diese in der wissenschaftlichen Literatur sehr genau beschriebenen Effekte beispielsweise dadurch kontrollieren können, indem man Kontrollgruppen bildet mit anderen Tieren oder mit anderen Aktivitäten für die Teilnehmer, die im Wasser stattfinden und positive Empfindungen hervorrufen. Die Wissenschaftler diskutieren noch etwa ein Dutzend weiterer methodischer Forderungen und Prinzipien, die für die Untermauerung der Befunde klinischer Studien notwendig sind. Sie stellen jedoch fest, dass alle fünf Untersuchungen zur Delphin-Therapie mehrere dieser Postulate verletzten.
• Die Studie im Volltext als PDF: Marino, Lori; Lilienfeld, Scott O.: Dolphin-Assisted Therapy: More Flawed Data and More Flawed Conclusions
• Ein Abstract der Studie
• Ein zusammenfassender Pressebericht aus Science Daily: Dolphin 'Therapy' A Dangerous Fad, Researchers Warn
Gerd Marstedt, 26.12.2007
Therapie von Asthma: Nur jeder dritte Patient wird leitliniengetreu behandelt
 Eine Analyse von Routinedaten zu Arzneimittelverschreibungen in der GKV hatte unlängst gezeigt, dass etwa 6 Prozent der Versicherten unter Asthma leiden und überdies die These aufgestellt, dass bei der Therapie dieser Patienten oftmals eine Fehlversorgung zu beobachten ist (vgl. S. Stock u.a.: Asthma: prevalence and cost of illness). Fundierte Aussagen hierzu allein auf der Basis von Medikamentenverschreibungen sind jedoch problematisch.
Eine Analyse von Routinedaten zu Arzneimittelverschreibungen in der GKV hatte unlängst gezeigt, dass etwa 6 Prozent der Versicherten unter Asthma leiden und überdies die These aufgestellt, dass bei der Therapie dieser Patienten oftmals eine Fehlversorgung zu beobachten ist (vgl. S. Stock u.a.: Asthma: prevalence and cost of illness). Fundierte Aussagen hierzu allein auf der Basis von Medikamentenverschreibungen sind jedoch problematisch.
Eine deutsche Forschungsgruppe hat daher eine Studie durchgeführt, in der Patienten ausführlich Auskunft gaben über den Schweregrad ihrer Asthma-Erkrankung, Details der Therapie sowie ihre Beschwerden und Lebensqualität. Die Ergebnisse waren besorgniserregend: Nur ein Drittel der Studienteilnehmer wurde im Einklang mit Therapie-Leitlinien behandelt, ein Drittel war unterversorgt, ein Drittel falsch versorgt. Die Studienergebnisse zeigten überdies, dass bei Patienten mit einer nicht leitlinien-konformen Therapie die Lebensqualität deutlich niedriger und das Ausmaß an Depressionen am höchsten war.
Die jetzt in der Zeitschrift "Journal of Evaluation in Clinical Practice" veröffentlichten Ergebnisse stammen aus einem vom Bundesministerium für Gesundheit finanzierten Projekt zur Verbesserung der Versorgungsqualität. Durchgeführt wurde es in Sachsen, wo insgesamt 256 Asthma-Patienten aus 43 Allgemeinarzt-Praxen an einer Befragung teilnahmen. Dort waren Angaben zu machen zu der von ihnen empfundenen Lebensqualität (anhand eines speziellen Fragebogens für Asthmatiker), über Symptome und Schweregrad der Erkrankung, zu anderen physischen und psychischen Beschwerden (insbesondere Depressions-Symptome), Arztbesuche und Klinikaufenthalte sowie zur genauen Therapie.
Als Ergebnis der Analyse zeigte sich:
• Bei 37% der Patienten/innen war die Therapie leitliniengerecht.
• Bei 34% war die Therapie zwar mit den Leitlinien übereinstimmend, jedoch die Dosierung zu niedrig.
• Bei 29% fand man Medikamentenverschreibungen, die nicht auf dem neuesten Forschungsstand waren.
• Die subjektiv wahrgenommene Lebensqualität und auch das Ausmaß an Depressions-Symptomen zeigten einen deutlichen Zusammenhang zum Schweregrad der Erkrankung. Ebenso spielte aber auch eine Rolle, ob die Therapie leitliniengerecht war oder nicht.
• Nur 29% der Patienten hatten eine Asthmatiker-Schulung erfahren. Allerdings äußerten zwei Drittel der übrigen Patienten ohne solch ausführliche Beratung auch kein Interesse daran.
• Krankenhauseinweisungen der Asthmatiker (wegen dieser Erkrankung) waren besonders hoch, wenn die Patienten auch ein hohes Maß an Depressivität zeigten.
Hier ist ein Abstract der Studie: Antonius Schneider u.a.: Asthma patients with low perceived burden of illness: a challenge for guideline adherence (Journal of Evaluation in Clinical Practice 13 (6), 846-852)
Gerd Marstedt, 19.12.2007
Honig statt Antitussiva - Ein altes Hausmittel hilft bei kindlichem Husten besser als Medikamente
 Wenn Kinder unter einem Husten leiden, greifen besorgte Eltern gern zu Arzneimitteln und verabreichen ihren Jüngsten Sirup oder Kapseln mit einem Hustenstiller aus der Apotheke. Dass in solchen Fällen ein altbewährtes Hausmittel, nämlich Honig, eine zumindest genau so gute Wirkung hat, wurde jetzt in einer methodisch fundierten Studie aufgezeigt, über deren Ergebnisse die Zeitschrift "Archives of Pediatric and Adolescent Medicine" jetzt berichtete.
Wenn Kinder unter einem Husten leiden, greifen besorgte Eltern gern zu Arzneimitteln und verabreichen ihren Jüngsten Sirup oder Kapseln mit einem Hustenstiller aus der Apotheke. Dass in solchen Fällen ein altbewährtes Hausmittel, nämlich Honig, eine zumindest genau so gute Wirkung hat, wurde jetzt in einer methodisch fundierten Studie aufgezeigt, über deren Ergebnisse die Zeitschrift "Archives of Pediatric and Adolescent Medicine" jetzt berichtete.
Das in diesen Arzneimitteln enthaltene Dextromethorphan ist ein dem Morphin und Codein verwandter Hustenblocker, ein sogenanntes Antitussivum. Es ist in Deutschland unter anderem enthalten in Wick® Formel 44 Husten-Stiller oder Wick® MediNait, in den Ratiopharm® Hustenstiller-Kapseln oder im Contac® Erkältungs-Trunk Forte. Wissenschaftler der Pennsylvania State University USA hatten an einer zwar recht kleinen Stichprobe von 105 Kindern und Jugendlichen (Alter 2-18 Jahre), aber im Rahmen einer methodisch besonders gut abgesicherten klinischen Studie untersucht, wie sich die Einnahme eines Medikaments mit Dextromethorphan im Vergleich zu Buchweizen-Honig und im Vergleich zu abwartender Beobachtung auf den Husten auswirkt.
In die Studie einbezogen wurden 105 jüngere Patienten, die schon einige Tage (aber nicht länger als eine Woche) unter einer Atemwegs-Infektion mit heftigeren Hustensymptomen und daraus resultierenden Schlafstörungen litten. Sie wurden per Zufall einer von drei Gruppen zugeordnet ("Randomisierung"), ohne dass die Wissenschaftler wussten, in welche ("Verblindung"). Die Eltern erhielten entsprechend dieser Zuordnung dann die Therapieanweisung, dass das erkrankte Kind entweder Honig oder einen Hustenblocker einnehmensollte oder ob man zunächst nicht tun und abwarten sollte. An den beiden folgenden Tagen wurde dann erhoben, ob und wie sich die Symptome und Beschwerden gebessert hatten.
In einem Fragebogen wurde (dreimal) erfasst, ob sich bei der ersten ärztlichen Vorstellung sowie in der ersten und in der zweiten Nacht
• die Häufigkeit von Hustenanfällen verbessert hatte oder nicht,
• ferner der Schweregrad des Hustens,
• die Schlafzeit und Schlafruhe des Kindes
• sowie die der Eltern und
• auch die Besorgtheit und psychische Beeinträchtigung des Kindes.
Als Ergebnis zeigte sich, dass bei allen fünf erfassten Indikatoren für die Hustenbeschwerden das Abwarten und der Verzicht auf eine Arznei die geringsten Effekte hatte. Im Vergleich von Honig und Hustenblocker schnitt durchgängig jedoch das Hausmittel und Naturprodukt besser ab.
Hier ist ein kostenloses Abstract der Studie: Ian M. Paul u.a.: Effect of Honey, Dextromethorphan, and No Treatment on Nocturnal Cough and Sleep Quality for Coughing Children and Their Parents (Arch Pediatr Adolesc Med. 2007;161(12):1140-1146)
In einem Kommentar zu dieser Studie, im "Evidence-Based Journal Club", werden für methodisch interessierte Leser verschiedene Fragen diskutiert, die für Einschätzung der methodischen Qualität wichtig sind und im Rahmen der Bewertung von "Evidenz" auch bei anderen Studien immer wieder auftauchen. So geht es etwa um Fragen wie: War die Studie randomisiert? Zeigten die Untersuchungs- und Kontrollgruppen vergleichbare Eingangsvoraussetzungen? Gab es eine "Verblindung"? Wie groß waren in den Gruppen jeweils die Abbrecher-Quoten? Die Diskussion dieser methodischen Kriterien führt zu einer sehr positiven Bewertung des methodischen Vorgehens: "Die Forscher waren ganz besonders streng bei ihrem Bemühen, die "Verblindung" durchzuführen und sehr sorgfältig darauf bedacht, alle Gruppen ähnlich zu behandeln (mit Ausnahme des Therapievorschlags)."
Hier ist die leider nicht kostenlose Diskussion: Evidence-Based Journal Club: The Effect of Honey on Nocturnal Cough and Sleep Quality for Children and Their Parents
(Arch Pediatr Adolesc Med. 2007;161(12):1149-1153)
Gerd Marstedt, 9.12.2007
Abnehmen mit Appetitzüglern - Wenig Wirkung, unklarer Nutzen aber schwere Nebenwirkungen
 Egal wie man es dreht und wendet, die Wahrscheinlichkeit die Probleme von Übergewicht und Fettsucht einfach, in kurzer Zeit und vor allem allein mit medizinischen oder pharmakologischen Interventionen "in den Griff" zu bekommen oder gar lösen zu können, ist denkbar gering. Hinzu kommen die in diesen "Lösungen" sichtbar werdenden unerwünschten gesundheitlichen Risiken.
Egal wie man es dreht und wendet, die Wahrscheinlichkeit die Probleme von Übergewicht und Fettsucht einfach, in kurzer Zeit und vor allem allein mit medizinischen oder pharmakologischen Interventionen "in den Griff" zu bekommen oder gar lösen zu können, ist denkbar gering. Hinzu kommen die in diesen "Lösungen" sichtbar werdenden unerwünschten gesundheitlichen Risiken.
Dies bestätigen mehrere in den letzten Tagen in internationalen Fachzeitschriften erschienene Auswertungen teilweise langjähriger Studien über pharmakologische Interventionen.
In einer Metaanalyse von vier randomisierten kontrollierten 4.105 Patienten umfassenden Doppelblind-Studien, die eine Behandlung mit täglich 20 Milligram des weit verbreiteten Appetitzügler-Präparats "Rimonabant®" gegenüber einem Placebo verglichen, kommen die dänischen Forscher um Arne Astrup vom Department of Human Nutrition der Faculty of Life Sciences an der Universität von Kopenhagen zu einer Reihe bemerkenswerten Ergebnissen über Wirkungen dieser "Einwerfversion" des Abnehmens von Übergewicht:
• Als erstes reduziert das Medikament das Ausgangsgewicht um durchschnittlich 4,7 kg.
• Als zweites hatten jedoch die NutzerInnen von Rimonabant ein um 40% höheres Risiko nachteiliger oder auch schwerwiegender Zwischenfälle. Die mit diesem Mittel behandelte Patienten brachen die Therapie auf Grund depressiver Störungen zweieinhalb mal häufiger ab als die Placebo-Gruppe, und dreimal so oft beendeten sie die Behandlung auf Grund von Angstzuständen. Das Auftreten solch schwerer psychischer Störungen wie einer Depression ist insofern nicht ernst genug zu nehmen, weil die in diese Studien aufgenommenen Übergewichtigen und Fettsüchtigen ausdrücklich nicht depressiv sein durften bzw. das Vorliegen einer solchen Erkrankung ein Ausschlussgrund gewesen wäre. Als Ursache oder Auslöser dieser unerwünschten Wirkungen wird vermutet, dass Rimonabant, was einen Wirkstoff enthält, der auf die Cannabinoid-Rezeptoren vom Typ 1 hemmend wirkt, bei der Blockade dieser Rezeptoren für körpereigene Cannabinoide deren stimmungsaufhellender Effekt ebenfalls unterdrückt und dadurch die negativen Gefühlszustände auftreten.
• Drittens weisen die Metaanalytiker noch auf ein auch hier beobachtbares und weit verbreitetes methodisches Manko von Übergewichts- und Abnehmstudien hin, nämlich dem Fehlen von Nachuntersuchungen nach Ende der aktiven Therapie und der Unmöglichkeit etwaige Gewichtszuwächse bewerten zu können.
Unabhängig davon, ob dies mit Vorsatz oder unbeabsichtigt eintritt, skizzieren die Forscher in diesem Zusammenhang folgendes Szenario der medikamentösen Intervention: "Wie bei anderen Appetitzüglern auch wird nach dem Beenden der Therapie ein Rückfall erwartet. Um ein dauerhaftes Gewicht und die Verbesserung der Risikofaktoren für das Herz-Kreislaufsystem und Diabetes beizubehalten, müssen die Medikamente lebenslang eingenommen werden." 2005 betrug der weltweite Umsatz mit Appetitzügler immerhin 1,2 Millarden US-Dollar.
Die Schlussfolgerungen der Wissenschaftler, die auch noch andere, in den USA laufende Debatten berücksichtigen, sind eindeutig: "Taken together with the recent US Food and Drug Administration finding of increased risk of suicide during treatment with rimonabant, we recommend increased alertness by physicians to these potentially severe psychiatric adverse reactions."
Die Ergebnisse des Aufsatzes "Efficacy and safety of the weight-loss drug rimonabant: a meta-analysis of randomised trials" von Robin Christensen, Pernelle Kruse Kristensen, Else Marie Bartels, Prof Henning Bliddal und Prof Arne Astrup (The Lancet 2007; 370:1706-1713) finden sich in einem Abstract.
Zusätzlich werden die Ergebnisse noch unter der Überschrift "Depression and anxiety with rimonabant" von Ph. Mitchell und M. Morris kommentiert (The Lancet 2007; 370:1671-1672).
Die jetzt veröffentlichten Erkenntnisse zu unerwünschten schweren Nebenwirkungen von Appetitzügler relativieren auch etwas optimistischere Ergebnisse, die ebenfalls in diesem Jahr in früheren Ausgaben des "Lancet" publiziert worden waren.
In dem Aufsatz "Drug treatments for obesity: orlistat, sibutramine, and rimonabant" von Padwal und Majumdar (The Lancet 2007; 369:71-77), für den es nur ein Abstract gibt, empfahlen die Autoren zwar einerseits "antiobesity treatment … for selected patients in whom lifestyle modification is unsuccessful." Andererseits verbanden sie dies mit einigen, wie wir jetzt wissen, nicht substanzlosen Warnungen: "In light of the lack of successful weight-loss treatments and the public-health implications of the obesity pandemic, the development of safe and effective drugs should be a priority. However, as new drugs are developed we suggest that the assessment processes should include both surrogate endpoints (ie, weight loss) and clinical outcomes (ie, major obesity-related morbidity and mortality). Only then can patients and their physicians be confident that the putative benefits of such drugs outweigh their risks and costs."
Parallel zu diesem Ergebnis veröffentlichten kanadische Forscher im "British Medical Journal (BMJ)" ihre Forschungsergebnisse zur Wirksamkeit von Rimonabant und zwei weiteren Appetitzüglern, Orlistat und Sibutramine.
Dazu reviewten sie die Ergebnisse von 30 doppelblinden, placebo-kontrollierten Studien, in denen fast 20.000 übergewichtige bzw. fettsüchtige Personen im Alter über 18 Jahren und mit einem Durchschnittsgewicht von 100 Kilogramm und einem Body Mass Index (BMI) von 35-36 Punkten eines der drei Medikamente mindestens ein Jahr einnahmen.
Am Ende der Interventionsphase waren die Orlistat-Patienten durchschnittlich 2,9 kg leichter, die Persionen, die Sibutramine einnahmen, waren 4,2 kg und die Rimonabant-Einnehmer sogar 4,7 kg leichter.
Alle Personen, die eines der drei Mittel einnahmen hatten auch eine höhere Wahrscheinlichkeit eine Gewichtsabnahme von 5-10% zu schaffen als die Personen, die ein Placebo einnahmen.
Dem standen in mehreren der reviewten Studien spezifische unerwünschte Effekte gegenüber und vor allem beendeten 30-40% der anfänglichen StudienteilnehmerInnen ihre Teilnahme vorzeitig. Solch hohen Drop-out-Raten sind zwar nicht selten, aber machen es noch schwerer, den Nutzen der medikamentösen Intervention tatsächlich zu bewerten.
Insgesamt blieb in den Studien auch ungeklärt, ob der Gewichtszuverlust stark genug war, um einen großen Gesundheits- und Lebenserwartungs-Nutzen damit zu realisieren. Teilweise untersuchten die Studien aber auch gar nicht den Effekt auf die Sterblichkeit oder das Neuauftreten (Inzidenz) spezifischer Erkrankungen.
Die Ergebnisse des Aufsatzes "Long term pharmacotherapy for obesity and overweight: updated meta-analysis" von Diana Rucker, Raj Padwal, Stephanie K Li, Cintia Curioni und David C W Lau (BMJ Online vom 15 November 2007) kann man sich als Abstract und als komplette 11-seitige PDF-Version als BMJ-Online-Veröffentlichung herunterladen.
Unter Berücksichtigung der kanadischen und dänischen Forschungsergebnisse weist der britische Mediziner Gareth Williams schließlich noch auf die besondere aktuelle Problematik der in den USA laufenden Zulassung einiger Anti-Obesity-Medikamente zum freien Verkauf ohne Verordnung hin: "Selling anti-obesity drugs over the counter will perpetuate the myth that obesity can be fixed simply by popping a pill and could further undermine the efforts to promote healthy living, which ist he only long term escape from obesity."
Bernard Braun, 19.11.2007
Nachweis des Nutzens von Frühaktivierung und Beschäftigungstherapie auch bei Schlaganfallpatienten!
 Eine der wichtigsten praktischen Erkenntnisse der neueren Versorgungsforschung ist, dass aus Gründen der Wirksamkeit der therapeutischen Interventionen und einer möglichst raschen Wiederherstellung der vorherigen Lebensqualität die lange vorherrschende möglichst lange Passivierung oder Bettliegezeit von PatientInnen durch eine möglichst frühe und gezielte Aktivierung ersetzt wird. Dass dies dann auch noch direkte ökonomische Vorteile durch die Verringerung von Liegezeiten hat, ist ein willkommener aber hier nicht im Vordergrund stehender Effekt dieser Art von Umgang mit schwer kranken PatientInnen.
Eine der wichtigsten praktischen Erkenntnisse der neueren Versorgungsforschung ist, dass aus Gründen der Wirksamkeit der therapeutischen Interventionen und einer möglichst raschen Wiederherstellung der vorherigen Lebensqualität die lange vorherrschende möglichst lange Passivierung oder Bettliegezeit von PatientInnen durch eine möglichst frühe und gezielte Aktivierung ersetzt wird. Dass dies dann auch noch direkte ökonomische Vorteile durch die Verringerung von Liegezeiten hat, ist ein willkommener aber hier nicht im Vordergrund stehender Effekt dieser Art von Umgang mit schwer kranken PatientInnen.
Dass dies selbst bei schwersten Erkrankungen Gültigkeit hat, zeigen die Ergebnisse einer gerade im "British Medical Journal (BMJ)" (BMJ published online vom 27. September 2007) veröffentlichten Metaanalyse von neun randomisierten kontrollierten Studien über den Nutzen von möglichst frühzeitiger Beschäftigungstherapie bei 1.258 Schlaganfallpatientinnen.
Dieser Nutzen sieht im Einzelnen so aus:
• Das Risiko negativer Folgen des Schlaganfalls (darunter Tod, Verfall oder die Abhängigkeit von fremder Hilfe bei persönlichen Alltagsaktivitäten [vorrangig mit dem Barthel-Index gemessen]) sank bei den Nutzern der Beschäftigungstherapie um ein Drittel (odds ratio 0.67, p=0,003).
• Gemessen mit dem Barthel-Index konnte die Beschäftigungstherapie den allgemeinen Performanzwert für die Fähigkeiten, Alltagsaktivitäten zu bewältigen, um 0,18 Punkte (p=0.01) auf der 20-Punkteskala erhöhen. Davon betroffen ist insbesondere die Aktivierung der Selbständigkeit und Unabhängigkeit der SchlaganfallpatientInnen.
• Um mit dieser Therapie negative Outcomes bei einem Patienten zu vermeiden, müssen 11 Schlaganfallpatienten so behandelt werden (der Indikator "numbers needed to treat). Dies ist zumindest ein Hinweis, dass die positiven Effekte nicht bei allen PatientInnen eintreten und wo weiterer Forschungsbedarf liegt.
• Danach verbessert eine solche Therapie nicht nur den Allgemeinzustand der Betroffenen, sondern verhindert oder reduziert auch den Verfall der Möglichkeiten, persönliche Aktivitäten im Alltagsleben ("daily living activities") ausüben zu können und damit in das subjektiv wahrgenommene "normale Leben" zurückkehren zu können.
Aus Sicht der Autoren geht es daher künftig nicht mehr darum, "ob" Beschäftigungstherapie eine positive Wirkung hat, sondern darum, welche spezifischen Interventionen dieser Art bei Untergruppen der Patienten wirksam sind.
Die PDF-Datei des neunseitigen Aufsatzes "Occupational therapy for patients with problems in personal activities of daily living after stroke: systematic review of randomised trials" von Lynn Legg et al. kann man hier kostenlos herunterladen.
Bernard Braun, 30.9.2007
Beispiel "erektile Dysfunktion": Wie ein biopsychosoziales Geschehen und Problem unzulässig somatisiert wird!
 Jeder, der bereits einmal oder auch mehrmals damit zu tun hatte, weiß, dass sexuelle Erregbarkeit und Lust nicht nur ein somatisches Geschehen sind, sondern auch etwas mit der Psyche zu tun haben.
Jeder, der bereits einmal oder auch mehrmals damit zu tun hatte, weiß, dass sexuelle Erregbarkeit und Lust nicht nur ein somatisches Geschehen sind, sondern auch etwas mit der Psyche zu tun haben.
Trotzdem rückten lange Zeit unzählige Männer ihren Potenzstörungen mechanisch mit Vakuumpumpen und chemisch mit Wundersalben oder injizierbaren Mitteln zu Leibe - oft schmerzhaft, eher unerotisch und lustbremsend oder wirkungslos.
Seitdem mehrere Hersteller pharmazeutischer Produkte die Beseitigung der so genannten erektilen Dysfunktion des Mannes auf ihre Fahnen geschrieben haben und z. B. die Firma Pfizer mit ihrem Medikament Viagra® weltweit Berühmtheit erlangte und hohe Gewinne realisierte, schien der somatische Königsweg gefunden zu sein. Entsprechend konzentrierte sich auch die Forschung darauf, fast nur noch die sicherlich auch vorhandenen somatischen Hintergründe und Lösungsmöglichkeiten der Potenzstörungen zu ergründen. Wenn das bei Bedarf unbemerkte Einwerfen einer blauen Pille alle Probleme zu lösen versprach, gab es offensichtlich keinen Grund mehr, auch und ergänzend über psychische Hintergründe und Lösungswege mit "Outingdruck" nachzudenken oder zu forschen.
Dabei räumen selbst die Hersteller von Medikamenten mit dem Wirkstoff Sildenafil ein, dass er nur 69 % der Nutzer bei ihren Potenzstörungen hilft und außerdem das Risiko von unerwünschten schweren Nebenwirkungen für Männer mit einer Reihe weiterer Gesundheitsstörungen und Arzneimitteleinnahmen erheblich ist. Viele Betroffene werden also die Finger von diesen Pillen lassen müssen und sind bei einer somatischen Orientierung wieder auf die bereits beschriebenen unangenehmen Hilfsmittel zurückverwiesen oder müssen mit einer erheblich reduzierten Lebensqualität zurechtkommen.
Dass es bei der erektilen Dysfunktion oder Impotenz um kein Bagatellgeschehen geht, soll vor der weiteren Beschäftigung mit ihr nur kurz für Deutschland memoriert werden. In der "Kölner Studie" vom Ende der 1990er Jahre stellten die Forscher "bei 19,2% aller Männer zwischen 30 und 80 Jahren eine erektile Dysfunktion fest. Aber nur rund ein Drittel dieser Männer (6,9 % aller Männer) leiden unter der Erektionsstörung und brauchen deshalb eine Behandlung. Die übrigen haben mit ihrer Potenzstörung kein Problem." Diese und weitere Daten sowie Literaturangaben finden sich auf der Website der "Selbsthilfegruppe Erektile Dysfunktion (Impotenz). Erektionsstörung: Ursachen, Behandlung, Kosten, Erfahrungen - von Betroffenen".
Eine "Cochrane Reviewer-Group" im Rahmen der "Cochrane Collaboration", bestehend aus T. Melnik, B. Soares und A. Nasselo hat sich nun ebenfalls mit der Vernachlässigung der psychischen und psychosozialen Seiten ("Normal sexual function is a biopsychosocial process and relies on the coordination of psychological, endocrine, vascular, and neurological factors") einer gesundheitlichen bzw. Lebensqualitäts-Störung beschäftigt. In einem gerade erschienenen "Cochrane Database Systematic Review" (2007 July 18;(3): CD004825) untersuchen die Forscher die Ergebnisse einer Reihe von neun randomisierten und zwei quasi-randomisierten Studien, die die Wirkungen der "Potenzpillen" mit der von psychosozialen Interventionen wie der Psychotherapie, psycho-edukative Methoden und insbesondere von Gruppen-Psychotherapien teilweise über längere Zeiträume hinweg verglichen.
Die Ergebnisse sind eindeutig:
• Es gab eine eindeutige Evidenz dafür, dass Gruppen-Psychotherapie Potenzstörungen verbessern helfen kann (die Kontrollgruppe erhielt keine Behandlung).
• Ein Vergleich von Männern, die eine solche Therapie besuchten und ein Sildenafil-haltiges Medikament einnahmen, mit einer Gruppe, die nur ein solches Medikament einnahm erbrachte folgendes Ergebnis: In der ersten Kombi-Gruppe verbesserten sich die erfolgreichen sexuellen Kontakte ("significant improvement of successful intercourse") mehr als in der zweiten und weniger Mitglieder der ersten Gruppe mussten einen Geschlechtsverkehr abbrechen ("drop out").
• Auch der direkte Vergleich einer Gruppe, die ihre Potenzstörung allein mit der Gruppenpsychotherapie behandelten mit einer anderen Gruppe, die sich nur mit einem Sildenafil-haltigen Medikament behandelten, fiel zugunsten der ersten aus. Dieses Ergebnis stammt allerdings nur aus einer enzigen kleinen Studie.
• Ein Vergleich der Erfolge psychosozialer Interventionen bei der Behandlung erektiler Dysfunktion mit den Ergebnissen lokaler Injektionen, Vakuumpumpen und den Erfolgen anderer psychosozialer Techniken ergab keine nennenswerten Unterschiede.
Ob sich auch bei voller Kenntnis der Erfolgswerte somatischer, pharmakologischer und psychosozialer Interventionen wesentlich mehr Männer dafür entscheiden, statt einen chemischen Stoff einzuwerfen ihre Potenzstörungen und vermutlichen Gründe in psychotherapeutischen Sexualgruppen zu outen und darüber zu reden, ist eher unwahrscheinlich oder erfordert gleichzeitige erhebliche Veränderungen des Gesundheits- und Krankheitsverständnis gerade bei Männern voraus. Nur, nichts über Viagra®-Alternativen gewusst zu haben, ist keine gute Ausrede mehr.
Den kompletten Text des Reviews gibt es leider nicht kostenfrei, setzt also ein Abonnement der Cochrane Library oder Database voraus. Hier findet sich aber das kostenfrei erhältliche und mit vielen empirischen Details gespickte Abstract des Cochrane-Reviews "Psychosocial interventions for erectile dysfunction" von Melnik et al..
Es ist außerdem bei PubMed erhältlich.
Bernard Braun, 1.9.2007
Überversorgung bei koronaren Herzkrankheiten: Viel hilft nicht unbedingt mehr - zumindest nicht dem Patienten.
 Eine Reihe von gesundheitsbezogenen Behandlungsangeboten werden zu Recht wegen ihrer zu kurzen Dauer kritisiert. Wenn es hoch kommt, gibt es "Silvesterraketen-Effekte" und nachhaltige Wirkung taucht höchstens noch als Floskel auf. Umgekehrt gibt es aber nicht wenige Angebote, die mit hohem sachlichen und zeitlichen Aufwand und Experteneinsatz ablaufen, bei denen dann aber der größte Erfolg der höhere Preis ist, aber keine zusätzliche Wirkung nachzuweisen ist.
Eine Reihe von gesundheitsbezogenen Behandlungsangeboten werden zu Recht wegen ihrer zu kurzen Dauer kritisiert. Wenn es hoch kommt, gibt es "Silvesterraketen-Effekte" und nachhaltige Wirkung taucht höchstens noch als Floskel auf. Umgekehrt gibt es aber nicht wenige Angebote, die mit hohem sachlichen und zeitlichen Aufwand und Experteneinsatz ablaufen, bei denen dann aber der größte Erfolg der höhere Preis ist, aber keine zusätzliche Wirkung nachzuweisen ist.
Ob es letzteres wirklich gibt und ob es sich um relevante Größenordnungen handelt, untersuchte eine Forschergruppe (Clark, Alexander M.; Hartling, Lisa; Vandermeer, Ben; Lissel, Sue L. und McAlister, Finlay A.) der kanadischen Universität von Alberta im Auftrag der "Agency for Healthcare Research and Quality" des "Center for Medicare and Medicaid Services" und des "U.S. Department of Health and Human Services" am Beispiel der Wirksamkeit und Effizienz von sekundärpräventiven Programmen gegen die koronare Herzkrankheit, also der weiterhin weltweit größten Einzel-Todesursache.
Die Ergebnisse ihrer Analysen sind in der August-Ausgabe 2007 des "European Journal of Cardiovascular Prevention & Rehabilitation" (14(4):538-546, August 2007) unter dem Titel "Secondary prevention programmes for coronary heart disease: a meta-regression showing the merits of shorter, generalist, primary care-based interventions" veröffentlicht worden. In die Studie gingen nach aufwändiger Suche und teilweise auch einer nachträglich ausführlicheren Charakterisierung von Interventionsprogrammen 46 Reviews oder einzelne randomisierte kontrollierte Untersuchungen mit 18.821 TeilnehmerInnen ein.
Die wichtigsten Erkenntnisse lauten:
• Wichtig ist eine klare und eindeutige Unterscheidung der Patienten in solche mit komplizierterer und schwerer koronaren Herzerkrankung und in welche mit weniger komplexen Erkrankung.
• Unterschieden wurden haus- oder fachärztlich getragene Herzgesundheitsprogramme von weniger als 10 Stunden pro Patient von länger als 10 Stunden dauernden Interventionen in Krankenhäusern oder bei niedergelassenen Fachärzten.
• Die Reduktion der Gesamtsterblichkeit unterschied sich bei kürzeren Programmen praktisch nicht von der durch längere Interventionen. Ebenfalls unterschied sich die Wirksamkeit der in Allgemeinarztpraxen angebotenen Programme nicht von den in Krankenhäusern angebotenen. Schließlich war es für die Wirksamkeit auch praktisch egal, ob das Programm von einem Haus- oder Facharzt durchgeführt wurde.
• Kürzere sekundärpräventive Programme in Allgemeinarzt- und Facharztpraxen sind für die Reduktion der Gesamtsterblichkeit bei Patienten mit einer koronaren Herzerkrankung zumindest so wirksam wie längere, in Krankenhäusern oder von Fachärzten getragenen längere Programme.
• Nach dem sorgfältigen Hinweis, dass die Schlussfolgerungen aus Studien mit weniger komplikativen und jüngeren Patienten stammen, ressumieren die Autoren praktisch: "As the shorter and more generalist programs are as effective at saving patients' lives, these offer an attractive and highly efficient alternative to longer, more costly, and often less accessible hospital programs. As most programs have poor access, contain more than 50 hours contact with professionals, and heart disease affects more people in the world than any other disease, the implications of these findings for patients and health care costs are major."
Ein Abstract des Aufsatzes finden Sie hier.
Bernard Braun, 14.8.2007
Nur 55 % der Assistenzärzte in USA beantworten 20 Fragen zur Diagnose und Behandlung von TBC richtig
 Zu den Unter- oder Fehlversorgungsrisiken in medizinisch und ärztlich als entwickelt geltenden Ländern gehören auch Spät-, Fehl- oder Nichtdiagnosen und eine sich daraus ergebenden Zuspät-, Falsch- oder Nichtbehandlung von gefährlichen, ja potenziell tödlichen Krankheitsarten.
Zu den Unter- oder Fehlversorgungsrisiken in medizinisch und ärztlich als entwickelt geltenden Ländern gehören auch Spät-, Fehl- oder Nichtdiagnosen und eine sich daraus ergebenden Zuspät-, Falsch- oder Nichtbehandlung von gefährlichen, ja potenziell tödlichen Krankheitsarten.
Dies gilt besonders für eine Reihe von Erkrankungen, die historisch besiegt schienen oder lange Zeit kein Problem mehr in Industriegesellschaften waren, in jüngerer Zeit aber durch die Zunahme des internationalen Reiseverkehrs oder der Immigration auch wieder in Europa oder Nordamerika zunehmen. Exemplarisch gilt dies für die Lungentuberkulose(TBC).
Deren Erscheinungsbild, die Möglichkeit der Diagnostik und die wissenschaftlich gesicherte Art und Weise der Therapíe ist in den USA und Europa in nationalen Leitlinien dargestellt. In den USA wird aufgrund der sozialen Zusammensetzung der Patienten und ihrer Konzentration in Städten davon ausgegangen, dass sie meistens ihren ersten Arztkontakt mit Internisten oder Primärärzten haben werden.
Trotzdem bzw. gerade deswegen untersuchte eine Forschergruppe aus Baltimore und Philadelphia welche Fähigkeiten bei Assistenzärzten, also meist jüngeren Ärzten, an vier medizinischer Versorgungszentren in den Städten Baltimore und Philadelphia existierten, TBC-Fälle zu diagnostizieren und mit den Erkrankten umgehen zu können. Dazu erhielten 131 Assistenzärzte ohne Ankündigung und damit ohne die Möglichkeit gezielter Vorbereitung einen auf Basis der Leitlinie der "American Thoracic Society" entwickelten 20 Fragen (Multiple-Choice- sowie wahr/falsch-Fragen - der komplette Fragebogen ist im Anhang des Aufsatzes nachgedruckt) umfassenden Wissensfragebogen zur TB, den sie in 30 Minuten beantworten konnten. Zusätzlich wurden eine Reihe von Merkmalen zur bisherigen Erfahrung der Ärzte mit TB-Patienten, ihrer Institution und dem Ausbildungsalter erhoben.
Die wesentlichen Resultate lauten:
• Im Durchschnitt werden 55 % aller Fragen von den Surveyteilnehmern korrekt beantwortet.
• Das Wissen der Assistenzärzte wächst nicht mit der Anzahl der im laufenden Jahr behandelten TBC-Patienten und auch nicht mit zunehmenden Dauer der postgraduierten Ausbildung.
• Die verbreiteten Wissenslücken umfassen gerade auch die Diagnose einer TBC und das Management einer latenten Tuberkuloseinfektion, was wichtig ist, um den gefährlicheren Ausbruch der Krankheit zu verhindern oder zu verschieben. Die dazu gestellten Fragen wurden nur noch von 40,7 % der Befragten korrekt beantwortet.
Da andere Studien zeigten, dass das spätere Versorgungsverhalten von niedergelassenen Ärzten in starkem Maße von Verhaltensmustern geprägt wird, welche die Ärzte in ihrer Facharzt-/Assistenzarztausbildung erworben haben, sehen die Forscher wichtige Implikationen ihrer Erkenntnisse für die öffentliche Gesundheit.
Nachdenklich stimmt in diesem Zusammenhang besonders der fehlende oder geringe Zusammenhang von Erfahrung und Wissensstand. Hier könnte sich ein grundsätzliches und auch in anderen Studien entdecktes inhaltliches und methodisches Problem der Qualifikation von Ärzten verbergen. Derartige Wissenslücken und damit falsche Handlungsorientierungen zu beseitigen erfordert danach wesentlich mehr als das Angebot von kognitiver Weiterbildung.
Der komplett 27 Seiten umfassende Aufsatz von Petros C Karakousis, Frangiscos G Sifakis , Ruben Montes de Oca, Valerianna C Amorosa, Kathleen R Page, Yukari C Manabe und James D Campbell erschien jetzt in der Fachzeitschrift "BMC Infectious Diseases" (2007, 7:89 doi:10.1186/1471-2334-7-89) und kann als PDF-Datei hier kostenlos heruntergeladen werden: "U.S. medical resident familiarity with national tuberculosis guidelines"
Bernard Braun, 10.8.2007
Der Kampf gegen die Malaria in Afrika: Weltbank-Bürokratie verhindert pragmatische Lösungen
 Etwa 40 Prozent der Weltbevölkerung leben nach Informationen der WHO derzeit mit dem ständigen Risiko, an Malaria zu erkranken, über eine Million Erkrankter sterben daran jedes Jahr, zumeist Kinder, Jugendliche und schwangere Frauen, die meisten von ihnen in Afrika. Warum ein Ende der Armutskrankheit nicht absehbar ist, beschreiben der Wissenschaftler Prof. Olaf Müller vom Hygiene-Institut des Universitätsklinikums Heidelberg und Kollegen aus dem westafrikanischen Staat Burkina Faso jetzt in einem Aufsatz der Zeitschrift "PLOS Medicine".
Etwa 40 Prozent der Weltbevölkerung leben nach Informationen der WHO derzeit mit dem ständigen Risiko, an Malaria zu erkranken, über eine Million Erkrankter sterben daran jedes Jahr, zumeist Kinder, Jugendliche und schwangere Frauen, die meisten von ihnen in Afrika. Warum ein Ende der Armutskrankheit nicht absehbar ist, beschreiben der Wissenschaftler Prof. Olaf Müller vom Hygiene-Institut des Universitätsklinikums Heidelberg und Kollegen aus dem westafrikanischen Staat Burkina Faso jetzt in einem Aufsatz der Zeitschrift "PLOS Medicine".
Danach sind Empfehlungen der WHO zur medikamentösen Behandlung der Malaria mit eine Wurzel der Problematik: Die WHO empfiehl die sogenannte Artemisinin-Kombinationstherapie (ACT), die jedoch für ein Land wie Burkina Faso und viele andere afrikanische Staaten viel zu teuer ist. Etwa 6,50 Dollar kostet die Behandlung mit diesem Präparat für einen einmaligen Fieberschub, ein Preis der weit über den möglicherweise noch bezahlbaren Limit von 50 US-Cent liegt. In Burkina Faso, einem Land in Westafrika mit knapp 14 Millionen Einwohnern, stirbt jedes fünfte Kind, bevor es fünf Jahre alt geworden ist, häufigste Todesursache: Malaria.
Gleichzeitig gibt es jedoch nach Angaben der Wissenschaftler bereits Medikamente, die ebenso effektiv sind und erheblich preisgünstiger. So würde eine Kombination der Wirkstoffe Sulfadoxin-Pyrimethamin und Amodiaquin lediglich Kosten in Höhe von 20 Cent verursachen. Ein Antrag der Regierung von Burkina Faso bei der Weltbank, aus einem laufenden Entwicklungshilfekredit auch Gelder für die Anschaffung dieser Medikamente bereit zu stellen, wurde unlängst jedoch abgelehnt. Begründung: Diese Therapie entspricht nicht den Empfehlungen der WHO.
Auch auf der Ebene der Prävention weisen die Wissenschaftler auf massive Defizite hin. So wisse man seit über 25 Jahren, dass Moskitonetze, die mit Insektiziden behandelt sind, einen überaus erfolgreichen Infektionsschutz bieten. De facto sei jedoch festzustellen, dass in Burkina Faso nur etwa 4 Prozent aller Kinder unter solchen Netzen schlafen und sich vor einem Mückenstich schützen. Die Anschaffung von Moskitonetzen für alle Vorschulkinder in Burkina Faso würde schätzungsweise etwa 20 Millionen US-Dollar kosten, hinzu kämen rund fünf Millionen Dollar jährlich für Neuanschaffungen. Diese Präventionsmaßnahme ist überaus effektiv, sie senkt das Infektionsrisiko um etwa 50 Prozent und die Gesamt-Mortalität um über 20 Prozent - und dies über einen einen sehr langen Zeitraum.
Der Aufsatz ist hier im Volltext nachzulesen: The great failure of malaria control in Africa: a district perspective from Burkina Faso (PLoS Medicine. Vol. 4(6) June 2007)
Gerd Marstedt, 17.6.2007
Therapie von Lungenentzündungen in Deutschland: Unangemessene Antibiotikatherapien in einer geteilten Nation.
 Jedes Jahr erkranken rund 800.000 Deutsche an einer Lungenentzündung, der häufigsten tödlichen Infektionskrankheit in westlichen Industrieländer. Erreger sind meistens Bakterien aber auch Viren, Parasiten oder Pilze. Welche Mikroorganismen es genau sind, ist bisher ebenso unklar wie die Resistenzlage und die besten Behandlungsstrategien.
Jedes Jahr erkranken rund 800.000 Deutsche an einer Lungenentzündung, der häufigsten tödlichen Infektionskrankheit in westlichen Industrieländer. Erreger sind meistens Bakterien aber auch Viren, Parasiten oder Pilze. Welche Mikroorganismen es genau sind, ist bisher ebenso unklar wie die Resistenzlage und die besten Behandlungsstrategien.
Abhilfe schaffen soll CAPNetz (Kompetenznetzwerk ambulant erworbene Pneumonie, Community Acquired Pneumonia), in dem Kliniker und niedergelassene Ärzte eng zusammen arbeiten und auf dessen Homepage sich auch noch ausführlichere Informationsmaterialien über die Epidemiologie und Behandlung der Lungenentzündung finden.
Eine erste vom "Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)" geförderte Teilstudie über die Risiko- und Versorgungsituation der Patienten in neun klinischen Zentren von Berlin bis Würzburg untersuchte dazu die Daten von insgesamt 3.221 Patienten im Alter von 18 bis 102 Jahren (Durchschnittsalter: 63,9 Jahre).
Nach einer sorgfältigen Standardisierung der untersuchten Patienten nach einheitlichen klinischen Kriterien und unter Berücksichtigung der unterschiedlichen soziodemografischen Charakteristika, gesundheitlichen Gesamtsituation und der Art der Versorgungsorte (stationär, ambulant, Pflegeheim) ergaben sich eine Reihe von Einblicken in den Versorgungsalltag:
• 30 % aller Todesfälle bei ambulant erworbenen Lungenentzündungen gehen auf eine primär eingeleitete und nicht angemessene antibiotische Therapie vor allem mit Breitband-Antibiotika zurück.
• Bereits jetzt sind 40 % aller Pneumokokken resistent gegen Antibiotika.
• Problematisch ist ferner bei den Pneumonien, dass bei mehr als der Hälfte der Patienten die ursächlichen Keime unentdeckt bleiben. Kommt hinzu: Nur in 30 bis 50 % der Fälle ist deren Identifikation zutreffend.
• Besonders bei Krankenhauspatienten existieren dazu erhebliche regionale Therapieunterschiede.
• Der Forderung, eine Harmonisierung der Therapie durch die Orientierung an dafür vorliegenden Leitlinien zu erreichen, steht eine offensichtlich hartnäckig existierende Vielfalt örtlicher Behandlungsempfehlungen und möglicherweise auch die regional unterschiedlichen Marketing-Praktiken der Pharma-Industrie entgegen.
Informationen zu der CAPNetz-Erhebung finden sich bisher frei zugänglich und kostenlos nur in einer ausführlichen Pressemitteilung.
Bernard Braun, 7.5.2007
Durchfallerkrankungen in Lateinamerika: Private Ärzte und Apotheker behandeln schlechter als öffentliche Anbieter
 Jedes Jahr sterben nach Angaben der UN-Kinderhilfsorganisation UNICEF weltweit mehr als 10 Millionen Kinder an vermeidbaren Ursachen. Mehr als 40 % dieser Sterbefälle beruhen auf Atemwegsinfektionen, Mangelernährung und dem dramatischen Verlust an Körperflüssigkeit und Salzen, der durch Durchfallerkrankungen (18 %) verursacht wird. In allen Fällen sind kosteneffektive Behandlungsmöglichkeiten verfügbar und bekannt gemacht.
Jedes Jahr sterben nach Angaben der UN-Kinderhilfsorganisation UNICEF weltweit mehr als 10 Millionen Kinder an vermeidbaren Ursachen. Mehr als 40 % dieser Sterbefälle beruhen auf Atemwegsinfektionen, Mangelernährung und dem dramatischen Verlust an Körperflüssigkeit und Salzen, der durch Durchfallerkrankungen (18 %) verursacht wird. In allen Fällen sind kosteneffektive Behandlungsmöglichkeiten verfügbar und bekannt gemacht.
Bereits seit einiger Zeit häuften sich Studien, die auf einen unerwarteten und lange für unmöglich gehaltenen Grund hinwiesen, der trotz der Behandlungsmöglichkeiten zu der hohen Sterblichkeit insbesondere an den Folgen von Durchfallerkrankungen vor allem in Entwicklungs- und Schwellenländern hinwiesen: Die auch in Ländern mit niedrigem Einkommen bevorzugte Behandlung in privaten Arztpraxen oder Apotheken statt in öffentlichen Gesundheitseinrichtungen. Trotz der vielfach genau gegenteiligen Empfindungen (z.B. bessere Ausstattung, kürzere Wartezeiten, Bereitschaft, mehr Zeit für Patienten aufzubringen) zeigte eine Zusammenstellung von demografischen und gesundheitlichen Daten aus 28 weltweiten Ländern in den 1990er Jahren, dass private Anbieter keineswegs immer besser ausgestattet sind und im Vergleich zu öffentlichen Gesundheitsdiensten bei Diarrhoe weniger auf die einfache und wirksame Methode der Wiederanreicherung mit Wasser durch die Gabe von in Flüssigkeit gelösten Salzen (so genannte "oral rehydration salts/solution" [ORS]) setzten als auf die Verschreibung von meist unnützen Medikamenten. Die von der "World Health Organization (WHO)" publizierte Leitlinie zur Behandlung von Kinder-Durchfallerkrankungen empfiehlt eindeutig, dass nur eine kleine Anzahl dieser Erkrankten (z.B. die mit blutigem Stuhlgang) mit Arzneimitteln behandelt werden soll und bei der weit überwiegenden Mehrheit Salz-/Glukoselösungen und der Zinkersatz die einzig angebrachte, wirksame und vor allem extrem preisgünstige Behandlung ist.
Eine populäre Zusammenfassung der Behandlungsempfehlungen enthält die als PDF-Datei erhältliche achtseitige WHO/UNICEF-Broschüre "CLINICAL MANAGEMENT OF ACUTE DIARRHOEA".
Ebenfalls in den 1990er Jahren wurde für Lateinamerika und die karibische Region, wo die Behandlung durch private Anbieter weit verbreitet ist, gezeigt, "that more than half of the providers treating child diarrhoea cases and acute respiratory infections (ARI) are in the private sector" und dass beispielsweise in Mexiko "private practitioners perform significantly worse than public ones in terms of advice, therapy, and drugs prescribed for both diarrhoea and ARI."
Ob dies überholt ist oder nur in wenigen Ländern dieser Region so war oder ist, wollten nun Gesundheitswissenschaftler von der Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health in Baltimore (USA) wissen. Dazu nutzten sie 10 von der Weltbank unterstützte "Living Standards Measurement Surveys (LSMS)" aus lateinamerikanischen und karibischen Ländern (Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Panama, Peru, Bolivien), die für den Zeitraum 1993-2003 repräsentative Daten lieferten. Damit konnten die Erkrankungs- und Behandlungsdaten von 31.073 Kindern unter 5 Jahren analysiert werden, von denen in den Erhebungszeiten 8.241 an einer Durchfallerkrankung litten.
Die wichtigsten Ergebnisse lauten:
• 36,8 % der erkrankten Kinder wurden eher durch einen privaten Behandler (Arzt oder Apotheker) behandelt als durch einen in einer öffentlichen Einrichtung.
• Nachdem der ökonomische Status der Befragtenhaushalte auf einer Skala in 20 %-Gruppen (Quintile) bestimmt wurde, erhöhte sich statistisch hochsignifikant mit jedem Übergang von einem niedrigeren zu einem höheren Status die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder mit Durchfall von einem privaten statt einem öffentlichen Leistungserbringer behandelt wurden, um 6,5 Prozentpunkte. Unter den Kindern mit dem ärmsten Elternhaus betrug dieser Anteil 23,3 % und unter den bestsituiertesten Kindern bzw. Elternhäuser 52,1 %.
• Auch die aktuelle Studie belegt nun eindeutig, dass die Behandlung im privaten Sektor qualitativ schlechter ist als im öffentlichen Bereich: Während 13,7 % der Kinder, die von privaten Ärzten behandelt wurden, orale Salzlösungen erhielten, waren dies immerhin 33 % der Kinder, die einen öffentlichen Anbieter aufsuchten. Umgekehrt erhielten die von privaten Anbietern behandelten Kinder mit höherer Wahrscheinlichkeit Arzneimittel verordnet, die von den Wissenschaftlern als "most commonly unnecessary antibiotics" bewertet wurden. 78,9 % der privaten Ärzte verschrieben den von ihnen behandelten Kinder Arzneimittel. Von den privaten Apothekern griffen, nicht weiter verwunderlich, 96,5 % zur Medikamentenschachtel. Der Anteil der privaten Behandler, die ORS "verordneten" bzw. empfohlen, lag betrug unter den Ärzten 20,2 % und bei den Apothekern 3,9 %.
• Ein weiteres Ergebnis ihrer Analyse fassen die Public Health-Experten so zusammen: "Ironically, when it comes to treatment for child diarrhoea, wealthier and better educated households in Latin America are paying for treatment in the private sector that is ineffective in comparison with treatments that are commonly and inexpensively avialable."
Auch wenn die Behandlung durch private Leistungserbringer deutlich unangemessener, schlechter und teurer ist als bei öffentlichen Gesundheitsdiensten, bleibt die Frage, warum auch bei letzteren nur eine Minderheit der erkrankten Kinder die im Normalfall einzig empfehlenswerte, wirksame und preiswerte Behandlung oder Beratung erhalten haben.
Wer sich mehr über den Umfang der Kinder-Durchfallerkrankungen sowie ihre wirksame Vermeidung und Behandlung informieren will, kann dies auf der beeindruckenden, sehr materialreichen und zum Teil auch bedrückenden (z.B. wegen der laufenden "Uhr" der am Besuchstag an Diarrhöe erkrankten und gestorbenen Kinder) Website des indischen Rehydration Project tun.
Kostenlos erhältlich ist leider nur das Abstract des gerade in der Onlineausgabe der Fachzeitschrift "Health Economics" erschienenen, d.h. noch in Druck befindlichen Aufsatzes
"The Role of Private Providers in Treating Child Diarrhoea In Latin America" von Hugh Waters, Laurel Hatt und Robert Black.
Wer einen entsprechenden Zugang über eine Bibliothek hat, kann den 9 Seiten umfassenden Aufsatz über diese Adresse herunterladen.
Bernard Braun, 6.5.2007
Herzdruckmassage ohne Mund-zu-Mund-Beatmung verbessert bei Herzstillstand die Überlebenschancen
 Eine jetzt in der renommierten Zeitschrift "The Lancet" veröffentlichte Studie japanischer Wissenschaftler hat gezeigt, dass bei einem Herzstillstand in Situationen außerhalb des Krankenhauses (etwa bei Verkehrsunfällen) eine alleinige Druckmassage des Brustkorbs ohne Mund-zu-Mund-Beatmung die Überlebenschancen des Betroffenen erheblich verbessert. Die bislang immer empfohlene Methode zur Wiederbelebung, ein heftiges Drücken auf Brustkorb und Herz und zusätzlich dazu von Zeit zu Zeit das Einhauchen von Atemluft, ist nach diesen Ergebnissen sogar ein Hemmschuh für die Erste Hilfe: Denn die meisten der zufällig anwesenden Zuschauer und potentieller Helfer verspüren eine starke Hemmung oder sogar Ekel vor dem Mund-zu-Mund-Kontakt. Daher werde von Zuschauern oft gar nichts unternommen, was dem bewusstlosen Opfer helfen könnte. Sofern sich die Einsicht durchsetzt, dass eine Herzdruckmassage allein viel besser hilft, wäre dies ein erheblicher Fortschritt und würde Hemmschwellen zur Ersten Hilfe abbauen.
Eine jetzt in der renommierten Zeitschrift "The Lancet" veröffentlichte Studie japanischer Wissenschaftler hat gezeigt, dass bei einem Herzstillstand in Situationen außerhalb des Krankenhauses (etwa bei Verkehrsunfällen) eine alleinige Druckmassage des Brustkorbs ohne Mund-zu-Mund-Beatmung die Überlebenschancen des Betroffenen erheblich verbessert. Die bislang immer empfohlene Methode zur Wiederbelebung, ein heftiges Drücken auf Brustkorb und Herz und zusätzlich dazu von Zeit zu Zeit das Einhauchen von Atemluft, ist nach diesen Ergebnissen sogar ein Hemmschuh für die Erste Hilfe: Denn die meisten der zufällig anwesenden Zuschauer und potentieller Helfer verspüren eine starke Hemmung oder sogar Ekel vor dem Mund-zu-Mund-Kontakt. Daher werde von Zuschauern oft gar nichts unternommen, was dem bewusstlosen Opfer helfen könnte. Sofern sich die Einsicht durchsetzt, dass eine Herzdruckmassage allein viel besser hilft, wäre dies ein erheblicher Fortschritt und würde Hemmschwellen zur Ersten Hilfe abbauen.
Prof. Ken Nagao von der Universitätsklinik Tokio und Kollegen hatten in einer Studie analysiert, wie die unterschiedlichen Maßnahmen zur Wiederbelebung von 4.068 erwachsenen Patienten verlaufen waren, die von anwesenden Passanten entweder nur eine Herzdruckmassage bekommen hatten oder die übliche Wiederbelebung mit Druck und Mund-zu-Mund-Beatmung. Die Forscher stellten fest, dass eine allein auf Herzdruckmassage basierende Wiederbelebung in neurologischer Hinsicht deutlich erfolgversprechender für das Überleben der Patienten ist. Dies zeigte sich bei einer Berücksichtigung der unterschiedlichen medizinischen Hintergründe des Herzstillstands. Im Vergleich der beiden Methoden (nur Massage, konventionelle Wiederbelebung) zeigten sich folgende Differenzen in der Überlebensrate: Bei Atemstillstand 6,2 Prozent im Vergleich zu 3,2 Prozent, bei Herzrhythmusstörungen 19,4 : 11,2 Prozent, bei kurzen, nicht behandelten Herzstillständen 10,1 : 5,1 Prozent). Die Wissenschaftler fanden auch keine Hinweise, dass die konventionelle Methode hinsichtlich anderer medizinischer Faktoren vorteilhaft ist.
Sie wiesen allerdings auch auf einige Ausnahmen hin: Bei einem Atemstillstand etwa nach Ertrinken, nach einer überhöhten Drogendosis oder einem Erstickungsanfall sei es nach wie vor sinnvoll, etwa nach 30maligem Druck auf den Brustkorb dem Bewusstlosen zwei Atemstöße einzuflössen.
Während dessen haben andere Wissenschaftler jedoch darauf hingewiesen, dass die in der Öffentlichkeit gehegten Erwartungen gegenüber den Chancen einer Wiederbelebung oft sehr unrealistisch sind. In vielen Fernsehserien und Kinofilmen würden Wiederbelebungsszenen gezeigt, die überwiegend glücklich ausgehen und Leben retten. Die dadurch bei Laien genährte Hoffnung widerspräche jedoch den tatsächlichen Gegebenheiten. So erklärte ein Mediziner in der BBC: "Die Leute nehmen aufgrund von Fernseh-Szenen an, dass mindestens drei von vier Herzstillstand-Opfern durch Wiederbelebung zurück ins Leben gerufen werden können. Tatsächlich sind es jedoch bei Vorfällen außerhalb eines Krankenhauses nur etwa 2 Prozent. Und überdies ist es leider so, dass sehr viele Überlebende schwere Gehirnschäden oder Behinderungen davontragen." vgl.: TV resuscitation 'is unrealistic'
Das Abstract der japanischen Studie ist hier nachzulesen: Cardiopulmonary resuscitation by bystanders with chest compression only (SOS-KANTO): an observational study (The Lancet 2007: 369: 920-26)
Gerd Marstedt, 17.3.2007
"Beschneidung von Männern reduziert HIV-Risiko um etwa die Hälfte"
 Diese schlagzeilenträchtige Quintessenz zweier aktueller großangelegten randomisierten und kontrollierten Studien enthält einen der größten denkbaren präventiven Fortschritte der letzten Jahre wenn nicht Jahrzehnte im Bereich von HIV und AIDS, und offenbart zugleich, wie desinteressiert, ignorant, unverständig oder oberflächlich in dem "abendländischen" medizinorientierten Vorsorgedenken mit Maßnahmen umgegangen wird, die in anderen Teilen der Erde aus kulturellen aber auch hygienischen Gründen eine jahrtausendalte empirische Tradition haben. Offensichtlich bedarf es aber heutzutage erst randomisierter kontrollierter Studien, um den gesundheitlichen Wert dieser Tradition anerkennen zu können. Dass dies zum Nachteil von Millionen HIV-Infizierten und AIDS-Erkrankten geht, wird dabei offensichtlich unwissentlich in Kauf genommen.
Diese schlagzeilenträchtige Quintessenz zweier aktueller großangelegten randomisierten und kontrollierten Studien enthält einen der größten denkbaren präventiven Fortschritte der letzten Jahre wenn nicht Jahrzehnte im Bereich von HIV und AIDS, und offenbart zugleich, wie desinteressiert, ignorant, unverständig oder oberflächlich in dem "abendländischen" medizinorientierten Vorsorgedenken mit Maßnahmen umgegangen wird, die in anderen Teilen der Erde aus kulturellen aber auch hygienischen Gründen eine jahrtausendalte empirische Tradition haben. Offensichtlich bedarf es aber heutzutage erst randomisierter kontrollierter Studien, um den gesundheitlichen Wert dieser Tradition anerkennen zu können. Dass dies zum Nachteil von Millionen HIV-Infizierten und AIDS-Erkrankten geht, wird dabei offensichtlich unwissentlich in Kauf genommen.
An der ersten Studie von Forschern um Robert Bailey von der Universität von Illinois in Chicago hatten 2.784 nicht mit HIV infizierte Männer im kenianischen Kisumu teilgenommen. Ronald Gray von der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore und seine Kollegen hatten 4.996 ebenfalls HIV-negative Männer in der Region Rakai in Uganda untersucht. Jeweils eine Gruppe der Teilnehmer wurde beschnitten, die andere nicht. Im Verlauf der Untersuchung prüften die Ärzte dann, welche Gruppe sich beim Geschlechtsverkehr eher mit dem Virus ansteckte. Bei den Beschnittenen infizierten sich rund fünfzig Prozent weniger Probanden als in der Gruppe der nicht beschnittenen Männer. Diese Ergebnisse bestätigen eine ähnliche Studie aus dem Jahr 2005 in Südafrika. Dort hatten französische Forscher sogar eine Minderung des Infektionsrisikos um 60 Prozent beobachtet.
Nachdem sich der enorme Effekt in den beiden aktuellen Studien eindeutig abzeichnete, beendeten die beiden Forscherteams sie, nicht ohne zwei differenzierende und relativierende Hinweise zu geben:
Erstens weisen sie darauf hin, dass es keine eindeutigen Erklärungen für die empirischen Effekte gibt. Die Hinweise auf die geringere "Angriffsfläche" bei beschnittenen Penisen oder auf eine schnellere Trocknung des Penis nach dem Geschlechtsverkehr und den damit schlechter werdenden Bedingungen für das AIDS-Virus HIV sind daher nur begründete Spekulationen. Zweitens aber warnen die Forscher vor Sorglosigkeit bei beschnittenen Männern und charakterisieren diese Methode als eine immer noch recht unsichere Methode.
In der deutschen Zusammenfassung der verschiedenen "Lancet-Aufsätze" werden die Potenziale und Dilemmata der Forschungsergebnisse so dargelegt:
• "Jüngsten Modell-Simulationen zufolge könnte eine breit angelegte Einführung der Beschneidung auf der Grundlage einer 60-prozentigen Schutzwirkung bis zu zwei Millionen HIV-Neuinfektionen und 300 000 Todesfälle im südlichen Afrika verhindern.
• Robert Bailey und Kollegen folgern daher: "Die Beschneidung wird den größten Nutzen erzielen, wenn sie nicht als Einzelmaßnahme, sondern als Bestandteil eines ganzen Maßnahmepakets mit HIV-Schutz und familienorientierter Gesundheitsversorgung verstanden wird. Diese Maßnahmen müssen HIV-Testverfahren und Beratungen beinhalten, sexuell übertragene Infektionen diagnostizieren und behandeln, den Gebrauch von Kondomen fördern, Beratungen zum Sexualverhalten anbieten und entsprechende Veränderungen unterstützen sowie weitere als effektiv bekannte Methoden anwenden."
• In einem begleitenden Kommentar bemerken Marie-Louise Newell und Till Bärnighausen von der südafrikanischen University of KwaZulu-Natal: "Die Herausforderung besteht darin zu lernen, wie man der Öffentlichkeit vermittelt, dass trotz des reduzierten HIV-Risikos der Gebrauch von Kondomen unabdingbar ist, da beschnittene Personen weiterhin infiziert werden können."
Wer sich bei dieser Gelegenheit auf der Website der Zeitschrift "Lancet" kostenfrei registriert oder dies bereits ist, kann sämtliche Texte in voller Länge als PDF-Dateien herunterladen:
• Den 14-seitigen Originalbeitrag "Male circumcision for HIV prevention in young men in Kisumu, Kenya: a randomised controlled trial" von Baily et al. (Lancet 2007; 369: 643-56).
• Den Beitrag von Gray RH, Kigozi G, Serwadda D, et al. "Male circumcision for HIV prevention in men in Rakai, Uganda: a randomised trial" (Lancet 2007; 369: 657-666).
• Die Zusammenfassung "Male circumcision to cut HIV risk in the general population" von Newell und Bärnighausen und eine
• 6-seitige Kommentierung "Male circumcision and HIV/AIDS: challenges and opportunities" von Sawires et al..
Bernard Braun, 27.2.2007
Malaria: Informationen über eine exotisch-stille Massenkrankheit.
 "Malaria, one of the world's most common and serious tropical diseases, causes at least one million deaths every year • the majority of which occur in the most resource-poor countries. More than half of the world's population is at risk of acquiring malaria, and the proportion increases each year because of deteriorating health systems, growing drug and insecticide resistance, climate change, natural disasters and armed conflict." (Kaiser Family Foundation)
"Malaria, one of the world's most common and serious tropical diseases, causes at least one million deaths every year • the majority of which occur in the most resource-poor countries. More than half of the world's population is at risk of acquiring malaria, and the proportion increases each year because of deteriorating health systems, growing drug and insecticide resistance, climate change, natural disasters and armed conflict." (Kaiser Family Foundation)
Weitere Daten zum Auftreten und zur Behandlung dieser vielfach unterschätzten Welt-Krankheit, darunter Zahlen zur regions- und länderspezifischen Anzahl der Erkrankungs-Fälle, der Krankheitsraten pro 1000 Einwohner und der Sterbefälle, liefert die auch allgemein erneut für alle quantitativen Daten zum weltweiten Krankheits- und Versorgungsgeschehen empfohlene und von der "Kaiser Family Foundation" gesponsorte Website "globalhealthfacts.org".
Eine weitere faktenreiche Informationsquelle über die Malaria, aber auch über TB und HIV/AIDS ist der wöchentlich kostenlos erscheinende Informationsdienst "Global health reporting.org", der entweder online gelesen oder als Email bezogen werden kann. Hier finden sich neueste Daten über die Epidemiologie der Erkrankungen, ihre Behandlung, wissenschaftliche und politische Entwicklungen und entsprechende "models of good practice".
Bernard Braun, 12.12.2006
Fehl- und Überversorgung: Röntgenuntersuchung und Antibiotika bei einfachen Entzündungen der Nasennebenhöhlen
 Häufig gehören Röntgenaufnahmen der Nasennebenhöhlen und der Einsatz von Antibiotika zum Grundrepertoire oder sind ein Basispaket des Umgangs mit Patienten, die mit Symptomen einer Rhinosinusitis oder Entzündung der Nasennebenhöhlen beim Arzt auftauchen.
Häufig gehören Röntgenaufnahmen der Nasennebenhöhlen und der Einsatz von Antibiotika zum Grundrepertoire oder sind ein Basispaket des Umgangs mit Patienten, die mit Symptomen einer Rhinosinusitis oder Entzündung der Nasennebenhöhlen beim Arzt auftauchen.
Die in der Fachzeitschrift "Annals of Family Medicine" veröffentlichten Ergebnisse einer randomisierten placebokontrollierten Studie aus Belgien über den Einsatz eines Antibiotika bei mindestens 12 Jahre alten PatientInnen mit klassischen Symptomen dieser Erkrankung, zeigen zweierlei:
• Die Röntgenaufnahmen lieferten keinerlei Informationen über die Prognose bzw. den Verlauf der Erkrankung und
• das eingesetzte Antibiotika Amoxicillin beeinflusste den Verlauf der Erkrankung nicht.
Die Schlussfolgerung der Autoren lautete daher auch: "The best policy for patients with suspected rhinosinusitis - but without signs of complications or severe infection (high fever and bad pain) - is to wait for spontaneous recovery. If necessary, bothersome symptoms, such as pain or nasal obstruction, can be suppressed with treatment aimed at the symptoms. Our study did not find evidence that any signs or symptoms warrant antibiotic treatment or that radiography has added value in this setting."
Hier finden Sie die PDF-Datei des Aufsatzes "Predicting Prognosis and Effect of Antibiotic Treatment in Rhinosinusitis".
Bernard Braun, 11.12.2006
Weitere Patienten-Leitlinie des ÄZQ zu chronisch obstruktiver Lungenkrankheit (COPD) erschienen
 "Die Inhalte ärztlicher Leitlinien sind für Patienten nicht immer verständlich. Eine Lösung für dieses Problem stellen spezielle Informationen für Patienten dar, die nicht nur den Inhalt der ärztlichen Leitlinie in verständlicher Form vermitteln, sondern auch weitergehende Informationen und Hilfestellungen bieten". Dieser sicherlich zutreffenden Feststellung lässt das von der Bundesärztekammer, der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung getragene und mit für die Qualitätssicherung im deutschen Gesundheitswesen zuständige "Ärztliche Zentrum für Qualität in der Medizin" (ÄZQ) seit einiger Zeit Taten folgen.
"Die Inhalte ärztlicher Leitlinien sind für Patienten nicht immer verständlich. Eine Lösung für dieses Problem stellen spezielle Informationen für Patienten dar, die nicht nur den Inhalt der ärztlichen Leitlinie in verständlicher Form vermitteln, sondern auch weitergehende Informationen und Hilfestellungen bieten". Dieser sicherlich zutreffenden Feststellung lässt das von der Bundesärztekammer, der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung getragene und mit für die Qualitätssicherung im deutschen Gesundheitswesen zuständige "Ärztliche Zentrum für Qualität in der Medizin" (ÄZQ) seit einiger Zeit Taten folgen.
Auf der Basis der für Ärzte und andere Experten erstellten wissenschaftlichen "Nationalen Versorgungs-Leitlinien" und den Erfahrungen von Patienten werden von Ärzten und Patienten so genannte NVL-Patientenleitlinien verfasst und veröffentlicht. Eine regelmäßige Überarbeitung und Aktualisierung ist geplant.
Die jüngste Ausgabe befasst sich mit der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD. Zuvor sind bereits Patientenleitlinien zu Asthma, Depression, Typ-2-Diabetes, Herzinsuffizienz, chronisch koronare Herzkrankheit und Rückenschmerzen erschienen. Ob die beispielsweise 61 Seiten umfassende COPD-Leitlinie ebenso wie die ähnlich gestalteten anderen Leitlinien wirklich patientengerecht, d.h. verständlich und spezifisch genug ist, sollte im Rahmen der weiteren Nutzung und Entwicklung dieses generell sinnvollen Formats untersucht werden.
Alle Patientenleitlinien sind über die ÄZQ-Leitlinien-Homepage herunterladbar.
Bernard Braun, 7.12.2006
Nutzen und Grenzen von Self-Managementtechniken für Patienten: Beispiel Osteoarthritis
 Zu den Handlungstechniken, die zu einer stärkeren Aktivierung und Beteiligung von Patienten an der Behandlung ihrer Erkrankungen gehören, zählt das so genannte self-management. Dass es sich dabei nicht um eine reine "Wohlfühlangelegenheit" handelt, sondern diese Techniken die Wirksamkeit der Behandlung spür- und messbar erhöhen, zeigen die im Oktober 2006 im "British Medical Journal"(BMJ) veröffentlichten Ergebnisse einer randomisierten kontrollierten Studie zum "Self management of osteoarthritis in primary care" (BMJ 2006; 333; 879-883) bei über 800 britischen Patienten.
Zu den Handlungstechniken, die zu einer stärkeren Aktivierung und Beteiligung von Patienten an der Behandlung ihrer Erkrankungen gehören, zählt das so genannte self-management. Dass es sich dabei nicht um eine reine "Wohlfühlangelegenheit" handelt, sondern diese Techniken die Wirksamkeit der Behandlung spür- und messbar erhöhen, zeigen die im Oktober 2006 im "British Medical Journal"(BMJ) veröffentlichten Ergebnisse einer randomisierten kontrollierten Studie zum "Self management of osteoarthritis in primary care" (BMJ 2006; 333; 879-883) bei über 800 britischen Patienten.
Verglichen wurde die Interventions-Gruppe, die neben einer Basisinformation an einem Self-Management-Kurs teilnahm mit einer anderen Gruppe, die lediglich eine Informationsbroschüre zu ihrer Erkrankung erhielt. Eine Überprüfung der Wirkungen erfolgte durch Befragungen zu Beginn der Studie sowie nach 4 und 12 Monaten.
Die Ergebnisse sind differenziert, eindeutig aber nicht sonderlich stark ausgeprägt: Patienten, die Selbstmanagementtechniken lernten, hatten weniger Angst und ein besseres Gefühl, ihre Symptome im Griff zu haben (Selbstwirksamkeitsüberzeugung) als die Mitglieder der Kontrollgruppe. Insgesamt wurde das psychische Wohlbefinden statistisch signifikant positiv beeinflusst.
Obwohl die Angehörigen der Interventionsgruppe zuversichtlicher waren ihre Schmerzen und andere Arthritissymptome "managen" zu können, litten sie aber nicht weniger an Schmerzen als die Angehörigen der Kontrollgruppe. Außerdem gab es keine Vorteile der Self-Managementpatienten für ihre körperliche Funktionsfähigkeit und auch nicht weniger Primärarztkontakte nach 12 Monaten.
Hier finden Sie die frei downloadbare PDF-Datei des Aufsatzes.
Bernard Braun, 12.11.2006
Blutdrucksenkung durch Gewichtsreduktion: Nutzen ungewiss, aber Diäten wirksamer als Medikamente
 Zu den zahlreichen Methoden, die als gesundheitlich folgenreich bewertete essentielle oder primäre Hypertonie (ein Bluthochdruck für den man keine Ursache feststellen kann) zu beeinflussen, gehört die Abnahme des Körpergewichts durch Diät und Medikamente. In dem gerade vorgelegten Bericht des "Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG)" für den "Gemeinsamen Bundesausschuss zum Thema "Nutzenbewertung nichtmedikamentöser Behandlungsstrategien bei Patienten mit Bluthochdruck: Gewichtsreduktion", finden sich einige erhebliche Irritationen mancher der weitverbreiteten Gewissheit über diese Zusammenhänge.
Zu den zahlreichen Methoden, die als gesundheitlich folgenreich bewertete essentielle oder primäre Hypertonie (ein Bluthochdruck für den man keine Ursache feststellen kann) zu beeinflussen, gehört die Abnahme des Körpergewichts durch Diät und Medikamente. In dem gerade vorgelegten Bericht des "Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG)" für den "Gemeinsamen Bundesausschuss zum Thema "Nutzenbewertung nichtmedikamentöser Behandlungsstrategien bei Patienten mit Bluthochdruck: Gewichtsreduktion", finden sich einige erhebliche Irritationen mancher der weitverbreiteten Gewissheit über diese Zusammenhänge.
So liegen
• zum einen keine qualitativ hochwertigen Studien vor, die belegen, dass Menschen mit essentiellem Hochdruck durch Gewichtsreduktion seltener an einer der vielen prognostizierten Folgeerkrankungen erkranken.
• Noch interessanter: Wer trotzdem sein Körpergewicht durch Diäten reduziert, senkt seinen Blutdruck stärker als jemand, der dazu eines der dafür auf dem Markt befindlichen Medikamente benutzt.
Was dieser Bericht ferner zeigt, ist erneut ein erschreckender Mangel an zuverlässigen Belegen für die Stimmigkeit weitverbreiteter Vorstellungen und Erklärungen und den Nutzen alter und neuer Therapien. Trotz einer jahrzehntelangen Debatte um Rationalisierung bei nicht notwendigen und nützlichen Leistungen statt der Rationierung medizinisch notwendiger, geht zum ersten Mal das IQWiG u.a. durch die Identifikation von Forschungslücken daran, Grundlagen für rationale Entscheidungen zu schaffen.
Hier finden Sie die PDF-Datei: Gutachten des IQWiG.
Bernard Braun, 6.11.2006
Fehlversorgung bei Krampfaderoperationen
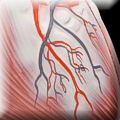 Auch wenn sich die Gesundheitspolitik aktuell wieder sehr stark der Finanzierungsseite des Gesundheitssystems zuwendet, zeigen veröffentlichte Studienergebnisse über die Versorgungsqualität regelmäßig die mindest gleichrangige aber vernachlässigte gesundheitspolitische Bedeutung von Über-, Unter- und Fehlversorgung.
Auch wenn sich die Gesundheitspolitik aktuell wieder sehr stark der Finanzierungsseite des Gesundheitssystems zuwendet, zeigen veröffentlichte Studienergebnisse über die Versorgungsqualität regelmäßig die mindest gleichrangige aber vernachlässigte gesundheitspolitische Bedeutung von Über-, Unter- und Fehlversorgung.
Aktuelles Beispiel ist die Qualität der jährlich bei rund 320.000 Patienten durchgeführten Krampfaderoperationen, die in einer nicht repräsentativen aber deutschlandweiten und am 17.10.2006 von der Ruhr-Universität Bochum veröffentlichten Studie in 7 Venenzentren unter Leitung der Kliniken für Dermatologie und Gefäßchirurgie der Ruhr-Universität Bochum genauer untersucht wurde. Qualitätsmängel und Fehlversorgung zeigen sich daran, dass ein Fünftel aller stationär an Krampfadern operierten Patienten mindestens ein zweites Mal operiert werden muss. Bei 67 % dieser Patienten war die Ausführung der ersten Operation mangelhaft und zwar deshalb, weil beim ersten Eingriff die krankhaft veränderte Vene nicht vollständig entfernt wurde. Diese Defizite scheinen bundesweit vrzuliegen. Ob der Hinweis der Forschungsgruppe, Krampfadern nur noch durch erfahrene Operateure operieren zu lassen, wirklich die Qualitätsprobleme beseitigt, müsste noch getrennt nachgewiesen werden.
Bernard Braun, 2.11.2006
Mängel bei der leitliniengerechten Behandlung von Herzinsuffizienz in Deutschland
 Ein aktuelles aber keineswegs seltenes Beispiel für die erhebliche Diskrepanz zwischen dem in Leitlinien für die Diagnose und Therapie von Krankheiten zusammengefassten gesicherten Wissen über wirksame Maßnahmen und dem Versorgungsalltag findet sich in einem in Heft 39 (September 2005) der "Deutschen Medizinischen Wochenschrift (DMW)" veröffentlichten Aufsatz über die Diagnose und Behandlung der an Herzinsuffizienz erkrankten Menschen in Deutschland (rund 800.000 Personen) und 5 anderen europäischen Ländern.
Ein aktuelles aber keineswegs seltenes Beispiel für die erhebliche Diskrepanz zwischen dem in Leitlinien für die Diagnose und Therapie von Krankheiten zusammengefassten gesicherten Wissen über wirksame Maßnahmen und dem Versorgungsalltag findet sich in einem in Heft 39 (September 2005) der "Deutschen Medizinischen Wochenschrift (DMW)" veröffentlichten Aufsatz über die Diagnose und Behandlung der an Herzinsuffizienz erkrankten Menschen in Deutschland (rund 800.000 Personen) und 5 anderen europäischen Ländern.
Nach dieser so genannten MAHLER-Studie (für "Medical Management of chronic heart failure in Europe and its related costs") verhalten sich gerade einmal 67 Prozent der deutschen Fachärzte bei der Diagnose leitliniengerecht und liegen damit vor den britischen Fachärzten auf dem vorletzten Platz. Bei der ausgeprägt medikamentösen Behandlung hielten sich nur noch 60 Prozent der deutschen Kardiologen an die Leitlinien. Nur weil sich ihre Fachkollegen in den anderen Ländern fast durchweg noch weniger an die Behandlungs-Leitlinien halten, liegen die deutschen Ärzte hier an zweiter Stelle. Die hauptsächlich beobachtete enorme Zurückhaltung bei der Verordnung bestimmter, zur ambulanten Therapie empfohlenen Arzneimittel, trägt nach Meinung der Berichterstatter maßgeblich zu einer deutlich erhöhten Häufigkeit stationärer Aufenthalte wegen Herzinsuffizienz bei. Die Zahl der Einweisungen war in Deutschland beispielsweise doppelt so hoch wie in den Niederlanden. Es ist nicht ausgeschlossen, dass einige Patienten möglicherweise ohne zwingenden Grund in der Klinik behandelt werden.
Hier, wie in zahlreichen vergleichbaren Fällen der Unkenntnis von Leitlinien oder der Ignoranz der dort gemachten Vorschläge oder Empfehlungen (also keineswegs zwingende und sanktionierte Vorschriften), führt offensichtlich eine noch so gut erreichbare und eindeutige Wissensbasis nicht automatisch oder rasch zu den erhofften Qualitätsverbesserungen. Spezielle Überlegungen zu verbesserten Strategien der Wissensvermittlung und Methoden der Verhaltensänderung von Ärzten und evtl. Patienten müssen ein integraler Bestandteil von Versuchen sein, durch Leitlinien die Versorgungsqualität zu verbessern.
Hier finden Sie ein Abstract des Studienberichts
Bernard Braun, 24.10.2005
Versorgungsforschung: Wirksamkeit von Grippeschutzimpfung für Ältere meist "bescheiden"
 Manche gesundheitsbezogenen Aktivitäten und Maßnahmen erscheinen derart selbstverständlich, plausibel und gesundheitsförderlich, dass ihre Wirkung und Existenzberechtigung gar nicht mehr hinterfragt werden. Ein Paradebeispiel ist die Grippeschutzimpfung für ältere Personen, die ohne Einschränkung "weltweit empfohlen" wird.
Manche gesundheitsbezogenen Aktivitäten und Maßnahmen erscheinen derart selbstverständlich, plausibel und gesundheitsförderlich, dass ihre Wirkung und Existenzberechtigung gar nicht mehr hinterfragt werden. Ein Paradebeispiel ist die Grippeschutzimpfung für ältere Personen, die ohne Einschränkung "weltweit empfohlen" wird.
Ob dies berechtigt ist oder ob es sich möglicherweise um eine Fehlversorgung oder eine hohle Versprechung handelt, wollten nun aber doch Wissenschaftler (Jefferson, T.; Rivetti, D. et al.) durch einen systematischen Review der medizinischen Studien überprüfen, die sich mit der Wirksamkeit dieser Impfung bei Personen über 65 Jahren beschäftigten.
Die gerade unter dem Titel "Efficacy and effectiveness of influenza vaccines in elderly people: a systematic review" in der Fachzeitschrift "Lancet" (The Lancet 2005; 366:1165-1174) veröffentlichten Ergebnisse dämpfen die populären Erwartungen beträchtlich und sind außerdem von sehr spezifischer Art:
• Nachweisbar hochwirksam ist danach eine Grippeschutzimpfung nur bei älteren Personen, die in Alten- und Pflegeheimen leben. Zumindest zum Teil hilft sie dort gegen die mit einer Grippe verbundenen Komplikationen.
• Für ältere Personen, die nicht pflegebedürftig sind und in Privathaushalten leben, war der Nutzen der Impfung dagegen insgesamt nur bescheiden ("modest") und auch nicht immer nachweisbar.
Wer zusätzlich zum kostenlosen englischsprachigen Abstract der Studie auch noch den Volltext ebenfalls kostenlos als PDF-Datei lesen will, kann dies nach einer kurzen Anmeldung auf der Homepage der Zeitschrift machen. Danach kann ein Teil der im "Lancet" veröffentlichten Arbeiten auch zukünftig kostenlos als Abstract und Langtext heruntergeladen werden.
Bernard Braun, 9.10.2005