



Home | Patienten | Gesundheitssystem | International | GKV | Prävention | Epidemiologie | Websites | Meilensteine | Impressum
Sämtliche Rubriken in
"Prävention"
Früherkennung, Screening |
Alle Artikel aus:
Prävention
Früherkennung, Screening
Resistenz gegenüber schlechter Beratung durch evidenzbasierte Informationen
 Die große Mehrzahl der Ärzte und Ärztinnen kennen bzw. verstehen die Prinzipien der (Krebs-)Früherkennung nicht, wie Studien einhellig zeigen, von denen wir eine Reihe im Forum in der Rubrik Früherkennung, Screening dokumentieren. Diese Prinzipien sind in diesen Lehrvideos dargelegt: Krankheitsfrüherkennung Teil 1 und Teil 2. Logischerweise kann die Beratung durch Ärzte, die diese Prinzipien nicht kennen bzw. verstanden haben, nur unzulänglich sein.
Die große Mehrzahl der Ärzte und Ärztinnen kennen bzw. verstehen die Prinzipien der (Krebs-)Früherkennung nicht, wie Studien einhellig zeigen, von denen wir eine Reihe im Forum in der Rubrik Früherkennung, Screening dokumentieren. Diese Prinzipien sind in diesen Lehrvideos dargelegt: Krankheitsfrüherkennung Teil 1 und Teil 2. Logischerweise kann die Beratung durch Ärzte, die diese Prinzipien nicht kennen bzw. verstanden haben, nur unzulänglich sein.
In einer Studie mit 897 Personen wurde getestet, ob korrekte Informationen vor unzureichender Beratung schützen.
In persönlichen Gesprächen erhielten 897 Personen, die aus dem Sozio-oekonomischen Panel rekrutiert wurden, entweder evidenzbasierte (z.B. absolute Risiken von Nutzen und Schäden) oder nicht-evidenzbasierte Informationen (z.B. relative Risiken von Nutzen und Schäden). Die genauen Formulierungen finden sich im Studienprotokoll.
Beide Arten von Information wurden aus tatsächlichen Patienteninformationsmaterialien entnommen.
Im Anschluss gaben die Probanden ihre Entscheidung für oder gegen die Teilnahme an der Früherkennungsuntersuchung an.
Im nächsten Schritt erhielten alle Teilnehmer einseitige und nicht-evidenzbasierte Empfehlungen für oder gegen die Früherkennungsuntersuchung und sollten sich vorstellen, dass diese von ihrem eigenen Arzt kämen. Dabei handelte es sich um realen Empfehlungen aus dem ärztlichen Alltag. Nach Erhalt dieser unzulänglichen ärztlichen Empfehlung sollten die Probanden ihre Entscheidung neu treffen.
Probanden, die im ersten Schritt unzureichend (nicht-evidenzbasiert) informiert wurden und eine Entscheidung getroffen hatten, die im Widerspruch zur Empfehlung des imaginierten Arztes stand, änderten 33% ihre Entscheidung im Sinne der (unzulänglichen) Arztempfehlung. Bei gut (evidenz-basiert) Informierten betrug dieser Anteil nur 16%.
Initial gut informierte Probanden erwiesen sich also als relativ resistent gegenüber schlechten Empfehlungen, die hier von einem imaginierten Arzt gegeben wurden.
Die Stärke der Studie liegt darin, erstmals die Reaktion von vorab gut bzw. schlecht informierten Probanden auf schlechte Empfehlungen untersucht zu haben. Eine Verallgemeinerung ist dadurch beschränkt, dass das Arztgespräch einem hypothetischen Szenario entsprach, dass einen realen Arzt-Patient-Kontakt nicht realistisch wiedergeben kann. Allerdings dürfte die Durchführung einer entsprechenden Untersuchung im klinischen Setting kaum möglich sein.
Das Fazit lautet also, dass sich die meisten Personen, die gut über Krankheitsfrüherkennung informiert waren, sich durch schlechte Beratung nicht beirren ließen.
Wegwarth O, Wagner GG, Gigerenzer G. Can facts trump unconditional trust? Evidence-based information halves the influence of physicians' non-evidence-based cancer screening recommendations. PLOS ONE. 2017;12(8):e0183024. Link
Evidenzbasierte Entscheidungshilfen (nicht nur) für Krankheitsfrüherkennungs-Untersuchungen bietet das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) hier auf seiner Website www.gesundheitsinformation.de
Das Harding-Zentrum für Risikokompetenz bietet Faktenboxen zu einem breiten Themenspektrum, u.a. zur Früherkennung von Brustkrebs, Eierstockkrebs, Prostatakrebs und Darmkrebs.
David Klemperer, 26.5.20
Digitale rektale Prostata-Untersuchung wegen Risiko von Über-/Fehldiagnostik nicht empfehlenswert, nur was sind die Alternativen?
 Die als "unangenehm" empfundene Untersuchung der Prostata mittels des in den After eingeführten Fingers des Urologen als Bestandteil der Früherkennungsuntersuchung auf ein Prostatakarzinom hindert wahrscheinlich Millionen von Männern, das Früherkennungsangebot in Anspruch zu nehmen. Viele Männer dürften aber auch versuchen, ihre Prostatagesundheit lediglich durch den via Blutprobe ermittelbaren PSA-Wert (Bestimmung eines prostataspezifischen Antigens) bestimmen zu lassen - selbst wenn sie von den Schwächen der Prädiktivität dieses Wertes schon einmal gehört haben. Hauptsache nicht "diese Untersuchung".
Die als "unangenehm" empfundene Untersuchung der Prostata mittels des in den After eingeführten Fingers des Urologen als Bestandteil der Früherkennungsuntersuchung auf ein Prostatakarzinom hindert wahrscheinlich Millionen von Männern, das Früherkennungsangebot in Anspruch zu nehmen. Viele Männer dürften aber auch versuchen, ihre Prostatagesundheit lediglich durch den via Blutprobe ermittelbaren PSA-Wert (Bestimmung eines prostataspezifischen Antigens) bestimmen zu lassen - selbst wenn sie von den Schwächen der Prädiktivität dieses Wertes schon einmal gehört haben. Hauptsache nicht "diese Untersuchung".
Nach der aktuellen Veröffentlichung einer Metaanalyse von 7 Studien (aus 8.217 themenbezogenen Studien) mit 9.142 Teilnehmern, die sowohl eine "digital rectal examination (DRE)" bei einem Primärarzt als auch in deren Folge eine Biopsie ihrer Prostata hinter sich haben, ergibt sich folgendes Bild:
• Die zusammengefasste Sensitivität betrug 0,51, d.h. nur 51% der tatsächlich erkrankten Personen werden durch die DRE-Untersuchung erkannt.
• Die zusammengefasste Spezifität der DRE betrug 0,59, d.h. es wurden 59% der tatsächlich gesunden Personen als solche identifiziert. In diesem Fall werden also gesunde Personen z.B. weiter mittels der invasiven Biopsie untersucht, also ohne Not psychisch belastet und den zahlreichen Risiken der Gewebeentnahme (z.B. Inkontinenz, erektile Dysfunktion) ausgesetzt.
• Der für die Leistungsfähigkeit von Tests wie der DRE berechenbare positive oder negative prädiktive Wert betrug 0,41 bzw. 0,64 - beides relativ geringe Werte.
• Die Qualität der Evidenz in den berücksichtigten Studien ist sehr gering.
Wegen der drohenden Über- oder Fehldiagnostik kommen die AutorInnen zu folgendem Schluss: "we do not recommend routine screening for prostate cancer using DRE in primary care, so as to minimize unnecessary diagnostic testing, overdiagnosis, and overtreatment."
Auch wenn damit die DRE als Screeninguntersuchung ausscheidet oder vermieden werden sollte, bleibt die Frage wie Männer sich angesichts regelmäßiger Berichte über Prostatakarzinome zu einem frühstmöglichen Zeitpunkt vergewissern können, ob ihre Prostata noch gesund ist oder nicht.
Der Aufsatz Digital Rectal Examination for Prostate Cancer Screening in Primary Care: A Systematic Review and Meta-Analysis von Leen Naji et al. ist im März 2018 in der Fachzeitschrift "Annals of Family Medicine" (vol. 16 no. 2: 149-154) erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 19.3.18
Wie häufig ist die Überversorgung mit nutzlosen oder schädlichen Leistungen und wie viel kostet das? Antworten aus WA und VA (USA)
 Über- und Fehlversorgung mit gesundheitlich nicht notwendigen, im besten Fall nutzlosen, im schlimmsten Fall aber für die PatientInnen schädlichen diagnostischen Tests und therapeutischen Interventionen ist eines der international wie national seit vielen Jahren beschriebenen (Haupt-)Probleme der Gesundheitssysteme entwickelter Länder.
Über- und Fehlversorgung mit gesundheitlich nicht notwendigen, im besten Fall nutzlosen, im schlimmsten Fall aber für die PatientInnen schädlichen diagnostischen Tests und therapeutischen Interventionen ist eines der international wie national seit vielen Jahren beschriebenen (Haupt-)Probleme der Gesundheitssysteme entwickelter Länder.
Bei aller Einigkeit wird die Anzahl der davon Betroffenen und der finanzielle Umfang der Überversorgung aber unterschiedlich bewertet, wenn dazu überhaupt halbwegs präzise Zahlen genannt werden.
Hier etwas Abhilfe zu schaffen, war das Anliegen einer Untersuchung der Behandlungsdaten von rund 2,4 Millionen bei privaten Krankenversicherungen versicherten Personen im US-Bundesstaat Washington im Zeitraum von Juli 2015 bis Juni 2016. Für diese Personen wurde mittels des Analyseinstruments "Health Waste Calculator" untersucht, wie häufig 47 diagnostische und therapeutische Leistungen erbracht wurden, die im Rahmen der "choosing wisely"-Initiative zahlreicher us-amerikanischen medizinischen Fachgesellschaften als potenziell unnütz oder schädlich bewertet wurden. Die Liste der Leistungen reicht von der wahllosen Verordnung von Antibiotika bei komplikationslosen Infektionen der oberen Atemwege über die Erstellung von Elektrokardiogrammen (EKG) bei symptomlosen und "low risk"-Patienten bis zu arthroskopischen Operationen zur Behandlung von Knien mit Osteoarthritis (die gesamte Liste findet sich im Anhang der hier vorgestellten Studie). Auf Basis der gesamten Behandlungsdaten wurde für jede dieser Leistungen bewertet, ob sie nützlich oder klinisch angemessen, wahrscheinlich verschwenderisch oder unangemessen oder sehr wahrscheinlich nicht notwendig bzw. Verschwendung war.
Die wichtigsten Ergebnisse lauten:
• 1,298 Millionen Personen erhielten eine oder mehrere der 47 Leistungen. 46,4% von ihnen erhielten Leistungen, die eindeutig unangemessen waren. Bei weiteren 1,5% waren sie wahrscheinlich unangemessen.
• Von den 758 Millionen US-Dollar, die sämtliche 47 Leistungen kosteten, wurden 32,9% für eindeutig unangemessene Leistungen ausgegeben.
• 11 der 47 Leistungen wurden als Schlüsselleistungen der Überversorgung bewertet. Darunter waren zu häufige Screenings auf Gebärmutterhalskrebs und alle bildgebenden Untersuchungen bei komplikationslosen Kopfschmerzen. Diese 11 Leistungen trugen zu 93% aller wahrscheinlich oder gesichert geringwertigen oder nutzlosen Leistungen bei. 578.503, also rund ein Viertel der 2,4 Millionen in der Studie betrachteten Personen erhielten mindestens eine dieser 11 Leistungen.
• So wurden ungefähr drei von vier jährlichen Screeninguntersuchungen auf Gebärmutterhalskrebs bei Frauen durchgeführt, die bereits vorher angemessen untersucht worden waren.
• Rund 85% aller Labortests, gesunde Patienten auf geringfügige und risikofreien Operationen vorzubereiten waren nicht notwendig.
• Bei 35% der 103.332 Personen, die screeningmäßig auf einen Vitamin D-Mangel untersucht wurden, war diese Untersuchung mangels Indikation völlig nutzlos und reine Verschwendung von 12 Millionen US-Dollar.
Weitere Beispiele für Überversorgung, aber auch Hinweise auf Limitationen der Daten und Vorschläge für das weitere Vorgehen finden sich in dem 27 Seiten umfassenden und im Februar 2018 veröffentlichten Bericht First, Do No Harm. Calculating Health Care Waste in Washington State erstellt von der "Washington Health Alliance" und der "Choosing Wisely initiative in Washington state", der komplett kostenlos erhältlich ist.
Für das weitere Vorgehen schlagen die VerfasserInnen der Studie u.a. vor:
• "The concepts of "choosing wisely" and shared decision-making must become the bedrock of provider-patient communications.
• We need to keep our collective "foot on the gas" to transition from paying for volume to paying for value in health care.
• Value-based provider contracts must include measures of overuse, and not just measures of access and underuse of evidence-based care."
Wer jetzt vielleicht meint, diese Verhältnisse seien regionaler Art oder in Washington State gäbe es eben viele "schwarze Schafe", muss diesen Gedanken zumindest für die USA aufgeben.
Beim einem vergleichbaren Einsatz des "Health Waste Calculator" bei 5,5 Millionen bei privaten Krankenversicherungen aber auch bei den öffentlichen Versicherungen Medicare und Medicaid versicherten Personen im US-Bundesstaat zeigte sich, dass 2014 1,7 Millionen Personen nutzlose Leistungen erhielten. Die Überversorgungs- oder Verschwendungsrate betrug 31%. Der Aufsatz Low-Cost, High-Volume Health Services Contribute The Most To Unnecessary Health Spending von John N. Mafi et al. ist im Oktober 2017 in der Zeitschrift "Health Affairs" (10: 1701-1704) erschienen. Ein Abstract ist kostenlos erhältlich.
Ob die Überversorgungsrate in Deutschland gleich hoch ist oder derartiges im "besten Gesundheitssystem der Welt" nicht existiert, lässt sich abschließend erst nach inhaltlich vergleichbaren Untersuchungen mit Abrechnungsdaten der GKV und der PKV beantworten. Die hohen Raten von sofortigen bildgebenden Untersuchungen bei Rückenschmerzen oder die immer noch große Anzahl von Antibiotikaverordnungen bei Atemwegsinfektionen sollten aber Anlass sein genauso intensiv hinzuschauen wie in Washington und Virginia.
Zum Schluss: Wie gesamte Überversorgungsraten aussehen, wenn also nicht nur die 47 Leistungen, sondern alle gesundheitsbezogen erbrachten Leistungen berücksichtigt würden, muss erst in umfassenderen Untersuchungen ermittelt werden.
Bernard Braun, 4.2.18
Mammografie-Screening: Häufige Überdiagnosen als gravierender Kollateralschaden
 Gilbert Welch vom Dartmouth Institute for Health Policy and Clinical Practiceund Kollegen haben jetzt die Frage untersucht, wie sich das Brustkrebs-Screening durch Mammographie bei Frauen ab 40 Jahren auf die Zahl und die Größe der gefundenen Tumoren auswirkt.
Gilbert Welch vom Dartmouth Institute for Health Policy and Clinical Practiceund Kollegen haben jetzt die Frage untersucht, wie sich das Brustkrebs-Screening durch Mammographie bei Frauen ab 40 Jahren auf die Zahl und die Größe der gefundenen Tumoren auswirkt.
Dafür haben sie für einen Zeitraum vor (1975-1979) und nach (2000-2002) Einführung der Brustkrebsfrüherkennung die jährlich neu aufgetretenen Fälle (Inzidenz), die Tumorgröße und die Sterblichkeit verglichen.
Die erforderlichen Daten entnahmen sie dem amerikanischen Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) program . SEER ist eine Einrichtung des National Cancer Institute, das epidemiologische Informationen über Krebs in den USA sammelt und zur Verfügung stellt.
Das Fazit der Studie lautet:
Auf der Nutzenseite mindert das Brustkrebs-Screening die Sterblichkeit an Brustkrebs durch Minderung der Zahl großer Tumoren und der früher einsetzender Therapie (8 Brustkrebs-Todesfälle pro 100.000 Frauen weniger also ohne Screening).
Größer ist die Minderung der Sterblichkeit durch verbesserte Therapie bei gegebener Tumorgröße (17 Brustkrebs-Todesfälle pro 100.000 Frauen weniger als bei Therapiestandard 1975-1980).
Auf der Schadenseite beträgt die Überdiagnose 132 kleine Tumoren pro 100.000 Frauen - da bislang die Tumoren, die schnell, langsam oder gar nicht wachsen, nicht unterschieden werden können, dürften die meisten Patientinnen eine letztlich überflüssige Behandlung erhalten. erhalten.
Ebenfalls auf der Schadenseite stehen die - wenig beachteten -psychologischen Folgen der Krebsdiagnose wie auch der falsch-positiven Screening-Ergebnisse (wir berichteten).
Im Einzelnen lauten die wichtigsten Ergebnisse:
• Die Inzidenz großer Tumoren (ab 2 cm) sank von 145 (1975-1979) auf 115 (2000-2002) pro 100.000 Frauen, also um 30 Fälle pro 100.000 Frauen
• Die Inzidenz kleiner Tumoren (unter 2 cm) stieg von 82 (1975-1979) auf 244 (2000-2002) pro 100.000 Frauen, also um um 162 Fälle pro 100.000 Frauen
Die Häufigkeit pro 100.000 Frauen von Tumoren einer Größe sank
• ab 5 cm von 29 auf 25
• von 3,0 bis 4,9 cm von 56 auf 38
• von 2,0 bis 2,9 cm von 60 auf 52
Dem steht gegenüber der Anstieg der Häufigkeit pro 100.000 Frauen von Tumoren einer Größe
• von 1,0 bis 1,9 cm von 59 auf 99
• weniger als 1 cm von 13 auf 66
• In-situ-Karzinom von 10 auf 79
Daraus folgt: Das Screening hat
• die Zahl großer Tumoren gesenkt (um 30 pro 100.000 Frauen) und
• die Zahl kleiner Tumoren erhöht (um 162 pro 100.00).
Konstante Bedingungen angenommen, lässt sich daraus folgern, dass nur 30 der 162 zusätzlichen kleinen Tumoren zu großen Tumoren werden - 132 kleine Tumoren stellen Überdiagnosen dar - sie bleiben klein und würden nie auffällig werden.
Die Minderung der Zahl großer Tumoren ist eine notwendige aber nicht hinreichende - also allein nicht ausreichende - Bedingung für den Erfolg von Screening, denn es geht ja um die Senkung der Brustkrebstodesfälle (und um die Senkung der Gesamtmortalität). Ein weiteres notwendiges Erfolgskriterium ist daher die höhere Effektivität bei früher - durch Screening - diagnostizierten Tumoren im Vergleich zu später - bei Auftreten von Symptomen - diagnostizierten Tumoren.
Bei der verminderten Mortalität ist zu bedenken, inwieweit sie effektiverer Behandlung geschuldet ist.
Hinweise auf eine verbesserte Effektivität bei gegebener Tumorgröße gibt die jeweilige Sterblichkeitsrate ("Size-specific case fatality rate") für eine Nachbeobachtungszeit von 10 Jahren, die tatsächlichin den Jahren 2000-2002 niedriger ist als 1970-1975.
Die Sterblichkeit pro 100.000 Frauen betrug für Tumoren einer Größe
• ab 5 cm vor Einführung des Screenings 55%, danach 43%%
• von 3,0 bis 4,9 cm vor Einführung des Screenings 39%, danach 27%
• von 2,0 bis 2,9 cm vor Einführung des Screenings 28%, danach 16%.
Die Autoren kalkulieren, dass pro 100.000 Frauen vermieden werden:
• 8 Todesfälle durch das Screening
• 17 Todesfälle durch die effektivere Therapie.
Somit sind 2/3 der Minderung der Sterblichkeit auf die verbesserte Therapie und 1/3 auf das Screening zurückzuführen.
Die 10-Jahresüberlensrate für Patientinnen mit einem Tumor von weniger als 1 cm oder einem In-situ-Tumor ist interessanterweise höher als die von gleichaltrigen Frauen ohne Krebserkrankung.
Welch HG, Prorok PC, O'Malley AJ, Kramer BS: Breast-Cancer Tumor Size, Overdiagnosis, and Mammography Screening Effectiveness. New England Journal of Medicine 2016, 375(15):1438-1447. Abstract
siehe auch im Forum Gesundheitspolitik:
Mammografie-Screening 1: Nutzen fraglich, wenn dann bestenfalls gering Link
Mammografie-Screening 2: Gynäkologen schlecht informiert über Nutzen und Risiken Link
Mammografie-Screening 3: Frauen schlecht informiert über Nutzen und Risiken Link
David Klemperer, 3.11.16
Neues vom PSA-Screening Teil 2 von 2 - Früh erkannter Prostatakrebs: Komplikationen häufig bei aktiver Behandlung
 In Teil 1 (Früh erkannter Prostatakrebs: Sterblichkeit gering ohne und mit Behandlung) wurden die Ergebnisse der randomisierten kontrollierten ProtecT-Studie zur Therapie des durch Screening erkannten Prostatakrebses dargelegt. Gerade 1 Teilnehmer von 100 war nach 10 Jahren an den Folgen des Prostatakrebses gestorben und zwar unabhängig davon, ob er operiert, bestrahlt oder nicht behandelt wurde.
In Teil 1 (Früh erkannter Prostatakrebs: Sterblichkeit gering ohne und mit Behandlung) wurden die Ergebnisse der randomisierten kontrollierten ProtecT-Studie zur Therapie des durch Screening erkannten Prostatakrebses dargelegt. Gerade 1 Teilnehmer von 100 war nach 10 Jahren an den Folgen des Prostatakrebses gestorben und zwar unabhängig davon, ob er operiert, bestrahlt oder nicht behandelt wurde.
In einer 2. Veröffentlichung wurden weitere aus Sicht der Patienten bedeutsame Ergebnisse (patient-reported outcomes) der ProtecT-Studie berichtet.
Verglichen wurden erneut die Gruppen
• Aktive Beobachtung
• Operative Entfernung der Prostata
• Bestrahlungstherapie in Verbindung mit einer Hormontherapie
Studienteilnehmer beantworteten einen Fragebogen zur Blasen-, Darm- und Sexualfunktion, zu spezifischen Auswirkungen auf die Lebensqualität, zu Angst, Depressivität und zur allgemeinen Gesundheit. Sie erhielten den Fragebogen vor Diagnosestellung, 6 und 12 Monate nach der Randomisation (Zuordnung zur jeweiligen Gruppe) und in der Folge jährlich. Ausgewertet wurde jetzt eine Nachbeobachtungszeit von 6 Jahren. Mit 85% war die Antwortquote hoch.
Im Vergleich der 3 Gruppen trat Inkontinenz nach Prostataentfernung am häufigsten auf: die Benutzung von Inkontinenzeinlagen stieg von 1% vor der Operation auf 46% nach 6 Monaten und sank auf 17% nach 6 Jahren. Bei Bestrahlung lag der Anteil nach 6 Monaten bei 6% und nach 6 Jahren 4%, bei Beobachtung nach 6 Monaten bei 4% und nach 6 Jahren bei 8%.
Auch die sexuelle Funktion war bei der Prostataentfernung am stärksten beeinträchtigt. Schlechter schnitten die operierten Männer bei Maßen ab wie "Erektionsstärke ausreichend für Geschlechtsverkehr", Impotenz und sexuelle Lebensqualität. Vor der Therapie berichteten 67% aller Männer über ausreichende Erektionsstärke, nach 6 Monaten war die Rate auf 12% bei Prostataentfernung gefallen, auf 22% bei Bestrahlung und auf 52% bei Beobachtung. Nach 6 Jahren waren 17% der Patienten nach Prostataentfernung zum Geschlechtsverkehr in der Lage, in der Bestrahlungsgruppe 27% und in der Beobachtungsgruppe 30%.
Die Bestrahlung führte zu etwas höheren Raten an Darmproblemen, wie Blut im Stuhl und bei den Betroffenen zu einer etwas geminderten Lebensqualität.
Der Vergleich der gesundheitsbezogenen körperlichen und psychischen Lebensqualität zeigte keine statistisch signifikanten Unterschiede zwischen den 3 Gruppen .
Zusammenfassend führt die Prostataentfernung am häufigsten zu Impotenz und Inkontinenz, die Bestrahlung kann in eher seltenen Fällen zu Darmproblemen führen. Die Patienten der Beobachtungsgruppe hatten im Vergleich die geringste Rate an Problemen. Die Lebensqualität unterschied sich interessanterweise nicht. Dies könnte dadurch zu erklären sein, dass sich die Patienten mit Inkontinenz bzw. Impotenz in ihr Schicksal fügen.
Diese Studie dürfte die bisher verlässlichsten Daten über die unerwünschten Auswirkungen von Prostataentfernung und Bestrahlung im Vergleich zur aktiven Beobachtungergeben erbracht haben.
Aus Sicht des Autors dieses Beitrags unterstreichen die Ergebnisse der ProtecT-Studie die Strategie, darauf zu verzichten, Männern das PSA-Screening aktiv anzubieten. Bei Nachfrage durch den Patienten sollte er mit einer strukturierten Entscheidungshilfe die wesentlichen Informationen erhalten und bei weiter bestehendem Wunsch schriftlich erklären, dass er weiß, worauf er sich einlässt. Für solch eine Entscheidungshilfe liefert die ProtecT-Studie wichtige Informationen.
Donovan JL, Hamdy FC, Lane JA, et al. Patient-reported outcomes after monitoring, surgery, or radiotherapy for prostate cancer. N Engl J Med 2016; 375:1425-37 Abstract
David Klemperer, 27.10.16
Neues vom PSA-Screening Teil 1 von 2 - Früh erkannter Prostatakrebs: Sterblichkeit gering ohne und mit Behandlung
 Den neuesten Daten zufolge erkrankten im Jahr 2012 in Deutschland 63.710 Männer an Prostatakrebs und 12.957 starben daran. Damit ist Prostatakrebs die häufigste Krebsart bei Männern, mit Abstand gefolgt von Lungenkrebs, an dem 2012 34.490 Männer erkrankten und 29.713 verstarben (Frauen: 18.030 erkrankten, 14.752 verstarben) (Krebs in Deutschland, Ausgabe 2015, S. 94 und S. 58). Die Zahl der jährlichen Neuerkrankungen an Prostatakrebs ist absolut seit 1998 um mehr als die Hälfte gestiegen (von 40.000 auf über 60.000). Der Anteil der Männer, die 2014 am Prostatakrebs starben, betrug laut Todesursachenstatistik des Statistischen Bundesamtes 3,2% - andersherum: knapp 97% der Männer starben nicht daran.
Den neuesten Daten zufolge erkrankten im Jahr 2012 in Deutschland 63.710 Männer an Prostatakrebs und 12.957 starben daran. Damit ist Prostatakrebs die häufigste Krebsart bei Männern, mit Abstand gefolgt von Lungenkrebs, an dem 2012 34.490 Männer erkrankten und 29.713 verstarben (Frauen: 18.030 erkrankten, 14.752 verstarben) (Krebs in Deutschland, Ausgabe 2015, S. 94 und S. 58). Die Zahl der jährlichen Neuerkrankungen an Prostatakrebs ist absolut seit 1998 um mehr als die Hälfte gestiegen (von 40.000 auf über 60.000). Der Anteil der Männer, die 2014 am Prostatakrebs starben, betrug laut Todesursachenstatistik des Statistischen Bundesamtes 3,2% - andersherum: knapp 97% der Männer starben nicht daran.
Das Prostata-spezifische Antigen wird seit Ende der 1980er-Jahre als Test zur Früherkennung eingesetzt. Problematisch sind dabei 3 Sachverhalte:
• Der Test soll die an Prostatakrebs Erkrankten "aussieben", diese sollen sozusagen im Sieb verbleiben während die Nicht-Erkrankten "durchrutschen". Dies leistet der Test aber nur unzureichend, wie eine schwedische Studie gezeigt hat - ein relevanter Anteil der Erkrankten "rutscht durch" und ein relevanter Anteil der Gesunden "bleibt im Sieb hängen" und erhält das Etikett krankheitsverdächtig.
• Die Therapie der früh erkannten Prostatakarzinome hat sich bislang nicht als effektiv erwiesen.
• Viele früh erkannte Tumoren wären im Verlauf wegen ihres langsamen Wachstums nie symptomatisch geworden (dies wird als Überdiagnose bezeichnet).
Die englische ProtecT-Studie untersucht den Nutzen und die Schäden unterschiedlicher Behandlungsstrategien des lokalisiertem Prostatakarzinoms. Ausgangspunkt sind 82,429 Männer, die zwischen 1999 und 2009 in einer Hausarztpraxis einen PSA-Test erhalten haben. 2664 Männer erhielten die Diagnose Prostatakrebs im Frühstadium (auch: lokalisiertes Prostatakarzinom). 1643 stimmten der Teilnahme an der Studie zu. Sie wurden nach Zufallsprinzip in eine von drei Gruppen eingeteilt (randomisiert):
• Aktive Beobachtung
• Operative Entfernung der Prostata
• Bestrahlungstherapie in Verbindung mit einer Hormontherapie
Unter aktiver Beobachtung wird eine Strategie verstanden, in der durch wiederholte PSA-Messungen untersucht wird, ob das Prostatakarzinom wächst oder nicht - operiert oder bestrahlt wird nur im Falle des Fortschreitens. Das Durchschnittsalter betrug zum Zweitpunkt der Randomisation 62 Jahre.
Die wichtigsten Ergebnisse nach 10 Jahren lauten:
• (nur) 17 der 1643 Männer sind am Prostatakrebs gestorben
• In allen 3 Gruppen sind nach 10 Jahren 99% der Teilnehmer nicht am Prostatakarzinom gestorben.
• Auch die Gesamtsterblichkeit der 3 Gruppen ist mit etwa 10% gleich.
Die vorab als Erfolgskriterium definierte Sterblichkeit am Prostatakrebs (primärer Endpunkt) ist also gleich, so auch die als sekundärer Endpunkt definierte Gesamtsterblichkeit.
Etwas häufiger wurde in der Beobachtungsgruppe das Fortschreiten des Prostatakrebses und das Auftreten von Metastasen verzeichnet (sekundäre Endpunkte). In der Beobachtungsgruppe traten in 6 Fällen pro 1000 Personenjahren Metastasten auf, in den Behandlungsgruppen in 2 bis 3 Fällen. Ein Fortschreiten der Erkrankung wurde in der Beobachtungsgruppe in 22 Fällen pro 1000 Personenjahre beobachtet, in den Behandlungsgruppen in je 9 Fällen.
Aus den Zahlen folgt, dass 27 Männer eine operative Prostataentfernung erhalten müssen, um einen Fall von Metastasen zu verhindern bzw. 33 Männer eine Strahlentherapie (number needed to treat). 9 Männer müssen eine Prostataentfernung oder eine Strahlentherapie erhalten, um einen Fall von Krankheitsprogression zu verhindern.
Die Ergebnisse zeigen Folgendes:
Nur wenige der durch PSA-Screening entdeckten Prostatakarzinome führen innerhalb von 10 Jahren zum Tode, unabhängig davon ob operiert oder bestrahlt wird oder nicht. Die Therapie ist insofern wirksam, dass nach 10 Jahren einige Männer mehr Metastasen bzw. ein Fortschreiten der Erkrankung aufweisen, die primär keine Therapie erhalten haben. Ob sich das im weiteren Verlauf in einer niedrigeren Sterblichkeit äußert, lässt sich nicht vorhersagen - die Ergebnisse einer längeren Nachbeobachtung müssen abgewartet werden. Dabei ist zu bedenken, dass das Durchschnittsalter zum Zeitpunkt der Auswertung 72 Jahre betrug und die durchschnittliche Lebenserwartung englischer Männer bei 78 Jahren liegt. Viel Zeit für den Lebenszeitgewinn verbleibt somit nicht mehr.
Deutlich dürfte schon jetzt sein, dass der Aufwand für ein niedrigeres Risiko des Fortschreitens der Erkrankung sehr hoch ist und die damit einhergehenden Schäden relevant, wie die Befragung der Probanden gezeigt hat, deren Ergebnisse ebenfalls vor Kurzem veröffentlicht wurden und in Teil 2 dargelegt werden
Hamdy FC, Donovan JL, Lane JA, et al. 10-year outcomes after monitoring, surgery, or radiotherapy for localized prostate cancer. N Engl J Med 2016; 375:1415-24 Abstract
Lane JA, Donovan JL, Davis M, Walsh E, Dedman D, Down L, Turner EL, Mason MD, Metcalfe C, Peters TJ et al: Active monitoring, radical prostatectomy, or radiotherapy for localised prostate cancer: study design and diagnostic and baseline results of the ProtecT randomised phase 3 trial. The Lancet Oncology 2014, 15(10):1109-1118. Volltext
Holmstrom B, Johansson M, Bergh A, Stenman U-H, Hallmans G, Stattin P: Prostate specific antigen for early detection of prostate cancer: longitudinal study. BMJ 2009, 339(sep24_1):b3537-. BMJ 2009;339:b3537 Abstract
Robert Koch Institut. Krebs in Deutschland 2011/2012. 10. Ausgabe 2015. Gesundheitsberichterstattung des Bundes. Link.
David Klemperer, 27.10.16
Diagnostische Variabilität der Biopsien von Brustgewebe je nach Art der Zellveränderung erheblich
 Wenn man sich vergegenwärtigt, dass die Biopsie von entnommenen Gewebe zum Goldstandard der Diagnostik verschiedener Krebserkrankungen gehört und mehr oder weniger folgenschwere Therapieentscheidungen begründet, reduzieren die Ergebnisse einer in den USA durchgeführten Studie über die Zuverlässigkeit der Untersuchung von Brustgewebe auf das Vorliegen verschiedener Ausprägungen von Brustkrebs den Glanz erheblich.
Wenn man sich vergegenwärtigt, dass die Biopsie von entnommenen Gewebe zum Goldstandard der Diagnostik verschiedener Krebserkrankungen gehört und mehr oder weniger folgenschwere Therapieentscheidungen begründet, reduzieren die Ergebnisse einer in den USA durchgeführten Studie über die Zuverlässigkeit der Untersuchung von Brustgewebe auf das Vorliegen verschiedener Ausprägungen von Brustkrebs den Glanz erheblich.
Der Studie lag zum einen die zwischen drei Biopsieexperten konsentierte Diagnose der Brustgewebeproben von 240 US-Amerikanerinnen im Alter von 50 bis 59 Jahren zugrunde.
Zum anderen wurde jeweils eine Probe jeder Patientin auch noch 115 USA-weiten Pathologen zur Diagnostik zugesandt.
Die Ergebnisse bzw. die Übereinstimmung der konsentierten Diagnosen mit denen der 115 Pathologen sahen je nach Art der Gewebeveränderung unterschiedlich aus:
• Bei invasivem Krebs und gutartiger Gewebeveränderung ohne strukturelle Abnormalität der Zellen ("benign issue without atypia") stimmten die Ergebnisse zu mehr als 97% überein.
• Die Übereinstimmung betrug bei einem sogenannten duktalen Karzinom in situ (DCIS), also einer möglichen Krebsvorstufe nur noch rund 70%.
• Bei der Diagnostik einer gutartigen strukturellen Abnormalität von Zellen ("atypia") gab es nur noch in 40% der Fälle eine Übereinstimmung.
• Sowohl bei der Diagnose DCIS als auch bei der einer strukturellen Abnormalität waren die Diagnosen der 115 Pathologen ernster als die einhelligen der drei Experten. Bei der Atypia-Diagnose überintertpretierten zum Beispiel rund 54% der Pathologen den Ernst der Situation.
Angesichts der Folgenschwere einer Unter- oder Überinterpretation von Gewebeproben fordern die AutorInnen der Studie, dass die beobachtete diagnostische Variabilität so rasch wie möglich verringert werden müsse. Ob die für solche Fälle immer häufiger als Lösung vorgeschlagene Zweitmeinung dabei wirklich hilft, ist zu bezweifeln. Dies allein schon deswegen, weil in Zweitmeinungsverfahren generell weder bei Übereinstimmung noch bei Divergenz der Diagnose ausgeschlossen ist, dass beide Diagnosen falsch sind oder nicht geklärt ist, welche der beiden Diagnosen der Wirklichkeit entspricht.
Die Studie Variability in Pathologists' Interpretations of Individual Breast Biopsy Slides: A Population Perspective von Joann Elmore et al. ist am 22. März 2016 online first inb der Fachzeitschrift "Annals of Internal Medicine" erschienen. Das Abstract ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 22.3.16
Rückgang der Inzidenz und Mortalität von Darmkrebs durch Vorsorgekoloskopie - Ja, mit kleinen Einschränkungen
 Bei einigen Vorsorge- oder Früherkennungsuntersuchungen gibt es oft keine verlässlichen Daten für deren erwartete oder behauptete Wirkung auf die Inzidenz und die Mortalität.
Bei einigen Vorsorge- oder Früherkennungsuntersuchungen gibt es oft keine verlässlichen Daten für deren erwartete oder behauptete Wirkung auf die Inzidenz und die Mortalität.
Umso mehr ist zu begrüßen, dass es für die so genannte Vorsorgekoloskopie als GKV-Leistung für alle Versicherten ab dem 55. Lebensjahr nun derartige Daten gibt. Dies auch deshalb, weil es in Deutschland bisher im internationalen Vergleich besonders viel Neuerkrankungen an Darmkrebs gab. Hinzu kommt die Besonderheit der Koloskopie nicht nur Krebserkrankungen im Frühstadium erkennen und der Behandlung zuführen, sondern auch durch die Erkennung von Vorstufen eines möglichen Karzinoms eine Krebserkrankung verhüten zu können.
Auf der Basis der Daten der epidemiologischen Krebsregister und der Todesursachenstatistik kommt eine Gruppe von KrebsforscherInnen nun für den Zeitraum 2003 bis 2012 zu folgenden Ergebnissen:
• Die Inzidenz an Darmkrebs war vor Einführung der Koloskopie über mehrere Jahrzehnte angestiegen.
• Im Untersuchungszeitraum nahm die altersstandardisierte Darmkrebsinzidenz in Deutschland dann um 13,8 % bei Männern und um 14,3 % bei Frauen ab. Außerdem sank die altersstandardisierte Darmkrebsmortalität um 20,8 % bei Männern und um 26,5 % bei Frauen. Der starke Rückgang der Inzidenz war selektiv in den Altersgruppen ab 55 Jahren zu beobachten (17% bis 26%).
• Etwa 20-25 % der Anspruchsberechtigten nahmen bisher das Angebot einer Vorsorgekoloskopie in Deutschland wahr.
• Die beobachteten Muster sprechen für einen wesentlichen Beitrag der Vorsorgekoloskopie zur Senkung der Darmkrebsinzidenz und -mortalität in Deutschland.
• Nach den längerfristigen Erfahrungen aus den USA und auf Basis aktueller Hochrechnungen erwarten die ForscherInnen, dass sich der Rückgang der Darmkrebsinzidenz und -mortalität in Deutschland in den kommenden Jahren weiter deutlich fortsetzen und verstärken wird.
Auch wenn vieles dafür spricht, dass die Vorsorgekoloskopie wesentlich zu den erkannten gesundheitlichen Veränderungen beitrug, weisen die AutorInnen darauf hin, dass ein allerdings schwer zu quantifizierender Anteil z.B. durch den Rückgang des Rauchens bestimmt sein könnte. Sie verweisen in diesem Zusammenhang auf die "Hauptlimitation" ihrer aber auch vieler anderer Studien, über keine getrennten Analysen zur Inzidenz und Mortalität in der mit bis zu 75% enorm großen Gruppe der NichtinanspruchnehmerInnen der Koloskopie zu verfügen. Dies erlaube nur "indirekte Rückschlüsse auf den möglichen Beitrag der Vorsorgekoloskopie". Für künftige Früherkennungs- und Vorsorgeangebote wünschen sich die AutorInnen daher weniger "unverhältnismäßig restriktive Datenschutzbestimmungen" bzw. eine andere Balance zwischen Datenschutz- und Vorsorgeinteressen der BürgerInnen.
Der Aufsatz Declining bowel cancer incidence and mortality in Germany—an analysis of time trends in the first ten years after the introduction of screening colonoscopy von H. Brenner, Schrotz-King P, Holleczek B, Katalinic A und Hoffmeister M ist am 19. Februar im Deutschen Ärzteblatt erschienen (113, 7: 101-6) und auch in deutscher Sprache komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 4.3.16
USA: Zu viele Früherkennungsuntersuchungen trotz guter Leitlinien
 Die U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF), ein unabhängiges Expertengremium für Fragen der evidenzbasierten Prävention hat im Jahr 2009 bzw. 2012 überarbeitete Versionen ihrer Leitlinien für die Früherkennungsuntersuchungen auf Brustkrebs und Gebärmutterhalskrebs veröffentlicht. Darin wurde die aktuelle Evidenz zu Nutzen und Schaden berücksichtigt. Zu den Neuerungen zählen die Empfehlungen, das Mammographie-Screening mit 50 statt mit 40 Jahren zu beginnen und ein zweijährliches statt einem jährlichen Intervall einzuhalten.
Die U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF), ein unabhängiges Expertengremium für Fragen der evidenzbasierten Prävention hat im Jahr 2009 bzw. 2012 überarbeitete Versionen ihrer Leitlinien für die Früherkennungsuntersuchungen auf Brustkrebs und Gebärmutterhalskrebs veröffentlicht. Darin wurde die aktuelle Evidenz zu Nutzen und Schaden berücksichtigt. Zu den Neuerungen zählen die Empfehlungen, das Mammographie-Screening mit 50 statt mit 40 Jahren zu beginnen und ein zweijährliches statt einem jährlichen Intervall einzuhalten.
Die Früherkennung auf Gebärmutterhalskrebs soll nicht vor dem 21. Lebensjahr beginnen, unabhängig vom Sexualverhalten. Frauen im Alter von 21 bis 30 Jahren sollen zytologische Abstrichuntersuchungen in dreijährlichen Abständen angeboten werden und zusätzliche HPV-Testung alle 5 Jahre oder Weiterführung der 3-jährlichen Untersuchung bis zum 65. Lebensjahr.
Die überarbeiteten Empfehlungen sollen das Verhältnis von Nutzen und Schaden günstiger gestalten, insbesondere die Zahl falsch positiver Befunde und unnötiger Biopsien mindern.
Wie sich die Veränderungen in den Leitlinien auf die Haltung der Ärzte und ihre Vorgehensweisen ausgewirkt haben, ist das Thema einer kürzlich veröffentlichten Studie.
Per Internet und per Brief gaben im Jahr 2014 385 primärversorgende Ärzte aus 4 Ärztenetzwerken Auskunft über ihre Haltungen und Einschätzungen zu den Früherkennungsuntersuchungen sowie auf Veränderungen ihrer Praxis als Reaktion auf die veränderten Leitlinien.
Die Mehrzahl der Ärzte bezeichnete das Mammographie-Screening bei Frauen im Alter von 40 bis 75 Jahren und die Zell-Abstrichuntersuchung bei Frauen im Alter von 21 bis 64 Jahren als effektiv zur Senkung der Krebssterblichkeit. Die Leitlinien der USPSTF wurden zwar als einflussreich anerkannt. Trotzdem gaben beim Brustkrebs-Screening 75.7% und beim Gebärmutterhalskrebs-Screening 41.2 % an, mehr Untersuchungen zu empfehlen oder zu veranlassen als in den Leitlinien vorgesehen.
Bezüglich der Brustkrebsfrüherkennung empfehlen 40% eine regelmäßige Mammographie bei Frauen zwischen 40 und 49 Jahre, 32% eine jährliche und 8% eine zweijährliche Untersuchung; mehr als die Hälfte gibt an, die Optionen mit den Patientinnen zu besprechen. 50 bis 75-jährigen Frauen empfehlen knapp 2/3 der Ärzte die jährliche und nur 8% die zweijährliche Mammographie; 13 % besprechen die Optionen.
Ein nennenswerter Anteil von Ärzten empfiehlt die Mammographie auch 30 bis 39-jährigen Frauen (3,2% jährlich, 0,8% zweijährlich) und Frauen von 75 oder mehr Jahren (16% jährlich, 8,7% zweijährlich).
Bei der Gebärmutterhalskrebs-Früherkennung empfehlen 21% der Ärzte die Abstrichuntersuchung sexuell aktiven Frauen unter 21 Jahren. 22% empfehlen die Untersuchung für Frauen im Alter 29 Jahren in jährlichen statt dreijährlichen Intervallen.
Als Gründe gaben für das Abweichen von den Empfehlungen der USPSTF geben Ärzte an: Bedenken der Patienten bezüglich der Leitlinien, anderer Meinung zu sein, als die Leitlinien, Qualitätsmaße, die nicht mit den Leitlinien-Empfehlungen übereinstimmen, Befürchtung von Kunstfehler-Prozessen und unzureichende Zeit für das Gespräch mit den Patientinnen.
US-amerikanische primärversorgende Ärzte halten sich somit nicht durchgehend an die Empfehlungen der nationalen Früherkennungs-Leitlinien, veranlassen Früherkennungsuntersuchungen, die mehr Schaden als Nutzen erbringen und tragen zur Überversorgung bei.
Haas JS, Sprague BL, Klabunde CN, et al. Provider Attitudes and Screening Practices Following Changes in Breast and Cervical Cancer Screening Guidelines. J Gen Intern Med 2015 Abstract
David Klemperer, 19.8.15
Schäden von Krebsfrüherkennung 4 - Mit Sicherheit nutzlos, trotzdem verbreitet: Krebsfrüherkennung bei Alten und Kranken
 Krebsfrüherkennung hat dann einen Nutzen, wenn die Vorverlegung der Diagnose eine Therapie ermöglicht, die zu einer niedrigeren Sterblichkeit und längeren Lebenserwartung führt, als wenn die Krebserkrankung erst nach Auftreten von Symptomen behandelt wird. Als nützlich in diesem Sinne gilt derzeit die Früherkennung von Brustkrebs, Darmkrebs und Gebärmutterhalskrebs, wobei der Nutzen der Brustkrebsfrüherkennung durch neuere Studienergebnisse in Frage gestellt ist (siehe Forum Gesundheitspolitik: Mammografie-Screening 1: Nutzen fraglich, wenn dann bestenfalls gering).
Krebsfrüherkennung hat dann einen Nutzen, wenn die Vorverlegung der Diagnose eine Therapie ermöglicht, die zu einer niedrigeren Sterblichkeit und längeren Lebenserwartung führt, als wenn die Krebserkrankung erst nach Auftreten von Symptomen behandelt wird. Als nützlich in diesem Sinne gilt derzeit die Früherkennung von Brustkrebs, Darmkrebs und Gebärmutterhalskrebs, wobei der Nutzen der Brustkrebsfrüherkennung durch neuere Studienergebnisse in Frage gestellt ist (siehe Forum Gesundheitspolitik: Mammografie-Screening 1: Nutzen fraglich, wenn dann bestenfalls gering).
In jedem Fall ist der Nutzen der Krebsfrüherkennung naturgemäß in einer nicht nahen Zukunft zu erwarten. Daher werden in Leitlinien zur Krebsfrüherkennung zumeist Obergrenzen für das Alter bzw. für die zu erwartende verbleibende Lebenszeit angegeben.
Eine amerikanische Untersuchung ging der Frage nach, ob auch Personen, die aufgrund von Alter und/oder Krankheit eine niedrige verbleibende Lebenserwartung haben, Krebsfrüherkennungsuntersuchungen erhalten.
Datenbasis ist die jährliche bevölkerungsweite Befragung National Health Interview Survey (NHIS) des amerikanischen National Center for Health Statistics.
In den Jahren 2000 bis 2010 wurden mehrfach Fragen nach der Teilnahme an der Früherkennung von Brustkrebs, Prostatakrebs, Gebärmutterhalskrebs und Darmkrebs gestellt. 27.404 Teilnehmer waren 65 Jahre alt oder älter und wurden in 5 Altersklassen (65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85 Jahre oder älter) sowie mit Hilfe eines validierten Mortalitätsindex in 4 Mortalitätsklassen eingeteilt - solche mit niedrigem (<25%), mittlerem (25%-49%), hohem (50-74%) und sehr hohem (75% oder höher) Risiko, in den nächsten 9 Jahren zu sterben.
Das Ergebnis lautet: Mit steigendem 9-Jahres-Mortalitätsrisiko nehmen die Screeningraten zwar ab, liegen aber immer noch hoch.
Trotz einem Risiko von 75% und mehr, innerhalb der nächsten 9 Jahre zu sterben,
erhielten eine Früherkennungsuntersuchung
• 54,6% der Männer in letzten 2 Jahren für Prostatakrebs
• 37,5% der Frauen in letzten 2 Jahren für Brustkrebs
• 30.6% der Frauen in den letzten 3 Jahren für Gebärmutterhalskrebs
• 40,8% der Männer und Frauen in den letzten 5 Jahren für Darmkrebs.
Und selbst bei einem Risiko von 75% oder mehr in den kommenden 5 Jahren zu sterben, ist der Anteil derjenigen, die eine Früherkennungsuntersuchung erhalten haben noch hoch: Prostatakrebs 51,6%, Brustkrebs 34,2%, Gebärmutterhalskrebs 25,7%, Darmkrebs 40,8%.
Für die genannten Krebsarten erhält selbst in der höchsten Altersgruppe (84 Jahre und älter) ein nennenswerter Anteil Früherkennungsuntersuchungen.
Höhere Bildung, Krankenversicherungsschutz und Ehe gingen mit einher, Früherkennungsuntersuchungen zu erhalten.
Die Autoren nennen mehrere mögliche Gründe für die Ergebnisse. So gibt es bislang keine einfache Methode, das 10-Jahres-Mortalitätsrisiko für den individuellen Patienten zu berechnen. Aber selbst wenn die verbleibende Lebenserwartung erkennbar niedrig ist, könnte es dem Arzt schwer fallen, dies dem Patienten durch Einstellen der Früherkennungsuntersuchungen mitzuteilen bzw. dem Patienten könnte es schwer fallen dies zu akzeptieren.
Anzumerken bleibt, dass Ärzte und folglich auch Patienten den Nutzen von Krebsfrüherkennung allgemein überschätzen und die möglichen Schäden unterschätzen, wie hier schon vielfach berichtet (siehe Forum Gesundheitspolitik, Kategorie Früherkennung, Screening). Das Screenen auf Krebserkrankungen von sehr alten und sehr kranken Personen unterstreicht diesen Sachverhalt eindrucksvoll und weist auf einen Bereich hin, in dem weniger mehr wäre: weniger medizinische Aktivität würde hier das Wohlbefinden der Patienten fördern und die Verschwendung von Ressourcen mindern.
Royce TJ, Hendrix LH, Stokes WA, et al. Cancer screening rates in individuals with different life expectancies. JAMA Internal Medicine 2014. Abstract
David Klemperer, 19.2.15
Schäden von Krebsfrüherkennung 3 - "Falscher Alarm" bei Brustkrebsfrüherkennung bewirkt psychische Langzeitschäden
 Als positiver Befund wird bei der Brustkrebsfrüherkennung durch Mammographie eine Gewebsverdichtung bezeichnet. "Richtig positiv" ist der Röntgenbefund, wenn die Abklärung ergibt, das die Verdichtung Tumorzellen enthält, "falsch positiv" hingegen, wenn die Veränderungen gutartig sind. Letzteres wird auch als "falscher Alarm" bezeichnet.
Als positiver Befund wird bei der Brustkrebsfrüherkennung durch Mammographie eine Gewebsverdichtung bezeichnet. "Richtig positiv" ist der Röntgenbefund, wenn die Abklärung ergibt, das die Verdichtung Tumorzellen enthält, "falsch positiv" hingegen, wenn die Veränderungen gutartig sind. Letzteres wird auch als "falscher Alarm" bezeichnet.
Falsch positive Befunde sind häufig - in Deutschland geht man davon aus, dass im Screening-Programm für 50- bis 69-jährige Frauen 200 von 1000 Frauen einmal einen falsch positiven Befund erhalten (siehe Kennzahlen Mammographie, Vs. 1.2, 2010, S. 4).
Eine dänische Studie untersuchte die psychischen Folgen eines falsch-positiven Befundes.
In die Studie wurden 454 Frauen mit positivem Befund (Gewebsverdichtung) in der Früherkennungs-Mammographie in den Jahren 2004 bzw. 2005 im Rahmen des dänischen Brustkrebs-Screening-Programms aufgenommen. Bei 174 ergab die Abklärung der Gewebsverdichtung die Diagnose Brustkrebs ("richtig positiv"), bei 272 konnte ein Brustkrebs ausgeschlossen werden ("falsch positiv"). Zum Vergleich wurden 864 Frauen mit Normalbefund hinzugezogen.
Der psychosoziale Status wurde mit dem "Consequences of Screening in Breast Cancer (COS-BC) questionnaire" (Link) gemessen.
Dieses Befragungsinstrument wurde spezifisch für die Brustkrebsfrüherkennung entwickelt und erfasst Outcomes wie Angst, Verhalten, Gefühl der Niedergeschlagenheit, Schlafprobleme, Ausgeglichenheit, soziale Kontakte und Sexualität.
Die Messung erfolgte zu 5 Zeitpunkten (1, 16, 18 und 36 Monate) und erlaubt somit Aussagen über den Verlauf der psychischen Folgen Unklar war bisher, ob die Ängste und Verunsicherungen, die bei der Eröffnung eines positiven Befundes entstehen, bei der Information, dass es sich nicht um Krebs handelt, wieder verschwinden - ob also bei der Entwarnung nach falschen Alarm alles wieder gut ist.
Frauen mit falsch positivem Screening-Ergebnis berichteten in der kritischen Phase vor der endgültigen entlastenden Diagnose aber auch 4 Wochen danach stärker negative psychosoziale Konsequenzen für alle gemessenen Outcomes im Vergleich zu Frauen mit Normalbefund.
Im Vergleich zu Frauen mit richtig positivem Befund (Brustkrebs-Diagnose) waren in den 6 Monaten nach der endgültigen entlastenden Diagnose die negativen Folgen für die Outcomes existentielle Werte und innere Ruhe genauso stark ausgeprägt, in den übrigen Outcomes deutlich weniger negativ. Die Werte der Frauen besserten sich für beide Gruppen bis zum 18. Monat, danach aber nur noch geringfügig.
3 Jahre nach der Information, keinen Brustkrebs zu haben, bestanden weiterhin deutliche negative psychosoziale Folgen, die etwa in der Mitte zwischen den Frauen mit negativem Mammographie-Ergebnis und den Frauen mit Brustkrebs liegen.
Entwarnung nach einem positiven Screening-Befund führte in dieser Studie also nicht zu einem Verschwinden der psychischen Beeinträchtigung, vielmehr scheint auch ein falsch positiver Screning-Befund ein anhaltendes Trauma auszulösen.
Die schädlichen psychischen Effekte wiegen angesichts des in Frage gestellten Nutzens des Brustkrebs-Screenings (wir berichteten) umso schwerer.
Brodersen J, Siersma VD. Long-Term Psychosocial Consequences of False-Positive Screening Mammography. The Annals of Family Medicine 2013;11:106-15 Abstract
David Klemperer, 19.2.15
Schäden von Krebsfrüherkennung 2 - Quantität und Qualität der Studien zu psychischen Folgen von Krebsfrüherkennung unzulänglich
 Ziel der systematischen Übersichtsarbeit war die Untersuchung der methodischen Qualität von Studien, die sich mit psychischen Folgen von Früherkennung befassen.
Ziel der systematischen Übersichtsarbeit war die Untersuchung der methodischen Qualität von Studien, die sich mit psychischen Folgen von Früherkennung befassen.
Ausgewertet wurden 68 Studien, die sich mit psychologischen Schäden bei der Früherkennung von 2 Krebserkrankungen und 4 Nicht-Krebs-Erkrankungen befassten
• PSA-Screening für Prostatakrebs
• Niedrigdosis- Computertomographie für Lungenkrebs
• Knochendichtemessung für Osteoporose
• Ultraschalluntersuchung Bauchaortenaneurysma
• Doppler-Sonographie der Halsgefäße zur Erfassung einer asymptomatischen Stenose (Verengung)
42 der 68 Studien bezogen sich auf das Prostatakrebs-Screening, 11 auf das Lungenkrebs-Screening und die übrigen 15 Studien auf die 3 Nicht-Krebs-Erkrankungen.
Als "psychologische Last" (psychologic burden) von Früherkennungsuntersuchungen bezeichnen die Autoren die Häufigkeit des Auftretens sowie der Schwere der psychologischen Reaktion, die Dauer und die Auswirkungen auf den Alltag der Patientin bzw. des Patienten und seiner bzw. ihrer Familie.
Schäden können während der gesamten "Screening-Kaskade" auftreten:
• vor dem Screening (Antizipation eines positiven Ergebnisses)
• in der Wartezeit unmittelbar nach dem Screening (Angst vor einem positiven Ergebnis)
• in der Abklärungsphase bei einem positiven Screening-Ergebnis
• nach der Bestätigung eines positiven Ergebnisses
• im Zusammenhang mit der Behandlung.
Als methodischen Standard fordern die Autoren Längsschnittstudien mit krankheitsspezifischen Messinstrumenten. Weniger geeignet seien hingegen Querschnittstudien mit allgemeinen Maßen der Lebensqualität (wie z.B. SF-36).
Von den 68 Studien sind 36 als Längsschnitt und 11 als Querschnitt durchgeführt worden, 19 sind qualitativer Natur und 2 nutzen unterschiedliche Methoden. 16 der 49 nicht-qualitativen Studien erfüllten die Kriterien Längsschnitt und krankheitsspezifische Maße für die psychologische Last. Dies traf für 9 der 30 Studien zum Prostatakrebs-Screening und für 7 der 9 Studien zum Lungenkrebs-Screening zu.
Die Autoren kommen zum Schluss, dass die Zahl, das Design und die Maße der Studien zu den psychologischen Schäden der 5 Früherkennungsuntersuchungen insgesamt inadäquat sind. Es bestünden erhebliche Evidenzlücken.
Die Studie stellt einen weiteren Hinweis dafür dar, dass die in Deutschland durch das Patientenrechtegesetz und das Krebsfrüherkennungsgesetz geforderte informierte Entscheidung allein an fehlenden Informationen infolge unzulänglicher Wissenschaft scheitert. Angesichts der vorgesehenen Ausweitung von Gesundheitsuntersuchungen im Rahmen des Präventionsgesetzes sollte die Evidenzlücken dringend und zügig gefüllt werden.
DeFrank J, Barclay C, Sheridan S, et al. The Psychological Harms of Screening: the Evidence We Have Versus the Evidence We Need. Journal of General Internal Medicine 2014:1-7 Abstract
David Klemperer, 19.2.15
Schäden von Krebsfrüherkennung 1 - Schäden werden nicht ausreichend erforscht
 In dieser Studie ging es um die Frage, inwieweit in randomisierten kontrollierten Studien zum Krebsscreening neben dem Nutzen auch die Schäden untersucht wurden.
In dieser Studie ging es um die Frage, inwieweit in randomisierten kontrollierten Studien zum Krebsscreening neben dem Nutzen auch die Schäden untersucht wurden.
Ausgewertet wurden 198 Veröffentlichungen, die sich auf 57 Studien mit insgesamt 3.419.036 Teilnehmern bezogen.
Als Nutzen von Krebsscreening gelten die Senkung
• der Inzidenz (Neuauftreten) der jeweiligen Krebsart
• der krebsspezifischen Mortalität und
• der Gesamtmortalität.
Die Studien befassten sich mit dem Screening von
• Brustkrebs (Selbstuntersuchung der Brust, Mammographie)
• Dickdarmkrebs (Stuhlbluttest, Sigmoidoskopie/"kleine Darmspiegelung
• Leberkrebs (Ultraschall, CA-125)
• Lungenkrebs (Röntgen bzw. Computertomographie des Brustkorbs)
• Mundhöhlenkrebs (visuelle Inspektion)
• Eierstockkrebs (Ultraschall, CA-125) und
• Prostatakrebs (PSA, Tastuntersuchung).
Bezogen auf die 57 Studien wurden in folgender Häufigkeit auch Schäden untersucht:
• in 4 Studien die Überdiagnose (Tumoren, die nie symptomatisch geworden wären)
• in 2 Studien falsch-positive Ergebnisse ("falscher Alarm", z.B. Gewebsverdichtung in der Mammographie, die sich bei weiterer Abklärung als gutartig erweist)
• in 5 Studien negative psychosoziale Folgen
• in 11 Studien körperliche Schäden und
• in 27 Studien die Notwendigkeit invasiver Folgeuntersuchungen mit den jeweils eigenen Risiken.
Der wichtigste Parameter für den Nutzen, die Senkung der Gesamtsterblichkeit, wurde in 34 der 57 Studien berechnet, der Surrogatparameter Senkung der krebsspezifischen Inzidenz in 51 der 57 Studien.
Dieser Studie zufolge werden die Schäden von Krebsscreening selten untersucht.
Krebsfrüherkennung richtet sich an gesunde Menschen. Die Nutzenwahrscheinlichkeit für den Einzelnen ist eher niedrig und geht mit einer niedrigen Wahrscheinlichkeit für gravierende Schäden einher. Eine Entscheidung über die Teilnahme muss sich auf die realistische Abwägung von Informationen über Nutzen und Schaden gründen. Dass Forscher darauf verzichten, Informationen über Schäden zu generieren ist außerordentlich bedenklich und weist auch auf ein Versagen der Ethikkomitees hin, die solche Studien nicht genehmigen dürften.
Heleno B, Thomsen MF, Rodrigues DS, et al. Quantification of harms in cancer screening trials: literature review. BMJ 2013;347 Open Access
David Klemperer, 19.2.15
Schäden von Krebsfrüherkennung - 4 neuere Studien
 Für Krebsfrüherkennung gilt, was für alle anderen medizinischen Interventionen ebenfalls zutrifft: der erhoffte Nutzen geht stets mit möglichen Schäden einher. Eine informierte Entscheidung sollte auf der Abwägung von Nutzenwahrscheinlichkeiten und Schadensrisiken durch den Patienten mit Unterstützung des Arztes im Sinne des Shared Decision Making erfolgen.
Für Krebsfrüherkennung gilt, was für alle anderen medizinischen Interventionen ebenfalls zutrifft: der erhoffte Nutzen geht stets mit möglichen Schäden einher. Eine informierte Entscheidung sollte auf der Abwägung von Nutzenwahrscheinlichkeiten und Schadensrisiken durch den Patienten mit Unterstützung des Arztes im Sinne des Shared Decision Making erfolgen.
Von diesem Ideal ist der medizinische Alltag weit entfernt. Diesbezügliche Studien haben wir im Forum fortlaufend aufgegriffen (Rubrik Früherkennung, Screening).
Diese Studien belegen eine ungute Situation, die sich kurzgefasst folgendermaßen darstellt:
• Viele Ärzte sind über die Wahrscheinlichkeiten von Nutzen und Schaden der Früherkennung schlecht informiert. Sie kennen die Zahlen nicht bzw. verstehen sie nicht.
• Daraus folgend kommunizieren Ärzte den Nutzen und den Schaden von Früherkennung unzulänglich.
• Patienten haben daher teils falsche Vorstellungen davon, was Früherkennung überhaupt ist und unrealistische Vorstellungen von Nutzen und Schaden.
• In Studien werden die Schäden unzureichend untersucht, wenn dann noch eher körperliche als psychische Schäden, obwohl auch letztere gravierend sein können.
Fortschritte sind erkennbar. So hat der Gesetzgeber kürzlich für organisierte Früherkennungsprogramme die "mit der Einladung erfolgende umfassende und verständliche Information der Versicherten über Nutzen und Risiken der jeweiligen Untersuchung" im §25a SGB V festgeschrieben.
Zur Schärfung des Problembewusstseins werden im Folgenden werden 4 neuere Studien vorgestellt.
Die Studien belegen folgende Probleme bzw. Verbesserungsbereiche:
1. In randomisierten kontrollierten Studie zur Krebsfrüherkennung werden die Schäden unzulänglich untersucht. Forum-Beitrag: Schäden werden nicht ausreichend erforscht.
Studie: Heleno B, Thomsen MF, Rodrigues DS, et al. Quantification of harms in cancer screening trials: literature review. BMJ 2013;347.
2. Wenn psychische Schäden untersucht werden, dann ist die Methodik häufig unzulänglich.
Forum-Beitrag: Quantität und Qualität der Studien zu psychischen Folgen von Krebsfrüherkennung unzulänglich
Studie: DeFrank J, Barclay C, Sheridan S, et al. The Psychological Harms of Screening: the Evidence We Have Versus the Evidence We Need. Journal of General Internal Medicine 2014:1-7.
3. Ein methodisch hochwertige Studie zu den psychischen Langzeitfolgen von falsch-positiven Screeningbefunden zeigt deutliche negative Folgen noch nach 2 Jahren
Forum-Beitrag: "Falscher Alarm" bei Brustkrebsfrüherkennung bewirkt psychische Langzeitschäden.
Studie: Brodersen J, Siersma VD. Long-Term Psychosocial Consequences of False-Positive Screening Mammography. The Annals of Family Medicine 2013;11(2):106-15.
4. Krebsfrüherkennung wird auch an Personen durchgeführt, die sicher keinen Nutzen davon haben können.
Forum-Beitrag: Mit Sicherheit nutzlos, trotzdem verbreitet: Krebsfrüherkennung bei Alten und Kranken.
Studie: Royce TJ, Hendrix LH, Stokes WA, et al. Cancer screening rates in individuals with different life expectancies. JAMA Internal Medicine 2014.
David Klemperer, 19.2.15
Sicher nutzlos aber verbreitet: Krebsfrüherkennung bei Alten und Kranken
 Dieser Beitrag ist umgezogen und jetzt hier zu finden: Link.
Dieser Beitrag ist umgezogen und jetzt hier zu finden: Link.
David Klemperer, 25.10.14
16% oder 0,3% - Relativ oder absolut und was folgt daraus für das Screening von Lungenkrebs?
 Auch in Deutschland hat sich vor allem durch die Arbeiten des Harding Center for risk literacy am Max-Planckinstitut für Bildungsforschung in Berlin und seines Direktors Gerd Gigerenzer bei immer mehr Menschen die Erkenntnis durchgesetzt, dass bei den Effekten von Interventionen und den daraus gezogenen Schlüssen für diagnostische und therapeutische Angebote sorgsam auf die Werte für relative und absolute Risikoveränderungen geachtet bzw. zwischen ihnen unterschieden werden muss.
Auch in Deutschland hat sich vor allem durch die Arbeiten des Harding Center for risk literacy am Max-Planckinstitut für Bildungsforschung in Berlin und seines Direktors Gerd Gigerenzer bei immer mehr Menschen die Erkenntnis durchgesetzt, dass bei den Effekten von Interventionen und den daraus gezogenen Schlüssen für diagnostische und therapeutische Angebote sorgsam auf die Werte für relative und absolute Risikoveränderungen geachtet bzw. zwischen ihnen unterschieden werden muss.
Dass es sich dabei aber keineswegs bereits um versorgungswissenschaftliches Allgemeingut handelt, zeigt z.B. die gerade in der Fachzeitschrift "JAMA Internal Medicine" geführte Debatte daüber, ob Medicare- und Medicaid-Versicherten eine Screeninguntersuchung auf Lungenkrebs mit einer niedrig dosierten Computertomographie bezahlt werden sollte oder nicht. Für diese Entscheidung sind in den USA die "Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS)" zuständig.
Ein erster Autor kam nach einer Analyse der Daten des "National Lung Screening Trial" für 53.454 Personen zwischen 55 und 74 Jahren zu dem Schluss, der Nutzen des Screenings sehr größer als die Risiken z.B. durch die immer noch vorhandene Strahlenbelastung. Es gäbe "a substantial improvement in lung cancer mortality among screened patients" und mögliche unerwünschte Folgen könnten durch einen kritischen Umgang mit der Untersuchung verhindert werden. Der Durchschnittswert der Sterblichkeitsreduktion von 16% verbirgt im Übrigen erhebliche Unterschiede zwischen Männen und Frauen. Die relative Reduktion betrug bei Frauen 27% und 8% bei Männern.
In einem zweiten Beitrag kommen seine AutorInnen bereits bei der Datenanalyse zu anderen, weil differenzierteren Ergebnissen. Die dem Screening zugeschriebene relative Reduktion der Sterblichkeit an Lungenkrebs von 16% könne man nur beurteilen, wenn man auch zur Kenntnis nähme, dass die absolute Reduktion des Risikos 0,3% betrage, die Anzahl der Gestorbenen also von 21 auf 18 Tote pro 1.000 Personen gesunken ist. Auf der anderen Seite dieser gar nicht mehr so blendenden Bilanz stehen außerdem 16 an den Folgen der Vielzahl diagnostischer Verfahren (z.B. in der Folge der 10.246 Tomogramm-Analysen, 671 Bronchoskopien, 322 perkutane Biopsien, 713 Operationen) gestorbenen Personen und 228 Komplikationen, von denen 86 groß waren.
Da es die AutorInnen sowohl für unklar halten "if routine screening would result in net good or net harm" als auch ein großes Potenzial an "false-positive results, patient anxiety, radiation exposure, numerous diagnostic workups, and the complications of these workups" sehen, raten sie trotz der auch sie beschäftigenden großen Anzahl von Lungenkrebskranken zur Zurückhaltung bei der Aufnahme des CT-Screenings in den Leistungskatalog der staatlichen Krankenversicherungen.
In ihrer Schlussbemerkung weisen sie schließlich noch auf eine andere möglicherweise unerwünschte Folge der Konzentration der Leistungspolitik auf ein CT-Screening hin: "In any event, enthusiasm for low-dose CT screening should not draw attention or resources away from the priority of tobacco control."
Dass dies nicht an den Haaren herbeigezogen ist, deutet schließlich auch noch eine Herausgebernotiz an: "The decision about low-dose CT is one of the most consequential and closely watched coverage determinations that CMS has had to make in many years. … As CMS deliberates, an intensive lobbying effort is under way to influence the decision, with support from industry and various professional and advocacy organizations. In June 2014, 45 US Senators and 134 House Representatives, from both political parties, separately wrote to CMS to advocate for low-dose CT scans."
Der erste Beitrag unter dem Titel The Importance of Lung Cancer Screening With Low-Dose Computed Tomography for Medicare Beneficiaries von Douglas E. Wood ist online first am 13. Oktober 2014 in der Zeitschrift "JAMA Internal Medicine" erschienen. Ein Abstract ist kostenlos erhältlich.
Der zweite Beitrag Low-Dose Computed Tomography Screening for Lung CancerHow Strong Is the Evidence? von Steven H. Woolf et al. ist ebenfalls online first in derselben Ausgabe erschienen, und auch von ihm gibt es frei zugänglich das Abstract.
Die Editor's Note Lung Cancer Screening With Low-Dose Computed Tomography for Medicare Beneficiaries von Robert Steinbrook komplettiert das Bild in derselben Zeitschrift.
Bei dieser Gelegenheit sei auch erneut auf die Rubrik der "Unstatistik des Monats" auf der Website des Harding-Centers hingewiesen, wo es sehr oft um vorsätzlich oder aus Unwissen aufgebauschte und dramatisierende Gesundheitsstatistiken geht.
Bernard Braun, 19.10.14
"Wenn Sie so weiter machen, kriegen Sie wahrscheinlich ohne Statine bald einen Herzinfarkt …." oder Irrtum des Risikokalkulators!?
 Bei der Kommunikation über die Folgen kardiologischer Risikofaktoren wie Blutdruck, Cholesterinwert und Übergewicht und bei Empfehlungen von entsprechenden als präventiv angesehenen Aktivitäten, spielen in Patient-Arztgesprächen relativ übersichtliche und leicht zu handhabende Kalkulatoren des Risikos an einer artheriosklerotischen Herzkreislauferkrankung zu erkranken oder durch ein ernstes kardiologisches Ereignis seine durchschnittliche Lebenserwartung zu verkürzen eine wichtige Rolle. Sie dienen auch dazu, zu entscheiden welchem Patienten z.B. Statine zur Senkung des Choilesterinspiegels verordnet werden. Die prädiktive Autorität solcher Kalkulatoren wird auch dadurch unterstrichen, dass ihr Einsatz von zahlreichen Fachgesellschaften, darunter auch durch das "American College of Cardiology (ACC)" und die "American Heart Association (AHA)" empfohlen werden - zuletzt in Leitlinien aus dem Jahr 2013.
Bei der Kommunikation über die Folgen kardiologischer Risikofaktoren wie Blutdruck, Cholesterinwert und Übergewicht und bei Empfehlungen von entsprechenden als präventiv angesehenen Aktivitäten, spielen in Patient-Arztgesprächen relativ übersichtliche und leicht zu handhabende Kalkulatoren des Risikos an einer artheriosklerotischen Herzkreislauferkrankung zu erkranken oder durch ein ernstes kardiologisches Ereignis seine durchschnittliche Lebenserwartung zu verkürzen eine wichtige Rolle. Sie dienen auch dazu, zu entscheiden welchem Patienten z.B. Statine zur Senkung des Choilesterinspiegels verordnet werden. Die prädiktive Autorität solcher Kalkulatoren wird auch dadurch unterstrichen, dass ihr Einsatz von zahlreichen Fachgesellschaften, darunter auch durch das "American College of Cardiology (ACC)" und die "American Heart Association (AHA)" empfohlen werden - zuletzt in Leitlinien aus dem Jahr 2013.
Zusätzlich zu der langjährigen Kritik an der Risikofaktorenbasierung und damit der überwiegenden Nutzung von Surrogatparametern für derartig harte Prognosen, häufen sich in den letzten Jahren Studien, die gravierende Mängel der Prädiktionskraft der Kalkulatorenprognosen nachweisen. Die mittlerweile siebte ist am 6. Oktober 201 online im us-amerikanischen Fachjournal "JAMA Internal Medicine" erschienen.
Deren empirische Basis sind Daten der großen "Women's Health Study" (WHS). Teilnehmerinnen dieser Kohortenstudie sind 39.876 us-weite Frauen zwqischen 45 und 79 Jahren, die zu Beginn der Studie im Zeitraum von 1992 bis 1995 weder an einer Herz-Kreislauferkrankung, noch an Krebs oder einer anderen schweren Krankheit litten. Von diesen Frauen wurden regelmäßig eine Reihe von Risikofaktoren, darunter alle Körperwerte, die in den kardiologischen Risikokalkulator eingehen (Blutdruck, Cholesterinwerte), und gesundheitsbezogene Verhaltensweisen sowie das Eintreten von Herzinfarkten; Schlaganfällen und anderen Herz-Kreislauf- oder Gefäßerkrankungen erfasst oder abgefragt. Dies erfolgte ebenfalls für die medikamentöse Behandlung der Risikofaktoren z.B. durch Lipide und operative Eingriffe im Bereich Herz-Kreislauf. Die Studie dauerte im Durchschnitt 10,2 Jahre.
In der jetzt vorgelegten Studie berechneten die AutorInnen mit den Risikoannahmen des aktuell verwendeten Risikokalkulators und den Werten der WHS-Teilnehmerinnen aus den Startjahren der WHS-Studie deren Risiko für das Eintreten einer Herz-Kreislauferkrankung im Verlaufe der 10 Studienjahre. Es betrug bzw. es hätte laut des Kalkulators durchschnittlich 3,6% betragen sollen. Die tatsächliche oder beobachtete Rate kardiovaskulärerer Ereignisse betrug dagegen durchschnittlich 2,2%. Die beträchtliche Überschätzung des Risikos durch den Kalkulator zeigte sich auch in einer Reihe von Teilanalysen. Dazu gehört vor allem die Untersuchung, ob das Auseinanderklaffen von Prädiktions- und Beobachtungswerten möglicherweise ein Effekt der zunehmenden Einnahme von Statinen, von gefäßerweiternden Operationen, der Untererfassung von kardiovaskulären Ereignissen oder der Gesamtheit der Studieninterventionen ist. Die empirische Häufigkeit von unerwünschten Ereignissen blieb weiter deutlich geringer als die der prognostizierten.
In einem Kommentar zu der Studienveröffentlichung weist dessen Autor auf die enormen gesundheitlichen und finanziellen Folgen der Risikoüberschätzung hin: "The implications of the overestimation of risk are profound. A 50% overestimation by the guideline risk equations would likely add millions of Americans to the roles of patients for whom statins are recommended."
Der Vorschlag des Kommentators, künftige Leitlinien und Risikokalkulatoren sollten frühzeitig öffentlich in Fachzeitschriften präsentiert und diskutiert werden, ist sicher nicht falsch. Die Reaktion des Präsidenten der AHA zeigt allerdings kaum Interesse und Bereitschaft für eine wissenschaftlich fundierte Debatte: "These comments are the same that we heard and addressed when we published the guidelines last year. Multiple publications since that time have validated the concepts and the utility of the risk assessment tool and cholesterol guidelines. In addition, we continue to receive positive feedback from healthcare providers who use the guidelines as a tool to drive discussions with their patients about appropriate care." Wahrscheinlich werden noch zahlreiche weitere unabhängige Querschnitts- und Langzeitstudien durchgeführt werden müssen, um die selbstzufriedene Feedback-Evidenz zu erschüttern. Das mögliche Risiko, dass Millionen von Menschen zu Unrecht Angst vor einem Herzinfarkt gemacht wird und sie jahrelang für sie nutzlose Medikamente einnehmen, reicht offensichtlich weder fürs Nachdenken noch fürs Umsteuern aus.
Dennoch rechtfertigt diese Studie samt ihren 7 Vorgängerinnen, die systematische Skepsis gegenüber Prognosen des Eintretens schwerer gesundheitlichen Ereignisse auf der Basis von Risikofaktoren und der daraus abgeleiteten Notwendigkeit langwieriger therapeutischer oder präventiver Interventionen.
Der Aufsatz Further Insight Into the Cardiovascular Risk CalculatorThe Roles of Statins, Revascularizations, and Underascertainment in the Women's Health Study von Nancy R. Cook und Paul M Ridker ist online first als Beitrag der Zeitschrift "JAMA Internal Medicine" am 6.10. 2014 erschienen. Ein Abstract ist frei erhältlich.
Am selben Tag und in derselben Zeitschrift erschien der Kommentar Prevention Guidelines Bad Process, Bad Outcome von Steven E. Nissen.
Bernard Braun, 15.10.14
Mammografie-Screening 3: Frauen schlecht informiert über Nutzen und Risiken
 Der Nutzen des Mammografie-Screenings ist fraglich (wir berichteten). Gynäkologen scheinen nicht dazu in der Lage, über Nutzen und Risiken zu informieren und die gesetzlich geforderte informierte Entscheidung der Betroffenen zu ermöglichen (wir berichteten).
Der Nutzen des Mammografie-Screenings ist fraglich (wir berichteten). Gynäkologen scheinen nicht dazu in der Lage, über Nutzen und Risiken zu informieren und die gesetzlich geforderte informierte Entscheidung der Betroffenen zu ermöglichen (wir berichteten).
Norbert Schmacke und Marie-Luise Dierks testeten in Untersuchung für den Bertelsmann Gesundheitsmonitor einige Aspekte des Brustkrebs- und Screening-Wissens von 1852 Frauen, die in der BARMER GEK versichert sind und aktuell oder in naher Zukunft einen Anspruch auf die Screening-Mammografie haben.
Als grundlegende und notwendige Informationen für eine informierte Entscheidung zur Früherkennung gelten entsprechend der "Guten Praxis Gesundheitsinformation":
1. Das Risiko für das Vorliegen der jeweiligen Krebserkrankung (Prävalenz).
2. Der Nutzen der Früherkennung dieser Krebserkrankung.
3. Die Risiken der Früherkennung.
Die anspruchsberechtigten Frauen hatten mit dem Einladungsschreiben ein Merkblatt des Gemeinsamen Bundesausschusses zum Mammografie-Screening erhalten, das zuletzt 2010 überarbeitet wurde und über Vor- und Nachteile des Programms aufklären soll (Website, Download).
Zu diesem Merkblatt sei ausdrücklich angemerkt, dass es - im Gegensatz zu vielen anderen Informationsmaterialien - einen großen Fortschritt darstellt, weil die darin enthaltenen Informationen zutreffend sind und keinen werbenden Charakter haben (wir berichteten).
Trotzdem ist das Wissen der Frauen, die das Merkblatt erhalten haben, nicht besser als das Wissen derjenigen, die es noch nicht erhalten haben. Dies dürfte im Wesentlichen darauf zurückzuführen sein, dass zugesandte Informationsmaterialien nur von einer Minderheit überhaupt gelesen werden. Darüber hinaus dürfte aber auch die Verständlichkeit des Merkblatts verbesserungsfähig sein.
Aktuelles Brustkrebsrisiko: Das Risiko für das Vorliegen von Brustkrebs wird im Merkblatt eher unklar ausgedrückt: eine von 20 Frauen erkranke im Alter zwischen 50 und 69 Jahre an Brustkrebs (S. 4). Das Sterberisiko verbirgt sich in folgendem Satz: "Rund 17.500 Frauen sterben jährlich an Brustkrebs, im Alter zwischen 50 und 69 Jahren etwa eine von 80 Frauen." (S. 4) Aus diesen Angaben das individuelle Risiko abzuleiten, dürfte den meisten Frauen Schwierigkeiten bereiten (dem Autor dieses Beitrags auch).
Da in der Studie nicht nach dem Wissen um die Brustkrebsprävalenz gefragt wird, ist der Wissensstand um dieses Grundrisiko nicht beurteilbar.
Nutzen des Mammografie-Screenings: Die Senkung der Brustkrebssterblichkeit lässt sich im Merkblatt aus folgender Aussage ableiten (S. 11): "1 von 200 Frauen wird dank ihrer regelmäßigen Teilnahme [über 20 Jahre] vor dem Tod durch Brustkrebs bewahrt." Gerade einmal 4% nennen diese Zahl (bzw. 5 von 1000). Die Antworten liegen zwischen 0 und 999 bei einem Median von 100. 30% sind hingegen der sachlich falschen Meinung, dass die Screening-Untersuchung vor Brustkrebs schützt.
Das Nutzenkriterium Minderung der Gesamtsterblichkeit wird im Merkblatt nicht genannt und in der vorliegenden Studie nicht angesprochen. Ein Nachweis für die Senkung der Gesamtsterblichkeit ist bislang für das Mammografie-Screening - wie auch für andere Krebsscreenings - nicht erbracht.
Risiken des Mammografie-Screenings: Zu dem Problem der falsch positiven Befunde nennt das Merkblatt keine konkrete Zahl. Aus den Angaben (S. 10) lässt sich die Zahl 50 falsch positive Befunde für 200 Frauen in 20 Jahren ableiten. Auf die Frage nach dem Vorkommen eines "falschen Verdachts" antworten 32% mit "häufig oder manchmal", 36% mit "selten", 4% mit "nie" und 28% mit "weiß nicht".
Das Merkblatt enthält keine Zahlenangabe zu falsch negativen Befunden, die in der Studie als "vorhandene Krankheit übersehen" bezeichnet werden. Nach Meinung von 4% kommen falsch negative Befunde überhaupt nicht vor, 36% antworten mit "selten", 32% mit "häufig/manchmal" und 28% mit "weiß nicht".
Die Frage nach Überdiagnose und Übertherapie ("Durch eine Früherkennung wird eine Krankheit entdeckt, die niemals ausbrechen würde") beantworten 3% mit häufig, 13% mit "manchmal", 19% mit "selten", 19% mit "nie" und 46 % mit "weiß nicht".
Die Studie zeigt, dass das Wissen von Frauen, auch wenn sie bereits am Screening teilgenommen haben, Minimalanforderungen für eine informierte Entscheidung nicht entspricht. Das Basisrisiko wird nicht vermittelt und entsprechend falsch und überhöht eingeschätzt ebenso wie die Minderung des Brustkrebssterberisikos durch das Mammografie-Screening.
Die Einschätzungen und Entscheidungen der Frauen gründen daher auf falschen Zahlen, unrealistischen Annahmen und falschen Hoffnungen - ein allein aus ethischen Gründen unhaltbarer Zustand. Auch wird die gesetzliche Anforderung nach informierter Entscheidung offensichtlich in keiner Weise erfüllt.
2 Ansatzpunkte zur Verbesserung dürften deutlich sein.
• Die Ärzte müssen lernen, die grundlegenden Informationen über Screening zu vermitteln. Dafür müssen sie diese Grundkenntnisse erst einmal selbst erwerben.
• Das Merkblatt des Gemeinsamen Bundesausschusses muss so überarbeitet werden, dass die grundlegenden Informationen, die zur Entscheidung für oder gegen das Screening erforderlich sind, bei den Leserinnen ankommen.
Notwendig dürfte aber an erster Stelle sein, dass die Verantwortlichen - Politik, gemeinsame Selbstverwaltung/Gemeinsamer Bundesausschuss und die ärztliche Selbstverwaltung/Ärztekammern - ihre Verantwortung erkennen und entsprechend handeln.
Schmacke N, Dierks ML. Mammografie-Screening und informierte Entscheidung - mehr Fragen als Antworten. Gesundheitsmonitor Bertelsmann-Stiftung. 2014 Download
Merkblatt des zum Mammografie-Screening Download
Forum Gesundheitspolitik. Mammografie-Screening 1: Nutzen fraglich, wenn dann bestenfalls gering Link
Forum Gesundheitspolitik. Mammografie-Screening 2 Link
David Klemperer, 21.4.14
Mammografie-Screening 2: Gynäkologen schlecht informiert über Nutzen und Risiken
 Durch das Krebsfrüherkennungs- und -registergesetz - KFRG (Text), das am 9.4.2013 in Kraft getreten ist, haben die in der gesetzlichen Krankenversicherung Versicherten das Anrecht auf "umfassende
Durch das Krebsfrüherkennungs- und -registergesetz - KFRG (Text), das am 9.4.2013 in Kraft getreten ist, haben die in der gesetzlichen Krankenversicherung Versicherten das Anrecht auf "umfassende
und verständliche Information (...) über Nutzen und Risiken der jeweiligen
[Früherkennungs-]Untersuchung".
Diese Formulierung aus dem neuen § 25a SGB V (Text) stellt ein Art Zeitenwende dar, denn die Politik anerkannte hiermit die Erkenntnis, dass Krankheitsfrüherkennung stets mit Nutzen und Risiken verbunden ist. Sie folgte damit einmütigen Empfehlungen von zwei Arbeitsgruppen des Nationalen Krebsplans (Ziel 1 Inanspruchnahme Krebsfrüherkennung, Ziel 11a Verbesserung der Informationsangebote).
In der Begründung zum Gesetzentwurf der Bundesregierung (Download, S.36) wurde die problematische Seite der Früherkennung - falsch positive Befunde sowie Überdiagnose und Übertherapie -klar benannt:
"Denn auch bevölkerungsmedizinisch sinnvolle und empfehlenswerte Krebsfrüherkennungsmaßnahmen beinhalten für die gesunde bzw. beschwerdefreie Person ein Risiko. Hierzu gehören neben den Risiken der Untersuchung selbst die Konsequenzen falsch-negativer oder falsch-positiver Testbefunde, invasive Abklärungsuntersuchungen (z. B. die Entnahme von Gewebeproben) sowie die mögliche Diagnose und Behandlung von Krebserkrankungen, von denen die Person ohne die Früherkennung in ihrem Leben nie etwas gemerkt hätte."
Daher sollen die Betroffenen neutral und unabhängig informiert und beraten werden, so dass sie eine ihren Präferenzen entsprechende Entscheidung treffen können. Das Ziel einer informierten individuellen Entscheidung sei dem Ziel einer möglichst hohen Teilnahmerate übergeordnet.
Voraussetzung für die Erfüllung der Anforderungen, die das Gesetz stellt, sind gut informierte Ärzte und Patienten.
Als grundlegende Informationen für eine informierte Entscheidung zur Früherkennung gelten entsprechend der "Guten Praxis Gesundheitsinformation":
1. Das Risiko für das Vorliegen der jeweiligen Krebserkrankung (Prävalenz).
2. Der Nutzen der Früherkennung dieser Krebserkrankung.
3. Die Risiken der Früherkennung.
Odette Wegwarth und Gerd Gigerenzer vom Harding Center for Risk Literacy untersuchten kürzlich die Qualität ärztlicher Beratung zur Brustkrebsfrüherkennung.
20 Gynäkologen wurden in einer realen telefonischen Beratungssituation getestet. Die Anruferin gab sich als besorgte Tochter aus, ihre 55-jährige Mutter habe eine Einladung zum Mammografie-Screening erhalten. Die Situation war also im Sinne einer Hidden-Client-Untersuchung gestaltet, die Ärzte wussten nicht, dass es sich um einen Test handelt. Im Folgenden werden die nach aktuellem Wissensstand zutreffenden Informationen für 55-jährige Frauen, die über 10 Jahre regelmäßig am Mammografie-Screening teilnehmen genannt. Dem werden die Angaben der Gynäkologen gegenübergestellt.
Aktuelles Brustkrebsrisiko 55-jähriger Frauen: 1,5% , d.h. von 1000 haben 15 Brustkrebs und 985 keinen Brustkrebs.
9 der 20 Gynäkologen machten dazu Angaben. 3 machten die qualitative Angabe, es handele sich um den häufigsten Krebs der Frau. 6 nannten Zahlen. Ein Gynäkologe nannte die Zahl 25,4%, die anderen 10%. Während die Herkunft der Angabe 25,4% im Dunklen bleiben dürfte, beziehen sich die 10% auf das Lebenszeitrisiko
Nutzen des Mammografie-Screenings: 4 statt 5 von 1000 Frauen sterben an Brustkrebs. Die Gesamtsterblichkeit ist nicht gemindert.
17 der 20 Gynäkologen rieten ausdrücklich zur Mammographie als sichere und wissenschaftliche begründete Intervention. Die Zahlenangaben zum Nutzen lagen zwischen 20 und 50% der Brustkrebssterblichkeit, mehrheitlich bei 25%, entsprechend einer früheren Berechnung der Sterblichkeitssenkung von 4 auf 3 pro 1000 Frauen.
Ein Gynäkologe behauptete, die Inzidenz könne durch Screening gesenkt werden. Nur einer der 20 Gynäkologen wies darauf hin, dass es unbewiesen sei, ob das Screening die Gesamtmortalität senke.
Risiken des Mammografie-Screenings: zwischen 50 und 200 Frauen erhalten einen falsch positiven Befund ("falscher Alarm"); 5 Frauen erhalten eine Überdiagnose (Tumor wäre nie symptomatisch geworden) mit Übertherapie; 1 bis 2 Frauen erhalten einen falsch negativen Befund (Brustkrebs wird nicht erkannt). Das Risiko für Brustkrebs durch die Röntgenstrahlen liegt unter 1 Fall von 1000 Frauen.
8 Gynäkologen bezeichneten das Mammografie-Screening ohne weiteren Kommentar als harmlos, 5 sprachen das Strahlenrisiko an, 3 bezeichneten es als vernachlässigbar. 8 nannten falsch positive Ergebnisse, deren Bedeutung 5 von ihnen ohne Zahlenangabe als vernachlässigbar bezeichneten, 3 nannten falsch negative Ergebnisse, deren Rate sie zwischen 10 und 60% angaben. Keiner der 20 Gynäkologen erwähnte das Risiko der Überdiagnose und der Überbehandlung.
Risikokommunikation: Die Prävalenz sowie den Nutzen und die Risiken stellten nur eine Minderheit der Gynäkologen in Form von Zahlen dar. 7 der 20 Gynäkologen kommunizierten den Nutzen und 3 die Risiken numerisch. Dabei wurde der Nutzen als relatives Risiko und die Risiken als absolutes Risiko dargestellt, was das Verhältnis von Nutzen und Risiken sehr viel günstiger erscheinen lässt, als bei einheitlicher Darstellung von Nutzen und Risiken als absolutes Risiko.
Das Fazit dieser Untersuchung kann nur lauten: Die beratenden Gynäkologen zeigten sich ausgesprochen schlecht informiert. Die Nicht-Erwähnung gravierender Risiken erscheint bedenklich. Die Fähigkeiten, Wahrscheinlichkeiten bzw. Risiken zu kommunizieren sind nicht entwickelt. Einschränkend ist anzumerken, dass die Untersuchung nicht repräsentativ ist. Es dürfte aber eher unwahrscheinlich ein, dass eine größere Studie grundlegend bessere Ergebnisse erzielen würde. Es erscheint müßig, die Gynäkologen bezüglich ihrer Unwissenheit zu beschuldigen. In der Verantwortung steht vielmehr die ärztliche Selbstverwaltung, deren Auftrag auch darin besteht, die Einhaltung der Berufspflichten sicherzustellen. Auch die medizinischen Fachgesellschaften sollten sich angesprochen fühlen.
Diese Studie ergänzt das Wissen um die Unwissenheit und das Unverständnis vieler Ärzte bezüglich der Grundlagen von Screening, wie bereits im Forum berichtet ("Dramatische Wissenslücken: Ärzte und Früherkennung").
Das Ergebnis der Unwissenheit der Ärzte über die Grunddaten des Mammografie-Screenings ist Unwissenheit auf Seiten der Patientinnen, wie Norbert Schmacke und Marie-Luise Dierks in einer Untersuchung für den Bertelsmann Gesundheitsmonitor dargestellt haben. Dazu erscheint in Kürze ein eigener Forum-Beitrag.
Wegwarth O, Gigerenzer G. "There is nothing to worry about": Gynecologists' counseling on mammography. Patient Education and Counseling 2011;84:251-6. Abstract
Wegwarth O, Gigerenzer G. Risikokommunikation: Risiken und Unsicherheiten richtig verstehen lernen. Dtsch Arztebl 2011;108:A-448 / B-360
Welch HG, Black WC. Overdiagnosis in Cancer. Journal of the National Cancer Institute 2010;102:605-13.
Schmacke N, Dierks ML. Mammografie-Screening und informierte Entscheidung - mehr Fragen als Antworten. Gesundheitsmonitor Bertelsmann-Stiftung. 2014 Download
Forum Gesundheitspolitik. Mammografie-Screening 1: Nutzen fraglich, wenn dann bestenfalls gering Link
Forum Gesundheitspolitik. Mammografie-Screening 3: Frauen schlecht informiert über Nutzen und Risiken Link
David Klemperer, 20.4.14
Mammografie-Screening 1: Nutzen fraglich, wenn dann bestenfalls gering
 Die Früherkennung von Brustkrebs steht immer wieder in der Diskussion und wurde auch im Forum mehrfach angesprochen (Link). Grund dafür sind widersprüchliche Studienergebnisse. Das aktuelle Fazit lautet: Studien von höherer methodischer Qualität und damit niedrigerer Wahrscheinlichkeit der Verfälschung der Ergebnisse zeigen keinen Vorteil für die Früherkennung von Brustkrebs. Die Studien, welche eine Minderung der Brustkrebssterblichkeit berichten, weisen durchweg methodische Mängel auf, so dass die Ergebnisse fragwürdig sind.
Die Früherkennung von Brustkrebs steht immer wieder in der Diskussion und wurde auch im Forum mehrfach angesprochen (Link). Grund dafür sind widersprüchliche Studienergebnisse. Das aktuelle Fazit lautet: Studien von höherer methodischer Qualität und damit niedrigerer Wahrscheinlichkeit der Verfälschung der Ergebnisse zeigen keinen Vorteil für die Früherkennung von Brustkrebs. Die Studien, welche eine Minderung der Brustkrebssterblichkeit berichten, weisen durchweg methodische Mängel auf, so dass die Ergebnisse fragwürdig sind.
Dazu einige im Forum noch nicht dargestellte Informationen.
Eine im Juni 2013 erschienen aktualisierte Cochrane Review zum Brustkrebsscreening mit Mammografie wertete die Daten von 7 randomisierten kontrollierten Studie mit insgesamt etwa 500.000 Frauen aus (Abstract, Volltext).
3 dieser Studien, denen die Autoren geringes Verzerrungsrisiko bescheinigen, ergaben nach 13 Jahren Nachbeobachtung eine Minderung der Brustkrebssterblichkeit um 10%, ein Wert der statistisch nicht signifikant ist, also möglicherweise dem Zufall geschuldet ist. 4 Studien mit methodischen Mängeln, die zur Verfälschung der Ergebnisse führen können, zeigten eine Minderung der Brustkrebssterblichkeit um 25%. Zählt man die Ergebnisse der 7 Studien ungeachtet der Qualitätsprobleme zusammen, ergibt sich eine Minderung der Brustkrebssterblichkeit durch Früherkennung um 19%.
Die Rate der brusterhaltenden Operationen (Lumpektomie) war in der Früherkennungsgruppe um ein knappes Drittel höher (31%), die Rate für die operative Entfernung der Brust (Mastektomie) war um 20% höher als in der Vergleichsgruppe ohne Früherkennung. Der Anteil von Frauen, die Chemotherapie erhielten war hingegen in beiden Gruppen gleich.
Auf Grundlage der Annahme, dass Screening die Brustkrebssterblichkeit um 15% senkt und die Überdiagnose und Überbehandlung 30% betragen, kommen die Autoren zu folgendem Ergebnis.
Wenn 2000 Frauen 10 Jahre an einem Screening-Programm teilnehmen
• vermeidet eine Frau den Tod an Brustkrebs
• erhalten 10 gesunde Frauen die Diagnose Brustkrebs für einen Tumor, der sich nie bemerkbar gemacht hätte (Überdiagnose) und werden unnötig behandelt (Übertherapie)
• erhalten 200 Frauen einen falsch positiven Screening-Befund, d.h. die Mammographie zeigt eine Verdichtung, die sich bei der Abklärung als gutartig erweist.
Die Studien reichen bis in die 1960er-Jahre zurück. Die Autoren weisen darauf hin, dass seitdem erhebliche Fortschritte in der Behandlung von Brustkrebs erzielt worden seien und daher der - wenn überhaupt vorhanden geringe - Nutzen der Früherkennung noch geschrumpft sein dürfte.
Zur Nachdenklichkeit Anlass geben auch die im Februar 2014 veröffentlichten aktualisierten Ergebnisse der Kanadischen National Breast Screening Study, einer der 3 methodisch hochwertigen Studien, die in die oben genannte Cochrane Review eingegangen ist. In dieser randomisierten kontrollierten Studie wurden im Jahr 1980 knapp 90.000 Frauen im Alter von 40 bis 59 Jahren in zwei Gruppen aufgeteilt. In 25 Jahren wurde bei 3250 Frauen in der Mammografie-Screeninggruppe Brustkrebs diagnostiziert, und bei 3133 Frauen in der Kontrollgruppe. 500 Frauen in der Screeninggruppe und 505 Frauen in der Kontrollgruppe starben an Brustkrebs. In der Screeninggruppe wurden 106 Brustkrebsfälle mehr gezählt als in der Kontrollgruppe, somit sind 22% aller Brustkrebsfälle in der Screeninggruppe Überdiagnosen. Eine Minderung der Brustkrebssterblichkeit wurde weder in der Gruppe der 40- bis 49-Jährigen noch in der Gruppe der 50- bis 59-Jährigen festgestellt.
Angemerkt sei noch Folgendes: Früherkennung von Krebs soll bewirken, dass weniger Menschen am jeweiligen Krebs sterben und dass dadurch insgesamt weniger Menschen in einem definierten Zeitraum sterben. Letzteres, also die Verbesserung des Gesamtüberlebens und somit eine Verbesserung der Lebenserwartung durch Krebsfrüherkennung, hat bislang keine Studie belegen können.
Noch vor Erscheinen der aktualisierten Ergebnisse aus Kanada hatte das Fachgremium im Swiss Medical Board Nutzen und Risiken der Brustkrebs-Früherkennung in einem 83-seitigen Bericht bilanziert und schlussfolgernd von der Einführung systematischer Mammographie-Screening-Programme abgeraten und zur Befristung bestehender Programme geraten.
Gøtzsche PC, Jørgensen KJ. Screening for breast cancer with mammography. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 6. Art. No.: CD001877. DOI: 10.1002/14651858.CD001877.pub5. Abstract Volltext
Informationsbroschüre der Autoren zum Mammografie-Screening Link
Miller AB, Wall C, Baines CJ, Sun P, To T, Narod SA. Twenty five year follow-up for breast cancer incidence and mortality of the Canadian National Breast Screening Study: randomised screening trial. BMJ 2014;348. Abstract Volltext
New York Times 11.2.2014 Vast Study Casts Doubts on Value of Mammograms Link
Swiss Medical Board. Systematisches Mammographie-Screening. Download Bericht, Download Pressemitteilung
Dazu eine Veröffentlichung im New England Journal of Medicine
Biller-Andorno N, Jüni P. Abolishing Mammography Screening Programs? A View from the Swiss Medical Board April 16, 2014 Link
Im Bereich "Comments" eine erwartbare lebhafte Diskussion.
Forum Gesundheitspolitik. Mammografie-Screening 2: Gynäkologen schlecht informiert über Nutzen und Risiken Link
Forum Gesundheitspolitik. Mammografie-Screening 3: Frauen schlecht informiert über Nutzen und Risiken Link
David Klemperer, 16.4.14
Vorsicht "Bluttests": Über- und Fehlversorgung durch umfassende und wiederholte Leberfunktionstests
 Umfassende Untersuchungen des Blutes und anderer Körperstoffe sowie diverser physikalischer oder seelischer Funktionen tragen zu einem Boom diagnostischer Leistungen als Kassen- oder Privatleistung bei. Dafür verantwortlich sind zum einen Ärzte, die eine "Null-Risiko"- oder Defensivmedizin betreiben aber auch PatientInnen, die glauben, ihr Erkrankungsrisiko durch möglichst umfassendes Durchchecken oder Früherkennen ebenfalls auf Null senken zu können. Ein fördernder Faktor sind außerdem die Fortschritte der Labor- und Analysetechnik der letzten Jahre, die innerhalb kürzester Zeit umfassende, exakt bewertete und Gewissheit versprechende Testergebnisse liefern. Dass dadurch möglicherweise eine gesundheitlich nicht notwendige oder nützliche aber teure Über- oder Fehlversorgung oder gar gesundheitliche Nachteile entstehen, ist Gegenstand zahlreicher versorgungswissenschaftlicher Analysen der letzten zehn bis fünfzehn Jahre.
Umfassende Untersuchungen des Blutes und anderer Körperstoffe sowie diverser physikalischer oder seelischer Funktionen tragen zu einem Boom diagnostischer Leistungen als Kassen- oder Privatleistung bei. Dafür verantwortlich sind zum einen Ärzte, die eine "Null-Risiko"- oder Defensivmedizin betreiben aber auch PatientInnen, die glauben, ihr Erkrankungsrisiko durch möglichst umfassendes Durchchecken oder Früherkennen ebenfalls auf Null senken zu können. Ein fördernder Faktor sind außerdem die Fortschritte der Labor- und Analysetechnik der letzten Jahre, die innerhalb kürzester Zeit umfassende, exakt bewertete und Gewissheit versprechende Testergebnisse liefern. Dass dadurch möglicherweise eine gesundheitlich nicht notwendige oder nützliche aber teure Über- oder Fehlversorgung oder gar gesundheitliche Nachteile entstehen, ist Gegenstand zahlreicher versorgungswissenschaftlicher Analysen der letzten zehn bis fünfzehn Jahre.
Was dies konkret bedeuten kann, zeigt ein im Juli 2013 in Großbritannien veröffentlichter Health-Technology-Assessement (HTA)-Report über den in der Regel sechs bis acht Werte untersuchenden Leberfunktionstest (LFT). Der Report und seine Schlussfolgerungen basieren im Wesentlichen auf der so genannten "Birmingham and Lambeth Liver Evaluation Testing Strategies (BALLETS)"-Studie, in der die Resultate der auch in Großbritannien weitverbreiteten Leberfunktionstests von 1.290 PatientInnen mit abnormalen Testergebnissen untersucht wurden. Die gesundheitliche Entwicklung dieser PatientInnen wurde über zwei Jahre beobachtet.
Die wesentlichen Ergebnisse der BALLETS-Studie lauteten:
• Weniger als 5% der Personen mit abnormalen LFT-Ergebnissen hatten eine spezifische Lebererkrankung. Eine ernsthafte Lebererkrankung, die eine sofortige Therapie verlangte, wurde in 1,3% aller Fälle entdeckt. Die Wissenschaftler fassen dies so zusammen: "It is unusual for an abnormal LFT result to signify a serious treatable disease of which the doctor was previously unaware."
• Die Mehrheit ernsthafter oder potenziell ernsthafter Erkrankungen können durch die Bestimmung von zwei Leberwerten entdeckt werden, erfordern also keinen umfassenden LFT. Dabei handelt es sich um die Bestimmung des Aminotransferase (ALT) und Alkalische Phosphatase (ALP)-Werts.
• Am häufigsten abnormal war das so genannte Gamma-Glutamyltransferase- oder GGT-Enzym eines LFT. Hier gab es aber auch die höchste falsch-positive Rate.
• Die in Leitlinien enthaltene Empfehlung, den LFT nach abnormalen Ergebnissen "zur Sicherheit" zu wiederholen, ist laut der BALLETS-Studie unsinnig und erhöht eher die negativen Folgen wie z.B. die Angst der untersuchten Personen vor den meist schweren Lebererkrankungen. Bei der Wiederholung innerhalb des ersten Monats nach dem Erst-Test lieferten 84% weiterhin abnormale Werte und sogar nach 2 Jahren blieben 75% aller Tests abnormal. Die WissenschaftlerInnen empfehlen dagegen die Durchführung weniger spezifischer Tests aus einem stufenweisen "dropdown"-Menu vorhandener Tests.
• LFTs sollten in der primärärztlichen Versorgung sparsam eingesetzt werden. Das Standardrepertoire von fünf bis acht Einzeltests "is obsolete".
• LFTs werden nach den Erkenntnissen der Studienverantwortlichen meist aus sozialen und psychologischen, weniger aus klinischen Gründen durchgeführt. Zu den wesentlichen Motiven von Ärzten LFTs durchzuführen, gehört die Absicht eine "defensive practice" zu betreiben und "to meet perceived patient need for a 'blood test'".
• Dafür, dass die Kenntnis einzelner abnormaler Ergebnisse von LFTs und Ultraschalluntersuchungen der Leber eine gesündere Lebensweise (Stichwort Alkoholkonsum) fördern, gibt es keine gute Evidenz. Ganz im Gegenteil: "the use of serial LFTs to promote behaviour change is an unproven therapy that might do more harm than good."
• Ob Bluttests bei chronisch Kranken oder PatientInnen mit diversen unklaren Symptomen generell einen Wert haben, ist nach Meinung der WissenschaftlerInnen unklar und sollte in weiteren Studien gründlicher untersucht werden.
Der gesamte 326 Seiten lange Report oder ein kurzerScientific summary der Studie "Birmingham and Lambeth Liver Evaluation Testing Strategies (BALLETS): a prospective cohort study" von Lilford R, Bentham L, Girling A, Litchfield I, Lancashire R, Armstrong D, Jones R, Marteau T, Neuberger J, Gill P, Cramb R, Olliff S, Arnold D und Khan K [Health Technol Assess 2013;17(28)] sind kostenlos zu erhalten.
Bernard Braun, 29.8.13
Über-/Fehlversorgung mit Koloskopien für knapp ein Viertel der 70-jährigen und älteren US-BürgerInnen
 23,4% der Krebs-Screeninguntersuchungen des Darmes älterer, in der staatlichen US-Krankenversicherung für RentnerInnen versicherter Personen durch eine Koloskopie, erscheinen im Lichte einer aktuellen Untersuchung der Medicare-Routinedaten von rund 75.000 TexanerInnen im Alter von 70 und mehr Jahren könnten unangemessen gewesen sein. Diese Personen wurden zwischen 2006 und 2009 jährlich mit einer vollständigen Koloskopie untersucht. Zusätzlich untersuchten die Forscher diese Art des Screenings auch in einer bundesweiten 5%-Stichprobe von Medicare-Versicherten.
23,4% der Krebs-Screeninguntersuchungen des Darmes älterer, in der staatlichen US-Krankenversicherung für RentnerInnen versicherter Personen durch eine Koloskopie, erscheinen im Lichte einer aktuellen Untersuchung der Medicare-Routinedaten von rund 75.000 TexanerInnen im Alter von 70 und mehr Jahren könnten unangemessen gewesen sein. Diese Personen wurden zwischen 2006 und 2009 jährlich mit einer vollständigen Koloskopie untersucht. Zusätzlich untersuchten die Forscher diese Art des Screenings auch in einer bundesweiten 5%-Stichprobe von Medicare-Versicherten.
Als unangemessen wurden Koloskopien bewertet, wenn sie bei den 2008-2009 untersuchten 70- bis 75-jährigen Personen ohne klare Indikation zu früh wiederholt wurde oder ihre Durchführung im klaren Gegensatz zu den altersspezifischen Leitlinien-Empfehlungen der medizinischen Fachgesellschaft stand. Diese spricht sich gegen das Routinescreening bei Personen zwischen 76 und 85 Jahren aus und empfiehlt für diese Altersgruppe eine Screeninguntersuchung nur dann, wenn andere Faktoren für die Notwendigkeit einer Untersuchung sprechen. Patienten über 85 Jahren sollten ausschließlich beraten werden, auf eine Koloskopie zu verzichten.
Die Untersuchungswirklichkeit sah deutlich anders aus als es die Fachgesellschaft empfiehlt:
• Hinter den insgesamt 23,4% unangemessenen Koloskopien in der Texas-Kohorte standen 9.9%, 38.8% und 24.9% unangemessene Untersuchungen der 70-75-, 76-85- und über 86-jährigen Personen.
• Die Häufigkeit der unangebrachten Koloskopien schwankte zwischen den 797 Fachärzten für Koloskopie bei mehrfacher Standardisierung der Patienten nach Alter, Geschlecht etc. zwischen 45,5% und 6,7%.
• Die Fachärzte mit überdurchschnittlich hohem Anteil unangemessener Untersuchungen waren im Vergleich mit ihren Fachkollegen mit unterdurchschnittlichem Anteil unangemessener Koloskopien eher Chirurgen, mit einem Ausbildungsende vor 1990 und mit großem Untersuchungsvolumen.
• Schließlich gab es auch bei den unangemessenen Koloskopien große regionale Unterschiede zwischen 13,3% und 34,9% in Texas und 19,5% und 30,5% in den gesamten USA.
Die Bewertung dieser Versorgungssituation als Fehlversorgung erfolgt wegen des immer vorhandenen Risikos unerwünschter Nebenwirkungen der Koloskopie (z.B. Schädigungen der Darmwand, falsch positive Ergebnisse).
Auch hier kommt man um die Textbausteine "vergleichbare Ergebnisse liegen für Bayern oder DEutschland (noch) nicht vor" oder "die deutsche Versorgungsforschung hat noch genug zu tun" leider nicht herum.
Der Aufsatz Potentially Inappropriate Screening Colonoscopy in Medicare PatientsVariation by Physician and Geographic Region von Kristin M. Sheffield et al., erschienen in der Fachzeitschrift "JAMA of Internal Medicine" (2013;(online first): 1-9) ist komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 15.3.13
Wie viele Jahre müssen Darm- und Brustkrebs-Gescreente noch leben, um den Überlebensnutzen der Untersuchungen genießen zu können?
 10 Jahre müssen TeilnehmerInnen an Screeninguntersuchungen zur Früherkennung von Darm-(Teststreifen für okkultes Blut) und Brustkrebs (Mammografie) im Durchschnitt noch leben, um einen der von ihnen erwarteten oder versprochenen Nutzen, nämlich das Überleben für eine bestimmte Zeit erleben zu können.
10 Jahre müssen TeilnehmerInnen an Screeninguntersuchungen zur Früherkennung von Darm-(Teststreifen für okkultes Blut) und Brustkrebs (Mammografie) im Durchschnitt noch leben, um einen der von ihnen erwarteten oder versprochenen Nutzen, nämlich das Überleben für eine bestimmte Zeit erleben zu können.
Die Grundlage für diese Schätzung stellt erstens eine Metaanalyse der Überlebensraten in vier Darmkrebsstudien in Dänemark, Großbritannien, Schweden und den USA mit rund 31.000 bis 150.000 Teilnehmern im Alter zwischen 45 und 80 Jahren dar, in denen jährlich oder zweijährlich Tests auf okkultes Blut im Stuhl durchgeführt wurden. Zweitens lagen der Studie die Ergebnisse von fünf ebenfalls internationalen Brustkrebsscreening-Studien zugrunde, in denen rund 14.000 bis 61.000 Teilnehmerinnen im Alter von 40 bis 74 Jahren alle 12 bis 33 Monate mit einer Mammografie untersucht worden waren.
Die AutorInnen nahmen in ihrer Metaanalyse an, dass die absolute Risikoreduktion von einem krebsassoziierten Toten pro 1.000 ScreeningteilnehmerInnen ein vernünftiger Schwellenwert ist, bei dem der potenzielle Nutzen des Screenings für das Überleben die potenziellen Schädigungen oder Belastungen für die meisten Gescreenten aufwiegt. Zu den unerwünschten gesundheitlichen Folgen der beiden Screeningmethoden rechneten die WissenschaftlerInnen die Anzahl von 3 Personen pro 10.000 NutzerInnen von Teststreifen für okkultes Blut, bei denen der Befund durch eine Koloskopie validiert werden musste, die zu Darmverletzungen führte. Zu den unerwünschten Folgen der Mammografie gehört die bei einer von 1.000 mammografierten Frauen unnötigerweise durchgeführte Biopsie von Brustgewebe.
Diese Nachteile werden laut den Berechnungen dieser Metaanalyse erst nach 10 Jahren bzw. durch die erst dann erreichte Risikoreduktion oder den Gewinn beim Überleben aufgewogen.
Die wichtigste Schlussfolgerung der AutorInnen lautet: "Screening for breast and colorectal cancer should be targeted toward those patients with a life expectancy greater than 10 years".
Der Aufsatz Time lag to benefit after screening for breast and colorectal cancer: Meta-analysis of survival data from the United States, Sweden, United Kingdom, and Denmark. von Lee SJ et al. ist am 8. Januar 2013 im "British Medical Journal" (346:e8441) erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 3.3.13
"Hoch zufrieden" und als hilfreich geschätzt, nur womit und wofür? Mammografie-PR statt Argumente für informierte Teilnahme
 Folgt man den Ausführungen der Parlamentarischen Staatssekretärin im Bundesgesundheitsministerium, Annette Widmann-Mauz, zeigt eine von ihr am 18. Februar 2013 mit vorgestellte und vom Ministerium geförderte Studie eine "hohe Zufriedenheit der Frauen mit dem Mammographie-Screening. Die Ergebnisse zeigen, dass organisierte Krebsfrüherkennungsprogramme von den Menschen in Deutschland angenommen werden." Und weil alles so gut und wegweisend zu sein scheint, fährt sie fort: "Daher werden mit dem Krebsfrüherkennungs- und -registergesetz vergleichbare Programme für die Früherkennung des Gebärmutterhalskrebses und des Darmkrebses eingeführt." Was sie dabei immerhin auch für wichtig hält, ist, dass "die Menschen fundiert über die Vor- und Nachteile der jeweiligen Krebsfrüherkennungsuntersuchung informiert werden (müssen)."
Folgt man den Ausführungen der Parlamentarischen Staatssekretärin im Bundesgesundheitsministerium, Annette Widmann-Mauz, zeigt eine von ihr am 18. Februar 2013 mit vorgestellte und vom Ministerium geförderte Studie eine "hohe Zufriedenheit der Frauen mit dem Mammographie-Screening. Die Ergebnisse zeigen, dass organisierte Krebsfrüherkennungsprogramme von den Menschen in Deutschland angenommen werden." Und weil alles so gut und wegweisend zu sein scheint, fährt sie fort: "Daher werden mit dem Krebsfrüherkennungs- und -registergesetz vergleichbare Programme für die Früherkennung des Gebärmutterhalskrebses und des Darmkrebses eingeführt." Was sie dabei immerhin auch für wichtig hält, ist, dass "die Menschen fundiert über die Vor- und Nachteile der jeweiligen Krebsfrüherkennungsuntersuchung informiert werden (müssen)."
Und auf den ersten Blick sind die Ergebnisse der 2012 durchgeführten Follow-up-Befragung von 4.663 aus 13.517 ursprünglich angeschriebenen Frauen im Alter von 50 bis 69 (Rücklaufquote von 34,9%), denen das Mammografiescreening in Deutschland zumindest dem Namen nach bekannt war, und darunter 3.811, die mindestens schon einmal an dem Mammografiescreening teilgenommen haben, auch beeindruckend:
• Von den 3.811 Befragten, die bereits ein oder mehrere Male an einem Mammografie-Screening teilgenommen haben, "wird das qualitätsgesicherte Mammographie-Screening Programm überwiegend positiv beurteilt. Die Aspekte Termintreue (95,7%), Hygiene (95,1%), Kompetenz (92,7%) und Freundlichkeit (91,6%) des Personals sowie die Modernität der Geräte (90,2%) werden von fast allen teilnehmenden Frauen als positiv wahrgenommen." Bemerkenswert ist, dass sich unter den von einer großen Mehrheit positiv bewerteten Faktoren keiner aus dem harten Kern von gesundheitlichem Nutzen oder Qualität befindet.
• Rund 94 Prozent der eingeladenen Teilnehmerinnen würden erneut am Screening teilnehmen.
• Fast 95 Prozent würden Freundinnen und Bekannten das Mammographie-Screening weiterempfehlen.
Zu den Schattenseiten des Programms liefert diese Studie aber auch wichtige Ergebnisse, die jedoch leicht und (un)beabsichtigt hinter der Schlagzeilen-Zufriedenheit verschwinden.
Bereits allgemein macht die Beobachtung nachdenklich, dass sich an vielen der seit der ersten vergleichbaren Befragung im Jahr 2008 bekannten Schwachstellen trotz zahlreicher öffentlicher und kontroverser Debatten und Aufklärungskampagnen "nur geringe Veränderungen" ergeben haben.
Dabei handelt es sich um z. B. um "Wissensdefizite …, die (sich) insbesondere auf den Zusammenhang zwischen Lebensalter und Brustkrebsrisiko sowie auf eine überhöhte Erwartungshaltung an den Nutzen des Mammographie-Screening Programms im Sinne eines größtmöglichen Schutzes vor und einer Verhinderung von Brustkrebs (beziehen). Weiterer Informationsbedarf besteht vor allem hinsichtlich der Themen Sicherheit des Befundes, gesundheitliche Risiken, Unterschied zur bisherigen Mammographie und Verwendung der persönlichen Daten." Insgesamt existiert eine "Überschätzung des Nutzens" der Untersuchung.
Konkret listet die Studie dazu Folgendes auf: "Vor allem die Teilnehmerinnen neigen zu einer Überschätzung des Nutzens und gehen (fälschlicherweise - Anmerkung bb) davon aus, dass das Mammographie-Screening Brustkrebs verhindern kann (57,1%) und größtmöglichen Schutz vor Brustkrebs bietet (73,5%). Dahingegen weisen die Nicht-Teilnehmerinnen eine rationalere Einschätzung auf: nur 33,0% glauben, dass Brustkrebs durch das Screening Programm verhindert werden kann und 42,5% erwarten sich größtmöglichen Schutz durch die Teilnahme am Screening-Programm. Beide Substichproben sind skeptisch im Hinblick auf die Weiterverwendung ihrer Daten (Teilnehmerinnen: 25,5%, Nicht-Teilnehmerinnen: 31,1%) und die Möglichkeit, mit Hilfe des Screenings alle Brustkrebsarten erkennen zu können (Teilnehmerinnen: 22,5%, Nicht-Teilnehmerinnen: 31,9%)."
Trotz des offiziellen, allerdings nach Meinung von KritikerInnen zu uneingeschränkt positiven und affirmativen Einladungsschreibens fanden die StudienautorInnen zahlreiche Informationslücken und -bedürfnisse bei den potenziellen TeilnehmerInnen: "Die Teilnehmerinnen sind vor allem auf der Suche nach Informationen, die ihnen eine Rückbestätigung für ihr eigenes Verhalten liefern. Sie geben an, mehr Informationen über die Sicherheit des Befundes (67,7%), gesundheitliche Risiken (60,9%) und die Verwendung der persönlichen Daten (41,7%) haben zu wollen. Die Nicht-Teilnehmerinnen hingegen interessieren sich für Argumente, die für eine Teilnahme am Mammographie-Screening sprechen, wie die Sicherheit des Befundes (63,4%), den Unterschied zur bisherigen Mammographie (62,0%), den persönlichen Nutzen einer Teilnahme (21,3%) sowie für Informationen zum Ablauf des Screenings (16,6%)."
Angesichts der immer noch zu niedrigen Beteiligungsrate von 56% am Mammografiescreening (um wissenschaftlich belastbare Aussagen zum Nutzen des Screenings machen zu können, müssen sich nach den eigenen Kriterien der Organisatoren mindestens 70% der anspruchsberechtigten Frauen am Screening beteiligen) stellt sich u.a. die Frage, welche Einstellung die Nicht-Beteiligten zum Mammografiescreening haben.
Wie die Studie zeigt, unterscheiden sich die beiden Gruppen beträchtlich. Die Frauen, die sich an der Befragung nicht beteiligen, betrachten "die "Teilnahme an Vorsorge- und Früherkennungsmaßnahmen eher als Belastung. Die Nicht-Teilnehmerinnen haben eine negativere Einstellung zum qualitätsgesicherten Mammographie-Screening Programm und nehmen die Inhibitoren für eine Teilnahme wie Risiken und das Gefühl der Bevormundung deutlich eher wahr als die Teilnehmerinnen. Darüber hinaus sind Verdrängung und Angst bei den Nicht-Teilnehmerinnen weitere Faktoren, die eine Teilnahme am Mammographie-Screening verhindern. Innerhalb der Gruppe der Nicht-Teilnehmerinnen hat ein deutlich geringerer Anteil der Frauen mit einem Arzt über das Mammographie-Screening Programm gesprochen. Diejenigen, bei denen das Thema im Arztgespräch diskutiert wurde, haben signifikant häufiger eine neutrale Reaktion des Arztes erfahren als die Teilnehmerinnen. Im Vergleich der beiden Erhebungswellen zeigt sich, dass die kritische Haltung der eingeladenen Nicht-Teilnehmerinnen deutlich zugenommen hat, so dass eine Manifestierung der negativen Einstellung anzunehmen ist. Dies spiegelt sich auch in der Abnahme der Bereitschaft zur Teilnahme bei erneuter Einladung und der sinkenden Wahrscheinlichkeit der Weiterempfehlung einer Teilnahme wider."
Ein weiterer interessanter Teil der Studie beschäftigt sich schließlich auch noch damit, ob und wie stark die Befragten den fünf anerkannten Einstellungstypen Befürworterinnen (Anteil: 33,7%), Risikobewusste (26,0%), Ambivalente (26,3%), Verdrängerinnen (7,5%) und Ablehnerinnen (6,6%) zuzuordnen sind und wie sich diese Gruppen voneinander unterscheiden.
Mustergültig ist schließlich die Dokumentation des Fragebogens im Anhang des Berichts.
Der bereits auf den 22. Oktober 2012 datierte aber erst am 18. Februar veröffentlichte 70-seitige wissenschaftliche Bericht "Inanspruchnahme des qualitätsgesicherten Mammographie-Screenings - Follow-Up Studie 2012" von den Koordinatorinnen Hilde Schulte,Irmgard Nass-Griegoleit sowie den WissenschaftlerInnen Ute-Susann Albert und Sabine Fischbeck, kann kostenlos über die Website des BMG heruntergeladen werden.
Bernard Braun, 19.2.13
"Auf den Hund gekommen" - Medizinisch-animalisch-olfaktorischer Fortschritt beim Umgang mit nosokomialen Infektionen in Holland
 Seit einigen Jahren treten in europäischen und nordamerikanischen Kliniken immer mehr Erkrankungen mit dem bei rund 30% der Krankenhauspatienten zunächst harmlos vorhandenen Bakterium Clostridium difficile auf. Beim Einsatz von Antibiotika gegen andere Erreger kann sich dieses Bakterium stark vermehren und dabei giftige Stoffe produzieren. Die betroffenen Patienten leiden an mildem Durchfall aber auch an schweren Erkrankungen wie einer pseudomembranösen Colitis und einer erheblichen Ausdehnung des Darmes (dem toxischen Megacolon). Die durchschnittliche Inzidenz von Clostridium difficile beträgt 17,5 bis 23 Fälle pro 10.000 Krankenhauseinweisungen. In Großbritannien liegt der Wert im Moment bereits bei 50 Fällen.
Seit einigen Jahren treten in europäischen und nordamerikanischen Kliniken immer mehr Erkrankungen mit dem bei rund 30% der Krankenhauspatienten zunächst harmlos vorhandenen Bakterium Clostridium difficile auf. Beim Einsatz von Antibiotika gegen andere Erreger kann sich dieses Bakterium stark vermehren und dabei giftige Stoffe produzieren. Die betroffenen Patienten leiden an mildem Durchfall aber auch an schweren Erkrankungen wie einer pseudomembranösen Colitis und einer erheblichen Ausdehnung des Darmes (dem toxischen Megacolon). Die durchschnittliche Inzidenz von Clostridium difficile beträgt 17,5 bis 23 Fälle pro 10.000 Krankenhauseinweisungen. In Großbritannien liegt der Wert im Moment bereits bei 50 Fällen.
Um die riskante Verbreitung des Bakteriums innerhalb des Krankenhauses zu verhindern, ist es wichtig zu wissen, welche PatientInnen infiziert sind, um diese dann, wenn die weiteren Voraussetzungen für die genannten Folgerisiken gegeben sind, zu isolieren. Die Routinemethode, der Nachweis durch eine Bakterienkultur, dauert aber zwei bis drei Tage, während denen die Verbreitung des Bakteriums ungehindert möglich ist.
In zwei großen niederländischen Krankenhäusern, die wie alle Kliniken in den Niederlanden generell mehr tun als deutsche Krankenhäuser, um die Infektionen mit multiresistenten Keimen zu verhindern, wurde jetzt untersucht, ob Hunde mit ihrem enormen Geruchssinn eingesetzt werden könnten, um in Stuhlproben oder direkt bei PatientInnen Clostridium difficile-Erreger über den ihnen eigenen "Pferdemistgeruch" in kürzester Zeit identifizieren zu können.
In einer explorativen Studie und in einer Art Fall-Kontrollstudie wurde ein zweijähriger Beagle trainiert, diesen Geruch zu identifizieren. In einem Test mit 30 infizierten Patienten und 270 Angehörigen einer Kontrollgruppe von Nichtinfizierten musste der Hund seine Fähigkeiten zusammen mit seinem Trainer auf die Probe stellen lassen. Dieser Trainer wusste nicht, welche Personen infiziert waren. In einer Gruppe von 10 Patienten waren jedes Mal eine infizierte und 9 nichtinfizierte Personen zusammengefasst.
Die beiden wichtigsten Ergebnisse waren:
• Bei der Identifizierung der Infektion in Stuhlproben betrug die Sensitivität und Spezifität 100%.
• Bei den Schnüffelrunden in Behandlungszimmern identifizierte der Hund 25 von 30 Fällen, was einer Sensitivität von 83% entspricht. Auch bei 265 von 270 nichtinfizierten Angehörigen der Kontrollgruppe verroch sich der Hund nicht, was einer Spezifität von 98% entsprach.
Trotz dieser sehr guten Werte beabsichtigen die ForscherInnen in weiteren Versuchen zu untersuchen, ob die Erfolge auch mit anderen Hunden und Trainern und unter anderen räumlichen Bedingungen wiederholt werden können. Da sich auch bei anderen Erkrankungen oft spezifische Körpergerüche entwickeln, ist nicht ausgeschlossen, dass die Erkennung und damit Prävention weiterer schwerer Erkrankungen ebenfalls noch "auf den Hund kommen" werden.
Der Aufsatz "Using a dog's superior olfactory sensitivity to identify Clostridium difficile in stools and patients: Proof of principle study" von Bomers MK et al. ist in der Weihnachtsausgabe 2012 des "British Medical Journal" (13. Dezember 2012, 345: e7396) erschienen und samt 10-minütigen Video mit dem Beagle "Cliff" kostenlos zugänglich.
Bernard Braun, 23.12.12
Gesundheitsuntersuchungen oder der Check-up-35 haben wahrscheinlich keinen Nutzen, erhöhen aber das Risiko von Überdiagnostik
 Zu einer der ältesten "Leistungen zur Verhütung von Krankheiten" im Sozialgesetzbuch V gehören die "Gesundheitsuntersuchungen" nach § 25 SGB V. Danach haben "Versicherte, die das 35. Lebensjahr vollendet haben, … jedes 2. Jahr Anspruch auf eine ärztliche Gesundheitsuntersuchung", die "insbesondere zur Früherkennung von Herz-Kreislauf- und Nierenerkrankungen sowie der Zuckerkrankheit" beitragen soll.
Zu einer der ältesten "Leistungen zur Verhütung von Krankheiten" im Sozialgesetzbuch V gehören die "Gesundheitsuntersuchungen" nach § 25 SGB V. Danach haben "Versicherte, die das 35. Lebensjahr vollendet haben, … jedes 2. Jahr Anspruch auf eine ärztliche Gesundheitsuntersuchung", die "insbesondere zur Früherkennung von Herz-Kreislauf- und Nierenerkrankungen sowie der Zuckerkrankheit" beitragen soll.
Eine Untersuchung der Inanspruchnahme dieser Gesunden-Untersuchung (Hauswaldt et al. 2009) durch 199.981 Anspruchsberechtigte in 124 Hausarztpraxen in den Jahren 1996 bis 2006 fand jährliche Untersuchungsraten zwischen 7% und knapp 30% - mit steigender Tendenz seit 2004 aber mit gruppenspezifischen Unterschieden (z.B. nehmen Männer Angebot mehr in Anspruch als Frauen). Andere Untersuchungen fanden Teilnahmeraten von knapp 40%. Für Hauswaldt und Kollegen stand damit fest, dass dieses Untersuchungsangebot "in bundesdeutschen Hausarztpraxen noch nicht die aus Public Health-Gesichtspunkten wünschenswerte Höhe in allen anspruchsberechtigten Geschlechts- und in den jüngeren Altersgruppen erreicht" hat.
Ob eine höhere Inanspruchnahme aber wirklich wünschenswert und gesundheitlich nützlich ist, wurde bereits in der Vergangenheit immer wieder bezweifelt. Hinzu kommen Hinweise auf mögliche nachteilige Wirkungen für die TeilnehmerInnen: "Wenn man bei Gesunden ungezielt nach Krankheiten fahndet, ist die Gefahr groß, dass man mehr Fehlalarme auslöst als tatsächlich Kranke identifiziert." (F. Gerlach u.a. Mitglied des Sachverständigenrat Gesundheit) Fehlalarme umfassen oft unnötige Ängste und aufwändige sowie belastende Folgeuntersuchungen und möglicherweise Operationen etc., die ohne die Gesundheitsuntersuchung nie für nötig gehalten bzw. durchgeführt worden wären.
Die am 17. Oktober 2012 veröffentlichte aktuelle Fassung des gewohnt methodisch und inhaltlich hochwertigen Cochrane-Reviews "General health checks in adults for reducing morbidity and mortality from disease", kommt nun unmissverständlich zu dem Schluss, dass allgemeine bzw. anlasslose Gesundheitsuntersuchungen weder die Herz-/Kreislauf- noch die Krebsmortalität reduzieren und ein sonstiger Nutzen unwahrscheinlich ist.
Die Reviewer gewinnen diese Erkenntnisse auf der Basis von 16 randomisierten kontrollierten Studien, die ihre erwachsenen TeilnehmerInnen in eine Gruppe unterschieden, die Gesundheitsuntersuchungen angeboten bekamen und in Anspruch nahmen und eine Gruppe in der dies nicht der Fall war. Von 14 Studien mit 182.880 TeilnehmerInnen gab es auch verwendbare Resultate.
Zu den wichtigsten Ergebnissen gehörten:
• Trotz der expliziten oder auch nur impliziten Versprechungen und Erwartungen eines gesundheitlichen Nutzens, spielten Outcomes jedweder Art in den meisten Studien keine oder nur eine marginale Rolle. Zum Beispiel wurde nur in neun Studien mit 155.899 TeilnehmerInnen das Sterblichkeitsrisiko untersucht. Keine Studie untersuchte die Anzahl der insgesamt neuen Verordnungen von Arzneimitteln. Zwei von vier Studien, die das untersuchten, zeigten aber eine Zunahme der Anzahl von Personen, die Bluthochdruckmedikamente verordnet bekamen. In keiner der Studien wurde über die Anzahl der Folgetests nach positiven Ergebnissen der Gesundheitsuntersuchung oder die Operationshäufigkeit nach solchen Untersuchungsergebnissen berichtet.
• In keiner Studie, welche die Sterblichkeit und das Erkrankungsrisiko untersuchten, gab es Hinweise auf einen Effekt der Untersuchung auf das generelle Sterblichkeitsrisiko in einem Zeitfenster von durchschnittlich neun Jahren (Risk-Ratio: 0,99 Untersuchungs- versus Kontrollgruppe - nicht signifikant) oder das Risiko an einer Herz-/Kreislauferkrankung (RR: 1,03 - nicht signifikant) oder an Krebs (RR: 1,01 - nicht signifikantzu erkranken. Auch für das allgemeine Erkrankungsrisiko fanden die Cochrane-Reviewer in den berücksichtigten Studien keinen Wirkungsnachweis von Gesundheitsuntersuchungen.
• Wie zu erwarten war, stieg allerdings in einer Studie die Anzahl von Personen bei denen Risikofaktoren wie hoher Blutdruck oder hohe Cholesterinwerte existierten. Ebenfalls nure eine Studie fand eine gestiegene Anzahl von Personen mit chronischen Erkrankungen. Eine weitere Studie berichtet schließlich für die NutzerInnen von Gesundheitsuntersuchungen über eine in sechs Jahren um 20% gestiegene Anzahl von neuen Diagnosen pro Teilnehmerin.
• Zwei von vier Studien, die sich überhaupt um diese Dimension kümmerten, fanden, dass sich Check-up-TeilnehmerInnen ein bißchen gesünder ("somewhat healthier") fühlten. Dieses Ergebnis ist aber nicht zuverlässig bzw. reliabel.
• In keiner Studien gab es Belege für einen Einfluss des Check-up auf die Anzahl der Krankenhauseinweisungen, Behinderungen, Sorgen, Facharztüberweisungen, zusätzlichen Arztbesuche oder Arbeitsunfähigkeit. Auch hier gilt aber der Hinweis, dass diese Ereignisse nur wenig und nicht besonders aufwändig untersucht worden sind.
Die Reviewer weisen selber auf mehrere kritische Punkte der in ihrem Review berücksichtigten Studien hin, die aber nichts daran ändern, dass eine gesonderte Gesundenuntersuchung wahrscheinlich keinen Nutzen hat: Ärzte würden u.U. ihre PatientInnen auch ohne spezielle Untersuchung ständig nach einer Reihe von Risikofaktoren untersuchen, wenn sie sie aus völlig anderen Gründen sehen würden. Personen mit einem hohen Erkrankungsrisiko gingen selbst auf eine Einladung hin nicht zu Check-up-Untersuchungen. Und schließlich sind die meisten der Studien relativ alt, was die Übertragbarkeit ihrer Erkenntnisse auf die möglicherweise geänderten Behandlungsbedingungen in Arztpraxen einschränkt. Früher wie heute wäre es aber auch möglich, dass die TeilnehmerInnen an Gesundenuntersuchungen auch außerhalb von ihnen bereits besonders gesundheits- und präventionsbewusst leben und der Check-up nur so etwas wie ein "Sahnehäubchen" darstellt.
"Wünschenswert" wäre also aus Public Health-Sicht eher der Verzicht auf den Check-up-35 im SGB V oder eine gründliche outcomezentrierte Untersuchung der aktuellen Wirkungen dieser Untersuchung.
Vom Cochrane-Review "General health checks in adults for reducing morbidity and mortality from disease" der dänischen GesundheitswissenschaftlerInnen Lasse T Krogsbøll, Karsten Juhl Jørgensen, Christian Grønhøj Larsen und Peter C Gøtzsche gibt es kostenlos ein gewohnt ausführliches Abstract.
Den Aufsatz "Zur Gesundheitsuntersuchung in deutschen Hausarztpraxen - eine sekundäre Analyse von Versorgungsdaten 1996 bis 2006" von Johannes Hauswaldt, Ulrike Junius-Walker, Markus Kersting und Eva Hummers-Pradier, veröffentlicht in der "Zeitschrift für Allgemeinmedizin" (10/2009: 411-418) gibt es komplett kostenlos.
Bernard Braun, 18.10.12
Krankheitsfrüherkennung von Eierstockkrebs - Ärzte missachten Evidenz
 Eine Krankheit vor Einsetzen von Beschwerden früh zu erkennen, ist sinnvoll, wenn der weitere Verlauf durch die Vorverlegung des Behandlungsbeginns die mit dieser Krankheit verbundene Mortalität oder Morbidität mindert, wenn also das Überleben verbessert und Krankheitsbeschwerden gemindert werden. So ist z.B. die Erkennung einer Unterfunktion der Schilddrüse beim Neugeborenen außerordentlich sinnvoll, weil die sofort einsetzende Behandlung vor Gesundheitsschäden bewahrt.
Eine Krankheit vor Einsetzen von Beschwerden früh zu erkennen, ist sinnvoll, wenn der weitere Verlauf durch die Vorverlegung des Behandlungsbeginns die mit dieser Krankheit verbundene Mortalität oder Morbidität mindert, wenn also das Überleben verbessert und Krankheitsbeschwerden gemindert werden. So ist z.B. die Erkennung einer Unterfunktion der Schilddrüse beim Neugeborenen außerordentlich sinnvoll, weil die sofort einsetzende Behandlung vor Gesundheitsschäden bewahrt.
Entgegen der noch immer weit verbreiteten intuitiven Annahme "früh erkannt, Gefahr gebannt" gilt es bei der Früherkennung von Krebs jedoch, den möglichen Nutzen gegen mögliche Schäden aufzuwiegen.
Eierstockkrebs wurde im Jahr 2008 in den USA bei 12,2 von 100.000 Frauen diagnostiziert. Die Schwierigkeit der Früherkennung besteht darin, diese 12,2 Frauen aus den 100.000 mit einer geeigneten Untersuchung "herauszufiltern". Eierstockkrebs lässt sich mit Transvaginalem Ultraschall (TVU) und dem Tumormarker CA-125 früh erkennen. Die bisher durchgeführten Studien ergeben keine Belege für einen Nutzen, nicht einmal in der Gruppe von Frauen mit hohem genetischen Risiko, von denen mehr als 20% in ihrem Leben einen Eierstockkrebs entwickeln.
Dagegen bestehen erhebliche Schadensrisiken für Frauen mit im Vergleich zu Frauen ohne Früherkennungsuntersuchung, wie u.a die PLCO-Studie ergeben hat (wir berichteten: Link). Die fehlende Treffsicherheit des TVU zeigt sich darin, dass - je nach Studie - nur in 0,75% bis. 2,8% hinter einem auffälligen Befund ein invasives Karzinom steckt. Um ein invasives Karzinom zu entdecken, müssen zwischen 30 und 35 Operationen durchgeführt werden (Link). Dafür, dass die früher einsetzende Behandlung einen Überlebensvorteil ergibt, fehlt der wissenschaftliche Nachweis. Keine Fachgesellschaft empfiehlt daher die Früherkennung dieses Tumors in ihren Leitlinien.
Eine amerikanische Studie untersuchte nun, inwieweit sich Ärzte an die Empfehlungen der Leitlinien halten, also auf die Früherkennung verzichten, oder aber dagegen verstoßen.
Dazu entwickelten die Forscher einen Fragebogen mit Fallbeispielen. Darin wurden Fälle von Frauen unterschiedlichen Alters mit unterschiedlichen Lebenszeitrisiken für den Eierstockkrebs und unterschiedlichem eigenen Wunsch nach einer Früherkennungsuntersuchung beschrieben.
Bei den Ärzten handelte es sich um Allgemeinmediziner (family physicians), allgemeinärztlich tätige Internisten (general internists) und Gynäkologen.
3.200 aus amerikanischen Registern zufällig ausgewählte Ärzte erhielten jeweils eine Fallbeschreibung. Dazu sollten sie angeben, ob sie die Untersuchung "fast nie", "manchmal", "fast immer" veranlassen bzw. durchführen würden. Als Nichtbefolgung der Leitlinien wurden die Antworten "manchmal" und "fast immer" gewertet. Der Rücklauf betrug 61,7%.
Bemerkenswert ist bereits, dass 33% der Ärzte fälschlich meinen, dass der TVU und das CA-125 effektive Früherkennungsmethoden seien.
Bei Frauen mit mittlerem Risiko veranlassen insgesamt 65,4% der Ärzte die Früherkennungsuntersuchung. Fragen die Frauen nach der Früherkennung, steigt der Anteil auf 78,4%, fragen sie nicht nach sind es 49,4%.
Bei Frauen mit niedrigem Risiko veranlassen insgesamt 28,5% der Ärzte die Untersuchung, bei nachfragenden Frauen 36,7%, bei nicht-nachfragenden Frauen 20,2%.
Dabei überschätzen die Ärzte das Lebenszeitrisiko systematisch - ein Viertel schätzt das niedrige Risiko nicht als niedrig sondern höher ein, ein Drittel schätzt das mittlere Risiko entsprechend höher ein.
Zu den wichtigsten "Risikofaktoren" für die Nicht-Befolgung der Leitlinien zählen das vom Arzt wahrgenommene Risiko für Eierstockkrebs, die Nachfrage von Seiten der Patientin und der Glaube des Arztes an den Nutzen der Tests.
Diese Studie ist ein weiterer Hinweis dafür, dass unter Ärzten falsche Vorstellungen über die Früherkennung von Krebs weit verbreitet sind. In dieser Studie schätzten 33% der Ärzte den Nutzen einer Früherkennungsuntersuchung schlicht falsch ein. In einer anderen Untersuchung, über die wir berichteten (Link), hatten 69% der befragten amerikanischen Ärzte offenbart, dass sie die Aussagekraft der 5-Jahrsüberlebensrate für den Nutzen der Früherkennung nicht verstanden haben. Bei deutschen Ärzten hatte der Anteil sogar 76% betragen.
In Deutschland gehört die Früherkennung von Eierstockkrebs durch TVU zu den zwei am häufigsten angebotenen Selbstzahlerleistungen (sog. Individuelle Gesundheitsleistungen - Link).
Eine Wissensoffensive in Aus-, Fort- und Weiterbildung der Ärzte wäre erforderlich, um weiteren Schaden von den Patientinnen und Patienten abzuwenden.
Baldwin L-M, Trivers KF, Matthews B, Andrilla CHA, Miller JW, Berry DL, et al.
Vignette-Based Study of Ovarian Cancer Screening: Do U.S. Physicians Report Adhering to Evidence-Based Recommendations?
Annals of Internal Medicine 2012;156:182-94. Abstract
David Klemperer, 12.8.12
Weniger operieren bei lokal begrenztem Prostatakarzinom
 Auf einen unnötigen Test folgt vielfach eine unnötige Operation. Die verläuft zwar meistens gut, allerdings bekommen die Patienten nicht selten hinterher Potenzprobleme oder werden harninkontinent. Das ist die Quintessenz einer im Juli 2012 in der renommierten Medizinerzeitschrift New England Journal of Medicine veröffentlichten Studie aus den USA. Der Artikel amerikanischer Urologen der Prostate Cancer Intervention versus Observation Trial (PIVOT) Study Group sollte und könnte dazu beitragen, betroffene Männern vor unnötigen Komplikationen und Einschränkungen der Lebensqualität zu bewahren.
Auf einen unnötigen Test folgt vielfach eine unnötige Operation. Die verläuft zwar meistens gut, allerdings bekommen die Patienten nicht selten hinterher Potenzprobleme oder werden harninkontinent. Das ist die Quintessenz einer im Juli 2012 in der renommierten Medizinerzeitschrift New England Journal of Medicine veröffentlichten Studie aus den USA. Der Artikel amerikanischer Urologen der Prostate Cancer Intervention versus Observation Trial (PIVOT) Study Group sollte und könnte dazu beitragen, betroffene Männern vor unnötigen Komplikationen und Einschränkungen der Lebensqualität zu bewahren.
Für ihre Studie Radical Prostatectomy versus Observation for Localized Prostate Cancer haben die Urologen 731 Männer untersucht, die an einem auf die Vorsteherdrüse begrenzten Krebs litten. Nach dem Zufallsprinzip wurde bei der Hälfte die komplette Prostata entfernt, während bei der anderen Hälfte der weitere Krankheitsverlauf ohne Therapie begleitet wurde. Nach einer Beobachtungsdauer von bis zu 15 Jahren ließ sich kein Vorteil für operierte Männer erkennen: Weder starben mehr Männer in der Gruppe, die nicht unters Messer kam, aus anderen Gründen, noch gab es ohne Behandlung mehr Todesfälle durch den Prostatakrebs.
Wer an dem begrenzten Tumor leidet, lebt ohne Behandlung genauso lange. "Viele Männer bekommen Angst, wenn sie die Diagnose Prostata-Krebs hören", sagt Erstautor Wilt, der an der Minnesota School of Medicine in Minneapolis tätig ist. "Sie denken, dass sie an dem Tumor sterben, wenn sie nicht therapiert werden. Unsere Daten zeigen jedoch eindeutig, dass dies nicht stimmt. Die überwältigende Mehrheit wird nicht an der Krankheit sterben, wenn sie unbehandelt bleibt."
Im aktuellen Studienbericht zeigen die ÄrztInnen um Timothy Wilt, dass die chirurgische Entfernung der Prostata bei lokalem Krebs kein Leben rettet (Bd. 367, S. 203, 2012) und Urologen künftig größere Zurückhaltung bei der Indikationsstellung zur operativen Prostata-Entfernung an den Tag legen. Die Studie zeigt nämlich, dass die moderne Medizin heute eine Vielzahl von Prostata-Tumoren diagnostiziert, die überhaupt nicht gefährlich sind. Denn leiden mehr als zwei Drittel aller Männer mit der Diagnose Prostata-Krebs an einer wenig aggressiven Frühform, die auf die Vorsteherdüse begrenzt ist. Die anfängliche Diagnosestellung beruht in den meisten auf dem höchst umstrittenen Bluttest auf prostataspezifisches Antigen (PSA).
Der PSA-Test ist ungenau und entdeckt zum einen viele Tumore, welche den betroffenen Männern nie ernsthafte gesundheitliche Probleme beschert hätten. Deshalb sprechen sich Fachorganisationen wie die US Preventive Services Task Force immer wieder gegen ungezieltes Screening aus. So hatte diese Behörde bereits 2008 in den Annals of Internal Medicine eine skeptische Einschätzung zum PSA-Screening abgegeben und dabei auf die Benefits and Harms of Prostate-Specific Antigen Screening for Prostate Cancer: An Evidence Update for the U.S. Preventive Services Task Force verwiesen. Die in dem ArtikelScreening for Prostata Carcinoma-US Preventive Service Task Force Recommendation Statement dargelegten Empfehlungen fassen die AutorInnen so zusammen: "No good-quality randomized, controlled trials of screening for prostate cancer have been completed. In 1 crosssectional and 2 prospective cohort studies of fair to good quality, false-positive PSA screening results caused psychological adverse effects for up to 1 year after the test. The natural history of PSA-detected prostate cancer is poorly understood." So ist es auch nicht überraschend, das die Gesetzliche Krankenversicherung in Deutschland die PSA-Bestimmung im Rahmen bloßen Screenings nicht als Leistung anerkennt; folglich bieten die UrologInnen den PSA-Test als IGeL Individuelle Gesundheits-Leistung an und kassieren dafür zwischen 15 und 30 Euro zuzüglich der Kosten für die Blutentnahme.
Die AutorInnen der nun im New England Journal of Medicine veröffentlichte Studie untersuchten 731 Männer mit lokal begrenztem Protata-Karzinom über insgesamt sechs Jahre, die sie nach dem Zufallsprinzip operieren oder nur beobachten ließen. In diesem Beobachtungszeitraum starben nur 7,1 Prozent der mit Krebs diagnostizierten Männer an dem Tumor. Dabei ließ sich kein statistisch relevanter Unterschied zwischen der operierten und der nicht behandelten Gruppe erkennen. Lediglich bei Vorliegen eines wenig differenzierten und daher aggressiveren Malignoms oder bei einem deutlich erhöhten PSA-Wert oberhalb von 10 Nanogramm pro Milliliter bot die Operation Vorteile.
Allerdings ist vor einer Überinterpretation dieser Studienergebnisse zu warnen. Zwar verleitet die US-Studie auf den ersten Blick zu großer Skepsis gegenüber der operativen Entfernung der Vorsteherdrüse bei Vorliegen lokalisierter bösartiger Tumore. Allerdings ist der Beobachtungszeitraum von gut sechs Jahren zu kurz, um generell Entwarnung zu geben. Gerade im höheren Lebensalter entwickeln sich Karzinome eher langsam. Außerdem besteht immer ein gewisses Risiko, das aus einem anfänglich ungefährlichen Tumor bei einem mittelalten Mann Jahre später ein aggressiver Krebs entstehen kann. Außerdem empfinden viele Betroffene selber ein vermeintlich harmloses Prostata-Karzinom als Zeitbombe und entscheiden sich für eine Operation. Fraglos aber stärkt das Studienergebnis aus den USA all jene, die sich in Anbetracht der Gefahr, nach der Operation impotent zu sein - das betrifft bis zu 30 Prozent - oder sogar an Inkontinenz zu leiden - immerhin bei jedem zwanzigsten operierten Mann - eher für abwartende Beobachtung bzw. das medizinisch begleitete "Zuwarten" entscheiden.
Die Studie von Timothy Wilt und Kollegen können Sie hier herunterladen; in vollem Umfang steht der Studienbericht nur AbonentInnen zur Verfügung, für alle anderen ein kommentiertes Abstract.
Zeitlich passend legte die Barmer GEK am 24. Juli ihren Krankenhausbericht 2012 vor, der sich schwerpunktmäßig demselben Thema widmet. Nach Auswertungen der eigenen Daten kommt die Barmer-GEK zu der Einschätzung, dass im Jahr 2011 bundesweit an deutschen Krankenhäusern rund 31.000 offene radikale Prostatektomien, 10.000 minimalinvasive Operationen, 3.000 mit Brachytherapien, 2.000 Chemotherapien und 1.600 perkutane Bestrahlungen erfolgten, was Gesamtkosten von rund 364 Millionen Euro verursachte. Die durchschnittlichen stationären Pro Kopf Behandlungskosten lagen im vergangenen Jahr bei etwa 5.900 Euro, wobei sich hier die auch bei anderen Krankheiten bekannte Altersabhängigkeit bestätigte: Während die Krankenhausbehandlung bei jüngeren Patienten regelmäßig über 6.000 Euro kostete, schlug sie bei Patienten jenseits der 80 mit rund 4.000 Euro zu Buche.
Prostatakrebs ist für die gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung sehr relevant, da er für etwa jeden zehnten krebsbedingten Sterbefall bei Männern verantwortlich ist. Häufigste Behandlungsmethode im Krankenhaus ist die "radikale Prostatektomie", die komplette operative Entfernung der Vorsteherdrüse. Das führt allerdings beim Gros der Patienten zu erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität: 70 Prozent klagen über Erektionsprobleme, 53 Prozent über sexuelles Desinteresse und rund 16 Prozent über Harninkontinenz. Rund ein Fünftel der operierten Patienten erleidet operationsbedingte Komplikationen wie Blutungen oder Darmverletzungen. Entsprechend durchwachsen sind die Zufriedenheitswerte: 52 Prozent der Befragten sind mit dem Behandlungsergebnis uneingeschränkt zufrieden, 41 Prozent eingeschränkt, 7 Prozent unzufrieden. Das sind schlechtere Ergebnisse als nach Einsetzen eines künstlichen Hüftgelenks (63 Prozent uneingeschränkte Zufriedenheit).
Diese und viele andere Informationen und statistische Daten enthält der diesjährige Krankenhausreport der Barmer-GEK. Für Interessierte stellt die Ersatzkasse kostenlos den Barmer-GEK Report Krankenhaus 2012 zum Download bereit. Ebenso sind eine überaus praktische Infografik- und Faktensammlung sowie eine Broschüre mit Behandlungsstrategien bei Prostatakarzinom auf der Internet-Seite verfügbar.
Jens Holst, 25.7.12
PSA-Massenscreening "nein danke" oder allenfalls noch individualisierte Suche nach Prostatakarzinom-Prädiktor!?
 Die seit einiger Zeit insbesondere in den USA intensiv geführte Debatte über den Nutzen und den Schaden, den das PSA-basierte Screening für Prostatakrebs anrichten kann, das Männern ab einem bestimmten Alter angeboten wird, geht in die nächste praktisch folgenreiche Runde. (vgl. dazu den Beitrag im Forum-Gesundheitspolitik und die dortigen Verweise auf Studien, welche die Empfehlung untermauern sollen).
Die seit einiger Zeit insbesondere in den USA intensiv geführte Debatte über den Nutzen und den Schaden, den das PSA-basierte Screening für Prostatakrebs anrichten kann, das Männern ab einem bestimmten Alter angeboten wird, geht in die nächste praktisch folgenreiche Runde. (vgl. dazu den Beitrag im Forum-Gesundheitspolitik und die dortigen Verweise auf Studien, welche die Empfehlung untermauern sollen).
Ausgangspunkt ist die Empfehlung der U.S. Preventive Services Task Force von einem Screeningangebot für Männer aller Altersgruppen abzusehen. Damit ist eine erste im Oktober 2011 zur Diskussion gestellte und auch heftige umstrittene vorläufige Empfehlung offiziell geworden. Medicare-Krankenversicherte und Versicherte einer Reihe weiterer privater Versicherungen erhalten damit die Kosten für PSA-Tests zur Früherkennung nicht mehr erstattet.
Die Empfehlung kulminiert in einer für alle medizinischen Interventionen leitenden Abwägung des Nutzens und des Schadens. Ihr vollständiger Wortlaut: "The reduction in prostate cancer mortality 10 to 14 years after PSA-based screening is, at most, very small, even for men in the optimal age range of 55 to 69 years. The harms of screening include pain, fever, bleeding, infection, and transient urinary difficulties associated with prostate biopsy, psychological harm of false-positive test results, and overdiagnosis. Harms of treatment include erectile dysfunction, urinary incontinence, bowel dysfunction, and a small risk for premature death. Because of the current inability to reliably distinguish tumors that will remain indolent from those destined to be lethal, many men are being subjected to the harms of treatment for prostate cancer that will never become symptomatic. The benefits of PSA-based screening for prostate cancer do not outweigh the harms."
In derselben Ausgabe sind außerdem ein zustimmender und ein ablehnender Kommentar veröffentlicht. Der Kernsatz der Zustimmung lautet: ""The harms are well-proven, whereas the evidence of benefit is weak. Even if one accepts that true benefits exist, the documented harms are likely greater than those small benefits. Despite this, some will continue to forcefully advocate advocate PSA-based screening because of a blind faith in early detection. We need to practice medicine on the basis of evidence and not on the basis of faith."
Eine Gruppe von Urologen kritisiert die Empfehlung u.a. deswegen, weil an der Erstellung der Leitlinienempfehlung zu wenig Urologen und Krebsspezialisten beteiligt gewesen wären und auch Studien mit 10 Jahre Dauer zu kurz wären, um die erwünschten und unerwünschten Effekte eines Screenings verlässlich messen zu können. Nach dem Hinweis, die Empfehlung gefährde möglicherweise Leben, empfehlen sie folgendes: "At this point, we suggest that physicians review the evidence, follow the continuing dialogue closely, and individualize prostate cancer screening decisions on the basis of informed patient preferences."
Schon damit wird klar, dass die Debatte in den USA nicht zu Ende ist. Dort, aber vor allem auch in Deutschland, ist daher die weitere Verbreitung der Forschungsergebnisse über Nutzen und Schaden von PSA-Messungen, die öffentliche Abwägung durch Ärzte und Patienten sowie auch weitere Forschung notwendig.
Alle zitierten Beiträge sind am 15. Mai 2012 in der Fachzeitschrift "Annals of internal medicine" (2012, 156 (10)) erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Der Aufsatz "Clinical Guidelines. Screening for Prostate Cancer: U.S. Preventive Services Task Force Recommendation Statement" stammt von Virginia A. Moyer und der U.S. Preventive Services Task Force.
Der zustimmende Kommentar "In the Balance. Prostate Cancer Screening: What We Know, Don't Know, and Believe" stammt von Otis W. Brawley.
Der kritische und ablehnende Beitrag "In the Balance. What the U.S. Preventive Services Task Force Missed in Its Prostate Cancer Screening Recommendation" stammt von einer Gruppe von 9 Urologen um William J. Catalona.
Bernard Braun, 7.6.12
Die Mär vom "guten" Cholesterin: Ursachen und Prävention des Herzinfarkt-Risikos sind komplexer.
 Komplexitätsreduktion bis auf eine einzige oder letzte Ursache oder die Dichotomisierung von Lösungen oder Lösungswegen in "gut" oder "schlecht" gehören zum Alltag gesundheitswissenschaftlicher oder -politischer Diskurse. So verständlich dies angesichts tausender Studien, des Gewimmels von "multifaktoriellen Ursachengefügen", dem Wunsch "zu helfen" und nicht zuletzt der Verkaufsinteressen von Unternehmen der Gesundheitswirtschaft sein mag, so problematisch erweist sich dies nicht selten, wenn die Richtigkeit der Annahmen für diese Vorgehensweisen überprüft werden.
Komplexitätsreduktion bis auf eine einzige oder letzte Ursache oder die Dichotomisierung von Lösungen oder Lösungswegen in "gut" oder "schlecht" gehören zum Alltag gesundheitswissenschaftlicher oder -politischer Diskurse. So verständlich dies angesichts tausender Studien, des Gewimmels von "multifaktoriellen Ursachengefügen", dem Wunsch "zu helfen" und nicht zuletzt der Verkaufsinteressen von Unternehmen der Gesundheitswirtschaft sein mag, so problematisch erweist sich dies nicht selten, wenn die Richtigkeit der Annahmen für diese Vorgehensweisen überprüft werden.
Das neueste Beispiel stammt aus der Forschung über die Bedeutung des Cholesterinspiegels für das Risiko einer Herz-/Kreislauferkrankung. Seit vielen Jahren wird dazu zwischen einem "bösen" (LDL-Wert=Low Density Lipoprotein) und einem "guten" (HDL-Wert=High Density Lipoprotein) Cholesterinwert unterschieden.
Bereits seit längerem wird allerdings am kausalen Zusammenhang eines hohen Gesamt-Cholesterinspiegels mit der Plaquebildung in Blutgefäßen als Einflussfaktor auf das Risiko von Herz-/Kreislauferkrankungen und damit am Nutzen cholesterinwertsenkender Interventionen durch spezielle Lebensmittel und Medikamente gezweifelt. Mit der Differenzierung nach HDL- und LDL-Werten schien ein Teil der Zweifel ausgeräumt zu sein und spezifischere risikovermeidende oder -senkende Interventionen doch möglich zu sein. Eine Senkung des "bösen" und eine Anhebung des "guten" Wertes versprach präventive Wunder.
Eine im Mai 2012 in der Fachzeitschrift "Lancet" veröffentlichte Studie zahlreicher internationaler WissenschaftlerInnen hält nun aber auch die Annahme, das "gute" Cholesterin und damit auch die Anhebung seines Werts durch Vitamine und andere Hilfsmittel wirkten kausal auf das Risiko kardiovaskulärer Erkrankungen, für zweifelhaft.
Sie stützen sich dabei u.a. darauf, dass es Personen gibt, die mit Genen ausgestattet sind, die ihnen lebenslänglich einen natürlich hohen Spiegel des "guten" Cholesterols verschaffen und umgekehrt Personen, deren genetische Ausstattung ebenfalls natürlich zu einem leicht niedrigeren Level des "guten" Cholesterols führen. Drei große, in den letzten Jahren abgeschlossene randomisierte Studien und weitere Analysen der Forschergruppe zeigen nun, dass die Personen mit dem natürlich höheren Niveau von "gutem" Cholesterol kein geringeres Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen wie einen Herzinfarkt haben.
Sie bestätigen ausdrücklich, "that genetically raised plasma HDL cholesterol is not associated with risk of myocardial infarction". Und jenseits der genetischen Disposition folgern sie auf der Basis der Gen- und Erkrankungsdaten von 53.500 Personen noch praktischer: "These results show that some ways of raising HDL cholesterol might not reduce risk of myocardial infarction in human beings. Therefore, if an intervention such as a drug raises HDL cholesterol, we cannot automatically assume that risk of myocardial infarction will be reduced."
Dabei bestreiten die VerfasserInnen nicht, dass das Niveau des LDL oder des HDL in vielen Beobachtungsstudien immer wieder im Zusammenhang mit dem Herzinfarktrisiko auftaucht und assoziiert erscheint. Der von der "New York Times" zu dieser Studie interviewte Direktor des staatlichen Instituts für kardiovaskuläre Erkrankungen, Michael Lauer", vergleicht den HDL-Wert mit dem "Stau-/Unfall-Voraus"-Warnschild bei Verkehrsunfällen. Nicht dieses Schild sei die Ursache für den Stau, sondern der Unfall und niemand käme auf die Idee, sich zur Staubeseitigung gegen das Schild zu wenden. Ebenso träten neben einem niedrigen HDL-Wert noch zahllose Faktoren auf, die überwiegend das erhöhte Infarktrisiko bedingten: "Our hypothesis ist hat much of the association may be due to these other factors."
Hinter die einfache, natürlich massiv von Herstellern und vielen Gesundheitsberatern erzeugte oder geförderte Vorstellung mittels Vitaminen (z.B. Niacin) oder Medikamenten den HDL-Spiegel heben und das Infarktrisiko senken zu können, müssen daher mehrere Fragezeichen gesetzt werden.
Ob und wie die sicherlich komplexen Ergebnisse der von den US National Institutes of Health, dem The Wellcome Trust, der European Union, der British Heart Foundation und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten in den Präventions- und Behandlungsalltag Eingang finden oder ob sich die Hersteller von "guten" HDL-erhöhenden Arzneimittel durchsetzen, verdient für die nächste Zeit besondere Aufmerksamkeit.
In dem in derselben Ausgabe des "Lancet" veröffentlichten Kommentar "Mendelian randomisation, lipids, and cardiovascular disease" von S. Harrison et al. unterstreichen dessen Autoren, die gewählte genetische Forschungsmethode "mendelian randomisation" der HDL-Wirkungsforscher sei "likely to yield insights that can both guide public health policy and prioritise potential therapeutic targets."
Der Aufsatz "Plasma HDL cholesterol and risk of myocardial infarction: a mendelian randomisation study" von Benjamin F Voight et al. ist am 17. Mai 2012 als "early online publication" der Zeitschrift "The Lancet" erschienen. Das Abstract ist kostenlos erhältlich.
Der Artikel "Doubt Cast on the 'Good' in 'Good Cholesterol'" von Gina Kolata ist in der "New York Times" vom 16. Mai 2012 erschienen und kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 17.5.12
Bis zu 10 Überdiagnosen auf einen durch Früherkennung verhinderten Tod an Brustkrebs
 Durch Brustkrebs-Früherkennungs-Untersuchungen werden 2 Arten von Brustkrebs frühzeitig entdeckt: zum einen Tumoren, die später, nach Auftreten von Beschwerden, diagnostiziert worden wären, zum anderen Tumoren, die sich nie im weiteren Leben bemerkbar gemacht hätten. Letzteres ist dann der Fall, wenn der Tumor nicht soweit wächst, dass er Beschwerden verursacht oder aber wenn die betroffene Frau stirbt, bevor sich der Tumor klinisch bemerkbar macht.
Durch Brustkrebs-Früherkennungs-Untersuchungen werden 2 Arten von Brustkrebs frühzeitig entdeckt: zum einen Tumoren, die später, nach Auftreten von Beschwerden, diagnostiziert worden wären, zum anderen Tumoren, die sich nie im weiteren Leben bemerkbar gemacht hätten. Letzteres ist dann der Fall, wenn der Tumor nicht soweit wächst, dass er Beschwerden verursacht oder aber wenn die betroffene Frau stirbt, bevor sich der Tumor klinisch bemerkbar macht.
Über dieses als Überdiagnose bezeichnete Phänomen haben wir berichtet (Link). Überdiagnose stellt ein gravierendes Problem dar, weil die überdiagnostizierten Tumoren von "normalen" Tumoren bisher nicht unterschieden werden können und somit zur Übertherapie führen. Frauen erhalten überflüssigerweise eine belastende und eingreifende Therapie.
Eine präzise Quantifizierung der Überdiagnose ist methodisch schwierig, weil zeitliche Trends in der Brustkrebsinzidenz berücksichtigt werden müssen. Zusätzlich tritt bei Neueinführung eines Screening-Programms stets eine Inzidenzerhöhung auf, weil die bislang asymptomatischen Tumoren entdeckt werden. Nach Ablauf der sog. lead time, also der Zeitspanne, um die die Diagnose durch Früherkennung vorverlegt wird, sollte die Inzidenz insgesamt auf das Niveau vor Einführung der Früherkennung zurückgehen, bei älteren Frauen jedoch abnehmen, weil ihre Diagnose durch das Screening ja früher gestellt wurde.
Präzisere Daten können nur Langzeit-Vergleiche einer gescreenten mit einer nicht gescreenten Gruppe im Rahmen einer randomisierten kontrollierten Studie erbringen. Von diesen Studien gibt es nur wenige und auch hier treten methodische Probleme auf. So werden auch nicht-randomisierte Formen des Vergleichs durchgeführt mit entsprechend unpräzisen und weit streuenden Ergebnissen - je nach Datengrundlage wird die Überdiagnose bislang auf 0 bis 54% geschätzt.
Genauere und zuverlässigere Ergebnisse erbrachte eine kürzlich veröffentlichte norwegische Studie. Das staatliche Gesundheitssystem mit einem annähernd vollständigen nationalen Krebsregister liefert zuverlässige Diagnosedaten. Da das Brustkrebs-Screening-Programm zwischen 1996 und 2005 schrittweise in die 6 norwegischen Regionen eingeführt wurde, konnte die Brustkrebsinzidenz in den Regionen mit und ohne Screening-Programm verglichen werden. Zusätzlich wurden die zeitlichen Trends erfasst, indem der jeweilige 10-Jahreszeitraum vor Einführung des Screenings mit einbezogen wurde. Dies ist erforderlich, weil auch in den Jahren vor Einführung des Screenings die Inzidenz bereits angestiegen ist, vermutlich infolge erhöhter Aufmerksamkeit und vermehrter Untersuchungen sowie dem starken Anstieg der Hormongabe in den Wechseljahren in den 1990er-Jahren. Die Teilnahme am Screening-Programm ist mit 77% hoch. In den Regionen ohne Screening war die Inanspruchnahme der Mammographie hingegen niedrig.
Die Forscher beschränkten die Untersuchung auf die Inzidenz von invasivem, also die Gewebsgrenzen durchbrechendem Brustkrebs. Nicht betrachtet wurde das sog. duktale Karzinom in situ, ein Tumor in den Milchgängen der weiblichen Brust, der den Milchgang (noch) nicht durchbrochen hat. Auch für diesen Tumor gibt es Überdiagnose, die Forscher wollten jedoch die zwei unterschiedlichen Arten von Brustkrebs nicht vermischen.
In den ersten 10 Jahren des Brustkrebs-Screening-Programms, also von 1996 bis 2005, wurden etwa 500.000 Frauen zur Mammographie eingeladen. Bei 7.793 wurde ein invasiver Brustkrebs diagnostiziert. Unter Berücksichtigung der Inzidenz im Zehnjahreszeitraum vor der Einführung des Programms sowie der Inzidenz in den Regionen, die nach 1995 noch nicht im Programm waren, errechnen die Forscher für die Frauen im Screening-Programm eine Überdiagnose von 15 bis 25%.
Darauf folgt, dass von den 7.793 Frauen mit invasivem Brustkrebs zwischen 1.169 (15% von 7.793) und 1.948 (25% von 7.793) nie die Diagnose erhalten hätten, wenn sie nicht gescreent worden wären, also eine Überdiagnose erhalten haben.
Bezogen auf 2.500 Frauen wird ein Tod an Brustkrebs verhindert, 20 Diagnosen sind keine Überdiagnose und 6 bis 10 sind eine Überdiagnose.
Die Zahlen sind etwas niedriger als frühere Berechnungen aus Norwegen und Dänemark. Dies begründen die Wissenschaftler mit unterschiedlichen Annahmen für die zeitlichen Trends und die lead time (Norwegen) sowie mit der Einbeziehung des duktalen Karzinoms in situ (Dänemark).
Diese Studie stellt einen weiteren deutlichen Beleg für den Sachverhalt dar, dass Krebsfrüherkennung entgegen verbreiteten intuitiven Vorstellungen sowohl Nutzen als auch Schaden bewirken kann. Der Schaden kann erheblich sein. Die Schadensrisiken sollten den Frauen, die zur Screening-Untersuchung eingeladen werden, in aller Klarheit vermittelt werden, fordern die Autoren.
Zu lösen ist das Problem der Überdiagnose allein durch Methoden, mit denen fortschreitende Tumoren von nicht bzw. nur langsam wachsenden Tumoren unterschieden werden können. Diese Methoden gibt es bislang nicht.
In einer Studie, die am 18. April 2012 im Wissenschaftsjournal NATURE erschienen ist, berichten Forscher über die neu geschaffene Unterteilung von Tumoren der weiblichen Brust in 10 nach genetischen Merkmalen definierte Untergruppen. Inwieweit diese genetischen Merkmale eine Prognose über das Wachstumsverhalten erlauben, ist noch nicht bekannt.
Kalager M, Adami H-O, Bretthauer M, Tamimi RM. Overdiagnosis of Invasive Breast Cancer Due to Mammography Screening: Results From the Norwegian Screening Program. Annals of Internal Medicine 2012;156(7):491-99 Abstract
Curtis C, Shah SP, Chin S-F, Turashvili G, Rueda OM, Dunning MJ, et al. The genomic and transcriptomic architecture of 2,000 breast tumours reveals novel subgroups. Nature 2012;advance online publication. Abstract
David Klemperer, 21.4.12
15-Jahres-Intervall für Knochendichtemessung reicht bei 67+-jährigen nicht schon erkrankten Frauen zur Osteoporose-Prophylaxe aus
 Niedrige Knochenmineraldichte (Osteopenie) und Knochenschwund (Osteoporose) mit hohem Frakturrisiko sind die häufigsten Knochenerkrankungen im Alter. Rund 80% der Erkrankten sind Frauen. Vor allem an sie richten sich daher auch Angebote, regelmäßig und screeningartig die Knochendichte messen zu lassen.
Niedrige Knochenmineraldichte (Osteopenie) und Knochenschwund (Osteoporose) mit hohem Frakturrisiko sind die häufigsten Knochenerkrankungen im Alter. Rund 80% der Erkrankten sind Frauen. Vor allem an sie richten sich daher auch Angebote, regelmäßig und screeningartig die Knochendichte messen zu lassen.
Unabhängig von der grundsätzlichen Frage, ob Voraussagen über eine Frakturgefahr nicht auch ohne apparative Messung, also z.B. durch anamnestische Informationen über Bewegungsstörungen etc. getroffen werden können, stellt sich die auch in Leitlinien nicht definitiv geklärte Frage, in welchen Abständen solche Messungen stattfinden müssen, um einen Nutzen haben zu können.
Eine aktuell abgeschlossene Untersuchung mit 4.957 Teilnehmerinnen und einer einzigartigen Beobachtungszeit von rund 15 Jahren zeigt: Bei über 67-jährigen Frauen mit normaler Kno-chendichte, ohne eine Vorgeschichte mit Hüft- oder Wirbelfrakturen und ohne eine bereits stattgefundene Osteoporosebehandlung sowie bei Frauen mit einer nur leicht niedrigeren Knochenmineraldichte reicht ein Mess-Intervall von 15 Jahren aus. Bei Frauen, deren Knochenmineraldichte zu Beginn der Beobachtungszeit moderat oder fortgeschritten niedrig war, sollte das Intervall auf 5 oder 1 Jahr verkürzt werden. In einzelnen Altersgruppen, wie beispielsweise bei den 85 Jahre alten und älteren Frauen, plädieren die WissenschaftlerInnen aber auch dafür, das bisher praktizierte Intervall von 5 auf 3 Jahre zu verringern.
Für die Untersuchung wurden die Teilnehmerinnen in vier Gruppen aufgeteilt: Eine Gruppe mit normaler Knochendichte und drei Gruppen mit einer milden, moderaten und fortgeschrittenen Verringerung der Knochenmineraldichte. Das Kriterium, das darüber entschied, ob die Länge des Abstands für den gesundheitlichen Nutzen ausreichte, war die Anzahl der Frauen, die nach dem Beginn der Studie an Osteoporose erkrankten. Solange nicht mehr als 10% der Angehörigen einer dieser Gruppen an Osteoporose erkrankte, hielten die WissenschaftlerInnen eine Knochendichtemessung für nicht notwendig bzw. nicht nützlich. Generell halten sie es zusammen mit anderen Autoren für unwahrscheinlich, durch in kurzen Abständen durchgeführte regelmäßige Knochendichtemessungen die Vorhersage von Knochenbrüchen verbessern zu können.
Ob die jetzt zugängliche Evidenz für Messintervalle den Anlass darstellt, die restriktive Regelung der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) bei der Finanzierung von Knochendichtemessungen zu modifizieren, ist offen. Die geltende Regelung war im Jahr 2000 eingeführt worden, nachdem es eine rasche Zunahme der Messungen ohne klaren Nutzen gab. Als Sachleistung der Krankenkasse darf seither eine Messung nur erbracht und in Anspruch genommen werden, wenn der Patient bereits ohne äußere Einwirkung einen Knochenbruch erlitten hat oder bei einem wahrscheinlich sehr niedrigen Knochenmineralgehalt. Möglich wäre eine modifizierte Fortentwicklung dieser Lösung durch die Wiederzulassung von Messungen ohne akuten Verdacht bzw. mit abgestuften Varianten der Knochenmineraldichte - bei strikter Einhaltung der hier gefundenen Intervallen.
Der von Margaret L. Gourlay, M.P.H., Jason P. Fine, John S. Preisser, Ryan C. May, Chenxi Li, Li-Yung Lui, David F. Ransohoff, Jane A. Cauley und Kristine E. Ensrud verfasste Aufsatz "Bone-Density Testing Interval and Transition to Osteoporosis in Older Wo-men", veröffentlicht im "New England Journal of Medicine (2012; 366: 225-233), ist komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 4.4.12
PSA-Screening senkt auch nach 13 Jahren Beobachtungszeit nicht das Risiko an Prostatakrebs zu sterben
 Was seit Jahren in vielen Untersuchungen mit kürzerer Laufzeit erkannt wurde, bestätigt auch die bislang am längsten, nämlich im Berichtsjahr 2009 13 Jahre laufende so genannte PLCO-Studie (Prostate, Lung, Colorectal and Ovarian Cancer Screening Trial) mit 76 .685 Teilnehmern aus 10 Screeningzentren im Alter von 55 bis 74 Jahren. Diese Teilnehmer wurden zufällig einer Gruppe zugewiesen, die 6 Jahre (bis zum Jahr 2006) regelmäßig an einem PSA-Screeningtest (PSA= prostataspezifisches Antigen) plus einer vierjährigen rektalen Untersuchung der Prostata teilnahm und einer Gruppe mit traditioneller Behandlung zu der von Fall zu Fall auch ein PSA-Test gehören konnte.
Was seit Jahren in vielen Untersuchungen mit kürzerer Laufzeit erkannt wurde, bestätigt auch die bislang am längsten, nämlich im Berichtsjahr 2009 13 Jahre laufende so genannte PLCO-Studie (Prostate, Lung, Colorectal and Ovarian Cancer Screening Trial) mit 76 .685 Teilnehmern aus 10 Screeningzentren im Alter von 55 bis 74 Jahren. Diese Teilnehmer wurden zufällig einer Gruppe zugewiesen, die 6 Jahre (bis zum Jahr 2006) regelmäßig an einem PSA-Screeningtest (PSA= prostataspezifisches Antigen) plus einer vierjährigen rektalen Untersuchung der Prostata teilnahm und einer Gruppe mit traditioneller Behandlung zu der von Fall zu Fall auch ein PSA-Test gehören konnte.
Das Ergebnis lautete:
• Die Inzidenz von Prostatakrebs war zwar in der Gruppe, die 6 Jahre an PSA-Screeningtests teilnahm, signifikant höher (108,4 gegenüber 97,1 Fälle pro 10.000 Personenjahre).
• An der Wahrscheinlichkeit, dass Teilnehmer der Studie an Prostatakrebs verstarben, änderte die Teilnahme am Screeningtest nichts. Die kumulative Sterblichkeitsrate für Prostatakrebs betrug 3,7 Fälle pro 10.000 Personenjahre in der Screeninggruppe und 3,4 Fälle in der Gruppe mit Standardbehandlung. Der Unterschied war statistisch nicht signifikant (RR=1,09 mit einem Konfidenzintervall von 0,87 bis1,36).
Die Schlussfolgerung der Forschergruppe lautete daher: "There is no evidence of a benefit [from screening]. Indeed, there is evidence of harms, in part associated with the false-positive tests, but also with the overdiagnosis inseparable from PSA screening, especially in older men".
Nachdem die Forschergruppe bei der Vorlage ähnlicher Ergebnisse nach 10 Jahren Laufzeit kritisiert wurde, die Zeit sei zu kurz für verlässliche Ergebnisse, beabsichtigt sie auch nach 13 Jahren noch die Studie fortzusetzen und nach 15 Jahren Laufzeit erneut Daten zu veröffentlichen.
Der Aufsatz enthält neben den eigenen Ergebnissen die meistenteils übereinstimmenden Resultate zahlreicher anderer Studien und Metaanalysen und verschafft daher einen guten Überblick zur insgesamt screeningskeptischen Forschungslandschaft im Bereich PSA-Test und Prostatakrebs.
Der Aufsatz "Prostate Cancer Screening in the Randomized Prostate, Lung, Colorectal, and Ovarian Cancer Screening Trial: Mortality Results after 13 Years of Follow-up" von Gerald L. Andriole et al. ist in der Onlineausgabe der Krebsfachzeitschrift "Journal of the National Cancer Institute" vom 6. Januar 2012 erschienen. Kostenlos ist lediglich das umfangreiche Abstract erhältlich.
Bernard Braun, 10.1.12
US-Empfehlung: Schluss mit PSA-basiertem Prostatakrebs-Screening bei gesunden Männern! Deutsche Urologen: "zu drastisch"!
 33 der 44 Millionen US-Amerikaner über 50 Jahre haben schon einen so genannten PSA-Test (Suche nach einem prostata-spezifischen Antigen) hinter sich. Vielen von ihnen wurde dabei, gestützt auf die "gute Erfahrungen" ihrer Urologen und auf entsprechende Leitlinien der Fachgesellschaften, ein großer persönlicher Nutzen bis hin zur Verbesserung der Überlebenschancen bei Prostatakrebs versprochen. Selbst die sich häufenden Hinweise, dass dieser Test bei symptomlos gesunden Männern wahrscheinlich weder diesen noch andere Nutzen erbringe, und daher die nachweisbaren Nachteile und Schäden durch weitere invasive Tests (z.B. Biopsien) und Behandlungen umso stärker zu bewerten sind, brachten das Vertrauen in den PSA-Test nicht ins Wanken.
33 der 44 Millionen US-Amerikaner über 50 Jahre haben schon einen so genannten PSA-Test (Suche nach einem prostata-spezifischen Antigen) hinter sich. Vielen von ihnen wurde dabei, gestützt auf die "gute Erfahrungen" ihrer Urologen und auf entsprechende Leitlinien der Fachgesellschaften, ein großer persönlicher Nutzen bis hin zur Verbesserung der Überlebenschancen bei Prostatakrebs versprochen. Selbst die sich häufenden Hinweise, dass dieser Test bei symptomlos gesunden Männern wahrscheinlich weder diesen noch andere Nutzen erbringe, und daher die nachweisbaren Nachteile und Schäden durch weitere invasive Tests (z.B. Biopsien) und Behandlungen umso stärker zu bewerten sind, brachten das Vertrauen in den PSA-Test nicht ins Wanken.
Gestützt auf die bewerteten Ergebnisse von 5 in den USA und Europa durchgeführten großen Studien, macht sich jetzt mit der "United States Preventive Services Task Force (USPSTF)" eine recht gewichtige und für die us-amerikanische Behandlungswirklichkeit autoritative Fachinstitution daran, aus dem Wanken einen Umsturz zu machen.
Nachdem die USPSTF bereits 2008 empfohlen hatte von einem PSA-Screening bei 75-Jährigen und Älteren abzusehen, lautet ihre jetzige Empfehlung: "The USPSTF now recommends against PSA-based screening for prostate cancer in all age groups." Die Studien hätten auf der Basis von Lebens- und Behandlungsverläufen von hunderttausenden Männern selbst nach bis zu 10 Jahren entweder keine lebensrettenden oder -verlängernden oder höchstens einen sehr kleinen Effekt des Tests nachweisen können.
Was die Experten zu dieser, im Moment auch noch gegen eine explizit andere Empfehlung der urologischen Fachgesellschaften der USA gerichtete Empfehlung bewogen hat, begründen u.a. die folgenden versorgungsepidemiologischen Daten: Von 1986 bis 2005 sind allein in den USA eine Million Männer operiert, bestrahlt oder beides geworden, die ohne den PSA-Test niemals behandelt worden wären. Von ihnen starben wenigstens 5.000 kurz nach der Operation und 10.000 bis 70.000 litten unter ernsthaften Komplikationen. Die Hälfte dieser Männer hatte anhaltend Blut in ihrem Samen und 200.000 bis 300.000 litten unter Impotenz oder Inkontinenz oder beiden gravierenden Einschränkungen ihrer Lebensqualität. Selbst der Entwickler des Tests, Richard Ablin, sprach daher bereits vor einiger Zeit von einem "public health disaster". Um einen Todesfall durch ein Prostatakarzinom zu verhindern, müssen 1.400 Männer gescreent werden und 48 Männer als Patienten behandelt werden.
Dabei verschweigen die Experten keineswegs, dass Prostatakrebs bei Männern zu den häufigsten, auch tödlichen Krebserkrankungen gehört: 2010 wurden in den USA bei schätzungsweise 217.730 Männer ein Prostakarzinom diagnostiziert und 32.050 Männer starben an dieser Krankheit.
Ab Dienstag dem 11. Oktober 2011 können interessierte Akteure die Empfehlung der Task Force kommentieren. Bereits bekannte Äußerungen lassen auch komplette Ablehnung oder moderatere Kompromissvorschläge erwarten. Hier lohnt sich ein regelmäßiger Blick auf die Kommentar-Website der USPSTF.
Den deutschen Urologen sind die Empfehlungen laut dem entsprechenden Spiegel online-Beitrag von Cinthia Briseno "zu drastisch", es gäbe viele Männer, die ihn für nützlich hielten und außerdem würde der PSA-Test hierzulande bei weitem nicht so häufig angeboten und durchgeführt wie in den USA. Trotzdem wäre es nach Meinung einiger dieser Experten wahrscheinlich sinnvoll, einen anderen Test zu entwickeln - was aber noch viele Jahre dauern könne. Und deshalb windet sich diese Argumentation wieder der Position zu, dass doch lieber der PSA-Test weiter durchgeführt aber durch rektale Untersuchungen ergänzt werden solle.
Wer mit dieser Art von "Sachargumentation" nichts anfangen kann, dem seien die auf 7 Seiten zusammengetragenen vielfältigen Sach- und Fachinformationen im "Draft Recommendation Statement - Summary of Recommendation and Evidence" der USPSTF empfohlen, die es mit viel Literaturverweisen angereichert, komplett und kostenlos zum Herunterladen gibt. Egal wie die weitere Diskussion ausgeht, sollten die hier vorliegenden Fakten in keiner PSA- und Prostatakrebsdebatte der Zukunft mehr fehlen.
Eine lesenswerte Zusammenfassung der Empfehlungen und einige Ergänzungen liefert auch der von Gardiner Harris verfasste Artikel U.S. Panel Says No to Prostate Screening for Healthy Men in der New York Times vom 6. Oktober 2011.
Bernard Braun, 9.10.11
Prävention koronarer Herzerkrankungen: Keine Evidenz für das Screening symptomfreier Erwachsener mit Ruhe- und Belastungs-EKGs
 Koronare Herzerkrankungen sind immer noch die Nummer 1 unter den Todesursachen in Ländern wie den USA aber auch in Deutschland. Daher ist es nicht verwunderlich, dass Kardiologen und Gesundheitspolitiker immer mal wieder davon träumen durch das Screening von symptomlosen Erwachsenen z.B. das Risiko tödlicher Herzinfarkte senken zu können. Zu den diskutierten Screeningmethoden gehören dann beispielsweise das Ruhe- und Belastungs-Elektrokardiogramm (EKG). Das Ruhe-EKG war daher auch ein fester Bestandteil der gesetzlichen Gesundheitsuntersuchungen für GKV-Versicherte und beide Untersuchungen sind Bestandteile der so genannten präventiven "Durch-Check"-Programme.
Koronare Herzerkrankungen sind immer noch die Nummer 1 unter den Todesursachen in Ländern wie den USA aber auch in Deutschland. Daher ist es nicht verwunderlich, dass Kardiologen und Gesundheitspolitiker immer mal wieder davon träumen durch das Screening von symptomlosen Erwachsenen z.B. das Risiko tödlicher Herzinfarkte senken zu können. Zu den diskutierten Screeningmethoden gehören dann beispielsweise das Ruhe- und Belastungs-Elektrokardiogramm (EKG). Das Ruhe-EKG war daher auch ein fester Bestandteil der gesetzlichen Gesundheitsuntersuchungen für GKV-Versicherte und beide Untersuchungen sind Bestandteile der so genannten präventiven "Durch-Check"-Programme.
Ob durch die screeningsmäßigen EKG-Untersuchungen und die dadurch mögliche Identifikation von Abnormalitäten aber wirklich ein gesundheitlicher Nutzen erzielt werden kann, war schon in der Vergangenheit immer wieder umstritten. Die insbesondere dem oft ungenauen Ruhe-EKG folgende Kaskade von Belastungs-EKG und weiteren Untersuchungen, förderte sogar Bedenken, dass dadurch mögliche Schaden sogar den Nutzen überwiege.
Eine im Auftrag der "U.S. Preventive Services Task Force" durchgeführte Analyse der zwischen 2002 und Anfang 2011 durchgeführten randomisierten kontrollierten und prospektiven Kohortenstudien versuchte hierzu konkrete Antworten zu finden.
Als erstes fanden die AutorInnen keine einzige englischsprachige Studie, die das klinische Ergebnis oder den Einsatz risikoreduzierender Therapien zwischen einer Screening- und einer Nicht-Screeninggruppe untersuchte. Außerdem fand sich keine Studie, die untersuchte, wie genau Ruhe- oder Belastungs-EKG das Risikoniveau der untersuchten Personen bestimmte, verglichen mit den Ergebnissen der traditionellen Risikofaktoren-Begutachtung. Schließlich gab es aber 63 prospektive Kohortenstudien, die zeigten, dass die beiden EKG-Untersuchungsmethoden Abnormalitäten entdeckten, die mit einem erhöhten Risiko für koronare Herzerkrankungen assoziiert waren. Direkte Schädigungen durch die Untersuchungen waren beim Ruhe-EKG minimal und beim Belastungs-EKG klein. Obwohl dem Belastungs-EKG in zunehmenden Umfang eine Angiographie folgt, untersuchte bisher keine Studie, ob hierdurch ein gesundheitlicher Schaden entsteht.
Da es für den Nutzen einer klinischen Behandlung nach einem EKG-Screening weiterhin nicht genügend Evidenz gibt, raten die AutorInnen wie bereits 2004 erneut davon ab, Ruhe- und Belastungs-EKG bei symptomfreien Personen durchzuführen. Ein Herausgeber der Fachzeitschrift "Annals of Internal Medicine" unterstützt diese Empfehlung in einem Kommentar mit dem folgenden Argument: "We cannot assume that because a clinical measurement predicts risk, incorporating it into clinical care will reduce risk." Dies schließe aber nicht aus, dass der erkannte Mangel an Forschung endliuch beseitigt würde.
Zu dem in der Fachzeitschrift "Annals of Internal Medicine" (2011;155: 375-385) erschienenen (Aufsatz Screening Asymptomatic Adults With Resting or Exercise Electrocardiography: A Review of the Evidence for the U.S. Preventive Services Task Force von Roger Chou et al. gibt es kostenlos nu rein Abstract.
Bernard Braun, 29.9.11
Screening, Überdiagnostik und Überbehandlung: Anstieg der Brustentfernungen statt Abnahme nach Einführung von Brustkrebs-Screening
 Zu den den vielen Versprechungen von Medizinern, diversen Beratungs- und Aufklärungsbroschüren von Krankenkassen, Patientenverbänden oder Verbände zum Nutzen des Brustkrebs-Screenings und zu den verständlichen Erwartungen der gesunden Nutzerinnen des Brustkrebs-Screenings gehört eine im Falle der Entdeckung eines Mamma-Karzinoms geringere Wahrescheinlichkeit und Notwendigkeit, die erkrankte Brust entfernen zu müssen. Die so genannte Mastektomie gehört zu den u.a. psychisch schwer belastenden Endpunkten einer Brustkrebserkrankung.
Zu den den vielen Versprechungen von Medizinern, diversen Beratungs- und Aufklärungsbroschüren von Krankenkassen, Patientenverbänden oder Verbände zum Nutzen des Brustkrebs-Screenings und zu den verständlichen Erwartungen der gesunden Nutzerinnen des Brustkrebs-Screenings gehört eine im Falle der Entdeckung eines Mamma-Karzinoms geringere Wahrescheinlichkeit und Notwendigkeit, die erkrankte Brust entfernen zu müssen. Die so genannte Mastektomie gehört zu den u.a. psychisch schwer belastenden Endpunkten einer Brustkrebserkrankung.
Wie viele andere Versprechungen und Erwartungen scheint dies aber nicht nachweisbar, einer der vielen Irrtümer über Früherkennungsuntersuchungen und das Gegenteil richtig zu sein.
Dies ist jedenfalls das ernüchternde Ergebnis einer Analyse der Daten von 35.408 Frauen im Alter von 40 bis 79 Jahren, die zwischen 1993 und 2008 wegen eines Mammakarzinioms operiert wurden und deren Daten im norwegischen Krebsregister erfasst sind. Verglichen wurden die Rate der Brustentfernungen in der Zeit vor (1993-95), während der Einführung (1996-2004) und nach beendeter Einführung (2005-08) des Brustkrebs-Screenings.
Die jährliche Rate an Brustkrebsoperationen stieg in der Gruppe der in dem Screeningprogramm zweijährig zu Untersuchungen eingeladenen Frauen im Alter von 50 bis 69 Jahren von der Vor-Screeningperiode bis zur Screeningperiode um signifikante 70%. In der nicht eingeladenen jüngeren Frauengruppe im Alter von 40-49 Jahren betrug der Anstieg der Operationsrate nur 8%. In der ebenfalls nicht systematisch zum Brustkrebs-Screening eingeladenen Altersgruppe von 70-79 Jahren sank die Rate sogar um 8%.
Was ebenfalls im Zusammenhang mit der Einführung des Brustkrebs-Screenings stieg, war die Rate der Mastektomien bei zum Screening eingeladenen 50-69-jährigen Frauen, und zwar um 9%. Dem stand die Abnahme der Mastektomien bei den jüngeren, nicht eingeladenen Frauen um 17%. In der zum Screening eingeladenen Frauengruppe war die Mastektomierate um 31% höher als in der nichteingeladenen jüngeren Gruppe. Die AutorInnen weisen zur Erklärung dieser Entwicklung der OP-Häufigkeiten auf Studien über die Effekte von fünf Screeningprogrammen hin, die zu einer 52%-igen Überdiagnostik von Brustkrebs führen, der ohne das Screening innerhalb der wahrscheinlichen Lebenszeit der untersuchten Frauen nicht klinisch relevant geworden wäre.
Die besonders in der Einführungszeit des Screenings gestiegenen Operationsraten und das teilweise Sinken nach Abschluss der Einführung interpretieren die AutorInnen vor allem als Folge einer veränderten, beispielsweise mehr brusterhaltenden Operations-Politik bei Brustkrebs.
Der Aufsatz "Effect of mammography screening on surgical treatment for breast cancer in Norway: comparative analysis of cancer registry data" von Pal Suhrke et al. ist im September 2011 in der Fachzeitschrift "British Medical Journal" (2011;343: d4692 doi: 10.1136/bmj.d4692) erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 14.9.11
Hausärzte in Brandenburg: Gesetzliche "Gesundheitsuntersuchung" nicht sinnvoll, außer mit IGeL-Zusatzleistungen
 Seitdem im Jahr 1989 mit dem § 25 des Fünften Buches des Sozialgesetzbuches jeder Versicherte in einer gesetzlichen Krankenkasse den Anspruch erhielt, nach Vollendung des 35. Lebensjahres jedes 2. Jahr eine "ärztliche Gesundheitsuntersuchung zur Früherkennung von Krankheiten, insbesondere zur Früherkennung von Herz-Kreislauf- und Nierenerkrankungen sowie der Zuckerkrankheit" durchführen zu lassen, ist diese auch als "Check Up 35" propagierte Leistung umstritten. Der Streit und Zweifel am Sinn der Leistung entzündete sich vor allem an der sich stabil zwischen 20% und allerhöchstens 50% bewegenden Inanspruchnahme, der mangelnden Spezifität und Sensitivität der Check Up-Untersuchungen, die häufig wegen Mängel durch weitere Untersuchungen geklärt werden müssen und der häufigen therapeutischen Folgenlosigkeit von Screeningergebnissen. Trotzdem gab es weder von Krankenkassen- noch von Seiten der Ärzteschaft offene und konsequente Forderungen, diese Leistung in dieser Form wieder abzuschaffen. Bei den Ärzten mag dafür die extrabudgetäre Vergütung der Leistungen eine gewisse Rolle spielen.
Seitdem im Jahr 1989 mit dem § 25 des Fünften Buches des Sozialgesetzbuches jeder Versicherte in einer gesetzlichen Krankenkasse den Anspruch erhielt, nach Vollendung des 35. Lebensjahres jedes 2. Jahr eine "ärztliche Gesundheitsuntersuchung zur Früherkennung von Krankheiten, insbesondere zur Früherkennung von Herz-Kreislauf- und Nierenerkrankungen sowie der Zuckerkrankheit" durchführen zu lassen, ist diese auch als "Check Up 35" propagierte Leistung umstritten. Der Streit und Zweifel am Sinn der Leistung entzündete sich vor allem an der sich stabil zwischen 20% und allerhöchstens 50% bewegenden Inanspruchnahme, der mangelnden Spezifität und Sensitivität der Check Up-Untersuchungen, die häufig wegen Mängel durch weitere Untersuchungen geklärt werden müssen und der häufigen therapeutischen Folgenlosigkeit von Screeningergebnissen. Trotzdem gab es weder von Krankenkassen- noch von Seiten der Ärzteschaft offene und konsequente Forderungen, diese Leistung in dieser Form wieder abzuschaffen. Bei den Ärzten mag dafür die extrabudgetäre Vergütung der Leistungen eine gewisse Rolle spielen.
Ob und wie kritisch Ärzte die Wirksamkeit der Leistung sehen, wurde jetzt das erste Mal mittels eines Fragebogens ermittelt, der im Frühjahr 2009 an eine repräsentative Stichprobe von 748 im Bereich der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburgs tätigen Hausärzte verschickt und von 274 oder 37% von ihnen auch ausgefüllt wurde.
Die wichtigsten Ergebnisse:
• Die Befragten hatten genügend Erfahrung mit der Gesundheitsuntersuchung. Sie führten sie im Median 40mal pro Quartal durch.
• Nur 4% boten die Untersuchung in der zwischen Krankenkassen und Ärzteschaft vereinbarten Standardform durch. Die restlichen 96% verknüpften das Standardprogramm mit weiteren Untersuchungen zur Früherkennung, die nur bei 49% der Ärzte zu keinerlei finanziellen Belastungen der Patienten führen. Am häufigsten wurde die Kreatinin-Bestimmung durchgeführt. Weit über zwei Drittel der Hausärzte führen aber auch "praktisch immer" oder in der Mehrzahl der Fälle ein kleines Blutbild, diverse Cholesterinwerteuntersuchungen oder Ruhe-EKGs durch. Dies ist insoweit bemerkenswert, weil der damalige Bundesausschuss der Ärzte und Krankenkassen (eine Art Vorläufer des seit 2004 für solche Fragen zuständigen "Gemeinsamen Bundesausschusses") einige dieser und andere Leistungen bereits 1999 als nicht hinreichend wissenschaftlich begründet aus dem Untersuchungskatalog der Gesundheitsuntersuchung gestrichgen hat.
• Die Beurteilung der Leistung ist zwiespältig: In ihrer derzeit offiziell vorgesehenen Form halten sie 52% der Befragten für "nicht sinnvoll" oder "eher nicht sinnvoll". Zum Teil anders sieht es aus, wenn die Ärzte sagen sollen, welchen Nutzen die Untersuchung in Detailangeboten hat: Fast 90% beurteilen dann den Nutzen für die Beratung über individuelle Risikofaktoren für "hoch" oder "eher hoch". Ähnlich hoch wird der Nutzen für die Erkennung von Risikofaktoren bewertet. Wenn es um die Entlastung von Gesundheitssorgen oder um die Auseinandersetzung mit psychosozialen Problemen, sehen aber nur noch rund 50% und weniger der Hausärzte einen Nutzen der Gesundheitsuntersuchung. Teilweise wird daher nur das zusätzliche Angebot, d.h. ein Angebot für das der Check Up nur der Aufhänger ist, als nützlich bewertet.
Was dies nun für die künftige Versorgung bedeutet, bleibt bei den AutorInnen der Studie diplomatisch in der Schwebe. Die unter den brandenburgischen Hausärzten weit verbreitete Neigung, die Gesundheitsuntersuchung zum Anlass zu nehmen, um zum Teil zweifelhafte aber in vielen Fällen für die NutzerInnen kostspielige individuelle Gesundheitsleistungen zu verkaufen, führt lediglich zu dem Vorhalt, es bleibe "unklar, inwieweit die präventive Wertigkeit dieser Untersuchungen von den durchführenden Hausärzten reflektiert wird." Dass das Problem aber damit gelöst wird, dass der vermutete "Qualifizierungsbedarf über Möglichkeiten und Grenzen von Früherkennungsmaßnahmen" befriedigt wird, erscheint nach allem was man über die Wirksamkeit der existierenden Qualifizierungsmaßnahmen weiß zu kurz und/oder in die falsche Richtung gegriffen.
Vermutlich werden aber von allen Beteiligten unter Verweis auf die geringe oder verzerrte (Nichtteilnahme der Ärzte, die überhaupt kein Check Up anbieten) Beteiligung von Hausärzten und die Nichtrepräsentativität der Brandenburger Hausärzte die Ergebnisse so lange in Frage gestellt bis auf praktische Schlussfolgerungen guten Gewissens verzichtet werden kann.
Der Aufsatz "Die Gesundheitsuntersuchung: Welchen Nutzen sehen Brandenburger Hausärzte?" von Sebastian Regus et al. ist in der aktuellen Ausgabe der "Zeitschrift für Evidenz, Fortbildung und Qualität im Gesundheitswesen" (Volume 105, Issue 6, 2011: 421-426) erschienen. Kostenlos ist leider nur das Abstract erhältlich.
Bernard Braun, 2.9.11
Medizinisch-technischer Fortschritt: teuer, aber gut und nützlich!? Das Beispiel der softwaregestützten Analyse von Mammogrammen.
 Zu den Verheißungen des Pro-E-Health-Diskurses gehört, dass ein Teil der bisher für diagnostische und therapeutische Tätigkeit aufgewandten Arbeitszeit und Aufmerksamkeit von Ärzten oder anderen hochqualifizierten, teuren und angeblich auch knapp werdenden Berufstätigen im Gesundheitswesen durch entsprechende Computersoftware eingespart werden kann - ohne, so jedenfalls nimmermüde die Hersteller, einen relevanten Qualitätsverlust oder gar mit einem höheren Nutzen dank des nie müde und unpräzise werdenden technischen Verfahrens.
Zu den Verheißungen des Pro-E-Health-Diskurses gehört, dass ein Teil der bisher für diagnostische und therapeutische Tätigkeit aufgewandten Arbeitszeit und Aufmerksamkeit von Ärzten oder anderen hochqualifizierten, teuren und angeblich auch knapp werdenden Berufstätigen im Gesundheitswesen durch entsprechende Computersoftware eingespart werden kann - ohne, so jedenfalls nimmermüde die Hersteller, einen relevanten Qualitätsverlust oder gar mit einem höheren Nutzen dank des nie müde und unpräzise werdenden technischen Verfahrens.
Es wundert deshalb nicht, dass gerade auch bei sehr häufigen diagnostischen Verfahren wie der Mammographie in den USA bereits rund 75% der gewonnenen Bilder mit Unterstützung entsprechender Software ("computer assisted detection" [CAD]) ausgewertet werden und sich Therapieentscheidungen u.a. auf die Richtigkeit der damit erzielten Ergebnisse beziehen. Die staatliche Krankenversicherung für Ältere, Medicare, gibt jährlich 20 Millionen US-Dollar für diese Art der Mammografie-Analyse aus.
Überprüft man den mit technischer Assistenz erzielten Ergebnisqualität-Nutzen mit dem, der allein auf den Augen und Erfahrungen von Radiologen etc. beruht, ist ersterer relativ gering und die Anzahl von falsch-positiven Befunden deutlich höher.
Nachdem dieser Verdacht bereits vor einigen Jahren geäußert und auch empirisch erhärtet wurde, untersuchten nach dem definitiven Ende einer Lernzeit eine Gruppe von Wissenschaftlern mit den Daten der 90 im "Breast Cancer Surveillance Consortium" zusammengefassten Diagnosezentren diese Frage erneut. Die Datenbasis umfasste 684.956 Frauen mit mehr als 1,6 Millionen Mammografien. Im Untersuchungsjahr 2006 setzten rund 28% der Diagnosezentren die Analyse-Software bereits 27,5 Monate lang ein.
Der Vergleich mit Zentren, die dieses Instrument des medizinisch-technischen Fortschritts nicht einsetzten, sieht dann wie folgt aus:
• Die Spezifität (die Fähigkeit risikofreie Personen zu entdecken und damit von weiteren diagnostischen und therapeutischen Prozeduren frei zu halten) der softwaregestützten Diagnose war statistisch signifikant um 13% geringer. Und auch der positive prädiktive Wert, also ein zentraler Ergebnisindikator der Mammografie, war signifikant um 11% niedriger.
• Die Sensitivität oder die Fähigkeit risikobehaftete Personen zuverlässig zu entdecken ist beim Einsatz con CAD zunächst leicht um 6% erhöht. Vor allzu viel Jubel ist aber zweierlei zu bedenken: Die Sensitivität in den Mammografiezentren, die sich auf die Blicke und Erfahrungen von ärztlichen Experten verlassen, ist erstens nicht signifikant niedriger und zweitens werden überwiegend "nur" so genannte duktale Karzinome in situ entdeckt. Dies sind krankhafte Wucherungen neoplastischer Zellen in den Milchgängen der weiblichen Brust, also aktuell kein bösartiger Krebs, die nur zum Teil (schätzungsweise in 10-20 Jahren rund 50%) invasive Karzinome werden können. Nur für diese Fälle hätte also eine Entdeckung möglicherweise einen Nutzen als Krebsvorsorge.
• Die computerassistierte Entdeckungsmethode war aber auch nicht mit einer generell höheren Entdeckungsrate von Brustkrebs oder mit der Entdeckung in einem besseren Stadium, in kleinerer Größe und einem unproblematischen Zustand der Lymphknoten im Falle eines invasiven Karzinoms assoziiert.
Zurückhaltend formulierend fassen die Forscher ihre Ergebnisse so zusammen: "The health benefits of CAD use during screening mammograms remain unclear, and the data indicate that the associated costs may outweigh the potential health benefits." Damit nicht genug, weisen sie darauf hin, dass die jetzige CAD-Praxis in den USA das Risiko erhöht, ohne gesundheitlichen Grund und mit zweifelhaftem gesundheitlichen Nutzen weitere Untersuchungen angeboten zu bekommen.
Wenn man jetzt noch bedenkt, dass es seit Jahren (vgl. dazu den Forumsbeitrag Brustkrebs-Früherkennung durch Mammographie: Ein Drittel aller Karzinome ist harmlos und überdiagnostiziert aber auch ganz aktuell (vgl. dazu die Ergebnisse eines gerade im "British Medical Journal" veröffentlichten und kostenlos erhältlichen 6-Ländervergleichs des Mammographienutzens für die Sterblichkeit, welche die Autoren so zusammenfassen: ""The contrast between the time differences in implementation of mammography screening and the similarity in reductions in mortality between the country pairs suggest[s] that screening did not play a direct part in the reductions in breast cancer mortality." - mehr dazu demnächst im Forum) kontroverse Untersuchungen und heftige Debatten über den grundsätzlichen Nutzen der Mammographie gibt, wird ein möglicherweise im Zeichen von Ärztemangel standardmäßige Einsatz von CAD noch fragwürdiger.
Für den Aufsatz "Effectiveness of Computer-Aided Detection in Community Mammography Practice" von Joshua Fenton et al., erschienen im "Journal of the National Cancer Institute (JNCI)" der USA (Vol. 103, Issue 15 vom 3.August 2011), ist kostenlos nur ein Abstract erhältlich.
Bernard Braun, 14.8.11
40 Jahre "war on cancer", 20 Jahre "Prostate, Lung, Colorectal, and Ovarian Cancer Screening trial" und kein "Sieg" in Sicht!
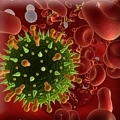 Der größte, langlebigste und solideste wissenschaftliche Beitrag (die "Prostate, Lung, Colorectal, and Ovarian Cancer (PLCO) Screening"-Studie) zu dem im Jahr 1971 vom damaligen US-Präsidenten Nixon per Gesetz (The National Cancer Act (P.L. 92-218) erklärten Krieg gegen den Krebs ist zwanzig Jahre nach seinem Start bezogen auf die "Wunderwaffe" Screening zu recht "friedlichen" oder erfolglosen Ergebnissen gelangt.
Der größte, langlebigste und solideste wissenschaftliche Beitrag (die "Prostate, Lung, Colorectal, and Ovarian Cancer (PLCO) Screening"-Studie) zu dem im Jahr 1971 vom damaligen US-Präsidenten Nixon per Gesetz (The National Cancer Act (P.L. 92-218) erklärten Krieg gegen den Krebs ist zwanzig Jahre nach seinem Start bezogen auf die "Wunderwaffe" Screening zu recht "friedlichen" oder erfolglosen Ergebnissen gelangt.
Sowohl über die Ergebnisse zum PSA-Screening: "Die Kernfrage ist nicht, ob das PSA-Screening effektiv ist, sondern ob es mehr nützt als schadet." - Neues und Widersprüchliches. als auch über das Eierstockkrebs-Screening: bringt nachweisbar Schaden durch nicht notwendige Operationen aber keinen Nutzen bei der Mortalität. gibt es 2009 und 2010 veröffentlichte Aufsätze über die im "forum-gesundheitspolitik" berichtet wurde.
Der aktuell als "Online first"-Beitrag im renommierten Medizinjournal "New England Journal of Medicine (NEJM)" veröffentlichte Aufsatz über die erwünschten und unerwünschten Erfolge und Wirkungen des Eierstockkrebs-Screenings bestätigt die bisher publizierten Ergebnisse grundsätzlich, erhärtet sie aber durch seine kompromisslos klaren Aussagen weiter.
Bezogen auf den primären Endpunkt oder Nutzenindikator "Mortalität" kommen die AutorInnen zu folgenden Schlüssen:
• "In this randomized controlled trial, we found no statistically significant reduction in mortality from ovarian cancer in a cohort of women derived from the general population who were screened for ovarian cancer with 6 annual CA-125 tests and 4 annual transvaginal ultrasound examinations. The numbers of deaths from ovarian cancer were similar in the 2 trial groups over the entire period of follow-up (maximal 13 Jahre - Einfügung d. Verf.), with a modestly (although not statistically significant) greater cause-specific mortality rate in the intervention group (RR, 1.18; 95% CI, 0.82-1.71)."
• Zur Häufigkeit und Art des Schadens, den das Screening den untersuchten Frauen unmittelbar und mittelbar zufügt - im kriegerischen Jargon also die Kollateralschäden -, kommt die Studie ebenfalls zu gewichtigen Zahlen. Von den 34.253 Frauen in der Interventionsgruppe erhielten 3.258 ein falsch-positives Resultat, d.h. bei ihnen wurde ein Eierstockkarzinom "entdeckt", das gar nicht existierte. 1.080 unterzogen sich nach dieser Fehldiagnose einer Operation, 32,9% davon einer Eierstockentfernung. Bei 163 operierten Personen, also 15% aller Operierten traten insgesamt 222 unterschiedliche Hauptkomplikationen (z.B. Blutungen, Herz-/Kreislaufstörungen, Infektionen) auf, was einer Rate von 20,6 Komplikationen pro 100 chirurgischen Eingriffen entsprach. Mangels einer wirklichen Erkrankung handelt es sich bei den Operationen und Komplikationen durchweg um mehr oder weniger gefährliche Körperverletzungen.
• Zusammenfassend heißt es dann: "We conclude that annual screening for ovarian cancer as performed in the PLCO trial with simultaneous CA-125 and transvaginal ultrasound does not reduce disease-specific mortality in women at average risk for ovarian cancer but does increase invasive medical procedures and associated harms."
Ob aus dem 0:2 für Krebs-Screenings durch die noch nicht veröffentlichten Mortalitätsdaten der PLCO nach Lungen- und Darmkrebs-Screening ein 2:2 wird, muss abgewartet werden. Das Ergebnis des "Kriegs" könnte aber auch bald 1:2, 1:3 oder 0:4 heißen. Trotz erster Anzeichen, dass CT-Untersuchungen bei Lungenkrebs sich positiv auf die Mortalität an dieser Krebsart auswirken, bleibt nämlich dann immer noch die Frage, ob z.B. allein die Strahlenbelastung bei einem Screening nicht doch mehr Schaden auslöst als präventiven Nutzen stiftet. 2010 hatte das National Cancer Institute (NCI" der USA als erstes und vorläufiges Ergebnis der "National Lung Screening Trial", einer randomisierten Studie mit mehr als 53.000 früher und auch heute noch schwer rauchenden Personen im Alter von 55 bis 74 berichtet, dass die Sterblichkeit an Lungenkrebs bei den mit einer niedrigen CT-Dosis untersuchten Personen um 20% geringer war als bei den Personen, bei denen ein Bruströntgenbild gemacht wurde. Auch beim Lungenkrebs-Screening gibt es aber wenigstens für ein Drittel der untersuchten Personen ein falsch-positives Ergebnis und bei einer Person unter 14 wird dann nutzlos eine Biopsie durchgeführt.
Von dem Online First-Aufsatz "Effect of Screening on Ovarian Cancer Mortality. The Prostate, Lung, Colorectal and Ovarian (PLCO) Cancer Screening Randomized Controlled Trial" im JAMA (2011; 305(22): 2295-2303. doi: 10.1001/jama.2011.766) gibt es dauerhaft ein kostenloses Abstract und anders als bei anderen Zeitschriften zumindest vorübergehend ebenfalls kostenlos den kompletten Text.
Bernard Braun, 11.6.11
Bessere Entscheidungen durch evidenzbasierte Informationen zur Darmkrebsfrüherkennung
 Die Früherkennung von Krebs gilt als sinnvoll, wenn sie die Sterbewahrscheinlichkeit am jeweiligen Krebs und - besser noch - die Gesamtsterblichkeit in der Gruppe der Untersuchten senkt.
Die Früherkennung von Krebs gilt als sinnvoll, wenn sie die Sterbewahrscheinlichkeit am jeweiligen Krebs und - besser noch - die Gesamtsterblichkeit in der Gruppe der Untersuchten senkt.
Nur wenige Früherkennungsmethoden erfüllen dieses Kriterium und selbst diese Methoden stiften wegen der stets nur beschränkten Treffsicherheit nicht nur Nutzen sondern auch Schaden. Falsch positive und falsch negative Befunde bei der Früherkennungsuntersuchung, Diagnosestellung und Therapie bei Tumoren, die sich nie bemerkbar gemacht hätten (Überdiagnose und Übertherapie) und eine relativ geringe Aussicht des Einzelnen auf den Benefit des vermiedenen Krebstodes sind unvermeidliche Aspekte von Krebsfrüherkennungsprogrammen.
Daher hat in den letzten Jahren die Forderung an Gewicht gewonnen, dass Betroffenen umfassende und individualisierte Informationen über den Nutzen und Schaden der Früherkennung angeboten werden sollen, damit sie eine informierte Entscheidung für oder gegen die Untersuchung treffen können. Die bislang vorliegenden Informationsmaterialien sparen die weniger erfreulichen Aspekte zumeist aus, informieren somit einseitig und unvollständig und haben häufig eher Werbe- als Informationscharakter - ein allein aus ethischen Gründen nicht haltbarer Zustand.
Eine Hamburger Forschungsgruppe um Ingrid Mühlhauser hat jetzt die Effekte einer evidenzbasierten im Vergleich zu einer konventionellen Patienteninformation zur Darmkrebsfrüherkennung untersucht.
1.577 Angehörige einer Krankenversicherung im Alter von 50 bis 75 Jahren wurden nach Zufallskriterien wurden in zwei Gruppen eingeteilt. Die Hälfte der Probanden erhielt eine 38-seitige, von der Arbeitsgruppe entwickelte evidenzbasierte Broschüre, in der z.B. individuelle Wahrscheinlichkeiten zur Erkrankung und zum Tod an Darmkrebs dargestellt werden sowie der mögliche Nutzen und Schaden der Früherkennungsuntersuchung. Die andere Gruppe erhielt eine konventionelle Information, das Informationsblatt des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Darmkrebsfrüherkennung; darin wird in allgemeiner und einseitiger Form für die Teilnahme geworben.
Der Ergebnisparameter war die "informierte Entscheidung", in die das Wissen, die Haltung zu Krebsfrüherkennung und die tatsächliche oder geplante Durchführung der Früherkennungsuntersuchung eingingen. Die Ergebnisse wurden mit Hilfe eines Fragebogens erfasst, der den Teilnehmern sechs Monate nach der Information per Post zugesandt wurde.
Die wesentlichen Ergebnisse der Intervention:
• 44% trafen eine informierte Entscheidung, in der Vergleichsgruppe lediglich 12,8%.
• Ein "gutes Wissen" hatten 59,6% erworben, in der Vergleichsgruppe16,2%.
• Die "positive Haltung" zur Darmkrebsfrüherkennung war in beiden Gruppen hoch, in der besser informierten Gruppe jedoch etwas niedriger (93,4% vs. 96,5%).
• Auf die tatsächliche oder geplante Durchführung wirkte sich die Intervention nicht aus - 72,4% in der Interventionsgruppe bzw. 72,9% in der Vergleichsgruppe hatten die Untersuchung schon hinter sich bzw. planten sie durchführen zu lassen.
Somit hat diese evidenzbasierte Patienteninformation starke Effekte auf das Wissen und auf die Art der Entscheidung. Aus Sicht derjenigen, die der Früherkennungsuntersuchung eher positiv gegenüber stehen, trifft die befürchtete Minderung der Inanspruchnahme also nicht ein. Die positive Bewertung und folgerichtige Nutzung der Krebsfrüherkennung wird kaum gemindert. Dies heißt aber auch: Die aufwändige evidenzbasierte Risikoinformation hat am Inanspruchnahme-Verhalten nichts geändert.
Aus einer etwas skeptischeren Sicht und Bewertung der Inanspruchnahme dieser Untersuchungen stellt sich die Frage, warum eine inhaltlich deutlich andere Information an der Häufigkeit des letztlich relevanten Endpunkts der Entscheidungsfindung nichts ändert und damit auch nichts an den möglichen Folgewirkungen falsch-positiver oder negativer Ergebnisse des Screenings. Die AutorInnen deuten an, dass die TeilnehmerInnen möglicherweise wegen der weit verbreiteten positiven Bewertung von Früherkennung durch ehrliche Risikoinformationen in eine Situation der kognitiven Dissonanz geraten und dann doch lieber das vorhandene positiv besetzte Untersuchungsangebot nutzen. Ob diese massive Barriere zwischen Wissen und Handeln existiert, sollte jedenfalls im Hinblick auf die Wirksamkeit weiterer wünschenswerter evidenter Risikoinformation noch gründlicher untersucht werden.
Es ist zu hoffen, dass in weiteren Untersuchungen ebenfalls geprüft wird, ob sich diese Ergebnisse verallgemeinern lassen, ob sie also auch für andere Populationen und andere Krebsarten gelten.
Steckelberg A, Hülfenhaus C, Haastert B, Mühlhauser I. Effect of evidence based risk information on "informed choice" in colorectal cancer screening: randomised controlled trial. BMJ 2011;342
Abstract
Volltext
38-seitige Broschüre zur Darmkrebsfrüherkennung Download
Zusatzmaterialien Link
David Klemperer, 7.6.11
Eierstockkrebs-Screening bringt nachweisbar Schaden durch nicht notwendige Operationen aber keinen Nutzen bei der Mortalität.
 Die bereits jetzt lange Reihe der als Screening konzipierten und angebotenen Früherkennungsuntersuchungen, deren Nutzen geringer und deren Nachteil für die untersuchten Personen höher als erwartet ist, wird jetzt gerade verlängert: durch die Ergebnisse einer Studie zur Wirkung von Screeningsuntersuchungen nach der zu den fünf häufigsten und schwersten Krebserkrankungen gehörenden Krebserkrankung der Eierstöcke.
Die bereits jetzt lange Reihe der als Screening konzipierten und angebotenen Früherkennungsuntersuchungen, deren Nutzen geringer und deren Nachteil für die untersuchten Personen höher als erwartet ist, wird jetzt gerade verlängert: durch die Ergebnisse einer Studie zur Wirkung von Screeningsuntersuchungen nach der zu den fünf häufigsten und schwersten Krebserkrankungen gehörenden Krebserkrankung der Eierstöcke.
An der großen randomisierten kontrollierten "Prostate, Lung, Colorectal, and Ovarian (PLCO) Cancer"-Studie in 10 landesweiten Screening-Zentren in den USA waren zwischen 1993 und 2001 78.216 Frauen im Alter von 55 bis 74 Jahren beteiligt. 39.105 von ihnen wurden nach dem Zufallsprinzip dem so genannten Interventionsarm zugewiesen und nahmen, 39.111 gehörten der Kontrollgruppe mit standardmäßiger Behandlung an. Die Frauen in der Interventionsgruppe wurden sechs und danach noch weitere 4 Jahre mit zwei verschiedenen Methoden auf das Vorliegen von früh zu erkennenden Anzeichen für eine Eierstockkrebserkrankung untersucht. Die Testresultate standen den Teilnehmerinnen und ihren behandelnden ÄrztInnen zur Entscheidungsfindung zur Therapie vollständig zur Verfügung. Für alle Teilnehmerinnen wurden bis zu 13 Jahre lang mögliche Krebsdiagnosen und die Sterblichkeit als primärer Endpunkt der Studie erhoben. Die sekundären Endpunkte waren die Inzidenz von Eierstockkrebs und Komplikationen im Zusammenhang mit den Screeninguntersuchungen und weiteren diagnostischen Prozeduren.
Die Ergebnisse waren eindeutig:
• 212 Frauen in der Interventionsgruppe und 176 in der Kontrollgruppe erkrankten im Untersuchungszeitraum an Eierstockkrebs. In der Interventionsgruppe endete die Erkrankung bei 118 Frauen und in der Kontrollgruppe bei 100 Frauen mit dem Tod. Aus beiden Betrachtungswinkeln gab es also keine nachweisbaren Vorteile für die Teilnehmnerinnen am Screening.
• An anderen Ursachen verstarben zusätzlich 2.924 in der Screening- und 2.914 in der Standardbehandlungsgruppe.
• Dafür gab es nachweisbar massive Nachteile und starke Belastungen durch die Teilnahme am Screening: 3.285 Frauen mit einem falsch positiven Screening-Testergebnis wurden unnötigerweise operiert, 166 litten dabei mindestens eine ernste postoperative Komplikation.
Die Schlussfolgerungen und Empfehlungen der ForscherInnen sind ebenfalls eindeutig: Zumindest so lange wie die zum Screening angewandten Tests (CA-125= Cancer antigen 125 oder Carbohydrate antigen 125 und transvaginale Ultraschalluntersuchung) derart viel falsche und dann folgenreiche Krebsdiagnosen begründen, sollte von ihm und den hohen positiven Erwartungen Abstand genommen werden.
Für die auf dem diesjährigen Fachkongress der "American Society of Clinical Oncology (ASCO)" Anfang Juni vorgestellte Studie " Effect of screening on ovarian cancer mortality in the Prostate, Lung, Colorectal, and Ovarian (PLCO) cancer randomized screening trial" von S. S. Buys, E. Partridge et al. (veröffentlicht im "Journal of Clinical Oncology 29: 2011 (suppl; abstr 5001)) gibt es nur das Abstract kostenlos.
Bernard Braun, 20.5.11
Auch nach 20 Jahren: Kein signifikanter Nutzen des PSA-Tests zur Senkung des Risikos an Prostatakrebs zu versterben zu entdecken!
 Der schon bisher vielstimmige Chor der Stimmen, die vor allzu überzogenen Erwartungen an den Nutzen des als Screeningmethode zur Messung des Risikos von Prostatakrebs empfohlenen PSA-Test (vgl. dazu auch mehrere Belege vgl. u.a. "Die Kernfrage ist nicht, ob das PSA-Screening effektiv ist, sondern ob es mehr nützt als schadet." - Neues und Widersprüchliches. in diesem Forum) warnten, wird seit wenigen Tagen durch die Ergebnisse einer in Schweden über 20 Jahre lang durchgeführten Studie kräftig verstärkt.
Der schon bisher vielstimmige Chor der Stimmen, die vor allzu überzogenen Erwartungen an den Nutzen des als Screeningmethode zur Messung des Risikos von Prostatakrebs empfohlenen PSA-Test (vgl. dazu auch mehrere Belege vgl. u.a. "Die Kernfrage ist nicht, ob das PSA-Screening effektiv ist, sondern ob es mehr nützt als schadet." - Neues und Widersprüchliches. in diesem Forum) warnten, wird seit wenigen Tagen durch die Ergebnisse einer in Schweden über 20 Jahre lang durchgeführten Studie kräftig verstärkt.
Die Länge des Beobachtungszeitraums ist deshalb wichtig, weil bei der Diskussion der PSA-kritischen Ergebnisse früherer Studien häufig der prinzipiell auch berechtigte Einwand eine Rolle spielte, die positiven Effekte des Tests würden erst nach längerer Zeit auftreten.
Ziel der Studie war zu bewerten, ob das regelmäßige Screening nach Anzeichen von Prostatakrebs der härteste Endpunkt einer solchen Untersuchung, nämlich die spezifische Sterblichkeit an Prostatakrebs in einem derart langen Zeitraum reduziert wird. An der Studie nahmen alle im Jahr 1987 50 bis 69 Jahre alten Männer in der schwedischen Mittelstadt Norrköpping teil. 1.494 Angehörige der Studiengruppe (jeder sechste Mann nach seinem Geburtsdatum) wurden zufällig für die Interventionsgruppe ausgewählt und mussten sich zwischen 1987 und 1996 jedes dritte Jahr auf Anzeichen eines Prostata-Karzinoms untersuchen lassen. Bis 1993 geschah dies durch eine digitale rektale Untersuchung, danach mittels des PSA-Tests. Die prostatakrebsspezifische Mortalität wurde samt genauerer Merkmale des Karzinoms und der Behandlungen bis zum 31. Dezember 2008 erhoben. Die Kontrollgruppe bestand aus den 7.532 restlichen Männern der 50-69jährigen Grundgesamtheit.
Die Ergebnisse lauteten:
• An den vier Screeningaktionen nahm ein von 78% auf minimal 70% sinkender Teil der Untersuchungsgruppe teil.
• In der Screeninggruppe erkrankten 85 Personen (5,7%) an Prostatakarzinom. In der Kontrollgruppe gab es 292 Erkrankte (3,9%). Rund die Hälfte der Tumore wurde in der Screeningsgruppe zwischen den Screeningterminen entdeckt. Auffällig war außerdem eine doppelt so hohe Entdeckungsrate von meist nicht großen oder extrem aggressiven lokalen Tumoren in der Screeninggruppe. Bei der Häufigkeit von Tumoren, die nicht lokal begrenzt also zum Teil deutlich gefährlicher waren als lokale Tumore, unterschieden sich die beiden Gruppen praktisch nicht.
• Die Gesamtmortalität bei Männern mit einem Prostatakarzinom betrug innerhalb der Untersuchungszeit bei den Angehörigen der Screeninggruppe 81% (69 von 85) und 86% (252 von 292) in der Kontrollgruppe.
• Weder die Überlebenszeit bei einer Krebserkrankung der Prostata noch die Gesamt-Überlebenszeit unterschied sich zwischen den beiden Gruppen signifikant.
• Um einen Todesfall wegen eines Prostatakarzinoms zu verhindern, müssen 1.410 Männer untersucht und 48 behandelt werden.
• Das relative Risiko ("risk ratio") für den Tod durch ein Prostatakarzinom betrug innerhalb der 20 Beobachtungsjahre 1,16, d.h. das Risiko an dieser Erkrankung zu versterben war in der Screeninggruppe höher als in der Kontrollgruppe, war aber statistisch nicht signifikant (Konfidenzintervall 0,78 bis 1,73). Da auch weitere Risikoindikatoren für das Prostatakrebs-Sterblichkeitsrisiko, wie beispielsweise das "hazard ratio" teilweise keine signifikanten Unterschiede zwischen der Sterblichkeit in beiden Gruppen zu Tage förderten, kommen die AutorInnen zu dem Schluss, das "screening for prostate cancer did not seem to have a significant effect on mortality" und die Indikatorwerte "did not indicate significant benefit from prostate cancer screening".
• Dem Mangel an signifikantem Nutzen des Screenings für ein längeres Leben mit Prostatakrebs steht ein beträchtliches Risiko zur Überentdeckung ("overdetection") von zum Teil (noch) harmlosem Krebs und einer Überbehandlung ("overtreatment") mit den bekannten und häufig auftretenden unerwünschten Nebenwirkungen (u.a. Impotenz und Inkontinenz) bei den Angehörigen der Screeninggruppe gegenüber.
Dass die Debatte über den Nutzen des PSA-Tests auch mit dieser Studie kein Ende hat, fördern die AutorInnen durch zwei weitere Überlegungen selbst: Zum einen weisen sie trotz der fehlenden Signifikanz zunächst darauf hin, es sei unmöglich, dass das Screening "more than a third" der Mortalität reduziere, dies könnte ("could") aber sein. Egal ob dies zutrifft oder nicht bestünde aber dann trotzdem das Risiko der Überentdeckung und nebenwirkungsreichen Behandlung von Tumoren. Zum anderen ist aber auch die Größe der schwedischen Studienpopulation "not sufficient to draw definite conclusions".
Was die Ergebnisse aber in jedem Fall liefern, sind massive Hinweise von der ungebremsten Nutzung des PSA-Tests als vermeintlich garantiert nützlicher Methode Abstand zu nehmen, das spezifische Sterblichkeitsrisiko gesichert zu verringern.
Der komplette Text des Aufsatzes "Randomised prostate cancer screening trial:20year follow-up" von Gabriel Sandblom, Eberhard Varenhorst, Johan Rosell, Owe Lofman, und Per Carlsson ist im März 2011 online im "British Medical Journal (BMJ)" (2011;342:d1539 doi:10.1136/bmj.d1539) veröffentlicht und kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 5.4.11
"Der Mensch ist ein soziales Wesen" und zwar fast immer! Was hat dies mit erfolgloser Gesundheitsaufklärung zu tun?
 Informationskampagnen für oder gegen bestimmte gesundheitsbezogene Verhaltensweisen und Therapien sind weit verbreitete Methoden der präventiven Gesundheitsaufklärung und -kommunikation. Wie bei Kampagnen gegen das Rauchen oder gegen ungesunde Ernährung schon vor einiger Zeit erkannt wurde, reichen noch so abschreckende und anschauliche Informationen über Raucherlungen und eine "fit-statt-fett"-Aufklärung jedoch nicht aus oder bewirken sogar das Gegenteil. Woran dies möglicherweise auch liegen könnte und warum manche Kampagne zur Krebsvorsorge nicht deren Inanspruchnahme erhöht, untersuchten nun, gefördert durch die Deutsche Krebshilfe, Heidelberger GesundheitspsychologInnen in einer zweistufigen Längsschnittstudie, die der Theorie des "planned behavior" folgt.
Informationskampagnen für oder gegen bestimmte gesundheitsbezogene Verhaltensweisen und Therapien sind weit verbreitete Methoden der präventiven Gesundheitsaufklärung und -kommunikation. Wie bei Kampagnen gegen das Rauchen oder gegen ungesunde Ernährung schon vor einiger Zeit erkannt wurde, reichen noch so abschreckende und anschauliche Informationen über Raucherlungen und eine "fit-statt-fett"-Aufklärung jedoch nicht aus oder bewirken sogar das Gegenteil. Woran dies möglicherweise auch liegen könnte und warum manche Kampagne zur Krebsvorsorge nicht deren Inanspruchnahme erhöht, untersuchten nun, gefördert durch die Deutsche Krebshilfe, Heidelberger GesundheitspsychologInnen in einer zweistufigen Längsschnittstudie, die der Theorie des "planned behavior" folgt.
Sie fragten dafür 2.426 Männer im Alter von 45 bis 65 Jahren nach ihrer Inanspruchnahme der Krebsfrüherkennungsuntersuchung und außerdem, wie sie das entsprechende Verhalten anderer Männer einschätzen.
Im zweiten experimentellen Teil der Studie wurde ein Jahr nach der ersten Studie bei 185 Männern zwischen 45 und 70 Jahren überprüft, ob Informationen oder Annahmen über das Verhalten anderer Männer, von den ForscherInnen als "deskriptive Normen" bezeichnet, ihre Motivation beeinflusst, selber an einer Untersuchung zur Krebsfrüherkennung teilzunehmen. Dabei war z.B. von vornherein bekannt, dass höchstens 21% der Männer Krebs-Vorsorgeuntersuchungen in Anspruch nehmen, gegenüber immerhin durchschnittlich rund 47% der Frauen. Die Unterrepräsentanz der Männer findet man aber auch bei anderen Gesundheitskursen oder Raucherentwöhnungskursen.
Ihre Ergebnisse sind weit über ihr Thema hinaus von Bedeutung und sehen so aus:
• Gesundheitsverhalten wird nicht nur durch Sachinformationen beeinflusst, sondern maßgeblich durch Faktoren im sozialen Umfeld der Personen, die z.B. darüber informiert werden, dass die Inanspruchnahme der Krebsfrüherkennung wichtig ist. Diese Faktoren sind einerseits die Erwartungen wichtiger Bezugspersonen und andererseits das Verhalten "vergleichbarer" Menschen. Soziale Normen und daraus abgeleitete Einstellungen haben beim Gesundheitsverhalten auch eine höhere Bedeutung als die klassischen soziodemographischen Faktoren Einkommen und Bildung. Die Bedeutung dieser Faktoren ist auch bereits bei älteren Menschen nachgewiesen worden. Wenn diese trotz vieler "Zipperlein" oder auch Erkrankungen ihren Gesundheitszustand subjektiv als ganz gut bewerten, liegt dies u.a. daran, dass sie sich mit Gleichaltrigen und zum Teil auch älteren und kränkeren Personen in ihrem Umfeld vergleichen.
• In der ersten Befragung gingen die Männer, die noch nie an einer Früherkennungsuntersuchung teilgenommen hatten, also die Mehrheit, davon aus, dass nur wenige andere Männer zu dieser Untersuchung gingen. Sie schätzten den Anteil auf 28%. Die Befragten, die angaben, sie würden die Krebsvorsorgeuntersuchung unregelmäßig oder gar regelmäßig in Anspruch nehmen, schätzten den Anteil der Männer, die dies auch so machten auf 36% oder gar 45%. Egal, wie das eigene Verhalten und die Erwartung oder Einschätzung des Verhaltens Anderer zusammenhängen, spielt Letzteres eine wichtige Rolle.
• In der zweiten Befragung bestätigte sich das Grundmuster, d.h. Informationen über das Verhalten anderer männlicher Personen beeinflusst eindeutig die eigene Motivation.
• Es zeigte sich darüber hinaus aber noch, dass bei dieser Interaktion die Art der Information eine extrem wichtige und auch unerwartet fatale Rolle spielt: Wenn die Information über das Verhalten anderer eher negativ ist, d.h. gesagt wurde, dass nur knapp 20 % aller Männer zur Krebsvorsorgeuntersuchung gegangen waren, war die Inanspruchnahme-Bereitschaft bei den so informierten Männern ebenfalls gering (31% der Angehörigen dieser Gruppe wollten das Krebs-Screening nutzen) und unterschied sich statistisch signifikant von den Werten in beiden anderen Gruppen. Die Bereitschaft war bei jenen Studienteilnehmern höher, denen gesagt wurde, rund zwei Drittel aller Männer wären schon bei der Vorsorgeuntersuchung gewesen (46%) oder die zu der Kontrollgruppe gehörten, der überhaupt keine Daten zur Einjahresprävalenz der Untersuchungs-Inanspruchnahme gegeben wurde (48%).
• Die Leiterin der Studie, Monika Siverding, fasst das praktisch folgenreiche Ergebnis ihres Experiments so zusammen: "Die Information über eine geringe Nutzung hat somit keine motivierende, sondern tatsächlich eine demotivierende Wirkung. Nach dem Motto: Wenn so wenige Männer dort hingehen, dann wird das wohl auch seinen Grund haben".
Angesichts der Tatsache, dass viele der gut gemeinten und fachlich gut gemachten Informationen im Gesundheitswesen eine häufig geringere Wirkung haben als erwünscht oder notwendig, sollte auch in anderen Zusammenhängen untersucht werden, ob und wie stark auch dort deskriptive Normen bzw. das Verhalten von Verwandten, Nachbarn, Freunden oder Ärzten effekthemmend wirken. Ob solche Effekte auch bei Frauen auftauchen, wäre natürlich ebenfalls untersuchenswert.
Und nicht zuletzt stellt sich die Frage, ob und wie man die mit negativen oder defensiven Verhaltensweisen verbundenen quantitativ "mickrigen" Daten-Inputs anders oder gar nicht kommunizieren kann und darf. Und wenn man dieses Problem gelöst hat, sollten nicht allein die Einstellungen (z.B. Früherkennungsuntersuchungen sind nutzvoll-nutzlos) beachtet und Ziel von Interventionen sein, sondern auch die subjektiven (z.B. Mein Partner denkt, ich solle die Krebsvorsorge nutzen) und deskriptiven Normen (z.B. Wie viele Menschen aus Ihrer Umgebung gingen zur Krebsvorsorge?)
Die Untersuchungsergebnisse sind u.a. in einer kurzen Pressemitteilung zusammengefasst, die frei erhältlich ist.
Außerdem liegen zwei Aufsätze der WissenschaftlerInnen mit detaillierteren Ergebnissen vor:
• Zu dem kurzen Aufsatz "Information about low participation in cancer screening demotivates other people" von Sieverding M., Decker S. und Zimmermann, F., der sich mit der zweiten Studie befasst und in "Psychological Science" (2010, 21, No. 7, 941-943) erschienen ist, gibt es leider noch nicht einmal ein kostenloses Abstract.
• Dafür wird man dadurch etwas entschädigt, dass der 10-seitige Aufsatz "What role do social norms play in the context of men's cancer screening intention and behavior? Application of an extended theory of planned behavior" von Sieverding M., Matterne U. und Ciccarello, L. in "Health Psychology" (2010, 29, No. 1, 72-81) komplett und kostenlos als PDF-Datei erhältlich ist.
Bernard Braun, 5.11.10
Verschwenderisch, nutzlos, inhuman: Warum erhalten todkranke Krebspatienten noch Untersuchungen zur Früherkennung?
 Ein Drittel aller Gesundheitsausgaben fallen unabhängig vom Lebensalter in den letzten 12 Monaten vor dem Tod an. Privat krankenversicherte Personen erhalten kurz vor ihrem Tod besonders häufig eine Vielzahl von möglicherweise lebensverlängernden Behandlungen. Über die Art der Leistungen weiß man wenig und vor allem ist es schwer den Nutzen dieser Leistungen in Frage zu stellen.
Ein Drittel aller Gesundheitsausgaben fallen unabhängig vom Lebensalter in den letzten 12 Monaten vor dem Tod an. Privat krankenversicherte Personen erhalten kurz vor ihrem Tod besonders häufig eine Vielzahl von möglicherweise lebensverlängernden Behandlungen. Über die Art der Leistungen weiß man wenig und vor allem ist es schwer den Nutzen dieser Leistungen in Frage zu stellen.
Eine jetzt veröffentlichte Untersuchung aus den USA ermöglicht aber tiefe Einblicke in einen Teil des Leistungsgeschehens für sterbenskranke Patienten und dessen medizinische und vor allem ethische Unsinnigkeit.
In die Untersuchung gingen 87.736 Versicherte von Medicare (eines der beiden staatlichen Krankenversicherungssysteme der USA mit Einzelleistungsvergütung) im Alter von 65 und mehr Jahren ein, die zwischen 1998 und 2005 im fortgeschrittenen Zustand an nicht mehr behandelbaren ("incurable") Lungen-, Darm-, Bauchspeicheldrüsen- oder Brustkrebs erkrankt waren und in einem der Tumorregister erfasst waren. Die Behandlungsgeschichte aller Teilnehmer wurde bis zu ihrem Tode oder bis zum 31. Dezember 2007 erfasst und ausgewertet. Eine zweite Gruppe von 87.307 Medicare-Versicherte, die nicht an Krebs erkrankt waren, wurde der ersten Gruppe nach Merkmalen wie Alter, Geschlecht und Rasse individuell zugeordnet. Das Hauptaugenmerk der Untersuchung lag auf dem Angebot und der Nutzung von Krebsfrüherkennungsuntersuchungen.
Die wesentlichen Ergebnisse sahen so aus:
• Dass es sich bei den an Krebs erkrankten Personen zu einem erheblichen Teil um tot-kranke Personen handelte, zeigen die Überlebensraten: Sie lagen zwischen 4,3 Monaten in der Gruppe der Pankreaskrebspatienten und 16,2 Monaten bei den Brustkrebspatienten. Die 5-Jahres-Überlebensrate betrug bei den Brustkrebspatienten 15,5 %, bei allen anderen Krebskranken aber 5% und weniger. Von der zu Beginn der Studie nicht an Krebs erkrankten Versichertengruppe lebten 5 Jahre nach dem Beginn der vergleichenden Untersuchung noch 80% bis 85 %.
• Unabhängig von ihrer geringen künftigen Lebenserwartung erhielt aber ein bedeutungsvoller Teil der eindeutig diagnostizierten Krebskranken noch weitere Krebsfrüherkennungsuntersuchungen im Rahmen des entsprechenden Screeningprogramms angeboten und nutzten sie auch: 8,9% der Frauen mit Krebs in fortgeschrittenem Stadium erhielten noch Mammographien (in der gesunden Kontrollgruppe waren es 22%), 5,8% erhielten einen PAP-Test zur Früherkennung von Gebärmutterhalskrebs (in der Kontrollgruppe erhielten den Test 12,5%) und 15% der krenskranken Männer erhielten einen PSA-Test zur möglichen Früherkennung eines Prostatakarzinoms (Kontrollgruppe 27,2%). Eine endoskopische Untersuchung des Darmes erhielten dagegen nur 1,7% sämtlicher Patienten (Kontrollgruppe 4,7%). Dabei ist besonders bemerkenswert, dass die Raten bei den Schwerkranken zwischen 25% und 55% der Raten betragen, die in der gesunden Kontrollgruppe bei deren Angehörigen also Früherkennungsuntersuchungen auf Krebs möglicherweise einen gesundheitlichen Nutzen haben im selben Zeitraum zu finden sind.
• Die WissenschaftlerInnen vermuten, dass in der Gruppe der unter 65-Jährigen die Frühherkennungsuntersuchungsrate bei unheilbar erkrankten Krebspatienten sogar noch höher sein dürfte.
• Der Faktor mit dem höchsten Vorhersagewert für eine Früherkennungsuntersuchung bei Krebskranken war die langjährige Teilnahme an Früherkennungsuntersuchungen vor der Diagnose der Krebserkrankung.
• Aus dem gerade genannten Prädiktor leiten die Autoren eine Reihe von Erklärungen für die Angebote dieser unter den Erkrankungsumständen der Patienten nutzlosen Leistungen her: Um die Adhärenz für die Teilnahme an Screenings zu verbessern seien systematische Erinnerungs- und Einbestellsysteme eingerichtet und auch wirksam, die nicht den aktuellen Gesundheitszustand erfassten. Es gäbe außerdem eine Art Screeningkultur,, die wie ein "Autopilot" funktioniere und u.a. auch dazu beitrage, dass PAP-Tests selbst bei Frauen durchgeführt werden, deren Gebärmutter entfernt worden war. Nicht zuletzt seien dafür auch Kommunikationsdefizite über die reale oder ernsthafte Bedeutung von Erkrankungsprognosen innerhalb der Aerzteschaft und gegenüber Patienten verantwortlich.
Auch wenn man der Einschränkung der Autoren folgt, dass die eine oder andere Früherkennungsuntersuchung auch bei todkranken Personen angemessen und nützlich sein kann, steht mit ihrer Untersuchung fest, dass viele Ärzte oder das "Früherkennungssystem" speziell bei schwerkranken Patienten eine Menge verschwenderische und gesundheitlich nicht notwendige oder nutzlose Leistungen erbringen. Ob dies - wie vermutet - bei jüngeren Krebskranken sogar noch häufiger passiert und auch bei anderen Patienten mit geringer Lebenserwartung in anderer Weise erfolgt, müssen weitere Untersuchungen schnellstens klären. Dabei wäre allerdings auch zu prüfen, ob die ärztliche Vergütung nach Einzelleistungen nicht als zusätzlicher Anreiz für Leistungsangebote ohne gesundheitliche Rechtfertigung wirkt.
Und natürlich sollte man sich weder als Arzt noch als Versicherter oder Patient im deutschen Gesundheitssystem unbetroffen, entspannt oder nur entsetzt über die "amerikanischen Zustände" zurücklehnen, sondern sich auch hierzulande um mehr Transparenz bemühen.
Der Aufsatz "Cancer screening among patients with advanced cancer" von Sima CS et al. ist in JAMA (2010 Oct 13; 304:1584) erschienen und ein Abstract ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 3.11.10
Neueste Daten zur Früherkennung von Prostatakrebs - keine Senkung der Sterblichkeit
 Senkt die Früherkennung mit Hilfe der PSA-Bestimmung bei Männern ohne Anzeichen von Prostatakrebs die Gesamtsterblichkeit im Vergleich zu Männern, die keinen PSA-Test erhalten - dieser Frage widmet sich ein jüngst veröffentlichte Cochrane Review. Cochrane Reviews sind die Zusammenfassungen von qualitätsgeprüften Studien die zu einer bestimmten Fragestellung erschienen sind.
Senkt die Früherkennung mit Hilfe der PSA-Bestimmung bei Männern ohne Anzeichen von Prostatakrebs die Gesamtsterblichkeit im Vergleich zu Männern, die keinen PSA-Test erhalten - dieser Frage widmet sich ein jüngst veröffentlichte Cochrane Review. Cochrane Reviews sind die Zusammenfassungen von qualitätsgeprüften Studien die zu einer bestimmten Fragestellung erschienen sind.
Die Antwort lautet nein. Weder die Gesamtsterblichkeit noch die Sterblichkeit am Prostatakarzinom war in der Gruppe der Männer mit Früherkennungsuntersuchung niedriger als in der Vergleichsgruppe. Somit ist die Früherkennung von Prostatakrebs durch PSA nach heutigem Wissensstand ineffektiv.
Ausgewertet wurden die Daten von 387.286 Teilnehmern aus sechs randomisierten kontrollierten Studien, die bis Juli 2010 veröffentlicht wurden. Die Autoren kritisieren die in Teilbereichen teils mäßige Qualität der Studien und die daraus hervorgehende Unsicherheit mancher Ergebnisse. Kritisiert wird auch, dass keine Studie nach der Lebensqualität fragte und die Frage nach dem möglichen Schaden der Früherkennungsuntersuchung weitgehend ausgespart blieb.
Ein Wirkung hat die Früherkennung jedoch auf die Zahl der Männer, die eine Diagnose Prostatakrebs erhalten. Die Wahrscheinlichkeit, die Diagnose Prostatakrebs zu erhalten, ist für Männer in der Früherkennungsgruppe um knapp 50% erhöht. Die Neuerkrankungsrate liegt somit bei Screening um 50% höher, ohne dass die Männer einen Nutzen davon haben. Somit handelt es sich um das Phänomen Überdiagnose, was zwangsläufig mit Übertherapie einhergeht.
Offen bleibt die Frage, ob sich bei längerer Nachbeobachtung doch noch ein Überlebensvorteil herausstellt oder ob es Risikogruppen gibt, die möglicherweise doch von der Früherkennung profitieren.
Geklärt ist jedoch die Frage nach den möglichen Schäden bei der Behandlung von Prostatakrebs, insbesondere Impotenz und Inkontinenz. Dazu haben wir berichtet (Link).
Mit dieser Studie stellt sich die Frage nach der ethischen Vertretbarkeit der Früherkennungsuntersuchung für Prostatakrebs außerhalb klinischer Studien verschärft. In Deutschland wird die PSA-Bestimmung zur Früherkennung nicht von den gesetzlichen Kassen übernommen (aus guten Gründen, wie dargelegt). Ärzte bieten sie daher als Individuelle Gesundheitsleistung (IGeL) an.
Djulbegovic M, Beyth RJ, Neuberger MM, Stoffs TL, Vieweg J, Djulbegovic B, et al. Screening for prostate cancer: systematic review and metaanalysis of randomised controlled trials. British Medical Journal, 14.9.2010. Download der Studie kostenlos
Mehr zum PSA-Screening im Forum Gesundheitspolitik: PSA oder Prostata in die Suche eingeben.
David Klemperer, 1.10.10
"Warten auf den medizinisch-technischen Fortschritt!?" Das Beispiel "Humane Genome Project"
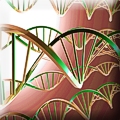 3 Milliarden US-Dollar waren vor rund 10 Jahren in den USA ausgegeben worden, um das aus Sicht von Genetikern und Biologen bedeutendste Projekt für die vollständige Transparenz der menschlichen "Gen-Landkarte" abzuschließen.
3 Milliarden US-Dollar waren vor rund 10 Jahren in den USA ausgegeben worden, um das aus Sicht von Genetikern und Biologen bedeutendste Projekt für die vollständige Transparenz der menschlichen "Gen-Landkarte" abzuschließen.
Damit sollte die entscheidende Voraussetzung für eine Revolution im Gesundheitswesen geschaffen werden. So meinte der damalige US-Präsident B. Clinton am 26. Juni 2000 bei der Vorlage der ersten Version der Genomkarte, dies würde "revolutionize the diagnosis, prevention and treatment of most, if not all, human diseases." Und der Direktor der Genome-Agency des "National Institutes of Health" der USA war sich damals auch sicher, dass zehn Jahre später, also heute, die genetische Diagnose aller Krankheiten möglich wäre und dass noch einmal 5 Jahre danach gezielte Behandlungen beginnen könnten: "Over the longer term, perhaps in another 15 or 20 years you will see a complete transformation in therapeutic medicine."
Obwohl sich die pharmazeutische Industrie geradezu in die Entwicklung und Herstellung neuer Arzneimittel mit Hilfe einiger Erkenntnisse der Genforschung gestürzt hat, kühlt nicht erst mit dem 10. Jahrestag des Abschlusses der ersten Gesamtübersicht des menschlichen Genoms die damalige Euphorie über den scheinbar grenzenlosen Nutzen dieser Kenntnisse erheblich ab.
Die realen Krankheiten erwiesen sich wider Erwarten hinsichtlich ihrer genetischen Verortung und Bestimmtheit als sehr komplex und uneindeutig. Weder die genetisch basierten Diagnosemöglichkeiten noch eine punktgenaue Therapie, geschweige denn die Verhinderung des Ausbruchs einer Krankheit durch Genscreening und rechtzeitige Intervention sind auch nur in Reichweite. Und selbst dann, wenn dies alles geklärt wäre, wäre bei vielen genetisch disponierten Krankheitsbildern immer noch unklar, wie eigentlich eine ethisch vertretbare Intervention aussehen könnte.
Zum Jahrestag titelte daher die "New York Times" am 12. Juni 2010 "A Decade Later, Genetic Map Yields Few New Cures" und die europäische Ausgabe unterstrich dies am 21. Juni 2010 nochmals nachdrücklich mit dem Titel "Gene map is yielding few new treatments".
In dieser und weiteren Veröffentlichungen spielte eine nahezu zeitgleiche wissenschaftliche Veröffentlichung in der US-Medizinzeitschrift Nr. 1, dem "Journal of American medical association (JAMA)" eine Rolle, in der nachdrücklich gezeigt wurde, wie weit Mediziner und Genetiker eigentlich noch davon entfernt sind, die genetischen Wurzeln selbst einfachster Erkrankungen überhaupt zu finden.
In der vorgestellten Studie eines Bostoner Medizinerteams um Nina Paynter wurde versucht mit Hilfe der Kenntnis von 101 genetischer Konstellationen, die in verschiedenen anderen Gen-Scans statistisch als mit Herzerkrankungen assoziiert bestimmt worden waren, prädiktive Hinweise für den wahrscheinlichen Eintritt einer dieser Erkrankungen mittels eines dazu gebildeten genetischen Risikowertes zu gewinnen. Ob Gen-Informationen dies wirklich verlässlich leisten wurde an einer prospektiven Kohorte von 19.313 weißen Frauen in der so genannten "Women's Genome Health Study"über durchschnittlich 12,3 Jahre hinweg untersucht. Die Zielerkrankungen oder Krankheitszustände, deren Eintreten man dabei beobachtete, waren der Herzinfarkt, Schlaganfall, die Wiederbelebung der Blutversorgung des Herzens und der kardiovaskuläre Tod. Im Untersuchungszeitraum von 12,3 Jahren traten insgesamt 777 dieser kardiovaskulären Krankheitsereignisse auf.
Nach einer Altersstandardisierung und einer Adjustierung der StudienteilnehmerInnen mit einem kardiovaskulären Ereignis nach traditionellen Risikofaktoren gab es keinerlei statistische Assoziation des genetischen Risikowerts mit den tatsächlichen kardiovaskulären Risiken bzw. Ereignissen. Der prädiktive Wert des genetischen Risikoindikators war gleich Null.
Ganz anders sah es mit der selbstberichteten Familien-Krankengeschichte aus, die auch in mehrfach standardisierten Berechnungen signifikant mit dem Auftreten kardiovaskulärer Ereignisse assoziiert blieb. Wer also Risikoschätzungen machen will, sollte noch und wieder auf die prädiktive Kraft einer gründlichen Familienanamnese setzen.
Von dem Aufsatz "Association Between a Literature-Based Genetic Risk Score and Cardiovascular Events in Women" von Nina P. Paynter, Daniel I. Chasman, Guillaume Paré, Julie E. Buring, Nancy R. Cook, Joseph P. Miletich, und Paul M Ridker im JAMA (2010; 303(7):631-637) gibt es kostenlos lediglich ein Abstract.
Bernard Braun, 23.6.10
Falsch-positive Ergebnisse des Lungenkrebs-Screenings per CT und Bruströntgen samt sinnlosen Eingriffen höher als erwartet
 Zu den möglichen unerwünschten und negativ folgenreichen Ergebnissen praktisch aller Früherkennungsuntersuchungen gehören falsch positive und negative Ergebnisse. Je höher der diagnostizierte Anteil von in Wirklichkeit gar nicht vorhandenen Erkrankungen oder von befundlosen Untersuchungen ist, die eine schwere Erkrankung "übersehen", desto gesundheitsabkömmlicher sind die physischen und psychischen Folgen.
Zu den möglichen unerwünschten und negativ folgenreichen Ergebnissen praktisch aller Früherkennungsuntersuchungen gehören falsch positive und negative Ergebnisse. Je höher der diagnostizierte Anteil von in Wirklichkeit gar nicht vorhandenen Erkrankungen oder von befundlosen Untersuchungen ist, die eine schwere Erkrankung "übersehen", desto gesundheitsabkömmlicher sind die physischen und psychischen Folgen.
Dies gilt zusätzlich noch für Untersuchungen, die als Screening empfohlen und durchgeführt werden. Sofern mit der Diagnostik auch noch mehr oder weniger hohe Strahlenbelastungen verbunden sind, droht eine Kumulation gesundheitlicher Risiken, die es dann sehr genau gegen die möglichen gesundheitlichen Vorteilen des Screenings abzuwägen gilt. Dabei spielen natürlich generell auch die ökonomischen Folgen eine wichtige Rolle.
Für viele Screeningangebote zur möglichst frühen Identifizierung von häufigen wie gefährlichen Erkrankungen gibt es bisher lediglich Vermutungen zu den diversen unerwünschten Effekten und damit auch für die sich daraus ergebenden Belastungen von Individuen und Versicherungsgemeinschaften.
Um diesen Zustand zu beenden, untersuchten nun WissenschaftlerInnen im Rahmen der noch laufenden randomisierten kontrollierten "National Lung Screening Trial" wie häufig bei den Untersuchungen von 3.190 früheren und aktuellen Rauchern (teilweise mit einer über 30 Jahre langen "Rauchgeschichte") im Alter von 55 bis 74 Jahren falsch positive oder negative Ergebnisse auftraten. Der Betrachtungszeitraum ob ein Lungenkrebs auftrat oder nicht, erstreckte sich noch auf den Zeitraum von einem Jahr nach der zweiten Screening-Untersuchung.
Die jetzt vorliegende Untersuchung, welche die Effekte zweier im Jahresabstand folgenden CT-Untersuchungen mit geringer Strahlenbelastung und der traditionellen Röntgenuntersuchung des Brustraums zur Existenz von Lungenkrebs bei zuvor nie wegen Lungenkrebs auffällig gewordenen Personen vergleicht, kommt zu einigen quantitativ wie qualitativ unerwarteten Ergebnissen:
• Eine Person, die einmal an einem CT-Screening teilnimmt, hat eine kumulierte Wahrscheinlichkeit von 21%, ein falsch-positives Ergebnis zu erhalten. Nach der Teilnahme an zwei Screeninguntersuchungen steigt die Wahrscheinlichkeit fälschlicherweise einen Lungenkrebs diagnostiziert zu bekommen auf 33%.
• Neben der psychischen Belastung durch den mehr oder weniger lang anhaltenden Schrecken der irrtümlich gestellten Diagnose erfolgte bei 7% der CT-untersuchten Personen mit falsch-positivem Befund eine mehr oder weniger gravierende invasive Prozedur.
• Falsch positive Ergebnisse erhielten beim ersten Screening mittels Bruströntgen 7 % und nach der Teilnahme an der zweiten Untersuchung 15 % der Untersuchten.
• Und bei immerhin noch 4 % von ihnen folgte dieser Fehldiagnose eine invasive Zusatzdiagnostik (z.B. Bronchoskopie, Biopsie) oder gar eine große Operation.
• Die Studie konzentrierte sich auf die falsch positiven Ergebnisse und vernachlässigte bereits methodisch die Erkennung der tatsächlichen Anzahl der Nichtentdeckung eines tatsächlich vorhandenen Lungenkarzinoms. So wurden die auftretenden falsch negativen Fälle nur zwischen dem ersten und zweiten Sreening genau gezählt und untersucht. Deshalb beurteilen die Forscher den relativ geringen Anteil falsch-negativer Untersuchungsergebnisse in ihrer Untersuchung als eine Unterschätzung dieses Risikos.
Was aus den falschen Ergebnissen im Einzelnen gesundheitlich, psychosozial, ökonomisch und körperlich folgt, empfehlen die AutorInnen nach ihren Funden noch genauer zu untersuchen.
Wichtige Hinweise für Ärzte und PatientInnen, die eine Bewertung des Verhältnisses von Nutzen, Kosten und Wirkungen/Nebenwirkungen von CT- und Röntgenuntersuchungen im Brustbereich vornehmen und auf dieser Basis Entscheidungen treffen wollen, enthält der 13-Seiten-Aufsatz "Cumulative incidence of false-positive test results in lung cancer screening: a randomized trial" von Croswell JM, Baker SG, Marcus PM, et al. in der anerkannten Fachzeitschrift "Annales of Internal Medicine" vom 20. April 2010 (2010 Apr 20;152(8):505-12, W176-80). Sowohl das Abstract als auch den kompletten Aufsatz gibt es kostenlos.
Bernard Braun, 9.5.10
Früherkennung von Lungenkrebs mit Computertomographie: Risiken sicher, Nutzen nicht
 Erfolgt die Diagnose Lungenkrebs durch Untersuchungen infolge von Beschwerden, bestehen zumeist bereits Metastasen und damit wenig Aussicht auf Heilung. Daher erscheint die rechtzeitige Erkennung vor Auftreten von Symptomen besonders wünschenswert. Eine systematische Übersichtsarbeit (Cochrane Review, Stand 15.4.2010) ergab jedoch keine Hinweise dafür, dass die Früherkennung durch Röntgen oder Computertomographie der Lunge die Sterblichkeit an Lungenkrebs mindert.
Erfolgt die Diagnose Lungenkrebs durch Untersuchungen infolge von Beschwerden, bestehen zumeist bereits Metastasen und damit wenig Aussicht auf Heilung. Daher erscheint die rechtzeitige Erkennung vor Auftreten von Symptomen besonders wünschenswert. Eine systematische Übersichtsarbeit (Cochrane Review, Stand 15.4.2010) ergab jedoch keine Hinweise dafür, dass die Früherkennung durch Röntgen oder Computertomographie der Lunge die Sterblichkeit an Lungenkrebs mindert.
Auch wenn zur Effektivität keine belastbaren Ergebnisse vorliegen, wird derzeit die Früherkennung von Lungenkrebs durch Spiral-Computertomographie in den USA zunehmend propagiert, wie auf diesem Bild zu sehen z.B. durch Werbung im öffentlichen Raum.
Eine jetzt veröffentlichte Studie befasste sich mit den falsch positiven Ergebnisse beim Lungenkrebs-Screening mit Spiral-CT. "Falsch positiv" bezieht sich darauf, dass man mit der Röntgenaufnahme nach Veränderungen sucht, die Krebs sein könnten. Gutartige und bösartige Veränderungen sind dabei aber nicht sicher unterscheidbar. Daher muss durch weitere Untersuchungen abgeklärt werden, ob es sich um einen gutartigen oder bösartigen Befund handelt.
Im Rahmen des National Lung Screening Trial wurden 3.190 aktuell oder ehemalig starke Raucher (mindestens eine Anzahl Zigaretten, die einem Konsum von einer Packung pro Tag über 30 Jahre entspricht, sog. pack years)im Alter von 55 bis 74 Jahren durch Randomisation (Zufallsverteilung)in 2 Gruppen geteilt. Beide Gruppen erhielten für drei Jahre pro Jahr eine Früherkennungsuntersuchung, die eine Gruppe eine Röntgenaufnahme, die andere Gruppe eine Spiral-Computertomographie. Die Studie ist auf 8 Jahre veranlagt.
Die Auswertung erfolgte ein Jahr nach Durchführung der 2. Früherkennungsuntersuchung.
Als falsch positiv wurde eine Untersuchung bewertet, wenn entweder die zur Abklärung durchgeführten Untersuchungen negativ waren (kein Krebs gefunden wurde) oder wenn mindestens 12 Monate nach der Screeninguntersuchung keine Lungenkrebsdiagnose gestellt worden war.
Ein falsch positives Ergebnis erhielten insgesamt 506 der 1398 Teilnehmer (31%) der CT-Gruppe sowie 216 der 1317 Teilnehmer (14%) der Röntgen-Gruppe. Lungenkrebs wurde entdeckt (richtig positives Ergebnis) bei 38 Teilnehmern (2%) der CT-Gruppe sowie bei 16 Teilnehmern (1%) der Röntgen-Gruppe.
Die weiterführende Diagnostik bestand zumeist in weiteren bildgebenden Verfahren. In der CT-Gruppe wurde jedoch bei insgesamt 7% und in der Röntgen-Gruppe bei 4% der Teilnehmer mit falsch positivem Ergebnis ein invasiver Eingriff durchgeführt, zumeist ein kleinerer wie Bronchoskopie oder Biopsie, bei 2% der falsch positiven Fälle der CT-Gruppe jedoch ein größerer operativer Eingriff.
Das Fazit lautet, dass zwar kein Nutzen für die Früherkennung durch Spiral-Computertomographie nachgewiesen ist, das Problem der falsch positiven Ergebnisse jedoch erheblich ist. Bereits bei zwei Untersuchungen erhält fast jeder Dritte ein falsch positives Ergebnis - eine Zahl die bei jeder weiteren Untersuchung weiter anwächst. Hinzu kommen Strahlenbelastung, psychologische Belastung und Kosten.
Croswell JM, Baker SG, Marcus PM, Clapp JD, Kramer BS. Cumulative Incidence of False-Positive Test Results in Lung Cancer Screening. Annals of Internal Medicine 2010;152(8):505-512. Abstract
Manser et al. Screening for Lung Cancer. Cochrane Review. Last assessed as up-to-date: April 15. 2010
Kapitel Lungenkrebs im Buch Untersuchungen zur Früherkennung Krebs.- Nutzen und Risiken. Klaus Koch und Stiftung Warentest 2005. Dieses Buch steht seit kurzem kapitelweise kostenlos zum Download zur Verfügung.
David Klemperer, 24.4.10
Brustkrebs-Früherkennung: doch effektiv? Wie unterschiedliche Studienergebnisse zu erklären sind.
 Die Früherkennung von Brustkrebs durch Mammographie in dreijährlichen Abständen bei Frauen im Alter ab 50 Jahren über einen Zeitraum von 20 Jahren verhindere 8,8 bzw. 5,7 Todesfälle pro 1.000 untersuchter Frauen. Gleichzeitig wird bei 4,3 bzw. 2,2 von 1.000 Frauen ein Brustkrebs entdeckt, der sich nie durch Beschwerden bemerkbar gemacht hätte. So lauten die Ergebnisse der jüngsten Auswertungen der schwedischen Two-County-Studie und des britischen Brustkrebsscreening-Programms durch die Arbeitsgruppe um Duffy.
Die Früherkennung von Brustkrebs durch Mammographie in dreijährlichen Abständen bei Frauen im Alter ab 50 Jahren über einen Zeitraum von 20 Jahren verhindere 8,8 bzw. 5,7 Todesfälle pro 1.000 untersuchter Frauen. Gleichzeitig wird bei 4,3 bzw. 2,2 von 1.000 Frauen ein Brustkrebs entdeckt, der sich nie durch Beschwerden bemerkbar gemacht hätte. So lauten die Ergebnisse der jüngsten Auswertungen der schwedischen Two-County-Studie und des britischen Brustkrebsscreening-Programms durch die Arbeitsgruppe um Duffy.
Bei der Two-County-Studie Studie handelt es sich um eine randomisierte kontrollierte Studie mit 134.867 Frauen, die zum Zeitpunkt der Randomisation (1977) 40 bis 73 Jahre alt waren. In die vorliegende Auswertung gingen Mortalitätsdaten bis 1998 ein. Mit den dabei entwickelten Annahmen wurde eine entsprechende Auswertung des englischen Brustkrebs-Screeningprogramms durchgeführt.
Vor kurzem berichteten wir über eine dänische Studie, die keine Unterschiede in der Brustkrebssterblichkeit zwischen Regionen mit und ohne Brustkrebsfrüherkennungsprogramm zeigte. In diesem Forum-Beitrag wurde auch auf die widersprüchlichen Ergebnisse verschiedener Studien eingegangen. Zu der Methodik der dänischen Studie hat sich eine scharfe Auseinandersetzung von Wissenschaftlern entwickelt, die im British Medical Journal dokumentiert ist.
Ergänzend ist festzustellen, dass die Diskrepanzen u.a. auch auf folgende Faktoren zurückzuführen sind:
• die Studienform, z.B. Regionenvergleich, randomisierte kontrollierte Studie, Kohortenstudie
• Zeitraum der Untersuchung - Rückgang der Brustkrebsmortalität in den letzten Jahrzehnten unabhängig von der Früherkennung
• Dauer der Nachbeobachtung
• Screeningintervallle
• Altersgruppe
• Röntgentechnik - z.B. ein oder zwei Bilder pro Brust
• Auswertung - z.B. Qualifikation der Auswerter, Auswertung durch einen oder durch zwei Untersucher
Möglicherweise wird es bis auf Weiteres keine abschließende Antwort auf die Frage geben, ob die Früherkennung von Brustkrebs zu einer Senkung der Sterblichkeit führt. Unstrittig sind jedoch zwei Dinge:
• Auch im günstigen Fall ist die Nutzenwahrscheinlichkeit für die einzelne Frau gering - in der Duffy-Studie 8,8 von Tausend in 20 Jahren.
• Mit der Teilnahme am Screening geht eine Frau auch das Risiko auf gravierende Schäden ein (Überdiagnose und Übertherapie).
So kann man die Brustkrebs-Früherkennung auch als eine Risikoverschiebung auffassen. Daraus folgt, dass an die Information über die Früherkennung von Brustkrebs hohe Anforderungen zu stellen sind, damit die Frauen eine informierte Entscheidung für oder gegen die Teilnahme treffen können.
Alles andere als vorbildlich ist die Kommentierung der Duffy-Studie auf der Website der Kooperationsgemeinschaft Mammographie: "Durch das Mammographie-Screening werden mehr Frauen vor dem Tod durch Brustkrebs gerettet als durch eine Überdiagnose beunruhigt." Zum einen wird schlicht unterschlagen, dass Überdiagnose gleichbedeutend mit Überbehandlung ist, also mit Operation, Bestrahlung und Chemotherapie. Zum andern wird suggeriert, dass die Mortalitätssenkung die Überdiagnose mehr als aufwiegt. Die Bewertung von Risiken ist jedoch subjektiv und kann individuell sehr unterschiedlich ausfallen.
Eine ergänzende lohnende Lektüre findet sich im Deutschen Ärzteblatt vom 16.4.2010: "Mammographie-Screening: Der Streit um den Nutzen geht in die nächste Runde".
Duffy SW, Tabar L, Olsen AH, Vitak B, Allgood PC, Chen THH, et al. Absolute numbers of lives saved and overdiagnosis in breast cancer screening, from a randomized trial and from the Breast Screening Programme in England. J Med Screen 2010;17(1):25-30.
Abstract
David Klemperer, 20.4.10
Wirksamkeit von Brustkrebs-Screening überaus fraglich
 Ein beachtenswerter Artikel zur Frage von Sinn und Unsinn des Brustkrebs-Screenings erschien Ende März 2010 in der angesehenen Medizinerzeitschrift British Medical Journal (BMJ). Ein dreiköpfiges Forscherteam bestehend aus Karsten Juhl Jørgensen und Peter Gøtzsche vom Nordic Cochrane Centre in Kopenhagen sowie Per-Henrik Zahl vom Folkehelseinstitut in Oslo untersuchten die Auswirkung von flächendeckenden Früherkennungsprogrammen auf die Sterblichkeit an Mamma-Karzinom. Dabei kamen sie zu ernüchternden Ergebnissen für Anhänger von Screening-Kampagnen.
Ein beachtenswerter Artikel zur Frage von Sinn und Unsinn des Brustkrebs-Screenings erschien Ende März 2010 in der angesehenen Medizinerzeitschrift British Medical Journal (BMJ). Ein dreiköpfiges Forscherteam bestehend aus Karsten Juhl Jørgensen und Peter Gøtzsche vom Nordic Cochrane Centre in Kopenhagen sowie Per-Henrik Zahl vom Folkehelseinstitut in Oslo untersuchten die Auswirkung von flächendeckenden Früherkennungsprogrammen auf die Sterblichkeit an Mamma-Karzinom. Dabei kamen sie zu ernüchternden Ergebnissen für Anhänger von Screening-Kampagnen.
Die Widersprüchlichkeit der Untersuchungsergebnisse und vor allem der daraus abgeleiteten Empfehlungen waren bereits wiederholt Thema im Forum Gesundheitspolitik, so z.B. in den Beiträgen
• Brustkrebs: EU fordert Staaten zu mehr Anstrengungen bei der Früherkennung auf
• Neue Studien schüren weiteren Zweifel am Nutzen des Mammographie-Screening und zuletzt
• Nutzen von Krebsfrüherkennung wird von Patienten deutlich überschätzt - Deutsche besonders schlecht informiert.
Auch der Spiegel griff das Thema wiederholt auf, so z.B. im April 2009 in dem Beitrag Umstrittene Früherkennung - "Ärzte schüren falsche Hoffnungen" und zuletzt mit Brustkrebs-Früherkennung - Forscher streiten über Mammografie-Studie. Die ZEIT hingegen publizierte im September 2009 in dem Artikel Mammografie-Screening ermöglicht frühzeitige Krebserkennung eine grundsätzlich positivere Haltung zur Frage von Reihenuntersuchungen zur Früherkennung von Mamma-Karzinomen. Ganz im Sinne des "medizinisch-industriellen Komplexes" und einer zunehmenden Technologisierung der Gesundheitsversorgung propagieren unter anderem deutsche Mediziner mittlerweile den Einsatz von Kernspintomographen anstelle der traditionellen Mammographie zur Früherkennung von Brustkrebs. Soeben erschienen die in diese Richtung weisenden Ergebnisse einer multizentrischen Studie aus Deutschland dem so genannten EVA-Trial: "Prospective Multicenter Cohort Study to Refine Management Recommendations for Women at Elevated Familial Risk of Breast Cancer".
Während der Deutsche Bundestag erst 2002 ein Brustkrebs-Screening-Programm ins Leben gerufen hatte, begannen in Teilen Dänemarks Reihenuntersuchungen zur Früherkennung von Mammakarzinomen bereits Anfang der 1990er Jahre. Aber was 1991 in Kopenhagen und 1993 auf der Insel Fünen begann, blieb dem Rest des Landes viele Jahre vorbehalten. So besteht in dem skandinavischen Land die einzigartige Situation, dass über 17 Jahre lang nur etwa ein Fünftel der Bevölkerung Zugang zu solchen Früherkennungsprogrammen hatte und sich die Bevölkerungsmehrheit als Kontrollgruppe anbietet.
Zentraler Ergebnisindikator der nun im BMJ erschienen Untersuchung war die jährliche anteilige Änderung der Brustkrebs-Mortalität in Regionen mit und ohne Screening-Programm. Dabei zeigte sich während des zehnjährigen Beobachtungszeitraums zwischen 1997 und 2006 bei Frauen zwischen 55 und 74 Jahren, die potenziell von der Früherkennung profitieren könnten, in den Screening-Gebieten ein jährlicher Rückgang der Krebssterblichkeit um 1 % (relatives Risiko (RR) 0.99, 95% Konfidenzintervall (KI) 0.96-1.01). Bei gleichaltrigen Frauen in den Gebieten, wo kein systematisches Screening erfolgte, ging im gleichen Zeitraum die Brustkrebs-Mortalität allerdings um 2 % und damit doppelt zu stark zurück wie unter Screening-Bedingungen (RR 0.98, 95% CI 0.97-0.99).
Bei jüngeren Frauen zwischen 35 und 55, bei denen aufgrund des jungen Alters kein positiver Effekt durch Früherkennungsprogramme zu erwarten ist, sank die Sterblichkeit aufgrund von Mammakarzinomen im gleichen Zeitraum um jährlich 5 % (RR 0.95, KI 0.92-0.98) in Regionen mit Screening-Programmen und sogar um 6 % in solchen ohne systematische Früherkennung (RR 0.94, KI 0.92-0.95). In den höheren Altersgruppen zwischen 75 und 84 Jahren zeigte sich sowohl in Gebieten mit als auch ohne Screening-Programm zwischen 1997 und 2006 nur eine geringfügige Änderung der jährlichen Sterblichkeit aufgrund von Brustkrebs.
Folgerichtig kommen die Autoren zu dem Schluss, dass sie keinen Effekt des dänischen Screening-Programm auf die Brustkrebsmortatiltät feststellen können, da die Verringerung der Sterblichkeit in Regionen mit und ohne Früherkennungsprogramm sehr ähnlich ausfiel und in Screening-Gebieten sogar tendenziell geringer war. Diese Ergebnisse sind nach ihrer Auffassung eher eine Änderung von Risikofaktoren und auf verbesserte Behandlungsmöglichkeiten zurückzuführen als auf Früherkennungsmaßnahmen.
Diese Ergebnisse widersprechen denen einer früheren Kohortenstudie aus Kopenhagen, die ebenfalls im BMJ erschien und kostenfrei als Volltext erhältlich ist: Breast cancer mortality in Copenhagen after introduction of mammography screening: cohort study. Damals hatte ein Forscherteam vom Institut of Public Health und der Universitätsklinik Kopenhagen einen sage und schreibe 25-prozentigen Rückgang der Mammakarzinom-Mortalität nach Einführung des Screening-Programms beobachtet, der bei tatsächlich teilnehmenden Frauen sogar bei 37 % lag. Solche Ergebnisse, für die im Übrigen auch keine Kontrollgruppe vorlag, sind nach Auffassung von Jørgensen und Kollegen in erster Linie Ausdruck des "healthy-Screenee-Effekts", denn an Früherkenungsprogrammen nehmen bekanntermaßen vor allem gebildete, gesündere und vor allem gesünder lebende Personen teil.
Das BMJ stellt den Artikel Breast cancer mortality in organised mammography screening in Denmark: comparative study von Karsten Juhl Jørgensen, Per-Henrik Zahl und Peter Gøtzsche kostenfrei zum Download zur Verfügung.
Jens Holst, 24.3.10
Das "Behandlungs-Risiko-Paradox": Steigende Anzahl von Ultraschalluntersuchungen schwangerer kanadischer Frauen = höhere Risiken?
 Eines der Vehikel der Medikalisierung, Pathologisierung und Risikoisierung von Schwangerschaft und Geburt sind die Ultraschalluntersuchungen der Schwangeren. In einer unheiligen Allianz neugieriger Eltern ("Babyfernsehen") und Ärzten, für die mittlerweile nach den Indikatoren des deutschen Mutterpasses 75% aller Schwangerschaften Risikoschwangerschaften sind und die Ultraschalluntersuchungen auch als Individuelle Gesundheitsleistung (IGeL) anbieten, nimmt die Anzahl dieser Untersuchungen auch hier zu Lande zu. Unklar bleibt bisher in Deutschland, ob die Zunahme nicht doch gerechtfertigt sein könnte, d.h. die so untersuchten Frauen vielleicht doch ein höheres Risiko haben und das Ganze daher Mutter und Kind zu gute kommt.
Eines der Vehikel der Medikalisierung, Pathologisierung und Risikoisierung von Schwangerschaft und Geburt sind die Ultraschalluntersuchungen der Schwangeren. In einer unheiligen Allianz neugieriger Eltern ("Babyfernsehen") und Ärzten, für die mittlerweile nach den Indikatoren des deutschen Mutterpasses 75% aller Schwangerschaften Risikoschwangerschaften sind und die Ultraschalluntersuchungen auch als Individuelle Gesundheitsleistung (IGeL) anbieten, nimmt die Anzahl dieser Untersuchungen auch hier zu Lande zu. Unklar bleibt bisher in Deutschland, ob die Zunahme nicht doch gerechtfertigt sein könnte, d.h. die so untersuchten Frauen vielleicht doch ein höheres Risiko haben und das Ganze daher Mutter und Kind zu gute kommt.
Etwas Licht in das Geschehen wirft jetzt eine in der neuesten Ausgabe des "Canadian Medical Association Journal (CMAJ)" vom 9. Februar 2010 veröffentlichte Untersuchung der Entwicklung in Kanada.
Für alle vorgeburtlichen Ultraschalluntersuchungen bei 1.399.389 Einzelgeburten zwischen 1996 und 2006 im Bundesstaat Ontario bzw. im "Ontario Health Insurance Plan" wurde die Rate der Untersuchungen pro 1.000 Schwangere berechnet. Außerdem wurde das relative Risiko eine solche Untersuchung zu erhalten für jedes Jahr berechnet. Das relative Risiko wurde für das Alter der Mutter, ihr Einkommen, die Wohngegend (Stadt/Land) mütterliche Komorbidität, dem Erhalt genetischer Beratungen und einer Fruchtwasserpunktion und nach den möglicherweise in früheren Schwangerschaften erlittenen Komplikationen adjustiert. Mittels mehrerer dieser Indikatoren wurden die Teilnehmerinnen der Studie als "high-risk"- oder "low-risk"-Personen klassifiziert.
Die Ergebnisse sahen u.a. so aus:
• Die Rate vorgeburtlicher Ultraschalluntersuchungen stieg von 2.055 Untersuchungen pro 1.000 Schwangerschaften im Jahr 1996 auf 3.264 in 2006 (adjustiertes relatives Risiko [RR] 1.55).
• Die Rate stieg sowohl bei Frauen mit niedrigem ( adj. RR 1.54) und hohem (adj. RR 1.55) Schwangerschaftsrisiko.
• Der Anteil der Schwangeren mit wenigstens vier Untersuchungen im zweiten und dritten Schwangerschaftsabschnitt stieg von 6,4% im Jahr 1996 auf 18,7% in 2006 (adjustiertes RR 2.68).
• Paradoxerweise war diese Zunahme mehr bei Frauen mit einer Niedrig-Risiko-Schwangerschaft (adj. RR 2.92) zu finden als bei Frauen mit einer Hochrisikoschwangerschaft (adj. RR 2.25).
Die kanadischen ForscherInnen hoben in ihrer Interpretation und Diskussion der Ergebnisse hervor, dass ein substantieller Anteil der Nutzung von Ultraschalldiagnostik in dem untersuchten Jahrzehnt nicht Änderungen im gesundheitlichen Risiko der werdenden Mütter reflektiert. Der größte Teil des Ultraschallgeschehens bei Schwangeren gehöre zu der wachsenden Menge von gesundheitsbezogenen Interventionen, die zwar meistens für Personen mit hohem Risiko von Nutzen sind, aber überwiegend Personen mit geringem Risiko angeboten werden.
Dieses so genannte "treatment-risk-paradox" ist u.a. auch im Arzneimittelbereich weit verbreitet.
Im Kontext der Ultraschalluntersuchungen verweisen die Autoren einerseits noch auf eine Reihe von nicht-klinischer anbieter- oder angebotsinduzierter Erklärungsfaktoren: "These factors may include the practice of defensive medicine, the desire to reassure a patient that her pregnancy is progressing normally, patient demand and even the "entertainment" value of seeing one's fetus."
Andererseits geben sie die Gefahr zu bedenken, dass durch die Untersuchung kein gesundheitlicher Nutzen entsteht, möglicherweise aber Schaden durch die kontrovers untersuchten Risiken der Diagnostik: "Although the benefits of prenatal ultrasonography in high-risk pregnancies may be clearer, the value of repeat ultrasonography in low-risk patients is not. Prenatal ultrasonography is widely regarded as safe. However, some studies have suggested that frequent prenatal ultrasonography may be associated with intrauterine growth restriction, delayed speech and non-righthandedness."
Alles in Allem wird eine wirksame und dauerhafte Änderung der Verhaltensweisen von Ärzten und mancher Erwartungen von Schwangeren dank der hier nur angerissenen Komplexität der möglichen Einflussfaktoren nicht einfach sein.
Der Aufsatz "Proliferation of prenatal ultrasonography" von John J. You, David A. Alter, Therese A. Stukel, Sarah D. McDonald, Andreas Laupacis, Ying Liu und Joel G. Ray ist in der kanadischen Medizin-Fachzeitschrift CMAJ (CMAJ (182[2]: 143-151) erschienen und komplett kostenlos zugänglich.
Bernard Braun, 9.2.10
Gibt es Überversorgung bei Screeningangeboten? Beim "Pap-Test" neigen amerikanische Ärzte sogar gewaltig dazu.
 Ob es nicht bereits bei der ärztlichen Empfehlung eines so genannten "Pap-Testes" Mängel und vor allem medizinisch nicht notwendige Überversorgung gibt, untersuchte eine 2006 und 2007 in den USA bundesweit und repräsentativ durchgeführte Befragungsstudie von 1.212 Gynäkologen, Familienärzten und Internisten, die fast alle angaben, Pap-Tests durchzuführen und auszuwerten.
Ob es nicht bereits bei der ärztlichen Empfehlung eines so genannten "Pap-Testes" Mängel und vor allem medizinisch nicht notwendige Überversorgung gibt, untersuchte eine 2006 und 2007 in den USA bundesweit und repräsentativ durchgeführte Befragungsstudie von 1.212 Gynäkologen, Familienärzten und Internisten, die fast alle angaben, Pap-Tests durchzuführen und auszuwerten.
Der 1928 von dem griechischen Arzt George Papanicolaou entwickelte so genannte Pap-Test entnimmt am Muttermund der Frau einen Abstrich von Zellen. Nach der Einfärbung können damit möglicherweise unerwünschte Zellveränderungen bis hin zum Gebärmutterhalskrebs entdeckt werden. Er ist daher auch fester Bestandteil in Screeningprogrammen zur Früherkennung eines Gebärmutterhalskrebses. Seine Sensivität, d.h. die Wahrscheinlichkeit, mit ihm einen tatsächlich positiven, d. h. in diesem Zusammenhang krankhaften Sachverhalt durch ein positives Testergebnis zu erkennen, beträgt 51%. Seine Spezifität, d.h. die Wahrscheinlichkeit, einen tatsächlich negativen, also gesunden Sachverhalt auch durch ein negatives Testergebnis zu erkennen und nicht fälschlicherweise einen Hinweis auf eine Erkrankung zu erhalten beträgt 98%. Eine 2003 im "British Medical Journal (BMJ)" veröffentlichte Vergleichsstudie des Pap-Tests mit mehreren damals existierenden Alternativverfahren "Cross sectional study of conventional cervical smear, monolayer cytology, and human papillomavirus DNA testing for cervical cancer screening" von Coste et al. belegte seine insgesamt überlegene Qualität.
Das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ) weist aber zur "Gebärmutterhalskrebs-Früherkennung: Krebsvorstufen rechtzeitig finden und behandeln" und Pap-Test auf seiner Website auf eine zu beachtende Grenze der Aussagefähigkeit der Testergebnisse hin: "Durch diese Abstrichuntersuchung lassen sich auffällig veränderte Zellen des Gebärmutterhalses aufspüren, die sich unter Umständen zu Krebsvorstufen entwickeln können. Manchmal verwenden Gynäkologen für diesen Nachweis auch den Begriff "Krebsabstrich". Dieser ist allerdings irreführend: Ein auffälliger Pap-Befund ist nicht automatisch gleichzusetzen mit einer Krebserkrankung. In den meisten Fällen ist der Befund völlig harmlos und die meisten Veränderungen heilen von alleine wieder ab."
In der aktuell veröffentlichten Studie aus den USA wurde den Ärzten von den ForscherInnen vier hypothetische PatientInnen-Typen unterschiedlichen Alters, Geschlechts, Gesundheit und Screening-Vorgeschichten und -ergebnissen vorgestellt. Die Beispiel-PatientInnen reichten von einer 18-jährigen Frau ohne Sexualerfahrungen bis zu einer 66-jährigen Frau, die vorher keinen Pap-Testbefund hatte und akut an Lungenkrebs erkrankt war. Die befragten Ärzte sollten jeweils ageben, welche Empfehlungen bezüglich eines Pap-Tests sie der Patientin geben würden.
Für alle diese Personen gibt es in den USA seit 2000 revidierte medizinische Leitlinien, die klare Alters- und Gesundheitsindikatoren für den Erhalt oder Nichterhalt eines Pap-Tests formulierten und Überversorgung vermeiden wollten. Nach diesen von den medizinischen Fachgesellschaften "American Cancer Society" und "American College of Obstetricians and Gynecologists" sowie der "U.S. Services Task Force" verfassten und verbreiteten Leitlinien sollten Frauen, die noch keinen Geschlechtsverkehr hatten nicht getestet werden und auch erst drei Jahre nach dem ersten Geschlechtsverkehr. Wenn drei Tests keinerlei Befund hatten, sollte bei über 30-Jährigen der Testabstand von einem auf mehr Jahre verlängert werden, um unnötige Ängste und Ausgaben zu vermeiden. Der Abstand kann bei Frauen über 60 Jahren noch länger werden, wenn dreimal kein Befund vorlag oder die Frau an einer lebensgefährlichen anderen Erkrankung leidet.
Nach einem Vergleich der von den Ärzten jeweils gemachten Empfehlungen an die hypothetischen Frauen mit diesen Leitlinien, ergab sich folgendes Bild:
• 22% aller Ärzte folgten bei allen vier Szenarien den Leitlinienempfehlungen.
• 50% der Ärzte hätten der 18-jährigen "Jungfrau" einen nicht durch Leitlinien begründeten Pap-Test empfohlen.
• Mehr als 40% der Ärzte hätten der 66-jährigen Lungenkrebspatientin, die vorher dreimal keinen Befund hatte, einen Pap-Test empfohlen und dann auch noch jährlich.
• 27% der Internisten folgten durchweg den Leitlinien. Dies machten auch noch 21% der Familien- und Allgemeinärzte aber lediglich 16% der Gynäkologen.
• Schließlich waren Ärzte, die jünger als 40 Jahre alt, zertifiziert und in einer größeren multidisziplinären Gruppenpraxis tätig waren, leitliniengetreuer als die jeweilige Vergleichsgruppe.
Über die Gründe dieser enormen Überversorgung eines Tests konnten die ForscherInnen relativ wenig sagen, wiesen aber auf den möglichen finanziellen Nutzen für die untersuchenden Ärzte und die Verwirrung von Ärzten hin, wenn Empfehlungen geändert würden.
Wem das Ergebnis nicht passt, kann gegen die Studie zusammen mit ihren VerfasserInnen einwenden, sie habe nur Hypothetisches erfasst, d.h. was die Ärzte tun würden und nicht wie sie ihre PatientInnen tatsächlich screenen. Dies zusätzlich zu untersuchen, erscheint möglich und machbar.
Von der Studie "Specialty Differences in Primary Care Physician Reports of Papanicolaou Test Screening Practices: A National Survey, 2006 to 2007" von Yabroff et al., die in der Fachzeitschrift "Annals of Internal Medicine" (November 3, 2009 vol. 151 no. 9 602-611) erschienen ist, gibt es kostenlos lediglich das Abstract. Dies gilt auch für das ebenfalls verfügbare und prinzipiell begrüßenswerte und zur Nachahmung empfohlene Summary for patients".
Bernard Braun, 8.11.09
Zu viel Medizin? Die Früherkennung von Prostatakrebs führt zu massenhafter Überdiagnostik und Übertherapie
 Zu viel Medizin? Die Früherkennung von Prostatakrebs führt zu massenhafter Überdiagnostik und Übertherapie
Zu viel Medizin? Die Früherkennung von Prostatakrebs führt zu massenhafter Überdiagnostik und Übertherapie
1986 wurde die Früherkennung von Prostatkrebs mit Hilfe des prostatspezifsichen Antigens (PSA-Screening) in den USA eingeführt. Ein Studie des renommierten Dartmouth Institute berechnete jetzt die dadurch geschaffene Zahl zusätzlich Kranker und Behandelter. Durch die Früherkennung wurde die Zahl der Neuerkrankten (Inzidenz) dramatisch in die Höhe getrieben: 1.305.600 Männer erhielten zusätzlich die Diagnose Prostatakrebs, 1.004.800 wurden operiert und / oder bestrahlt. Die Inzidenz stieg bei Männern im Alter von 60 bis 69 Jahren von 349 pro 100.000 im Jahr 1985 auf 667 pro 100.000 im Jahr 2005, bei 50- bis 59-Jährige von 58 pro 100.000 auf 213 pro 100.000, bei Männern unter 50 Jahren von 1,3 auf 9,4 pro 100.000.
Tatsächlich ist die Sterblichkeit an Prostatakrebs in den USA im genannten Zeitraum zurückgegangen. Sieht man die Ursache für den Rückgang im Screening (wogegen die vorliegenden Studien sprechen), verhindert nach optimistischsten Berechnungen die Diagnose von 23 Männern und die Therapie von 18 Männern einen Todesfall. Die weniger optimistische Zahl lautet ein verhinderter Todesfall auf 50 Behandelte. Die übrigen waren nur dem Risiko unerwünschter Therapiefolgen ausgesetzt. Die Operation kann zu Impotenz, Inkontinenz und zum Tod führen, die Bestrahlung zu Impotenz, Beschwerden beim Wasserlassen, schmerzhaftem Stuhlgang und Verletzungen des Darmes.
Wie berichtet haben zwei kürzlich veröffentlichte randomisierte kontrollierte Studien den Nutzen des PSA-Screenings nicht belegen können: während eine amerikanische Studie keine Senkung der Prostatakrebsmortalität zeigte, wurde in einer europäischen Studie die Mortalität um 0,17 Promille gesenkt, was bedeutet, dass für einen verhinderten Todesfall 1.410 Männer gescreent und 48 Männer behandelt werden müssen, 47 davon überflüssigerweise.
Eine 2008 veröffentlichte systematische Übersichtsarbeit hatte ergeben, dass nach radikaler Prostataentfernung bei 58 Prozent der Männer Impotenz auftritt, nach Bestrahlung bei 43 Prozent und nach Hormonbehandlung bei 86 Prozent. Harninkontinenz ist nach operativer Prostataentfernung bei 35 Prozent der Männer, nach Bestrahlung bei 12 Prozent und nach Hormonbehandlung bei 11 Prozent zu erwarten.
H. Gilbert Welch, Peter C. Albertsen. Prostate Cancer Diagnosis and Treatment After the Introduction of Prostate-Specific Antigen Screening: 1986-2005. Journal of the National Cancer Institute. Abstract
Pressemitteilung des Dartmouth Institute.
David Klemperer, 12.9.09
US-Studie zeigt: Machos gehen sehr viel seltener zur medizinischen Vorsorge-Untersuchung
 Männer nehmen deutlich seltener als Frauen medizinische Untersuchungen zur Früherkennung von Krankheiten in Anspruch. Dies ist hinlänglich aus vielen internationalen und auch deutschen Studien bekannt. Im Gesundheitsmonitor 2007 etwa geben nur 20% der Männer, aber 60% der Frauen an, sie würden regelmäßig zur Krebsfrüherkennung gehen (vgl. Koch/Scheibler: Einstellungen und Informationsstand zur Früherkennung: Informiert und doch getäuscht?). Eine US-amerikanische Studie hat nun aber gezeigt, dass es zwischen Männern noch erhebliche Unterschiede gibt: Männer mit einem sehr starken Macho-Verhalten und Vorstellungen männlicher Überlegenheit gehen deutlich seltener zu Vorsorge- oder Früherkennungs-Untersuchungen zum Arzt.
Männer nehmen deutlich seltener als Frauen medizinische Untersuchungen zur Früherkennung von Krankheiten in Anspruch. Dies ist hinlänglich aus vielen internationalen und auch deutschen Studien bekannt. Im Gesundheitsmonitor 2007 etwa geben nur 20% der Männer, aber 60% der Frauen an, sie würden regelmäßig zur Krebsfrüherkennung gehen (vgl. Koch/Scheibler: Einstellungen und Informationsstand zur Früherkennung: Informiert und doch getäuscht?). Eine US-amerikanische Studie hat nun aber gezeigt, dass es zwischen Männern noch erhebliche Unterschiede gibt: Männer mit einem sehr starken Macho-Verhalten und Vorstellungen männlicher Überlegenheit gehen deutlich seltener zu Vorsorge- oder Früherkennungs-Untersuchungen zum Arzt.
Basis der jetzt auf dem Jahres-Kongress der American Sociological Association referierten Studie sind Daten von 1.000 älteren Männern (im Durchschnitt 65 Jahre), die aus der Wisconsin Longitudinal Study stammen. Aus dieser Stichprobe wurden Befragungsdaten des Jahres 2004 verwendet, unter anderem verschiedene sozialstatistische Angaben (Alter, Geschlecht, Familienstand usw.) und sozio-ökonomischer Status (gemessen anhand des Bildungsniveaus, des Einkommens und weiterer Merkmale). Weiterhin erfasst wurden Angaben der befragten Männer, ob sie in den letzten 12 Monaten folgende drei Untersuchungen bei einem Arzt haben durchführen lassen: 1) eine allgemeine körperliche Untersuchung etwa vergleichbar dem "Gesundheits-Checkup", 2) eine vorbeugende Grippe-Impfung, 3) eine Prostata-Untersuchung. Aus den drei Merkmalen wurde dann ein Gesamtwert für das medizinische Vorsorgeverhalten gebildet.
Detailliert erfragt wurden weiterhin Einstellungen in Bezug auf Männlichkeits-Normen. Diese Fragenbatterie zur männlichen Überlegenheit ("Hegemonic Masculinity") umfasste acht Feststellungen, die man auf einer vierstufigen Skala ablehnen oder bejahen konnte. Die Statements lauteten übersetzt:
• Wenn Mann und Frau wichtige Entscheidungen über häusliche Angelegenheiten treffen müssen, sollte der Mann das letzte Wort haben.
• Ein Mann sollte bei seinen Vorhaben immer Zuversicht ausstrahlen, auch wenn er innerlich nicht besonders zuversichtlich ist.
• Es ärgert mich, wenn ein Mann etwas tut, was ich als "feminin" erlebe.
• Männer haben ein stärkeres sexuelles Verlangen als Frauen.
• Ein Mann sollte es nicht zeigen, wenn er Schmerzen hat.
• In bestimmten Situationen sollte ein Mann auch bereit sein, seine Fäuste zu gebrauchen.
• Frauen finden große, kräftige und muskulöse Männer attraktiver.
• Es ist immer besser, wenn der Mann den Lebensunterhalt verdient und die Frau sich um Heim und Familie kümmert.
Die Antworten zu diesen Statements wurden dann summiert, so dass für jeden Teilnehmer ein Maskulinitätswert errechnet wurde. Dieser wurde dann in einer multivariaten Analyse unter gleichzeitiger Berücksichtigung sozialstatistischer und sozio-ökonomischer Einflussfaktoren in Beziehung gesetzt zum Vorsorgeverhalten im vergangenen Jahr. Dabei zeigte sich dann: Je stärker die Männlichkeitsnormen bei den Teilnehmern verwurzelt waren, um so seltener wurde an Untersuchungen zur Früherkennung oder Vorsorge teilgenommen - auch wenn man andere Faktoren wie Alter oder Bildungsniveau mitberücksichtigte. Die statistische Chance für eine Teilnahme an diesen Untersuchungen war für Männer mit einer ausgeprägten Maskulinitäts-Ideologie nur etwa halb so groß wie für andere (Odds-Ratio 0,54; p<0,001).
Überraschend war für die Wissenschaftler weiterhin, dass das Bildungsniveau und der berufliche Status die enge Verknüpfung von Maskulinitäts-Einstellungen und Vorsorgeverhalten nicht kompensierte, sondern im Gegenteil noch verstärkten: In der Gruppe jener Befragungsteilnehmer mit starker Macho-Einstellung zeigte sich, dass das Vorsorgeverhalten umso schwächer ausgeprägt war, je höher der berufliche Status war.
• Pressemitteilung der ASA: ASA Press Releases: Men's Masculinity Beliefs Are a Barrier to Preventative Healthcare
• Die komplette Studie: Springer, Kristen, Mouzon, Dawne: Masculinity and Health Care Seeking among Midlife Men: Variation by Social Context (Paper presented at the annual meeting of the American Sociological Association Annual Meeting, Sheraton Boston and the Boston Marriott Copley Place, Boston, MA, Jul 31, 2008)
Gerd Marstedt, 20.8.09
Nutzen von Krebsfrüherkennung wird von Patienten deutlich überschätzt, Deutsche besonders schlecht informiert
 Was wissen Bürger und Patienten in Europa über Nutzen und Risiken der Krebs-Früherkennung? Interviews mit mehr als 10.000 Bürgern aus neun europäischern Ländern gingen in die erste europaweit durchgeführte Studie zu diesem Thema ein. Die Ergebnisse der vom Harding-Zentrum für Risikokompetenz und der Gesellschaft für Konsumforschung durchgeführten Studie überraschen. Die ganz überwiegende Mehrheit der befragten Europäer erweist sich als mangelhaft informiert und viel zu optimistisch in Sachen Früherkennung, allen voran die Deutschen.
Was wissen Bürger und Patienten in Europa über Nutzen und Risiken der Krebs-Früherkennung? Interviews mit mehr als 10.000 Bürgern aus neun europäischern Ländern gingen in die erste europaweit durchgeführte Studie zu diesem Thema ein. Die Ergebnisse der vom Harding-Zentrum für Risikokompetenz und der Gesellschaft für Konsumforschung durchgeführten Studie überraschen. Die ganz überwiegende Mehrheit der befragten Europäer erweist sich als mangelhaft informiert und viel zu optimistisch in Sachen Früherkennung, allen voran die Deutschen.
So fanden die Wissenschaftler heraus, dass 92 % aller befragten Frauen den Nutzen der Mammografie als Mittel zur Vermeidung einer tödlich verlaufenden Brustkrebserkrankung völlig überschätzen oder gar keine Angaben dazu machen können. Und in ähnlicher Weise versprechen sich 89 % aller Männer zu viel vom PSA-Test im Hinblick auf die Reduktion des Risikos einer tödlich verlaufenden Prostatakrebserkrankung oder wissen dies nicht. Aber tatsächlich ist es um den Nutzen der Mammografie wie des PSA-Tests sehr viel schlechter bestellt. Dieses Informationen sind bislang jedoch kaum zu Patienten und Bürgern vorgedrungen. Dies ist kein Wunder, denn schon vor einiger Zeit hatten Wissenschaftler festgestellt: "Nicht nur Patienten, auch Journalisten und Ärzte sind Analphabeten, was Gesundheitsstatistiken anbetrifft".
Frühere Untersuchungen haben ergeben (vgl. Grafik), dass von 1.000 Frauen, die nicht am Mammographie-Sreening teilgenommen hatten, etwa 5 in einem Zeitraum von ca. 10 Jahren an Brustkrebs sterben. Bei einer Gruppe von ebenfalls 1.000 Frauen, die sich für die Früherkennung entschieden haben, verringert sich diese Zahl auf 4. In vielen Informationsbroschüren wird dieser Sachverhalt in die Aussage übersetzt, dass die Mammografie eine Risikoreduktion um 20 % ermögliche (mitunter werden auch 25 % oder 30 % angegeben). Das ist mathematisch korrekt (1 Todesfall von 5 Fällen weniger macht 20 Prozent aus), aber inhaltlich irreführend. Denn häufig schließen Frauen daraus, dass durch Mammografie 20 von 100 oder 200 von 1.000 Frauen "gerettet" werden. Die jetzt präsentierte Studie zeigt: In Deutschland wissen gerade einmal 0,8 % der Frauen, dass Früherkennung die Brustkrebssterblichkeit um etwa eine von je 1.000 Frauen reduziert - das ist europäischer Tiefstwert, allerdings ist das Wissen im europäischen Durchschnitt (1,5%) nicht sehr viel höher. 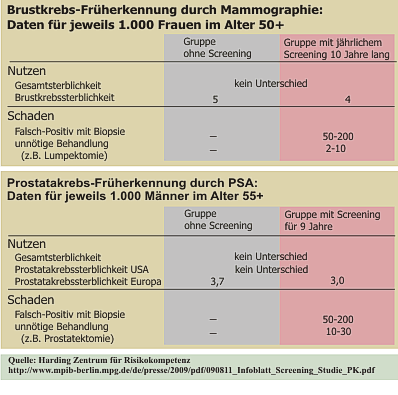
Doch auch bei Männern zeigt sich Ähnliches: Der Nutzen der Prostatakrebsfrüherkennung mit PSA-Tests liegt bei null oder einem von 1.000 Männern. Dies wissen jedoch insgesamt (alle Länder) nur 11 Prozent, und in Deutschland gerade einmal 6 Prozent.
Dafür sind die Deutschen, Männer wie Frauen, "Prospekt-Europameister": 41 % der Befragten informieren sich häufig durch Broschüren von Gesundheitsorganisationen - der europäische Durchschnitt liegt hier bei 21 %. Jene Deutschen, die solche Informationsquellen häufig zu Rate ziehen, sind aber keineswegs besser informiert als andere. Vielmehr überschätzen sie den Nutzen der Früherkennung noch etwas mehr als jene, die die Broschüren nicht lesen. Menschen im Alter von 50-69 Jahren, die besonders gefährdet sind und daher die wichtigste Zielgruppe des Informationsmaterials darstellen, sind keineswegs besser im Bilde als andere Altersgruppen.
Und noch einer weiteren Frage widmet sich die Studie: Sind Menschen, die häufiger Ärzte oder Apotheker konsultieren, besser über den Nutzen der Früherkennung informiert? Die Antwort darauf ist europaweit ein klares "Nein". Insbesondere deutsche Frauen, die ihr Wissen zum Thema Früherkennung bevorzugt aus Gesprächen mit Ärzten und Apothekern beziehen, sind nicht etwa zu einer deutlich genaueren Einschätzung in der Lage, sondern zeigen sich schlechter informiert als andere, die sich weniger bei Ärzten oder Apothekern erkundigen.
Prof. Dr. Gerd Gigerenzer, Direktor des Harding Center for Risk Literacy, zu den Ergebnissen der Studie: "Früherkennung birgt immer die Gefahr von Folgeschäden, wie z. B. unnötige Operationen oder Inkontinenz. Um informiert entscheiden zu können, ob sie teilnehmen möchten oder nicht, müssen Patienten um den möglichen Nutzen der Früherkennung genauso wissen wie um potenzielle Schädigungen. Wenn wir mündige Patienten und kein paternalistisches Gesundheitswesen wollen, dann müssen wir genau hier ansetzen. Wir müssen - gerade in einem immer teurer werdenden System - die Menschen umfassend und präzise informieren und sie so in die Lage versetzen, notwendige Entscheidungen kompetent zu treffen."
• Die neuere Studie mit der Umfrage in Europa (kostenlose PDF-Datei): Gerd Gigerenzer, Jutta Mata und Ronald Frank: Public Knowledge of Benefits of Breast and Prostate Cancer Screening in Europe
• Abstract der Studie im Journal of the National Cancer Institute, Vol. 101, Issue 17
• Informations-Blatt mit Quellen für die genannten epidemiologischen Daten
Frühere Veröffentlichungen:
• Gerd Gigerenzer, Odette Wegwarth: Risikoabschätzung in der Medizin am Beispiel der Krebsfrüherkennung (Zeitschrift für Evidenz, Fortbildung und Qualität im Gesundheitswesen, Volume 102, Issue 9, 2008, Pages 513-519)
• Gerd Gigerenzer u.a.: Helping Doctors and Patients Make Sense of Health Statistics (Psychological Science in the Public Interest, Volume 8 Issue 2, Pages 53 - 96, Published Online: 8 Oct 2008)
Gerd Marstedt, 12.8.09
Brustkrebs-Früherkennung durch Mammographie: Ein Drittel aller Karzinome ist harmlos und überdiagnostiziert
 Etwa jedes dritte Brustkrebs-Karzinom, das bei bevölkerungsweiten Screenings mithilfe der Mammographie entdeckt wird, ist nach Befunden einer Studie, die jetzt im British Medical Journal veröffentlicht wurde, überdiagnostiziert. Solche Tumore wachsen entweder nur sehr langsam oder sie bilden sich auch spontan zurück, so dass sie in keinem Falle gefährliche oder lebensbedrohliche Formen einnehmen. Die Patientinnen würden in diesem Falle an anderen Ursachen sterben. Ein Problem ist allerdings, dass die Medizin bis heute noch nicht vorhersagen kann, welche Tumore harmlos bleiben und welche sich zu einem tödlichen Risiko entwickeln. Von daher werden alle diagnostizierten Brustkrebs-Tumore medizinisch behandelt - mit der Folge einer Überdiagnostik und Überversorgung.
Etwa jedes dritte Brustkrebs-Karzinom, das bei bevölkerungsweiten Screenings mithilfe der Mammographie entdeckt wird, ist nach Befunden einer Studie, die jetzt im British Medical Journal veröffentlicht wurde, überdiagnostiziert. Solche Tumore wachsen entweder nur sehr langsam oder sie bilden sich auch spontan zurück, so dass sie in keinem Falle gefährliche oder lebensbedrohliche Formen einnehmen. Die Patientinnen würden in diesem Falle an anderen Ursachen sterben. Ein Problem ist allerdings, dass die Medizin bis heute noch nicht vorhersagen kann, welche Tumore harmlos bleiben und welche sich zu einem tödlichen Risiko entwickeln. Von daher werden alle diagnostizierten Brustkrebs-Tumore medizinisch behandelt - mit der Folge einer Überdiagnostik und Überversorgung.
Um das Ausmaß dieser Überversorgung zu erkennen, analysierten Karsten Jørgensen und Peter Gøtzsche vom "Nordic Cochrane Centre" die Inzidenzraten (Häufigkeit neu auftretender Fälle) von Brustkrebs vor und nach der Einführung bevölkerungsweiter Screening-Programme in fünf Ländern: United Kingdom, Kanada, Australien, Schweden und Norwegen. Um Verzerrungen bei den Daten zu vermeiden, schlossen sie Zeiträume von zumindest sieben Jahren vor und nach der Einführung des Screenings ein. Überdies analysierten sie die Ergebnisse von Gruppen mit und ohne Mammographie und unterteilten diese auch in Altersgruppen. Auch andere Einflussfaktoren wurden berücksichtigt, so unter anderem sinkende Brustkrebsquoten bei älteren, schon gescreenten Frauen.
Heraus kam bei den Analysen eine Zunahme der Inzidenzquoten, die eng zusammenhing mit der Einführung des Screening. Dieser Befund ist jedoch zu erwarten, denn neben den klinisch relevanten werden auch kleinere Tumore entdeckt. Einige Jahre später sollte die Inzidenz jedoch wieder auf das ursprüngliche Niveau aus dem Zeitraum vor Einführung des Screenings zurückgehen. Dies jedoch war in keinem der untersuchten fünf Länder der Fall. Die Wissenschaftler schätzten dann das Ausmaß der Überdiagnostik folgendermaßen ein: United Kingdom etwa 57%, Manitoba (Kanada) 59%, New South Wales 53%, Schweden 46%, Norwegen 52%. Insgesamt schätzen sie die Überdiagnostik auf 52%. Dies schließt sog. Carcinome in-situ mit ein (eine Krebs-Vorstufe), die üblicherweise medizinisch auch behandelt werde. Für gravierende Krebsformen schätzten sie die Überdiagnostik auf 35%.
Diese Befunde, so schreibt Prof. H. Gilbert Welch in einem Editorial des British Medical Journal, stimmen überein mit einer wachsenden Evidenz aus vielen anderen Studien, die darauf hinweisen, dass die Einführung des Brustkrebs-Screening mit Mammographie eine gravierende Überdiagnostik bewirkt. Ohne Zweifel würde das Screening vielen Frauen helfen, bei anderen aber auch schwere Schäden im Gefolge der Therapie verursachen. Es gibt daher keine objektiv richtige Antwort auf die Frage: Zur Früherkennung gehen oder nicht? Dies sei eine persönliche Entscheidung jeder Frau. Allerdings müsse man diese besser informieren und ihnen auch quantitativ deutlich machen, welche Nutzen und welche Risiken sich aus der Früherkennungs-Untersuchung für sie ergeben.
• PDF der Studie: Karsten Juhl Jørgensen, Peter C Gøtzsche: Overdiagnosis in publicly organised mammography screening programmes: systematic review of incidence trends
(BMJ 2009;339:b2587; doi:10.1136/bmj.b2587)
• Abstract der Studie
• Editorial von H Gilbert Welch: Overdiagnosis and mammography screening
Gerd Marstedt, 10.8.09
Jeder sechste Niederländer hat schon medizinische Selbsttests gemacht zur Diagnose von Diabetes oder Cholesterin
 Wenn es derzeit schon möglich ist, die eigenen 23 Chromosomenpaare gegen eine Gebühr von 1000 Dollar entschlüsseln und auf Erbkrankheiten analysieren zu lassen (vgl. "23andMe" - Eine Google-Firma verkauft an Privatpersonen jetzt Analysen ihrer Erbanlagen), dann kann nicht überraschen, dass auch die Verkaufszahlen für persönlich durchführbare medizinisch-diagnostische Selbsttests deutlich zunehmen. Jeder sechste Niederländer, so hat eine Umfrage jetzt festgestellt, hat bereits Erfahrungen mit solchen Untersuchungen, die ohne Einschaltung eines Arztes Diabetes oder Allergien erkennen sollen, einen zu hohen Cholesterinspiegel oder Infektionen.
Wenn es derzeit schon möglich ist, die eigenen 23 Chromosomenpaare gegen eine Gebühr von 1000 Dollar entschlüsseln und auf Erbkrankheiten analysieren zu lassen (vgl. "23andMe" - Eine Google-Firma verkauft an Privatpersonen jetzt Analysen ihrer Erbanlagen), dann kann nicht überraschen, dass auch die Verkaufszahlen für persönlich durchführbare medizinisch-diagnostische Selbsttests deutlich zunehmen. Jeder sechste Niederländer, so hat eine Umfrage jetzt festgestellt, hat bereits Erfahrungen mit solchen Untersuchungen, die ohne Einschaltung eines Arztes Diabetes oder Allergien erkennen sollen, einen zu hohen Cholesterinspiegel oder Infektionen.
Im Rahmen einer Internet-Befragung, an der sich im Herbst 2006 knapp 8.000 niederländische Männer und Frauen im Alter von 12-94 Jahren beteiligten (Durchschnittsalter: 37), wollte ein Forschungsteam der Universität Maastricht der Frage nachgehen, wie stark solche Tests heute verbreitet sind und von welchen Bevölkerungsgruppen sie häufiger genutzt werden. Unterschieden werden verschiedene Formen von Selbsttests, die auch auf dem Fragebogen erläutert sind. Am häufigsten sind solche, die man in der Apotheke kauft oder im Internet bestellt, zuhause durchführt und dort auch das Ergebnis ablesen kann, sowie auch Tests, die man in bestimmten Einrichtungen (in der Apotheke oder Klinik ebenso wie im Supermarkt) durchführt und dort entweder sofort das Resultat erfährt oder per Post zugeschickt bekommt.
Die wichtigsten Ergebnisse der Befragung waren:
• 63% hatten schon von solchen Tests zuvor gehört, 28% schon einmal eine Nutzung in Betracht gezogen, 16% sie schon einmal persönlich genutzt.
• Bei den Nutzern war die durchschnittliche Zahl der schon einmal verwendeten Selbsttests 2,1.
• Die am häufigsten von den Nutzern verwendeten Tests waren: Diabetes (39% der Nutzer), Cholesterin (34%), weiblicher Eisprung (15%), Allergien (12%), Harntrakt-Infektionen (12%), HIV-Infektion (11%), Anämie (11%), Menopause / weibliche Fruchtbarkeit (10%).
• Im Rahmen einer multivariaten Analyse, also unter Einbezug einer Vielzahl gesundheitlicher und soziodemografischer Einflussfaktoren, zeigte sich dann, dass folgende Gruppen bzw. Merkmale besonders häufig in Zusammenhang standen mit der Nutzung medizinischer Selbsttests: Body Mass Index über 30, wenig körperliche Bewegung, eher fettreiche Ernährung, regelmäßige Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln und Vitaminen, Sympathie für homöopathische Medizin, Vorliegen einer chronischen Erkrankung, eher schlechte Selbsteinstufung des Gesundheitszustands.
• Im Hinblick auf das Alter, Geschlecht oder Bildungsniveau zeigten sich keine signifikanten Einflüsse.
Damit entsteht der Eindruck einer eher kranken (u.U. auch nur "kränkelnden", also gegenüber Krankheiten und Beschwerden überdurchschnittlich sensiblen) Bevölkerungsgruppe, deren Gesundheitsverhalten eher riskant ist und die daher bemüht ist, durch Selbsttests mehr Gewissheit zu erlangen über weitere Erkrankungsrisiken.
Inwieweit die Verwendung von Selbsttests in gesundheitlicher und therapeutischer Hinsicht eine sinnvolle oder eher problematische Maßnahme ist, lässt sich aus den Daten der Befragung leider nicht exakt ablesen. Bei jedem vierten Befragungsteilnehmer wiesen die Befunde auf eine Erkrankung oder einen Risikofaktor hin, und 75% dieser Gruppe ging dann zum Arzt, 25% unterließen dies. Bei jenen mit negativem Testergebnis gingen lediglich 9% zum Arzt. Um diese Zahlen bewerten zu können, wäre es allerdings nötig, die Fehler-Anfälligkeit der einzelnen Verfahren genauer zu kennen.
Quelle: Gaby Ronda et al: Use of diagnostic self-tests on body materials among Internet users in the Netherlands: prevalence and correlates of use; BMC Public Health 2009, 9:100doi:10.1186/1471-2458-9-100
• Vorläufige PDF-Datei mit Volltext der Studie
• kurzes Abstract der Studie
Gerd Marstedt, 21.4.09
Schweiz: Nur 50% der Ärzte ist vom Nutzen des PSA-Tests überzeugt, aber 75% empfehlen ihn aus juristischen Erwägungen
 In einer Befragung Schweizer Allgemeinärzte und Internisten wurde deutlich, dass nur jeder zweite Arzt vom Nutzen des PSA-Tests zur Früherkennung von Prostatakrebs überzeugt ist und davon, dass der Nutzen das Risiko überwiegt. Zugleich erklären jedoch drei von vier Befragungsteilnehmern, dass sie den Test den Älteren unter ihren Patienten empfehlen. Der Grund dafür ist nach Meinung der Forscher, deren Studie jetzt in der Zeitschrift "Journal of Evaluation in Clinical Practice" veröffentlicht wurde, nicht in finanziellen Anreizen zu sehen, sondern im Sicherheitsdenken der Ärzte. Solche Befürchtungen zukünftiger Klagen wegen eines Kunstfehlers, falls ein Patient später an Prostatakrebs erkrankt und der PSA-Test unterblieben ist, sind zwar extrem unwahrscheinlich, gleichwohl geben viele der Befragten an, sie würden den PSA-Test auch aus Gründen der juristischen Absicherung gegen spätere Klagen empfehlen.
In einer Befragung Schweizer Allgemeinärzte und Internisten wurde deutlich, dass nur jeder zweite Arzt vom Nutzen des PSA-Tests zur Früherkennung von Prostatakrebs überzeugt ist und davon, dass der Nutzen das Risiko überwiegt. Zugleich erklären jedoch drei von vier Befragungsteilnehmern, dass sie den Test den Älteren unter ihren Patienten empfehlen. Der Grund dafür ist nach Meinung der Forscher, deren Studie jetzt in der Zeitschrift "Journal of Evaluation in Clinical Practice" veröffentlicht wurde, nicht in finanziellen Anreizen zu sehen, sondern im Sicherheitsdenken der Ärzte. Solche Befürchtungen zukünftiger Klagen wegen eines Kunstfehlers, falls ein Patient später an Prostatakrebs erkrankt und der PSA-Test unterblieben ist, sind zwar extrem unwahrscheinlich, gleichwohl geben viele der Befragten an, sie würden den PSA-Test auch aus Gründen der juristischen Absicherung gegen spätere Klagen empfehlen.
Dass die Risiken des PSA-Tests aufgrund von Biopsien und Nebenwirkungen therapeutischer Eingriffe (wie Impotenz, Inkontinenz) den Nutzen überwiegen, haben erst vor kurzem wieder Studien gezeigt (vgl. Die Kernfrage ist nicht, ob das PSA-Screening effektiv ist, sondern ob es mehr nützt als schadet). Gleichwohl ist die Empfehlungsquote für die Durchführung des PSA-Tests in den USA extrem hoch. Im Deutschen Ärzteblatt heißt es: "Die meisten Männer lassen dort ab dem 50. Lebensjahr jährlich einen PSA-Test durchführen. Auch 95 Prozent der Urologen sowie 78 Prozent der Allgemeinärzte lassen sich selbst testen, was belegt, dass sie vom Nutzen überzeugt sind - im Gegensatz zu den Fachgesellschaften." (vgl.: Prostatakarzinom: Studien bestätigen Zweifel am PSA-Test) Allerdings könnte es auch sein, dass nicht nur die Überzeugung der US-Ärzte maßgeblich ist für die große Verbreitung dort, sondern auch die größere Rechtsunsicherheit der Ärzte.
Im Jahre 1999 war es, als der US-amerikanische Familien-Arzt Dr. Daniel Merenstein, der gerade eine längere Weiterbildung in Evidence-Based Medicine machte, einen 53jährigen gesunden Patienten in die Klinik bekam, der sich nach Prostatakrebs und dem PSA-Test erkundigte. Merenstein erzählte ihm, was er in der Fortbildung gelernt hatte: Dass die Risiken des Tests hoch seien, der Nutzen durch Früherkennung vergleichsweise gering. So kam es, dass der Test nicht durchgeführt wurde. Leider erkrankte der Patient einige Jahre später unheilbar an Prostatakrebs und verklagte seinen Arzt. Dieser wurde in einem Zivilprozess zwar freigesprochen, die Fortbildungseinrichtung jedoch zu Schadensersatz in Höhe von 1 Million Dollar verurteilt.
Gedanken an solche Folgen ärztlicher Unterlassungen spielen vermutlich bei vielen Medizinern in den USA eine große Rolle, wenn sie den PSA-Test empfehlen. Dass sie auch bei Schweizer oder deutschen Ärzten maßgeblich sein könnten, erscheint jedoch wenig plausibel. Denn der Test ist keineswegs in einem solchen Maße wissenschaftlich anerkannt, dass das Unterlassen der Durchführung (außer bei Verdachtsmomenten auf eine Prostata-Erkrankung) als "Kunstfehler" gelten könnte. Gleichwohl ist dies bei vielen Ärzten der Fall, wie einer Schweizer Studie jetzt gezeigt hat. Befragt wurden dort 245 Allgemeinärzte und Internisten, die an einer beruflichen Fortbildung in der deutschsprachigen Schweiz teilnahmen. Das Durchschnittsalter war 52 Jahre, drei Viertel waren männlich, 68% Allgemeinärzte, 32% Fachärzte für Innere Medizin. In der Befragung wurde deutlich:
• Nur 56% der Allgemeinärzte und 53% der Fachärzte für Innere Medizin waren der Meinung, der PSA-Test sei zur Früherkennung nützlich und sein Nutzen würde die Risiken übersteigen.
• Gleichwohl gaben in beiden Gruppen jeweils 75% an, sie würden den Test Männern ab 50 regelmäßig empfehlen.
• 41% der Allgemeinärzte und 43% der Internisten nannten als Grund dafür juristische Überlegungen.
Ein Abstract der Studie ist hier verfügbar: Johan Steurer u.a.: Legal concerns trigger prostate-specific antigen testing (Journal of Evaluation in Clinical Practice, Volume 15 Issue 2, Pages 390 - 392, Published Online: 19 Mar 2009)
Dass der PSA-Test in Deutschland zwar nicht so häufig wie in den USA eingesetzt wird, trotzdem aber für ältere Männer fast schon eine standardmäßig durchgeführte Früherkennungsuntersuchung ist, hat unlängst eine deutsche Studie gezeigt. Dort heißt es in der Zusammenfassung: "In der vorliegenden Analyse werden Einflussfaktoren auf die Inanspruchnahme der Prostatakarzinom-Früherkennung (Prostata-KFU) in Deutschland untersucht. Eine repräsentative Stichprobe von 10659 Männer im Alter von 45 - 70 Jahren (M = 55.2) wurde nach ihrer Prostata-KFU-Inanspruchnahme befragt. (...) Zwei Drittel der Stichprobe gibt an, mindestens ein Mal eine DRU erhalten zu haben, knapp die Hälfte der Männer (48 %) hat bereits einen PSA-Test durchführen lassen. Die Anzahl der Männer, die regelmäßig an einer Prostata-KFU teilnehmen, ist deutlich geringer (44 % DRU, 33 % PSA)." (DRU = digital rektale Untersuchung, ein Abtasten des hinteren Dickdarms und der angrenzenden Organemit dem Finger)
Quelle: M. Sieverding u.a.: Prostatakarzinomfrüherkennung in Deutschland. Untersuchung einer repräsentativen Bevölkerungsstichprobe, Der Urologe, Volume 47, Number 9 / September 2008
• Abstract
• PDF Volltext
Die Aufklärung von Patienten über Nutzen und Risiken des PSA-Tests war nach einem Experiment der Stiftung Warentest im Jahre 2003 überaus unbefriedigend. Von den 135 Berliner Urologen wurden 20 ausgewählt und im September und Oktober 2003 von einem 60-jährigen Probanden besucht, mit dem Wunsch, sich zum PSA-Test auf Prostatakrebs beraten zu lassen. Ergebnis: "Einige Urologen informierten den Patienten ausführlich und richtig über den PSA-Test. Doch die meisten Ärzte erläuterten die Problematik nur lückenhaft und einige sogar falsch. Kein einziger der besuchten Fachärzte sprach die in der wissenschaftlichen Leitlinie der urologischen Fachgesellschaften genannten Beratungsinhalte von sich aus an. Sie informierten nur ganz allgemein über den Eiweißstoff PSA, den Normalwert und den Sinn eines Tests. (…) Die getesteten Ärzte lassen sich grob in zwei Gruppen einteilen. Etwa ein Drittel der Urologen war mit "evidenzbasierter Medizin" vertraut - sie machten also die Ergebnisse wissenschaftlicher Studien zur Grundlage ihrer Beratung. Rund zwei Drittel von ihnen, die zweite Gruppe, hatte aber offenbar kein gesichertes Wissen über den Nutzen von Früherkennungsuntersuchungen. Ihren Äußerungen zufolge glaubten sie daran, dass eine früh erkannte Erkrankung grundsätzlich die Heilungschancen verbessere." Gesamt-Ergebnis: 2mal sehr gut, 4mal befriedigend, 7mal ausreichend, 7mal mangelhaft
Quelle: Früherkennung. Folge 1. Dilemma. Urologen im Test. Zeitschrift test, 2/2004, S. 86-89
• PDF zum kostenlosen Download
• WWW-Seite
Gerd Marstedt, 23.3.09
"Die Kernfrage ist nicht, ob das PSA-Screening effektiv ist, sondern ob es mehr nützt als schadet." - Neues und Widersprüchliches.
 Der Kommentar des Bostoner Arztes Michael J. Barry zu den zusammen gerade im angesehenen "New England Journal of Medicine (NEJM)" veröffentlichten Zwischenergebnissen zweier randomisierter kontrollierter Studien über den Nutzen der systematischen Bestimmung des PSA-Wertes (gemessen wird dabei ein prostataspezifisches Antigen) zur frühzeitigen Entdeckung von Prostatakrebs und der damit erhofften Senkung der spezifischen Sterberate, bringt das Dilemma und einen Teil der Lösung für die Leser beider Studien auf den Punkt: Die lange erwarteten Ergebnisse widersprechen sich diametral.
Der Kommentar des Bostoner Arztes Michael J. Barry zu den zusammen gerade im angesehenen "New England Journal of Medicine (NEJM)" veröffentlichten Zwischenergebnissen zweier randomisierter kontrollierter Studien über den Nutzen der systematischen Bestimmung des PSA-Wertes (gemessen wird dabei ein prostataspezifisches Antigen) zur frühzeitigen Entdeckung von Prostatakrebs und der damit erhofften Senkung der spezifischen Sterberate, bringt das Dilemma und einen Teil der Lösung für die Leser beider Studien auf den Punkt: Die lange erwarteten Ergebnisse widersprechen sich diametral.
In der Interventionsgruppe der zwischen 1993 und 2001 laufenden "U.S. Prostate, Lung, Colorectal, and Ovarian Cancer Screening Trial (PLCO)" mit 73.693 teilnehmenden Männern war die Prostatakrebs-Sterberate mit rund 2 Toten pro 10.000 Personenjahren insgesamt sehr niedrig. Vor allem aber unterschied sich die Sterberate der Screeningteilnehmer (n=38.343) nicht signifikant von der der Teilnehmer in der Kontrollgruppe (n=38.350). Unerwartet lag dann schließlich die Sterberate in der Interventionsgruppe mit 2 Toten über (!!) der von 1,7 Toten pro 10.00 Personenjahre (Rate 1,13) in der Kontrollgruppe, der Unterschied war aber nicht signifikant. Die Inzidenz von Prostatakrebs betrug in der Screeninggruppe 116 Erkrankte pro 10.000 Personenjahre und 95/10.0000 Personenjahre in der Kontrollgruppe (Rate=1,22). Der PSA-Test erhöht zwar die Anzahl der entdeckten Prostatakarzinome erhöht, erfüllt aber seinen insbesondere in Deutschland (interessanterweise beurteilen die us-amerikanischen Urologen das PSA-Screening viel zurückhaltender) propagierten Zweck, die Sterblichkeit zu senken, nicht.
Was die Ergebnisse etwas verwässert ist der Fakt, dass anders als in anderen klinischen Studien sich auch etwa die Hälfte der Kontrollgruppe ihren PSA-Wert bestimmen (Anstieg von 40 % auf 52 % im sechsten Studienjahr) und sich auch digital-rektal untersuchen (Anstieg von 41% auf 46 %) ließ. Trotzdem lag dieser Anteil in der Interventionsgruppe deutlich höher; nämlich bei 85 % für den PSA-Test und 86 % für die rektale Untersuchung. Dies Teilnehmer der Interventionsgruppe nahmen innerhalb der vergleichsweise langen Untersuchungsdauer von 7 bis 10 Jahren regelmäßig an einem PSA-Screening (jährlich über 6 Jahre) teil oder ließen eine digital-rektale Untersuchung (jährlich für vier Jahre) durchführen.
Die Ergebnisse der "European Randomized Study of Screening for Prostate Cancer (ERSPC)" unterscheiden sich inhaltlich beträchtlich von denen der US-Studie. Ihre 162.243 Teilnehmer zwischen 50 und 74 Jahren aus sieben europäischen Ländern (ohne deutsche Teilnehmer) wurden in der Interventionsgruppe alle vier Jahre PSA-gescreent. Letztendlich akzeptierten 82 % der Männer dieses Angebot. Die Teilnehmer der Kontrollgruppe nahmen keine Screeningleistung in Anspruch.
Die auch hier untersuchte Prostatakrebs-Sterberate sah deutlich anders aus als in den USA: Bei den Interventionsteilnehmern lag sie 20 % niedriger als bei den Kontrollgruppenteilnehmern (p = 0,04). Das Screening führt nach Meinung der Studienautoren dazu, dass nach 9 Jahren Laufdauer sieben Männer pro 10.000 Männer weniger starben als ohne PSA-Bestimmung mit anschließender Intervention. Um einen Todesfall zu verhindern, müssen mehr als 1.400 Männern ein PSA-Screening durchlaufen ("number to treat" oder "number to test"), und es müssen zusätzlich 48 Männer zum Teil aufwändig behandelt werden. Um den Nutzen erreichen zu können, muss man nach Meinung des bereits zitierten ärztlichen Kommentators also viel oder auch zu viel an Diagnostik und Therapie in Kauf nehmen. Dies bedeutet nicht nur einen finanziellen Mehraufwand, sondern birgt auch unterschiedliche Risiken in sich. Dies gilt etwa für die 17.000 Biopsien, die bei 73.000 Männern in der ERSPC-Studie gemacht wurden. Die WissenschaftlerInnen der europäischen Studie nennen selber im Abstract ihres Aufsatzes das Problem des "high risk of overdiagnosis" durch das PSA-Screening und mögliche Folgeaktivitäten.
Zumindest aktuell können keine offensichtlichen methodischen Schwächen einer der beiden Studien als Erklärung für ihren Kardinalunterschied und als Entscheidungsfaktor herangezogen werden.
Daraus folgt praktisch zweierlei:
• Der potenzielle Schaden durch zu umfassende und nicht notwendige Diagnostik oder Therapie muss gründlich gegen den Nutzen abgewogen werden.
• Zum anderen muss künftig aber noch mehr das berücksichtigt werden, was Barry für den Behandlungsalltag erneut nachdrücklich empfiehlt: "As a result, a shared decision-making approach to PSA screening, as recommended by most guidelines, seems more appropriate than ever." Dass dabei möglicherweise territoriale Präferenzen die entscheidende Rolle spielt ist unbefriedigend, aber immer noch besser als wenn behandelnde Urologen allein die europäischen Ergebnissen an ihre Patienten vermitteln würden.
Alle Beteiligten und Betroffenen bekommen aber evtl. durch zwei weitere, nicht abgeschlossene Studien, der "Prostate Cancer Intervention Versus Observation Trial (PIVOT)" in den USA und dem Projekt "Prostate Testing for Cancer and Treatment (PROTECT)" in Großbritannien einhelligere Entscheidungsdaten oder aber noch mehr Widersprüchliches. Die Diskussion um Sinn und Unsinn des PSA-Screenings bezogen auf die Sterblichkeit an Prostatakrebs dürfte deshalb noch einige Jahre anhalten.
Der Aufsatz "Mortality Results from a Randomized Prostate-Cancer Screening Trial" von Gerald L. Andriole und zahlreichen weiteren Mitgliedern des PLCO Projektteams ist im NEJM vom 18. März 2009 erschienen und als zehnseitige PDF-Datei kostenlos erhältlich.
Den Aufsatz "Screening and Prostate-Cancer Mortality in a Randomized European Study" von Fritz H. Schröder et al. erhältlich man ebenfalls komplett kostenlos.
Der Kommentar von Michael J. Barry "Screening for Prostate Cancer — The Controversy That Refuses to Die" in der Ausgabe des NEJM vom 18. März 2009 ist als vierseitige PDF-Datei komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 21.3.09
US-Experten: Wenig bis keine Evidenz des Nutzens von Hautkrebs-Screening oder ärztlicher Beratung über Hautkrebsprävention
 Auch wenn der Februar klimatisch nicht der ideale Zeitpunkt ist, über den Nutzen des Hautscreenings gegen Hautkrebserkrankungen aufgrund ungeschützter Exposition gegenüber Sonnenstrahlung zu reden, gibt es dazu Nachdenkenswertes aus den USA.
Auch wenn der Februar klimatisch nicht der ideale Zeitpunkt ist, über den Nutzen des Hautscreenings gegen Hautkrebserkrankungen aufgrund ungeschützter Exposition gegenüber Sonnenstrahlung zu reden, gibt es dazu Nachdenkenswertes aus den USA.
Dort gehören die verschiedenen Hautkrebsarten, unterteilt in weißen Hautkrebs (Basalzellenkrebs, Basaliom) und schwarzen Hautkrebs (malignes Melanom), zu den am häufigsten diagnostizierten Krebsarten überhaupt - mit steigender Inzidenz in den letzten 3 Jahrzehnten. In Deutschland erkranken jährlich ca. 118.000 Menschen neu an weißem Hautkrebs. An schwarzem Hautkrebs erkranken hierzulande jährlich ca. 22.000 Menschen; etwa 3.000 sterben pro Jahr an dem malignen Melanom.
Was liegt also näher als die Forderung, alles präventiv Mögliche und Sinnvolle zu tun, um die Entstehung von Hautkrebs über Hautschädigungen zu verhindern und außerdem durch ein Screening möglichst alle Hautkrebserkrankungen so früh wie möglich entdecken und behandeln zu können.
Die neuesten dazu in den USA durchgeführten und im Februar 2009 veröffentlichten systematischen Analysen von RCT-Studien verbreiten allerdings erheblich Skepsis gegen die weltweit von Hautärzten und Krankenversicherungen empfohlenen und angebotenen Screeninguntersuchungen.
War die aus derartigen Untersuchungen zu gewinnende Evidenz des Nutzens von Screenings etc. schon bisher nicht groß, fanden die US-ForscherInnen auch aktuell und immer noch "no new evidence from controlled studies ... that addressed the benefit of screening for skin cancer with a whole body examination." Aber nicht nur hierzu mangelt es an gesichertem Wissen, sondern auch am Wissen über die Sorgfältigkeit des von Ärzten bisher durchgeführten Screenings bei wirklichen Patienten mit der Vielfalt von Hautbeschädigungen, die jeder Mensch aufweist. All dies zusammen verhindert "an accurate estimation of the benefits of screening for skin cancer in the general primary care population."
In dem in den "Annals of Internal Medicine" vom 3. Februar 2009 veröffentlichten Aufsatz "Screening for Skin Cancer. U.S. Preventive Services Task Force Recommendation Statement" kommen Wissenschaftler der U.S. Preventive Services Task Force nach Sichtung der Ergebnisse aller zum Thema in englischer Sprache seit 2001 erschienenen Studien auf 7 Seiten dann zu folgendem Schluss: "The USPSTF concludes that the current evidence is insufficient to assess the balance of benefits and harms of screening for skin cancer by primary care clinicians or by patient skin self-examination."
Die U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF) ist die öffentliche wissenschaftliche Einrichtung, die in den USA u.a. Empfehlungen zu präventiven Dienstleistungen für Patienten ohne erkennbare Anzeichen für die Ziel-Erkrankung gibt. Auch wenn sie es der Politik und den Ärzten überlässt, ihre Erkenntnisse zu individualisieren, plädiert sie im aktuellen "Clinical Summary of U.S. Preventive Services Task Force Recommendation" zum Thema "Screening for Skin Cancer" für die allgemeine erwachsene Bevölkerung eindeutig so: "No recommendation due to insufficient evidence".
Abgerundet wird das skeptische Bild noch durch die Ergebnisse einer weiteren Analyse der U.S. Preventive Services Task Force zu der Wirksamkeit oder dem Nutzen einer primärärztlichen Beratung von asymptomatischen Patienten zur Prävention gegenüber unerwünschten Folgen von zu üppiger Sonnenbestrahlung.
Die entsprechende Veröffentlichung "Counseling to Prevent Skin Cancer. Recommendations and Rationale" findet lediglich "insufficient evidence to determine whether clinician counseling is effective in changing patient behaviors to reduce skin cancer risk. Counseling parents may increase the use of sunscreen for children, but there is little evidence to determine the effects of counseling on other preventive behaviors (such as wearing protective clothing, reducing excessive sun exposure, avoiding sun lamps/tanning beds, or practicing skin self-examination) and little evidence on potential harms."
Dabei stellen die US-WissenschaftlerInnen fast nebenbei fest, dass es für die präventiven Mittel und Strategien zur Verhinderung einer schädigenden Exposition gegenüber Sonnenstrahlung, also das Tragen von Schutzkleidung oder die regelmäßige Benutzung von Sonnenschirmen sowie die Nichtnutzung von Sonnenlampen oder bestimmten Bräunungstechniken und den Nutzen regelmäßiger Selbstuntersuchungen nur "little direct evidence" gibt, wenn es um den Zusammenhang der Interventionen mit der Hautkrebsmorbidität und -mortalität geht.
Dies lässt sie entgegen den geballten, aber nicht explizit wissenschaftlich belegten Empfehlungen zahlreicher us-amerikanischer medizinischer Fachgesellschaften (American Cancer Society, American Academy of Dermatology, American Academy of Pediatrics, American College of Obstetricians and Gynecologists, National Institutes of Health consensus panel und American Academy of Family Physicians) zu dem Schluss kommen, dass "the evidence is insufficient to recommend for or against routine counseling by primary care clinicians to prevent skin cancer" und bei dieser Gelegenheit all die bereits genannten Schutzmaßnahmen mit ungesichertem Nutzen empfehlen zu lassen.
Die Verwirrung über die aktuellen Veröffentlichungen ist gegenwärtig bei den praktisch tätigen Ärzten in den USA groß. Sie haben natürlich recht, dass eine längere ungeschützte Einstrahlung des Sonnenlichts insbesondere weißhäutigen Personen nicht gut bekommt und daher möglichst vermieden werden sollte. Trotzdem darf damit nicht die Erwartung verknüpft werden, ein geringeres Hautkrebs-Risiko zu haben. Die Beobachtung, dass man sich unter Sonnenschirmen letztlich zu lange gegenüber indirekter Bestrahlung exponiert ist und dies auch zu Hautschäden und möglicherweise Krebs führen kann, ist beachtenswert.
Egal, ob man zu den präventiven Mitteln greift oder nicht, scheint aber gegenüber einem Ganzkörper-Screening zu Hautkrebsanfängen nicht nur eine geringe Erwartung, sondern auch aktive Zurückhaltung angebracht zu sein. So gibt es offensichtlich eine hohe Anzahl falsch-positiver Funde von bösartigen Melanomen, die eine Reihe nicht harmloser Folgeuntersuchungen und evtl. auch nicht notwendige Operationen und Behandlungen nach sich ziehen.
Nachdenklich sollten diese Ergebnisse und Schlussfolgerungen aber auch die im GKV-System machen, die nach einem Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses vom November 2007 am 1. Juli 2008 für jeden symptomfreien Versicherten über 35 Jahren im Zwei-Jahresabstand die Ganzkörper-Hautuntersuchung in den Leistungskatalog der GKV aufgenommen haben.
Das 17 Seiten umfassende Arbeitspapier "Screening for Skin Cancer: An Update of the Evidence for the U.S. Preventive Services Task Force" von Wolff T, Tai E und Miller T. (Evidence Synthesis No. 67. AHRQ Publication No. 09-05128-EF-1. Rockville, Maryland: Agency for Healthcare Research and Quality. February 2009) ist komplett kostenlos erhältlich.
Dies gilt auch für den Aufsatz "Screening for Skin Cancer. U.S. Preventive Services Task Force Recommendation Statement" der U.S. Preventive Services Task Force in der Fachzeitschrift "Annals of Internal Medicine" (Ann Intern Med. 2009;150:188-193).
In derselben Ausgabe der "Annals of Internal Medicine" veröffentlichen Tracy Wolff, MD, MPH; Eric Tai, MD, MS; and Therese Miller auch den im Kern mit ihrem Paper identischen Aufsatz "Screening for Skin Cancer: An Update of the Evidence for the U.S. Preventive Services Task Force" (Ann Intern Med. 2009;150: 194-198).
Die klinische Empfehlung der USPSTF zum Hautkrebssreening für Erwachsene ist auch kostenlos erhältlich.
Die Ausführungen der USPSTF über "Counseling to Prevent Skin Cancer Recommendations and Rationale" sind uneingeschränkt und kostenlos zugänglich.
Bernard Braun, 18.2.09
Übergewicht und Adipositas wird auch bei Kindern und Jugendlichen von US-Ärzten viel zu oft übersehen
 Erst vor kurzem hatte eine Studie der renommierten US-amerikanischen Mayo-Klinik festgestellt, dass Übergewicht und Adipositas von Ärzten viel zu selten als Erkrankung diagnostiziert und den Patienten auch als solche mitgeteilt wird. Innerhalb der Gruppe mit Adipositas (also einem Body Mass Index von 30 und mehr) wurde jedoch nur bei jedem Fünften (20%) auch eine entsprechende Diagnose im Protokoll festgehalten und genau so selten (23%) fand man in den Behandlungsunterlagen Hinweise darauf, dass ein Therapieplan aufgestellt worden war. Basis der Studie waren Daten von knapp 10.000 Patienten, die bei 101 Ärzten in einer auf Übergewicht spezialisierten Mayo-Klinik zur Untersuchung waren. (vgl. Übergewicht: Eine bedeutsame Veränderungsbarriere ist auch die mangelhafte Diagnose und Therapieberatung durch Ärzte)
Erst vor kurzem hatte eine Studie der renommierten US-amerikanischen Mayo-Klinik festgestellt, dass Übergewicht und Adipositas von Ärzten viel zu selten als Erkrankung diagnostiziert und den Patienten auch als solche mitgeteilt wird. Innerhalb der Gruppe mit Adipositas (also einem Body Mass Index von 30 und mehr) wurde jedoch nur bei jedem Fünften (20%) auch eine entsprechende Diagnose im Protokoll festgehalten und genau so selten (23%) fand man in den Behandlungsunterlagen Hinweise darauf, dass ein Therapieplan aufgestellt worden war. Basis der Studie waren Daten von knapp 10.000 Patienten, die bei 101 Ärzten in einer auf Übergewicht spezialisierten Mayo-Klinik zur Untersuchung waren. (vgl. Übergewicht: Eine bedeutsame Veränderungsbarriere ist auch die mangelhafte Diagnose und Therapieberatung durch Ärzte)
Eine jetzt in der Zeitschrift "Pediatrics" veröffentlichte Studie hat nun gezeigt, dass Ärzte auch bei Kindern und Jugendlichen viel zu selten eine Diagnose stellen, die den Betroffenen Übergewicht oder Adipositas als gesundheitliches Problem verdeutlicht. Dies ist umso überraschender, als die "Übergewichts-Epidemie" bei Kindern und Jugendlichen im United Kingdom und ebenso in den USA in den letzten Jahren immer wieder in den Medien auftauchte und mit Horror-Szenarien hinsichtlich der zukünftigen gesundheitsökonomischen Folgen ausgemalt wurde.
Basis der jetzt veröffentlichten Studie waren Daten von über 60.000 Kindern und Jugendlichen im Alter von 2 bis 18 Jahren. Alle waren Mitglieder bei "MetroHealth", einer Krankenversicherung in Ohio mit überwiegend akademischen Mitgliedern. Berücksichtigt wurden dabei Daten, die Ärzte bei sogenannten "well-child visits" (vergleichbar den deutschen Vorsorge-Untersuchungen) erhoben hatten. Hier wurde dann von den Forschern einerseits anhand von Körpergröße und Gewicht der jeweilige Body-Mass-Index errechnet und andererseits in den Krankenakten überprüft, ob gegebenenfalls auch eine entsprechende Diagnose (Übergewicht, Adipositas, schwere Adipositas) vom Arzt eingetragen worden war.
Hierbei zeigte sich dann:
• 19% der Kinder und Jugendlichen hatten Übergewicht, 23% Adipositas, 8% schwere Adipositas. Insgesamt waren also 50% der Untersuchungsteilnehmer oberhalb der empfohlenen Norm zum Körpergewicht.
• Hinsichtlich ärztlicher Diagnosen wurde dann deutlich, dass Ärzte bei einem ganz erheblichen Teil der Kinder und Jugendlichen keine entsprechende Diagnose festgehalten hatten. So wurden Gewichtsprobleme nur bei 76% der schwer Adipösen, 54% der Adipösen und 10% der Übergewichtigen aktenkundig.
Problematisch erscheint dies den Wissenschaftlern, weil erst eine zutreffende Diagnose und ihre Dokumentation den Weg für weitere therapeutische Maßnahmen, welcher Art auch immer, eröffnet und ohne eine Diagnose das Problem für die Betroffenen unter den Tisch gekehrt oder zumindest bagatellisiert wird. Allerdings erscheint ihnen die Vorgehensweise der Ärzte aus mehreren Gründen nachvollziehbar, denn erst 2004 wurde der Satz "Übergewicht an sich ist noch keine Krankheit" aus den Regularien der Medicare-Krankenversicherung gestrichen. Erst danach gab es dann für Ärzte auch Möglichkeiten der finanziellen Vergütung, wenn sie sich um das BMI-Problem von Patienten kümmerten. Darüber hinaus besteht bei vielen Ärzten nach wie vor die Sichtweise, dass die Übergewichts-Problematik medizinisch nur sehr schwer beherrschbar ist und dass es andere Merkmale gibt (Rauchen, Alkohol- und Drogenmissbrauch), die gesundheitlich ebenso problematisch sind, aber von Ärzten mit mehr Erfolg angesprochen werden können.
Hier ist nicht nur das Abstract von Lacey Benson u.a.: Trends in the Diagnosis of Overweight and Obesity in Children and Adolescents: 1999-2007, sondern auch der gesamte Artikel aus PEDIATRICS Vol. 123 No. 1 January 2009, pp. e153-e158, doi:10.1542/peds.2008-1408 herunterladen.
Gerd Marstedt, 31.12.08
Solide Basis für Beratung über Gebärmutterhalskrebs-Früherkennung
 Seit gut 35 Jahren wird der Pap-Test zur Früherkennung und Vorsorge des Gebärmutterhalstumors propagiert und jährlich ab einem Alter von 20 Jahren als Kassenleistung angeboten. Diese Untersuchung ist so vollständig in den Kanon der Gesundheitspflege eingegangen, dass viele Frauen den jährlichen Gang zu "ihrer Ärztin" als Pflicht begreifen und umgekehrt viele Ärztinnen und Ärzte die Erfüllung dieser - zumindest moralischen - Pflicht einfordern. Eine Beratung fand vermutlich nicht statt.
Seit gut 35 Jahren wird der Pap-Test zur Früherkennung und Vorsorge des Gebärmutterhalstumors propagiert und jährlich ab einem Alter von 20 Jahren als Kassenleistung angeboten. Diese Untersuchung ist so vollständig in den Kanon der Gesundheitspflege eingegangen, dass viele Frauen den jährlichen Gang zu "ihrer Ärztin" als Pflicht begreifen und umgekehrt viele Ärztinnen und Ärzte die Erfüllung dieser - zumindest moralischen - Pflicht einfordern. Eine Beratung fand vermutlich nicht statt.
Wie wichtig eine Beratung aber ist, zeigt eine eben erschienene Broschüre des Nationalen Netzwerks Frauen und Gesundheit. Konzeptioniert, geschrieben und organisiert hat die Broschüre die Medizinjournalistin Dr. Eva Schindele, beraten wurde sie dabei von Prof. Dr. med. Ingrid Mühlhauser und finanziert wurde die Arbeit von zwei Krankenkassen, der TK und der Barmer, die die Broschüre auch vertreiben. Auf 27 Seiten werden technische, organisatorische, medizinische und menschliche Aspekte der Früherkennung mittels Pap-Test sowie der HPV-Impfung beleuchtet. Betroffene Frauen sowie Expertinnen und Experten kommen zu Wort, Studiendaten und Quellen werden zitiert, Übersichtsgrafiken und ein Glossar runden die Broschüre ab. Fachlich auf höchstem Niveau bietet die Broschüre umfassende und - bis auf die etwas einseitig negativ gefärbten Stellungnahmen betroffener Frauen - auch ausgewogene Informationen. So wird anschaulich geschildert, wie viele Frauen im Zuge der Früherkennung behandelt werden ohne einen Nutzen davon zu haben, und welche Konsequenzen sie dabei in Kauf nehmen müssen.
Wer die Broschüre als zwar ambitioniertes, aber letztlich peripheres Engagement abtun möchte, kommt nicht weit. Denn auch von offizieller Seite tut sich etwas. Im August 2008 verabschiedete der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) ein Merkblatt, das die wesentlichen Informationen über die Früherkennung des Gebärmutterhalstumors enthält, inklusive einer Auflistung möglicher Vor- und Nachteile (siehe Forum Gesundheitspolitik). Das Merkblatt war notwendig geworden, weil bereits seit 1.April 2008 eine Beratung Pflicht ist, die sich auf das Merkblatt stützen soll. Die Beratungspflicht sieht vor, dass sich momentan 20-jährige Frauen über die Gebärmutterhalskrebs-Früherkennung informieren lassen oder falls sie es nicht tun, im späteren Krankheitsfall zwei statt nur ein Prozent ihres Einkommens zur Behandlung dazubezahlen müssen.
Bevor das Merkblatt jedoch amtlich werden kann, muss es vom Bundesministerium für Gesundheit (BMG) genehmigt werden. Laut BMG wurde das Merkblatt am 9.10.2008 ohne Beanstandung, aber mit einem kleinen Änderungswunsch an den G-BA zurück geschickt. Der weitere Ablauf sieht nun vor, dass vermutlich bis Ende November 2008 das Merkblatt ohne Änderung in Kraft tritt. Die Änderungen werden dann frühestens auf der nächsten entsprechenden Sitzung des G-BA im Januar 2009 verhandelt. Bis das Merkblatt samt Änderung dann gedruckt vorliegt und den Frauen ausgehändigt werden kann, werden laut G-BA weitere Monate vergehen, so dass nicht vor April 2009 mit den gedruckten Exemplaren zu rechnen ist - mittlerweile ein Jahr nach in Kraft treten der Beratungspflicht.
Broschüre und Merkblatt sollten von den Frauen und von den Ärztinnen und Ärzten als Chance begriffen werden, mit den auch von der Ärzteschaft erhobenen Forderungen nach ausgewogener Patienteninformation ernst zu machen. Wer diese Chance nicht ergreift, ist schlecht beraten - und er wird schlecht beraten.
Christian Weymayr, 12.11.08
Mammographie-Broschüre bemüht sich um ausgewogene Information
 Seit einigen Monaten ist in ganz Deutschland das Mammographie-Programm zur Früherkennung von Brustkrebs nach den EU-Richtlinien etabliert. Heute kam eine Programm-begleitende Mammographie-Broschüre heraus. Bemerkenswert ist, dass es diese Broschüre ernst meint mit dem Begriff "informieren" - im Sinne von neutral informieren und nicht im Sinne von einseitig beeinflussen.
Seit einigen Monaten ist in ganz Deutschland das Mammographie-Programm zur Früherkennung von Brustkrebs nach den EU-Richtlinien etabliert. Heute kam eine Programm-begleitende Mammographie-Broschüre heraus. Bemerkenswert ist, dass es diese Broschüre ernst meint mit dem Begriff "informieren" - im Sinne von neutral informieren und nicht im Sinne von einseitig beeinflussen.
Sie ist damit zwar nicht die erste, die wirklich informieren möchte, denn es gibt bereits seit Jahren die von der Techniker Krankenkasse unterstützte Broschüre des Nationalen Netzwerks Frauen und Gesundheit von Eva Schindele, die sich wohltuend von den üblichen Awareness- und Motivationsbroschüren abhebt, indem sie Frauen nicht zu überreden versucht, das Untersuchungsangebot anzunehmen. Doch die neue, 24-Seiten starke Broschüre im DIN A 5-Format ist die erste informative Broschüre, die von zwei unmittelbar am Screening beteiligten Organisationen herausgegeben wird: von der Kooperationsgemeinschaft Mammographie, die das Programm in Deutschland organisiert und die deshalb ein existenzielles Interesse daran haben müsste, die Werbetrommel zu rühren, sowie vom Krebsinformationsdienst am Deutschen Krebsforschungszentrum.
Trotz der Interessenskonflikte merkt man der Broschüre an, dass es den beiden Organisationen ein Anliegen war, die EU-Vorgaben für eine angemessene Patienteninformation nicht nur gutzuheißen, sondern sie auch umzusetzen: verständlich und sauber zu formulieren, Für und Wider ungeschönt darzulegen und keine Zwischen-den-Zeilen-Botschaften zu lancieren. Wie ernst es den beiden Herausgebern war, kann man auch daran ablesen, dass mit mir (Christian Weymayr, Autor von Mythos Krebsvorsorge), ein Vorsorge-skeptischer Journalist mit ins Redaktionsteam geholt wurde.
Die Broschüre ist in vier Kapitel untergliedert: Worum geht es? Was ist Brustkrebs? Wie läuft das Screening ab? Welche Vor- und Nachteile gibt es? Ein Glossar rundet das Heft ab. Jedes Kapitel besteht aus einer Seite mit "Kernpunkten" und zwei bis vier Seiten "zur Vertiefung", in denen einzelne Aspekte ausführlicher dargelegt werden. Ein Schaubild verdeutlicht den Ablauf des Screenens.
Im Kapitel über die Vor- und Nachteile werden Zahlen genannt, die Leserinnen verdeutlichen sollen, was Sie vermutlich zu erwarten hätten: von 200 Frauen, die sich 20 Jahre lang jedes 2. Jahr im Rahmen des Programms untersuchen lassen, wird 60 Frauen ein auffälliger Befund mitgeteilt, werden 20 Befunde mit einer Gewebeentnahme abgeklärt, erhalten 10 Frauen die Diagnose Brustkrebs, von denen 1 Diagnose ohne Mammographie nicht gestellt worden wäre (Überdiagnosen), erhalten 3 weitere Frauen zwischen zwei Untersuchungen die Diagnose Brustkrebs (Intervallkarzinome), sterben 3 Frauen an Brustkrebs und wird 1 Frau vor dem Tod durch Brustkrebs bewahrt.
Hier finden Sie die Mammographie-Broschüre
Christian Weymayr, 29.10.08
Aktuelle Informationen zum Thema "Krebsfrüherkennung" per Email
 Bis zum letzten Jahr gab der Wissenschaftsjournalist Christian Weymayr den Newsletter "Krebsvorsorge aktuell" heraus, in dem eine Vielzahl aktueller Nachrichten, Zusammenfassungen wissenschaftlicher Studien und gesundheitspolitischer Informationen zum Thema Früherkennung zu finden waren. Der Newsletter wurde zwar eingestellt, für Interessierte gibt es jetzt jedoch einen unregelmäßig erscheinenden "Rundbrief Krebsvorsorge". Themen in diesem seit März 2008 versendeten Rundbrief waren unter anderem das Mammographie-Screening, das Hautkrebs-Screening als GKV-Leistung, der "Nationale Krebsplan" des Bundesgesundheitsministeriums oder Medienberichte über steigende Krebszahlen.
Bis zum letzten Jahr gab der Wissenschaftsjournalist Christian Weymayr den Newsletter "Krebsvorsorge aktuell" heraus, in dem eine Vielzahl aktueller Nachrichten, Zusammenfassungen wissenschaftlicher Studien und gesundheitspolitischer Informationen zum Thema Früherkennung zu finden waren. Der Newsletter wurde zwar eingestellt, für Interessierte gibt es jetzt jedoch einen unregelmäßig erscheinenden "Rundbrief Krebsvorsorge". Themen in diesem seit März 2008 versendeten Rundbrief waren unter anderem das Mammographie-Screening, das Hautkrebs-Screening als GKV-Leistung, der "Nationale Krebsplan" des Bundesgesundheitsministeriums oder Medienberichte über steigende Krebszahlen.
Wer an diesen Rundbriefen interessiert ist, findet auf dieser Seite eine Bezugsmöglichkeit: Rundbriefe Krebsvorsorge
Alle früher erschienenen Newsletter "Krebsvorsorge aktuell" von 2003 bis Ende 2007 mit einer Vielzahl immer noch aktueller und relevanter wissenschaftlicher Forschungsergebnisse sind hier verfügbar (PDF, 87 Seiten): Newsletter "Krebsvorsorge aktuell" 2003-2007
Eine große Zahl von Artikeln zur Krebsvorsorge kann man auch auf der Website von Christian Weymayr kostenlos als PDF-Datei herunterladen, unter anderem:
• Krebs-Impfung: Hoffnung oder Horror? Artikel über die HPV-Impfung, Bild der Wissenschaft, Juni 2008
• Kritik der Krebsfrüherkennung (mit Klaus Koch), Review über Arbeiten zum Thema Überdiagnosen, Der Onkologe, Feburar 2008
• Gib Krebs keine Chance, Kommentar zur HPV-Impfung, Laborjournal, November 2007
• "Es gibt enormen Druck, sich impfen zu lassen", Interview mit Dr. Claudia Schuhmann über die HPV-Impfung, Laborjournal, November 2007
Christian Weymayr, geboren 1961, ist promovierter Biologe und arbeitet als Wissenschaftsjournalist mit dem Schwerpunkt Medizin. Er schreibt u. a. für DIE ZEIT. 2003 erschien von ihm das gemeinsam mit Klaus Koch verfasste Buch "Mythos Krebsvorsorge". Dort heißt es im Klappentext: "Wer verantwortungsbewusst ist, geht zur Krebsvorsorge. Je früher und regelmäßiger wir uns Mammographie und Darmspiegelung unterziehen, desto besser für unsere Gesundheit. Aber ist das tatsächlich so? Nein, sagen die renommierten Wissenschaftsjournalisten Christian Weymayr und Klaus Koch. Der uneingeschränkte Nutzen der Krebsvorsorge ist ein von Interessenverbänden, Politikern und Medizinern gepflegter Mythos. Viele Verfahren der Früherkennung sind fehlerhaft, die Folgen aus Fehldiagnosen und vorschnell ausgeführten Operationen gravierend. Dieses informative und allgemein verständliche Handbuch sagt Ihnen, was Sie über Früherkennungsmethoden wissen müssen, und liefert wichtige Argumente für eine eigenverantwortliche Abwägung von Chancen und Risiken der Krebsvorsorge."
Gerd Marstedt, 6.9.2008
Ausgewogene Informationen: Gemeinsamer Bundesausschuss verabschiedet Merkblatt zur Früherkennung auf Gebärmutterhalskrebs
 Seit 1. April dieses Jahres müssen sich Frauen ab einem Alter von 20 Jahren über die Früherkennung von Gebärmutterhalskrebs bei ihrem Frauenarzt beraten lassen.
Seit 1. April dieses Jahres müssen sich Frauen ab einem Alter von 20 Jahren über die Früherkennung von Gebärmutterhalskrebs bei ihrem Frauenarzt beraten lassen.
Mit der zum 1.4.2007 in Kraft getretenen Gesundheitsreform ("Wettbewerbsstärkungsgesetz") war ursprünglich die Pflicht der Versicherten zur Inanspruchnahme bestimmter Krebsfrüherkennungsuntersuchungen festgeschrieben worden unter Androhung finanzieller Nachteile im Falle des Auftretens der entsprechenden Krebserkrankung bei Nichtbefolgung (§ 62 Sozialgesetzbuch 5).
Derzeit gilt dies für die Mammografie zur Früherkennung von Brustkrebs (für Frauen zwischen 50 und 69 Jahren), den Stuhlbluttest (ab 50 Jahren) und die Darmspiegelung (ab 55 Jahren) zur Früherkennung von Darmkrebs sowie bei Frauen ab 20 Jahren für den Pap-Test zur Früherkennung des Gebärmutterhalskrebses.
Der Gemeinsame Bundesausschuss hat diese Regelung mit der sog. Chroniker-Richtlinie entschärft. Darin wurde festgelegt, dass die Inanspruchnahme einer Beratung über die Chancen und Risiken der jeweiligen Untersuchung ausreicht, um den finanziellen Nachteilen zu entgehen - unabhängig davon, ob sich der Patient für oder gegen die Untersuchung entscheidet.
Ein Merkblatt zur Einladung der Frau zum Mammographie-Screening hat der Gemeinsame Bundesausschuss im Juni 2007 vorgelegt.
Am 21. August hat der Gemeinsame Bundesausschuss ein Merkblatt zur Früherkennung auf Gebärmutterhalskrebs beschlossen, das - vorbehaltlich der Genehmigung des Gesundheitsministeriums - die verbindliche Grundlage einer bundeseinheitlichen Beratung von Frauen über die Vorteile der Inanspruchnahme dieser Früherkennungsuntersuchung bildet.
Dieses Merkblatt ist bemerkenswert, weil es - im Gegensatz zum Merkblatt zum Mammographie-Screening - die Frauen konkret und ergebnisoffen informiert. Im Merkblatt zum Mammographie-Screening wurde der Eindruck erweckt, als gäbe es nur eine vertretbare Entscheidung, nämlich die zustimmende. In Anbetracht des sehr engen Nutzen-Schaden-Verhältnisses kommt dies der Entmündigung der Frauen gleich und ist mit den Prinzipien der partizipativen Entscheidungsfindung (Shared Decision-Making) auf keine Weise vereinbar.
Ganz anders der Tenor im Merkblatt zur Früherkennung auf Gebärmutterhalskrebs. Bereits in der Einleitung heißt es: "Ob Sie die Untersuchung tatsächlich machen lassen, ist Ihre persönliche Entscheidung und hat keinen Einfluss auf die spätere Zuzahlung. Die folgenden Informationen sollen es Ihnen leichter machen, sich für oder gegen die Untersuchung zu entscheiden." Im Mammographie-Merkblatt wird die das Erkrankungsrisiko für die gesamte Lebenszeit in Prozent angegeben, ohne das für die Zielgruppe der 50-69-jährigen Frauen bereits deutlich geminderte verbleibende Risiko zu nennen - das Sterberisiko, um dessen Senkung es in erster Linie geht, wird überhaupt nicht erwähnt.
Im Gebärmutterhalskrebs-Merkblatt werden dagegen konkrete Zahlen genannt: "In Deutschland wird jedes Jahr bei 15 von 100.000 Frauen ein Gebärmutterhalskrebs entdeckt, das sind insgesamt 6200 Frauen. 4 von 100.000 Frauen sterben jährlich an diesem Tumor, das sind insgesamt 1700." Unerwähnt bleibt allerdings, wie vielen Frauen der Tod an Gebärmutterhalskrebs durch die Früherkennung erspart bleibt - Grund dafür ist das Fehlen verlässlicher Zahlen. Die Rate an positiven Untersuchungsergebnissen wird mit Zahlen benannt ("drei bis vier von 100 Untersuchungen"). Abschließend werden die Risiken und Nebenwirkungen sowie die Argumente für die Früherkennung benannt als Grundlage für einen individuellen Abwägungsprozess.
Merkblatt Zervixkarzinomfrüherkennung
(Muster-)Merkblatt zur Einladung der Frau zum Mammographie-Screening
Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Umsetzung der Regelungen in § 62 für schwerwiegend chronisch Erkrankte - "Chroniker-Richtlinie"
David Klemperer, 4.9.2008
Das Abtasten der Brust zur Krebsfrüherkennung senkt die Mortalität nicht. Cochrane-Studie sagt: "Nicht zu empfehlen"
 Noch heute wird das Abtasten der eigenen Brust durch Frauen oder auch das Abtasten durch Ärzte als sinnvolle und effektive Methode zur Früherkennung von Brustkrebs empfohlen. So erläuterte BILD noch in diesem Jahr Millionen Lesern, "Wie Sie Ihre Brust richtig abtasten" und behauptete: "So werden bereits heute 90 Prozent aller Brustkrebserkrankungen durch eigenes Abtasten erkannt." Aber auch eine Vielzahl von Krankenkassen und Verbänden empfiehlt die Abtast-Methode, wie eine Google-Suche schnell verdeutlicht.
Noch heute wird das Abtasten der eigenen Brust durch Frauen oder auch das Abtasten durch Ärzte als sinnvolle und effektive Methode zur Früherkennung von Brustkrebs empfohlen. So erläuterte BILD noch in diesem Jahr Millionen Lesern, "Wie Sie Ihre Brust richtig abtasten" und behauptete: "So werden bereits heute 90 Prozent aller Brustkrebserkrankungen durch eigenes Abtasten erkannt." Aber auch eine Vielzahl von Krankenkassen und Verbänden empfiehlt die Abtast-Methode, wie eine Google-Suche schnell verdeutlicht.
Bereits im Jahr 2003 hatte eine Cochrane-Studie darauf hingewiesen, dass vorliegende Studienergebnisse mit sehr großen Stichproben unzweideutig belegen , dass das Abtasten keine sinnvolle Methode der Früherkennung ist, da es zwar mehr Verdachtsmomente auf Tumore erzeugt und entsprechend mehr Biopsien, also eine Entnahme von Gewebeproben, die gesundheitlich nicht völlig unproblematisch ist und überdies Ängste hervorruft. Eine reduzierte Sterblichkeitsquote durch Brustkrebs wird dadurch jedoch nicht erzielt. Die Cochrane-Studie von Kösters & Gøtzsche wurde jetzt noch einmal aktualisiert, d.h. es wurde geprüft, ob neuere Studien und Erkenntnisse vorliegen. Das Fazit der Autoren blieb jedoch dasselbe: Das Abtasten der Brust, ganz gleich, ob es von den Frauen selbst oder von Medizinern durchgeführt wird, ist zur Brustkrebs-Früherkennung nicht empfehlenswert.
Basis der Cochrane-Studie waren bereits im Jahr 2003 zwei große Bevölkerungsstudien mit rund 390.000 Frauen aus Russland und Shanghai, in der zwei Gruppen verglichen wurden, eine mit Abtasten der eigenen Brust, eine andere ohne solche Maßnahme. Die Sterblichkeit infolge von Brustkrebs zeigte in beiden Gruppen keinerlei statistisch signifikanten Unterschied (RR: 1.05). In der russischen Studie wurden sogar mehr Krebsfälle in der Interventionsgruppe mit Selbstabtasten gefunden als in der Gruppe ohne Körperbeobachtung. In den Abtastgruppen in Russland und Shanghai wurden etwa doppelt so viele Biopsien mit negativem Befund durchgeführt, in denen also lediglich gutartige Wucherungen gefunden wurden (3406 vs. 1856).
In die Cochrane-Studie einbezogen wurde auch noch eine zweite große Studie, an der anfänglich über 400.000 Frauen auf den Philippinen teilnahmen. Hier sollte geprüft werden, ob ein Abtasten der Brust durch Ärzte effektiver ist als das Selbst-Abtasten. Die Abbruchquote der Teilnehmerinnen war jedoch so hoch, dass ein Fazit aus dieser Untersuchung nicht möglich ist.
Die Wissenschaftler heben hervor, dass zwei andere Meta-Analysen zu denselben Ergebnissen wie sie selbst gekommen sind. Auch diese beiden Studien
• Nancy Baxter, the Canadian Task Force on Preventive Health care. Preventive health care, 2001 update: Should women be routinely taught breast self-examination to screen for breast cancer? (CMAJ 2001;164(13):1837-46) PDF-Nachdruck des Artikels
• Hackshaw AK, Paul EA. Breast self-examination and death from breast cancer: a meta-analysis (British Journal of Cancer 2003;88(7): 1047-53) Abstract des Artikels
heben hervor, dass das Abtasten der Brust die Sterblichkeit durch Brustkrebs nicht reduziert, wohl aber Gesundheitsrisiken mit sich bringt durch die Entnahme der Gewebeproben und die psychischen Belastungen für die betroffenen Frauen.
Ein kostenloses Abstract der Cochrane-Studie ist hier zu finden: Kösters JP, Gøtzsche PC. Regular self-examination or clinical examination for early detection of breast cancer (Cochrane Database of Systematic Reviews 2003, Issue 2. Art. No.: CD003373. DOI: 10.1002/14651858.CD003373)
Gerd Marstedt, 16.7.2008
Der Kylie-Effekt: Prominente können auch Schaden anrichten, wenn sie ihre Krankheit öffentlich machen
 Am 17. Mai 2005, elf Tage vor ihrem 37. Geburtstag, schockierte die australische Pop-Sängerin Kylie Minogue die Öffentlichkeit mit der Nachricht, an Brustkrebs erkrankt zu sein. In den folgenden zwei Wochen stieg die Brustkrebsberichterstattung in den australischen Medien um das 20fache. Beim australischen Brustkrebsprogramm, das Frauen zwischen 50 und 69 angeboten wird, fragten doppelt so viele Frauen, die bislang noch nicht zur Mammographie gekommen waren, um einen Termin an. Dabei hätte Kylie Minogue selbst von einer Früherkennung nicht profitiert: Sie gehörte keiner Risikogruppe an und war für eine Mammographie zu jung. Auch ein gezieltes Selbstabtasten verringert nach den Ergebnissen mehrerer Studien die Brustkrebssterblichkeit nicht.
Am 17. Mai 2005, elf Tage vor ihrem 37. Geburtstag, schockierte die australische Pop-Sängerin Kylie Minogue die Öffentlichkeit mit der Nachricht, an Brustkrebs erkrankt zu sein. In den folgenden zwei Wochen stieg die Brustkrebsberichterstattung in den australischen Medien um das 20fache. Beim australischen Brustkrebsprogramm, das Frauen zwischen 50 und 69 angeboten wird, fragten doppelt so viele Frauen, die bislang noch nicht zur Mammographie gekommen waren, um einen Termin an. Dabei hätte Kylie Minogue selbst von einer Früherkennung nicht profitiert: Sie gehörte keiner Risikogruppe an und war für eine Mammographie zu jung. Auch ein gezieltes Selbstabtasten verringert nach den Ergebnissen mehrerer Studien die Brustkrebssterblichkeit nicht.
Australische Forscher gingen der Frage nach, welche Auswirkungen der beobachtete Prominenten-induzierte Früherkennungs-Boom, der so genannte Kylie-Effekt, auf Frauen hat, die für eine Früherkennung ebenso wenig in Frage kommen wie Minogue selbst, die sich aber durch das Schicksal der Sängerin bemüßigt fühlen, eine Früherkennungsmaßnahme wahrzunehmen. Es zeigte sich, dass zwar mehr Aufnahmen und Biopsien gemacht, dabei aber nicht mehr Tumore gefunden werden.
Ihre Studie publizierten die Autoren jetzt im International Journal of Epidemiology. Die Ergebnisse im Einzelnen:
• Von Januar bis Oktober 2005 erhöhte sich die Rate an Mammographien und Ultraschalluntersuchungen bei Frauen im Alter von 25 bis 34 Jahren von 8 auf 12 pro 1000 und bei Frauen im Alter von 35 bis 44 Jahren von 20 auf 28 pro 1000.
• Auch die Anzahl der Gewebeentnahmen stieg an: Bei den 25- bis 34-Jährigen von 1156 im Januar 2005 auf 1719 im Oktober 2006 und bei den 35- bis 44-Jährigen im selben Zeitraum von 2502 auf 3613.
• Die Anzahl der entdeckten und entfernten Tumore blieb jedoch gleich: Bei den 25- bis 34-Jährigen wurden jeweils 42 Tumore entfernt, bei den 35- bis 44-Jährigen 277 beziehungsweise 295.
Die Autoren fordern, dass erkrankte Prominente und ihre PR-Teams sich im Sinne eines "manage the message" intensiver mit Gesundheitsexperten abstimmen sollten. Auch müsse man darauf achten, "unangemessene Nachfrage zu vermeiden".
Christian Weymayr, 9.6.2008
Früherkennung von Prostatakrebs durch den PSA-Test: Schaden ja, Nutzen nein
 In Deutschland und in anderen Ländern wird das PSA-Screening zur Früherkennung des Prostatakarzinoms in großem Umfang durchgeführt. Eine der Folgen davon ist der Anstieg von Krebsneuerkrankungen bei Männern (vgl. Krebs in Deutschland, S.11) durch Überdiagnose, d.h. durch Entdeckung von Krebs, der wegen seines langsamen Wachstums nie zu einem Gesundheitsproblem geworden wäre. Belastbare Evidenz für den Nutzen des PSA-Screenings - Senkung der Sterblichkeit, Verlängerung der Lebenserwartung, Verbesserung der Lebensqualität - liegt nicht vor (Cochrane Review Screening for prostate cancer).
In Deutschland und in anderen Ländern wird das PSA-Screening zur Früherkennung des Prostatakarzinoms in großem Umfang durchgeführt. Eine der Folgen davon ist der Anstieg von Krebsneuerkrankungen bei Männern (vgl. Krebs in Deutschland, S.11) durch Überdiagnose, d.h. durch Entdeckung von Krebs, der wegen seines langsamen Wachstums nie zu einem Gesundheitsproblem geworden wäre. Belastbare Evidenz für den Nutzen des PSA-Screenings - Senkung der Sterblichkeit, Verlängerung der Lebenserwartung, Verbesserung der Lebensqualität - liegt nicht vor (Cochrane Review Screening for prostate cancer).
Eine neue systematische Übersichtsarbeit (Annals of Internal Medicine, 18.3.2008) über 18 randomisierte kontrollierte Studien und 473 Beobachtungsstudien verdeutlicht jedoch das Wissen über die schädlichen Folgen der Behandlung des Prostatakarzinoms im Frühstadium. Auch hier weisen die Autoren jedoch auf den Mangel an belastbarer Evidenz hin, insbesondere für das durch PSA-Bestimmung entdeckte Prostatakarzinom. Die Qualität vieler Studien sei niedrig, viele klinisch wichtige Fragen seien überhaupt noch nicht durch randomisierte kontrollierte Studien untersucht, wie z.B. Kryotherapie, Brachytherapie, Protonenbestrahlung und primäre Androgensuppression - trotz verbreiteter Anwendung.
Der Stand des Wissens über das Auftreten von Impotenz und Harninkontinenz lautet folgendermaßen:
• Impotenz tritt nach radikaler Prostataentfernung bei 58 Prozent der Männer auf, nach Bestrahlung bei 43 Prozent und nach Hormonbehandlung (Androgenunterdrückung) bei 86 Prozent.
• Harninkontinenz ist nach operativer Prostataentfernung bei 35 Prozent der Männer, nach Bestrahlung bei 12 Prozent und nach Hormonbehandlung bei 11 Prozent zu erwarten. Diesen erwiesenen relevanten Schäden steht - wie gesagt - nach heutigem Wissensstand keinerlei erwiesener Nutzen gegenüber.
• Systematische Übersichtsarbeit zur Behandlung des Prostatakarzinoms im Frühstadium: Timothy J. Wilt u.a.: Systematic Review: Comparative Effectiveness and Harms of Treatments for Clinically Localized Prostate Cancer. Annals of Internal Medicine, 18.3.2008 Abstract
• Systematische Übersichtsarbeit (Cochrane Review) zur Früherkennung des Prostatakarzinoms durch PSA-Untersuchung, 2006 D Ilic u.a.: Screening for prostate cancer. Abstract
• Krebs in Deutschland 2003-2004 Häufigkeiten und Trends. Gesundheitsberichterstattung des Bundes. 6. Auflage, 19.2.2008
David Klemperer, 15.4.2008
Primärprävention in der ärztlichen Praxis: Zumindest in deutschen Praxen wird Krankheitsvorbeugung klein geschrieben
 Bereits 2006 hatte eine repräsentative Befragung von Ärzten im Rahmen des "Gesundheitsmonitor" der Bertelsmann-Stiftung gezeigt, dass niedergelassene Ärzte nur in äußerst geringem Umfang auch Primärprävention in ihrer Praxis betreiben, etwa durch eine Beratung zur Änderung von Lebensstilen und gesundheitsriskanten Verhaltensweisen. Eine jetzt veröffentlichte neue Literatur-Übersicht zum Thema "Primärprävention in der ärztlichen Praxis" hat vor allem gezeigt, dass der Forschungsstand überaus große Defizite aufweist und es derzeit zu einer Vielzahl gesundheitspolitisch überaus relevanter Fragen keine Antworten gibt.
Bereits 2006 hatte eine repräsentative Befragung von Ärzten im Rahmen des "Gesundheitsmonitor" der Bertelsmann-Stiftung gezeigt, dass niedergelassene Ärzte nur in äußerst geringem Umfang auch Primärprävention in ihrer Praxis betreiben, etwa durch eine Beratung zur Änderung von Lebensstilen und gesundheitsriskanten Verhaltensweisen. Eine jetzt veröffentlichte neue Literatur-Übersicht zum Thema "Primärprävention in der ärztlichen Praxis" hat vor allem gezeigt, dass der Forschungsstand überaus große Defizite aufweist und es derzeit zu einer Vielzahl gesundheitspolitisch überaus relevanter Fragen keine Antworten gibt.
In einer Befragung von über 500 niedergelassenen Ärzten im November/Dezember 2004 im Rahmen des "Gesundheitsmonitor" hatte sich unter anderem gezeigt:
• Insgesamt schreiben Ärzte verhaltensbezogenen Maßnahmen bei der Verhütung von Krankheiten eine höhere Bedeutung zu als medikamentösen Therapien. Dies zeigt sich auch am Beispiel von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Alle verhaltenspräventiven Interventionen (wie Verringerung des Tabakkonsums, Abnehmen, mehr Bewegung, Ernährungsumstellung) werden zur Krankheitsvorbeugung für wirksamer eingeschätzt als die Einnahme von Arzneimitteln (etwa Blutdruck- und Blutfettsenker).
• Gleichwohl ist die Zeit, die Ärzte durchschnittlich pro Woche für die Prävention und Früherkennung von Krankheiten aufwenden sehr gering. Vier von fünf Ärzten geben an, dass sie nicht mehr als 10 Prozent ihrer Arbeitszeit für Primärprävention nutzen. Bei den Fachärzten entfallen durchschnittlich 8,5 Prozent der Arbeitszeit auf primärpräventive Maßnahmen. Bei Medizinern, die in der Regel von ihren Patienten direkt und ohne Überweisung aufgesucht werden (so genannten Primärärzten, also Allgemeinmedizinern, Praktischen Ärzten, hausärztlich tätigen Internisten, Kinderärzten, Frauenärzten), ist der Arbeitszeitanteil mit durchschnittlich 13,5 Prozent etwas höher. Für die Früherkennung von Krankheiten (Sekundärprävention) wird dabei doppelt so viel Zeit aufgewendet wie für Krankheitsvermeidung (Primärprävention).
• Ein Viertel der Ärzte sieht die Verantwortung für die Krankheitsvorbeugung allerdings allein beim Patienten. Gleichzeitig verweisen 29 Prozent ihre Patienten in Sachen Primärprävention an andere Institutionen wie vor allem Selbsthilfegruppen und Patientenverbände, Krankenhäuser und Rehabilitationseinrichtungen, aber auch Ernährungsberater, Krankenkassen und Sportvereine.
• Fragt man Ärzte, was getan werden müsste, damit sie sich mehr im Bereich der Primärprävention engagieren, dann wird vor allem hingewiesen auf eine bessere finanzielle Vergütung (51% der Nennungen). Eine bessere Fortbildung halten nur noch 17 Prozent der Leistungserbringer für eine geeignete Maßnahme und 15 Prozent geben an, sie bräuchten mehr wissenschaftliche Nachweise über den Nutzen von Prävention.
Der Newsletter ist hier als PDF-Datei herunterzuladen: Gesundheitsmonitor 1/2006: "Ärzte kaum präventiv tätig"
In einer systematischen Literaturübersicht haben nun Wissenschaftler der Abteilung für Allgemeinmedizin des Universitätsklinikum Düsseldorf versucht, noch mehr Licht zu werfen auf die Frage der Primärprävention in Arztpraxen. In verschiedenen Datenbanken wurden insgesamt 33 empirische Untersuchungen gefunden, die das Thema behandeln, darunter acht Interventionsstudien und 25 deskriptive Studien. Einbezogen wurden nur Untersuchungen mit präventivmedizinischem Schwerpunkt unter Beteiligung deutscher Hausärzte.
Das allgemeine Fazit der Literaturauswertung ist überaus ernüchternd und zeigt vor allem einen hohen Forschungsbedarf auf, wenn man berücksichtigt, dass Primärprävention nach Meinung vieler Wissenschaftler ebenso wie Gesundheitspolitiker und zum Beispiel auch nach Ansicht des Sachverständigenrats zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen unbedingt zu einer "vierten Säule" des Gesundheitssystems ausgebaut werden sollte. In der Zusammenfassung ihrer Literaturstudie kommen die Wissenschaftler der Universität Düsseldorf jedoch zu dem Fazit "Das so entstehende Bild ist gleichermaßen von Unterentwicklung des Feldes Prävention in der deutschen Hausarztpraxis als auch von der Unterentwicklung des Forschungsfeldes selbst geprägt."
Die Literaturübersicht referiert kurz alle einbezogenen Studien und ist daher als Zusammenfassung des Forschungsstands sehr hilfreich. Hinsichtlich der Verbreitung von Primärprävention bei Hausärzten zeigen deskriptive Studien u.a. folgende Befunde:
• In einer postalischen Umfrage bei 447 Allgemeinärzten in der Region Hannover zeigte sich: Ernährungsberatung war mit 37% die am häufigsten durchgeführte Präventionsmaßnahme, gefolgt von Beratung zur "Lebensführung allgemein" mit 28%.
• Von 315 zur Raucherentwöhnung befragten Hausärzten gaben über die Hälfte an, weniger als 10 Patienten in den letzten drei Monaten hinsichtlich ihres Rauchverhaltens beraten oder behandelt zu haben. Als Gründe wurden die mangelnde Vergütung genannt, gefolgt von mangelnden Kenntnissen und Zeitmangel.
• Auch eine weitere Studie findet geringe Raten an Raucherberatung. Patienten in sechs europäischen Staaten wurden mittels Fragebogen hierzu befragt. Die Antworten von 147 deutschen Patienten zeigen mit 13% Beratung bei gesunden Rauchern und 14% bei chronisch kranken Rauchern im Vergleich zu andern Ländern wie Russland, Finnland, Spanien die niedrigsten Raten.
• Eine andere Studie verglich die Aussagen von 135 deutschen mit denen von 235 dänischen Ärzten zum Thema Prävention bei Alkoholmissbrauch. Hier glauben 46 % der deutschen Ärzte an den Einfluss ihrer Beratung. 60 % äußern Interesse an Alkoholprävention, aber nur 24 % berichten über Teilnahme an Fortbildungen in diesem Bereich. Im Vergleich waren nur 35 von 100 dänischen Ärzten an Präventionsarbeit überhaupt interessiert, 66 % der dänischen Ärzte glaubten an ihren Einfluss auf die Patienten und 28 % berichteten über Fortbildungskenntnisse in Bezug auf Alkoholmissbrauch.
In der Veröffentlichung werden auch viele Ergebnisse aus Interventionsstudien dargestellt sowie aus Untersuchungen zu speziellen Themen (Darmkrebs-Vorsorge, Geriatrisches Screening, Depression).
Hier ist ein Abstract der Literaturübersicht: Othman, C.; Altiner, A.; Abholz, H. -H.: Prävention in der deutschen Hausarztpraxis im Spiegel der Forschung - ein systematischer Literaturüberblick (Z Allg Med 2008; 84: 36-42; DOI: 10.1055/s-2007-1004532)
Gerd Marstedt, 14.3.2008
Untersuchungen zur Früherkennung: Ein Drittel der Bevölkerung bezweifelt den klaren Nutzen
 Seit Jahren beklagen Mediziner wie Gesundheitswissenschaftler die geringe Teilnahme von Versicherten an Früherkennungsuntersuchungen, denn nur etwa 47 Prozent der Frauen und 18 Prozent der anspruchsberechtigten Männer beteiligen sich gegenwärtig an der Krebsfrüherkennung. Zugleich wird allerdings immer wieder auch Kritik laut an einzelnen Untersuchungen. So hat die Stiftung Warentest 46 gängige Früherkennungsverfahren untersucht (die allerdings nur zum Teil GKV-Leistungen sind). Das Ergebnis lautet: "Die meisten Methoden sind für die Krebsfrüherkennung nicht oder nur wenig geeignet." (vgl.: Früherkennungsuntersuchungen: Nicht-Teilnahme soll finanziell bestraft werden). Eine aktuelle Umfrage des Wissenschaftlichen Instituts der Ortskrankenkassen (WidO) zur Akzeptanz von Früherkennungsmaßnahmen in der gesetzlichen Krankenversicherung versucht nun, den Motiven der Teilnahme und Nicht-Teilnahme näher auf die Spur zu kommen.
Seit Jahren beklagen Mediziner wie Gesundheitswissenschaftler die geringe Teilnahme von Versicherten an Früherkennungsuntersuchungen, denn nur etwa 47 Prozent der Frauen und 18 Prozent der anspruchsberechtigten Männer beteiligen sich gegenwärtig an der Krebsfrüherkennung. Zugleich wird allerdings immer wieder auch Kritik laut an einzelnen Untersuchungen. So hat die Stiftung Warentest 46 gängige Früherkennungsverfahren untersucht (die allerdings nur zum Teil GKV-Leistungen sind). Das Ergebnis lautet: "Die meisten Methoden sind für die Krebsfrüherkennung nicht oder nur wenig geeignet." (vgl.: Früherkennungsuntersuchungen: Nicht-Teilnahme soll finanziell bestraft werden). Eine aktuelle Umfrage des Wissenschaftlichen Instituts der Ortskrankenkassen (WidO) zur Akzeptanz von Früherkennungsmaßnahmen in der gesetzlichen Krankenversicherung versucht nun, den Motiven der Teilnahme und Nicht-Teilnahme näher auf die Spur zu kommen.
Die aktuelle Umfrage zeigt, dass längst nicht alle teilnahmeberechtigten Versicherten wissen, dass sie einen Anspruch auf kostenlose Früherkennungsuntersuchungen haben. Die Angaben zur Teilnahme an den einzelnen Untersuchungen sind jeweils sehr unterschiedlich. Insgesamt haben 23 Prozent der anspruchsberechtigten Männer und 6 Prozent der Frauen überhaupt noch nie an einer Krebsfrüherkennung teilgenommen. Diese Tatsache wird in erster Linie damit begründet, dass man sich "gesund fühlt".
Weitere Ergebnisse der Umfrage:
• Frauen sind besser über die Ansprüche auf Früherkennungsuntersuchungen informiert als Männer.
• Am bekanntesten ist die jährliche Krebsfrüherkennung für Frauen: 88 Prozent der Frauen kennen ihren Anspruch auf diese Untersuchung.
• Rund 30 Prozent haben noch nie an einem Gesundheits-Check-up für Versicherte ab 35 Jahren teilgenommen. Insbesondere in der Altersgruppe der 35- bis 39-Jährigen nehmen die Versicherten das Angebot unterdurchschnittlich wahr. Dabei zeigen sich kaum Unterschiede zwischen den Geschlechtern.
• Bei den Gründen für eine bislang fehlende Teilnahme wird am häufigsten angegeben: "weil ich mich gesund fühle". Möglicherweise vertreten die Versicherten die veraltete Auffassung (als Krebstherapie noch fast ausschließlich Operation bedeutete), Früherkennungsuntersuchungen nur dann in Anspruch zu nehmen, wenn subjektiv erste Anzeichen einer Erkrankung vorliegen. Als zweithäufigste Begründung für die Nichtteilnahme an den Früherkennungsuntersuchungen wurde angegeben: "weil ich nichts davon wusste".
• Mehr als ein Drittel der Befragten (38 Prozent der Männer und 36 Prozent der Frauen) stimmen der Aussage zu, dass Früherkennungsuntersuchungen auch Ergebnisse liefern können, die gar nicht richtig sind.
• Ebenfalls mehr als ein Drittel der Versicherten stimmen der Aussage zu, dass auch durch die Teilnahme an Früherkennungen der Krebs meist nicht früh genug erkannt wird".
• Fast ein Drittel der anspruchsberechtigten Befragten stimmt ferner - mit dem Alter zunehmend - der Aussage zu, dass bei vielen Früherkennungsuntersuchungen der Nutzen nicht klar und eindeutig ist.
Seit 1998 führt das Wissenschaftliche Institut der Ortskrankenkassen (WidO) jährlich Versichertenbefragungen zu aktuellen gesundheitspolitischen Themen durch. Die repräsentative Stichprobe umfasst 3.000 Personen ab 18 Jahren, die bei einer gesetzlichen Krankenkasse versichert sind. Die befragten Versicherten verteilen sich auf alle Krankenkassen. Hier sind die Umfrage-Ergebnisse:
WidO Monitor 3/2007: Wahrnehmung und Akzeptanz von Früherkennungsuntersuchungen.
In einer zweiten jetzt ebenfalls veröffentlichten Studie der Deutschen Krebsgesellschaft und der Stiftung LebensBlicke (Mannheim) über die Darmkrebsfrüherkennung wurden von August bis Dezember 2006 insgesamt 150 Interviews mit Menschen ab dem 40. Lebensjahr durchgeführt. Im Mittelpunkt standen dabei Fragen nach den Zusammenhängen zwischen Wissen, Einstellung und Verhalten gegenüber der Darmkrebsfrüherkennung. Als Ergebnis wird in der Zusammenfassung der Studie hervorgehoben:
• "Nur etwa ein Drittel der Interviewten ist an der Krebsprävention interessiert. Ebenso konnte nur ein Drittel der Interviewten zutreffende Angaben über die Ursachen von Darmkrebs machen. Bei etwa der Hälfte wird die Körperlichkeit als ein unspezifisches Phänomen erlebt, über dessen Selbstverständlichkeit nur vermittels Krankheit und körperlichem Funktionsverlust nachgedacht und emotional reagiert wird."
• "Die Analyse der Antworten bestärkt die Hypothese, wonach Schamempfindungen und Schamabwehrreaktionen auf sehr subtile Weise an das Thema Darmkrebs gekoppelt sind. Eine große Mehrheit der Interviewten hat deswegen emotionale Schwierigkeiten mit der Darmkrebsfrüherkennung. Wenn es gelingt, diese aufzulösen, kann die Kommunikation über die Darmkrebsfrüherkennung deutlich profitieren."
• Nicht-Akzeptanz der Darmkrebsfrüherkennung - Eine Studie der Deutschen Krebsgesellschaft und der Stiftung LebensBlicke (Mannheim) (Deutsche Krebsgesellschaft: Forum DKG 5/07)
Gerd Marstedt, 4.1.2008
Brustkrebs-Diagnosen durch Mammographie: Die Treffsicherheit von Ärzten ist extrem unterschiedlich
 Frühere Studien haben gezeigt, dass bei es bei Früherkennungsuntersuchungen für Brustkrebs erhebliche Unterschiede zwischen Ärzten gibt, was die Treffsicherheit der Diagnose anbetrifft. Ein US-amerikanisches Forschungsteam hat nun die Kompetenz von Radiologen überprüft, die nach einem Krebsverdacht bei Frauen Mammographien durchgeführt und ausgewertet haben. Sie fanden heraus, dass es auch bei dieser Gruppe spezialisierter Ärzte erhebliche Unterschiede gibt. Die Treffsicherheit, was die Quote richtig erkannter Brustkrebs-Erkrankungen anbetrifft, schwankte zwischen 27 und 100 Prozent.
Frühere Studien haben gezeigt, dass bei es bei Früherkennungsuntersuchungen für Brustkrebs erhebliche Unterschiede zwischen Ärzten gibt, was die Treffsicherheit der Diagnose anbetrifft. Ein US-amerikanisches Forschungsteam hat nun die Kompetenz von Radiologen überprüft, die nach einem Krebsverdacht bei Frauen Mammographien durchgeführt und ausgewertet haben. Sie fanden heraus, dass es auch bei dieser Gruppe spezialisierter Ärzte erhebliche Unterschiede gibt. Die Treffsicherheit, was die Quote richtig erkannter Brustkrebs-Erkrankungen anbetrifft, schwankte zwischen 27 und 100 Prozent.
Die Diagnosen von 123 Radiologen und 36.000 Mammographien waren Basis der Studie, die jetzt in der Zeitschrift "Journal of the National Cancer Institute" veröffentlicht wurde. Die Diagnosen stammen aus den Jahren 1996 bis 2003 und wurden in insgesamt 72 Kliniken oder anderen Versorgungseinrichtungen aufgestellt. Die Wissenschaftler überprüften einerseits, ob die Diagnosen zutreffend waren oder ob Krebsknoten übersehen worden waren ("Falsch-Negativ-Befunde"). Andererseits untersuchten sie aber auch, ob es sich um irrtümliche, in späteren Untersuchungen korrigierte Urteile ("Falsch-Positiv-Befunde") handelte. Darüber hinaus versuchten sie schließlich auch, festzustellen, ob bestimmte berufliche Merkmale der Ärzte die Treffsicherheit der Diagnosen beeinflusst.
Als Ergebnis zeigte sich:
• Die durchschnittliche Trefferquote (zutreffende Diagnosen) lag bei 79%, d.h. 21% der Krebserkrankungen wurden übersehen.
• Die Quote korrekter Diagnosen variierte aber bei einzelnen Ärzten erheblich, sie lag zwischen 27% und 100%. D.h. Einzelne Radiologen beurteilten nur etwa jeden vierten Fall korrekt, andere waren durchweg treffsicher.
• Falsch-Positiv-Urteile (irrtümliche Krebs-Diagnosen) variierten zwischen 0 und 16% und lagen im Mittel bei 4.3%
• Radiologen in universitären Versorgungseinrichtungen zeigten eine deutlich höhere Treffsicherheit (88%) als Spezialisten in anderen Einrichtungen (76%).
• Eine höhere Diagnosesicherheit zeigten auch Radiologen, die mindestens 20 Prozent ihrer Arbeitszeit nur mit der Auswertung von Mammographien verwenden.
Ein kostenloses Abstract der Studie ist hier zu finden: Diana L. Miglioretti u.a.: Radiologist Characteristics Associated With Interpretive Performance of Diagnostic Mammography (JNCI Journal of the National Cancer Institute, doi:10.1093/jnci/djm238)
Gerd Marstedt, 16.12.2007
Früherkennung von Prostatakrebs: Bessere Information von Patienten senkt die Teilnahmebereitschaft
 Über den Nutzen und möglichen Schaden der Früherkennung von Prostatakrebs und insbesondere über die Tauglichkeit des sogenanntem "PSA-Test" ist ein heftiger Streit im Gange. Der Test soll durch überhöhte Werte von Prostata-Spezifischem Antigen (PSA) im Blut unter Umständen einen Hinweis auf eine Krebserkrankung geben. Während viele Urologen und Allgemeinärzte die lebensrettende Funktion hervorheben, weisen Kritiker darauf hin, dass der Test sehr fehleranfällig ist und bei vielen Patienten unnötige (und teilweise sehr gesundheitsriskante) Folgeuntersuchungen und Behandlungen in Gang setzt. (vgl. Klaus Koch: PSA-Test und Prostatakarzinom. Ein Beispiel für das Dilemma der Früherkennung) Einigkeit besteht allerdings darin, dass sehr viele Patienten nicht hinreichend über den PSA-Test und seine Folgen aufgeklärt werden. Auch Professor Gerhard Jakse, Chef der Urologie des Uniklinikums Aachen, gibt zu, dass viele Hausärzte und Urologen nicht gut über Vor- und Nachteile des PSA-Tests aufklären: "Wir müssen die Ärzte disziplinieren, die noch nicht ehrlich sind.".
Über den Nutzen und möglichen Schaden der Früherkennung von Prostatakrebs und insbesondere über die Tauglichkeit des sogenanntem "PSA-Test" ist ein heftiger Streit im Gange. Der Test soll durch überhöhte Werte von Prostata-Spezifischem Antigen (PSA) im Blut unter Umständen einen Hinweis auf eine Krebserkrankung geben. Während viele Urologen und Allgemeinärzte die lebensrettende Funktion hervorheben, weisen Kritiker darauf hin, dass der Test sehr fehleranfällig ist und bei vielen Patienten unnötige (und teilweise sehr gesundheitsriskante) Folgeuntersuchungen und Behandlungen in Gang setzt. (vgl. Klaus Koch: PSA-Test und Prostatakarzinom. Ein Beispiel für das Dilemma der Früherkennung) Einigkeit besteht allerdings darin, dass sehr viele Patienten nicht hinreichend über den PSA-Test und seine Folgen aufgeklärt werden. Auch Professor Gerhard Jakse, Chef der Urologie des Uniklinikums Aachen, gibt zu, dass viele Hausärzte und Urologen nicht gut über Vor- und Nachteile des PSA-Tests aufklären: "Wir müssen die Ärzte disziplinieren, die noch nicht ehrlich sind.".
Vor diesem Hintergrund wurde in den USA und im United Kingdom, wo die Problematik sich ähnlich darstellt, eine große Zahl von Entscheidungshilfen für Patienten entwickelt, in denen die einzelnen Früherkennungsmaßnahmen (PSA-Test, Gewebeentnahme aus der Prostata), ihre Vor- und Nachteile und auch die unterschiedlichen Behandlungsmethoden bei einer Krebsdiagnose (Radikaloperation und Entfernung der Prostata, Bestrahlung, "abwartende Beobachtung") ausführlich erläutert werden. In den meisten dieser Entscheidungshilfen ("Decision Aids") wird auch auf die Unsicherheit des PSA-Tests hingewiesen, der in sehr vielen Fällen überhöhte Werte auch anzeigen kann, ohne dass eine Krebserkrankung vorliegt. Eine viel in Anspruch genommene Entscheidungshilfe im Internet ist PROSDEX PSA-Test.
Eine jetzt in der Zeitschrift "American Journal of Preventive Medicine" veröffentlichte US-amerikanische Studie, hat nun untersucht, welche Effekte Entscheidungshilfen zur Teilnahme an Prostatakrebs-Früherkennung überhaupt haben. Dazu wurden 18 schon veröffentlichte Studien näher unter die Lupe genommen. Die Untersuchungen hatten teilweise in Kommunen unter Teilnahme niedergelassener Ärzte, teilweise auch in Kliniken stattgefunden. Insgesamt waren über 6.000 Patienten beteiligt. Als Ergebnisse eine Sekundärauswertung dieser Studien zeigte sich:
• Die eingesetzten Entscheidungshilfen für Patienten verbessern nicht nur deren Kenntnisse über die Früherkennung und die Risiken und Chancen, sondern schaffen auch größere Verhaltenssicherheit und reduzieren Entscheidungskonflikte. Allerdings zeigte sich auch, dass der Wissensstand nach etwa einem Jahr erheblich zurückgeht.
• Patienten, die sich wegen einer Routine-Untersuchung zu einem Arzt begeben hatten, zeigten im Vergleich zu Kontrollgruppen nach Kenntnisnahme der Entscheidungshilfe eine deutlich reduzierte Bereitschaft, sich einem PSA-Test zu unterziehen. Dies zeigte sich in der Mehrzahl (6 von 9) der Studien.
• Bei anderen Patienten hingegen, die bereits für sich die Entscheidung getroffen hatten, an der Früherkennung teilzunehmen, bewirkten die Entscheidungshilfe keinen Sinneswandel.
• In vier Studien war überprüft worden, für welche Therapie-Alternative sich Patienten entscheiden würden, falls bei ihnen Krebszellen in der Prostata gefunden würden. Hier votierten sehr viel mehr Patienten für eine "abwartende Beobachtung" ("watchful waiting"), falls sie zuvor eine Entscheidungshilfe in Anspruch genommen hatten. Bei diesem Vorgehen wird zunächst auf eine Prostata-Entfernung oder Bestrahlung verzichtet, jedoch fortlaufend die Entwicklung kontrolliert.
Die Wissenschaftler heben hervor, dass Entscheidungshilfen zu einem nicht geringen Teil dazu beitragen, dass Patienten sich gegen den aktuellen "main stream" im Hinblick auf die Teilnahme an Krebs-Früherkennung wenden. Bei einer fundierteren Kenntnis der Chancen und Risiken verzichten sie öfter auf die Durchführung von PSA-Tests und entscheiden sich häufiger für das "watchful waiting" als dies normalerweise geschieht.
Ein Abstract der Studie ist ab November 2007 im American Journal of Preventive Medicine zu finden:
Robert J. Volk u.a.: Trials of Decision Aids for Prostate Cancer Screening. A Systematic Review (Am J Prev Med 2007;33(5) 428-434)
Gerd Marstedt, 17.10.2007
Übergewicht: Eine bedeutsame Veränderungsbarriere ist auch die mangelhafte Diagnose und Therapieberatung durch Ärzte
 Die bislang erprobten Interventionen, um der weiteren Verbreitung von Übergewicht und Adipositas Einhalt zu gebieten, zeigen durchweg nur sehr bescheidene und oftmals auch nur kurzfristige Erfolge - dies hat eine Literaturübersicht in einem Newsletter der Bertelsmann-Stiftung gezeigt ("Deutsche sind die dicksten Europäer? Wie es zu einer Zeitungsente kam und was die neuesten Fakten sind"). Hintergründe für die auch in Deutschland wachsenden Raten übergewichtiger Bürger sind überaus vielfältig und komplex und betreffen anerzogene Ernährungs- und Bewegungsgewohnheiten, aber auch soziale und kulturelle Normen.
Die bislang erprobten Interventionen, um der weiteren Verbreitung von Übergewicht und Adipositas Einhalt zu gebieten, zeigen durchweg nur sehr bescheidene und oftmals auch nur kurzfristige Erfolge - dies hat eine Literaturübersicht in einem Newsletter der Bertelsmann-Stiftung gezeigt ("Deutsche sind die dicksten Europäer? Wie es zu einer Zeitungsente kam und was die neuesten Fakten sind"). Hintergründe für die auch in Deutschland wachsenden Raten übergewichtiger Bürger sind überaus vielfältig und komplex und betreffen anerzogene Ernährungs- und Bewegungsgewohnheiten, aber auch soziale und kulturelle Normen.
Eine in der Zeitschrift "Mayo Clinic Proceedings" veröffentlichte Studie jetzt ein völlig neues Ursachenbündel ausgemacht: Adipositas, so der Befund, wird von Ärzten viel zu selten als Erkrankung diagnostiziert und den Patienten auch als solche mitgeteilt. Auch wird in den meisten Fällen kein Therapieplan aufgestellt, der Behandlungsschritte auflistet und konkrete Empfehlungen etwa zur Änderung von Verhaltensgewohnheiten enthält. Basis der Studie waren Daten von knapp 10.000 Patienten, die bei 101 Ärzten in einer auf Übergewicht spezialisierten Mayo-Klinik zur Untersuchung waren. Für alle Patienten wurden über einen Zeitraum von 12 Monaten (November 2004 - Oktober 2005) routinemäßig umfangreiche Daten und Befunde protokolliert, unter anderem Alter und Geschlecht, schon vorliegende Erkrankungen und auch der Body-Mass-Index (BMI).
Als die Wissenschaftler dann später anhand der Datenbanken überprüften, welche Diagnosen und welche Therapiepläne in den Untersuchungsprotokollen (auf EDV gespeichert) vorlagen, stießen sie auf überraschende Befunde:
• Bei etwa 2.500 der knapp 10.000 Patienten wurde ein BMI von 30 oder mehr festgestellt, jeder vierte Patient war also adipös.
• Innerhalb dieser Gruppe mit Adipositas wurde jedoch nur bei jedem Fünften (20%) auch eine entsprechende Diagnose im Protokoll festgehalten und genau so selten (23%) fand man in den Behandlungsunterlagen Hinweise darauf, dass ein Therapieplan aufgestellt worden war.
• Selbst bei Patienten mit einem BMI >= 35 war man nur in 62% der Fälle eine entsprechende Diagnose vermerkt.
• Von Assistenzärzten wurden Diagnosen doppelt so oft festgehalten wie von Ärzten, die ihre Ausbildung schon hinter sich hatten und längere Zeit in der Klinik tätig waren. Bei der Aufstellung von Therapieplänen unterscheiden beide Gruppen sich allerdings nicht .
Die Forscher diskutieren leider nur sehr kurz, welche Hintergründe sie als maßgeblich für diese Befunde erachten. Es könnte ihrer Meinung nach sowohl zutreffen, dass Übergewicht von Ärzten aufgrund der hohen Verbreitung in den USA nicht als "richtige Krankheit" wahrgenommen und daher auch nur selten protokolliert wird. Ebenso könnte ein Stück Resignation mitschwingen: Wenn es in langen Jahren nur in wenigen Fällen gelungen ist, übergewichtige Patienten zu einer Änderung ihrer Alltagsgewohnheiten (Ernährung, Bewegung) zu motivieren, dann lohnt es auch nicht, erneut "hoffnungslose Fälle" als solche statistisch zu dokumentieren. Aber auch Zeitdruck könnte für Ärzte eine Rolle spielen oder auch Überlegungen zur Finanzierung, da Krankenversicherungen in vielen Fällen für die Therapie von Übergewicht keine Kosten übernehmen. In jedem Falle jedoch, so ihr Fazit, besteht eine tiefe Kluft zwischen der medizinischen Beobachtung von Risikofaktoren und deren Umsetzung in konkrete Therapien.
Die Studie Aditya Bardia u.a.: Diagnosis of Obesity by Primary Care Physicians and Impact on Obesity Management ist hier verfügbar als
Abstract
Gerd Marstedt, 26.8.2007
Umfassende HPV-Impfung würde 200 Mio Euro kosten - Wissenschaftler erkennt bessere Möglichkeiten der Prävention
 Die aktuelle Empfehlung der Ständigen Impfkommission, die Impfung gegen den Humanen Papillom Virus (HPV) als Leistung der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) anzuerkennen, wird von der Pharma-Industrie, Ärzteverbänden und auch Krankenkassen entschieden begrüßt. Auf vielen Tagungen wird die HPV-Impfung als "Durchbruch in der Krebs-Prävention" propagiert. Dass hier viel Augenwischerei am Werk ist, zeigt Rolf Rosenbrock, Professor für Gesundheitspolitik an der TU Berlin und seit 1999 Mitglied im Sachverständigenrat im Gesundheitswesen, in einem Aufsatz auf.
Die aktuelle Empfehlung der Ständigen Impfkommission, die Impfung gegen den Humanen Papillom Virus (HPV) als Leistung der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) anzuerkennen, wird von der Pharma-Industrie, Ärzteverbänden und auch Krankenkassen entschieden begrüßt. Auf vielen Tagungen wird die HPV-Impfung als "Durchbruch in der Krebs-Prävention" propagiert. Dass hier viel Augenwischerei am Werk ist, zeigt Rolf Rosenbrock, Professor für Gesundheitspolitik an der TU Berlin und seit 1999 Mitglied im Sachverständigenrat im Gesundheitswesen, in einem Aufsatz auf.
Er weist einerseits darauf hin, dass das Cervix Carcinom in Deutschland lediglich 3,16 % der Krebs-Inzidenz bei Frauen und 1,76% der Krebsmortalität bei Frauen erklärt, so dass schon aufgrund dieser quantitativ geringen Bedeutung keine Rede sein kann von einem Durchbruch in der Krebsprävention. Der Wissenschaftler setzt sich darüber hinaus jedoch auch kritisch mit der Praxis der Früherkennung in Deutschland auseinander: "Durchbruch in der Krebsprävention", so Rosenbrock, "stimmt auch deshalb nicht, weil die Impfstrategie nicht weit trägt: von den häufigeren Karzinomen weist wohl keines eine Virusinfektion als notwendige Bedingung auf. Einem 'Durchbruch in der Krebsprävention' könnte man sehr viel näher kommen, wenn modernere Ansätze lebensweltbezogener Prävention, mit denen das Verhalten und die hinter dem Verhalten stehenden Faktoren im Hinblick auf Ernährung, Stressbewältigung, Bewegung und Rauchen in großem Umfang umgesetzt würden. Schließlich erklären sich 30% der Inzidenz aller Krebsarten aus diesen Faktoren."
In diesem Zusammenhang wird auch darauf hingewiesen, dass die Maßnahmen zur Erhöhung der Teilnahmequote an Früherkennungsuntersuchungen in Deutschland hinter dem zurückbleiben, was sich in anderen Ländern als überaus erfolgreich erwiesen hat: Systeme mit persönlicher Einladung und persönlicher Erinnerung oder eben auch zugehende Versorgung in sozialen Brennpunkten, wie z. B. durch Health Visitors ins Großbritannien. Der in Deutschland durch die Gesundheitsreform geplante Weg einer späteren finanziellen Sanktionierung von Patienten, die nicht an Früherkennung teilgenommen haben, sei weder durch Forschungsergebnisse belegt, noch sei er geeignet, jene Gruppen in der Bevölkerung zu erreichen, die die größten Erkrankungsrisiken aufweisen: Angehörige unterer Sozialschichten.
Da die Durchimpfung eines Mädchenjahrgangs in Deutschland (ca. 400.000 Betroffene) etwa 200 Millionen Euro kosten würde, setzt sich der Wissenschaftler auch mit der Frage auseinander, ob es für diese Mittel nicht sinnvollere und effizientere Einsatzmöglichkeiten zur Krankheitsverhütung gäbe: "Stellt man sich die - aus Systemsicht bereits stark eingeengte - Frage, wo und wie mit 200 Mio. Euro für die Krebsprävention die größte gesundheitliche Wirkung zu erzielen wäre, dann hätte die HPV-Impfung wahrscheinlich keinen guten Stand. Es böte sich vielmehr an, zunächst die Früherkennung auf Cervix Ca in ihrer Reichweite und Qualität zu verbessern (die Krankheit kann - theoretisch - zu mehr als 90% durch Früherkennung verhindert werden) und - da dies gewiss keine 200 Millionen Euro kosten würde - das restliche Geld in partizipativ gestaltete Setting-Projekte in sozial benachteiligten Orten bzw. Stadtteilen bzw. Schulen zu stecken. Dies freilich würde einen Grad an Rationalität bedeuten, den Gesundheitspolitik in der Regel nicht aufweist. Gegen die Koalition aus Pharma-Industrie und impfbereiten Ärzten, getragen von der großen und breiten Sympathie für die Impfung als individuelle, passive Prävention durch ärztliches Handeln, haben Konzepte wie das hier vorgetragene regelmäßig eine nur geringe Chance."
Der komplette Aufsatz ist hier als PDF-Datei verfügbar: Rolf Rosenbrock: HPV-Impfung - Durchbruch in der Krebsprävention?
Eine sehr kritische und detaillierte Auseinandersetzung mit der Empfehlung der Ständigen Impfkommission leistet auch der Verein "Ärzte für individuelle Impfentscheidung e.V.", der darauf hinweist, dass ein Wirkungsnachweis bisher streng wissenschaftlich nicht geführt ist - vor allem nicht bei der Zielgruppe der jugendlichen Mädchen, dass die Bedeutung von Nebenwirkungen bislang ebenso ungeklärt ist wie wie die Wirkdauer der Impfung. In einem Leserbrief des Vereins an die Süddeutsche Zeitung heißt es: "Angesichts der gut eingeführten und hocheffektiven Krebsvorsorge mit Pap-Diagnostik bestehen weder eine Notsituation noch Zeitdruck. Warum konnte die STIKO mit ihrer Impfempfehlung nicht noch einige wenige Jahre warten, bis verlässlichere Daten zur Verfügung stehen? Der Vorwurf, vor der massiven Promotionskampagne der Impfindustrie eingeknickt zu sein, bleibt ihr so nicht erspart."
Hier ist die ausführliche Stellungnahme nachzulesen: Die HPV-Impfung
Gerd Marstedt, 28.3.2007
Eine Checkliste für die Gesundheit soll US-Amerikaner zu noch mehr Früherkennungs - Untersuchungen motivieren
 Die "Agency for Healthcare Research and Quality", eine Forschungs- und Kontrollbehörde der US-Regierung hat eine Checkliste für die Gesundheit herausgegeben, die in komprimierter Form für amerikanische Männer und Frauen Empfehlungen ausspricht, welche Früherkennungsuntersuchungen in welchem Alter sinnvoll sind, welche körperlichen Funktionswerte man beim Arzt überprüfen lassen sollte und welche Verhaltensweisen im Alltag dazu beitragen, die Gesundheit zu erhalten.
Die "Agency for Healthcare Research and Quality", eine Forschungs- und Kontrollbehörde der US-Regierung hat eine Checkliste für die Gesundheit herausgegeben, die in komprimierter Form für amerikanische Männer und Frauen Empfehlungen ausspricht, welche Früherkennungsuntersuchungen in welchem Alter sinnvoll sind, welche körperlichen Funktionswerte man beim Arzt überprüfen lassen sollte und welche Verhaltensweisen im Alltag dazu beitragen, die Gesundheit zu erhalten.
Die Ratschläge basieren nach eigener Aussage der Behörde auf evidenz-basierten Forschungsergebnissen. Sie wurden in komprimierter Form zusammengestellt, um der quantitativen Flut und Unübersichtlichkeit von Internet-Informationen zur Gesundheit etwas entgegen zu setzen. Auch die Beeinflussung der Informationen auf vielen Gesundheits-Websites durch kommerzielle Interessen war ein Anlass für die Veröffentlichung.
Die Broschüre soll von Benutzern individuell gelesen oder auch zum Arzt mitgenommen und dort in der Sprechstunde diskutiert werden. Sie hat für Männer und Frauen einen unterschiedlichen Inhalt. Aufgeteilt sind die Broschüren jeweils in mehrere Abschnitte, in denen unter anderem die Themen behandelt werden:
• Früherkennungs- und Kontrolluntersuchungen: Welche Untersuchungen in welchem Alter wichtig sind
• Tägliche Schritte zur Gesundheit (Ratschläge zum Gesundheitsverhalten)
• Welche Arzneimittel zur Krankheitsverhütung sinnvoll und welche nicht?
Ergänzend zu diesen Broschüren gibt es im Internet ausführliche Informationen zur Prävention , Krankheitsfrüherkennung und zum Gesundheitsverhalten, dabei gibt es spezielle Informationsangebote auch für Ältere ab 50.
Bei den Früherkennungs- und Kontrolluntersuchungen für Frauen werden beispielsweise folgende Empfehlungen gegeben:
• Überprüfung des Body-Mass-Index (BMI)
• Brustkrebsuntersuchungen: Mammographie alle 1-2 Jahre ab dem Alter von 40
• Gebärmutterhalskrens: Screening alle 1-3 Jahre im Alter von 21-65 Jahren
• Kontrolle des Cholesterinspiegels: regelmäßig ab 45
• Bluthochdruckkontrolle alle 2 Jahre
• Darmkrebsuntersuchungen ab dem Alter von 50
• Diabetes: Kontrolle bei hohem Blutdruck oder ungünstigen Cholesterinwerten
• Depression: bei Anzeichen von Niedergeschlagenheit, Hoffnungs- oder Interesselosigkeit in den letzten zwei Wochen sollte der Arzt gefragt werden
• Chlamydien und sexuell übertragbare Krankheiten: Kontrolluntersuchungen für unter 25jährige bei regelmäßigem Sex
• HIV-Test: bei ungeschütztem Sex, Schwangerschaft und einigen anderen Voraussetzungen
Selbst wenn man in Rechnung stellt, dass die Broschüre mit ihren Empfehlungen nicht bei sehr vielen Amerikanern nennenswerte Veränderungen des Gesundheitsverhaltens hervorrufen wird, dürfte sie schon bald etliche Kritiker auf den Plan rufen. Man kann die Broschüren ohne Weiteres kritisieren, werden doch pauschale und undifferenzierte Empfehlungen ohne jede Abwägung von Chancen und Risiken (wie z.B. Falsch-Positiv-Befunde und darauf folgende z.T. gesundheitsriskante diagnostische Methoden) einer Früherkennung abgegeben.
• Broschüre für Frauen: Women: Stay Healthy at Any Age - Your Checklist for Health
• Broschüre für Männer: Men: Stay Healthy at Any Age - Your Checklist for Health
• Ergänzende Gesundheits-Informationen: The Pocket Guide to Good Health For Adults
• Ergänzende Gesundheits-Informationen für Ältere: The Pocket Guide to Staying Healthy at 50+
Gerd Marstedt, 22.3.2007
Erzwungene Vorsorge-Untersuchungen bei Kindern zur Vermeidung häuslicher Gewalt sind der falsche Weg
 Der Tod von Kindern durch elterliche Misshandlung und unterbliebene Fürsorge hat 2006 für großes Aufsehen gesorgt und eine Suche nach Lösungen ausgelöst, um häusliche Gewalt zu vermeiden. Politiker haben vorgeschlagen, Kindervorsorge-Untersuchungen verpflichtend einzuführen. Gegen diesen Vorschlag hat jetzt das Deutsche Netzwerk Evidenzbasierte Medizin Stellung genommen und darauf hingewiesen, dass erzwungene Vorsorge-Untersuchungen wenig erfolgversprechend sind, da gewaltbereite Eltern sehr häufig den Kinderarzt wechseln und Misshandlungen dadurch oft unentdeckt bleiben. Zugleich gibt es jedoch eine große Zahl wissenschaftlicher Studien, die eindeutig belegen, dass eine aufsuchende Fürsorge von Hochrisikofamilien, also unangemeldete präventive Besuche in der Familie durch ausgebildetes Personal in der Lage sind, die Zahl der Fälle von Gewalt, Vernachlässigung oder Misshandlung einzugrenzen.
Der Tod von Kindern durch elterliche Misshandlung und unterbliebene Fürsorge hat 2006 für großes Aufsehen gesorgt und eine Suche nach Lösungen ausgelöst, um häusliche Gewalt zu vermeiden. Politiker haben vorgeschlagen, Kindervorsorge-Untersuchungen verpflichtend einzuführen. Gegen diesen Vorschlag hat jetzt das Deutsche Netzwerk Evidenzbasierte Medizin Stellung genommen und darauf hingewiesen, dass erzwungene Vorsorge-Untersuchungen wenig erfolgversprechend sind, da gewaltbereite Eltern sehr häufig den Kinderarzt wechseln und Misshandlungen dadurch oft unentdeckt bleiben. Zugleich gibt es jedoch eine große Zahl wissenschaftlicher Studien, die eindeutig belegen, dass eine aufsuchende Fürsorge von Hochrisikofamilien, also unangemeldete präventive Besuche in der Familie durch ausgebildetes Personal in der Lage sind, die Zahl der Fälle von Gewalt, Vernachlässigung oder Misshandlung einzugrenzen.
Mitte Mai 2006 hatte der Bundesrat nach dem Bekanntwerden von Gewalt gegen Kinder die Bundesregierung aufgefordert, gesetzliche Grundlagen für eine bessere Inanspruchnahme von Früherkennungsmaßnahmen für Kinder zu schaffen. Im Deutschen Ärzteblatt heißt es dazu: Solche Maßnahmen "sollten in Zukunft so verpflichtend wie möglich gestaltet werden. Die Länder verlangen vor allem, die rechtliche Basis für verbindliche Einladungen zu schaffen ..." (Vorsorge für Kinder: Votum für mehr Verbindlichkeit)
Das Deutsche Netzwerk Evidenzbasierte Medizin (DNEbM) hat zu diesem Vorschlag jetzt Stellung genommen und datrauf hingewiesen, dass das Ziel, die Zahl von Kindesvernachlässigung und Kindesmisshandlung zu vermindern, vom DNEbM ausdrücklich unterstützt wird. Es gibt jedoch keinen Beleg dafür, dass ein Zwang zu Vorsorgeuntersuchungen beim Kinderarzt eine wirksame Vorbeugung gegen Vernachlässigung oder Gewalt gegen Kinder ist, während es andererseits eindeutige Belege gibt für die Wirksamkeit aufsuchender Fürsorge von Hochrisikofamilien durch ausgebildetes Personal. Daher seien möglichst lückenlose Vorsorgeuntersuchungen bei Kindern wünschenswert, aber nicht um Vernachlässigung, sondern um sich anbahnende medizinische Defizite zu erkennen und entsprechende Gegenschritte zu veranlassen.
Das Netzwerk zitiert zu der Frage, mit welchen Methoden Kindesvernachlässigung und Kindesmisshandlung vorgebeugt werden kann, eine sehr grundlegende neuere Meta-Analyse belgischer Wissenschaftler, in der die Ergebnisse von 40 schon veröffentlichten Studien bilanziert werden. Das Ergebnis ist eindeutig: Frühe präventive Maßnahmen durch Aufsuchen von Hochrisikofamilien zeigen einen signifikanten Rückgang von Vernachlässigung und Gewalt gegen Säuglinge und Kinder durch diese Maßnahme. Das Abtract zur Studie ist hier zu lesen: The Effects of Early Prevention Programs for Families with Young Children at Risk for Physical Child Abuse and Neglect: A Meta-Analysis (Child Maltreatment, Vol. 9, No. 3, 277-291, 2004)
Solche Belege fehlen aber nach Auffassung von DNEbM für die Wirkung von Zwangsuntersuchungen. Keine einzige Untersuchung oder Studie zeige, dass mit einer Zwangs-Vorsorgeuntersuchung Vernachlässigungen oder Misshandlungen von Säuglingen und Kleinkindern vorgebeugt werden könnte. Gegen Zwangsuntersuchungen spricht, dass misshandelnde oder vernachlässigende Eltern häufiger den Arzt wechseln, so dass ein einzelner Arzt sich kein solides Bild machen oder einen langjährigen Patienten-Arzt-Kontakt aufbauen kann. Dies wäre zur Entdeckung von Vernachlässigung von oder Gewalt gegen Kinder jedoch notwendig. Die Studie ist im Volltext hier nachzulesen: Patterns of Health Care Use That May Identify Young Children Who Are at Risk for Maltreatment (Pediatrics 2005; 116; 1303-1308)
Der politischen Forderung, Zwangsuntersuchungen zur Eindämmung von Misshandlung und Vernachlässigung einzuführen, fehlt also nicht nur ein Beweis oder zumindest Hinweis auf einen Nutzen für die Kinder. Der Vorschlag lässt auch mögliche "Nebenwirkungen" außer Acht. Die Vorsorgeuntersuchungen für Kinder werden heute von über 90 Prozent der Eltern akzeptiert. Diese Eltern bringen ihre Kinder zum Kinderarzt, weil sie ihm und seiner Kompetenz vertrauen, Entwicklungsdefizite rechtzeitig zu erkennen und betroffene Kinder optimal zu fördern. Dieses bei über 90% der deutschen Eltern bestehende Vertrauen ginge verloren gegenüber einem Kinderarzt, der einen staatlich verordneten "Misshandlungs-Check" durchführen müsste. Außerdem lenken Zwangsuntersuchungen von sinnvolleren Alternativen ab.
Gerd Marstedt, 4.2.2007
Neue Studien schüren weiteren Zweifel am Nutzen des Mammographie-Screening
 Die Debatte um den gesundheitlichen Nutzen des für Deutschland flächendeckend geplanten Mammographie-Screening (zweijährliche Untersuchung für 50-69jährige Frauen) wird durch zwei neuere Studien weiter angeheizt. Beide Studien können zwar die These der Kritiker des Mammographie-Programms nicht eindeutig belegen, dass der gesundheitliche Schaden größer ist als der Nutzen. Indes: Belege für einen gesundheitlichen Nutzen im Sinne einer nachhaltigen Senkung von Sterblichkeit oder Lebenserwartung bringen auch diese Studien nicht.
Die Debatte um den gesundheitlichen Nutzen des für Deutschland flächendeckend geplanten Mammographie-Screening (zweijährliche Untersuchung für 50-69jährige Frauen) wird durch zwei neuere Studien weiter angeheizt. Beide Studien können zwar die These der Kritiker des Mammographie-Programms nicht eindeutig belegen, dass der gesundheitliche Schaden größer ist als der Nutzen. Indes: Belege für einen gesundheitlichen Nutzen im Sinne einer nachhaltigen Senkung von Sterblichkeit oder Lebenserwartung bringen auch diese Studien nicht.
Gøtzsche und Nielsen haben in einer Übersichtsarbeit 7 methodisch fundierte Studien mit Einbezug von 500.000 Frauen bewertet. Danach wird durch regelmäßige Mammographie die Brustkrebssterblichkeit um 20 Prozent gesenkt. Da die Vorteile in den Studien mit der höchsten Qualität aber am niedrigsten ausfallen, halten sie eine Reduktion der Mortalität um 15 Prozent für wahrscheinlich und nur eine von 2.000 gescreenten Frauen profitiert von einer Lebensverlängerung durch die erfolgreiche Therapie einer Früherkennung. Dies sei zwar ein gewisser Nutzen, dem aber 10 von 2.000 Frauen gegenüberstehen, bei denen in 10 Jahren Tumore erkannt werden, die ohne Früherkennung niemals entdeckt worden wären. Folge davon sind unnötige Operationen, Chemo- und Radiotherapien, schreiben die Wissenschaftler. Die Chance auf Vorteile sei zu gering im Vergleich zum Risiko für schwere Schäden. Überdies müssten 200 von 2.000 Frauen damit rechnen, einen falschen Befund mitgeteilt zu bekommen. Eine solch irrtümliche Diagnose bringe für die Betroffenen aber erhebliche psychische Belastungen mit sich ebenso wie weitere unnötige Folgeuntersuchungen. Ein Abstract der Studie ist hier zu finden: PC Gøtzsche and M Nielsen: Screening for breast cancer with mammography
In einer zweiten jetzt veröffentlichten englischen Studie hatten Wissenschaftler 160.900 Frauen zwischen 39 und 41 Jahren nach dem Zufallsprinzip in eine Mammographie- und in eine Kontrollgruppe eingeteilt. Bis zum Alter von 48 sollten die Frauen der 1.Gruppe jährlich in 23 Mammographiezentren in England, Schottland und Wales untersucht werden. Im Ergebnis zeigte sich, dass keine statistisch signifikanten (also tatsächlich wirksame und nicht durch Zufall erklärbare) Unterschiede in der Zahl der Todesfälle durch Brustkrebs gefunden wurden. In der Mammographie-Gruppe waren es 2,35 Fälle pro 1.000 Teilnehmer, in der Kontrollgruppe 3,3. 23% Prozent der Teilnehmerinnen, die mindestens 7 Mammographien erhielten, bekamen überdies mindestens einmal ein falsch positives Ergebnis (falsche Krebs-Diagnose), bei Teilnehmerinnen über 50 Jahren liegt diese Fehlerquote nur bei 12%. Ein weiterer Minuspunkt war die höhere Strahlendosis, die für jüngere Frauen aufgrund des dichteren Brustgewebes nötig war und damit ein zusätzliches Krebsrisiko hervorrief. Die Autoren (Sue M. Moss u.a.) betonen daher, dass bei zukünftigen systematischen Screening-Vorhaben eine sorgfältige Abwägung von Nutzen und Schäden erfolgen sollte. Ein Abstract der Studie ist in der Zeitschrift "The Lancet" zu finden (kostenlose Registrierung erforderlich): Sue M Moss u.a.: Effect of mammographic screening from age 40 years on breast cancer mortality at 10 years' follow-up: a randomised controlled trial oder bei PubMed.gov
In der Öffentlichkeit werden oftmals Angaben wie "Senkung des Risikos um 25%" völlig falsch interpretiert. In einem Artikel in der "Financial Times Deutschland" heißt es dazu: "Eine Senkung der Sterblichkeit um bis zu 30 Prozent sage in absoluten Zahlen Folgendes aus: Ohne Screening sterben in zehn Jahren 4 von 1.000 Frauen an Brustkrebs, mit Röntgen-Check wären es drei. Von vier auf drei entspricht rechnerisch einer Reduzierung um 25 Prozent. Bezogen auf jede einzelne Frau senke die Untersuchung die Sterblichkeit aber nur um 0,1 Prozent." (vgl. "Der bundesweite Röntgen-Check gegen Brustkrebs ist das teuerste Früherkennungsprojekt der vergangenen Jahrzehnte. Der Nutzen des Programms ist jedoch zweifelhaft", in: Stefanie Kreiss: Suche nach Gewissheit)
Im Gegensatz zu den in neueren Studien sorgsam abwägenden Einschätzungen hinsichtlich des Nutzens eines sehr frühzeitigen Screenings ist die Bewertung der in drei Modellregionen in Deutschland eingeführten Programme wenig differenziert. "Zu einer uneingeschränkt positiven Bewertung der Früherkennungsmethode kommt in Deutschland hingegen der am 17. Oktober vorgelegte Abschlussbericht der Kooperationsgemeinschaft Mammographie," schreibt das Deutsche Ärzteblatt (Deutsches Ärzteblatt 103, Ausgabe 44 vom 03.11.2006). "Träger sind die Spitzenverbände der gesetzlichen Krankenkassen und die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV). Die drei deutschen Modellprojekte hätten die Anforderungen der europäischen Leitlinien zur Qualitätssicherung im Mammographie-Screening 'erfüllt und teilweise sogar übertroffen'." (Zylka-Menhorn, Vera; Meyer, Rüdiger: Mammographie-Screening: Divergierende Einschätzungen)
Über das Programm zum Mammographie-Screening informiert die Kooperationsgemeinschaft Mammographie und präsentiert auf der Website auch den Abschlussbericht Modellprojekte 0611
Eine fundamentale Kritikerin der Ausweitung und flächendeckenden Einführung von Screeningmaßnahmen ist die Hamburger Universitätsprofessorin Ingrid Mühlhauser. In einer Reihe von Veröffentlichungen hat sie ihre Bedenken und kritischen Stellungnahmen ausführlich dargelegt. Zu diesen Bedenken gehören (Zitate aus den unten genannten Publikationen):
• Früher ist nicht immer besser: Durch Mammographie-Screening werden überwiegend Brustkrebsformen diagnostiziert, die auch bei späterer Erkennung keine schlechtere Prognose haben. Die Zeitspanne, mit der Diagnose Brustkrebs zu leben, ist durch die Früherkennung verlängert, ohne dass dadurch notwendigerweise eine Verlängerung der Lebenserwartung besteht.
• Der Nutzen von Krebsfrüherkennung wird überschätzt: Tatsächlich können durch ein Screening von 1.000 Personen auf Brust- oder Darmkrebs über 10 Jahre bestenfalls l bis 2 Todesfälle durch diese Krebserkrankung verhindert oder verzögert werden.
• Früherkennung verändert die Lebenserwartung nicht: Ohne Mammographie-Screening sterben etwa 8 von 1000 Frauen, mit Mammographie-Screening 6 von 1.000. Das heißt, im günstigsten Fall hätten 2 von 1000 Frauen insofern einen Nutzen, als sie in der Zeit von 10 Jahren nicht an Brustkrebs sterben würden. Während dieser 10 Jahre versterben etwa 5-mal so viele Frauen an anderen Krebserkrankungen und insgesamt etwa 10-mal so viele Frauen an anderen Todesursachen.
• Screening beunruhigt: So müssen sich 5-10 von je 100 Frauen wegen verdächtiger Befunde weiteren Untersuchungen unterziehen, bis geklärt ist, dass kein Brustkrebs vorliegt. Von 1.000 Frauen im Alter zwischen 50 und 60 Jahren, die über 10 Jahre an einem Mammographie-Screening teilnehmen, müssen etwa 200 mit einem falsch positiven Ergebnis rechnen, bei etwa 60 Frauen erfolgt eine Biopsie, obwohl kein Brustkrebs vorliegt. Für nicht qualitätsgesichertes Screening liegen diese Zahlen noch deutlich höher
• Früherkennung schadet: Die Überdiagnosen von Brustkrebs führen zu unnötigen Operationen, Strahlenbehandlungen und Chemotherapien, Brustkrebs-Screening führt nicht zu einer Abnahme, sondern zu einer Zunahme von therapeutischen Eingriffen, einschließlich von Mastektomien
Die Argumente von Prof. Mühlhauser sind hier nachzulesen:
• Mühlhauser I, Steckelberg A: Aufklärung über Krebsfrüherkennung am Beispiel Mammographie- und Darmkrebs-Screening
• Mühlhauser I: Pro & Contra Mammographie-Screening. In: Gerhard I, Kiechle M (Hrsg.) Gynäkologie integrativ. München 2005
Gerd Marstedt, 8.1.2007
Der Unsinn der Bestrafung von Krebskranken bei Nichtinanspruchnahme von Früherkennungsuntersuchungen
 Ob die anfängliche Absicht der Bundesregierung im "Wettbewerbsstärkungsgesetz", Krebskranke bei Auftreten einer Krebserkrankung die Ermäßigung der Zuzahlung zu verweigern, wenn sie nicht an den entsprechenden Krebsfrüherkennungsuntersuchungen teilgenommen haben, im endgültigen Gesetz überlebt, weiß niemand.
Ob die anfängliche Absicht der Bundesregierung im "Wettbewerbsstärkungsgesetz", Krebskranke bei Auftreten einer Krebserkrankung die Ermäßigung der Zuzahlung zu verweigern, wenn sie nicht an den entsprechenden Krebsfrüherkennungsuntersuchungen teilgenommen haben, im endgültigen Gesetz überlebt, weiß niemand.
Dass derartige Pläne gesundheitswissenschaftlich und -ökonomisch unsinnig sind, steht für das "Deutsche Netzwerk Evidenzbasierte Medizin e.V." fest. In dem seit 2000 existierenden Netzwerk sind Ärzte und Wissenschaftler zahlreicher Fach- und Forschungsrichtungen aktiv, die Konzepte und Methoden der evidenzbasierten Medizin (EbM) in klinischer Praxis, Lehre und Forschung anwenden und weiter entwickeln. Zu dieser Entwicklung gehört auch unabhängige wissenschaftsbasierte Information der Öffentlichkeit.
Am 11. Dezember 2006 lehnt das Netzwerk die Absicht des § 62 aus verschiedenen Gründen eindeutig ab:
• "Die Entscheidung für oder gegen eine Krebsfrüherkennungsuntersuchung erfordert eine individuelle, ergebnisoffene Abwägung von Nutzen und Schaden. Die Entscheidung für oder gegen eine medizinische Maßnahme muss frei bleiben. Eine Bestrafung bei Nicht-Teilnahme ist mit dem Prinzip der Eigenverantwortung und Autonomie der Bürgerinnen und Bürger unvereinbar.
• Die Wahrscheinlichkeit, als Einzelner von der Früherkennung zu profitieren, ist eher gering. So erspart die Teilnahme am Früherkennungsprogramm für Brustkrebs innerhalb von 10 Jahren etwa einer von 1.000 Teilnehmerinnen den Tod an Brustkrebs. Mit einem Verdachtsbefund müssen innerhalb von 10 Jahren jedoch 200 Frauen rechnen. Dieser Verdachtsbefund erfordert eine weitergehende Abklärung bis hin zu operativen Eingriffen. Die Bundesregierung unterschätzt ganz offensichtlich, dass die Teilnahme an der Krebsfrüherkennung für eine erhebliche Anzahl von Personen mit Belästigungen und Risiken verbunden ist.
• Nicht-Teilnahme an der Krebsfrüherkennung hat für die Versichertengemeinschaft keine nachteiligen Folgen. Es gibt keine ausreichenden Nachweise dafür, dass die Teilnahme an einem Krebsfrüherkennungsprogramm Kosten erspart.
• Krebstherapien können sehr teuer sein. Die Regelung würde ausgerechnet diejenigen finanziell bestrafen, die wegen Ihrer Krankheit ganz besonders der Solidarität bedürfen."
Zur Erläuterung stützen sich die Netzwerker auf entsprechende evidenzbasierten Erkenntnisse des Nutzens und Schadens der verschiedenen Früherkennungsuntersuchungen:
• "Krebsfrüherkennungsprogramme zielen auf die Senkung der Sterblichkeit an der jeweiligen Krebsart. Bislang gibt es nur für drei Methoden einen Nachweis, dass sie die krebsartbezogene Sterblichkeit tatsächlich senken können. Das sind die Mammographie zur Früherkennung von Brustkrebs, der Okkultbluttest für die Früherkennung von Dickdarmkrebs und - mit Einschränkung - der "PAP"-Abstrich für die Früherkennung von Gebär-mutterhalskrebs. Aber auch für diese Methoden gilt, dass aus Sicht der Teilnehmer nur wenige von 1000 durch Früherkennung einen Krebstod vermeiden können. Zum Beispiel lässt sich abschätzen, dass von 1.000 Frauen, die 10 Jahre lang an der Mammographie zur Brustkrebs-früherkennung beteiligen, etwa einer Frau der Tod an Brustkrebs erspart bleibt.
• Jedem Teilnehmer der Krebsfrüherkennungsprogramme, der diesen Nutzen hat, steht jedoch eine zumeist weitaus größere Zahl von Teilnehmern gegenüber, die einen Schaden erleiden. Direkte Schäden entstehen durch die Untersuchung selbst, zum Beispiel durch Röntgenstrahlung oder durch Darmspiegelung. Im deutschen Koloskopie-Programm kam es in 2 bis 7 Fällen von 10.000 Spiegelungen zu Verletzung bis hin zu Durchstoßungen der Darmwand, die einen Krankenhausaufenthalt notwendig machten. Die Wahrscheinlichkeit für solche direkten Schäden ist für den Einzelnen zwar zumeist gering, für denjenigen, der davon betroffen ist, handelt es sich jedoch um ein gravierendes Ereignis. Die möglichen direkten Schäden dürfen daher bei der Aufklärung nicht verschwiegen oder verharmlost werden.
• Wesentlich größere Tragweite haben zumeist die indirekten Risiken, die sich aus dem Befund der Untersuchung ergeben. Dazu gehören vor allem falsch-positive Befunde (Verdachtsbefunde), die eine Abklärung mit weiteren Verfahren erfordern, die ihrerseits zu Belastungen und Schäden führen können. Besonders schwerwiegend ist, dass durch Früherkennung auch Tumore entdeckt werden, die zwar bösartig erscheinen, die aber im weiteren Leben nie auffällig geworden wären. Solche Diagnosen ohne Krankheitswert nennt man Überdiagnosen. Weil diese Tumore fälschlicherweise als gefährlich beurteilt werden, führen sie zu risikobehafteter Übertherapie bis hin zu Operation, Bestrahlung und Chemotherapie. Bei der Brustkrebsfrüherkennung durch Mammographie schätzen Fachleute, dass sich unter zehn gefundenen Tumoren eine bis fünf solcher Überdiagnosen befindet."
Sie finden den gesamten Text der Presserklärung des "Deutschen Netzwerks Evidenzbasierte Medizin" samt einiger Literaturhinweise hier.
Bernard Braun, 11.12.2006
Über- und Fehlversorgung beim PSA-Screening für ältere Männer
 Die meisten spezifischen Leitlinien empfehlen nicht, älteren Männern ein Screening für das so genannte prostataspezifische Antigen (PSA) und die damit verfolgte Absicht, einen Prostatakrebs identifizieren zu können, anzubieten. Angesichts der zum Teil begrenzten Lebenserwartung drohen nämlich die unerwünschten und belastenden Folgen dieser Untersuchung (z.B. bei falsch-negativen Ergebnissen) die erwartbaren Vorteile zu überwiegen. Wie oft bei älteren Männer trotzdem PSA-Tests angeboten und durchgeführt werden, war bisher nicht an größeren Gruppen untersucht worden.
Die meisten spezifischen Leitlinien empfehlen nicht, älteren Männern ein Screening für das so genannte prostataspezifische Antigen (PSA) und die damit verfolgte Absicht, einen Prostatakrebs identifizieren zu können, anzubieten. Angesichts der zum Teil begrenzten Lebenserwartung drohen nämlich die unerwünschten und belastenden Folgen dieser Untersuchung (z.B. bei falsch-negativen Ergebnissen) die erwartbaren Vorteile zu überwiegen. Wie oft bei älteren Männer trotzdem PSA-Tests angeboten und durchgeführt werden, war bisher nicht an größeren Gruppen untersucht worden.
Diesen Zustand hat jetzt der von Louise C. Walter; Daniel Bertenthal; Karla Lindquist und Badrinath R. Konety in der Fachzeitschrift JAMA (2006;296:2336-2342)veröffentlichte Forschungsbericht "PSA Screening Among Elderly Men With Limited Life Expectancies" beendet.
Bei einer Analyse der Daten von knapp 600.000 70 Jahre alten und älteren Männern, die 2002/2003 beim US Departement of Veterans Affairs (VA) oder Medicare krankenversichert waren, zeigte sich folgende Screening-Wirklichkeit:
• 56 % der Gesamtkohorte erhielten innerhalb eines Jahres einen PSA-Test,
• die Screeningrate sank zwar mit zunehmendem Alter, aber immerhin wurden auch noch Männer, die 85 Jahre und mehr alt waren noch getestet - obwohl weniger als 10 % dieser Männer die nächsten 10 Jahre überleben werden und Leitlinien solche Tests nicht empfehlen, wenn die Lebenserwartung der Personen kürzer als 10 Jahre ist,
• die Screeningsrate hatte auch kaum etwas mit dem Gesundheitszustand der Männer zu tun: Bei den 85+-Personen erhielten 34 %, die sich bester Gesundheit erfreuten genauso wie die 36 %, deren Gesundheitszustand sehr schlecht war, den Test. In multivariaten Analysen hatten viele nichtklinischen Faktoren und Merkmale, wie etwa der Familienstand und die Region in einem Bundesstaat einen größeren Effekt auf die Duurchführung von PSA-Tests als der Gesundheitszustand.
Männern im fortgeschrittenen Alter und mit ernsten sonstigen Erkrankungen - so die Autoren - "should be told that PSA screening is more likely to harm them than to help them". Hier handelt es sich also neben der Überversorgung mit einem hinsichtlich seines Nutzens heftig umstrittenen Test auch um Fehlversorgung, wenn ein möglicher mentaler Folgeschaden größer ist.
Damit werden auch die Ergebnisse von drei bereits im Sommer veröffentlichten Studien in kleineren Gruppen von Männern bestätigt, deren Zusammenfassung der von den Herausgebern des renommierten "New England Journal of Medicine" getragene Medizin-Informationsdienst "Journal Watch. Medicine that matters" bereits im September veröffentlichte. Zum Hintergrund der Verbreitung des PSA-Tests bei älteren Männern aber auch in anderen Altersgruppen führten die Journal Watch-Autoren aus: "Many factors, including media hype, ambiguous messages from professional and advocacy groups, and physicians' fear of litigation, undoubtedly contribute to these trends."
Weitere kritische Anmerkungen zum Sinn und den Risiken des PSA-Tests aber auch anderer Früherkennungsuntersuchen stehen auf der Website Mythos Krebsvorsorge
Hier finden Sie das Abstract des Aufsatzes.
Bernard Braun, 15.11.2006
Früherkennungsuntersuchungen: Nicht-Teilnahme soll finanziell bestraft werden
 Im neuen Gesundheitsreform-Vorhaben der Großen Koalition ist geplant, Zuzahlungen bei späteren chronischen Erkrankungen dann zu erhöhen, wenn zuvor nicht an entsprechenden Früherkennungsuntersuchungen teilgenommen wurde. Zwar sind Details im Referentenentwurf zum "Wettbewerbsstärkungsgesetz" noch offen, fest steht jedoch, dass bei bestimmten (noch nicht abschließend festgelegten) chronischen Erkrankungen die Betroffenen bis zu 2 Prozent (statt ansonsten 1 Prozent) ihres Bruttoeinkommens für Zuzahlungen leisten müssen, wenn sie zuvor nicht an Früherkennungsuntersuchungen für diese Erkrankung teilgenommen haben. Das Vorhaben hat vielfältige Kritik hervorgerufen, unter anderem deshalb, weil Tauglichkeit und Zuverlässigkeit vieler Früherkennungsuntersuchung ungesichert sind.
Im neuen Gesundheitsreform-Vorhaben der Großen Koalition ist geplant, Zuzahlungen bei späteren chronischen Erkrankungen dann zu erhöhen, wenn zuvor nicht an entsprechenden Früherkennungsuntersuchungen teilgenommen wurde. Zwar sind Details im Referentenentwurf zum "Wettbewerbsstärkungsgesetz" noch offen, fest steht jedoch, dass bei bestimmten (noch nicht abschließend festgelegten) chronischen Erkrankungen die Betroffenen bis zu 2 Prozent (statt ansonsten 1 Prozent) ihres Bruttoeinkommens für Zuzahlungen leisten müssen, wenn sie zuvor nicht an Früherkennungsuntersuchungen für diese Erkrankung teilgenommen haben. Das Vorhaben hat vielfältige Kritik hervorgerufen, unter anderem deshalb, weil Tauglichkeit und Zuverlässigkeit vieler Früherkennungsuntersuchung ungesichert sind.
So hat die Stiftung Warentest 46 gängige Früherkennungsverfahren untersucht, das Ergebnis unter dem Strich lautet: "Die meisten Methoden sind für die Krebsfrüherkennung nicht oder nur wenig geeignet." Als ungeeignet wurde ein Verfahren dabei eingestuft, wenn es zu viele "Falsch-Negativ-Befunde" liefert (der Tumor ist bereits vorhanden, wird aber mit der Methode nicht erkannt) oder auch zu viele "Falsch-Positiv-Befunde" (Das Testergebnis sagt, es gäbe einen Tumor, obwohl dies nicht der Fall ist). Für die Studie wurde internationale Fachliteratur und Studien gesichtet. Die Ergebnisse wurden jetzt in einer Buchveröffentlichung zusammen gestellt, mit insgesamt 50 Bewertungen zu den gängigsten Verfahren. Insgesamt fällt die Bilanz eher erschreckend aus. Nur die Mammografie ist bei Frauen zwischen 50 und 70 Jahren zur Krebsvorsorge geeignet, weitere 13 Methoden sind nur wenig oder mit Einschränkung geeignet und 36 Verfahren eignen sich überhaupt nicht zur Krebsfrüherkennung.
Als Negativbeispiel führt die Stiftung Warentest den sog. HPV-Test an. "Dieser soll als Früherkennungsmethode für Gebärmutterhalskrebs Infektionen der Muttermundschleimhaut mit bestimmten Warzenviren nachweisen. Einige dieser Viren können auch Jahre nach einer Infektion ein Krebswachstum begünstigen. Für den Test benötigt der Frauenartz einen Abstrich vom Gebärmuttermund. Dieser ist einfach und gefahrlos zu entnehmen. Doch bei vielen Frauen führt die Untersuchung zu falschen Verdachtsbefunden. Die Folge: Ängste und sogar unnötige Operationen. Zudem gibt es kaum zuverlässige Studien, die belegen, dass die Untersuchung das Risiko senkt, an Gebärmutterhalskrebs zu erkranken. Der HPV-Test ist daher als Früherkennungsmethode nicht geeignet."
Das Buch (290 Seiten) ist im Handel für 19,90 Euro erhältlich oder kann bei der Stiftung Warentest bestellt werden: Ratgeber Krebsfrüherkennung.
Unter dem Motto ""Wer nicht zur Krebs-Früherkennung geht, braucht kein schlechtes Gewissen zu haben" berichtet auch eine andere Buchveröffentlichung über den "Mythos Krebsvorsorge". Christian Weymayr und Klaus Koch berichten in ihrer sorgfältig recherchierten Veröffentlichung (im Eichborn Verlag) über Schaden und Nutzen der Früherkennung. Im Klappentext heißt es: "Dies ist ein kritisches, aber kein polemisches Buch. Wir entwerfen keine Antithese zur gängigen Vorstellung 'Rechtzeitig erkannt - geheilt'. Wir beleuchten vielmehr Schaden und Nutzen der einzelnen Früherkennungsmethoden. Mit der pauschalen Ablehnung der Vorsorge würden wir in dieselbe Vereinfachungsfalle tappen wie deren Befürworter. [...] Der Präventionsgedanke gilt als der heilige Gral der Krebsmedizin. Die Eckpunkte der Argumentation: Rechtzeitig erkannte Tumoren lassen sich im Keim ersticken. Früherkennung ist harmlos und schadet nicht. Das Gesundheitssystem wird finanziell entlastet. Doch so einfach ist es nicht. Wir zeigen in diesem Buch, dass keines der Argumente wirklich stimmt. Dass die Befürworter sie dennoch mit soviel Vehemenz vortragen, macht das Mythische der Früherkennung aus."
Auf der Website Mythos Krebsvorsorge wird das detaillierte Inhaltverzeichnis der Buchveröffentlichung gezeigt und es gibt ausführliche Leseproben (mehrere Kapitel, u.a.: Leben mit der Angst vor Krebs - Wie man sich fühlt, wenn man zur Früherkennung geht - Unnötige Sorgen - Wenn ein Verdacht zur Sicherheit wird - Wie man sich fühlt, wenn man nicht zur Früherkennung geht - Vom Gesunden zum Patienten).
Gerd Marstedt, 30.10.2006
Brustkrebs: EU fordert Staaten zu mehr Anstrengungen bei der Früherkennung auf
 Weltweit erkrankt etwa eine Million Frauen pro Jahr an Brustkrebs, in Deutschland diagnostizieren die Mediziner jedes Jahr rund 51.000 neue Fälle. Für 19.000 Frauen unter ihnen kommt jede Hilfe zu spät. Trotz aller Fortschritte: Brustkrebs ist für Frauen im Alter zwischen 35 und 65 Jahren noch immer die häufigste Todesursache und hat einen Anteil von 24 % bei den Krebsneuerkrankungen der Frauen. (Detaillierte Informationen zum Vorkommen von Brustkrebs findet man im Gesundheitsbericht des Robert-Koch-Instituts "Themenheft 25: Brustkrebs"). Jetzt macht die Europäische Union Druck. Am internationalen Brustkrebstag veröffentlichte der Brüsseler Gesundheitskommissar Markos Kyprianou Leitlinien, in denen die EU den 25 Mitgliedsstaaten die Förderung des digitalen Screenings und den Aufbau eines landesweiten Brustzentren-Netzes empfiehlt.
Weltweit erkrankt etwa eine Million Frauen pro Jahr an Brustkrebs, in Deutschland diagnostizieren die Mediziner jedes Jahr rund 51.000 neue Fälle. Für 19.000 Frauen unter ihnen kommt jede Hilfe zu spät. Trotz aller Fortschritte: Brustkrebs ist für Frauen im Alter zwischen 35 und 65 Jahren noch immer die häufigste Todesursache und hat einen Anteil von 24 % bei den Krebsneuerkrankungen der Frauen. (Detaillierte Informationen zum Vorkommen von Brustkrebs findet man im Gesundheitsbericht des Robert-Koch-Instituts "Themenheft 25: Brustkrebs"). Jetzt macht die Europäische Union Druck. Am internationalen Brustkrebstag veröffentlichte der Brüsseler Gesundheitskommissar Markos Kyprianou Leitlinien, in denen die EU den 25 Mitgliedsstaaten die Förderung des digitalen Screenings und den Aufbau eines landesweiten Brustzentren-Netzes empfiehlt.
In Deutschland werden jedes Jahr rund fünf Millionen Mammographien gemacht. In den meisten Fällen meinen Experten jedoch, dass die Qualität mangelhaft ist, weil beispielsweise keine Doppelbefundung und keine Qualitätskontrolle gewährleistet ist. "In Deutschland könnte allein durch qualitätsgesichertes Screening pro Tag zehn Frauen das Leben gerettet werden", erklärte die Bremer SPD-Europaabgeordnete Karin Jöns, deren Parlamentsbericht aus dem Jahr 2003 die Grundlage für die EU-Leitlinien bildet. Die Empfehlungen zur flächendeckenden Ausdehnung der Mammographie (alle Frauen zwischen 50 und 69 Jahren sollen alle zwei Jahre zur Röntgenuntersuchung der Brust eingeladen werden) sind jedoch nicht unumstritten.
So weisen zum Beispiel Bremer Wissenschaftler darauf hin, dass "über den tatsächlichen Nutzen der Früherkennungsmammografie in der wissenschaftlichen Literatur keine Einigkeit herrscht." In einer Broschüre (Institut für Public Health und Pflegeforschung der Universität Bremen, Ärztekammer Bremen (Hrsg.): Mammografie Screening - Was Multiplikatorinnen vor Ort wissen sollten) wird überdies auf den bislang oft unterbelichteten Aspekt der Beratung und sozialen Unterstützung betroffener Frauen hingewiesen: "Die Bedürfnisse der Frauen, für die ja eigentlich das Screening eingeführt wird, geraten dabei schnell aus dem Blick. Welche Informationen benötigen sie, um entscheiden zu können, ob sie das Screening in Anspruch nehmen wollen? Wo können sich Frauen vor oder nach dem Screening beraten lassen? Wie wird die Würde der Frau im Screening geachtet? Wie kann der Datenschutz gesichert werden? An wen kann sich eine Frau wenden, wenn sie Kritik oder Beschwerden über den Ablauf der Reihenuntersuchung hat?" Broschüre Mammographie-Screening, S. 4).
Gerd Marstedt, 18.10.2005