



Home | Patienten | Gesundheitssystem | International | GKV | Prävention | Epidemiologie | Websites | Meilensteine | Impressum
Sämtliche Rubriken in
"Patienten"
Krankenhaus, stationäre Versorgung |
Verhaltenssteuerung (Arzt, Patient), Zuzahlungen, Praxisgebühr |
Alle Artikel aus:
Patienten
Krankenhaus, stationäre Versorgung
Klinikpflegekräfte verwenden 23,6 % ihrer Wochenarbeitszeit für Dokumentation. Digitale Assistenzsysteme als Lösung?
 Praktisch alle Angehörigen von patientenbehandelnden Berufen im stationären und ambulanten Bereich klagen seit Jahren über die laufende Abnahme ihrer Arbeitszeit für patientennahen Tätigkeit durch die wachsenden Dokumentationsarbeiten. Für jede Pflegefachperson wurde zu Beginn der Nuller-Jahre geschätzt, dass für diese Tätigkeit von einer 38,5 Stundenwoche fachgebietsübergreifend etwa 20 Prozent der Arbeitszeit und damit 7,7 h pro Woche verwendet werden musste.
Praktisch alle Angehörigen von patientenbehandelnden Berufen im stationären und ambulanten Bereich klagen seit Jahren über die laufende Abnahme ihrer Arbeitszeit für patientennahen Tätigkeit durch die wachsenden Dokumentationsarbeiten. Für jede Pflegefachperson wurde zu Beginn der Nuller-Jahre geschätzt, dass für diese Tätigkeit von einer 38,5 Stundenwoche fachgebietsübergreifend etwa 20 Prozent der Arbeitszeit und damit 7,7 h pro Woche verwendet werden musste.
Wie die Ist-Situation von Pflegekräften in Krankenhäusern aktuell aussieht, wie technikaffin die Pflegekräfte sind und welche Lösungsvorstellungen sie haben, wurde methodisch aufwändig im Rahmen des Forschungsprojektes "Eingabefreie Station - Bewegungsbasierte Aufnahme von Pflegetätigkeiten zur automatisierten Dokumentation im Krankenhaus" am Dortmunder Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML untersucht. Gefördert wurde dieses Projekt durch die Europäische Union und das Land Nordrhein-Westfalen im Zuge des Leitmarktes Gesundheit.NRW.
Die Situation wurde mit zwei Methoden erfasst:
• Mit einer standardisierten Online-Befragung aller Pflegekräfte in zwei Krankenhäuser der Grund- und Regelversorgung (200 und 228 Betten) und eine Rehabilitationsklinik (121 Betten). Von den insgesamt 531 im Februar und März 2021 befragten angestellten Pflegefachpersonen in den drei Pilotkrankenhäusern beantworteten 74 oder rund 14 Prozent den Fragebogen.
• Mit einer sensorbasierte Langzeitmessung für die die Pflegestationen sowie Pflegefachpersonen mit innovativer Sensorik ausgestattet und die Messdaten durch Deep Learning-Algorithmen ausgewertet wurden.
Die Ergebnisse beider Erhebungen sahen folgendermaßen aus:
• Der in der Onlinebefragung selbst eingeschätzte Zeitaufwand für Dokumentationsarbeiten betrug pro Schicht durchschnittlich 52 Minuten.
• Der mit Sensoren technisch gemessene Zeitaufwand je Schicht betrug mehr, nämlich mit durchschnittlich 109 Minuten mehr als das Doppelte. Zusätzlich lieferte die technische Messung weitere differenzierte Kennzahlen für zeitliche Aufwände für patientennahe und -ferne Tätigkeiten: Von der gesamten Arbeitszeit pro Schicht entfielen auf die Arbeit am Patienten und den Wegen dazwischen 51 %, auf die Arbeit im Stationsraum Küche 12,4 %, die Arbeit außerhalb der Station 6,9 % und den Aufenthalt in Stationszimmern 27,7 % (davon 22,5 % im Stationsstützpunkt). Geht man immer noch von einer 38,5-Stundenwoche aus, entfallen 23,6 % der gesamten wöchentlichen Arbeitszeit oder etwas mehr als 9 Stunden auf Dokumentationsarbeiten.
• Die Autor:innen halten es für möglich, dass fast die Hälfte der im Arbeitsablauf auftretenden Probleme durch digitale Assistenzsysteme behoben werden könne.
• Danach gefragt, wodurch sie wieder mehr Zeit für Patientenbetreuung bekommen könnten, nennen die Pflegekräfte an vorderster Stelle eine Absenkung der Anzahl der Patient:innen pro Pflegekraft. 77 Prozent der Befragten können sich vorstellen, dies zukünftig durch technische Assistenzsysteme schaffen zu können. 71 Prozent gaben an, sich vorstellen zu können, dass digitale Assistenzsysteme einen Teil der Dokumentation vollständig übernehmen.
"Erstmalig" wurde in der Studie die zeitliche Verteilung auf der Pflegestation in verschiedenen vordefinierten Räumlichkeiten erfasst. Sie liefert nach Meinung der Autor:innen "neue Erkenntnisse zum operativen Stationsalltag und können zur Prozessverbesserung beitragen." Während des Aufnahmezeitraums der Messung sind die folgenden Kennzahlen sichtbar Arbeit am Patienten und den Wegen dazwischen rund 51 Prozent (inkl. Wegzeit über Flure) Arbeit im Stationsraum Küche 12,4 Prozent, Arbeit außerhalb der Station: 6,9 Prozent und Aufenthalt in Stationszimmern: 27,7 Prozent (davon 22,5 Prozent im Stationsstützpunkt).
So berechtigt das Ziel ist, Arbeitszeit für patientenferne Tätigkeiten vor allem durch digitale Assistenzsysteme zu verringern, vernachlässigt diese Studie aber, wie aufwändig und langwierig (z.B. durch möglichst einheitliche Technik und die Weiterbildung für Beschäftigte) die Implementation solcher Systeme in den Klinikalltag ist.
Ein Teil des Dokumentationsaufwand beruht auf dem wechselseitigen Misstrauen von Krankenkassen und Kliniken, vom jeweils anderen "über den Tisch gezogen zu werden" was spiralförmig oder nach dem "Hase-Igel-Prinzip" zur ständigen Zunahme und Verfeinerung der Nachweise "korrekten" Verhaltens und "berechtigter" Kontrolle führt, ohne dass dies zum Abbau des Misstrauens führt. Experten sind sogar der Ansicht, dass solche immer komplexere und kompliziertere Systeme sogar die Suche nach Umgehungs- oder Untertunnelungsmöglichkeiten geradezu provozieren. Stattdessen lohnte sich aber u.U. das Nachdenken über vertrauensbildende Maßnahmen auf der Basis intrinsischer Motivationen zu quantitativ und qualitativ "korrekten" Alltags.
Das 24-seitige Whitepaper Pflegedokumentation in Krankenhäusern - Eine quantitative Studie von Kaczmarek, S./Hintze, M./ Fiedler, M. und Grzeszick R. ist im September 2023 veröffentlicht worden und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 18.11.23
Höheres Sterberisiko bei COVID-19 für Menschen aus benachteiligten Regionen in Schottland
 Unterschiedliche Auswirkungen der SARS-CoV-2-Pandemie auf unterschiedliche Bevölkerungsgruppen sind bekannt. Die wichtigsten Prognosefaktoren sind neben dem Alter Vorerkrankungen von Herz, Lunge, Leber, Nieren und Krebserkrankungen. Die höhere Prävalenz dieser chronischen Erkrankungen für Personen mit niedrigerem sozioökonomischem Status ist bekannt und gut dokumentiert (Klemperer 2020, S. 193 ff.). Allein aus diesem Grund verteilen sich auch die mit dem SARS-CoV-2 einhergehenden Risiken sozial ungleich.
Unterschiedliche Auswirkungen der SARS-CoV-2-Pandemie auf unterschiedliche Bevölkerungsgruppen sind bekannt. Die wichtigsten Prognosefaktoren sind neben dem Alter Vorerkrankungen von Herz, Lunge, Leber, Nieren und Krebserkrankungen. Die höhere Prävalenz dieser chronischen Erkrankungen für Personen mit niedrigerem sozioökonomischem Status ist bekannt und gut dokumentiert (Klemperer 2020, S. 193 ff.). Allein aus diesem Grund verteilen sich auch die mit dem SARS-CoV-2 einhergehenden Risiken sozial ungleich.
Eine schottische Studie hat dies anhand aller 735 COVID-19-Patienten dokumentiert, die zwischen dem 1.3. und 20.6.2020 in Schottland auf einer Intensivstation behandelt wurden.
Grundlage der Studie sind umfangreiche demographische und gesundheitliche Daten der 735 Patienten, die mit der sozialen Situation ihres Wohnortes in Beziehung gesetzt wurden.
Die soziale Situation wurde mit dem Scottish Index of Multiple Deprivation 2020 abgebildet. Mit diesem Index werden Daten zu Einkommen, Beschäftigung, Bildung, Gesundheit, Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen, Kriminalität und Wohnen kleinräumig für etwa 7000 Bezirke mit jeweils 700-800 Einwohnern erfasst. Die Bezirke werden in eine Rangfolge gebracht und in Quintile - also in fünf Gruppen von jeweils 20% der Bezirke - von der günstigsten bis zur ungünstigsten sozialen Situation eingeteilt. Einen entsprechenden Index, den German Index of Socioeconomic Deprivation (GISD), hat das RKI für Deutschland entwickelt.
Die Sterblichkeit innerhalb von 30 Tagen nach der Aufnahme auf die Intensivstation betrug für alle Patienten 34,8%. Für Patienten aus den sozial am stärksten benachteiligten Bezirken war das Sterberisiko fast doppelt so hoch im Vergleich zu Patienten aus den sozial günstigsten Bezirken. In diesem Wert waren Unterschiede in den Variablen Alter, Geschlecht und Ethnizität statistisch ausgeglichen (adjustiert). Auch nach zusätzlicher Adjustierung des Prognosefaktors Vorerkrankungen war das Sterberisiko immer noch um fast 80% erhöht.
Damit einher ging die schlechtere Versorgung mit Intensivbetten in den benachteiligten Regionen. Perioden von Überlastung, in denen das Bettenangebot niedriger war als der Bedarf, hielten in den am meisten benachteiligten Bezirken länger an. Der Zusammenhang von Überlastung des Versorgungssyystems, schlechterer Versorgungsqualität und erhöhter Mortalität ist aus früheren Studien bekannt.
Der Schluss liegt somit nahe, dass neben dem schlechteren Gesundheitszustand zum Zeitpunkt der Aufnahme auf die Intensivstation die unzureichende Infrastruktur für eine intensivmedizinischer Versorgung die Sterberaten für sozial benachteiligte Patienten in Schottland erhöht.
Lone NI, McPeake J, Stewart NI, Blayney MC, Seem RC, Donaldson L, et al. Influence of socioeconomic deprivation on interventions and outcomes for patients admitted with COVID-19 to critical care units in Scotland: A national cohort study. The Lancet Regional Health - Europe. 2020. Veröffentlicht am 15.12.20208 Download
Scottish Index of Multiple Deprivation 2020
Sozioökonomischer Deprivationsindex für Deutschland / German Index of Socioeconomic Deprivation Link
Vertiefung: Zusatzkapitel Corona (fortlaufende Aktualisierung) zum Lehrbuch Sozialmedizin - Public Health - Gesundheitswissenschaften. 4. Auflage März 2020.
Download: www.sozmad.de
David Klemperer, 21.12.20
"Inkonsistenzen" zwischen den tatsächlich durchgeführten ärztlichen Untersuchungen und der elektronischen Dokumentation erheblich
 Ein immer wieder vorgebrachtes Argument für die Einführung elektronischer Behandlungs-/PatientInnenakten, in die entweder schon während der Behandlung z.B. per Diktat oder kurz danach von ÄrztInnen und Angehörigen anderer Gesundheitsberufe alle erbrachten Leistungen und festgestellten Gesundheitswerte eingegeben werden, ist die "just in time"-Nutzbarkeit durch andere behandelnde Personen und die Vollständigkeit.
Ein immer wieder vorgebrachtes Argument für die Einführung elektronischer Behandlungs-/PatientInnenakten, in die entweder schon während der Behandlung z.B. per Diktat oder kurz danach von ÄrztInnen und Angehörigen anderer Gesundheitsberufe alle erbrachten Leistungen und festgestellten Gesundheitswerte eingegeben werden, ist die "just in time"-Nutzbarkeit durch andere behandelnde Personen und die Vollständigkeit.
Abgesehen von der oftmals nicht einfachen technischen Handhab- und Nutzbarkeit (Stichwort Interoperationalität) weist eine gerade veröffentlichte Studie aus den USA nun auf erhebliche Differenzen zwischen mehreren tatsächlich erbrachten und elektronisch dokumentierten diagnostischen Leistungen mehrerer ÄrztInnen in Notfallambulanzen hin.
Diese Studie wurde zwischen 2016 und 2018 mit 9 ausgebildeten NotfallärztInnen in den Notfallambulanzen zweier akademischen Medizinzentren und 180 ihrer PatientInnen durchgeführt. Das Ziel war, die Akkuratheit der elektronischen Dokumentation von ÄrztInnen über die Erhebung einer umfassenden Anamnese ("review of systems (ROS)") und über die körperliche Untersuchung (physical examination - PE) zu quantifizieren. Dazu beobachteten 12 qualifizierte und trainierte Reviewer mit Wissen und Zustimmung der behandelnden ÄrztInnen deren Tätigkeit und erstellten Tondokumente von der Arzt-Patient-Kommunikation. Ihre Beobachtungen und die Tondokumentation verglichen sie dann abschließend mit den Daten/Informationen, die in der elektronischen Behandlungsakte dokumentiert waren.
ROS ist "an inventory of body systems obtained through a series of questions seeking to identify signs and/or symptoms which the patient may be experiencing or has experienced". Es umfasst 14 Organsysteme wie die Augen, das muskuloskelettale oder gastrointestinale System. Sie sind vom von der staatlichen Gesundheitsbehörde "Centers for Medicare and Medicaid Services" festgelegt worden.
Die Ergebnisse sahen folgendermaßen aus:
• Beim ROS dokumentierten die ÄrztInnen zwischen 8 und 14 Organsysteme anamnestisch erfasst zu haben. Die Audioaufzeichnungen belegten dagegen nur 3 bis 6 untersuchte Organbereiche. Insgesamt wurden von 1.961 dokumentierten ROS-Aktivitäten nur 755 oder 38,5% durch Audioaufzeichnungen bestätigt.
• Die ÄrztInnen dokumentierten in der elektronischen Behandlungsakte/-datei zwischen 7 und 9 (Median 8) überprüfbare körperliche Untersuchungen. Die Reviewer beobachteten aber nur zwischen 3 und 6 Untersuchungen (Median 5,5). Insgesamt wurden von 1.429 überprüfbaren körperlichen Untersuchungen 760 oder 53,2% von den Beobachtenden bestätigt. Bei mehr als 90% der Beobachtungen war die so genannte "Interrater reliability", also das Ausmaß der übereinstimmenden Beobachtungen bei unterschiedlichen Beobachtern, gut.
Offensichtlich, so die AutorInnen, existieren "inconsistencies between the documentation of ROS and PE findings in the electronic health record and observational reports" und ihre Ergebnisse "raise the possibility that some documentation may not accurately represent physician actions."
Dass häufig in der elektronischen Behandlungsdatei Untersuchungen angegeben wurden, die gar nicht durchgeführt wurden, sollte nicht bagatellisiert werden. Dies kann in bestimmten Fällen PatientInnen schaden, und zwar dann, wenn sich weitere Behandler auf die Angaben verlassen und möglicherweise Untersuchungen unterbleiben, die für die Behandlungsqualität wichtig gewesen wären. Warum es zu den Inkonsistenzen kommt, wurde nicht untersucht, sollte aber ein zentraler Bestandteil weiterer Forschung zu diesem Versorgungsbereich gehören. Dies zu wissen ist vor allem deshalb wichtig, weil Fehldokumentationen stattfanden obwohl den ÄrztInnen bekannt war, dass ihr Handeln beobachtet wurde. Damit ist eigentlich vorsätzliche Täuschung oder Schlamperei ausgeschlossen.
Interessant ist schließlich, dass die AutorInnen Krankenversicherungen raten, sie "should consider removing financial incentives to generate lengthy documentation."
Da die vorliegende Untersuchung nur in zwei Kliniken, bei wenigen ÄrztInnen und PatientInnen durchgeführt wurde, müssen auch nach Meinung der AutorInnen weitere Untersuchungen erheben wie weit verbreitet die Inkonsistenzen sind und ob sie auch in anderen klinischen Bereichen als dem der Notfallversorgung zu finden sind.
Ob es sie auch in deutschen Kliniken gibt, ist m. W. unbekannt, nur weiß man auch nicht, ob es sie dort und in ambulanten Praxen nicht auch gibt. Eine Untersuchung müsste aber beim Punkt Null anfangen.
Der Aufsatz Concordance Between Electronic Clinical Documentation and Physicians' Observed Behavior von Carl T. Berdahl et al. ist am 18. September 2019 in dem "JAMA Network Open" (2019;2(9):e1911390) erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 30.9.19
Trotz eklatanter Forschungslücken: individuelles Entlassungsmanagement wirkt sich für PatientInnen mehrfach positiv aus.
 Obwohl niemand im deutschen Gesundheitssystem mit seiner charakteristischen Abschottung oder seinem Hürdenreichtum zwischen stationärer, ambulanter medizinischer und pflegerischer Versorgung die Notwendigkeit von Entlass- oder Überleitungsmanagement offen bestreitet und dies auch in einer Fülle gesetzlicher und vertraglicher Vorschriften der letzten anderthalb Jahrzehnte seinen Niederschlag gefunden hat, ist die Empirie des Entlassmanagements trotz der zuletzt 2017 konkretisierten Bestimmungen unzulänglich (vgl. dazu den hkk-Gesundheitsreport 2018: Entlassmanagement). Das Recht auf Entlassmanagement ist einem erheblichen Teil der derzeit jährlich rund 19 Millionen KrankenhauspatientInnen unbekannt und Millionen von PatientInnen erhalten selbst dann wenn sie über ihr Recht informiert werden keine oder eine lediglich lückenhafte individuelle Entlassplanung.
Obwohl niemand im deutschen Gesundheitssystem mit seiner charakteristischen Abschottung oder seinem Hürdenreichtum zwischen stationärer, ambulanter medizinischer und pflegerischer Versorgung die Notwendigkeit von Entlass- oder Überleitungsmanagement offen bestreitet und dies auch in einer Fülle gesetzlicher und vertraglicher Vorschriften der letzten anderthalb Jahrzehnte seinen Niederschlag gefunden hat, ist die Empirie des Entlassmanagements trotz der zuletzt 2017 konkretisierten Bestimmungen unzulänglich (vgl. dazu den hkk-Gesundheitsreport 2018: Entlassmanagement). Das Recht auf Entlassmanagement ist einem erheblichen Teil der derzeit jährlich rund 19 Millionen KrankenhauspatientInnen unbekannt und Millionen von PatientInnen erhalten selbst dann wenn sie über ihr Recht informiert werden keine oder eine lediglich lückenhafte individuelle Entlassplanung.
Zur Rechtfertigung dieses Zustands gibt es eine Reihe von allgemeinen (z.B. zu viel bürokratischer Aufwand, zu wenig Personal) und spezifischen (z.B. fehlende Formulare, ungeeignete Drucker, Unklarheiten über Zuständigkeiten) technisch-organisatorischen Hinweisen, die bei entsprechendem Interesse in den allermeisten Fällen relativ kurzfristig klärbar wären. Dass dies möglich ist, zeigen die nicht wenigen und strukturell unterschiedlichen Kliniken in denen zum Teil seit mehreren Jahren ein funktionierendes Entlassmanagement existiert. Ein stillschweigendes Argument könnten Zweifel am Nutzen sein.
Ein bereits 2016 veröffentlichter so genannter Cochrane Review untersuchte was 30 randomisierte kontrollierte Studien mit 11.964 TeilnehmerInnen, die zur allgemein medizinischen, chirurgischen oder psychiatrischen Behandlung im Krankenhaus waren, dazu an Ergebnissen zu Tage gefördert hatten. Verglichen wurden PatientInnen mit individuellem Entlassmanagement und mit normaler Entlassung.
Die wichtigsten Ergebnisse sehen wie folgt aus:
• PatientInnen mit allgemein medizinischem Behandlungsanlass mit Entlassmanagement lagen etwas kürzer im Krankenhaus und hatten auch ein geringeres Risiko innerhalb der drei Monate nach Entlassung wieder einen Krankenhausaufenthalt nötig zu haben. Die gesicherte Evidenz war aber moderat. Dieser Nutzen ist für Patienten mit Sturzfolgen fraglich.
• Bei älteren PatientInnen mit allgemein medizinischem oder chirurgischem Behandlungsanlass gab es lediglich kleine oder keine Unterschiede bei der Sterblichkeit.
• Die Zufriedenheit von PatientInnen mit Entlassmanagement und Krankenhauspersonal war höher als bei PatientInnen mit Standardentlassung - mit sehr geringer Sicherheit und Evidenz.
• Und auch bei möglichen Kostenunterschieden sind sich die RCTs bei PatientInnen mit allgemein-medizinischem Behandlungsanlass unsicher, ob es irgendeinen Kostenunterschied gibt. Immerhin sind die Kosten der Entlassung mit Entlassungsmanagement nicht gesichert und/oder deutlich höher.
• Zu ihrer eigenen Überraschung mussten die Cochrane Reviewer aber feststellen, dass wichtige Aspekte der Wirksamkeit und des Nutzens von Entlassmanagement in keiner einzigen der von ihnen untersuchten Studien untersucht wurden. So gab es keine detaillierten Analysen wie und wodurch die Schnittstelle zwischen stationärer und ambulanter Behandlung überbrückt wurde und ob sich dies auf die weitere Gesundheit und die generell vernachlässigte Lebensqualität der PatientInnen ausgewirkt hat. Dies traf auch für die Kommunikation zwischen KrankenhausbehandlerInnen und ambulanten Leistungserbringern zu.
Trotz vieler Forschungsdesiderata und teilweise geringer Evidenz gibt es also genug Hinweise auf einen vorhandenen Nutzen von individueller Entlassungsplanung im Krankenhaus.
Der 74-seitige Cochrane Review Discharge planning from hospital von Gonçalves-Bradley DC, Lannin NA, Clemson LM, Cameron ID, Shepperd S. (Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 1) ist komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 11.12.18
Ein Jahr "Rahmenvertrag Entlassmanagement": "Natürlich wichtig", aber immer noch jede Menge Schwachstellen
 Auch nach jahrzehntelanger Debatte über die unerwünschten Wirkungen der in Deutschland existierenden Abschottung der stationären von der ambulanten Gesundheitsversorgung und trotz einiger gesetzlicher Vorschriften (z.B. Nahtlosigkeit und Zügigkeit bei der Rehabilitation nach dem SGB IX und mehrere Varianten multilateraler Verträge im SGB V), gibt es zwar graduelle Fortschritte aber keine strukturelle Lösung der Schnittstellenprobleme. Als Lösung unterhalb einer richtigen Strukturreform gilt seit Mitte der Nuller Jahre das so genannte Überleitungs- oder Entlassmanagement während der stationären Behandlung. Die Pflicht, dies anzubieten und das Recht der im Krankenhaus behandelten PatientInnen diese Leistung bei Bedarf zu erhalten, wurde mehrere Male im SGB V betont und ein ExpertInnenkreis an der Universität Osnabrück arbeitet seit Jahren an einem Expertenstandard Entlassungsmanagement in der Pflege dessen neueste Version noch in der Konsultationsphase steckt und im Frühjahr 2019 fertiggestellt sein soll.
Auch nach jahrzehntelanger Debatte über die unerwünschten Wirkungen der in Deutschland existierenden Abschottung der stationären von der ambulanten Gesundheitsversorgung und trotz einiger gesetzlicher Vorschriften (z.B. Nahtlosigkeit und Zügigkeit bei der Rehabilitation nach dem SGB IX und mehrere Varianten multilateraler Verträge im SGB V), gibt es zwar graduelle Fortschritte aber keine strukturelle Lösung der Schnittstellenprobleme. Als Lösung unterhalb einer richtigen Strukturreform gilt seit Mitte der Nuller Jahre das so genannte Überleitungs- oder Entlassmanagement während der stationären Behandlung. Die Pflicht, dies anzubieten und das Recht der im Krankenhaus behandelten PatientInnen diese Leistung bei Bedarf zu erhalten, wurde mehrere Male im SGB V betont und ein ExpertInnenkreis an der Universität Osnabrück arbeitet seit Jahren an einem Expertenstandard Entlassungsmanagement in der Pflege dessen neueste Version noch in der Konsultationsphase steckt und im Frühjahr 2019 fertiggestellt sein soll.
Da sich aber die Wirklichkeit an vielen deutschen Krankenhäusern nicht verbessert hatte, verpflichtete der Gesetzgeber im GKV-Versorgungsstrukturgesetz von 2012 in § 39 Abs. 1a SGB V Leistungserbringer und Krankenkassen dazu, einen detaillierten Vertrag zur Ausgestaltung der geltenden Form des Entlassmanagements (EM) für die Zeit nach einer Krankenhausbehandlung abzuschließen.
Wie allerdings bereits die Entstehungsgeschichte des Rahmenvertrags über das "Ent-lassmanagement zur Unterstützung einer sektorenübergreifenden Versorgung der Versi¬cherten beim Übergang in die Versorgung nach Krankenhausbehandlung" zeigt, ist auch mit einem solchen Vertrag keineswegs der Reformdurchbruch vollzogen; inhaltlich und organisatorisch handelt es sich also trotz stetiger verbaler Bestätigung der Wichtigkeit keineswegs um ein Selbstläuferprojekt. Selbst die genannte gesetzliche Vorgabe an den Spitzenverband Bund der Krankenkassen, die Kassenärztliche Bun¬desvereinigung (KBV) und die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG), das Entlassmanagement in einem Rahmenvertrag zu regeln, ließ sich nach langen strittigen und ergeb¬nislosen Verhandlungen zwischen den Vertragspartnern erst durch ein Schiedsverfahren des erweiterten Bundesschiedsamts für die vertragsärztliche Versorgung erfüllen. Der danach ab dem 17.10.2016 verbindliche Vertrag wurde durch die "Änderungsvereinba¬rung zum Rahmenvertrag" der drei Selbstverwaltungspartner vom 06.06.2017 anerkannt und trat am 01.10.2017 in Kraft.
Angesichts der ausgesprochen zähen und tatenarmen Vorgeschichte lag der Gedanke nahe, nicht erst wieder mehrere Jahre abzuwarten, sondern zu einem frühen sich inhaltlich anbietenden Zeitpunkt zu überprüfen was und wie viel von diesem Rahmenvertrag umgesetzt worden ist.
Geradezu themenspezifisch nahmen sich dies nicht die Vertragspartner vor (entgegen dem Standard bei Modellversuchen etc. gibt es aber auch keine gesetzliche oder vertragliche Pflicht zur Evaluation), sondern zum Jahrestag des Rahmenvertrags am 1.10.2018 allein die Handelskrankenkasse (hkk) Bremen.
Dazu ließ sie durch das "Bremer Institut für Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung (BIAG)" eine Zufallsstichprobe von 1.200 Versicherten, die im April 2018 einen Krankenhausaufenthalt beendet hatten (Rücklauf 29,1%) zu ihren Erfahrungen mit wichtigen Elementen des Entlassmanagements und dem gesundheitlichen Anlass ihrer Behandlung befragen.
Die wichtigsten Ergebnisse lauten:
• Ein Jahr nach Einführung des Rahmenvertrags werden lediglich 35,8 % der Krankenhauspatienten über das Pflichtangebot des EM ihrer behandelnden Klinik informiert. Noch weniger, nämlich 26,6 % aller Patienten wurden schriftlich über Inhalt und Ziele des EM in Kenntnis gesetzt. Solange aber nicht mindestens die 42,1% der schwer und chronisch Erkrankten unter den Befragten mit einem eindeutigen nachstationären Behandlungs- und Versorgungsbedarf vollumfänglich informiert werden, ist der Rahmenvertrag zum Entlassmanagement nicht erfüllt.
• Der mangelhafte Informationsgrad hat zur Folge, dass weniger als ein Fünftel (19,2 Prozent) der Patienten einen Entlassplan zu ihrem Behandlungsbedarf an die Hand bekommen, also weniger als die Hälfte der PatientInnen mit nachstationärem Behandlungsbedarf als der Hauptzielgruppe von EM.
• Von den Studienteilnehmern, die nach ihrer Entlassung genehmigungspflichtige Leistungen der Krankenkasse benötigten, erhielten weniger als ein Drittel (29,3 %) Unterstützung bei der Bearbeitung der dafür notwendigen Antragsunterlagen.
• Mit existentiellen Risiken verbunden ist, dass 37,1 % der Befragten, die eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung benötigen, keine bekamen, was eigentlich selbst ohne EM-Rahmenvertrag nicht passieren darf.
• Besser sieht es bei der Aufklärung der Patienten über Art und Behandlung ihrer Krankheit aus. 83,7 % der Befragungsteilnehmer gaben an, ausreichend über ihre Krankheit und Behandlung informiert worden zu sein. Aber: 40 % der Patienten erhielten keine Erklärung zur Selbsthilfe zur Genesung, obwohl der Bedarf nach ihren eigenen Angaben bestand. Weiterhin wurde mit 45,7 % entgegen der Notwendigkeit nicht darüber gesprochen, wie sie nach ihrer Entlassung ihre gewohnten Alltagsaktivitäten wieder aufnehmen könnten.
• 85,4 % erhielten einen (vorläufigen) Entlassbrief, der zwar einzelne Aspekte des Entlassplans enthalten kann, aber keineswegs alle und auch nicht durch eine entsprechende Beratung im Krankenhaus sichert, dass der Patient weiß an wen mit welchen Zielen etc. er sich nach der Entlassung wenden muss.
• Positiv ist auch, dass 81,8 % der Patienten, die mindestens drei verordnete Arzneimittel einnehmen mussten, einen Medikationsplan mit nach Hause bekamen.
Und wer jetzt meint, ein Jahr sei völlig utopisch, wenn es um Veränderungen in 1942 Krankenhäusern geht, sollte daran denken, wie lange bereits die Wichtigkeit einer strukturierten Entlassung aus dem Krankenhaus diskutiert wird und geltendes Recht ist und sollte sich die Wiederholung einer derartigen Studie auf Wiedervorlage im Jahr 2019 oder 2020 legen.
Der 22 Seiten umfassende hkk-Gesundheitsreport 2018: Entlassmanagement von Bernard Braun ist komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 20.11.18
Wie kann die Einkommenssituation von Pflegekräften verbessert werden? Ein ungewöhnliches Beispiel aus Kanada!
 Zu den prinzipiell von niemand mehr bestrittenen notwendigsten Verbesserungen der stationären Versorgung gehört eine deutliche Erhöhung der Anzahl von Pflegekräften. Zu den Voraussetzungen ohne die dieses Ziel kaum zu erreichen sein dürfte, gehört eine höhere Attraktivität oder Wertschätzung der pflegerischen Tätigkeit, was konkret u.a. eine höhere Bezahlung und eine Verbesserung der organisatorischen und sozialen Arbeitsbedingungen umfassen müsste.
Zu den prinzipiell von niemand mehr bestrittenen notwendigsten Verbesserungen der stationären Versorgung gehört eine deutliche Erhöhung der Anzahl von Pflegekräften. Zu den Voraussetzungen ohne die dieses Ziel kaum zu erreichen sein dürfte, gehört eine höhere Attraktivität oder Wertschätzung der pflegerischen Tätigkeit, was konkret u.a. eine höhere Bezahlung und eine Verbesserung der organisatorischen und sozialen Arbeitsbedingungen umfassen müsste.
Ohne dass dies als Patentrezept für die weitere Entwicklung im deutschen Krankenhauswesen oder anderen pflegerischen Bereichen verstanden werden soll, zeigt ein Blick auf eine seit dem 28. Februar 2018 im öffentlichen kanadischen Gesundheitssystem laufende ungewöhnliche Initiative zur Verbesserung der Einkommen von Pflegekräften zweierlei: Erstens sieht die Einkommenssituation von Pflegekräften auch in vergleichbaren Ländern im Vergleich mit dem anderer Gesundheitsbeschäftigten nicht gut aus und zweitens endet der dortige Einfallsreichtum nicht beim Appell an Gewerkschaften, Arbeitgeber und Politik.
Bisher 964 ÄrztInnen unterschrieben vor einem vergleichbaren Hintergrund relativ schlechter Bezahlung von Pflegekräften eine Erklärung, deren Kernaussagen so lauten:
• "Wir, Ärzte aus Québec, die an ein starkes öffentliches System glauben, wenden uns gegen die jüngsten Gehaltserhöhungen, die von unseren medizinischen Verbänden ausgehandelt wurden. Diese Erhöhungen sind umso schockierender, da unsere Krankenschwestern, Pfleger und andere Fachkräfte mit sehr schwierigen Arbeitsbedingungen konfrontiert sind, während unsere Patienten aufgrund der drastischen Kürzungen in den letzten Jahren und der Zentralisierung der Macht im Gesundheitsministerium mit einem fehlenden Zugang zu den erforderlichen Dienstleistungen leben müssen."
• "Nous, médecins québécois, demandons que les hausses salariales octroyées aux médecins soient annulées et que les ressources du système soient mieux distribuées pour le bien des travailleuses et travailleurs de la santé".
Der von der Ärztevereinigung "Médecins Québécois pour le Régime Public (MQRP)" erstellte Brief "Nous demandons l'annulation des hausses" ist komplett erhältlich.
Bernard Braun, 7.5.18
Oft Weiterführung von Kliniken trotz Insolvenz und erhebliche regionale Unterschiede der Versorgungsmerkmale
 Zu den in regelmäßigen Abständen veröffentlichten Eckzahlen der Krankenhausentwicklung in Deutschland gehört die Anzahl der insolventen oder der Krankenhäuser denen Insolvenz droht durch das "Rheinisch-Westfälische Wirtschaftsinstitut (RWI)".
Zu den in regelmäßigen Abständen veröffentlichten Eckzahlen der Krankenhausentwicklung in Deutschland gehört die Anzahl der insolventen oder der Krankenhäuser denen Insolvenz droht durch das "Rheinisch-Westfälische Wirtschaftsinstitut (RWI)".
In der Pressemitteilung vom 21.6. 2017 zur jüngsten Ausgabe des Krankenhaus-Ratingreports 2017 liest sich dies dann so: "Die wirtschaftliche Lage deutscher Krankenhäuser hat sich im Jahr 2015 gegenüber dem Vorjahr nur leicht verschlechtert. Sie war besser als 2012, das in jüngster Vergangenheit das schlechteste Jahr für Krankenhäuser war. 9 Prozent befanden sich 2015 im 'roten Bereich' mit erhöhter Insolvenzgefahr, 12 Prozent im 'gelben' und 79 Prozent im 'grünen Bereich'."
Darüber wie es mit den Kliniken im 'roten Bereich' weiter ging, ob es jedes Jahr andere Kliniken waren oder ein Teil dauerhaft knapp vor der Insolvenz stand oder steht und was mit diesen oder insolventen Kliniken, ihren Beschäftigten und PatientInnen konkret passiert, erfährt man aus den Ratingreports leider nichts.
Dass der dort erzeugte alarmierende Eindruck zum Teil übertrieben sein könnte, zeigt nun eine Antwort der Bundesregierung vom 9. Februar 2018 auf eine Anfrage der FDP-Fraktion zum Insolvenzgeschehen bei Kliniken in den Jahren 2016 und 2017.
Nach einer Umfrage bei den für den Krankenhaussektor zuständigen Bundesländern antwortete die Bundesregierung auf die Frage "Welche Auswirkungen haben und hatten diese Insolvenzen nach Kenntnis der Bundesregierung auf Patienten, Mitarbeiter, Zulieferer und weitere beteiligte Akteure?" wie folgt: "Die von einer Krankenhausinsolvenz bzw. entsprechenden Verfahren betroffenen Länder teilten mit, dass der Klinikbetrieb zum größten Teil unverändert und ununterbrochen weitergeführt wurde. Die meisten von einer Insolvenz betroffenen Krankenhäuser wurden unter neuer Trägerschaft fortgeführt."
Diese für die "Temperatur" der Krankenhausdebatte interessante Feststellung sollte natürlich nicht so verstanden werden, dass Träger von Kliniken, dort Beschäftigte und PatientInnen im Umkreis von wirtschaftlich angeschlagenen Kliniken nicht große Probleme hätten.
Woran einige dieser und anderer Probleme der Krankenhausversorgung aber auch liegen könnten, deuten weitere in der Antwort der Bundesregierung enthaltene Informationen an.
Berichtet wird noch über
• die Anzahl von Planbetten im teil- und vollstationären Bereich insgesamt und pro 1 000 Einwohner nach Bundesländern mit erheblichen Unterschieden zwischen diesen Ländern,
• die zur Verfügung gestellten und ausgezahlten Krankenhausinvestitionsmittel insgesamt und pro Planbett der einzelnen Bundesländer, die ebenfalls erheblich unterschiedlich sind und
• über die Entwicklung von Inflation, Tarifsteigerungen und Landesbasisfallwerten für den Zeitraum 2007 bis 2017.
Die Bundestagsdrucksache 19/702 ist wie alle Bundestagsdrucksachen und -Protokolle kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 27.4.18
Evidenz für Kombination von Maßnahmen: "mehr Pflegepersonal" und besseren Arbeitsbedingungen gleich hohe Überlebenschance
 Bereits 2011 siehe "Mehr Personal im Pflegebereich und alles wird gut"!? Auch die Evidenz von "guten" Patentrezepten muss nachgewiesen werden hatten PflegewissenschaftlerInnen darauf hingewiesen, dass neben einer Erhöhung der Anzahl von Pflegekräften (aber auch Ärzten) auch eine Verbesserung bestimmter Arbeitsbedingungen eine Reihe von Outcomes für die PatientInnen positiv beeinflusst, ja ohne eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen bis zu einem bestimmten Maße sogar die Aufstockung des Personals keine positive Wirkung hat.
Bereits 2011 siehe "Mehr Personal im Pflegebereich und alles wird gut"!? Auch die Evidenz von "guten" Patentrezepten muss nachgewiesen werden hatten PflegewissenschaftlerInnen darauf hingewiesen, dass neben einer Erhöhung der Anzahl von Pflegekräften (aber auch Ärzten) auch eine Verbesserung bestimmter Arbeitsbedingungen eine Reihe von Outcomes für die PatientInnen positiv beeinflusst, ja ohne eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen bis zu einem bestimmten Maße sogar die Aufstockung des Personals keine positive Wirkung hat.
In einer weiteren, 2016 veröffentlichten Studie mit 11.160 erwachsenenen Patienten, die wegen eines plötzlichen Herzstillstands zwischen 2005 und 2007 in 75 Kliniken in vier US-Bundesstaaten behandelt wurden, scheint sich dieses Ergebnis erneut zu ergeben und kann die Wirkungen einer Personalaufstockung sowie verbesserter ausgewählter Arbeitsbedingungen quantifiziert werden.
Die zwei statistisch signifikanten Ergebnisse lauten:
• Mit jedem Patienten pro Pflegekraft im chirurgischen Bereich mehr sank die Wahrscheinlichkeit, den Herzstillstand bis zur Entlassung zu überleben um 5%.
• Sofern die Patienten in Kliniken mit schlechten Arbeitsbedingngen, also etwa schlechter Zusammenarbeit zwischen Ärzten und Pflegekräften, geringe Mitwirkungsmöglichkeiten bei das Krankenhaus betreffenden Fragen oder rigider Hierachie behandelt wurden, hatten sie im Vergleich mit Patienten in Kliniken mit besseren Arbeitsbedingungen eine um 16% geringere Chance, ihre Erkrankung zu überleben.
Die auch für die in Deutschland gerade intensiv geführte Debatte um die Personalbemessung und Mindestausstattung mit Pflegekräften in Krankenhäusern relevante Schlussfolgerungen der AutorInnen lauten: "This suggests that adding more nurses without considering the work environment may be a poor investment." Dies gilt auch dann, wenn man in Rechnung stellt, dass auch diese Querschnittsstudie keine kausale Interpretation zulässt.
Die Studie Better Nurse Staffing and Nurse Work Environments Associated With Increased Survival of In-Hospital Cardiac Arrest Patients von MD McHugh et al. (darunter auch die Mitverfasserin der 2011er Studie L. Aiken) ist in der Zeitschrift "Medical Care" ( 2016 January ; 54(1): 74-8) veröffentlicht. Die komplette Fassung des Autorenmanuskripts ist kostenlos zu erhalten.
Bernard Braun, 28.10.17
12 Jahre danach: Deutliche Gewichtsabnahme für stark Übergewichtige durch einen Magenbypass kann nachhaltig sein.
 Auch wenn nichtinvasive Maßnahmen für den Abbau erheblichen Übergewichts immer noch anstrebenswert sind, das Risiko einer Operation nicht unterschätzt werden darf und frühere Studien Zweifel am mittel- bis langfristigen Nutzen einer bariatrischen Operation förderten oder nicht ausschließen konnten, zeigt eine aktuelle Studie mit zwei Vergleichsgruppen auch nach 12 Jahren einen signifikanten und beträchtlichen Nutzen durch einen so genannten Roux-en-Y-Magenbypass - einer der häufigsten Methoden den natürlichen Weg der Nahrung durch den Magen-Darm-Trakt so zu verändern, "dass die Patienten geringere Mengen an fester und flüssiger Nahrung aufnehmen." (mehr unter dem Wikipedia-Stichwort Roux-en-Y-Magenbypass).
Auch wenn nichtinvasive Maßnahmen für den Abbau erheblichen Übergewichts immer noch anstrebenswert sind, das Risiko einer Operation nicht unterschätzt werden darf und frühere Studien Zweifel am mittel- bis langfristigen Nutzen einer bariatrischen Operation förderten oder nicht ausschließen konnten, zeigt eine aktuelle Studie mit zwei Vergleichsgruppen auch nach 12 Jahren einen signifikanten und beträchtlichen Nutzen durch einen so genannten Roux-en-Y-Magenbypass - einer der häufigsten Methoden den natürlichen Weg der Nahrung durch den Magen-Darm-Trakt so zu verändern, "dass die Patienten geringere Mengen an fester und flüssiger Nahrung aufnehmen." (mehr unter dem Wikipedia-Stichwort Roux-en-Y-Magenbypass).
Eine Gruppe von 1.156 schwer übergewichtigen Personen wurde dazu auf drei Gruppen verteilt: Eine Operationsgruppe, eine erste Nichtoperations-Vergleichsgruppe deren Angehörige zwar eine Operation wollten, sie aber überwiegend wegen ihrer schlechten Versicherung nicht erhielten und eine dritte Gruppe bzw. die zweite Nichtoperationsgruppe deren Angehörige nicht operiert werden wollten. Alle StudienteilnehmerInnen wurden zu Beginn der Studie sowie nach 2, 6 und 12 Jahren gründlich auf die Betroffenheit durch Diabetes Typ 2, Bluthochdruck und Fettstoffwechselstörungen untersucht.
Der adjustierte durchschnittliche Gewichtsverlust betrug in der Operationsgruppe im Vergleich zum Ausgangsgewicht nach zwei Jahren 45 kg, 36,3 kg nach6 Jahren und 35 kg nach 12 Jahren. Nach 12 Jahren hatten die Angwehörigen der ersten Nichtoperationsgruppe 2,9 kg abgenommen. Das Gewicht der nichtoperierten Angehörigen der zweiten Vergleichsgruppe hatte sich nach 12 Jahren nicht verändert. Zusätzlich zu der signifikant größeren Gewichtsabnahme hatten die bariatrisch Operierten auch signifikant geringere Inzidenzraten für Diabetes Typ 2 (3% gegenüber 26%) Bluthochdruck und Fettstoffwechselstörungen als die nichtoperierten aus der ersten Vergleichsgruppe.
Die Studie Weight and Metabolic Outcomes 12 Years after Gastric Bypass von Ted D. Adams et al. ist am 21. September 2017 in der Zeitschriftr "New England Journal of Medicine (NEJM)" (377:1143-115) erschienen. Ein Abstract ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 30.9.17
Handhygiene in Kliniken: "probably slightly reduces infection…and colonisation rates" aber "based moderate certainty of evidence"
 Eine Erhöhung der Häufigkeit und Gründlichkeit der Handhygiene aller Beschäftigten in Krankenhäusern reduziert nach zahlreichen weltweiten Studien sowohl die Keimbesiedlung als auch die Rate der oft schwerwiegenden Infektionen und Todesfälle. Da dies entgegen manchen Erwartungen an die Professionalität von Ärzten und Pflegekräften nicht automatisch zu den notwendigen Veränderungen von Einstellungen und Verhalten von Ärzten und Pflegekräften geführt hat, wurde die Erkenntnis in eine Vielzahl unterschiedlichster Interventionsvorschlägen integriert - darunter z.B. ein umfangreicher Handlungskatalog der Weltgesundheitsorganisation (WHO).
Eine Erhöhung der Häufigkeit und Gründlichkeit der Handhygiene aller Beschäftigten in Krankenhäusern reduziert nach zahlreichen weltweiten Studien sowohl die Keimbesiedlung als auch die Rate der oft schwerwiegenden Infektionen und Todesfälle. Da dies entgegen manchen Erwartungen an die Professionalität von Ärzten und Pflegekräften nicht automatisch zu den notwendigen Veränderungen von Einstellungen und Verhalten von Ärzten und Pflegekräften geführt hat, wurde die Erkenntnis in eine Vielzahl unterschiedlichster Interventionsvorschlägen integriert - darunter z.B. ein umfangreicher Handlungskatalog der Weltgesundheitsorganisation (WHO).
Ob diese Interventionen aber wirksam und ausreichend sind oder möglicherweise nicht, war das Thema eines bereits im Jahr 2004 gestarteten so genannten Cochrane Reviews, also eines Versuchs den Stand der Forschung möglichst auf der Basis von methodisch hochwertigen primären Interventionsstudien (vor allem randomisierte kontrollierte Studien) zu ermitteln.
In einer ersten Veröffentlichung über die Ergebnisse zweier Studien aus dem Jahr 2007 hieß es dann: "There is not enough evidence to be certain about what strategies improve hand hygiene compliance. 'One off' teaching sessions about hand hygiene may not improve hand hygiene, but again there is not enough evidence to be certain. More research is needed." (Dinah Gould, Jane H Chudleigh, Donna Moralejo, Nicholas Drey: Interventions to improve hand hygiene compliance in patient care).
Nach einem zweiten Review im Jahr 2010 mit etwas mehr Studien, konnte die Reviewergruppe jetzt 2017 auf die Ergebnisse von 26 weltweit zwischen November 2009 und Oktober 2016 in verschiedenen Krankenhaustypen durchgeführte Studien zurückgreifen, darunter 14 randomisierte, zwei nicht-randomisierte und 10 andere klinische Studien (Vorher-Nachher-Analysen und "interrupted time series(ITS)"-Analysen).
Im Zentrum aller Studien und des Reviews stand die Frage, ob Handhygiene mit Seife oder alkoholhaltigen Mitteln oder beiden Stoffen und den verschiedensten Arrangements und Feedbacktechniken die Keimbesiedlung und die Infektions- oder gar Sterblichkeitshäufigkeit reduzierten oder nicht.
Trotz der im gesamten Zeitraum immer wieder betonten Relevanz der Handhygiene, der Vielzahl an Untersuchungen und des langen Beobachtungszeitraums sind die Ergebnisse sehr durchwachsen und schwächer als für die weitere Praxis erhofft.
Die trotzdem vorhandene Generaltendenz lässt sich an der Zusammenfassung der Interventionen auf Basis der WHO-Empfehlung ablesen. Hierzu heißt es: "Multimodal interventions that include some but not all strategies recommended in the WHO guidelines may slightly improve hand hygiene compliance (five studies; 56 centres) and may slightly reduce infection rates (three studies; 34 centres), low certainty of evidence for both outcomes."
Auch wenn Konsens besteht, dass komplexere Interventionen mehr bewirken als unimodale, kommt es auch durch sie nicht zum durchschlagenden Erfolg bei Keimbesiedlung und Infektionen und selbst diese Ergebnisse sind nicht hochevident und unbestreitbar.
So ähnelt die Zusammenfassung des 2017-er-Reviews auch nach rund 13-jähriger Arbeit am Forschungsstand sehr dem zitierten zehn Jahre alten ersten Ergebnis: "With the identified variability in certainty of evidence, interventions, and methods, there remains an urgent need to undertake methodologically robust research to explore the effectiveness of multimodal versus simpler interventions to increase hand hygiene compliance, and to identify which components of multimodal interventions or combinations of strategies are most effective in a particular context."
Zu dem am 1. September 2017 veröffentlichten Cochrane Review Interventions to improve hand hygiene compliance in patient care von Gould DJ, Moralejo D, Drey N, Chudleigh JH, Taljaard M. gibt es kostenlos eine umfangreiche Zusammenfassung.
Bernard Braun, 13.9.17
Falsches Wissen 2 - bei Patienten weit verbreitet
 Notwendige Voraussetzung für sachgerechte Entscheidungen in der Medizin ist ein zutreffendes Wissen über Nutzen und Schäden (Risiken). Eine systematische Übersichtsarbeit zeigt, dass Patienten fast regelhaft nicht über zutreffendes Wissen verfügen - ihre Vorstellungen über Nutzen und Schäden für therapeutische, diagnostische und präventive Maßnahmen sind selten selten zutreffend. Ein überoptimistisches Bild herrscht vor - der Nutzen wird zumeist überschätzt und die Schäden werden unterschätzt. Ein vergleichbares Ergebnis hatte eine entsprechende Studie über das Wissen von Ärzten ergeben.
Notwendige Voraussetzung für sachgerechte Entscheidungen in der Medizin ist ein zutreffendes Wissen über Nutzen und Schäden (Risiken). Eine systematische Übersichtsarbeit zeigt, dass Patienten fast regelhaft nicht über zutreffendes Wissen verfügen - ihre Vorstellungen über Nutzen und Schäden für therapeutische, diagnostische und präventive Maßnahmen sind selten selten zutreffend. Ein überoptimistisches Bild herrscht vor - der Nutzen wird zumeist überschätzt und die Schäden werden unterschätzt. Ein vergleichbares Ergebnis hatte eine entsprechende Studie über das Wissen von Ärzten ergeben.
Für die Übersichtsarbeit werteten die Autoren die Angaben von 27.323 Ärzten in 35 Studien aus den Jahren 1994 bis 2013 aus. Die Studien stammen aus 16 Ländern, 17 der 35 Studien aus den USA. Die Teilnehmerzahl lag zwischen 45 und 228. Eingeschlossen sind Studien, in denen die Patienten quantitative Angaben zu Nutzen und Schäden von Therapie (16 Studien) oder diagnostische Untersuchungen bzw. Screening (20 Studien, davon 15 zu Krebs).
22 Studien untersuchten die Erwartung an den Nutzen, 10 die Erwartungen an Nutzen und Schäden (Risiken) und 3 die Erwartung von Schäden.
Insgesamt ergaben sich 81 Ergebnisse (Outcomes, Endpunkte), 54 zu Erwartungen an den Nutzen und 27 zu Schäden. Die meisten Studien benutzen Multiple-Choice-Fragen, einige gaben keine Antwortauswahl vor. Bei den Probanden handelte es sich um Patienten, die eine Intervention erhalten hatten oder in Kürze erhalten sollten, um Patienten die sich in einem Krankenhaus oder einer Praxis befanden oder kürzlich befunden hatten und um Allgemeinbevölkerung.
Im Ergebnis überschätze die Mehrzahl der Befragten der meisten Outcomes. Der Anteil der Befragten, die den Nutzen überschätzen, lag je nach Outcome zwischen 7 und 94%.
Nur bei 2 Outcomes schätzte die Mehrzahl den Nutzen korrekt - die Sehverbesserung durch Katarakt-Operation und die Genauigkeit des PAP-Tests (Abstrich des Gebärmutterhalses). Nur bei einem Outcome (Nutzen der Operation bei Kreuzschmerz) unterschätzte mehr als die Hälfte den Nutzen.
In 10 von 25 Outcomes unterschätzen zwischen 18 und 97% der Befragten die Schäden. Nur für 2 Outcomes schätzte die Mehrzahl die Schäden korrekt ein (Fehlgeburt nach Fruchtwasseruntersuchung, verbleibende Notwendigkeit für Sehhilfen nach Katarakt-Operation). Der einzige Schaden, der überschätzt wurde, war das Risiko für Brustkrebs infolge der Hormontherapie bei gesunden Frauen.
Zu hohe Erwartungen an den Nutzen in teils ganz erheblichem Ausmaß lagen vor für
• Screening-Untersuchungen (Brustkrebs, Gebärmutterhalskrebs, Prostatakrebs und Darmkrebs)
• Krebstherapien (Stammzelltransplantation, adjuvante Chemotherapie bei Brustkrebs)
• Prävention und Therapie von Herz-Kreislauf-Erkrankungen (medikamentöse Prävention, Stenting der Herzkranzgefäße)
• Operationen (Nierentransplantation, bariatrische Operationen)
• Arzneitherapie (Infliximab for entzündliche Darmerkankungen, Hormontherapie, Prävention der Hüftgelenksfraktur bei Osteoporose)
Diese hochrelevante systematische Übersichtsarbeit weist darauf hin, dass Patienten ihre Entscheidungen häufig auf überoptimistische Erwartungen an Nutzen und Schäden gründen. Die analoge Studie zum Wissen der Ärzte legt den Schluss nahe, dass die Ärzte maßgeblichen zu den Fehleinschätzungen der Patienten beitragen. Die Gründe für diesen medizinischen Überoptimismus sind vielfältig, die Folge sind Overdiagnosis und Overuse, also ein Zuviel an Untersuchungen und Behandlungen zum Schaden der Patienten. Sowohl die Studie über die Erwartungen der Ärzte als auch der Patienten zeigt, dass dieses Phänomen nicht neu ist. Gewachsen ist jedoch die Aufmerksamkeit dafür und eine internationale Bewegung, die sich für eine bessere Medizin einsetzt, wie z.B.
• Choosing Wisely
• Gemeinsam Klug Entscheiden
• Preventing Overdiagnosis
• Realistic Medicine
• Right Care.
Erwähnt sei auch die umfassende Right Care-Serie, die im Januar 2017 im Lancet veröffentlicht wurde.
Hoffmann TC, Del Mar C. Patients' expectations of the benefits and harms of treatments, screening, and tests: a systematic review. JAMA Intern Med 2015;175(2):274-86. doi: 10.1001/jamainternmed.2014.6016 [published Online First: 2014/12/23]
Link.
Hoffmann TC, Del Mar C. Clinicians' expectations of the benefits and harms of treatments, screening, and tests: A systematic review. JAMA Internal Medicine 2017;177(3):407-19. im Forum Gesundheitspolitik: Link
David Klemperer, 13.4.17
Falsches Wissen 1 - bei Ärzten weit verbreitet
 Notwendige Voraussetzung für sachgerechte Entscheidungen in der Medizin ist ein zutreffendes Wissen über Nutzen und Schäden (Risiken). Eine systematische Übersichtsarbeit zeigt, dass Ärzte zumeist nicht über dieses Wissen verfügen. Nutzen und Schäden für therapeutische, diagnostische und präventive Maßnahmen geben Ärzte selten zutreffend an aber häufig zu hoch oder zu niedrig. Dabei herrscht ein überoptimistisches Bild vor - der Nutzen wird zumeist überschätzt und die Schäden werden unterschätzt.
Notwendige Voraussetzung für sachgerechte Entscheidungen in der Medizin ist ein zutreffendes Wissen über Nutzen und Schäden (Risiken). Eine systematische Übersichtsarbeit zeigt, dass Ärzte zumeist nicht über dieses Wissen verfügen. Nutzen und Schäden für therapeutische, diagnostische und präventive Maßnahmen geben Ärzte selten zutreffend an aber häufig zu hoch oder zu niedrig. Dabei herrscht ein überoptimistisches Bild vor - der Nutzen wird zumeist überschätzt und die Schäden werden unterschätzt.
Für die Übersichtsarbeit werteten die Autoren die Angaben von 13.011 Ärzten in 48 Studien der Jahre von 1981 bis 2015 aus. Die Studien stammen aus 17 Ländern, 16 der 48 Studien aus den USA. Eingeschlossen sind Studien, in denen die Ärzte quantitative Angaben zu Nutzen und Schäden von Therapie (20 Studien), bildgebenden Untersuchungen (20 Studien) und Screening (8 Studien - 5 zu Krebsscreening, 3 zu vorgeburtlichem Screening) machen sollten.
30 Studien untersuchten die Einschätzung von Schäden, 9 von Nutzen und 6 sowohl Nutzen als auch Schäden.
Zutreffend geben die befragten Ärzte nur 3 von 28 Nutzenergebnisse und 9 von 69 Schadenergebnisse an. Dabei wird der Nutzen sehr viel häufiger über- als unterschätzt, die Schäden hingegen werden sehr viel häufiger unter- als überschätzt.
Die 48 Studien stellen die Autoren in 3 Tabellen dar, unterteilt in Therapien, nicht-bildgebende Untersuchungen / Screening-Untersuchungen und bildgebende Untersuchungen dar.
Beispielhaft seien hier einige Ergebnisse genannt. Dabei ist zu betonen, dass die Ergebnisse für die jeweilige Studie mit den jeweiligen Ärzten zum gegebenen Zeitpunkt gelten und sich nicht ohne weiteres verallgemeinern lassen.
• Fast die Hälfte der Allgemeinmediziner überschätzen den Nutzen der Antibioitikatherapie bei akuter Mittelohrentzündung und bei akuter Mandelentzündung, gleichzeitig überschätzen sie die Risiken der Nicht-Verschreibung (Studie aus 2012).
• In der Bewertung der Mortalitätsrisiken und Komplikationsraten für Eingriffe wie Leistenbruchoperation, Mandelentfernung, Gebärmutterentfernung und Linksherzkatheteruntersuchung liegen nur etwa ein Viertel der Ärzte innerhalb der richtigen Größenordnung, ein ähnlicher Anteil überschätzte bzw. unterschätzte die Risiken (Studie aus 1985).
• Urologen schätzen die Risiken für Inkontinenz und Impotenz bei verschiedenen Behandlungsformen des Prostatakarzinoms richtig ein. Die Spezialisten empfehlen aber die Therapie, die sie erbringen (Studie aus 2000).
• 1998 überschätzten Ärzte den Nutzen der Hormon"ersatz"therapie für die koronare Herzkrankheit, die Knochendichte und die Alzheimer-Krankheit.
• Ärzte sind über und Nutzen Schäden des Mammografie-Screenings nicht zutreffend informiert (Studien aus 1981, 1989, 1993).
• Kinderärzte unterschätzen das Krebsrisiko von CT-Untersuchungen bei Kindern (Studie aus 2012).
• Die meisten Orthopäden unterschätzen die Strahlenbelastung durch eine Knochendichtemessung (Studie aus 2003).
Diese hochrelevante systematische Übersichtsarbeit weist darauf hin, dass Ärzte ihr Handeln häufig überoptimistisch und somit unrealistisch bewerten. Die Studie untersuchte den Zeitraum von 1981 bis 2015. Anhaltspunkte für eine Besserung der Situation liegen eher nicht vor, vielmehr zeigen Studie, die auch für das Forum Gesundheitspolitik aufgearbeitet wurden, gravierende Probleme bei der Therapie mit Antibiotika, dem Mammographie-Screening, dem Stent bei der koronaren Herzkrankheit und der Chemotherapie bei fortgeschrittenem Krebs.
Behandlungsentscheidungen können nicht besser sein als die Informationen, auf denen sie beruhen. Jegliche Bemühung für eine Versorgung, die sich am Bedarf der Nutzer orientiert, sollte von diesem Sachverhalt ausgehen.
Bereits 2015 haben die Autoren eine analoge Studie zu den Einschätzungen der Patienten veröffentlicht Link. Eine Darstellung wird in kürze hier erscheinen.
Hoffmann TC, Del Mar C. Clinicians' expectations of the benefits and harms of treatments, screening, and tests: A systematic review. JAMA Internal Medicine 2017;177(3):407-19. Link
Hoffmann TC, Del Mar C. Patients' expectations of the benefits and harms of treatments, screening, and tests: a systematic review. JAMA Intern Med 2015;175(2):274-86. doi: 10.1001/jamainternmed.2014.6016 [published Online First: 2014/12/23]
im Forum Gesundheitspolitik: Link
David Klemperer, 10.4.17
Personalausstattung in der stationären Psychiatrie zwischen gerade noch ausreichend bis desaströs.
 Zu einer der seit Jahren in der stationären Versorgung immer intensiver diskutierten Fragen gehört, wie viel und welches ärztliches und pflegerisches Personal dort tätig ist und ob damit eine gute Behandlung möglich ist. Sobald es darauf genügend Antworten gibt, sollen es per Gesetz verbindliche Vorgaben für die Anzahl von Patienten pro Pflegekraft oder Arzt geben. Speziell für den Bereich der Behandlung psychisch Kranker plant die Bundesregierung ab 2017 mit dem "Gesetz zur Weiterentwicklung der Versorgung und der Vergütung für psychiatrische und psychosomatische Leistungen (PsychVVG)", Verbesserungen zu erreichen. Mit dem PsychVVG "wird z. B. auch der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) beauftragt, verbindliche Mindestvorgaben für die Personalausstattung in Kliniken für psychisch kranke Menschen festzulegen. Diese sollen - soweit möglich - evidenzbasiert sein und eine leitliniengerechte Behandlung ermöglichen."
Zu einer der seit Jahren in der stationären Versorgung immer intensiver diskutierten Fragen gehört, wie viel und welches ärztliches und pflegerisches Personal dort tätig ist und ob damit eine gute Behandlung möglich ist. Sobald es darauf genügend Antworten gibt, sollen es per Gesetz verbindliche Vorgaben für die Anzahl von Patienten pro Pflegekraft oder Arzt geben. Speziell für den Bereich der Behandlung psychisch Kranker plant die Bundesregierung ab 2017 mit dem "Gesetz zur Weiterentwicklung der Versorgung und der Vergütung für psychiatrische und psychosomatische Leistungen (PsychVVG)", Verbesserungen zu erreichen. Mit dem PsychVVG "wird z. B. auch der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) beauftragt, verbindliche Mindestvorgaben für die Personalausstattung in Kliniken für psychisch kranke Menschen festzulegen. Diese sollen - soweit möglich - evidenzbasiert sein und eine leitliniengerechte Behandlung ermöglichen."
Dass dies alles nicht schon längst erfolgt ist, liegt auch daran, dass es keine verlässlichen und konsentierten Zahlen zum quantitativen und qualitativen Status quo gibt.
Eine im Juni 2016 vorgelegte Studie der Bundespsychotherapeutenkammer über die personellen Verhältnisse und die Versorgungsqualität in der stationären Psychiatrie und Psychosomatik zeigt zum einen die Fülle von Schwierigkeiten bei der Schaffung von Transparenz und zum andern anhand der wenigen Angaben in den verpflichtenden Qualitätsberichten von Krankenhäusern aus drei Bundesländern (Bayern, Hamburg und Sachsen) und weiteren Recherchen, welche personellen Versorgungsmängel hier existieren.
Die Maßstäbe mit denen beurteilt wird, ob die Personalausstattung ausreichend ist oder nicht, entstammen der "Verordnung über Maßstäbe und Grundsätze für den Personalbedarf in der stationären Psychiatrie (Psychiatrie-Personalverordnung - Psych-PV)" vom 18. Dezember 1990. Diese Verordnung regelte die "Maßstäbe und Grundsätze zur Ermittlung des Personalbedarfs für Ärzte, Krankenpflegepersonal und sonstiges therapeutisches Fachpersonal in psychiatrischen Einrichtungen für Erwachsene sowie für Kinder und Jugendliche mit dem Ziel, eine ausreichende, zweckmäßige und wirtschaftliche stationäre oder teilstationäre Behandlung der Patienten zu gewährleisten." Angesichts der Tatsache, dass das was eine ausreichende Behandlung ausmacht sich seitdem im Sinne neuer Leistungen mit einem entsprechenden Personalaufwand verändert hat, sind die Personalwerte der Psych-PV aber heute eine Art Mindestwerte. Umso bedenklicher, wenn noch nicht einmal diese Werte in der heutigen Behandlungswirklichkeit erreicht werden.
Die wichtigsten Ergebnisse lauten:
• Es beginnt relativ positiv: "In fast neun von zehn (86 Prozent) der allgemeinpsychiatrischen und psychosomatischen und in acht von zehn (82 Prozent) der kinder- und jugendpsychiatrischen Kliniken und Abteilungen gibt es ausreichend ärztliches und fachärztliches Personal, um die medizinisch-psychiatrische Grundversorgung der Patienten sicherzustellen. Die Leistungen der medizinisch-psychiatrischen Grundversorgung nach Psych-PV (Psychiatrie-Personalverordnung), die nicht durch andere Berufsgruppen erbracht werden können, können dort durch Ärzte abgedeckt werden."
• Doch dieses Bild verdunkelt sich dann rasch: "Deutlich wird aber ein Defizit, wenn man die medizinisch-psychiatrische Grundversorgung und die psychotherapeutische Versorgung, d. h. die Aufgabe n von Ärzten und Psychologen, zusammen betrachtet. Nur drei von vier der Kliniken und Abteilungen für Allgemeinpsychiatrie (75 Prozent) und (etwas knapper) für Kinder- und Jugendpsychiatrie (73 Prozent) verfügen über ausreichend Ärzte/Fachärzte und Diplom-Psychologen/Psychotherapeuten, um die Leistungen, wie sie nach Psych-PV im Regelbehandlungsbereich für die medizinisch-psychiatrische und die psychotherapeutische Versorgung zusammen vorgesehen sind, zu erbringen."
• Und bevor es richtig "desaströs" wird, ist die Personalausstattung in den Klinken und Abteilungen für Psychosomatik wiederum etwas besser: "Dort verfügen 95 Prozent der Kliniken über ausreichend Ärzte/Fachärzte und Diplom-Psychologen/Psychotherapeuten, um die Vorgaben der Psych-PV zu erfüllen."
• Die schlechteste Personalausstattung gibt es dagegen in dem gerade auch für die gute Behandlung von psychisch Kranken wichtigen Bereich der Pflege: "Nur die Hälfte der Kliniken und Abteilungen in der Allgemeinpsychiatrie (49 Prozent) und nur eine von fünf psychosomatischen Einrichtungen (17 Prozent) verfügen über ausreichend Pflegepersonal, um die Vorgaben der Psych-PV zu erfüllen."
• Da in Deutschland die Privatisierung von Krankenhäusern weiterhin ungebremst stattfindet, ist ein weiterer Fund des Reports der Bundespsychotherapeutenkammer versorgungspolitisch beachtenswert: "In der ärztlichen und der ärztlich-psychotherapeutischen Versorgung gibt es wenig Unterschiede zwischen öffentlichen und freigemeinnützigen Trägern bei der Erfüllung der Vorgaben nach Psych-PV. In der Pflege ist die Personalausstattung, insbesondere in den Kliniken und Abteilungen in privater Trägerschaft, besonders schlecht. Auch bei den rein ärztlichen Leistungen werden die Vorgaben der Psych-PV seltener erfüllt (79 Prozent)."
Die Studie der Bundespsychotherapeutenkammer 2016: Die Qualität der Versorgung in Psychiatrie und Psychosomatik. Eine Auswertung der Qualitätsberichte der Krankenhäuser ist komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 8.7.16
Immer noch eingeschränktes Interesse an der Quantität und Qualität von Transparenz über Interessenkonflikte in Chirurgiestudien
 Beginnend mit einem Aufruf eines der renommiertesten Medizin-Journals, dem "New England Journal of Medicine (NEJM)", im Jahr 1984 nahm das Bewusstsein zu, dass verborgene finanzielle oder soziale Beziehungen zwischen ForscherInnen und z.B. Herstellern von Arzneimitteln oder Medizinprodukten Forschungsergebnisse verzerren können und das Vertrauen in medizinische Forschung gefährden können. Das geeignete Gegenmittel erschien die Offenlegung möglichst aller potenziellen Interessenkonflikte (z.B. direkte Finanzierung der durchgeführten Studie durch den Hersteller des untersuchten Produkts, Vergütungen für andere Studien und Vorträge durch den Hersteller, alle sonst gewährten Vorteile für den Besuch von Tagungen etc.) im Rahmen wissenschaftlicher Studien und deren Veröffentlichung zu sein. Wie diverse Untersuchungen gezeigt haben, wurden und werden selbst erhebliche Interessenkonflikte entweder gar nicht oder nur partiell transparent gemacht.
Beginnend mit einem Aufruf eines der renommiertesten Medizin-Journals, dem "New England Journal of Medicine (NEJM)", im Jahr 1984 nahm das Bewusstsein zu, dass verborgene finanzielle oder soziale Beziehungen zwischen ForscherInnen und z.B. Herstellern von Arzneimitteln oder Medizinprodukten Forschungsergebnisse verzerren können und das Vertrauen in medizinische Forschung gefährden können. Das geeignete Gegenmittel erschien die Offenlegung möglichst aller potenziellen Interessenkonflikte (z.B. direkte Finanzierung der durchgeführten Studie durch den Hersteller des untersuchten Produkts, Vergütungen für andere Studien und Vorträge durch den Hersteller, alle sonst gewährten Vorteile für den Besuch von Tagungen etc.) im Rahmen wissenschaftlicher Studien und deren Veröffentlichung zu sein. Wie diverse Untersuchungen gezeigt haben, wurden und werden selbst erhebliche Interessenkonflikte entweder gar nicht oder nur partiell transparent gemacht.
Zur Entwicklung und zum Status quo der Transparenz in 444 randomisierten kontrollierten Studien (RCT) zur chirurgischen Behandlung in den Jahren 1985 bis 2015 gibt nun eine von an der Universität Heidelberg tätigen MedizinerInnen erstellte Studie differenziert Auskunft.
Diese sieht dann u.a. so aus:
• 66,2% der Studien untersuchten die Wirkung bzw. den Nutzen von medizinischen Geräten und 33,8% die Medikation und Ernährung im Umfeld chirurgischer Eingriffe - also durchaus für Interessenkonflikte anfällige Dinge
• 25,9% aller RCTs waren durch Hersteller finanziert.
• In sämtlichen bis 2000 durchgeführten RCTs gab es keinerlei Hinweise auf Interessenkonflikte.
• Trotz eines Anstiegs der Studien mit Angaben zu Interessenkonflikten fanden sich diese nur in 33% der zwischen 2005 und 2014 durchgeführten RCTs.
• Von den allein im Jahr 2014 durchgeführten RCTs enthielten schließlich immerhin schon 74% Informationen über Interessenkonflikte.
• Trotz der deutlichen Verbesserung der Transparenz fanden sich nur in 93 oder 20,9% aller 444 RCTs Angaben zur Existenz oder Nichtexistenz von Interessenkonflikten. Dies ist deshalb noch von aktueller Bedeutung, weil die Ergebnisse vieler dieser Studien noch heute das Operationsgeschehen beeinflussen dürften.
• Selbst wenn man die quantitative Entwicklung positiv bewertet, zeigt die qualitative Analyse erhebliche Mängel der abgegebenen Erklärungen zu Interessenkonflikten: Nur in 49 der 93 überhaupt Interessenkonflikte ansprechenden RCTs (52,7% und 11% bezogen auf alle RCTs) waren die Formulierungen so detailliert oder prägnant, dass es dem Leser möglich war zu bewerten, ob die veröffentlichten Ergebnisse durch Interessen beeinflusst sein könnten oder nicht.
• Dies liegt nach Ansicht der AutorInnen auch daran, dass viele Zeitschriften bisher keine detaillierten Vorgaben für die bei einer Erklärung zu nennenden Interessenkonflikte vorgeben und Reviewer nicht entschieden genug diese Erklärung einfordern.
Um die Transparenz über Interessenkonflikte quantitativ wie qualitativ weiter und zum Teil erheblich zu verbessern, kommt es nach Ansicht der AutorInnen vor allem auf die Herausgeber und Reviewer von wissenschaftlichen Veröffentlichungen an.
Der Aufsatz Conflicts of interest in randomised controlled surgical trials: systematic review and qualitative and quantitative analysis von Pascal Probst, Kathrin Grummich, Ulla Klaiber, Phillip Knebel, Alexis Ulrich, Markus W. Büchler und Markus K. ist am 22. April 2016 vor Drucklegung in der Zeitschrift "Innovative Surgical Science" online erschienen. Ein Abstract ist kostenlos erhältlich
Bernard Braun, 29.4.16
Anzahl von Patienten pro Pflegekraft und deren Arbeitsbedingungen relevant für ungeplante Wiedereinweisung von Patienten
 Erneut (vgl. dazu auch schon eine Studie von L. Aiken et al.) bestätigt eine Analyse der Behandlungsdaten von 112.017 älteren erwachsenen Medicare-PatientInnen, die im Jahr 2006 in 495 Kliniken in Kalifornien, Florida, New Jersey und Pennsylvania künstliche Knie- oder Hüftgelenke implantiert bekamen, überwiegend signifikante Zusammenhänge des Risikos einer Wiedereinweisung wegen unerwünschter Folgewirkungen der Operation innerhalb von 10 oder 30 Tagen mit der Anzahl von Patienten pro Pflegekraft und der Qualität deren Arbeitsbedingungen.
Erneut (vgl. dazu auch schon eine Studie von L. Aiken et al.) bestätigt eine Analyse der Behandlungsdaten von 112.017 älteren erwachsenen Medicare-PatientInnen, die im Jahr 2006 in 495 Kliniken in Kalifornien, Florida, New Jersey und Pennsylvania künstliche Knie- oder Hüftgelenke implantiert bekamen, überwiegend signifikante Zusammenhänge des Risikos einer Wiedereinweisung wegen unerwünschter Folgewirkungen der Operation innerhalb von 10 oder 30 Tagen mit der Anzahl von Patienten pro Pflegekraft und der Qualität deren Arbeitsbedingungen.
Die wichtigsten Ergebnisse sahen so aus:
• 5,64% aller PatientInnen mussten innerhalb von 30 Tagen ungeplant wegen Folgeproblemen erneut in einem Krankenhaus behandelt werden, mehr als die Häfte davon innerhalb von 10 Tagen. Die häufigsten Gründe waren postoperative Infektionen oder Osteoarthritis.
• Nach der Adjustierung nach Patienten- und Klinikmerkmalen erhöhte sich die Chance für eine Wiedereinweisung innerhalb von 30 Tagen statistisch signifikant um 8% (odds ratio 1,08) für jeden zusätzlichen Patienten pro Pflegekraft. Diese Chance betrug bei Patienten, die innerhalb von 10 Tagen wiedereingewiesen wurden, 12% (odds ratio 1,12).
• Wie bereits aus anderen Untersuchungen bekannt, wirkt sich aber nicht nur das quantitative Verhältnis von Patienten pro Pflegekraft auf unerwünschte Folgewirkungen einer Krankenhausbehandlung aus, sondern auch die Qualität der Arbeitsbedingungen der Pflegekräfte. Wenn die mit dem Standardinstrumnent "Practice Environment Scale of the Nursing Work Index" gemessene Arbeitsqualität gut war, war die patienten- und klinikadjustierte Chance für eine Wiedereinweisung innerhalb von 30 Tagen um 12% (odds ratio 0,88) geringer als wenn sie von geringer Qualität war. Bei den Patienten, die innerhalb 10 Tagen ungeplant in stationärer Behandlung waren, war zwar die Chance bei guten Arbeitsbedingungen ebenfalls geringer, aber der Unterschied statistisch nicht signifikant. Die für die Qualität der Arbeitsbedingungen von Pflegekräften wichtigsten Merkmale waren kollegiale Beziehungen zu Ärzten, Möglichkeiten autonomen Handelns und kompetente und wirksame Führungskräfte.
Der Aufsatz Nurse staffing and the work environment linked to readmissions among older adults following elective total hip and knee replacement von Karen B. Lasater und Matthew D. Mchugh ist zuerst online im "International Journal for Quality in Health Care" (2016, 28(2), 253-258) erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 19.4.16
Unterversorgung mit chirurgischen Behandlungen in armen und mittelarmen Ländern am größten = fast 17 Millionen vermeidbare Tote
 Wer hierzulande darüber klagt, dass er möglicherweise demnächst mit einem Beinbruch oder einer akuten Blinddarmentzündung in ein etwas weiter hinter der nächsten Ecke liegendes Krankenhaus gehen oder transportiert werden wird, sollte sich einmal über das Niveau seiner Klagen Gedanken machen.
Wer hierzulande darüber klagt, dass er möglicherweise demnächst mit einem Beinbruch oder einer akuten Blinddarmentzündung in ein etwas weiter hinter der nächsten Ecke liegendes Krankenhaus gehen oder transportiert werden wird, sollte sich einmal über das Niveau seiner Klagen Gedanken machen.
Viele Anregungen enthält ein am 26. April 2015 online veröffentlichter 56-seitiger Report einer 25-köpfigen internationalen Wissenschaftlergruppe über den weltweiten Zustand und die Erhältlichkeit chirurgischer Behandlung bei entsprechenden Erkrankungen - in der Vergangenheit, Gegenwart und im Jahr 2030.
Der Report kommt zu folgenden zentralen Feststellungen:
• 32,9% aller weltweiten Todesfälle beruhen auf Krankheiten (z.B. Blinddarmentzündungen, Knochenbrüche oder Geburtskomplikationen), die mit Operationen behandelbar sind. Dies entspricht 16,9 Millionen Toten.
• 5 Milliarden Angehörige der Weltbevölkerung haben im Bedarfsfall keinen Zugang zu sicheren und finanziell leistbaren Operationen samt angemessener Anästhesie.
• Dies trifft besonders die Einwohner von Ländern mit geringem und mittleren Einkommen, wo fast 90% von ihnen keinen Zugang zu einer chirurgischen Basisversorgung haben.
• Von den 313 Millionen Operationen, die jährlich weltweit stattfinden, entfallen lediglich 6% auf die Einwohner armer Länder, die allerdings ein Drittel der Weltbevölkerung stellen, und dann auch noch mit großen Erkrankungsrisiken zu tun haben.
• Allein um Leben zu retten und Behinderungen zu vermeiden sind in den armen und mittelarmen Ländern 143 Millionen zusätzlicher Operationen notwendig.
• 33 Millionen Personen haben wegen der Kosten für Operationen und Anästhesie mit für sie katastrophalen Behandlungsausgaben zu kämpfen. 48 Millionen weitere sind zusätzlich wegen der nichtmedizinischen Kosten des Zugangs zu operativen Leistungen in ökonomischen Schwierigkeiten.
• Um an diesen Zuständen in armen und mittelarmen Ländern bis 2030 etwas zu ändern, also ein akzeptables Minimum von 5.000 chirurgischen Eingriffen pro 100.000 Einwohner zu erreichen, bedarf es einer Investition von 420 Milliarden US-Dollar. Passiert nichts, häufen sich in diesen Ländern zwischen 2015 und 2030 finanzielle Verluste von insgesamt 12,3 Trillionen US-Dollar (in Kaufkraftparitäten des Jahres 2010) an. Obwohl also die Investitionskosten hoch sind, sind in den Worten des Leiters der Wissenschaftlergruppe "the costs of inaction … higher, and will accumulate progressively with delay".
Wer glaubt, dass er Westafrika nach der viel zu spät angelaufenen aber letztlich für den Augenblick erfolgreichen Bekämpfung der dortigen Ebola-Epidemie, samt seinen insgesamt miserablen Gesundheitssystemen wieder vergessen kann oder höchstens eine "Weißhelmtruppe" zu stationieren braucht, irrt sich mit Ansage gewaltig.
Der enorm materialreiche Aufsatz Global Surgery 2030: evidence and solutions for achieving health, welfare, and economic development von John G. Meara et al. ist am 27. April 2015 online in dem Fachjournal "Lancet" erschienen und nach einer kurzen Anmeldung als Nutzer komplett kostenlos erhältlich. Hilfreich ist auch die über 300 Titel umfassende Literaturliste und per Link erreichbare Methodikübersichten.
Generell erneut der Hinweis, dass an komplett kostenlosen Beiträgen des Lancet interessierte Personen sich für einen freien Zugang zu einer respektablen Anzahl von Texten einfach anmelden können und sich nach Erfahrung des Autors nicht vor unerwünschten Zusendungen etc. fürchten müssen.
Bernard Braun, 29.4.15
Auch im Nordwesten: Über 30% Kaiserschnittgeburten bei zu geringer Aufklärung und viel zu seltene nachgeburtliche Gespräche
 Die relativ häufigsten an deutschen Krankenhäusern erbrachten Leistungen sind normale Geburten. Dies liegt vor allem daran, dass anders als in vergleichbaren europäischen Ländern (z.B. Niederlande), hierzulande rund 98% aller Geburten in Krankenhäusern stattfinden, und nicht bei fehlenden Geburtsrisiken durch Hebammen im häuslichen Umfeld oder in ebenfalls hebammengeleiteten Geburtshäusern.
Die relativ häufigsten an deutschen Krankenhäusern erbrachten Leistungen sind normale Geburten. Dies liegt vor allem daran, dass anders als in vergleichbaren europäischen Ländern (z.B. Niederlande), hierzulande rund 98% aller Geburten in Krankenhäusern stattfinden, und nicht bei fehlenden Geburtsrisiken durch Hebammen im häuslichen Umfeld oder in ebenfalls hebammengeleiteten Geburtshäusern.
Als eine der wahrscheinlichen Folgen der Klinikzentrierung des Geburtsgeschehens wird seit mehreren Jahren die mit rund 30% nach Meinung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu hohe Rate von operativen Geburten bei Kaiserschnitt diskutiert. Die WHO hält für Mutter wie Kind eine Rate von 10% bis 15% und unter bestimmten Umständen auch 20% für gesundheitlich notwendig. Ob die Kritik an der damit auch in Deutschland zu hohen Kaiserschnittrate sowie an der zu geringen Wertschätzung und Nutzung von Hebammen etwas bewirkt hat, haben bereits mehrere Studien in den letzten Jahren untersucht (Übersicht in dem hier angezeigten Report).
Aktuell erhoben die Gesundheitswissenschaftlerin Petra Kolip von der Universität Bielefeld und der am Zentrum für Sozialpolitik der Universität Bremen arbeitende Gesundheitswissenschaftler Bernard Braun im Auftrag der nordwestdeuztschen Regionalkasse Handelskrankenkasse (hkk) im Juni 2014 umfassend per Fragebogen die Erfahrungen von 1.627 Frauen, die bis zu sechs Monate zuvor stationär ein Kind geboren hatten. Auch bei diesen Frauen betrug die Kaiserschnittrate etwas mehr als 30%. Bei einer ebenfalls durchgeführten Auswertung der Routinedaten für alle Versicherten, die zwischen 2008 und 2013 in einem Krankenhaus ein Kind geboren hatten, stieg dieser Wert auf durchgehend rund 33%.
Zu den wichtigsten bestätigten oder auch neu gewonnenen Erkenntnissen und Schlussfolgerungen zählen die Autoren:
• Auffällig war zum Beispiel, dass der Anteil an Frauen, die laut Mutterpass eine Risikoschwangerschaft hatten, im bundesweiten Vergleich deutlich unterrepräsentiert war. Des Weiteren ließ sich die These, dass werdende Mütter mit bekannten Risikofaktoren beunruhigter in Bezug auf Schwangerschaft und Geburt sind, nicht bestätigen.
• Überraschend viele Frauen mit einer Kaiserschnittgeburt gaben an, sie wären insgesamt nicht gut über den Ablauf und die Folgen eines Kaiserschnitts informiert worden - und zwar weder von Ärzten noch von Hebammen.
• Für die Phase nach der Geburt ist die wichtigste und eventuell auch folgenreichste Erkenntnis, dass mit knapp über die Hälfte der Mütter kein bei der Geburt anwesender Arzt ein abschließendes Gespräch geführt hat. Bei über 45 Prozent der Mütter hat auch die bei der Geburt anwesende Hebamme kein Gespräch angeboten. Dabei gaben über 70 Prozent der Frauen an, dass dieses Gespräch (sehr) hilfreich gewesen wäre. Angesichts des häufig länger als drei Tage dauernden Klinikaufenthalts kann dies nicht daran liegen, dass die Mütter nur kurz in der Klinik waren.
• Die Studie deckt sich mit den bereits vorliegenden Befunden. Da sticht nichts heraus oder ließe vermuten, dass es den hkk-versicherten Müttern besser oder schlechter ginge als den restlichen Frauen in der Republik. Dies stellt für die Autoren jedoch angesichts der bekannten gesundheitlichen Nachteile mancher Defizite und Mängel keinen Grund zur Zufriedenheit dar - im Gegenteil. Offensichtlich bedarf es dazu kontinuierlicher Transparenz, wie zum Beispiel durch diesen hkk-Gesundheitsreport, konkreter Aufklärung und strukturverändernder Modellversuche.
• Für den anhaltend hohen Anteil von Kaiserschnittgeburten sind vor allem organisatorische Faktoren verantwortlich - also die "Klinikkultur". Die große regionale Variation - 51 Prozent in Landau in der Pfalz bis 16 Prozent in Dresden und mittendrin Bremen und umzu bei Altersstandardisierung - zeigt, dass es offenbar einen großen Spielraum in der Entscheidung für einen Kaiserschnitt gibt. Natürlich spielen forensische Gründe eine große Rolle: Kliniken fürchten, dass gravierende Komplikationen die Haftpflichtprämie hoch treiben und auch der Personalschlüssel ist relevant.
• Eine zentrale Forderung des Reports ist daher auch die 1:1-Betreuung durch Hebammen, und dies auch kontinuierlich. Die Präsenz einer einzigen verantwortlichen Hebamme während der gesamten Geburt war einer der am häufigsten auf eine entsprechende offene Frage geäußerten Wünsche der befragten Mütter. Dies senkt nachweislich die Kaiserschnittsrate und erhöht das Wohlbefinden von Gebärenden. Dass aber möglicherweise auch eine allein quantitative Verbesserung der Hebammenbetreuung nicht sämtliche qualitativen Mängel behebt, zeigen die Ergebnisse der hkk-Studie auch an mehreren Stellen.
• Der Hebammenkreißsaal, den es z.B. auch in Bremerhaven gibt, könnte hier ein wirksames und richtungsweisendes Modell sein.
Der ausführliche hkk-Gesundheitsreport 2014. Schwangerschaft und Geburt: Ergebnisse einer Befragung von Müttern ist komplett kostenlos erhältlich.
Jens Holst, 26.11.14
Hängt die Gesundheit der "Menschen mit Migrationshintergrund" von der Art der Integrationspolitik ab? Irgendwie schon.
 Um es gleich vorweg zu sagen: Wie die Gesundheit der länger als 10 Jahre in Deutschland lebenden "Menschen mit Migrationshintergrund" im Vergleich mit derselben sozialen Gruppe in anderen europäischen Ländern aussieht, findet sich einer gerade veröffentlichten Querschnittsuntersuchung mit Daten des "European Union Survey on Income and Living Conditions" zu den möglichen Zusammenhängen von Gesundheit und Integrationspolitik nicht. Der Grund: Für Deutschland kann wie für ein paar andere Länder (Estonia, Latvia, Malta, Slovenia) nicht unterschieden werden, ob die Einwanderer in EU-Ländern oder außerhalb der EU geboren wurden.
Um es gleich vorweg zu sagen: Wie die Gesundheit der länger als 10 Jahre in Deutschland lebenden "Menschen mit Migrationshintergrund" im Vergleich mit derselben sozialen Gruppe in anderen europäischen Ländern aussieht, findet sich einer gerade veröffentlichten Querschnittsuntersuchung mit Daten des "European Union Survey on Income and Living Conditions" zu den möglichen Zusammenhängen von Gesundheit und Integrationspolitik nicht. Der Grund: Für Deutschland kann wie für ein paar andere Länder (Estonia, Latvia, Malta, Slovenia) nicht unterschieden werden, ob die Einwanderer in EU-Ländern oder außerhalb der EU geboren wurden.
Die mit Daten aus dem Jahr 2011 durchgeführte Studie schließt 14 europäische Länder ein. Die Integrationspolitik dieser Länder wurde mittels des erprobten "Migrant Integration Policy Index" nach drei Typen unterschieden: multikulturell (9 Länder darunter Großbritannien, Italien, Schweden), exklusionistisch (Österreich, Dänemark) und assimilationistisch (je nach Dimension mehr oder weniger sind das Frankreich, Schweiz, Luxemburg). In die Untersuchung des Gesundheitszustandes wurden dann Daten von 177.300 über sechszehnjährige Personen einbezogen, die in den jeweiligen Ländern geboren waren und Daten von 7.088 Personen bzw. Immigranten, die außerhalb der EU geboren waren und bereits 10 und mehr Jahre in dem jeweiligen EU-Land wohnten. Mit diesem Merkmal sollte der so genannte "healthy immigrant effect" ausgeschlossen werden.
Gewichtet nach Alter, Bildungsabschluss, Beschäftigungsstatus und sozio-ökonomischen Bedingungen wurde dann der selbst wahrgenommene Gesundheitszustand zur Bewertung der Gesundheit genutzt.
Verglichen mit Immigranten in Ländern mit multikultureller Integrationspolitik war der Gesundheitszustand der in Ländern mit exklusionistischer Integrationspolitik lebenden Immigranten signifikant schlechter, und zwar komplett adjustiert um das 1,78-fache bei Männern und um das 1,47-fache bei Frauen. Und selbst im Vergleich mit Ländern, deren Politik sich vor allem auf die Assimilation von ausländischen Personen konzentriert, war die Gesundheit der Immigranten in exklusionistischen Ländern noch signifikant schlechter: um das 1,19-fache bei Männern und 1,22-fache bei Frauen.
Zusätzlich war auch die Ungleichheit beim Gesundheitszustand zwischen Immigranten und Einwohnern ohne Migrationshintergrund in Ländern mit einer auf Exklusion gerichteten Integrationspolitik am höchsten - auch nach dem Ausschluss des Einflusses der sozioökonomischen Verhältnisse.
Auch wenn eine weitere Erforschung solcher Zusammenhänge sicher notwendig ist, kann sich nach den Ergebnissen dieser Studie niemand mehr damit selbst beruhigen, dass es sich bei der Alternative "Willkommenskultur" oder "Festung Europa"-Mentalität um eine Stimmungs- oder Stilfrage handelt.
Und vielleicht schaffen es dann auch die deutschen Organisatoren des Survey den Unterschied zwischen in Birmingham oder Manila geborenen Immigranten zu erfassen. Welche Art von Integrationspolitik dann in Deutschland praktiziert wird, ist im Lichte der aktuellen gesetzgeberischen und faktischen Asylbewerberpolitik leider nicht eindeutig abzusehen.
Der Aufsatz Immigrants' health and health inequality by type of integration policies in European countries von Davide Malmusi ist am 17. September 2014 im "European Journal of Public Health" online first erschienen. Das Abstract ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 26.9.14
"Stille- oder Null-Post"-Effekte bei der morgendlichen Übergabe von 40% der nächtlichen Ereignisse durch ärztliches Personal
 Die stationäre Behandlung von PatientInnen ist ein vollkontinuierlicher Prozess in dem rund um die Uhr viel passieren kann und eine Vielzahl von professionellen HelferInnen beteiligt ist. Die Weiter- oder Übergabe von Informationen ist daher eine wichtige Voraussetzung für die bedarfs- und situationsgerechte wie sichere Behandlung der PatientInnen und die professionelle Zufriedenheit. Eine Reihe von Studien im Aus- und Inland haben aber gezeigt, dass dies nicht überall und immer gewährleistet ist.
Die stationäre Behandlung von PatientInnen ist ein vollkontinuierlicher Prozess in dem rund um die Uhr viel passieren kann und eine Vielzahl von professionellen HelferInnen beteiligt ist. Die Weiter- oder Übergabe von Informationen ist daher eine wichtige Voraussetzung für die bedarfs- und situationsgerechte wie sichere Behandlung der PatientInnen und die professionelle Zufriedenheit. Eine Reihe von Studien im Aus- und Inland haben aber gezeigt, dass dies nicht überall und immer gewährleistet ist.
Eine inhaltsanalytische Analyse von 16 Dienstübergaben patientenrelevanter Informationen zwischen Pflegekräften in Krankenhäusern im Rahmen einer Dissertation an der Universität Witten-Herdecke (Andreas Lauterbach: "Stille Post": Qualitative Untersuchung serieller Reproduktionen bei Dienstübergaben; in Buchform 2008 unter dem Titel "... da ist nichts, außer dass das zweite Programm nicht geht: Stille Post. Dienstübergaben in der Pflege" veröffentlicht und auch heute noch unbedingt lesenswert), kam zu folgendem Ergebnis: "Die unhinterfragte These, dass die Informationen zwar fragmentiert, aber homogen und sich puzzleartig ergänzend sind, ist falsch: Die Informationslandschaft ist brüchig, weist Gräben und Verwerfungen auf und ist in Teilen eine terra incognita. Pflegerische Entscheidungen werden in Situationen informationeller Unsicherheit ausgehandelt. Die hohe Arbeitsbelastung wandelt die Funktion der Übergabe: Sie wird zunehmend zum Refugium das der Kompensation der eigenen Arbeitsbelastung dient und einen Rahmen zur Rechtfertigung des eigenen pflegerischen (Nicht-) Handelns bietet. Sie ist mehr als ein "pflegerisches Relikt" (Zegelin-Abt): Sie ist Beispiel für die Reformationsresistenz einer (Semi-) Profession, die ihre Fachsprache noch nicht gefunden hat."
Die Hoffnung, dass es sich hier um Einzelfälle handelt oder das Wissen um Defizite im Rahmen von gezielter Weiterbildung zu deutlichen Verbesserungen gegenüber der Vergangenheit geführt hat, erweist sich im Lichte der Ergebnisse einer in den Jahren 2012 und 2013 durchgeführten quantitativen Analyse aus den internistischen Abteilungen zweier großer kanadischen Kliniken als verfrüht.
Untersucht wurde die morgendliche Weitergabe ("morning handover") von wichtigen patientenbezogenen Informationen und klinischer Verantwortung zwischen dem für die ärztlich-medizinischen Behandlung in der Nacht zuständigen Fachpersonal (dies waren zum Teil Medizinstudenten im dritten Jahr ihres Studiums oder Assistenzärzte im ersten oder zweiten Jahr ihrer Berufstätigkeit).
An den 26 beobachteten Tagen sah das Übergabegeschehen folgendermaßen aus:
• Insgesamt gab es 141 klinisch wichtige und damit unbedingt zu kommunizierende nächtliche Ereignisse.
• Die Angehörigen der Nachtschicht informierten die Angehörigen des Tagteams über 40,4% dieser Ereignisse und die für sie wichtigen Informationen in den morgendlichen Übergabegesprächen nicht.
• Wer vielleicht hofft, dass die notwendigen Informationen zumindest schriftlich in der Patientenakte o.ä. dokumentiert worden sind, wird leider nicht fündig: Zu 85,4% der 141 wichtigen Ereignisse fand sich keinerlei schriftlicher Hinweis.
• Univariate Analysen zeigten, dass das schematische Abarbeiten der Patientenliste ("patient-by-patient") und Gespräche in einer speziellen Räumlichkeit den Umfang und die Qualität der weitergegebenen Informationen verbesserten, während ein störungsreiches Umfeld dies verschlechterte. In einer multivariaten Analyse blieb als einziger unabhängiger Prädiktor für eine gute Informationsübergabe die "patient-by-patient"-Besprechung übrig. Die Wahrscheinlichkeit bzw. Chance für sie erhöhte sich unter dieser Bedingung um das 3,8-Fache (OR).
• Ob das beobachtete Geschehen zu nachweisbaren gesundheitlichen Nachteilen für die PatientInnen führte, wurde in der Studie zwar nicht untersucht, erscheint den Forschern aber zum Teil als wahrscheinlich. Solche und andere genannten Limitationen könnten aber in weiteren Untersuchungen relativ einfach vermieden werden.
Die kanadischen Forscher weisen für die weitere Praxis zum einen auf die Notwendigkeit spezieller Trainingsprogramme für Übergabegespräche hin. Zum anderen müssten für solche Gespräche aber auch Arbeitsabläufe verändert werden, mehr Zeit zur Verfügung stehen und eine möglichst störungsfreie Umgebung geschaffen werden.
Der am 21. Juli 2014 zuerst online veröffentlichte Aufsatz Morning Handover of On-Call IssuesOpportunities for Improvement von Megan K. Devlin et al. ist in der Zeitschrift "JAMA Internal Medicine" erschienen. Ein Abstract ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 22.7.14
"Noncompliance kann tödlich enden" oder warum es beim Entlassungsmanagement in Kliniken manchmal um mehr als warme Worte geht
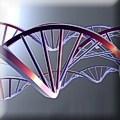 Die Mehrheit der im Krankenhaus behandelten Menschen wird nicht als vollkommen geheilt sondern als mehr oder minder stark behandlungsbedürftig entlassen. Ein Indikator ist, dass diese Personen umden stationären Heilungserfolg erhalten oder verbessern zu können oft kontinuierlich auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen sind.
Die Mehrheit der im Krankenhaus behandelten Menschen wird nicht als vollkommen geheilt sondern als mehr oder minder stark behandlungsbedürftig entlassen. Ein Indikator ist, dass diese Personen umden stationären Heilungserfolg erhalten oder verbessern zu können oft kontinuierlich auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen sind.
Dass es an der Schnittstelle zur nachstationären Behandlung zu potenziell folgenreichen und unerwünschten Ereignissen kommen kann, zeigt jetzt eine Untersuchung der Einnahme des die Blutgerinnung hemmenden oder "blutverdünnenden" Arzneimittels Clopidogrel nach der Implantation eines Stents. Stents, eine Art gefäßerweiterndes Drahtgeflecht in den Herzkranzgefäßen (mit oder ohne Arzneimittelbeschichtung), werden zur Prävention von schweren oder gar tödlichen Folgen einer Gefäßdurchblutungsstörung eingepflanzt und sind relativ teuer. Damit dieser Schutz wirklich funktioniert, müssen so behandelte Patienten nach der Entlassung aus dem Krankenhaus ohne Unterbrechung das genannte Medikament einnehmen. Wenn die Einnahme um drei oder mehr Tage unterbrochen ist, verdoppelt sein Risiko zu sterben oder innerhalb der zwei Jahre nach der Entlassung mit einem Herzinfarkt erneut in ein Krankenhaus eingeliefert zu werden - unabhängig von der Art des eingepflanzten Stents. Das höchste Risiko (um das 5,5Fache) für diese Ereignisse besteht in den ersten 30 Tagen nach der Entlassung.
Dass diese dringend notwendige lückenlose medikamentöse Behandlung nicht funktionieren muss, zeigt jetzt eine Untersuchung des gesamten Behandlungsgeschehens von 15.629 Stent-Implantatempfänger im kanadischen British Columbia. Die Patienten, die ihren Stent in den Jahren 2004 bis 2006 erhielten, wurden noch bis zu zwei Jahre nach Entlassung beobachtet. 4.822 von ihnen oder rund 31% hatten das Rezept für das Medikament nicht innerhalb der ersten drei Tage nach Entlassung eingelöst und starteten daher frühestens am vierten Tag mit der notwendigen Behandlung. Die Daten zeigen aber, dass ein Teil der Patienten auch nach fünf und mehr Tagen kein Arzneimittel eingelöst und dann wahrscheinlich auch eingenommen hatte.
Auch wenn nicht geklärt wurde, warum die Patienten ihr Rezept nicht sofort einlösten und unabhängig von einigen methodischen Limitationen der Studie (z.B. keine Randomisierung) sprechen die AutorInnen mit dem folgenden Statement wichtige Leistungen in der Entlassungs- oder Überleitungsphase stationär behandelter Patienten an, die offensichtlich selbst bei derart aufwändigen und riskanten Behandlungen noch nicht überall im Alltag angekommen sind und wichtige Voraussetzungen für die nötige Therapietreue sind: "Interventions to enhance discharge planning, educate patients, simplify regulatory hurdles, and ensure early community pharmacy involvement all have the potential to improve early compliance with medications after hospital discharge and, ultimately, clinical outcomes."
Ob so etwas in Deutschland auch passiert, kann zwar mangels entsprechender Untersuchungen nicht gesichert gesagt oder verneint werden, ist aber angesichts des häufig als verbesserungsbedürftig bewerteten Entlassungsmanagements nicht unwahrscheinlich.
Die am 28. Mai 2014 online in der Fachzeitschrift "Journal of the American Heart Association" veröffentlichte Studie Delay in Filling First Clopidogrel Prescription After Coronary Stenting Is Associated With an Increased Risk of Death and Myocardial Infarction von Nicholas L. Cruden et al. (2014; 3: e000669) ist komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 29.5.14
"Beds create their own demand" oder die Realität von Nachfrageelastizität am Beispiel von Intensivstationsbetten in den USA
 Im Gesundheitswesen spielt die anbieter- oder angebotsinduzierte Nachfrage eine gewichtige Rolle bei der Art und Inanspruchnahme angebotener Leistungen. Dabei spielen Informations-Asymmetrien zwischen Ärzten und Patienten aber auch die schlichte Existenz bestimmter Versorgungsangebote praktisch relevante Rollen.
Im Gesundheitswesen spielt die anbieter- oder angebotsinduzierte Nachfrage eine gewichtige Rolle bei der Art und Inanspruchnahme angebotener Leistungen. Dabei spielen Informations-Asymmetrien zwischen Ärzten und Patienten aber auch die schlichte Existenz bestimmter Versorgungsangebote praktisch relevante Rollen.
Das kostenträchtige und für die Versorgungsqualität relevante Beispiel der Inanspruchnahme der in den USA weltweit größten Menge von Intensivbetten (intensive care unit [ICU]) wurde am 9. Januar 2014 in der Fachzeitschrift "Journal of the American Medical Association" etwas ausführlicher vorgestellt. In den USA gibt es 25 Intensivstationsbetten pro 100.000 Personen auf deren Nutzung rund 3% der us-amerikanischen Gesundheitsausgaben und fast 1% des Bruttoinlandsprodukts entfallen. Ihre Anzahl wuchs zwischen 2000 und 2005 um 7%. Großbritannien kommt mit 5 solcher Betten pro 100.000 Personen aus, ohne dass sich dies erkennbar negativ auf die Behandlungsergebnisse oder die Lebenserwartung auswirkt. Auf dieser Basis gibt es zwei deutlich unterschiedliche Effekte: Zum einen unterscheidet sich der Schweregrad oder case-mix der behandelten Patienten in den beiden Ländern so, dass die Mehrheit der ICU-Patienten in Großbritannien schwerstkrank ist oder ein hohes Sterberisiko hat, während in den USA zahlreiche ICU-Patienten dort "nur" zur Beobachtung sind. Zum anderen sterben aber in den us-amerikanischen ICU's wesentlich mehr Patienten als in den britischen.
Mit ihrem dazu vor allem vorgetragenen Erklärungsversuch, "increased bed availability appears to reduce the incentive to keep dying patients out oft the ICU", fokussieren die AutorInnen auf die vielfältige Rolle und Wirkung des Umfangs von Behandlungsangeboten bzw. -ressourcen wie z.B. von Krankenhausbetten auf die Nachfrage und deren Elastizität. Das Angebot von Intensivstationsbetten führt dann sowohl dazu, dass Patienten dort eingewiesen werden, die eigentlich gar keinen intensivmedizinischen Behandlungsbedarf haben, als auch solche Patienten, bei denen es unwahrscheinlich ist, dass ihnen eine intensivmedizinische Behandlung hilft bzw. ihr Sterblichkeitsrisiko beeinflusst.
Im Rest des kurzen Artikels wägen die AutorInnen die gesundheitspolitische und -ökonomische Relevanz eines Abbaus von ICU-Betten ab und schlagen weitere Forschung über die ökonomisch wie gesundheitlich unerwünschten oder sinnlos-belastenden Auswirkungen dieser Art von Nachfrageelastizität vor.
Der kurze Artikel ("viewpoint") ICU Bed Supply, Utilization, and Health Care Spending. An Example of Demand Elasticity von Rebecca A. Gooch und Jeremy M. Kahn ist am 9.1. 2014 online first in "Journal of the American Medical Association" erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 9.1.14
Wie häufig erhielten GKV-Versicherte 2008-2012 Hüft-/Knie-Endoprothesen und welche Leistungen erhielten sie vor- und nachoperativ?
 Die Endoprothetik - der operative Einsatz von Implantaten in den Körper, um Arthrose-geschädigte Gelenke dauerhaft zu ersetzen - verbessert die Lebensqualität vieler Patienten mit degenerativen Gelenkerkrankungen und ist aus der modernen Medizin nicht mehr wegzudenken. Experten sind jedoch überzeugt, dass rund zehn Prozent der Operationen in Deutschland unnötig sind. Im Vergleich zu anderen Ländern ist Deutschland nach einem im Frühjahr 2013 veröffentlichten Bericht der "Organisation für Economic Co-operation and Development (OECD)" Spitzenreiter oder liegt nach anderen Berichten bei der endoprothetischen Versorgung mit Hüft- und Kniegelenken auf einem der Medaillenränge. Ärzte und Krankenhäuser müssen sich mit dem Vorwurf auseinandersetzen, das eigene wirtschaftliche Interesse über das ihrer Patienten zu stellen. Wird in Deutschland zu schnell operiert?
Die Endoprothetik - der operative Einsatz von Implantaten in den Körper, um Arthrose-geschädigte Gelenke dauerhaft zu ersetzen - verbessert die Lebensqualität vieler Patienten mit degenerativen Gelenkerkrankungen und ist aus der modernen Medizin nicht mehr wegzudenken. Experten sind jedoch überzeugt, dass rund zehn Prozent der Operationen in Deutschland unnötig sind. Im Vergleich zu anderen Ländern ist Deutschland nach einem im Frühjahr 2013 veröffentlichten Bericht der "Organisation für Economic Co-operation and Development (OECD)" Spitzenreiter oder liegt nach anderen Berichten bei der endoprothetischen Versorgung mit Hüft- und Kniegelenken auf einem der Medaillenränge. Ärzte und Krankenhäuser müssen sich mit dem Vorwurf auseinandersetzen, das eigene wirtschaftliche Interesse über das ihrer Patienten zu stellen. Wird in Deutschland zu schnell operiert?
Diese und weitere Versorgungsdetails zur Prävalenz von endoprothetischen Operationen des Knie- und Hüftgelenks in den Jahren 2008 bis 2012 untersucht Bernard Braun, Gesundheitswissenschaftler am Zentrum für Sozialpolitik der Universität Bremen anhand von Routinedaten in einem Ende November 2013 veröffentlichten Gesundheitsreport für die überwiegend in Nordwestdeutschland lebenden Versicherten der gesetzlichen Krankenkasse hkk.
Zusätzlich zu den vor kurzem auch bereits mit den Routinedaten anderer GKV-Kassen - z.B. denen der AOK im Faktencheck Gesundheit Knieoperationen (Endoprothetik) - Regionale Unterschiede und ihre Einflussfaktoren der Bertelsmann Stiftung - untersuchten Häufigkeiten dieser Operationen analysierte der hkk-Report auch erstmalig die in den Kassendaten dokumentierte vor- und nachoperative (jeweils 6 Monate) Inanspruchnahme ausgewählter Leistungen wie ambulant-ärztliche Behandlungsfälle, Heil- und Hilfsmittel sowie Arzneimittel.
Die Ergebnisse lauten u.a. so:
• Im Untersuchungszeitraum steigt die Anzahl der Operationen bei hkk-Versicherten nahezu kontinuierlich an. Während im Jahr 2008 noch 598 operierte Hüft-Endoprothesen registriert wurden, waren es 2012 bereits 723 - ein Anstieg von 21 Prozent. Ein ähnliches Bild zeigt sich bei den Knie-Endoprothesen mit 347 Fällen in 2008 sowie 432 Fällen in 2012, was einer Steigerung von 24,5 Prozent entspricht.
• Bundesweit stagniert laut Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) die Anzahl der erstimplantierten Hüft- und Knie-Endoprothesen seit 2009 auf dem erreichten hohen Niveau. Um die Vergleichbarkeit der hkk-Daten mit anderen Studien zu gewährleisten, nutzt die Studie die Zahl der Fälle pro 100.000 Versichertenjahre (VJ) als gemeinsame Berechnungsgrundlage. Dabei ergibt sich erwartungsgemäß, dass die durchschnittlich jüngeren hkk-Versicherte im Vergleich zum bundesweiten Behandlungsgeschehen seltener eine Knie-Prothese erhalten: Im Referenzjahr 2011 waren es 118,2 Erstimplantationen je 100.000 VJ, während der bundesweite Vergleichswert bei AOK-Versicherten 129,5 betrug. Im gleichen Jahr wurden bei der hkk 175,8 Hüft-Endoprothesen je 100.000 VJ erstmals eingesetzt. In diesem Fall liegen jedoch keine Referenzzahlen für den Bundesdurchschnitt vor.
• Der hkk Gesundheitsreport zeigt einen deutlichen Anstieg von Revisionen und Wechseln bei hkk-Versicherten: Von 2008 bis 2012 zeigte sich bei Hüft-Endoprothesen ein prozentualer Anstieg von 75 Prozent; bei Knie-Endoprothesen lag dieser Wert bei 45 Prozent. Bundesweit nahmen die Revisionen und Wechsel bei Knie-Endoprothesen im Vergleichszeitraum mit 43 Prozent ähnlich stark zu; die Anzahl der Hüft-Endoprothesen ist jedoch seit 2009 leicht rückläufig.
• Bei der Analyse der Inanspruchnahme ausgewählter Leistungen fällt vor-operativ der im Vergleich mit dem gesamten vor- und nachoperativen Leistungsvolumen relativ geringe Umfang der nachweislich hilfreichen (vgl. dazu den entsprechenden Forum-Beitrag "Evidenz für den Nutzen von Gewichtsabnahme, Bewegungssport und Muskelaufbau als Methoden für Patienten mit Knie-/Hüft-Arthrose") Heilmittelleistungen, also von Physiotherapie etc. auf. Hier könnte es sich um eine Unter- und Fehlversorgung handeln. Für die 6 Monate nach der Operation ist besonders der noch lang andauernde spezifische Behandlungsbedarf gegen offensichtich starke (indiziert durch die Verordnung von Opioden) Schmerzen und Bewegungsprobleme auffällig.
• Die zum Teil in diesem Umfang nicht erwarteten Häufigkeiten des vor- und nachoperativen Befindens und Behandlungsgeschehens begründen die Notwendigkeit einer noch besseren Information und Aufklärung der an Arthrose erkrankten Personen über die konservativen Behandlungsmöglichkeiten und die realistischen Erfolge einer Operation. Personell könnte dies durch unabhängige Ärzte erfolgen. Als Instrument könnten so genannte evidenzbasierte Entscheidungshilfen oder "decision aids" eingesetzt werden, die sich bei der Vermeidung noch nicht notwendiger Operationen bzw. der Initiierung konservativer Behandlung von Gelenkerkrankungen bereits als erfolgreich erwiesen haben (siehe dazu den entsprechenden Forumbeitrag "Der Boom der Knie- und Hüftgelenks-Endoprothesen-Operationen kann durch "decision aids" signifikant gebremst werden").
• Unabhängig von den genannten Maßnahmen unterstützt der Verfasser des Reports und die hkk die Bemühungen um den Aufbau und eine zeitnahe Auswertung eines Endoprothesenregisters.
Den hkk-Gesundheitsreport zum Thema Knie- und Hüft-(Total-)Endoprothesen 2008 bis 2012 von Bernard Braun ist komplett kostenlos erhältlich.
Ein Interview mit Dr. Bertram Regenbrecht, Zentrum für Endoprothetik, Fußchirurgie, Kinder- und Allgemeine Orthopädie der Roland Klinik, Bremen, das aus Sicht des klinischen Praktikers die Ergebnisse des Reports kommentiert und erweitert, ist ebenfalls kostenlos erhältlich.
Jens Holst, 1.1.14
Schlusslicht der stationären pflegerischen Versorgung in Europa für das deutsche Gesundheitssystem - und Griechenland.
 Das deutsche Gesundheitssystem nimmt in internationalen Vergleichen bei vielen Leistungsindikatoren meist einen Mittelplatz ein, bei einigen problematischen landet es aber auch am Ende solcher Rangskalen.
Das deutsche Gesundheitssystem nimmt in internationalen Vergleichen bei vielen Leistungsindikatoren meist einen Mittelplatz ein, bei einigen problematischen landet es aber auch am Ende solcher Rangskalen.
Eine in der international durchgeführten Studie "Registered nurses forecasting (RN4CAST)" gestellte Frage nach der Anzahl von pflegerisch notwendigen Leistungen, die z.B. aus Zeitmangel nicht durchgeführt werden konnten, also eines Maßes für implizite Rationierung, zeigt, dass dies auch bei gesundheitlich gewichtigen Leistungen der Fall sein kann.
Diese und eine Reihe anderer für die Arbeitsbedingungen und die patientenbezogene Versorgungsqualität relevanten Fragen wurde 2009/10 33.659 Pflegekräften in 488 den chirurgischen und medizinischen Abteilungen in Akut-Krankenhäusern in zwölf europäischen Ländern, darunter Großbritannien, Finnland, Griechenland, Schweiz und Deutschland, gestellt. In Deutschland betraf dies 1.508 examinierte Pflegekräfte in bundesweit 49 Kliniken.
Die Ergebnisse aus deutscher Sicht sahen u.a. so aus:
• Während in Europa durchschnittlich 54% aller Pflegekräfte über einen Bachelorabschluss verfügten, traf dies zu dem Befragungszeitpunkt für keine(n) Befragten an deutschen Krankenhäusern zu. Dies bedeutete beim Ausbildungsstand den letzten Platz.
• Beim Belastungsindikator Patient pro Pflegekraft landete Deutschland mit 13 Patienten erneut auf dem letzten Platz. Den Spitzenplatz nahm Norwegen mit 5 Patienten pro Pflegekraft ein.
• Abgerundet werden diese Negativrekorde mit dem erneut europaweit schlechtesten Indikator des Anteils der Pflegekräfte, die in ihrer letzten Arbeitsschicht mit nichtpflegerischen Tätigkeiten beschäftigt waren. Im europäischen Durchschnitt waren es 34%, in Spanien 17% und in Deutschland 61%.
• Bei den 13 pflegerischen Aktivitäten (z.B. physische Pflege, Patientenüberwachung und -mobilisierung sowie den psychosoziale äußerst notwendigen Patientengesprächen), für welche die Pflegekräfte befragt wurden, ob sie sie z.B. wegen Zeitmangel nicht durchführen konnten, lagen die Pflegekräfte in deutschen Krankenhäusern erneut deutlich über dem europäischen Durchschnitt von 3,6. Mit durchschnittlich 4,7 nicht erbrachten notwendigen pflegerischen Maßnahmen landete Deutschland auf dem vorletzten Platz - vor Griechenland mit 5,8 solcher Aktivitäten. Dass es besser gehen kann zeigten die Pflegekräfte in der Schweiz, den Niederlanden und in Schweden mit 2,8 rationierten Pflegemaßnahmen.
• Angesichts des immer häufiger beklagten Pflegekräftemangels ist auch ein weiteres Ergebnis relevant: In Kliniken mit vorteilhafteren Arbeitsbedingungen, einer geringeren Anzahl von Patienten pro Pflegekraft und eines unterdurchschnittlichen Anteils von nichtpflegerischen Tätigkeiten am gesamten Arbeitsvolumen ist der Anteil von AussteigerInnen aus dem Pflegeberuf signifikant am geringsten.
Diese Ergebnisse werden auch in einer neueren (2012) inhaltlich vergleichbaren Befragung von Pflegekräften an 27 hessischen Krankenhäusern bestätigt, deren Ergebnisse in den nächsten Wochen veröffentlicht werden.
Der Forderung der Autorinnen des Europavergleichs, solche Befragung als eine Art Frühwarnsystem für dauerhaft die Arbeits- und Versorgungsqualität verschlechternde Arbeitsbedingungen regelmäßig durchzuführen und dadurch Druck auf eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen und darunter auch eine Erhöhung der Personalanzahl auszuüben, ist zuzustimmen.
Der Aufsatz Prevalence, patterns and predictors of nursing care left undone in European hospitals: results from the multicountry cross-sectional RN4CAST study von Dietmar Ausserhofer et al. ist in der Fachzeitschrift "BMJ Quality & Safety" online am 10. November 2013 erschienen. Das Abstract ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 18.12.13
Welchen Einfluss haben TV-Serien wie "Grey's Anatomy" oder "In aller Freundschaft" auf den Pflegernachwuchs in Krankenhäusern?
 Ein Teil des gesellschaftlichen Ansehens, Immages, der Bedeutung oder Attraktivität von Personen oder Personengruppen wird über und in Medien wie dem Fernsehen bestimmt. Die unzähligen und nicht endenwollenden Kommissar-, Tatort- oder Kriminalserien zeichnen z.B. ein Bild der im Polizeidienst tätigen Berufsgruppen, das die dortige Arbeit und dortigen Beschäftigten mehr oder weniger stark positiv oder heroisierend verzerrt. Wer einmal in einem asiatischen Land begeistert als Bürger des Landes angesprochen wurde, in dem Kommissar Derrick wirkte (fast im selben Atemzug mit Beckenbauer), weiß, dass selbst Nationalstereotype über Fernsehserien mitbestimmt werden. Und wer glaubt nicht, mit Kommissar Wallander Stimmiges über "die Schweden" zu erfahren?
Ein Teil des gesellschaftlichen Ansehens, Immages, der Bedeutung oder Attraktivität von Personen oder Personengruppen wird über und in Medien wie dem Fernsehen bestimmt. Die unzähligen und nicht endenwollenden Kommissar-, Tatort- oder Kriminalserien zeichnen z.B. ein Bild der im Polizeidienst tätigen Berufsgruppen, das die dortige Arbeit und dortigen Beschäftigten mehr oder weniger stark positiv oder heroisierend verzerrt. Wer einmal in einem asiatischen Land begeistert als Bürger des Landes angesprochen wurde, in dem Kommissar Derrick wirkte (fast im selben Atemzug mit Beckenbauer), weiß, dass selbst Nationalstereotype über Fernsehserien mitbestimmt werden. Und wer glaubt nicht, mit Kommissar Wallander Stimmiges über "die Schweden" zu erfahren?
Zwei aktuell veröffentlichte Studien haben nun untersucht, welches Bild oder welche Stereotypen von männlichen Pflegekräften die seit Jahren ebenfalls weltweit und national boomenden Krankenhausserien erzeugen oder transportieren und damit möglicherweise Einfluss auf die Berufswahl von Männern und die Pflegesituation in Krankenhäusern nehmen.
Eine australische Wissenschaftlergruppe untersuchte dazu die regelmäßig zwischen 2007 und 2010 von verschiedenen Fernsehsendern -auch deutschen - gesendeten Episoden der us-amerikanischen Krankenhaus- und Krankenhauspersonal-Serien Greys Anatomy, Hawthorne, Nercy, Nurse Jackie und Private Practice.
Das wesentliche Ergebnis der im September 2013 veröffentlichten Studie war, dass in der Pflege beschäftigte Männer bzw. Pfleger überwiegend durch ex- und implizite Stereotypen oder Klischees dargestellt wurden: Sie wurden wesentlich häufiger als ihre weiblichen Berufskolleginnen gefragt, ob ihre Tätigkeit eigentlich eine Karriere ermögliche. Auch ihre Männlichkeit und männliche Sexualität wurden häufig in Frage gestellt. Obwohl den Pflegern durchaus Kompetenz zugesprochen wird, wird ihre Rolle gewöhnlich auf die einer Requisite, des Sprechers von Minderheiten oder auf die des Objekts oder auf die der Quelle von Belustigung bzw. Comedy reduziert.
Die hier verbreiteten Stereotypen und Klischees der "männlichen Krankenschwestern" können nach Ansicht der ForscherInnen "potentially discourage men from considerung nursing as a viable profession."
Bereits 2012 hatte der ebenfalls in Australien forschende Wissenschaftler D. Stanley für die Jahre 1900 bis 2007/2010 u.a. mit dem Suchbegriff "male nurse" 36.000 Filmdokumente gefunden und 13 davon inhaltsanalytisch untersucht. 12 von ihnen kamen aus den USA. Die meisten Filme portraitierten Pfleger negativ. Sie entsprachen nicht dem Selbst- und Fremdbild des beherrschenden Mannes, sondern sie waren verweich- oder weiblicht, homosexuell, gemeingefährlich, korrupt oder inkompetent. Nur wenige Darstellungen von Pflegern zeigten sie in ihren traditionellen maskulinen Rollen oder als klinisch kompetente und mit Selbstvertrauen ausgestattete Professionals.
Auch dieser Autor weist auf die medial erzeugte Unattraktivität des Pflegeberufs für Männer und den dadurch möglicherweise miterzeugten Nachwuchsmangel hin. Nachdem sich das Bild der weiblichen Pflegekräfte als gottgefälligen, lieben aber irgendwie unproofessionellen "Schwestern" gerade zu wandeln beginnt, basteln die Drehbuchschreiber der eher noch zunehmenden Anzahl von TV-Serien über das Krankenhaus gerade an genau so heftigen und diskriminierenden Klischees über die männlichen Pflegekräfte.
Selbst wenn es nicht mehr sachliche Argumente gegen diese Art der Typisierung von männlichen Pflegekräften gäbe, sollten sich die Schreiber und Produzenten derartiger Filme oder Serien schon aus Eigennutz überlegen, ob sie im Falle eines Krankenhausaufenthalts wegen des Mangels an Pflegern schlecht gepflegt werden wollen oder in die Hände eines ihren Serien entsprungenen Pfleger-Monsters fallen wollen.
Ohne Anspruch auf eine systematische Analyse entspricht der einzige (jedenfalls im Moment) Krankenpfleger, Hans-Peter Brenner (dessen Darsteller Michael Trischan ist immerhin gelernter Krankenpfleger), in der seit 1998 mit zig Millionen von Zuschauern laufenden deutschen ARD-Serie "In aller Freundschaft" zahlreichen der von den australischen Medienwissenschaftlern in US-Serien entdeckten Stereotypen: übergewichtig, ohne eigenen Willen, "Mamasöhnchen" und vom Typ "Klassenclown" oder "Spaßvogel". Um dies zu erkennen reicht der Konsum einer Folge.
Lohnen würde sich nicht nur eine Replikation der australischen Untersuchungen bei deutschen Krankenhausfilmen, sondern natürlich auch eine durchaus dem Grunde nach vergleichbare Stereotypisierung von Ärzten in deutschen und wiederum us-amerikanischen Serien. Ärzte zwischen dem Gutarzt Dr. Brinkmann, den "Emergency Room"-Hektikern und dem Zyniker Dr. House.
Die Studie mit dem bezeichnenden Titel Celluloid devils: a research study of male nurses in feature films von David Stanley erschien im "Journal of Advanced Nursing" (68, 11: 2526-2537). Ihr Abstract ist kostenlos erhältlich.
Ebenfalls im "Journal of Advanced Nursing" erschien am 4. September 2013 zuerst online der Aufsatz Men in nursing on television: exposing and reinforcing stereotypes von Roslyn Weaver et al., dessen Abstract ebenfalls kostenlos erhältlich ist.
Bernard Braun, 31.10.13
"Roland Berger"-Gutachten oder wie man mit altem säuerlichem Wein in neuen Schläuchen mit dem Fachkräftemangel Geld verdienen kann
 Mindestens um den Umsatz und die Gewinne der zahlreichen Unternehmensberatungen, die sich um die künftige Entwicklung der Personalressourcen und Organisation der Gesundheitsversorgung in regelmäßigen Abständen gutachterlich Gedanken machen, braucht man sich nicht zu sorgen. Unabhängig davon, ob sie etwas Neues finden oder ihre Lösungsvorschläge oftmals der siebte Aufguss bekannter Lösungsversuche unter anderem Namen sind.
Mindestens um den Umsatz und die Gewinne der zahlreichen Unternehmensberatungen, die sich um die künftige Entwicklung der Personalressourcen und Organisation der Gesundheitsversorgung in regelmäßigen Abständen gutachterlich Gedanken machen, braucht man sich nicht zu sorgen. Unabhängig davon, ob sie etwas Neues finden oder ihre Lösungsvorschläge oftmals der siebte Aufguss bekannter Lösungsversuche unter anderem Namen sind.
Dies gilt auch für das am 28. Oktober 2013 veröffentlichte Gutachten der Unternehmensberatung Roland Berger, das sich mit dem Thema "Fachkräftemangel im Gesundheitswesen: Medizinische Berufe verlieren in Deutschland an Attraktivität" beschäftigt.
Die Kerndiagnosen oder -behauptungen lauten:
• fast 80 % der deutschen Krankenhäuser spüren heute schon die Folgen des Fachkräftemangels,
• der demografischer Wandel führt bis 2030 zu einer Verdoppelung der Anzahl der über 80-Jährigen,
• dadurch wird der Fachkräftemangel bis 2015 auf rund 175.000 bzw. rund 15 % steigen,
• Medizin- und Pflegeberufe werden immer unattraktiver: Hoher bürokratischer Aufwand und Überstunden belasten das Image der Branche aber
• dank neuer Technologien (z.B. Telemonitoring oder technische Assistenzsysteme) und mehr Prävention wird der so genannte erste Gesundheitsmarkt, also das GKV-System bis 2030 jährlich um ca. 3% und der zweite Gesundheitsmarkt, also die gesundheitsbezogenen Leistungen, die nicht von der GKV organisiert und bezahlt werden jährlich sogar um 6% pro Jahr wachsen wird.
Und für die mangelnde Attraktivität der Medizin- und Pflegeberufe hat Roland Berger auch gleich die Lösung:
• Patientenkoordinatoren als wichtige Schnittstelle zwischen Medizin und Verwaltung, um Ärzte (obwohl nicht explizit genannt wahrscheinlich auch Pflegekräfte?) zu entlasten.
Woher der Roland Berger-Gutachter dies auch immer wissen will, hätte seines Erachtens die "Einführung von so genannten 'Patientenkoordinatoren' … zwei positive Folgen: das medizinische und Pflegepersonal würde deutlich entlastet und die Patienten wären mit den Leistungen der Ärzte und mit der Organisation in den Kliniken zufriedener." Oder auf den Punkt gebracht: "Nur so lässt sich das Problem des akuten Fachkräftemangels in deutschen Krankenhäusern an den Wurzeln packen."
Unter dem Titel "Verweildauerorientiertes Patientenmanagement" hatte Roland Berger übrigens bereits 2012 wahre Wunderdinge über den Nutzen eines damals "Patientenmanager" genannten neuen Akteurs berichtet (der Bericht kann schriftlich angefordert werden). Der Vollständigkeit halber sei der aktuell gemachte, gleichrangige Vorschlag einer "durchgängigen Prozessoptimierung" erwähnt - was immer das auch heißen mag.
Dabei ist das Nachdenken über die nachteilige Wirkung fehlender Arbeitsteilung im Bereich administrativer Tätigkeiten und möglicher Alternativen zum Status quo vollkommen berechtigt. Problematisch wird es, wenn die Berger-Experten keine Silbe darüber verlieren, dass es etwas ähnliches wie die "Patientenkoordinatoren" etc. unter der Bezeichnung Case- oder Care-Manager bereits seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten gibt und woran es liegt, dass diese bisher nicht die in sie gesetzten Erwartungen erfüllt haben.
Ärgerlich wird es, wenn es darum geht was Roland Berger nicht analysieren will oder kann und als mögliche kurz- und langfristige Lösungsansätze mitpräsentiert: Kein Wort zu der Unattraktivität zumindest der Einkommen von Pflegekräften, kein Wort von der Finanzierung der "Patientenkoordinatoren", kein Wort zu der fast unendlich-zähen, schwierigen und zum Teil auch erforschten Geschichte der Delegation traditioneller Tätigkeiten von Ärzten und Pflegekräften an andere Beschäftigte und der interprofessionellen Zusammenarbeit. Und schließlich auch kein Wort zur eventuell personalsparenden Reduktion der Über- und Fehlversorgung im Krankenhaus und der Möglichkeiten einer stärkeren Ambulantisierung z.B. normaler Geburten oder Sterbefälle.
Sofern dies alles nicht in einer zumindest im Moment nicht bekannten und frei zugänglichen Langfassung des Gutachtens (interessante Fußnote der Veröffentlichung: "Dieses Dokument ist vertraulich zu behandeln. Es dient nur dem internen Gebrauch unseres Klienten und ist ohne die zu Grunde liegenden Detailanalysen sowie den mündlichen Vortrag nicht vollständig") vorkommt, verfehlt das Gutachten das Motto von Roland Berger um Längen. Dieses lautet "it's character that makes impact".
Von dem Gutachten "Fachkräftemangel im Gesundheitswesen" von Zun-Gon Kim ist eine 17-seitige Zusammenfassung frei und kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 29.10.13
Bundessozialgericht: Warum darf der G-BA nicht einfach die Mindestmengen für die Geburt und Behandlung von Frühgeborenen erhöhen?!
 Bereits am 18. Dezember 2012 hatte das Bundessozialgericht (BSG) einen Revisionsantrag des Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) gegen ein Urteil des Landessozialgerichts (LSG) Berlin-Brandenburg zum G-BA-Beschluss die Mindestmenge für die Versorgung von Frühgeborenen mit einem Geburtsgewicht von unter 1250 Gramm (so genannte Level 1-Geburten) von 14 auf 30 solcher Geburten zu erhöhen, abgelehnt. Der G-BA hatte sich wie immer bei solchen Entscheidungen auf einen Bericht des "Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG)" gestützt. Darin sah sich das IQWiG aber aufgrund der Studienlage und in den Worten des BSG "nachvollziehbar außerstande, Schwellenwerte, eine bestimmte Mindestmenge oder auch nur einen Mindestmengenkorridor vorzuschlagen."
Bereits am 18. Dezember 2012 hatte das Bundessozialgericht (BSG) einen Revisionsantrag des Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) gegen ein Urteil des Landessozialgerichts (LSG) Berlin-Brandenburg zum G-BA-Beschluss die Mindestmenge für die Versorgung von Frühgeborenen mit einem Geburtsgewicht von unter 1250 Gramm (so genannte Level 1-Geburten) von 14 auf 30 solcher Geburten zu erhöhen, abgelehnt. Der G-BA hatte sich wie immer bei solchen Entscheidungen auf einen Bericht des "Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG)" gestützt. Darin sah sich das IQWiG aber aufgrund der Studienlage und in den Worten des BSG "nachvollziehbar außerstande, Schwellenwerte, eine bestimmte Mindestmenge oder auch nur einen Mindestmengenkorridor vorzuschlagen."
Welche maßgeblichen Gründe bei seiner Entscheidung eine Rolle gespielt haben, veröffentlichte jetzt das BSG schriftlich.
Für die im Urteil vollzogene Gratwanderung sind folgende Argumente die wichtigsten:
• Generell unterstreicht das BSG, der G-BA habe seit 2004 das gesetzliche Recht "planbare Leistungen zu beschließen, bei denen die Qualität des Behandlungsergebnisses in besonderem Maße von der Menge der erbrachten Leistungen abhängig ist." Dies bedeute Mindestmengen je Arzt oder Krankenhaus. Und bei der Leistung der Level-1-Geburten sei die Festlegung auf 14 Geburten aus mehreren Gründen zulässig.
• Der Vorrang von Qualitätssicherung: "Die Abwägung der Bedeutung des Interesses der Kinderkliniken, uneingeschränkt Kinder von Level-1-Geburten zu versorgen, mit dem Interesse an einer besseren Versorgungsqualität für Frühgeborene ergibt einen Vorrang der Qualitätssicherung zugunsten der hiervon betroffenen Individual- und Gemeinwohlbelange."
• Die notwendige Qualitätsorientierung der Berufsausübung: "Art 12 Abs 1 S 1 GG schützt - neben der Freiheit der Berufswahl - die Freiheit der Berufsausübung. Zu den Rahmenbedingungen der Berufsausübung gehört für Krankenhäuser auch, dass sie bestimmte Qualitätsanforderungen erfüllen müssen, um einzelne Operationen und Prozeduren, aber auch um eine aus einer Vielheit von Einzelmaßnahmen bestehende Behandlung eines bestimmten Krankheitsbildes erbringen zu dürfen."
• Das BSG beginnt mit der Feststellung, dass es für eine Mindestmengenentscheidung keiner "'besonderen' Kausalität zwischen Leistungsmenge und Ergebnisqualität" bedarf. "Vielmehr genügt ein nach wissenschaftlichen Maßstäben wahrscheinlicher Zusammenhang zwischen Behandlungsmenge und -qualität."
• Ist der hier zu bewertende Zusammenhang "nicht statistisch (u.a. durch risikoadjustiert bewertete Korrelationen) bewiesen, ist er anhand medizinischer Erfahrungssätze ergänzend zu untermauern." Dabei reicht aber "nicht schon die landläufige Erfahrung, dass routinierte Praxis im Allgemeinen eine bessere Ergebnisqualität sichert als deren Fehlen."
• Für das BSG "ermittelte (der G-BA - Einfügung des Verfassers) den zugrunde liegenden Sachverhalt unzureichend" als er die Mindestmenge konkret von 14 auf 30 erhöhte. Dadurch gelangte er "fehlerhaft zu der Überzeugung, dass die neue höhere Mindestmenge die Mortalität bei der Behandlung von Level-1-Geburten bundesweit einheitlich stärker reduzieren könne." Die Heraufsetzung sei daher "nichtig".
Die Entscheidung und die ihr zugrundegelegten Kriterien mögen nach den immer wieder publik werdenden tödlichen Risiken für Frühgeborenen vielleicht zu hart erscheinen. Hier auf einen besonders schlüssigen wissenschaftlichen Nutzennachweis zu verzichten, könnte aber entsprechend oberflächlich begründeten und wissenschaftlich unzulänglichen Entscheidungen für nutzlose Leistungen oder sinnlose Leistungsmengen durch andere Akteure oder Leistungsanbieter Tür und Tor öffnen.
Die vollständige schriftliche Begründung für das Mindestmengenurteil des BSG vom 18.12.2012, B 1 KR 34/12 R ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 12.10.13
Welche zentralen Faktoren spielen bei Patienten- und Mitarbeiterzufriedenheit Hauptrollen und was haben beide miteinander zu tun?
 Was sind die häufigsten Probleme von Pflegekräften, Ärzten und Patienten im Zusammenhang mit der stationären Behandlung? Gibt es Zusammenhänge zwischen der Zufriedenheit von Patienten und Krankenhausmitarbeitern? Diesen Fragen ging das Picker-Institut, einer der international tätigen Pioniere der seriösen Patienten- und Mitarbeiterbefragung, umfassend nach. Erstens mit einer Analyse der Antworten von 111.835 Patienten-Befragungsbögen aus den Jahren 2009 bis 2012, zweitens mit einer Auswertung der Antworten auf einen Mitarbeiter-Fragebogen von 10.441 Pflegekräften und 4.211 Ärzten im selben Zeitraum und drittens mit den Antworten von 27.300 Patienten, ca. 4.000 Ärzten und 11.000 Pflegekräfte aus Krankenhäusern, in denen im Abstand von höchstens einem Jahr alle drei Gruppen befragt wurden.
Was sind die häufigsten Probleme von Pflegekräften, Ärzten und Patienten im Zusammenhang mit der stationären Behandlung? Gibt es Zusammenhänge zwischen der Zufriedenheit von Patienten und Krankenhausmitarbeitern? Diesen Fragen ging das Picker-Institut, einer der international tätigen Pioniere der seriösen Patienten- und Mitarbeiterbefragung, umfassend nach. Erstens mit einer Analyse der Antworten von 111.835 Patienten-Befragungsbögen aus den Jahren 2009 bis 2012, zweitens mit einer Auswertung der Antworten auf einen Mitarbeiter-Fragebogen von 10.441 Pflegekräften und 4.211 Ärzten im selben Zeitraum und drittens mit den Antworten von 27.300 Patienten, ca. 4.000 Ärzten und 11.000 Pflegekräfte aus Krankenhäusern, in denen im Abstand von höchstens einem Jahr alle drei Gruppen befragt wurden.
Zu den wichtigsten bekannten und neuen Erkenntnissen gehören:
• 47% der befragten Patienten berichten über eine suboptimale Versorgungssituation bei der Vorbereitung auf ihre Entlassung, 30% sahen ihre Familie nicht gut einbezogen, 22% hatten Probleme mit der Arzt-Patient-Interaktion, 18% hatten Probleme mit dem Essen und der geringste Anteil von 10% Probleme mit der Sauberkeit.
• Die zentralen Faktoren für die Gesamtzufriedenheit der Patienten waren mit 60,8% Anteil die Pflegepersonal- und Arzt-Patient-Interaktion. Und nicht die häufig kolportierte Qualität der Küche oder der TV-Empfangsmöglichkeiten.
• 57%, 54% und 50% der Ärzte haben große Probleme mit der Arbeitsbelastung, ihrer Qualifizierung und der Führungs- und Unternehmenskultur. Diese Wahrnehmung und Erfahrungen teilten sie sich mit 49%, 47% und 48% der Pflegekräfte. Die wenigsten Ärzte und Pflegekräfte, nämlich zwischen 13% und 20% hatten dagegen Probleme mit dem zwischenmenschlichen Umgang oder der Dienstplanung.
• 49% der Arbeitszufriedenheit von Ärzten wird durch die Faktoren Führungs- und Unternehmenskultur, das Verhältnis zu den direkten Vorgesetzten sowie zu ihren direkten Kollegen bestimmt. Etwas anders sieht es bei Pflegekräften aus: 58% ihrer Arbeitszufriedenheit werden auch durch den Faktor Führungs- und Unternehmenskultur, die Arbeitsbelastung und die Bedingungen der Patientenversorgung bestimmt.
• 50% bis 65% der Ärzte und Pflegekräfte haben aus ihrer subjektiven Sicht zu wenig Zeit für die Interaktion mit Patienten und deren Angehörigen.
• Je besser die Pflegekräfte die Interaktion von Patienten, Pflegekräften und Ärzten und die Bedingungen der Patientenversorgung bewerten, umso besser beurteilen die Patienten die Interaktion mit den Pflegekräften. Ähnliche ebenfalls hochsignifikante Zusammenhänge gibt es auch zwischen Patienten und Ärzten.
Für die Autoren des Picker-Reports bedeutet dies, dass Patienten- und Mitarbeiterorientierung "nicht zu Lippenbekenntnissen in Leitbildern und Marketingaktionen" "verkommen" dürfen. Ähnliches gilt wohl auch für einen Teil der Qualitätssicherungs- und Zertifizierungsrituale. Die offensichtlich essentiell miteinander verbundenen Erfahrungen von Patienten und Ärzten sollten daher wesentlich mehr als bisher bei der Definition von Qualitätszielen oder als Steuerungselemente in Krankenhäusern genutzt werden.
Eine Kurzversion von vier Seiten des Reports Picker-Report 2013. Zentrale Faktoren der Patienten- und Mitarbeiterzufriedenheit von K. Stahl und M. Nadj-Kittler ist kostenlos erhältlich. Wer an der 23-seitigen Langversion interessiert ist, sollte es beim Picker-Institut in Hamburg versuchen.
Bernard Braun, 2.10.13
Jährlich bis zu 400.000 Personen sterben derzeit in Krankenhäusern der USA an den Folgen vermeidbarer Behandlungsfehler
 Der auch 2013 noch lesenswerte, 1999 vom "Institute of Medicine (IOM)" der USA herausgegebene Report "To err is human. Building a Safer Health System" (vgl. dazu für den eiligen Leser die achtseitige Kurzfassung) konstatierte auf der Basis von Daten aus dem Jahr 1984, dass jährlich wenigstens 44.000 und vielleicht bis zu 98.000 Personen in Krankenhäusern wegen vermeidbarer medizinischer Fehler und Irrtümer starben. Diese Zahlen wurden im Kern nicht bezweifelt und lösten in den USA eine Welle von Überlegungen und Instrumenten aus, die Behandlungsqualität zu verbessern.
Der auch 2013 noch lesenswerte, 1999 vom "Institute of Medicine (IOM)" der USA herausgegebene Report "To err is human. Building a Safer Health System" (vgl. dazu für den eiligen Leser die achtseitige Kurzfassung) konstatierte auf der Basis von Daten aus dem Jahr 1984, dass jährlich wenigstens 44.000 und vielleicht bis zu 98.000 Personen in Krankenhäusern wegen vermeidbarer medizinischer Fehler und Irrtümer starben. Diese Zahlen wurden im Kern nicht bezweifelt und lösten in den USA eine Welle von Überlegungen und Instrumenten aus, die Behandlungsqualität zu verbessern.
Eine im September 2013 veröffentlichte, auf Daten von vier Studien mit Behandlungs-Routinedaten (so genanntes "Global trigger tool") aus den Jahren 2008 bis 2011 basierende Untersuchung, kommt zu dem Ergebnis, dass diese Bemühungen relativ wenig bis nichts gefruchtet haben - im Gegenteil. Die Anzahl der Personen, die derzeit jährlich in US-Krankenhäusern wegen vermeidbarer Behandlungs-Fehler und -Irrtümer sterben, bewegt sich zwischen 210.000 und 400.000 Menschen. Damit stellt diese Todesart die dritthäufigste Todesursache in us-amerikanischen Krankenhäusern dar.
In der Diskussion seiner Ergebnisse versucht der Autor, diesen gewaltigen Anstieg genauer zu erklären. Einerseits könnte dies seines Erachtens daran liegen, dass die 1999er Daten u.a. auf Ärztebeurteilungen der Häufigkeit vermeidbarer unerwünschter Ereignisse beruhte und die Anzahl der in den 199oer Jahren vermeidbar gestorbener Krankenhauspatienten unterschätzt wurde. Andererseits könnte aber auch die aktuelle Schätzung zu niedrig sein. Dies könnte daran liegen, dass viele Behandlungsfehler erst nach so langer Zeit zum Tode führen, dass dies in Routinedaten nicht erkennbar ist. Unklar ist auch, ob die Zunahme der Gestorbenen nicht auch auf der Zunahme der technischen Komplexität der Behandlungen, der Zunahme resistenter Erreger, dem Fehlgebrauch von Arzneimitteln, der Alterung der Patienten und dem allzu häufigen Einsatz riskanter, invasiver aber gewinnfördernder Medizintechnik beruht. An dem Gesamtniveau der aktuellen vermeidbaren Sterblichkeit und ihrer Zunahme gegenüber früheren Jahren dürfte sich dadurch aber nichts ändern.
Schließlich ist dem Autor zustimmen, wenn er sagt: "It does not matter whether the deaths of 100.000, 200.000 or 400.000 Americans each year are associated with preventable adverse effects in hospitals. Any of the estimates demands assertive action on the part of providers, legislators, and people who will one day become patients." Leider kommt er aber auch zu dem Ergebnis, der Fortschritt bei der Patientensicherheit sei in den USA frustierend langsam.
Nachdem nun in den USA innerhalb von 15 Jahren immerhin zwei derartige Untersuchungen veröffentlicht wurden, fällt das Fehlen auch nur einer vergleichbaren Studie über die vermeidbaren Behandlungsfehler mit Todesfolge in deutschen Krankenhäusern besonders deutlich auf. Statt der Litanei, so etwas gäbe es in deutschen Krankenhäusern nicht oder die US-Ergebnisse seien überhaupt nicht übertragbar, sollten endlich alle Beteiligten eine erste unabhängige Studie in Deutschland beginnen - bevor die dritte in den USA fertig ist.
Die Studienergebnisse sind in dem Aufsatz A New, Evidence-based Estimate of Patient Harms Associated with Hospital Care von John James in der Zeitschrift "Journal of Patient Safety" im September 2013 (Volume 9, Issue 3: 122-128) erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 26.9.13
Multiresistente Erreger in Krankenhäusern: Hysterie oder ernstes aber vermeidbares Problem. Ergebnisse einer Krankenkassen-Analyse
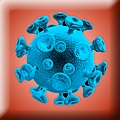 Problematische Hygieneverhältnisse in Krankenhäusern, langwierig und aufwändig behandlungsbedürftige Infektionen und Todesfälle durch Erkrankungen mit multiresistenten Keimen waren in den vergangenen Jahren immer wieder Gegenstand der Medienberichterstattung. Ob es sich dabei um medial betriebene "Hysterie" oder darum handelt, dass "wer moderne Medizin will, … ein bestimmtes Infektionsrisiko in Kauf nehmen (muss)" und "die meisten Krankenhausinfektionen … unvermeidbar" sind, so der seit kurzem pensionierte Infektionsexperte Daschner 2012 im "Deutschen Ärzteblatt", sollte u.a. durch eine Auswertung der Routinedaten der in Nordwestdeutschland aktiven gesetzlichen Krankenkasse "hkk" etwas genauer beleuchtet werden.
Problematische Hygieneverhältnisse in Krankenhäusern, langwierig und aufwändig behandlungsbedürftige Infektionen und Todesfälle durch Erkrankungen mit multiresistenten Keimen waren in den vergangenen Jahren immer wieder Gegenstand der Medienberichterstattung. Ob es sich dabei um medial betriebene "Hysterie" oder darum handelt, dass "wer moderne Medizin will, … ein bestimmtes Infektionsrisiko in Kauf nehmen (muss)" und "die meisten Krankenhausinfektionen … unvermeidbar" sind, so der seit kurzem pensionierte Infektionsexperte Daschner 2012 im "Deutschen Ärzteblatt", sollte u.a. durch eine Auswertung der Routinedaten der in Nordwestdeutschland aktiven gesetzlichen Krankenkasse "hkk" etwas genauer beleuchtet werden.
Laut einer Hochrechnung der 2012 veröffentlichten ALERTS-Studie am Sepsis-Forschungs- und Behandlungszentrum der Universität Jena erkranken in Deutschland 4,3 Prozent aller Krankenhauspatienten während ihres dortigen Aufenthaltes an einer Infektion. Dies entspricht jährlich zwischen 400.000 und 600.000 Fällen, die bei 10.000 bis 15.000 Patienten zum Tod führen. Davon werden schätzungsweise 15 Prozent durch multiresistente Krankheitserreger (MRE) verursacht. Weitere Studien bestätigen diese Ergebnisse im Wesentlichen. MRE verdanken ihren Namen der Eigenschaft, dass sie gegen zahlreiche Antibiotika immun sind. MRE kommen nicht nur im Krankenhaus, sondern in der gesamten Umwelt vor und stellen für gesunde Menschen meist keine Gefahr dar - ganz im Gegensatz zu Menschen mit einem geschwächten Immunsystem. Unter allen MRE tritt der MRSA-Erreger (Methicillin-Resistenter Staphylococcus Aureus) am häufigsten auf. Der Report weist eingangs auf die Notwendigkeit hin, die unterschiedlichen Erreger, Messmethoden und vor allem die Vielzahl der von verschiedenen nationalen und internationalen Institutionen verwandten Indikatoren genau zu beachten.
In die empirische Untersuchung durch den Gesundheitswissenschaftler Bernard Braun vom Zentrum für Sozialpolitik der Universität Bremen wurden alle hkk-Versicherten einbezogen, die zwischen 2007 und 2011 im Krankenhaus behandelt wurden und bei denen eine Infektion mit MRE diagnostiziert wurde.
Die wichtigsten Ergebnisse lauteten:
• Im Untersuchungszeitraum verdoppelte sich der Anteil der im Krankenhaus behandelten hkk-Versicherten, die dort eine Infektion erlitten, von 3,1 auf 6,3 Prozent. Mit den genutzten Daten kann nicht definitiv unterschieden werden, ob es sich dabei um ein zunehmendes Infektionsrisiko oder um den Effekt verstärkter Aufmerksamkeit und Messung handelt. Es dürfte wahrscheinlich eine Mischung beider Effekte sein. Betrachtet man nur die Zahl der MRE-Infektionen, so wurden diese im Jahr 2007 in 271 Krankenhausfällen nachgewiesen, während es 2011 bereits 619 Fälle waren. Damit hat sich auch der Anteil der MRE-Infektionen an allen Krankenhausfällen in von fünf Jahren von 0,465 auf 0,941 Prozent mehr als verdoppelt. Der Anteil der MRSA-Infektionen stieg von 0,299 auf 0,526 Prozent. Zu 65,6 Prozent handelte es sich dabei um MRSA-Infektionen, die ohne Krankheitssymptome verliefen. Betroffen waren vorwiegend ältere Menschen: 49 Prozent aller MRE-infizierten Krankenhausfälle betrafen Patienten im Alter von 70 bis 89 Jahren.
• MRE-infizierte Krankenhaus-Patienten verursachen erhebliche Folgekosten, die auf längere Liegezeiten, Personal- und Sachkosten für qualifiziertes Hygienepersonal, Isolier- und Sanierungsmaßnahmen sowie Schutzkleidung zurückgehen. Überraschenderweise sank aber der Anteil der diesen Aufwand im Prinzip finanzierenden Komplexbehandlungen an allen MRE-Fällen im Untersuchungszeitraum von 58 auf rund 42 Prozent, beziehungsweise bei MRSA-Infektionen von 73 auf 58 Prozent. Offen muss, ob dies daran liegt, dass die Schwere der Fälle abgenommen hat, so dass aufwendige Maßnahmen aus Sicht der Krankenhäuser nicht notwendig sind oder viele Krankenhäuser weder personell noch baulich und infrastrukturell in der Lage sind, derartige Leistungen zu erbringen."
• Ein Blick ins Ausland zeigt, dass mindestens 20-30% der MRE-Erkrankungen und damit auch viele Todesfälle vermeidbar sind. Während der Anteil von MRSA an allen nachgewiesenen Staphylococcus Aureus-Proben in Deutschland mehr als 20 Prozent beträgt, liegt er in Skandinavien, Estland und den Niederlanden weit unter 5 Prozent. Selbst im chronisch unterfinanzierten britischen Gesundheitswesen wurde die Rate innerhalb von fünf Jahren von 44 auf heute knapp 22 Prozent gesenkt.
• Um dies zu erreichen bedarf es allerdings eines mehrschichtigen, interdisziplinären Ansatzes.
• So umfasst die im Report u.a. kurz dargestellte erfolgreiche niederländische Anti-MRSA-Strategie ("search and destroy") ein Maßnahmenbündel vom Komplettscreening in Risikobereichen, über die Quarantäne des Patienten bis zum Negativergebnis, die systematische Präsenz von infektionsmedizinischen Experten sowie eine rigorose Politik zur Vermeidung nicht notwendiger Antibiotika-Verordnungen im ambulanten Bereich. Weitere Positivbeispiele aus den USA umfassen technische, organisatorische und vor allem auch soziale (z.B. gemeinsame Hygieneschulungen von Pflegekräften und Ärzten, Hygiene-Tagesziele) Maßnahmen. Die in Deutschland jahre- wenn nicht gar jahrzehntelange Vernachlässigung der Ausbildung und Beschäftigung qualifizierter Hygieneärzte und -pflegekräfte und die Geringschätzung von Hygiene stellt aber eine erhebliche Barriere für sofortige Abhilfe dar.
Die Tatsache, dass es mittlerweile bereits Erreger gibt, die auch gegen das letzte im Moment zur Verfügung stehende Antibiotikum resistent sind (vgl. dazu den Beitrag Was kosten multiresistente Bakterien wirklich und wie gefährlich ist es, kein Antibiotikum-" Ass mehr in der Hinterhand" zu haben?), sollte Anlass sein die hier vorgestellten Maßnahmen so rasch wie möglich umzusetzen.
Der 29 Seiten umfassende hkk-Report Multiresistente Erreger im Krankenhaus Eine Analyse mit hkk-Routinedaten von Bernard Braun ist komplett kostenlos erhältlich.
Jens Holst, 1.9.13
Was kosten multiresistente Bakterien wirklich und wie gefährlich ist es, kein Antibiotikum-" Ass mehr in der Hinterhand" zu haben?
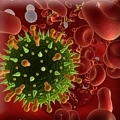 Während deutsche Gesundheits- und Landwirtschaftspolitiker oder Krankenhausexperten eher gemächlich über den Sinn oder Unsinn der Übernahme niederländischer Hygienestandards ("search and destroy") zur Bekämpfung der etwas prominenter gewordenen antibiotikaresistenten "Methycillin-resistenten Staphylococcus aureus (MRSA)-Erreger in deutschen Krankenhäusern beraten und der flächendeckende Einsatz von Antibiotika in der Massen-Tiermast in deutschen Fleischfabriken bisher vor allem mit einer Meldepflicht "bekämpft" werden soll, reden die Leiter der britischen wie us-amerikanischen Gesundheitsbehörde von einem richtigen "Albtraum" jenseits von MRSA.
Während deutsche Gesundheits- und Landwirtschaftspolitiker oder Krankenhausexperten eher gemächlich über den Sinn oder Unsinn der Übernahme niederländischer Hygienestandards ("search and destroy") zur Bekämpfung der etwas prominenter gewordenen antibiotikaresistenten "Methycillin-resistenten Staphylococcus aureus (MRSA)-Erreger in deutschen Krankenhäusern beraten und der flächendeckende Einsatz von Antibiotika in der Massen-Tiermast in deutschen Fleischfabriken bisher vor allem mit einer Meldepflicht "bekämpft" werden soll, reden die Leiter der britischen wie us-amerikanischen Gesundheitsbehörde von einem richtigen "Albtraum" jenseits von MRSA.
Es geht um den raschen Anstieg (der Anteil an allen resistenten Erregern stieg in den USA zwischen 2001 und 2012 von 1% auf 4%) einer anderen, weit weniger bekannten Klasse von Bakterien, die gegen Antibiotika resistent sind: den so genannten "Carbapenem-resistenten Enterobakterien (CRE)" zu denen u.a. die im Zusammenhang mit dem Tod von Frühchen in verschiedenen Kliniken bekannter gewordenen Klebsiella-Bakterien gehören. Diese befinden sich wie die meisten anderen Erreger auch im Darm vieler Personen, die weder Symptome haben noch daran erkranken müssen. CRE sind deshalb besonders bedrohlich, weil Carbapeneme Reserve-Antibiotika oder das bisher letzte "Ass in der Hinterhand" der modernen Infektionsmedizin sind bzw. waren. Wer an CRE erkrankt, kann daher nicht mehr wirksam mit Antibiotika behandelt werden und hat ein hohes Sterblichkeitsrisiko.
Über die bisherige Entwicklung mit Schwerpunkt in den USA berichtet der gerade frei zugänglich in deutscher Übersetzung erschienene Fachaufsatz "Antibiotic resistance: The last resort" von Maryn McKenna in dem renommierten Wissenschaftsmagazin "Nature" (Nr. 499. 2013: 394-396) ausführlich. Ohne das "Ass" der Carbapeneme oder ohne dass irgendwelche anderen Reserve-Antibiotika am Horizont oder gar auf dem Markt sind, bleibt Ärzten nichts anders übrig als mit "wilden" Kombination alter und zum Teil schädlicher Mittel gegen diese Erreger und ihre potenziell tödlichen Wirkungen vorzugehen.
Die Autorin weist dabei auf einen relevanten und fatalen Zirkel hin: Will man die Resistenzbildungen von Bakterien gegenüber alten und neuen Antibiotika so lang wie möglich vermeiden, müssen sie am besten sehr sparsam eingesetzt sein. Damit lohnt sich aber die Neuentwicklung von Antibiotika für privatwirtschaftliche Pharmaunternehmen tendenziell nicht mehr.
Damit gewinnen sämtliche Maßnahmen der technischen und personalen Krankenhaushygiene wie beispielsweise der Handhygiene eine noch wesentlich größere Bedeutung als sie auch jetzt schon haben. Der Hinweis, auch hier würde viel zu wenig untersucht, "ob und wie sich solche Standardprozeduren noch verbessern lassen" und im Ernstfall würde "einfach dem Pflegepersonal die Schuld in die Schuhe geschoben", zeigt aber auch, dass diese Bedeutung keineswegs überall angekommen ist.
Wie die jüngsten Expertenschätzungen für Europa zeigen, hilft das hierzulande übliche Abwarten bereits jetzt nicht mehr.
Am 11. Juli 2013 wurden nämlich die Ergebnisse eines im Frühjahr durchgeführten Surveys bei nationalen Experten aus 39 europäischen Ländern veröffentlicht, die zweierlei beinhalteten:
• Auch in Europa verbreiten sich die CRE oder auch CPE ("carbapenemase-producing Enterobacteriaceae") nach den Schätzungen der Experten in den letzten drei beobachteten Jahren immer weiter bzw. treten häufiger auf.
• 21 von den 39 Staaten, deren Experten befragt wurden, sind nach deren Meinung so gut koordiniert, dass sie eine Epidemie dieser Erreger bewältigen könnten. Deutschland gehört zu diesen Ländern.
Für diejenigen, die seit Jahren oder Jahrzehnten nichts für eine ausreichende Anzahl qualifizierter Hygienefachkräfte in deutschen Krankenhäusern getan haben und auch jetzt eher diskutieren und dokumentieren als handeln, liefert ein in dem "Nature"-Aufsatz zitierter Review zweier britischer Gesundheitsökonomen einige drastische Zahlen zu den Folgen anhaltender Passivität beim Abbau gesundheitlich nicht notwendiger Antibiotikaverordnungen und bei der Krankenhaushygiene.
Nach der Analyse von 24 aus 192 seit 2000 erschienenen Einzelstudien kommen sie zu dem Schluss, dass die "wahren Kosten" und Folgen multiresistenter Bakterien weit unterschätzt werden und die Situation für die gesamte Gesundheitsversorgung wesentlich ernster ist als bisher angenommen.
Dies beruht generell darauf, dass die Prävention und Behandlung von bakteriellen Entzündungen durch Antibiotika bei vielen Operationen und Prozeduren standardmäßig erfolgt und ohne sie entweder viele Operationen nicht durchgeführt würden oder das Erkrankungs- und Sterberisiko deutlich anstiege. Bei vielen Operationen würde in jedem Fall der notwendige Aufwand (z.B. technische Hygienemaßnahmen, Liegezeitverlängerung durch Komplikationen) wesentlich höher sein als bisher.
Was der Ausfall des letzten "Asses" konkret bedeuten könnte, zeigen die beiden Ökonomen in einer einfachen literaturgestützten Analyse über die Folgen für eine der derzeit häufigsten Operationen, dem Ersatz eines Hüftgelenks. Ohne wirksame Antibiotika stiege die nachoperative Infektionsrate auf 40-50% und von diesen PatientInnen würden rund 30% sterben. Und wenn ohne Antibiotika die Anzahl der Hüft-Endoprothesen-Operationen wahrscheinlich sänke, stiege die Morbiditätslast durch schmerzende und bewegungseinschränkende Hüftgelenksarthrosen erheblich an.
Mehr über die "wahren" Risiken und Kosten bakterieller Resistenzen gegenüber allen Antibiotika findet man in dem im März 2013 erschienenen kurzen Aufsatz The true cost of antimicrobial resistance. von Smith R. und J. Coast (2013) - erschienen im British Medical Journal;346: f1493.
Zur Vertiefung der Erkenntnisse steht der ebenfalls im Frühjahr 2013 erschienene 34 Seiten umfassende Review The economic burden of antimicrobial resistance. Why it is more serious than current studies suggest. derselben Autoren komplett kostenlos zur Verfügung.
Die deutsche Übersetzung des "Nature"-Aufsatzes Kein Ass mehr in der Hinterhand von Maryn McKenna erhält man nach einer möglicherweise notwendigen Kurzanmeldung auf der Website der Zeitschrift "Spektrum der Wissenschaft" kostenlos.
Wer auch die am 24. Juli 2013 erschienene englische Fassung des "Nature"-Aufsatzes Antibiotic resistance: The last resort. Health officials are watching in horror as bacteria become resistant to powerful carbapenem antibiotics — one of the last drugs on the shelf. lesen will, kann dies ebenfalls kostenlos.
Den aktuellen Überblick über die CRE-Situation in 39 europäischen Ländern kann man sich in der Schnellmitteilung Carbapenemase-producing Enterobacteriaceae in Europe: a survey among national experts from 39 countries, February 2013 von C. Glasner und weiteren Mitglieder der "European Survey on Carbapenemase-Producing Enterobacteriaceae (EuSCAPE) working group" verschaffen, der in der Fachserie "Eurosurveillance" (Volume 18, Issue 28) erschienen ist.
Bernard Braun, 31.8.13
Beschäftigungsabbau durch Privatisierung von Krankenhäusern! Bei jeder Form der Privatisierung und bei allen Beschäftigten?
 Sowohl der bis 2008 erfolgte Abbau von rund 50.000 Pflegekräftestellen in deutschen Krankenhäusern als auch zuletzt die Privatisierung der Uni-Kliniken in Marburg und Gießen, wurde und wird von einer heftigen Debatte über erwünschte und unerwünschte Wirkungen der Umwandlung von zuvor öffentlichen oder freigemeinnützigen Kliniken in privatwirtschaftlich betriebene Krankenhaus-Wirtschaftsunternehmen begleitet.
Sowohl der bis 2008 erfolgte Abbau von rund 50.000 Pflegekräftestellen in deutschen Krankenhäusern als auch zuletzt die Privatisierung der Uni-Kliniken in Marburg und Gießen, wurde und wird von einer heftigen Debatte über erwünschte und unerwünschte Wirkungen der Umwandlung von zuvor öffentlichen oder freigemeinnützigen Kliniken in privatwirtschaftlich betriebene Krankenhaus-Wirtschaftsunternehmen begleitet.
Die Manager von privaten Krankenhausunternehmen oder Klinikketten nennen als ein erwünschtes Ziel von Privatisierung, die Effizienz der stationären Versorgung zu verbessern, also z.B. nicht mehr durch schlechte Behandlungsprozesse Ressourcen zu verschwenden oder technische Neuerung mit Rationalisierungspotenzial zu "verschlafen". Die Gegner oder Kritiker der Privatisierung von Krankenhäusern sehen im Abbau von Personal das wesentliche Mittel dieser Effizienzsteigerung und fürchten, dass dies zu einer Verschlechterung der Behandlungsqualität führt oder führen könnte.
Eine jetzt veröffentlichte Studie von Ökonomen des Zentrums für Gesundheitsökonomie der Universität Hamburg ist die erste Studie, die auf breiter empirischen Basis tiefschürfend untersucht, welche dieser Erwartungen oder Befürchtungen überwiegen.
Sie untersuchen dazu 493 Krankenhäuser, von denen 132 bereits vor dem Beginn der Studie, d.h. in den Jahren 1996 bis 2008, privatisiert worden waren. 99 von ihnen waren von privaten, gewinnorientierten Eigentümern erworben worden, 33 gehören privaten Eigentümern, die mit dem Kauf und Betrieb keine Gewinnabsichten verbanden. Vor detaillierteren Untersuchungen der Privatisierungseffekte, sehen die Autoren einerseits keinen Zusammenhang zwischen dem Privatisierungsgeschehen und der Einführung von Fallpauschalen, relativieren diese Aussage aber, wenn sie ihr Augenmerk nur auf die gewinnorientierten Privatisierungen richten.
Bei den Effekten der Privatisierung zeigte sich Folgendes:
• Zunächst führt die Privatisierung von Krankenhäusern insgesamt zu dem erwarteten Personalabbau. Dies ist aber fast ausschließlich der Effekt der großen Anzahl von "for-profit"-Privatisierungen.
• Nach einer so genannten "for-profit-privatization" gab es große Reduktionen bei den Beschäftigten, die sich bei "non-profit-privatization" nicht bzw. nicht auf Dauer zeigten.
• Auch bei einer "for-profit-privatization" betraf die Reduktion nicht sämtliche Beschäftigtengruppen, sondern bestand vor allem im Abbau von nichtärztlichem Personal, wie z.B. den Pflegekräften oder sonstige therapeutische oder technische Arbeitskräfte. Bei Ärzten konnten die Forscher im Zusammenhang mit Privatisierung keinerlei dauerhaften Personalabbau entdecken.
• Bei der Frage, ob der Personalabbau bei Pflegekräften und sonstigem nichtärztlichem Personal z.B. über die Erhöhung der Anzahl von Patienten pro Pflegekraft zu unerwünschten Effekten bei der Versorgungsqualität führen, geben die Hamburger Forscher keine abschließende Antwort: "Reductions in nurses and other clinical staff following for-profit privatization may not necessarily lead to quality reductions, however. Public hospitals are likely to be overstaffed before the privatization event. Furthermore, private hospital chains could have decreased their staff-to-patient ratios as a result of increases in productivity by improvement of IT, workflow and standardization. Moreover, there is evidence for Germany that especially private for-profit hospitals, which often operate in very competitive regions, have improved their quality management and hospital outcomes as a way of attracting patients".
Da es auch empirische Studien insbesondere in den USA gibt, die solche unerwünschten Qualitätsmängel nach "for-profit"-Privatisierungen belegten und auch genügend Studien existieren, die zeigen, dass ab einer bestimmten Anzahl von Patienten pro Pflegekraft das Sterblichkeits- und Folgeerkrankungsrisiko kräftig steigt, ist die Absicht hierüber auch in Deutschland mehr Klarheit zu schaffen begrüßenswert.
Auch wenn manche Zusammenhänge von Krankenhaus-Privatisierung und Stellenabbau schon immer in gewerkschaftlichen Analysen zu einzelnen Übernahmen behauptet und belegt wurden, erhärtet die vorliegende Studie nunmehr eine Reihe bisher unklarer systematischer Zusammenhänge dieser Art und zeigt, dass es sich bei diesen Folgen nicht um das Ergebnis einzelner "schwarzen Schafe" handelt.
Der Aufsatz Employment effects of hospital privatization in Germany von Mareike Heimeshoff, Jonas Schreyögg und Oliver Tiemann ist am 24.Juli 2013 im "The European Journal of Health Economics" erschienen. Leider ist nur das Abstract kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 15.8.13
Deutschland-OECD-Vergleich im Doppelpack: Weit verbreitete Überversorgung mit stationären Strukturen und Leistungen in Deutschland
 Gleich in zwei Berichten hat die OECD dem deutschen Krankenhauswesen überdurchschnittliche Leistungen attestiert - eine bessere und leichter zugängliche Versorgung zu bieten als in vielen anderen OECD-Ländern und ohne erkennbare gesundheitlichen Gründe viele Leistungen am häufigsten zu erbringen.
Gleich in zwei Berichten hat die OECD dem deutschen Krankenhauswesen überdurchschnittliche Leistungen attestiert - eine bessere und leichter zugängliche Versorgung zu bieten als in vielen anderen OECD-Ländern und ohne erkennbare gesundheitlichen Gründe viele Leistungen am häufigsten zu erbringen.
In einem am 25. März 2013 erschienenen OECD-Arbeitspapier vergleichen die Verfasser die rohe und altersstandardisierte Rate für eine Reihe aufwändiger, zum Teil aber auch qualitativ umstrittenen operativen Leistungen in den OECD-Ländern:
• 2008 lag Deutschland mit 305 Kaiserschnitt-Entbindungen pro 1.000 Lebendgeburten OECD-weit auf dem vierten Platz, hinter Italien, der Schweiz und den USA (OECD-Durchschnitt: 242).
• Auch bei den Prostataentfernungen lag 2008 Deutschland mit 153 Operationen pro 100.000 Männer auf dem vierten Platz, und erneut deutlich über dem OECD-Durchschnitt von 108.
• Bei der Implantation künstlicher Hüften war Deutschland 2008 bei den Frauen mit 150 Eingriffen pro 100.000 Einwohnern auf dem dritten )OECD-Durchschnitt: 112) und bei den Männern mit 124 Operationen/100.000 Einwohnern (OECD-Durchschnitt: 96) ebenfalls auf dem dritten Platz.
• Weltmeisterlich steht Deutschland bei den Blinddarmentfernungen da: 219 Operationen pro 100.000 Einwohnern bei den Frauen bedeuten 2008 OECD-weit Platz 1 (Durchschnitt: 132) und 173 Operationen bei den Männern (Durchschnitt: 138) erneut den "undankbaren" Platz 4.
Zu Recht weisen die Autoren des Berichts darauf hin, dass sie nicht sagen können, welches die "richtige" oder angemessene Raten sind und dies weiterer Forschung bedarf. Dies bedeutet aber zugleich, dass auch ohne die genauere Kenntnis der Gesamtmorbidität von Patienten nicht davon ausgegangen werden darf, dass solche Häufigkeits-Spitzenplätze per se für eine gute und angemessene operative Behandlung an deutschen Krankenhäusern sprechen. Es könnte sowohl gesundheitlich aber auch bezogen auf die Kosten und mit Operationen verbundenen Risiken ein schlechtes Zeichen sein.
In dem im April 2013 veröffentlichten Papier "Managing Hospital Volumes - Germany and Experiences from OECD Countries", einer Vorlage für eine am 11.April stattfindende krankenhauspolitische Konferenz, wird das Bild vervollständigt und vertieft.
Auch hier befinden sich die deutschen Krankenhäuser bei zahlreichen Indikatoren im internationalen Vergleich durchweg in der Spitzengruppe:
• Mit 8,3 Krankenhausbetten pro 1.000 Einwohner lag Deutschland 2010 auf Platz 3 (Durchschnitt: 4,9).
• Mit 40,4 Krankenhäusern pro eine Million Personen befindet sich Deutschland 2010 nur auf Platz 7, aber immer noch weit über dem OECD-Durchschnitt von 29,9 Krankenhäusern.
• Nur Österreich lag mit 261 Krankenhausentlassungen pro 1.000 Einwohner im Jahr 2010 vor Deutschland, wo diese Anzahl 240 betrug (OECD-Durchschnitt: 155).
• Bei 17 Behandlungsanlässen (z.B. Entlassungen nach einer Kreislauf- oder Krebserkrankung) und Operationen oder anderen Behandlungen (z.B. Mandelentfernungen, Bypass-Ops, Hernienoperationen, Knieersatz-Ops oder brusterhaltenden Operationen) lag die Häufigkeit in deutschen Krankenhäusern mehr oder weniger deutlich über dem OECD-Durchschnittswert und bei 10 dieser Krankenhausleistungen auf den Plätzen eins bis drei.
• Trotzdem war der Anteil der Ausgaben für Krankenhausbehandlungen am Bruttoinlandsprodukt in Deutschland 2010 mit 2,8% nicht so hoch, dass es zu einem Platz unter den drei ersten Ländern reichte. Auf Platz 7 stehend, wurde in Deutschland aber immer noch mehr für stationäre Behandlungen ausgegeben als im Durchschnitt der OECD-Länder mit 2,4%.
Als mögliche Erklärungsfaktoren der in Deutschland wahrscheinlichen Überversorgung mit Krankenhausleistungen geben die OECD-Experten vier Faktoren an:
• Deutschland habe einen mehr "open-ended approach" bei der Finanzierung seiner Krankenhäuser und schwächere Kontrollen der Krankenhausbudgets als in anderen Ländern.
• Während in anderen Ländern mehrere Tools benutzt werden, Einfluss auf die Krankenhausbudgets zu nehmen, setzt Deutschland beinahe ausschließlich auf die DRGs als Preissteuerungsinstrument.
• Die deutschen Regierungen haben keinen Anreiz die Krankenhauskapazität zu rationalisieren, wenn es wünschenswert wäre.
• Die große Verfügbarkeit von Qualitätsinformationen in Deutschland sollte zur Verbesserung der direkten Finanzierung benutzt werden (z.B. P4P).
Der Bericht schließt mit dem Appell die bestehende Überversorgung im Interesse der Patienten und Beitragszahler abzubauen und die Versorgung chronisch Kranker außerhalb des Krankenhauses zu verbessern. In ihm finden sich u.a. auch eine Reihe von Auswertungen für die einzelnen deutschen Bundesländer.
Die in der reflexartigen Reaktion z.B. der Deutschen Krankenhausgesellschaft enthaltene Kritik an der Aussagefähigkeit der OECD-Daten wiederholt zwar die bereits einige Male geäußerte Zweifel an der Validität und Qualität der OECD-Daten, zielt aber dann, wenn es wie hier um Vergleiche geht, ins Leere. Wenn die Daten schlecht erhoben wären oder die Indikatoren unpräzise wären, träfe dies doch wahrscheinlich auf alle verglichenen Länder zu. Dann könnten die absoluten Zahlen falsch sein, die Relation und damit Aussagen zur relativen Position des deutschen Krankenhauswesens aber nicht.
Der 22-seitige Bericht MANAGING HOSPITAL VOLUMES - GERMANY AND EXPERIENCES FROM OECD COUNTRIES von Ankit Kumar und Michael Schoenstein ist komplett kostenlos erhältlich.
Das 80-seitige OECD Health Working Paper No. 61 International Variations in a Selected Number of Surgical Procedures von McPherson, K., G. Gon und M. Scott ist ebenfalls komplett und kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 7.4.13
Kostensparen durch Magenverkleinerung!!? Wie oft wollen Politik und Krankenkassen noch auf "Kostenwunder" hereinfallen?
 Zu den verlockendsten und meistgeglaubten Versprechungen der Anbieter von gesundheitsbezogenen Leistungen gehört es, mit geringeren Kosten bessere Qualität zu liefern oder zumindest die Kosten zu senken. Und genauso regelmäßig wie dies Gesundheitspolitiker und Krankenkassen glaubten, wuchs der Leistungskatalog mit dieser Art von Angeboten, die sich dann aber häufig als weder qualitativ hochwertig, noch wirksam und kostensparend erwiesen.
Zu den verlockendsten und meistgeglaubten Versprechungen der Anbieter von gesundheitsbezogenen Leistungen gehört es, mit geringeren Kosten bessere Qualität zu liefern oder zumindest die Kosten zu senken. Und genauso regelmäßig wie dies Gesundheitspolitiker und Krankenkassen glaubten, wuchs der Leistungskatalog mit dieser Art von Angeboten, die sich dann aber häufig als weder qualitativ hochwertig, noch wirksam und kostensparend erwiesen.
Das jüngste Beispiel, so eine in der Fachzeitschrift "JAMA Surgery" gerade veröffentlichte Studie, ist die als radikale und mit Sicherheit mittel- wie langfristig kostensparende Therapie für extrem Übergewichtige seit einigen Jahren propagierte und auch durchgeführte operative Verkleinerung des Magens. Angesichts der großen und zum Teil zunehmenden Anzahl von adipösen Personen und deren praktischen Schwierigkeiten dies durch ein anderes Ess- und Bewegungsverhalten zu ändern, schien die auch Adipositaschirurgie genannte Reihe von Verkleinerungstechniken eine Art Patentlösung zu sein.
Eine Untersuchung von anfänglich 29.820 Personen, die bariatrisch operiert worden waren, über 6 Jahre (2002 bis 2008) und der Vergleich ihrer gesundheitlichen Versorgung und deren Kosten mit den in gesundheitlicher Sicht ähnlichen (z.B. Betroffenheit von Übergewicht) Angehörigen einer nichtoperierten Vergleichsgruppe, zeigte aber ein wesentlich unpatenteres Bild.
Die gesamten Gesundheitsausgaben der operierten Personen waren bis zum dritten Jahr der Untersuchung größer als die der Kontrollgruppenangehörigen. In den weiteren Jahren ähneln sich die Ausgaben.
Dabei waren die Ausgaben der bariatrisch operierten Personen für Medikamente und Arztbesuche niedriger, die für stationäre Behandlung aber höher als in der Kontrollgruppe. Letztere entstanden überwiegend durch unerwünschte und zum Teil erst nach Jahren auftretenden Komplikationen und Folgen der überwiegenden Operationstechnik, einer so genannten laparoskopischen Operation.
Zusammenfassend betonten die AutorInnen und der Verfasser eines Editorials zwei Aspekte:
• "We were unable to identify any short- or long-term reductions in overall health care costs associated with surgery."
• Ein Herausgeber der Zeitschrift weist in seiner "invited critique" stattdessen auf eine qualitative völlig andere Herangehens- und Bewertungsweise für diese und andere Behandlungsangebote hin: "The indications for bariatric surgery should be viewed in terms of individual patient benefit without anticipating that there will be cost savings to a health care system by offering this treatment." Zum patientenbezogenen Nutzen und zu den Entscheidungskriterien für eine Operation gehört für die ForscherInnen auch noch das "well-being" der betroffenen Personen.
Der am 20. Februar 2013 zuerst online veröffentlichte Aufsatz Impact of Bariatric Surgery on Health Care Costs of Obese Persons. A 6-Year Follow-up of Surgical and Comparison Cohorts Using Health Plan Data von Jonathan P. Weiner et al. ist in der Fachzeitschrift "JAMA Surgery" (2013;():1-8) erschienen und komplett kostenlos zugänglich.
Der komplette Text der "Invited Critique" Is Bariatric Surgery Worth It? Comment on "Impact of Bariatric Surgery on Health Care Costs of Obese Persons" von Edward H. Livingston ist ebenfalls kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 22.2.13
"Auf den Hund gekommen" - Medizinisch-animalisch-olfaktorischer Fortschritt beim Umgang mit nosokomialen Infektionen in Holland
 Seit einigen Jahren treten in europäischen und nordamerikanischen Kliniken immer mehr Erkrankungen mit dem bei rund 30% der Krankenhauspatienten zunächst harmlos vorhandenen Bakterium Clostridium difficile auf. Beim Einsatz von Antibiotika gegen andere Erreger kann sich dieses Bakterium stark vermehren und dabei giftige Stoffe produzieren. Die betroffenen Patienten leiden an mildem Durchfall aber auch an schweren Erkrankungen wie einer pseudomembranösen Colitis und einer erheblichen Ausdehnung des Darmes (dem toxischen Megacolon). Die durchschnittliche Inzidenz von Clostridium difficile beträgt 17,5 bis 23 Fälle pro 10.000 Krankenhauseinweisungen. In Großbritannien liegt der Wert im Moment bereits bei 50 Fällen.
Seit einigen Jahren treten in europäischen und nordamerikanischen Kliniken immer mehr Erkrankungen mit dem bei rund 30% der Krankenhauspatienten zunächst harmlos vorhandenen Bakterium Clostridium difficile auf. Beim Einsatz von Antibiotika gegen andere Erreger kann sich dieses Bakterium stark vermehren und dabei giftige Stoffe produzieren. Die betroffenen Patienten leiden an mildem Durchfall aber auch an schweren Erkrankungen wie einer pseudomembranösen Colitis und einer erheblichen Ausdehnung des Darmes (dem toxischen Megacolon). Die durchschnittliche Inzidenz von Clostridium difficile beträgt 17,5 bis 23 Fälle pro 10.000 Krankenhauseinweisungen. In Großbritannien liegt der Wert im Moment bereits bei 50 Fällen.
Um die riskante Verbreitung des Bakteriums innerhalb des Krankenhauses zu verhindern, ist es wichtig zu wissen, welche PatientInnen infiziert sind, um diese dann, wenn die weiteren Voraussetzungen für die genannten Folgerisiken gegeben sind, zu isolieren. Die Routinemethode, der Nachweis durch eine Bakterienkultur, dauert aber zwei bis drei Tage, während denen die Verbreitung des Bakteriums ungehindert möglich ist.
In zwei großen niederländischen Krankenhäusern, die wie alle Kliniken in den Niederlanden generell mehr tun als deutsche Krankenhäuser, um die Infektionen mit multiresistenten Keimen zu verhindern, wurde jetzt untersucht, ob Hunde mit ihrem enormen Geruchssinn eingesetzt werden könnten, um in Stuhlproben oder direkt bei PatientInnen Clostridium difficile-Erreger über den ihnen eigenen "Pferdemistgeruch" in kürzester Zeit identifizieren zu können.
In einer explorativen Studie und in einer Art Fall-Kontrollstudie wurde ein zweijähriger Beagle trainiert, diesen Geruch zu identifizieren. In einem Test mit 30 infizierten Patienten und 270 Angehörigen einer Kontrollgruppe von Nichtinfizierten musste der Hund seine Fähigkeiten zusammen mit seinem Trainer auf die Probe stellen lassen. Dieser Trainer wusste nicht, welche Personen infiziert waren. In einer Gruppe von 10 Patienten waren jedes Mal eine infizierte und 9 nichtinfizierte Personen zusammengefasst.
Die beiden wichtigsten Ergebnisse waren:
• Bei der Identifizierung der Infektion in Stuhlproben betrug die Sensitivität und Spezifität 100%.
• Bei den Schnüffelrunden in Behandlungszimmern identifizierte der Hund 25 von 30 Fällen, was einer Sensitivität von 83% entspricht. Auch bei 265 von 270 nichtinfizierten Angehörigen der Kontrollgruppe verroch sich der Hund nicht, was einer Spezifität von 98% entsprach.
Trotz dieser sehr guten Werte beabsichtigen die ForscherInnen in weiteren Versuchen zu untersuchen, ob die Erfolge auch mit anderen Hunden und Trainern und unter anderen räumlichen Bedingungen wiederholt werden können. Da sich auch bei anderen Erkrankungen oft spezifische Körpergerüche entwickeln, ist nicht ausgeschlossen, dass die Erkennung und damit Prävention weiterer schwerer Erkrankungen ebenfalls noch "auf den Hund kommen" werden.
Der Aufsatz "Using a dog's superior olfactory sensitivity to identify Clostridium difficile in stools and patients: Proof of principle study" von Bomers MK et al. ist in der Weihnachtsausgabe 2012 des "British Medical Journal" (13. Dezember 2012, 345: e7396) erschienen und samt 10-minütigen Video mit dem Beagle "Cliff" kostenlos zugänglich.
Bernard Braun, 23.12.12
90% der US- Muster-Krankenhäuser haben ein Programm zur Reduktion vermeidbarer Wiedereinweisungen von Herzpatienten, sagen sie!
 Zweite und weitere Krankenhausaufenthalte nach der Erstbehandlung von Herzversagen und akutem Herzinfarkt stellen für die PatientInnen mindestens eine enorme Beeinträchtigung ihrer Lebensqualität dar und können unter den Bedingungen einer Vergütung mit diagnosebezogenen Fallpauschalen (DRG) auch erhebliche Nachteile für das Krankenhaus haben - vor allem, wenn es sich um vermeidbare Wiedereinweisungen handelt. Deshalb gibt es Bemühungen, diese mit entsprechend differenzierten Programmen zu senken.
Zweite und weitere Krankenhausaufenthalte nach der Erstbehandlung von Herzversagen und akutem Herzinfarkt stellen für die PatientInnen mindestens eine enorme Beeinträchtigung ihrer Lebensqualität dar und können unter den Bedingungen einer Vergütung mit diagnosebezogenen Fallpauschalen (DRG) auch erhebliche Nachteile für das Krankenhaus haben - vor allem, wenn es sich um vermeidbare Wiedereinweisungen handelt. Deshalb gibt es Bemühungen, diese mit entsprechend differenzierten Programmen zu senken.
Fragt man, wie es jetzt eine ForscherInnengruppe in den USA gemacht hat, Krankenhausleitungen danach, was sie tun um die Anzahl der Wiedereinweisungen dieser Patientengruppen innerhalb der ersten 30 Tage nach Entlassung zu senken, geben 90% an, bei ihnen existierten dazu klare schriftliche Strategien und Maßnahmenpakete. Dies war eigentlich auch gar nicht anders zu erwarten, wenn man sich die Art der Krankenhäuser ansieht, die dazu in einem nationalen Survey befragt wurden. Es waren 594 Kliniken (Antwortrate 90,4%), die im Jahr 2010 Mitglied der Qualitätsverbesserungsinitiative "Hospital to Home (H2H)" waren.
Umso kritikwürdiger sieht aber die Qualitätssicherungsrealität im Lichte der Antworten auf konkrete Nachfragen zu den Einzelmaßnahmen aus mit denen die Kliniken das Ziel zu erreichen versuchten:
• 87% von ihnen hatten Qualitätsverbesserungsteams für PatientInnen mit Herzversagen und 54% für Herzinfarkt-PatientInnen.
• 49,3% gaben an, partnerschaftliche Kooperationen mit niedergelassenen Ärzten zu haben und zu pflegen.
• 23,5% hatten für PatientInnen mit hohem Krankheitsrisiko zweckbezogene Partnerschaften mit anderen örtlichen Krankenhäusern.
• In 28,9% der befragten Krankenhäuser wurden routinemäßig die Angaben über die Art und die Menge ambulanten und stationären Verordnungen von Arzneimitteln zusammengeführt, bewertet und bei der weiteren Medikation berücksichtigt.
• 25,5% der Kliniken gaben an, sie würden eine Zusammenfassung aller Entlassungsdaten immer direkt an den ambulanten (weiter)behandelnden Arzt des Patienten schicken.
• Von 10 nützlichen Praktiken und Maßnahmen (einige sind gerade genannt worden) zur Verringerung des Rehospitalisierungsrisikos nutzten die befragten Krankenhäuser im Durchschnitt 4,8 und nur weniger als 3% der befragten Kliniken nutzten alle 10. Einer kleinen Zahl von 12% aller Krankenhäuser mit weit unterdurchschnittlicher Nutzung (zwei und weniger der Maßnahmen) der angeblich schriftlich vereinbarten Maßnahmen steht eine ebenso kleine Gruppe mit überdurchschnittlicher Nutzung (8 und mehr dieser Maßnahmen) gegenüber.
Bedenkt man, dass es sich bei den befragten Krankenhäusern um eine positiv verzerrte Gruppe handelt, ist die enorme Diskrepanz zwischen der Schrift-Performance und den tatsächlich umgesetzten konkreten Maßnahmen bedenklich. Vor allem dann, wenn man weiter bedenkt, dass sich z.B. Patienten und ihre Ärzte bei der Auswahl eines Krankenhauses oft nur an den schriftlichen Angaben zur Existenz eines derartigen Programms oder entsprechenden Qualitätssiegeln orientieren können - wenn sie überhaupt die Wahl haben.
Die im deutschen Gesundheitswesen verbreitete Hoffnung, dass ein Entlassungs-, Überleitungs- oder versorgungskettenbezogenes Versorgungsmanagement in Krankenhäusern allein schon durch die gesetzliche Verpflichtung (neuerdings die gesetzliche Verpflichtung zu einem Versorgungsmanagement zwischen stationärer und ambulanter Behandlung nach § 11 Abs. 4 SGB V und zum Entlassungsmanagement der Krankenhäuser nach den §§ 39 und 112 SGB V) oder die Existenz von Leitbildern, Qualitätssiegeln etc. existiert und funktioniert, sollte im Lichte dieser Untersuchung gründlich hinterfragt werden. Außer der schon fast traditionelle Pawlowsche Reflex, das sei nur in den USA so und an deutschen Krankenhäuser kein Thema, funktioniert auch bei diesem Thema. Eine Überprüfung nach dem hier erprobten Modell wäre aber allemal vertrauenswürdiger.
Vom Aufsatz "Contemporary evidence about hospital strategies for reducing 30-day readmissions: a national study." von Bradley EH et al. in der Zeitschrift "Journal of American College of Cardiology" (14. August 2012; 60(7): 607-14) gibt es nur das Abstract kostenlos.
Für diejenigen LeserInnen, die einen Zugang zu dieser Zeitschrift haben lohnt sich auch die Lektüre des ausführlichen Kommentars "Hospital strategies to reduce heart failure readmissions: where is the evidence?" von Butler J und Kalogeropoulos A. in derselben Ausgabe der Zeitschrift (60[7]: 615-7), von dem es wie bei Kommentaren üblich noch nicht einmal ein Abstract gibt.
Wie der Titel ihres Kommentars bereits andeutet, weisen die Verfasser auf ein besonders in den USA existierendes Dilemma hin: Einerseits reagiert Medicare, die staatliche Krankenversicherung für Ältere, auf Qualitätsmängel bei der stationären Versorgung, und dazu zählen vermeidbare Wiedereinweisungen in den ersten 30 Tagen nach Entlassung mit derselben Indikation, mit spürbaren Abschlägen bei der Honorierung. Darauf reagieren die Krankenhäuser u.a. verstärkt mit Maßnahmen, die z.B. Wiedereinweisungen reduzieren helfen sollen.
Andererseits bedeutet dies, dass häufig Maßnahmen entwickelt und eingesetzt werden, die "are neither proven nor primarily based on the motivation to improve patient outcomes, but rather on the fear of punitive financial disincentives. Would these enormous resources spent by hospitals to randomly implement unproven interventions be better spent on actually studying what the real determinants of HF (heart failure) hospitalizations are and which interventions will prove to be beneficial? Such questions are difficult to answer when policy trumps science. We agree with the investigators in their concluding remarks that more evidence establishing the effectiveness of the various hospital practices is needed."
Bernard Braun, 9.11.12
Die Lichtseite eines Teils der oft beklagten Dokumentationsarbeit im Krankenhaus: Fallpauschalenbezogene Krankenhausstatistik 2011
 Auch wenn unter den Bedingungen der Arbeitsverdichtung und des spezifischen Personalmangels in Krankenhäusern alle dort Beschäftigten über die patientenfernen Dokumentationsarbeiten verständlicherweise klagen, wird auf dieser Basis eine facettenreiche Gesundheitsberichterstattung über das stationäre Versorgungsgeschehen erstellt.
Auch wenn unter den Bedingungen der Arbeitsverdichtung und des spezifischen Personalmangels in Krankenhäusern alle dort Beschäftigten über die patientenfernen Dokumentationsarbeiten verständlicherweise klagen, wird auf dieser Basis eine facettenreiche Gesundheitsberichterstattung über das stationäre Versorgungsgeschehen erstellt.
Zu den jährlichen Veröffentlichungen zählt die fallpauschalenbezogene Krankenhausstatistik, deren Ausgabe für das Jahr 2011 am 25. Oktober erschienen ist.
Zu den wesentlichen Ergebnissen zählen die folgenden Angaben:
• Im Jahr 2011 wurden insgesamt 17,7 Mill. Patientinnen und Patienten aus der vollstationären Krankenhausbehandlung entlassen. Dies waren 1,6 % mehr als im Jahr zuvor. 53,1 % der Behandelten waren weiblich, 46,9 % männlich. Im Durchschnitt waren die Patientinnen und Patienten 55 Jahre alt (Frauen 54 Jahre, Männer 55 Jahre).
• Die durchschnittliche Verweildauer in den Einrichtungen lag bei 6,7 Tagen und nahm im Vergleich zum Vorjahr weiter um 0,1 Tage ab.
• Bei 52,5 % der Fälle erfolgte der Krankenhausaufenthalt aufgrund der Einweisung durch einen Arzt und bei 40,4 % aufgrund eines Notfalls. Die Behandlung wurde bei 87,6 % der Patientinnen und Patienten regulär beendet. In 2,1 % der Fälle wurde die Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet.
• Die meisten Behandlungsfälle gab es in der Fachabteilung Innere Medizin.
• Je Krankenhausfall wurden durchschnittlich 2,8 Operationen und medizinische Prozeduren erbracht. Insgesamt summierte sich dies zu rund 49 Millionen Operationen und medizinische Prozeduren auf. Die Zunahme gegenüber 2010 belief sich auf 4,2%.
• Auch wenn es mittlerweile fast 1.200 abrechenbare DRGs gibt (am Anfang standen etwas über 400) gibt machen 2% aller DRGs rund ein Viertel des gesamten vollstationären Leistungsspektrums aus. Die zwanzig häufigsten DRGs deckten 23% und die fünfzig häufigsten DRGs 39 % des gesamten DRG-Leistungsspektrums ab.
• Die Versorgung gesunder Neugeborener (528.422 Fälle), die Speiseröhrenentzündung, Magen-Darm-Entzündung oder verschiedene Krankheiten der Verdauungsorgane (448.994 Fälle) und die Entbindungen ohne komplizierende Diagnose (313.364 Fälle) waren im Jahr 2011 die insgesamt am häufigsten abgerechneten DRGs.
• Die Häufigkeit der Hauptdiagnosegruppen veränderte sich gegenüber dem Jahr 2010 zum Teil kräftig - ohne, dass die Statistik-Fachserie Erklärungen liefert. So nahm die Gruppe der Polytrauma um 8,1 % zu, die der infektiösen und parasitären Krankheiten um 6,9 % ebenso wie die Verletzungen, Vergiftungen und toxische Wirkungen von Drogen und Medikamenten mit +6,4 %. Abgenommen haben die Fälle mit den Diagnosen endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (-6,6 %), HIV (-2,7 %) und Neugeborene (-2,5 %).
Der als Fachserie Fachserie 12 Reihe 6.4 des Statistischen Bundesamtes jährlich veröffentlichte Statistikband "Gesundheit. Fallpauschalenbezogene Krankenhausstatistik (DRG-Statistik) Diagnosen, Prozeduren, Fallpauschalen und Case Mix der vollstationären Patientinnen und Patienten in Krankenhäusern 2011" ist eine Fundgrube für viele weiteren Informationen zum stationären Versorgungsgeschehen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 5.11.12
Ein Lehrbeispiel!? Wie in der größten US-for-profit-Krankenhauskette "outbreaks of stents" oder "EBDITA"-Ärzte zum Alltag gehören
 Öffentlich werdende Vorfälle, dass in Krankenhäusern gesundheitlich nicht notwendige oder gerechtfertigte Untersuchungen und Operationen aus rein wirtschaftlichen Erwägungen stattfinden, werden fast schon routinemäßig als "einmalige Ausrutscher", als Werk eines "schwarzen Schafs" oder als "Ausreißergeschehen" kleiner, unprofessionell geführter Krankenhäuser charakterisiert.
Öffentlich werdende Vorfälle, dass in Krankenhäusern gesundheitlich nicht notwendige oder gerechtfertigte Untersuchungen und Operationen aus rein wirtschaftlichen Erwägungen stattfinden, werden fast schon routinemäßig als "einmalige Ausrutscher", als Werk eines "schwarzen Schafs" oder als "Ausreißergeschehen" kleiner, unprofessionell geführter Krankenhäuser charakterisiert.
Umso bedeutender sind die zwischen dem Jahr 2000 und 2010/11 rund 1.200 Ereignisse von vermutlich gesundheitlich nicht notwendigen und damit zum Teil auch für die Gesundheit von PatientInnen gefährlichen Untersuchungen in Herzkatheterlabors oder das Einpflanzen von Gefäßstents in mehreren Kliniken der mit 163 Einrichtungen größten for-profit-Krankenhauskette der USA - HCA (Hospital Corporation of America). Mehr als 80% der Kliniken dieser Kette befinden sich nach eigenen Angaben auch unter den 10% der nach dem staatlichen Qualitäts-Ranking besten Krankenhäuser der USA. Blind darauf zu vertrauen, dass auch die restlichen knapp 20% Musterbetriebe sind, wäre aber eindeutig ein Irrtum. Den unerwünschten Ereignissen wird jetzt mit dem Schwerpunkt im Bundesstaat Florida in einer gerichtlichen Untersuchung nachgegangen. Diese Häuser tragen interessanterweise mit über 20% zum Gewinn von HCA bei.
In einem langen fundierten Beitrag in der angesehenen Tageszeitung "New York Times" (NYT), dokumentieren die Autoren die lange Kette dieser Ereignisse. So wurde in einem vertraulichen internen Bericht aus dem Jahr 2010 für ein HCA-Großkrankenhaus z.B. eingeräumt, dass bei rund der Hälfte teurer invasiver diagnostischer Tests mittels eines Katheters, keine signifikante Herzerkrankung vorlag. Im Jahr 2000 untersuchte das Justizministerium, ob HCA nicht der staatlichen Krankenversicherung Medicare rund 1,7 Milliarden US-Dollar zu viel in Rechnung gestellt hatte. Der damals verantwortliche HCA-Vorstand, Rick Scott, musste sich dafür nie rechtlich und faktisch verantworten und ist heute Governeur von Florida. 2004 stellte eine damit von HCA beauftragte externe Gruppe von Qualitätssicherungsexperten vertraulich fest, dass in einem bereits zuvor auffällig gewordenen Krankenhaus 43% der invasiven Öffnungen und Erweiterungen von verkalkten Arterien, so genannte Angioplastien) in keiner Weise anerkannten Standards entsprachen. Andere bei HCA tätigen Kardiologen fälschten diagnostische Daten so, dass sie kardiologisch relevante Gefäßoperationen durchführen konnten. Aus Blutgefäßen, deren zwischen 33% und 53% durch Verkalkung etc. verkleinert waren, wurden Blockaden zwischen 80% und 90%. Wenn Letzteres der Fall ist, ist eine operative Behandlung indiziert. In anderen Kliniken der Krankenhaus-Kette brachen in mehgreren Jahren medizinisch unerklärbare Wellen der Implantation von teuren Gefäß-Stents aus. Und schließlich warb die Krankenhaus-Kette in einem Business Plan aus dem Jahr 2008 mit einem beschäftigten Arzt als "our leading EBDITA MD". Diese Abkürzung bezieht sich nicht auf eine besondere medizinische oder ärztliche Fähigkeit oder Fertigkeit, sondern auf die Fähigkeit "earnings before interest, taxes, depreciation and amortization" zu generieren, also die Fähigkeit des Arztes, den Gewinn des Krankenhauses zu mehren. Wenige Monate zuvor war demselben Arzt intern vorgehalten worden, er führe zu schnell Katheteruntersuchungen durch und untersuche nicht ausreichend, ob die Patienten den invasiven und damit potenziell gesundheitsgefährdenden und teuren Eingriff benötigten oder nicht.
Auch wenn HCA oder die beteiligten Ärzte viele der Vorwürfe letztlich bestätigen mussten, sprechen sie anderen Vorwürfen ihre Berechtigung ab. Angesichts der seit 2010 bekannt gewordenen Über- oder Fehlversorgungsfälle wird HCA laut NYT aber nichts anderes übrigbleiben als "still more reviews" durchzuführen und zu veröffentlichen.
In Deutschland ist natürlich HCA (bisher) nicht tätig, für andere gewinnorientierte Krankenhausketten in den USA fehlen vergleichbare Ereignisketten und so etwas kommt "natürlich" in keinem deutschen Krankenhaus vor. Besser wäre aber trotzdem eine vergleichbare längsschnittliche krankenhausbezogene Transparenz und Berichterstattung über solche und andere unerwünschten Ereignisse in deutschen Krankenhäusern und Tageszeitungen. Dass viele Qualitätsmerkmale der stationären Behandlung im Rahmen der externen bzw. sektorenübergreifenden vergleichenden Qualitätssicherung von BQS und AQUA noch nicht untersucht werden, die Ergebnisse der untersuchten Indikatoren oder die Ergebnisse der strukurierten Dialoge meist nur anonym berichtet werden, ist aber nicht geeignet Ironie zu dämpfen und uneingeschränktes Vertrauen in das Nichtvorkommen solcher Ereignisketten zu fördern.
Der ausführliche Bericht der NYT vom 6.8.2012 "Hospital Chain Inquiry Cited Unnecessary Cardiac Work" von Reed Abelson und Julie Creswell ist komplett kostenlos erhältlich und verschafft einem dank einiger Links einen guten Blick hinter die Kulissen.
Wer aktuell mehr über die systematischen Bemühungen zur Qualitätstransparenz in deutschen Krankenhäusern erfahren will, kann sich z.B. den kostenlos erhältlichen Abschlussbericht 2011 zum Strukturierten Dialog gemäß §15 Abs. 2 QSKH-RL über die Maßnahmen und Ergebnisse der geführten Strukturierten Dialoge anschauen, die im Jahr 2011 auf Basis der Daten des Erfassungsjahres 2010 durchgeführt wurden. Er kann sich auch den Anhang zum Abschlussbericht 2011 anschauen.
Und wer noch mehr über die Realität der eher bundesland- statt auch krankenhausbezogenen Qualitätsberichterstattung mit den BQS/AQUA-Qualitätsindikatoren wissen will, dem ist der "Bericht zur Schnellprüfung und Bewertung der Indikatoren der externen stationären Qualitätssicherung hinsichtlich ihrer Eignung für die einrichtungsbezogene öffentliche Berichterstattung" mit Stand Juni 2011 zu empfehlen. Dort erfährt er u.a. dass und warum "von den 316 geprüften Hauptkennzahlen … 48 ohne Einschränkung zur Veröffentlichung empfohlen (wurden). 134 wurden mit Erläuterungen oder leichter Anpassung zur Veröffentlichung empfohlen. Für 108 Indikatoren wurde eine Veröffentlichung zum jetzigen Zeitpunkt nicht empfohlen. Weitere 26 wurden nicht zur Veröffentlichung empfohlen."
Bernard Braun, 28.10.12
Cochrane-Review: Umfassende geriatrische Bewertung in Spezialabteilungen nützlicher als normale Behandlung und geriatrische Teams
 Mit für Cochrane-Reviews relativ seltener Entschiedenheit bzw. Uneingeschränktheit bewerteten die Reviewer in ihrem im Juli 2011 veröffentlichten Review "Comprehensive geriatric assessment for older adults admitted to hospital" diese Form der Diagnose und Bewertung der Verfassung von geschwächten älteren KrankenhauspatientInnen als durchweg nützlicher als ihre normale Behandlung.
Mit für Cochrane-Reviews relativ seltener Entschiedenheit bzw. Uneingeschränktheit bewerteten die Reviewer in ihrem im Juli 2011 veröffentlichten Review "Comprehensive geriatric assessment for older adults admitted to hospital" diese Form der Diagnose und Bewertung der Verfassung von geschwächten älteren KrankenhauspatientInnen als durchweg nützlicher als ihre normale Behandlung.
Diese Bewertung des "comprehensive geriatric assessment (CGA)" basierte auf den Ergebnissen von 22 randomisierten, kontrollierten Studien aus sechs Ländern mit 10.315 TeilnehmerInnen. CGA ist ein multidimensionaler, interdisziplinärer Diagnoseprozess, der die medizinischen, psychologischen und funktionalen Fähigkeiten von geschwächten älteren KrankenhauspatientInnen ermittelt, selbständig und selbstbestimmt leben zu können und dafür einen koordinierten und integrierten Behandlungs- und Unterstützungsplan entwickelt, der eine möglichst lange Dauer hat. Die professionellen Akteure bei CGA können spezielle Abteilungen in den Krankenhäusern oder mobile Teams sein.
Die wesentlichen Ergebnisse der berücksichtigten Studien lauteten:
• Die PatientInnen, die das CGA erhielten, lebten im Vergleich zu den PatientInnen mit der üblichen Behandlung sowohl nach sechs (Odds ratio: 1,25; p=0,0002)) als auch nach zwölf Monaten (odds ratio: 1,16; p=0,003) nach der Krankenhausentlassung signifikant häufiger in ihren eigenen vier Wänden ("living at home" als primärer Outcome).
• Die "Chance" nach der Krankenhausbehandlung in einem Pflegeheim oder einer ähnlichen Institution zu landen war unter den CGA-PatientInnen signifikant geringer (OR: 0,79; p<0,0001). Dies galt ebenso für die "Chance" zu sterben oder eines schlechteren Gesundheitszustands (OR: 0,76; p=0,001).
• Es war schließlich signifikant wahrscheinlicher, dass die CGA-PatientInnen im Vergleich mit normalbehandelten PatientInnen ihre kognitiven Fähigkeiten verbesserten (OR: 1,11; p=0,02)
• Detaillierte Analysen zeigten außerdem, dass die wesentlichen Effekte des CGA vor allem dann auftraten, wenn die älteren PatientInnen in speziellen Abteilungen ("wards") anstatt in ihrer jeweiligen Behandlungsabteilung durch spezielle mobile Teams behandelt wurden.
Vom Cochrane-Review "Comprehensive geriatric assessment for older adults admitted to hospital" von Ellis G., Whitehead MA et al. (Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 7. Art. No.: CD006211) ist kostenlos nur das umfassende Abstract zu erhalten.
Die Ergebnisse des Cochrane-Reviews werden auch in dem Aufsatz "Comprehensive geriatric assessment for older adults adnitted to hospital: meta-analysis of randomised controlled trials" von Graham Ellis et al. im "British Medical Journal" (2011; 343) dargestellt, der komplett kostenlos erhältlich ist.
Bernard Braun, 22.10.12
Selbständiges häusliches Leben für Ältere nach kürzerem Krankenhausaufenthalt möglich: Das "Acute Care for Elders (ACE)"-Programm
 Der schon immer hohe Anteil von älteren, oft multimorbiden PatientInnen im Krankenhaus, die nach ihrer Entlassung auch noch oft behandlungs- und versorgungsbedürftig sind, wird als Folge der demografischen Alterung weiter zunehmen. Und damit nimmt auch das Problem zu, sie so zu entlassen, dass sie mit möglichst geringem Stress wieder in ein möglichst selbständiges oder selbstbestimmtes Leben in ihrer häuslichen Umgebung zurückkehren können. Funktioniert diese Reintegration nicht, drohen die Wiedereinweisung in das Krankenhaus, unerwünschte gesundheitliche Stress-Folgen oder gar der Beginn von ambulanter und stationärer Pflegebedürftigkeit.
Der schon immer hohe Anteil von älteren, oft multimorbiden PatientInnen im Krankenhaus, die nach ihrer Entlassung auch noch oft behandlungs- und versorgungsbedürftig sind, wird als Folge der demografischen Alterung weiter zunehmen. Und damit nimmt auch das Problem zu, sie so zu entlassen, dass sie mit möglichst geringem Stress wieder in ein möglichst selbständiges oder selbstbestimmtes Leben in ihrer häuslichen Umgebung zurückkehren können. Funktioniert diese Reintegration nicht, drohen die Wiedereinweisung in das Krankenhaus, unerwünschte gesundheitliche Stress-Folgen oder gar der Beginn von ambulanter und stationärer Pflegebedürftigkeit.
Ob und was Krankenhäuser machen können, um diese unerwünschten Folgen vermeiden oder minimieren zu können, zeigen die in der Juniausgabe 2012 der renommierten Gesundheitspolitikzeitschrift "Health Affairs" veröffentlichten Ergebnisse einer in 200 bundesweiten Kliniken der USA in den Jahren 1993 bis 1997 durchgeführten kontrollierten Studie mit insgesamt 1.632 70-jährigen und älteren TeilnehmerInnen über die Wirkungen des "Acute Care for Elders (ACE)"-Programms. Zuvor war das Programm bereits in zwei randomisierten kontrollierten Studien in unterschiedlichen Krankenhaustypen untersucht worden und zum Teil gab es ebenfalls positive Wirkungen auf die Lebensqualität und die Kosten der stationären Behandlung.
Dieses Programm wurde u.a. deshalb entwickelt, weil in den USA über ein Drittel der älteren KrankenhauspatientInnen das Krankenhaus mit einer geringeren Funktionsfähigkeit für das tägliche selbstbestimmte Leben verlassen als zu Beginn der stationären Behandlung. Dafür verantwortlich sind Mobilitätsverluste, gestörtes Schlafen, die ungewohnte Krankenhausumgebung, andere gesundheitliche Störungen, Verwirrungen und Schwierigkeiten alleine Stärke und Mobilität zurückzugewinnen.
Das Programm beruht auf einem multidisziplinären Ansatz, der Prinzipien der Qualitätsverbesserung und ein umfassendes geriatrisches Assessment mit dem Ziel verbindet, stationär behandelten älteren Personen Fähigkeiten und Fertigkeiten zu vermitteln, sich im Bereich der funktionalen Basisaktivitäten des täglichen Lebens unabhängig verhalten zu können. Das dafür gebildete Versorgungsteam besteht in der Regel aus einem Geriater, einer speziell weitergebildeten Pflegekraft ("practice nurse"), einem Sozialarbeiter, einem Apotheker, Ernährungsberater und einem Physiotherapeuten.
Zu den Hauptinstrumenten und -bedingungen des Programms gehören z.B.
• eine speziell "häuslich" gestaltete Krankenhausumgebung mit Teppichböden, erhöhten Toilettensitzen und einem salonartigen Raum für gemeinsames Essen und Familienbesuche,
• die patientenzentrierte Behandlung, in deren Mittelpunkt die Förderung von Unabhängigkeit und Selbstbestimmung steht und
• die regelmäßige Überprüfung der medizinischen Behandlung mit dem besonderen Schwerpunkt behandlungsbedingte und den Krankenhausaufenthalt verlängernde Komplikationen zu reduzieren.
Zu den untersuchten Wirkungen des Programms gehörten primär die Länge des Krankenhausaufenthalts und seine Kosten und sekundär einige Indikatoren des Behandlungsverlaufs (z.B. Entlassplanung, Krankenhaussterblichkeit, Drei-Monats-Wiedereinweisungsrate) und der Fähigkeiten im täglichen häuslichen Leben (z.B. Einkaufen, diverse Mobilitätsmerkmale).
Die Ergebnisse für diese Outcome-Indikatoren lauteten:
• Die stationäre Liegezeit betrug in der ACE-Gruppe 6,7 Tage. In der Kontrollgruppe mit der üblichen Behandlung betrug sie 7,3 Tage. Der Unterschied ist statistisch signifikant. Pro hundert PatientInnen, die in der Untersuchungszeit nach dem ACE-Programm versorgt wurden, verringerte sich im Vergleich die Anzahl der Krankenhaustage um 58 Tage.
• Die Wiedereinweisungsrate nahm bei den ACE-PatientInnen nicht zu.
• Bei den funktionalen Fähigkeiten zum Zeitpunkt der Entlassung gab es in dieser Studie keine signifikanten Unterschiede zwischen den beiden Gruppen. In zwei anderen, im hier vorgestellten Aufsatz zitierten Studien gab es aber signifikant bessere Fähigkeiten für das tägliche Leben bei den ACE-Personen. Eine Erklärung wäre, dass nach den ersten Erfolgen des ACE-Konzepts auch die übliche Behandlung verbessert wurde und ähnlich positive Wirkungen hat.
• Den 9.477 US-Dollar, welche die Behandlung eines ACE-Patienten im Durchschnitt kostete, standen 10.451 US-Dollar für normal behandelte PatientInnen gegenüber - ein ebenfalls statistisch signifikanter Unterschied. Auf sämtliche stationär behandelte Medicare-Versicherte hochgerechnet beträgt die jährliche Ausgabenersparnis 6 Milliarden US-Dollar.
• Schließlich gab es auch Ergebnisse, die den intuitiven Erwartungen widersprachen: So hatten die TeilnehmnerInnen der ACE-Gruppe z.B. weniger Konsultationen mit Physiotherapeuten und auch seltener eine Entlassungsplanungsdokumentation. Eine Erklärung wäre, dass vieles, was in den genannten formalen Formen erwartet wird bereits informell in den multidisziplinären Teams bearbeitet und vermittelt wurde. Immerhin ist ja das Ziel, die PatientInnen darauf vorzubereiten, nach Hause entlassen werden zu können, eine integrale Komponente von ACE. Diese spezielle Vorbereitung ersetzt dann evtl. die normale Entlassungsplanung.
• Trotz der wiederholten Belege für den Nutzen des ACE-Konzepts weisen die AutorInnen auf mehrere potenziellen Implementationsbarrieren hin, die es wahrscheinlich nicht nur in den USA gibt: der Mangel an angemessenen Vergütungsformen, der Mangel an geeignetem geriatrisch qualifizierten Personal, das Risiko für eine Unterauslastung der ACE-Betten, die nicht für andere Patienten genutzt werden können.
Zu dem möglichen Hinweis, es handle sich doch um eine relativ alte Studie mit möglicherweise völlig veralteten Ergebnissen, merken die AutorInnen an: "We believe that in all likelihood, the findings are even more relevant today for several reasons."
Von dem im Juni 2012 in der Zeitschrift "Health Affairs" (31, no.6 :1227-1236) veröffentlichten Aufsatz "Acute Care For Elders Units Produced Shorter Hospital Stays At Lower Cost While Maintaining Patients' Functional Status" von Deborah E. Barnes, Robert M. Palmer, Denise M. Kresevic et al. gibt es kostenlos ein knappes Abstract.
Bernard Braun, 21.10.12
65+-PatientInnen in Krankenhäusern haben ein höheres Risiko für unerwünschte Ereignisse als Jüngere. Gegenmaßnahmen möglich!
 Auch wenn das öffentliche Bewusstsein, dass es in Krankenhäuser auch zu unerwünschten gesundheitlichen Ereignissen kommen kann, vor allem durch diverse Hygieneskandale oder fragwürdige Umstände von Organverpflanzungen stimuliert wird, zeigen systematische Untersuchungen, dass ihr Auftreten keine Seltenheit ist oder es nur um "schwarze Schafe" geht.
Auch wenn das öffentliche Bewusstsein, dass es in Krankenhäuser auch zu unerwünschten gesundheitlichen Ereignissen kommen kann, vor allem durch diverse Hygieneskandale oder fragwürdige Umstände von Organverpflanzungen stimuliert wird, zeigen systematische Untersuchungen, dass ihr Auftreten keine Seltenheit ist oder es nur um "schwarze Schafe" geht.
In den Niederlanden hat eine retrospektive Analyse von medizinischen Behandlungsdaten als nationale Inzidenzrate für unerwünschte Ereignisse bei KrankenhauspatientInnen einen Anteil von 5,7% aller Krankenhausfälle ermittelt. 40% dieser Ereignisse wurden als vermeidbar bewertet und 12,8% der Ereignisse endeten bei permanenter Behinderung oder Tod.
Da der Anteil älterer PatientInnen unter den KrankenhauspatientInnen bereits jetzt relativ hoch ist und weiter wachsen wird, stellten sich holländische Wissenschaftler die Frage, ob diese PatientInnengruppe besonders häufig von unerwünschten gesundheitlichen Ereignissen betroffen ist.
Eine für die niederländischen Krankenhäuser repräsentative Studie und fachliche Bewertung von 7.917 Patienten-Behandlungsakten bzw. -dateien aus 21 Kliniken im Jahr 2004, bestätigten ein signifikant höheres Risiko älterer KrankenhauspatientInnen.
Im Einzelnen sahen die Ergebnisse so aus:
• Unerwünschte Ereignisse und vermeidbare unerwünschte Ergebnissen traten bei 6,9% bzw. 2,9% aller 65-jährigen und älteren PatientInnen auf. Bei jüngeren PatientInnen (jünger als 65 Jahre) betrugen die Anteile 4,8% bzw. 1,8%.
• Bei älteren PatientInnen traten bei 20,1% unerwünschte Ereignisse bei der Verordnung und Einnahme von Arzneimitteln auf. Der Anteil dieser Art von Ereignissen lag bei den Jüngeren erneut signifikant niedriger, nämlich bei 9,6%.
• Als Hauptursache für die unerwünschten Ereignisse identifizierten die WissenschaftlerInnen die Unfähigkeit von Ärzten und/oder Pflegekräften vorhandenes Wissen in neuen und komplexen Situationen anzuwenden. Dies war bei 36,4% der Ereignisse der Älteren und bei 24,3%, und damit wieder signifikant selteneren Ereignissen der Jüngeren der Fall.
Um das für Ältere im Krankenhaus deutlich höhere Risiko gesundheitlich geschädigt zu werden zu reduzieren, schlagen die AutorInnen u.a. ein spezifisches Training vor mit dem die Wissens- und Handlungslücken für die Behandlung älterer PatientInnen geschlossen werden können. Zusätzlich könnte der Aufbau und standardmäßige Einsatz von multidisziplinären Teams von Geriatern und spezialisierten Pflegekräften für die Behandlung älterer KlinikpatientInnen zu einer deutlichen Verbesserung der Behandlung und auch zu weniger unerwünschten Ereignisse führen.
Von dem am 19. Oktober 2012 veröffentlichten Aufsatz "Scale, nature, preventability and causes of adverse events in hospitalised older patients" von H. Merten et al. - erschienen in der Fachzeitschrift "Age and Ageing 2012; 0: 1-6" - ist kostenlos ein Abstract erhältlich.
Bernard Braun, 20.10.12
Erhebliche Unterschiede der postoperativen Sterberate in Europa. Deutschland wie gewohnt im Mittelfeld
 Der Anteil der Patienten, die nach einer nichtkardiologischen Operation im Krankenhaus vor ihrer Entlassung verstarben, wurde bisher in Europa deutlich unterschätzt. Statt der in verschiedenen Studien genannten oder angenommenen 1,3% bis maximal 2% sind es in einer europaweiten so genannten 7-Tage-Kohortenstudie rund 4%. Die Datenbasis stammt von den im Zeitraum zwischen dem 4. und 11. April 2011 in 498 Krankenhäusern in 28 europäischen Staaten operierten und maximal 60 Tage lang beobachteten über 16-jährigen PatientInnen. Neben dem primären Endpunkt der Sterblichkeit untersuchte die internationale Wissenschaftlergruppe als sekundäre Endpunkte noch die Dauer des Krankenhausaufenthalts und die Verlegung in eine Intensivstation.
Der Anteil der Patienten, die nach einer nichtkardiologischen Operation im Krankenhaus vor ihrer Entlassung verstarben, wurde bisher in Europa deutlich unterschätzt. Statt der in verschiedenen Studien genannten oder angenommenen 1,3% bis maximal 2% sind es in einer europaweiten so genannten 7-Tage-Kohortenstudie rund 4%. Die Datenbasis stammt von den im Zeitraum zwischen dem 4. und 11. April 2011 in 498 Krankenhäusern in 28 europäischen Staaten operierten und maximal 60 Tage lang beobachteten über 16-jährigen PatientInnen. Neben dem primären Endpunkt der Sterblichkeit untersuchte die internationale Wissenschaftlergruppe als sekundäre Endpunkte noch die Dauer des Krankenhausaufenthalts und die Verlegung in eine Intensivstation.
Von den 46.539 PatientInnen in der 7-Tage-Kohorte verstarben 1.855 oder 4% noch im Krankenhaus, 3.599 oder 8% wurden nach der Operation noch auf einer Intensivstation durchschnittlich 1 bis 2 Tage behandelt. 73% der PatientInnen, die verstarben, waren nicht in eine Intensivstation verlegt worden.
Unerwartet waren die enormen Länderunterschiede bei der rohen Sterberate ("crude mortality rate"): Während in Island nur 1,2% aller nicht am Herzen operierten PatientInnen vor ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus starben, stieg dieser Anteil auf 21,5% in Lettland. In Deutschland lag der Wert bei 2,5% und damit etwas über dem in der Schweiz (2%) und etwas unter den 3,6% in Großbritannien.
Die Länderunterschiede bleiben auch dann erhalten, wenn man den Einfluss möglicher Confounder durch eine Adjustierung verringert oder ausschließt: Verglichen mit dem Wert in Großbritannien war dann die Sterberate in Finnland mit 0,44 (p=0,06) am kleinsten und mit 6,92 (p=0,0004) in Polen am größten. Der Wert in Deutschland lag bei 0,85 (p=0,54).
Trotz einiger selbstkritischer Anmerkungen zur Repräsentativität der Krankenhausstichprobe ("1% of the estimated volume of surgery taking place worldwide") sind die AutorInnen der Studie der Ansicht, ihre Stichprobe "clearly describe a large cross-section of health care in Europe".
Nachdem sie mit ihren Ergebnissen belegen, dass es ein Potenzial für Bemühungen gibt, die postoperative Sterberate zu senken, fall ihre Bemerkungen dazu, wie man dies machen kann, relativ knapp aus: "The high mortality rate after surgery might be modified by changes in the organisation of care."
Vom in der Fachzeitschrift "The Lancet" (Volume 380, Issue 9847, Pages 1059 - 1065 am 22. September 2012 erschienenen Aufsatz " Mortality after surgery in Europe: a 7 day cohort study" von Rupert Pearse et al. gibt es kostenlos ein Abstract.
Bernard Braun, 12.10.12
Was wäre, wenn kommunale Krankenhäuser Weihnachtsmärkte wären? Schluss mit ihrer Privatisierung!?
 Es "steht…nicht im freien Ermessen einer Gemeinde, 'freie Selbstverwaltungsangelegenheiten' zu übernehmen oder sich auch jeder Zeit wieder dieser Aufgaben zu entledigen. Gehören Aufgaben zu den Angelegenheiten des örtlichen Wirkungskreises, so darf sich die Gemeinde im Interesse einer wirksamen Wahrnehmung dieses örtlichen Wirkungskreises, der ausschließlich der Gemeinde, letztlich zum Wohle der Gemeindeangehörigen, anvertraut ist, nicht ihrer gemeinwohlorientierten Handlungsspielräume begeben. Der Gemeinde steht es damit nicht grundsätzlich zu, sich ohne Weiteres der Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft zu entledigen. Anderenfalls hätten es die Gemeinden selbst in der Hand, den Inhalt der kommunalen Selbstverwaltung durch Abstoßen oder Nichtwahrnehmung ihrer ureigenen Aufgaben auszuhöhlen. Um ein Unterlaufen des ihr anvertrauten Aufgabenbereichs zu verhindern, muss sich die Gemeinde grundsätzlich zumindest Einwirkungs- und Steuerungsmöglichkeiten vorbehalten, wenn sie die Angelegenheiten des örtlichen Wirkungskreises anderen übertragen will. Sie kann sich damit nicht ihres genuinen Verantwortungsbereichs für die Wahrnehmung ihrer Angelegenheiten des örtlichen Wirkungskreises entziehen. Will sie Dritte bei der Verwaltung bestimmter Bereiche ihres eigenen Aufgabenbereichs einschalten, die gerade das Zusammenleben und das Zusammenwohnen der Menschen in der politischen Gemeinschaft betreffen, so muss sie ihren Einflussbereich über die Entscheidung etwa über die Zulassung im Grundsatz behalten. Der Gemeinde ist es verwehrt, gewissermaßen den Inhalt der Selbstverwaltungsaufgaben selbst zu beschneiden oder an Dritte abzugeben."
Es "steht…nicht im freien Ermessen einer Gemeinde, 'freie Selbstverwaltungsangelegenheiten' zu übernehmen oder sich auch jeder Zeit wieder dieser Aufgaben zu entledigen. Gehören Aufgaben zu den Angelegenheiten des örtlichen Wirkungskreises, so darf sich die Gemeinde im Interesse einer wirksamen Wahrnehmung dieses örtlichen Wirkungskreises, der ausschließlich der Gemeinde, letztlich zum Wohle der Gemeindeangehörigen, anvertraut ist, nicht ihrer gemeinwohlorientierten Handlungsspielräume begeben. Der Gemeinde steht es damit nicht grundsätzlich zu, sich ohne Weiteres der Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft zu entledigen. Anderenfalls hätten es die Gemeinden selbst in der Hand, den Inhalt der kommunalen Selbstverwaltung durch Abstoßen oder Nichtwahrnehmung ihrer ureigenen Aufgaben auszuhöhlen. Um ein Unterlaufen des ihr anvertrauten Aufgabenbereichs zu verhindern, muss sich die Gemeinde grundsätzlich zumindest Einwirkungs- und Steuerungsmöglichkeiten vorbehalten, wenn sie die Angelegenheiten des örtlichen Wirkungskreises anderen übertragen will. Sie kann sich damit nicht ihres genuinen Verantwortungsbereichs für die Wahrnehmung ihrer Angelegenheiten des örtlichen Wirkungskreises entziehen. Will sie Dritte bei der Verwaltung bestimmter Bereiche ihres eigenen Aufgabenbereichs einschalten, die gerade das Zusammenleben und das Zusammenwohnen der Menschen in der politischen Gemeinschaft betreffen, so muss sie ihren Einflussbereich über die Entscheidung etwa über die Zulassung im Grundsatz behalten. Der Gemeinde ist es verwehrt, gewissermaßen den Inhalt der Selbstverwaltungsaufgaben selbst zu beschneiden oder an Dritte abzugeben."
Wer glaubt, hier handle es sich um eine Passage aus dem neuesten kommunalpolitischen Grundsatzpapier der Gewerkschaft Ver.di irrt und darf ein zweites Mal raten.
"Aus der bundesverfassungsrechtlichen Garantie der kommunalen Selbstverwaltung folgt, dass sich eine Gemeinde im Interesse einer wirksamen Wahrnehmung der Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft nicht ihrer gemeinwohlorientierten Handlungsspielräume begeben darf. Eine materielle Privatisierung eines kulturell, sozial und traditionsmäßig bedeutsamen" Bereichs, "der bisher in alleiniger kommunaler Verantwortung betrieben wurde, widerspricht dem. Eine Gemeinde kann sich nicht ihrer hierfür bestehenden Aufgabenverantwortung entziehen. Ihr obliegt vielmehr auch die Sicherung und Wahrung ihres Aufgabenbereichs, um eine wirkungsvolle Selbstverwaltung und Wahrnehmung der Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft zu gewährleisten."
Wer immer noch an Ver.di oder eine kommunalpolitische Arbeitsgemeinschaft der Jungsozialisten in der SPD denkt, aber das Gefühl hat, das passe "irgendwie" nicht zu den in seiner Gemeinde laufenden Absichten ein bisher kommunales Krankenhaus an einen privaten Krankenhaus-Träger zu verkaufen oder zu verscherbeln, irrt erneut, aber goldrichtig.
Beide Zitate stammen aus einem Grundsatzurteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 27. Mai 2009. Und auch wenn es sich konkret um ein letztinstanzliches Urteil zur Privatisierung des lange Zeit in alleiniger kommunaler Verantwortung betriebenen Offenbacher Weihnachtsmarktes handelt, gehören natürlich Krankenhäuser ohne Zweifel zu den sozial bedeutsamen Bereichen einer Kommune.
Und wem dies zu spekulativ erscheint, kann sich durch den Kommentar der privaten Unternehmensberatung PricewaterhouseCoopers (PwC) eines besseren belehren lassen: "Diese Grundsatzentscheidung des Bundesverwaltungsgerichts könnte sich auch auf andere Angelegenheiten der kommunalen Selbstverwaltung auswirken. Das Urteil beschränkt die Privatisierungsmöglichkeiten einer Gemeinde zumindest auf kulturell, sozial und traditionsmäßig bedeutsame Aufgabenbereiche….Ferner ist nun das rechtliche Risiko deutlich gestiegen, dass private Dritte Privatisierungsentscheidungen einer Gemeinde gerichtlich angreifen und womöglich ganz verhindern."
Und wie viele "gerichtlichen Angriffe" auf Privatisierungen kommunaler Krankenhäuser oder Schwimmbäder gibt es seit 2009? Richtig geraten: keine (bekannt gewordenen).
Die "Entdeckung" dieses Urteils ist dem Geschäftsführer der Frankfurter Nicht-Regierungsorganisation medico international zu verdanken, der im medico Rundschreiben 03/2012 mit seinem Beitrag Bescherung im Gesundheitswesen darauf aufmerksam machte. Zu weiterer Verbreitung dieses Wissens trug nun der
Frankfurter Chirurg Bernd Hontschik bei, der neben seiner Praxis auch noch wöchentlich in der "Frankfurter Rundschau" engagierte und meist kluge Kommentare zur gesundheitspolitischen Situation in Deutschland verfasst und Herausgeber der im Suhrkamp-Verlag erscheinenden Buchreihe "Medizin Human" ist. Die Kommentare kann man entweder in der FR lesen oder sie sich regelmäßig kostenlos zumailen lassen (chirurg@hontschik.de).
Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts mit dem Aktenzeichen 8 C 10.08 kann komplett kostenlos heruntergeladen werden und ist auch außerhalb der zitierten Passagen für Nichtjuristen interessant und verständlich.
Und auch der PwC-Kommentar "Privatisierung öffentlicher Einrichtungen durch die Gemeinde" ist in Gänze auf der Website der wahrscheinlich auch gelegentlich mit Krankenhaus-Privatisierungen befassten Beratungsfirma kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 30.9.12
Macht nur konserviertes Fleisch krank - oder führt jede Art von Fleischkonsum zu höherer Sterblichkeit?
 Seit Längerem gibt es Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen dem Verzehr von Fleisch und dem Auftreten von koronarer Herzkrankheit (KHK), Schlaganfall und Diabetes mellitus (DM), was regelmäßig zu entsprechenden Ernährungsempfehlungen führt. Allerdings bestand bisher weitgehend Unklarheit, ob der Fleischkonsum insgesamt, der von rotem Fleisch oder der von haltbar gemachtem oder anderweitig verarbeitetem Fleisch pathogenetisch bedeutsam sind. Eine in Circulation, der Zeitschrift der American Heart Association (AHA - Amerikanische Herzvereinigung), erschienene Metaanalyse lieferte ein differenzierteres Bild von den Übeltätern: Demnach ist nur der Konsum von verarbeitetem Fleisch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit verbunden, an DM oder KHK zu leiden, nicht aber der Verzehr von "rotem Fleisch".
Seit Längerem gibt es Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen dem Verzehr von Fleisch und dem Auftreten von koronarer Herzkrankheit (KHK), Schlaganfall und Diabetes mellitus (DM), was regelmäßig zu entsprechenden Ernährungsempfehlungen führt. Allerdings bestand bisher weitgehend Unklarheit, ob der Fleischkonsum insgesamt, der von rotem Fleisch oder der von haltbar gemachtem oder anderweitig verarbeitetem Fleisch pathogenetisch bedeutsam sind. Eine in Circulation, der Zeitschrift der American Heart Association (AHA - Amerikanische Herzvereinigung), erschienene Metaanalyse lieferte ein differenzierteres Bild von den Übeltätern: Demnach ist nur der Konsum von verarbeitetem Fleisch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit verbunden, an DM oder KHK zu leiden, nicht aber der Verzehr von "rotem Fleisch".
Das legte jedenfalls die umfassende Untersuchung belegbarer Zusammenhänge zwischen dem Auftreten von Erkrankungen der Koronar- und Hirngefäße sowie Zuckerkrankheit und dem Verzehr von unverarbeitetem rotem, von verarbeitetem sowie von Fleisch insgesamt nahe, die drei WissenschaftlerInnen aus Harvard Renata Micha, Sarah Wallace und Dariush Mozaffarian bereits 2009 in Circulation publizierten. "Rotes Fleisch" ist definiert als unverarbeitetes bzw. nicht konserviertes Rinder-, Lamm-, Schweine- oder Wildfleisch außer Geflügel, Fisch oder Eiern; als "verarbeitet" gelten geräuchertes, gepökeltes, gesalzenes oder chemisch konserviertes Fleisch wie Schinken, Salami, Würste, Hot Dogs sowie anderweitig verarbeitet Feinkost- oder Fertiggerichte. Der Gesamtverzehr von Fleisch erfasst den Konsum sowohl unverarbeiteten als auch verarbeiteten Fleisches außer Geflügel und Fisch.
Bei ihrer systematischen Suche und Metaanalyse fahndeten die WissenschaftlerInnen nach sämtlichen Kohorten-, Fall-Kontroll- oder randomisierten Studien, die dem Zusammenhang zwischen Fleischkonsum und den drei chronischen Krankheiten bei ansonsten gesunden Erwachsenen auf den Grund gingen. Von den an Hand ihrer Abstracts thematisch identifizierten 1598 Studien erfüllten gerade einmal 20 die Einschlusskriterien; bei 17 handelte es sich um prospektive Kohorten- und bei drei um Fall-Kontrollstudien. Summa summarum erfassten die 20 Studien 1.218.380 Personen, von denen 23.889 an KHK und 10.797 an Diabetes mellitus erkrankt waren und 2.280 einen Schlaganfall erlitten.
Nach den Ergebnissen dieser Metaanalyse der WissenschaftlerInnen aus Harvard hat der Verzehr von rotem Fleisch weder einen erkennbaren Einfluss auf das Auftreten von KHK (die vier ausgewerteten Studien zeigten ein relatives Gesamtrisiko pro 100-Gramm Tageskonsum von 1.00; 95% Konfidenzinterval 0,81 bis 1,23; Heterogenitätswahrscheinlichkeit P = 0,36) und DM (insgesamt 5 Studien, relatives Risiko 1,16; 95% Konfidenzinterval, 0,92 biso 1,46; P = 0,25). Bei verarbeitetem Fleisch waren hingegen bereits bei vergleichsweise geringer Steigerung der täglich verzehrten Menge um 50 Gramm ein 42 Prozent höheres Risiko für eine KHK (n = 5, relatives Risiko pro 50-Gramm Tagesverzehr 1,42; 95% Konfidenzinterval 1,07 bis 1,89; P = 0,04). Lässt man eine große US-Studie mit mehr als einer halben Million TeilnehmerInnen außer Acht, deren Endpunkt nur die koronare Sterblichkeit, nicht aber das Auftreten von KHK insgesamt war, zeigte sich ein noch drastischeres Ergebnis: Der Verzehr von verarbeitetem Fleisch führt nahezu zu einer Verdoppelung des Risikos krankhafter Veränderungen der Koronarien RR = 1,90; 95% KI, 1,00 - 3,62. Jene US-Studie der AutorInnen Rashmi Sinha, Amanda Cross, Barry Graubard, Michael Leitzmann und Arthur Schatzkin erschien bereits 2009 unter dem Titel Meat intake and mortality: a prospective study of over half a million people in den Archives of Internal Medicine 169 (6), Seiten 562-571 war zu dem Ergebnis gekommen, der Verzehr von rotem und verarbeitetem Fleisch führe zu einem geringen Anstieg sowohl der Gesamt- als auch der Tumor-bedingten und kardiovaskulären Mortalität.
Bei DM ergab sich bei Sichtung aller einbezogenen Studien in Abhängigkeit vom Tagesverzehr an verarbeitetem Fleisch ein insgesamt um 19 Prozent erhöhtes Erkrankungsrisiko (n = 7; relatives Risiko 1,19; 95% Konfidenzinterval, 1,11 - 1,27; P = 0,001). Bemerkenswerterweise zeigten US-Studien allein sogar eine über 50-prozentige Risikosteigerung für das Auftreten eines DM (RR = 1,53; 95% KI, 1,37 - 1,71). Drei Studien unterschieden sogar zwischen verschiedenen Arten von verarbeitetem bzw. konserviertem Fleisch. Demnach erhöht der Konsum von zwei Scheiben Schinken pro Tag das Diabetes-Risiko auf mehr als das Doppelte (RR = 2,07; 95% KI, 1,40 - 3,04), von einem Hotdog auf knapp das Doppelte (RR = 1,92; 95% KI, 1,33 - 2.78) und von anderen Formen verarbeiteten Fleisches pro Stück um zwei Drittel (RR = 1,66; 95% KI, 1,13 - 2,42).
Zusammenhänge zwischen dem Verzehr von rotem bzw. verarbeitetem Fleisch und dem Auftreten von Schlaganfällen ließen sich nicht erkennen; allerdings lagen nur drei Studien vor, die dieser Frage nachgingen. Eine Ursache könnte darin liegen, dass hier keine Unterscheidung zwischen verschiedenen Arten von Schlaganfällen erfolgte; denn die einzige Studie, die dem Zusammenhang zwischen Fleischkonsum und hämorrhagischem Schlaganfall nachging, zeigt eine deutlichere Korrelation und einen Risikoanstieg um zwei Drittel in Abhängigkeit vom Tagesverzehr (RR pro Tagesdosis 1,64; 95% KI, 0,75 - 3,60). Nicht klar ist dabei, ob es sich um Hirnblutungen aufgrund von Gefäßmissbildungen oder um solche bei arteriosklerotisch veränderten Gefäßen handelte (checken bei He et al., BMJ!). Hier fallen einem etliche potenzielle Confounder ein, die nicht nur mit sonstigen Ernährungsgewohnheiten wie beispielsweise dem in jener Studie primär untersuchten Fettkonsum zusammenhängen, sondern auch mit ursächlich relevanten Erkrankungen wie arteriellem Hypertonus beim Entstehen hämorrhagischer Schlaganfälle des höheren Lebensalters. Insofern wäre es auch sehr interessant zu wissen, ob Art und Menge des Fleischkonsums das Entstehen von Bluthochdruck beeinflusst.
Insgesamt ist zum einen die Heterogenität der analysierten Studien als Einschränkung zu berücksichtigen, die vergleichend-vereinheitlichende Ergebnisse in ihrer Aussagekraft verringern können. Zum anderen können die AutorInnen mögliche qualitative Unterscheide zwischen den einzelnen Produkten der verschiedenen Fleischarten überhaupt nicht erfassen, beispielsweise die Kombination mit Fetten unterschiedlicher Schädlichkeit, der Art der Konservierungsmethode und damit verbundener Noxen, und ähnliche Faktoren, die im Zuge einer zunehmenden Industrialisierung der Nahrungsmittelproduktion bevölkerungsbezogen auch quantitativ relevante Auswirkungen haben kann. Und ganz grundsätzlich ist anzumerken, dass das Ausmaß der Adjustierung nach Kovariaten in den ausgewerteten Studien erheblich variierte und insbesondere vielfach keine Kontrolle sonstiger Ernährungsgewohnheiten und Lebensbedingungen der Personen sowie vor allem von sozialen Einflussfaktoren erfolgte.
Die drei Autoren betonen in ihrer Schlussfolgerung zum einen die Notwendigkeit, die ursächlichen Zusammenhänge und mögliche pathogenetische Effekte besser zu verstehen. Zum anderen fordern sie dazu auf, bei Diät- und Politikempfehlungen stärkeres Augenmerk auf verarbeitetes als auf rotes Fleisch oder den Fleischkonsum insgesamt zu legen. Dem ist uneingeschränkt zuzustimmen, allerdings nur dann, wenn sich diese Empfehlungen nicht auf übliche Normierungsvorgaben für das Individuum im Sinne der "Gesund-Leben"-Ideologie beschränken, sondern auch gesellschaftlich relevante Fragen der kapitalistischen Gewinnmaximierungsideologie in der Nahrungsmittelindustrie und der Vermarktung ihrer Produkte aufwirft.
Zu einem anderen Ergebnis kommt eine kürzlich in den Archives of Internal Medicine veröffentlichte Studie einer Gruppe von AutorInnen aus Harvard und einer anderen Klinik in Boston, aus Ohio sowie vom Deutschen Institut für Ernährungsforschung. An Pan, Qi Sun, Adam Bernstein, Matthias Schulze, JoAnn Manson, Meir Stampfer, Walter Willett, und Frank publizierten Ende März 2012 in Arch Intern Med 172 (7), Seiten 555-563, ihre große Untersuchung unter dem Titel Red Meat Consumption and Mortality. Results From 2 Prospective Cohort Studies.
Der prospektiven Beobachtungsstudie mit 37.698 männlichen Teilnehmern aus der Health Professionals Follow-up Study (1986-2008) und 83.644 Frauen der Nurses' Health Study (1980-2008), die zum Zeitpunkt des Studienbeginns weder einen KHK noch eine maligne Erkrankung aufwiesen, liegen vierjährlich aktualisierte Bewertungen des Ernährungsverhaltens mit Hilfe von validierten Nahrungshäufigkeitserhebungen zu Grunde.
Während de Beobachtungszeitraums mit 2,96 Millionen Personenjahren verstarben insgesamt 23.926 Personen aus dieser Kohorte, darunter 5.910 Todesfälle durch KHK und 9.464 afgrund bösartiger Neubildungen. Nach multivariater Adjustierung im Hinblick auf wichtige Lebensstil- und dietätische Risikofaktoren waren bei nicht behandeltem bzw. konserviertem Fleisch ein Anstieg des Gesamtsterblichkeitsrisikos pro täglichem Verzehr um 13 % [Hazard Ratio 1,13, Streuung 1,07 - 1,20] und bei verarbeitetem Fleisch sogar im ein Fünftel [HR (95 % KI) 1,20 (1,15 - 1,24)]. Bei der isolierten Betrachtung der KHK-bedingten Todesfälle belief sich der Anstieg der Sterblichkeitswahrscheinlichkeit bei unbehandeltem Fleisch auf 18 % [HR 1,18 (1,13 - 1,23] und bei konserviertem oder anderweitig verarbeiteten Fleisch bei 21 % [HR 1,21 (1,13 - 1,31)], während der Zusammenhang bei tumorbedingter Sterblichkeit mit einem nur 10- [HR 1,10 (1,06 - 1,14)] bzw. 16-prozentigen Anstieg der fleischkonsumassoziierten Sterblichkeit [HR 1.16 (1,09 - 1,23)] deutlich geringer ausfiel.
Die WissenschaftlerInnen aus den USA und Deutschland führten multivariate Analysien durch und kontrollierten ihre Ergebnisse dabei simultan nach einer Vielzahl von anderen relevanten Einflussfaktoren: Gesamtkalorienaufnahme, Verzehr von Vollkornprodukten, Obst und Gemüse sowie von anderen wichtigen Nahrungsvariablen wie dem Konsum von Fisch, Geflügel, Nüssen, Milchprodukten und verschiedenen Nahrungsbestandteilen wie Zucker, Balaststoffen, Magnesium und mehrfach ungesättigten bzw. Transfettsäuren. Zudem adkustierten sie nach anderen nicht-dietätischen potentiellen Confoundern, für die an Hand von zwei- bis vierjährigen Befragungsrunden aktualisierte Daten vorlagen. Zu diesen Variablen gehörten Alter, Body-Mass-Index, ethnische Zugehörigkeit, Raucherverhalten, Alkoholkonsum, physische Aktivität, Einnahme von Multivitaminpräparaten und Aspirin, familiäre Vorgeschichte von DM, Herzinfarkt oder Krebs sowie bestehender DM, Hypertonus oder Fettstoffwechselstörung bei Aufnahme in die Beobachtungsstudie. Bei Frauen erfolgte zusätzlich eine Adjustierung nach postmenopausalem Zustand und Hormonbehandlung.
Nach Schätzung der AutorInnen würde der Ersatz einer täglichen Verzehrdosis an rotem Fleisch durch andere Nahrungsmittel wie Fisch, Geflügel, Nüsse, Gemüse, fettarme Milchprodukte und Vollkornprodukte das Sterblichkeitsrisiko um 7 - 19 % senken. Gleichermaßen schätzen sie, dass in dieser Kohorte bis zum Ende des Beobachtungszeitraums 9,3 % der Todesfälle bei Männern und 7,6 % bei Frauen vermeidbar wären, wenn alle Beteiligten weniger als eine halbe tägliche Verzehrdosis - ungefähr 42 g - rotes Fleisch zu sich genommen hätten. Insgesamt kommen sie zu dem Schluss, dass der Verzehr von rotem Fleisch mit einer erhöhten Gesamt- sowie koronarer und tumorbedingter Sterblichkeit führt. Der Ersatz roten Fleisches durch andere gesunde Proteinquellen zu ersetzen scheint demnach mit einer geringeren Sterblichkeit assoziiert zu sein.
Den älteren, durch lesenswerten und datenreichen Artikel von Red and Processed Meat Consumption and Risk of Incident Coronary Heart Disease, Stroke, and Diabetes Mellitus von Renata Micha, Sarah Wallace und Dariush Mozaffarian in Circulation 121 (21), S. 2271-2283, können Sie hier in ganzer Länge herunterladen; zusätzlich stehen die gesamten Rohdaten dieser Metaanalyse zum Download zur Verfügung.
Auch den Artikel Red Meat Consumption and Mortality. Results From 2 Prospective Cohort Studies von An Pan, Qi Sun, Adam Bernstein, Matthias Schulze, JoAnn Manson, Meir Stampfer, Walter Willett und Frank Hu stellen die Archives of Internal Medicine [172 (7): 555-563. DOI:10.1001/archinternmed.2011.2287] kostenfrei zum Download zur Verfügung.
Jens Holst, 6.7.12
"Pay for performance" auch nach 6 Jahren ohne positive Wirkung auf das Ergebnis "30-Tagesterblichkeit" in US-Kliniken
 Eines der jüngsten Patentrezepte in der langen Reihe von Honorierungskonzepten für eine bessere Gesundheitsversorgungsqualität ist "pay for performance" oder P4P.
Eines der jüngsten Patentrezepte in der langen Reihe von Honorierungskonzepten für eine bessere Gesundheitsversorgungsqualität ist "pay for performance" oder P4P.
Dass Ärzte und Krankenhäuser, die ihre Einnahmen im Rahmen solcher Programme erhöhen können, mit dieser Art der Verknüpfung des Erreichens definierter Qualitätsziele mit der Honorierung zufrieden sind, ist einleuchtend. Und ebenfalls, dass sich Patienten in einem Krankenhaus wohler fühlen, in dem sie möglicherweise (das hängt von vereinbarten Zielwerten ab) mehr nach ihrer Zufriedenheit gefragt werden und auch überhaupt oder intensiver auf die künftige Behandlung vorbereitet werden.
Frühere Studien in den USA oder in Großbritannien über die auch im Forum-Gesundheitspolitik berichtet wurde, hatten aber bereits deutlich auf kräftige Abweichungen der Wirklichkeit von den wunderbaren Erwartungen hingewiesen. So verbesserten z.B. meist nur Krankenhäuser ihre Behandlungsqualität, die bereits gut waren, während sich schlechtere Krankenhäuser entweder gar nicht an P4P-Programmen beteiligten oder dort nur wenig Qualitätsverbesserungen vorzuweisen hatten. Andere Studien wiesen auf die Indikationsspezifik der Wirkungen hin. Je nachdem um welche Erkrankung es sicher handelte gab es Verbesserungen aber auch Verschlechterungen der Qualität.
Eine nicht nur bei der Bewertung von P4P vernachlässigte Frage war, ob sich diese Honorierungsform auf die Ergebnisqualität der Behandlung auswirkt oder "nur" auf die Struktur- oder Prozessqualität. In diesem Zusammenhang taucht auch immer wieder die Frage auf, ob die Qualitätsverbesserungen erst nach längerer Einwirkzeit eintreten und ob sie dauerhaft sind.
Die Ende März 2012 im "New England Journal of Medicine (NEJM)" veröffentlichten Ergebnisse einer den Zeitraum 2003 bis 2009 umfassenden Studie, liefern dazu erste Antworten. In dieser derzeit umfassendsten P4P-Studie wird untersucht, ob sich der harte Ergebnisqualitätsindikator der 30-Tagesterblichkeit nach einer Entlassung aus dem Krankenhaus von rund 6 Millionen wegen eines akuten Herzinfarkts, einer Lungenentzündung, einer By pass-Operation oder einer Herzinsuffienz behandelten PatientInnen in 252 an dem Medicare-P4P-Programm "Premier Hospital Quality Incentive Demonstration (HQID)" von dem in 3.363 normalen Krankenhäusern unterscheidet.
Die mit einem erheblichen methodischen Aufwand analysierten Daten ergaben folgendes Bild:
• Die 30-Tage-Mortalität in den HQID-Krankenhäusern (12,33%) unterschied sich zu Beginn der Untersuchung gegenüber der in den Nicht-HQID-Kliniken (12,40%) nicht.
• An dieser Ähnlichkeit hat sich auch nach sechs Jahren Programmintervention nichts geändert (11,82% versus 11,74%). Es gab zwar leichte Verbesserungen, die aber in beiden Gruppen ähnlich ausfielen. Ein spezieller Effekt des P4P-Programms war nichts zu erkennen.
• Ein Vergleich der diagnosespezifischen Sterblichkeit bei Erkrankungen für deren Behandlung es P4P-Anreize gab mit anderen Erkrankungen, wo es solche Anreize nicht gab, lieferte ebenfalls keinen Beleg für eine besondere Wirkung dieser Anreize.
• In den Krankenhäusern mit schlechterer Start-Ergebnisqualität (15,12% versus 14,73%) gab es zwar während der Untersuchungszeit zwar Verbesserungen (13,37% versus 13,21%). Aber auch hier lässt sich kein spezifischer Effekt von P4P erkennen.
Erwartungen an Programme wie HQID, die Ergebnisqualität zu verbessern, sollten nach Meinung der WissenschaftlerInnen "remain modest". Der Aufsatz kommt aber auch bei Verbesserungen der Behandlungsprozessqualität auf der Basis entsprechender Literatur zu dem Ergebnis, dort gäbe es lediglich "modest improvements".
Was diese Ergebnisse für die in den USA geplante flächendeckende Übernahme des P4P-Systems bedeuten, ist offen. Wer in Deutschland aber mit dem Gedanken spielt das "US-Erfolgsmodell" zu übernehmen und damit das Nachdenken über andere Anreize einzustellen, sollte sich diese und ähnliche Studien genau anschauen und nicht erst 6 oder 9 Jahre warten, um u.U. ähnliche Ergebnisse gewonnen zu haben - wenn überhaupt Wirkungsforschung stattfindet.
Der Aufsatz "The Long-Term Effect of Premier Pay for Performance on Patient Outcomes" von Ashish K. Jha, Karen E. Joynt, E. John Orav und Arnold M. Epstein ist am 29. März 2012 im New England Journal of Medicine" (2012; 366: 1606-15) erschienen und in Gänze kostenlos erhältlich.
Auch der Kommentar Making the Best of Hospital Pay for Performance von Andrew Ryan und Jan Blustein (N Engl J Med 2012; 366: 1557-155) ist frei erhältlich.
Bernard Braun, 13.5.12
USA: Öffentliche Berichte über Mortalitätsrisiken in Krankenhäusern wirken sich nicht oder nur mäßig auf Risikoentwicklung aus.
 Öffentliche Berichte über wichtige Maße der Qualität der Krankheitsbehandlung in Krankenhäusern oder Arztpraxen üben durch das Abwandern von Patienten oder auch indirekt so viel Druck auf die Anbieter aus, bei denen das Sterbe- oder Komplikationsrisiko vergleichsweise hoch ist, dass die Risiken deutlich sinken - so weit die Theorie vom Patienten als "König Kunde" und der "Macht von Daten".
Öffentliche Berichte über wichtige Maße der Qualität der Krankheitsbehandlung in Krankenhäusern oder Arztpraxen üben durch das Abwandern von Patienten oder auch indirekt so viel Druck auf die Anbieter aus, bei denen das Sterbe- oder Komplikationsrisiko vergleichsweise hoch ist, dass die Risiken deutlich sinken - so weit die Theorie vom Patienten als "König Kunde" und der "Macht von Daten".
In den USA begann die staatliche Krankenversicherung Medicare im Jahre 2005 mit der Veröffentlichung einer Vielzahl von Qualitätsindikatoren für die meisten Akutkrankenhäuser in den USA. Ob dieses Programm, "Hospital Compare", wirklich den erwarteten Nutzen hatte, war lange unbekannt. Eine Gruppe von Gesundheitswissenschaftlern und Medizinern beendete diesen Zustand und untersuchte mit Routinedaten von Medicare für die Jahre 2000 bis 2008 die Veränderungen der 30-Tagesmortalität für die drei Indikationen Herzinfarkt, Herzinsuffizienz/-versagen und Lungenentzündung.
Der mögliche Vergleich der Sterblichkeitstrends vor und nach der Veröffentlichung der krankenhausspezifischen Sterblichkeitsrisiken erbrachte für diese Indikationen folgende Ergebnisse:
• Die Berichterstattung beeinflusste das Risiko an einem Herzinfarkt oder einer Lungenentzündung innerhalb der 30 Tage nach der Krankenhausentlassung zu sterben nicht zusätzlich zu den unabhängig von der Publikationsintervention oder bereits vor ihr ablaufenden Trends.
• Die Sterblichkeit wegen Herzversagens wurde dagegen durch die Berichterstattung mäßig reduziert.
• Ein Nebenergebnis der Studie zeigt für die untersuchte Zeit und die USA, dass die Veröffentlichung der Qualitätsindikatoren zu keiner erkennbaren Veränderung der Patientenströme führte, also keine nennenswerte Anzahl von PatientInnen durch die "Hospital Compare"-Qualitätsindikatoren ein qualitativ höherwertiges Krankenhaus ausgewählt hat.
Warum dies so war und ist, kann mit den Daten nicht erklärt werden, sollte aber ein Kernanliegen aller Ersteller und Vertreiber solcher Vergleiche sein - egal ob sie Medicare, "Weiße Liste" oder Krankenhaus-Navigator heißen. Den Autoren ist zuzustimmen, dass diese Ergebnisse nicht als Begründung für die Beendigung der Berichterstattung mit Mortalitätsindikatoren dienen sollten. Und sie bedeuten auch nicht, dass es in dem einen oder anderen Fall nicht doch zu den erwarteten Wirkungen kommen wird.
In Deutschland wäre es sogar wünschenswert, dass Mortalitäts-Qualitätsindikatoren endlich für jedes Krankenhaus existierten und veröffentlicht werden. Nur die allein auf solche Indikatoren begründeten gewaltigen Hoffnungen auf spürbare Effekte in den Krankenhäusern und bei den PatientInnen müssen wohl reduziert und über andere Steuerungsmöglichkeiten für beide nachgedacht werden.
Der Aufsatz " Medicare's Public Reporting Initiative On Hospital Quality Had Modest Or No Impact On Mortality From Three Key Conditions" von Andrew M. Ryan, Brahmajee K. Nallamothu und Justin B. Dimick ist in der Märzausgabe 2012 der Public Health-Fachzeitschrift "Health Affairs" (31, no.3 (2012): 585-592) erschienen. Leider ist nur das Abstract kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 21.3.12
Nicht nur in Holland: Mindestmengenanforderungen können Anreiz sein, mehr Operationen zu berichten als tatsächlich gemacht wurden.
 Berichten kleine Krankenhäuser mehr Totaloperationen von Speiseröhren als sie tatsächlich entfernten, wenn die öffentliche Berichterstattung über eine Mindestanzahl von Operationen ein Qualitätsindikator ist? Ja und zwar passiert dies in 7 oder 70% der 10 niederländischen Krankenhäuser deren Meldungen von einer Forschergruppe retrospektiv für die Jahre 2005 und 2006 mit der in Operationsberichten dokumentierten Anzahl dieser Operationen verglichen wurden.
Berichten kleine Krankenhäuser mehr Totaloperationen von Speiseröhren als sie tatsächlich entfernten, wenn die öffentliche Berichterstattung über eine Mindestanzahl von Operationen ein Qualitätsindikator ist? Ja und zwar passiert dies in 7 oder 70% der 10 niederländischen Krankenhäuser deren Meldungen von einer Forschergruppe retrospektiv für die Jahre 2005 und 2006 mit der in Operationsberichten dokumentierten Anzahl dieser Operationen verglichen wurden.
Zum Hintergrund: Jedes Jahr wird in den Niederlanden bei rund 1.500 Personen ein Speiseröhrenkrebs diagnostiziert. Von ihnen erhalten ungefähr 600 die Speiseröhre entfernt. 2005 erschien die multidisziplinäre Leitlinie "Diagnosis and treatment of oesophageal carcinoma" mit einer klaren Mindestmengenempfehlung. Die Operation sollte danach nur in Krankenhäuser stattfinden, die jährlich wenigstens 10 bis 20 solcher Operationen durchführen. Die holländischen Qualitätskontrolleure forderten daher alle 14 Kliniken, die in den Jahren 2003 bis 2005 jährlich weniger als 10 Operationen durchgeführt hatten auf, entweder solche Operationen nicht mehr durchzuführen oder z.B. durch die Kooperation mit anderen Kliniken das Mindestmengenziel zu erreichen oder zu übertreffen. Die Inspektoren befürchteten schon damals, dass dies für einige Krankenhäuser der Anreiz sein könnte, ihre Operationszahlen zu erhöhen bzw. der Leitlinienanforderung anzupassen. Der unmittelbare quantitative Effekt einer Erhöhung der durchschnittlichen Anzahl von 602 solcher Operationen zwischen 2003 und 2005 auf den Wert von 652 im Jahr 2006 schien diese Befürchtung zu bestätigen.
In der Studie wurden jetzt für den Zeitraum 2003 bis 2006 alle Berichte über die Behandlung der an Speiseröhrenkrebs erkrankten PatientInnen in kleinen Krankenhäusern mit der gemeldeten und auch meistens auf der Website der Kliniken veröffentlichten Anzahl von Speiseröhrenentfernungen verglichen.
Sieht man von einer Reihe zögerlicher Lieferung der anonymisierten OP-Berichte und anderen administrativen Hindernissen ab, ergeben sich im Einzelnen folgende Resultate:
• 2005, d.h. im letzten Jahr ohne Mindestmengenanforderung, berichteten die 10 kleinen Kliniken 82 Speiseröhrenentfernungen. Fünf von diesen "Melde-OPs" erfolgten in Wirklichkeit nicht. Der Unterschied zwischen berichteten und durchgeführten Operationen war so klein, dass der Unterschied statistisch nicht signifikant war (p=0,38).
• 2006, also im ersten Jahr, in dem die dargestellten Anforderungen an eine Mindestmenge galten, berichteten die 10 Krankenhäuser 115 Speiseröhren-OPs. Bei 7 von ihnen oder 70% wurden insgesamt 26 Operationen berichtet, die tatsächlich nicht durchgeführt wurden. Trotz der sehr kleinen Zahlen war der Unterschied zwischen den berichteten und durchgeführten Operationen statistisch signifikant (p=0,01).
• Die drei Krankenhäuser, deren berichtete Operationen mit der Anzahl der durchgeführten voll übereinstimmten, waren Kliniken, die 2006 10 und mehr Entfernungen durchführten.
Die holländischen ForscherInnen gehen davon aus, dass es für die beobachteten Differenzen keine anderen Ursachen als die Anreize der veröffentlichten Mindestmengen-Qualitätsindikatoren gibt. Um daran etwas zu verändern, schlagen sie unter den Bedingungen der Notwendigkeit hohe Zahlen veröffentlichen zu müssen ("need to score") entweder eine stärkere Zentralisierung derartiger Operationen in spezialisierten Krankenhäusern oder eine strenge(re) externe Kontrolle vor.
Der Aufsatz "Does public disclosure of quality indicators influence hospitals' inclination to enhance results?" von Kris H.A. Smolders et al. ist am 7. Februar 2012 online in der Zeitschrift "International Journal for Quality in Health Care" (24 (2): 129-134) erschienen. Ein Abstract ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 8.3.12
Prognosen über die künftigen Krankenhausfallzahlen müssen den Alterungseffekt, die Risikoerhöhung und -verminderung beachten
 Zum Standardrepertoire der Debatte über die Folgen der demographischen Alterung gehört die drohende Zunahme der Anzahl chronischer Krankheiten und deren Schwere und die damit verbundenen Belastungen der Kapazitäten und Finanzen des Gesundheitssystems. Am stärksten wird u.a. wegen der Schwere der Erkrankungen die stationäre Versorgung unter Druck geraten - so der Mainstream der Prognosen.
Zum Standardrepertoire der Debatte über die Folgen der demographischen Alterung gehört die drohende Zunahme der Anzahl chronischer Krankheiten und deren Schwere und die damit verbundenen Belastungen der Kapazitäten und Finanzen des Gesundheitssystems. Am stärksten wird u.a. wegen der Schwere der Erkrankungen die stationäre Versorgung unter Druck geraten - so der Mainstream der Prognosen.
Deutlich anders und vor allem differenzierter sieht dies eine aktuelle Analyse der Krankenhausdiagnosestatistik des Statistischen Bundesamt für die drei heute und künftig relevanten Diagnosehauptgruppen bösartige Neubildungen, Herz-Kreislauferkrankungen und Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes sowie nein Diagnosegruppen.
Der Autor, Epidemiologe am Robert-Koch-Institut, berücksichtigt und untersucht dabei nicht nur den alterungsbedingten Anstieg der Krankenhausfallzahlen, sondern auch die Veränderung des Risikos wegen bestimmter Erkrankungen überhaupt im Krankenhaus behandelt werden zu müssen, also die Chance der Abnahme von Krankenhausfällen wegen sinkenden Risiken.
Die Kernergebnisse der differenzierten Analysen sehen so aus:
• "Die demografische Alterung hat im Zeitraum von 2000 bis 2009 zu einem Anstieg der Fallzahlen in der stationären Versorgung von 6 % geführt.
• Die Wirkung der Alterung auf die Behandlungszahlen wird je nach Diagnosegruppe vom sich verändernden Risiko, mit einer bestimmten Diagnose in einem Krankenhaus behandelt zu werden, verstärkt, abgemildert respektive kompensiert. Für die Diagnosen Herzinsuffizienz sowie Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens beispielsweise addieren sich Effekte der Alterung und der Risikosteigerung zu einer jeweiligen Steigerung der Behandlungszahlen von 40 % und mehr."
• Die Risikoverringerung bei Lungenkrebs und Prostatakarzinom reichen nicht aus, um die Effekte der Alterung zu kompensieren. Dies führt zu einem leichten Anstieg der Behandlungsfallzahlen.
• Bei ischämischen Herzerkrankungen, zerebrovaskulären Krankheiten (z.B. Schlaganfall), Darmkrebs und Brustkrebs sinkt das Risiko so stark, dass die Alterungseffekte deutlich überkompensiert werden und die im Krankenhaus erwartbaren Fallzahlen um bis zu 41% zurück gehen.
Um auch fürderhin realistischere Prognosen der künftigen Entwicklung zu erhalten, d.h. nicht nur alterungsbedingte "worst case"-Szenarien mit Selbstlähmungspotenzial, müssen künftig sowohl Alterungseffekte wie Veränderungen der Erkrankungs- und Behandlungsrisiken beachtet werden. Und beide Effekte müssen weiter nach Altersgruppen, Diagnosen und zeitlichem Auftreten unterschieden werden. So trivial das klingen mag: Nicht alle Personen, die das 65. Lebensjahr hinter sich haben, erkranken sofort und mit gleich hoher Intensität an allen chronischen Krankheiten.
Unbenommen davon gilt auch weiterhin die Warnung vor zu einseitig pessimistischen Prognosen der Alterungseffekte und der Hinweis auf die seit Jahren zunehmend gesünder werdende ältere Bevölkerung.
Der Aufsatz "Demografische Alterung und stationäre Versorgung chronischer Krankheiten" von Enno Nowossadeck ist im "Deutschen Ärzteblatt" vom 2. März 2012 (109(9): 151-7) erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 5.3.12
Was sollten Hygieniker/Politiker bei einem Infektions-"Ausbruch" sein lassen oder "C'est les microbes qui auront le dernier mot"?
 Man muss die These von Louis Pasteur nicht völlig teilen, um daraus Lehren für den aktuellen Umgang mit Infektionen ziehen zu können. Der mit dem "Ausbruch" gefährlicher oder sogar tödlicher Infektionen häufig verbundene Versuch, den beruhigend gemeinten Eindruck zu erwecken, man könne solche Risiken durch das prinzipiell mögliche Entdecken der Erregerquelle und dem dann möglichen Einsatz geeigneter, meist technisch-hygienischer Mittel prinzipiell verhindern, ist zu einem gewissen Teil symbolischer politischer Aktionismus.
Man muss die These von Louis Pasteur nicht völlig teilen, um daraus Lehren für den aktuellen Umgang mit Infektionen ziehen zu können. Der mit dem "Ausbruch" gefährlicher oder sogar tödlicher Infektionen häufig verbundene Versuch, den beruhigend gemeinten Eindruck zu erwecken, man könne solche Risiken durch das prinzipiell mögliche Entdecken der Erregerquelle und dem dann möglichen Einsatz geeigneter, meist technisch-hygienischer Mittel prinzipiell verhindern, ist zu einem gewissen Teil symbolischer politischer Aktionismus.
Das wäre sogar hinzunehmen, wenn damit nicht falsche Erwartungen geweckt oder falsche Sicherheiten versprochen würden. Dies ist jedenfalls das Ergebnis einer etwas gründlicheren Lektüre von Fachbeiträgen, die in der von deutschen Fachwissenschaftlern im Jahr 2001 gegründeten Online-Fachdatenbank "Outbreak" zugänglich sind. Die Datenbank enthält derzeit Berichte über 2.756 Infektions-"Ausbrüche", die zwischen 1956 und 2011 publiziert wurden. Damit liegen relativ differenzierte Informationen über 259 verschiedene Erreger vor. Ergänzt werden diese "Ausbruch"-Berichte durch wissenschaftliche Überblicksarbeiten über die Dynamik von Infektionserkrankungen und die Charakteristika einzelner Erreger.
Unter einem gesundheitsbezogenen "Ausbruch" versteht man das Auftreten von zwei oder mehr gleichartigen Erkrankungen, bei denen ein epidemiologischer Zusammenhang wahrscheinlich ist oder vermutet wird. Wie man am Auftreten und dem Umgang mit dem Auftreten von schweren, d.h. zum Teil lebensbedrohlichen Infektionserkrankungen wie EHEC oder der Verbreitung von teilweise multiresistenten Keimen in diversen "Frühchen-Stationen mehrerer bundesweiter Krankenhäuser sehen konnte, ist trotz dieser Definition für die zuständigen Gesundheitseinrichtungen nicht immer klar, ob es sich um Ausbrüche oder ganz normale, d.h. zunächst nicht dramatische und entsprechende Interventionen verlangende Erkrankungsfälle handelt. Dass die Nichtklassifikation als "Ausbruch" sehr praktische Folgen haben kann, konnte man Ende 2011 an der monatelangen Unterschätzung der von Darmkeiminfektionen in der neonatologischen Abteilung des Bremer Klinikums-Mitte ausgehenden Gefahren für die Frühgeborenen beobachten.
Mit dem Ausbruch von Krankheiten und ihrer Bekämpfung zerbricht einerseits die nicht zuletzt von Gesundheitsdienstleistern mitgeförderte Illusion einer nebenrisikofreien Versorgungs- und Behandlungswelt. Andererseits wird diese Illusion durch das mit dem öffentlichkeitswirksamen Einsatz nationaler Hygiene-Task Force-Einheiten verbundene Versprechen, die Quelle des Ausbruchs zu finden und mit technischen Mitteln auszuschalten, von neuem produziert.
Wer sich mit dem Umgang mit einem "Ausbruch" von Infektionskrankheiten näher beschäftigt, stößt auf zwei zwar verständliche aber letztlich hochproblematische Argumentationsfiguren:
• Die Absicht oder gar das Versprechen, so etwas dauerhaft zu verhindern und
• die Vorstellung, die Erregerquelle rasch finden und sie mit einem Bündel meist technischer Sanierungsmaßnahmen (z.B. Desinfektion der Räumlichkeiten, Hygieneschleusen für Angehörige, neue Vorschriften zur Handhygiene bis hin zu einer Schaffung einer neuen Behandlungslokalität) zum Versiegen bringen zu können.
In der wissenschaftlichen Datenbank "Outbreak" finden sich zahlreiche Beiträge, die zu dem Schluss kommen, dass es allein wegen der Vielzahl von Erregern und deren zum Teil enorme Wandlungs- und Anpassungsfähigkeit illusorisch ist, zumindest bestimmte Erreger "ausrotten" zu können. Eine dort zugängliche Dissertation über das Verhalten einiger Typen der zur normalen Darmflora gehörenden so genannten Klebsiellen zeigt bereits im Titel die Schwierigkeiten an, Erkrankungen zu verhindern, die durch diese weit verbreiten Darmkeime verursacht werden: "Mechanismen, durch die Klebsiella pneumoniae zum Erreger nicht beherrschbarer nosokomialer Infektionen werden kann". Zu diesen Mechanismen gehören z.B. Fähigkeiten des Erregers, auch an nicht so leicht zugänglichen Orten wie Siphons und Abwasserrohren überleben zu können. Die Autorin umschreibt das Risiko-Szenario so: "Während eines nosokomialen Ausbruchs multiresistenter K. pneumoniae konnten SU et al. … die Ausbruchsstämme aus mehreren Siphons isolieren und vermuteten dort die Quelle der Kontaminationen. KAC et al. konnten durch ein Umgebungsscreening auf einer Intensivstation zeigen, dass trockene Oberflächen frei von ESBL-produzierenden Enterobacteriaceae blieben, diese Stämme jedoch für Wochen und Monate in den feuchten Spalten von Abflüssen und Waschbecken überlebten. Bisher (Erstellungsjahr der Dissertation ist 2007) wurde eine Infektion von Patienten über besiedelte Siphons nicht zweifelsfrei nachgewiesen. Es ist jedoch anzunehmen, dass es beim Verspritzen des laufenden Wassers sowohl zur Kontamination von Händen und Kontaktflächen als auch zur Aerosolbildung kommen kann."
Selbst ohne diese Art von Hindernissen vor einem Sieg über diese Art von Erregern entstehen aber ständig durch den immer noch viel zu oft erfolgenden Einsatz von Antibiotika bei Menschen und in der Fleischproduktion neue resistente und damit auch sehr persistente Erreger.
Das Versprechen, die Bedrohung durch einen Erreger "auszurotten", steht und fällt u.a. damit, die Erregerquelle zu finden und alle sie fördernden Bedingungen dauerhaft verändern zu können. Ein in der "Outbreak"-Datenbank zu findender Beitrag über wichtige Details von 225 "Ausbrüchen" unter Beteiligung dreier Erregergruppen (darunter 59 "Ausbrüche" von multiresistenten Enterobakterien à la Klebsiella insbesondere in neonatologischen Krankenhausstationen) aus dem Jahr 2011, weist auf die praktisch durchweg hohe Rate der trotz intensiver Suche unbekannt gebliebenen Erregerquellen zwischen 68% und 37% hin. Die Quelle der Enterobakterien, also der Darmkeime konnte in 58% der Fälle nicht entdeckt werden.
Schließlich sind die mehr oder weniger aufwändigen technisch-hygienischen oder baulichen Veränderungen in Krankenhausstationen mit einem "Ausbruch" zwar notwendig, aber bei weitem nicht hinreichend. Wie aber sowohl Untersuchungen über die Compliance von Hygienevorschriften bei Pflegekräften und vor allem Ärzten zeigen (vgl. dazu den Forums-Beitrag "Schrecklich, mit den Frühchen"! Aber: Ärzte und Pflegekräfte halten sich bei 52% bzw. 66% der Gelegenheiten an Hygienepflichten") aber auch positive Beispiele für eine dauerhafte Absenkung von "Ausbruchs"-Risiken in einzelnen Krankenhäusern (vgl. dazu u.a. die 2011 erschienene Studie von Sillow-Caroll et al.), sind ständige beschäftigtenbezogene und soziale Maßnahmen zur Verinnerlichung von Hygienevorschriften und deren Einbau in tagtägliche Verhaltensroutinen mindestens genauso wichtig. Anders gesagt: Absolut perfekte Handhygienevorrichtungen, das Scannen von Angehörigen und ein einwöchiger Hygienekurs für Pflegekräfte und interessierte Ärzte alleine versprechen Erfolge, die sie nicht erreichen oder halten können.
Die von verschiedenen wissenschaftlichen Einrichtungen an deutschen Kliniken getragene "Outbreak Database" ist kostenlos zugänglich.
Die erwähnte rer nat.-Dissertation "Mechanismen, durch die Klebsiella pneumoniae zum Erreger nicht beherrschbarer nosokomialer Infektionen werden kann" von Sonja Burak ist ebenfalls in ganzer Länge (179 Seiten) kostenlos erhältlich.
Von dem Kongressbeitrag "A systematic review of nosocomial outbreaks caused by multidrug-resistant Gram-negative bacteria von Zhuchenko, K. Graf und R.P. Vonberg gibt es lediglich das Abstract und eine aussagekräftige Tabelle über weitere Details der "Ausbrüche" kostenlos herunterzuladen.
Ein letztes Beispiel zu den aktuell interessanten Beiträgen, auf die man über "Outbreak" Zugriff bekommt, ist die ebenfalls auf einer Dissertation basierende Übersichtsarbeit "Healthcare Associated infections in Pediatrics" der finnischen Medizinerin Emmi Sarvikivi aus dem Jahre 2008.
Die 16-seitige Studie "Eliminating Central Line Infections and Spreading Success at High Performing Hospitals." von Sharon Silow-Carroll und Jennifer Edwards ist als "Commonwealth Fund Publication 1559, Vol. 21" erschienen und kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 2.3.12
USA: Qualität von Krankenhaus-Entlassberichten unterscheidet sich je nach Arbeitsbelastung der Ärzte erheblich
 Rund 18 Millionen Mal wird aus deutschen Krankenhäusern pro Jahr ein Patient entlassen. Der Großteil der Entlassenen ist weiter behandlungsbedürftig oder bedarf einer sonstigen nachstationären Unterstützung. Ein wichtiges Bindeglied zwischen der Behandlung im und außerhalb des Krankenhauses und für die Bedarfsgerechtigkeit, Nahtlosigkeit und Zügigkeit der weiteren Behandlung ist der Entlassbericht. Dieser enthält Informationen zur Krankengeschichte, zum stationären Behandlungsverlauf, zur Entlassungsplanung und Hinweise oder Empfehlungen zur Behandlungskontinuität.
Rund 18 Millionen Mal wird aus deutschen Krankenhäusern pro Jahr ein Patient entlassen. Der Großteil der Entlassenen ist weiter behandlungsbedürftig oder bedarf einer sonstigen nachstationären Unterstützung. Ein wichtiges Bindeglied zwischen der Behandlung im und außerhalb des Krankenhauses und für die Bedarfsgerechtigkeit, Nahtlosigkeit und Zügigkeit der weiteren Behandlung ist der Entlassbericht. Dieser enthält Informationen zur Krankengeschichte, zum stationären Behandlungsverlauf, zur Entlassungsplanung und Hinweise oder Empfehlungen zur Behandlungskontinuität.
Nachdem eine Reihe von empirischen Studien für die letzten 10 Jahre Hinweise lieferten, dass die Vorbereitung von PatientInnen auf ihre Entlassung, das so genannte Entlassungs- oder Schnittstellenmanagement, in vielen Krankenhäusern nicht optimal verläuft, stellt sich die Frage, wie die Qualität der Entlassberichte oder Arztbriefe aussieht und wie man eventuelle Defizite beheben kann. Vermutet wird, dass die bei allen Berufsgruppen zu beobachtende Verdichtung der Arbeit, d.h. die Notwendigkeit eine ständig wachsende Anzahl von PatientInnen oder "Fälle" zu behandeln, auch unerwünschte Auswirkungen auf die Qualität der Entlassberichte haben könnte.
Diese Fragen lassen sich im Moment für die deutschen Krankenhäuser nicht beantworten. Die Ergebnisse einer 2011 veröffentlichten Studie über die Qualität der in den USA verfassten Entlassberichte zeigen aber, dass es hier mehr Probleme gibt als erwartet, aber auch konkrete Ursachen und Lösungswege.
Dazu wurden 142 in einem Zeitraum von 3 Monaten erstellte Entlassberichte von insgesamt 61 internistischen Krankenhausärzten in einem Lehrkrankenhaus per Zufall ausgesucht und untersucht. Die Vollständigkeit und die Qualität der verblindeten Berichte wurde mit einem einheitlichen Instrument bewertet. Die Mitglieder einer Interventionsgruppe waren Fachärzte im ersten Berufsjahr mit einer durchschnittlichen Anzahl von 6 entlassenen PatientInnen pro Woche. In der Kontrollgruppe befanden sich erfahrene Internisten, die durchschnittlich 11 PatientInnen pro Woche entließen oder entlassen mussten. Die wöchentlichen Arbeitszeiten waren in etwa gleich. Die Länge der Entlassberichte (in Worten) auch.
Die Analyse ergab folgende Ergebnisse:
• Von den in dem Bewertungsinstrument insgesamt für wichtig gehaltenen Elemente eines Entlassberichts enthielten die Berichte der Interventionsgruppe signifikant mehr als die der Kontrollgruppe (74% versus 65%).
• Die von den geringer belasteten Ärzten im Interventionsteam erstellten Berichte waren praktisch bei allen wichtigen Inhalten vollständiger. So enthielten 65,7% der ärztlichen Entlassberichte aus der Interventionsgruppe praktisch alle wichtigen Informationen zur Patientengeschichte, was hochsignifikant weniger, nämlich nur 36,1% der Berichte aus der stärker mit Arbeit belasteten Kontrollgruppe schafften. Die jeweils statistisch signifikant unterschiedlichen Werte betrugen bei Angaben zur innerstationären Behandlungsverlauf 47,1% versus 22,2%, bei Angaben zur Entlassungsplanung 20% versus 5,5% und bei Angaben/Hinweisen zur Weiterbehandlung bzw. Behandlungskontinuität 24,3% zu 6,9%.
• Weniger als ein Viertel der Berichte enthielten Hinweise auf Entlassungsinstruktionen, Informationen zur Weiterbehandlung oder eine Liste der Medikamente, die zum Zeitpunkt der Entlassung eingenommen wurden.
Auch wenn nachvollziehbar ist, dass die unterschiedliche Arbeitslast im Krankenhausalltag hier nur durch den Vergleich der Arbeit von noch geringer belasteten ärztlichen Berufsanfängern und voll belasteten berufserfahrenen Ärzten abgebildet werden kann, wäre natürlich ein Vergleich unterschiedlich belasteter Ärzte in derselben Berufsaltergruppe noch interessanter.
Trotzdem ist dem Schluss zuzustimmen, dass eine Reduktion der Arbeitsbelastung wahrscheinlich die Qualität der Entlassberichte signifikant verbessern kann und damit auch die Behandlungsqualität vieler PatientInnen.
Der Aufsatz "The effect of workload reduction on the quality of residents' discharge summaries." von Coit MH, Katz JT ist im Journal of General Internal Medicine (2011 Jan; 26(1): 28-32) erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 15.2.12
Nicht vergessen: "Das Thema Demenz ist im Krankenhaus leider noch nicht richtig angekommen, die dementen Patienten aber sehr wohl"
 Nicht erst seitdem die Boulevardpresse nach dem Selbstmord von Gunter Sachs und dem Demenz-Outing Rudi Assauers die Existenz der Alzheimer-Krankheit als einer der Hauptursachen von Demenz schlagzeilenträchtig thematisierte, wurden die dementiellen Erkrankungen als große Herausforderungen für die Lebensqualität der zahlreicher werdenden SeniorInnen und für die soziale Kranken- wie Pflegeversicherung prognostiziert und diskutiert.
Nicht erst seitdem die Boulevardpresse nach dem Selbstmord von Gunter Sachs und dem Demenz-Outing Rudi Assauers die Existenz der Alzheimer-Krankheit als einer der Hauptursachen von Demenz schlagzeilenträchtig thematisierte, wurden die dementiellen Erkrankungen als große Herausforderungen für die Lebensqualität der zahlreicher werdenden SeniorInnen und für die soziale Kranken- wie Pflegeversicherung prognostiziert und diskutiert.
So berechneten Pflegeforscher am Zentrum für Sozialpolitik (ZeS) der Universität Bremen in ihrem Pflegereport 2010, dass "bis zum Jahr 2060 … mit 2,5 Millionen Demenzkranken in Deutschland zu rechnen (ist) … Das wären etwa 3,8 % der dann lebenden Bevölkerung. Der Anteil der Dementen an der Bevölkerung verzweieinhalbfacht sich somit." Noch plakativer und problemsensibilisierender lauten ihre Erkenntnisse: "Ein Drittel der Männer und die Hälfte der Frauen werden im Laufe ihres Lebens dement."
Zu erwarten wäre daher, dass sich die diversen Akteure im Gesundheitswesen und die Leistungserbringer in Pflegeheimen, Arztpraxen und Krankenhäusern seit längerem organisatorisch und vor allem qualifikatorisch auf diese künftigen Herausforderungen vorbereiten.
Wie eine jetzt veröffentlichte Studie des ebenfalls an der Universität Bremen angesiedelten Instituts für Public Health und Pflegeforschung (IPP) aber zeigt, verfehlen solche Erwartungen zumindest für den Erhebungszeitraum im Jahr 2011 noch erheblich die Wirklichkeit, wenn es um die Vermittlung demenzspezifischer Kompetenzen im Rahmen der Gesundheits- und Krankenpflegeausbildung geht. Wer weiß, dass Qualifikationsprozesse um wirksam zu werden einen langen zeitlichen Vorlauf brauchen, hat es hier mit einem besonders ausgeprägten Fall der Diskrepanz von Wissen, Wollen, Beschwören und Handeln zu tun.
Die Bremer ForscherInnen erhoben ihre Erkenntnisse mittels einer bundesweiten Onlinebefragung aller Kranken- und Altenpflegeschulen (derzeit 1293) sowie deren Pflegeauszubildenden (insgesamt wurden 2.467 Auszubildende angeschrieben). Nach dem Erhebungszeitraum Februar bis Mai 2011 konnten die Daten von 678 Pflegeschulen sowie 564 Pflegeauszubildende ausgewertet werden.
Das Resumé der IPP-Studie lautet: "Die IPP-Daten (zeigen) sehr eindrucksvoll, dass die Vermittlung demenzspezifischer Kompetenzen vor allem im Rahmen der Gesundheits- und Krankenpflegeausbildung zukünftig deutlich stärker zu berücksichtigen ist. Insgesamt gilt es eine intensivere Auseinandersetzung mit und Integration von demenzsensiblen Konzepten im Krankenhaus gezielt zu forcieren. Denn obwohl das Thema Demenz von der Mehrheit der Befragten eine große Relevanz zugeschrieben wird und eine curriculare Verankerung stattgefunden hat, wirkt sich das nur sehr begrenzt auf den Kompetenzerwerb der Auszubildenden, insbesondere im Versorgungssetting Krankenhaus aus. Um aktuell und zukünftig eine adäquate Versorgung von Menschen mit Demenz in Akutkliniken zu gewährleisten, bedarf es entsprechender Maßnahmen, die bereits in der Pflegeausbildung beginnen."
Konkreter sieht schon die derzeitige Lage so aus: "Ein Großteil (75,6 Prozent) der Auszubildenden der Gesundheits- und Krankenpflege wird regelmäßig beauftragt, demenzerkrankte Menschen im Krankenhaus zu betreuen. Doch nur knapp ein Viertel (23,4 Prozent) von ihnen glaubt, dass ihre Kompetenzen zum Zeitpunkt der Befragung ausreichen, um Menschen mit Demenz bedürfnisorientiert zu pflegen. Bei knapp dreiviertel (74 Prozent) der Gesundheits- und Krankenpflegeauszubildenden treten Kompetenzunsicherheiten auf, wenn Demenzpatienten zum Beispiel aggressiv sind. 64,9 Prozent haben Probleme, die Bedürfnisse des an Demenz erkrankten Menschen zu erkennen. Gut die Hälfte der Auszubildenden (56,3 Prozent) fühlen sich im Umgang mit den Angehörigen schlecht vorbereitet." Die in der Überschrift zitierte Äußerung einer im Rahmen der Studie interviewten Leiterin einer Pflegeeinrichtung beschreibt das praktische Dilemma vieler Beschäftigter vor allem in der stationären Pflege.
Positiv stellen die IPP-ForscherInnen aber fest, dass die Vermittlung pflegerischer Kompetenzen für den Umgang mit Demenzkranken in Altenpflegeschulen besser aussieht.
Der 41-seitige Abschlussbericht des Projektes "Demenzsensible nicht medikamentöse Konzepte in Pflegeschulen. Vermittlung pflegerischer Kompetenzen in der Ausbildung, die zur nachhaltigen Verbesserung von Menschen mit Demenz in Akutkliniken beitragen - Eine bundesweite Vollerhebung" von S. Görres, M. Stöver, J. Bomball und A. Schwanke steht kostenlos als Band 8 der IPP-Schriften zur Verfügung.
Der 256 Seiten umfassende materialreiche BARMER GEK Pflegereport 2010. Schwerpunktthema: Demenz und Pflege von Heinz Rothgang, Stephanie Iwansky, Rolf Müller, Sebastian Sauer und Rainer Unger ist ebenfalls in ganzer Längfe kostenlos erhältlich. Dort findet man auch eine Fülle von interessanten Daten zu den vermutlichen Auswirkungen der künftigen demografischen Entwicklung auf die Pflegebedürftigkeit.
Bernard Braun, 8.2.12
Anzahl und Qualifikationsstruktur des Pflegepersonals durch Gesundheitspersonalstatistik um 20% und 50% überschätzt.
 Während sich u.a. der GKV-Spitzenverband regelmäßig über die mehr oder weniger umfangreichen oder gesicherten quantitativen Erfolge des Pflegesonderprogramms freut und die unterschiedlichsten Pflegeexperten in Deutschland sich kräftig über die Absichten der EU-Kommission streiten, als Zugangsvoraussetzung zur Ausbildung zur Pflegefachkraft eine mindestens 12-jährige Schulbildung zu verlangen, sieht die quantitative und qualitative Wirklichkeit der Pflegepersonen in Krankenhäusern noch wesentlich schlimmer aus als es schon die amtliche Statistik zeigt.
Während sich u.a. der GKV-Spitzenverband regelmäßig über die mehr oder weniger umfangreichen oder gesicherten quantitativen Erfolge des Pflegesonderprogramms freut und die unterschiedlichsten Pflegeexperten in Deutschland sich kräftig über die Absichten der EU-Kommission streiten, als Zugangsvoraussetzung zur Ausbildung zur Pflegefachkraft eine mindestens 12-jährige Schulbildung zu verlangen, sieht die quantitative und qualitative Wirklichkeit der Pflegepersonen in Krankenhäusern noch wesentlich schlimmer aus als es schon die amtliche Statistik zeigt.
Das zeigen jedenfalls die wesentlichen Erkenntnisse eines für den "Deutschen Pflegerat" erstellten Gutachtens des in diesem Sachbereich seit Jahren ausgewiesenen Hannoveraner Wissenschaftlers, Michael Simon. Simon war es, der vor einiger Zeit nachgewiesen hatte, dass trotz der seit einigen Jahren stetig steigenden Anzahl und Schwere von Krankenhaus-Fällen seit Ende der 1990er Jahren rund 50.000 Pflegekräftestellen abgebaut worden sind. Wenn überhaupt, nimmt das Pflegesonderprogramm davon nur einen Bruchteil zurück.
Auf der Basis einer kritischen Würdigung der methodischen Grenzen der Gesundheitspersonalstatistik des Statistischen Bundesamtes (z.B. Hochrechnungen von der 1%-Haushaltsstichprobe des Mikrozensus) kommt Simon auf der Basis diverser 100%-Meldedatensätze über die Anzahl und Qualität des Pflegepersonals u.a. zu folgenden, deutlich von der Gesundheitspersonalstatistik abweichenden Ergebnissen:
• Die Zahl des Pflegepersonals ist niedriger als bislang angenommen: Statt der von der Gesundheitspersonalrechnung des Bundes für das Jahr 2009 ausgewiesenen 1,458 Mio. Pflegekräfte gibt es lediglich ca. 1,21 Mio. Beschäftigte in Pflegeberufen.
• Deutlich niedriger als bisher angenommen ist auch die Zahl der Pflegefachkräfte, d.h. der Pflegekräfte mit dreijähriger Pflegeausbildung. Das Statistische Bundesamt überschätzt die Zahl der Pflegefachkräfte um fast 50 %.
• Der Beschäftigungszuwachs in der Pflege, oftmals als Indiz für den "Jobmotor" Pflege bemüht, besteht überwiegend aus einer enormen Ausweitung der Teilzeitbeschäftigung. Der Gutachter bezweifelt in diesem Zusammenhang ferner, dass diese Zunahme der Teilzeitbeschäftigung komplett oder zum größten Teil durch die persönlichen Lebensumstände oder die Präferenzen der dort meist weiblichen Beschäftigten bestimmt wurde und wird - sie also uneingeschränkt eine soziale Wohltat darstellt. Vielmehr spiele die Teilzeitbeschäftigung auch als Instrument der Flexibilisierung des Personaleinsatzes eine Rolle.
Das Gutachten "Beschäftigte und Beschäftigungsstrukturen in Pflegeberufen. Analyse der Jahre 1999 bis 2009" gibt es komplett (72 Seiten) kostenlos auf der Website des Auftraggebers, des Deutschen Pflegerates.
Wer zusätzlich noch daran interessiert ist, mehr über die im Vergleich zu den gerade genannten Trends kleinen Verbesserungen durch das Pflegesonderprogramm zu erfahren, kann dies z.B. im "Zweiten Bericht des GKV-Spitzenverbandes zum Pflegesonderprogramm gemäß § 4 Abs. 10 Satz 12 KHEntgG (Förderjahre 2009 und 2010)" vom 30.6.2011 tun, der ebenfalls kostenlos erhältlich ist.
Die beiden Kernsätze des Berichtes lauten:
• "Der kumulierte Finanzierungsbetrag 2009/2010 auf Basis der Vereinbarungswerte beläuft sich auf insgesamt ca. 537 Mio. Euro für bislang fast 10.700 zusätzlich vereinbarte Pflegestellen."
• "Trotz einer gesetzlichen Änderung zur Nachweisführung in § 4 Abs. 10 Satz 11 KHEntgG kann die Zahl der in den Jahren 2009 und 2010 neu geschaffenen Stellen noch nicht zuverlässig ermittelt werden. Dies ist erst möglich, wenn den Krankenkassen von allen am Programm teilnehmenden Krankenhäusern die erforderliche Bestätigung durch einen Jahresabschlussprüfer vorgelegt wurde. Zum Zeitpunkt der diesjährigen Berichterstattung war das nur bei etwa der Hälfte der Krankenhäuser der Fall. Der GKV liegen Bestätigungen der Wirtschaftsprüfer für das Jahr 2009 von 475 der 1.017 am Förderprogramm teilnehmenden Krankenhäuser vor. Damit sind für etwa 63 % der vereinbarten zusätzlichen Stellen des ersten Förderjahres die Nachweise durch die Krankenhäuser geführt worden. Für weitere 7 % der zusätzlich vereinbarten Vollkräfte haben die Krankenhäuser unbestätigte Informationen mitgeteilt. Von Wirtschaftsprüfern bestätigte Angaben zu zusätzlich beschäftigtem Pflegepersonal oder zusätzlichen Finanzierungsbeträgen liegen für das Jahr 2010 nur in Ausnahmefällen vor."
Bernard Braun, 23.1.12
Zu kurze Liegezeiten können gefährlich werden
 Eine interessante internationale Vergleichsstudie veröffentlichte das renommierte us-amerikanische Ärzteblatt Journal of the American Medical Association in seiner ersten Ausgabe des Jahres 2012. Diese Untersuchung bestätigt zwar zum einen das bekannte und gesundheitspolitisch viel diskutierte Phänomen vergleichsweise langer Liegedauern in deutschen Krankenhäusern. Zum anderen aber liefert sie Hinweise darauf, dass eine ökonomisch attraktiv erscheinende Verkürzung der stationären Behandlungszeiten nicht unbegrenzt sinnvoll sein dürfte.
Eine interessante internationale Vergleichsstudie veröffentlichte das renommierte us-amerikanische Ärzteblatt Journal of the American Medical Association in seiner ersten Ausgabe des Jahres 2012. Diese Untersuchung bestätigt zwar zum einen das bekannte und gesundheitspolitisch viel diskutierte Phänomen vergleichsweise langer Liegedauern in deutschen Krankenhäusern. Zum anderen aber liefert sie Hinweise darauf, dass eine ökonomisch attraktiv erscheinende Verkürzung der stationären Behandlungszeiten nicht unbegrenzt sinnvoll sein dürfte.
Die Studienpopulation umfasste insgesamt 5.745 PatientInnen mit einem an Hand typischer EKG-Veränderungen nachweisbaren Herzinfarkt in insgesamt 17 Ländern. Bei der Behandlung des Myokardinfarkts haben verbesserte Behandlungsmöglichkeiten in den letzten Jahren zu einer Verkürzung der Therapiedauer und einer Verbesserung der Ergebnisse geführt. Außerdem sind sowohl die Diagnostik und Dokumentation als auch der klinische Umgang mit diesem Krankheitsbild vergleichsweise einheitlich, so dass Vergleichsanalysen durchaus Aussagekraft besitzen können.
Primärer Endpunkt dieser internationalen Vergleichsstudie waren sämtliche stationären Wiederaufnahmen innerhalb der ersten 30 Tage nach Entlastung aus stationärer Herzinfarktbehandlung. Sekundärer Endpunkt waren alle nicht-elektiven Wiederaufnahmen in den ersten 30 Tagen nach Entlassung, wobei geplante angiografische Erweiterungen der Herzkranzgefäße oder Bypassoperationen explizit ausgenommen waren.
Von den insgesamt 5.571 überlebenden und in die Studie eingeschlossenen InfarktpatientInnen erfolgte bei 631 (11,3%; 95% Konfidenzintervall, 10,5-12,2 %) innerhalb der ersten 30 Tage nach Entlassung eine erneute stationäre Aufnahme. Bei diesen 631 PatientInnen lag die Wiederaufnahmerate in den USA bei 14,5 % (95% KI, 12,9-16,2 %) und bei 9,9 % (95% KI, 9,0-10,9 %) außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika. Abzüglich der geplanten stationären Wiederaufnahmen zur Revaskularisierung erfolgte bei 478 (8,6 %; 95 % KI, 7,8-9,3 %) PatientInnen der gesamten Kohorte innerhalb des ersten Monats nach Abschluss einer stationären Infarktbehandlung eine Rehospitalisierung, wobei dies für 10,5 % (95 % KI, 9,0-11,9 %) der US-PatientInnen und nur 7,7 % (95 % KI, 6,9-8,6 %) der übrigen PatientInnen zutraf. Dabei war zu beobachten, dass die PatientInnen mit frühzeitiger Wiederaufnahme in stationäre Behandlung in höherem Maße an Begleiterkrankungen litten, vor allem an vorbestehender koronarer Herzkrankheit (KHK), Bluthochdruck und Diabetes mellitus, und eine Mehrgefäßerkrankung aufwiesen. Außerdem erwiesen sich Komplikationen während der stationären Infarktbehandlung als Prädiktoren für eine Wiederaufnahme innerhalb des ersten Monats nach Entlassung.
Beim internationalen Vergleich zeigten sich zunächst die folgenden Unterschiede:
• US-PatientInnen waren etwas jünger als die internationale Vergleichsgruppe und wiesen eine diskret höhere Prävalenz einer KHK bzw. vorangegangener Bypassoperationen auf. Die übrigen Charakteristika stimmten weitgehend überein.
• Die stationäre Behandlungsdauer bei akutem Herzinfarkt war in den USA signifikant kürzer als in den anderen Ländern und betrug in 60 % der Fälle (95 % KI, 57,7-62,4 %) 3 Tage oder weniger, während in den anderen Ländern nur 15,9 % (95 % KI, 14,9-17.0%) in den Genuss solch kurzer Behandlungszeiten kamen.
• Während 54 % (95 % KI, 52,4-55,6 %) der InfarktpatientInnen außerhalb der Vereinigten Staaten sechs Tage oder länger in stationärer Behandlung blieben, traf dies nur für 16,6 % (95 % KI, 14,8-18,4 %) ihrer LeidensgenossInnen in den USA zu.
• Bei US-PatientInnen kam es häufiger zur stationären Wiederaufnahme im Rahmen von Revaskularisierungsmaßnahmen wie Dilatationen oder Bypass-Operationen (4,4 gegenüber 2,0 %; 95 % KI, 3,4-5,3 % vs. 1,5-2,4 %; p<0,001 bzw. 0,6 % vs. 1,2 %; 95 % KI, 0,2-1,0 % vs. 0,8-1,5 %; p=0,046).
• In den USA erhielten InfarktpatientInnen bei Entlassung häufiger ß-Blocker und Nitrate, etwas seltener Ticlopidin oder Clopidogrel und Statine und zu einem geringeren Anteil ACE-Hemmer oder Aldosteronantagonisten. Die Verschreibungsraten von ASS waren international ähnlich.
• Die mittlere Verweildauer im Krankenhaus aufgrund eines akuten Myokardinfarkts variierte im internationalen Vergleich recht stark zwischen 3 Tagen in den USA und 8 Tagen in Deutschland.
Im Hinblick auf die Endpunkte der Studie erwies sich neben der Lokalisation des Infarktes, wiederholten ischämischen Ereignissen, chronischer Lungenerkrankung, Bluthochdruck und chronischen Entzündungserkrankungen das Vorliegen einer Mehrgefäßerkrankung als wichtigster Prädiktor für eine kurzfristige stationäre Wiederaufnahme nach Abschluss einer Infarkttherapie, denn hier war die Wahrscheinlichkeit nahezu verdoppelt (OR 1,97; 95 % KI, 1,65-2,35). Die beiden weiteren relevanten Prädiktoren waren die Behandlung im us-amerikanischen Gesundheitswesen, was die Chance auf kurzfristige stationäre Wiederaufnahme um zwei Drittel erhöhte (OR 1,68; 95 % KI, 1,37-2,07) und Herzrasen während des Akutereignisses mit einer OR von 1,09; 95 % KI, 1,05-1,15 je Erhöhung der Herzfrequenz um 10 Schläge pro Minute. Schließt man die erneuten stationären Aufnahmen aufgrund von elektiven Revaskularisierungsmaßnahmen aus, blieb allein die Behandlung im US-System als signifikanter Prädiktor für eine frühzeitige Wiederaufnahme bestehen.
Mit Ausnahme von Dänemark und Schweden zeigte sich in allen Ländern eine geringere Wiederaufnahmerate als in den USA. Die Wahrscheinlichkeit, innerhalb eines Monats nach Entlassung erneut in ein Krankenhaus gehen zu müssen, war in Italien und Deutschland nur etwas mehr als ein Viertel so groß (OR 0,26; 95 % KI, 0,15-0,43 bzw. OR 0,28; 95 % KI, 0,07-0,46), in Kanada nur ein Drittel so groß (OR 0,33; 95 % KI, 0,20-0,56) und in den Niederlanden nur halb so groß wie in den USA (OR 0,50; 95 % KI, 0,30-0,84). Es zeigte sich insgesamt eine umgekehrte Proportionalität zwischen der jeweils landestypischen mittleren Verweildauer und der Wiederaufnahmehäufigkeit, also je kürzer die stationäre Primärtherapie des Infarkts, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit einer erneuten Aufnahme innerhalb des ersten Monats.
Von der interessanten Studien von Robb Kociol, Renato Lopes, Robert Clare, Laine Thomas, Rajendra Mehta, Padma Kaul, Karen Pieper, Judith Hochman, Douglas Weaver, Paul Armstrong, Christopher Granger und Manesh Patel mit dem Titel International Variation in and Factors Associated With Hospital Readmission After Myocardial Infarction aus dem JAMA 307 (1), Seiten 66-74, steht für Nicht-AbonentInnen kostenfrei ein Abstract zur Verfügung.
Jens Holst, 4.1.12
Friede auf Erden und im OP oder Orthopäden sind nicht ganz so stark wie ein Ochse und auch nicht nur halb so gescheit !
 Das bevorstehende Weihnachtsfest bietet auch der Gesundheitswissenschaft die Gelegenheit mit schrecklichen Vorurteilen über Ärzte aufzuräumen. Ob das wirklich zu einem nachhhaltigen vorurteilsfreien Miteinander von Patienten und Ärzten und von Ärzten mit Ärzten führt, lässt sich trotz der jüngsten Forschungsergebnissen zum professionellen Image bezweifeln.
Das bevorstehende Weihnachtsfest bietet auch der Gesundheitswissenschaft die Gelegenheit mit schrecklichen Vorurteilen über Ärzte aufzuräumen. Ob das wirklich zu einem nachhhaltigen vorurteilsfreien Miteinander von Patienten und Ärzten und von Ärzten mit Ärzten führt, lässt sich trotz der jüngsten Forschungsergebnissen zum professionellen Image bezweifeln.
Ausgangspunkt einer Studie über deren Ergebnisse jetzt in der Weihnachtsausgabe des "British Medical Journal (BMJ)" berichtet wird, ist das Vorurteil, dass operierende Orthopäden im Vergleich mit anderen Fachärzten zwar wahre Kraftmeier aber nicht besonders intelligent sind: "typical orthopaedic surgeon—as strong as an ox but half as bright." Auch wenn man mal den Ochsenvergleich vergisst, werden die Vergleiche nicht besser. Manche denken bei Orthopäden dann nämlich an "Schlachter-Typen" - ohne wiederum den Angehörigen dieses Berufs zu nahetreten zu wollen.
Um weder operierende Orthopäden weiter zu verunglimpfen noch Patienten in Angst und Schrecken zu versetzen, untersuchte ein Wissenschaftlerteam jetzt an drei Allgemeinkrankenhäusern in Großbritannien in einer multizentrischen prospektiven vergleichenden Studie sowohl die Festigkeit des Händedrucks als auch die durchschnittliche Intelligenz von 36 männlichen chirurgisch tätigen Orthopäden und von 40 männlichen Angehörigen einer Kontrollgruppe, die aus Anästhesisten bestand.
Das Ergebnis war von seltener Klarheit:
• Orthopädenhände packten statistisch signifikant stärker zu als die ihrer Anästhesisten-Kollegen (47,25 kg versus 43,83 kg).
• Ein Intelligenztest zeigte, dass es sich bei der Behauptung zur Intelligenz der Orthopäden um ein gräßliches Vorurteil handelt: Sie waren mit einem durchschnittlichen Wert von 105,19 Punkten signifikant intelligenter als die Anästhesisten mit 98,38 Punkten.
Wer von den anderen Fachärzten oder vom einfachen Volk weiterhin seine Orthopäden-Vorurteile pflegen oder sich über Orthopäden lustig machen will, muss - sofern er intelligent genug ist - also etwas Neues finden. Und wie man das wissenschaftlich bestätigte Image der Anästhesisten (merke: "Wo Licht ist, gibt es auch Schatten"), leicht unterdurchschnittlich intelligente Weicheier zu sein, gerade rückt, wird mit Sicherheit eine Studie zum nächsten Weihnachtsfest oder sogar schon zu Ostern 2012 hinkriegen!?
Wegen der unzweifelhaften Relevanz des Themas gibt es den Aufsatz "Orthopaedic surgeons: as strong as an ox and almost twice as clever? Multicentre prospective comparative study von P Subramanian (trauma and orthopaedic specialist registrar) S Kantharuban (core surgical trainee, Oxford Deanery), V Subramanian (foundation year trainee, Mersey Deanery), S A G Willis-Owen (postdoctoral research scientist) und C A Willis-Owen (consultant trauma and orthopaedic surgeon) aus dem BMJ vom 15. Dezember 2011 komplett kostenlos.
Und wer jetzt noch wissen will, was einer der Forschungsanlässe war, kann einen Blick in den bösartigen YouTube-Beitrag: Orthopedia vs anesthesia (orthopaedics, anaesthetics conversation) aus dem Jahr 2011 werfen.
Bernard Braun, 16.12.11
Dekubitusprophylaxe für ältere Patienten muss bei den wenigen Stunden auf Tragbahren in Notfallambulanzen anfangen, und lohnt sich
 Druckgeschwüre oder Dekubiti gehören zu den am schnellsten entstehenden und schwersten unerwünschten Nebenwirkungen bei zum Liegen gezwungenen Patienten im Krankenhaus oder auch von bettlägrigen häuslichen Patienten oder Heimbewohnern. Wenn erst einmal ein Druckgeschwür entstanden ist, ist es sehr aufwändig, es wieder weg zu bekommen und weitere Folgen zu vermeiden.
Druckgeschwüre oder Dekubiti gehören zu den am schnellsten entstehenden und schwersten unerwünschten Nebenwirkungen bei zum Liegen gezwungenen Patienten im Krankenhaus oder auch von bettlägrigen häuslichen Patienten oder Heimbewohnern. Wenn erst einmal ein Druckgeschwür entstanden ist, ist es sehr aufwändig, es wieder weg zu bekommen und weitere Folgen zu vermeiden.
Deshalb gelten gezielte präventive Maßnahmen wie das personalintensive ständige Umlagern gefährdeter PatientInnen oder druckentlastende Unterlagen bzw. Matratzen zu den anerkannten Gegenmitteln. Da weder zusätzliches Personal kostenlos zu erhalten ist, noch geeignete Matratzen billig sind, scheuen viele Behandlungs- und Pflegeeinrichtungen vor solchen Personal- und/oder Sachinvestitionen aus Kostengründen zurück und riskieren damit eine lang andauernde gesundheitliche Beeinträchtigung sowie auch Folgekosten für das Krankenhaus.
Dass dieses Verhalten weder human noch kosteneffizient ist, weist jetzt eine kanadische Studie über die Kosten und den finanziellen Nutzen früher Prävention von Druckgeschwüren durch spezielle druckentlastende Matratzen in Notfallambulanzen bis auf den Dollar-Cent genau nach. Da dort viele dieser Patienten lange auf Tragbahren und einfachen Betten liegen müssen und sich bereits dadurch ein Druckgeschwür bilden oder verschlimmern kann, untersuchten die ForscherInnen mittels einer aufwändigen Analysemethodik (Markov-Modelle) für die rund 240.000 älteren Patienten in Ontario, die über eine Notfallambulanz ins Krankenhaus kamen, die Inzidenz von Druckgeschwüren nach durchschnittlich 15,4 Stunden Aufenthalt auf normalen Liegegelegenheiten und bei der Nutzung von speziellen druckentlastenden Betten.
Die Ergebnisse sehen so aus:
• Die Inzidenz eines während eines Notfallambulanzaufenthalts erworbenen Druckgeschwürs betrug bei PatientInnen, die auf einfachen Tragbahren etc. lagen, 1,90%. Bei den Patienten mit einem speziellen präventiv wirkenden Schaumstoffbett belief sich die Inzidenz auf 1,48%. Für die erfolgreiche Verhinderung eines Druckgeschwürs mussten 238 PatientInnen behandelt werden ("number needed to treat").
• Die Ausgaben für die Umrüstung auf druckentlastende Betten bzw. entsprechend wirkende Matratzen für Tragbahren beliefen sich auf 0,30 Canada-Dollar pro Patient.
• Das Liegen in den Spezialbetten stellte ein wirksames Mittel der Frühprävention gegen Druckgeschwüre dar, führte zu einer Verlängerung der "quality-adjusted life-days" von 0,0015 und führte zu einer durchschnittlichen Gesamtkostenersparnis von 32,36 Kanada-Dollar pro älterem Patient. Der Anteil des durch die Verlängerung der gesunden Lebenszeit bedingten Gesundheitsnutzens am finanziellen Netto-Nutzen betrug 0,21 Kanada-Dollar. Die Kostenersparnis pro Patient schlug mit 32,15 Kanada-Dollar zu Buche. Selbst wenn ein Patient nur eine Stunde in einer Notfallambulanz lag, betrug der finanzielle Nutzen der Dekubitus-Prävention mittels einer speziellen Matratze noch 4 Kanada-Dollar pro Patient selbst dann, wenn diese nur eine Stunde liegend in einer Krankenhaus-Ambulanz auf ihre Behandlung warten mussten.
• Die positive gesundheitliche und ökonomische Wirkung druckentlastender Schaumstoffmatratzen bestätigte sich auf unterschiedlichen Niveaus auch noch in weiteren Analysen, die z.B. Effekte über längere Zeiträume untersuchten.
• Trotz der Absicht, nach weiteren Effekte in differenzierteren Untersuchungen zu suchen, kommen die AutorInnen zu dem eindeutigen Schluss, dass "the economic evidence supports early prevention with pressure-redistribution foam mattresses in the emergency department. Early prevention is likely to improve health for elderly patients and save hospital costs."
Zu dem in der Novemberausgabe 2011 in der Fachzeitschrift "Annals of Emergency Medicine" (Volumen 58 [5]: 468-78) erschienenen Aufsatz "Early Prevention of Pressure Ulcers Among Elderly Patients Admitted Through Emergency Departments: A Cost-effectiveness Analysis" von Ba' Pham et al. ist kostenlos lediglich das Abstract erhältlich.
Bernard Braun, 14.12.11
Mehr und ausgeruhte Pflegekräfte=weniger Wiedereinweisungen und Ausgaben sowie bessere Entlassung: Spinnerei oder Wirklichkeit?
 Was bedeutet ein Mangel an Pflegepersonen oder ein Mangel an Pflegekräften mit bestimmten Qualifikationen für die Behandlungsqualität von KrankenhauspatientInnen? Wer dazu verlässliche Antworten in entsprechend konzipierten und methodisch hochwertigen wissenschaftlichen Untersuchungen sucht, kann sich durch eine Fülle von insbesondere internationalen Fachzeitschriften wühlen oder findet auf der Website "Truth About Nursing" eine regelmäßig aktualisierte Übersicht über Veröffentlichungen zu diesen meist in den angelsächsischen Ländern durchgeführten empirischen Studien. Die Seite wird von der nicht gewinnorientierten internationalen Organisation "Truth" mit Sitz in Baltimore gepflegt, deren erklärtes Ziel es ist, der Öffentlichkeit die zentrale Rolle nahezubringen, welche Pflegekräfte in der Gesundheitsversorgung spielen.
Was bedeutet ein Mangel an Pflegepersonen oder ein Mangel an Pflegekräften mit bestimmten Qualifikationen für die Behandlungsqualität von KrankenhauspatientInnen? Wer dazu verlässliche Antworten in entsprechend konzipierten und methodisch hochwertigen wissenschaftlichen Untersuchungen sucht, kann sich durch eine Fülle von insbesondere internationalen Fachzeitschriften wühlen oder findet auf der Website "Truth About Nursing" eine regelmäßig aktualisierte Übersicht über Veröffentlichungen zu diesen meist in den angelsächsischen Ländern durchgeführten empirischen Studien. Die Seite wird von der nicht gewinnorientierten internationalen Organisation "Truth" mit Sitz in Baltimore gepflegt, deren erklärtes Ziel es ist, der Öffentlichkeit die zentrale Rolle nahezubringen, welche Pflegekräfte in der Gesundheitsversorgung spielen.
Die Informationen sind nach den Abschnitten "Reports on nurse staffing levels and their effects", "Research", Analysis and first accounts of effects of nurse staffing levels" und Recruit and retain nurses in the workforce" gegliedert. An eine kurze Überschrift schließt sich meist das offizielle Abstract oder seine Zusammenfassung und ein Link zu Pubmed oder der Zeitschrift selber an. Abgeschlossen wird die Seite mit einer Darstellung der von der "American Nurses Association" getragenen Kampagne "Safe staffing saves lives".
Zu den Beiträgen gehören zum Beispiel
• der komplett kostenlos erhältliche Aufsatz "Implications of the California Nurse Staffing Mandate for Other States" von Linda H. Aiken, Douglas M. Sloane, Jeannie P. Cimiotti, Sean P. Clarke, Linda Flynn, Jean Ann Seago, Joanne Spetz und Herbert L. Smith (in der Zeitschrift "Health Services Research" Volume 45, Issue 4, 2010: 904-921) , der u.a. über die Effekte des Unterschreitens der im Bundesstaat Kalifornien gesetzlich festgelegten Mindestrelationen zwischen Pflegekräften und Patienten auf die Mortalität berichtet (z.B. Medical-surgical 1:5, Pädiatrie 1:4, Intensivversorgung 1:2, Onkologie 1:5, Geburtshilfe 1:3)
• und das hier nur kostenlos erhältliche Abstract des Aufsatz "Quality and Cost Analysis of Nurse Staffing, Discharge Preparation, and Postdischarge Utilization" von Marianne E. Weiss1, Olga Yakusheva und Kathleen L. Bobay (in der Oktoberausgabe 2011 der Zeitschrift "Health Services Research", Volume 46, Issue 5: 1473-1494) in dem der empirische Nachweis erbracht wird, dass der Umbau von Pflegekräfte-Überstunden in zusätzliche Pflegekräftestellen nicht nur der Versorgungsqualität der PatientInnen zugutekommt (z.B. weniger Wiedereinweisungen), sondern sich auch für das Wirtschaftsunternehmen Krankenhaus rechnet.
Auf der Truth-Seite kann auch ein regelmäßig erscheinender Newsletter bestellt werden.
Die "Truth About Nursing"-Literaturübersichtsseite lohnt sich regelmäßig zu besuchen.
Bernard Braun, 7.12.11
Sind Haus- und Geburtshausgeburten riskanter als Krankenhausgeburten? Was eine britische Studie wirklich dazu findet!!
 Die Veröffentlichung einer großen britischen Studie über die Risiken von außer- und innerstationären Geburten war der Anlass für eine in zahlreichen Medien fast wortgleich verbreitete Schlussfolgerung zweier deutscher Verbandsexperten: "Bei einer Hausgeburt können Geburtsstillstand, Blutungen bei der Mutter oder Sauerstoffmangel beim Kind auftreten, warnen die Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe und des Berufsverbandes der Frauenärzte, Prof. Klaus Friese und Christian Albring. In Deutschland müsse fast jede zehnte Schwangere, die ihre Entbindung als Hausgeburt begonnen hat, während der Geburt wegen Komplikationen in ein Krankenhaus gebracht werden. In mehr als der Hälfte dieser Fälle sei dann ein Kaiserschnitt oder der Einsatz einer Saugglocke oder Zange nötig." So exemplarisch alarmisierend die Meldung im Web-Angebot der Illustrierten "Stern", die dann auch in der impliziten Aufforderung mündet, lieber sofort im Krankenhaus gebären zu wollen.
Die Veröffentlichung einer großen britischen Studie über die Risiken von außer- und innerstationären Geburten war der Anlass für eine in zahlreichen Medien fast wortgleich verbreitete Schlussfolgerung zweier deutscher Verbandsexperten: "Bei einer Hausgeburt können Geburtsstillstand, Blutungen bei der Mutter oder Sauerstoffmangel beim Kind auftreten, warnen die Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe und des Berufsverbandes der Frauenärzte, Prof. Klaus Friese und Christian Albring. In Deutschland müsse fast jede zehnte Schwangere, die ihre Entbindung als Hausgeburt begonnen hat, während der Geburt wegen Komplikationen in ein Krankenhaus gebracht werden. In mehr als der Hälfte dieser Fälle sei dann ein Kaiserschnitt oder der Einsatz einer Saugglocke oder Zange nötig." So exemplarisch alarmisierend die Meldung im Web-Angebot der Illustrierten "Stern", die dann auch in der impliziten Aufforderung mündet, lieber sofort im Krankenhaus gebären zu wollen.
Nachdem es den ärztlichen und stationären Geburtshilfeexperten in Deutschland bis heute gelang, die weltweit relativ seltene Situation zu perpetuieren, dass mehr als 95% der Geburten in Krankenhäusern stattfinden, kann sich am Beispiel der Rezeption dieser im "British Medical Journal (BMJ)" am 24. November 2011 frei zugänglich veröffentlichten Studie jeder ein eigenes Bild von der Härte der berufspolitischen Auseinandersetzung um Schwangere und ihre Kinder machen und der Bereitschaft, dafür sehr selektiv zu lesen und zu argumentieren.
In dieser prospektiven Kohoertenstudie wurden im Zeitraum zwischen April 2008 und April 2010 das Geburtsgeschehen und die dabei auftretenden Komplikationen, Interventionen und unerwünschten Wirkungen bei 79.774 britischen Schwangeren untersucht, unter denen 64.538 ein niedriges Schwangerschaftsrisiko hatten. Frauen, die eine geplante Kaiserschnittentbindung machen oder eine ungeplante Hausgeburt hatten, wurden aus der Studie ausgeschlossen.
Die Studie lieferte folgende Erkenntnisse:
• Sie bestätigte zum einen, dass gesunde schwangere Frauen, die eine Entbindung in einer Hebammeneinrichtung planen, im Vergleich zu Entbindenden in einer Krankenhaus-Entbindungsstation mit höherer Wahrscheinlichkeit eine Entbindung mit wenigen ärztlichen und medizinischen Interventionen haben.
• Sie bestätigte auch, dass es bisher immer noch einen Mangel an Evidenz zur Ergebnisqualität im Bereich der seltenen aber ernsten unerwünschten Geburtsereignissen für alle Gebär-Settungs gibt. Die Studie will daran etwas ändern, erwartete selber aber wenig Nachteiliges für die außerstationären Angebote.
• Für gesunde Erstgebärende (nulliparous), die ein geringes Schwangerschaftsrisiko aufweisen, "the risk of an adverse perinatal outcome seems to be higher for planned births at home, and the intrapartum transfer rate (in ein Krankenhaus) is high in all settings other than obstetric unit." Die Rate der ungeplanten Überführungen von Gebärenden in eine stationäre Geburtshilfeeinrichtung schwankte zwischen 36% und 45%. Die Anzahl unerwünschter Ereignisse während der Geburt war aber trotzdem so gering, dass deswegen bestimmte Wahrscheinlichkeitswerte nicht berechnet werden konnten. Andererseits ist die Rate erwünschter Ergebnisse wie z.B. dem Stillen der Neugeborenen bei außerstationären Geburten signifikant höher als bei den Krankenhaus-Neugeborenen und ihren Müttern.
• Für gesunde Frauen, die geringe Schwangerschaftsrisiken aufwiesen, ist die Inzidenz unerwünschter Ereignisse rund um die Geburt herum (perinatal) in allen Geburts-Settings niedrig.
• Was beim innerdeutschen Kampf um die Krankenhaus-Geburt als Normalfall dann komplett unterschlagen wird, ist folgendes: Für gesunde Frauen, die das zweite oder ein weiteres Kind gebären (multiparous), und wiederum ein geringes Schwangerschaftsrisiko aufweisen, gibt es im Vergleich zu den im Krankenhaus gebärenden Mehrfachgebärenden und im Vergleich der unterschiedlichen außerstationären Gebärmöglichkeiten keinen statistisch signifikanten Unterschied des Auftretens unerwünschter Ereignisse.
• Für diejenigen LeserInnen, die wissen wollen, über welche "Feinheiten" deutsche Lobbyisten fürs stationäre und ärztliche Gebären hinweglesen (lassen), sei hier die sorgfältig differenzierende Zusammenfassung der Studie durch ihre AutorInnen zitiert: "The results support a policy of offering healthy women with low risk pregnancies a choice of birth setting. Women planning birth in a midwifery unit and multiparous women planning birth at home experience fewer interventions than those planning birth in an obstetric unit with no impact on perinatal outcomes. For nulliparous women, planned home births also have fewer interventions but have poorer perinatal outcomes."
Dank der vorbildlichen "open access"-Politik des BMJ kann sich jeder daran Interessierte von den weiteren Details und quantitative Belegen der Studie "Perinatal and maternal outcomes by planned place of birth for healthy women with low risk pregnancies: the Birthplace in England national prospective cohort study" kostenlos ein vollständiges Bild verschaffen und in Zukunft noch skeptischer gegenüber Äüßerungen von Anbieterverbandsvertretern sein. Die von der "Birthplace in England Collaborative Group" unter Leitung von Peter Brocklehurst durchgeführte Studie ist im BMJ (343 doi: 10.1136/bmj.d7400) erschienen.
Bernard Braun, 1.12.11
"Der Patient steht im Mittelpunkt" … der dritten Reihe. Prioritäten im Reporting und Benchmarking von Krankenhäusern
 Egal, ob Krankenhäuser im Zusammenhang mit einer möglichen Privatisierung, wegen unerwünschter Todesfälle unter PatientInnen oder durch "rollende Köpfe" öffentlich ins Gerede kommen, stellt sich auch die Frage, welche Aspekte des sozialen Systems Krankenhaus eigentlich für die Führungskräfte des Krankenhauses wichtig sind und aufbereitet werden und welche Informationen und Benchmarking-Indikatoren in der Steuerung die wichtigste Rolle spielen, und auf dem "Chef-Schreibtisch" landen.
Egal, ob Krankenhäuser im Zusammenhang mit einer möglichen Privatisierung, wegen unerwünschter Todesfälle unter PatientInnen oder durch "rollende Köpfe" öffentlich ins Gerede kommen, stellt sich auch die Frage, welche Aspekte des sozialen Systems Krankenhaus eigentlich für die Führungskräfte des Krankenhauses wichtig sind und aufbereitet werden und welche Informationen und Benchmarking-Indikatoren in der Steuerung die wichtigste Rolle spielen, und auf dem "Chef-Schreibtisch" landen.
Etwas Licht verschaffen die Ergebnisse zweier kleiner, wahrscheinlich nichtrepräsentativen Befragungen: 184 leitende Mitglieder von Krankenhausverwaltungen (Rücklauf 31%) wurden zur Ausgestaltung des Reportings in ihren Einrichtungen gefragt und 97 Chefärzten in den Bereichen Orthopädie und Unfallchirurgie (Rücklaufquote 53%) wurden u.a. Fragen zur Identifikation mit dem Krankenhaus und Beruf sowie der wahrgenommenen Nützlichkeit von Berichten und Kennzahlen gestellt.
Die wichtigsten Ergebnisse lauten:
• Krankenhäuser steuern vor allem durch die Aufbereitung und Kommunikation von "Zielen zu abrechnungsrelevanten medizinischen Leistungskennzahlen, wie etwa Case-Mix-Index oder Fallzahlen."
• Danach kommen die Aufbereitung und praktische Nutzung von Daten zur Verweildauer von Patienten und durchschnittlichen Auslastung des Krankenhauses - alsao Effizienzkennzahlen. Ergänzt werden diese Daten durch Finanzkennzahlen zu den Einnahmen und Ausgaben.
• Qualitätskennzahlen wie die "Patientenzufriedenheit oder (die) Beachtung von Qualitätsmaßstäben … spielen eine eher untergeordnete Rolle."
• Die abrechnungsrelevanten medizinischen Leistungskennzahlen und die Effizienzkennzahlen werden in über 90% der Krankenhäuser wenigstens monatlich berichtet und wenigstens einmal jährlich gibt es hierzu Benchmarking-Daten. Finanzkennzahlen und mit Sicherheit auch Qualitätskennzahlen werden von weniger Krankenhäuser und dann vermutlich auch wesentlich seltener berichtet.
• Die befragten Chefärzte messen sämtlichen Indikatoren einen geringen Stellenwert zu. Auf die Frage, welche der Kennzahlen für sie als Arzt wichtig sind, sagen ein Drittel (ob immerhin oder nur, ist mangels Referenzdaten schwer zu sagen), dies träfe für die Qualitätskennzahlen zu, also z.B. für die Patientenzufriedenheit. Finanzkennzahlen sehen nur noch 10% der Chefärzte positiv.
• Regelmäßige aber "wohldosierte" bzw. nicht zu häufige Benchmarking-Informationen tragen nach Meinung der Autoren des Reporting-Aufsatzes "zu einer positiven sozialen Austauschbeziehung" bei, weil sich "die Mitarbeiter … unterstützt (fühlen)."
• Ein weiteres nicht genauer belegtes Fazit: "Erfolgreiche Krankenhäuser setzten Benchmarking-Informationen deutlich häufiger und umfänglicher ein als ihre weniger erfolgreichen Konkurrenten." Welche Indikatoren dies waren oder sind und welcher Art die Erfolge sind, wird ebenfalls nicht genauer berichtet.
Zu dem Aufsatz "Reporting in deutschen Krankenhäusern - die Bedeutung von Benchmarking-Informationen" von Matthias Mahlendorf und Fabian Kleinschmidt (ZfCM/Controlling & Management 55. Jg. 2011, Heft 4: 216-223), der diese Einblicke in eine ansonsten relativ intransparente Ecke des Gesundheitswesens vermittelt, gibt es kostenlos leider nur ein mageres thesenartiges Abstract.
Warum dies ausgerechnet bei einem Aufsatz über mehr und bessere Transparenz aus dem "Institut für Management und Controlling" der privaten Otto Beisheim School of Management so ist, wirft ein seltsames Licht auf das dort herrschende Verständnis von Berichterstattung.
Bernard Braun, 20.11.11
"Schrecklich, mit den Frühchen"! Aber: Ärzte und Pflegekräfte halten sich bei 52% bzw. 66% der Gelegenheiten an Hygienepflichten
 Die seit einigen Tagen laufenden öffentlichen Debatten über die Ursachen und die Vermeidbarkeit des Todes dreier so genannter "Frühchen" in der neonatologischen Spezialabteilung eines großen Bremer Krankenhauses, machen zum wiederholten Male innerhalb der letzten Jahre darauf aufmerksam, dass es auch in Krankenhäusern gesundheitliche oder auch tödliche Risiken gibt. Trotz aller professionellen Ethik und den ab dem 1.1. 2012 sogar bundesweit geltenden Infektionsschutz- oder Hygienevorschriften (bis 2011 gab es in mehreren Bundesländern solche Vorschriften überhaupt nicht), gilt neben der durch übermäßigen Antibiotikaeinsatz immer größer werdenden Anzahl multi-resistenter Krankheitserreger auch mangelnde Handhygiene als eine wichtige zum größten Teil vermeidbare Ursache für den jährlichen Tod von zig Frühgeborenen (die genaue Anzahl ist nicht bekannt) und mindestens 15.000 erwachsenen Patienten in Krankenhäusern.
Die seit einigen Tagen laufenden öffentlichen Debatten über die Ursachen und die Vermeidbarkeit des Todes dreier so genannter "Frühchen" in der neonatologischen Spezialabteilung eines großen Bremer Krankenhauses, machen zum wiederholten Male innerhalb der letzten Jahre darauf aufmerksam, dass es auch in Krankenhäusern gesundheitliche oder auch tödliche Risiken gibt. Trotz aller professionellen Ethik und den ab dem 1.1. 2012 sogar bundesweit geltenden Infektionsschutz- oder Hygienevorschriften (bis 2011 gab es in mehreren Bundesländern solche Vorschriften überhaupt nicht), gilt neben der durch übermäßigen Antibiotikaeinsatz immer größer werdenden Anzahl multi-resistenter Krankheitserreger auch mangelnde Handhygiene als eine wichtige zum größten Teil vermeidbare Ursache für den jährlichen Tod von zig Frühgeborenen (die genaue Anzahl ist nicht bekannt) und mindestens 15.000 erwachsenen Patienten in Krankenhäusern.
Wer bisher glaubte, dass das noch zusätzlich qualifizierte und sensibilisierte ärztliche und pflegerische Personal in intensivmedizinischen Einrichtungen für besonders geschwächte oder gefährdete PatientInnen wie "Frühchen" oder kleine Kinder sich konsequent an die fachlich unumstrittenen Regeln zur Händehygiene hält, muss seine Vorstellung mit der Veröffentlichung einer Untersuchung in der pädiatrischen und neonatologischen Intensivstation des Groß- und Universitäts-Klinikums Aachen korrigieren.
In einer im Jahr 2009 durchgeführten Studie wurden dort sämtliche behandelnden Personen und ihre patienten- oder hygienebezogenen Handlungen 192 Stunden lang mit ihrem Wissen lückenlos beobachtet. Zusätzlich zu der Information, dass ihr Hygieneverhalten beobachtet wird, wurden die Beschäftigten in einer sechswöchtigen Pilotphase in mündlicher und schriftlicher Form gründlich über Hygienevorschriften informiert. Dies umfasste auch Verweise auf die kostenlos erhältlichen 270 Seiten umfassenden und weltweit anerkannten " Guidelines on Hand Hygiene in Health Care. First Global Patient Safety Challenge Clean Care is Safer Care 2009" der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Ferner wurde mit den Beschäftigten das sachgerechte Verhalten trainiert und die dafür benötigte Ausrüstung installiert. Mit anderen Worten: Sehr viel besser können Beschäftigte nicht darauf vorbereitet werden, Hygienevorschriften einzuhalten und dabei beobachtet zu werden.
Die Ergebnisse sahen dann so aus:
• Die Anzahl von Situationen und Gegelegenheiten zur Handhygiene ("hand hygiene opportunities") ist höher als erwartet: In der pädiatrischen Intensivstation lag ihre Anzahl bei 321 in 24 Stunden, während es in der neonatologischen Intensivstation in derselben Zeit "nur" 194 solcher Gelegenheiten gab. Der Hauptteil dieser Gelegenheiten lag vor Kontakten zu den PatientInnen und nach dem Kontakt mit ihnen.
• Die Compliancerate, d.h. die Treue mit der sich die Beschäftigten an die durch Vorschriften geregelten Abläufe hielten, betrug in der pädiatrischen Intensivversorgung insgesamt 53% (170 handhygienische Aktivitäten). Die Beschäftigten in der Neonatologie waren statistisch signifikant vorschriftentreuer und hielten sich in 118 oder 61% der Gelegenheiten an die Handhygienevorschriften.
• Die Durchschnittswerte verdecken hier aber in besonderer Weise einen sehr kritisch zu bewertenden Teil der Wirklichkeit. Während sich Pflegekräfte in den beiden Stationen zu 57% (Pädiatrie) und 66% (Neonatologie) an die Hygienevorschriften hielt, taten dies lediglich 29% bzw. 52% der dort beschäftigten Ärzte. Die AutorInnen der Studie empfehlen daher auch, weitere Trainings und Kampagnen auf die Ärzteschaft zu konzentrieren.
• Interessant war auch, dass die Hygiene-Compliance vor dem Kontakt mit einem der PatientInnen höher war als nach dem Kontakt. Dies kann man mit den AutorInnen positiv im Sinne des Patientenwohls bewerten. Aber auch die Compliance vor dem Kontakt mit PatientInnen war bei weitem nicht optimal.
• Wer nun meint, die Hygiene-Compliance sei im "normalen" beispielsweise unbeobachteten Betrieb in solchen Stationen niedriger, hat leider wahrscheinlich recht: Aus den so genannten Hand-KISS-Daten des "National Reference Laboratory for Infection Control" am Robert Koch-Institut in Berlin errechnen sich in den dort erfassten 24 pädiatrischen (in 24 Krankenhäusern) und 57 neonatologischen (in 56 Krankenhäusern) 33 bzw. 29 gründliche Händereinigungen pro Patiententag. Obwohl wie gesehen keineswegs perfekt, reinigten sich die StudienteilnehmerInnen in Aachen ihre Hände im Durchschnitt 43 Mal pro Patiententag.
In Kenntnis der mit Sicherheit erheblich positiv verzerrten Ergebnisse der Studie im Klinikum Aachen kann man sich eigentlich nur noch wundern, warum nicht wesentlich mehr und wesentlich häufiger "Frühchen" oder schwer kranke Kinder (darunter viel am offenen Herzen operierte Kinder) sterben.
Die Studie zeigt aber auch, dass viele für wirksam gehaltenen präventiven Interventionen, darunter das Schließen von Wissenslücken, Verhaltenstrainings und optimale Ausstattungen allein zwar graduelle Verbesserungen bewirken können, aber am Grundproblem mangelnder und folgenreicher Handhygiene nichts ändern.
Die sowohl in Bremen zu hörenden Hinweise, man selber habe sich aber an alle Vorschriften gehalten oder die nach der hier vorgestellten Studie zu erwartenden Zweifel an der Repräsentativität der Aachener Ergebnisse, sind als reine Verteidigungsrhetorik zu bewerten. Die ebenfalls immer wieder bemühten Argumente, dass gerade "Frühchen" wegen ihrem nicht entwickelten Immunsystem bereits ein extrem hohes "natürliches" und eben auch potenziell tödliches Infektionsrisiko haben und viele Keime gegen Antibiotika resistent sind, ist ernster zu nehmen, enthebt aber auch nicht von der Pflicht, die Händehygiene der Beschäftigten bei der Versorgung dieser PatientInnen besonders ernst zu nehmen.
Über die gelungenen Versuche, wirklich etwas gegen den vermeidbaren hygienebedingten Tod von "Frühchen" und erwachsenen PatientInnen (vgl. z.B. zur erfolgreichen MRSA-Prophylaxe à la Niederlande eine ZDF-Reportage vom 24.8.2011 die mit dem Stichwort MRSA und dem Sendungsnamen ZDFzoom aufgerufen werden kann) zu tun und den dafür allerdings notwendigen Aufwand, wird daher noch umfassender berichtet und diskutiert werden müssen.
Der auch mit reichlich weiterführender Literatur versehene Aufsatz "Hand hygiene in pediatric and neonatal intensive care unit patients: Daily opportunities and indication- and profession-specific analyses of compliance" von Simone Scheithauer et al. ist in der November-Ausgabe des "American Journal of Infection Control" (Volume 39, Issue 9: 732-737, November 2011) erschienen. Ein Abstract ist kostenlos erhältlich. Die Hauptergebnisse sind auch schon als Poster auf dem 20. "European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID)" im April 2010 in Wien vorgestellt worden.
Bernard Braun, 12.11.11
0,92% aller Krankenhaus-Fälle im Jahre 2006 sind mit Sicherheit unerwünschte Arzneimittelereignisse gewesen.
 Die Anzahl der unerwünschten Arzneimittelereignisse (UAE), d.h. der medizinischen Ereignisse, die in Verbindung mit der Anwendung eines Arzneimittels auftreten, wird auf der Basis spezieller Meldesysteme und Spontanmeldungen in den Industriestaaten auf 1 bis 5% aller Krankenhausaufnahmen geschätzt. In 1,7 bis 8,2% dieser Fälle endet das Ereignis tödlich. In Deutschland bedeutet dies 160.000-800.000 UAE-bedingte Krankenhaus-Fälle und ca. 10.000 bis 40.000 Todesfälle pro Jahr.
Die Anzahl der unerwünschten Arzneimittelereignisse (UAE), d.h. der medizinischen Ereignisse, die in Verbindung mit der Anwendung eines Arzneimittels auftreten, wird auf der Basis spezieller Meldesysteme und Spontanmeldungen in den Industriestaaten auf 1 bis 5% aller Krankenhausaufnahmen geschätzt. In 1,7 bis 8,2% dieser Fälle endet das Ereignis tödlich. In Deutschland bedeutet dies 160.000-800.000 UAE-bedingte Krankenhaus-Fälle und ca. 10.000 bis 40.000 Todesfälle pro Jahr.
Da die speziellen Meldesysteme gelegentlich als unzuverlässig und selektiv bewertet werden, untersuchten drei deutsche WissenschaftlerInnen jetzt mit den mit Sicherheit nicht durch Selektionseffekte und Meldesonderwege verzerrten DRG-Routinedaten aus dem gesamten Jahr 2006 die Häufigkeit des diagnostizierten Auftretens von UAEs in allen deutschen Krankenhäusern. Zur Identifikation der UAE-bedingten Krankenhaus-Aufnahmen wurden einschlägige ICD-Hauptdiagnosen herangezogen.
Unter den insgesamt 16.230.407 Krankenhaus-Fällen des Jahres 2006 erwiesen sich 0,92 % durch eine explizite Diagnose gesichert als UAE bedingt.
Zu den besonderen Ergebnissen der Analyse gehört, dass UAE-Fälle gegenüber Nichtbetroffenen eine verkürzte Verweildauer zeigten. Die Krankenhaussterblichkeit war mit einer Odds Ratio (OR) von 0,59 bei den UAE kleiner. Dagegen war der Anteil von Notaufnahmen wegen einer Fehlmedikation etc. mit einer OR von 3,10 erhöht. Fälle mit einem UAE waren häufig in der Inneren Medizin, Pädiatrie, Dermatologie, Intensivmedizin und Neurologie zu finden.
Auch wenn die AutorInnen die Aussagekraft der Routinedatenanalyse in diesem Zusammenhang positiv bewerten und für weitere Untersuchungen empfehlen, stehen z.B. die kürzere Verweildauer von UAE-Betroffenen, das niedrigere Alter und die geringere Mortalitätsrate im Widerspruch zu einigen anderen Studien.
Dabei kann es sich nach Meinung der AutorInnen um Effekte der DRG-Daten-Besonderheiten handeln. So führt die Vollerhebung z.B. dazu, dass die in anderen Meldesystemen meist nicht erfassten UAEs von Kindern und Jugendlichen über die DRG-Abrechnungsunterlagen erfasst wird. Ebenso könnte es sein, dass in diesen Datensätzen auch viele leichtere UAEs erfasst sind, die sonst nicht berichtet werden.
Selbst wenn DRG-Daten wahrscheinlich ein vollständigeres Bild dieser unerwünschten Ereignisse liefern, tragen bestimmte Besonderheiten aber auch zu einer Unterschätzung des Risikos bei. So besteht auch hier die Gefahr, dass bestimmte gesundheitliche Ereignisse nicht als UAE interpretiert werden und auch nicht als solche diagnostiziert werden. Da DRG-Diagnosen primär Abrechnungszwecken dienen, kann es auch sein, dass UAEs nur als Nebendiagnose auftauchen und daher in dieser Studie überhaupt nicht erfasst wurden.
Bei dem Anteil von 0,92% UAEs an allen Krankenhaus-Fällen, was 149.320 Fälle sind, handelt es sich also immer noch um eine Unterfassung und Unterschätzung des Risikos.
Dass der Auswertung von derartigen Routinedaten trotzdem ein fester Platz in der Analyse von UAEs eingeräumt werden sollte, belegen die WissenschaftlerInnen mit einem Vergleich von Routinedaten- und dem UAE-Meldesystem der Spontanberichte an die Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft: 2006 wurden 16.410 Krankenhaus-Fälle wegen einer Entzündung des Dünn- oder Dickdarms (Enterokolitis) durch das nach einer Antibiotikabehandlung als bösartiger Erreger agierende Clostridium difficile abgerechnet. Dem standen maximal 141 Fälle in den Spontanberichten gegenüber.
Von dem 2011 bisher nur in der Onlineausgabe der Zeitschrift "Gesundheitswesen" veröffentlichten Aufsatz "Stationäre Aufnahmen wegen unerwünschter Arzneimittelereignisse (UAE): Analyse der DRG-Statistik 2006" von Amann, C.; Hasford, J. und Stausberg gibt es kostenlos nur das Abstract.
Bernard Braun, 7.11.11
"Schmierentheater im OP" - Wie realistisch können, dürfen und müssen Placebokontrollen in der Neurochirurgie durchgeführt werden?
 Ob eine medizinische Therapie wirklich wirksam ist, kann nur der Vergleich mit den Behandlungsergebnis-sen in einer Placebogruppe zeigen - so das im Zeichen der Über- und Fehlversorgung mit Scheininnovationen und "Wundermitteln" zu Recht propagierte harte Kriterium der evidenzbasierten Medizin.
Ob eine medizinische Therapie wirklich wirksam ist, kann nur der Vergleich mit den Behandlungsergebnis-sen in einer Placebogruppe zeigen - so das im Zeichen der Über- und Fehlversorgung mit Scheininnovationen und "Wundermitteln" zu Recht propagierte harte Kriterium der evidenzbasierten Medizin.
Doch kann daran auch im Falle aufwändiger Operationen bei schweren Erkrankungen und gar den neuro-chirurgischen Interventionen festgehalten werden? Dienen vorgetäuschte oder Placebooperationen oder gar doppelblinde Operationen am Schädel bzw. Hirn, und seien sie technisch noch so raffiniert und täuschend echt (was sie ja auch sein müssen), aber wirklich noch dem erklärten Ziel oder verhindern sie etwa nützliche Therapien für schwerstkranke Menschen?
Diese und weitere Fragen werden in einem zuerst in der Wissenschaftszeitschrift "Nature" erschienenen und jetzt auf Deutsch im Wissenschaftsportal "Spektrumdirekt" zugänglichen Aufsatz der us-amerikanischen Wissenschaftsjournalistin Alla Katsnelson aufgeworfen, diskutiert und nicht endgültig beantwortet.
Die Autorin zeigt am Beispiel verschiedener operativer Therapien gegen die Parkinsonkrankheit zweierlei: Es gibt aufwändige und den Patienten schwer belastende und gefährdende Therapien, die sich im Nachhinein als unwirksam erwiesen haben. Es gibt aber weiterhin operative Therapien, die über eine Öffnung im Schädel verschiedene Zellen in das Hirn einfügen, von denen die Therapeuten vermuten und hoffen, dass sie den Erkrankungsverlauf von Parkinsonpatienten positiv beeinflussen.
Das Dilemma vor dem die Forderung nach einer Placebo-Kontrollgruppe steht, entsteht durch die Notwendigkeit, sowohl die Patienten als eigentlich auch die Operateure in der Kontrollgruppe doppelblind im Glauben zu lassen, sie würden operiert oder operierten wirklich. Dies wirft die quälende Frage auf, ob die Bohrung an der äußeren Haut der Schädeldecke aufhört oder auch in der Placebogruppe komplett durchgeführt wird und ob der Operateur dann auch noch "therapeutisch echte" Zellen implantiert.
Zu der Vielzahl weiterer ungeklärter Fragen zählt die Autorin, dass die Studien mit Placebokontrolle meist nur wenige TeilnehmerInnen haben, sehr teuer sind und trotzdem nur beschränkte Aussagekraft besitzen. Eine von ihr zitierte Studie, die gegen Parkinson fötale dopaminerge Nervenzellen einsetzt, kostet etwa bereits ohne jegliche Kontrolluntersuchung 12 Millionen Euro. Andere Studien zeigen aber gerade auch bei Parkinson-Patienten, dass allein die Vorstellung, die richtige Therapie erhalten zu haben, auch bei Empfängern eines Placebos nachhaltige positive Wirkungen erzielt.
Wer sich noch ausführlicher mit den Methoden und Problemen der aktuellen Parkinsontherapie und ihren wissenschaftlichen sowie ethischen Dilemmata befassen will, kann dazu die zahlreichen Links zu Fachaufsätzen etc. nutzen.
Die deutsche Übersetzung des Aufsatzes Ansturm auf die Scheinblockade. Vorgetäuschte Eingriffe am Gehirn drohen nützliche Therapien zu verhindern von Alla Katsnelson gibt es kostenlos im Wissenschaftsportal "Spektrumdirekt". Dieses Portal bietet auch zu vielen anderen überwiegend naturwissenschaftlichen Themen interessante, nach einer kurzen Anmeldung auch zum Teil kostenlose Beiträge.
Bernard Braun, 2.10.11
Weniger Entbindungen gleich höhere Komplikationsraten! Mindestmengen oder gezieltes Training für Geburtshelfer mit wenig Praxis?
 Für eine Reihe von Operationen gibt es Belege für einen unerwünschten Zusammenhang der pro Krankenhaus oder Chirurg durchgeführten Operationen mit der Behandlungs- oder Ergebnisqualität: Weniger Operationen gleich schlechterer Outcome und umgekehrt. In einer Reihe von Ländern, darunter auch der Bundesrepublik Deutschland, versucht die Gesundheitspolitik dies in Gestalt von Mindestmengenregelungen und damit des Ausschlusses von Operatueuren oder Behandlern zu berücksichtigen.
Für eine Reihe von Operationen gibt es Belege für einen unerwünschten Zusammenhang der pro Krankenhaus oder Chirurg durchgeführten Operationen mit der Behandlungs- oder Ergebnisqualität: Weniger Operationen gleich schlechterer Outcome und umgekehrt. In einer Reihe von Ländern, darunter auch der Bundesrepublik Deutschland, versucht die Gesundheitspolitik dies in Gestalt von Mindestmengenregelungen und damit des Ausschlusses von Operatueuren oder Behandlern zu berücksichtigen.
Ob es diesen Zusammenhang auch im Bereich der Entbindungen bzw. der Geburtshilfe gibt, wurde nun in einer USA-weiten retrospektiven Kohortenstudie auf der Basis von 380.000 Entbindungen in Krankenhäusern aus dem Jahr 2007 genauer untersucht. Dazu wurden die Krankenhäuser und Geburtshelfer nach der Anzahl ihrer Entbindungen eingeteilt. Der niedrigste Wert lag bei weniger als 7 Entbindungen pro Jahr, der höchste bei 90 und mehr Geburten pro Jahr. Außerdem wurden die Entbindungskomplikationen dokumentiert, darunter Infektionen, Thrombosen, schwere Dammverletzungen und nachgeburtliche Blutungen.
Nach einem Ausgleich der unterschiedlichen medizinischen und schwangerschaftsspezifischen Risikofaktoren zeigte sich als erstes keine konsistente Beziehung zwischen der Gesamtanzahl der Entbindungen in den Krankenhäusern und der Häufigkeit der ausgewählten Komplikationen. Dagegen war aber die Komplikationsrate bei den Entbindungen, die von individuellen Geburtshelfern mit dem geringsten Entbindungsvolumen erbracht wurden, um 50% höher als bei Geburtshelfern mit der höchsten Entbindungsrate. Die Komplikationsraten lagen bei 17,8% und 12,7% und der Unterschied war hochsignifikant. Nur in einem Punkt veränderte sich diese Assoziation: In Krankenhäusern mit einem höheren Volumen an Entbindungen war das Risiko einer Infektion signifikant höher als in Kliniken, die weniger Entbindungen machten. Die Mitberücksichtigung weiterer Charakteristika der Krankenhäuser oder die Häufigkeit von Kaiserschnittentbindungen wirkte sich auf das Komplikationsgeschehen nur wenig aus.
Angesichts dieser auf der Ebene einzelner Geburtshelfer eindeutigen Zusammenhänge, plädieren die WissenschaftlerInnen dafür, solche Ergebnisse nicht nur dazu zu nutzen, die Ergebnisqualität durch öffentliche Ergebnisberichterstattung und verfeinerte Rankinglisten über die Geburtshelfer zu verbessern. Neben einer vorrangigen Überweisung von Schwangeren an Geburtshelfer mit einer hohen Anzahl von Entbindungen sollten aber die Daten dazu genutzt werden, Geburtshelfer zu identifizieren, die zusätzliches Training und Unterstützung brauchen, um bessere Leistungen erbringen zu können.
Ob solche Effekte auch in Deutschland existieren, lässt sich mangels vergleichbarer und veröffentlichter Untersuchungen der hier beschriebenen Art nicht sagen. Sofern dies nachgeholt wird, sollten aber auf jeden Fall weitere Merkmale der Geburtshelfer (z.B. deren weitere Spezialisierung) miterfasst werden, deren Nichtberücksichtigung die US-AutorInnen als einen Mangel ihrer Studie bezeichnen.
Der Aufsatz "Hospital volume, provider volume, and complications after childbirth in U.S. hospitals" von Janakiraman V. et al. ist im September 2011 in der US-Fachzeitschrift "Obstetric Gynecology" (118: 521) erschienen, und ein Abstract ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 1.10.11
Krankenhausgeistliche: Anrührendes Relikt oder doch nützlich? Ein Beispiel aus der Kinder-Palliativbehandlung.
 Welchen Nutzen stiften die rund 10.000 Geistlichen in den Krankenhäusern der USA für Patienten, ihre Angehörigen, die traditionellen Berufsgruppen der Ärzte und Pflegekräfte und die immer größer werdende Schar von Case-, Care- oder Palliativ-Care-Manager? Oder stellen sie einfach nur ein Relikt aus der Zeit vor dem medizinisch-technischen Fortschritt dar?
Welchen Nutzen stiften die rund 10.000 Geistlichen in den Krankenhäusern der USA für Patienten, ihre Angehörigen, die traditionellen Berufsgruppen der Ärzte und Pflegekräfte und die immer größer werdende Schar von Case-, Care- oder Palliativ-Care-Manager? Oder stellen sie einfach nur ein Relikt aus der Zeit vor dem medizinisch-technischen Fortschritt dar?
Diese Frage stand im Mittelpunkt einer weitgehend qualitativen Pilotstudie im Auftrag des "The Hastings Center" und des "Rush University Medical Center" deren Ergebnisse im August 2011 veröffentlicht wurden. Genauer ging es darum, mehr über die Rolle und den Alltag von Geistlichen in Palliativ-Behandlungsteams für Kinder in Erfahrung zu bringen - aus Sicht von Ärzten und Geistlicher selbst. Dabei ist weitgehend akzeptiert und belegt, dass geistige oder spirituelle Hilfe oder Behandlung ein wichtiges Element bei der Schmerzbehandlung von Kindern ist und einen Teil der Probleme ernsthafter oder gar tödlicher Erkrankungen von Kindern für sie selber und ihre Familien bewältigen oder lindern hilft.
In der Pilotstudie sollte zusätzlich untersucht werden wie spirituelle Behandlung in etablierten Programmen zur kindbezogenen Schmerzbehandlung (so genannte "pediatric palliative care" [PPC]) geliefert wird und die Rolle von in den Programmen fest integrierten Geistlichen zu beschreiben.
Dazu untersuchten die Wissenschaftler 2009 zunächst 28 USA-weit verbreitete PPC-Programme und wählten daraus acht Programme zur weiteren Analyse aus, die länger als ein Jahr existierten, interdisziplinär besetzt waren, ausgebaute Verweisungsprozeduren besaßen und in der Lage waren, Daten über ihren Arbeitsaufwand zu liefern. Sieben Programme liefen in speziellen Kinderkliniken und eines in der Kinderabteilung einer Hochschulklinik.
In den acht Programmen wurden schließlich halbstrukturierte Interviews mit dem Geistlichen und dem medizinischen Direktor oder Chefarzt durchgeführt. Zu den Ergebnissen:
• Die Chefärzte beschrieben die Programm-Beiträge der überwiegend fest am Krankenhaus angestellten Geistlichen so: Als erstes erleichterten sie das geistig verursachte Leiden der jungen Patienten und ihrer Familien. Zweitens verbesserten Gespräche mit den Geistlichen die Kommunikation zwischen den Familien und dem Behandlungsteam über die Ziele der Behandlung. Zum Beispiel erfahren vor allem Geistliche mehr über die kulturellen oder religiösen Überezeugungen und Einstellungen der Familien, deren Kenntnis allen Teammitgliedern oft erst ermöglichte elterliche Entscheidungen, Ziele, Prioritäten und Werte zu verstehen. Drittens vermitteln Geistliche auch den anderen Teammitgliedern eine etwas andere oder aufmerksamere Sichtweise der Behandlung und Behandelten. Umso wichtiger ist daher die Erkenntnis der Untersuchung, dass Geistliche in der Regel zu den gut integrierten Mitgliedern der PPC gehörten.
• Die interviewten Geistlichen berichteten im Großen und Ganzen Ähnliches über ihre Rolle und Beiträge zur Behandlung der schwer erkrankten Kinder. Sie konzentrierten sich dabei aber mehr auf den Prozess ihrer Arbeit als darauf, wie sie zu besseren Ergebnissen führt.
• Beide Gruppen waren sich einig, dass es darauf ankommt, gemeinsam im Team zu lernen, wie man die Bedürfnisse der Patienten und ihrer Angehörigen nach geistiger Unterstützung besser befriedigt und ihre Erwartungen an Geistliche genauer erkennen lernt. Zudem müssen die bei Angehörigen verbreiteten Vorurteile beseitigt werden, Geistliche wären dann präsent, wenn der Tod des Kindes kurz bevor stünde oder wollten als Missionare ihrer eigenen religiösen Überzeugung auftreten.
Die Pilotprojektergebnisse werden von den ForscherInnen als Rechtfertigung angesehen, zukünftig noch intensiver darüber zu forschen, ob und wenn ja wie die Interventionen der Geistlichen die spirituellen Bedürfnisse der Patienten und ihrer Angehörigen treffen und welche organisatorischen Bedingungen hilfreich sind, geistige Unterstützung und Behandlung zu liefern.
Die Ergebnisse der Pilotstudie "The Role of Professional Chaplains on Pediatric Palliative Care Teams: Perspectives from Physicians and Chaplains" von George Fitchett et al., erschienen in der Fachzeitschrift "JOURNAL OF PALLIATIVE MEDICINE" (Volume 14, Number 6, 2011: 704-707) sind komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 24.8.11
Welche Verbesserungspotenziale gibt es bei der Krankenhausbehandlung, wie findet und hebt man sie und hilft dabei "peer review"?
 "Peer Review" ist bei wissenschaftlichen Publikationen fast schon ein Standardverfahren. Inhaltlich "Ebenbürtige" lesen und kommentieren dabei anonym Manuskripte und geben kritische Hinweise und Empfehlungen, die meist zu einer Verbesserung des Originaltextes führen.
"Peer Review" ist bei wissenschaftlichen Publikationen fast schon ein Standardverfahren. Inhaltlich "Ebenbürtige" lesen und kommentieren dabei anonym Manuskripte und geben kritische Hinweise und Empfehlungen, die meist zu einer Verbesserung des Originaltextes führen.
Warum dieses Verfahren also nicht auch für die Analyse von Versorgungsprozessen und die Fehleranalyse im Bereich der stationären Versorgung einsetzen? Eine freiwillige Qualitätsinitiative aus der Ärzteschaft, institutionalisiert in der "Initiative Qualitätsmedizin", hat diese Methode seit 2008 als eine "Ur-Methode" ärztlicher Qualitätssicherung entdeckt und seither Regeln und Standards für den "kollegialen Dialog mit Fachkollegen auf gleicher Augenhöhe und auf systematischer Basis" entwickelt. Die Regeln und Prozeduren sind im Frühjahr 2011 im Heft 16 des "Deutschen Ärzteblatts" veröffentlicht. 2009 wurden die ersten 21 Pilotprojekte durchgeführt, die u.a. von der Bundesärztekammer begleitet und evaluiert wurden.
Die Ergebnisse liegen nun vor.
Generell zeigt sich darin, dass es bei wesentlichen Bestandteilen des Versorgungsprozesses im Krankenhaus eklatante inhaltliche und organisatorische "Auffälligkeiten" gibt, ebenso wie grundsätzlich richtige Strategien, die lediglich an manchen Punkten verbessert werden können und müssen. Mit dem "Peer review" liegt ferner ein Verfahren vor, das auch bei kritisierten Ärzten weitgehend akzeptiert ist und dazu beitragen kann, den Bedarf zu erkennen und zu beeinflussen.
Zu den wichtigsten Ergebnissen gehört:
• Bei den 21 durchgeführten Peer Reviews betrug das durchschnittliche Optimierungspotenzial 64%. Dabei wichen Eigen- und Fremdbewertung in "nicht unerheblichem Maß" voneinander ab.
• In zwei Dritteln der 21 Kliniken war keine ausreichende Dokumentation der Krankheitsverläufe vor. So fehlten etwa Arbeitsdiagnosen, logische Darstellung von Therapieentscheidungen oder es war zu viel Irrelevantes dokumentiert. "Recht häufig" widersprachen sich auch Pflege- und ärztliche Dokumentation.
• In 57% aller untersuchten Kliniken sollten Schnittstellen im diagnostischen wie therapeutischen Bereich kritisch und zeitnah hinterfragt werden, ob sie für das jeweilige Behandlungsergebnis zielführend sind.
• Bei 52% der Häuser gab es Schwierigkeiten bei der medizinisch angemessenen Reaktion, von der Indikationsstellung über die zeitlichen Abläufe bis hin zu der Übernahme in Intensivstationen.
• Der Aufwand von vier Stunden Analyse von maximal 20 Behandlungsakten dirch den "Peer" und die nochmals drei bis vier Stunden dauernde Falldiskussion zwischen externen "Peers" und Chefarzt plus weitere Mitarbeiter des analysierten Krankenhauses reicht offensichtlich für die Zielsetzung aus und belastet die Krankenhäuser nicht zu stark.
• Obwohl also eine ganze Reihe von Chefärzten, Pflegeleitungen und Krankenhaus-Geschäftsführer von den ihnen "ebenbürtigen" Reviewern (meist auch Chefärzte) eine Reihe kritischer Rückmeldungen bekamen, bewegten sich ihre Beurteilungen des Verfahrens zwischen 1,9 (auf einer Skala von 1=sehr gut bis 10=schlecht) für die Atmosphäre bis 3,2 für das Ergebnis.
Ob aber die eindeutig vorhandenen Verbesserungspotenziale tatsächlich per "Peer review" gehoben werden konnten, und wie man dies misst, bleibt unklar, kann aber mit Sicherheit nicht allein an Sterblichkeitsindikatoren festgemacht werden. Unverständlich bleibt in diesem Zusammenhang, warum die weitere Unterstützung der externen Ebenbürtigen bei der Umsetzung von Verbesserungen "oftmals abgelehnt" wurde.
Den Aufsatz PEER REVIEW IM KRANKENHAUS. Evaluation zeigt: Es gibt noch Verbesserungspotenzial von Oda Rink aus dem "Deutschen Ärzteblatt" (Heft 27, 8. Juli 2011: A 1518-20) gibt es kostenlos.
Bernard Braun, 8.7.11
Unerwünschte Folgen der Fallpauschalen in Krankenhäusern für die Rehabilitation: Aktuelle Ergebnisse der REDIA-Studie
 Die Zahl der Patienten, die bei Aufnahme in eine Rehabilitationsmaßnahme vermehrt unter Komplikationen litten sowie einen deutlich verschlechterten Gesundheits- und Mobilitätszustand aufwiesen, stieg seit der Einführung des Fallpauschalen- oder DRG-Systems in deutschen Akutkrankenhäusern stabil an.
Die Zahl der Patienten, die bei Aufnahme in eine Rehabilitationsmaßnahme vermehrt unter Komplikationen litten sowie einen deutlich verschlechterten Gesundheits- und Mobilitätszustand aufwiesen, stieg seit der Einführung des Fallpauschalen- oder DRG-Systems in deutschen Akutkrankenhäusern stabil an.
So stieg etwa der der Anteil von Hüftpatienten, die wegen Schmerzen und geklammerten Wundnähten in der ersten Woche nicht an der Physiotherapie, also der eigentlichen Leistung in der Rehabilitation, teilnehmen konnten, von 5,6 % auf 39,4 %. Deutlich nahm auch der Medikationsaufwand in der Reha zu: die Verabreichung von Herz entlastenden Nitraten wuchs von 1,2 % (2003) auf 33,3 % (2010) und die Gabe von Schmerzpräparaten nahm von 4% auf 32 % zu. Die Einnahme von Blutverdünnern entwickelte sich gar von 3,1 % (2003) auf 57,4 % (2010) bei kardiologischen Patienten. Dies sind akutmedizinische Maßnahmen, die eigentlich nichts mehr in der Rehabilitationsphase zu suchen haben, d.h. deren Ziel beeinträchtigen kann.
Zusätzlich zu der offensichtlich zunehmenden Entlassung von noch akutmedizinisch behandlungsbedürftigen Patienten aus dem Krankenhaus in die Rehabilitation gab es aber auch noch vermehrt Probleme mit dem Verlegungs- oder Entlassungsmanagement der Krankenhäuser oder der sonstigen für eine nahtlose und zügige Versorgung verantwortlichen Akteure und Institutionen (z.B. auch die Gesetzliche Krankenversicherung.
Diese auch bereits im Berliner/Bremer Forschungsvorhaben "Wandel von Medizin und Pflege im DRG-System (WAMP)" mehrfach festgestellte unerwünschte Auswirkung oder nicht zu der DRG-Einführung passende Entwicklung führt u.a. zu einer Verlängerung der Übergangszeit zwischen Entlassung aus dem Krankenhaus und der Aufnahme in der Reha-Klinik führt. Diese häusliche Übergangszeit ist - so die REDIA-Studie - mit therapeutisch und ökonomisch relevanten Risiken verbunden: Häufig wird die Thromboseprophylaxe unterbrochen und die Wundversorgung erfolgt nicht fachgerecht; in 2003 waren 1,8% der kardiologischen Patienten von Komplikationen wie Pleuraerguß und Wundheilungsstörungen während der Übergangszeit betroffen, in 2010 dagegen 18%.
Das sind einige der gesicherten Erkenntnisse der aktuell veröffentlichten Ergebnisse der so genannten REDIA-Studie (REhabilitation und DIAgnosis Related Groups-Studie) aus dem Centrum für Krankenhaus-Management an der Universität Münster.
Die Mitarbeiter dieses Instituts gehören zu den wenigen WissenschaftlerInnengruppen, die trotz der jahrelangen Blockade des Beginns der gesetzlich vorgeschriebenen inhaltlich hochwertigen Begleitforschung begannen, die Auswirkungen der Einführung des Fallpauschalen-Vergütungssystems der Diagnosis related groups (DRG) zu erforschen. REDIA ist die einzige prospektive, multizentrische, zufallsgesteuerte Langzeitstudie über die Auswirkungen der DRG-Einführung im Akutbereich auf medizinische Leistungsanforderungen und Kosten in der Rehabilitation.
Mit Unterstützung der "Deutschen Rentenversicherung" untersuchten die Münsteraner Forscher seit 2003, ob die durch das DRG-System ausgelösten Aktivitäten, die Liegezeit und die Versorgungskosten in den Akutkrankenhäuser zu senken zu unerwünschten Effekten für andere Behandlungsbereiche und vor allem die PatientInnen führt.
Dies geschah in drei Erhebungsphasen 2003/04 vor DRG-Einführung;2005 und 2007 während der Konvergenzphase sowie 2009/10 und 2011 nach Ende der Konvergenzphase. Dabei wurden patientenindividuelle (Depression und Angst umfassende), medizinische (den Patientenzustand beschreibende), ökonomische (Arbeitsaufwand und Kosten berücksichtigende), entgeltbezogene (die Entwicklung der Vergütung von Reha-Leistungen zeigende) und systemische (die Anreizwirkungen von politischen Eingriffen in das Gesundheitssystem reflektierende) Daten von 956 Anschlussheilbehandlung (AHB)-Patienten der Kardiologie (Bypass-OP; Myokardinfarkt) und 1.334 Patienten der Orthopädie (Hüft-TEP; Knie-TEP; Bandscheiben-OP) in 27 ausgewählten stationären und ambulanten Reha—Einrichtungen erfasst. Die medizinischen Patientendaten (Laborwerte, Medikation, Morbidität) wurden über Fragebögen durch die behandelnden Ärzte erhoben. Die Patienten individuellen Daten zur persönlichen Befindlichkeit (Mobilität, Angst, Depression) wurden abgefragt bei Aufnahme des Patienten in die Reha sowie sechs Monate nach Entlassung.
Die Auswahl der Patienten erfolgte zufällig, so dass sowohl Patienten der Rentenversicherung als auch der gesetzlichen Krankenversicherung repräsentiert sind und die Scheregrade der Patienten sind zufallsverteilt abgebildet. Die darüber hinaus durchgeführte Strukturerhebung in Verbindung mit einer Mitarbeiterbefragung machte die Veränderungen im Arbeitsaufwand, in der Organisation sowie der baulichen und technischen Ausstattung transparent.
Die kompletten Ergebnisse der Studie finden sich in dem von Wilfried von Eiff, Stefan Schüring und Christopher Niehues verfassten Buch "REDIA: Auswirkungen der DRG-Einführung auf die medizinische Rehabilitation. Ergebnisse einer prospektiven medizin-ökonomischen Langzeitstudie 2003 bis 2011", das 2011 im LIT-Verlag Münster erschienen und im Buchhandel erhältlich ist.
Einen kostenlosen Überblick zu den genannten und weiteren Ergebnissen liefert unter dem Titel "Rehabilitation unter Kosten- und Qualitätsdruck Konsequenzen der DRG-Einführung für Patienten und Versorgungsstruktur" ein kurzer Text des Projektleiters Wilfried von Eiff.
Bernard Braun, 24.5.11
Verpasste Chance: Wie der Gemeinsame Bundesausschuss wider besseres Wissen wenig zur Verbesserung des Qualitätsberichts tat!
 Am 5. Mai 2011 treten durch die Veröffentlichung im Bundesanzeiger Änderungen der Regelungen zum Qualitätsbericht der Krankenhäuser nach § 137 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 SGB V in Kraft, die der auch dafür zuständige Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) bereits am 16. Dezember 2010 verabschiedet hatte.
Am 5. Mai 2011 treten durch die Veröffentlichung im Bundesanzeiger Änderungen der Regelungen zum Qualitätsbericht der Krankenhäuser nach § 137 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 SGB V in Kraft, die der auch dafür zuständige Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) bereits am 16. Dezember 2010 verabschiedet hatte.
Alle relevanten Texte dieser Änderung und einige Begründungen etc. für deren Notwendigkeit finden sich in der gewohnt vorbildlichen Dokumentationsqualität des "kleinen Gesetzgebers" auf seiner Website.
In einem dieser Texte findet sich dann auch als Ziel des reformierten Qualitätsberichts folgendes: "Ziel ist eine unverfälschte Darstellung des Krankenhauses und seiner Standorte als umfassende Informationsgrundlage für alle Interessierten."
Außerdem hebt der G-BA hervor, er habe bei seinen Änderungsvorschlägen auch die "Ergebnisse eines Forschungsauftrags zur Evaluation der Qualitätsberichte auf der Basis einer Krankenhaus-, Patienten- und Einweiserbefragung durch das Institut für Gesundheitssystemforschung der Universität Witten/Herdecke … in die Überarbeitung der Qb-R mit einbezogen."
Wer diesen im August 2010 erschienenen Bericht noch in Erinnerung hat oder ihn zu diesem Anlass ansieht, findet dort die folgenden
"Hauptergebnisse:
• A) Die befragten Patienten kannten im Allgemeinen die QB (Qualitätsberichte) nicht. Mit den vorgelegten pdf-Berichten konfrontiert, verstanden sie sie nicht und hielten die Berichtsinhalte nur in geringem Umfang für hilfreich. Anstatt auf der Basis objektiver Informationen, erfolgte die Krankenhauswahl durch die befragten Patienten auf der Basis von Vertrauen in die fachliche und menschliche Kompetenz der Behandler.
• B) Ärzte nutzen als Basis ihrer Patientenberatung zu Einweisungsentscheidungen zum Teil genau die Informationen, die ihnen die Berichte bieten könnten. Jedoch kannten weniger als die Hälfte der Ärzte die Berichte und nur jeder zehnte Arzt hat die QB zu diesem Zweck bereits eingesetzt. Viele Kriterien, auf die sich Ärzte bei ihren Beratungen stützen, sind jedoch bislang nicht in den Berichten enthalten.
• C) Die befragten Krankenhäuser hielten die QB mehrheitlich für geeignet, die Art und Anzahl ihrer Leistungen darzustellen, aber eher ungeeignet, die Qualität der erbrachten Leistungen abzubilden. Das Verhältnis von Nutzen zu Aufwand wird überwiegend als nicht angemessen angesehen. Die Krankenhäuser sehen Verbesserungsbedarf im Hinblick auf die Darstellungsweise, Ausführlichkeit, Laienverständlichkeit und Gestaltungsfreiheit. Trotzdem werden die vorliegenden QB für andere externe oder interne Zwecke genutzt.
• Fazit: Die Ergebnisse der Befragungen der drei Zielgruppen verdeutlichen, dass die QB in der vorliegenden Form die definierten Zwecke a) Patienten bei der Krankenhaussuche zu unterstützen, b) einweisenden Ärzten als Instrument der Patientenberatung zu dienen und c) Krankenhäusern die Möglichkeit zu bieten, ihre Leistungen nach Art und Qualität dazustellen, nur unzureichend erfüllen. Ohne strukturierte Informationen zur Qualität der Krankenhausversorgung ist aber eine patientenorientierte Gestaltung des Gesundheits-wesens nicht denkbar. Für die Zukunft bietet sich an, auf die pdf-Berichte zu verzichten und den Datensatz für die QB weiterzuentwickeln. Ziel sollte ein konsentierter, mit vergleichbaren, möglichst auditierten Informationen aus den Krankenhäusern bestückter Datensatz ein, der um strukturiert erfasste Einschätzungen von Patienten und Ärzten ergänzt wird. Der Datensatz sollte den verschiedenen Nutzergruppen zur Verfügung gestellt werden, damit diese die Daten in vielfältiger, nutzergerechter Form aufbereiten können."
Damit bestätigte und untermauerte der Bericht zum Teil die seit Jahren von allen Seiten geäußerte und Mängel und Kritikpunkte.
Wer sich daraufhin die G-BA-Änderungen ansieht, steht vor einem weiteren, der für das deutsche Gesundheitssystem nicht seltenen Gegensätze zwischen dutzendfach gesichertem und konsentierten Wissen und maximal minimalsten und vorwiegend formalen Veränderungen.
Statt ebenfalls bereits bekannte und im Ausland erprobte Lösungen für die oben beschriebenen Hauptprobleme des Qualitätsberichts aus Sicht aller relevanter NutzerInnen vorzulegen, beschränkt sich der "Reformschwung" des G-BA u.a. auf eine Verlängerung der Abgabefrist um 15 Tage, die Verpflichtung künftig 100% und nicht nur 80% der Diagnosen zu dokumentieren, die Vorschrift, dass Freitextangaben "umgangssprachliche Bezeichnungen" verwenden und nicht umfangreicher als 5 MB sein sollen, die Angabe der teilstationären Fallzahl und eine bessere Darstellung des speziellen therapeutischen Personals - wobei die beiden letzten Änderungen wirkliche Verbesserungen darstellen. Kein Wort aber über irgendwelche krankenhausbezogene Indikatoren für die Ergebnisqualität, Komplikationen, unerwünschte Krankenhausinfektionen etc.
Wie der G-BA und/oder die Gesundheitspolitik mit einem derartigen Reformeifer jemals das Ziel eines aus Sicht der PatientInnen (aus wessen Sicht denn sonst?) bekannten, aussagekräftigen, verständlichen, hilfreichen und akzeptierten Qualitätsberichts erreichen will, bleibt sein Geheimnis.
Der nach diesen "Änderungen" uneingeschränkt aktuelle Abschlussbericht zum Forschungsauftrag zur Verbesserung der gesetzlichen Qualitätsberichte auf der Basis einer Krankenhaus-, Patienten- und Einweiserbefragung. Revidierte Fassung auf der Basis der Diskussionen in der AG Qualitätsbericht des UA Qualitätssicherung des G-BA von M. Geraedts, S. Auras, P. Hermeling, W. de Cruppé vom Institut für Gesundheitssystemforschung der Universität Witten/Herdecke aus dem August 2010 steht komplett und kostenlos zur Verfügung.
Die Bekanntmachung eines Beschlusses des Gemeinsamen Bundesausschusses über eine Änderung der Regelungen zum Qualitätsbericht der Krankenhäuser vom 16. Dezember 2010 gibt es auch kostenlos zum Lesen.
Bernard Braun, 4.5.11
Telemedizin paradox: Geringere Sterblichkeit, weniger Krankenhausaufenthalte, kürzere Aufenthalte in Intensivstationen, aber ...!
 Eine der großen Erwartungen an das Tele-Monitoring als einer der am weitesten entwickelten Techniken der Tele-Medizin ist, dass man durch die kontinuierliche Überwachung bestimmter Körperwerte (z.B. Blutdruck oder andere Blutwerte, Blutzucker) z.B. mittels implantierter Sensoren und die automatische kontinuierliche oder regelmäßige Übermittlung an behandelnde Ärzte rechtzeitig kritische Veränderungen erkennen und durch telemedizinische Instrumente wiederum von außen spezifisch intervenieren kann. Der mögliche Nutzen könnte eine Verringerung der Anzahl von Krankenhausaufenthalte und die Verkürzung von Krankenhausaufenthalten oder sogar die Vermeidung kritischer oder gar tödlicher Ereignisse sein.
Eine der großen Erwartungen an das Tele-Monitoring als einer der am weitesten entwickelten Techniken der Tele-Medizin ist, dass man durch die kontinuierliche Überwachung bestimmter Körperwerte (z.B. Blutdruck oder andere Blutwerte, Blutzucker) z.B. mittels implantierter Sensoren und die automatische kontinuierliche oder regelmäßige Übermittlung an behandelnde Ärzte rechtzeitig kritische Veränderungen erkennen und durch telemedizinische Instrumente wiederum von außen spezifisch intervenieren kann. Der mögliche Nutzen könnte eine Verringerung der Anzahl von Krankenhausaufenthalte und die Verkürzung von Krankenhausaufenthalten oder sogar die Vermeidung kritischer oder gar tödlicher Ereignisse sein.
Sowohl generell für die Existenz von Nutzen als auch für seinen Umfang oder die Anzahl der tatsächlichen Nutznießer (z.B. liegt erst seit kurzem eine hochwertige Studie über die Nutznießer von Telemonitoring mit Herzinsuffizienz in Deutschland vor) liefern die noch überschaubare Anzahl der vorliegenden methodisch hochwertigen und auch über längere Zeit durchgeführten Studien zum Teil weniger euphorische Belege oder hinterlassen mehr Fragen als Antworten. Bevor es also darum geht, ob Tele-Leistungen z.B. zur GKV-Regelleistung werden, sollten weitere möglichst mehrjährige Studien abgewartet werden.
Die Ergebnisse einer jetzt in den USA abgeschlossenen Studie zum positivenEinfluss eines so genannten "Champion heart sensor" auf die Notwendigkeit von Krankenhausbehandlung bei an Herzinsuffizienz erkrankten Personen setzt aber die Reihe von Untersuchungen fort, die einerseits einen bestimmten quantifizierbaren Nutzen nachweisen, andererseits aber paradoxe Effekte zu Tage fördern.
An der offen industriegesponserten randomisierten kontrollierten Studie nahmen 550 Personen (Durchschnittsalter 61, 70% Männer) teil, die wenigstens drei Monate an Herzinsuffizienz litten und innerhalb des letzten Jahrs einen spezifischen Krankenhausaufenthalt hatten. Alle TeilnehmerInnen erhielten einen drahtlosen Sensor in die Lungenarterie implantiert, der kontinuierlich den dortigen Blutdruck maß. Die Ergebnisse wurden aber nur an die Ärzte übertragen, deren Patienten zufällig für die Behandlungsgruppe ausgewählt worden waren. Die ebenfalls zufällig ausgewählte Kontrollgruppe erhielt die normale Behandlung, wobei die Bestimmung des Blutdrucks und mögliche Schlussfolgerungen für die Behandlung einen Arztbesuch erforderte. Gegenüber den Patienten war verblindet in welcher Gruppe sie sich befanden.
Nach 6 Monaten sahen die erwarteten Wirkungen so aus:
• Die Rate der erkrankungsspezifischen Krankenhausaufenthalte war in der Interventionsgruppe nach 6 Monaten signifikant niedriger als in der Kontrollgruppe (31% versus 44%). Aus der absoluten Differenz von 13 Prozentpunkten wird eine Reduktion von rund 30 Prozent gemacht.
• Nach durchschnittlich 15 Monaten Follow up war die Krankenhausrate in der Behandlungsgruppe um 39% niedriger als in der Kontrollgruppe (56,7% versus 90,4).
• Auch der Anteil von PatientInnen in der Tele-Behandlungsgruppe, die in den 6 Studienmonaten ins Krankenhaus eingeliefert werden musste, war mit 20% signifikant niedriger als die 29% in der Kontrollgruppe.
• Die Überlebensrate beider Gruppen unterschied sich den 6 Monaten fast nicht.
• Die mit einem Standardinstrument gemessene Lebensqualität war in der Behandlungsgruppe besser.
• Kein Teilnehmer erlebte in 15 Monaten Beobachtungszeit ein Versagen des Druckmessgeräts. Und auch bei 98,6% aller TeilnehmerInnen ereignete sich innerhalb derselben Zeit kein unerwünschtes Ereignis mit dem implantierten Sensor wie z.B. Blutungen. 8 TeilnehmerInnen erlewbten aber insgesamt 15 Komplikationen.
• Ein Wechsel zu einer spezifischen Arzneimitteltherapie war in der telemedizinisch versorgten Patientengruppe signifikant höher als in der traditionell versorgten Gruppe.
• Mit der Feststellung, dass die Anzahl der Krankenhausaufenthalte, die nichts mit der Herzinsuffizienz zu tun hatte, sich zwischen den beiden Gruppen praktisch nicht unterschied (146 versus 143) beginnt der Teil paradoxer Ergebnisse: Auch wenn der Unterschied statistisch signifikant ist, ist die Anzahl von Tagen, welche die Angehörigen beider Gruppen in den 6 Studienmonaten außerhalb eines Krankenhauses verbrachten, mit 174 zu 172 Tagen nahezu identisch. Leider wird dieses Phänomen weder angesprochen noch zu erklären versucht.
Je nachdem, ob man aus Patientensicht lediglich die Krankenhausliegezeiten durch die Herzschwäche betrachtet oder den Nutzen eher an der Gesamtdauer aller Krankenhausaufenthalte in einem bestimmten Zeitraum bemisst, fällt also die Nutzenbewertung der telemedizinischen Intervention aus.
Dass es bei einer Gesamtbetrachtung einer Behandlungsepisode im Vergleich zu der Bewertung einzelner Behandlungselemente bei denen Telemonitoring oder -medizin eine tragende Rolle spielen zu unerwarteten oder paradoxen Effekten kommen kann, belegt ein ebenfalls gerade veröffentlichter systematischer Review samt Meta-Analyse über 13 methodisch in Frage kommenden Studien über die Wirkung von Telemedizin in 35 Intensivstationen (IS), die bis zum 30. September 2010 weltweit durchgeführt wurden. Eingeschlossen wurden Studien, welche Daten zum primären Ergebnis der Sterblichkeit und zum sekundären Ergebnis der Liegedauer in Intensivstationen und Krankenhaus lieferten.
Die Vorher-Nachher-Analyse dieser Ergebnisse für 41.374 Patienten (15.667 vor und 25.707 nach Einführung telemedizinischer Überwachungstechnik in Intensivstationen) zeigte folgende Wirkungen:
• Die Einführung von Telemedizin war mit einer signifikanten Abnahme der Sterblichkeit in den IS von rund 20% assoziiert. Sie war ebenfalls signifikant mit einer Reduktion der Liegezeiten in IS um 1,26 Tagen assoziiert.
• Keine signifikanten und damit überzufälligen sowie quantitativ relevanten Assoziationen gab es aber zum ersten zwischen dem Einsatz von Telemedizin in IS und der gesamten Sterblichkeit der in IS eingelieferten PatientInnen bezogen auf den gesamten Krankenhausaufenthalt. Letztere wurde bei einem p-Wert von 0,08 um rund 18% reduziert. Zum anderen war Gesamtliegedauer von PatientInnen, die meist zu Beginn ihres Klinikaufenthalts in der IS behandelt wurden, innerhalb des Krankenhauses nur noch um 0,64 Tage kürzer - bei einem p-Wert von 0,16.
Auch die AutorInnen dieses Reviews können nicht schlüssig erklären wie es zu ihren disparaten Funden kommt und fordern daher mit Vorrang noch rigorosere Evaluation der Wirkungen von Telemedizin in IS. Sie liefern dazu eine Reihe von zu beachtenden möglichen Erklärungsfaktoren. Dazu gehört z.B. die Tatsache, dass in vielen Evaluationsstudien von Telemedizin in IS nur auf die dortige Sterblichkeit geschaut wird und nicht auf das gesamte stationäre Sterberisiko. Ein weiterer möglicher Erklärungsfaktor für Studienergebnisse über positive Wirkungen von Telemedizin könnten die engen Verbindungen der AutorInnen dieser Studien mit den Herstellern telemedizinischer Technologien sein. Die großen Konfidenzintervalle ihrer Ergebnisse deuten auch methodisch auf eine gewisse Instabilität und Kontingenz der Wirkungen hin zu der dann auch die disparaten Ergebnisse passen. Dies eröffnet die wahrlich breite und auch offen ratlose Perspektive, dass die Telemedizin-Versorgung "could have a much larger effect or no effect whatsoever".
Von der Studie "Wireless pulmonary artery haemodynamic monitoring in chronic heart failure: A randomised controlled trial" von Abraham WT und zahlreichen weiteren Angehörigen der CHAMPION Trial Study Group, veröffentlicht in der britischen Fachzeitschrift "Lancet" am 19. Februar 2011 (377 (9766):616-8), ist kostenlos nur das Abstract zu erhalten.
Die Studie "Impact of Telemedicine Intensive Care Unit Coverage on Patient Outcomes. A Systematic Review and Meta-analysis" von Lance Brendan Young et al. ist am 28. März 2011 in der Fachzeitschrift "Archives of Internal Medicine" (2011; 171 (6):498-506. doi:10.1001/archinternmed.2011.61) erschienen. Von ihr ist ebenfalls nur ein Abstract kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 4.4.11
Wie gut vorbereitet sind Krankenhäuser auf schwere Katastrophen à la Japan? Beunruhigende Ergebnisse einer US-Krankenhausbefragung
 Wie schnell sich die "Alles-ist-sicher"- und "Wir-haben-alles-im-Griff"-Rhetorik von Unternehmen und Politik im Bereich technischer Verfahren im wahrsten Sinne des Wortes in lebensgefährlichen Rauch auflösen kann, konnte und kann man an den Folgen des Erdbebens, Tsunamis und der gewaltigen Störfälle im Atomkraftwerk Fukushima leider in allen Details studieren.
Wie schnell sich die "Alles-ist-sicher"- und "Wir-haben-alles-im-Griff"-Rhetorik von Unternehmen und Politik im Bereich technischer Verfahren im wahrsten Sinne des Wortes in lebensgefährlichen Rauch auflösen kann, konnte und kann man an den Folgen des Erdbebens, Tsunamis und der gewaltigen Störfälle im Atomkraftwerk Fukushima leider in allen Details studieren.
Wer dabei sieht, dass in einem der reichsten Industrieländer der Welt, gebrechliche und kranke Personen in unterkühlten Turnhallen oder zuletzt auch in Tokioter 5-Sterne-Hotels notdürftig untergebracht wurden, sollte sich fragen, wie die gesundheitliche Versorgung in vergleichbaren Katastrophenfällen eigentlich in anderen, ärmeren wie reicheren Ländern aussehen würde.
Welche Funde eine entsprechende Recherche zu Tage fördern kann, zeigt ein gerade für die USA veröffentlichter offizieller Bericht, der sich auf Daten des "National Hospital Ambulatory Medical Care Survey" aus dem Jahr 2008 stützt. Dessen spezifischen Fragen nach der Vorbereitung auf sechs näher bezeichnete Typen von Katastrophen wurde von 294 der insgesamt 395 befragten repräsentativen Krankenhäuser beantwortet zurückgeschickt. Bei den Katastrophenkonstellationen handelt es sich um den pandemischen Ausbruch von Krankheiten, Bioterror-Attacken, chemischen Unfällen oder Angriffen, nukleare, mit Strahlung verbundene Ereignisse, große Explosionen und Feuersbrünste sowie große Naturkatastrophen wie z.B. Erdbeben.
Die Ergebnisse lauten im Einzelnen:
• Nahezu alle befragten Krankenhäuser hatten für irgendeine der Katastrophen Aktionspläne.
• Nur 68% der Krankenhäuser hatten aber Pläne für den Umgang mit allen sechs Katastrophensorten.
• Am wenigsten Pläne gab es für den Fall und die Folgen eines nuklearen Unfalls mit Verstrahlungen und eine große Brandsatzexplosion. Sie fehlten in jeweils gut 20 % der Krankenhäuser. Obwohl der einzige große AKW-Unfall vor Tschernobyl in den USA stattfand, und einige kalifornische AKW in vergleichbaren Erbebenrisikogebieten stehen wie das jetzt am Rande des GAU stehende japanische AKW war auch in den USA offensichtlich die Meinung verbreitet, die eigenen AKWs seien "sicher".
• Mehr als 95% der Kliniken hatten aber Pläne für den Fall von Naturkatastrophen und Chemieunfälle.
• Ein Hauptmangel war die Dominanz von Plänen welche die beim Anstrum zu vieler Patienten notwendige Zusammenarbeit mit anderen Krankenhäusern und anderen Gesundheitsversorgungseinrichtungen vernachlässigten bzw. nicht geregelt hatten. Beispielsweise hatte ein Viertel der Kliniken keine Pläne wie die örtlichen Kapazitäten im Falle einer großen Anzahl von zu versorgenden Katastrophenopfer mobilisiert werden könnten. Ferner hatten 40% der Kliniken keine Vereinbarungen mit spezialisierten Zentren zur Behandlung von Verbrennungspatienten.
• Während immerhin 88% der Krankenhäuser angaben, sie hätten schriftliche Arrangements mit anderen Kliniken, bei Überfüllung erwachsene Patienten zu übernehmen, hatten nur 56,2 % aller Häuser solche Vereinbarungen zur Übernahme von Kindern. Die potenzielle Versorgung von Kindern (dazu gehören z.B. auch Hilfen bei der Wiederzusammenführung von Familien) und Behinderten sah insgesamt bei mehr als der Hälfte der Krankenhäuser schlecht aus.
• Schließlich gab es bei beinahe 40 % aller Krankenhäuser keinen Plan, wie man ihre Kapazität zur Lagerung von Leichen erweitern kann.
• Dennoch gibt es aber auch Positives zu berichten: Die große Mehrheit der Krankenhäuser hat in ihre Planungen andere lokale Akteure wie die Feuerwehr oder die örtlichen öffentlichen Gesundheitseinrichtungen einbezogen.
Bevor man weiter sagt oder hofft, in Deutschland träten natürlich nie solche Katastrophen ein und selbst im eigentlich unmöglichen Fall sähe dann versorgungsmäßig alles gut aus und funktioniere, wäre ein dem US-Beispiel ähnelnder nationaler Bericht beruhigender.
Den von den staatlichen "Centers of Disease Control (CDC)" verbreiteten 15-seitigen "Report "Hospital Preparedness for Emergency Response: United States, 2008" von Richard W. Niska und Iris M. Shimizu (National Health Statistic Reports 24. März 2011; Nummer 37) gibt es kostenlos im Internet.
Bernard Braun, 28.3.11
Haben sich die Arbeitsbedingungen von Pflegekräften in Krankenhäusern zwischen 2003 und 2008 verändert und wie?
 Veränderten sich die Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte in deutschen Krankenhäusern während und durch die Einführung von sog. diagnosebezogenen Fallpauschalen ("diagnosis related groups (DRG)") im Zeitraum von 2003 bis 2008? Und wenn ja, wie?
Veränderten sich die Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte in deutschen Krankenhäusern während und durch die Einführung von sog. diagnosebezogenen Fallpauschalen ("diagnosis related groups (DRG)") im Zeitraum von 2003 bis 2008? Und wenn ja, wie?
Diese Frage untersuchte das vom Wissenschaftszentrum Berlin (WZB) und dem Zentrum für Sozialpolitik (ZeS) der Universität Bremen durchgeführte Forschungsprojekt "Wandel von Medizin und Pflege im DRG-System (WAMP)" - auf dessen Ergebnisse in diesem Forum schon mehrere Male hingewiesen wurde - u.a. durch eine dreimalige schriftlich standardisierte Befragung jeweils repräsentativer Stichproben examinierter Pflegekräfte in den Jahren 2003, 2006 und 2008. Ohne die organisatorische und finanzielle Unterstützung durch die frühere Gmünder Ersatzkasse (GEK), die Hans Böckler Stiftung, die Robert Bosch Stiftung und die Techniker Krankenkasse wären diese Erhebungen nicht möglich gewesen.
Die Ergebnisse sind nun in einer gesonderten Publikation zugänglich. Die wesentlichen Erkenntnisse lauten:
• "DRG verstärken die Auswirkungen von Kostendruck auf die Behandlungswirklichkeit": Eine ausführliche Pflegeaufnahme findet regelhaft ("immer" und "überwiegend") unter DRGBedingungen deutlich seltener statt (Rückgang um 9 Prozentpunkte von 43 in 2003 auf 34 Prozent in 2008), obwohl unter der Bedingung abnehmender Liegezeiten und in Verbindung mit der Zunahme des Anteils schwerer und pflegeintensiver Fälle (u. a. durch mehr ambulante Operationen) eine umfassende Aufnahme für die zielgerichtete Pflege unter Zeitdruck sinnvoll erscheint. Insgesamt ist der Anteil der Pflegekräfte, die einen eher negativen Einfluss der DRG auf die Durchführung notwendiger Behandlungen wahrnehmen bei 43 Prozent konstant geblieben, während nur 14 (2006) bzw. 13 Prozent (2008) einen eher positiven Einfluss wahrnehmen. Der Anteil der Pflegekräfte, die für ihren Alltag der Feststellung zustimmen, die Patienten in ihrem Haus würden tendenziell auf dem Stand der medizinischen Erkenntnis versorgt ("beste Leistungen") ist von 63 Prozent (2006) auf 60 Prozent (2008) zurückgegangen.
• "DRG stellen bei Pflegekräften das traditionelle berufliche Selbstverständnis in Frage": Während 2008 der sehr allgemein gehaltenen Frage "Lege Wert auf eine würdevolle Behandlung der Patienten" von 79 Prozent (2003: 88 Prozent) der Pflegekräfte zugestimmt wird, ist dies bei der stärker konkretisierten Frage, ob man eine "soziale und emotionale Zuwendung" (psychosoziale Versorgung) grundsätzlich als zur Versorgung der Patienten zugehörig empfinde, mit 66 Prozent (2003: 69 Prozent) um 13 Prozentpunkte geringer.
• "DRG verbessern die Entlassung aus dem Krankenhaus und die Überleitung in nachgeordnete Versorgungsformen nicht": Ein großer Verbesserungsbedarf besteht offensichtlich bei der Organisation der Entlassung aus dem Krankenhaus: Nur etwa 56 % der befragten Pflegekräfte bestätigten im Jahr 2003, also vor der verbindlichen Einführung der DRG, die Existenz eines Entlassungsmanagements. Fünf Jahre später hat sich die Situation formal nicht verbessert und inhaltlich sogar verschlechtert: Während 2003 für 37 Prozent der Befragten das Entlassungsmanagement gut funktioniert, sind es 2008 nur noch 32 Prozent.
• "DRG fördern die Kooperation und den patientenbezogenen Informationsfluss zwischen den Berufsgruppen im Krankenhaus nicht.": Der Informationsfluss hat sich daher unter DRG-Bedingungen verschlechtert, obwohl beschleunigte Abläufe vermehrte Kommunikation erfordern, um beispielsweise (Behandlungs-)Fehler zu vermeiden. So ist etwa der Anteil der Pflegekräfte, die einen schlechten Einfluss der DRG auf die Zusammenarbeit mit Ärzten wahrnehmen, von 24 Prozent in 2003 auf 35 Prozent in 2008. Und auch die - formellen - Kommunikationsstrukturen unter DRG-Bedingungen haben sich eher verschlechtert als verbessert. Vor allem die gemeinsame Visite von Pflegekräften und Ärzten findet immer seltener statt, weil die Pflegekräfte aufgrund der Personalknappheit weniger Zeit haben und die Ärzte keine festen Visitenzeiten einhalten, auf die sich die Pflegekräfte einstellen können. Durch den Wegfall der gemeinsamen Visite werden Informationsverluste und Fehler bei der Patientenversorgung wahrscheinlicher.
• "DRG verschlechtern die sozialen und materiellen Arbeitsbedingungen von Pflegekräften im Krankenhaus.": Durch die aus ihrer Sicht höheren Anforderungen (Mischstationen) und den erhöhten Zeitdruck fühlen sich die Pflegekräfte in gestiegenem Ausmaß nicht mehr gut genug für ihre Arbeit ausgebildet. Waren 2003 noch 79 Prozent der Meinung, sie seien dies, sagen dies 2008 nur noch gut 58 Prozent. Neben störenden Unterbrechungen (+14 Prozentpunkte), unregelmäßigen Arbeitszeiten (+ 11 Prozentpunkte), Organisationsmängeln im Krankenhaus (+ 8 Prozentpunkte), dem andauernd hohen Zeitdruck (+7 Prozentpunkte), hat auch die Belastung durch mangelhaften Arbeitsschutz (+ 5 Prozentpunkte) und zu viele administrative Tätigkeiten (+3 Prozentpunkte) 2008 im Vergleich zu 2003 zugenommen. Den zum Teil zunehmenden, jedenfalls aber nicht geringer werdenden Arbeitsbelastungen stehen Ressourcen (z. B. interessante Tätigkeit) gegenüber, welche die erwartbaren negativen Auswirkungen der DRG für die Arbeitszufriedenheit teilweise kompensieren können. Für Pflegekräfte haben 2008 diese Ressourcen jedoch in den meisten Bereichen und um bis zu 10 Prozentpunkte gegenüber 2003 abgenommen.
Die WissenschaftlerInnen heben an verschiedenen Stellen hervor, dass es sich bei vielen ihrer Funde um stabile Trends und nicht etwa um das "übliche Gejammer" in der Startphase von Innovationen und Veränderungen handelt. Außerdem werden eine Reihe von Schwachstellen oder Fehlentwicklungen sowohl von Ärzten, Pflegekräften und Patienten berichtet, was eine Art interne Validierung der Ergebnisse bedeutet.
Trotzdem wären natürlich weitere Untersuchungen der Wahrnehmungen und Erfahrungen der Beschäftigten und Patienten sinnvoll. Ebenso sollten die für eine sozialwissenschaftliche Studie typischen "nur" subjektiven Informationen durch "objektive" multidisziplinäre Daten aus der Betriebswirtschaft oder über den physischen und mentalen Zustand der Beschäftigten ergänzt und ggfls. korrigiert werden.
Wen die weiteren Erkenntnisse aus der Wahrnehmung durch Pflegekräfte und Details für alle Ergebnisse interessieren, kann sich den 109 Seiten umfassenden Forschungsbericht " Einfluss der DRGs auf Arbeitsbedingungen und Versorgungsqualität von Pflegekräften im Krankenhaus - Ergebnisse einer bundesweiten schriftlichen Befragung repräsentativer Stichproben von Pflegekräften an Akutkrankenhäusern in den Jahren 2003, 2006 und 2008" von Bernard Braun, Sebastian Klinke, Rolf Müller und Rolf Rosenbrock (erschienen als Paper 173 des Forschungszentrums Nachhaltigkeit artec der Universität Bremen im Januar 2011) kostenlos herunterladen. Wer an gedruckten Exemplaren Interesse hat, kann sie über die Mailadresse dieses Forums ebenfalls kostenlos bestellen.
Bernard Braun, 11.2.11
"Lasst die Toten ruhen!?" - Warum Rate und Ergebnisse von Obduktionen Bestandteil der Qualitätsberichte werden sollten?
 Am 4. Januar 2011 äußerte sich der "Bundesverband Deutscher Pathologen" unter der Überschrift "Neue Obduktionsstudie zeigt: Qualität klinischer Diagnostik ist gestiegen" zu Obduktionsergebnisse aus dem Krankenhaus Görlitz in Sachsen aus den Jahren 1987 und 2005-2007. Der Vorsitzende des Verbandes, Schlake, zog daraus für die aktuelle Gesundheitspolitik den Schluss: "Gehen Sie dorthin, wo viel obduziert wird".
Am 4. Januar 2011 äußerte sich der "Bundesverband Deutscher Pathologen" unter der Überschrift "Neue Obduktionsstudie zeigt: Qualität klinischer Diagnostik ist gestiegen" zu Obduktionsergebnisse aus dem Krankenhaus Görlitz in Sachsen aus den Jahren 1987 und 2005-2007. Der Vorsitzende des Verbandes, Schlake, zog daraus für die aktuelle Gesundheitspolitik den Schluss: "Gehen Sie dorthin, wo viel obduziert wird".
Richtig daran ist, dass Obduktionen oder Sektionen nicht zum Ensemble der Maßnahmen gehören, die Prozess- und Ergebnisqualität im Krankenhaus und Behandlungssystem zu verbessern und weder ihre Häufigkeit noch ihre Ergebnisse zu den Qualitätsindikatoren der obligatorischen strukturierten Qualitätsberichte der Krankenhäuser gehören. Und angesichts der Blässe oder Lückenhaftigkeit der gesamten Qualitätsberichterstattung sollte ernsthaft über die Aufnahme derartiger Indikatoren nachgedacht werden.
Falsch ist aber, dass es sich um neue Ergebnisse handelt, wenn man bedenkt, dass diese Ergebnisse bereits im "Ärzteblatt Sachsen 1/2009" veröffentlicht wurden. Aber dies ist nicht der erste Fall im deutschen Gesundheitswesen, dass die Einen Ereignisse und Daten schon als veraltet vergessen haben, Andere dieselben als brandneu entdecken und verbreiten.
Problematisch ist bei solchen Neuentdeckungen aber wirklich, wenn sie relativ unvollständig und tendenziös präsentiert werden. So werden zwar für das Jahr 1987 ausführlich die in der so genannten "Görlitzer Studie" extrem hohe Sektionsrate von 97 % aller im Klinikum der damals in der DDR gelegenen sächsischen Stadt Görlitz und die relativ niedrige Rate von 41 % übereinstimmenden klinischen Diagnosen und dem Obduktionsbefund berichtet. Für die Jahre 2005 bis 2007 fehlt in der Pressemitteilung des Verbandes einerseits jede Angabe zu der im Bundesdurchschnitt immer noch überdurchschnittlich hohen Görlitzer Obduktionsrate von 36 % und damit auch zu den möglichen Selektionseffekten. Andererseits berichtet der Verband aber, dass in den aktuelleren Jahren Diagnosen und Befunde in 60-62 % aller untersuchten Fälle voll übereinstimmten.
Trotz der eindeutigen Verbesserungen bei der Häufigkeit in der klinische Diagnosen mit Obduktionsbefunden übereinstimmen sieht dies 2005-2007 bei 38-40 % aller untersuchten Fälle mehr oder weniger anders aus. Deshalb lohnt ein zweiter ausführlicherer und vollständigerer Blick auf die Ergebnisse der "Görlitzer Studie" und die Erklärungen mancher ihrer Ergebnisse:
• Negativ betrachtet wurde 1987 in 37 % aller untersuchten Fälle bzw. obduzierten Toten eine Fehleinschätzung der Todesursache aufgedeckt. Dieser Anteil sank 2005-2007 auf durchschnittlich 18 %. Teilweise Übereinstimmungen traten 2005-2007 bei rund 20 % der Obduzierten auf.
• Trotz des selbstkritischen Hinweises in der Ärzteblatt-Publikation im Jahr 2009, dass die wesentlich niedrigere Obduktionsrate zu Selektionseffekten jedweder Art führen könnte und auch "ein gewisser Selektionsfaktor im Obduktionsgut anzunehmen" wäre "der durch die im häuslichen Milieu Verstorbenen noch verstärkt sein dürfte", relativieren diesselben Autoren die Gefahr selektiver Ergebnisse im selben Atemzug bzw. Absatz. Ihre Ergebnisse wiesen angeblich darauf hin, "dass der Selektionsfaktor von mehr als 30 % (Selektionsrate ab) statistisch gesehen abnimmt."
• Auch wenn das so ist, bedeutet diese Aussage, dass ein Großteil der Krankenhäuser, die entweder gar keine Obduktionen durchführen oder die Häuser mit der aktuell von Experten geschätzten und unwidersprochenen durchschnittlichen Obduktionsrate von 4 bis 6 %, keine verlässliche und für die qualitätsorientierte Krankenhaus-Auswahl relevanten Angaben über ihre Diagnosesicherheit und -qualität liefern können. Diese Situation hat sich auch in den letzten 20 Jahren deutlich verschärft: "So ist die Zahl der Obduktionen an deutschen Krankenhäusern um weit mehr als die Hälfte zurückgegangen". Die Bundesärztekammer berichtet für 1999 sogar eine Rate von 3,1 %. Als Gründe nannten die Ärzteblatt-Autoren 2009 den Wandel in der Einstellung der Bevölkerung zu Krankheit und Tod "als Störfaktor", die "Einstellung der Ärzte und der ihrer Lehrer zur Obduktion" und für das Verschwinden der Obduktionen aus dem Beantragungs- und Handlungsrepertoire der öffentlichen Gesundheitsämter "Kostenfragen". In 30% der Fälle bei denen eine Obduktion aus ärztlicher Sicht sinnvoll gewesen wäre, sprachen sie sich gegen einen dafür notwendigen Antrag bei den Angehörigen aus. Kommt es zum Antrag würde "nicht selten … das Gespräch dem jüngsten Assistenten überlassen".
Auf die Folgen für die ärztliche Therapiequalität hat die Bundesärztekammer bereits im Jahr 2005 hingewiesen und ihre Einschätzung bis heute auf ihrer Website dokumentiert: "In ca. 15 % aller Todesfälle in Krankenhäusern besteht eine Diskrepanz zwischen klinischer Hauptdiagnose und Sektionsbefund, die mit Folgen für Therapie und Überleben der Patienten einhergeht. Diese Fehlerquote kann nur durch eine systematische klinische Autopsie erkannt und benannt sowie durch einen intensivierten klinisch-pathologischen Diskurs zukünftig verringert werden. In weiteren ca. 20 % der Sektionen ergeben sich ebenfalls deutliche Unterschiede zwischen klinischer Hauptdiagnose und Sektionsbefund, allerdings ohne Konsequenzen für die Therapie und das Überleben der Patienten. ... Aus den genannten Fakten und Daten ergibt sich zwingend, dass eine Erhöhung der Sektionsfrequenz notwendig ist, da anderenfalls die ethisch und ökonomisch gebotene Selbstkontrolle der Medizin nur unzureichend erfüllt wird."
Sowohl für die gesetzlich vorgeschriebene Qualitätssicherung und die Transparenz über die Qualitätssicherungsbemühungen und die Diagnose-Qualität einzelner Krankenhäuser ist daher der Forderung des Pathologenverbandes zuzustimmen, Angaben zur Sektionshäufigkeit und die gewonnenen Ergebnisse in die strukturierten Qualitätsberichte aufzunehmen.
Selbst bei der Unklarheit über Selektionseffekte in der vergleichsweise hohen Obduktionsrate des Görlitzer Krankenhauses zeigen seine Ergebnisse, dass Obduktionen auch Hinweise auf epidemiologische Fehleinschätzungen durch die amtliche Totenscheinstatistik liefern können: "So beträgt der Anteil der zum Tode führenden Herz-Kreislauferkrankungen im Autopsiegut 33-40 % und nicht entgegen offiziellen Mitteilungen über 50 %. Infektionen und Entzündungen stehen seit Jahren in der Obduktionsstatistik als Todesursache mit 14 % an 3. Stelle."
Und selbst wenn sich aber das stationäre Versorgungswesen nicht auf den Fortschritten von "Görlitz 2" ausruht, ändert dies nichts an den unter Qualitätsgesichtspunkten noch wesentlich größeren Mängeln der außerstationären Leichenschau und Todesursachen-Diagnostik. Auch wenn alle Ärzte zur Durchführung der Leichenschau verpflichtet sind, wimmelt(e) für die Bundesärztekammer die "Durchführung der ärztlichen Leichenschau" nach gründlicher Sichtung der bis zum Jahr 2002 dazu veröffentlichten wissenschaftlichen Studien von "Sorgfaltsmängeln", "Fehlleistungen" und liegt zum Teil "weit unter dem Anspruch der 'Evidence-Based-Medicine'."
Zu den "Highlights" der wesentlich längeren Mängelliste gehört, dass nur 25 % aller Ärzte und gerade einmal 1 % der Hausärzte die zu diagnostizierende Leiche gemäß der rechtsmedizinischen Empfehlung völlig entkleiden, sich 47 % der Notärzte und 41 % der niedergelassenen Ärzte durch die Polizei beeinflussen lassen, wenn es um die Entscheidung geht, "polizeiliche Ermittlungen zum Todesfall zu veranlassen", von den Ärzten "in der Regel (unzutreffenderweise) angenommen (wird), dass durch die Leichenschau die sichere Feststellung der Todesursache … möglich wäre", falsch eingeschätzte Todesursachen auf der Todesbescheinigung in 20 bis 50 % aller Todesfälle vorliegen und 1997 "mindestens 11.000 'nicht natürliche Todesfälle' darunter 1.200 Tötungsdelekte pro Jahr der Statistik entgehen, weil sie bei der Leichenschau als 'natürliche Todesfälle' deklariert werden." Von den zuletzt erwähnten 11.000 "nicht natürlich Gestorbenen" starben ca. 4.000 "im Zusammenhang mit medizinischen Maßnahmen". Bei dem hier zitierten Verfasser handelt es sich um den Präsidenten der Bundesärztekammer, Hoppe, der dies und noch viel mehr zum Thema in einem Brief an die Teilnehmer der Gesundheitsministerkonferenz vom 22.1. 2003 vortrug und auch gleich ein Mustergesetz angehängt hatte.
Die aktuelle "Presseerklärung des "Bundesverband Deutscher Pathologen" ist kostenlos erhältlich.
Der "alte" Artikel "Obduktionsergebnisse. Unter dem Aspekt der Qualitätsberichte - Jahresanalysen aus dem Klinikum Görlitz" aus dem "Ärzteblatt Sachsen 1/2009" ist ebenfalls kostenlos erhältlich.
Wer an noch mehr Vor- und Nachteilen und Hintergründen zur Autopsie interessiert ist, findet dies in dem 61-seitigen sehr material- und referenzreichen Beschluss des Vorstandes der Bundesärztekammer vom 26. August 2005 "Stellungnahme zur Autopsie - Langfassung".
Und auch der ebenfalls mit zahlreichen weiterführenden Hinweisen versehene Brief von BÄK-Präsident Hoppe an die GMK aus dem Jahr 2003 ist im Internet kostenfrei erhältlich.
Bernard Braun, 8.1.11
Patientenzufriedenheitsbefragungen im Krankenhaus: "Nice to have" oder "Duschen ohne nass zu werden"
 Egal ob es Gesetze und der Gemeinsame Bundesausschuss vorschreiben oder es "der Markt" fordert, erstellen alle oder die Mehrheit der Krankenhäuser Qualitätsberichte oder f�hren standardm��ig Patientenzufriedenheitsbefragungen durch. Welche Qualit�t die Qualitätsberichte haben, d.h. wie verst�ndlich, relevant und bedarfsorientiert sie für die Zielgruppen potenzielle Patienten und ambulante Leistungserbringer sind, wird seit einiger Zeit untersucht. Diese Untersuchungen zeigen trotz mehrfacher Appelle besser zu werden bis in die Gegenwart hinein erhebliche Umsetzungsdefizite auf, die den Nutzen des Entscheidungs-Hilfsmittels Qualitätsberichte zum Teil auf Null f�hrt.
Egal ob es Gesetze und der Gemeinsame Bundesausschuss vorschreiben oder es "der Markt" fordert, erstellen alle oder die Mehrheit der Krankenhäuser Qualitätsberichte oder f�hren standardm��ig Patientenzufriedenheitsbefragungen durch. Welche Qualit�t die Qualitätsberichte haben, d.h. wie verst�ndlich, relevant und bedarfsorientiert sie für die Zielgruppen potenzielle Patienten und ambulante Leistungserbringer sind, wird seit einiger Zeit untersucht. Diese Untersuchungen zeigen trotz mehrfacher Appelle besser zu werden bis in die Gegenwart hinein erhebliche Umsetzungsdefizite auf, die den Nutzen des Entscheidungs-Hilfsmittels Qualitätsberichte zum Teil auf Null f�hrt.
Au�er der wissenschaftlichen Kritik an der Aussagefähigkeit des Zufriedenheitskonzepts und von verschiedenen Varianten der Zufriedenheitsbefragungen der WZB-Wissenschaftlerin Birgit Aust oder der ZUMA-Autoren Birgit Neugebauer und Rolf Porst, die aber bei der Entwicklung einiger Instrumente konstruktiv aufgegriffen wurde, gibt es zum Design der fast an jedem Krankenhaus aber auch in anderen Einrichtungen des Gesundheitswesens geradezu inflation�r pr�senten Zufriedenheitsbefragungen nur sehr wenig substantielle empirische Untersuchungen.
Noch weniger wei� man dar�ber, ob und wie die Ergebnisse der Befragungen genutzt werden. Einzelne Studien wie beispielsweise Befragungen von Pflegekr�ften �ber die Auswirkungen der DRG in den Jahren 2003 und 2006 zeigten, dass an mindestens 70 bis 85 % der Krankenh�user Patientenbefragungen durchgef�hrt wurden, zwischen 45% und 60 % der Befragten aber nichts �ber die Ergebnisse sagen konnten. Hinweise auf Tendenzen, dass solche Befragungen ausschlie�lich als Marketinginstrument oder Symbol f�r "Kundenorientierung" genutzt wurden, gab es also schon l�ngere Zeit.
Das "Institut f�r betriebswirtschaftliche Analysen, Beratung und Strategieentwicklung (ifabs)" hat nun aber im Rahmen einer "Forschungsinitiative Benchmarking" in einer kleinen, nicht repr�sentativen Untersuchung �ber die Befragungspraxis in 174 Klinikabteilungen verschiedener Krankenh�user und Fachrichtungen sowohl aktuellere als auch facettenreichere Ergebnisse nachgelegt.
Die wesentlichen Ergebnisse einer Art Best-Practice-Analyse lauten:
• In der Mehrheit der untersuchten Einrichtungen waren die Besch�ftigten lediglich oberfl�chlich �ber die Durchf�hrung solcher Patientenbefragungen informiert. In 62 % der Einrichtungen erfolgte die Verteilung der B�gen eher zuf�llig und wurden Patienten nicht systematisch daran erinnert, einen Bogen auszuf�llen. Knapp die H�lfte der Besch�ftigten sahen die Zufriedenheitsbefragungen nahezu folgerichtig nicht als notwendiges Instrument f�r die Entwicklung der Dienstleistungsqualit�t an.
• In lediglich 35% der untersuchten Abteilungen wurden die Resultate durchg�ngig kommuniziert, in den �brigen H�usern erfolgte die Information entweder selektiv nur f�r einzelne Mitarbeitergruppen (26%) oder gar nicht (39%).
• Lediglich 12% der Abteilungen setzten bei ihren Befragungen eine zweidimensionale Befragungsmethodik ein, mit der f�r die untersuchten Leistungsmerkmale sowohl deren Wichtigkeit f�r die Patienten als auch die Zufriedenheit mit der Umsetzung ermittelt werden. In 75 % der Befragungewn wurden au�erdem keine offene Fragen verwendet. Hauptgrund war das Vermeiden des gr��eren Auswertungsaufwandes.
• Die Frageb�gen enthielten zahlreiche Ausf�llbarrieren: In 51 % war die Schrift so klein, dass gerade �ltere Menschen sie nicht lesen konnten. 38 % der Frageb�gen waren un�bersichtlich gelayoutet und in 42 % der B�gen fehlten Erkl�rungen zum Ausf�llen der B�gen.
• In keiner der Kliniken, die Patienten-Befragungen durchf�hrten wurden parallel die Vorstellungen von Mitarbeitern �ber die von den Patienten abgefragten Leistungsmerkmale erhoben. Die Diskrepanz zwischen Patienten- und Besch�ftigtensicht und -bewertung sind aber die h�ufigsten Ursachen f�r Unzufriedenheit der Patienten oder auch frustrierenden Erfahrungen von Krankenhaus-Personal.
• 19 % der untersuchten Abteilgten unterschieden in ihren Analysen nach Patientengruppen wie beispielsweise �ltere von J�ngeren.
• In 64 % der Kliniken lagen lediglich zeitpunktbezogene Auswertungen vor. Darstellungen der Entwicklung der Merkmale im Zeitverlauf fehlten dort.
• In s�mtlichen Kliniken und Abteilungen fehlten Vergleiche der Ergebnisse mit anderen Abteilungen des Hauses oder mit anderen fachlich �hnlichen Kliniken.
• Als Fazit ihrer Untersuchung halten die Benchmarking-ForscherInnen zur�ckhaltend fest, dass der "hohe Verbreitungsgrad" derartiger Befragungen mit einer "geringen Umsetzungsqualit�t" einhergeht.
Etwas zu viel Zur�ckhaltung, das verst�ndliche Interesse des privatwirtschaftlichen Instituts an m�glichen Beratungsauftr�gen oder eine enorme Untersch�tzung der Gr�nde f�r diese durchgehenden Umsetzungs- und Nutzungsm�ngel verbergen sich allerdings hinter der Formulierung, die mangelnde Qualit�t sei mit "geringem Aufwand � steigerbar".
Die Pr�sentation der M�ngel und die Darstellung von Best practice und der dabei hilfreichen technischen �nderungen sind sicherlich notwendige und �berf�llige Voraussetzungen f�r die Verbesserung des Instruments Patientenzufriedenheitsbefragungen, hinreichend ist dies aber mit Sicherheit nicht. Um welche Dimensionen es sich handelt, sollte dann mit gekl�rt werden, wenn noch etwas mehr und auch repr�sentative Transparenz �ber den Status quo dieser Befragungen geschaffen wird.
Eine vierseitige Zusammenfassung der Ergebnisse "Patientenzufriedenheits-Befragungen im Krankenaus: Ein Qualit�tsmanagement-Instrument mit Anwendungs-schw�chen - Best-Practice-Studienergebnisse" steht kostenlos zur Verf�gung.
Bernard Braun, 9.12.10
Pflegekräftemangel 2025: Unentrinnbare Lücke oder doch etwas anders und beeinflussbarer!?
 Die Prognosen über einen künftigen Mangel an Pflegekräften im Krankenhaus und in der ambulanten Pflege boomen. Nach der zuletzt veröffentlichten Prognose des Unternehmensberatungskonzerns PricewaterhouseCoopers (PwC) legen nun auch das Statistische Bundesamt und das Bundesinstitut für berufliche Bildung (BiBB) auf der Basis von Mikrozensus-Daten aus dem Jahr 2005 "Projektionen des Personalbedarfs und -angebots in Pflegeberufen bis 2025" vor.
Die Prognosen über einen künftigen Mangel an Pflegekräften im Krankenhaus und in der ambulanten Pflege boomen. Nach der zuletzt veröffentlichten Prognose des Unternehmensberatungskonzerns PricewaterhouseCoopers (PwC) legen nun auch das Statistische Bundesamt und das Bundesinstitut für berufliche Bildung (BiBB) auf der Basis von Mikrozensus-Daten aus dem Jahr 2005 "Projektionen des Personalbedarfs und -angebots in Pflegeberufen bis 2025" vor.
Das "Deutsche Ärzteblatt" startet seinen Kurzbericht zu dieser Prognose am Nikolaustag mit der Überschrift "In 15 Jahren fehlen rund 150.000 Pflegekräfte". Am Dienstag lässt dann etwa die "Süddeutsche Zeitung" unter der Überschrift "Die Pflege-Lücke" die "Statistiker … einen massiven Personalmangel bei der Betreuung alter und kranker Menschen (erwarten)" und berichtet dann aber relativ differenziert über die ihr wichtig erscheinenden Ergebnisse der Projektionen. Angesichts des Ernstes der künftigen Entwicklung der Nachfrage und des Angebots von Pflege lohnt sich eigentlich bei jeder Informationsquelle die Lektüre des Originals. Diese verschafft einen Menge inhaltlicher und methodischer Einblicke in das Innere derartiger Prognosen.
Die bisher bekannt gewordene Berichterstattung erwähnt nämlich einige der wesentlich differenzierter als normal vorgelegten Ergebnisse nicht bzw. behandelt sie randständig.
Zu den wichtigen Determinanten der Nachfrage nach Pflege und des Angebots an Pflegekräfte zählen die Autoren Anja Afentakis und Tobias Maier
• auf der Nachfrageseite die stetige Zunahme des Anteils der 65+-Bevölkerung und ihrer spezifischen Morbidität. Wie bereits in früheren Untersuchungen des Statistischen Bundesamtes legen die AutorInnen ihren Berechnungen aber zwei theoretisch solide Szenarien der künftigen Morbiditäts- und Leistungsnachfrageentwicklung zugrunde. Dies sind das so genannte "status quo-Szenario", das die bisherige expandierende Entwicklung fortschreibt und das "Szenario der sinkenden Behandlungsquoten". Im "status quo-Modell" steigt die als Bedarf genutzte Anzahl der Krankenhaus-Fälle bis zum Jahr 2025 um 12,5 %. Im Modell der "sinkenden Behandlungsquoten" steigt die Nachfrage im selben Zeitraum schwächer, nämlich um 8,5 %. Dies ist bezogen auf aktuell 17,5 Millionen Krankenhaus-Fälle pro Jahr ein Unterschied von rund 800.000 Fällen und ein spürbarer Unterschied bei der benötigten Anzahl von Pflegekräften, die man braucht, um diesen Bedarf bei ansonsten konstanten Bedingungen abzudecken. In beiden Szenarien steigt der Vollständigkeit halber die Nachfrage nach Pflegekräften in der ambulanten und (teil-)stationären Pflege aber um einen höheren Betrag (Status quo: +48,1 %; Sinkende Behandlungsquoten: +35,4 %) als in der Krankenhauspflege.
• Aber auch die Angebotsseite, also die Quantität unterschiedlich qualifizierter Pflegekräfte und die Beschäftigungsstruktur, d.h. vor allem das Verhältnis von Vollarbeits- zu Teilzeitarbeitskräften und das von voll ausgebildetem und angelernten Pflegepersonal, ist gegenwärtig das Gegenteil von unabänderlich determiniert. Es gibt vielmehr z.B. bei der Beschäftigungsstruktur trotz ähnlich hoher Frauenanteile erhebliche Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland. Bereits für die Situation im Ausgangsjahr 2005 der Prognose wirkten sich die Unterschiede in der Beschäftigungsstruktur allein des ausgebildeten Pflegepersonals in Ost- und Westdeutschland so aus: Die westdeutsche Beschäftigungsstruktur würde, wenn sie für Gesamtdeutschland gelten würde, bereits 2005 zu einem Mangel an 59.000 Pflegevollkräften führen. Wenn alternativ die ostdeutsche Beschäftigtenstruktur gesamtdeutsch würde, hätte 2005 ein Überangebot von 28.000 Pflegevollkräften bestanden.
• Bezieht man sämtliche bisherigen Differenzierungen in die Prognosen ein, also die unterschiedlichen Morbiditäts- und Versorgungsszenarien und Beschäftigtenstrukturen ergeben sich erhebliche quantitative Unterschiede für das im Zieljahr 2025 notwendige oder fehlende Pflegepersonal: Die Beschäftigtenstruktur in Gesamtdeutschland bzw. im früheren Bundesgebiet unterstellt, würde der Mangel an ausgebildeten Pflegekräften im "status quo-Szenario" 193.000 bzw. 214.000 Personen umfassen. Die fehlende Anzahl von ausgebildeten Pflegekräfte sinkt im Szenario "sinkender Behandlungsquoten" auf 135.000 bzw. 157.000.
• Nimmt man aber für Gesamtdeutschland die ostdeutsche Beschäftigtenstruktur an oder sorgte dafür sie zu verallgemeinern, sieht die Anzahl der fehlenden ausgebildeten Pflegekräfte im Jahr 2025 noch einmal völlig anders aus: Unter den Bedingungen des "status quo-Szenarios" für die Nachfrage nach Pflegeleistungen würde bis 2023 kein quantitativer Mangel existieren, aber 2025 fehlten dann doch 34.000 Pflegevollkräfte. Unter den Bedingungen des Szenarios "sinkender Behandlungsquoten" träte aber schließlich der Fall ein, dass es sogar nochim Jahr 2025 ein ausreichendes Angebot an Pflegevollkräften gäbe. Warum also nicht die Schlagzeile "Pflege-Lücke bis 2025 geschlossen!"?
• Die Autoren der weisen außerdem eindringlich darauf hin, dass ihre Prognosen auf einer Fülle konstant gesetzter Rahmenbedingungen und Einflussfaktoren basieren, die in den meisten Fällen geändert werden könnten. Dies betrifft etwa die durchschnittliche Verweildauer von Krankenhaus-Patienten, die Aufgabenteilung von Pflegekräften und Ärzten, die Berufsflexibilität oder das Verhältnis von ausgebildeten zu an- und ungelernten Pflegekräften.
Auch wenn man nicht davon ausgehen kann, dass die derzeitigen ostdeutschen Rahmenbedingungen für das Pflegekräfte-Angebot irgendwann einmal ohne Abstriche zur Normalität in Gesamtdeutschland werden, zeigt diese Projektionsvariante, dass die künftige Pflegekräftesituation auch von einer Menge politisch beeinflussbaren Faktoren abhängig ist.
Dabei geht es beispielsweise um eine Politik zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie, Kindererziehung und Beruf, die Prävention hoch belastender und für viele Pflegekräfte nicht mehr in Vollzeit ertragbaren Arbeitsbedingungen oder kreativere Arbeitszeitmodelle.
Sich dieser Gestaltungsmöglichkeiten vor der Kapitulation vor dem scheinbar unentrinnbaren "massiven Personalmangel" von "rund 150.000" Pflegekräften zu erinnern, ist ein wichtiger Beitrag zu einer rationaleren Pflegekräfte-Politik.
Der Aufsatz "Projektionen des Personalbedarfs und -angebots in Pflegeberufen bis 2025" von Anja Afentakis (Statistisches Bundesamt) und Tobias Maier (BiBB) ist in der Zeitschrift "Wirtschaft und Statistik" (Heft 11/2010) erschienen und komplett wie kostenlos zum weiteren Kennenlernen anspruchsvollerer Prognosen erhältlich.
Bernard Braun, 7.12.10
Grenzen der Kriminologie: Wie häufig ist die Abrechnung von DRG-Krankenhausfällen "fehlerhaft" und welche Fehler gibt es?
 Bereits mit der Einführung der diagnosebezogenen Fallpauschalen oder "Diagnosis related groups (DRG)" in der deutschen Krankenhauslandschaft war die Befürchtung verbunden, dies reize die Krankenhäuser an, sich durch entsprechende Aktivitäten mehr Einnahmen zu beschaffen als ihnen nach dem tatsächlichen Aufwand zustünden. Dieser Verdacht wird auch nach der Veralltäglichung der DRG unvermindert weiter geäußert und zum Teil belegt.
Bereits mit der Einführung der diagnosebezogenen Fallpauschalen oder "Diagnosis related groups (DRG)" in der deutschen Krankenhauslandschaft war die Befürchtung verbunden, dies reize die Krankenhäuser an, sich durch entsprechende Aktivitäten mehr Einnahmen zu beschaffen als ihnen nach dem tatsächlichen Aufwand zustünden. Dieser Verdacht wird auch nach der Veralltäglichung der DRG unvermindert weiter geäußert und zum Teil belegt.
Dies war der Ausgangspunkt eines Gutachtens, das sich im Auftrag des AOK-Bundesverbandes um eine kriminologische Betrachtung und Bewertung bemühen sollte.
Trotz der fehlenden oder systematisch verzerrten Datengrundlage für die Abrechnungspraxis der deutschen Krankenhäuser mit den Gesetzlichen Krankenkassen, kommt der Rechtswissenschaftler Kölbel von der Universität Bielefeld zu folgenden Erkenntnissen:
• Die Entdeckung von Abrechnungsfehlern oder Unstimmigkeiten von Berechnungsgrundlagen (z.B. Diagnose) ist nur im Verlaufe des normalen Abrechnungsprozesses möglich und kann zu Aktivitäten des Kassenmitarbeiters oder einer Weitergabe zur genaueren Prüfung durch den "Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK)" (etwa jeder 10. Fall, der entdeckt wurde) führen.
• Die entdeckten Fehler werden dadurch limitiert, dass die Krankenkassen keineswegs sämtliche Falldaten erhalten, sondern nur die nach § 301 SGB V. Außerdem ist ihr eigenes Interesse überwiegend auf die wirtschaftliche Seite der Behandlung gerichtet.
• Die Fehler- und Betrugsempirie innerhalb der in den USA schon länger etablierten DRG-Abrechnung zeigt, dass bestimmte Abrechnungsfehler keine reine Spekulation sind: In durchschnittlich rund 18 % der Abrechnungsfälle treten entgeltrelevante Kodierfehler auf. In Befragungen in den USA gab nahezu die Hälfte des interviewten Kodier-Personals an, von ihrem Management zu einer grenzwertig erlösmaximierenden Kodierung angehalten worden zu sein.
• "Die amtliche DRG-Abrechnungsstatistik ebenso wie die kassenspezifische Auswertung ausgewählter Abrechnungsbereiche (bilden) ein modifiziertes Kodierverhalten der Kliniken ab, das eindeutig durch die DRG-Einführung ausgelöst wurde: namentlich eine zunehmende Mitkodierung von entgeltsteigernden Faktoren (Nebendiagnosen, Prozeduren und Komplikationen) - freilich ohne dass auf dieser Datenebene feststellbar wäre, ob sich darin eine erlösmaximierende Verschlüsselungspraxis niederschlägt oder nur die zunehmende Vermeidung des früheren (damals noch vergütungsirrelevanten) Downcodings."
• "Grenzwertige Vergütungsziele" spielen nach Ansicht des kriminologischen Gutachters eine eindeutige Rolle bei der "Verteilung der geltend gemachten DRG innerhalb mancher Diagnose- und Behandlungsgruppen, in denen das Abrechnungsverhalten ganz offensichtlich auf das Erreichen entgeltsteigernder Schwellwerte abzielt."
• Auch wenn der MDK in den vergangenen Jahren "beständig relativ große Abrechnungsanteile als überhöht reklamiert, im Durchschnitt knapp 40 %" ist dies keine repräsentative Erkenntnis und muss auch nicht Ergebnis einer unabhängigen fachkompetenten Überprüfung sein. Die Prüfpraxis des MDK variiert von Prüfung nach "Aktenlage" bis zu aufwändig recherchierenden Krankenhausbesuchen. Umgekehrt stecken in den Fällen, die nicht vom MDK überprüft wurden, mit Sicherheit noch weitere Fälle mit Abrechnungsfehlern.
• Wenn die Fehlerstatistik in den letzten Jahren als Hauptfehler feststellt, dass die stationäre Behandlung nicht notwendig war oder eine kürzere Dauer ausgereicht hätte, kommt hier nur die einseitige Suchstrategie der GKV zum Ausdruck. Eine umfassende Dokumentation der Fehlerschwerpunkte fehlt.
• Vor allem fehlen aber Analysen der Entstehungszusammenhänge. Diese können von Fehlern in der DRG-Software über Bedienungsfehler und Strategien der Erlösoptimierung innerhalb des legalen Rahmens bis zum vorsätzlichen Fälschen der Diagnosen etc. reichen.
• Dass eine "relevante Manipulationspraxis" existiert, sieht der Gutachter durch eine "Reihe "weicher" Indikatoren" als gegeben an: Die Abrechnungsfehler zu Gunsten der abrechnenden Kliniken sind auffällig häufiger als die Fehler zu deren Lasten. Auch ist ein Lerneffekt i.S. einer zunehmenden Abrechnungskonformität, … in den MDK-Prüfdaten nicht feststellbar. Obendrein werden von den MDK nicht nur deutliche Unterschiede in der Fehlerbelastung verschiedener Krankenhäuser, sondern sogar richtiggehend abrechnungsauffällige Kliniken ausgemacht."
• Schritte, die an der belegbaren und vermutlichen Abrechnungsfälschung bei DRGs etwas ändern könnten, sind bessere diagnosebezogene Informationsmaterialien, spürbare Sanktionen von Fehlern, pausachale Vergütungskürzungen beim Überschreiten bestimmter Fehlermarken und ggfls. die Nutzung des Strafrechts.
Das 14 Seiten umfassende Gutachten "Die Prüfung der Abrechnungen von Krankenhausleistungen in der Gesetzlichen Krankenversicherung. Eine Bewertung aus kriminologischer Perspektive" von Ralf Kölbel ist komplett kostenlos erhältlich und enthält im Anhang einige empirische Belege für die erwähnten Fehlerphänomene.
Bernard Braun, 14.11.10
Höhere Wiedereinweisungsraten ins Krankenhaus unter DRG-Bedingungen - Erste Beobachtungen von Wirkungen der Swiss-DRG
 Um die Wirtschaftlichkeit der Krankenhausversorgung zu erhöhen und mehr Transparenz über die stationären Behandlungen zu erhalten - so die offiziellen Begründungen - sollen auch in der Schweiz ab 2012 die so genannten "Diagnosis related groups (DRG)" oder Fallpauschalen eingeführt werden. Ähnlich wie in Deutschland, dessen DRG-Systematik auch die Basis für das Swiss-DRG-System darstellt, gibt es auch in der Schweiz seit Jahren eine heftige Debatte über erwünschte und unerwünschte Effekte der DRG-Einführung auf Leistungserbringer, Versicherungsunternehmen und Krankenhauspatienten.
Um die Wirtschaftlichkeit der Krankenhausversorgung zu erhöhen und mehr Transparenz über die stationären Behandlungen zu erhalten - so die offiziellen Begründungen - sollen auch in der Schweiz ab 2012 die so genannten "Diagnosis related groups (DRG)" oder Fallpauschalen eingeführt werden. Ähnlich wie in Deutschland, dessen DRG-Systematik auch die Basis für das Swiss-DRG-System darstellt, gibt es auch in der Schweiz seit Jahren eine heftige Debatte über erwünschte und unerwünschte Effekte der DRG-Einführung auf Leistungserbringer, Versicherungsunternehmen und Krankenhauspatienten.
Anders als in Deutschland werden diese Effekte aber in der Schweiz bereits jetzt oder ab dem nächsten Jahr in mehreren Begleitforschungsprojekten einführungsbegleitend untersucht und können damit theoretisch so früh wie möglich identifiziert und verhindert werden.
Ferner bietet die Besonderheit, dass in einigen Kantonen und Kliniken bereits jetzt nach DRG klassifiziert und finanziert wird, die Möglichkeit, bereits vor der flächendeckenden Implementation bestimmte Vermutungen über DRG-Effekte durch einen Kantonsvergleich zu überprüfen.
Dies hat nun ein Forscherteam mit sehr hohem methodischen Aufwand bevölkerungsbezogen für den Zeitraum 2003-2007 getan und folgende Trends identifiziert:
• Zunächst wuchs die Anzahl der Kantone, in denen seit 2003 DRGs eingeführt wurden, von einem auf neun weitere. Die Anzahl der so genannten "health service areas" mit DRG-Vergütung wuchs von 8 im Jahr 2003 auf 26 im Jahr 2007. Entsprechend stieg der Anteil der unter DRG-Bedingungen stattfindenden Krankenhausfälle an allen Fällen von 8,3 % auf 29,8%.
• Die Honorierung mit DRGs führte in der Schweiz zu weniger Krankenhausfällen und zu einer Verlagerung der Ressourcen in den Bereich der ambulanten Versorgung. Dies führte u.a. auch zu einer besseren Kooperation von stationären und ambulanten Leistungserbringern durch die "integration of care pathways".
• Die in Prokopfausgaben ausgedrückte "burden of disease" unterschied sich zwischen dem alten Vergütungssystem und der DRG-Finanzierung während des gesamten Untersuchungszeitraums fast nicht. Die Befürchtungen, dass das DRG-System Anreiz bietet, die Schwere des Behandlungsfalles nach oben zu kodieren ("upcoding"), scheinen also zwischen 2003 und 2007 nicht substanziiert werden zu können.
• Ähnlich wie in Deutschland nahm die Liegezeit in Krankenhäusern auch bereits vor der DRG-Einführung beträchtlich ab. Es gibt also keinen ausschließlichen oder außerordentlich hohen Effekt der DRGs auf die Aufenthaltsdauer.
• Der einzige gewichtige Unterschied trat zwischen den verglichenen Kantonen bei der Rate der innerhalb 90 Tage nach einer Krankenhausentlassung erfolgten Wiedereinweisung ins Krankenhaus auf. Diese erfolgte in DRG-Krankenhäusern beträchtlich häufiger als in Nicht-DRG-Kliniken.
Da die Autoren sich selber auf Publikationen über die DRG-Einführung in Deutschland beziehen, wäre ihnen lediglich zu empfehlen, künftig auch sämtliche Erfahrungen und Ergebnisse der doch insgesamt überschaubaren DRG-Forschung nördlich des Bodensees zu berücksichtigen.
Der 16 Seiten umfassende Aufsatz "The implementation of DRG-based hospital reimbursement in Switzerland: A population-based perspective" von Andre Busato und Georg von Below ist in der Fachzeitschrift "Health Research Policy and Systems" (2010, 8:31; doi 10.1186/1478-4505-8-31) am 16. Oktober 2010 erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 31.10.10
Klinische Behandlungspfade helfen Behandlungsqualität zu verbessern und teilweise Liegezeiten und Behandlungskosten zu verringern!
 Nicht selten als Form von "Kochbuchmedizin" oder auch als rein ökonomisch induzierte Übertragung von Normen industrieller Serienfertigung kritisiert oder in Frage gestellt, erwiesen sich klinische Behandlungspfade bzw. "clinical pathways" im Rahmen eines Reviews der "Cochrane Effective Practice and Organisation of Care Group" als geeignet, die Verweildauer in Krankenhäusern verkürzen, Kosten zu reduzieren aber vor allem auch die Behandlungsqualität zu sichern.
Nicht selten als Form von "Kochbuchmedizin" oder auch als rein ökonomisch induzierte Übertragung von Normen industrieller Serienfertigung kritisiert oder in Frage gestellt, erwiesen sich klinische Behandlungspfade bzw. "clinical pathways" im Rahmen eines Reviews der "Cochrane Effective Practice and Organisation of Care Group" als geeignet, die Verweildauer in Krankenhäusern verkürzen, Kosten zu reduzieren aber vor allem auch die Behandlungsqualität zu sichern.
Die um den Dresdner Gesundheitswissenschaftler Thomas Rotter gescharte internationale Reviewer-Gruppe stützt sich bei diesen Aussagen auf eine Auswahl von 27 randomisierten kontrollierten Studien aus insgesamt international existierenden qualitativ hochwertigen 3.214 Studien, die sich bisher mit den verschiedenen Wirkungen klinischer Behandlungspfade beschäftigten. An den ausgewählten Studien nahmen insgesamt 11.398 PatientInnen teil. Bisher gab es auf der Basis einzelner Studien nicht selten zum Teil sich diametral widersprechende Ergebnisse.
20 Studien verglichen die Ergebnisse von Behandlungen, die ausschließlich auf der Basis von klinischen Behandlungspfaden erfolgten mit den Ergebnissen in Krankenhäusern mit normaler Behandlung.
Die jeweils statistisch signifikanten Hauptergebnisse dieser Studien sahen wie folgt aus:
• Die Häufigkeit von Komplikationen wie etwa Wundinfektionen, Blutungen und Pneumonien während eines stationären Aufenthalts wurde um 42% reduziert.
• Eine umfassende Dokumentation der Behandlung erfolgte in Krankenhäusern mit klinischen Behandlungspfaden fast vierzehnmal häufiger als in Krankenhäusern mit traditionellen, nichtstrukturierten Behandlungsabläufen.
• Es gibt keine Anzeichen für für signifikante Unterschiede bei der Wiedereinweisungshäufigkeit oder der Häufigkeit von tödlichen Ereignissen während des Krankenhausaufenthalts.
• Bei dem am häufigsten dokumentierten Indikator der Aufenthaltsdauer gibt es viele Studien, die unter den Bedingungen klinischer Behandlungspfade kürzere Liegezeiten nachwiesen.
• Auch bei den Kosten der Behandlungen finden sich zahlreiche Studien, die erhebliche Kostenunterschiede zwischen den verglichenen Behandlungsmodi zeigen. Je nach Ausgangssituation des Krankenhauses reichte die durch Behandlungspfade erreichte Einsparung von mehreren hundert bis zu mehreren tausend US-Dollar.
• Die beachtliche methodische Heteroegenität derartiger Studien erlaubte es aber nicht, eine aussagekräftige Meta-Analyse zur Aufenthaltsdauer und den Aufenthaltskosten durchzuführen. Die Autoren schlussfolgern daher auch nur sehr zurückhaltend, Behandlungspfad-Behandlung sei "without negatively impacting on length of stay and hospital costs".
Als inhaltliche Beschränkungen ihres Reviews merken die Reviewer selber an, sie hätten weder untersucht, ob niedrigere Krankenhauskosten möglicherweise in andere Behandlungssektoren verschoben werden, noch reichten die wenigen dazu in den Studien berichteten Fakten aus, einzelne Faktoren des Konzepts der klinischen Behandlungspfade als besonders erfolgversprechende nachzuweisen.
Beim Vergleich der Ergebnisse von sieben Studien, bei denen klinische Behandlungspfade zusammen mit anderen Behandlungsformen wie Case-Management etc. zum Einsatz kamen, mit den Ergebnissen der Behandlung mit üblichen Behandlungsformen, zeigten sich interessanterweise bei keinem der untersuchten Leistungsindikatoren signifikanten Unterschiede. Auch bei der Lektüre des gesamten Reviews fanden sich keine substantiellen Hinweise woran dies liegen könnte.
Zu dem 166 Seiten umfassenden Cochrane Intervention Review "Clinical pathways: effects on professional practice, patient outcomes, length of stay and hospital costs." von Rotter T, Kinsman L, James E, Machotta A, Gothe H, Willis J, Snow P und Kugler J. (CochraneDatabase of Systematic Reviews 2010, Issue 3. Art.No.:CD006632.) gibt es kostenlos nur ein Abstract.
Bernard Braun, 30.5.10
Im Krankenhaus: Vier-Minuten-Medizin für Patienten, 20 Sekunden für das Gespräch mit Angehörigen
 Von "Fünf-Minuten-Medizin" ist meist die Rede, um deutlich zu machen, dass Ärzte zu wenig Zeit aufwenden für das Gespräch mit Patienten und ihre Untersuchung. Tatsächlich hat eine Analyse unlängst gezeigt, dass deutsche Patienten sehr viel häufiger zum Arzt gehen als international üblich und dass der durchschnittliche Patientenkontakt im Jahr 2008 etwa acht Minuten dauerte (vgl. Barmer GEK Arztreport 2010: Viele Patientenkontakte, wenig Zeit). Eine deutsche Studie, die an der Universitätsklinik Freiburg durchgeführt wurde, hat jetzt deutlich gemacht, dass für Patienten in Krankenhäusern das Arzt-Patient-Gespräch noch sehr viel kürzer dauert: Als Durchschnittswert für die Kommunikation von Klinikärzten mit Patienten ermittelten die Wissenschaftler 4 Minuten und 17 Sekunden (pro Tag und Patient). Gerade mal 20 Sekunden dauerte das Gespräch mit Angehörigen.
Von "Fünf-Minuten-Medizin" ist meist die Rede, um deutlich zu machen, dass Ärzte zu wenig Zeit aufwenden für das Gespräch mit Patienten und ihre Untersuchung. Tatsächlich hat eine Analyse unlängst gezeigt, dass deutsche Patienten sehr viel häufiger zum Arzt gehen als international üblich und dass der durchschnittliche Patientenkontakt im Jahr 2008 etwa acht Minuten dauerte (vgl. Barmer GEK Arztreport 2010: Viele Patientenkontakte, wenig Zeit). Eine deutsche Studie, die an der Universitätsklinik Freiburg durchgeführt wurde, hat jetzt deutlich gemacht, dass für Patienten in Krankenhäusern das Arzt-Patient-Gespräch noch sehr viel kürzer dauert: Als Durchschnittswert für die Kommunikation von Klinikärzten mit Patienten ermittelten die Wissenschaftler 4 Minuten und 17 Sekunden (pro Tag und Patient). Gerade mal 20 Sekunden dauerte das Gespräch mit Angehörigen.
Die Studie fand statt am Universitätsklinikum Freiburg, einem Lehrkrankenhaus mit 1.700 Betten, 110 Krankenstationen und rund 55.000 stationären Patienten pro Jahr. Während des Studienverlaufs wurden die konkreten Tätigkeiten von 44 Ärzten akribisch protokolliert. Dies geschah, um subjektive Verzerrungen auszuschließen, wie in ethnologischen Studien durch Beobachtung: Ein Medizinstudent im 4.Studienjahr verfolgte einen zufällig ausgewählten Arzt einen ganzen Tag lang und notierte anhand eines zuvor erprobten Klassifizierungsschemas Art und Zeitdauer der jeweiligen Verrichtung. Dieses Schema umfasste 19 verschiedene Tätigkeiten, darunter Operationen, Schreiben von Berichten, Pausen, Gespräche mit Kollegen, mit Patienten, mit Angehörigen, Lehre und Forschung etc.
Insgesamt wurden so 374 Arbeitsstunden von Ärzten anhand objektiver Beobachtungen analysiert, im Durchschnitt 10 Stunden und 58 Minuten pro Arzt. Darüber hinaus füllten die Ärzte jedoch auch noch einen Fragebogen aus, in dem sie schätzen sollten, wie viel Zeit sie an einem Tag für die 19 unterschiedlichen Arbeitsaufgaben aufbringen.
Als Ergebnis der Beobachtungsdaten zeigte sich dann:
• Das Gespräch mit Patienten dauerte im Durchschnitt 4 Minuten und 17 Sekunden, das Gespräch mit einem Angehörigen 20 Sekunden.
• Die Wissenschaftler suchten auch danach, ob Ärzte je nach Alter, Geschlecht, Arbeitszeit und Überstunden, Zahl betreuter Patienten, Arbeitszufriedenheit usw. unterschiedlich lange Gespräche führen, konnten hierzu jedoch keine statistisch signifikanten Einflussfaktoren identifizieren.
• Diskussionen mit Kollegen nahmen die meiste Zeit in Anspruch und dauerten pro Tag etwa 2 Stunden und 30 Minuten.
• An zweiter Stelle rangierten Dokumentations-Arbeiten: DRGs vercoden, Operationsberichte verfassen, Briefe schreiben, Verwaltungsaufgaben und ähnliche Tätigkeiten nahmen pro Tag 2 Stunden und 28 Minuten in Anspruch.
Überraschender Weise schätzten die beobachteten Ärzte dann die Zeitdauer für das Patientengespräch doppelt so lang ein wie es tatsächlich war und das Gespräch mit Angehörigen sieben Mal so lang.
In der Diskussion der Befunde machen die Wissenschaftler deutlich, dass die ermittelte Zeitdauer der Arzt-Patient-Kommunikation im Rahmen einer zukünftig immer wichtigeren patientenzentrierten Versorgung auch im stationären Bereich wohl viel zu kurz ist und weisen auch darauf, dass die Qualität dieser Kommunikation noch gar nicht untersucht und berücksichtigt wurde.
Hier findet man ein Abstract der Studie und den Link zum kostenlosen Volltext (PDF): Gerhild Becker et al: Four minutes for a patient, twenty seconds for a relative - an observational study at a university hospital
(BMC Health Services Research 2010, 10:94 doi:10.1186/1472-6963-10-94)
Gerd Marstedt, 20.4.10
Dreimal "Auswirkungen der DRGs": Ähnliche und völlig unterschiedliche Ergebnisse und Bewertungen dreier Politikfolgen-Studien
 Mit der Veröffentlichung des ersten umfangreichen inhaltlichen Berichtes der gesetzlich vorgeschriebenen Begleitforschung des "Instituts für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK)" am 31.3.2010 und einer interaktiv mit den Aussagen des Berichtes verknüpfbaren Sammlung von Daten liegen nun die Ergebnisse aus drei methodisch und inhaltlich mehr oder weniger unterschiedlichen Forschungsvorhaben über die Auswirkungen der seit 2003 an den meisten deutschen Krankenhäusern eingeführten "Diagnosis related groups (DRG)" vor.
Mit der Veröffentlichung des ersten umfangreichen inhaltlichen Berichtes der gesetzlich vorgeschriebenen Begleitforschung des "Instituts für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK)" am 31.3.2010 und einer interaktiv mit den Aussagen des Berichtes verknüpfbaren Sammlung von Daten liegen nun die Ergebnisse aus drei methodisch und inhaltlich mehr oder weniger unterschiedlichen Forschungsvorhaben über die Auswirkungen der seit 2003 an den meisten deutschen Krankenhäusern eingeführten "Diagnosis related groups (DRG)" vor.
Dabei handelt es sich um folgende Projekte:
• Das vom Wissenschaftszentrum Berlin (WZB) und dem Zentrum für Sozialpolitik (ZeS) der Universität Bremen mit Unterstützung der Hans Böckler Stiftung, der Bosch Stiftung, der ehemaligen Gmünder Ersatzkasse (GEK), der Techniker Krankenkasse und der Landesärztekammer Hessen zwischen 2002 und 2009 durchgeführte Projekt "Wandel in Medizin und Pflege im DRG-System (WAMP)". Das Projekt erhob die Daten als einziges parallel zum zeitlichen Verlauf der langjährigen Einführung. Dies geschah durch mehrmalige (zwei- und dreimalige) schriftlich standardisierte Befragungen repräsentativer Stichproben von durchweg mehr als 1.000 bundesweit verteilter Krankenhaus-Patienten und -Pflegekräfte sowie hessischer Krankenhausärzte, die Analyse von individuenbezogenen Routinedaten der GEK und zweiwelligen qualitativen Fallstudien an vier Krankenhäusern.
• Das vom Zentrum für Qualität und Management im Gesundheitswesen, einer Einrichtung der Ärztekammer Niedersachsen, im Jahr 2007 durchgeführte Projekt "Effekte der pauschalierten Vergütung in der stationären Versorgung (DRG) auf die Gesundheitsversorgung: DRG-induzierte Veränderungen und ihre Auswirkungen auf die Organisationen, Professionals, Patienten und Qualität". Es handelt sich um eine einmalige schriftliche Befragung von jeweils zahlreichen Vertretern der Krankenhausleitungen, des Medizincontrolling/DRG-Beauftragte, Ärzten, Pflegenden und Patienten in 30 repräsentativen niedersächsischen Krankenhäuser. Hinzu kamen Erhebungen bei niedergelassenen Ärzten und Interviews mit weiteren Experten sowie eine Analyse von Leistungskennzahlen der Krankenhäuser.
• Das Berliner Forschungsinstitut IGES beschäftigte sich im Auftrag des von der Deutschen Krankenhausgesellschaft, dem Spitzenverband Bund der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) und dem Verband der privaten Krankenversicherungen getragenen INEK zeitlich am spätesten, nämlich erst seit 2008, mit der Identifizierung von Auswirkungen der DRG. Das Projekt kann daher in seinen eigenen Worten die "Funktion eines 'Frühwarnsystems' …nicht mehr wahrnehmen" und "nicht allen Anforderungen an die Begleitforschung" entsprechen. Es stützt sich dafür aber auf eine breite empirische Datenbasis, die schriftliche Befragungen aller nach § 108 SGB V zugelassenen Krankenhäuser, aller gesetzlichen Krankenkassen und privaten Krankenversicherungsunternehmen, aller Medizinische Dienste der GKV sowie einer Reihe von Akteure und Interessengruppen umfasste, die für den stationären Versorgungssektor relevant sind. Hinzu kommen Auswertungen von hochaggregierten DRG-Daten gemäß § 21 KHEntgG, Daten des Statistischen Bundesamtes im Rahmen der Krankenhausstatistik und Daten der Bundesgeschäftsstelle Qualitätssicherung (BQS). Sofern über "Veränderungen" durch die DRG in den Untersuchungsjahren 2004 bis 2006 berichtet wird, stützen sich die Aussagen ausschließlich auf einmalige und retrospektive Befragungen. Anders als in der WAMP- und Niedersachsenstudie richtete sich der Krankenhausfragebogen auch nicht an einzelne Beschäftigte bzw. Akteure, sondern an "das Krankenhaus", also in der Regel die Krankenhausleitungen. Aber nicht nur die Erfahrungen von Beschäftigten, sondern auch die Erfahrungen von Patienten spielten daher systematisch keine erkenntnisfundierende Rolle. Und auch bei der Befragung "der Krankenkassen" dominierte die Sichtweise der leitenden MitarbeiterInnen der Kassen. Von 1.687 um die Beantwortung des Fragebogens gebetenen Krankenhäusern antworteten 25 % (n=421), wovon 396 als brauchbar für die Analyse bewertet wurden. Von den 249 befragten Krankenkassen antworteten 43% (n=107). Etwas höhere Beteiligungsquoten gab es bei den anderen Befragtengruppen. Die ForscherInnen bewerten trotz dieser zum Teil geringen Antwortbereitschaft die Rücklaufgruppen als mehr oder weniger repräsentativ.
Die wesentlichen Ergebnisse der drei Projekte werden nachfolgend knapp dargestellt und zwar beginnend mit dem WAMP-Projekt als dem Projekt mit der größten Forschungsspanne und endend mit dem INEK/IGES-Projekt als jüngstem und auch erst für einen ersten Zeitraum (2004-2006) abgeschlossenen Projekt.
Zu den aus Sicht und der Erfahrung von Krankenhaus-Patienten, -Pflegekräften und -Ärzten wesentlichen Ergebnissen des WAMP-Projektes gehören:
• Auf der Makroebene der Gesundheitspolitik zeigt sich parallel zur Einführung von Fallpauschen und DRGs eine stetige Aufwertung des Wirtschaftlichkeitsgebots (Beitragssatzstabilität) bei gleichzeitiger Abwertung des Sachleistungsprinzips, des Solidar- und auch des Bedarfsprinzips.
• Viele der von den DRG erwarteten Effekte, wie etwa die Verkürzung der Liegezeiten, begannen bereits lange vor ihrer Einführung und entwickelten sich linear weiter. DRG-Effekte sind von Wirkungen der restlichen Gesundheits- und Krankenhauspolitik (z.B. Budgets) nicht klar und eindeutig zu trennen.
• Weder die befürchteten selektiven Aufnahmen noch die "blutigen Entlassungen" sind auf der Basis der Wahrnehmungen von Patienten, Pflegekräften und Ärzten bisher empirisch nachweisbar.
• Auch für die negativ erwartete Zunahme von Rehospitalisierungen oder ein vermehrtes Fallsplitting gab es zumindest bis 2005 keinen Hinweis in den Routinedaten der GKV.
• Nachweisbar sind aber bis zum Jahr 2005 signifikante Veränderungen bei der Behandlungsqualität von Patienten mit mehreren Behandlungsanlässen.
• Empirisch erkennbar sind aber auch nicht die erwarteten Verbesserungen bei der Strukturierung von Behandlungsabläufen sowie bei der Aufnahme und Entlassung von Patienten.
• Bei wichtigen organisatorischen und inhaltlichen Bedingungen für die Prozess- und Ergebnisqualität, wie etwa dem Entlassungs- und Überleitungsmanagement (u.a. Vorbereitung der Patienten auf die poststationäre Behandlung und Unterstützung sowie Kooperation von stationären und ambulanten Leistungserbringern) gibt es aus übereinstimmenden Sicht von Patienten, Pflegekräften und Ärzten auf zum Teil sehr niedrigem Niveau bis zu den Jahren 2007 und 2008 wenig oder gar keine Verbesserungen.
• Die Beschäftigten bewerten die meisten Dimensionen der DRG-Einführung zu drei Befragungszeitpunkten, d.h. kontinuierlich negativ und berichten von deutlicher Arbeitsverdichtung.
• Erkennbar ist außerdem die Zunahme der Dissonanz zwischen dem Soll professioneller Standards und ethischer Normen sowie dem Alltags-Ist von Pflegekräften und Ärzten. Die Anpassung der Normen an die Wirklichkeit führte zu irreversiblen Qualitätsverlusten.
Die Untersuchung der DRG-Wirkungen in niedersächsischen Krankenhäusern förderte u.a. folgende Ergebnisse zutage:
• "Die Qualität der unmittelbaren Patientenversorgung im Krankenhaus hat sich aufgrund der DRG-Einführung im Großen und Ganzen nicht verändert.
• Für eine gezielte Selektion lukrativer Behandlungsfälle ("Rosinenpickerei") gibt es keine Belege.
• Das Phänomen einer systematischen "blutigen Entlassung" kann nicht belegt werden.
• Eine Zunahme ungeplanter Wiederaufnahmen ("Drehtüreffekt") … ist nicht nachweisbar.
• Die Krankenhäuser haben die essentiellen Voraussetzungen für die operative Umsetzung des DRG-Systems geschaffen; eine zukunftsfähige strategische Ausrichtung sowie eine durchgängige Prozessgestaltung ist nur zum Teil umgesetzt worden.
• Die Arbeitsbedingungen haben sich im Zuge der DRG-Einführung verändert, wobei der Dokumentations- und Kodieraufwand überschätzt wird; einer höheren Arbeitsdichte in Folge u.a. der weiteren Verweildauerverkürzung und Fallzahlsteigerung ist nicht durch konsequent umgesetzte Prozessorientierung begegnet worden.
• Die mittleren und großen Krankenhäuser sind auch unter DRG-Bedingungen überwiegend ökonomisch erfolgreich, weil sie die Möglichkeiten zur strategischen Neuausrichtung nutzen können, während dies für die kleineren Krankenhäuser deutlich schwieriger ist."
Zu den wesentlichen Ergebnissen des IGES/INEK-Projekts gehören:
• Negative Erwartungen wie z.B. Fallzahlvermehrung, die Zunahme der Verlagerung von Leistungen in die Rehabilitation oder die Risikoselektion unprofitabler Fälle sind nicht eingetroffen bzw. nachweisbar.
• Die Wirtschaftlichkeit der stationären Versorgung ist "nach überwiegender Ansicht der Befragten" durch die DRG "insgesamt gestiegen".
• Die Trennung zwischen spezifischen DRG-Effekten und anderen plausiblen Einflussfaktoren ist zumeist nicht möglich (z.B. bei Liegezeiten).
• Im Bereich der Aufbau- und Ablauforganisation der Krankenhäuser, d.h. beispielsweise in den Bereichen Medizincontrolling und Entlassungsmanagement lösten die DRG "starke Impulse für Anpassungen" aus.
• Die DRG-Einführung wirkt sich "eher negativ" auf Motivation, Zufriedenheit und die allgemeinen Arbeitsbedingungen aus.
• Im Lichte der ausgewählten Leistungsbereiche und des eingeschränkten Indikatorensets der BQS-Berichte existiert unter DRG-Bedingungen eine "stabile oder verbesserte Prozess- und Ergebnisqualität" im Krankenhaus.
• Unter DRG-Bedingungen entsteht eine "deutlich verbesserte Transparenz über das stationäre Leistungsgeschehen."
• Als eine Art Zusammenfassung finden sich schließlich in der IGES-Studie die folgenden beiden spannungsgeladenen Sätze: "Das G-DRG-System und sein Einführungsprozess, aber auch die Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit, werden somit insgesamt mehrheitlich positiv beurteilt. Als negative Begleiterscheinungen werden dagegen immer wieder die Arbeitsverdichtung für die Beschäftigten in den Krankenhäusern und der mit einer stärker betriebswirtschaftlich ausgerichteten Steuerung verbundene grundsätzliche Perspektivwechsel in der stationären Versorgung genannt."
Ohne damit einer spannenden vergleichenden Diskussion der Ergebnisse der drei Studien vorgreifen zu wollen, zeigen sich zum einen eine Reihe wichtiger Übereinstimmungen zur Reformdynamik und den Schwierigkeiten ihrer trennscharfen Evaluation. Zum anderen gibt es aber auch eine Reihe mehr oder weniger deutlicher Unterschiede über deren Existenz und Zustandekommen sich eine gründliche methodische und inhaltliche Debatte lohnt.
Dies gilt z.B. dann, wenn in der INEK/IGES-Studie viele der befragten Krankenhausleitungen auf die entsprechende Frage antworten, sie hätten ein Entlassungsmanagement "aufgebaut" und nur eine Minderheit der in der WAMP-Studie danach befragten und tagtäglich mit ihm befassten Ärzte und Pflegekräfte über mehrere Jahre hinweg von dessen Existenz und gutem Funktionieren in ihrem beruflichen Alltag berichtet. "Lügen" sich also die Krankenhausleitungen "in die Tasche" oder "jammern" die Beschäftigten mal wieder? Und was bedeutet dies für die Methodik von weiteren Auswirkungsanalysen?
Den derzeit umfassendsten Überblick über die Ergebnisse der WAMP-Studie gibt es leider nicht kostenlos, sondern nur in normaler Buchform: Braun, B./Buhr, P./Klinke, S./Müller, R./Rosenbrock, R. (2010): Pauschalpatienten, Kurzlieger und Draufzahler - Auswirkungen der DRGs auf Versorgungsqualität und Arbeitsbedingungen im Krankenhaus. Bern: Huber.
Und auch ein etwas älterer kurzer Überblick ist nur als Buchbeitrag erhältlich: Braun B./Buhr P./Klinke S./Müller R./Rosenbrock R. (2009): Einfluss der DRGs auf Arbeitsbedingungen und Versorgungsqualität. In: Rau F./Roeder N./Hensen P. (Hrsg.) (2009): Auswirkungen der DRG-Einführung in Deutschland. Stuttgart: Kohlhammer: 61-73. Der Sammelband von Rau et al. ist allerdings eine enzyklopädische Fundgrube, die sogar den leider hohen Preis rechtfertigt.
Zwei WAMP-Studien über die Auswirkungen der DRG auf die Pflegearbeit sind aber komplett kostenlos erhältlich: Braun, B./Buhr, P./Müller, R. (2008): Pflegearbeit im Krankenhaus. St. Augustin: Asgard.. Und: Braun, B./Müller, R./Timm, A. (2004): Gesundheitliche Belastungen, Arbeitsbedingungen und Erwerbsbiografien von Pflegekräften im Krankenhaus. St. Augustin: Asgard..
Kostenlos erhältlich ist auch noch die bisher einzige veröffentlichte Studie über die DRG-Auswirkungen auf die Versorgungsqualität aus Sicht der Patienten: Bernard Braun, Rolf Müller (2006): Versorgungsqualität im Krankenhaus aus der Perspektive der Patienten. Sankt Augustin: Asgard-Verl. Hippe.
Über die Ergebnisse des Niedersachsenprojekts "AUSWIRKUNGEN DER DRG-EINFÜHRUNG. Die Qualität hat nicht gelitten. Eine repräsentative wissenschaftliche Studie aus Niedersachsen kommt zu überraschenden Ergebnissen" von Brigitte Sens, Paul Wenzlaff, Gerd Pommer, Horst von der Hardt gibt es im Deutschen Ärzteblatt (Dtsch Arztebl 2010; 107(1-2): A 25-7) einen kostenlos erhältlichen Aufsatz.
Der komplette 100-seitige Ergebnisbericht "Sens B., Wenzlaff P., Pommer G., von der Hardt H. (2009): Effekte der pauschalierten Vergütung in der stationären Versorgung (DRG) auf die Gesundheitsversorgung: DRG-induzierte Veränderungen und ihre Auswirkungen auf die Organisationen, Professionals, Patienten und Qualität" ist kostenlos in Broschürenform über die Autoren (E-Mail: brigitte.sens@zq-aekn.de) erhältlich.
Aus der offiziellen DRG-Begleitforschung der so genannten IGES/INEK-Studie gibt es seit dem 31.3.2010 drei wichtige Veröffentlichungen kostenlos und in imponierender Fülle komplett zum Herunterladen und Weiterarbeiten:
Den 895 Seiten umfassenden "Endbericht des ersten Forschungszyklus (2004 bis 2006) - G-DRG-Begleitforschung gemäß § 17b Abs. 8 KHG" gibt es allerdings erst, wenn man auf einer Eingangsseite einer Art Datenschutzerklärung zustimmt.
Die beiden anderen, über dieselbe Website erhältlichen Texte bzw. Datensammlungen sind die siebzehnseitige "Benutzeranleitung" zur "Datenveröffentlichung zur DRG-Einführung" und dann die fast 39 MB große Datenbank mit sämtlichen zur Erstellung des Berichts benutzten Daten. Mit diesem äußerst innovativen Angebot können Interessenten und kompetente Nutzer vorhandene Berechnungen nachrechnen bzw. weitere Analysen vornehmen. Technische Bedingung ist, dass sich sämtliche Dateien der Datenbank in einem Verzeichnis auf einem Rechner befinden.
Bernard Braun, 5.4.10
Sind private gewinnorientierte Krankenhäuser in Deutschland wirtschaftlicher als öffentliche Krankenhäuser? Nein!
 Wer diese Frage unter dem Eindruck von Hochglanzprospekten, Krankenhaus-Hitlisten und öffentlicher "Berichterstattung" mit "Ja" beantwortet und sich als Mitarbeiter oder Befürworter öffentlicher oder frei-gemeinnütziger Krankenhäuser am liebsten vor einer Antwort gedrückt hätte, kann sich hiermit wundern und den Kopf wieder etwas höher tragen.
Wer diese Frage unter dem Eindruck von Hochglanzprospekten, Krankenhaus-Hitlisten und öffentlicher "Berichterstattung" mit "Ja" beantwortet und sich als Mitarbeiter oder Befürworter öffentlicher oder frei-gemeinnütziger Krankenhäuser am liebsten vor einer Antwort gedrückt hätte, kann sich hiermit wundern und den Kopf wieder etwas höher tragen.
Eine Analyse der Ökonomen Tiemann und Schreyögg von der "Munich School of Management" hat sich nämlich diese Frage auch gestellt und für die Antwort die umfangreichen betriebswirtschaftlichen Daten zur Arbeit der unterschiedlichen Eigentums- oder Trägertypen von Krankenhäuser gründlich analysiert. Die Forscher verglichen dabei insbesondere die Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit von Krankenhäusern in öffentlichem Eigentum mit der von gewinnorientierten wie nicht gewinnorientierten Kliniken in privatem Besitz.
Anders als einer Reihe früherer Studien ging in ihre Berechnung nicht nur die Anzahl der behandelten Fälle und Finanzdaten bis hin zum Gewinn ein, sondern auch Daten über die Qualität der Versorgung und die Heterogenität der in den unterschiedlichen Krankenhausarten behandelten PatientInnen.
In einem ersten Schritt bewerteten sie für die Jahre 2002 bis 2006 mit einer so genannten "data envelopment analysis (DEA)" die Leistungsfähigkeit von 1.046, d.h. knapp der Hälfte der noch betriebenen Krankenhäuser in öffentlichem und privaten Besitz. Letztere wurden nochmals nach "for-profit" oder "non-profit"-Krankenhäuser unterschieden.
In einem zweiten Analyseschritt verfeinerten sie die Effizienzanalyse durch eine multivariate lineare Regressionsanalyse, in deren Modell auch organisatoriche Merkmale, Umweltcharakteristika und vor allem die Verschiedenheit des "Patientenguts" eingingen.
Die zum Teil unerwarteten Ergebnissen fassten die Forscher so zusammen:
• "Our findings show that public ownership was associated with significantly higher efficiency than other forms of ownership; private for-profit ownership, in particular, was associated with lower efficiency."
• An diesen Schlüsselergebnissen veränderte sich auch nach einer Reihe von Sensitivitätsüberprüfungen nichts.
• Was private Krankenhäuser besser hinbekommen als öffentlich getragene und was diese stattdessen in den Vordergrund ihres Handelns rückten, bringen die Autoren auf folgenden Nenner: "Our results suggest that private for-profit hospitals place greater emphasis on earning profits (i.e. higher revenues per case due to higher prices), whereas public hospitals, because of resource constraints, focus primarily on input efficiency."
• Ein weiteres wichtiges Ergebnis war die positive Assoziation zwischen der Krankenhausgröße und der Leistungsfähigkeit. Private gewinnorientierte Krankenhäuser waren dabei unter den Kliniken mit mehr als 1.000 Betten wirtschaftlicher als alle anderen Krankenhaustypen.
• Private, gewinnorientierte Krankenhäuser, die bekanntermaßen vorrangig kleinere bis mittlere Krankenhäuser kaufen und dort ausgewählte Leistungen anbieten, wären daher "well advised, to change their acquisition strategy in terms of choice of hospital size and location."
• Dort wo ein strammer regionaler Wettbewerb zwischen Krankenhäusern existiert, waren die privaten gewinnorientierten Krankenhäuser allerdings unwirtschaftlicher als ihre Konkurrenten mit anderer Trägerschaft.
• Anders als dies von denjenigen, die Wettbewerb zum ordnungspolitischen Zweck oder Allheilmittel erklären, suggeriert wird, hat der Wettbewerbsdruck nach der Analyse der beiden Ökonomen einen "significant negative impact on hospital efficiency."
• Abschließend stellen sie daher fest: "The ongoing trend towards privatization in Germany may not be an appropriate way to ensure the best use of the scarce resources in the hospital sector, because public hospitals use relatively fewer resources than private for-profit hospitals."
Angesichts der ungehinderten weiteren Privatisierung von Krankenhäusern darf man in jedem Fall auf die Ergebnisse der von den beiden Betriebswirten zusätzlich für notwendig gehaltenen Längsschnittanalyse der Wirtschaftlichkeit der verschiedenen Krankenhaustypen gespannt sein.
Die mit detaillierten Angaben gespickte Studie "Effects of Ownership on Hospital Efficiency in Germany" von Oliver Tiemann, Jonas Schreyögg ist im Sammelband "BuR - Business Research Official Open Access Journal of VHB" des Verbands der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft (Volume 2, Issue 2, December 2009: 115-145) erschienen und kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 17.3.10
Moderne Legenden: Kosten sparen und Qualität verbessern mit Computern im Krankenhaus!?
 Die real existierende IT-Ausstattung ist fast in jedem Krankenhaus spätestens seit Einführung der DRG ein beliebtes Beispiel für nicht endenwollende Organisationsprobleme, überbordende Dokumentationsarbeit oder abgehobene Programmierer ohne jeglichen "Sinn für das Besondere der ärztlichen oder pflegerischen Arbeit".
Die real existierende IT-Ausstattung ist fast in jedem Krankenhaus spätestens seit Einführung der DRG ein beliebtes Beispiel für nicht endenwollende Organisationsprobleme, überbordende Dokumentationsarbeit oder abgehobene Programmierer ohne jeglichen "Sinn für das Besondere der ärztlichen oder pflegerischen Arbeit".
Trotzdem wird natürlich von IT-Beratern und Anbietern von "Systemlösungen" aber auch von Ärzten, Krankenkassen und manchen Patientenvertretern eher auf mehr und neue Patientenerfassungs- und -informationssysteme oder bed-side-online-Tablets gesetzt und von einem Telematikparadies geträumt. Zumindest die jeweils künftigen EDV-Systeme sollen Kosten sparen helfen, die Patientensicherheit erhöhen und auch die restliche Behandlungsqualität verbessern.
Tun sie das aber wirklich oder bedeutet die Forderung nach "mehr Computer und IT" nur noch mehr Beschäftigung mit als sinnlos und belastend empfundener Technik? Wie nahezu gewohnt, gibt es dazu aus Deutschland trotz der auch hierzulande enormen EDV-Ausgaben (noch) keine empirisch seriöse und belastbare Antwort.
Ebenfalls mit großer Verzögerung, aber immerhin, bietet jetzt aber eine in den USA für die Jahre 2003 bis 2007 durchgeführte Auswertung von Daten über den Einsatz von Computern (Daten aus dem größten Längsschnittdatensatz, dem jährlichen "Healthcare Information and Management Systems Society"-Survey) aus beinahe 4.000 Krankenhäusern tiefe Einblicke in die Wirklichkeit hinter Werbeprospekten und Selbstbeschwörungsrhetorik.
Das unerwartet ernüchternde Ergebnis lautet: Weder die Verwaltungskosten noch die Behandlungskosten sanken durch den EDV-Einsatz. Dieser bewirkte auch keine nennenswerte Straffung oder Dynamisierung ("streamlined") der Verwaltung. Die Frage, ob Computer dann wenigstens die Qualität verbessern und damit indirekt doch noch Kosteneffekte haben, lässt sich nach Ansicht der Forschergruppe von der Harvard University nicht eindeutig positiv beantworten: "Auch, wenn optimale Computerisierung wahrscheinlich die Qualität verbessert, bleibt unklar, ob die gegenwärtig in den meisten Kliniken eingesetzten Systeme solche Verbesserungen erzielen."
Die ForscherInnengruppe von der Harvard Medical School berechnete für jedes der knapp 4.000 Krankenhäuser einen Gesamtwert für deren Computerisierung und außerdem drei Sub-Scores, welche die Ausstattung mit 24 speziellen EDV-gestützten Programmen (z.B. elektronische Patientenakte oder Verordnungsprogramm) abbildeten. Dem gegenüber gingen Verwaltungskostendaten aus den "Medicare Cost Reports" sowie Kosten- und Qualitätsdaten aus dem legendären und beispielhaft guten Dartmouth Health Atlas für das Jahr 2008 in die Berechnungen ein. Zentrale Fragen drehten sich darum, ob Krankenhäuser mit besserer EDV-Ausstattung geringere Behandlungs- und Verwaltungskosten haben oder bessere Qualität. Dazu verglichen die Bostoner ForscherInnen auch die Werte der Kliniken, die der Liste der "100 Most wired" angehörten, mit anderen Kliniken. In den multivariaten Analysen wurde neben der EDV-Ausstattung, Faktoren wie der Status als Ausbildungskrankenhaus, die Bettenanzahl, die regionale Lage (Stadt/Land), die Eigentümerverhältnis (gewinnorientiert, öffentlich oder privat non-profit-Status) Bundesstaat und die Versorgungsstufe des Krankenhauses mit berücksichtigt.
Die wichtigsten Ergebnisse lauteten:
• Computerisiertere Krankenhäuser hatten in bivariaten statistischen Analysen sogar signifikant höhere Gesamtkosten als Häuser mit geringerer IT-Ausstattung. In multivariaten Analysen zeigten sich keinerlei statistisch signifikante Zusammenhänge mit niedrigeren Verwaltungs- und Behandlungskosten, aber auch keine mit höheren Kosten.
• Weder die Indikatoren für die Gesamtausstattung mit EDV noch Subgruppen für den Grad der Computerisierung waren durchweg oder konsistent mit weniger Verwaltungskosten verbunden. Bei Betrachtung einzelner Aspekte hatten Krankenhäuser in denen die EDV sehr schnell eingeführt wurde, einen hochsignifikant schnelleren Anstieg ihrer Verwaltungskosten als Häuser mit langsamerer Einführung.
• Summa summarum: "We found no evidence that computerization has lowered costs or streamlined administration."
• Ein höheres allgemeines Ausstattungsniveau mit IT korrelierte nur schwach mit der Qualität der Versorgung von Patienten und dies auch nur bei der Versorgung von PatientInnen mit Akut-Herzinfarkt. Keinerlei signifikante Zusammenhänge gab es aber mit der Versorgungsqualität von PatientInnen mit Herzschwäche, Lungenentzündung oder mit einem Indikator, der die Qualität der Behandlung mehrerer Krankheiten zusammenfasst.
• In multivariaten Analysen hatten mehr computerisierte Krankenhäuser eine leicht bessere Qualität ihrer Behandlungsangebote. Wie schwach letztlich dieser Zusammenhang ist, zeigt sich aber daran, dass die 100 Spitzenreiter bei der Computerisierung weder bei Verwaltungs- und Behandlungskosten noch bei der Qualität besser waren als die restlichen 3.900 Kliniken.
Dass kaum oder nur sehr eingeschränkt Kosteneinsparungen erkennbar sind, führen die ForscherInnen darauf zurück, dass die Beschaffungs- und Einsatzkosten von EDV die erzielten oder erzielbaren Einsparungen konstant übertreffen. Für möglich halten sie es auch, dass die Einspareffekte erst nach einem sehr hohen Grad des Computereinsatzes auftreten. Auch wenn es dafür Belege in der 100er-Spitzengruppe zu geben scheint, gibt es auch gerade dort jede Menge Beispiele für hochausgerüstete Kliniken, die keine Kostenersparnisse hatten.
Insbesondere die sehr bescheidenen oder fehlenden qualitätsverbessernden Effekte der Computerisierung sind nach Meinung der ForscherInnen nicht einfach zu erklären. Von ihnen wird nach einer kurzen Sichtung einiger Analysen zu den Wirkungen des Einsatzes von IT in US-Krankenhäusern zwar keineswegs prinzipiell eine positive Wirkung von IT auf Kosten und Qualität ("optimal computerization probably improves quality") ausgeschlossen. Warum dies trotzdem empirisch nur selten funktioniert, liegt ihres Erachtens vor allem daran, dass "the commercial marketplace does not favor optimal products. Coding and other reimbursement-driven documentation might take precedence over efficiency and the encouragement of clinical parsimony."
Dass die herrschenden Vergütungssysteme ein gewichtiger Erklärungsfaktor für die geringen Effekte des IT-Einsatzes sein könnten, macht das Beispiel der Krankenhäuser der "Veterans Administration" (der speziellen staatlichen Versicherung und des speziellen Leistungsanbieters für Exsoldaten) plausibel. Dort erfolgt die gesamte Finanzierung über Globalbudgets, die individuelle Rechnungsstellung und detaillierte interne Kostenerfassung als klassische Produktivitätsbremsen überflüssig machen und auch den kommerziellen Druck minimieren.
Auch wenn die letzten Thesen und ihre Evidenz gründlicher untersucht werden müssen, zeigen sie deutlich, an wie vielen und vor allem welchen "Rädchen" im sozialen System Krankenhaus und vor allem außerhalb von ihm gedreht werden muss, um die erhofften und wünschenswerten Effekte der IT erzielen zu können. Und er zeigt auch, dass die Lösung nicht in der Bestellung und Implementation einer neuen Rechnerarchitektur oder neuer Software also in neuer Technik liegt. Dieses Geld sollte man sich nach den nun gut belegten Ergebnissen in den USA für den Start einer inhaltlicheren Lösungsstrategie sparen.
Nebenbei: Die Analyse der Qualitätsangaben für die unterschiedlichen Krankenhaus-Typen belegt aufs Neue die höhere Qualität in Krankenhäusern mit Ausbildungsbetrieb und die geringere Qualität in gewinnorientierten Kliniken. Wer vielleicht dachte, höhere Verwaltungsausgaben wären durch bessere Qualität gerechtfertigt, findet dafür in diesen Daten keinen Beleg.
Der Aufsatz "Hospital Computing and the costs and quality of care: A National Study" von David Himmelstein, Adam Wright und Steffie Woolhandler wird noch 2009 in der Zeitschrift "The American Journal of Medicine" erscheinen, ist aber bereits jetzt online komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 9.12.09
"Privat" und "groß" gleich gut; "öffentlich" und "klein" gleich schlecht oder wie sieht die Klinik-Versorgungsqualität aus?
 Gibt es auch in Deutschland "gute" und "schlechte" Krankenhäuser, wie sehen diese Unterschiede aus und wie kann man sie erfahren? Für diese im Gegensatz z.B. zu den USA (vgl. dazu den Überblick über die in den USA regelmäßig veröffentlichten Krankenhausvergleiche) überhaupt erst seit kurzer Zeit stellbaren Fragen liegen mittlerweile genügend Antworten vor, welche die Notwendigkeit und den Nutzen einer regelmäßigen Berichterstattung belegen.
Gibt es auch in Deutschland "gute" und "schlechte" Krankenhäuser, wie sehen diese Unterschiede aus und wie kann man sie erfahren? Für diese im Gegensatz z.B. zu den USA (vgl. dazu den Überblick über die in den USA regelmäßig veröffentlichten Krankenhausvergleiche) überhaupt erst seit kurzer Zeit stellbaren Fragen liegen mittlerweile genügend Antworten vor, welche die Notwendigkeit und den Nutzen einer regelmäßigen Berichterstattung belegen.
Dazu gehört auch die im Rahmen eines größeren Forschungsprojekts konzipierte und durchgeführte, im September 2009 als Arbeitspapier Nr. 86 des Instituts für Genossenschaftswesen der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster veröffentlichte Auswertung der Daten zur externen vergleichenden Qualitätssicherung.
Seit dem Jahr 2001 veröffentlicht die Bundesgeschäftsstelle für Qualitätssicherung gGmbH (kurz: BQS) Qualitätsdaten deutscher Krankenhäuser. Diese ermöglichen es im Prinzip jedem Krankenhaus sich im Bereich der erfassten medizinischen und pflegerischen Qualitätsindikatoren mit allen in Deutschland zugelassenen Krankenhäusern3 zu vergleichen. Damit erhalten aber auch Patienten, niedergelassene Ärzte etc. einen Überblick über die erbrachte Qualität der Krankenhäuser.
Diese Vergleichsmöglichkeit wurde bisher auch, ob in den seit einiger Zeit auch gesetzlich vorgeschriebenen Qualitätsberichten oder in anderen Auswertungen, genutzt. In den Qualitätsberichten sollen die Krankenhäuser laut § 137 Abs. 3 lit. 4 SGB V "Inhalt, Umfang und Datenformat eines im Abstand von zwei Jahren zu veröffentlichenden strukturierten Qualitätsberichts der zugelassenen Krankenhäuser" darstellen. "Der Bericht hat auch Art und Anzahl der Leistungen des Krankenhauses auszuweisen und ist in einem für die Abbildung aller Kriterien geeigneten standardisierten Datensatzformat zu erstellen."
Die Vergleiche bestanden bisher aber durchweg darin, dass sich einzelne Häuser mit allen anderen Krankenhäusern verglichen. Vergleiche zwischen homogenen Teilgruppen, also etwa zwischen ost- und süddeutschen, großen und kleinen oder privaten und öffentlichen Kliniken existierten nicht, obwohl solche Vergleiche z.B. für eine anspruchsvolle regionale Krankenhausplanung wichtig wären.
Den möglichen Nutzen derartiger Vergleiche und ihre Machbarkeit versuchte nun die Münsteraner Studie mit Daten des Jahres 2006 zu demonstrieren. Aus den 24 Leistungsbereichen der BQS-Qualitätsmessung mit ihren 180 Qualitätsindikatoren und 282 Qualitätskennzahlen wurden diejenigen Leistungsbereiche ausgewählt, welche nach Einschätzung von Medizinern, Pflegenden und Patientenvertretern für die Patienten und einweisenden Ärzte die geeignetsten Informationen über die jeweilige Qualität des Krankenhauses liefern.
Zu den wichtigsten Qualitätsunterschiede zwischen den unterschiedlich aggregierten oder geclusterten Krankenhäusern zählten:
• "Krankenhäuser in privater Trägerschaft belegten fünfundzwanzigmal den ersten Platz, viermal den zweiten und einmal den dritten Platz. Krankenhäuser in öffentlicher Trägerstruktur belegten den ersten Platz zweimal und Rang zwei und drei jeweils vierzehnmal. Freigemeinnützige Krankenhäuser belegten achtmal Rang eins, neunmal
Rang zwei und dreizehnmal Rang drei." Dabei gab es indikatorenspezisch teilweise enorme Unterschiede: "Die größte Amplitude von 21,44% Punkten innerhalb eines Qualitätsindikators kann bei der internen Nummer 14 "Komplikation: Verrutschen der Vorhofsonden" im Leistungsbereich Herzschrittmacher Implantation abgelesen werden. Bei diesem Indikator erreichen private Träger einen Prozentsatz von 61,11% gegenüber Krankenhäusern in freigemeinnütziger Trägerschaft die nur 39,67% erzielen. Dies kann wie folgt interpretiert werden: in sechs von zehn Krankenhäusern in privater Trägerschaft wird gute Qualität geleistet und in nur vier von zehn Krankenhäusern in freigemeinnütziger Trägerschaft wird gute Qualität erbracht. Auch Krankenhäuser in öffentlicher Trägerschaft erreichen nur einen Anteil von 42,66%."
Wichtig ist, dass es keineswegs immer derselbe Trägertyp ist, der qualitativ hochwertige Leistungen erbringt, sondern dass dies je nach Leistung variiert.
• Bei dem Merkmal der Größe eines Krankenhauses gibt es die Tendenz, dass größere Krankenhäuser bei vielen Qualitätsindikatoren häufiger eine gute Qualität leisten als kleinere Krankenhäuser.
• Im Vergleich der "alten" Bundesländer mit den "neuen" Bundesländern ist erkennbar, dass die neuen Bundesländer (inkl. Berlin) häufiger gute Qualität erbringen als die "alten" Bundesländer. Dabei ist aber bemerkenswert, dass bei rund der Hälfte der Qualitätsindikatoren kein Einfluss der geografischen Lage der Krankenhäuser nachgewiesen werden konnte. Bei den übrigen Indikatoren konnte dagegen statistisch signifikante Unterschiede festgestellt werden.
• Zu den inhaltlich am wenigsten erwarteten Ergebnisse der regionalen Analyse gehört ein Nord-Süd-Qualitätsgefälle und zwar wider Erwarten ein Gefälle vom qualitativ guten zum nicht guten Süden der Republik. Auch hier zeigt sich aber bei zwölf Indikatoren eine Beeinflussung zwischen den Merkmalen "Qualität" und "geografische Position" bei achtzehn der untersuchten Indikatoren dagegen keine signifikanten Unterschiede.
Auch wenn die Autoren wichtige Belege für den Nutzen derartiger Analysen und Hinweise für die Versorgungsforschung und -planung liefern, werden sie nicht darum herum kommen, weitere möglicherweise erklärungskräftige Merkmale in ihre Analysen aufzunehmen. Eine weitere Beschränkung ihrer bisherigen Analysen liegt schließlich in der im Vergleich zum gesamten stationären Versorgungsgeschehen begrenzten Anzahl der von der BQS dokumentierten Qualitätsindikatoren.
Die 50 Seiten umfassende Studie "Qualitätsvergleich deutscher Krankenhäuser. Eine Studie anhand der Daten zur externen vergleichenden Qualitätssicherung" von Christoph Heller ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 4.11.09
"Immer an der Spitze!" - Arbeitsbedingungen und Belastungen der Gesundheits- und Krankenpfleger/innen
 Egal ob es um die Anzahl der Beschäftigten im Gesundheitswesen oder den Beitrag zum gesundheitlichen Wohlbefinden von PatientInnen geht: Krankenpflege und Pflegekräfte sind immer ganz vorne dabei. Wie eine gerade veröffentliche Ausgabe des STATmagazin des Statistischen Bundesamtes mit Daten der Gesundheitspersonalrechnung, der Krankenhausstatistik des Bundes und der Länder und des Mikrozensus zeigt, liegen Pflegekräfte auch bei manchen belastenden Arbeitsbedingungen an der Spitze.
Egal ob es um die Anzahl der Beschäftigten im Gesundheitswesen oder den Beitrag zum gesundheitlichen Wohlbefinden von PatientInnen geht: Krankenpflege und Pflegekräfte sind immer ganz vorne dabei. Wie eine gerade veröffentliche Ausgabe des STATmagazin des Statistischen Bundesamtes mit Daten der Gesundheitspersonalrechnung, der Krankenhausstatistik des Bundes und der Länder und des Mikrozensus zeigt, liegen Pflegekräfte auch bei manchen belastenden Arbeitsbedingungen an der Spitze.
Die wichtigsten Daten zeichnen folgendes Bild der Krankenpflege:
• Mit 712.000 Beschäftigten stellten die Gesundheits- und Krankenpflegerinnen/-pfleger 2007 die größte Berufsgruppe unter den Gesundheitsdienstberufen. 490.000 arbeiteten primär in Krankenhäusern, 98.000 in der ambulanten Pflege.
• Ihre Zahl stieg von 1997 bis 2007 um 5%. Rechnet man aber alle Beschäftigungsverhältnisse in Vollzeitstellen um, war deren Anzahl im selben Zeitraum rückläufig, und zwar von 518.000 auf 512.000. Vollzeitstellen waren um 12% zurückgegangen während Teilzeit- und geringfügige Beschäftigungsverhältnisse um rund 39% zunahmen. Aktuell dürfte sich daran wegen der personellen Aufstockungen in den Jahren 2008 und 2009 etwas verändert haben: quantitativ, aber nicht qualitativ.
• Um Genaueres über die allgemeine Belastung des Pflegepersonals in Krankenhäusern sagen zu können, berechnet das Statistische Bundesamt zwei Pflegedienstbelastungszahlen: die durchschnittliche Zahl der Behandlungsfälle je Pflegevollkraft pro Jahr und die durchschnittliche Zahl der zu versorgenden Betten je Pflegevollkraft pro Jahr.
• Die Anzahl der zu versorgenden Betten fiel von 504 im Jahr 1997 auf 474 im Jahr 2004 und bewegte sich von diesem Wert auf 479 im Jahr 2007 - was insgesamt einer Verringerung von 5% entsprach.
• Die Zahl der Behandlungsfälle pro Pflegevollkraft nahm im selben Zeitraum von 48 kontinuierlich auf 58 zu - was einer Erhöhung um 21% entsprach.
• Zusätzlich zu dem was der letzte Indikator zur Verdichtung der Pflegearbeit zeigt, stellt das höhere werdende Alter der KrankenhauspatientInnen einen zweiten Verdichtungsfaktor dar. 1997 waren rund 32% von ihnen 65 Jahre und älter, 2007 bereits 43%. Auch wenn nicht automatisch alle älteren Personen multimorbide sind oder weniger Selbstversorgungsfähigkeit haben als Jüngere, nimmt der Anteil der deswegen zeitlich und mental aufwändigeren PatientInnen in jedem Fall zu.
• 2007 arbeiteten nach den Daten des Mikrozensus rund 69% der Gesundheits- und Krankenpflegerinnen/-pfleger ständig, regelmäßig oder gelegentlich im Schichtdienst. Dies traf auf die Beschäftigten in Gesundheitsdienstberufen und in der Gesamtwirtschaft mit rund 17% und 14% wesentlich seltener zu. Pflegekräfte arbeiteten auch besonders häufig an Samstagen (85%), Sonn- und Feiertagen (84%) und nachts (58%).
• Der Anteil der Pflegekräfte mit Überstunden war mit knapp 22% dagegen ähnlich hoch wie bei allen Gesundheitsdienstberufen (21%) oder in der Gesamtwirtschaft (20%). Dies hängt wahrscheinlich direkt mit der höheren Anzahl von Teilzeitbeschäftigten unter den Pflegekräften zusammen.
• Die Frage, ob sie in den letzten 12 Monaten mindestens ein arbeitsbedingtes Gesundheitsproblem gehabt hätten, bejahten 16% der Pflegekräfte aber nur 6,4% und 6,5% der Beschäftigten in allen Gesundheitsdienstberufen und in der Gesamtwirtschaft.
• Als Hauptbelastungsfaktoren nannten alle drei Beschäftigtengruppen schwierige Körperhaltungen, Zeitdruck und Arbeitsüberlastung. Auch hier gab es deutliche Unterschiede zwischen Pflegekräften und den beiden anderen Beschäftigtengruppen. Den 35% der Pflegekräfte, die schwierige Körperhaltungen oder Hantieren mit schweren Lasten als Hauptbelastungen angaben, stehen 15% (Gesundheitsdienstberufe) und 7% (Gesamtwirtschaft) gegenüber. Ein ähnliches Bild ergibt sich bei der Belastung durch Zeitdruck: 33% der Pflegekräfte klagten darüber, aber "nur" 24% bei Beschäftigten in Gesundheitsdienstberufen und 15% in der Gesamtwirtschaft.
Das 4 Seiten umfassende STATmagazin "Krankenpflege - Berufsbelastung und Arbeitsbedingungen" des Statistischen Bundesamtes ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 29.8.09
Gesundheitsförderung für Krankenhausärzte und in Krankenhäusern - Fehlanzeige!
 Anders als man dies vielleicht in oder von einer Einrichtung der Gesundheitsversorgung und bei Ärzten erwartet: "Erstens ist die Arbeitsbelastung der Krankenhausärzte ... vergleichsweise hoch. Zweitens gibt es trotz einer Reihe positiver Ansätze ein Verbreitungs- und Umsetzungsdefizit vor allem für ausgewählte verhaltenspräventive wie verhältnispräventive Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung im Krankenhaus. Und drittens beeinflussen Maßnahmen des betrieblichen Gesundheits- und Qualitätsmanagements die Arbeitsbedingungen und die Gesundheit der Krankenhausärzte bislang kaum."
Anders als man dies vielleicht in oder von einer Einrichtung der Gesundheitsversorgung und bei Ärzten erwartet: "Erstens ist die Arbeitsbelastung der Krankenhausärzte ... vergleichsweise hoch. Zweitens gibt es trotz einer Reihe positiver Ansätze ein Verbreitungs- und Umsetzungsdefizit vor allem für ausgewählte verhaltenspräventive wie verhältnispräventive Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung im Krankenhaus. Und drittens beeinflussen Maßnahmen des betrieblichen Gesundheits- und Qualitätsmanagements die Arbeitsbedingungen und die Gesundheit der Krankenhausärzte bislang kaum."
Dies sind die drei wesentlichen Ergebnisse einer im Januar 2009 abgeschlossenen und von der Hans-Böckler-Stiftung geförderten Untersuchung der "Psychosoziale Arbeitsbelastungen, Patientenversorgung und betriebliche Gesundheitsförderung im Krankenhaus. - Eine Befragung von Ärzten und Krankenhäusern".
In dem gemeinsam von MitarbeiterInnen des Institut für Medizin-Soziologie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, des Düsseldorfer Deutschen Krankenhausinstituts und des Instituts für Medizinische Soziologie an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf durchgeführten empirischen Forschungsprojekt wurde sowohl eine Befragung von Krankenhausärzten als auch der Krankenhäuser, d.h. in der Regel der Krankenhausleitungen durchgeführt.
Die Grundgesamtheit der Ärztebefragung umfasste alle hauptamtlichen Krankenhausärzte in Allgemeinkrankenhäusern ab 100 Betten mit einer Fachabteilung für Chirurgie und/oder Gynäkologie bzw. Geburtshilfe (ohne Belegabteilungen). Das sind rund 31.000 Ärzte, die etwa 98% der stationär tätigen Ärzte beider Fachgebiete insgesamt ausmachen. Die bereinigte Ärztestichprobe umfasste 3.648 Ärzte, wovon 2643 aus einer chirurgischen und 1005 aus einer gynäkologischen Fachabteilung einbezogen wurden. Die Rücklauf-Stichprobe betrug auf der Arztebene 35,9%, was eine für Ärztebefragungen respektable Quote ist. Noch deutlich besser wird die Quote, wenn man nur die Ärzte rechnet, die aus Krankenhäusern stammten, die an der zusätzlichen Krankenhausbefragung teilnahmen. Von deren Ärzten antworteten immerhin 64,9%. Die Möglichkeit das Antwortverhalten von Ärzten und ihrem Krankenhaus aufeinander zu beziehen besteht selten, erhöht aber auch die Aussagekraft der Ergebnisse.
Die Krankenhausbefragung befasste sich mit dem Stand der betrieblichen Gesundheitsförderung und des Qualitätsmanagements in den Krankenhäusern. Ziel dieses Teilprojektes war es, Maßnahmen und Instrumente der betrieblichen Gesundheitsförderung und des Qualitätsmanagements in deutschen Krankenhäusern systematisch zu beschreiben.
Bereinigt wurden brutto 922 Krankenhäuser angeschrieben. Insgesamt antworteten 291 Krankenhäuser, einer Rücklaufquote von 31,6% entspricht. Die Ausschöpfungsquote fiel in der Krankenhausbefragung insofern merklich niedriger aus als in der Ärztebefragung.
Neben einer detaillierten Darstellung der eingangs zusammengefassten Ergebnisse beider Befragungen, versuchte das ForscherInnenteam auch Schlussfolgerungen zu ziehen und kam im Wesentlichen auf zwei: "Zum einen ist die Verbreitung und Wirksamkeit der betrieblichen Gesundheitsförderung im Krankenhaus insgesamt zu erhöhen. Zum anderen sind zielgruppenorientiert Gesundheitsförderungsmaßnahmen speziell für die Ärzteschaft zu entwickeln und umzusetzen."
Um mehr betriebliche Gesundheitsförderung aber wirklich implementieren zu können bedarf es mehr als reiner Appelle. Ob die stattdessen vorgeschlagene Entwicklung einer "gesundheitsförderlichen Unternehmenskultur und -organisation" sowie professionell und systematisch durchgeführeter einschlägiger Gesundheitsförderungsprojekte wirklich zum erwarteten "Ruck" in Sachen Gesundheitsförderung führt ist solange nicht zwingend wie man nicht genug weiß, welche Faktoren, Bedingungen, Akteure, Handlungsroutinen etc. zum aktuellen Zustand beigetreagen haben.
Immerhin kann "im Grundsatz auf das WHO-Konzept Gesundheitsfördernder Krankenhäuser verwiesen werden", das in wenigen Kliniken einige tatsächliche Veränderungen bewirkt hat.
So richtig in diesem Zusammenhang die Hinweise sind
• "das Krankenhaus" möge "eine nach Möglichkeit schriftlich festgelegte Gesundheitsförderungspolitik" entwickeln
• sowie "Strategie und Ziele der Gesundheitsförderung sowie operative Maßnahmen zur Zielerreichung" festlegen,
• die "Krankenhausleitung sowie die Bereichsleitungen" hätten "das betriebliche Gesundheitsmanagement aktiv zu unterstützen und konstruktiv zu begleiten" und eine "entsprechende Investitionsbereitschaft" zeigen,
• eine "spezifische Managementstruktur für die Gesundheitsförderung einrichten" und
• die "Mitarbeitervertretung oder ausgewählte Mitglieder davon partizipativ und aktiv in Veränderungsprozesse einzubinden" (was nach der Studie bisher kaum geschah),
so unklar bleibt fast durchweg, warum und wodurch dies eigentlich plötzlich geschehen oder möglich sein sollte.
Hilfreich ist aber sicherlich trotzdem der Vorschlag, die "Effektivität konkreter zielgruppenorientierter Veränderungsmaßnahmen" dadurch zu steigern, "dass die Gesundheitsförderung im Krankenhaus den Ärztlichen Dienst stärker als bislang in den Mittelpunkt stellt. ... Darüber hinaus sind die Ärzte stärker in das Projektmanagement im Rahmen der Gesundheitsförderung zu integrieren."
Eine Projektbeschreibung, weitere Einzelheiten und Links zu kostenlos erhältlichen projektbezogenen Publikationen finden sich im Rahmen der Projektübersicht der Hans Böckler Stiftung.
Bernard Braun, 19.7.09
Wie viel Prozent der Arbeitszeit verbringt ein Krankenhausarzt mit Patienten, Angehörigen und der Verwaltung? 11,8%, 0,9%, 12,5%!
 Von Ärzten aber auch Pflegekräften an Krankenhäusern sind in den letzten Jahren immer häufiger Klagen zu hören, sie hätten dank des mit den DRGs verbundenen Kodier- und Dokumentationsaufwands immer weniger Zeit für Gespräche mit Patienten und deren Angehörigen oder für die Behandlung der Patienten. Darüber ob dies wirklich so ist und wie viel der täglichen Arbeitszeit für die verschiedenen Tätigkeiten verwendet werden, gibt es aber nicht allzu viele Untersuchungen aus Deutschland oder sie beschäftigen sich, und dies gilt auch für die meisten internationalen Studien, fast nur mit der Gesprächszeit in Allgemeinpraxen. Die letzte Untersuchung über die Zeitaufwände von Krankenhausärzten in DEutschland stammt aus dem Jahr 1999, also aus einer Zeit mit deutlich anderen Rahmenbedingungen und hat eine Beobachtungsbasis von 5 Ärzten.
Von Ärzten aber auch Pflegekräften an Krankenhäusern sind in den letzten Jahren immer häufiger Klagen zu hören, sie hätten dank des mit den DRGs verbundenen Kodier- und Dokumentationsaufwands immer weniger Zeit für Gespräche mit Patienten und deren Angehörigen oder für die Behandlung der Patienten. Darüber ob dies wirklich so ist und wie viel der täglichen Arbeitszeit für die verschiedenen Tätigkeiten verwendet werden, gibt es aber nicht allzu viele Untersuchungen aus Deutschland oder sie beschäftigen sich, und dies gilt auch für die meisten internationalen Studien, fast nur mit der Gesprächszeit in Allgemeinpraxen. Die letzte Untersuchung über die Zeitaufwände von Krankenhausärzten in DEutschland stammt aus dem Jahr 1999, also aus einer Zeit mit deutlich anderen Rahmenbedingungen und hat eine Beobachtungsbasis von 5 Ärzten.
Welche Bedeutung Gespräche mit PatientInnen auch für Krankenhausärzte haben zeigt die Tatsache, dass sie in einem 40-jährigen Arbeitsleben nach entsprechenden Studien 150.000 bis 200.000 solcher Gespräche führen und der psychosomatisch orientierte Mediziner und Psychoanalytiker Balint mit guten Argumenten das Gespräch zwischen Arzt und Patient als das zentrale diagnostische und therapeutische Instrument bezeichnete.
Deshalb verdient auch eine bereits etwas ältere, nämlich 2007 veröffentlichte Studie Beachtung, die als Dissertationsprojekt bei immerhin 32 Ärzten auf 34 Stationen aus den Bereichen Innere Medizin, Chirurgie, Gynäkologie, Neurologie und Strahlenheilkunde am Universitätsklinikum Freiburg durchgeführt wurde und in deren Mittelpunkt die möglichst detaillierte Erfassung der Gesprächszeiten mit Patienten und Angehörigen stand.
Dazu begleitete die Jungforscherin die Ärzte jeweils einen Arbeitstag lang und maß mittels einer Stoppuhr die Dauer verschiedener ärztlicher Tätigkeiten. Zusätzlich wurde jeder teilnehmende Arzt gebeten, einen Fragebogen auszufüllen, in dem er eigene Schätzwerte bezüglich der Dauer verschiedener ärztlicher Tätigkeiten angeben und seine persönliche Zufriedenheit mit der zur Verfügung stehenden Zeit für bestimmte ärztliche Tätigkeiten benoten sollte. Schließlich wurde eine Querschnitterhebung durchgeführt, in dem eine Ärztin auf einer chirurgischen Station eine Arbeitswoche lang begleitet wurde.
Der Arbeitstag eines Arztes betrug durchschnittlich 659 Minuten und war damit länger als in einigen vergleichbaren Untersuchungen mit anderem Facharztspektrum und in anderen Behandlungsinstitutionen.
Auf diese Zeit verteilten sich die verschiedenen ärztlichen Aufgaben wie folgt: 11,8% Kommunikation mit Patienten, 0,9% Kommunikation mit Angehörigen, 4,9% Ärztliche Besprechungen, 1,7% DRG, 7,6% Briefe schreiben, 0,5% Berichtswesen, 5,9% Praktische Tätigkeiten, 4,3% Befundbewertung, 0,4% Konsilanforderungen, 22,8% Besprechung mit Kollegen, 6,2% Kurvenvisite, 2,8% Anmeldung für weitere Untersuchungen, 5,9% Lehre und Forschung, 6,3% OP-Zeit, 0,3% Schreiben von OP-Berichten, 12,5% Verwaltung und Sonstiges und 5% Pausen.
Pro Arbeitstag sprach also ein Arzt durchschnittlich 4 Minuten 17 Sekunden mit einem Patienten und durchschnittlich 20 Sekunden mit einem Angehörigen.
Die Dauer der Gespräche zwischen Krankenhausarzt und Krankenhaus-Patient kommentiert die Freiburger Medizinerin: "Fraglich bleibt insgesamt, ob 4 Minuten 17 Sekunden genügend Zeit dafür bieten, dass sowohl die medizinischen als auch die psychosozialen Sorgen und Probleme eines Patienten, die im Rahmen einer physischen Erkrankung entstehen können, genügend Beachtung finden können."
Dieser Gedanke wird in einer Literaturpassage der Dissertation vertieft: Wenn der Arzt unter Zeitdruck steht hat er immer das Gefühl, das ihm bei Gesprächen Zeit für andere Aufgaben "geraubt" wird. Dies hat manchmal auch damit zu tun, dass sich Patienten spontan an den Arzt wendet und ihn oft in einer anderen Tätigkeit unterbrecht. Alles zusammen genommen erscheint die Dauer solcher Gespräche länger als sie in Wirklichkeit ist. Dies wiederum führt zu der in mehreren Studien beobachteten arzttypischen Unterbrechung des Redeflusses von Patienten nach durchschnittlich 18 oder 23 Sekunden (in den 1980er Jahren) und der damit verbundenen Gefahr, dass "diese frühen Unterbrechungen der Patienten dazu führen könnten, dass wichtige gesundheitliche Probleme des Patienten nicht zur Sprache und damit auch nicht in Behandlung kommen."
Zu der Annahme, dass der Redefluss von Patienten jeglichen Zeitplan durcheinander brächte, wenn man sie so lange reden ließe wie sie wollten, untersuchten frühere Studien "wie lange Patienten tatsächlich reden, wenn man sie reden lässt. Ergebnis war, dass von '335 Patienten 78% weniger als zwei Minuten für ihr Anliegen benötigten und nur 2% länger als fünf Minuten sprachen'. Weiterhin stellten die Ärzte, die die untersuchten Gespräche führten, fest, dass alle Patienten wichtige Informationen mitzuteilen hatten und nicht unterbrochen werden sollten."
In der Freiburger Studie und in dort zitierten anderen Studien werden als Ursachen der kurzen Arzt-Patientengespräche der ständige Zeitdruck, der steigende Verwaltungsaufwand und die organisatorische Rahmenbedingungen des Zwangs zum Multitasking genannt.
Bereits etwas resignativ schließt die Studienautorin den entsprechenden Abschnitt mit den Worten: "Die Gründe für kurz gehaltene Gespräche mit Patienten und Angehörigen sind also eigentlich bekannt. Eine mögliche Lösung des Problems wäre es, einen Teil der administrativen Aufgaben und auch der einfacheren praktischen Tätigkeiten, wie Blutentnahmen, an andere Arbeitskräfte zu delegieren."
Die gemessenen Zeiten für Arbeiten, die durch die DRG nötig waren, betrugen durchschnittlich elf Minuten pro Arzt und Arbeitstag. Die Spannweite der benötigten Arbeitszeit lag aber zwischen 0 und über 67 Minuten.
Sowohl die gemessenen Zeiten als auch die Ergebnisse aus den Fragebögen wurden anhand verschiedener Merkmale der Ärzte, wie zum Beispiel konservatives versus operatives Tätigkeitsfeld, Geschlecht des Arztes und Länge der Berufserfahrung des Arztes, in Gruppen unterteilt und miteinander verglichen. Dabei zeigte sich, dass ein berufserfahrenerer Arzt mehr Zeit mit Patientengesprächen und mit praktischen Tätigkeiten verbrachte als ein unerfahrenerer Arzt. Mit zunehmender Berufserfahrung zeigte sich ebenfalls eine signifikante Verbesserung der Zufriedenheit des Arztes mit der zur Verfügung stehenden Zeit für Angehörigengespräche.
Der damit mögliche Vergleich zwischen gemessener und "gefühlter" Arbeitszeit förderte eine Reihe interessanter Divergenzen zu Tage: Die Ärzte schätzten im Fragebogen z. B. ihre Kommunikationszeit mit Patienten fast doppelt so hoch ein wie die tatsächlich gemessene Zeit. Sie gaben im Durchschnitt eine geschätzte Zeit für ihre Kommunikation mit Patienten von 133 Minuten pro Arbeitstag an deutlich mehr als die gemessene Zeit von 79 Minuten.
Für die Kommunikationszeit mit Angehörigen gaben die Ärzte eine geschätzte Zeit an, die siebenmal so lang war wie die eigentlich gemessene Zeit. Die geschätzte Zeit betrug durchschnittlich 43 Minuten pro Tag, gemessen wurden 6 Minuten.
Für die gesamte Arbeitszeitverwendungsdebatte ist interessant, dass die Ärzte auch den Anteil der auf die als "unliebsam" empfundene Dokumentation, also das Berichtswesen, OP-Berichte, Briefe schreiben, Verwaltung (Sonstiges) und DRG entfällt, kräftig überschätzen: Gemessenen 146 Minuten pro Tag stehen 226 eingeschätzte Minuten gegenüber. Fast keine Diskrepanz gab es aber immerhin bei der täglichen Gesamtarbeitszeit.
Ärztinnen waren schließlich mit der ihnen zur Verfügung stehenden Zeit für praktische Tätigkeiten deutlich zufriedener als Ärzte und hatten auch eine längere Gesprächszeit mit PatientInnen - allerdings nur im Sekundenbereich.
Natürlich kann man diese Studie an einem süddeutschen Uniklinikum und bei 32 Ärzten nicht als repräsentativ ansehen. Dies sollte allerdings nicht dazu dienen, die weitere Debatte und empirische Klärung totzuschlagen. Warum nämlich die für Deutschland zum Teil erstmaligen und spannenden Ergebnisse trotz der Problemartikulation und den nachgewiesenermaßen gesundheitlichen wie ökonomischen Auswirkungen schlechter Arzt-Patient-Kommunikation bisher nicht als Hypothesen für eine umfassendere Studie gedient haben, ist unverständlich und ein weiteres Beispiel für die gut gehegte Diskrepanz zwischen öffentlichem Problemgetöse und der Bereitschaft, dessen Substanz zu belegen oder gar nach Lösungen gegen z.B. den Zeitdruck zu suchen.
Die 79 Seiten umfassende medizinische Dissertation "Untersuchung der Gesprächszeit mit Patienten und Angehörigen unter Zugrundelegung der Arbeitszeitverteilung von Krankenhausärzten" von Dorothee Kempf ist komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 18.6.09
Wie zahlreich sind und welchen Nutzen haben die "Medizinischen Versorgungszentren (MVZ)"? Antworten des KBV-MVZ-Survey 2008
 Seit dem 01.01.2004 besteht mit dem Gesetz zur Modernisierung der Gesetzlichen Krankenversicherung (GMG) die Möglichkeit, Medizinische Versorgungszentren (MVZ) zu gründen. Das Vertragsarztrechts-Änderungs-Gesetz (VÄndG) hat die Rahmenbedingungen für MVZ ab dem 01.01.2007 modifiziert und auch erweitert.
Seit dem 01.01.2004 besteht mit dem Gesetz zur Modernisierung der Gesetzlichen Krankenversicherung (GMG) die Möglichkeit, Medizinische Versorgungszentren (MVZ) zu gründen. Das Vertragsarztrechts-Änderungs-Gesetz (VÄndG) hat die Rahmenbedingungen für MVZ ab dem 01.01.2007 modifiziert und auch erweitert.
Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) hat die Entwicklung der MVZ-Gründungen seitdem mit Publikationen begleitet. Fortlaufend quartalsweise erscheint die MVZ-Statistik, welche die strukturellen Eckdaten erhebt. Im Jahr 2005 wurde erstmals ein so genannter MVZ-Survey, d.h. eine repräsentative Befragung über die Motive und Perspektiven der MVZ-Gründer durchgeführt. Im Jahr 2006 wurde der kostenlos in einer Kurzfassung von der KBV erhältliche MVZ-Leitfaden als praktische Hilfe für interessierte Gründer herausgegeben.
Nach den aktuellsten Daten der KBV gab es im 4. Quartal 2008 1.206 zugelassene MVZ mit 5.536 darin tätigen Ärzten, von denen wiederum 4.270 im Anstellungsverhältnis arbeiteten. Pro MVZ waren damit durchschnittlich 4,6 Ärzte tätig. 54,1% aller MVZ waren in Trägerschaft von Vertragsärzten und 37,4% in Trägerschaft eines Krankenhauses. Die am häufigsten beteiligten Facharztgruppen waren Hausärzte und Internisten.
Am 25. Mai 2009 veröffentlichte die KBV die Ergebnisse des zweiten Surveys, des MVZ-Survey 2008. Im Sommer 2008 hatte die KBV 1.023 MVZ angeschrieben. Es antworteten 286, das entspricht einer Rücklaufquote von 28 %. Bezüglich der Gründer (Vertragsärzte oder Krankenhäuser), Rechtsform, Arbeitsgröße, Zulassungsdauer und regionalen Verteilung war die Stichprobe repräsentativ.
Danach sah es bei den MVZ im ersten Halbjahr 2008 so aus:
• Die Zahl der Neugründungen hat sich mittlerweile auf einem niedrigen Niveau von rund 70 pro Quartal eingependelt, was aber trotzdem indiziert, dass sich die Versorgungsform MVZ etabliert hat.
• Im Vergleich zu den Praxen führen sie jedoch immer noch ein Nischendasein. So gab es im dritten Quartal 2008 1.152 MVZ gegenüber 80.000 zugelassenen Praxen.
• Die meisten MVZ gab es im ersten Halbjahr 2008 in Bayern, Berlin und Niedersachsen. In urbanen Zentren gibt es mehr MVZ als in ländlichen Gegenden (55 % städtische MVZ). Daraus ergeben sich laut Andreas Köhler, dem Vorstandsvorsitzenden der KBV zwei unterschiedliche Funktionen von MVZ's: "In Ballungsräumen können MVZ eine gute Ergänzung zur ambulanten Versorgung in den Praxen darstellen. Im ländlichen Raum sind sie hingegen eine Chance, um die medizinische Grundversorgung der Menschen zu gewährleisten".
• Zwei Haupttypen lassen sich identifizieren. Während das von Krankenhäusern gegründete MVZ in den neuen Bundesländern dominiert, ist in Westdeutschland das vertragsarztgeführte Zentrum vorherrschend. Die häufigste Gesellschaftsform ist die GmbH. Daraus leiten die Autoren der Studie die Prognose ab, ein dritter MVZ-Typ spiele künftig eine größere Rolle: das von einer Managementgesellschaft betriebene vertragsärztliche MVZ, das sich abgrenzt vom vertragsärztlichen MVZ als Variante der Gemeinschaftspraxis.
• Insgesamt sehen 71,7 % der Teilnehmer - betreiberunabhängig - die umfassende wohnortnahe Versorgung nicht gefährdet. Hinsichtlich der Auswirkungen von MVZ auf die sie umgebende Versorgungslandschaft haben Vertragärzte häufiger angegeben, dass MVZ-Gründungen zu Lasten der bestehenden Strukturen geschehen - eine Sichtweise, die Antwortende für Krankenhaus-MVZ nicht teilten.
• Die Haupteinnahmequelle aller MVZ stellen kollektivvertragliche Einnahmen aus der EBM-Abrechnung dar. 50,3 Prozent der MVZ geben gestiegene EBM-Einnahmen an, wobei dieser Trend für Krankenhaus-MVZ deutlicher ausfällt. 21 % der vertragsärztlich geführten MVZ betrachten die Einkommenssituation als rückläufig.
• Zwei Drittel aller MVZ haben ein Qualitätsmanagement-System eingeführt. Während annährend zwei Drittel der Teilnehmer der Auffassung sind, dass QM-Systeme einen Wettbewerbsvorteil darstellen, werden mögliche konkrete Effekte des Qualitätsmanagements eher zurückhaltend beurteilt.
Angesichts der Entdeckung von MVZ als Anlagebereich für Kapitaleigner warnt A. Köhler schon mal: "Hier liegt auch eine Gefahr, MVZ vorrangig als Geschäfts- und nicht als Versorgungsmodell zu sehen: Gewinnorientierte Kapitalgesellschaften als MVZ-Eigner könnten versuchen, aus wirtschaftlichen Gründen direkten Einfluss auf die ärztliche Tätigkeit zu nehmen. Dem muss der Gesetzgeber vorbeugen". Das KBV-Vorstandsmitglied Carl-Heinz Müller ergänzt diese Aussage: "Denn unabhängig davon, ob Ärzte als selbstständige Vertragsärzte oder angestellt arbeiten, sind sie Angehörige eines freien Berufs. Dies dient auch dem Schutz der Patienten".
So berechtigt die warnenden Hinweise der KBV-Vertreter gegen die trojanisch über die MVZ einsickernden Gewinnerzielungsmentalitäten sind, so schwer fällt es dabei, nicht auch an die seit Anfang diesen Jahres von Teilen der "frei" niedergelassenen Ärzten mit offenem Visier und auch zu Lasten der Patienten geführten Auseinandersetzung um die Auswirkungen ihres neuen Honorarsystems zu denken.
Gemeint sind z.B. die mehrtägigen Schließungen von Facharztpraxen, die Verweigerung von Behandlungen auf Versichertenkarte und die Forderung nach Vorleistung der Patienten sowie der verbreitete und Vertrauen erodierende Eindruck, "die" Ärzte nagten am Hungertuch (bei einem Durchschnittseinkommen vor Steuern und Sozialabgaben aber nach Abzug von Praxiskosten von 95.000€ bis 120.000€ pro Allgemein- oder Facharzt) und deshalb müssten sie sich vorrangig um ihre Honorierung kümmern. Wer vom "freien Beruf des Arztes" redet, sollte auch bedenken, dass dessen bisherige Stabilität und Anerkennung trotz momentaner Einkommensverluste um mehreren zig Prozent bei einigen Facharztgruppen wesentlich von einer völlig unfrei garantierten Grundfinanzierung ihres Gesamteinkommens durch die GKV zwischen mindestens zwei Dritteln und 100% abhing. Die unterschiedlichen Einkommenshöhen hinter dem Durchschnittsbetrag sind bekannt und natürlich unfreulich, sind aber kein Problem von "zu wenig Geld im System", sondern zunächst eines der besseren Verteilung.
Für kommende Erhebungen wird schließlich etwas im deutschen Gesundheitssystem für neue Leistungen und Strukturen immer noch nicht Prioritäres und Selbstverständliches angekündigt: Den offen eingeräumten bisher fehlenden Nachweis zu erbringen, dass die MVZ die Versorgung vor allem in den unterversorgten Gebieten verbessern können.
Weitere allgemeine Informationen über die MVZs sind in einem speziellen Bereich der KBV-Homepage kostenlos erhältlich. Dies trifft auch auf den "MVZ-Survey 2008. Die strategische Positionierung Medizinischer Versorgungszentren" zu.
Bernard Braun, 25.5.09
Technikvision und Wirklichkeit: Weniger als 10% der US-Hospitäler haben irgendein elektronisches Gesundheitsinformationssystem
 Eigentlich ist dies für Fernsehzuschauer, die sich "zufällig" in US-Krankenhaus-Serien à la "Emergency Room" festzappen und noch aufmerksam bei "Dr. House" vorbeischauen, keine Überraschung: Eine umfassende elektronische Dokumentation, funktionierende elektronische Krankenakten und ein darauf basierendes Behandlungsmanagement sind in us-amerikanischen Krankenhäusern eher die Ausnahme als die Regel. Ob es aber dort in Wirklichkeit so zugeht wie in den genannten und vielen anderen internationalen und nationalen Krankenhausserien gezeigt, kann bezweifelt werden.
Eigentlich ist dies für Fernsehzuschauer, die sich "zufällig" in US-Krankenhaus-Serien à la "Emergency Room" festzappen und noch aufmerksam bei "Dr. House" vorbeischauen, keine Überraschung: Eine umfassende elektronische Dokumentation, funktionierende elektronische Krankenakten und ein darauf basierendes Behandlungsmanagement sind in us-amerikanischen Krankenhäusern eher die Ausnahme als die Regel. Ob es aber dort in Wirklichkeit so zugeht wie in den genannten und vielen anderen internationalen und nationalen Krankenhausserien gezeigt, kann bezweifelt werden.
Trotzdem förderte jetzt eine umfassende Untersuchung des Standes der Einführung einer elektronischen Informations-, Planungs- und Steuerungs-Infrastruktur und der Nutzung von "electronic health records (EHR)" aus dem Jahr 2008 in 3.049 (nach dem Ausschluss einiger Krankenhäuser blieben noch 2.952 Studienkliniken übrig) an der Untersuchung teilnehmenden (dies entspricht einer Responserate von 63,1%) Akutkrankenhäusern der USA, die Mitglied der "American Hospital Association" sind, eine unerwartete Wirklichkeit zu Tage. Der Untersuchung lag die Annahme oder sogar fast die Gewissheit zugrunde, dass eine umfassende Informationstechnologie die Qualität der Gesundheitsversorgung in Krankenhäusern verbessert und medizinische oder Behandlungsirrtümer vermeiden hilft.
Auf der Basis von Informationen, die sie von den teilnehmenden Krankenhäusern über das Verständnis der Bedeutung von EHR, den Grad ihrer Einführung in den klinischen Alltag und über die Barrieren für ihre Übernahme erhielten, teilten die ForscherInnen die Kliniken drei Kategorien zu: umfassende EHR (abgeschlossene Einführung in allen Klinikabteilungen), Basisversion von EHR (abgeschlossene Einführung in mindestens einer Abteilung) oder eine nicht existente EHR-Infrastruktur.
Von den fast 3.000 Krankenhäusern besaßen und nutzten
• nur 1,5% eine umfassende elektronische Infrastruktur,
• 7,6% zumindest eine Basisversion von EHR, die beispielsweise ärztliche Aufzeichnungen und Bewertungen über Patienten von Pflegekräften enthielt und
• der Rest der untersuchten Kliniken arbeitete ohne EHR.
Zusätzlich lieferte die Untersuchung noch weitere Einzelheiten über die aktuelle elektronische Infrastruktur:
• 17% der Krankenhäuser setzten computergestützte Bestellsysteme ein,
• dies ist u.a. ein Beleg dafür, dass auch Krankenhäuser ohne ein umfassendes EHR-System einige Voraussetzungen für dessen späteren Aufbau, wie etwa klinische Informationssysteme und andere Module haben können,
• größere Krankenhäuser, Ausbildungs-Kliniken und Häuser mit speziellen Herz-/Kreislauf-Behandlungseinheiten waren besser elektronisch ausgerüstet als die jeweils anderen Kliniken,
• von den Krankenhäusern ohne eine EHR-Infrastruktur gaben 74% fehlendes Investitionskapital, 44 % die zu hohen Betriebskosten, 36% den Widerstand von Ärzten, 32% Unklarheiten über den "return of investment" und 30% inkompetentes Fachpersonal für Informationstechnologie an.
Die Beobachtung, dass der Widerstand von Ärzten gegen EHR in Kliniken mit eingeführter Informationstechnologie in etwa gleich groß war wie in Kliniken ohne EHR, weist auf die Existenz einer offensichtlich mächtigen und faktenfernen oder -resistenten subjektiven Implementationsbarriere hin.
Nach Erkenntnis der AutorInnen sollte sich die teilweise mit Mitteln des aktuellen US-Konjunkturprogramms geförderte Verbesserung der Zustimmung zu EHR-Systemen und deren Einführung vor allem auf die finanzielle Unterstützung, die Gewährleistung einer EHR mit hoher Interoperabilität mit Systemen außerhalb des konkreten Anwendungsbereichs und das Training des Personals konzentrieren, das mit der Informationstechnologie im Haus befasst ist.
Den Aufsatz "Use of Electronic Health Records in U.S. Hospitals" von Ashish K. Jha, Catherine M. DesRoches, Eric G. Campbell, Karen Donelan, Sowmya R. Rao, Timothy G. Ferris, Alexandra Shields, Sara Rosenbaum, und David Blumenthal im "New England Journal of Medicine (NEJM)" (2009;360 vom 25. März 2009) erhält man kostenlos als 11 Seiten umfassende PDF-Datei.
Neben den Hinweisen auf einige Beschränkungen der Studie (z.B. der Ausfall bestimmter Typen von Krankenhäusern durch Nonresponse) weisen die AutorInnen aber auch auf die noch recht frische (aus 2006) Erkenntnis hin, die Qualitätsgewinne durch EHR seien keineswegs so stabil, verallgemeinerbar und zwingend nachgewiesen worden wie stillschweigend angenommen wurde und wird.
So kommt der am 16. Mai 2006 in der Fachzeitschrift "Annals of Internal Medicine" (Volume 144 Issue 10: 742-752) auf 29 Seiten veröffentlichte und komplett kostenlos zugängliche Aufsatz "Systematic Review: Impact of Health Information Technology on Quality, Efficiency, and Costs of Medical Care" von Basit Chaudhry et al. nach gründlicher Analyse der damals vorliegenden 257 Studien über den Nutzen elektronischer Infrastruktur in Krankenanstalten zu folgendem quantitativ und qualitativ sehr zurückhaltenden Schluss: "Available quantitative research was limited and was done by a small number of institutions. Systems were heterogeneous and sometimes incompletely described. Available financial and contextual data were limited. Conclusions: Four benchmark institutions have demonstrated the efficacy of health information technologies in improving quality and efficiency. Whether and how other institutions can achieve similar benefits, and at what costs, are unclear."
Bernard Braun, 15.4.09
Gute Vorbereitung auf die Krankenhausentlassung (Entlassplan, Arztinfo) bringt spürbaren gesundheitlichen und finanziellen Nutzen.
 Viele der aus dem Krankenhaus entlassenen Patienten sind noch nicht wieder voll genesen und brauchen sowohl akutmedizinische Behandlung als auch oft eine Reihe nichtmedizinischer oder -ärztlicher sozialer Unterstützungsangebote, um ihre vorherige Lebensqualität wieder erreichen zu können.
Viele der aus dem Krankenhaus entlassenen Patienten sind noch nicht wieder voll genesen und brauchen sowohl akutmedizinische Behandlung als auch oft eine Reihe nichtmedizinischer oder -ärztlicher sozialer Unterstützungsangebote, um ihre vorherige Lebensqualität wieder erreichen zu können.
Angesichts der zusätzlich in den letzten Jahren auch in Deutschland spürbar verkürzten Liegezeiten im Krankenhaus entscheidet eine gute Vorbereitung des Patienten auf die Zeit danach und die Vorbereitung eines möglichst nahtlosen und zügigen poststationären Behandlungs- und Unterstützungsprozesses wesentlich über die Heilung der Patienten, d.h. die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der stationären Behandlung mit.
Der entlasspunktnahe Fluss von Informationen über die Diagnosen, den Behandlungsverlauf, die wichtigsten Behandlungsinhalte (z. B. Arzneimittelverordnungen) und die Prognose der entlassenen Patienten zu ihren ambulanten Versorgungsexperten wird daher seit langem zu den wichtigsten Entlassleistungen des Krankenhauses gerechnet. Als Instrumente dienen der "gute alte" Arztbrief und mündliche Informationen für die ambulante Versorge.
So plausibel und nahezu selbstverständlich all dies erscheint (ein Kommentar der hier gleich vorgestellten Studie bringt dies auf den Punkt: "Nevertheless, the results of this study confirm what those working in hospital medicine already know: It's high time we reconfigure the discharge process.") so verwunderlicher ist das in einer aktuellen Studie ("Wandel von Medizin und Pflege im DRG-System [WAMP]")des Zentrums für Sozialpolitik (ZeS) der Universität Bremen und des Wissenschaftszentrums Berlin (WZB) erkannte weit verbreitete Fehlen oder das schlechte Funktionieren des Entlassungs- oder Überleitungsmanagements in Krankenhäusern und die in Befragungen von Krankenhausärzten sogar in den letzten Jahren schlechter werdende Kooperation der Krankenhaus- mit Haus- und Fachärzten.
Sollte dieser Zustand damit begründet werden, man wisse überhaupt nicht, ob der vermutete Nutzen einer guten Kommunikation von stationär und ambulant tätigen Ärzten wirklich etwas für die Gesundheit oder gar den Geldbeutel der Versicherten bringe, zeigten die gerade veröffentlichten Ergebnisse einer randomisierten Studie des weiteren Behandlungsverlaufes von Krankenhauspatienten eines Allgemeinkrankenhauses eines städtischen Ballungsgebiets (Boston Medical Center) nach dem Klinikaufenthalt das Gegenteil.
Dazu verteilten die ForscherInnen eine Gruppe von 749 PatientInnen zufällig in eine Gruppe, welche das gewöhnliche, also schmalspurige und nicht unbedingt auf nahtloses Geschehen orientierte Entlassprogramm erhielten und eine Gruppe mit einem aufwändigen und neu konzipierten Entlassungsprogramm. Die neuartige Entlassleistung bestand aus einem Bündel neuer Akteure und Aktivitäten.
Dazu gehörten spezielle Entlass-Krankenschwestern bzw. -beauftragte ("nurse discharge advocates"), die früh damit beginnen, einen individuellen Entlassungsbericht zusammenzustellen, umfangreiche Kontaktinformationen der ambulanten Behandlungshelfer, Terminvereinbarungen mit diesen, die Ergebnisse der bisherigen klinischen Tests, Einnahmepläne für verordnete Medikamente und weitere Informationen. Am Entlassungstag erhält der vorher bekannte oder organisierte Hausarzt des Patienten diesen Entlassbericht und eine Kurzzusammenfassung zur weiteren Behandlung per Fax zugeschickt. Die entlassenen Patienten werden außerdem innerhalb der nächsten vier Tage von einem klinischen Pharmakologen angerufen oder sogar besucht, der sich gezielt um die Alltagstauglichkeit und die mögliche Anpassung der Medikation kümmert.
Die von den ForscherInnen verblindet gemessenen Ergebnisse (sie wussten also nicht, in welcher Entlassenengruppe der analysierte Patient war) sahen so aus:
• Innerhalb der 30 Tage nach Entlassung hatten die PatientInnen in der Interventionsgruppe eine um ein Drittel geringere Häufigkeit von erneuten Krankenhausaufenthalten oder gar Notaufnahmeereignisse (0,314 Besuche gegenüber 0,451 Besuche pro Person und Monat). 90 Patienten in der Kontroll-/Standardgruppe gegenüber 61 in der Interventionsgruppe mussten eine Notfallstation aufsuchen. Wiedereinweisungen gab es bei 76 gegenüber 55 PatientInnen.
• Die Patienten der Interventionsgruppe wussten signifikant besser über ihre Entlassdiagnose Bescheid (70 % in der Kontroll- und 79 % in der Interventionsgruppe), kannten ebenfalls signifikant mehr und besser den Allgemeinmediziner, bei dem sie sich weiterbehandeln mussten (89 % zu 95 %) und berichteten auch häufiger, dass sie sich optimal auf ihre Entlassung vorbereitet gefühlt hatten (55 % gegenüber 65 %).
• Die Behandlungskosten waren in der Interventionsgruppe ebenfalls rund ein Drittel niedriger als in der Kontrollgruppe. Pro Kopf der Angehörigen der Interventionsgruppe waren dies 412 US-$.
Die von der Forschergruppe selbst benannte Schwäche dieser Studie, nämlich an einem einzigen großstädtischen Krankenhaus durchgeführt worden zu sein, schmälert nichts an dem Nachweis der Machbarkeit eines solchen Managements. Wer an der Übertragbarkeit in andere Regionen der USA, auf an speziellen Krankheit erkrankten Personen und natürlich nach Deutschland zweifelt, sollte es daher auf einen gar nicht so aufwändigen neuen Versuch ankommen lassen und u. U. dabei auch weitere Instrumente entwickeln und einführen.
Von dem Aufsatz "A Reengineered Hospital Discharge Program to Decrease Rehospitalization A Randomized Trial" von Brian W. Jack et al., der am 3. Februar 2009 in der US-Fachzeitschrift "Annals of Internal Medicine" (Volume 150, Issue 3: 178-187) erschienen ist, gibt es kostenlos nur ein Abstract.
Bernard Braun, 3.2.09
Selbstverständlichkeit oder medizinisch-technischer Fortschritt? WHO-Sicherheitscheck im OP.
 Um noch mehr diagnostische Einblicke für frühe oder punktgenaue Therapien zu erhalten, werden millionenschwere Investitionen in Großgeräte getätigt und um bestimmte Wirkstoffspiegel noch schneller und direkter zu erreichen ebenfalls Millionen in die Entwicklung neuer Arzneimittel gesteckt. Den medizinisch-technischen Fortschritt lassen "wir uns" also so viel kosten, dass oft schon die bange Frage auftaucht, ob dies künftig wirklich noch alles auf "Kassenrezept" erhältlich sein wird.
Um noch mehr diagnostische Einblicke für frühe oder punktgenaue Therapien zu erhalten, werden millionenschwere Investitionen in Großgeräte getätigt und um bestimmte Wirkstoffspiegel noch schneller und direkter zu erreichen ebenfalls Millionen in die Entwicklung neuer Arzneimittel gesteckt. Den medizinisch-technischen Fortschritt lassen "wir uns" also so viel kosten, dass oft schon die bange Frage auftaucht, ob dies künftig wirklich noch alles auf "Kassenrezept" erhältlich sein wird.
Zur selben Zeit tragen aber die mangelhafte Handhygiene (siehe dazu auch z. B. diesen Forumsbeitrag zur Handhygiene und ihren unerwünschten Folgen), der unüberlegte gießkannenartige Einsatz von Antibiotika in allen Teilen des Krankenbehandlungssystems nicht wenig zum Problem der multiresistenten Erreger bei (siehe dazu auch diesen Forumsbeitrag) und offensichtlich auch das Fehlen einfachster Sicherheitschecks in vielen Operationssälen dazu bei, dass Patienten trotz aller Fortschrittsinvestitionen z.B. wegen "vergessener" Gegenstände im Bauchraum schwer erkranken oder gar sterben.
Dies will nun die Weltgesundheitsorganisation (WHO) mit Hilfe einer von ihr entwickelten einfachen Sicherheits-Checkliste im Umfang von einer DIN A 4-Seite dauerhaft verhindern. Nach dieser insgesamt 19 Fragen umfassenden Liste soll u.a. routinemäßig und schematisch vor der Narkose die Identität des Patienten festgestellt werden, die Art des Eingriffs und die Stelle, die operiert werden soll, bestätigt werden, wenn möglich, festgestellt werden, ob der Patient eine Allergie hat, unter Atemschwierigkeiten leidet und ob er bereits Blut verloren hat. Vor dem Schnitt stellt sich jedes Mitglied des OP-Teams mit Namen und Funktion vor. Ärzte und Pflegepersonal sollen vor dem Eingriff über mögliche Komplikationen während der Operation sprechen. Bevor der Patient nach dem Eingriff den Operationssaal verlässt, werden die Instrumente gezählt und mögliche Schwierigkeiten, die bei der Abheilung der Wunde auftreten könnten, vermerkt werden.
Auch wenn vieles selbstverständlich wirkt und banal erscheint, beruht die WHO-Liste schlicht auf den am häufigsten vorkommenden Behandlungsfehlern mit zum Teil schwerwiegenden negativen Auswirkungen auf die Gesundheit der Patienten im Krankenhaus.
Um aber nicht ständig hören zu müssen, die Liste bewirke praktisch nichts, untersuchten weltweit aktive Mitglieder der "Safe Surgery Saves Lives Study Group" in einer Studie an acht sozial und technisch deutlich unterschiedlichen Krankenhäusern in weltweit acht Städten (Toronto, Neudelhi, Ammann, Auckland, Manila, Ifakara, London und Seattle - natürlich wieder ohne ein deutsches Krankenhaus) die Behandlungsgeschichten von 7.688 nichtkardiologischen Chirurgiepatienten, die älter als 16 Jahre alt waren, drei Monate vor (3.733 Patienten) und 3 Monate lang nach (3.955 Patienten) der Anwendung dieser Liste.
Die im Januar 2009 im "New England Journal of Medicine (NEJM)" veröffentlichten Hauptergebnisse lauten:
• Die Rate aller wesentlichen Komplikationen während der Behandlung und 30 Tage nach dem operativen Eingriff fiel statistisch signifikant (p<0,001) von 11 % vor dem Einsatz der Liste auf 7 % danach.
• Die Sterblichkeit während und nach der Operation sank ebenfalls statistisch signifikant (p=0,003) von 1,5 % auf 0,8 %.
• Auch die Raten für postoperative Infektionen und ungeplante Nachoperationen sanken statistisch hochsignifikant.
• Diese Erfolge konnten in allen sozialen Settings verzeichnet werden.
• Die Erfahrungen mit der Einführung an organisatorisch unterschiedlichen Kliniken zeigten auch, dass die Einführung weder viel Geld noch Zeit kostet. Die Testkliniken brauchten zwischen einer Woche und einem Monat, die Checkliste und ihre expliziten Prüfvorgänge in den Alltag einzubauen.
Die erste Ausgabe der WHO Surgical Safety Checklist kann komplett im Internet eingesehen und herunter geladen werden.
Dort gibt es auch einen kurzen Überblick über das Projekt der WHO.
Der 8 Seiten umfassende Aufsatz "A Surgical Safety Checklist to Reduce Morbidity and Mortality in a Global Population" von Alex B. Haynes et al. ist seit 14. Januar 2009 online auf der Website des NEJM komplett kostenlos erhältlich und wird am 29. Januar 2009 im NEJM (N Engl J Med 2009;360: 491-9) gedruckt erscheinen.
Bernard Braun, 22.1.09
Dreh- und Angelpunkt von "chronic care management"-Programmen: Multidisziplinäres Team und persönliche Kommunikation
 Angesichts des hohen und wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch wachsenden Anteils chronischer Erkrankungen bzw. Erkrankter am gesamten Morbiditäts- und Versorgungsgeschehen gibt es weltweit Konzepte und Programme, die Qualität, Wirksamkeit und Kosten der Versorgung dieser Patientengruppe durch spezielle "chronic care management programs" oder auch spezielle Disease Managementprogramme zu verbessern.
Angesichts des hohen und wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch wachsenden Anteils chronischer Erkrankungen bzw. Erkrankter am gesamten Morbiditäts- und Versorgungsgeschehen gibt es weltweit Konzepte und Programme, die Qualität, Wirksamkeit und Kosten der Versorgung dieser Patientengruppe durch spezielle "chronic care management programs" oder auch spezielle Disease Managementprogramme zu verbessern.
Die zentrale Frage nach dem Nutzen dieser Programme insgesamt und möglicherweise auch noch gravierende Nutzenunterschiede zwischen unterschiedlich aufgebauten Programmen ist aber bisher noch nicht ausreichend untersucht und beantwortet worden.
Einen wichtigen Beitrag, diesen Zustand zu beenden, liefert eine Studie, die die Daten von zehn randomisierten kontrollierten Studien über die Wirksamkeit und den Nutzen von Versorgungsmanagementprogrammen für Patienten mit Herzinsuffizienz poolte und durch eine Gruppe von Spezialisten für die Behandlung von Herzinsuffizienz nach sieben Kriterien reanalysieren ließ. Dabei kam die von der "American Heart Association's (AHA's) Writing Group" entwickelte "Taxonomy of Disease Management" zum Einsatz. Die Studien wurden zwischen 1990 und 2004 mit insgesamt 2.028 Fällen in den USA (6 Studien), Australien (2), den Niederlanden (1) und Großbritannien (1) durchgeführt. 961 der TeilnehmerInnen in diesen Studien erhielten spezielle Chronikerversorgungen und 1.067 erhielten eine Routineversorgung. Die Maßstäbe oder Indikatoren für den Nutzen eines Programms war die Häufigkeit der raschen Wiedereinweisung mit derselben Erkrankung in ein Krankenhaus und die Anzahl der Wiedereinweisungstage.
Die in den Studien unterscheidbaren Versorgungskonzepte waren zum einen eine Art Routineversorgung durch einen einzigen Herzexperten bzw. Ansprechpartner (in den meisten Studien war dies eine registrierte Krankenschwester (nurse) mit klinischer Sachkunde in Kardiologie und Herzinsuffizienz) und Beratung per Telefon, diese Routineversorgung mit persönlicher Kommunikation zwischen Patient und einer Fachkrankenschwester und schließlich die Programm-Versorgung durch ein multidisziplinäres Team und standardmäßig persönliche Kommunikationsmöglichkeiten. Die letzte Versorgungsvariante entspricht dem Kerngehalt aller Chronic-care-management-Programme.
Die Relevanz der Untersuchungsergebnisse ergibt sich allein schon aus dem Faktum, dass Herzinsuffizienz weltweit zu den führenden Ursachen von Klinikaufenthalten älterer Menschen gehört und in den USA 10 % aller Krankenhausausgaben der staatlichen Versicherung Medicare auf die Versorgung der an dieser Erkrankung leidenden Personen entfielen, was einem Anteil an den Gesamtausgaben von Medicare von 5 % entspricht.
Die durch logistische Regressionsanalysen gewonnenen Ergebnisse sahen so aus:
• Die Patienten in der Routineversorgung unterschieden sich von den Patienten in der "chronic care"-Versorgung hinsichtlich ihrer soziodemografischen und klinischen Charakteristika kaum.
• Weniger Programmpatienten (42 %) wurden innerhalb der follow up-Periode nach einem Krankenhausaufenthalt wieder in ein Krankenhaus eingewiesen als Routineversorgungspatienten (49 %).
• Programmpatienten hatten 25 % weniger Krankenhauswiedereinweisungen und 30 % weniger Krankenhaustage wegen einer Wiedereinweisung als Patienten mit einer Routineversorgung.
• Wenn Chronic-Care-Management-Programme als strukturierte Versorgung durch einen einzelnen Experten und Kommunikation per Telefon erfolgte, unterschieden sich die Ergebnisse nicht von denen bei Patienten in der Routineversorgung.
• Wenn die Versorgung zwar durch einen einzelnen Experten aber zumindest auf der Basis persönlicher Kommunikation erfolgte, wurde die Wiedereinweisungshäufigkeit im Vergleich mit der Routineversorgungsgruppe um 2 % pro Monat und die Anzahl der dadurch veranlassten Krankenhaustage um über 4 % pro Monat reduziert.
• Patienten, die in Chronikerprogrammen mit einem multidisziplinären Team und persönlicher Kommunikation waren, hatten noch einen etwas größeren Nutzen als die Routineversorgten, nämlich eine statistisch hoch signifikante Reduktion der Wiedereinweisungshäufigkeit um 2,9 % pro Monat und der damit ausgelösten Tagezahl um 6,4 % pro Monat.
• Rechnet man diese Effekte in die Anzahl von Fällen stationärer Behandlung um, sind in den Ländern mit komplexen Chronic-Care-Programmen zwischen 14.700 und 29.140 pro Jahr weniger Krankenhaushalte notwendig.
Selbst wenn sich einige Strukturen und Gewohnheiten schon zwischen den Studienländern (z.B. zwischen Großbritannien und den USA) und erst recht von den beispielsweise in Deutschland existierenden Rahmenbedingungen unterscheiden, geben sie mit Sicherheit die relativ einfache Richtung vor, in der auch in Deutschland spezielle Versorgungsprogramme für chronisch Kranke verstärkt vorgehen sollten.
Ein sehr knappes Abstract des in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift "Health Affairs" (Januar/Februar 2009 28(1):179-89) erschienenen elfseitigen Aufsatzes "What Works in Chronic Care Management: The Case of Heart Failure" von J. Sochalski, T. Jaarsma, H. M. Krumholz et al. gibt es kostenlos.
Bernard Braun, 9.1.09
Häufiger Konsum von Arztserien im Fernsehen erhöht die Angst vor Operationen im Krankenhaus
 Patienten, die sich überdurchschnittlich oft Krankenhaus- und Arztserien im Fernsehen anschauen, zeigen bei einer bevorstehenden Operation in einem Krankenhaus sehr viel größere Angst vor diesem Eingriff. Zu diesem Befund kommt eine jetzt von der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie (DGCH) veröffentlichte Studie, bei der 162 Patienten der Chirurgischen Universitätsklinik Salzburg zu ihren Fernsehgewohnheiten und Ihrer Angst vor Operationen befragt wurden. Allen Studienteilnehmern stand eine Leistenbruch- oder Gallenblasen-Operation in der Klinik bevor. Vor und nach dem Klinikaufenthalt interviewten die Forscher die Patienten mithilfe eines Fragebogens über ihre Fernsehgewohnheiten, ihr spezielles Interesse an Arzt- und Klinikserien sowie ihre Angst vor der bevorstehenden Operation.
Patienten, die sich überdurchschnittlich oft Krankenhaus- und Arztserien im Fernsehen anschauen, zeigen bei einer bevorstehenden Operation in einem Krankenhaus sehr viel größere Angst vor diesem Eingriff. Zu diesem Befund kommt eine jetzt von der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie (DGCH) veröffentlichte Studie, bei der 162 Patienten der Chirurgischen Universitätsklinik Salzburg zu ihren Fernsehgewohnheiten und Ihrer Angst vor Operationen befragt wurden. Allen Studienteilnehmern stand eine Leistenbruch- oder Gallenblasen-Operation in der Klinik bevor. Vor und nach dem Klinikaufenthalt interviewten die Forscher die Patienten mithilfe eines Fragebogens über ihre Fernsehgewohnheiten, ihr spezielles Interesse an Arzt- und Klinikserien sowie ihre Angst vor der bevorstehenden Operation.
"Die Dramaturgie der Arztserien", so interpretieren die Wissenschaftler ihre Ergebnisse, "stellt keine 'langweilige Routinetätigkeit' wie komplikationslose kleinere Operationen dar. Hiermit lassen sich keine Einschaltquoten erzielen. Nahezu jede in einer Arztserie dargestellte Operationsszene zeigt stattdessen einen schicksalhaften Verlauf - sei es eine Komplikation, bei welcher der Patient gerade mit dem Leben davonkommt, oder aber ein persönliches Fehlverhalten des Operateurs, der damit das Leben des Patienten riskiert." Durch die übertrieben dramatische Darstellung des Krankenhausalltags werden jedoch oftmals auch unnötige Ängste geschürt.
In die Studie eingeschlossen wurden ausschließlich freiwillige, volljährige Patienten, die noch nie in stationärer Behandlung waren oder deren letzter Krankenhausaufenthalt mindestens 10 Jahre zurücklag. Sie durften auch keine chronische Erkrankung aufweisen. Die Patienten wurden dann nach der Befragung in Gruppen eingeteilt, um den Zusammenhang zwischen dem Konsum von Arztserien im Fernserien und dem realen Angstniveau vor OPs zu analysieren. "Wenigseher", die unter 10 Stunden in der Woche fernsehen und "Vielseher", die über 20 Stunden wöchentlich fernsehen, bilden hier die beiden zu betrachtenden Pole. Die Wenigseher hatten mit einem durchschnittlichen Wert ihres Angstniveaus vor der Operation von 3,4 einen um 0,7 Punkte niedrigeren Wert als die Vielseher. Diese sind zudem weniger gut über den eigenen operativen Eingriff informiert als jene, die selten Arzt- und Krankenhausserien sehen. Das Ausmaß der Angst vor dem medizinischen Eingriff erwies sich überdies auch als stark abhängig von der jeweiligen Anzahl der Arztserien, die ein Patient kennt. Die Frage, ob es einen Zusammenhang zwischen Angst vor der Operation und dem Konsum von Arztserien gibt, kann durch die Studie daher eindeutig mit "ja" beantwortet werden.
Die Angst vor der bevorstehenden Operation ist weiterhin, wie die Studie gezeigt hat, auch altersabhängig: Ältere Patienten sehen ihrem Schicksal aufgrund ihrer Lebenserfahrung in der Regel gelassener entgegen. Dies wirkt sich dann auch sdo aus, dass sie - unabhängig von ihrem Fernsehkonsum - ein im Durchschnitt niedrigeres Angstniveau vor Klinikaufenthalten und Operationen zeigen.
Ein weiteres bedeutsames Ergebnis der Befragung war die unterschiedliche Zufriedenheit der Wenigseher und Vielseher mit der Visite im Krankenhaus. Vielseher äußerten hier sehr viel mehr Kritik, offensichtlich waren ihre durch Fernsehserien geprägten Erwartungen an Kommunikation und Information, soziale und emotionale Unterstützung durch Ärzte wie Pflegepersonal sehr viel höher und führten in der Konfrontation mit der Klinik-Realität dann zu Frustration und Kritik.
"Wird der durch den Konsum von Arztserien geprägte Patient beim stationären Krankenhausaufenthalt mit der Wirklichkeit konfrontiert, muss es notwendigerweise zu einer Enttäuschung kommen", so interpretieren die Wissenschaftler auf einer Pressekonferenz dieses Ergebnis. "Die im Krankenhaus tatsächlich erlebte Wirklichkeit tritt in Konkurrenz zur medialen und als ideal empfundenen Wirklichkeit. Ärzte und Schwestern, die weder wie Dr. Ross alias George Clooney in Emergency Room noch wie Schwester Carla aus Scrubs - die Anfänger daher kommen, haben dann von vornherein schlechte Karten."
In der Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie: DGCH Mitteilungen 4/2008, S.332ff findet man als leicht geänderten Nachdruck die referierte Studie "K. Witzel, C. Kaminski, G. Struve, H.J. Koch: Einfluss des Fernsehkonsums auf die Angst vor einer Operation" (Erstveröffentlichung in: Neuro-Geriatrie 2008; 5 (2): 57 - 61)
Gerd Marstedt, 11.12.08
EKG und Belastungs-EKG bei Angina pectoris: Grenzen technischer Diagnostik und Nutzen von Anamnese und körperlicher Untersuchung.
 Das Elektrokardiogramm (EKG) oder gar das Belastungs-EKG gehören zu den Standardinstrumenten in der kardiologischen Diagnostik. Die Messungen der elektrischen Aktivitäten am Herzen, ob im Normalzustand oder unter definierten Belastungen, werden für unentbehrlich zur Klärung der Ursachen von unklaren Schmerzen in der Herzgegend oder gar zur Bestimmung des Risikos oder der Prognose einer symptomatisch voll entfalteten Angina pectoris gehalten.
Das Elektrokardiogramm (EKG) oder gar das Belastungs-EKG gehören zu den Standardinstrumenten in der kardiologischen Diagnostik. Die Messungen der elektrischen Aktivitäten am Herzen, ob im Normalzustand oder unter definierten Belastungen, werden für unentbehrlich zur Klärung der Ursachen von unklaren Schmerzen in der Herzgegend oder gar zur Bestimmung des Risikos oder der Prognose einer symptomatisch voll entfalteten Angina pectoris gehalten.
Seit einigen Jahren gehört das EKG auch zum Diagnostik-Repertoire der so genannten "Gesundheitsuntersuchung" nach § 25 SGB V.
Mindestens bei Personen, die zum ersten Mal wegen einer Angina pectoris untersucht wurden und vorher an keiner Herz-/Kreislauferkrankung erkrankt waren, erwies sich jetzt aber das EKG und auch das Belastungs-EKG in einer britischen Kohortenstudie mit 8.176 Patienten mit akuten Brustbeschwerdenals lediglich von begrenztem prognostischen Wert. In der Studie erfolgte neben der Anamnese (Alter, Geschlecht, ethnische Herkunft, Dauer der Symptome, Schmerzmuster, Raucherstatus, Hypertonie und Medikamente) bei allen Patienten ein EKG. Bei 60 % der Patienten folgte meist in kurzem zeitlichen Abstand ein Belastungs-EKG.
Die im "British Medical Journal (BMJ)" im November 2008 veröffentlichten Ergebnisse zeigen mehrerlei:
• Generell gingen nur bei jedem zweiten Patienten mit einer späteren koronaren Erkrankung EKG-Veränderungen voraus. Dies trägt zu einem enorm hohen Anteil von falsch-negativen Befunden bei. Dies bedeutet: Personen, die tatsächlich ein erhöhtes Risiko für eine koronare Erkrankung in sich tragen, wird auf der alleinigen Basis von EKGs gesagt, sie seien gesund.
• Umgekehrt zeigte die gründliche Nachbeobachtung der StudienteilnehmerInnen, dass 47 % aller koronaren Fälle bei PatientInnen auftraten, die bei den EKG-Untersuchungen keinerlei Befunde hatten.
• Für die Prognose der Erkrankung und damit für die Entscheidung wie die Personen weiterbehandelt werden, spielte weder das einfache noch das Belastungs-EKG eine wichtige und entscheidende Rolle bzw. erbrachte keinen Zugewinn gegenüber einer gründlichen Anamnese und körperlichen Untersuchung. Dies wird dann problematisch und zeitigt möglicherweise unerwünschte Folgen für die Patienten, wenn die Anamnese und körperliche Untersuchung zugunsten des EKG in die zweite Reihe geschoben oder gar durch die technische Diagnostik ersetzt wird.
Wer mehr über diese Studie erfahren will, kann hierzu den kompletten Text des Aufsatzes "Incremental prognostic value of the exercise electrocardiogram in the initial assessment of patients with suspected angina: cohort study" (BMJ 2008; 337: a 2240) von Neha Sekhri, Gene S Feder, Cornelia Junghans, Sandra Eldridge, Athavan Umaipalan, Rashmi Madhu, Harry Hemingway und Adam D Timmis kostenlos heranziehen.
Bernard Braun, 11.12.08
Bundessozialgericht: Nur "medizinisch vertretbar" reicht nicht als Grund für Krankenhausaufenthalt - Kasse muss nicht zahlen!
 In der Klärung gesetzlich oder durch Verträge nicht abschließend und handhabbar geklärter Interessenskonflikte und Vorstellungen vom "richtigen und angemessenen Handeln" spielt im deutschen Gesundheitswesen die Rechtsprechung die entscheidende Rolle - mit weit reichenden konkreten Auswirkungen auf alle Patienten, Beschäftigte und Institutionen.
In der Klärung gesetzlich oder durch Verträge nicht abschließend und handhabbar geklärter Interessenskonflikte und Vorstellungen vom "richtigen und angemessenen Handeln" spielt im deutschen Gesundheitswesen die Rechtsprechung die entscheidende Rolle - mit weit reichenden konkreten Auswirkungen auf alle Patienten, Beschäftigte und Institutionen.
Dies ist auch in einem seit einiger Zeit unentschiedenen Streit darüber, ob die gesetzlichen Krankenkassen auch für einen "medizinisch vertretbaren" aber nicht "notwendigen" Klinikaufenthalt, der stattdessen ambulant behandelt werden könnte, bezahlen müssen.
Der 3. Senat des Bundessozialgerichts (BSG) hatte dazu in der Vergangenheit in einem Verfahren die Position vertreten, die Krankenversicherung müsse für einen ärztlich angeordneten Klinikaufenthalt zahlen, sobald er nur "medizinisch vertretbar" sei. Die Entscheidung der Klinikärzte dürfe von den Krankenversicherungen kaum angefochten werden oder systematisch überprüft werden. Höchstens dürften die Krankenkassen konkrete Alternativen aufzeigen.
Ein anderer, der 1. Senat des BSG, vertrat dagegen eine völlig andere Meinung. Er billigte den Krankenkassen zahlreiche Rechte zu, die Notwendigkeit einer stationären Behandlung eines Versicherten/Patienten zu überprüfen.
Bei solchen kontroversen Rechtsmeinungen und -sprechungen in einem Bundesgericht entscheidet der so genannte "Große Senat" des Gerichts darüber, welche Rechtsauffassung künftig praktisch von den unteren Instanzen für Streitigkeiten oder Differenzen zwischen Kliniken und Krankenkassen herangezogen werden muss. Dieser Senat schloss sich nun der kassenfreundlichen Sicht des 1. Senats an. Sein Beschluss, dass die medizinische Notwendigkeit einer stationären Behandlung im Streitfall "uneingeschränkt" vor Gericht überprüfbar sei und die ärztliche Einschätzung keinen Vorrang mehr habe, musste jetzt auch vom unterlegenen 3. Senat praktisch umgesetzt werden.
Diese Klärung hatte insofern sofort praktische Bedeutung als der 3. Senat des BSG am 10. April 2008 in einer Entscheidung von seiner bisherigen Rechtsprechung abrückte (Az.: B 3 KR 19/05 R u.a.) und den Druck auf Klinikärzte erhöhte, die medizinische Notwendigkeit einer Krankenhausbehandlung nachzuweisen. Künftig müssen daher die Kassen für einen Klinikaufenthalt nicht mehr zahlen, wenn für die vom Arzt diagnostizierte Krankheit nach dem Stand der Medizin auch eine ambulante Therapie ausgereicht hätte.
Auch wenn die Urteilsgründe noch nicht schriftlich veröffentlicht sind (wenn sie vorliegen, werden wir hier darauf verweisen), erscheint der beruhigende Hinweis, die neue einheitliche Rechtsprechung beträfe nur Kliniken und Krankenkassen und nicht Patienten, etwas weltfremd.
Zwar müssen Patienten selbst dann, wenn sie nach Ansicht ihrer Kasse zu lange stationär behandelt worden sind, nicht selber die dadurch entstandenen Kosten bezahlen (Gegenteiliges steht allerdings in der noch zitierten Pressemitteilung des BSG über die Entscheidungsgründe), aber sie werden mit Sicherheit von Krankenhausärzten, die über die konkrete Grenzziehung verunsichert sind, gar nicht mehr stationär aufgenommen oder zu einem sehr frühen und möglicherweise zu frühen Zeitpunkt entlassen. Ob dies dann dem gesundheitlichen Bedarf der Patienten entspricht und ob diese sofort Zugang zu den ambulanten Leistungen bekommen, könnte unerwünschte gesundheitliche Folgen nach sich ziehen.
Im konkreten Fall ging es um Folgendes:
"Eine bei der beklagten Krankenkasse (AOK Schleswig Holstein) versicherte Patientin war in der Zeit vom 7. 1. bis zum 22. 4. 2002 in einem von der Klägerin betriebenen Krankenhaus zur Behandlung einer langjährigen Alkoholerkrankung und darauf beruhenden Folgeschäden vollstationär untergebracht. Die Beklagte bezahlte die Behandlung aber nur bis zum 31. 1. 2002, weil die weitere Behandlung auch außerhalb eines Krankenhauses hätte durchgeführt werden können. Die von der Klägerin durchgeführten Maßnahmen (z. B. Hirnleistungstraining, Training der Alltagsfähigkeit, medikamentöse Behandlung) zur "Planung und Überprüfung auf Wirklichkeitsgerechtheit der weiterführenden Betreuung in einer Tagesstätte, des Besuchs von Selbsthilfegruppen und der Strukturierung der Resttageszeit durch die Familie in der Wohnung der Patientin sowie die Erstellung eines ausreichenden ambulanten Hilfsnetzes" seien durchaus als sinnvolle rehabilitative Maßnahmen anzusehen, begründeten aber nicht die Notwendigkeit einer Krankenhausbehandlung nach Abschluss der Entgiftung. Im Revisionsverfahren allein noch streitig war der Anspruch auf Vergütung einer vollstationären Krankenhausbehandlung für die Zeit vom 20. 3. bis zum 22. 4. 2002."
Nach wechselnden Entscheidungen des zuständigen Sozial- und des Landessozialgerichts landete der Fall schließlich beim BSG, das jetzt eindeutig die Position der Krankenkasse teilte und stärkte.
Bei zwei Vorschriften darf man gespannt sein wie sie umgesetzt werden und ob sich dahinter nicht erhebliche praktische Härten verbergen.
Zum einen gilt dies für die folgende Vorgabe: "Es kommt nur darauf an, zu welchem Zeitpunkt die Versicherte aus medizinischer Sicht außerhalb des Krankenhauses hätte weiterbehandelt werden können. Organisatorische und administrative Fragen wie die Bestellung eines Betreuers oder die Bereitstellung eines Platzes in einer Wohneinrichtung spielen grundsätzlich keine Rolle. Ebenso hat außer Betracht zu bleiben, ob die Krankenkasse auf eine Versorgungsmöglichkeit außerhalb des Krankenhauses hingewiesen hat. Fehlt es an der medizinischen Notwendigkeit einer vollstationären Krankenhausbehandlung, müssen die Kosten entweder vom Versicherten selbst oder - bei Bedürftigkeit des Versicherten - vom Sozialhilfeträger übernommen werden."
Zum anderen baut das BSG auch die Erkenntnishürden für Gutachter recht hoch: "Bei einem Streit über die Notwendigkeit einer vollstationären Krankenhausbehandlung und/oder deren Dauer im Rahmen eines Abrechnungsverfahrens zwischen Krankenhaus und Krankenkasse hat das Gericht die an den medizinischen Sachverständigen gerichteten Beweisfragen so zu formulieren, dass die Begutachtung nicht aus nachträglicher Sicht erfolgt, sondern aus vorausschauender Sicht zum Zeitpunkt der Aufnahme des Versicherten in das Krankenhaus bzw. zum Zeitpunkt der Entscheidung über die Fortdauer einer stationären Behandlung. Dabei muss der Sachverständige von dem im Behandlungszeitpunkt verfügbaren Wissens- und Kenntnisstand des verantwortlichen Krankenhausarztes ausgehen."
Bisher stehen lediglich eine Medien-Information des BSG Nr. 16 v. 10. 4. 2008 kostenfrei öffentlich zur Verfügung.
Bernard Braun, 16.4.2008
Neue Befunde zur Zwei-Klassen-Medizin: Auch auf eine Krankenhaus-Behandlung warten GKV-Versicherte länger
 Erst vor kurzem heizte eine experimentelle wissenschaftliche Studie die gesundheitspolitischen Diskussionen an, als bekannt wurde, dass Kassenpatienten etwa dreimal so lange Wartezeiten wie Privatversicherte für einen Facharzt-Termin haben (vgl. Neue Studie: Kassenpatienten warten dreimal so lange wie Privatpatienten auf einen Arzttermin für planbare Behandlungen). Ob die Ergebnisse eher Hinweis sind auf eine Zwei-Klassen-Medizin oder im Grunde nur geringfügige Komfort-Vorteile der privat Versicherten belegt, blieb strittig. Eine neue Studie der WHL Wissenschaftlichen Hochschule Lahr und der Technischen Universität Ilmenau dürfte die Diskussion weiter beleben, denn sie hat gezeigt, dass auch im stationären Sektor bei der Vereinbarung von Terminen Unterschiede zwischen Patienten gemacht werden, je nachdem, ob es Kassen- oder Privatpatienten sind. In diesen Krankenhäusern, die die Versicherungsart erfragen, hatten gesetzlich Versicherte eine rund 20 Prozent längere Wartezeit für einen Behandlungstermin als privat Versicherte.
Erst vor kurzem heizte eine experimentelle wissenschaftliche Studie die gesundheitspolitischen Diskussionen an, als bekannt wurde, dass Kassenpatienten etwa dreimal so lange Wartezeiten wie Privatversicherte für einen Facharzt-Termin haben (vgl. Neue Studie: Kassenpatienten warten dreimal so lange wie Privatpatienten auf einen Arzttermin für planbare Behandlungen). Ob die Ergebnisse eher Hinweis sind auf eine Zwei-Klassen-Medizin oder im Grunde nur geringfügige Komfort-Vorteile der privat Versicherten belegt, blieb strittig. Eine neue Studie der WHL Wissenschaftlichen Hochschule Lahr und der Technischen Universität Ilmenau dürfte die Diskussion weiter beleben, denn sie hat gezeigt, dass auch im stationären Sektor bei der Vereinbarung von Terminen Unterschiede zwischen Patienten gemacht werden, je nachdem, ob es Kassen- oder Privatpatienten sind. In diesen Krankenhäusern, die die Versicherungsart erfragen, hatten gesetzlich Versicherte eine rund 20 Prozent längere Wartezeit für einen Behandlungstermin als privat Versicherte.
Geschulte Anrufer vereinbarten in der Studie bei Krankenhäusern mit Standard-Formulierungen zu ihrer Person und Erkrankung in insgesamt 687 Anrufen einen Termin. Es wurden drei Krankheitsbilder ausgewählt, für die aus medizinischer Sicht einen zeitnahe Behandlung notwendig ist: Aus dem Bereich Chirurgie, die Indikation "Knöchelbruch", aus der Kardiologie die Indikation "Herzkranzgefäßverengung" und aus der Frauenheilkunde, die Indikation "Krebsverdacht". Alle drei Krankheitsbilder sind als medizinische Routineindikationen zu bezeichnen. Sie sind nicht akut lebensbedrohlich oder als Notfall zu deklarieren, erfordern aber zwingend einen medizinischen Eingriff. Aus medizinischer Sicht wird für alle genannten Krankheitsbilder ein Behandlungstermin innerhalb von zwei Wochen nach Auftreten als erforderlich angesehen. In dem Telefongespräch wurde auch deutlicht gemacht, dass bereits bei einem niedergelassenen Facharzt eine differenzierte Untersuchung stattgefunden hatte und die Diagnose somit fest stand. Jedes vierte bei der Studie getestete Krankenhaus fragte dann von sich aus den Versichertenstatus ab. Diejenigen Krankenhäuser, die aktiv den Versichertenstatus abfragten, wurden zwei Wochen später noch ein mal von demselben Forscher angerufen, der sich nun als fiktiver Privatpatient ausgab. Dadurch konnte für das jeweilige Krankenhaus die Abweichung bei der Terminvergabe zwischen den gesetzlich und privat Versicherten geprüft werden.
Als Ergebnis zeigte sich dann: Je nach Krankheitsbild warteten die gesetzlich Versicherten unterschiedlich lange auf einen Termin: Bei der Indikation "Knöchelbruch" mussten gesetzlich Versicherte mehr als doppelt so lange warten (131 Prozent) als privat Versicherte, nämlich 4,7 Tage im Vergleich zu 2,1 Tagen. Bei der Indikation "Herzkranzgefäßverengung" (Stenose) lag die Wartezeit noch 18 Prozent (13,9 bzw. 11,8 Tage) und bei "Krebsverdacht" (Konisation) noch 5 Prozent über den privat Versicherten. Während 41 Prozent der privat Versicherten innerhalb einer Woche einen Termin erhielten, waren es bei den gesetzlich Versicherten nur 28 Prozent. Zwei Wochen nach dem Anruf erhielten 73 Prozent der gesetzlich Versicherten einen Termin, während der Anteil privat Versicherter bereits bei 81 Prozent lag.
• Die Studie ist hier im Volltext herunterzuladen : Sauerland, Dirk u.a.: Ansgar: Warten gesetzlich Versicherte länger? Zum Einfluss des Versichertenstatus auf den Zugang zu medizinischen Leistungen im stationären Sektor, Lahr 2008
• Hier ist ein Abstract und weitere WHL Diskussionspapiere
Gerd Marstedt, 10.4.2008
Entwicklung und Stand der Privatisierungsprozesse im deutschen Krankenhauswesen - Länderbericht Deutschland 2006!
 Seit der Wiedervereinigung ist bis 2004 der Anteil privater Träger im Krankenhausbereich von 14,1 % auf 25,3 % gestiegen. Diese für die vorherige deutsche Krankenhauslandschaft ungewöhnliche Entwicklung trug mit dazu bei, dass die drei größten privaten Krankenhausbetreiber Europas mit den Rhönkliniken, Helios und Asklepios ihren Sitz und ihr Hauptaktionsfeld in Deutschland haben.
Seit der Wiedervereinigung ist bis 2004 der Anteil privater Träger im Krankenhausbereich von 14,1 % auf 25,3 % gestiegen. Diese für die vorherige deutsche Krankenhauslandschaft ungewöhnliche Entwicklung trug mit dazu bei, dass die drei größten privaten Krankenhausbetreiber Europas mit den Rhönkliniken, Helios und Asklepios ihren Sitz und ihr Hauptaktionsfeld in Deutschland haben.
Diesen und vergleichbaren Prozessen in drei weiteren Branchen geht in weiteren fünf europäischen Ländern seit einigen Jahren und noch bis 2009 ein internationales Forschungsprojekt auf den Grund. Das von der EU-Kommission geförderte Forschungsprojekt "Privatisation of Public Services and the Impact
on Quality, Employment and Productivity (PIQUE)" (CIT5-2006-028478) beschäftigt sich mit den "Zusammenhängen zwischen Beschäftigung, Produktivität und der Qualität öffentlicher Dienstleistungen im Rahmen von Liberalisierungs- und Privatisierungsprozessen".
Eine Kernhypothese des Projekts ist die eines engen Zusammenhangs von guten Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen und ihren positiven Auswirkungen auf die Produktivität wie die Qualität der Dienstleistungen. Dieser Hypothese geht das Projekt in mehreren Ländern (z. B. Belgien, Österreich, Schweden und auch Deutschland) und verschiedenen Branchen (z. B. Elektrizität, Post, ÖPNV und Gesundheitsdienste / Krankenhäuser) empirisch nach. Das Projekt veröffentlicht innerhalb seiner Laufzeit mehrere Branchenberichte und Fallstudien und wird in Deutschland vom WSI-Institut in der Hans-Böckler-Stiftung bearbeitet.
Einer der Branchenberichte untersucht auf 27 Seiten die "Liberalisation, privatisation and regulation
in the German healthcare sector/hospitals", ist von Thorsten Schulte verfasst und Ende 2006 veröffentlicht worden.
Der Bericht beschäftigt sich vorrangig damit, einen kompakten und materialreichen Überblick über die Entwicklung und den Zustand der Krankenhausmarktsstruktur, das spezielle deutsche System zur gesetzlichen und finanziellen Regulierung dieses Marktes sowie die Rolle des Staates und anderer Stakeholders zu geben.
Ohne dass es im Krankenhausbereich eine vergleichbar explizite Privatisierungs- und Kommerzialisierungsansage gegeben hat, startete eine solche Strategie zunächst nach der Wiedervereinigung in Ostdeutschland und ab 2000 auch mit einer Privatisierungswelle in Westdeutschland. Letztere mit der vorläufigen Krönung der ersten Privatisierung zweier Universitätskliniken in Hessen. Dabei waren die verschiedenen Finanzierungs- und Finanzengpässe nahezu aller Bundesländer und vieler städtischer Haushalte die mitentscheidenden Triebkräfte.
Auch wenn der Verfasser des Berichts zu Recht beklagt, dass es erst wenige und dann kaum abgeschlossene Forschung über den Impact dieser Entwicklung auf die Arbeitsbedingungen, die wirtschaftlichen Beziehungen und die Qualität der Krankenhausleistungen gibt, verficht er entschieden die These, "privatisation will lead sooner or later to a deterioration of both working conditions and service quality".
Damit steht für ihn fest, dass der deutsche Krankenhaussektor auch künftig "an area of political struggles" bleiben wird.
Da die PIQUE-ForscherInnen auch den Krankenhausmarkt als das Resultat von politischen Entscheidungen betrachten, bleibt zu hoffen, dass es ihnen selber oder in Kooperation mit anderen empirischen Forschungsprojekten zur Arbeits- und Versorgungsqualität im Krankenhaus (z. B. das seit 2003 und noch bis Ende 2008 vom WZB und Zentrum für Sozialpolitik der Universität Bremen bearbeitete Projekt "Wandel von Medizin und Pflege im DRG-System (WAMP)") gelingt, ihre Thesen zu verifizieren.
Den Bericht "Liberalisation, privatisation and regulation in the German healthcare sector/hospitals" kann man als kostenfreie PDF-Datei hier herunterladen.
Bernard Braun, 30.9.2007
GB: Längere Anfahrtswege und -zeiten von Schwerkranken zu Notfallambulanzen erhöhen ihr Sterblichkeitsrisiko
 Die von manchen Kritikern befürchteten Nachteile der planmäßigen oder durch den Wettbewerbdruck erzwungenen Schließung kleiner und mittlerer regionaler Krankenhäuser in Deutschland für die Gesundheit oder gar das Leben von Patienten scheint weder gegenstandslos noch vernachlässigenswert gering zu sein.
Die von manchen Kritikern befürchteten Nachteile der planmäßigen oder durch den Wettbewerbdruck erzwungenen Schließung kleiner und mittlerer regionaler Krankenhäuser in Deutschland für die Gesundheit oder gar das Leben von Patienten scheint weder gegenstandslos noch vernachlässigenswert gering zu sein.
Dies zeigt zumindest eine gerade im "Emergency Medicine Journal" veröffentlichte Untersuchung der Verlaufs- und Folgendaten von 10.315 in Großbritannien von vier Rettungsdiensten durchgeführten Notfalleinsätzen über einen Zeitraum von 5 Jahren. Dabei handelte es sich meist um Patienten mit lebensbedrohlichen Zuständen. Alle Patienten waren bewusstlos, hatten schwere Atmungsprobleme oder litten an schweren akuten Brustschmerzen.
Die Ergebnissen sehen so aus:
• Über 6 % dieser Patienten starben.
• Insgesamt betrachtet stieg das relative Sterberisiko mit jedem zusätzlich zu überwindenden Kilometer um 1,02 %.
• Die strengste Assoziation zwischen Sterblichkeit und Entfernung zur Notfallambulanz zeigte sich bei Patienten mit Atemproblemen.
• Diese Ergebnisse wurden auch nach einer Adjustierung nach Confoundern wie dem Alter oder der Schwere der Erkrankung nicht statistisch signifikant verändert.
Die Forscher sehen durch ihre Studie bestätigt, dass ein nahezu einprozentiger absoluter Anstieg der Sterblichkeit mit einer 10 Kilometer betragenden Verlängerung der Luftlinienentfernung zur Notaufnahme eines Krankenhauses zusammenhängt. Folglich könnte nach ihrer Meinung die Schließung lokaler Notfall- oder Unfallstationen "result in an increase in mortality for a small number of patients with life-threatening emergencies."
Ein kostenloses Abstract des Aufsatzes "The relationship between distance to hospital and patient mortality in emergencies: an observational study" von Jon Nicholl, James West, Steve Goodacre und Janette Turner im "Emergency Medicine Journal" (Emerg Med J 2007; 24: 665-668. doi:10.1136/emj.2007.047654) kann hier heruntergeladen werden. Der komplette Aufsatz ist bisher nicht kostenfrei erhältlich.
Bernard Braun, 21.8.2007
Vernetzung ambulant-stationär und mehr Strukturkenntnisse der Patienten könnten unnötige Notfall-Behandlungen vermeiden
 In zwei vom "Zentrum für Sozialpolitik (ZeS)" der Universität Bremen 2002 und 2005 durchgeführten Befragungen von Krankenhauspatienten gaben 7,8 % bzw. 10,1 % der Befragten an, ohne ärztliche Einweisung ins Krankenhaus gekommen zu sein. Rechnet man zu den Personen, die nach einer so genannten Selbsteinweisung wirklich zur stationären Behandlung aufgenommen worden sind noch die Personen hinzu, die sich ohne ärztliche Einweisung als "Notfall" an eine Krankenhaus-Rettungsstelle wandten und dort ohne stationäre Aufnahme behandelt wurden, geht es dabei um finanziell und gesundheitlich erhebliche Quantitäten.
In zwei vom "Zentrum für Sozialpolitik (ZeS)" der Universität Bremen 2002 und 2005 durchgeführten Befragungen von Krankenhauspatienten gaben 7,8 % bzw. 10,1 % der Befragten an, ohne ärztliche Einweisung ins Krankenhaus gekommen zu sein. Rechnet man zu den Personen, die nach einer so genannten Selbsteinweisung wirklich zur stationären Behandlung aufgenommen worden sind noch die Personen hinzu, die sich ohne ärztliche Einweisung als "Notfall" an eine Krankenhaus-Rettungsstelle wandten und dort ohne stationäre Aufnahme behandelt wurden, geht es dabei um finanziell und gesundheitlich erhebliche Quantitäten.
Will man nicht jeden Selbsteinweiser des Missbrauchs verdächtigen, muss man differenziert untersuchen, warum Menschen die Notfallstelle eines Krankenhauses bevorzugen, wie viele dieser Kontakte die einzig gesundheitlich richtige Entscheidung und wie viele Kontakte unsinnig waren. Bevor das Thema von der Gesundheitspolitik oder Krankenhausmanagern als nächste Möglichkeit zur Erhebung von "Eintrittsgebühren" à la Praxisgebühr entdeckt wird, sollte auch überlegt werden, ob es strukturelle Möglichkeit der Inanspruchnahme-Steuerung gibt.
Zu allen Aspekten gibt es eine erste empirische Untersuchung, die im November 2006 an der "Klinik für Unfall- und Wiederherstellungschirurgie der Charité-Universitätsmedizin in Berlin" an allen Wochentagen für das Geschehen zwischen 8 und 18 Uhr durchgeführt wurde. Von den 894 Patienten, die in dieser Rettungsstelle also zu der Zeit behandelt werden wollten, in der ohne Weiteres eine ambulante Behandlung bei einem niedergelassenen Arzt möglich gewesen wäre, erhielten 276 einen speziellen Fragebogen, den dann auch 271 ausfüllten. Ausgeschlossen waren u.a. die 393 Patienten, die durch einen Rettungsdienst eingeliefert wurden oder die 76 Patienten, die eine Mitarbeit von vornherein verweigerten.
Die demnach ausschließlich auf Selbstbeurteilungen der Patienten beruhenden Ergebnisse zeichnen ein sehr differenziertes Bild:
• Etwa die Hälfte der Patienten, die sich selber in die Rettungsstelle des Krankenhauses begaben, sehen sich nicht als Notfälle.
• Für die Entscheidung, sich trotzdem in eine Notfallbehandlungs-Einrichtung zu begeben, spielte dann ein Bündel von Motiven eine Rolle. Rund 74 % sahen eine medizinische Notwendigkeit unterhalb einer Notfallindikation, fast zwei Drittel der Befragten konnten mangels Kenntnis nicht qualifiziert zwischen den medizinischen Anlaufstellen unterscheiden, fast 62 % nannten ihre Bequemlichkeit als Grund, 45 % der Befragten schätzten, dass eine notärztliche Behandlung durch die gleichzeitige Verfügbarkeit verschiedener Fachärzte einen geringeren Gesamtaufwand bedeutet und fast die Hälfte schätzten die Qualität der notärztlichen Versorgung besser ein als die der niedergelassenen Ärzte.
• Alles in allem hätten nach den Autoren der Studie aus medizinischer Sicht rund 20 % der Befragten nach ihren eigenen Angaben eine angemessene Behandlung im ambulanten Bereich finden können.
Will man dieses Fünftel unnötiger Inanspruchnahme vermeiden, favorisieren die Charité-Forscher eindeutig Lösungen, die zur Überwindung der strikten Trennung und Undurchschaubarkeit der ambulanten, stationären und notärztlichen Versorgung beitragen und weniger denkbare Motivations- oder Informationsangebote für Patienten. Die Vernetzung aller Anlaufstellen zu einer, die dann über den Behandlungsort entscheidet, hat den möglichen Vorteil, dass Patienten, die ihre Beschwerden unterschätzen, schneller problemgerecht behandelt werden. Mit der Idee, ambulante Unfallpraxen in diesen vernetzten Strukturen zu integrieren oder ganze medizinische Versorgungszentren mit stationären Kliniken zusammenarbeiten zu lassen, bewegen sich die Forscher in Bereiche, in denen es von jahrzehntelang gehegten Unverrückbarkeiten nur so wimmelt.
Die Ergebnisse der Studie sind von Steffen, Tempka und Klute unter dem Titel "Falsche Patientenanreize in der Ersten Hilfe der Krankenhäuser" im "Deutschen Ärzteblatt" im April 2007 (Jg. 104, Heft 16 vom 20. April 2007) veröffentlicht worden und hier herunterladbar.
Bernard Braun, 25.5.2007
Kostendämpfung und Rationalisierung in US-Krankenhäusern erhöhen das Risiko unerwünschter Wirkungen bei Patienten
 Die Anstrengungen an us-amerikanischen Krankenhäusern, Operationen zu rationalisieren und Kosten durch die Reduktion von Personal zu senken, erhöht in Spitzenzeiten des Behandlungsgeschehens das Risiko vermeidbarer Fehler und damit das Risiko unerwünschter Behandlungsereignisse. Das ist das Ergebnis einer gründlichen Analyse der Behandlungsdaten von 6.841 Patienten an zwei städtischen Lehrkrankenhäusern und zwei vorstädtischen Krankenhäusern in zwei Bundesstaaten der USA über den Zeitraum von 12 Monaten in den Jahren 2000 und 2001.
Die Anstrengungen an us-amerikanischen Krankenhäusern, Operationen zu rationalisieren und Kosten durch die Reduktion von Personal zu senken, erhöht in Spitzenzeiten des Behandlungsgeschehens das Risiko vermeidbarer Fehler und damit das Risiko unerwünschter Behandlungsereignisse. Das ist das Ergebnis einer gründlichen Analyse der Behandlungsdaten von 6.841 Patienten an zwei städtischen Lehrkrankenhäusern und zwei vorstädtischen Krankenhäusern in zwei Bundesstaaten der USA über den Zeitraum von 12 Monaten in den Jahren 2000 und 2001.
Die Forscher um Joel Weissman, die meisten davon beschäftigt an zwei renommierten Bostoner Krankenhäusern, wiesen zum Beleg ihrer These auf mehrere eindeutige Ereignisse und Zusammenhänge hin. Ihre Analysen zeigten 1.530 unerwünschte Ereignisse, die nicht durch die behandelte Erkrankung der Patienten verursacht wurden. Die vermeidbaren Behandlungsfehler schlossen Fehler bei der Arzneimittelbehandlung, Nervenverletzungen und Infektionen ein. In einem Hospital führte ein Anstieg der quantitativen Relation von Patienten und Pflegekräften um 10 % zu einem statistisch signifikanten Anstieg der vermeidbaren unerwünschten Effekte um 28 %. An den drei anderen Krankenhäusern, an denen auch ein insgesamt schwächerer Rationalisierungsdruck im Personalbereich berechnet wurde, konnten derartige extremen Zusammenhänge nicht gefunden werden oder sie waren ohne statistische Signifikanz.
David Bates, einer der leitenden Verfasser der Studie und Leiter der Allgemeinmedizin an einem großen Krankenhaus, wies warnend darauf hin, dass die Ziele Kostendämpfung und Qualitätsverbesserung der Patientenbehandlung "working against each other".
Von der Studie "Hospital Workload and Adverse Events" von Weissman, Rothschild, Bates et al. in der Fachzeitschrift "Medical Care" (45(5):448-455, May 2007) gibt es kostenlos lediglich ein Abstract.
Bernard Braun, 4.5.2007
Daten zur Behandlungsqualität werden Wettbewerb zwischen Kliniken forcieren
 Eine neue Dimension der Qualitätssicherung in der stationären Behandlung haben nach eigener Aussage die AOK und der Klinikbetreiber Helios jetzt aufgezeigt. Mit ihrem Projekt "Qualitätssicherung der stationären Versorgung mit Routinedaten" (QSR) haben sie gemeinsam mit dem Wissenschaftlichen Institut der AOK (WIdO) und dem Forschungsinstitut für das Sozial- und Gesundheitswesen Sachsen-Anhalt (FEISA) ein Verfahren entwickelt, mit dem sich erstmals Langzeiterfolge von Klinikbehandlungen bewerten lassen.
Eine neue Dimension der Qualitätssicherung in der stationären Behandlung haben nach eigener Aussage die AOK und der Klinikbetreiber Helios jetzt aufgezeigt. Mit ihrem Projekt "Qualitätssicherung der stationären Versorgung mit Routinedaten" (QSR) haben sie gemeinsam mit dem Wissenschaftlichen Institut der AOK (WIdO) und dem Forschungsinstitut für das Sozial- und Gesundheitswesen Sachsen-Anhalt (FEISA) ein Verfahren entwickelt, mit dem sich erstmals Langzeiterfolge von Klinikbehandlungen bewerten lassen.
"Als erste gesetzliche Krankenkasse verfügen wir über zuverlässige Informationen zur Behandlungsqualität unserer Versicherten in Krankenhäusern", betonte Johann-Magnus von Stackelberg, stellvertretender Vorstandsvorsitzender des AOK-Bundesverbandes, bei der Vorstellung des QSR-Abschlussberichtes in Berlin. Mehr Transparenz bei der Qualität von Krankenhäusern sei eine unverzichtbare Voraussetzung für den Vertragswettbewerb. Die Transparenz von Behandlungsergebnissen könne Kliniken helfen, ihre Wettbewerbssituation substanziell zu verbessern.
Mit dem QSR-Projekt lassen sich nach einer Krankenhaus-Entlassung Patientendaten über beliebig lange Zeiträume verfolgen. Damit können Langzeiterfolge von Therapien geprüft werden. Die Daten sind anonymisiert. Als Datengrundlage dienten Angaben von 25,4 Millionen AOK-Versicherten mit 6,4 Millionen Krankenhausfällen aus dem Jahr 2003. Für die Analyse wurden zehn Indikatoren wie Herzinfarkt, Hirninfarkt oder Operationen bei Dickdarm-Krebs ausgewählt.
"Da die Patientenstruktur in den Krankenhäusern sehr unterschiedlich sein kann, wurde Wert auf ein zuverlässiges Verfahren gelegt, durch das die verschiedenen Risiken berücksichtigt werden können", erklärte Günther Heller vom Wissenschaftlichen Institut der AOK (WIdO). Mit einbezogen wurden bei der Risikoadjustierung Faktoren wie Geschlecht, Alter oder Begleiterkrankungen. "Die Daten liegen bei den Krankenhäusern vor, so dass kein bürokratischer Aufwand bei den Kliniken entsteht", betonte Heller.
Die AOK will das QSR-System auch anderen Krankenhäusern anbieten. Diese Kliniken können im ersten Schritt bis Sommer 2007 Daten zur eigenen Ergebnisqualität der bisher analysierten Leistungsbereiche erhalten. In einem zweiten Schritt will der AOK-Bundesverband im nächsten Jahr erste Klinikvergleiche veröffentlichen, um den Versicherten Daten zur Ergebnisqualität von Behandlungen zur Verfügung zu stellen. Ralf Michels von den Helios-Kliniken ermunterte die Krankenhäuser, der Veröffentlichung ihrer Daten zuzustimmen und sich dem Qualitätswettbewerb zu stellen.
• Materialien zur Pressekonferenz "Mehr Transparenz bei der Ergebnisqualität von Krankenhausbehandlungen" am 28. März 2007 in Berlin
• Wissenschaftliches Institut der AOK (WidO): Qualitätssicherung der stationären Versorgung mit Routinedaten (QSR) - Abschlussbericht (PDF, 435 Seiten)
Gerd Marstedt, 30.3.2007
Wenig qualifiziertes Pflegepersonal im Krankenhaus: Für Patienten ein tödlicher Risikofaktor
 Viele Todesfälle im Krankenhaus könnten vermieden werden, wenn besser qualifizierte Pflegekräfte tätig wären und routinemäßig Pflegeprotokolle verwendet würden. Dies ist der überraschende Befund einer jetzt veröffentlichten kanadischen Studie. Ein Forschungsteam der Universität von Toronto und des "Institute for Clinical Evaluative Sciences" in Ontario (Kanada) hat die Daten von rund 47.000 Patienten näher analysiert, die seinerzeit wegen bestimmter Erkrankungen (Herzinfarkt, Schlaganfall, Lungenentzündung, Blutvergiftung) in einer der Kliniken des Distrikts behandelt wurden. Zunächst zeigte sich, dass die Sterbequote dieser Patienten innerhalb eines 30-Tages-Zeitraums erhebliche Unterschiede zwischen den 75 einbezogenen Krankenhäusern aufwies: Sie variierte zwischen 10% und 28%. Als die Forscher auch Informationen über die jeweiligen Pflegekräfte in die Analyse der Daten aufnahmen, zeigte sich, dass fast die Hälfte der Todesfälle in engem Zusammenhang stand mit der Qualifikation der Pfleger/innen sowie der Qualität der Pflegeorganisation.
Viele Todesfälle im Krankenhaus könnten vermieden werden, wenn besser qualifizierte Pflegekräfte tätig wären und routinemäßig Pflegeprotokolle verwendet würden. Dies ist der überraschende Befund einer jetzt veröffentlichten kanadischen Studie. Ein Forschungsteam der Universität von Toronto und des "Institute for Clinical Evaluative Sciences" in Ontario (Kanada) hat die Daten von rund 47.000 Patienten näher analysiert, die seinerzeit wegen bestimmter Erkrankungen (Herzinfarkt, Schlaganfall, Lungenentzündung, Blutvergiftung) in einer der Kliniken des Distrikts behandelt wurden. Zunächst zeigte sich, dass die Sterbequote dieser Patienten innerhalb eines 30-Tages-Zeitraums erhebliche Unterschiede zwischen den 75 einbezogenen Krankenhäusern aufwies: Sie variierte zwischen 10% und 28%. Als die Forscher auch Informationen über die jeweiligen Pflegekräfte in die Analyse der Daten aufnahmen, zeigte sich, dass fast die Hälfte der Todesfälle in engem Zusammenhang stand mit der Qualifikation der Pfleger/innen sowie der Qualität der Pflegeorganisation.
Die Studie zeigte unter anderem:
&bull, Bei einer um 10% höheren Zahl der Pflegekräfte ergibt sich in der Analyse eine Senkung der Todesfälle um 6 pro 1.000 Patienten. Ähnliche Effekte zeigen sich wenn man den zeitlichen Pflegeaufwand (in Relation zur Zahl der betreuten Patienten) in Rechnung stellt.
&bull, Die Überlebensrate der Patienten liegt um 9 pro 1.000 Patienten höher (innerhalb der betrachteten 30-Tages-Zeitspanne), wenn höher qualifizierte Pflegekräfte im Einsatz sind. (Die Berufsausbildung der Pflegekräfte kann in Kanada wie in den USA im Unterschied zu Deutschland hinsichtlich der Dauer, Qualität und Praxisnähe sehr unterschiedlich ausfallen, man findet in Kliniken relativ unqualifizierte Hilfskräfte ebenso wie Pfleger mit Hochschulabschluss für diese Tätigkeit.).
&bull, Ebenso zeigte sich, dass die Sterbequote in solchen Kliniken deutlich niedriger ausfällt, die eine gute Arbeitsorganisation haben und Pflegeprotokolle routinemäßig bei der Arbeit einsetzen, also auch tatsächlich und nicht nur pro forma zur Kontrolle des Pflegeablaufs und der Patientendaten verwenden.
Insgesamt waren in die Analyse knapp 20 Merkmale einbezogen, die auch als Indikatoren unterschiedlicher Pflegequalität interpretierbar sind: Qualifikation und Berufserfahrung der Pflegekräfte, Ausmaß des Burnout-Gefühls, Anteil Vollzeitstellen innerhalb des Pflegepersonals, Krankenstand bzw. Fehlzeiten, Verhältnis zum ärztlichen Personal, Unterstützung durch Ärzte, aufgewendete Arbeitszeit und andere mehr. 8 dieser 20 Merkmale konnten einen erheblichen Teil (knapp die Hälfte) der unterschiedlichen Sterbequoten in den verschiedenen Krankenhäusern erklären. In die Studie einbezogen waren alle Kliniken in Ontario im Jahre 2002 und 2003 mit Ausnahme kleinerer Häuser mit aktuell weniger als 100 Patienten. Insgesamt wurden Qualifikationsmerkmale und Arbeitsbedingungen von knapp 6.000 Pflegekräften in der Analyse berücksichtigt. Im Durchschnitt hatten 13% der Pfleger/innen eine hochqualifizierte Ausbildung (Hochschule), diese Quote als zentrales Merkmal der Pflegequalität variierte in den Kliniken jedoch zwischen 0 und 62%. In ähnlicher Weise zeigten sich auch für den Einsatz von Pflegeprotokollen massive Differenzen zwischen Kliniken und Abteilungen. In einigen Häusern bzw. Abteilungen lag diese Quote bei 29%, in anderen bei 85%.
In der Studie wurde auch berücksichtigt bzw. geprüft, ob die Ergebnisse möglicherweise dadurch beeinflusst sind, dass die in den einzelnen Kliniken behandelten Patienten auch unterschiedliche Merkmale aufweisen, die ebenfalls maßgeblich sein könnten für die Sterbequote. Dies könnte etwa bewirkt sein durch Differenzen im Lebensalter, Schweregrad der Erkrankung, Zweit-Erkrankungen und anderes mehr. Aufgrund von Patientenbögen konnte dies jedoch kontrolliert und in der Analyse mitberücksichtigt werden, d.h. es sind tatsächlich Merkmale der Pflegequalität und nicht Besonderheiten der Patienten, die fast zur Hälfte ursächlich sind für Überlebenschancen von Patienten.
Die Ergebnisse der Studie haben erhebliche Bedeutung auch für deutsche Verhältnisse. Zwar gibt es in Deutschland keine vergleichbar großen Differenzen in der Qualifikation des Pflegepersonals. Eine Hochschulausbildung im Fach "Pflegewissenschaft" weisen bei uns bislang nur verschwindend geringe Anteile des Personals auf. Gleichwohl sind andere Befunde der Studie durchaus übertragbar. Dies gilt etwa für die zeitliche Belastung der Pfleger/innen bzw. den Pflegeaufwand je Patient und ebenso für die systematische Verwendung von Pflegeprotokollen, wo es markante Differenzen zwischen einzelnen Kliniken gibt. Diese aber auch weitverbreitete Defizite und Unterschiede bei anderen Merkmalen der Struktur- und Prozessqualität der Behandlung im Krankenhaus (z.B. die Orientierung an so genannten "clinical pathways") förderte beispielsweise eine 2003 durchgeführte bundesweite Befragung von Pflegekräften in Akutkrankenhäusern zutage, die durch eine 2004 erfolgte Befragung von hessischen Krankenhausärzten in der Tendenz bestätigt wurden.
Nachdenklich stimmen muss in Anbetracht der Befunde aber auch, dass in Kliniken aufgrund des ökonomischen Drucks weiterhin Personal abgebaut wird und zwar insbesondere im Bereich der Pflege. So meldet das Krankenhaus-Barometer, eine repräsentative Umfrage des Deutschen Krankenhausinstituts (DKI), dass von 2002 bis 2004 insgesamt 12,2 Vollkraftstellen pro Krankenhaus gestrichen wurden. In den Jahren 2000 bis 2002 war der Stellenabbau nur etwa halb so hoch. Von der Personalreduzierung waren vor allem der Pflegedienst (-4,2 Prozent) und Mitarbeiter im Medizinisch-technischen Dienst (-1,1 Prozent) betroffen, während der Ärztliche Dienst Zuwächse um +4,2 Prozent vermeldet.
Die Studie wurde im Januar 2007 veröffentlicht im Journal of Advanced Nursing (Heft 57.1)
&bull, Kostenlos zugänglich ist eine Pressemitteilung mit den wichtigsten Ergebnissen
&bull, und ein Abstract der Studie: "Impact of hospital nursing care on 30-day mortality for acute medical patients"
Gerd Marstedt, 17.1.2007
Krankenhaus-Barometer 2006: Jede dritte Klinik schreibt Verluste
 Das Deutsche Krankenhausinstitut hat jetzt die Ergebnisse der Umfrage des "Krankenhaus Barometer 2006" vorgelegt. Das Krankenhaus Barometer liefert seit sieben Jahren umfangreiche Informationen zum aktuellen Krankenhausgeschehen. Die Umfrage 2006 beruht auf den Angaben von 341 Allgemeinkrankenhäusern, die im April und Mai diesen Jahres durchgeführt wurden. Die Ergebnisse sind repräsentativ für alle allgemeinen Krankenhäuser in Deutschland, die gemäß § 108 SGB V zur Krankenhausbehandlung zugelassen sind. Einige wesentliche Befunde der Studie:
Das Deutsche Krankenhausinstitut hat jetzt die Ergebnisse der Umfrage des "Krankenhaus Barometer 2006" vorgelegt. Das Krankenhaus Barometer liefert seit sieben Jahren umfangreiche Informationen zum aktuellen Krankenhausgeschehen. Die Umfrage 2006 beruht auf den Angaben von 341 Allgemeinkrankenhäusern, die im April und Mai diesen Jahres durchgeführt wurden. Die Ergebnisse sind repräsentativ für alle allgemeinen Krankenhäuser in Deutschland, die gemäß § 108 SGB V zur Krankenhausbehandlung zugelassen sind. Einige wesentliche Befunde der Studie:
• Trotz der durch das neue Vergütungssystem ausgelösten weitreichenden Veränderungen ist fast die Hälfte der Krankenhäuser eher oder sehr zufrieden mit den DRGs. Rund 15% gaben an, eher oder sehr unzufrieden mit dem System zu sein.
• Die tendenzielle Zufriedenheit der Krankenhäuser mit dem neuen Entgeltsystem schließt jedoch eine kritische Bewertung der einzelnen System-Bestandteile nicht aus: So sind die Kliniken mit den Bewertungsrelationen bzw. Entgeltbeträgen in den Katalogen noch relativ häufig unzufrieden.
• Die Kliniken sind verstärkt den Prüfungen des von den Krankenkassen beauftragten MDK ausgesetzt. Die Anzahl der verdachtsabhängigen Einzelfallprüfungen des MDK hat seit dem Anfang des Jahres 2004 bei insgesamt 83% der Krankenhäuser zugenommen.
• Zur Jahresmitte 2006 haben 40% der Krankenhäuser neue Arbeitszeitmodelle eingeführt. Bei einem Drittel der Häuser ist eine neue Arbeitszeitorganisation konkret in Planung. Die erheblichen rechtlichen, tariflichen und finanziellen Unsicherheiten und Probleme haben bislang viele Krankenhäuser von der (weiteren) Umsetzung einer neuen Arbeitszeitorganisation abgehalten.
• Im Jahr 2005 erzielte knapp die Hälfte der zugelassenen Allgemeinkrankenhäuser in Deutschland einen Jahresüberschuss. Immerhin ein Drittel der Häuser schrieb Verluste. Knapp 17% wiesen ein ausgeglichenes Ergebnis auf.
Neben diesen Schwerpunkten finden sich im aktuellen Krankenhaus-Barometer weitere Auswertungen zu den Themen: Leistungsentwicklung, Entgelte und deren Prüfungen im DRG-System, Zahlungsverzögerungen und -verweigerungen, Medizinische Versorgungszentren sowie Integrierte Versorgung. Auf der Website der Deutschen Krankenhausgesellschaft ist
• die komplette Studie verfügbar: Krankenhaus Barometer 2006
• als auch eine Kurzfassung der wichtigsten Ergebnisse
Gerd Marstedt, 29.11.2006
Krankenhaus-Report 2006: 3,7 Milliarden Euro Einsparpotenziel durch effiziente Klinikverwaltung
 Würden sich alle Krankenhäuser in Deutschland an den effizienten Kliniken orientieren, könnten allein in der Verwaltung bis zu 3,7 Milliarden Euro jährlich eingespart werden. Zu diesem Ergebnis kommt der heute in Bonn veröffentlichte Krankenhaus-Report 2006. Schwerpunkt des neuen Reports ist das Thema "Krankenhausmarkt im Umbruch". Für den Krankenhaus-Report 2006 hat das Wissenschaftliche Institut der AOK (WIdO) die Verwaltungsausgaben der Krankenhäuser analysiert. Dabei haben sich erhebliche Effizienzunterschiede zwischen den Bundesländern und Klinikträgern gezeigt. Im Vergleich sind die Berliner Krankenhäuser am wenigsten effizient. Dort könnten laut Report pro Krankenhausfall 509 Euro bei den Verwaltungskosten eingespart werden. Bezogen auf das absolute Einsparvolumen liegt Nordrhein-Westfalen mit 721 Millionen Euro an der Spitze. Beim Vergleich der Träger weisen die öffentlichen Krankenhäuser die schlechtesten Effizienzwerte bei der Verwaltung auf. Freigemeinnützige und private Häuser stehen laut WIdO deutlich besser da. Das mögliche Einsparpotenzial bei den Kliniken in öffentlicher Trägerschaft beziffern die Experten auf 2,9 Milliarden Euro.
Würden sich alle Krankenhäuser in Deutschland an den effizienten Kliniken orientieren, könnten allein in der Verwaltung bis zu 3,7 Milliarden Euro jährlich eingespart werden. Zu diesem Ergebnis kommt der heute in Bonn veröffentlichte Krankenhaus-Report 2006. Schwerpunkt des neuen Reports ist das Thema "Krankenhausmarkt im Umbruch". Für den Krankenhaus-Report 2006 hat das Wissenschaftliche Institut der AOK (WIdO) die Verwaltungsausgaben der Krankenhäuser analysiert. Dabei haben sich erhebliche Effizienzunterschiede zwischen den Bundesländern und Klinikträgern gezeigt. Im Vergleich sind die Berliner Krankenhäuser am wenigsten effizient. Dort könnten laut Report pro Krankenhausfall 509 Euro bei den Verwaltungskosten eingespart werden. Bezogen auf das absolute Einsparvolumen liegt Nordrhein-Westfalen mit 721 Millionen Euro an der Spitze. Beim Vergleich der Träger weisen die öffentlichen Krankenhäuser die schlechtesten Effizienzwerte bei der Verwaltung auf. Freigemeinnützige und private Häuser stehen laut WIdO deutlich besser da. Das mögliche Einsparpotenzial bei den Kliniken in öffentlicher Trägerschaft beziffern die Experten auf 2,9 Milliarden Euro.
Deutliche regionale Unterschiede verzeichnet der Krankenhaus-Report bei der Zahl der Behandlungsfälle. Die meisten Krankenhausbehandlungen je 100.000 Einwohner gab es 2004 in Sachsen-Anhalt (22.474) und im Saarland (22.209). Am seltensten wurden die Baden-Württemberger im Krankenhaus behandelt (17.540). Bei der Behandlung von Kreislauferkrankungen liegt die Zahl der Klinikfälle in Baden-Württemberg sogar 68 Prozent unter der des Saarlandes. Der Gesetzgeber sieht für das Jahr 2009 eine umfassende Neuregelung des Krankenhausmarktes vor. Der Krankenhaus-Report 2006 liefert mit Blick darauf Impulse zur Planung, Finanzierung und regionalen Versorgung. Unter anderem nimmt das Bundeskartellamt Stellung zu den Veränderungen im Krankenhausmarkt und der Kritiken an seinen Regulierungsentscheidungen. Die Herausgeber des Krankenhaus-Reports betrachten die Veränderungen im Krankenhausmarkt nicht zwingend als Krise. Es gebe viele Möglichkeiten, den Klinikmarkt wirtschaftlich und ohne Qualitätseinbußen zu restrukturieren und durch geeignete Planung und Regulierung auch die Versorgung in der Fläche zu sichern. Ein radikaler Wandel im Markt sei nicht zu erwarten. Der Anteil der privaten Kliniken liege jetzt bei 25,6 Prozent. 36 Prozent der Krankenhäuser sind in öffentlicher Hand, 38,4 Prozent befinden sich in freigemeinnütziger Trägerschaft.
Auf der Website des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO) kann die Buchveröffentlichung bestellt werden: Klauber/Robra/Schellschmidt (Hrsg.): Krankenhaus-Report 2006; Schwerpunkt: Krankenhausmarkt im Umbruch; Schattauer (Stuttgart), 460 Seiten inkl. CD-ROM (49,95 Euro).
• Dort gibt es eine Pressemitteilung mit den wichtigsten Ergebnissen zum kostenlosen Download: Pressemitteilung: Krankenhaus-Report 2006 erschienen
• Ferner gibt es eine PDF-Datei mit Abstracts der Aufsätze
Gerd Marstedt, 27.11.2006
Krankenhaus: Konflikte zwischen Betriebswirtschaft und Patientenversorgung sichtbar.
 Aus dem von der Hans Böcklerstiftung, der Gmünder Ersatzkasse und der Landesärztekammer Hessen seit 2002 geförderten und unterstützten Forschungsprojekt des Zentrums für Sozialpolitik (ZeS) der Universität Bremen und des Wissenschaftszentrums Berlin (WZB) zum "Wandel von Medizin und Pflege im DRG-System" (WAMP) liegen weitere Forschungsergebnisse aus den 2005 in vier Krankenhäusern unterschiedlicher Trägerform durchgeführten 48 qualitativen Interviews mit ÄrztInnen, PflegerInnen und Verwaltungsangehörigen vor.
Aus dem von der Hans Böcklerstiftung, der Gmünder Ersatzkasse und der Landesärztekammer Hessen seit 2002 geförderten und unterstützten Forschungsprojekt des Zentrums für Sozialpolitik (ZeS) der Universität Bremen und des Wissenschaftszentrums Berlin (WZB) zum "Wandel von Medizin und Pflege im DRG-System" (WAMP) liegen weitere Forschungsergebnisse aus den 2005 in vier Krankenhäusern unterschiedlicher Trägerform durchgeführten 48 qualitativen Interviews mit ÄrztInnen, PflegerInnen und Verwaltungsangehörigen vor.
In dem in der Reihe "Discussion Papers" des WZB gerade als Nr. 311 erschienenen 187 Seiten umfassenden Text geht es - so der Titel - um "Qualitative Folgen der DRG-Einführung für Arbeitsbedingungen und Versorgung im Krankenhaus unter Bedingungen fortgesetzter Budgetierung. Eine vergleichende Auswertung von vier Fallstudien". Dadurch sollen und werden "Einstellungen und Handlungsweisen sichtbar…, die Konflikte zwischen betriebswirtschaftlichen Erfordernissen und Patientenversorgung reflektieren" (aus der Zusammenfassung). Der Nutzwert dieses Arbeitspapiers ist für Leser, die sich mit dem keineswegs abgeschlossenen Geschehen weiter beschäftigen wollen, auch deshalb besonders groß, weil die Autoren, Petra Buhr (ZeS) und Sebastian Klinke (WZB), nach ihrer knapp 30-seitigen Aufbereitung der Fallstudien ausführliche Zusammenfassungen und Originalzitate der vier Fallstudien angefügt haben.
Das Papier finden Sie hier als PDF-Datei.
Bernard Braun, 17.11.2006
Modell Brandenburg: Vergleichende externe Qualitätssicherung der stationären Versorgung 2002-2004
 Im Rahmen der bundesweit eingeführten und institutionalisierten (bis 2003 Bundeskuratorium und Bundesgeschäftsstelle Qualitätssicherung - BQS und seit 1.1. 2004 der Gemeinsame Bundesausschuss) externen vergleichenden Qualitätssicherung nach § 137 SGB V gibt es im Land Brandenburg seit 2000 auf der Basis eines dreiseitigen Vertrags von Krankenkassenverbänden, Krankenhausgesellschaft und Landesärztekammer eine Landesgeschäftsstelle Qualitätsssicherung (LQS).
Im Rahmen der bundesweit eingeführten und institutionalisierten (bis 2003 Bundeskuratorium und Bundesgeschäftsstelle Qualitätssicherung - BQS und seit 1.1. 2004 der Gemeinsame Bundesausschuss) externen vergleichenden Qualitätssicherung nach § 137 SGB V gibt es im Land Brandenburg seit 2000 auf der Basis eines dreiseitigen Vertrags von Krankenkassenverbänden, Krankenhausgesellschaft und Landesärztekammer eine Landesgeschäftsstelle Qualitätsssicherung (LQS).
Zu deren Aufgaben gehört es u.a., einen "Qualitätsreport" über die Krankenhäuser des Landes im Vergleich mit den Bundeswerten auszuarbeiten.
Der "Qualitätsreport 2005" stellt nun zum ersten Mal nicht nur ein Jahresergebnis vor, sondern bereitet die Daten für die Jahre 2002 bis 2004 auf. Für ausgewählte klinische Bereiche wie z.B. die Augenheilkunde oder Geburtshilfe wurden von den medizinischen Fachgruppen prägnante Qualitätsindikatoren (z.B. eine bestimmte Häufigkeit von Wundinfektionen oder Glaskörperverluste bei Kataraktoperationen) ausgewählt, deren jährlichen Ergebnisse und Entwicklungen in jedem der untersuchten Bereiche ebenfalls von der jeweiligen Fachgruppe kommentiert wird.
Auf dieser Grundlage finden sich dann beispielsweise im Report folgende Ausführungen: "Der intraoperative Glaskörperverlust stellt in der Kataraktchirurgie eine ernste, weil folgenschwere Komplikation dar. Die Gefahr von postoperativen Entzündungen aber auch die Rate von zu erwartenden Netzhautablösungen steigt um ein Vielfaches. Mit einer Gesamtrate von 1,4% im Landesdurchschnitt wurde das Qualitätsziel im Vergleich zum Bundesdurchschnitt von 0,9% nicht erreicht. Im Qualitätsmanagement der Krankenhäuser sollte die Reduktion der intraoperativen Komplikationen eine höhere Priorität erfahren" (S. 14) oder "Insgesamt wurde aber mit einer Gesamtrate von 3,3% auch hier (bei den Wundinfektionen) das selbst gesteckte Ziel erreicht. Die Spannbreite der Kliniken lag jedoch zwischen 0 und 13,9%" (S. 24).
Die fachwissenschaftliche Diktion und die karge tabellarische Darstellung der Ergebnisse machen den Report aber mit Sicherheit zu keinem Informationsmittel für den Durchschnittsversicherten und -patienten. Grenzen des Orientierungsnutzens liegen ferner in der durchgehenden Anonymität der Krankenhäuser, egal ob sie die Qualitätsindikatoren erreichen oder übertreffen oder sie unterschreiten.
Den 151-seitigen "Qualitätsreport 2005" findet man auf der Website der Landesgeschäftsstelle Qualitätssicherung Brandenburg
Bernard Braun, 14.11.2006
Händewaschen gegen Krankenhausinfektionen: Auch eine Art medizinischer Fortschritt
 "One of the most powerful approaches to fighting health care-related infection is also the simplest: healthcare providers need to clean their hands every time they see a patient."
"One of the most powerful approaches to fighting health care-related infection is also the simplest: healthcare providers need to clean their hands every time they see a patient."
Dieser Kernüberzeugung der seit 2005 existierenden und von 22 Ländern getragenen WHO-Initiative "Clean Care is Safer Care" folgen seit 10. November 2006 13 weitere Länder, darunter Deutschland, die USA und der Sudan.
Zu jedem Zeitpunkt sind weltweit etwa 1,4 Millionen Personen an einer Krankheit erkrankt, die sie sich in Krankenhäusern erworben haben. In entwickelten Ländern leiden an diesen so genannten nosokomialen Infektionen zwischen 5 und 10 % aller Patienten. In einigen Entwicklungsländern sind bis zu einem Viertel der Patienten davon betroffen. Das besondere Problem eines wachsenden Anteils dieser Art von Krankheiten ist der ebenfalls steigende Anteil multiresistenter Erreger, was z. B. in den USA zu jährlich 44.000-98.000 Todesfällen durch nosokomiale Infektionen führt. In den dazu in den USA durchgeführten Studien wurde ermittelt, "dass etwa 1 % dieser Patienten mittelbar oder unmittelbar daran versterben. Bei 2,7 % aller ins Krankenhaus aufgenommenen Patienten tragen Infektionen als Mitursache zu einem tödlichen Verlauf bei, sind jedoch nicht die eigentliche Todesursache. " (Zitat Wikipedia)
Für die Situation in Deutschland verweist das "Institut für Hygiene und Umweltmedizin" der Charité auf seiner Website auf folgende Sachverhalte: "1994 wurde eine erste repräsentative bundesweite Studie zur Prävalenz nosokomialer Infektionen in Deutschland durchgeführt (NIDEP 1 - Nosokomiale Infektionen in Deutschland - Erfassung und Prävention). Für diese Studie wurden alle Patienten aus 72 zufällig ausgewählten Krankenhäusern, die zum Zeitpunkt der Studie stationär in den Fachrichtungen Innere Medizin, Chirurgie, Gynäkologie und Intensivpflege behandelt wurden, auf das Vorhandensein nosokomialer Infektionen hin untersucht. 14 966 Patienten wurden in diese Studie einbezogen. Die ermittelte Prävalenz betrug 3,0 % in der Gruppe der internistischen Patienten, 3,8 % bei den chirurgischen Patienten, 1,5% bei den gynäkologisch-geburtshilflichen und 15,3 % bei den Intensivpatienten (nosokomial infizierte Patienten pro 100 Patienten). Aufgrund verschiedener methodischer Festlegungen dieser Untersuchung...sind diese Prävalenzraten im Sinne von minimalen Infektionsraten anzusehen. Die häufigsten nosokomialen Infektionen waren in dieser nationalen Untersuchung die Harnweginfektionen (40 %), die Infektionen der unteren Atemwege (20 %) und die postoperativen Wundinfektionen (15 %) gefolgt von der primären Sepsis(8 %). [...] Die zurzeit umfangreichsten Daten zur Inzidenz von nosokomialen Infektionen in Deutschland resultieren aus dem Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System (KISS). Insgesamt sind durch KISS inzwischen Daten zu mehr als 330.000 Patienten aus 212 Intensivstationen und zu fast 150.000 Operationen in 217 operativen Fachabteilungen erhoben worden. Auf der Basis der Daten des Krankenhaus-Infektions-Surveillance-Systems (KISS) und des Statistischen Bundesamtes muss man davon ausgehen, daß in Deutschland allein auf den Intensivstationen jährlich mehr als 60.000 Krankenhausinfektionen auftreten, und es ist mit ca. 128.000 postoperativen Wundinfektionen pro Jahr zu rechnen. Insgesamt kann aufgrund von Hochrechnungen von etwa 500.000 bis 800.000 Fällen nosokomialer Infektionen im Jahr in Deutschland ausgegangen werden."
Im 2002 erschienenen als PDF-Datei erhältlichen Heft 8 der Gesundheitsberichterstattung des Bundes zum Thema "NosokomialeInfektionen" wird die Anzahl solcher Fälle auf jährlich 600.000 geschätzt.
Wie einfach und schnell hier gesundheitliche Erfolge erreicht werden können, zeigt die WHO am Beispiel der Schweiz: In zwei kantonalen Krankenhäusern gelang es mittels einer viermonatigen Kampagne für gründliche Handhygiene den Anteil von Ärzten und Pflegekräften, die sich die Hände reinigten um 25 % zu erhöhen. Wenn man dies auf die gesamte Schweiz hochrechnet, könnten jährlich allein durch Händewaschen 17.000 dieser Infektionen vermieden werden.
Hier finden Sie mehr über die WHO-Initiative
Bernard Braun, 13.11.2006
Qualitätsberichte der Krankenhäuser: Ab 2007 übersichtlicher und verständlicher
 Die Qualitätsberichte der deutschen Krankenhäuser sollen ab dem Jahr 2007 übersichtlicher, vergleichbarer und für die Patienten noch verständlicher gestaltet werden als das bisher der Fall war. Eine entsprechende Regelung hat der Gemeinsame Bundesausschuss (GBA) beschlossen.
Die Qualitätsberichte der deutschen Krankenhäuser sollen ab dem Jahr 2007 übersichtlicher, vergleichbarer und für die Patienten noch verständlicher gestaltet werden als das bisher der Fall war. Eine entsprechende Regelung hat der Gemeinsame Bundesausschuss (GBA) beschlossen.
Die Änderungen sehen beispielsweise vor, dass die Qualitätsberichte künftig ein Inhaltsverzeichnis und eine Einleitung haben, in der das Krankenhaus kurz vorgestellt und Verantwortliche sowie Ansprechpartner genannt werden. Insgesamt wird durch spezielle Vorgaben zur Berichtsstruktur eine bessere Orientierung und Vergleichbarkeit hergestellt, gleichzeitig gibt es Freiräume für individuelle Darstellungen, wie etwa die Organisationsstruktur eines Krankenhauses oder dessen besondere Kompetenzen. Auf die bisherige Auflistung von DRG-Kodierungen, die eigentlich nur der Bildung von diagnosebezogenen Abrechnungspositionen innerhalb des im Jahr 2002 neu eingeführten Fallpauschalensystems dienen, wird verzichtet. Die Versorgungsschwerpunkte, das Leistungsspektrum und die Ausstattungsmerkmale werden übersichtlicher dargestellt. Die Darstellung von Behandlungsergebnissen soll zukünftig nach einheitlichen Regeln erfolgen. Zudem wird es neben den im Internet als PDF-Datei zu veröffentlichenden Qualitätsberichten ab dem Jahr 2007 eine Datenbankversion im einheitlichen XML-Format geben, um umfassende und vergleichende Analysen zu erleichtern.
"Bei der Auswertung der Qualitätsberichte hat sich gezeigt, dass die bisherige Gliederung nicht zweckmäßig ist und die Orientierungs- und Nutzungsmöglichkeiten vor allem für die Patienten verbessert werden müssen, die wissen wollen, welches Krankenhaus speziell ihre Erkrankungen optimal behandeln kann. Diese Vorgabe hat der G-BA in der überarbeiteten Regelung jetzt besser und patientenfreundlicher umgesetzt", sagte Professor Dr. Michael-Jürgen Polonius, Vorsitzender des G-BA für den Krankenhausbereich.
Im Internet findet man hier die Neufassung der Vereinbarung des G-BA mit Erläuterungen.Für das Jahr 2005 werden Daten zur Behandlungsqualität in rund 1.500 deutschen Krankenhäusern noch in der alten Form durch den BQS-Qualitätsreport 2005 und die BQS-Bundesauswertung 2005 veröffentlicht. Grundlage sind mehr als 2,6 Millionen Datensätze aus deutschen Krankenhäusern. Veröffentlichungen dazu im Internet findet man hier:
BQS-Qualitätsreport 2005
BQS-Bundesauswertung
Hier ist die Neufassung der Vereinbarung des G-BA zu Qualitätsberichten der Krankenhäuser
Gerd Marstedt, 27.10.2006
DAK-Krankenpflege Report 2005: Belastungen für Krankenpfleger sind gestiegen
 Aufgabenvielfalt und Weiterbildungsbedarf im Krankenhaus haben zugenommen, aber auch die Arbeitsbelastungen sind gestiegen, insbesondere Arbeitstempo, Leistungsdruck und Sorgen um den Arbeitsplatz. Gesunken sind auf der anderen Seite die Möglichkeiten, Arbeitsabläufe bei der Pflege mitzugestalten. Als Folge dieser Veränderungen in den letzten sechs Jahren ist die Arbeitszufriedenheit zurückgegangen. Hinzu kommt, dass Pflegekräfte noch immer überdurchschnittlich stark von Krankheiten und Gesundheitsstörungen betroffen sind.
Aufgabenvielfalt und Weiterbildungsbedarf im Krankenhaus haben zugenommen, aber auch die Arbeitsbelastungen sind gestiegen, insbesondere Arbeitstempo, Leistungsdruck und Sorgen um den Arbeitsplatz. Gesunken sind auf der anderen Seite die Möglichkeiten, Arbeitsabläufe bei der Pflege mitzugestalten. Als Folge dieser Veränderungen in den letzten sechs Jahren ist die Arbeitszufriedenheit zurückgegangen. Hinzu kommt, dass Pflegekräfte noch immer überdurchschnittlich stark von Krankheiten und Gesundheitsstörungen betroffen sind.
Dies sind wesentliche Befunde des Krankenpflegereport 2005, den die DAK und die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) zum zweiten Mal nach 2000 jetzt vorgelegt haben. Bundesweit wurden 1.300 Krankenschwestern und Pfleger befragt. Der Report wurde mit Unterstützung des Instituts für Gesundheits- und Sozialforschung (IGES) erstellt. Das Institut hat Daten der DAK zur Arbeitsunfähigkeit und der BGW zu Arbeits- und Wegeunfällen sowie Berufskrankheiten ausgewertet.
"Unsere Untersuchung zeigt, dass der tief greifende Strukturwandel in den Krankenhäusern für viele Pflegende mit einem Zuwachs an interessanten Aufgaben und fachlichen Anforderungen verbunden ist. Er geht jedoch auch mit einer Reihe von negativen Veränderungen einher, die wir mit Sorge beobachten", fasst Stephan Brandenburg, BGW-Geschäftsführer, die Ergebnisse zusammen. "Wir haben aber gleichzeitig festgestellt, dass die Arbeitszufriedenheit von Pflegekräften steigt, wenn sie gut informiert und an Entscheidungsprozessen beteiligt werden."
Der aktuelle Report belegt die hohen körperlichen und organisationsbedingten Belastungen, denen Pflegende bei ihrer Tätigkeit ausgesetzt sind. So gab mehr als ein Drittel der Befragten (38%) an, sehr oft unter Zeitdruck zu leiden, 29% haben sehr oft keine Möglichkeit, Pausen einzulegen. Über ein Viertel aller Befragten leistet durchschnittlich mehr als 10 Überstunden im Monat, bei den Pflegekräften mit Leitungsfunktion sind es sogar über 40%. Unzufriedenheit besteht auch bei den Beteiligungs- und Mitsprachemöglichkeiten. Sie werden von den Befragten deutlich schlechter eingestuft als noch 1999. Nur 16 Prozent stimmten zu, dass Beschwerden der Mitarbeiter berücksichtigt werden (1999: 30 Prozent). Lediglich 24 Prozent fühlen sich zum Einbringen von Verbesserungsvorschlägen ermutigt (1999: 39 Prozent).
Auf der DAK-Seite gibt es eine Zusammenfassung der Ergebnisse und auch den kompletten Bericht als PDF-Datei (166 Seiten): DAK-BGW Gesundheitsreport 2005 Stationäre Krankenpflege.
Eine ausführliche Analyse der Arbeitsbedingungen von Pflegekräften nach Einführung der DRGs wurde unlängst auch als GEK-Gesundheitsbericht vorgelegt. Die Studie steht hier zum Download bereit: Gesundheitliche Belastungen, Arbeitsbedingungen und Erwerbsbiographien von Pflegekräften im Krankenhaus. Eine Untersuchung vor dem Hintergrund der DRG-Einführung.
Gerd Marstedt, 2.12.2005
Ärzte als Patienten: Ein Erfahrungsbericht von der "anderen Seite" des Medizinbetriebs
 Interessanterweise gibt es relativ wenige wissenschaftliche Studien oder auch nur Berichte über Ärzte als Patienten. Einige auf Befragungen gestützte Studien zeigten, dass dies u.a. auch daran liegt, dass "mit Ausnahme der Blinddarmoperationen - die Operationshäufigkeit der Gesamtbevölkerung im Vergleich zu der der Ärzte immer deutlich höher liegt, nämlich zwischen 19 und 84 Prozent. Am grössten ist der Unterschied bei Gallenblasen- und Hämorrhoidenentfernung (84 und 83 Prozent); es folgen Gebärmutterentfernung (58 Prozent), Leistenbruchoperationen (53 Prozent) und Mandelentfernungen (46 Prozent). Im Durchschnitt liegt die Operationshäufigkeit bei der Gesamtbevölkerung um 33 Prozent höher als bei den Ärzten."
Interessanterweise gibt es relativ wenige wissenschaftliche Studien oder auch nur Berichte über Ärzte als Patienten. Einige auf Befragungen gestützte Studien zeigten, dass dies u.a. auch daran liegt, dass "mit Ausnahme der Blinddarmoperationen - die Operationshäufigkeit der Gesamtbevölkerung im Vergleich zu der der Ärzte immer deutlich höher liegt, nämlich zwischen 19 und 84 Prozent. Am grössten ist der Unterschied bei Gallenblasen- und Hämorrhoidenentfernung (84 und 83 Prozent); es folgen Gebärmutterentfernung (58 Prozent), Leistenbruchoperationen (53 Prozent) und Mandelentfernungen (46 Prozent). Im Durchschnitt liegt die Operationshäufigkeit bei der Gesamtbevölkerung um 33 Prozent höher als bei den Ärzten."
Was passiert, wenn Ärzte schwer erkranken und beispielsweise als Patient im Krankenhaus liegen, wird äußerst detailliert, konkret und realistisch in einem "Erfahrungsbericht" in der Ausgabe des "Deutschen Ärzteblatt" vom 17. November 2005 geschildert. Unter der Überschrift "Der Arzt im Krankenbette. Ein Plädoyer für mehr Menschlichkeit im Krankenhaus, 'trotz Finanznot und Wirtschaftskrise' " wird die Vorgeschichte und der Krankenhausaufenthalt des "Dr. R." dargestellt. Der Patient ist "der sportliche und immer gesunde, inzwischen pensionierte Chefarzt, der sich nun erstmals selbst mit brennenden Harnblasenschmerzen nachts in seinem Bette wälzt" und nach misslungenen Versuchen der Eigentherapie stationär behandelt werden muss.
Seine Erfahrungen mit der "anderen Seite" des Medizinbetriebs unterscheiden sich praktisch nicht von denen, die nichtärztliche PatientInnen seit Jahren und Jahrzehnten immer wieder berichten. Auch er macht seine negativen Erfahrungen als "Objekt" in hoch technisierten Intensivstationen, mit "kühler Professionalität" des ärztlichen und Pflegepersonals und mit dessen "aufgesetzter Kundenfreundlichkeit" statt "empathischer Zuwedndung, wohlwollendem Zuhören und Hoffnung vermittelnder Ermunterung".
Nach "Verlassen des Bett-Kerkers" steht für Dr. R. fest: "Der Mensch ist kein Apparat und die Klinik kein Reparaturbetrieb." Gegen den "inhumanen blinden Rigorismus" der unter Sparzwängen agieren müssenden Institution Krankenhaus fordert er das "verständnisvolle Gespräch" der anthropologischen Medizin Viktor von Weizäckers.
Bernard Braun, 27.11.2005
Krankenhaus-Report 2005 und Krankenhaus-Barometer veröffentlicht
 Das Wissenschaftliche Institut der Ortskrankenkassen (WidO) hat den jährlich erscheinenden neuen "Krankenhaus Report 2005" jetzt veröffentlicht. "Die Integrationsversorgung ist ein zartes Pflänzchen, das noch viel Pflege braucht, um für die Patienten Früchte zu tragen. Soll ein neuer Versorgungstypus entstehen, der mehr ist als nur eine Kooperation zwischen Krankenhäusern und ambulanten Ärzten, sind noch mehr Ideen, mehr Risikokapital und mehr Zeit nötig." So fassen die Autoren des Krankenhaus-Reports die Situation in den Projekten der integrativen Versorgung zusammen. Die neuen Regelungen zum Aufbau einer integrierten Versorgung hätten noch keine strukturbildende Kraft entwickelt. Zwar sei die Zahl der neu geschlossenen Verträge durchaus beachtlich. Tragende neue Formen der Integration seien aber noch nicht zu erkennen. Dazu seien das spezielle Budgetvolumen und der bisherige Zeitrahmen für die Neuentwicklung noch zu begrenzt. Einige Ergebnisse.
Das Wissenschaftliche Institut der Ortskrankenkassen (WidO) hat den jährlich erscheinenden neuen "Krankenhaus Report 2005" jetzt veröffentlicht. "Die Integrationsversorgung ist ein zartes Pflänzchen, das noch viel Pflege braucht, um für die Patienten Früchte zu tragen. Soll ein neuer Versorgungstypus entstehen, der mehr ist als nur eine Kooperation zwischen Krankenhäusern und ambulanten Ärzten, sind noch mehr Ideen, mehr Risikokapital und mehr Zeit nötig." So fassen die Autoren des Krankenhaus-Reports die Situation in den Projekten der integrativen Versorgung zusammen. Die neuen Regelungen zum Aufbau einer integrierten Versorgung hätten noch keine strukturbildende Kraft entwickelt. Zwar sei die Zahl der neu geschlossenen Verträge durchaus beachtlich. Tragende neue Formen der Integration seien aber noch nicht zu erkennen. Dazu seien das spezielle Budgetvolumen und der bisherige Zeitrahmen für die Neuentwicklung noch zu begrenzt. Einige Ergebnisse.
• Die durchschnittliche Verweildauer lag bei 8,9 Tagen (2002: 9,2 Tage). Die Zahl der Betten betrug 541 901, das entspricht 657 je 100 000 Einwohner (-1,0 Prozent), die Betten waren nur noch zu 77,6 Prozent (2002: 80,1 Prozent) ausgelastet. Die Auslastung liegt damit deutlich unter der Planungsgröße von 85%. In Betten umgerechnet ergibt sich hieraus ein Bettenüberhang von über 47 000 Betten.
• Kreislauf- und Krebserkrankungen sind die häufigsten Gründe für einen Krankenhausaufenthalt in Deutschland (15,9 % bzw. 11,1 %). Bei den Männern dominieren als Einzeldiagnosen die chronische ischämische Herzkrankheit, psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol und der Leistenbruch. Bei den Frauen sind die normale Entbindung, Brustkrebs sowie Herzinsuffizienz die drei führenden Diagnosen.
• Mit 2 197 Krankenhäusern stehen in Deutschland ausreichend Klinikkapazitäten zur Verfügung. Die Zahl der Kliniken sinkt jedoch kontinuierlich: Zwischen 1991 und 2003 ging sie um 8,9% zurück, die Zahl der Betten sogar um 18,6%.
Der Report ist im Buchhandel erhältlich und kostet incl. CD-ROM 49,95 Euro: Jürgen Klauber, Bernt-Peter Robra und Henner Schellschmidt (Hrsg.): Krankenhaus-Report 2005, Schattauer-Verlag, Stuttgart. Präsentiert werden umfangreiche Daten zur Krankenhaus-Versorgung, zur Diagnose-Statistik, Rehabilitations-Daten, Erreichbarkeit von Krankenhäusern, Änderungen in der Diagnosestatistik in Folge der DRG-Einführung. Die wichtigsten Ergebnisse sind hier zusammengefasst: Krankenhaus-Report 2005 erschienen / Schwerpunktthema: Wege zur Integration
Zeitgleich zum "Krankenhaus Report 2005" sind vom Deutschen Krankenhaus Institut (DKI) die Ergebnisse der Umfrage 2005 des Krankenhaus-Barometers veröffentlicht worden. Die Ergebnisse beruhen auf der Befragung einer repräsentativen Stichprobe von allgemeinen Krankenhäusern, die in der Zeit von April bis Juli 2005 durchgeführt wurde. Daran teilgenommen haben insgesamt 319 Krankenhäuser. Bei der Gesamtschau zur wirtschaftlichen Lage zeigt sich nach den Umfrageergebnissen weiterhin ein eher düsteres Bild. So schätzen bundesweit über 40% der teilnehmenden Häuser ihre derzeitige wirtschaftliche Situation als eher unbefriedigend ein. Nur 18% bewerten die Lage als gut und 39% sind unentschieden. Hierbei besteht allerdings ein deutlicher Unterschied in der Beurteilung zwischen Ost und West. Während sich in den neuen Bundesländern nur ein Viertel der Häuser negativ zur Lage äußerte, taten dies in den alten Bundesländern nahezu 45%.
Das Krankenhaus-Barometer bringt viele weitere Befragungsergebnisse zu Investitionen, neuen Arbeitszeitregelungen und Auswertungen zu den Themen Leistungen und Erlöse, Wahlleistungen, Umsatzsteuer 2005, Neue Versorgungsformen, Integrierte Versorgung sowie Personal. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse ist hier:
Ergebnisse der Umfrage 2005 des Krankenhaus-Barometers.
Der komplette Bericht (68 Seiten) kann auch als PDF-Datei kostenlos herunter geladen werden: Krankenhaus Barometer Umfrage 2005
Gerd Marstedt, 23.11.2005
Moderate Entwicklung der künftigen Krankenhauskosten trotz Alterung
 Zum gesundheitspolitischen Standardrepertoire in Deutschland gehört die folgende Argumentationskette: Immer mehr Menschen, die älter und zugleich kränker werden und deren gesundheitliche Versorgung immer schwerer zu finanzieren ist! Ob dies für die künftige Krankenhausbehandlung zutrifft, haben H. Brockmann und J. Gampe in einer im März 2005 als Arbeitspapier des Max Planck-Instituts für demografische Forschung in Rostock veröffentlichten Studie über "The cost of population aging: forecasting future hospital expenses in Germany" genauer untersucht.
Zum gesundheitspolitischen Standardrepertoire in Deutschland gehört die folgende Argumentationskette: Immer mehr Menschen, die älter und zugleich kränker werden und deren gesundheitliche Versorgung immer schwerer zu finanzieren ist! Ob dies für die künftige Krankenhausbehandlung zutrifft, haben H. Brockmann und J. Gampe in einer im März 2005 als Arbeitspapier des Max Planck-Instituts für demografische Forschung in Rostock veröffentlichten Studie über "The cost of population aging: forecasting future hospital expenses in Germany" genauer untersucht.
Mittels komplexer Modellberechnungen kommen sie zu drei interessanten Ergebnissen:
• Zunächst werden die Gesamtausgaben für die stationäre Versorgung bis zum Versterben der deutschen Baby-Boomer-Generation bis zum Zeitraum 2040 bis 2050 ansteigen.
• Zweitens wird der Anstieg der Ausgaben vergleichsweise moderat verlaufen, weil die durchschnittlichen individuellen Kosten wegen der künftig verbesserten Gesundheit abnehmen und der medizinische Fortschritt je nach erreichter Etappe in einem Zirkel der technologischen Entwicklung sowohl treibend aber zunehmend auch bremsend Einfluss auf die Krankenhausausgaben nehmen wird.
• Zuletzt variiert die Zunahme der Kosten je nach Geschlecht und Krankheit signifikant.
Auch wenn die Autorinnen selbst auf manche Unsicherheit solcher Prognosen hinweisen, zeigen sie doch, dass die massiv dramatisierende öffentliche Debatte über die Kosteneffekte der demografischen Entwicklung eine Menge empirische Evidenz gegen sich stehen hat.
Hier finden Sie die PDF-Datei der Prognose-Studie über die Kosten der Alterung
Bernard Braun, 8.8.2005
Mehr Transparenz über Krankenhäuser: Start der strukturierten Qualitätsberichte
 Seit dem 1. August können Patienten und Ärzte online recherchieren, welches Krankenhaus sich in der Region auf die Behandlung eines bestimmten Krankheitsbildes spezialisiert hat, wie oft ein Krankenhaus bestimmte Operationen durchführt und wo die Komplikationsrate in ausgewählten Bereichen besonders gering ist. Erstmalig veröffentlichen die Bundesverbände der Gesetzlichen Krankenkassen sowie der Verband der Privaten Krankenversicherung strukturierte Qualitätsberichte der Krankenhäuser im Internet.
Seit dem 1. August können Patienten und Ärzte online recherchieren, welches Krankenhaus sich in der Region auf die Behandlung eines bestimmten Krankheitsbildes spezialisiert hat, wie oft ein Krankenhaus bestimmte Operationen durchführt und wo die Komplikationsrate in ausgewählten Bereichen besonders gering ist. Erstmalig veröffentlichen die Bundesverbände der Gesetzlichen Krankenkassen sowie der Verband der Privaten Krankenversicherung strukturierte Qualitätsberichte der Krankenhäuser im Internet.
Die Krankenhäuser sind zur Abgabe eines strukturierten Qualitätsberichtes - erstmalig im Jahr 2005 für das Jahr 2004 - gesetzlich verpflichtet. Die Krankenkassenverbände wiederum müssen diese vollständig und unverändert veröffentlichen. Die Kliniken sollen ihren Bericht bis zum 31. August 2005 abgeben, sie werden dann unmittelbar ins Internet eingestellt. Die ersten Berichte sind bereits Anfang August fertiggestellt und online verfügbar.
Die Qualitätsberichte sind nach einem einheitlichen Schema aufgebaut, das zwischen den gesetzlichen Krankenkassen und der privaten Krankenversicherung am 31. Januar 2005 in einer 40-seitigen "Datensatzbeschreibung zur Umsetzung des strukturierten Qualitätsberichts nach § 137 Abs. 1 Satz 3 Nr. 6 SGB V für das Jahr 2005" vereinbart wurde. Danach sollen die Berichte Struktur- und Leistungsdaten sowie Informationen zur Qualitätssicherung enthalten. Die Inhalte sind so aufbereitet, dass sie auch für medizinische Laien verständlich sind.
Die Hauptkritikpunkte an der geschilderten Auswahl von Indikatoren konzentrieren sich auf zwei Punkte: Erstens stützte sich dieser Prozess nicht auf eine Erhebung der Informationsbedürfnisse von Patienten. Zweitens konzentrieren sich die Berichte auf viele Mengenangaben und vernachlässigen die Darstellung der Zusammenhänge von Menge und Qualität oder die Ergebnisqualität der Behandlung. Selbst nach dem Verweis auf 23 dafür geeignete Indikatoren der US-amerikanischen "Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ)" empfehlen die Krankenkassen für den ersten Bericht lediglich drei Indikatoren: Komplikationen bei der Anästhesie, Dekubitus und ausgewählte Infektionen im Krankenhaus.
Die nächsten strukturierten Qualitätsberichte sind erst wieder im Jahr 2007 für das Jahr 2006 zu erstellen.
Bernard Braun, 2.8.2005