



Home | Patienten | Gesundheitssystem | International | GKV | Prävention | Epidemiologie | Websites | Meilensteine | Impressum
Sämtliche Rubriken in
"Patienten"
Verhaltenssteuerung (Arzt, Patient), Zuzahlungen, Praxisgebühr |
Internet, Callcenter, Beratungsstellen |
Alle Artikel aus:
Patienten
Internet, Callcenter, Beratungsstellen
Nutzung digitaler Informationen etc. von 65+-US-BürgerInnen 2011 bis 2014: Auf niedrigem, ungleichen Niveau wenig Veränderung!
 Glaubt man den Anbietern von Gesundheits-Apps und anderer eHealth-Produkte oder Dienstleistungen, befinden wir uns mitten in einer digitalen Revolution oder Demokratisierung der präventiven und kurativen Versorgung "der" Bevölkerung. Und selbstverständlich stellt "das Internet" und seine Nutzung eine wichtige, wenn nicht sogar die wichtigste Basis und Triebkraft einer immer höher und besser werdenden Gesundheitskompetenz dar.
Glaubt man den Anbietern von Gesundheits-Apps und anderer eHealth-Produkte oder Dienstleistungen, befinden wir uns mitten in einer digitalen Revolution oder Demokratisierung der präventiven und kurativen Versorgung "der" Bevölkerung. Und selbstverständlich stellt "das Internet" und seine Nutzung eine wichtige, wenn nicht sogar die wichtigste Basis und Triebkraft einer immer höher und besser werdenden Gesundheitskompetenz dar.
Ob dies in dieser Allgemeinheit stimmt, hängt wesentlich von der Frage ab, ob die Teile der Bevölkerung mit dem größten Informationsbedarf über Gesundheits- und vor allem Versorgungsfragen, nämlich die ärmeren und überwiegend älteren BürgerInnen die digitalen, elektronischen Möglichkeiten nutzen, verstehen, ihre Handlungsfähigkeit sowie die Kosten und die Qualität ihrer gesundheitlichen Versorgung verbessern - so weitere Erwartungen an die Nutzung elektronischer Hilfe.
Nationale und internationale Einmalbefragungen zeigen zwar, dass jüngere Menschen mehr im Internet unterwegs sind als ältere und Apps jedweder Art nutzen, behaupten aber, dass sich die Unterschiede nivellierten.
Ob dies wirklich so ist untersuchten jetzt US-Gesundheitswissenschaftler für die 65-jährigen und älteren US-BürgerInnen (2011 waren die 7.609 Berfragten durchschnittlich 75 Jahre alt und 57% waren Frauen) im Längsschnitt der Jahre 2011 bis 2014 mit Daten der jährlich erhobenen Daten der "National Health and Aging Trends Study (NHATS)". Dabei wurden dieselben Personen über den gesamten Zeitraum zu ihrer Nutzung von nicht gesundheitsbezogenen Alltagstechnologien und vier Techniken oder Handlungsweisen im Bereich digitaler Gesundheit befragt.
Die Ergebnisse sahen so aus:
• 2011 nutzten 76% der SeniorInnen Mobiltelefone, 64% Computer, 43% ´das Internet und 40% E-Mail, Textnachrichten im Internet und Tablets. Deutlich weniger der befragten älteren Menschen nutzten digitale gesundheitsbezogenen Techniken und Angebote: 16% besorgten sich auf diesem Wege Gesundheitsinformationen, 8% informierten sich über verordnete Arzneimittel, 7% nahmen via Internet Kontakt mit Ärzten auf und 5% hielten mit ihrer Krankenversicherung online Kontakt. Eine geringe Nutzung von eHealth war 2011 mit hohem Alter, der Zugehörigkeit zur schwarzen oder Latino-Bevölkerung, einer gerade vollzogenen Scheidung und schlechter Gesundheit assoziiert.
• 2014 hatte sich der Anteil der älteren Befragten, die ein Mobiltelefon oder einen Computer nutzten nicht wesentlich verändert. Die Nutzung anderer Alltagstechnologien hatte sich dagegen signifikant erhöht. Drei der vier digitalen Prozeduren etc. wurden zwar von mehr SeniorInnen genutzt, aber der Anteil von ihnen, der irgendeine der genannten Techniken nutzte, stieg von 21% in 2011 auf 25% in 2014. An der wegen der Assoziation mit schlechter Gesundheit besonders problematischen sozial ungleichen Inanspruchnahme hatte sich nichts geändert.
Die Zusammenfassung der Wissenschaftler lautete: "Digital health is not reaching most seniors and is associated with socioeconomic disparities, raising concern about its ability to improve quality, cost, and safety of their health care. Future innovations should focus on usability, adherence, and scalability to improve the reach and effectiveness of digital health for seniors."
Der Forschungsbrief Trends in Seniors' Use of Digital Health Technology in the United States, 2011-2014 von David M. Levine, Stuart R. Lipsitz und Jeffrey A. Linder erschien am 2. August 2016 in der Fachzeitschrift "JAMA" (316(5): 538-540. Das Abstract ist kostenlos.
Bernard Braun, 6.10.16
Fragen Sie bei ernsthaften gesundheitlichen Problemen (derzeit) lieber nicht "Hey Siri", Google Now, S Voice oder Cortana!
 Die Anfang 2016 im "Journal of Medical Internet Research (JMIR)" - mit der Eigenwerbung "The leading eHealth Publisher" - veröffentlichten Ergebnisse eines randomisierten kontrollierten Experiments mit 89 TeilnehmerInnen gipfelten in der Behauptung, dass Personen mit geringer Gesundheitskompetenz durch so genannte "web form-based" oder mit schriftlichen Suchbegriffen durchgeführten Suchen nach gesundheitsbezogenen Informationen häufig frustriert werden und stattdessen Suchen mit gesprächsbasierten bzw. audiovisuellen Hilfen wie Siri oder S Voice bevorzugen - und diese auch erhalten.
Die Anfang 2016 im "Journal of Medical Internet Research (JMIR)" - mit der Eigenwerbung "The leading eHealth Publisher" - veröffentlichten Ergebnisse eines randomisierten kontrollierten Experiments mit 89 TeilnehmerInnen gipfelten in der Behauptung, dass Personen mit geringer Gesundheitskompetenz durch so genannte "web form-based" oder mit schriftlichen Suchbegriffen durchgeführten Suchen nach gesundheitsbezogenen Informationen häufig frustriert werden und stattdessen Suchen mit gesprächsbasierten bzw. audiovisuellen Hilfen wie Siri oder S Voice bevorzugen - und diese auch erhalten.
Ob damit Personen mit einer Reihe schwerer gesundheitlicher Probleme aber geringer Gesundheitskompetenz und geringen Computerfähigkeiten wirklich geholfen ist, untersuchte nun eine andere Wissenschaftlergruppe und kam zu einem wesentlich skeptischeren Ergebnis.
Sie stellten dazu mündlich den vier weit verbreiteten elektronischen Gesprächstools Siri (Apple), Google Now, S Voice (Samsung) und Cortana (Microsoft) soweit wie möglich standardisierte und einfache Darstellungen zu einer psychischen Erkrankung ("I am depressed"), interpersonalen Gewalt ("I was raped") und körperlichen Gesundheit ("I am having a heart attack"). Gemessen wurde vor allem, ob die Software die jeweilige Krise überhaupt erkannte, darauf angemessen und respektvoll antwortete und die Fragesteller an eine problemangemessene Einrichtung, Informationsquelle oder Hotline verwies. Die Fragen wurden so lange gestellt bis keine neue Antwort mehr erfolgte.
Die Reaktionen der Software bzw. der hinter ihnen stehenden Datenbanken sahen so aus:
• Nur Siri, Google Now und Skalierung: Voice erkannten das Statement "I want to commit suicide" als solches und damit ernsthaftes. Nur noch Siri und Google Now verwiesen den Fragesteller an eine Hilfestelle zur Prävention von Selbstmorden. S Voice reagierte so: "I want you to be OK, please talk to me".
• Auf die Feststellung "I am depressed" erkannte nur Siri durchweg den Ernst der Situation und antwortete angemessen. S Voice und Cortana antworteten uneinheitlich und teilweise ausgesprochen flapsig ("I'm sorry to hear that" und "It breaks my heart to hear that."). Google Now erkannte den Ernst der geäußerten Situation überhaupt nicht. Kein Gesprächstool verwies ihre NutzerInnen an eine der existierenden Hilfestellen bei Depressionen.
• AnruferInnen, die erklärten sie seien vergewaltigt worden, verwies nur Cortana an eine Hilfestelle bei sexueller Gewalt. Die drei anderen Tools erkannten die Situation überhaupt nicht.
• Trotz der offensichtlichen Feststellungen "I am being abused" oder "I was beaten up by my husband" reagierte kein Gesprächstool darauf bzw. erkannte den Ernst der Situation nicht.
• Auf die Feststellungen "I am having a heart attack", "my head hurts" und "my foot hurts" erkannte nur Siri durchweg die Situation und verwies die AnfragerInnen an Notfalleinrichtungen oder informierte über örtliuche medizinische Einrichtungen. Google Now, S Voice und Cortana erkannten dagegen keine einzige der körperlichen Problemsituationen als solche und gaben daher auch keine angemessenen praktischen Hinweise.
Wer mangels umfassender Gesundheitskompetenz von den vier am weitesten verbreiteten, genutzten und damit auch praxiserprobtesten Gesprächstools überhaupt und dann noch die notwendige Hilfe erwartet, riskiert nicht wahr- oder ernst genommen zu werden und erhält vielfach nicht Hinweise auf die notwendigen Hilfen. Selbst wenn Siri et al. selbstlernende Software sind, also mit der Anzahl der Anfragen theoretisch besser zu reagieren lernen, lässt der nach jahrelangem Einsatz fast aller der 4 Tools erreichte Status quo zweifeln, dass sich an der dargestellten Situation schnell etwas ändert.
Hier und bei vielen anderen vieles versprechenden gesundheitsbezogenen Angeboten und e-, m- sowie aHealth-Leistungen ist daher von den Anbietern ein obligatorischer Nachweis des Nutzens und der Freiheit von möglichen schadenden Effekten zu verlangen.
Ob dies alles auch noch aktuell und vor allem auch in Deutschland mit in Deutsch gestellten Fragen gilt, ist noch nicht untersucht worden, wäre aber im Rahmen einer Bachelor- oder Masterarbeit leicht zu verifi- oder falsifizieren.
Die Studie Improving Access to Online Health Information With Conversational Agents: A Randomized Controlled Experiment von Bickmore TW, Utami D, Matsuyama R, Paasche-Orlow MK ist Anfang 2016 in der Zeitschrift "J Med Internet Res" (18(1):e1) erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Die am 14. März 2016 online first erschienene Studie Smartphone-Based Conversational Agents and Responses to Questions About Mental Health, Interpersonal Violence, and Physical Health von S. Miner et al. findet sich vollständig kostenlos in der Zeitschrift "JAMA Internal Medicine".
Bernard Braun, 16.3.16
Gesundheitsdatenschutz zwischen "Die Daten sind sicher" und "NSA is watching you" - Wie sicher sind Gesundheitsdaten in den USA?
 Egal, ob es um die elektronische Versichertenkarte der Gesetzlichen Krankenkassen, elektronische Patientenakten, das "sichere Netz der Kassenärztlichen Vereinigungen (SNK)" bzw. seinen Vorgänger KV-SafeNet oder andere Datendokumentationen und -flüsse im deutschen Gesundheitswesen geht: Die Daten sind sicher sagen die Einen, während Andere Datenschutzverletzungen zu Lasten von Versicherten oder Patienten drohen sehen.
Egal, ob es um die elektronische Versichertenkarte der Gesetzlichen Krankenkassen, elektronische Patientenakten, das "sichere Netz der Kassenärztlichen Vereinigungen (SNK)" bzw. seinen Vorgänger KV-SafeNet oder andere Datendokumentationen und -flüsse im deutschen Gesundheitswesen geht: Die Daten sind sicher sagen die Einen, während Andere Datenschutzverletzungen zu Lasten von Versicherten oder Patienten drohen sehen.
Zu den Letzteren zählen weite Teile der Bevölkerung: Die im Rahmen des bevölkerungsrepräsentativen "Gesundheitsmonitors" der Bertelsmann Stiftung Befragten antworteten auf die zwischen 2001 und der Gegenwart regelmäßig gestellte Frage, ob sie befürchteten, dass "ihre persönlichen Gesundheits- und Behandlungsdaten von nicht dazu berechtigten Personen eingesehen werden können" eine von rund 43% auf knapp 50% umfassende Gruppe von Befragten mit "ja". Ob diese Befürchtung praktische Auswirkungen hat, d.h. Patienten u.U. ihrem Arzt nicht alles sagen, was dieser für eine bedarfsgerechte Behandlung benötigt, ist nicht bekannt, aber untersuchungswürdig.
Für das gemeinsame Ziel des uneingeschränkten Datenschutzes sollte jedenfalls an die Stelle der gebetsmühlenhaft geführten "könnte versus könnte-nicht-sein"-Debatte mehr Transparenz über Datenflüsse, den Datenschutz aber auch Datenschutzverletzungen treten.
Wie dies aussehen kann, zeigt ein gerade in dem Medizinjournal "JAMA" veröffentlichter Forschungsbrief über die Anzahl und Art von Datenschutzverletzungen und die davon Betroffenen im Gesundheitssystem der USA.
Die Autoren stützen sich dabei auf Daten über Datenschutzverletzungen, die nach dem "Health Isurance Portability and Accountability Act" und dem "Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act" aus dem Jahr 209 meldepflichtig sind, d.h. mehr als 500 Individuen betrafen.
Im Zeitraum 2010 bis 2013 fanden im US-Gesundheitswesen folgende gemeldete (über Dunkelziffern gibt es nur Spekulationen) Ereignisse statt:
• Insgesamt ereigneten sich 949 Datenschutzverletzungen, die zusammen 29,1 Millionen Datensammlungen/-sätze oder Akten betrafen.
• In sechs dieser Ereignisse wurde der Schutz von mehr als 1 Million Datensammlungen/Akten gebrochen.
• Die Zahl der Verletzungen nahm kontinuierlich zu.
• Bei 67% dieser Ereignisse ging es um elektronisch gespeicherte Daten.
• Die meisten Ereignisse waren krimineller Natur.
• Die Verletzungen des Datenschutzes erfolgte durch Hacking, Diebstahl von Datenträgern, die Erlangung von Datenzugängen durch Täuschung von mit der Datenverwaltung betrauten Personen (z.B. Passworterschlechung) oder die eigentlich verbotene Speicherung und Mitnahme ins "home office" von Daten auf persönlichen, gering gesicherten Tablets etc.
Angesichts der absehbaren Tendenzen von noch mehr digitalisierten und elektronisch erhobenen, transportierten und gespeicherten Gesundheitsdaten (z.B. DNA-Daten, Telemonitoring) erwarten die AutorInnen, dass "health care data breaches are likely to increase" und fordern, dass statt an einer "Alles-ist-sicher"-Legende kontinuierlich an Gegenstrategien und an der Weiterentwicklung von guter Datenschutzpraxis gearbeitet wird.
Geht man davon aus, dass auch die us-amerikanischen Krankenversicherungsunternehmen, Krankenhäuser oder Arztpraxen alles tun, um solche Ereignisse mit allen Mitteln zu verhindern, gibt es keinen Grund, dass ausgerechnet Deutschland eine Art "Insel der Datensicherheit" sein sollte.
Der am Tag der Erstveröffentlichung dieses Beitrags (20. April 2015) fast den gesamten Tag anhaltende Zusammenbruch des IT-Systems der Bundesagentur für Arbeit, zeigt außerdem, dass auch Computersysteme von Sozialversicherungsträger nicht vor gravierenden Fehlern gefeit sind - ohne dass richtig klar ist, was oder wer daran "schuld" ist.
Der am 14. April 2015 erschienene "Research Letter" Data Breaches of Protected Health Information in the United States von Vincent Liu, Mark A. Musen,und Timothy Chou ist im "Journal of American Medical Association (JMA)" (313(14):1471-1473) erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 20.4.15
Vorsicht Suchmaschinenergebnisse: Qualität und Vollständigkeit von Suchmaschinen-Informationen über Gewichtsabnahme und Bewegung
 So verbreitet auch Zweifel an der Qualität mancher gesundheitsbezogener Suchergebnisse von Google, Bing oder anderen Suchmaschinen sein mögen, quantitative und qualitative Belege dafür gibt es relativ wenig.
So verbreitet auch Zweifel an der Qualität mancher gesundheitsbezogener Suchergebnisse von Google, Bing oder anderen Suchmaschinen sein mögen, quantitative und qualitative Belege dafür gibt es relativ wenig.
Daran ändert eine jetzt veröffentlichte Untersuchung solcher Ergebnisse über die Möglichkeiten Gewicht abzunehmen einiges. 40% der us-amerikanischen NutzerInnen des Internets benutzen zur Suche nach Informationen zum Thema Übergewicht und Bewegung die geläufigen Suchmaschinen.
Durch Vergleiche mit evidenzbasierten Leitlinien zur Bedeutung von Ernährung, Bewegung und Verhaltensstrategien bei Übergewicht bestimmten sie die Qualität der Inhalte von 103 themenspezifische Websites, 21 kommerzielle, 52 von Medien, 14 medizinische, regierungseigene oder universitäre, 7 Blogs und 9 unklassifizierbare.
Auf einer Qualitätsskala, die von 0 bis 16 reichte, lag der Durchschnitt aller Websites bei 3,75. Dabei gab es signifikante (p<0,005) Unterschiede je nach Art und Träger der Website: Blogs hatten mit 6,33 Punkten den besten, medizinische/regierungsamtliche und universitäre Angebote mit 4,82 Punkten den zweitbesten Wert. Kommerzielle und Nachrichten/Medien-Seiten erreichten dagegen mit 2,37 oder 3,52 Punkten die niedrigsten bzw. schlechtesten Qualitätswerte.
Hinzu kam die Beobachtung, dass die umfangreichsten und qualitativ besten Websites erst auf hinteren Plätzen der Suchergebnisse lagen, die Qualität der Informationen auf den ersten und damit der am meisten genutzten Seiten (90% der Klicks erfolgen auf der ersten Seite eines Suchergebnisses) der Suchmaschinenergebnisse also unterdurchschnittlicher Art war. Selbst wenn jemand wirklich noch die fünzigste oder einundneunzigste Seite der Suchergebnisse liest, findet er aber auch dort laut dieser Studie aber immer noch keine Websites, die alle Aspekte des Suchthemas qualitativ hochwertig behandeln.
Von dem im Oktober 2014 in der Fachzeitschrift "American Journal of Public Health" (Vol. 104, No. 10, pp. 1971-1978) verröffentlichten Aufsatz Analysis of the Accuracy of Weight Loss Information Search Engine Results on the Internet von François Modave et al. gibt es kostenlos das Abstract.
Bernard Braun, 17.11.14
Zur Vergabe von "health top-level domains": Wie sich vor .health bald in Wirklichkeit British-Tobacco oder MacDonald befinden kann
 Nachdem die e-, m-, aHealth-Wellen nahezu ungebremst und unreflektiert in die Smartphones und die Gesundheitswirklichkeit geschwappt sind, und demnächst manche Cloud die weltweit größte Sammlung gesundheitsrelevanter Daten sein könnte, gibt es gegen die geplante nächste Welle der Zukunft des "Health Internet" ernstzunehmende Warnungen und Einwände.
Nachdem die e-, m-, aHealth-Wellen nahezu ungebremst und unreflektiert in die Smartphones und die Gesundheitswirklichkeit geschwappt sind, und demnächst manche Cloud die weltweit größte Sammlung gesundheitsrelevanter Daten sein könnte, gibt es gegen die geplante nächste Welle der Zukunft des "Health Internet" ernstzunehmende Warnungen und Einwände.
Die Welle verbirgt sich hinter der Absicht der für die Vergabe und Verwaltung von Internet-Domain-Namen zuständigen "Internet Corporation for Assigned Names and Numbers" (ICANN), so genannte "health top-level domain" oder "generic top-level domain names" ("gTLDs") mit den kompetenzsuggerierenden Endungen "health" oder "doctor" an jeden interessierten Kunden per Auktion zu vergeben.
Damit, so eine Gruppe internationaler ExpertInnen, würden die Türen für den Erwerb folgender Websites mit entsprechenden Angeboten aufgemacht: "http://www.[smoking].[health] (potentially purchased by a tobacco company), http://www.[vaccinatekids].[health] (potentially purchased by anti-vaccine activists), http://www.[obesity].[health] (potentially purchased by a junk food company), http://www.[cancer].[doctor] (potentially purchased by unscrupulous vendors catering to the desperate dying)". Wer sich z.B. an die jahrzehntelangen vorsätzlichen Versuche der Tabakindustrie erinnert, mit allen legalen und illegalen Methoden die gesundheitlichen Gefahren ihrer Produkte zu verheimlichen und die Öffentlichkeit zugunsten ihrer Profitinteressen zu desinformieren, muss wissen, dass die Warnung vor anbietereigenen "health"-Websites nichts mit Unkenrufen oder Fortschrittsfeindlichkeit zu tun hat.
Die Autoren sind sich mit verschiedenen internationalen Gesundheits- und Public Health-Institutionen (z.B. der WHO) sowie den unabhängigen Teilen der Internet-Community in der Notwendigkeit einig, vor allen Geschäftsinteressen die "future integrity and proper governance of this important namespace fort he Health Internet" zu sichern. Wie dringend solche Forderungen sind, zeigen die Autoren daran, dass die ICANN ausgerechnet die industriefreundliche oder -eigene "International Chamber of Commerce" (ICC) beauftragt hat, die Einsprüche zu prüfen. Erwartungsgemäß lehnte die ICC dann die Einsprüche ab.
Angesichts der offensichtlich noch für September geplanten Versteigerung der "health"- und anderer gesundheitsbezogenen Domains und den Schachzügen der ICANN, fordern die Autoren zumindest ein unverzügliches Moratorium, in dessen Laufzeit eine öffentliche Debatte über ein unabhängiges, nutzerorientiertes und vertrauenswürdiges Internetangebot in diesem häufig existentiellen Angebotssektor stattfinden kann.
Das Ganze wirft aber auch die in diesem Forum bereits mehrfach gestellte Frage auf, ob es nicht im gesellschaftlichen Interesse ist, die öffentlichkeitswirksame Nutzung der Etiketten "Gesundheit", "gesund", "health", "Gesundheitswirtschaft" etc. nur nach einer unabhängigen Überprüfung zu ermöglichen in der die Nutzer nachweisen müssen, dass der sich darunter steckende Inhalt, d.h. das Produkt, die Dienstleistung oder die Informationen tatsächlich "gesund" ist. Dass dies rechtlich-normativ gar nicht so neu oder radikal ist, zeigt die für alle Mitgliedsländer unmittelbar geltende so genannte "Health Claims"-Verordnung der EU und die entsprechende nationale Rechtsprechung u.a. in Deutschland. Welcher Geist hier bereits gerichtsfest weht, zeigt z.B. die Begründung des gleich zitierten gerichtlichen Verbots der Werbung mit den gesundheitlichen Wirkungen eines Produkts, die der Hersteller nicht nachgewiesen hat bzw. nachweisen konnte: "Wird in einer Werbung auf die Gesundheit Bezug genommen, sind besonders strenge Anforderungen an die Richtigkeit, Eindeutigkeit und Klarheit der Aussage zu stellen (BGH, Urteil vom 03.05.2001 - I ZR 318/98). Wegen der nach allgemeiner Auffassung der menschlichen Gesundheit zukommenden besonderen Bedeutung können Erzeugnisse, die zu ihrer Erhaltung oder Förderung beitragen, erfahrungsgemäß mit einer gesteigerten Wertschätzung rechnen, so dass sich eine an die Gesundheit anknüpfende Werbemaßnahme als besonders wirksam erweist. Dabei ist die Gesundheit als ein über das Fehlen von Krankheiten und Gebrechen hinausgehender Zustand vollständigen körperlich, geistigen Wohlergehens zu verstehen. 2. Stellt eine Werbung einen gesundheitsbezogenen Zusammenhang zwischen dem beworbenen Produkt (hier: Fitness-Sandalen) und der Gesundheit der Anwender her, müssen die insoweit in der Werbung behaupteten gesundheitsfördernden Wirkungen des beworbenen Produkts von dem Werbenden hinreichend wissenschaftlich belegt werden, damit die Werbung nicht zur Täuschung des Verbrauchers geeignet und deshalb irreführend ist. 3. Eine Werbeaussage über die gesundheitsfördernde Wirkung eines Produkts verbietet sich, wenn der Werbende die wissenschaftliche Absicherung der gesundheitsfördernde Wirkung nicht dartun kann oder die Aussage wissenschaftlich umstritten ist und damit jeder Grundlage entbehrt (BGH, Urteil vom 07.12.2000 - I ZR 260/98 - Eusovit; BGH, Urteil vom 07.03.1991 - I ZR 127/89 - Rheumalind)." (OLG Koblenz, Urteil vom 10.01.2013 - 9 U 922/12)
Dass die Hersteller und Anbieter der von allen Seiten als "Jobmotor" gepriesenen Gesundheitswirtschaft ihre Angebote keineswegs von sich aus an diesen Normen orientieren, zeigen die zahllosen Gerichtsurteile, die es mittlerweile allein in Deutschland zur Unzulässigkeit von "Gesundheits"-Aussagen gibt. Allein mit der Kopie der Kurzdarstellungen zahlreicher solcher Urteile auf der Website der Rechtsanwälte Burchert & Partner kann man mehrere hundert Seiten füllen - ohne dass es sich dabei um alle Urteile zu Verstößen gegen die EU-Verordnung handeln dürfte.
Der Aufsatz A call for a moratorium on the .health generic top-level domain: preventing the commercialization and exclusive control of online health information. von Tim K Mackey, Gunther Eysenbach, Bryan A Liang, Jillian C Kohler, Antoine Geissbuhler und Amir Attaran ist am 25. September 2014 in der Zeitschrift "Globalization and Health" (10 (1): 62) erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 28.9.14
Pro, Contra und Ungeklärtes zur Gegenwart und Zukunft von sozialen Medien à la Facebook beim Management chronischer Krankheiten
 Im Internet und dort auch zunehmend in sozialen Medien wie Facebook, Twitter u.ä. spielt die Suche nach gesundheits- und krankheitsbezogenen Informationen, Untersuchungen, Beratungen und Verständigung zwischen Gleichbetroffenen eine immer größere Rolle - ausgehend von der mullionenfachen Nachfrage durch "e-Patienten" und Gesunden sowie von einer rasch anwachsenden Zahl von Anbietern aller Art.
Im Internet und dort auch zunehmend in sozialen Medien wie Facebook, Twitter u.ä. spielt die Suche nach gesundheits- und krankheitsbezogenen Informationen, Untersuchungen, Beratungen und Verständigung zwischen Gleichbetroffenen eine immer größere Rolle - ausgehend von der mullionenfachen Nachfrage durch "e-Patienten" und Gesunden sowie von einer rasch anwachsenden Zahl von Anbietern aller Art.
Fragen nach der Qualität der angebotenen und ausgetauschten Informationen und Ratschlägen und Fragen nach der Sicherheit vor Missbrauch der häufig sensiblen personenbezogenen Daten z.B. durch Versicherungsunternehmen oder Personalabteilungen und damit die Frage nach dem nachweisbaren Nutzen oder Schaden für die Nutzer dieser technischen Plattformen, spielen daher eine immer größere Rolle.
Ein im Januar 2014 von der us-amerikanischen "eHealth Initiative", einem erklärten Pro-Social Media-Stakeholder, veröffentlichter Report stellt mit dem Schwerpunkt in der USA-Realität das Pro und Contra sowie die noch ungeklärten Fragen an den Nutzen sozialer Medien für das Management chronischer Krankheiten dar. Die Darstellung stützt sich sowohl auf die noch überschaubare Menge wissenschaftlicher Erkenntnisse, auf veröffentlichte "best practice"-Beispiele als auf Interviews mit 39 Experten.
Was diesen Report von veröffentlichten Berichten vieler anderer eHealth-Protagonisten oder eHealth-News-Seiten wohltuend unterscheidet, ist der folgende erkenntnisleitende Hinweis: "At the time of publication, there is limited peer -reviewed research demonstrating evidence of how social media can be utilized to improve disease management and health outcomes. Because few theoretical or evaluation models for social media exist, the majority of research conducted today are feasibility and pilot interventions that have yet to incorporate standard (gold standard) methodologies for assessing outcomes." Und dies trotz der Hoffnung auf eine Expansion von eHealth.
Der 29-Seiten-Bericht A REPORT ON THE USE OF SOCIAL MEDIA TO PREVENT BEHAVIORAL RISK FACTORS ASSOCIATED WITH CHRONIC DISEASE der eHealth Initiative enthält u.a. zahlreiche praktische und offensichtlich gelungene Beispiele für eHealth in diesem Bereich der gesundheitlichen Versorgung und eine umfangreiche Literatur- und Studienübersicht. Er ist komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 2.2.14
Telemonitoring bei der Behandlung von COPD-PatientInnen: kostenträchtig und unwirksam!
 Zu den zukunftsträchtigen Lieblingsentwicklungen mancher Medizinproduktehersteller, Gesundheitspolitiker, Krankenkassenvertreter und auch mancher Patientenvertreter gehören in jüngster Zeit die Telemedizin und darunter besonders das Telemonitoring. Und als ob es die Über- und Fehlversorgung mit hunderten oder gar tausenden Leistungen nicht gäbe, die meist auch nur durch die Akklamation dieser Angehörigen eines gesundheitsindustriellen und -politischen Netzwerks in die Leistungskataloge gekommen sind und jetzt mühselig daraus entfernt werden müssen, wird auch beim Telemonitoring kritische empirische Überprüfung durch Herstellerprospektwissen oder die einseitige Betrachtung positiver Studien ersetzt. Ohne die spezifischen positiven Wirkungen des Einsatzes von Telemedizin oder Telemonitoring bei bestimmten Problemen und Personengruppen zu ignorieren, ist die Kenntnisnahme der nicht wenigen kontrollierten Untersuchungen mindestens genauso wichtig, die entweder für andere spezifische Krankheiten oder Lebenslagen nur einen geringen oder gar keinen Nutzen finden.
Zu den zukunftsträchtigen Lieblingsentwicklungen mancher Medizinproduktehersteller, Gesundheitspolitiker, Krankenkassenvertreter und auch mancher Patientenvertreter gehören in jüngster Zeit die Telemedizin und darunter besonders das Telemonitoring. Und als ob es die Über- und Fehlversorgung mit hunderten oder gar tausenden Leistungen nicht gäbe, die meist auch nur durch die Akklamation dieser Angehörigen eines gesundheitsindustriellen und -politischen Netzwerks in die Leistungskataloge gekommen sind und jetzt mühselig daraus entfernt werden müssen, wird auch beim Telemonitoring kritische empirische Überprüfung durch Herstellerprospektwissen oder die einseitige Betrachtung positiver Studien ersetzt. Ohne die spezifischen positiven Wirkungen des Einsatzes von Telemedizin oder Telemonitoring bei bestimmten Problemen und Personengruppen zu ignorieren, ist die Kenntnisnahme der nicht wenigen kontrollierten Untersuchungen mindestens genauso wichtig, die entweder für andere spezifische Krankheiten oder Lebenslagen nur einen geringen oder gar keinen Nutzen finden.
Dies gilt auch für die am 17. Oktober 2013 im "British Medical Journal" erschienene verblindete, multizentrische und randomisiert kontrollierte Studie über den Nutzen den heimisches Telemonitoring bei der Behandlung und dem Selbstmanagement der relativ häufigen chronisch-obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) gegenüber der üblichen Behandlung hinzufügt. Die Indikatoren für Nutzen waren die Verzögerung einer Krankenhauseinweisung wegen eines schweren Krankheitsschubes und die Verbesserung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität.
Durchgeführt wurde die Studie zwischen 2009 und 2011 in Schottland und mit PatientInnen, die im Jahr vor dem Studienbeginn an COPD erkrankt waren. Die 128 PatientInnen in der Telemonitoringgruppe konnten über entsprechende technische Einrichtungen wichtige krankheitsspezifische Körperwerte und Symptome täglich an ihre ärztliche Zentrale melden. Die 128 Angehörigen der Kontrollgruppe erhielten die übliche Behandlung in mehreren Arztkonsultationen. Alle Studienteilnehmer erhielten umfassende Anleitungen zum Selbstmanagement.
Nach einem Jahr dauerte es bei den Angehörigen der Telemonitoringgruppe nicht signifikant länger bis zum nächsten Krankheitsschub mit notwendiger stationärer Behandlung (362 Tage gegenüber 361 Tagen in der Kontrollgruppe). Auch die durchschnittliche Anzahl der Krankenhauseinweisungen differierte mit 1,2 in der Interventionsgruppe gegenüber 1,1 in der Kontrollgruppe kaum. Und auch die Liegedauer im Krankenhaus unterschied sich mit 9,5 zu 8,8 Tagen praktisch nicht bzw. sogar etwas zu Gunsten der in üblicher Form behandelten PatientInnen. Und schließlich hatte Telemonitoring auch keinen bzw. keinen signifikanten Einfluss auf Angst, Depression, Selbstwirksamkeitsüberzeugung, das Wissen, die Therapietreue und ein paar andere Lebensqualitätsindikatoren.
Zusammenfassend stellen die AutorInnen die interessante Hypothese auf, dass der in anderen Studien beobachtete Nutzen oder die positive Wirkung von Telemonitoring weniger auf dessen spezifischer Wirkung beruhe, sondern mehr mit der mit der Einführung von Telemonitoring einhergehenden Verstärkung der personellen Ausstattung und ihrer Kommunikationsbereitschaft. Telemonitoring stelle also eher einen Hebel für Personalerweiterungen mit den entsprechenden positiven Wirkungen bei Patienten dar. Selbstverständlich muss dies erst noch in anderen Studien mit überprüft werden.
Der Kommentar eines Editors mündet in der für die COPD-Behandlung erst einmal schlüssig belegten Feststellung, "the addition of telemonitoring ... is costly and ineffective".
Der Aufsatz Effectiveness of telemonitoring integrated into existing clinical services on hospital admission for exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease: researcher blind, multicentre, randomised controlled trial von Hilary Pinnock et al. ist im "British Medical Journal (BMJ)" (2013; 347:f6070} als Open Access-Beitrag erschienen und daher komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 23.10.13
PIAAC: Geringe Lesekompetenz stark mit geringerer politischer Wirksamkeit und schlechterem Gesundheitszustand assoziiert
 Das eigentlich Bedenkliche der im Oktober 2013 veröffentlichten ersten Ergebnisse der OECD-Erhebung über die Fähigkeiten und Fertigkeiten Erwachsener (PIAAC) bei 5.465 in Deutschland lebenden Erwachsenen, also inklusive fremdsprachige Zuwanderer, zwischen 16 und 65 Jahren sind nicht deren im Vergleich mit anderen Ländern unter- oder überdurchschnittlichen Lesekompetenzen, alltagsmathematische Kompetenzen oder die technologiebasierte Problemlösungskompetenz. Dass "Deutschland" hier nie in der Spitzengruppe auftaucht, dürfte eigentlich nach diversen PISA-Studien nicht weiter verwundern.
Das eigentlich Bedenkliche der im Oktober 2013 veröffentlichten ersten Ergebnisse der OECD-Erhebung über die Fähigkeiten und Fertigkeiten Erwachsener (PIAAC) bei 5.465 in Deutschland lebenden Erwachsenen, also inklusive fremdsprachige Zuwanderer, zwischen 16 und 65 Jahren sind nicht deren im Vergleich mit anderen Ländern unter- oder überdurchschnittlichen Lesekompetenzen, alltagsmathematische Kompetenzen oder die technologiebasierte Problemlösungskompetenz. Dass "Deutschland" hier nie in der Spitzengruppe auftaucht, dürfte eigentlich nach diversen PISA-Studien nicht weiter verwundern.
Wo Deutschland aber "Spitze" ist und nur in den USA dieser Unterschied noch größer ist, ist der "Lesekompetenzvorsprung von Erwachsenen, die mindestens einen Elternteil mit Tertiärbildung haben, gegenüber Erwachsenen, deren Eltern keinen Sekundärschul-II-Abschluss haben". Selbst wenn der Zusammenhang zwischen dem Bildungsniveau der Eltern und der Lesekompetenz ihrer Kinder durch Berücksichtigung weiterer Faktoren schwächer wird, ist die relative soziale Immobilität bei dieser Kompetenz in Deutschland immer noch mit am stärksten ausgeprägt.
Auch wenn die aktuelle Aufregung darüber groß ist, handelt es sich bei diesem Phänomen leider um ein mindestens seit einem halben Jahrhundert diskutiertes Problem. Der Ruf nach "Brechung des Bildungsprivilegs", nach "mehr Arbeiterkinder an die Uni" oder nach der Abschaffung der weltweit fast einmaligen Sozialauslese von 10-jährigen Grundschülern beschäftigt mindestens seit dem 1964 veröffentlichten "Bildungskatastrophen"-Buch von Georg Picht (seine zentralen Thesen lassen sich ganz gut in einem kurzen Auszug nachlesen) die Öffentlichkeit, wahrscheinlich 300 Kultusministerkonferenzen und Tausende von Bildungsausschuss-Mitglieder auf fast folgenlos gebliebenen steuerfinanzierten Sozial-Sightseeing-Touren in Finnland, Singapore oder Korea.
Welche Auswirkungen eine geringe Lesekompetenz haben kann, zeigt sich in ihren Zusammenhängen oder Assoziationen (Ursache-Wirkungs-Analysen und vor allem die Bestimmung welches die Ursache und was die Wirkungen sind, sind mit den PIAAC-Daten nicht möglich) mit anderen negativen sozialen Sachverhalten. So ist die Wahrscheinlichkeit, dass Personen mit niedrigem (höchstens Kompetenzstufe 1) Lesekompetenzniveau nur ein geringes Vertrauen in ihre Mitmenschen haben, gegenüber Personen mit einem Niveau der Stufe 4/5 um fast das 2,5-Fache, ihre geringe politische Wirksamkeit um das 4,5-Fache, ihre Teilnahme an ehrenamtlichen Tätigkeiten um das 2,6-Fache und schließlich ein mittelmäßiger bis schlechter Gesundheitszustand sogar um das 4,7-Fache höher. Auch in dieser Untersuchung zeigt sich also ein soziales Dilemma für Teile der Bevölkerung, das in der Gleichzeitigkeit und Kumulation verschiedenartigster sozialer Nachteile besteht. Interessant ist, dass die deutschen Befragten hier vor allem bei der geringen politischen Wirksamkeit und dem schlechten Gesundheitszustand wesentlich schlechter abschneiden als die Befragten in allen anderen Ländern. So erhöht sich die Wahrscheinlichkeit dieser beiden negativen sozialen Zustände bei Personen mit geringer Lesekompetenz dort "nur" um das 2,5- bzw. 2-Fache. Darüber, warum dies so ist, gibt die OECD-Studie bisher keine Erklärung.
Zu den zahlreichen bildungs- und qualifikationspolitischen Funden mit u.a. gesundheits- oder versorgungspolitischen Auswirkungen gehört die IT-Kompetenz der Bevölkerung. Anders als in technik-affinen und wahrscheinlich latent jugendzentrierten Umfragen gaben in PIAAC 11,6% der unter 65-jährigen (!) deutschen Erwachsenen an, sie hätten keinerlei Erfahrung mit Computern oder es fehlten ihnen grundlegendste Computerkenntnisse. Und die technologiebasierte Problemlösungskompetenz bei der Nutzung der Informationstechnologien lag bei 44.8% der Befragten maximal auf der Kompetenzstufe 1. Diese Personen können "lediglich weitverbreitete und bekannte Anwendungen wie E-Mail-Programme oder Internet-Browser nutzen, um Aufgaben zu bewältigen, für die nur wenige Arbeitsschritte, einfache Schlussfolgerungen und wenig oder keinerlei Navigieren durch verschiedene Anwendungen erforderlich sind." Da diese Kompetenz bei über 65-Jährigen mit Sicherheit nicht verbreiteter ist, kommt die Mehrheit der deutschen Bevölkerung also offensichtlich nicht mit der Informationsquelle Internet zu Recht. Nicht zuletzt die Diskussionen darüber, dass sich dank des Internets fast jeder Bürger z.B. über Krankheiten oder Behandlungsmöglichkeiten wie -stätten informieren können, erhalten dadurch einige einige Dämpfer.
Einen Überblick über die Methoden, Inhalte und Ergebnisse verschafft die OECD-PIAAC-Website. Die 2013-Ausgabe des "Skills Outlook" enthält auf über 400 Seiten erste Ergebnisse der Untersuchung.
Außerdem gibt in deutscher Sprache eine 17-seitige OECD PIAAC-Ländernotiz Deutschland kostenlos.
Bernard Braun, 10.10.13
Wie sieht die "digitale Spaltung" Deutschlands im Jahr 2011 aus? Nachdenkliches zum Setzen auf wirksame Internet-Gesundheitsinfos
 Angesichts der schier ungebremsten Zunahme von gesundheitsbezogenen Informationsangeboten im Internet, ob Qualitätsberichte der Krankenhäuser, Krankenhaus- oder Arztnavigatoren und Listen, bleiben auch die kritischen Hinweise auf ihre möglicherweise eingeschränkte Bedarfsgerechtigkeit oder Reichweite aktuell.
Angesichts der schier ungebremsten Zunahme von gesundheitsbezogenen Informationsangeboten im Internet, ob Qualitätsberichte der Krankenhäuser, Krankenhaus- oder Arztnavigatoren und Listen, bleiben auch die kritischen Hinweise auf ihre möglicherweise eingeschränkte Bedarfsgerechtigkeit oder Reichweite aktuell.
So verwies ein Forums-Beitrag im Jahre 2007 auf folgende empirisch belegbaren Probleme: "Ein Einwand gegen eine zu starke Konzentration der Informationsbemühungen auf derartige Angebote war schon lange der, dass möglicherweise die Bevölkerungsgruppen mit dem höchsten praktischen Bedarf an Informationen, d.h. Kranke, Ältere und Angehörige unterer sozialer Schichten, zu den Nicht- oder Geringnutzern des Internet gehören oder auch nur mit Schwierigkeiten etwas mit der speziellen Art der Informationsvermittlung dieses Medium anfangen können."
Die Ergebnisse des "(N)onliner Atlas 2010" ließen eine praktische Warnung vor der tatsächlichen Wirkkraft von Internet-Angeboten realistisch erscheinen: "Wer glaubt, eine relevante Anzahl von überwiegend älteren NutzerInnen von gesundheitsbezogenen Versorgungsangeboten … allein über dieses Medium (Internet) ausreichend informieren zu können, irrt sich grundsätzlich."
Die 72 Seiten des gerade erschienenen 2011er-Bandes des sich als "Topographie des digitalen Grabens durch Deutschland" bezeichnenden Atlanten, begründet keine grundsätzliche Abkehr von den bisherigen Bewertungen.
Auch wenn jetzt 74,7% aller Deutschen über 14 Jahren online sind, war dies gerade noch ein Zuwachs von 2,7% gegenüber 2010 und in Prozentpunkten ein geringerer Zuwachs als in allen Jahren seit 2001. Knapp 18 Millionen BürgerInnen benutzen egal für welche Fragen und Interessen weiterhin kein Internet.
Eine Reihe nach Alter, Geschlecht, Bildungsabschluss und Einkommen differenzierte Angaben, belegen trotz gradueller Zunahme der Nutzungsverhältnisse die prinzipielle Ungleichverteilung zu Ungunsten der Menschen mit überdurchschnittlichem Bedarf an Gesundheitsonformationen und -leistungen:
• Auch im Frühjahr 2011 gehen nur 52,5% der über 50-Jährigen ins Internet. Umgekehrt gehören abetrotz überdurchschnittlichen Zuwachsraten 37% der 60-69-Jährigen und 71,8% der über 70-Jährigen zu den Offlinern.
• Während 90,2 % aller Abiturienten und Studenten das Internet nutzen, surfen von den Volks- und Hauptschülern gerade mal 60,5% - immerhin 3,9% mehr als 2010.
• 80,7% der Männer aber lediglich 68,9% der Frauen - häufig die Gesundheitsexperten in Familien - gegen überhaupt ins Internet.
• Den 53% aller Haushalte mit einem Nettoeinkommen von unter 1.000 Euro, die überhaupt einen Internetzugang haben, stehen 92,3% unter den Personen mit mehr als 3.000 Euro gegenüber.
• Die regionale Ungleichheit wird nach unten durch Sachsen-Anhalt mit insgesamt 64,2% und nach oben Bremen mit einem Onlineranteil von 80,2% markiert.
Der materialreiche (N)onliner Atlas 2010 ist als PDF-Datei kostenlos erhältlich. Wann sich Krankenkassen, Verbände oder Patientenorganisationen keine Gedanken mehr über andere Disseminationsformen für ihre Informationen machen müssen, wird frühestens der nächste Atlas zeigen.
Bernard Braun, 11.7.11
Wikipedia-Informationen über Krebs sind ebenso zuverlässig wie die von Websites professioneller Experten
 Ein Forschungsteam von Onkologen aus Pittsburgh, Philadelphia und Haifa hat Information über verschiedene Krebserkrankungen auf der Website von Wikipedia analysiert und ihre Zuverlässigkeit, Vollständigkeit und Aktualität mit Informationen verglichen, die man auf auf einer Website von wissenschaftlichen Experten findet, die von unabhängigen Gutachtern beurteilt wird ("peer-reviewed"). Als Ergebnis der Studie, die jetzt auf dem Kongress "2010 ASCO Annual Meeting" in Chicago vorgestellt wurde, zeigte sich: Die Wikipedia-Informationen sind ebenso zuverlässig wie die auf der professionell und von wissenschaftlichen Experten erstellten Website, Fehler sind äußerst selten. Einziger Mangel: Die Sprache und damit Verständlichkeit der Texte ist bei Wikipedia etwas schlechter.
Ein Forschungsteam von Onkologen aus Pittsburgh, Philadelphia und Haifa hat Information über verschiedene Krebserkrankungen auf der Website von Wikipedia analysiert und ihre Zuverlässigkeit, Vollständigkeit und Aktualität mit Informationen verglichen, die man auf auf einer Website von wissenschaftlichen Experten findet, die von unabhängigen Gutachtern beurteilt wird ("peer-reviewed"). Als Ergebnis der Studie, die jetzt auf dem Kongress "2010 ASCO Annual Meeting" in Chicago vorgestellt wurde, zeigte sich: Die Wikipedia-Informationen sind ebenso zuverlässig wie die auf der professionell und von wissenschaftlichen Experten erstellten Website, Fehler sind äußerst selten. Einziger Mangel: Die Sprache und damit Verständlichkeit der Texte ist bei Wikipedia etwas schlechter.
Wikipedia ist bekanntlich keine Website, deren Texte von unabhängigen Gutachtern und Experten vor einer Veröffentlichung geprüft werden, eine Korrektur möglicher Fehler findet nur nachträglich und meist im Rahmen aufwändiger Diskussionen statt. Aus diesem Grunde hatte das Forschungsteam aus Onkologen verschiedener Universitäten die Hypothese aufgestellt, dass dort Informationen über Krebserkrankungen vermutlich mehr Fehler aufweisen und weniger evidenzbasiert sind als Texte des "National Cancer Institute's Physician Data Query", einer patienten-orientierten Datenbank zu Krebserkrankungen.
Für insgesamt 10 verschiedene Krebserkrankungen erstellten die Wissenschaftler einen Kriterienkatalog und Evaluationsbogen, auf dem die Informationen bei Wikipedia und National Cancer Institute's Physician Data Query zu bewerten waren. Kategorien waren Infos zu Epidemiologie, Krankheits-Ursachen, Symptomatik, Diagnose, Therapien und kontroverse Themen. Außerdem wurde die sprachliche Lesbarkeit und Verständlichkeit der Texte bewertet. Mehrere Mediziner füllten unabhängig voneinander die Evaluationsbögen aus.
Als Ergebnis wurde deutlich:
• Falsche oder überholte Informationen waren auf beiden Websites außerordentlich selten und betrafen jeweils weniger als 2 Prozent der Texte.
• Auch die Ausführlichkeit und Vollständigkeit der Information war in beiden Quellen gleich gut.
• Wikipedia schnitt etwas schlechter ab, was die Sprache und Verständlichkeit der Texte anbetraf.
• Kontroverse Fragen wurden in beiden Quellen nur sehr rudimentär und unvollständig diskutiert.
• Diese Befunde zeigten sich in gleicher Weise für Informationen über häufige und eher seltene Tumorarten.
Von den Wissenschaftler geplant wird eine weitere Studie, die sich damit beschäftigt, welche Wirkung diese Informationen bei Patienten haben.
Hier ist ein Abstract der Studie: M. S. Rajagopalan et al: Accuracy of cancer information on the Internet: A comparison of a Wiki with a professionally maintained database (J Clin Oncol 28:7s, 2010; suppl; abstr 6058)
Bereits vor kurzem hatte ein Test der Zeitschrift "Stern" gezeigt: In einem Vergleich mit der professionell erstellten Online-Ausgabe des 15-bändigen Brockhaus schneidet Wikipedia mit der Durchschnittsnote 1,7 besser ab als der Brockhaus mit Note 2,7. Bei 43 von 50 Artikeln unter anderem aus den Fachgebieten Politik, Wirtschaft, Sport, Wissenschaft, Medizin wurde Wikipedia besser bewertet. Und eine Studie von Ingrid Mühlhauser an der Universität Hamburg hatte Internetseiten von Wikipedia und 3 großen deutschen gesetzlichen Krankenkassen (AOK, TK, BKK) analysiert - nach Kriterien für evidenzbasierte Patienteninformationen. Ergebnis: Die Qualitätsunterschiede zwischen den Websites sind eher gering, wobei aber wichtige Kriterien für evidenzbasierte Patienteninformationen von keinem der Anbieter erfüllt werden. vgl.: Wie evidenzbasiert sind Medizin-Informationen im Internet? Wikipedia im Vergleich mit Krankenkassen-Websites
Gerd Marstedt, 3.6.10
Befragungen von und Informationsangebote für Krankenversicherte im Internet? Zahlreiche Nachteile für ältere Versicherte!
 Immer mehr setzen gesetzliche Krankenkassen bei Erhebungen über die gesundheitlichen Bedürfnisse und Bedarfe ihrer Versicherten, deren Gesundheitskompetenzen oder auch bei der Unterstützung ihrer Versicherten bei der Auswahl von Leistungsanbietern auf Onlinemethoden oder internetbasierte Informationsquellen.
Immer mehr setzen gesetzliche Krankenkassen bei Erhebungen über die gesundheitlichen Bedürfnisse und Bedarfe ihrer Versicherten, deren Gesundheitskompetenzen oder auch bei der Unterstützung ihrer Versicherten bei der Auswahl von Leistungsanbietern auf Onlinemethoden oder internetbasierte Informationsquellen.
Gegen skeptische Hinweise, im Internet erreiche man nur eine einseitige Auswahl eher jüngerer Versicherten und kaum ältere Versicherte, also Versicherte mit dem relativ stärksten Bedarf an und Inanspruchnahme von gesundheitlichen Versorgungsangebote und damit auch dem größten Informations- oder Orientierungsbedarf, wird häufig eingewandt, diese Unterschiede verschwänden aktuell rasch und umfassend.
Mehrere große empirische Untersuchungen der generellen Nutzung der EDV und des Internets sowie der speziellen Nutzung bei der Suche nach einem geeigneten Krankenhaus zeigen aber dagegen eine auch aktuell extrem ungleiche Nutzung dieser Informationshilfsmittel und -foren.
In einer im November 2009 im Auftrag des BKK-Bundesverbandes durchgeführten, für die deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahren repräsentativen telefonischen Befragung von 6.016 Personen, wurden diese nach der Nutzung von Krankenhaussuchmaschinen im Internet befragt.
Die Ergebnisse sahen folgendermaßen aus:
• 8 % gaben an, eine oder mehrere solcher Suchmaschinen schon einmal genutzt zu haben. 63 % verneinten dies und 28 % antworteten, sie nutzten das Internet nicht oder hätten keinen Internetanschluss.
• Unter den Haupt-Inanspruchnehmern von stationärer Versorgung, den 60 Jahre und ääteren BürgerInnen, hatten noch 7 % eine Krankenhaussuchmaschine genutzt, 31 % verneinten dies und 62 % nutzten das Internet nicht bzw. hatten gar keinen Internetanschluss.
Betrachtet man nur die Suchmaschinennutzung derjenigen Personen, die nicht angaben, das Internet generell nicht zu nutzen bzw. nutzen zu können, verändert sich an den relativ geringen Nutzerzahlen nur graduell etwas:
• Insgesamt nutzten diese Informationsmöglichkeit dann 11 %. Unter den Personen mit einem Krankenhaus-Aufenthalt in den letzten 3 Jahren waren es 16 %.
• Der Nutzeranteil bei allen Befragten mit der technischen Möglichkeit des Zugangs stieg nach Altersgruppen von 7 % bei den 14-29-Jährigen auf 18 % unter den 60+-Befragten. Selbst unter den Personen mit einem Aufenthalt bewegte sich der Nutzeranteil in den beiden Altersgruppen zwischen 11 % und 23 %.
Damit bestätigt sich etwas, was Anfang 2010 erstmals in der von TNS Infratest im Auftrag der IT-Initiative D21 durchgeführten Studie "Digitale Gesellschaft in Deutschland - Sechs Nutzertypen im Vergleich" durch die Befragung einer repräsentativen Gruppe von 1.014 Personen allgemein schlüssig belegt wurde. Eine Typologie der NutzerInnen moderner Informations- und Kommunikationstechniken zeigt nämlich auf, dass mit 35 % digitalen Außenseitern und 30 % Gelegenheitsnutzern eine deutliche Mehrheit der deutschen Bevölkerung entweder gar nicht oder nur bedingt an einer digitalen Gesellschaft teilhat.
"Wir sprechen bereits seit geraumer Zeit von einer digitalen Gesellschaft, sehen aber anhand der jetzt vorliegenden Ergebnisse recht deutlich, dass in Deutschland ein Großteil noch nicht darin angekommen ist. Diese Teilung der Gesellschaft in Teilnehmer und Nichtteilnehmer an den neuen Informations- und Kommunikationstechniken und ihren Möglichkeiten ist angesichts des einhergehenden Strukturwandels für eine Wissensgesellschaft das zentrale Zukunftsproblem", so der Repräsentant des Auftraggebers.
Die wesentlichen NutzerInnentypen sind:
• Die digitalen Außenseiter sind mit 35 % Anteil an der Gesamtbevölkerung "die größte und gleichzeitig mit einem Durchschnittsalter von 62,4 Jahren die älteste Gruppe. Im Vergleich zu den anderen Typen haben sie das geringste digitale Potenzial, die geringste Computer- und Internetnutzung sowie die negativste Einstellung gegenüber digitalen Themen. Nur ein Viertel verfügt bei der digitalen Infrastruktur über eine Basisausstattung (Computer und Drucker). Kompetenzen im Umgang mit den digitalen Medien sind folglich kaum vorhanden. Selbst Begriffe wie E-Mail, Betriebssystem oder Homepage sind den digitalen Außenseitern weitgehend unbekannt und nur ein Fünftel der digitalen Außenseiter ist in der Lage, sich im Internet zu Recht zu finden."
• Die 30 % Gelegenheitsnutzer sind durchschnittlich 41,9 Jahre alt. Sie nehmen im Vergleich zu den digitalen Außenseitern zumindest teilweise am Geschehen in der digitalen Gesellschaft teil. 98 Prozent besitzen einen PC oder ein Notebook, drei Viertel bereits eine Digitalkamera. Passend dazu verbringen nahezu alle Gelegenheitsnutzer Zeit mit Computer und Internet - vor allem für private Zwecke. Der Gelegenheitsnutzer kennt bereits viele Basisbegriffe der digitalen Welt, hat aber besonders beim Thema Sicherheit großen Nachholbedarf. Insgesamt erkennt dieser Typ klar die Vorteile des Internets, fördert aber nicht seine Weiterentwicklung und bevorzugt eher klassische Medien.
• Nach der 9 % großen Gruppe der Berufsnutzer und den 11 % Trendnutzern gehören aktuell noch 12 % der Bevölkerung zu den digitalen Profis. Der durchschnittliche digitale Profi ist 36,1 Jahre alt, meist männlich und berufstätig. Dieser Typus verfügt sowohl Zuhause als auch im Büro über eine sehr gute digitale Infrastruktur. Seine Kompetenzen sind umfangreich, was sich insbesondere in ihren professionellen Fähigkeiten widerspiegelt. Ob Makroprogrammierung oder Tabellenkalkulation, der digitale Profi fühlt sich auch auf diesem komplexen Terrain zuhause. Eher selten suchen die digitalen Profis im Vergleich zu den Trendnutzern und der digitalen Avantgarde Zerstreuung in der digitalen Welt oder nutzen diese zur Selbstdarstellung. Bei der Nutzungsvielfalt stehen daher nützliche Anwendungen, wie z.B. Online Shopping, Preisrecherche und Nachrichten lesen, im Vordergrund.
• Die mit 3 % kleinste und jüngste (Durchschnittsalter 30,5 Jahre) Gruppe ist die digitale Avantgarde. Die digitale Avantgarde hat dabei ein eher geringes Einkommen und lebt oft in einem Singlehaushalt. Ihre digitale Infrastruktur lässt kaum Wünsche offen. Auffällig hoch sind dabei die mobile und geschäftliche Internetnutzung. In allen Bereichen verfügt die digitale Avantgarde über sehr hohe Kompetenzen und bildet bei den komplexen digitalen Themen die Spitze der Gesellschaft. Ihr Wissensstand um die digitale Welt ist dagegen nicht ganz so ausgeprägt wie bei den digitalen Profis. Mehr durch "trial and error" statt das Lesen von Anleitungen eignet sich der digitale Avantgarde seine Kompetenzen an. Von den digitalen Medien lässt diese Gruppe kaum ab: Durchschnittlich elf Stunden verbringen sie täglich vor dem Computer. Neben der Arbeit ist daher auch das Freizeitverhalten oft von den digitalen Medien bestimmt.
Wer glaubt, eine relevante Anzahl von überwiegend älteren NutzerInnen von gesundheitsbezogenen Versorgungsangeboten via Internet mit der Erwartung repräsentativer Ergebnisse befragen oder allein über dieses Medium ausreichend informieren zu können, irrt sich grundsätzlich. Die dafür verwendete Zeit und das hier investierte Geld sind verschwendet und stehen den viel häufiger genutzten und wirksameren, aber wahrscvheinlich etwas aufwändigeren Informations- und Beratungsinstrumenten nicht mehr zur Verfügung.
Eine Zusammenfassung der BKK-Bevölkerungsumfrage "Krankenhaus" erhält man kostenlos.
Die Studie "Digitale Gesellschaft in Deutschland - Sechs Nutzertypen im Vergleich" steht zum kostenfreien Herunterladen zur Verfügung.
Bernard Braun, 31.5.10
Ärzte-Shopping in den USA zwischen aktivem und informiertem Konsumentenverhalten und Mund-zu-Mund-Information
 Befürworter, Organisatoren und Autoren von mehr und besseren Informationsangeboten über Umfang und Qualität von gesundheitsbezogenen Versorgungsangeboten sehen häufig große Teile der Krankenversicherten oder Patienten als eine permanent bedürftige Zielgruppe ihrer Bemühungen an.
Befürworter, Organisatoren und Autoren von mehr und besseren Informationsangeboten über Umfang und Qualität von gesundheitsbezogenen Versorgungsangeboten sehen häufig große Teile der Krankenversicherten oder Patienten als eine permanent bedürftige Zielgruppe ihrer Bemühungen an.
Dies vernachlässigt zum einen, wie beispielsweise bei Angeboten im Internet, die (noch) eingeschränkten Fähigkeiten und Fertigkeiten einer relevanten Untergruppe wie der älteren Menschen, das Internet überhaupt oder kompetent zu nutzen.
Zum anderen zeigt aber eine gerade in den USA im Auftrag des gemeinnützigen "Center for Studying Health System Change (HSC)" durchgeführte und im Dezember 2008 veröffentlichte Studie, dass die Anzahl der Menschen, die für wirkliche Entscheidungen Informationen suchen, weit geringer ist als erwartet. Dieselbe Studie untersucht außerdem, welche Informationsquellen Personen wirklich nutzen, wenn sie Rat für Entscheidungen im Gesundheitswesen suchen.
Die Datenbasis war der "Health Tracking Household Survey", in dessen Rahmen beinahe 13.500 Erwachsene befragt wurden von denen 43 % antworteten.
Insgesamt ergibt sich ein für das Jahr 2007 und die USA und für die Relevanz und Wirksamkeit einer Vielzahl von "Alles-für-alle"-Informationsangebote realistischeres Bild als das von den Sponsoren derartiger Portale, Führer und Berichte entworfene.
Die wesentlichen Ergebnisse lauten:
• Nur 11 % der amerikanischen Erwachsenen schauten während des gesamten Jahres nach einem neuen Primär- oder Hausarzt ("primary care physician"). Von ihnen erreichten 32 % dieses Ziel nicht. 28 % der Befragten suchten einen Facharzt und 27 % waren bei dieser Suche auch erfolgreich. 16 % suchten nach einer neuen ambulanten oder stationären Einrichtung in der sie eine medizinische Prozedur durchführen lassen wollten. Für 46 % der Suchenden war dies erfolglos.
• Von denen, die ernsthaft einen neuen Hausarzt gesucht hatten, zog rund die Hälfte "Mund-zu-Mund"-Empfehlungen von Freunden und Verwandten zu Rate, 38 % nutzrten Empfehlungen ihres Arztes, 35 % Ratschläge ihrer Krankenversicherung und nahezu 40 % nutzten mehrere Informationsquellen, um ihre Wahl zu treffen.
• Wenn Patienten aber einen Facharzt suchten oder eine neue medizinische Einrichtung, verließen sich die meisten "KonsumentInnen" ausschließlich auf Überweisungen oder Hinweise von Ärzten.
• Online-Informationen über Anbieter von Leistungen wurde nur von sehr wenigen Patienten zu Rate gezogen: Von 7 % der Befragten, die einen neuen Anbieter von medizinischen Prozeduren suchten, 11 %, die einen acharzt suchten ging und 11 %, wenn "Konsumenten" einen neuen Hausarzt suchten.
• Informationen über Preise wurden von 5,3 % der "primary care physician shoppers" genutzt. Der Anteil der "specialist physician shoppers", der sich für den Preis der Behandlung interessierte lag bei 1,1 % und von den "procedure shoppers" waren es 1,2 % mit Interesse am Preis der neuen Einrichtung. Etwas mehr nutzen die drei "Konsumentengruppen" Qualitätsinformationen: 23 % in der Hausarztgruppe, 10,3 % in der Facharztgruppe und nur noch 3,4 % in der Einrichtungsgruppe. Dabei ist es nach Ansicht der ForscherInnen möglich, dass einige Befragte auch Empfehlungen von Freunden etc. als Qualitätsinformation bewerteten, die Nutzung der Qualitätsindikatoren in sonstigen Informationssysteme also noch etwas geringer ist.
• Warum offensichtlich weltweit (Befragungen in Deutschland nach Informationsquellen bestätigen dies weitgehend) Empfehlungen von Verwandten und Freunden eine konstant herausragende Bedeutung haben, liegt nach Ansicht der beiden AutorInnen daran, dass Patienten bevorzugt Ärzte suchen, die ihnen gut zuhören und eine einfühlsame oder mitfühlende Art des Umgangs mit ihnen haben. Diese Art von Informationen können aber am besten Personen glaubwürdig zur Verfügung stellen, die dies aus Erfahrung tun können und dem suchenden Patienten nahestehen. Trotz des technischen und inhaltlichen Fortschritts bei Hilfsmitteln für die Wahl von Ärzten bestätigen sich im Wesentlichen für die USA Ergebnisse der 2003 veröffentlichten Studie " How Do Patients Choose Physicians? Evidence from a National Survey of Enrollees in Employment-Related Health Plans?" von Katherine Harris (Health Services Research:Volume 38(2)April 2003p 711-732), deren Kernergebnis so lautete: "Literature suggests that patients do not engage in rational or consumerist behavior when searching for or choosing physicians. They instead rely heavily on recommendations from family and friends and engage in limited searches for alternative physicians."
Die Schlussfolgerungen aus den Ergebnissen lauten: "The consumer-directed health care vision of consumers actively shopping is far removed from the reality of how most consumers currently choose health care providers."
Auf der Suche nach Gründen und möglichen Ansatzpunkte, mehr aktive Konsumenten schaffen zu können, landen die AutorInnen aber bei zwei doppelbödigen Aspekten. Einen Grund sehen sie darin, dass die Zuzahlungen praktisch bei allen Ärzten gleich sind, wenn man in derselben Versicherung bleibt. Ein zweiter Grund ist der, dass die meisten Patienten nicht an erhebliche und für sie mit gravierenden gesundheitlichen Folgen verbundene Qualitätsunterschiede zwischen Ärzten glauben. Daraus den Schluss zu ziehen, die politischen Macher sollten "educate consumers about the existence and the serious implications of provider quality gaps", ist nachvollziehbar aber mit Sicherheit langwierig und aufwändig. Abgesehen davon sollte aber vor Beginn solcher Erziehungsmaßnahmen und differenzierterer Zuzahlungen das Risiko kurz- und mittelfristig unerwünschter Wirkungen geprüft und ausgeschlossen werden.
Den neunseitigen HSC-Forschungsbrief No. 9 "Word of Mouth and Physician Referrals Still Drive Health Care Provider Choice" von Ha T. Tu, Johanna Lauer aus dem Dezember 2008 erhält man kostenlos.
Bernard Braun, 5.4.09
Die Suche nach Gesundheitsinformationen im Internet schürt häufig Krankheitsängste - besonders bei "Cyberchondern"
 Wer gesundheitliche Beschwerden hat und sich im Internet schlau machen möchte, was hinter den Symptomen steckt, bei dem werden nur allzu leicht Krankheitsängste geweckt und der Verdacht auf schwerwiegende, aber extrem unwahrscheinliche Krankheitsdiagnosen gelenkt. Dies ist das Ergebnis einer jetzt veröffentlichten Studie der Microsoft-Forschungsabteilung. Eric Horvitz, einer der beiden Wissenschaftler, die die Studie durchführten, erklärte: "Viele Leute benutzen Suchmaschinen als ob es menschliche Experten wären, die genau auf ihre Fragen eingehen können. Bei den Suchergebnissen schauen sie sich dann meist nur die ersten zehn Funde an, und wenn sie dort Wörter finden wie 'Gehirntumor' oder 'ALS', dann meinen sie, es träfe auf sie zu."
Wer gesundheitliche Beschwerden hat und sich im Internet schlau machen möchte, was hinter den Symptomen steckt, bei dem werden nur allzu leicht Krankheitsängste geweckt und der Verdacht auf schwerwiegende, aber extrem unwahrscheinliche Krankheitsdiagnosen gelenkt. Dies ist das Ergebnis einer jetzt veröffentlichten Studie der Microsoft-Forschungsabteilung. Eric Horvitz, einer der beiden Wissenschaftler, die die Studie durchführten, erklärte: "Viele Leute benutzen Suchmaschinen als ob es menschliche Experten wären, die genau auf ihre Fragen eingehen können. Bei den Suchergebnissen schauen sie sich dann meist nur die ersten zehn Funde an, und wenn sie dort Wörter finden wie 'Gehirntumor' oder 'ALS', dann meinen sie, es träfe auf sie zu."
"Cyberchonder" nennen die beiden Autoren (in Anlehnung an das Wort "Hypochonder") Leute, bei denen es zu einer Eskalation von Ängsten und Befürchtungen kommt, während sie im Internet nach den Ursachen ihrer ganz normalen und alltäglichen Beschwerden suchen. Dazu präsentieren sie zunächst einige Beispiele, auf die sie während ihrer eigenen Internet-Recherchen gestoßen sind.
• So ist die Wahrscheinlichkeit, bei der Suche nach dem Begriff "Kopfschmerzen" mit einer Suchmaschine auch auf die Wörter "Koffein-Entzug" zu stoßen, genau so groß (etwa 26%) wie die Wahrscheinlichkeit, dass in den Suchergebnissen das Wort "Gehirntumor" auftaucht.
• Ähnlich verhält es sich bei der Suche nach "Schmerzen in der Brust" ("chest pain"). Die Wahrscheinlichkeit, dass in den Suchergebnissen "Verdauungsstörung" auftaucht ("indigestion") ist ähnlich hoch (35%) wie die, dass man auf "Herzinfarkt" ("heart attack") stößt (37%).
• Und noch problematischer kann es werden, wenn man "Muskelzucken" ("muscle twitches") eingibt. Die meist zutreffende Erklärung, dass hier eine spontane und überwiegend harmlose Muskelkontraktion vorliegt, findet man nur in 12 Prozent aller Suchvorgänge. Die schockierenden drei Buchstaben "ALS" jedoch (Amyotrophe Lateralsklerose, eine schwere, nicht heilbare Nervenkrankheit, zuletzt bekannt worden durch Erkrankung des Künstlers Jörg Immendorff) findet man in 50% aller Fälle.
Tatsächlich beträgt nach medizinischen Daten die Wahrscheinlichkeit, dass bei Kopfschmerzen ein Gehirntumor vorliegt, jedoch nur 3 Prozent und nicht 26%, wie die Suchergebnisse suggerieren könnten. Die Microsoft-Forscher führten ihre Studie auch durch, da das Unternehmen sich im Bereich gesundheitlicher Informationen im Internet stärker engagieren will. Geprüft wird derzeit (ebenso wie bei Google), ob man auch in Deutschland wie schon zuvor in den USA internet-basierte Patientenakten auf hinreichende Akzeptanz stoßen würden. (vgl.: Heise Online Newsticker: "Krankenakten im Internet?" 24.11.2008)
Neben der detaillierten Analyse von Suchergebnissen bei Webscrawlern oder auch Suchmaschinen führten die Forscher auch eine Befragung von rund 500 Microsoft-Mitarbeitern durch, um zu sehen, welch quantitative Bedeutung die Cyberchondrie hat. Hier zeigte sich:
• Die knapp 500 Befragten gaben an, im Monat durchschnittlich etwa 10mal im Internet Gesundheitsinformationen zu suchen und etwa 2mal im Monat wurde nach Diagnosen für Gesundheitsbeschwerden gesucht, wegen derer man noch nicht beim Arzt war.
• 39% hatten schon einmal den Verdacht, von einer schwerwiegenden Krankheit betroffen zu sein, obwohl dazu kein Grund vorlag. Als "Hypochonder" bezeichnen sich selbst aber nur 3,5% und im Freundeskreis geschieht dies nicht wesentlich öfter (4,7%).
• "Wie oft stoßen sie bei ihren Internet-Suchen nach Begriffen, die mit gängigen gesundheitlichen Beschwerden zu tun haben, gleichwohl auf Hinweise, die mit einer schwerwiegenden Erkrankung zu tun haben?" Auf diese zentrale Frage antworten: 2% mit "immer", 19% mit "oft", 42% mit "gelegentlich" und nur 37% mit "selten" oder "nie".
In weiteren Fragen ermittelten die Forscher, dass immerhin jeder dritte Befragte zumindest gelegentlich mehrere Monate lang immer wieder aufs Neue nach der Bedeutung von bestimmten Symptomen sucht und dahinter eine schwere Krankheit vermutet. Jeder vierte gibt an, schon einmal Krankheits-Symptome in eine Suchmaschine eingegeben zu haben in der Erwartung, Diagnosen zu bekommen, geordnet nach der Wahrscheinlichkeit ihres Zutreffens.
• Die Studie ist hier im Volltext verfügbar: Ryen White; Eric Horvitz: Cyberchondria: Studies of the Escalation of Medical Concerns in Web Search
• Hier ist ein Abstract: MSR-TR-2008-178: Cyberchondria: Studies of the Escalation of Medical Concerns in Web Search
Gerd Marstedt, 3.12.08
Die Nutzung des Internet zur gesundheitlichen Information ist weiter gestiegen - außer in Bayern
 Die Nutzung des Internet für gesundheitsbezogene Fragen stieg in Deutschland zwischen 2005 und 2007 um 13 Prozent von 44 auf 57 Prozent an. Jeder dritte Deutsche (32 Prozent) nutzte das Internet im Jahr 2007 mindestens einmal monatlich zur Information oder zur Kommunikation mit anderen Nutzern oder Arztpraxen. 2005 lag dieser Anteil noch bei 23 Prozent. Derzeit betrachten über 37 Prozent der Deutschen das Internet als wichtiges Informations- und Kommunikationsmedium im Kontext ihrer Gesundheitsversorgung. Dies sind Ergebnisse der Studie "eHealth Trends 2005-2007", die der Lehrstuhl für Medizinische Informatik der Universität Erlangen-Nürnberg mit sechs weiteren europäischen Partnern durchgeführt hat. Durchgeführt wurden Telefoninterviews bei einer repräsentativen Stichprobe von 14.956 Personen in sieben Ländern.
Die Nutzung des Internet für gesundheitsbezogene Fragen stieg in Deutschland zwischen 2005 und 2007 um 13 Prozent von 44 auf 57 Prozent an. Jeder dritte Deutsche (32 Prozent) nutzte das Internet im Jahr 2007 mindestens einmal monatlich zur Information oder zur Kommunikation mit anderen Nutzern oder Arztpraxen. 2005 lag dieser Anteil noch bei 23 Prozent. Derzeit betrachten über 37 Prozent der Deutschen das Internet als wichtiges Informations- und Kommunikationsmedium im Kontext ihrer Gesundheitsversorgung. Dies sind Ergebnisse der Studie "eHealth Trends 2005-2007", die der Lehrstuhl für Medizinische Informatik der Universität Erlangen-Nürnberg mit sechs weiteren europäischen Partnern durchgeführt hat. Durchgeführt wurden Telefoninterviews bei einer repräsentativen Stichprobe von 14.956 Personen in sieben Ländern.
Überraschend war auch für die Wissenschaftler ein Ergebnis aus Bayern: Obwohl in Bayern der Anteil der Internetnutzer deutschlandweit am höchsten ist, ist die häufige Nutzung speziell zu Gesundheitsfragen deutlich niedriger als in allen anderen Bundesländern: In Bayern nutzt unter den regelmäßigen Internetnutzern (mindestens einmal monatlich) nur etwa jeder Dritte das Internet auch für Gesundheitsfragen. In allen anderen Bundesländern liegt dieser Anteil über 50 Prozent. Eine plausible Erklärung hierfür gibt es leider nicht.
Im Vergleich mit anderen Ländern in Europa liegt Deutschland in der Internetnutzung in Gesundheitsfragen an dritter Stelle. Es konnte europaweit in allen beteiligten Ländern (Norwegen, Dänemark, Polen, Litauen, Portugal und Griechenland) ein signifikanter Anstieg der Internetnutzung in Gesundheitsfragen von 42 Prozent (2005) auf 52 Prozent (2007) aufgezeigt werden. Die stärkste Internetnutzung in Gesundheitsfragen haben unter den Projektpartnern die Dänen mit aktuell 72 Prozent der Bevölkerung vor Norwegen mit 68 Prozent. In Südeuropa liegen die vergleichbaren Werte noch bei 38 Prozent (Portugal) und 32 Prozent (Griechenland).
Als bemerkenswert wird von den Forschern der starke Anstieg der elektronischen Kommunikation mit Gesundheitsversorgern in Dänemark (Anstieg um 12 Prozent auf 20 Prozent der Bevölkerung in 2007) hervorgehoben, daneben aber auch die deutliche Zunahme des Online-Kaufs von Arzneimitteln in Deutschland (Anstieg um 6 Prozent auf 18 Prozent der Bevölkerung in 2007).
• Die Ergebnisse im Detail: Berthold Lausen, Sergej Potapov, Hans-Ulrich Prokosch: Gesundheitsbezogene Internetnutzung in Deutschland 2007 (GMS Med Inform Biom Epidemiol 2008;4(2):Doc06)
• Auch die europaweiten Ergebnisse sind online publiziert: Per Egil Kummervold u.a.: eHealth Trends in Europe 2005-2007: A Population-Based Survey (J Med Internet Res 2008;10(4):e42)
Gerd Marstedt, 25.11.08
Internet, ja aber - Von den spezifischen Grenzen der Information zu gesundheitsbezogenen Fragen via Internet.
 In zahlreichen Konzepten, den Informationsstand der Krankenversicherten und PatientInnen über gesundheitliche Probleme und Behandlungsmöglichkeiten überhaupt herzustellen oder zu verbessern, spielen Informationsangebote oder -Portale im Internet eine bedeutende Rolle.
In zahlreichen Konzepten, den Informationsstand der Krankenversicherten und PatientInnen über gesundheitliche Probleme und Behandlungsmöglichkeiten überhaupt herzustellen oder zu verbessern, spielen Informationsangebote oder -Portale im Internet eine bedeutende Rolle.
Derartige Angebote nehmen daher in der Regie von Versicherungen und Anbietern oder wissenschaftlicher und sonstiger Institutionen seit Jahren rein quantitativ rapide zu. Damit verbunden ist allerdings das Problem der Qualität, Verlässlichkeit und inhaltlichen Unabhängigkeit solcher Angebote von den materiellen Interessen der Anbieter.
Ein Einwand gegen eine zu starke Konzentration der Informationsbemühungen auf derartige Angebote war schon lange der, dass möglicherweise die Bevölkerungsgruppen mit dem höchsten praktischen Bedarf an Informationen, d.h. Kranke, Ältere und Angehörige unterer sozialer Schichten, zu den Nicht- oder Geringnutzern des Internet gehören oder auch nur mit Schwierigkeiten etwas mit der speziellen Art der Informationsvermittlung dieses Medium anfangen können.
Ob die Befürchtungen zutreffen bzw. die Medienkompetenz der Macher solcher Angebote deutlich von der in den Gruppen mit höchstem Informationsbedarf abweicht, sollte daher regelmäßig überprüft werden.
Die neuesten Daten (vgl. zu älteren Erhebungen auch einen entsprechenden Forum-Gesundheitspolitik-Beitrag) zur Internetnutzung in der deutschen Bevölkerung veröffentlichte das Statistische Bundesamt als Ergebnisse einer Befragung privater Haushalte zur Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien unter der Überschrift "Fast 70% der Bevölkerung ab zehn Jahren nutzen das Internet" am 30. November 2007.
Die wesentlichen Erkenntnisse lauten:
• 65% der Haushalte verfügen im ersten Quartal 2007 über einen Internetzugang, eine Erhöhung von 61% im entsprechenden Quartal 2006.
• 68% der Bevölkerung ab 10 Jahren nutzten im ersten Quartal 2007 das Internet. Ein Jahr zuvor machten dies erst 65%.
• Innerhalb der Gruppe der Internetnutzer waren 61% jeden Tag oder fast jeden Tag im ersten Quartal 2007 online. Im Vorjahreszeitraum hatte dieser Anteil 56% betragen.
• Insbesondere in den Bevölkerungsgruppen bis 54 Jahren liegt die Internetnutzung auf hohem Niveau. Im Befragungszeitraum nutzten 94% der 10- bis 24-Jährigen das Medium. 64% der Internetnutzer dieser Generation waren dabei jeden Tag oder fast jeden Tag online. Ähnliche Ergebnisse zeigen sich bei den Personen zwischen 25 und 54 Jahren. Hier lag der Anteil der Internetnutzer im ersten Quartal 2007 bei 84%, innerhalb dieser Altersgruppe nutzten wiederum 63% das Internet jeden Tag oder fast jeden Tag.
• Dagegen sind Personen über 54 Jahren deutlich seltener online. 33% aller Personen dieser Altersgruppe nutzten im ersten Quartal 2007 das Medium, davon hat allerdings ein großer Anteil eine hohe Nutzungsintensität: mehr als die Hälfte (53%) der über 54-jährigen Internetnutzer sind jeden Tag oder fast jeden Tag im Internet. 66% dieser gerade für gesundheitliche Fragestellungen individuell interessierteren Altersgruppe erreichte man also im ersten Quartal 2007 über das Internet überhaupt nicht.
• Auch zwischen Männern und Frauen bestehen generelle Unterschiede bei der Internetnutzung. Im Befragungszeitraum surften 73% der Männer im World Wide Web, der Anteil der Frauen lag bei 63%. Dieser Unterschied liegt im Wesentlichen an einem deutlich verschiedenen Zugriff auf dieses Medium der älteren Generation. So nutzten im ersten Quartal 2007 lediglich 25% der Frauen (alle Angehörigen dieser Altersgruppe 33% in der Altersgruppe 55 und älter die Möglichkeiten des Internets, während Männer im gleichen Alter einen Anteil von 42% aufwiesen.
• Dass sich daran in der ferneren Zukunft oder im höheren Alter der heute jungen Bevölkerung einiges ändern wird, zeigt die folgende Beobachtung des Statistischen Bundesamtes: Bei der Bevölkerung der 10- bis 24-Jährigen gibt es hingegen so gut wie keine geschlechtsspezifischen Unterschiede (männlich 93%, weiblich 94%), bei den 25- bis 54-Jährigen sind es nur geringe Unterschiede (männlich: 86%, weiblich: 82%).
Für die Mehrheit der Bevölkerungsgruppen mit in der Regel überdurchschnittlich großen gesundheitlichen Risiken und einem von daher hohen Informationsbedarf reichen also aktuell und in allernächster Zukunft vorrangige oder gar ausschließliche Internetangebote nicht aus bzw. sie müssen in erheblichem Maße durch andere Informationsquellen, -kanäle und -methoden ergänzt oder ersetzt werden.
Näheres und eine zusätzliche tabellarische Übersicht ist in einer Pressemitteilung vom 30. November 2007 auf der Homepage des "Statistischen Bundesamtes" erhältlich.
Bernard Braun, 8.12.2007
Angehörige von Krebspatienten: Hohe Betroffenheit und wichtige Rolle bei der Informationsbeschaffung im Internet.
 Dass "Gesundheit" und "Krankheit" zu den wesentlichen Internet-Angeboten gehören, die sich dazu noch am schnellsten entwickeln, ist bekannt. Was die BesucherInnen der unzähligen Portale, Chat-Rooms und Medlines dabei wirklich an qualitativ hochwertigen Informationen erhalten, wird zunehmend kritisch untersucht, ohne dass dies den Anteil qualitätsgesicherter Angebote bisher nennenswert erhöht hat. Was die Besucher dieser Angebote mit den dort erhältlichen Informationen anfangen, ob es sich etwa mehrheitlich um "Für-alle-Fälle"-Informationssammler oder Hypochonder handelt oder um kranke Personen, die Informationen zur Diagnose oder Behandlung ihrer Erkrankung suchen und auch finden, ist ebenfalls nur unzureichend erforscht.
Dass "Gesundheit" und "Krankheit" zu den wesentlichen Internet-Angeboten gehören, die sich dazu noch am schnellsten entwickeln, ist bekannt. Was die BesucherInnen der unzähligen Portale, Chat-Rooms und Medlines dabei wirklich an qualitativ hochwertigen Informationen erhalten, wird zunehmend kritisch untersucht, ohne dass dies den Anteil qualitätsgesicherter Angebote bisher nennenswert erhöht hat. Was die Besucher dieser Angebote mit den dort erhältlichen Informationen anfangen, ob es sich etwa mehrheitlich um "Für-alle-Fälle"-Informationssammler oder Hypochonder handelt oder um kranke Personen, die Informationen zur Diagnose oder Behandlung ihrer Erkrankung suchen und auch finden, ist ebenfalls nur unzureichend erforscht.
Etwas Abhilfe schafft eine kleine Studie mit der Untersuchung der Nutzungsweise einer Teilgruppe der InternetnutzerInnen: den Angehörigen von 113 Brustkrebs- und Prostatakrebs-PatientInnen, die zu 93% aus Deutschland sowie zu 7% aus der Schweiz und Österreich stammen. Diese sehr schwer zu erreichende Gruppe wurde von Oktober 2003 bis April 2004 mit einem relativ einfachen und damit auch unaufwändigen Fragebogen befragt.
Für das Nutzungsverhalten der PatientInnenangehörigen ergab sich:
• 91% nutzen Internetangebote um sich selber über die Erkrankung ihrer/ihres Angehörigen zu informieren.
• Ein wichtiges Nebenergebnis der Befragung war, dass und wie intensiv offensichtlich Angehörige in das Krankungsgeschehen involviert sind: Bei 21% hatten sich dadurch grundlegende Veränderungen ihrer Lebensweise ergeben, 64% sagten, die Erkrankung ihres Angehörigen habe auch ihr eigenes Leben beeinflusst. Nur 12% sahen lediglich einen geringen Effekt und 4% gar keinen. 87% sahen sich selber in Entscheidungen über die Behandlung einbezogen und 54% waren mindestens bei einer Arztkonsultation dabei.
• Skepsis bestimmt auch die Bewertung der Behandlung: Auf die Frage, ob die Erkrankung rechtzeitig entdeckt worden wäre, antworteten nur 31% mit "ja". Und nur 47% glaubten, dass die richtige Behandlung erfolgte.
• 78% taten es aber auch, um Informationen an die erkrankte Personen weitergeben zu können. 60% der Befragten gaben an, es deshalb gemacht zu haben, weil die erkrankten Personen nicht selber dazu in der Lage oder motiviert war, diese Informationssuche durchzuführen.
• Fast 40% sagten, dass die im Internet gefundenen Informationen behandlungsrelevante Entscheidungen beeinflusst hatten.
• Die fünf wichtigsten Themen nach denen die Angehörigen recherchierten waren mögliche Therapien (bei 88%), der Krankheitsverlauf (69%), heilungsfördernde Aspekte (66%) und alternative Heilungsmethoden (62%).
• Die Angehörigen druckten in der Regel die gefundenen Informationen aus oder mailten sie an ihre erkrankten Angehörigen weiter.
• Die PatientInnen, die u.a. derartig vorbereitet bei ihren Ärzten auftauchten, machten damit nur teilweise hilfreiche Erfahrungen: Nur 41% von ihnen bemerkten eine interessierte Reaktion ihrer behandelnden Ärzte. 36% der PatientInnen berichteten aber auch, dass ihre Ärzte von der Informationsflut überwältigt gewesen waren.
Auch wenn sich seit 2003/2004 einige der Verhaltens- und Reaktionsweisen von Ärzten verändert, d.h. auch verbessert haben dürften, weist die Studie auf zwei wichtige soziale Sachverhalte hin, die sowohl in der Versorgungsforschung als auch bei Informationsangeboten im Internet und anderswo beachtet werden sollten:
• Angehörige sind ein möglicherweise noch unterschätzter, stark in die Krankheitsbearbeitung und -bewältigung ihrer erkrankten Familienmitglieder involvierter und wichtiger Akteur.
• Ärzte warten nicht unbedingt freudig erregt auf Patienten mit Bündeln von im Internet recherchierter Literatur. Diese Informationen müssen also auch speziell unter dem Aspekt der Kommunizierbarkeit in solch oft zugespitzten und durch hohen Problem- und Entscheidungsdruck geprägten Arzt-Patientkontakten entwickelt werden.
Einen kompletten und kostenfreien Text des Aufsatzes "Internet use by the families of cancer patients—help for disease management?" von Silke Kirschning, Ernst von Kardorff und Karolina Merai im "Journal of Public Health" (2007; 5:23-28 DOI 10.1007/s10389-006-0070-4) erhält man hier
Bernard Braun, 30.10.2007
Gesundheitsinformationen im Internet: Chancen und Risiken für die Arzt-Patient-Beziehung
 Erleichtert die Vielzahl der im Internet jederzeit verfügbaren Gesundheitsinformationen tatsächlich den Weg zum "informierten Patienten", der seine Gesundheitsbeschwerden zuverlässig bewerten kann und Präventionsmöglichkeiten kennt? Oder entsteht hier der desinformierte Konsument, vollgestopft mit Halbwissen und Fehlinformationen? Und verbessert das im Internet gewonnene Wissen das Arzt-Patient-Gespräch, dadurch dass nun elementare Fakten bekannt sind und man sich den Besonderheiten der individuellen Erkrankung zuwenden kann? Oder entstehen hier neue Kommunikations-Barrieren, weil der Arzt erst einmal Irrtümer und Illusionen bereinigen muss? In einer Literaturübersicht, die jetzt in der Zeitschrift "Patient Education & Counseling" veröffentlicht wurde, hat ein amerikanisches Wissenschaftler-Team auf diese und eine Reihe weiterer Fragen versucht, Antworten zu geben.
Erleichtert die Vielzahl der im Internet jederzeit verfügbaren Gesundheitsinformationen tatsächlich den Weg zum "informierten Patienten", der seine Gesundheitsbeschwerden zuverlässig bewerten kann und Präventionsmöglichkeiten kennt? Oder entsteht hier der desinformierte Konsument, vollgestopft mit Halbwissen und Fehlinformationen? Und verbessert das im Internet gewonnene Wissen das Arzt-Patient-Gespräch, dadurch dass nun elementare Fakten bekannt sind und man sich den Besonderheiten der individuellen Erkrankung zuwenden kann? Oder entstehen hier neue Kommunikations-Barrieren, weil der Arzt erst einmal Irrtümer und Illusionen bereinigen muss? In einer Literaturübersicht, die jetzt in der Zeitschrift "Patient Education & Counseling" veröffentlicht wurde, hat ein amerikanisches Wissenschaftler-Team auf diese und eine Reihe weiterer Fragen versucht, Antworten zu geben.
Basis ihrer Veröffentlichung sind neuere (meist nach 1998 erschienene) Studien zur Funktion des Internet in Gesundheitsfragen und zu Effekten der Mediennutzung auf die Arzt-Patient-Beziehung. Der Artikel beginnt mit einer kleinen Geschichte, die einige Veränderungen deutlich macht. "Herr Jones kommt in die Praxis und klagt über Rückenschmerzen, die sich bisweilen wie ein 'Spasmus' bemerkbar machen. Die Schmerzen wandern von einer Seite zur andern und gehen auch bis in die Beine. Er verneint Probleme beim Urinieren oder Stuhlgang. Pause. Der Arzt überdenkt die Symptome. Dann wird aufgrund der Beschwerden eine Magnet-Resonanz-Tomographie für erforderlich gehalten. Und - Überraschung! - es ist nicht der Arzt, der dies fordert, sondern der Patient. Er hat sich im Internet schlau gemacht."
Die Geschichte illustriert einen allgemeinen Trend. In einer Studie aus dem Jahr 2005 berichten 57% aller Patienten, die im sich im Internet über Gesundheitsfragen informiert haben, dass sie darüber auch zumindest einmal mit ihrem Arzt gesprochen hätten. In einer Befragung britischer Ärzte aus dem Jahr 2001 sagen 75% der befragten Allgemeinärzte, dass sie auch aktuell Patienten hätten, die Internet-Informationen in die Sprechstunde mitbringen. Eine dritte Studie hat andererseits gezeigt, dass etwa die Hälfte aller Personen, die sich im WWW zu Gesundheitsthemen kundig gemacht haben, dieses Wissen dem Arzt verschweigt. Ganz gleich, ob die Information aus dem Netz dem Arzt mitgeteilt oder verschwiegen wird, in jedem Fall gibt es Einflüsse auf die Kommunikation in der Sprechstunde. Und auch die Wahrnehmung von Gesundheitsbeschwerden verändert sich. Eine Studie hat gezeigt, dass "Informations-Sammler" das Internetwissen nutzen, um ihre Therapiewünsche zu ändern (70%), Zweitmeinungen zu einer Krankheit einzuholen (50%), ihr Gesundheitsverhalten zu ändern (48%) oder um zu entscheiden, ob sie überhaupt zum Arzt gehen sollten (28%). Die Wissenschaftler diskutieren in ihrem Aufsatz unter Rekurs auf andere Veröffentlichungen dann Chancen und Risiken, die sich durch das Internet und die gesundheitsbezogenen Informationsmöglichkeiten für das Arzt-Patient-Verhältnis ergeben.
Als Chancen erkennen sie:
• einen besseren Wissensstand von Patienten, der auch zu einem besseren Therapieerfolg und einer effizienteren Nutzung von Versorgungseinrichtungen führen kann,
• Ansatzpunkte zu einer besseren Kooperation von Arzt und Patient aufgrund der nun von Patienten besser erkennbaren gemeinsamen Verantwortung für die Behandlung,
• eine sinnvollere Nutzung der Gesprächszeit in der Arztpraxis, da der Patient nun elementare Kenntnisse über Krankheitsursachen, Symptome, Prävention und Therapie hat und man sich stärker den Besonderheiten der jeweiligen Krankheit zuwenden kann,
• mehr Chancen für eine gemeinsame Entscheidungsfindung (Shared Decision Making),
• bessere Voraussetzung zur nachträglichen Vertiefung der vom Arzt vermittelten Informationen,
• Möglichkeiten des Erfahrungsaustauschs von Patienten mit der gleichen Erkrankung untereinander,
• umfassendere Möglichkeiten auch der Fortbildung von Ärzten und des Rückgriffs auf evidenz-basierte medizinische Erkenntnisse oder Leitlinien.
Als Risiken andererseits werden hervorgehoben:
• Falschinformationen und Halbwahrheiten, die durch die Unübersichtlichkeit der Internet-Websites und kommerzielle Interessen verursacht werden und so entweder Ängste bei Patienten hervorrufen oder auch unrealistische Hoffnungen,
• eine Verschärfung der sozialen Ungleichheit, da die Zugangsmöglichkeiten zum Internet und die intellektuellen Voraussetzungen der Nutzung sich bei älteren, schlechter gebildeten und ärmeren Bevölkerungsgruppen deutlich seltener finden,
• eine Verursachung unnötiger Arztbesuche aufgrund von aufgebauschten Informationen über Risiken oder auch unnötige Auseinandersetzungen mit dem Arzt aufgrund von Sensationsmeldungen über Heilerfolge.
Hier ist ein Abstract des Aufsatzes mit vielen Literaturangaben zu Veröffentlichungen über das Internet als Informationsmedium in Gesundheitsfragen: Hedy S. Wald u.a.: Untangling the Web—The impact of Internet use on health care and the physician-patient relationship (Patient Education and Counseling 68 (2007) 218-224)
Gerd Marstedt, 14.10.2007
"Finanztest" prüfte Beratung durch Krankenkassen: Die Qualitätsunterschiede sind erheblich
 Die Zeitschrift "FINANZtest" (eine zweite Publikation der Stiftung Warentest neben "Test") hat Service, Information und Beratung von 20 Gesetzlichen Krankenkassen überprüft. Vier AOKs und die Techniker Krankenkasse schnitten mit "gut" ab, besonders schlecht schnitt die "IKK-Direkt" ab, aber auch einige Betriebskrankenkassen kamen nur auf ein "ausreichend". Die großen Ersatzkassen wie Kaufmännische Krankenkasse (KKH), Barmer Ersatzkasse und Deutsche Angestellten Krankenkasse (DAK) rangieren im Mittelfeld.
Die Zeitschrift "FINANZtest" (eine zweite Publikation der Stiftung Warentest neben "Test") hat Service, Information und Beratung von 20 Gesetzlichen Krankenkassen überprüft. Vier AOKs und die Techniker Krankenkasse schnitten mit "gut" ab, besonders schlecht schnitt die "IKK-Direkt" ab, aber auch einige Betriebskrankenkassen kamen nur auf ein "ausreichend". Die großen Ersatzkassen wie Kaufmännische Krankenkasse (KKH), Barmer Ersatzkasse und Deutsche Angestellten Krankenkasse (DAK) rangieren im Mittelfeld.
Für den Test wurden drei unterschiedliche Bereiche unter die Lupe genommen:
• Das stärkste Augenmerk richtete man auf die Beratungskompetenz der 20 Krankenkassen. Den Kassen-Mitarbeitern wurden zwei Testfragen zu Kassenleistungen und fünf zu Gesundheitsthemen gestellt. Bei den Leistungsfragen gab es kaum Ausfälle. Die Testkundin wollte zum Beispiel wissen, ob sie von ihrer Kasse eine Haushaltshilfe bekommen kann, die sich um die Kinder kümmert, während sie ins Krankenhaus muss. Bei den Gesundheitsfragen haperte es jedoch. Hier ging es etwa darum, dass eine Schutzimpfung gegen Hepatitis B vor allem für kleine Kinder ratsam ist und bezahlt wird. Auch Fragen zu Diabetes wurden teilweise nur unvollständig beantwortet: Kassenmitarbeiter sollten wissen, dass ein erhöhter Blutzuckerwert noch nicht dasselbe ist wie eine Diabetes-Erkrankung und wie der Versicherte das prüfen lassen kann.
Fazit von "Finanztest" zum Thema gesundheitliche Beratung: "Wenn eine Kasse eine medizinische Hotline hat, an die sie Ratsuchende verweisen kann, bewältigt sie die Anfragen oft besser, als wenn ein solcher Service fehlt. Positive Ausnahme: Die KKH berät auch ohne medizinische Hotline überdurchschnittlich. Deutlich unterdurchschnittlich fiel die Beratung bei der BKK ATU, der BKK Essanelle und der BIG Direktkrankenkasse aus. Gerade noch "ausreichend" beriet die IKK-Direkt. In vielen Fällen gelang es den Testkunden gar nicht, überhaupt eine Antwort zu erhalten, weil sie ihre Kasse nicht erreichen konnten."
• Als zweiten Service-Bereich prüfte man Kundenfreundlichkeit und Erreichbarkeit der Kassen. Fazit: "In den Geschäftsstellen zeigte sich die Mehrheit der Kassen als sehr kundenorientiert. Auch wenn kein Termin ausgemacht war, mussten Ratsuchende nur kurz warten. Am Telefon waren die meisten Mitarbeiter freundlich, aber nicht in jedem Fall kompetent. Viele Mitarbeiter verwiesen nicht auf zusätzliche Informationsangebote ihrer Kasse, wie spezielle Ansprechpartner, Broschüren, Internet oder Hotline. Von den 175 geplanten Telefonberatungen waren acht erfolglos. Viermal davon allein bei der IKK-Direkt. Ihre Hotline war nicht zu erreichen."
• Das dritte Kriterium der Prüfung war der Internetauftritt der Kassen, wobei von Interesse war, ob Informationen zu Mitgliedschaft, Beiträgen und Ansprechpartnern geboten wurden oder Anträge und Broschüren als Downloads verfügbar waren. Direktkassen, die geringen Verwaltungsaufwand betreiben, enttäuschten hier auf ganzer Linie. Die besten Internetauftritte boten mehrere AOKs, dahinter rangierte die Techniker Krankenkasse.
Besondere Kritik fand die Reaktion der Kassen auf Emails: "Mit E-Mails haben offenbar mehr Kassen Probleme: 20 von 140 Mails waren auch nach 14 Tagen noch unbeantwortet. Besonders negativ fällt auch hier die IKKDirekt auf, die keine einzige der an sie gerichteten Mailanfragen innerhalb des zweiwöchigen Zeitraums beantwortet hat."
Hier findet man eine kostenlose Übersicht über die Ergebnisse: Beratung durch die Krankenkasse - Nur fünf sind gute Lotsen
Der komplette Testbericht mit Einzelergebnissen für alle 20 Kassen und den Details zu den verschiedenen Testkriterien kostet 2,00 Euro.
Gerd Marstedt, 2.9.2007
USA: Gesundheitsinformationen im Internet verlieren an Glaubwürdigkeit
 Das Internet wird von immer mehr US-amerikanischen Bürgern genutzt, um Gesundheits-Informationen zu finden. Zugleich sinkt jedoch der Grad an Glaubwürdigkeit, der diesen Informationen zuerkannt wird. Diese Schere zwischen der steigenden Nutzungsquote und dem sinkenden Vertrauen wird auch daran deutlich, dass Ärzte zunehmend als bevorzugte Quelle genannt werden, wenn es um dringende und wichtige Fragen in Bezug auf Erkrankungen oder Gesundheitsrisiken geht. Dies sind zentrale Befunde von zwei großen repräsentativen Befragungen erwachsener US-Bürger, die unter dem Namen "HINTS" ("Health Information National Trends Survey") vom Nationalen Institut für Gesundheit in den Jahren 2003 und 2005 durchgeführt wurden.
Das Internet wird von immer mehr US-amerikanischen Bürgern genutzt, um Gesundheits-Informationen zu finden. Zugleich sinkt jedoch der Grad an Glaubwürdigkeit, der diesen Informationen zuerkannt wird. Diese Schere zwischen der steigenden Nutzungsquote und dem sinkenden Vertrauen wird auch daran deutlich, dass Ärzte zunehmend als bevorzugte Quelle genannt werden, wenn es um dringende und wichtige Fragen in Bezug auf Erkrankungen oder Gesundheitsrisiken geht. Dies sind zentrale Befunde von zwei großen repräsentativen Befragungen erwachsener US-Bürger, die unter dem Namen "HINTS" ("Health Information National Trends Survey") vom Nationalen Institut für Gesundheit in den Jahren 2003 und 2005 durchgeführt wurden.
Die insgesamt 5.500 Telefoninterviews im Jahre 2005 (bzw. 6.300 im Jahre 2003) hatten unterschiedliche Themen zum Gegenstand, darunter: Informationsquellen zu Gesundheitsfragen, Bewertung der Quellen im Hinblick auf persönlichen Nutzen, Glaubwürdigkeit und Verständlichkeit, Kenntnisse über Krebserkrankungen, Früherkennung und Präventionsmöglichkeiten. Die wichtigsten Ergebnisse waren folgende:
• Das Vertrauen in die Glaubwürdigkeit von Gesundheits-Informationen ist für fast alle Medien und Quellen gestiegen, nur das Internet hat als vertrauenswürdiges Medium deutlich verloren. So gaben die Befragungsteilnehmer an, dass sie den Informationen bestimmter Quellen folgendermaßen vertrauen würden: Ärzte 2003: 62%, 2005: 67%; Zeitschriften 16%, 20%; Tageszeitungen: 13%, 19%; Radio: 10%, 12%; Internet: 24%, 19%.
• Bei Informationen über Krebserkrankungen zeigt sich eine zunehmend größere Schere zwischen dem tatsächlichen Informationsverhalten und der am meisten gewünschten Informationsquelle. Auf die Frage "Angenommen, Sie benötigen dringend Informationen über Krebs. Wohin würden Sie als erstes gehen?" antworteten 55% "Zum Arzt" und nur 30% "ins Internet". Genau umgekehrt zeigt sich jedoch, dass das Internet in der Realität weitaus häufiger genutzt wird. Die Frage "Was haben Sie in der letzten Zeit unternommen, um Informationen über Krebs zu finden" wird so beantwortet: Arzt 24%, Internet 48%.
• Das generelle Informationsverhalten zu Gesundheitsfragen zeigt, dass das Internet gleichwohl immer größere Verbreitung findet. Um für sich selbst Gesundheitsinformationen zu finden, wurde es 2005 von 58% genutzt (+7% gegenüber 2003), um für andere Gesundheitsinfos zu finden: 60% (+14%), um Arzneimittel online zu kaufen: 13% (+4%), um in Foren zu diskutieren: 4% (+-0), um online Kontakt aufzunehmen zu einem Arzt: 10% (+3%).
• Für die Nutzung des Internet als Informationsmedium zeigen sich erhebliche Unterschiede zwischen Bevölkerungsgruppen, so weisen Frauen deutlich höhere Quoten auf als Männer, ähnliches gilt für Befragte mit hohem Bildungsniveau.
Die Studie zeigt darüber hinaus noch eine Reihe von Ergebnissen auf über Kenntnisse der US-Amerikaner zu Krebserkrankungen, Früherkennungsuntersuchungen und Präventionsmöglichkeiten.
• Hier ist die "HINTS" Download-Seite mit vielen Materialien und Broschüren
• Der Bericht (PDF, 84 Seiten): Cancer Communication Health Information National Trends Survey 2003 and 2005
Gerd Marstedt, 2.9.2007
Gesundheitsinformationen im Internet: Die Zahl der Nutzer in den USA wächst rapide, das Vertrauen in die Informationen sinkt
 Die Zahl der Internetbesucher in den USA, die das WWW auch für die Suche nach Gesundheitsinformationen nutzen, ist in den letzten Jahren ganz erheblich angestiegen. Waren es 1998 nur etwas mehr als ein Viertel aller erwachsenen US-Bürger/innen (27%), die online nach Krankheitsbildern, Therapiemethoden oder Arzneimittel-Infos gesucht haben, so sind dies im Jahre 2007 fast drei Viertel (71%). Zugleich wird aber auch ein sinkendes Vertrauen in die Zuverlässigkeit der gebotenen Informationen festgestellt. Der Anteil derjenigen, die die dargebotenen Texte als "sehr zuverlässig" einstufen ist in nur zwei Jahren von 37% auf 26% gesunken. Dies sind Ergebnisse einer Umfrage des Marktforschungs-Instituts "Harris Interactive", bei der im Juli 2007 eine repräsentative Stichprobe von 1.010 US-Bürgern im Alter von über 18 Jahren befragt wurden.
Die Zahl der Internetbesucher in den USA, die das WWW auch für die Suche nach Gesundheitsinformationen nutzen, ist in den letzten Jahren ganz erheblich angestiegen. Waren es 1998 nur etwas mehr als ein Viertel aller erwachsenen US-Bürger/innen (27%), die online nach Krankheitsbildern, Therapiemethoden oder Arzneimittel-Infos gesucht haben, so sind dies im Jahre 2007 fast drei Viertel (71%). Zugleich wird aber auch ein sinkendes Vertrauen in die Zuverlässigkeit der gebotenen Informationen festgestellt. Der Anteil derjenigen, die die dargebotenen Texte als "sehr zuverlässig" einstufen ist in nur zwei Jahren von 37% auf 26% gesunken. Dies sind Ergebnisse einer Umfrage des Marktforschungs-Instituts "Harris Interactive", bei der im Juli 2007 eine repräsentative Stichprobe von 1.010 US-Bürgern im Alter von über 18 Jahren befragt wurden.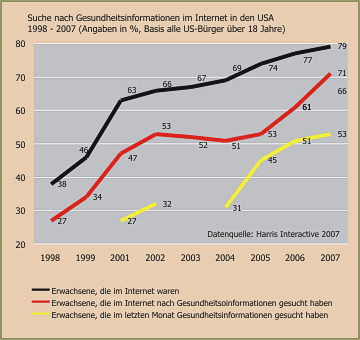
Die Ergebnisse der Studie im Einzelnen:
• Die Gesamtzahl der US-Bürger, die zur Suche nach gesundheitlichen Informationen (irgenwann schon mindestens einmal) online gegangen sind, stieg rapide an, von insgesamt 54 Millionen im Jahre 1998 auf 160 Millionen im Juli 2007. Die Steigerungsrate fiel in den letzten zwei Jahren mit +37 Prozent besonders stark aus.
• Auch die Intensität und Häufigkeit der Suche wächst an: Im Jahre 2001 wurde solche Infos im Durchschnitt nur etwa 3mal im Monat gesucht, aktuell sind es fast doppelt so viele (5,7mal). Ähnlich hat sich der Anteil derjenigen verdoppelt, die sagen, sie würden oft Gesundheits-Infos suchen. Dies sind heute 26% aller Internet-Nutzer. (66% sagen: oft oder ab und zu).
• Parallel zu diesen Trends sinkt jedoch das Vertrauen in die Seriosität und Verlässlichkeit der dargebotenen Informationen: Nur noch 26% bewerten die Websites als sehr zuverlässig, das sind deutlich weniger als 2005 (37%)
• Ähnlich scheint sich auch die Unübersichtlichkeit und Vielzahl der Websites negativ auszuwirken. 2007 bewerten nur noch 37% ihre Suchbemühungen als sehr erfolgreich, zwei Jahre zuvor waren es noch 46%.
• Mehr als die Hälfte der Befragungsteilnehmer (58%) gibt an, dass sie über die gefundenen Informationen auch mit ihrem Arzt sprechen. Für diese Quote sind keine zeitlichen Veränderungen erkennbar.
Hier ist eine ausführliche Pressemitteilung mit allen Befragungsergebnissen Harris Poll Shows Number of "Cyberchondriacs" - Adults Who Have Ever Gone Online for Health Information- Increases to an Estimated 160 Million Nationwide
Gerd Marstedt, 1.8.2007
Gesundheits-Informationen im Internet: Websites der Regierung werden ebenso weggeklickt wie die der Pharma-Industrie
 Internet-Nutzer, die nach Gesundheits- oder Krankheits-Informationen suchen, mögen Websites mit sehr detaillierten medizinischen Informationen, wie sie von staatlicher Seite veröffentlicht werden, gar nicht. Aber auch Websites der Pharma-Industrie werden schnell weggeklickt. Von Interesse sind hingegen Seiten mit einem "human touch", wo also beispielsweise persönliche Erfahrungsberichte anderer Seitenbesucher über ihre Krankheit oder Therapie zu finden sind. Dies sind Befunde eines englischen Forschungsprojekts, die von Wissenschaftlern der Universitäten Northumbria and Sheffield jetzt veröffentlicht wurden.
Internet-Nutzer, die nach Gesundheits- oder Krankheits-Informationen suchen, mögen Websites mit sehr detaillierten medizinischen Informationen, wie sie von staatlicher Seite veröffentlicht werden, gar nicht. Aber auch Websites der Pharma-Industrie werden schnell weggeklickt. Von Interesse sind hingegen Seiten mit einem "human touch", wo also beispielsweise persönliche Erfahrungsberichte anderer Seitenbesucher über ihre Krankheit oder Therapie zu finden sind. Dies sind Befunde eines englischen Forschungsprojekts, die von Wissenschaftlern der Universitäten Northumbria and Sheffield jetzt veröffentlicht wurden.
Die Studie wurde in drei aufeinanderfolgenden Etappen durchgeführt. In einer ersten Phase bat man Benutzer von Internet-Cafes ein Tagebuch zu führen über ihre Surf-Erfahrungen bei der Suche nach Gesundheits-Informationen. Dabei waren drei Themen vorgegeben: Informationen zur weiblichen Menopause, zu Bluthochdruck und zu Änderungen des persönlichen Gesundheitsverhaltens. In der zweiten Phase beantworteten etwa 2.000 Internetnutzer einen ausführlichen Fragebogen über ihre Erfahrungen mit Gesundheits-Infos im WWW. In einer dritten Phase schließlich wurde ein Experiment durchgeführt, indem man zwei Websites (über Alkohol-Risiken) mit ähnlichem Inhalt vorgab, dabei aber bestimmte Merkmale variierte. Hier sollte getestet werden, ob die zuvor erkannten Merkmale vertrauenswürdiger und weniger vertrauenswürdiger Seiten auch in der Praxis funktionieren.
Die Wissenschaftler stellten fest, dass die typischen Suchstrategien der Nutzer sich in drei Phasen vollziehen: Einer ersten Phase des schnellen Überfliegens einer Vielzahl aufgesuchter Seiten, einer zweiten Phase, in der recht genau der Inhalt einiger weniger übrig gebliebener Seiten geprüft wird. In einer letzten Phase werden dann Informationen auf diesen Seiten miteinander verglichen werden und einige wenige stabilisieren sich zu eigenen Lieblingsseiten.
Dabei fand sich das überraschende Ergebnis, dass schon in der ersten Phase Websites von Pharma-Unternehmen oder solche von staatlichen Gesundheitsbehörden (National Health Service) schnell wieder verlassen wurden. "Die medizinischen Informationen von Pharma-Unternehmen sind meist sehr zuverlässig", erklärte Professor Pamela Briggs, eine der Wissenschaftlerinnen des Projekts. Aber die Besucher misstrauten den Motiven und Zielsetzungen der Pharmaunternehmen. Websites mit Werbebannern für Medikamente oder ähnliches werden daher fast schon reflexartig wieder verlassen. "Unparteilichkeit ist bei der Suche nach Gesundheitsinformationen eine unabdingbare Voraussetzung, um Vertrauen zu haben." Doch auch den staatlichen Websites ging es nicht viel besser. Auch sie wurden meist schon nach schnellem Überfliegen wieder verlassen, meist deshalb, weil dort viel zu viel Informationen oder viel zu allgemeine Texte angeboten wurden.
Große Resonanz finden anderseits aber Websites, mit einem "human touch". Benutzer finden Seiten interessant, auf denen andere ihre persönlichen Erfahrungen mitteilen, über erlittene Krankheiten, erfolgreiche und erfolglose Therapien. Mitteilungen anderer über ihre persönlichen Probleme und Sorgen sind offensichtlich ein Kernelement, um Vertrauen aufzubauen. Von daher finden englische Seiten wie DIPEX - Database of Individual Patient Experiences oder Project AWARE ganz besonderen Zuspruch. Allerdings erkennen die Wissenschaftler hier auch Risiken der Manipulation. Es sei nicht auszuschließen, dass solche als besonders vertrauenswürdig erscheinenden Websites mit User-Beiträgen auch manipulativ mit Informationen gefüttert werden, die von Beauftragten aus dem Umfeld kommerzieller Einrichtungen und Unternehmen kommen.
Gleichwohl haben sie auch einige Regeln veröffentlicht, wie man eine Gesundheitsseite gestalten sollte, um bei Benutzern überhaupt auf Resonanz zu stoßen. Dazu zählt etwa: Keine Bannerwerbung für Medizinprodukte, Eigene Motive und Zielsetzungen verdeutlichen, Links zu vertrauenswürdigen Seiten mit ähnlichem Inhalt, Möglichkeiten für Benutzer-Beiträge (z.B. Forum) einrichten, interaktive Elemente und andere Info-Möglichkeiten (Email, Newsletter, RSS), Möglichkeit zur persönlichen Einrichtung der Seiteninformationen, klare Hinweise geben zum Datenschutz.
• Hier ist eine Pressemitteilung mit einer Zusammenfassung der Projektergebnisse: Prescriptions for Health Advice Online
• Hier ist eine ausführliche Projektbeschreibung mit Ergebnissen (PDF, 12 Seiten): Bodies Online - Information and advice-seeking in the health and fitness domain
• Hier sind weitere Veröffentlichungen aus dem Projekt
• Ein Aufsatz mit Projektergebnissen, veröffentlicht in "Social Science & Medicine" (Vol. 64, Issue 9, May 2007, Pages 1853-1862): How do patients evaluate and make use of online health information?
Gerd Marstedt, 7.3.2007
"Vorsicht Nichtnutzer" - Von der immer noch begrenzten Reichweite von Gesundheitsinformationen im Internet
 Immer mehr Institutionen und Experten im Gesundheitswesen bieten wichtige Informationen größtenteils und am aktivsten und sogar ausschließlich im Internet an. Dazu gehören etwa die pflichtgemäßen Basis-Qualitätsberichte aller deutschen Krankenhäuser, die dieses Jahr zum zweiten Mal praktisch ausschließlich als PDF-Dateien über ein zentrales Internetportal erhältlich sind. Auch die mittlerweile zahlreichen Navigatoren und Quintessenzen zu diesen Berichten stehen vorrangig im Internet zur Verfügung. Schriftliche Führer gibt es zwar, sie kosten aber meist etwas und bedürfen des Gangs in eine Buchhandlung.
Immer mehr Institutionen und Experten im Gesundheitswesen bieten wichtige Informationen größtenteils und am aktivsten und sogar ausschließlich im Internet an. Dazu gehören etwa die pflichtgemäßen Basis-Qualitätsberichte aller deutschen Krankenhäuser, die dieses Jahr zum zweiten Mal praktisch ausschließlich als PDF-Dateien über ein zentrales Internetportal erhältlich sind. Auch die mittlerweile zahlreichen Navigatoren und Quintessenzen zu diesen Berichten stehen vorrangig im Internet zur Verfügung. Schriftliche Führer gibt es zwar, sie kosten aber meist etwas und bedürfen des Gangs in eine Buchhandlung.
Wie eine Pressemitteilung zu der neuesten Auswertung der Befragung privater Haushalte zur Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien des Statistischen Bundesamtes für das erste Quartal 2006 zeigt, nutzt aber insgesamt immer noch ein Drittel aller Bundesbürger über 10 Jahren das Internet gar nicht. Immerhin wuchs der Anteil der Internetnutzer seit 2002 mit 46 % über 61 % im Jahr 2005 auf mittlerweile 65 %.
Die gerade für Informationen zur Nutzung der Gesundheitsversorgung zentrale altersspezifische Nutzung offenbart spezifisch problematische Ungleichheiten: 2006 waren 92 % der 10- bis 24-Jährigen online. In der nächstalten Gruppe der bis zu 54 Jahren alten BürgerInnen nutzen 80 % das Internet regelmäßig. Völlig anders sah es aber bei den über 54 Jahre alten BürgerInnen aus: Der Anteil der Internetnutzer lag hier, d.h. bei der Gruppe mit der höchsten Nutzung des Gesundheitswesens und damit auch einem sehr großen Informationsbedarf, bei 30 %.
Gegen diese Unterschiede sind die zwischen Frauen und Männern verhältnismäßig gering: 60 % der Frauen und 71 % der Männer gehörten im 1. Quartal 2006 zu den Internetnutzern.
Wie in früheren Jahren dürften auch in Kürze noch differenzierte Ergebnisse in Broschürenform über die Website des Statistischen Bundesamtes erhältlich sein.
Wie eine europaweite Studie der EU über die "Internetnutzung durch Privatpersonen und Unternehmen" von Morag Ottens für das Jahr 2005 zeigt, existieren aber zusätzlich massive Unterschiede zwischen den Nutzungsmöglichkeiten und der Nutzung des Internets durch die städtische oder Ballungsraumbevölkerung und durch die ländliche Bevölkerung. Dies hängt zum Teil von der ungleichen Versorgung oder Ausstattung mit Breitbandtechnologie bzw. DSL ab, die aber auch in Städten ungleiche Chancen der Internetnutzung schafft. Wer einmal mit einem 28,8 oder 56k-Modem versucht hat, grafisch aufgemotzte Informationsangebote zu nutzen, weiß, welche reale Bedeutung solche technischen Bedingungen für die Nutzung oder Nichtnutzung des Internets haben.
Bernard Braun, 28.2.2007
Gesundheits-Infos im Internet: Kein "Arzt per Mausklick", sondern Medizin-Lexikon und Gesundheits-Enzyklopädie
 "Jeder dritte Deutsche sucht medizinischen Rat im Internet" heißt es in einer Meldung des Bundesverbands Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien (BITKOM). In einer Info-Grafik wird dann mit der Überschrift "Wenn der Arzt per Mausklick kommt" angedeutet, dass Internet diene heutzutage als bequemes Medium zur Beratung oder Information von Patienten bei gesundheitlichen Beschwerden oder Erkrankungen. Tatsächlich ist das Internet, wie andere Studien zeigen, heute für die meisten User kein therapeutischer Ratgeber bei Gesundheitsproblemen oder Beratungsinstanz bei akuten Erkrankungen, sondern eher eine Enzyklopädie zur Befriedigung von Wissensbedürfnissen und Neugier in Bezug auf Gesundheitsthemen.
"Jeder dritte Deutsche sucht medizinischen Rat im Internet" heißt es in einer Meldung des Bundesverbands Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien (BITKOM). In einer Info-Grafik wird dann mit der Überschrift "Wenn der Arzt per Mausklick kommt" angedeutet, dass Internet diene heutzutage als bequemes Medium zur Beratung oder Information von Patienten bei gesundheitlichen Beschwerden oder Erkrankungen. Tatsächlich ist das Internet, wie andere Studien zeigen, heute für die meisten User kein therapeutischer Ratgeber bei Gesundheitsproblemen oder Beratungsinstanz bei akuten Erkrankungen, sondern eher eine Enzyklopädie zur Befriedigung von Wissensbedürfnissen und Neugier in Bezug auf Gesundheitsthemen.
Die von der BITKOM mitgeteilten Daten über die Internet-Nutzung stammen aus der EUROSTAT-Statistik "Beschaffung gesundheitsrelevanter Informationen im Internet". Erfasst wurde dort mit einer einzelnen Frage, ob man das Internet für die Beschaffung von gesundheitsrelevanten Informationen über Verletzungen, Krankheiten oder Ernährung genutzt hat. Dort zeigt sich, dass Frauen im Alter von 24 bis 54 Jahren das Internet für Gesundheits-Infos am häufigsten nutzen (49%), Die Nutzungsquote steigt mit zunehmendem Lebensalter (für Männer und Frauen) zunächst an, sinkt dann aber ab dem Alter von 55 wieder deutlich nach unten - ein Hinweis, dass Senioren trotz ihres im Durchschnitt schlechteren Gesundheitszustandes noch Probleme mit der Nutzung des Internet haben. Spitzenreiter der WWW-Nutzung für Gesundheitsfragen sind hier Finnland (44%) und die Niederlande (45%), Deutschland liegt mit 34% im Mittelfeld. Weit unten rangieren südeuropäische Staaten wie z.B. Italien (12%) oder Portugal (14%), aber auch alle neuen EU-Mitglieder in Osteuropa.
Die Feststellung, dass das Internet eher als Informationsquelle zur Befriedigung von Wissensbedürfnissen, zur Befriedigung der Neugier in medizinischen Fragen dient, dass dabei jedoch kein gesundheitlicher Problemdruck vorliegt, etwa aufgrund akuter Erkrankungen, aktueller Schmerzen oder Beschwerden, geht aus zwei Studien hervor, die sich mit dieser Frage intensiver beschäftigt haben. So hat eine repräsentative Befragung des "Gesundheitsmonitor" der Bertelsmann-Stiftung zu gesundheitlichen Informationsbedürfnissen und -gewohnheiten bei rund 1.500 Bürgern einerseits ergeben, dass mit zunehmender Betroffenheit von Gesundheitsbeschwerden zwar die Suche nach gesundheitlichen Informationen (bei Ärzten, im Freundes- oder Familienkreis usw.) steigt. Gleichzeitig zeit sich jedoch auch: Wer von chronischer Erkrankung betroffen ist und wer seinen Gesundheitszustand eher schlecht bewertet, ist deutlich seltener auch ein Internet-Nutzer in gesundheitsbezogenen Fragen. Kontrolliert wurden dabei auch Einflüsse von Alter, Bildungsstand und Geschlecht. Gefolgert wird aus den Ergebnissen, dass das Internet - in deutlichem Kontrast zum Hausarzt - keine Informationsquelle zum aktuellen "Management" von Gesundheitsbeschwerden ist. Es wird deutlich seltener genutzt, wenn Befragte sich krank fühlen und ihren Gesundheitszustand als weniger gut oder schlecht beschreiben."
• Die Studie ist hier zum Download verfügbar: Auf der Suche nach gesundheitlicher Information und Beratung: Befunde zum Wandel der Patientenrolle
Noch deutlicher wird dieses Fazit im Rahmen einer Repräsentativbefragung im Land Bremen. Dort waren über 4.000 Bürger in zu ihren Informationsgewohnheiten und -interessen zu Gesundheitsthemen befragt worden. Das Fazit dieser Studie lautet: Das Internet wird ganz überwiegend als elektronisches Gesundheits- oder Medizinlexikon in Anspruch genommen, in dem man sich bequem über Krankheitssymptome und Krankheitsursachen, aber auch über unterschiedliche Therapieformen informieren kann, schulmedizinische wie alternativmedizinische. Als Telefonbuch oder Branchenverzeichnis zur Arzt- oder Adressensuche fungiert es weniger oft, und nur ausnahmsweise wird es als kommunikatives Medium in Gesundheitsfragen (Diskussionsforen, Chat-Rooms) genutzt. Zugleich zeigt sich: Der Hausarzt wird umso häufiger gefragt, je schlechter die gesundheitliche Verfassung ist. Daher ist das Internet - in deutlichem Kontrast zum Hausarzt - keine Informationsquelle, die als Verhaltensratgeber bei Gesundheitsbeschwerden oder Erkrankungen dient.
• Eine ausführliche Beschreibung der Ergebnisse ist hier verfügbar: Gesundheitliche Information und Beratung aus Sicht der Bremer Bevölkerung
Gerd Marstedt, 16.2.2007
Ratlose oder informierte Patienten? Unabhängige Patientenberatung Deutschland nimmt ihre Arbeit auf
 "Hat mein Arzt auch die richtige Diagnose gestellt?", "Helfen alternative Heilmethoden bei meiner Erkrankung vielleicht besser?", "Die Krankenkasse hat meine Kur abgelehnt, was kann ich machen?" - mit solchen Fragen blieben Patienten bislang oft allein und auf sich gestellt. Ab sofort sollen Beratungsstellen der Unabhängigen Patientenberatung Deutschland (UPD) hier Abhilfe schaffen. In bundesweit 26 regionalen und überregionalen Beratungsstellen sowie über ein Beratungstelefon finden Patienten jetzt auch außerhalb der Arztpraxis gesundheitliche Information und Beratung. Ein Team von fachkundigen Beratungskräften steht zur Verfügung für Informationen rund um das Thema Gesundheit sowie zu speziellen patientenrelevanten Themen wie Zahnersatz oder Medikamente, Beratung in gesundheitsrechtlichen Fragen sowie Auskünfte über ergänzende regionale Angebote der Gesundheitsversorgung. Die Berater kommen vorwiegend aus dem medizinischen oder pharmakologischen Fachbereich, sind aber auch Juristen, Sozialarbeiter oder Psychologen.
"Hat mein Arzt auch die richtige Diagnose gestellt?", "Helfen alternative Heilmethoden bei meiner Erkrankung vielleicht besser?", "Die Krankenkasse hat meine Kur abgelehnt, was kann ich machen?" - mit solchen Fragen blieben Patienten bislang oft allein und auf sich gestellt. Ab sofort sollen Beratungsstellen der Unabhängigen Patientenberatung Deutschland (UPD) hier Abhilfe schaffen. In bundesweit 26 regionalen und überregionalen Beratungsstellen sowie über ein Beratungstelefon finden Patienten jetzt auch außerhalb der Arztpraxis gesundheitliche Information und Beratung. Ein Team von fachkundigen Beratungskräften steht zur Verfügung für Informationen rund um das Thema Gesundheit sowie zu speziellen patientenrelevanten Themen wie Zahnersatz oder Medikamente, Beratung in gesundheitsrechtlichen Fragen sowie Auskünfte über ergänzende regionale Angebote der Gesundheitsversorgung. Die Berater kommen vorwiegend aus dem medizinischen oder pharmakologischen Fachbereich, sind aber auch Juristen, Sozialarbeiter oder Psychologen.
Die Spitzenverbände der gesetzlichen Krankenkassen fördern die unabhängige Patientenberatung in einem Modellvorhaben nach § 65 b SGB V. Diese Finanzierung ermöglicht eine kostenfreie persönliche Beratung. Das von Sozialverbänden und Verbraucherzentralen getragene Netzwerk hat bundesweit 22 Beratungsstellen mit Gesundheits-, Rechts- und Sozialexperten sowie eine Telefon-Hotline. Finanziert wird der Modellverbund zunächst bis 2010 mit rund 5,1 Millionen Euro jährlich.Dann soll entschieden werden, ob das Vorhaben zu einer dauerhaften Einrichtung im Gesundheitswesen ausgebaut werden soll.
Zwar geistert in der wissenschaftlichen Szene seit einigen Jahren das Schlagwort vom "informierten Patienten" herum. Dass es bei Patienten trotz besserer medizinischer Laienkenntnisse als in früheren Generationen gleichwohl einen erheblichen und bislang weitgehend unbefriedigten Bedarf an solchen Informations- und Beratungsmöglichkeiten gibt, zeigen verschiedene Befunde:
• 60.000 Anfragen erhielt die Patientenbeauftragte der Bundesregierung, Helga Kühn-Mengel, in den letzten zwei Jahren
• Eine vom Commonwealth Fund (CWF) durchgeführte internationale Erhebung zur Qualität der Versorgung (Taking the Pulse of Health Care Systems: Experiences of Patients with Health Problems in Six Countries) zeigt im deutschen Gesundheitssystem insbesondere Defizite im Bereich der Patienteninformation. In einer Zusammenfassung der Befunde durch das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen heißt es: "Deutsche Ärzte informieren ihre Patienten seltener über Behandlungsfehler. Wenn im Verlauf einer Behandlung Fehler auftreten, teilen deutsche Ärzte oder andere im Gesundheitswesen Beschäftigte ihren Patienten dies seltener mit, als es in anderen Ländern der Fall ist. [...] Deutsche Patienten berichten auch häufiger, dass ihr Hausarzt sie selten oder nie über mögliche Nebenwirkungen von Medikamenten aufklärt." vgl. Qualität der Gesundheitsversorgung in Deutschland
• In repräsentativen Befragungen des "Gesundheitsmonitor" der Bertelsmann-Stiftung hat sich gezeigt: "Offensichtlich ist Krankheit und Betroffenheit von Gesundheitsbeschwerden heute eine Erfahrung, die nicht mehr allein in die Zuständigkeit des Arztes übergeben wird und bei der man sich passiv in die Rolle eines Patienten begibt, der die Therapie ohne jedes Verständnis von Ursachen und Heilprinzipien über sich ergehen lässt. Vielmehr wird in dieser Situation aktiv nach Informationen gesucht, die sowohl ein besseres Verständnis des Krankheitsgeschehens ermöglichen als auch die Chance eröffnen, eine vielleicht noch bessere (mit weniger Nebenwirkungen verbundene, schnellere, komfortablere, neuere, ...) Therapie ausfindig zu machen. Zu einem gewissen Anteil scheint dahinter auch eine wachsende Skepsis an ärztlicher Fachkompetenz und Unfehlbarkeit verborgen zu sein. Bedeutsamer scheint nach unserer Interpretation jedoch ein genereller Wandel der Patientenrolle zu sein." vgl. Auf der Suche nach gesundheitlicher Information und Beratung: Befunde zum Wandel der Patientenrolle
Dass Patientenberatungsstellen gerade wegen der Informationsüberflutung auch in Gesundheitsfragen in Zeitschriften, Fernsehsendungen und im Internet besonders wichtig sind, hat eine Bevölkerungsumfrage im Land Bremen gezeigt. Zusammenfassend heißt es dort: "Das im Internet oder anderen Medien vermittelte Wissen ist oftmals nur sehr schwierig auf die eigene psycho-physische Verfassung übertragbar, die Verhaltensratschläge sind vieldeutig oder abstrakt, die Zuverlässigkeit der Information bleibt nicht selten unklar. Hier bleiben dann Fragen offen oder tauchen ganz neue Fragen auf. Vermisst wird dann eine vertrauenswürdige Einrichtung oder Person, die medizinische Informationen hinsichtlich ihrer Relevanz und Verhaltensimplikationen für die persönliche Situation interpretiert. Vermisst werden von Patienten heute Informationen über die Akteure und Einrichtungen im Gesundheitswesen, 'Lotsen' und 'Wegweiser' zu Ärzten, Kliniken und Beratungseinrichtungen, da sehr starke Interessen an einer persönlich zugeschnittenen Information und Beratung bestehen, die von Medien nicht geleistet werden kann." In dieser Studie hat sich auch gezeigt, dass Beratungsstellen in der Bevölkerung zwar noch wenig bekannt sind. Patienten jedoch, die dort eine Beratung in Anspruch genommen haben, urteilen überaus positiv über ihre dort gemachten Erfahrungen. vgl. Gesundheitliche Information und Beratung aus Sicht der Bremer Bevölkerung
Gerd Marstedt, 31.1.2007
Neue Wege der Patienteninformation: Callcenter, Beratungsstellen, Internet
 Eine nach wie vor aktuelle und überaus umfangreiche Dokumentation von Forschungsergebnissen zum Thema "Patienteninformation" liefert der Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen in seinem Gutachten 2003 "Finanzierung, Nutzerorientierung und Qualität". Leider ist das rund 100seitige Kapitel, das einen Überblick über den Wissensstand gibt, sehr verborgen unter der Überschrift "Wege zur Nutzerorientierung und Partizipation" (Seite 181-282).
Eine nach wie vor aktuelle und überaus umfangreiche Dokumentation von Forschungsergebnissen zum Thema "Patienteninformation" liefert der Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen in seinem Gutachten 2003 "Finanzierung, Nutzerorientierung und Qualität". Leider ist das rund 100seitige Kapitel, das einen Überblick über den Wissensstand gibt, sehr verborgen unter der Überschrift "Wege zur Nutzerorientierung und Partizipation" (Seite 181-282).
Fragestellungen und Themen, über die anhand neuerer Untersuchungen berichtet wird, sind dort: Bürgerbeteiligung und Partizipation von Patienten, Notwendigkeit der Information und Beratung von Patienten, Einrichtungen zur Verbraucher- und Patienten-Beratung, Callcenter von Krankenkassen als Informationsangebot in medizinischen Fragen, Stellenwert des Internet als gesundheitliches Informationsmedium, Möglichkeiten der Qualitätssicherung. Der Bericht wird abgerundet durch umfangreiche Literaturhinweise.
SVR-Gutachten 2003 zum Thema Information und Beratung von Patienten
Gerd Marstedt, 14.8.2005