



Home | Patienten | Gesundheitssystem | International | GKV | Prävention | Epidemiologie | Websites | Meilensteine | Impressum
Sämtliche Rubriken in
"Patienten"
Disease Management (DMP), Qualitätssicherung |
Verhaltenssteuerung (Arzt, Patient), Zuzahlungen, Praxisgebühr |
Alle Artikel aus:
Patienten
Disease Management (DMP), Qualitätssicherung
Überversorgung in der Medizin aus Sicht von Patienten und Ärzten
 Wie das Thema medizinischer Überversorgung von Patienten und Ärzten wahrgenommen wird, untersuchte das Kölner rheingold Institut im Auftrag der Bertelsmann Stiftung mithilfe einer Befragung von Patienten und Ärzten. Die Methode der offenen Befragung soll Einblicke in die Sichtweisen, Motivationen und Entscheidungsprozesse im Zusammenhang mit medizinischer Behandlung gewähren. Die Studie wurde im Vorfeld und zur Unterstützung des Choosing Wisely International Roundtable veröffentlicht, der Anfang Oktober in Berlin stattfand.
Wie das Thema medizinischer Überversorgung von Patienten und Ärzten wahrgenommen wird, untersuchte das Kölner rheingold Institut im Auftrag der Bertelsmann Stiftung mithilfe einer Befragung von Patienten und Ärzten. Die Methode der offenen Befragung soll Einblicke in die Sichtweisen, Motivationen und Entscheidungsprozesse im Zusammenhang mit medizinischer Behandlung gewähren. Die Studie wurde im Vorfeld und zur Unterstützung des Choosing Wisely International Roundtable veröffentlicht, der Anfang Oktober in Berlin stattfand.
Die folgenden Ergebnisse beziehen sich auf die Aussagen von 24 Patienten und 15 Ärzten. Damit bietet die Studie Einblicke, aber naturgemäß keine Repräsentativität und somit auch keine Grundlage für Verallgemeinerungen.
Bei Patienten ist das Thema Überversorgung allgemein wenig präsent und wurde speziell in der eigenen Behandlung selten wahrgenommen. GKV-Versicherte befürchten eher Leistungseinschränkungen, von Seiten der PKV-Versicherten wird Überversorgung sogar als erwünschter Luxus betrachtet. Ängstliche Patienten fühlen sich durch ein Mehr an Versorgung ernst genommen und betrachten medizinische Leistungen, auch wenn sie Überversorgung bedeuten, als eine Art von Zuwendung. Insgesamt wird der Nutzen von Behandlungen überschätzt und die Risiken unterschätzt. Handeln schätzen Patienten häufig mehr als abwarten, mehr Behandlung wird mit mehr Nutzen verbunden, ebenso wie "moderne" Methoden.
Bei den 14 befragten Ärzte ist das Thema Überversorgung präsent, teils als Reizthema, sie komme aber in der eigenen Praxis eher nicht vor. GKV-Leistungen seien gedeckelt, der Budgetrahmen wird als fehlende Wertschätzung wahrgenommen, drohende finanzielle Verluste würden zu Gegenreaktionen zwingen, die in Überversorgung münden könnten. Überversorgung entstehe auch durch Beruhigung ängstlicher Patienten mithilfe von an sich überflüssigen Leistungen, durch nicht notwendige Diagnostik im Rahmen einer Defensivmedizin zur eigenen Absicherung und durch Nachgeben gegenüber Forderungen von Patienten.
Sowohl aus Sicht der Patienten als auch der Ärzte sind gute Informationen und Aufklärung das beste Gegenmittel gegen Überversorgung.
Die hier sehr knapp dargestellten Ergebnisse bestätigen und vertiefen das aus anderen Studien vorhandene Wissen über einige "Treiber" der Überversorgung.
Uwe Hambrock. Erfahrungen mit Überversorgung. Qualitativ-psychologische Studie mit Patienten und Ärzten. Bertelsmann Stiftung. 2019 Website und kostenloser Download
David Klemperer, 8.12.19
"Englische Zustände" bei der Qualitätsüberprüfung und -bewertung von Gesundheits- und Sozialeinrichtungen - ein Vorbild!?
 In Ergänzung zu ihrem aktuellen 149 Seiten umfassenden Bericht "The state of health care and adult social care in England 2015/16" hat die unabhängige "Care Quality Commission (CQC)" für den "National Health Service (NHS)" Großbritanniens gerade einen beispielhaften ergänzenden Bericht veröffentlicht.
In Ergänzung zu ihrem aktuellen 149 Seiten umfassenden Bericht "The state of health care and adult social care in England 2015/16" hat die unabhängige "Care Quality Commission (CQC)" für den "National Health Service (NHS)" Großbritanniens gerade einen beispielhaften ergänzenden Bericht veröffentlicht.
Im zuerst genannten Care-Bericht ergibt sich auch für Großbritannien das übliche Bild von erheblichen Unterschieden für ausgewählte Versorgungsbereiche (z.B. Adult social care, Acute hospitals, community health services and ambulance services, Mental health, primary medical services) nach Regionen und stationären Anbietern. In einer interaktiven Landkarte sind die von der CQC im Detail untersuchten und bewerteten Versorgungsanbieter zum einen mittels einer modifizierten Ampelkennzeichnung von blau ("outstanding") bis rot ("inadequate") geratet - gelb für "requires improvement" überwiegt bei weitem. 8% aller bewerteten Einrichtungen erhielten das Urteil "inadequate". Per Mausklick kann man für jede Einrichtung auch Details erfahren (z.B. Bewertung der Chirurgie oder der "end of life care").
Dass diese regulatorische Tätigkeit mit dieser Transparenz wahrscheinlich zu Verbesserungen führt, zeigt sich daran, dass sich 76% der Anbieter, die beim letzten Rating als "inadequate" bewertet wurden, aktuell verbessert haben. Dass auch dieses Regulationsverfahren nicht immer so erfolgreich ist wie erwartet, zeigt sich daran, dass sich 47% der Einrichtungen, die bei der vorletzten Überprüfung gesagt bekamen, sie bedürften Verbesserungen, aktuell nicht verändert hatten.
Diese Ratingergebnisse werden nun durch eine knappe Übersicht über namentlich genannte "models of good practice" u.a. bei der Sicherheit, der Wirksamkeit und der Leitungsqualität der Angebote ergänzt. Dort kann man teilweise konkret nachvollziehen was die hohe Qualität ausmacht und wie die genannten Einruichtungen dies geschafft haben. Wer die gute Praxis auch hinbekommen will, weiß, wo er sich zum "wie" erkundigen kann.
Die 32-seitige Broschüre Celebrating good care, championing outstanding care ist im April 2017 erschienen und kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 30.4.17
Hohe Evidenz für die Bedeutung von Patientenerfahrungen als Säule der Versorgungsqualität.
 Eignen sich die Erfahrungen von Patienten als eine der Säulen zur Bewertung der Sicherheit und klinischen Wirksamkeit von Gesundheitsversorgung oder sollte man dies lieber weiter den Experten überlassen? Wer hier mit "ja" antwortet, muss klären, welche Aspekte und Facetten der Patientenerfahrungen Indikatoren für die klinische Wirksamkeit und die patientenbezogenen Sicherheit bzw. die Ergebnisqualität gesundheitsbezogener Leistungen sind. Und auch hier gilt wie bei medizinischen Indikatoren und Interventionen, dass die Antwort nicht vom "guten Gefühl" bei der Berücksichtigung von Patientenerfahrungen oder -bewertungen abhängig sein darf, sondern von der gesicherten Evidenz ihrer Links oder Assoziationen mit Qualität, Wirksamkeit und Sicherheit.
Eignen sich die Erfahrungen von Patienten als eine der Säulen zur Bewertung der Sicherheit und klinischen Wirksamkeit von Gesundheitsversorgung oder sollte man dies lieber weiter den Experten überlassen? Wer hier mit "ja" antwortet, muss klären, welche Aspekte und Facetten der Patientenerfahrungen Indikatoren für die klinische Wirksamkeit und die patientenbezogenen Sicherheit bzw. die Ergebnisqualität gesundheitsbezogener Leistungen sind. Und auch hier gilt wie bei medizinischen Indikatoren und Interventionen, dass die Antwort nicht vom "guten Gefühl" bei der Berücksichtigung von Patientenerfahrungen oder -bewertungen abhängig sein darf, sondern von der gesicherten Evidenz ihrer Links oder Assoziationen mit Qualität, Wirksamkeit und Sicherheit.
Ein am 3. Januar 2013 im "British Medical Journal (BMJ) Open" veröffentlichter systematischer Review der Ergebnisse von 55 Studien (z-.B. randomisierte kontrollierte Studien, Kohortenanalysen) zu diesen Zusammenhängen liefert zahlreiche Belege für derartige Assoziationen.
Dazu zählen u.a.
• der Nachweis, dass Patientenerfahrungen bei einer Fülle von Erkrankungen, in verschiedenen Studiendesigns (z.B. Surveys, Interviews, strukturierte Patient-Arzt-Gespräche), Settings (z.B. Krankenhäuser, Hausarztpraxen), Bevölkerungsgruppen und Ergebnisparametern (z.B. Anzahl der Arztbesuche, Erkrankungshäufigkeit, Komplikationen) positiv mit Patientensicherheit klinischer Wirksamkeit assoziiert sind, d.h. valide und reliable Hinweise auf die Ausprägungen der beiden Qualitätsparameter liefern,
• die positive und dann auch statistisch signifikante Assoziation von Patientenerfahrungen mit sieben Arten von Behandlungsergebnissen. Dazu zählt das subjektiv wahrgenommene aber auch objektive, d.h. durch Ärzte und andere Experten erhobene oder gemessene Behandlungsergebnis, die Adhärenz bei empfohlenen Medikationen und Behandlungen, die Inanspruchnahme präventiver Versorgungsangebote wie Impfungen und Screening-Untersuchungen, die Anzahl der Besuche oder Inanspruchnahme von Versorgungsressourcen im Krankenhaus oder in ambulanten Arztpraxen, die technische Behandlungsqualität und unerwünschte Ereignisse unter der Behandlung.
• In den 55 berücksichtigten Studien werden für diese sieben Facetten von Behandlungsqualität 312 positive Assoziationen dafür gefunden, dass die Patientenerfahrung verlässliche Hinweise auf die Qualität, d.h. Stärken und Schwächen von Gesundheitsversorgung liefert. Die Anzahl der fehlenden positiven Assoziationen beläuft sich dagegen auf lediglich 66. Überdurchschnittlich häufig finden sich Nachweise für positive Assoziationen bei objektiven Gesundheits-Outcomes (29 positive Assoziationen und 11 Fälle fehlender Assoziation), bei der Adhärenz von Behandlungen (152 und 7) und den unerwünschten Ereignissen (7 und 0). Selbst im Bereich der technischen Behandlungsqualität, wo der Anteil der nachgewiesenen Anzahl positiver Assoziationen unterdurchschnittlich ist, gibt es mit 8 mehr Untersuchungen, die eine positive Assoziation nachweisen als 4 in denen dieser Nachweis nicht zu finden ist.
Die Schlussfolgerungen der britischen Reviewergruppe lauten: Differenzierte und spezifische Patientenerfahrung sollten als einer der "central pillars" in die Bewertung der gesundheitsbezogenen Versorgungsqualität einbezogen werden. Klinische Wirksamkeit, Sicherheit und Patientenerfahrungen sollten nicht isoliert und einzeln, sondern als Gruppe von Faktoren behandelt werden. Den Erfahrungen von Patienten kommt dabei der evidenzgesicherte Part zu, nutzlose und unsichere Versorgungspraxis verlässlich zu identifizieren und die Wahrscheinlichkeit von Verbesserungen bei der Ergebnisqualität und Sicherheit zu verbessern. Direkt an die Ärzte und andere Experten gewandt weisen die selbst in Krankenhäusern arbeitenden Wissenschaftler abschließend auf eine Schlüsselvoraussetzung für den praktischen Nutzen der von ihnen gefundenen Assoziationen hin: "Clinicians should resist sidelining patient experience measures as too subjective or mood-orientated, divorced from the 'real' clinical work of measuring and delivering patient safety and clinical effectiveness."
Die im deutschen Gesundheitswesen immer noch weit verbreitete Praxis entweder Patienten gar nicht (z.B. in Arztpraxen) und überwiegend nach ihrer allgemeinen Zufriedenheit (z.B. in Krankenhäusern) zu fragen oder die gewonnenen Ergebnisse als Schrankware zu entsorgen und folgenlos zu machen, sollte nach diesen Ergebnissen ein rasches Ende nehmen.
Auch wenn die Autoren selbst auf Grenzen ihres aktuellen Reviews hinweisen, also z.B. ein Publikationsbias durch die in Veröffentlichungen Bevorzugung von Studien mit positiver Assoziation existieren könnte oder im Moment noch Studien aus den USA relativ stark vertreten sind, verbietet die Ergebnisfülle auf differenzierte Patientenerfahrungen als Qualitätssicherungs-Faktor weiterhin zu verzichten. Trotzdem vorhandene Forschungslücken sollten in weiteren systematischen Reviews möglichst bald geschlossen werden.
Der durch eine vorbildlich informative Dokumentation der berücksichtigten Studien äußerst materialreiche Aufsatz A systematic review of evidence on the links between patient experience and clinical safety and effectiveness von Cathal Doyle, Laura Lennox und Derek Bell ist in "BMJ Open" erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Hilfreich und erneut vorbildlich ist schließlich der Hinweis auf die Möglichkeit, 13 der im Aufsatz zitierten Aufsätze mittels eines entsprechenden Sammellinks ebenfalls komplett kostenlos einsehen zu können.
Bernard Braun, 3.4.13
90% der US- Muster-Krankenhäuser haben ein Programm zur Reduktion vermeidbarer Wiedereinweisungen von Herzpatienten, sagen sie!
 Zweite und weitere Krankenhausaufenthalte nach der Erstbehandlung von Herzversagen und akutem Herzinfarkt stellen für die PatientInnen mindestens eine enorme Beeinträchtigung ihrer Lebensqualität dar und können unter den Bedingungen einer Vergütung mit diagnosebezogenen Fallpauschalen (DRG) auch erhebliche Nachteile für das Krankenhaus haben - vor allem, wenn es sich um vermeidbare Wiedereinweisungen handelt. Deshalb gibt es Bemühungen, diese mit entsprechend differenzierten Programmen zu senken.
Zweite und weitere Krankenhausaufenthalte nach der Erstbehandlung von Herzversagen und akutem Herzinfarkt stellen für die PatientInnen mindestens eine enorme Beeinträchtigung ihrer Lebensqualität dar und können unter den Bedingungen einer Vergütung mit diagnosebezogenen Fallpauschalen (DRG) auch erhebliche Nachteile für das Krankenhaus haben - vor allem, wenn es sich um vermeidbare Wiedereinweisungen handelt. Deshalb gibt es Bemühungen, diese mit entsprechend differenzierten Programmen zu senken.
Fragt man, wie es jetzt eine ForscherInnengruppe in den USA gemacht hat, Krankenhausleitungen danach, was sie tun um die Anzahl der Wiedereinweisungen dieser Patientengruppen innerhalb der ersten 30 Tage nach Entlassung zu senken, geben 90% an, bei ihnen existierten dazu klare schriftliche Strategien und Maßnahmenpakete. Dies war eigentlich auch gar nicht anders zu erwarten, wenn man sich die Art der Krankenhäuser ansieht, die dazu in einem nationalen Survey befragt wurden. Es waren 594 Kliniken (Antwortrate 90,4%), die im Jahr 2010 Mitglied der Qualitätsverbesserungsinitiative "Hospital to Home (H2H)" waren.
Umso kritikwürdiger sieht aber die Qualitätssicherungsrealität im Lichte der Antworten auf konkrete Nachfragen zu den Einzelmaßnahmen aus mit denen die Kliniken das Ziel zu erreichen versuchten:
• 87% von ihnen hatten Qualitätsverbesserungsteams für PatientInnen mit Herzversagen und 54% für Herzinfarkt-PatientInnen.
• 49,3% gaben an, partnerschaftliche Kooperationen mit niedergelassenen Ärzten zu haben und zu pflegen.
• 23,5% hatten für PatientInnen mit hohem Krankheitsrisiko zweckbezogene Partnerschaften mit anderen örtlichen Krankenhäusern.
• In 28,9% der befragten Krankenhäuser wurden routinemäßig die Angaben über die Art und die Menge ambulanten und stationären Verordnungen von Arzneimitteln zusammengeführt, bewertet und bei der weiteren Medikation berücksichtigt.
• 25,5% der Kliniken gaben an, sie würden eine Zusammenfassung aller Entlassungsdaten immer direkt an den ambulanten (weiter)behandelnden Arzt des Patienten schicken.
• Von 10 nützlichen Praktiken und Maßnahmen (einige sind gerade genannt worden) zur Verringerung des Rehospitalisierungsrisikos nutzten die befragten Krankenhäuser im Durchschnitt 4,8 und nur weniger als 3% der befragten Kliniken nutzten alle 10. Einer kleinen Zahl von 12% aller Krankenhäuser mit weit unterdurchschnittlicher Nutzung (zwei und weniger der Maßnahmen) der angeblich schriftlich vereinbarten Maßnahmen steht eine ebenso kleine Gruppe mit überdurchschnittlicher Nutzung (8 und mehr dieser Maßnahmen) gegenüber.
Bedenkt man, dass es sich bei den befragten Krankenhäusern um eine positiv verzerrte Gruppe handelt, ist die enorme Diskrepanz zwischen der Schrift-Performance und den tatsächlich umgesetzten konkreten Maßnahmen bedenklich. Vor allem dann, wenn man weiter bedenkt, dass sich z.B. Patienten und ihre Ärzte bei der Auswahl eines Krankenhauses oft nur an den schriftlichen Angaben zur Existenz eines derartigen Programms oder entsprechenden Qualitätssiegeln orientieren können - wenn sie überhaupt die Wahl haben.
Die im deutschen Gesundheitswesen verbreitete Hoffnung, dass ein Entlassungs-, Überleitungs- oder versorgungskettenbezogenes Versorgungsmanagement in Krankenhäusern allein schon durch die gesetzliche Verpflichtung (neuerdings die gesetzliche Verpflichtung zu einem Versorgungsmanagement zwischen stationärer und ambulanter Behandlung nach § 11 Abs. 4 SGB V und zum Entlassungsmanagement der Krankenhäuser nach den §§ 39 und 112 SGB V) oder die Existenz von Leitbildern, Qualitätssiegeln etc. existiert und funktioniert, sollte im Lichte dieser Untersuchung gründlich hinterfragt werden. Außer der schon fast traditionelle Pawlowsche Reflex, das sei nur in den USA so und an deutschen Krankenhäuser kein Thema, funktioniert auch bei diesem Thema. Eine Überprüfung nach dem hier erprobten Modell wäre aber allemal vertrauenswürdiger.
Vom Aufsatz "Contemporary evidence about hospital strategies for reducing 30-day readmissions: a national study." von Bradley EH et al. in der Zeitschrift "Journal of American College of Cardiology" (14. August 2012; 60(7): 607-14) gibt es nur das Abstract kostenlos.
Für diejenigen LeserInnen, die einen Zugang zu dieser Zeitschrift haben lohnt sich auch die Lektüre des ausführlichen Kommentars "Hospital strategies to reduce heart failure readmissions: where is the evidence?" von Butler J und Kalogeropoulos A. in derselben Ausgabe der Zeitschrift (60[7]: 615-7), von dem es wie bei Kommentaren üblich noch nicht einmal ein Abstract gibt.
Wie der Titel ihres Kommentars bereits andeutet, weisen die Verfasser auf ein besonders in den USA existierendes Dilemma hin: Einerseits reagiert Medicare, die staatliche Krankenversicherung für Ältere, auf Qualitätsmängel bei der stationären Versorgung, und dazu zählen vermeidbare Wiedereinweisungen in den ersten 30 Tagen nach Entlassung mit derselben Indikation, mit spürbaren Abschlägen bei der Honorierung. Darauf reagieren die Krankenhäuser u.a. verstärkt mit Maßnahmen, die z.B. Wiedereinweisungen reduzieren helfen sollen.
Andererseits bedeutet dies, dass häufig Maßnahmen entwickelt und eingesetzt werden, die "are neither proven nor primarily based on the motivation to improve patient outcomes, but rather on the fear of punitive financial disincentives. Would these enormous resources spent by hospitals to randomly implement unproven interventions be better spent on actually studying what the real determinants of HF (heart failure) hospitalizations are and which interventions will prove to be beneficial? Such questions are difficult to answer when policy trumps science. We agree with the investigators in their concluding remarks that more evidence establishing the effectiveness of the various hospital practices is needed."
Bernard Braun, 9.11.12
"Pay for performance" auch nach 6 Jahren ohne positive Wirkung auf das Ergebnis "30-Tagesterblichkeit" in US-Kliniken
 Eines der jüngsten Patentrezepte in der langen Reihe von Honorierungskonzepten für eine bessere Gesundheitsversorgungsqualität ist "pay for performance" oder P4P.
Eines der jüngsten Patentrezepte in der langen Reihe von Honorierungskonzepten für eine bessere Gesundheitsversorgungsqualität ist "pay for performance" oder P4P.
Dass Ärzte und Krankenhäuser, die ihre Einnahmen im Rahmen solcher Programme erhöhen können, mit dieser Art der Verknüpfung des Erreichens definierter Qualitätsziele mit der Honorierung zufrieden sind, ist einleuchtend. Und ebenfalls, dass sich Patienten in einem Krankenhaus wohler fühlen, in dem sie möglicherweise (das hängt von vereinbarten Zielwerten ab) mehr nach ihrer Zufriedenheit gefragt werden und auch überhaupt oder intensiver auf die künftige Behandlung vorbereitet werden.
Frühere Studien in den USA oder in Großbritannien über die auch im Forum-Gesundheitspolitik berichtet wurde, hatten aber bereits deutlich auf kräftige Abweichungen der Wirklichkeit von den wunderbaren Erwartungen hingewiesen. So verbesserten z.B. meist nur Krankenhäuser ihre Behandlungsqualität, die bereits gut waren, während sich schlechtere Krankenhäuser entweder gar nicht an P4P-Programmen beteiligten oder dort nur wenig Qualitätsverbesserungen vorzuweisen hatten. Andere Studien wiesen auf die Indikationsspezifik der Wirkungen hin. Je nachdem um welche Erkrankung es sicher handelte gab es Verbesserungen aber auch Verschlechterungen der Qualität.
Eine nicht nur bei der Bewertung von P4P vernachlässigte Frage war, ob sich diese Honorierungsform auf die Ergebnisqualität der Behandlung auswirkt oder "nur" auf die Struktur- oder Prozessqualität. In diesem Zusammenhang taucht auch immer wieder die Frage auf, ob die Qualitätsverbesserungen erst nach längerer Einwirkzeit eintreten und ob sie dauerhaft sind.
Die Ende März 2012 im "New England Journal of Medicine (NEJM)" veröffentlichten Ergebnisse einer den Zeitraum 2003 bis 2009 umfassenden Studie, liefern dazu erste Antworten. In dieser derzeit umfassendsten P4P-Studie wird untersucht, ob sich der harte Ergebnisqualitätsindikator der 30-Tagesterblichkeit nach einer Entlassung aus dem Krankenhaus von rund 6 Millionen wegen eines akuten Herzinfarkts, einer Lungenentzündung, einer By pass-Operation oder einer Herzinsuffienz behandelten PatientInnen in 252 an dem Medicare-P4P-Programm "Premier Hospital Quality Incentive Demonstration (HQID)" von dem in 3.363 normalen Krankenhäusern unterscheidet.
Die mit einem erheblichen methodischen Aufwand analysierten Daten ergaben folgendes Bild:
• Die 30-Tage-Mortalität in den HQID-Krankenhäusern (12,33%) unterschied sich zu Beginn der Untersuchung gegenüber der in den Nicht-HQID-Kliniken (12,40%) nicht.
• An dieser Ähnlichkeit hat sich auch nach sechs Jahren Programmintervention nichts geändert (11,82% versus 11,74%). Es gab zwar leichte Verbesserungen, die aber in beiden Gruppen ähnlich ausfielen. Ein spezieller Effekt des P4P-Programms war nichts zu erkennen.
• Ein Vergleich der diagnosespezifischen Sterblichkeit bei Erkrankungen für deren Behandlung es P4P-Anreize gab mit anderen Erkrankungen, wo es solche Anreize nicht gab, lieferte ebenfalls keinen Beleg für eine besondere Wirkung dieser Anreize.
• In den Krankenhäusern mit schlechterer Start-Ergebnisqualität (15,12% versus 14,73%) gab es zwar während der Untersuchungszeit zwar Verbesserungen (13,37% versus 13,21%). Aber auch hier lässt sich kein spezifischer Effekt von P4P erkennen.
Erwartungen an Programme wie HQID, die Ergebnisqualität zu verbessern, sollten nach Meinung der WissenschaftlerInnen "remain modest". Der Aufsatz kommt aber auch bei Verbesserungen der Behandlungsprozessqualität auf der Basis entsprechender Literatur zu dem Ergebnis, dort gäbe es lediglich "modest improvements".
Was diese Ergebnisse für die in den USA geplante flächendeckende Übernahme des P4P-Systems bedeuten, ist offen. Wer in Deutschland aber mit dem Gedanken spielt das "US-Erfolgsmodell" zu übernehmen und damit das Nachdenken über andere Anreize einzustellen, sollte sich diese und ähnliche Studien genau anschauen und nicht erst 6 oder 9 Jahre warten, um u.U. ähnliche Ergebnisse gewonnen zu haben - wenn überhaupt Wirkungsforschung stattfindet.
Der Aufsatz "The Long-Term Effect of Premier Pay for Performance on Patient Outcomes" von Ashish K. Jha, Karen E. Joynt, E. John Orav und Arnold M. Epstein ist am 29. März 2012 im New England Journal of Medicine" (2012; 366: 1606-15) erschienen und in Gänze kostenlos erhältlich.
Auch der Kommentar Making the Best of Hospital Pay for Performance von Andrew Ryan und Jan Blustein (N Engl J Med 2012; 366: 1557-155) ist frei erhältlich.
Bernard Braun, 13.5.12
Qualitätsmanagement und Hygiene in Arztpraxen. Ergebnisse einer "nicht inzentivierten" Ärztebefragung
 Nicht nur für Krankenhäuser, sondern auch für die Praxen niedergelassener Ärzte mit ihren mehreren hundert Millionen Patient-Arztkontakten ist u.a. mit dem § 135a SGB V ("Vertragsärzte … sind … verpflichtet … einrichtungsintern ein Qualitätsmanagement einzuführen und weiterzuentwickeln.") Qualitätsmanagement (QM) und -sicherung gesetzlich vorgeschrieben. Dass dort auf eine ausreichende Hygiene geachtet wird, ist eigentlich auch ohne das SGB V bereits auf der Basis der hippokratischen Ethik (primum nihil nocere) nicht anders zu erwarten.
Nicht nur für Krankenhäuser, sondern auch für die Praxen niedergelassener Ärzte mit ihren mehreren hundert Millionen Patient-Arztkontakten ist u.a. mit dem § 135a SGB V ("Vertragsärzte … sind … verpflichtet … einrichtungsintern ein Qualitätsmanagement einzuführen und weiterzuentwickeln.") Qualitätsmanagement (QM) und -sicherung gesetzlich vorgeschrieben. Dass dort auf eine ausreichende Hygiene geachtet wird, ist eigentlich auch ohne das SGB V bereits auf der Basis der hippokratischen Ethik (primum nihil nocere) nicht anders zu erwarten.
Die Ergebnisse der gerade veröffentlichten Umfrage "Qualitätsmanagement, Patientensicherheit und Hygiene in der ärztlichen Praxis 2012" der Stiftung Gesundheit bei niedergelassenen Ärzten vermitteln einige interessante Einblicke in die Wirklichkeit.
Interessant und lehrreich sind bereits die Angaben zur Anzahl der befragten und antwortenden Ärzte: Danach haben von den 9.532 online angeschriebenen für die Gesamtheit der ambulant tätigen Ärzte repräsentativen Ärzten und Zahnärzten 290 (Antwortquote: 3,04 Prozent) aussagekräftige Antworten geliefert. Diesen wahrlich nicht gewaltigen Rücklauf rechtfertigen die AutorInnen der Studie mit Argumenten, die für die Ärzteschaft in jeder Hinsicht unschmeichelhaft sind: "Damit liegt der Rücklauf im zu erwartenden Rahmen für eine nicht inzentivierte, unangekündigte Online-Befragung ohne telefonisches Nachfassen."
Die QM- und Hygienewirklichkeit dieser 290 ÄrztInnen sieht dann so aus:
• Auch wenn niedergelassene Ärzte laut Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) seit 2010 die Planungs- und Umsetzungsphase für QM in ihren Praxen abgeschlossen haben müssen, die niedergelassenen Zahnärzte sogar schon seit 2009, geben noch immer 5,9 % der Ärzte und Zahnärzte an, sich bislang für kein QM-System entschieden zu haben. 12,1 % der Mediziner können aber auf Nachfrage nicht den Namen des von ihnen gewählten Systems angeben.
• Mehr als fünf Prozent der antwortenden Praxisbetreiber bescheinigen sich selbst ein schlechtes Hygiene-Niveau und konstatieren auch erhebliche Defizite in der wichtigsten Einzelmaßnahme (Händewaschen). 24,1 % geben ein nur mittelmäßiges Hygieneniveau in ihrer Praxis an und 22,9 % halten das Niveau der Hände-Desinfektion ebenfalls für mittelmäßig. "Insgesamt sehen also jeweils knapp 30 % deutliches Verbesserungspotenzial. Und während sich immerhin mehr als 50 Prozent ein sehr hohes Niveau bei der Hände-Desinfektion bescheinigen, sind es bei der Hygiene insgesamt weniger als 45 Prozent."
• Jede sechste Praxis hat schon einmal einen Hygieneberater in Anspruch genommen.
• "Betracht man die Gruppe derjenigen Praxen separat, die ein nicht optimales Hygieneniveau haben so wird erwartungsgemäß ein höherer Bedarf an Weiterbildung und spezifischen Initiativen gesehen, doch ist der Unterschied nicht sehr ausgeprägt. Auch in dieser Gruppe sehen 42 % keinen Handlungsbedarf - nicht-optimale Hygiene wird hier offenbar als ein verzeihliches Problem gesehen."
• "Bei der Frage, wer das Thema Hygiene bei den niedergelassenen Ärzten und Zahnärzten koordinieren und voranbringen sollte, liegt die Selbstverwaltung ganz vorn: Die Hälfte aller Nennungen entfielen auf die (Zahn-)Ärztekammern als Koordinator und Treiber. KVen, Fachgesellschaften und das Robert-Koch-Institut stehen mit jeweils etwa 30 % der Antworten an zweiter Stelle (Mehrfachnennungen waren möglich). Dagegen liegen diejenigen Institutionen, die eigentlich eine wichtige Rolle spielen sollten, nämlich die Landesgesundheitsämter, mit 16 % abgeschlagen an dritter Stelle."
Auch wenn die VerfasserInnen der Studie die kritischen Ergebnisse ihrer Umfrage als Zeichen des Vertrauens der Ärzte in die "Marke Stiftung Gesundheit" interpretieren, stellt sich doch die Frage nach ihrer Validität und Verallgemeinerbarkeit. Überträgt man Erfahrungen, dass solche Befragungen eher von denjenigen Personen beantwortet werden, die ihre Situation positiv bewerten, könnte die QM- und Hygienewirklichkeit in den ambulanten Praxen eher schlechter aussehen. Wer also ohne Zuhilfenahme von Incentives, sprich Geld und kostentreibendem enormen Kommunikationsaufwand mehr Ärzte zu einer Antwort bewegen kann, sollte diese inhaltlich wichtige Studie replizieren.
Die 32-seitige Studie "Qualitätsmanagement, Patientensicherheit und Hygiene in der ärztlichen Praxis 2012. Eine deutschlandweite Befragung niedergelassener Ärztinnen und Ärzte" von Konrad Obermann, Stefanie Woerns und Peter Müller gibt es komplett kostenlos.
Bernard Braun, 6.5.12
"Schrecklich, mit den Frühchen"! Aber: Ärzte und Pflegekräfte halten sich bei 52% bzw. 66% der Gelegenheiten an Hygienepflichten
 Die seit einigen Tagen laufenden öffentlichen Debatten über die Ursachen und die Vermeidbarkeit des Todes dreier so genannter "Frühchen" in der neonatologischen Spezialabteilung eines großen Bremer Krankenhauses, machen zum wiederholten Male innerhalb der letzten Jahre darauf aufmerksam, dass es auch in Krankenhäusern gesundheitliche oder auch tödliche Risiken gibt. Trotz aller professionellen Ethik und den ab dem 1.1. 2012 sogar bundesweit geltenden Infektionsschutz- oder Hygienevorschriften (bis 2011 gab es in mehreren Bundesländern solche Vorschriften überhaupt nicht), gilt neben der durch übermäßigen Antibiotikaeinsatz immer größer werdenden Anzahl multi-resistenter Krankheitserreger auch mangelnde Handhygiene als eine wichtige zum größten Teil vermeidbare Ursache für den jährlichen Tod von zig Frühgeborenen (die genaue Anzahl ist nicht bekannt) und mindestens 15.000 erwachsenen Patienten in Krankenhäusern.
Die seit einigen Tagen laufenden öffentlichen Debatten über die Ursachen und die Vermeidbarkeit des Todes dreier so genannter "Frühchen" in der neonatologischen Spezialabteilung eines großen Bremer Krankenhauses, machen zum wiederholten Male innerhalb der letzten Jahre darauf aufmerksam, dass es auch in Krankenhäusern gesundheitliche oder auch tödliche Risiken gibt. Trotz aller professionellen Ethik und den ab dem 1.1. 2012 sogar bundesweit geltenden Infektionsschutz- oder Hygienevorschriften (bis 2011 gab es in mehreren Bundesländern solche Vorschriften überhaupt nicht), gilt neben der durch übermäßigen Antibiotikaeinsatz immer größer werdenden Anzahl multi-resistenter Krankheitserreger auch mangelnde Handhygiene als eine wichtige zum größten Teil vermeidbare Ursache für den jährlichen Tod von zig Frühgeborenen (die genaue Anzahl ist nicht bekannt) und mindestens 15.000 erwachsenen Patienten in Krankenhäusern.
Wer bisher glaubte, dass das noch zusätzlich qualifizierte und sensibilisierte ärztliche und pflegerische Personal in intensivmedizinischen Einrichtungen für besonders geschwächte oder gefährdete PatientInnen wie "Frühchen" oder kleine Kinder sich konsequent an die fachlich unumstrittenen Regeln zur Händehygiene hält, muss seine Vorstellung mit der Veröffentlichung einer Untersuchung in der pädiatrischen und neonatologischen Intensivstation des Groß- und Universitäts-Klinikums Aachen korrigieren.
In einer im Jahr 2009 durchgeführten Studie wurden dort sämtliche behandelnden Personen und ihre patienten- oder hygienebezogenen Handlungen 192 Stunden lang mit ihrem Wissen lückenlos beobachtet. Zusätzlich zu der Information, dass ihr Hygieneverhalten beobachtet wird, wurden die Beschäftigten in einer sechswöchtigen Pilotphase in mündlicher und schriftlicher Form gründlich über Hygienevorschriften informiert. Dies umfasste auch Verweise auf die kostenlos erhältlichen 270 Seiten umfassenden und weltweit anerkannten " Guidelines on Hand Hygiene in Health Care. First Global Patient Safety Challenge Clean Care is Safer Care 2009" der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Ferner wurde mit den Beschäftigten das sachgerechte Verhalten trainiert und die dafür benötigte Ausrüstung installiert. Mit anderen Worten: Sehr viel besser können Beschäftigte nicht darauf vorbereitet werden, Hygienevorschriften einzuhalten und dabei beobachtet zu werden.
Die Ergebnisse sahen dann so aus:
• Die Anzahl von Situationen und Gegelegenheiten zur Handhygiene ("hand hygiene opportunities") ist höher als erwartet: In der pädiatrischen Intensivstation lag ihre Anzahl bei 321 in 24 Stunden, während es in der neonatologischen Intensivstation in derselben Zeit "nur" 194 solcher Gelegenheiten gab. Der Hauptteil dieser Gelegenheiten lag vor Kontakten zu den PatientInnen und nach dem Kontakt mit ihnen.
• Die Compliancerate, d.h. die Treue mit der sich die Beschäftigten an die durch Vorschriften geregelten Abläufe hielten, betrug in der pädiatrischen Intensivversorgung insgesamt 53% (170 handhygienische Aktivitäten). Die Beschäftigten in der Neonatologie waren statistisch signifikant vorschriftentreuer und hielten sich in 118 oder 61% der Gelegenheiten an die Handhygienevorschriften.
• Die Durchschnittswerte verdecken hier aber in besonderer Weise einen sehr kritisch zu bewertenden Teil der Wirklichkeit. Während sich Pflegekräfte in den beiden Stationen zu 57% (Pädiatrie) und 66% (Neonatologie) an die Hygienevorschriften hielt, taten dies lediglich 29% bzw. 52% der dort beschäftigten Ärzte. Die AutorInnen der Studie empfehlen daher auch, weitere Trainings und Kampagnen auf die Ärzteschaft zu konzentrieren.
• Interessant war auch, dass die Hygiene-Compliance vor dem Kontakt mit einem der PatientInnen höher war als nach dem Kontakt. Dies kann man mit den AutorInnen positiv im Sinne des Patientenwohls bewerten. Aber auch die Compliance vor dem Kontakt mit PatientInnen war bei weitem nicht optimal.
• Wer nun meint, die Hygiene-Compliance sei im "normalen" beispielsweise unbeobachteten Betrieb in solchen Stationen niedriger, hat leider wahrscheinlich recht: Aus den so genannten Hand-KISS-Daten des "National Reference Laboratory for Infection Control" am Robert Koch-Institut in Berlin errechnen sich in den dort erfassten 24 pädiatrischen (in 24 Krankenhäusern) und 57 neonatologischen (in 56 Krankenhäusern) 33 bzw. 29 gründliche Händereinigungen pro Patiententag. Obwohl wie gesehen keineswegs perfekt, reinigten sich die StudienteilnehmerInnen in Aachen ihre Hände im Durchschnitt 43 Mal pro Patiententag.
In Kenntnis der mit Sicherheit erheblich positiv verzerrten Ergebnisse der Studie im Klinikum Aachen kann man sich eigentlich nur noch wundern, warum nicht wesentlich mehr und wesentlich häufiger "Frühchen" oder schwer kranke Kinder (darunter viel am offenen Herzen operierte Kinder) sterben.
Die Studie zeigt aber auch, dass viele für wirksam gehaltenen präventiven Interventionen, darunter das Schließen von Wissenslücken, Verhaltenstrainings und optimale Ausstattungen allein zwar graduelle Verbesserungen bewirken können, aber am Grundproblem mangelnder und folgenreicher Handhygiene nichts ändern.
Die sowohl in Bremen zu hörenden Hinweise, man selber habe sich aber an alle Vorschriften gehalten oder die nach der hier vorgestellten Studie zu erwartenden Zweifel an der Repräsentativität der Aachener Ergebnisse, sind als reine Verteidigungsrhetorik zu bewerten. Die ebenfalls immer wieder bemühten Argumente, dass gerade "Frühchen" wegen ihrem nicht entwickelten Immunsystem bereits ein extrem hohes "natürliches" und eben auch potenziell tödliches Infektionsrisiko haben und viele Keime gegen Antibiotika resistent sind, ist ernster zu nehmen, enthebt aber auch nicht von der Pflicht, die Händehygiene der Beschäftigten bei der Versorgung dieser PatientInnen besonders ernst zu nehmen.
Über die gelungenen Versuche, wirklich etwas gegen den vermeidbaren hygienebedingten Tod von "Frühchen" und erwachsenen PatientInnen (vgl. z.B. zur erfolgreichen MRSA-Prophylaxe à la Niederlande eine ZDF-Reportage vom 24.8.2011 die mit dem Stichwort MRSA und dem Sendungsnamen ZDFzoom aufgerufen werden kann) zu tun und den dafür allerdings notwendigen Aufwand, wird daher noch umfassender berichtet und diskutiert werden müssen.
Der auch mit reichlich weiterführender Literatur versehene Aufsatz "Hand hygiene in pediatric and neonatal intensive care unit patients: Daily opportunities and indication- and profession-specific analyses of compliance" von Simone Scheithauer et al. ist in der November-Ausgabe des "American Journal of Infection Control" (Volume 39, Issue 9: 732-737, November 2011) erschienen. Ein Abstract ist kostenlos erhältlich. Die Hauptergebnisse sind auch schon als Poster auf dem 20. "European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID)" im April 2010 in Wien vorgestellt worden.
Bernard Braun, 12.11.11
Qualitätsreport in GB: Werden PatientInnen im Krankenhaus respektvoll behandelt und entspricht ihre Ernährung ihren Bedürfnissen?
 Zu den Prüfaufgaben der "Care Quality Commission (CQC)" des "National Health Service" in Großbritannien gehört auch die stichprobenweise Überprüfung, ob und wie insbesondere mit den älteren PatientInnen in Akutkrankenhäusern würdevoll und mit Respekt umgegangen wird und ob ihre Ernährung und die Umstände ihrer Aufnahme ihren individuellen Bedürfnissen entsprechen.
Zu den Prüfaufgaben der "Care Quality Commission (CQC)" des "National Health Service" in Großbritannien gehört auch die stichprobenweise Überprüfung, ob und wie insbesondere mit den älteren PatientInnen in Akutkrankenhäusern würdevoll und mit Respekt umgegangen wird und ob ihre Ernährung und die Umstände ihrer Aufnahme ihren individuellen Bedürfnissen entsprechen.
Was mit der dazu gewählten Methode des unangemeldeten Besuchs einer Prüfgruppe aus CQC-Inspektoren, einer praktizierenden erfahrenen Krankenpflegekraft und eines "expert by experience" mit der Behandlung in Krankenhäusern, alles herauzszubekommen ist, zeigt der jüngste Bericht über eine Überprüfung von 100 zufällig ausgewählten Akutkrankenhäusern in England zwischen März und Juni 2011.
Zwei Outcomes standen hier im Mittelpunkt: Der Respekt vor und die Einbeziehung von PatientInnen in die Behandlung (Standard: "People should be treated with respect, involved in discussions about their care and treatment and able to influence how the service is run") und die Übereinstimmung der Nahrungs-/Ernährungsbedürfnissen von PatientInnen mit dem tatsächlichen Ernährungsangebot (Standard: "Food and drink should meet people's individual dietary needs").
Bezogen auf die Standards für das Versorgungsergebnis, stellt sich die Wirklichkeit so dar:
• In 45 der 100 inspizierten Krankenhäuser wurden die PatientInnen mit vollem Respekt und würdevoll behandelt und war auch die Ernährung patientengerecht.
• In weiteren 35 wurden immer noch beide Standards erfüllt, aber je nach Klinik mit Verbesserungsbedarf in einem der beiden Qualitätsbereiche.
• 29 Kliniken oder 20% aller untersuchten Kliniken erfüllten mindestens einen der Standards oder gar beide nicht. Verbesserungen waren entsprechend dringend nötig.
• Betrachtet man nur den Qualitätsstandard des würde- und respektvollen Umgangs mit Patienten, erbrachten 12 der 100 Kliniken nicht akzeptable Leistungen. Dies bedeutete z.B., dass Trennvorhänge zwischen Betten bei Behandlungen im Bett nicht dicht genug schlossen, dass Klingeln außerhalb der Reichweite von Patienten positioniert waren und auf Klingeln sehr langsam reagiert wurde und schließlich das Personal herabsetzend und unpersönlich über oder mit PatientInnen redete.
• Im Bereich der Ernährung erfüllten 15% der Kliniken überhaupt nicht das Qualitätsziel. Die Hauptprobleme waren die fehlende Unterstützung der PatientInnen bei der Essensaufnahme oder die vorschnelle Annahme, ein Teil von ihnen seit körperlich nicht in der Lage, alleine oder auch unterstützt Nahrung aufzunehmen. Außerdem wurden PatientInnen während des Essens unterbrochen oder mussten vom Mittagstisch aufstehen bevor sie mit dem Essen fertig waren. Mangelnde Dokumentation der Aufnahme von Nahrungsmitteln und Getränken verhinderte Fortschrittsmessungen. Mangelnde Umsetzung des Qualitätsstandards führte auch dazu, dass PatientInnen oft nicht in der Lage waren, ihre Hände vor dem Essen zu waschen.
Zum gesamten patientenorientierten Qualitätssicherungsprogramm "Dignity and nutrition inspection programme 2011" gibt es kostenlos einen 30-seitigen nationalen Überblick.
Zusätzlich sind ebenfalls die kompletten Prüfberichte für die 100 Krankenhäuser im Internet für jeden Interessierten herunterladbar.
Bernard Braun, 31.10.11
Welche Verbesserungspotenziale gibt es bei der Krankenhausbehandlung, wie findet und hebt man sie und hilft dabei "peer review"?
 "Peer Review" ist bei wissenschaftlichen Publikationen fast schon ein Standardverfahren. Inhaltlich "Ebenbürtige" lesen und kommentieren dabei anonym Manuskripte und geben kritische Hinweise und Empfehlungen, die meist zu einer Verbesserung des Originaltextes führen.
"Peer Review" ist bei wissenschaftlichen Publikationen fast schon ein Standardverfahren. Inhaltlich "Ebenbürtige" lesen und kommentieren dabei anonym Manuskripte und geben kritische Hinweise und Empfehlungen, die meist zu einer Verbesserung des Originaltextes führen.
Warum dieses Verfahren also nicht auch für die Analyse von Versorgungsprozessen und die Fehleranalyse im Bereich der stationären Versorgung einsetzen? Eine freiwillige Qualitätsinitiative aus der Ärzteschaft, institutionalisiert in der "Initiative Qualitätsmedizin", hat diese Methode seit 2008 als eine "Ur-Methode" ärztlicher Qualitätssicherung entdeckt und seither Regeln und Standards für den "kollegialen Dialog mit Fachkollegen auf gleicher Augenhöhe und auf systematischer Basis" entwickelt. Die Regeln und Prozeduren sind im Frühjahr 2011 im Heft 16 des "Deutschen Ärzteblatts" veröffentlicht. 2009 wurden die ersten 21 Pilotprojekte durchgeführt, die u.a. von der Bundesärztekammer begleitet und evaluiert wurden.
Die Ergebnisse liegen nun vor.
Generell zeigt sich darin, dass es bei wesentlichen Bestandteilen des Versorgungsprozesses im Krankenhaus eklatante inhaltliche und organisatorische "Auffälligkeiten" gibt, ebenso wie grundsätzlich richtige Strategien, die lediglich an manchen Punkten verbessert werden können und müssen. Mit dem "Peer review" liegt ferner ein Verfahren vor, das auch bei kritisierten Ärzten weitgehend akzeptiert ist und dazu beitragen kann, den Bedarf zu erkennen und zu beeinflussen.
Zu den wichtigsten Ergebnissen gehört:
• Bei den 21 durchgeführten Peer Reviews betrug das durchschnittliche Optimierungspotenzial 64%. Dabei wichen Eigen- und Fremdbewertung in "nicht unerheblichem Maß" voneinander ab.
• In zwei Dritteln der 21 Kliniken war keine ausreichende Dokumentation der Krankheitsverläufe vor. So fehlten etwa Arbeitsdiagnosen, logische Darstellung von Therapieentscheidungen oder es war zu viel Irrelevantes dokumentiert. "Recht häufig" widersprachen sich auch Pflege- und ärztliche Dokumentation.
• In 57% aller untersuchten Kliniken sollten Schnittstellen im diagnostischen wie therapeutischen Bereich kritisch und zeitnah hinterfragt werden, ob sie für das jeweilige Behandlungsergebnis zielführend sind.
• Bei 52% der Häuser gab es Schwierigkeiten bei der medizinisch angemessenen Reaktion, von der Indikationsstellung über die zeitlichen Abläufe bis hin zu der Übernahme in Intensivstationen.
• Der Aufwand von vier Stunden Analyse von maximal 20 Behandlungsakten dirch den "Peer" und die nochmals drei bis vier Stunden dauernde Falldiskussion zwischen externen "Peers" und Chefarzt plus weitere Mitarbeiter des analysierten Krankenhauses reicht offensichtlich für die Zielsetzung aus und belastet die Krankenhäuser nicht zu stark.
• Obwohl also eine ganze Reihe von Chefärzten, Pflegeleitungen und Krankenhaus-Geschäftsführer von den ihnen "ebenbürtigen" Reviewern (meist auch Chefärzte) eine Reihe kritischer Rückmeldungen bekamen, bewegten sich ihre Beurteilungen des Verfahrens zwischen 1,9 (auf einer Skala von 1=sehr gut bis 10=schlecht) für die Atmosphäre bis 3,2 für das Ergebnis.
Ob aber die eindeutig vorhandenen Verbesserungspotenziale tatsächlich per "Peer review" gehoben werden konnten, und wie man dies misst, bleibt unklar, kann aber mit Sicherheit nicht allein an Sterblichkeitsindikatoren festgemacht werden. Unverständlich bleibt in diesem Zusammenhang, warum die weitere Unterstützung der externen Ebenbürtigen bei der Umsetzung von Verbesserungen "oftmals abgelehnt" wurde.
Den Aufsatz PEER REVIEW IM KRANKENHAUS. Evaluation zeigt: Es gibt noch Verbesserungspotenzial von Oda Rink aus dem "Deutschen Ärzteblatt" (Heft 27, 8. Juli 2011: A 1518-20) gibt es kostenlos.
Bernard Braun, 8.7.11
Unter-/Fehlversorgung: Nur mehrmalige Blutdruckmessungen liefern sichere Grundlage für Diagnose und Therapie von Bluthochdruck
 Das Messen des Blutdrucks ist einer der häufigsten und wichtigsten Gründe, einen Arzt aufzusuchen. Ein dabei gemessener erhöhter Blutdruck ist auch eine der häufigsten Diagnosen und gehört in der ambu-lanten ärztlichen Versorgung zu den wichtigsten Anlässen für eine mehr oder weniger aufwändige und jahre- oder gar lebenslange Behandlung. Und ein wirklich dauerhaft hoher Blutdruck ist wegen der vielen durch ihn mitbedingten schweren Erkrankungen behandlungsbedürftig und kann auch, sofern leitliniengerecht, gut behandelt werden. Wegen der zahlreichen mehr oder weniger schweren und belastenden Nebenwirkungen der Therapien sind aber an die Richtigkeit der Blutdruckmessung auch besondere Qualitätsanforderungen zu stellen.
Das Messen des Blutdrucks ist einer der häufigsten und wichtigsten Gründe, einen Arzt aufzusuchen. Ein dabei gemessener erhöhter Blutdruck ist auch eine der häufigsten Diagnosen und gehört in der ambu-lanten ärztlichen Versorgung zu den wichtigsten Anlässen für eine mehr oder weniger aufwändige und jahre- oder gar lebenslange Behandlung. Und ein wirklich dauerhaft hoher Blutdruck ist wegen der vielen durch ihn mitbedingten schweren Erkrankungen behandlungsbedürftig und kann auch, sofern leitliniengerecht, gut behandelt werden. Wegen der zahlreichen mehr oder weniger schweren und belastenden Nebenwirkungen der Therapien sind aber an die Richtigkeit der Blutdruckmessung auch besondere Qualitätsanforderungen zu stellen.
Schon immer gab es Zweifel an der Validität des Messalltags und der Notwendigkeit der darauf gestützten Behandlung: Ein Zweifel entzündete sich immer wieder an den Blutdruckwerten ab denen die beiden gemessenen Bludruckwerte als "hoch" klassifiziert und als behandlungsbedürftig gewertet werden. Andere Zweifel setzten daran an, dass viele ArztbesucherInnen mit Betreten einer Praxis und in Sichtweite des Arztkittels (daher auch die Bezeichnung "white coat effect") und der Messmanschette mit erhöhtem, also letztlich rein iatrogenen Blutdruck reagieren. Und ein letzter Zweifel machte sich schließlich an der klinisch weit verbreiteten Einmal- oder auch Zweifachmessung der Werte fest.
Ob und wie viel insbesondere am letzten Zweifel berechtigt ist, untersuchten nun us-amerikanische ÄrztInnen im Rahmen einer randomisierten kontrollierten Studie mit 444 fast ausschließlich männlichen Angehörigen der US-Streitkräfte und der "Veterans Affairs"-Krankenversicherung. 75% der Personen waren schon mindestens 10 Jahre als Hochdruckkranke diagnostiziert worden bei denen sich aber immer wieder Unklarheiten bei der Blutdruckkontrolle ergeben hatten.
Die Teilnehmer wurden in drei Gruppen mit unterschiedlichen Messmethoden und -orten aufgeteilt: eine Gruppe, deren Blutdruck in 6-Monatsintervallen nach einem standardisierten Forschungsmessverfahren gemessen wurde, einer Gruppe, deren Blutdruck bei jedem Besuch eines niedergelassenen Arztes gemessen wurde und einer Gruppe, die ihren Blutdruck zu Hause mittels eines elektronischen Systems maß und auf einem Monitor sichtbar machte. Die Messgeschichte des systolischen Blutdruckwertes der Teilnehmer, also des oberen maximalen Wertes mit dem Blut in die Adern gepumpt wird, wurde in der Studie über 18 Monate verfolgt. Die Ergebnisse konnten sich auf insgesamt 111.181 Messungen stützen, 3.218 Forschungs-, 7.121 klinische und 100.842 häusliche Messungen.
Die wichtigsten Ergebnisse sehen so aus:
• Wenn für die klinischen und Forschungsmessungen ein Wert von unter 140 mm Hg und für häusliche Messungen ein Wert von weniger als 135 mm Hg als guter Wert genommen wird, waren 28% der in Arztpraxen diagnostizierten Personen, 47% der Zuhause-Messer und 68% der im Forschungszusammenhang diagnostizierten Personen unterhalb der Grenzwerte. Nur 33% der Patienten waren über alle drei Methoden hinweg dauerhaft als Personen mit zu hohem systolischem Blutdruck eingestuft.
• Die kurzzeitige Veränderung des Wertes ist bei allen drei Messverfahren ähnlich groß. Die mittlere patienteneigene Variablität ("within-patient variability") des systolischen Wertes in der Zeit betrug 10% und schwankte in einem Bereich zwischen 1% und 24%.
• Wer mit 80-prozentiger Wahrscheinlichkeit oder Sicherheit wissen will, ob der systolische Wert einer Person ober- oder unterhalb der Grenzwerte liegt und damit behandelt oder nicht behandelt werden sollte oder muss, kann dies nicht auf der Basis einer einzigen Messung klären. Hier schwanken die Werte zwischen 120 und 157 mm Hg.
• Der Unsicherheits-Effekt der bei ein- und demselben Patienten hin- und herschwankenden Blutdruckwerte verschwindet optimal nach fünf bis sechs Messungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Wenn eine Diagnose auf weniger Messungen oder gar einer einzigen Messung in einer Arztpraxis beruht, droht einer großen Anzahl der so diagnostizierten Personen eine Fehlbewertung ihrer gesundheitlichen Situation und entweder eine nebenwirkungsreiche Behandlung ohne gesundheitliche Notwendigkeit oder die Nichttherapie trotz tatsächlich zu hohem Blutdruck. Die Autoren berichten dazu auch, dass in vielen Kliniken in den USA wegen der Unsicherheit von Einmalmessungen und ohne dass dann um Kosten zu vermeiden mehrfach gemessen wird bei vielen Personen auf eine blutdrucksenkende Behandlung verzichtet wird.
• Bei der zusätzlichen Untersuchung der Patienten mit häuslichen und Praxismessungen wiesen 51,6% der Patienten einen mittleren in der Arztpraxis gemessenen systolischen Blutdruck auf, der wenigstens 10 mm Hg über dem durchschnittlichen häuslichen Wert lag. Bei 5% der Patienten lag der Praxiswert aber wenigstens 10 mm Hg unterhalb des mittleren häuslich gemessenen Wertes.
Wegen der speziellen Charakteristika der Studienteilnehmer weisen die Autoren selber auf die dadurch möglicherweise vorhandene Begrenzung der Verallgemeinerbarkeit der Studienergebnisse hin. Dies können nur weitere Studien klären, die dann aber auch die Effekte einer höheren Sicherheit als 80% mitklären sollten. Wer aber nach einer einzigen Blutdruckmessung als Hypertoniker klassifiziert wird und von dem untersuchenden Arzt eine Behandlung mit Betablockern und weiteren Arzneimitteln vorgeschlagen bekommt, sollte vorher auf mehr Messungen beharren.
Die 10 Seiten umfassende Studie "Measuring Blood Pressure for Decision Making and Quality Reporting: Where and How Many Measures?" von Benjamin J. Powers et al. ist gerade in der Fachzeitschrift "Annals of Internal Medicine" (2011; 154: 781-788) erschienen und komplett kostenlos erhältlich.
Dass diese Ergebnisse nicht ungeteilte Zustimmung erfahren, macht ein spontaner Blog-Kommentar eines us-amerikanischen Internisten am 21. Juni 2011 sehr deutlich: "What a great solution to measuring blood pressure! Lets get certified so we can all be sure we are measuring correctly!! This country is broke and this is idiotic! Complicance and cost are much bigger barriers to control. Lets stop paying for these stupid studies!!"
Bernard Braun, 30.6.11
Praxis-Pflegekräfte behandeln Diabetiker vergleichbar gut wie Allgemeinärzte - Ergebnis eines RCT in den Niederlanden
 Selbst in Deutschland wird unter dem Druck, die ungünstigen Effekte der Ungleichverteilung der Ärzte auf die Bewohner ländlicher Gebiete zu bewältigen, immer intensiver über die "Substitution" oder "Delegation" ärztlicher Tätigkeit durch qualifizierte Pflegekräfte oder Angehörige andere Fachberufe nachgedacht und auch an Modellen (z.B. AGnES) gearbeitet. Dass sich dabei z.B. zuletzt der Gemeinsame Bundesausschuss in einer Liste der so zu erledigenden Aufgaben darum herum drückte einen der unterschiedlichen Begriffe zu verwenden, zeigt aber, dass das deutsche Gesundheitssystem auch hier noch einen etwas längeren Weg vor sich hat als andere.
Selbst in Deutschland wird unter dem Druck, die ungünstigen Effekte der Ungleichverteilung der Ärzte auf die Bewohner ländlicher Gebiete zu bewältigen, immer intensiver über die "Substitution" oder "Delegation" ärztlicher Tätigkeit durch qualifizierte Pflegekräfte oder Angehörige andere Fachberufe nachgedacht und auch an Modellen (z.B. AGnES) gearbeitet. Dass sich dabei z.B. zuletzt der Gemeinsame Bundesausschuss in einer Liste der so zu erledigenden Aufgaben darum herum drückte einen der unterschiedlichen Begriffe zu verwenden, zeigt aber, dass das deutsche Gesundheitssystem auch hier noch einen etwas längeren Weg vor sich hat als andere.
Für manche deutsche Diskutanten gehört auch die Ergebnisqualität der "ärztlichen" Tätigkeit von Nichtärzten zu den noch offenen Fragen - egal ob die Aufgaben noch unter der Oberaufsicht von Ärzten oder von den Nichtärzten schon autonom erledigt werden. In den meisten der bisherigen Interventionsstudien sollte im Wesentlichen gezeigt werden, dass die Behandlung durch Pflegekräfte die Behandlung von Patienten verbessert.
Für eine der häufigen, demnächst vielleicht sogar häufigsten chronischen und aufwendungsintensiven Erkrankungen, den Diabetes Typ II, belegt jetzt eine in den Niederlanden mit 230 PatientInnen über 14 Monate durchgeführte randomisierte und kontrollierte Studie, dass so genannte "practice nurses", also qualifizierte ambulant tätige Pflegekräfte oder "ArzthelferInnen", DiabetikerInnen nicht nur gut, sondern vergleichbar gut, wenn nicht sogar besser behandeln können als Allgemeinärzte. Die Behandlung in der Interventionsgruppe mit nichtärztlichem Pflegepersonal bestand in der Kontrolle des Blutzuckerwertes, des Blutdrucks und der Fettstoffwerte. Die Diabetespatienten in der Kontrollgruppe wurden konventionell durch Allgemeinärzte behandelt. Der in beiden Behandlergruppen gemessene primäre Outcome war eine Absenkung des HbA1c-Wertes, des so genannten Blutzuckergedächtnis-Wert am Ende der 14 Monate.
Die Ergebnisse waren unerwartet klar:
• Zwischen den beiden Patientengruppen gab es bei der Reduktion der drei Messwerte keine signifikanten Unterschiede.
• In beiden Gruppen sank der Blutdruck, eine der wichtigen Zielgrößen evidenter Diabetesbehandlung, signifikant: Um 7,4 mm Hg und 3,2 mm Hg beim systolischen bzw. diastolischen Wert in der Interventionsgruppe mit nichtärztlicher Behandlung und um 5,5 bzw. 1,0 mm Hg. In der Kontrollgruppe.
• In beiden Gruppen erreichten mehr Patienten als zu Beginn der Studie Zielgrößen für ihr Fettstoffwerteprofil.
• In der Interventionsgruppetraten häufiger als in der Kontrollgruppe Verschlechterungen in der gesundheitsbezogenen Lebensqualität und diabetesspezifische Symptome nahmen stärker zu.
• Trotzdem waren Patienten, die von Praxis-Pflegekräften behandelt wurden, mit der Behandlung zufriedener als die von Allgemeinärzten behandelten Patienten.
Eine Empfehlung der ForscherInnen lautete, die entsprechend qualifizierten und offensichtlich auch praktisch erfolgreichen Praxis-Pflegekräfte sollten auch Medikamente verordnen dürfen.
Was steht daher dem Transfer der weitgehend standardisierbaren Behandlung derart verbreiteter Erkrankungen zu Praxis-Pflegekräften noch im Wege?
Zu dem erstmals im Mai 2011 in der Fachzeitschrift "Journal of Clinical Nursing" (2011 May; 20 (9-10): 1264-72) veröffentlichten Aufsatz "Can diabetes management be safely transferred to practice nurses in a primary care setting? A randomised controlled trial" von Houweling ST, Kleefstra N, van Hateren KJ, et al. gibt es kostenlos nur ein Abstract.
Bernard Braun, 30.6.11
"Bewertet wird das, was beim Bewohner tatsächlich ankommt": Qualitäts-Indikatoren für Altenpflege liegen vor - und was nun?
 Mitten in die unsägliche Situation, dass eine nette Weihnachtsfeier im Altenpflegeheim die fehlerhafte Ausgabe von Arzneimitteln an HeimbewohnerInnen aufwiegen oder ausgleichen kann und Prüfberichte über Altenheime nicht veröffentlicht werden dürfen, legt jetzt eine Gruppe von WissenschaftlerInnen eine umfangreiche Sammlung wissenschaftlich gesicherter, machbarer und sogar innerhalb des Projekts praktisch erprobter Indikatoren zur Erhebung und Bewertung der Ergebnisqualität in der stationären Altenhilfe vor. Sie wurde zwischen 2008 und 2011 im Auftrag von Gesundheits- und Familienministerium von MitarbeiterInnen des Instituts für Pflegewissenschaft an der Universität Bielefeld (IPW) sowie des Instituts für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik GmbH (ISG) erarbeitet.
Mitten in die unsägliche Situation, dass eine nette Weihnachtsfeier im Altenpflegeheim die fehlerhafte Ausgabe von Arzneimitteln an HeimbewohnerInnen aufwiegen oder ausgleichen kann und Prüfberichte über Altenheime nicht veröffentlicht werden dürfen, legt jetzt eine Gruppe von WissenschaftlerInnen eine umfangreiche Sammlung wissenschaftlich gesicherter, machbarer und sogar innerhalb des Projekts praktisch erprobter Indikatoren zur Erhebung und Bewertung der Ergebnisqualität in der stationären Altenhilfe vor. Sie wurde zwischen 2008 und 2011 im Auftrag von Gesundheits- und Familienministerium von MitarbeiterInnen des Instituts für Pflegewissenschaft an der Universität Bielefeld (IPW) sowie des Instituts für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik GmbH (ISG) erarbeitet.
Wegen der bescheidenen Wirklichkeit der (Ergebnis)-Qualitätsaktivitäten in Deutschland heben die AutorInnen vor ihren detaillierteren Vorschlägen ein "gemeinsames Grundverständnis von Versorgungsergebnissen" hervor: "Ergebnisse der vollstationären pflegerischen Versorgung umfassen danach messbare Veränderungen des Gesundheitszustands, der Wahrnehmung und des Erlebens der Bewohner, die durch die Unterstützung der Einrichtung bzw. durch das Handeln ihrer Mitarbeiter bewirkt werden. Ergebnisqualität ist dementsprechend eine Eigenschaft von Versorgungsergebnissen, die mit einer bewertenden Aussage beschrieben wird." Für besonders wichtig halten sie, "dass sich die Indikatoren auf Ergebnisse beziehen, die von einer Einrichtung und ihren Mitarbeitern maßgeblich beeinflusst werden können. Darüber hinaus sollten sie sich für einen seriösen Vergleich der Qualität zwischen Einrichtungen eignen."
Im Detail schlagen sie 15 Indikatoren als geeignet vor: Erhalt oder Verbesserung der Mobilität (zwei Indikatoren, die abhängig vom Grad der kognitiven Einbußen sind), Selbständigkeitserhalt oder -verbesserung bei Alltagsverrichtungen (zwei Indikatoren), Selbständigkeitserhalt oder -verbesserung bei der Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte, Dekubitusentstehung (zwei Indikatoren je nach Dekubitusrisiko), Stürze mit gravierenden Folgen (zwei Indikatoren), Unbeabsichtigter Gewichtsverlust (zwei Indikatoren), Integrationsgespräch für Bewohner nach dem Heimeinzug, Einsatz von Gurtfixierungen, Einschätzung von Verhaltensauffälligkeiten bei Bewohnern mit kognitiven Einbußen, Schmerzmanagement (Schmerzeinschätzung/Information über Schmerz).
Zusätzlich geben sie auch an, welche Indikatoren für die Beurteilung der Ergebnisqualität begrenzt einsetzbar und nicht empfohlen sind bzw. werden können - durchaus aber im Rahmen des internen Qualitätsmanagements nutzbar sind: Häufigkeit von Sondenernährung, Sturzhäufigkeit, Entstehung von Kontrakturen bei Bewohnern mit erheblichen Mobilitätseinbußen, Intensiver Medikamenteneinsatz ohne Überprüfung von Wechsel-/Nebenwirkungen, Verhaltensweisen und psychische Problemlagen, Management von Harninkontinenz und Häufigkeit von Medikationsfehlern.
Bei einer dritten Gruppe von Indikatoren "wirft auch der begrenzte Einsatz im internen Qualitätsmanagement Probleme auf. Vielfach steht in Frage, ob hier tatsächlich von einem relevanten Einfluss der Einrichtungen ausgegangen werden kann." Dazu gehören u.a. die Entwöhnung von der Sondenernährung, Ungeplante Krankenhaus-Einweisungen, Häufigkeit von Harnwegsinfekten, Veränderungen der kognitiven Fähigkeiten, Depression, Angst, Inadäquater Psychopharmakaeinsatz, Im Krankenhaus verstorbene Bewohner, Vorliegen einer Stuhlinkontinenz, Nosokomiale Infektionen, Grippeimpfungen, Chronische Wunden und Frakturen/Verletzungen.
Zu den so genannten "objektiven Indikatoren" zählen die Pflegeexperten schließlich noch sechs Indikatoren für den Regelbetrieb: Grad der Möglichkeit zur Möblierung, Qualität der Wäscheversorgung, Teilnahme an Aktivitäten und Kommunikation, Aktionsradius von Bewohnern mit deutlichen Mobilitätseinschränkungen, Risiko sozialer Isolation (mit Bedarf an Weiterentwicklung) und Mitarbeiterzeit pro Bewohner (mit Bedarf an Weiterentwicklung).
Auf der Basis einer zehnmonatigen Versuchsphase an Bewohnern von 46 Heimen halten die AutorInnen ihre Vorschläge auch mit einem geringen zusatzaufwand für praktikabel , an die "heutigen Bedingungen in den Pflegeeinrichtungen anschlussfähig und in bestehende Abläufe integrierbar." Den zusätzlichen Aufwand halten sie für gering bzw. müsste er im Rahmen einer fachgerechten Pflege sowieso erbracht werden.
Ihr Fazit lautet: "Mit dem vorgestellten Set gesundheitsbezogener Indikatoren stehen die Voraussetzungen für ein innovatives Qualitätsberichtssystem zur Verfügung. Mit einem solchen System würde der Anspruch, Ergebnisqualität in den Mittelpunkt von Qualitätssicherung und Qualitätsbeurteilung zu stellen, nach vielen Jahren Diskussion umgesetzt. In Deutschland würde damit auch frühzeitig Anschluss gefunden an den aktuellen internationalen Entwicklungstrend. … Die Eigenverantwortung der Einrichtungen würde gestärkt und ein erheblicher Anreiz für "gute Pflege" im Interesse des Bewohners geschaffen."
Was die tatsächliche Chancen für den Einsatz der Indikatoren zur Qualitätssicherung in stationären Altenpflegeeinrichtungen angeht, ist aber nach Meinung des Staatssekretärs im Bundesgesundheitsministerium, Thomas Ilka, auch trotz der ausdrücklich in Auftrag gegebenen und positiv verlaufenen praktischen ERprobung offen: "Die Ergebnisse lassen sich jedoch auf das heutige System nur schrittweise übertragen und benötigen weitere sorgfältige Vorbereitungen."
Der im März 2011 veröffentlichte Abschlussbericht "Entwicklung und Erprobung von Instrumenten zur Beurteilung der Ergebnisqualität in der stationären Altenhilfe von Klaus Wingenfeld, Dietrich Engels et al. umfasst 394 Seiten und ist kostenlos erhältlich. Er sollte in keiner künftigen Debatte über Pflegequalität unerwähnt bleiben.
Bernard Braun, 20.6.11
Nichtwissen gilt nicht: Modell der künftigen Versorgungsberichterstattung des Gemeinsamen Bundesausschusses zum Thema "Depression"
 Für die weiteren Debatten und Entscheidungen über die Über-, Unter- und Fehlversorgung sowie über Qualitätssicherung im deutschen Gesundheitsversorgungssystem bedarf es qualitativ hochwertiger Analysen zur Epidemiologie und zum tatsächlichen Versorgungsgeschehen.
Für die weiteren Debatten und Entscheidungen über die Über-, Unter- und Fehlversorgung sowie über Qualitätssicherung im deutschen Gesundheitsversorgungssystem bedarf es qualitativ hochwertiger Analysen zur Epidemiologie und zum tatsächlichen Versorgungsgeschehen.
Wie so etwas aussehen könnte, wie hilfreich die Ergebnisse sind und welchen Aufwandes es dazu bedarf, ließ der Gemeinsame Bundesausschuss am Beispiel der Depression erarbeiten. Das Ergebnis ist ein jüngst veröffentlichter Abschlussbericht, der den hiesigen Versorgungsstatus darstellt.
Zu der aufwändig entwickelten Methodik bemerkt der Leiter der Autorengruppe, Mathias Perleth: "Damit Verbesserungspotenziale in der Versorgung, also mögliche Handlungsfelder für den G-BA, identifiziert werden können, besteht das entscheidende Kernelement des Konzepts im Abgleich von empfohlener und tatsächlich beobachteter Versorgung, der so genannte Soll-Ist-Vergleich". Dieser Vergleich stützt sich zum einen auf die generierten Daten aus einer umfangreichen Recherche der wissenschaftlichen Literatur der letzten 10 Jahre. Darüber hinaus nutzten die AutorInnen Datenauswertungen der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) und des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung (ZI) hinsichtlich ambulanter Psychotherapie zur Verfügung. Ergänzt wird die Informationsbasis noch durch Expertenmaterialien und -Statements.
Die wichtigsten Ergebnisse sind:
• Prävalenz: "Es konnten sechs Studien identifiziert werden, welche die Prävalenz depressiver Störungen bei Patienten von Haus- oder Allgemeinarztpraxen untersucht haben. Trotz dieser methodischen Unterschiede kommen die Studien zu ähnlichen Angaben hinsichtlich der Häufigkeit depressiver Störungen (8,6%-11,3%). … Die Frage, ob depressive Störungen in Deutschland zunehmen, kann anhand der derzeitigen Studienlage kaum beantwortet werden." Hier bekommt also der seit Jahren anhaltende und schon immer sachlich fragwürdige Hype einer plötzlichen Epidemie der Depression einen deutlichen Dämpfer.
• Versorgungsqualität beim Hausarzt, der am häufigsten mit depressiven PatientInnen zu tun hat: "Nach den berücksichtigten Studien werden 40% bis 75% der Patienten mit depressiven Störungen in der hausärztlichen Versorgung entsprechend diagnostiziert, 12% bis 18% der Patienten wurden fälschlich als an einer depressiven Störung leidend diagnostiziert. … Auch in den anderen Studien, die den Schweregrad depressiver Störungen nach den strengeren DSM-IV-Kriterien klassifizieren, liegt die Sensitivität hausärztlicher Diagnosen lediglich im Bereich von 40% bis 50%."
"Die vorliegenden Studien weisen somit insbesondere auf eine Untererkennung depressiver Störungen im hausärztlichen Bereich hin, aber auch auf eine Fehldiagnostik (inklusive falsch positiver Befunde)."
• Die wesentlichen Gründen der schlechten Versorgungsqualität bei einer Depression liegen in der nachgewiesenen mangelhaften Anwendung der Leitlinien und einer alles in allem mangelhaften Kompetenz der Hausärzte für die Versorgung depressiv Erkrankter. Als Gründe für ein solches Verhalten nennen die Hausärzte das Arzneimittelbudget, Zeitmangel und eine schlechte Honorierung. Nur ein kleiner Teil der depressiven PatientInnen erhält so eine leitliniengerechte Medikation, wozu z.B. eine medikamentöse Rezidivprophlaxe gehört.
• Zu den Mängeln der Behandlungsqualität gehört schließlich auch die Zahl von 35% ambulant behandelter Personen, die sich nicht therapietreu verhielten. Dies ist am häufigsten die Folge unzulänglicher Aufklärung der Patienten durch ihren Arzt.
• "Es ist noch einmal zu unterstreichen, dass die Datenlage als lückenhaft, methodisch häufig wenig zuverlässig und auch in erheblichen Teilen vermutlich inzwischen veraltet ist."
Der methodisch wie speziell für die gründliche inhaltliche Information über die Behandlung der Depression und der daran erkrankten Personen gedachte ertragreiche 342 Seiten-Abschlussbericht zum "Modellprojekt Verfahren zur verbesserten Versorgungsorientierung am Beispielthema Depression" stammt von der AG Versorgungsorientierung / Priorisierung des Gemeinsamen Bundesausschusses und steht seit dem März 2011 kostenlos zur Verfügung.
Wer sich jetzt fragt, warum dieser Bericht nicht intensiv von den verantwortlichen Akteuren des Gesundheitswesens diskutiert und damit einer breiteren Öffentlichkeit bekannt wird, findet wichtige Hinweise in der jüngsten Ausgabe von "Gerechte Gesundheit. Der Newsletter zur Verteilungsdebatte". Dort heißt es unter der Überschrift "G-BA erprobt Priorisierung Versorgung in den Mittelpunkt stellen statt nach Willkürprinzip verfahren": "Das Modellprojekt ist in die Unterausschüsse verwiesen worden. Erste Meinungsäußerungen zeigen
aber schon deutlich, wohin die Reise geht. Die Kostenträger können
sich mit der Ausrichtung auf Versorgungsnotwendigkeiten nicht anfreunden, ebenso die Patientenvertreter. Die Leistungserbringer
hingegen geben allesamt ein klares Votum für den Versorgungsansatz
ab. Die Kassenbank beklagt vor allem die Ressourcen, die für die
Erstellung dieser Analyse notwendig waren und zukünftig würden."
Bevor diese Art von entscheidungsrelevanter Versorgungsberichterstattung aus "Kostengründen" nicht weiter aus den Startlöchern kommt, sollten sich die Genannten nur einmal die Unsummen und das Leid von PatientInnen vor Augen führen, die solches Nichthandeln in Sachen Über- und Fehlversorgung kosten.
Der auch sonst (aktuelles Thema Priorisierung) lesenswerte und abonnierbare Newsletter Gerechte Gesundheit ist kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 23.5.11
Wie das Bundesverfassungsgericht das Grundrecht auf freie Berufsausübung über das Patientenrecht auf fachliche Behandlung erhebt.
 Wenn ein approbierter und einschlägig durch zahlreiche Operationen im Mund-, Kiefer- und Gesichtsbereich fachlich ausgewiesener Arzt und Zahnarzt in seiner Nebentätigkeit als Geschäftsführer einer Klinik für Schönheitsoperationen noch Brustimplantate einsetzt und operative Bauch- oder Oberarmstraffungen durchführt, darf er dies, wenn derartige Zusatzarbeiten nicht mehr als 5 Prozent seiner Gesamttätigkeit umfassen. So urteilte das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) am 1. Februar 2011 und gab damit der Verfassungsbeschwerde genau dieses Allroundchirurgen statt.
Wenn ein approbierter und einschlägig durch zahlreiche Operationen im Mund-, Kiefer- und Gesichtsbereich fachlich ausgewiesener Arzt und Zahnarzt in seiner Nebentätigkeit als Geschäftsführer einer Klinik für Schönheitsoperationen noch Brustimplantate einsetzt und operative Bauch- oder Oberarmstraffungen durchführt, darf er dies, wenn derartige Zusatzarbeiten nicht mehr als 5 Prozent seiner Gesamttätigkeit umfassen. So urteilte das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) am 1. Februar 2011 und gab damit der Verfassungsbeschwerde genau dieses Allroundchirurgen statt.
Diese Beschwerde richtete sich gegen eine Reihe standesrechtlicher und gerichtlicher Entscheidungen bis hin zum Bundesgerichtshof, die in dieser omnipotenten Berufsausübung einen Verstoß gegen das ärztliche Berufsrecht sahen. Dieses ist in Heilberufe- und Kammergesetzen kodifiziert und verpflichtet Ärzte auf eine Berufsausübung innerhalb der Grenzen des Fachgebiets für die sie fortgebildet sind und sich auch ständig weiterbilden müssen.
Der betroffene Arzt verwies dagegen u.a. darauf, dass ohne die Durchführung dieser zusätzlichen und nicht seiner Facharztqualifikation entsprechenden Operationen die Existenz seiner Klinik gefährdet wäre.
Die Verfassungsrichter plädieren nun für eine weite Auslegung dieser Vorschrift des ärztlichen Berufsrechts und für die Zulässigkeit von Ausnahmen. Sie beschäftigten sich auch mit dem in den vorherigen Verfahren für entscheidend erachteten Argument, ob nicht ein Teil der fachfremd operierten PatientInnen über die tatsächliche Befähigung des Operateurs für diese Art von Eingriffen getäuscht worden wäre.
Dem widerspricht das BVerfG mit einer eigentümlichen Argumentationskaskade:
• Erstens: "… erscheint auch schon die vom Gericht angenommene, nicht näher begründete Verwechslungsgefahr mehr als fraglich, denn es leuchtet nicht ein, weshalb der durchschnittlich gebildete Patient annehmen sollte, ein Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurg - also ein Arzt, dessen fachärztliche Qualifikation sich auf den Bereich des Kopfes bezieht - weise eine besondere Eignung für Operationen im Bereich des Bauch-, Oberkörper- und Armbereichs auf."
• Und auch wenn einige der "durchschnittlich gebildeten Patienten" dann erfolgreich die besondere Eignung vorgegaukelt bekommen haben, ist das letztlich doch akzeptabel: "Insbesondere der Patientenschutz erfordert es nicht, einem bestimmten Fachgebiet zugeordnete Behandlungen nur durch Ärzte dieses Fachgebiets durchführen zu lassen. Die Qualität ärztlicher Tätigkeit wird durch die Approbation nach den Vorschriften der Bundesärzteordnung sichergestellt."
• Was dieser Typ von Arzt an schier Übermenschlichem beachten muss, umreißt das BVerfG so: "Zwar hat ein Arzt in jedem Einzelfall zu prüfen, ob er aufgrund seiner Fähigkeiten und der sonstigen Umstände - wie etwa der Praxisausstattung - in der Lage ist, seinen Patienten nach den Regeln der ärztlichen Kunst zu behandeln. Vorbehaltlich dieser Prüfung ist er aber, unabhängig vom Vorhandensein von Spezialisierungen, berechtigt, Patienten auf allen Gebieten, die von seiner Approbation umfasst sind, zu behandeln. Eine generelle Verpflichtung, Patienten mit Erkrankungen auf einem bestimmten Gebiet an einen für dieses Gebiet zuständigen Facharzt zu verweisen, wie sie die Ärztekammer H. in ihrer Stellungnahme sieht, ist hiermit nicht vereinbar."
• Wer diese Selbstprüfung und -verantwortung nicht hinbekommt, dem hilft das Verfassungsgericht durch den von ihm kreierten "5-Prozent-Freiraum" als einer Art berufsrechts- und patientenrechtsfreie Zone im sozialen Leben der Bundesrepublik: "Selbst wenn man von einer Zahl von 200 fachgebietsfremden Operationen pro Jahr, wie von der Ärztekammer H. im Rahmen der Verhandlung vor dem Berufsgerichtshof in den Raum gestellt, ausgeht, liegt der Anteil unter 5 % und bewegt sich damit noch im geringfügigen Bereich." Was in einer Prozentrechnung geringfügig sein mag, ist aber für jeden der 200 operierten PatientInnen im Guten wie im Bösen ein 100-Prozent-Ereignis!
Diese Art von "5-Prozent-Freiraum" in dem das Grundrecht auf freie Berufsausübung nicht zwingend an einen konkreten Nachweis der fachlichen Qualifikation gebunden ist, bedeutet bei allem Respekt vor dem notwendigen Schutz von Grundrechten eine erhebliche Relativierung oder Minderbewertung des Rechts von Patienten auf eine ärztliche Leistung, die verlässlich und zertifiziert dem "allgemein anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse" (u.a. § 70 SGB V) entspricht.
Wer meint, das träfe doch höchstens jeden zwanzigsten Patienten in Kliniken für Schönheitsoperationen und sei daher zu vernachlässigen, sollte seine Bewertung der Reichweite des Urteils nach Lektüre der Schlussfolgerung eines Medizinrechtskommentators nochmal überprüfen: "Als Konsequenz ist es auch Vertragsärzten möglich, einen Anteil von 5% fachfremder Leistungen zu Lasten der GKV abzurechnen. Diese in früheren Honorarverteilungsmaßstäben enthaltene Regelung ist daher wieder einzuführen." Zusätzlich zu den immer häufiger von niedergelassenen Ärzten angebotenen zum großen Teil fachlich fragwürdigen oder sinnlosen "Individuellen Gesundheitsleistungen" müssen sich Haus- und Facharztpatienten nun also auch noch darauf vorbereiten maximal 5% "fachfremde Leistungen" zu erhalten - ohne dass ihnen dies gesagt werden wird.
Die 33 Absätze des Urteil des BVerfG mit dem Aktenzeichen 1 BvR 2383/10 vom 1.2. 2011 sind kostenlos über die Website des Gerichts erhältlich.
Bernard Braun, 26.3.11
"Medizin aus der Steckdose und via Bluetooth!?" Neues über den Nutzen und die Grenzen von Telemonitoring und Telemedizin
 Kaum ein gesellschaftlicher Bereich wird so stark von "deus ex machina"-Konjunkturen bestimmt wie das Gesundheitswesen. Egal ob es sich um bestimmte Arzneimittel, freie Radikale im Broccoli, Rotwein oder Bewegungsprogramme handelt: zumindest phasenweise scheinen sie für nahezu alle gesundheitlichen Probleme die Lösung zu sein - eben Götter aus der Theater-Maschine, die helfen, wenn scheinbar nichts anderes hilft.
Kaum ein gesellschaftlicher Bereich wird so stark von "deus ex machina"-Konjunkturen bestimmt wie das Gesundheitswesen. Egal ob es sich um bestimmte Arzneimittel, freie Radikale im Broccoli, Rotwein oder Bewegungsprogramme handelt: zumindest phasenweise scheinen sie für nahezu alle gesundheitlichen Probleme die Lösung zu sein - eben Götter aus der Theater-Maschine, die helfen, wenn scheinbar nichts anderes hilft.
In diese Reihe fügt sich seit einiger Zeit eine Art "Gott aus der Steckdose" ein, nämlich die Telemedizin mit einer Fülle von diagnostischen und therapeutischen Anwendungen und Hilfsmitteln. Egal, ob prädemente Patienten zu Hause die Einnahme wichtiger Arzneimittel vergessen könnten, Körperwerte unregelmäßig schwanken und bei den davon betroffenen Personen unberechtigte Panik auslösen oder schlichtweg die Arztdichte in ländlichen Gegenden immer geringer wird, versprechen telemedizinische Techniken und Verfahren der Datenerfassung, -übertragung und -überprüfung Probleme zu beseitigen und gesundheitlichen wie wirtschaftlichen Nutzen zu stiften.
Und solange diejenigen, die z.B. in Deutschland den Sicherstellungsauftrag für die gesundheitliche Versorgung haben, über keine alternativen Lösungen der schwindenden Arztdichte auf dem Land nachdenken müssen (Schlagwort: "AGNES statt Arzt"), wurde auch lieber nicht seriös überprüft, ob und wie nützlich telemedizinische Verfahren sind.
Im kurzen Abstand sind jetzt aber Ergebnisse zweier Studien einer us-amerikanischen und einer deutschen Forschergruppe über den Nutzen von Telemonitoring als einem Eckpfeiler der Telemedizin-Welt erschienen, die erhebliche Zweifel an ihrer Omnipotenz erwecken.
In der US-Studie mit 1.653 Teilnehmern, die vor kurzem mit einer Herzschwäche stationär behandelt wurden, erhielt die Hälfte Telemonitoringleistungen und die andere Hälfte wurde traditionell versorgt. Das Telemonitoring bestand aus einem telefonbasierten interaktiven und mündlichen System der täglichen Information der Arztpraxen über Krankheitssymptome und weitere Körperwerte wie z.B. das Gewicht. Dem schlossen sich eine Bewertung durch den Arzt und möglicherweise Rückmeldungen an den Patienten an. 180 Tage lang wurde kontrolliert, ob die Angehörigen der Interventions- wie Kontrollgruppe wegen irgendeiner Erkrankung erneut stationär behandelt werden mussten oder starben (primärer Endpunkt) und wie oft und wie lange sie im Falle einer erneuten Krankenhausbehandlung ihrer Herzschwäche ihr Aufenthalt war (sekundärer Endpunkt).
Die Ergebnisse für die im Durchschnitt 61 Jahre alten, überwiegend männlichen und weißen Patienten sahen so aus:
• Beim primären Endpunkt unterschieden sich die Telemonitoring- nicht signifikant von der Normalversorgungsgruppe. 52,3 % der Interventions- und 51,5 % der Kontrollgruppen-Angehörigen waren erneut in stationärer Behandlung oder starben innerhalb der 180 Tage. Dieser geringe Unterschied fand sich auch in beiden Subgruppen wieder.
• Und auch bei den sekundären Endpunkten fanden sich keinerlei statistisch signifikante Unterschiede.
• Zumindest für diese Zielgruppe verbesserte also Telemonitoring nicht das Behandlungsergebnis.
• Bei keinem Teilnehmer der randomisierten kontrollierten Studie gab es unerwünschte Wirkungen eines der Verfahren.
Dies heißt nicht, dass Telemonitoring der beschriebenen oder einer anderen Art bei Patienten mit einer anderen gesundheitlichen Konstellation nicht doch von Nutzen sein kann. Das Ergebnis zeigt aber in den Worten der Forschergruppe plastisch "the importance of a thorough, indeoendent evaluation of disease-management strategies before their adoption."
Gründlich und methodisch noch anspruchsvoller hingeschaut hat eine Gruppe deutscher ForscherInnen an der Charité in Berlin im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums im Rahmen der seit Anfang 2008 laufenden Telemedizin-Studie TIM-HF ("Telemedical Interventional Monitoring in Heart Failure"). Weitere Einzelheiten finden sich auf der vorbildlich gestalteten Website des gesamten Forschungs- und Entwicklungsprojektes "Partnership for the Heart".
Die TIM-HF-Studie gehört zu den weltweit wenigen Langzeitstudien zur Prüfung der medizinischen und wirtschaftlichen Überlegenheit einer telemedizinischen Mitbetreuung gegenüber der Standard-Therapie bei chronischer Herzinsuffizienz.
An der kontrollierten multizentrischen Studie nahmen 710 Patienten teil, jeweils zur Hälfte mit telemedizinischer Betreuung zusätzlich zur Standardtherapie ("Gruppe Telemedizin") bzw. ausschließlich mit Standardtherapie ("Gruppe Standard-Therapie").
Als Patient der Telemedizingruppe erhielt man zusätzlich zu den gewohnten Medikamenten ein EKG-Gerät, ein Blutdruckmessgerät, einen Aktivitätsmesser und eine Waage. Diese Messgeräte sind mit einem Sender ausgestattet, der die Messdaten über Bluetooth (Nahfunk) an einen Mobilen Medizinischen Assistenten (MMA) sendet. Dieser sendet dann alle Daten über Mobilfunk an das Telemedizinische Zentrum des behandelnden Krankenhauses, wo die Daten in einer elektronischen Patientenakte erscheinen und von medizinischem Fachpersonal befundet werden. Bei auffälligen Werten leitet der Arzt im Telemedizinischen Zentrum das weitere Vorgehen (z.B. Therapieplanänderung) ein. Die Angehörigen der Standard-Therapiegruppe unterscheiden sich nur darin, dass sie keine Geräte erhalten. Ihre Daten gelangen daher wesentlich seltener und nur im Rahmen direkter Kontakte zu ihren Ärzten.
Endpunkte der Studie sind Mortalität, stationäre Morbidität, Wirtschaftlichkeit und Lebensqualität. Die Studie ermöglicht zudem die Prüfung von Langzeiteffekten der telemedizinischen Mitbetreuung bei Patienten mit chronischer Herzinsuffizienz. Bisherige Studien weisen mehrheitlich eine Laufzeit von 6-12 Monaten auf und konnten daher keine Langzeiteffekte bei dieser chronischen Erkrankung prüfen. Neben den beteiligten Kliniken Charité - Universitätsmedizin Berlin und Robert-Bosch-Krankenhaus Stuttgart unterstützten niedergelassene Fachärzte aus inzwischen vier Bundesländern die Studie (Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg sowie Sachsen-Anhalt). An der technischen Entwicklung und Unterstützung während der Studie sind unter anderem die folgenden medizintechnischen Anbieter beteiligt: Robert Bosch Healthcare GmbH sowie die Intercomponentware AG und die Aipermon GmbH & Co. KG.
Die im Laufe des November 2010 veröffentlichten Ergebnisse der Studie sahen so aus:
• In der Gesamtgruppe der TeilnehmerInnen gab es weder bei der Gesamtsterblichkeit (primärer Endpunkt) noch bei den Klinikeinweisungen (sekundärer Endpunkt) signifikante Unterschiede zwischen den beiden Gruppen (Gesamtmortalität in beiden Gruppen rund 8,2 %). Erklärt wird dies von den ForscherInnen mit der insgesamt hervorragenden Versorgung herzinsuffizienter Patienten in Deutschland.
• Auch bei der mit dem SF36-Instrument gemessenen Lebensqualität im Bereich der körperlichen Funktionsfähigkeit gab es lediglich nach 12 Monaten einen absolut geringen aber signifikanten (54,3 zu 49,9 Punkte, p=0,01) Unterschied zu Gunsten der Telemonitoringgruppe. Nach 24 Monaten war die Lebensqualität in beiden Gruppen absolut fast gleich und der Unterschied auch eindeutig nicht mehr signifikant (53,8 zu 51,7 Punkten, p=0,30).
• Nach einer Subgruppenanalyse bleibt eine Subgruppe der Patienten mit Herzinsuffizienz übrig, die von Telemonitoring einen Nutzen hat: Patienten mit einer kardialen Dekompensation, die nicht depressiv sind und eine so genannte Auswurffraktion des Herzens (Herzleistungsmaß) zwischen 25 und 35 % haben. Dabei handelt es sich schätzungsweise um 10 % aller an Herzinsuffizienz leidenden Personen.
• Wichtig ist sicherlich auch, dass die technische Lösung funktioniert hat und 81 % der TeilnehmerInnen therapietreu gewesen sind. Ob dies nicht auch damit zu tun hat, dass die TeilnehmerInnen solcher Studie a priori interessierter und engagierter für die Therapie und das Erleben der Ergebnisse sind, sollte aber trotz der dabei zu überwindenden Schwierigkeiten gründlich untersucht werden.
Auch wenn dieses Ergebnis aus Sicht der WissenschaftlerInnen vor der Übernahme des Telemonitorings in die Regelversorgung noch weiter bestätigt werden sollte, steht im Prinzip fest, dass Telemonitoring nur für eine Minderheit der hier näher betrachteten Kranken einen zusätzlichen Nutzen hat.
Nur Bundeswirtschaftsminister Brüderle will für die 8 Millionen Euro Fördergelder mehr sehen und springt nach kurzem Zögern vor so viel Differenzierung in das alte "deus ex machina"-Gleis zurück: "Die Studienergebnisse müssen jetzt rasch in praktisches Handeln umgesetzt werden, zumal dadurch auch Kosten eingespart werden können. Vor allem in strukturschwachen Gebieten sehe ich große Chancen für die Telemedizin. Eines Tages könnte es Telemedizin auch in Deutschland auf Krankenschein geben."
Zu der Studie " Telemonitoring in Patients with Heart Failure" von Sarwat I. Chaudhry et al., die am 9. Dezember 2010 im "New England Journal of Medicine" (2010; 363:2301-2309) vorgestellt wurde, ist kostenlos ein Abstract zugänglich.
Die Ergebnisse der deutschen Telemonitoringstudie sind in zwei komplett und kostenlos zugänglichen Veröffentlichungen dargestellt: in dem im März 2011 in der Zeitschrift "Circulation" (2011; 123: 1873-1880) erschienen Aufsatz "Impact of Remote Telemedical Management on Mortality and Hospitalizations in Ambulatory Patients With Chronic Heart Failure : The Telemedical Interventional Monitoring in Heart Failure Study von Friedrich Köhler et al. und in dem Aufsatz "Telemedical Interventional Monitoring in Heart Failure (TIM-HF), a randomized, controlled intervention trial investigating the impact of telemedicine on mortality in ambulatory patients with heart failure: study design" von Koehler et al. in Eur J Heart Fail (2010, 12 [12]: 1354-1362).
Bernard Braun, 11.12.10
Trotz einem Positivlisten-System für Arzneimittel: Frankreich fast immer in der Spitzengruppe des Arzneimittelmarktes dabei!
 Im Herbst 2009 hat ein bei SPIEGEL-Online veröffentlichter Artikel über das Preisdiktat der Pharmaindustrie in Deutschland auf einen interessanten externen Effekt der deutschen Verhältnisse hingewiesen: "Im europäischen Ausland gilt Deutschland wegen dieser Einzigartigkeit als Referenzmarkt - zur Freude der dortigen Behörden. In Frankreich zum Beispiel wartet man gern, welchen Preis die Hersteller in Deutschland den Kassen diktieren. Dort hat die Pharmaindustrie dann wenig zu melden - sogenannte Verhandlungen laufen vielmehr nach dem Prinzip: Preis in Frankreich = deutscher Preis minus 20 Prozent." (SPIEGEL-Online 8.10.2009)
Im Herbst 2009 hat ein bei SPIEGEL-Online veröffentlichter Artikel über das Preisdiktat der Pharmaindustrie in Deutschland auf einen interessanten externen Effekt der deutschen Verhältnisse hingewiesen: "Im europäischen Ausland gilt Deutschland wegen dieser Einzigartigkeit als Referenzmarkt - zur Freude der dortigen Behörden. In Frankreich zum Beispiel wartet man gern, welchen Preis die Hersteller in Deutschland den Kassen diktieren. Dort hat die Pharmaindustrie dann wenig zu melden - sogenannte Verhandlungen laufen vielmehr nach dem Prinzip: Preis in Frankreich = deutscher Preis minus 20 Prozent." (SPIEGEL-Online 8.10.2009)
Bei der Zulassung von Arzneimitteln zur Verordnung auf Kosten der Gesetzlichen Krankenversicherung wird in Frankreich aber nicht nur auf die Deutschen gewartet. Es existieren vielmehr eine Reihe von Maßnahmen, Instrumenten und Prozeduren, die auch in Frankreich so etwas wie die Quadratur des Kreises hinbekommen sollen: So viel qualitativ hochwertige, d.h. wirksame und nützliche Arzneimittel wie nötig und diese einem möglichst fairen Preis.
Eines dieser in Frankreich und einer ganzen Reihe anderer europäischer Länder existierenden Instrumente ist ein differenziertes System von Positivlisten, also jener unter primär pharmakologischen und medizinischen Kriterien gebildeten Listen, auf denen nicht mehr jedes von den nationalen oder internationalen Zulassungsbehörden zugelassene Arzneimittel steht, sondern wesentlich weniger und auf ihre Wirksamkeit überprüfte.
In Deutschland gab es zwar 1993 und zuletzt 2003 wiederholte Anläufe ein Positivlistensystem einzuführen und es gab sogar schon fertige Listen. Doch ausgerechnet der heutige Kopfpauschalen-Rebell Horst Seehofer knickte als damaliger Bundesgesundheitsminister so tief vor der Pharmaindustrie ein, dass er 1995 die fertige Liste in einem Akt politischer Pornografie schreddern ließ und die in einen Plastiksack gepackten Schnipsel durch seinen Staatssekretär Baldur Wagner dem Präsidenten des Bundesverband der pharmazeutischen Industrie, Hans-Rüdiger Vogel, als Geburtstagsgeschenk überreichen ließ (der Beleg findet sich u.a. in einem umfassenden Text über die Pharmalobby auf der Seite 141).
Außerdem gibt es in Frankreich die "Haute Autorité de Santé (HAS)", die ähnlich wie das deutsche "Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen" - aber schon etwas länger und deswegen produktiver - die entscheidende Einrichtung für die Benennung von Kosten-Nutzenrelationen für Arzneimittel aber auch andere Medizinprodukte ist. Zu dem, was die HAS ist und was sie macht, findet sich auf ihrer Website eine ganze Menge und speziell unter der Überschrift "Key facts and figures" zahlreiche Daten und Arbeitsüberblicke für die letzten Jahre. Die meisten Dokumente stehen in französischer und englischer Sprache zur Verfügung.
Wie das französische System der Positivlisten, der HAS und weiterer Prozeduren gesetzlich fundiert ist und wie es zu welchen Grundlagen für die Regulierung von Menge, Preis und Qualität der Arzneimittelversorgung durch die Gesetzliche Krankenversicherung kommt, ist in einem aktuellen Text der französischen Medizinerin und Kennerin des dortigen Gesundheitssystems, Dr. Ursula Descamps, übersichtlich dargestellt. Dort wird sehr gut die Komplexität dargestellt, welche die Maßnahmen, die diese Ziele erreichen will, in Frankreich erreicht haben. Und natürlich versucht auch in Frankreich die Pharmaindustrie Einfluss auf die Positionierung innerhalb der Positivlisten zu nehmen.
Das damit in der Struktur deutlich andere System der Arzneimittelregulation muss sich aber auch auf dem Prüfstand der empirischen Wirksamkeit bewähren.
Ein systematischer internationaler Vergleich wichtiger Indikatoren des Arzneimittelgeschehens mit den OECD-Health Data 2009, zeigt, dass auch die Wirksamkeit des französischen Systems der Zulassung von Arzneimitteln als Leistung der gesetzlichen Krankenkassen nicht so aussieht wie es dort und von denjenigen, die von Positivlisten spürbare Effekte erwartet wird:
• Frankreich belegt bei den Arzneimittelausgaben (in Kaufkraftparitäten - PPP) mit 711 PPP pro Kopf Rang 3 (Deutschland mit 656 PPP: Rang 6)
• Frankreich erreicht bei dem Anteil sämtlicher Arzneimittelausgaben an den gesamten Gesundheitsausgaben mit 16,3 % Rang 11 (Deutschland mit 15,1 % Rang 13)
• Beim Anteil öffentlich finanzierter Arzneimittelausgaben pro Kopf liegen Frankreich und Deutschland auf dem zweiten und ersten Platz.
• Und auch beim Anteil der öffentlich finanzierten Arzneimittelausgaben an sämtlichen Ausgaben für Arzneimittel liegen beide Länder in der Spitzengruppe: In Deutschland sind dies 75,9 %, was es auf Platz 1 bringt. In Frankreich 69,4 % und Platz 4.
Auch wenn diese Verhältnisse nicht als absoluter Beleg für die völlige Nutzlosigkeit eines Positivlistensystems interpretiert werden sollten, zeigen sie aber, dass es sich auch bei Positivlisten um kein selbstlaufendes Patentrezept oder Wundermittel handelt. Ähnlich wie in dem von der Anzahl der Instrumente her überregulierten deutschen Arzneimittelsystem kommt es wahrscheinlich auf eine Kombination von Maßnahmen an.
Die kurze informative Übersicht " Zulassung zur Kostenübernahme durch die Krankenversicherung, Kosten-Nutzen-Evaluation, Preisfestsetzung von Arzneimitteln in Frankreich" von U. Descamps kann kostenlos heruntergeladen werden.
Bernard Braun, 20.6.10
(Fehl)-Versorgung von Rücken- und Ischiasschmerzen: Besser normale Alltagsaktivitäten statt Bettruhe!
 Während früher "Bettruhe" bei einer Fülle von Erkrankungen zu den bevorzugten therapeutischen Empfehlungen oder Anordnungen gehörte und auch die langen Liegezeiten in Krankenhäusern u.a. diesem Therapieprinzip entsprang, deutet sich seit einigen Jahren eine Kehrtwende an. Egal ob es die Zeit nach einem Herzinfarkt oder einer Entbindung ist oder nach verschiedenen Operationen, gehört die schnelle (Re-)Aktivierung von Patienten immer häufiger zum Mittel der ersten Wahl. Trotzdem müssen Patienten wie Therapeuten noch immer vom Nutzen und fehlenden oder geringen Schaden dieser Methode überzeugt werden.
Während früher "Bettruhe" bei einer Fülle von Erkrankungen zu den bevorzugten therapeutischen Empfehlungen oder Anordnungen gehörte und auch die langen Liegezeiten in Krankenhäusern u.a. diesem Therapieprinzip entsprang, deutet sich seit einigen Jahren eine Kehrtwende an. Egal ob es die Zeit nach einem Herzinfarkt oder einer Entbindung ist oder nach verschiedenen Operationen, gehört die schnelle (Re-)Aktivierung von Patienten immer häufiger zum Mittel der ersten Wahl. Trotzdem müssen Patienten wie Therapeuten noch immer vom Nutzen und fehlenden oder geringen Schaden dieser Methode überzeugt werden.
Für eine der häufigsten akuten und auch belastenden Erkrankungen, die Rückenschmerzen, gibt es nun von Wissenschaftlern des norwegischen "Centre for the Health Services" einen Cochrane Review, der zehn randomisierte kontrollierte Studien mit insgesamt 1.923 TeilnehmerInnen mit Rückenschmerzen und Ischias darauf hin untersuchte, ob eine schnelle Aktivierung einen höheren Nutzen hat als Bettruhe oder umgekehrt.
Wenngleich mit zum Teil bescheidener, geringer oder sogar nicht vorhandener Evidenz präsentierten die Reviewer folgende Ergebnisse:
• Bei Rückenschmerzen sollte Bettruhe möglichst vermieden werden, d.h. die Patienten sollten besser ihren normalen Alltagsaktivitäten nachgehen. Aktive Patienten hatten bei einer Untersuchung nach zwölf Wochen weniger Schmerzen und waren in ihrer Beweglichkeit weniger eingeschränkt als andere Patienten, die sich vorrangig im Bett aufhielten.
• Bei Patienten mit Ischiasschmerzen gäbe es aber keine Nutzenunterschiede oder gar erneut eine Überlegenheit von aktiven Tätigkeiten.
• Auch wenn es nur einen geringen oder gar keinen überlegenen Nutzen der Aktivierung dieser Patienten gibt, spricht die Gesamtbilanz von Nutzen und Nachteilen oder Schaden bei beiden Erkranktengruppen für die Wahl der Aktivierung. Wie die AutorInnen der Studie nämlich hervorheben, besitzt Bettruhe den potenziell schädlichen Effekt, dass pro Tag zwei bis fünf Prozent der Körperkraft verloren geht und außerdem einige körpereigene Prozesse mit positiven Wirkungen auf die beiden Symptomatiken langsamer abliefen oder gar eingestellt würden (z.B. der Nährstofftransport zur Wirbelsäule).
Zu dem im Juni 2010 veröffentlichten Cochrane-Review "Advice to rest in bed versus advice to stay active for acute low-back pain and sciatica" von Dahm KT, Brurberg KG, Jamtvedt G. und Hagen KB (Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 6. Art. No.: CD007612. DOI: 10.1002/14651858.CD007612.pub2) gibt es nur das wie üblich etwas ausführlichere Abstract kostenlos.
Bernard Braun, 17.6.10
Klinische Behandlungspfade helfen Behandlungsqualität zu verbessern und teilweise Liegezeiten und Behandlungskosten zu verringern!
 Nicht selten als Form von "Kochbuchmedizin" oder auch als rein ökonomisch induzierte Übertragung von Normen industrieller Serienfertigung kritisiert oder in Frage gestellt, erwiesen sich klinische Behandlungspfade bzw. "clinical pathways" im Rahmen eines Reviews der "Cochrane Effective Practice and Organisation of Care Group" als geeignet, die Verweildauer in Krankenhäusern verkürzen, Kosten zu reduzieren aber vor allem auch die Behandlungsqualität zu sichern.
Nicht selten als Form von "Kochbuchmedizin" oder auch als rein ökonomisch induzierte Übertragung von Normen industrieller Serienfertigung kritisiert oder in Frage gestellt, erwiesen sich klinische Behandlungspfade bzw. "clinical pathways" im Rahmen eines Reviews der "Cochrane Effective Practice and Organisation of Care Group" als geeignet, die Verweildauer in Krankenhäusern verkürzen, Kosten zu reduzieren aber vor allem auch die Behandlungsqualität zu sichern.
Die um den Dresdner Gesundheitswissenschaftler Thomas Rotter gescharte internationale Reviewer-Gruppe stützt sich bei diesen Aussagen auf eine Auswahl von 27 randomisierten kontrollierten Studien aus insgesamt international existierenden qualitativ hochwertigen 3.214 Studien, die sich bisher mit den verschiedenen Wirkungen klinischer Behandlungspfade beschäftigten. An den ausgewählten Studien nahmen insgesamt 11.398 PatientInnen teil. Bisher gab es auf der Basis einzelner Studien nicht selten zum Teil sich diametral widersprechende Ergebnisse.
20 Studien verglichen die Ergebnisse von Behandlungen, die ausschließlich auf der Basis von klinischen Behandlungspfaden erfolgten mit den Ergebnissen in Krankenhäusern mit normaler Behandlung.
Die jeweils statistisch signifikanten Hauptergebnisse dieser Studien sahen wie folgt aus:
• Die Häufigkeit von Komplikationen wie etwa Wundinfektionen, Blutungen und Pneumonien während eines stationären Aufenthalts wurde um 42% reduziert.
• Eine umfassende Dokumentation der Behandlung erfolgte in Krankenhäusern mit klinischen Behandlungspfaden fast vierzehnmal häufiger als in Krankenhäusern mit traditionellen, nichtstrukturierten Behandlungsabläufen.
• Es gibt keine Anzeichen für für signifikante Unterschiede bei der Wiedereinweisungshäufigkeit oder der Häufigkeit von tödlichen Ereignissen während des Krankenhausaufenthalts.
• Bei dem am häufigsten dokumentierten Indikator der Aufenthaltsdauer gibt es viele Studien, die unter den Bedingungen klinischer Behandlungspfade kürzere Liegezeiten nachwiesen.
• Auch bei den Kosten der Behandlungen finden sich zahlreiche Studien, die erhebliche Kostenunterschiede zwischen den verglichenen Behandlungsmodi zeigen. Je nach Ausgangssituation des Krankenhauses reichte die durch Behandlungspfade erreichte Einsparung von mehreren hundert bis zu mehreren tausend US-Dollar.
• Die beachtliche methodische Heteroegenität derartiger Studien erlaubte es aber nicht, eine aussagekräftige Meta-Analyse zur Aufenthaltsdauer und den Aufenthaltskosten durchzuführen. Die Autoren schlussfolgern daher auch nur sehr zurückhaltend, Behandlungspfad-Behandlung sei "without negatively impacting on length of stay and hospital costs".
Als inhaltliche Beschränkungen ihres Reviews merken die Reviewer selber an, sie hätten weder untersucht, ob niedrigere Krankenhauskosten möglicherweise in andere Behandlungssektoren verschoben werden, noch reichten die wenigen dazu in den Studien berichteten Fakten aus, einzelne Faktoren des Konzepts der klinischen Behandlungspfade als besonders erfolgversprechende nachzuweisen.
Beim Vergleich der Ergebnisse von sieben Studien, bei denen klinische Behandlungspfade zusammen mit anderen Behandlungsformen wie Case-Management etc. zum Einsatz kamen, mit den Ergebnissen der Behandlung mit üblichen Behandlungsformen, zeigten sich interessanterweise bei keinem der untersuchten Leistungsindikatoren signifikanten Unterschiede. Auch bei der Lektüre des gesamten Reviews fanden sich keine substantiellen Hinweise woran dies liegen könnte.
Zu dem 166 Seiten umfassenden Cochrane Intervention Review "Clinical pathways: effects on professional practice, patient outcomes, length of stay and hospital costs." von Rotter T, Kinsman L, James E, Machotta A, Gothe H, Willis J, Snow P und Kugler J. (CochraneDatabase of Systematic Reviews 2010, Issue 3. Art.No.:CD006632.) gibt es kostenlos nur ein Abstract.
Bernard Braun, 30.5.10
"Gesunde Normalität" oder wie (lebens)-gefährlich sind sekundärpräventive "Idealwerte"? - Das Beispiel Diabetes und HbA1c-Wert
 Mehrere Studien haben in der jüngsten Vergangenheit gezeigt, dass das sekundärpräventive Erreichen bisher für erstrebenswert gehaltener Parameter nicht nur nicht den erwarteten Erhalt oder Zugewinn an Gesundheit mit sich brachte, sondern sogar Nachteile bei Morbidität, Mortalität und Lebensqualität. Dies gilt beispielsweise für den Body Mass-Index (BMI). Statt des lange für optimal gehaltenen BMI-Wert von 25 und weniger wird jetzt sogar ein leichtes bis mittleres Übergewicht mit einem BMI-Wert zwischen 25 und 29,9 als gesünderer Zielwert angesehen (vgl. hierzu u.a. einen Studienbericht im Forum Gesundheitspolitik aus dem Jahr 2009).
Mehrere Studien haben in der jüngsten Vergangenheit gezeigt, dass das sekundärpräventive Erreichen bisher für erstrebenswert gehaltener Parameter nicht nur nicht den erwarteten Erhalt oder Zugewinn an Gesundheit mit sich brachte, sondern sogar Nachteile bei Morbidität, Mortalität und Lebensqualität. Dies gilt beispielsweise für den Body Mass-Index (BMI). Statt des lange für optimal gehaltenen BMI-Wert von 25 und weniger wird jetzt sogar ein leichtes bis mittleres Übergewicht mit einem BMI-Wert zwischen 25 und 29,9 als gesünderer Zielwert angesehen (vgl. hierzu u.a. einen Studienbericht im Forum Gesundheitspolitik aus dem Jahr 2009).
Eine Studie aus dem Jahr 2008 (ACCORD), über deren Ergebnisse zu den Wirkungen der so genannten intensivierten Insulintherapie von DiabetikerInnen wir ebenfalls schon berichteten, hatte für diese Behandlungsvariante einen signifikant höheren Anteil unerwünschter Folgen gezeigt.
In mehreren aktuellen Studien über den für Diabeteskranke wichtigen sog. Blutzuckergedächtniswert HbA1c wurde nun untersucht, ob die Praxis, den langjährig und für viele Diabetiker wie ihre behandelnden Ärzte auch heute noch für ideal gehaltenen Wert von 6,5% oder sogar niedrigere Werte anzustreben, gesundheitlich unerwünschte Folgen hat.
Dazu wurden aus der "UK General Practice Research Database" für den Zeitraum von Ende 1986 bis Ende 2008 zwei Gruppen von Diabetes Typ 2-Kranken im Alter von 50 und mehr Jahren gebildet: 27.965 Personen stark war eine Gruppe von PatientInnen, deren Diabetesbehandlung mit mehreren oralen Arzneimitteln erfolgte und 20.005 wurden unter Einbezug von Insulin behandelt. Multimorbide Personen wurden aus der Studie ausgeschlossen. Die TeilnehmerInnen an dieser retrospektiven Kohortenstudie wurden nach nach den als Confoundern angesehenen Merkmalen Alter, Geschlecht, Raucherstatus, Cholesterinwert, kardiovaskulärem Risiko und dem allgemeinen Gesundheitszustand adjustiert, was bedeutet, dass diese Einflussfaktoren beim Ergebnis keine Rolle mehr spielen.
Die Berechnung der sogenannten adjustierten Risikorate (hazard ratio) für die Gesamtsterblichkeit führte zu folgenden Ergebnissen:
• Die 10% StudienteilnehmerInnen mit einem HbA1c-Wert unter 6,7% hatten eine höhere Sterblichkeitsrate als die DiabetikerInnen mit einem Wert zwischen 6,8% und 9,9%.
• Ihre Sterblichkeitsrate war in etwa so hoch wie die der Personen mit dem aus diabetologischer Sicht tatsächlich katastrophalen HbA1c -Wert von 10 und mehr Prozent.
• Kardiovaskuläre Erkrankungen wie z.B. Herzinfarkt oder Schlaganfall waren in der Personengruppe mit dem niedrigsten HbA1c-Wert sogar häufiger als in allen anderen Teilgruppen mit höheren Werten.
• Verglichen mit der Personengruppe mit einem HbA1c-Wert von 7,4 bis 7,7% hatten die mit Insulin behandelten DiabetikerInnen ein höheres Sterberisiko (1,79) als die mit oralen Antidiabetika behandelten Personen (1,30).
• Auch in dieser bisher zahlenmäßig größten Studie zu unerwünschten Effekten von bisher als ideal betrachteten Werten betrachten die Forscher das mit dem Erreichen dieses Wertes verbundene Risiko von Unterzuckerung bis hin zum Unterzuckerungskoma als Hauptgrund für die erhöhte Sterblichkeit.
Auch wenn die Forschergruppe auf viele methodische Einschränkungen ihrer Studie hinweist, ist ihre Schlussfolgerung, man müsse den Zielwert revidieren, von hoher praktischer Relevanz und Dringlichkeit. Auch wenn also aus methodischen Gründen keine kausalen Schlüsse möglich sind, sollten künftig die genannten aber auch andere scheinbar selbstevidenten oder plausiblen Idealwerte und Zielgrößen (noch) kritischer betrachtet und systematisch auf ihre möglicherweise auch unerwünschten Wirkungen hin untersucht werden. Dies gilt nach dieser und den Vorläuferstudien eindeutig für den bisher "idealen" HbA1c-Minimalwert.
Zu dem im britischen Medizin-Journal "Lancet" erschienenen Aufsatz "Survival as a function of HbA1c in people with type 2 diabetes: a retrospective cohort study" von Craig J Currie et al. (The Lancet, Volume 375, Issue 9713, Pages 481 - 489) gibt es nur ein kostenloses Abstract.
Bernard Braun, 1.4.10
US-Studie: Haben Arztpraxen zu wenig Patienten für gute Qualitätssicherung der Behandlung einer Vielzahl von Erkrankungen?
 Der § 135a SGB V verpflichtet ausdrücklich Vertragsärzte, medizinische Versorgungszentren, zugelassene Krankenhäuser und Erbringer von Vorsorgeleistungen oder Rehabilitationsmaßnahmen dazu, ihre Leistungen nach dem "jeweiligen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse ... und in der fachlich gebotenen Qualität" zu erbringen.
Der § 135a SGB V verpflichtet ausdrücklich Vertragsärzte, medizinische Versorgungszentren, zugelassene Krankenhäuser und Erbringer von Vorsorgeleistungen oder Rehabilitationsmaßnahmen dazu, ihre Leistungen nach dem "jeweiligen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse ... und in der fachlich gebotenen Qualität" zu erbringen.
Sie sollen sich dazu an "einrichtungsübergreifenden Maßnahmen der Qualitätssicherung ... beteiligen, die insbesondere zum Ziel haben, die Ergebnisqualität zu verbessern und einrichtungsintern ein Qualitätsmanagement" einführen. So weit, so gut und sicherlich ein gewaltiger Fortschritt gegenüber der Vergangenheit.
Die Frage, wie z.B. Einzelarztpraxen dies praktisch schaffen und ob sie überhaupt von ihren Strukturbedingungen in der Lage sind, dem hohen Anspruch genügen zu können, ist nach der Veröffentlichung einer Studie, welche die Möglichkeit us-amerikanischer niedergelassener Ärzte, die dortigen Anforderungen an Qualitätssicherung zu erfüllen, untersuchte, eine absolut berechtigte.
Die US-Forscher fanden nämlich nach der Analyse der Anzahl von Patienten mit ausgewählten Behandlungsanlässen oder Diagnosen und dem damit in Allgemein-/Hausarztpraxen und -zentren verbundenen Aufwand folgendes für die Qualitätssicherungsrealität heraus:
• Will man der Qualitätssicherung im Medicaresystem der USA statistisch zuverlässige, d.h. mindestens 10% betragende Unterschiede in Kosten und Behandlungsqualität zugrundelegen, und dies z.B. bei der Mammographierate von Frauen im Alter zwischen 66 und 69 Jahren, der Bestimmung des HbA(1c)-Wertes bei 66-75-jährigen Diabetikern, der Rate vermeidbarer Hospitalisierung und der Rate der stationären Wiederaufnahme nach Entlassung bei kongestiver Herzinsuffizienz., müssen die Praxen eine beträchtliche Anzahl von Patienten mit der jeweiligen Erkrankung behandeln.
• Die Versorgungszentren und Arztpraxen der Primärversorgung behandelten im jährlichen Mittel insgesamt 260 Medicare-Patienten 25 Mammographie-Patientinnen, 30 Diabetespatienten mit Hämoglobin A(1c)-Bestimmung und 0 Patienten mit Hospitalisierung wegen kongestiver Herzinsuffizienz.
• Bei der Mammographierate und der Hämoglobin A(1c)-Bestimmung lag der Anteil von Praxen mit ausreichender Patientenfallzahl bei Praxen mit weniger als 11 Primärärzten unter 10% und erst bei Praxiszentren mit mehr als 50 Ärzten bei 100%. Keine der Praxen der Primärversorgung hatte genügend Patienten, um 10%-ige Qualitätsunterschiede hinsichtlich vermeidbarer Hospitalisierung oder Wiederaufnahme bei kongestiver Herzinsuffizienz innerhalb von 30 Tagen zu erfassen.
• Viele Einzelarztpraxen und auch relativ viele kleine bis mittlere primärärztliche Versorgungszentren haben also eine ausreichende große Patientenfallzahlen, um die übliche Bestimmung von Behandlungsqualität und Kosteneffizienz mit 10%-igen Unterschiede bei Medicare-Patienten mit kostenfreier Behandlung verlässlich durchführen zu können. Damit fehlt ihnen aber ein wichtiges Datum für Qualitätssicherung oder -management bei vielen ihrer Patienten, das sie auch durch eine Absenkung der quantitativen Anforderungen an die Patientenzahl unter die 10-Prozentmarke nicht generieren können.
Wie fast immer, gibt es für den Bereich der ambulanten ärztlichen Behandlung in Deutschland (noch) keine vergleichbare Untersuchung und daher auch keine spezifischen Daten. Wie mehrere Analysen der letzten Jahre zeigten, konzentriert sich das Krankheitsgeschehen der meisten Patienten von Allgemeinärzten zwar auf relativ wenig Diagnosen. Dahinter verbergen sich aber vor allem in der durchschnittlichen Einzelarztpraxis (2005 waren noch 63% aller Praxen Einzelpraxen, was mittlerweile weniger sein dürften) eine je nach Diagnose absolut rasch kleiner werdende Anzahl von Personen, die eine Qualitätsüberprüfung auf dem US-Niveau der 10%-Unterschiede auch unmöglich machen:
• In der DETECT-Studie von 2007 war die häufigste Diagnose der Bluthochdruck, der bei 35,5% der TeilnehmerInnen an einer Basisuntersuchung diagnostiziert wurde. Auf den weiteren Häufigkeitsrängen landeten erhöhte Bluttfertwerte (29,5%), Übergewichtigkeit/Adipositas (32,9%) oder die koronare Herzkrankeit (12,1%). Depressionen waren mit 10,6% schon seltener und völlig selten war in einer ambulanten Praxis der Schlaganfall (1,7%).
• Im Praxenpanel des "Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung in der Bundesrepublik Deutschland" (ZI-ADT-Panel) der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, das für eine ausgewählte Anzahl von 58 Allgemeinarztpraxen (darunter 49 Einzelpraxen) im KV-Bezirk Nordrhein das Diagnosenspektrum dokumentiert, sah dies im I.Quartal 2008 bei 71.915 PatientInnen so aus: Auf Platz 1 stand auch die essentielle (primäre) Hypertonie (30,9% der PatientInnen), gefolgt von Störungen d. Lipoproteinstoffwechs. u.sonst.Lipidämien (22,9%), Rückenschmerzen (14,3%), Sonstigen nichttoxische Struma (9,8%), der chronischen ischämischen Herzkrankheit (9,8%), dem nicht primär insulinabhäng. Diabet. mell.[Typ-2-Diab.] (9,3%), der Adipositas (8,1%), der akut.Infektion.mehrer.od.n.n.bez.Lokalis.d.ob.Atemwege (7,9%), der sonst. Krankh. v. Wirbelsäule/Rücken, and.nicht klass. (7,1%) und der Gastritis und Duodenitis (6,9%). Auf Platz 25 befand sich dann die Herzinsuffizienz (4,3%) und auf dem letzten Platz 29 somatoforme Störungen (Störungen, die sich eindeutig auf körperliche Störungen zurückführen lassen wie z.B. Erschöpfung,Müdigkeit und bestimmte Schmerzen), die bei 3,8% der PatientInnen von Allgemeinärzten/Hausärzten auftraten. Berücksichtigt man, dass das ZI (siehe dazu den faktenreichen Vortrag eines ZI-Mitarbeiters auf der 54. Gmds-Jahrestagung 2009) eine durchschnittliche Anzahl von 2.045 Patienten pro Praxis (Mehrfachzählungen möglich) im gesamten Jahr 2008 angibt, haben die meisten Praxen bei den meisten Krankheiten zu wenig Patienten für eine methodisch hochwertige Qualitätskontrolle und -sicherung.
Damit besteht trotz der guten normativen Ausgangssituation im deutschen Gesundheitssystem die Gefahr, dass sich Qualitätsmanagement weiter und überwiegend in Untersuchungen zur Struktur- und bestenfalls Prozessqualität erschöpft und mit dem Anbringen von Zertifikaten und Plaketten endet.
Die Ergebnisqualität als wichtigster Indikator für Qualität bliebe dabei - nur jetzt wegen nicht ausreichender Fälle bzw. Patienten - im Dunkeln. Wenn sich dies bewahrheitet, muss sich der Gesetzgeber und die gemeinsame Selbstverwaltung von Krankenkassen und Ärzten rasch einfallen lassen, ob dies mit den einrichtungsübergreifendenb Maßnahmen doch machbar ist oder was sonst noch passieren müsste, um die zitierten Normen und Ziele umsetzen zu können.
Zu der US-Studie "Relationship of primary care physicians' patient caseload with measurement of quality and cost performance" von Nyweide DJ, Weeks WB, Gottlieb DJ, Casalino LP und Fisher ES, die im "Journal of American Medical Association (JAMA)" am 9. Dezember 2009 (302(22):2444-50) erschienen ist, gibt es kostenlos nur ein Abstract.
Einige Auszüge zum Diagnosenspektrum aus dem Buch "Detect: Ergebnisse einer klinisch-epidemiologischen Querschnitts- und Verlaufsstudie mit 55.000 Patienten in 3.000" von Wittchen H.U. und Pieper L. gibt es kostenlos im Internet zum Lesen.
Einige Daten aus dem ZI-ADT-Panel I. Quartal 2008 des Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in der Bundesrepublik Deutschland gibt es kostenlos.
Bernard Braun, 16.3.10
Unter-/Fehlversorgung für Diabetiker in England: Leichte und schwere Amputationen nehmen bei Typ 2-Diabetikern 1996-2005 zu.
 Amputationen der unteren Gliedmaßen gehören zu den folgenschwersten Folgen einer diabetischen Angiopathie bei Typ 1 und Typ 2-Diabeteskranken. Obwohl es genügend einfache praktische und wirksame Interventionen gibt, neben der Senkung des Blutzuckers vor allem die regelmäßige Kontrolle der Füße und zusätzlich die Kontrolle der Augen und der Nieren, zeigen langjährige Untersuchungen zur Inzidenz von Amputationen bei beiden Arten der Diabeteskranken kein richtig befriedigendes oder gar ein dramatisch schlechter werdendes Geschehen.
Amputationen der unteren Gliedmaßen gehören zu den folgenschwersten Folgen einer diabetischen Angiopathie bei Typ 1 und Typ 2-Diabeteskranken. Obwohl es genügend einfache praktische und wirksame Interventionen gibt, neben der Senkung des Blutzuckers vor allem die regelmäßige Kontrolle der Füße und zusätzlich die Kontrolle der Augen und der Nieren, zeigen langjährige Untersuchungen zur Inzidenz von Amputationen bei beiden Arten der Diabeteskranken kein richtig befriedigendes oder gar ein dramatisch schlechter werdendes Geschehen.
In England wurde jetzt die Entwicklung der Amputations-Inzidenz bei Typ 1 und Typ 2-DiabetikerInnen von 1996 bis 2005 untersucht und die Ergebnisse in der Februarausgabe 2010 der Fachzeitschrift "Diabetes Research and Clinical Practice" veröffentlicht.
Dazu wurden die diagnostischen und therapeutischen Daten aller Personen ausgewertet, die in diesen 10 Jahren in einem NHS-Krankenhaus in England an den unteren Extremitäten amputiert werden mussten (exkl. Amputationen aufgrund von Knochenbrüchen). Insgesamt handelt es sich um 56.624 Minor- und 48.569 Major-Amputationen bei 84.597 Patienten. 40% aller Krankenhauseinweisungen für eine Amputationen erfolgten für einen Diabeteskranken (13,5% Typ 1 und 26,5% Typ 2). Anders als in Studien, die einen Rückgang der gesamten Amputationsinzidenz bei allen DiabetikerInnen konstatierten, gehen in diese Untersuchung alle Krankenhausfälle der gesamten Bevölkerung Englands ein.
Zur Erinnerung: Amputationen werden meist wegen massiver Wundheilungsstörungen notwendig, die darauf beruhen, dass die zerstörten Gefäße zu einer diabetischen Neuropathie führen, die eine weitgehende Empfindungslosigkeit in den Füßen bedeutet. Verletzt sich ein Diabetiker z.B. bei der eigenen Fußpflege an den Füßen, empfindet er keinen Schmerz und die Wundheilung verzögert sich so stark, dass es zu großen Entzündungen kommt.
Die wichtigsten Ergebnisse im Einzelnen:
• Die Zahl der Amputationen unterhalb des Fußknöchels (sog. Minor-Amputationen) sank bei den Typ 1 DiabetikerInnen, der quantitativ deutlich kleineren Gruppe der Diabeteskranken, von 1996 bis 2005 um insgesamt 11,4%. Die Anzahl der schwereren Amputationen, d.h. der Amputationen oberhalb des Fußknöchels, ging sogar um 41% zurück. So erfreulich dies ist, so bleibt festzuhalten, dass nur der kleinere Teil der Inzidenz abgebaut werden konnte.
• Die Zahl der Minor-Amputationen bei den Nicht-DiabetikerInnen sank um 32,4%, die ihrer Major-Amputationen um 22%.
• Die alters- und geschlechtsadjustierte Inzidenz der Minor-Amputationen fiel bei Typ 1-DiabetikerInnen von 1,5 auf 1,2 Fälle/100.000 Einwohner und bei Nicht-DiabetikerInnen von 8,1 auf 5,1 Fälle/1000.000 Einwohner. Die Neuerkrankungsrate für Major-Amputationen fiel bei Typ 1-DiabetikerInnen von 1,3 auf 0,7 und von 7 auf 4,9 Fälle/100.000 Personen bei Nicht-DiabetikerInnen.
• Ganz anders sieht es bei den Amputationen bei Typ 2-DiabetikerInnen aus: Die Anzahl der Minor-Amputationen verdoppelte sich fast von 1.172 auf 2.151 und die der Major-Amputationen stieg von 994 auf 1.424. Dies schlug sich auch in einem erheblichen Anstieg der Inzidenz beider Schweregrade der diabetesbedingten Amputationen bei Typ 2 DiabetikerInnen nieder: Sie stieg für die Minor-Amputationen von 2,4 auf 4,1 Fälle pro 100.000 Personen und bei den Major-Amputationen von 2,0 auf 2,7 Fälle pro 1000.000 Personen.
Angesichts der durch zahlreiche Studien belegten Möglichkeit, die Inzidenz von Amputationen durch eine Kombination von präventiven Maßnahmen und Interventionen um maximal 78% zu reduzieren, sind die Vorschläge der Forschergruppe, die Fußkontrollen zu intensivieren, Patienten besser zu schulen und ein Management für Fußverletzungen von DiabetikerInnen einzuführen, von hoher Bedeutung.
Auch in dieser Studie bleibt aber im Lichte der harten Zahlen undiskutiert und -geklärt, warum sich nicht mehr PatientInnen und ihre Ärzte systematisch und mit dem dafür notwendigen geringen Aufwand um die Füße der Erkrankten kümmern.
Von dem Aufsatz "Trends in lower extremity amputations in people with and without diabetes in England, 1996-2005" von Eszter Panna Vamos, Alex Bottle, Azeem Majeed und Christopher Millett aus der Zeitschrift "Diabetes Research and Clinical Practice" (Volume 87, Issue 2, February 2010, Pages 275-282) ist ein Abstract kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 15.2.10
Zunahme der bildgebenden Diagnostik: Unerwünschte Strahlenbelastungen und geringer Nutzen gegen Fehldiagnosen. Lösung in den USA?
 Ohne dass es lückenlose und uneingeschränkte Nachweise der Notwendigkeit und des Nutzens gibt, wächst die Anzahl der Verfahren der bildgebenden Diagnostik und darunter besonders auch der mit einer Röntgenstrahlenexposition verbundenen Verfahren in Deutschland seit Mitte der 1990er Jahren stetig an.
Ohne dass es lückenlose und uneingeschränkte Nachweise der Notwendigkeit und des Nutzens gibt, wächst die Anzahl der Verfahren der bildgebenden Diagnostik und darunter besonders auch der mit einer Röntgenstrahlenexposition verbundenen Verfahren in Deutschland seit Mitte der 1990er Jahren stetig an.
Der aktuellste Bericht zu dieser Entwicklung, der im Dezember 2008 erschienene "Jahresbericht 2007 Umweltradioaktivität und Strahlenbelastung" des Bundesamtes für Strahlenschutz stellt in seinem Hauptabschnitt über den medizinischen Beitrag zum Problem trotz einer Reihe methodischer Probleme und Skrupel folgende ZUstände und Tendenzen dar:
• Zur Generaltendenz: "Der größte Beitrag zur zivilisatorischen Strahlenexposition wurde durch die Anwendung radioaktiver Stoffe und ionisierender Strahlung in der medizinischen Diagnostik verursacht. Insbesondere der Beitrag der Röntgendiagnostik zur effektiven Dosis ist in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen. Wesentliche Ursache für die Zunahme ist die steigende CT-Untersuchungshäufigkeit. Von daher bleibt in diesem Bereich Handlungsbedarf weiterhin angezeigt."
• Tendenz des klassischen Röntgen: "Für das Jahr 2005 wurde für Deutschland eine Gesamtzahl von etwa 132 Millionen Röntgenuntersuchungen abgeschätzt (ohne zahnmedizinischen Bereich: etwa 84,5 Mio. Röntgenuntersuchungen). Die Häufigkeit von Röntgenuntersuchungen in Deutschland während des betrachteten Zeitraums 1996 bis 2005 nahm leicht ab, wobei der Wert für das Jahr 2005 bei etwa 1,6 Röntgenuntersuchungen pro Einwohner und Jahr liegt." 1996 betrug dieser Wert 1,8.
• Tendenz des "modernen" Röntgen=Computertomographie: "In der Trendanalyse am auffälligsten ist die stetige Zunahme der Computertomographie(CT)-Untersuchungen - insgesamt um nahezu 80% über den beobachteten Zeitraum." Die Häufigkeit stieg von rund 0,06 (1996) auf rund 0,11 (2005) CT-Untersuchungen pro Einwohner und Jahr.
• Bildgebende Verfahren ohne Röntgenexposition: "Ein erheblicher Anstieg ist auch bei den "alternativen" bildgebenden Untersuchungsverfahren, die keine ionisierende Strahlung verwenden, zu verzeichnen, insbesondere bei der Magnetresonanztomographie (MRT)." Der Anstieg von 1996 auf 2005 erfolgte von 0,02 auf 0,08 Untersuchungen pro Einwohner und Jahr.
• Zu den Strahlenbelastungseffekten: Unter verschiedenen Annahmen "beläuft sich die - rein rechnerische - effektive Dosis pro Einwohner in Deutschland für das Jahr 2005 auf ca. 1,8 mSv und stieg damit über den Beobachtungszeitraum nahezu kontinuierlich an. Der festgestellte Dosisanstieg ist im Wesentlichen durch die Zunahme der CT-Untersuchungshäufigkeit bedingt."
• Wo steht Deutschland international?: "Im internationalen Vergleich liegt Deutschland nach den vorliegenden Daten bezüglich der jährlichen Anzahl der Röntgenuntersuchungen pro Einwohner und Jahr im oberen Bereich." In Ländern wie den USA betrug die effektive Dosis pro Kopf in den USA im Jahr 2006 3,2 mSv.
• Was tun?: "Darüber hinaus ist es weiterhin erforderlich, bei der Ärzteschaft ein Problembewusstsein für eine strenge Indikationsstellung unter Berücksichtigung der Strahlenexposition der Patienten zu schaffen."
Dem gesundheitspolitikfernen Bundesamt ist es nicht übel zu nehmen, dass es bei Appellen an das "Problembewusstsein" und bei den technischen Möglichkeiten der Röntgenverordnung verharrt, die Strahlenexposition zu reduzieren.
Außerdem stellt sich auch hier die Frage warum zu diesem quantitativ und qualitativ relevanten gesundheitsbezogenen Geschehen nicht die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) die Daten liefert und sich auf dieser Datenbasis verstärkt um die wahrscheinliche diagnostische Über- oder Fehlversorgung kümmert?
Um über andere, ausdrücklich gesundheitspolitische Methoden und deren Wirksamkeit Genaueres zu erfahren, muss man schon in die USA schauen. Angesichts der gerade genannten sehr hohen Strahlenbelastung und den damit auch noch verbundenen hohen Gesundheitsausgaben ist es nicht verwunderlich, dass dort bereits vor mehreren Jahren versucht wurde, die Zunahme aller bildgebenden und besonders der röntgenbasierten Verfahren zu stoppen und den Trend u.U. umzukehren.
Ob es dort gelungen ist eine wirksame Lösung zu finden und wodurch, arbeitet nun ein im Januar 2010 in der renommierten US-Public Health-Zeitschrift "Health Affairs" erschienener Aufsatz akribisch auf.
Zu den wesentlichen Daten und Einflussfaktoren der Untersuchung gehören:
• Zwischen 2000 und 2005 nahm die Anzahl der bildgebenden Untersuchungen für die ambulante Behandlung mit so genannten entwickelten diagnostischen Bildverfahren (MRT, CT und Nuklearmedizin - hier vor allem die Positronenemissionstomographie PET) für Medicare-Versicherte um 72,7% zu (von 365,7 Untersuchungen pro 1.000 Versicherte auf 631,4 Untersuchungen pro 1.000 Versicherte). Die jährliche durchschnittliche Wachstumsrate war mit 11,3% bei MRT-Untersuchungen am höchsten, dicht gefolgt von der Nuklearmedizin mit 10,7% und der CT mit 9,2%.
• Während die Zunahme der Häufigkeit bildgebender Diagnostik in ambulanten Praxen (inklusive alleinstehende Diagnosezentren bzw. "imaging centers") von 2000 bis 2006 jährlich rund 15,4% betrug, stieg derselbe Indikator in ambulanten Einrichtungen innerhalb von Krankenhäusern lediglich um 6,1% pro Jahr.
• Mit dem "Deficit Reduction Act (DRA)" von 2005, der allerdings voll erst mit dem Beginn des Jahres 2007 wirkte, versuchte die US-Regierung diese Entwicklung in ambulanten Praxen zu bremsen. Das Gesetz enthält aber keine direkten Blockaden des Zugangs der Versicherten zu diesen Leistungen.
• Bereits 2006 und dann vor allem 2007 verringerte sich die Zunahme der bildgebenden Untersuchungen beträchtlich: Das jährliche Wachstum betrug bei allen drei Verfahren zusammen nur noch 1,7% pro Jahr. Dahinter steigt ein Wachstum von 4,3% bei CTs, von 1% bei MRTs aber ein Minuswachstum von 0,8% bei nukleartechnischen Verfahren.
• Sieht man sich insbesondere die Entwicklung im Jahr 2007 nach Art des Leistungserbringern an, steigt die Rate aller Untersuchungen pro 1.000 Medicareversicherten in privaten Praxen um 2,8% und in ambulanten Einrichtungen in Krankenhäusern um gerade einmal 0,4% an. Dies ist insofern ein paradoxes Ergebnis, weil der erwartete Anreiz des DRA vor allem zu einem Rückgang bei den privaten Praxen führen sollte. Gegen eine Stagnation oder gar einen Rückgang der Untersuchungsrate in Krankenhäusern hätte auch gesprochen, dass ein Teil des bisher ambulanten Diagnostikgeschehens wegen der Schließung ambulanter Einrichtungen in die Krankenhäuser hätte wandern müssen.
• Da damit der DRA nicht mehr der einzige oder entscheidende Faktor für die Stagnation der Zunahme zu sein scheint, fragen die Forscher nach anderen Ursachen. Sie halten generell mehrere Erklärungen für möglich. Dazu zählen das Aufkommen von so genannten "radiology business management companies", die besonders hart die Notwendigkeit des Einsatzes bildgebender Verfahren überprüfen und evtl. auch das Bewusstsein für die Angemessenheit derartiger Untersuchungen schärfen. Eine weitere mögliche Erklärung ist der verbesserte Zugang zu fachlichen Kriterien, mit denen sich Ärzte die Angemessenheit einer bildgebenden Diagnostik vergegenwärtigen können.
• Selbst wenn die Abnahme der Zunahme ("slowdown") auch nach 2007 anhält, handelt es sich um eine anhaltende Stagnation auf dem erreichten hohen Niveau. Bei der Nutzung dieser Untersuchungen dürfte es sich daher immer noch um eine Menge Überversorgung oder angesichts der Strahlenrisiken auch um Fehlversorgung handeln.
Im Zusammenhang mit der Einführung innovativer bildgebender Verfahren sind aber nicht nur die Menge, der Preis und die Strahlenbelastung zu hinterfragen, sondern auch der tatsächlich mit den neuen Verfahren zusätzlich zu realisierende Nutzen.
Dass auch hier die Formel "neu-teuer-gut-nützlich" nicht uneingeschränkt gilt, zeigten u.a. zwei Studien einer deutschen Forschergruppe. Dieser untersuchten bereits Mitte der 1990er Jahre für die Jahre 1959, 1969, 1979 und 1989 und dann erneut für die Jahre 1999/2000, also während der alten Röntgenzeit und der Einführungszeit von CT, MRT, Ultraschall und weiteren Verfahren, via Obduktion die Entwicklung der Raten klinischer Fehleinschätzungen an einer Universitätsklinik. Diese Ergebnisse beruhten auf den Autopsiedaten von jeweils 100 zufällig ausgewählten und im Krankenhaus oder kurz danach verstorbenen PatientInnen.
Ernüchterndes Ergebnis: Die Verbesserung der Diagnostik hat die Raten der Fehldiagnosen, des Übersehens der Grundkrankheit, irrtümlich gestellter Diagnosen und übersehener anderer Krankheiten nicht nennenswert beeinflusst.
Im Einzelnen:
• Die Rate von 11% Fehldiagnosen veränderte sich während der gesamten Untersuchungszeit nicht.
• Die Häufigkeit falsch negativer Diagnosen stiegen sogar von 22% im Jahr 1979 auf 34% und 41% in den Jahren 1989 und 1999/2000.
• Die Häufigkeit von falsch positiven Diagnosen stieg ebenfalls vom Jahr 1989 bis zum Jahr 1999/2000 von 7% auf 15%.
• Zu den verbreitetsten und häufigsten Diagnoseirrtümern gehörte im Jahr 1999/2000 wie in den Vorjahren Lungenembolien, Myokardinfarkte, Neubildungen und Infektionen.
Interessante Ergebnis am Rande und auch ein Beitrag zur Debatte über den Nutzen neuer Techniken:
• Die gründliche Erhebung der Erkrankungs- und Behandlungsgeschichte der Patienten und die einfache körperliche Untersuchung hatten durchweg eine wichtige diagnostische Bedeutung. Mit diesen Methoden gelangten die nur so diagnostizierenden Ärzte in 75% der Fälle zu einer korrekten Diagnose.
• Die Autopsierate sank von 88% im Jahr 1959 auf 20% im Jahr 1999/2000. Dies bewerten die Autoren als enorme Beschränkung der Möglichkeiten für Ärzte, aus Fehlern zu lernen. Es könnte aber auch Ausdruck der vermessenen und mit Sicherheit unbegründeten Überzeugung sein, keine Fehler zu machen.
Der erste Aufsatz "Misdiagnosis at a University Hospital in 4 Medical Eras: Report on 400 Cases" von Wilhelm Kirch und Christine Schafii erschien in der Zeitschrift "Medicine" (January 1996; Volume 75, Issue 1: 29-40) und hat weder einen freien Zugang zum Abstract noch zum kompletten Text.
Der zweite Aufsatz bzw. die Fortsetzung der Beobachtungszeitpunkte des Autorenteams "Health care quality: Misdiagnosis at a university hospital in five medical eras. Autopsy-confirmed evaluation of 500 cases between 1959 and 1999/2000: a follow-up study" von Wilhelm Kirch, Fred Shapiro und Ulrich R. Fölsch erschien im "Journal of Public Health" (Volume 12, Number 3 / June, 2004: 154-161) und von ihm ist kostenlos das Abstract zugänglich.
Von der Studie "Physician Orders Contribute To High-Tech Imaging Slowdown" von David C. Levin, Vijay M. Rao und Laurence Parker in der Zeitschrift "Health Affairs" (29, no. 1 (2010): 189-195) gibt es leider nur ein Abstract. Da die Zeitschrift seit Januar 2010 auch ein etwas aufgelockerteres Layout hat, ist Interessenten an der US-Gesundheitspolitik und -wissenschaft aber auch allen Anderen ein Abonnement als "individual" empfohlen, das zumindest normal bezahlte Beschäftigte nicht überfordert.
Der 308-Seiten-Bericht "Umweltradioaktivität und Strahlenbelastung. Jahresbericht 2007" wird seit Anfang des Jahrhunderts vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) herausgegeben, ist vom Bundesamt für Strahlenschutz erstellt und kostenlos herunterladbar.
Bernard Braun, 2.2.10
Warum Zweitmeinungen nicht nur bei teuren Spezialpräparaten? Funde aus der Praxis von Zweitmeinungszentren bei Hodenkrebs.
 Für die ärztliche Verordnung von "Spezialpräparaten mit hohen Jahrestherapiekosten oder mit erheblichem Risikopotenzial", für die "hinsichtlich der Patientensicherheit sowie des Therapieerfolgs besondere Fachkenntnisse erforderlich sind", wurde 2007 im Wettbewerbsstärkungsgesetz das obligatorische Zweitmeinungsprinzip in den Alltag des deutschen Krankenversorgungssystems eingeführt (§ 73d SGB V). Der behandelnde Arzt ist bei der genannten Verordnung gehalten, sich mit "einem Arzt für besondere Arzneimitteltherapie" abzustimmen. Der Gemeinsame Bundesausschuss bestimmt die Einzelheiten des Verfahrens in Richtlinien.
Für die ärztliche Verordnung von "Spezialpräparaten mit hohen Jahrestherapiekosten oder mit erheblichem Risikopotenzial", für die "hinsichtlich der Patientensicherheit sowie des Therapieerfolgs besondere Fachkenntnisse erforderlich sind", wurde 2007 im Wettbewerbsstärkungsgesetz das obligatorische Zweitmeinungsprinzip in den Alltag des deutschen Krankenversorgungssystems eingeführt (§ 73d SGB V). Der behandelnde Arzt ist bei der genannten Verordnung gehalten, sich mit "einem Arzt für besondere Arzneimitteltherapie" abzustimmen. Der Gemeinsame Bundesausschuss bestimmt die Einzelheiten des Verfahrens in Richtlinien.
Wie diese allerdings noch weitgehend unbekannte Neuerung bisher funktioniert und ob überhaupt, ist öffentlich nicht bekannt. Die bisher nicht veröffentlichten Ergebnisse einer im Herbst 2008 durchgeführten Versichertenbefragung des Bertelsmann-"Gesundheitsmonitors" zur Bewertung dieser Neuerung zeigte eine eher skeptische Grundeinstellung bzw. Uniformiertheit: In diesem ZUsammenhang wenige 21% der Befragten stimmten ihr voll und ganz oder eher zu, 64,5% lehnten das Einholen einer Zweitmeinung voll und ganz oder eher ab und 14,5 % konnten dies nicht beurteilen - hatten also mit großer Wahrscheinlichkeit noch gar nichts von dieser gesetzlichen Möglichkeit gehört.
Dennoch gab es vor ihrer Einführung gleichwohl Stimmen, die das Prinzip der obligatorisch einzuholenden Zweitmeinung auch auf andere schweren oder folgenreichen Behandlungen ausgedehnt wissen wollten.
Ob dies sinnvoll ist, d.h. wie groß der Nutzen einer breiteren Anwendung dieses Prinzips ist oder sein könnte, zeigt nun eine in Deutschland mit Unterstützung der Deutschen Krebshilfe durchgeführte und im Januar 2010 (zwischen-)veröffentlichte Studie über Zweitmeinungen bei der Behandlung von Patienten mit Hodenkrebs.
Hodenkrebs ist eine eher seltene Krebserkrankung. Rund 4.700 Männer erkranken jedes Jahr in Deutschland neu daran - vor allem jüngere Männer sind von dieser Krankheit betroffen.
In der Angebotsstruktur unterscheidet sich die Behandlung von Hodenkrebs insofern von der anderer Erkrankungen, als dass es hier bereits freiwillig so genannte Zweitmeinungszentren gibt. Diese Zentren sind Mitglied der Deutschen Studiengruppe zu Hodentumoren und nahezu an allen Universitätskliniken in Deutschland vertreten.
Für die Zweitmeinungsstudie wurden zwischen Februar 2006 und September 2008 die Diagnose- und Behandlungsgeschichte von 642 Männer (streng genommen handelte es sich um 642 Anfragen von 162 ambulant und stationär tätigen Urologen an eines der 18 Zweitmeinungszentren) mit einer Hodenkrebserkrankung mit Zweitmeinungsverfahren untersucht.
Die Zwischen-Ergebnisse dieser noch breiter angelegten Untersuchung zeigten:
• 32,3% der Hodenkrebs-Patienten bekam mit der Zweitmeinung eine abweichende Empfehlung für die Behandlung.
• Besonders in fortgeschrittenen Erkrankungsstadien differierten der erste und der zweite Therapieansatz noch mehr, d.h. mehr Patienten bekamen abweichende Empfehlungen.
• In 71,8% der diskrepanten Fälle übernahm dann der erstdiagnostizierende und behandelnde Arzt den andersartigen Vorschlag des Zweitmeinungszentrums. 15,6% blieben bei ihrer Behandlung und in 7,1% der Fälle wurden die Patienten mit einer dritten Variante behandelt. Was beim Rest der Patienten passierte, konnte nicht ermittelt werden.
• Die Auswirkungen auf die Behandlungs- und Lebensqualität waren beträchtlich: Die neue Behandlung war in fast der Hälfte der Fälle weniger intensiv, was u.a. das Risiko für Komplikationen senkte.
• Bei einem Viertel der Patienten musste aber die begonnene Therapie nach Meinung der Zweitgutachter verstärkt werden.
• Die abweichende Zweitmeinung verhinderte bei Übernahme in 40,3% bzw. 26,5% der diskrepanten Fälle Überbehandlung oder Unterbehandlung.
• Um nicht einen zu positiven Eindruck vom Nutzen des Zweitmeinungsverfahrens zu erwecken, hier ein zweiter Blick mit dem Bezug auf alle 642 angefragten Fälle: Dann verhindert das Verfahren immer noch in 10,7% aller dieser Fälle Überbehandlung und Unterbehandlung in 16% aller Fälle. Fast jede sechste Zweitmeinung führte also zu einer relevanten Veränderung der Art und Weise der Behandlung.
• Ein wichtiger Grund für die abweichende Zweitmeinung war nach Feststellung der WissenschaftlerInnen, dass gerade einmal zwei Drittel der Ärzte, welche die erste Diagnose gestellt hatten, ihre Therapie an den aktuellen Leitlinien der Europäischen Gesellschaft für Urologie ("European Consensus on Diagnosis and Treatment of Germ Cell Cancer") orientierten. Diese waren wiederum für die Ärzte des Zweitmeinungszentrums leitend.
Die wichtigsten Schlussfolgerungen lauten: Selbst die besten Leitlinien sind relativ wenig im Behandlungsalltag verbreitet und wirksam oder gar Standard. Zusätzliche Transfer- und Implementations- oder Durchsetzungsmethoden und -strategien sind nötig. Die Entwicklung und Nutzung von "second-opinion networks" sind für die AutorInnen dieser Studie ein notwendiges und auch wirksames Mittel.
Die Ergebnisse der Studie sind mit Sicherheit mehrfach verzerrt, und können daher weder für alle Hodenkrebspatienten und ihre Ärzte oder Behandlungen verallgemeinert werden. So sind die freiwillig teilnehmenden Urologen mit Sicherheit einerseits weniger von der absoluten wissenschaftlichen Richtigkeit und Stimmigkeit ihres Handelns überzeugt als die Nichtteilnehmer. Andererseits könnte die Teilnahme natürlich auch erfolgen, weil der Arzt der Meinung ist, seine Diagnose und Therapie hielten einer Zweitbegutachtung stand.
Was daher eine obligatorische Zweitmeinung nicht nur bei Spezialmedikamenten, sondern bei der meist massiv invasiven Therapie (im Beispiel Hodenkrebs die Entfernung der Hoden und eine dieser Operation meist folgende Chemotherapie) aller schwerwiegenden Erkrankungen für die Behandlungs- und anschließende Lebensqualität an Nutzen bringt und ob sie sogar zu mehr Wirtschaftlichkeit führt, wissen wir nicht. Eine solche konsequente Weiterentwicklung der Zweitmeinungsidee von vornherein als wirkungslos, "Kochbuchmedizin" und "bürokratische Kontrolle" abzulehnen, erscheint nach den Erfahrungen im Bereich der Hodenkrebsbehandlung voreilig. Dies umso mehr, wenn auch Studien über die Verbreitung und Anwendung fachlich anerkannter Behandlungsleitlinien in anderen Krankheitsbereichen erhebliche Defizite offenbaren.
Der "Article in press" "Burden or Relief: Do Second-Opinion Centers Influence the Quality of Care Delivered to Patients with Testicular Germ Cell Cancer?" von Mark Schrader, Lothar Weissbach, Michael Hartmann, Susanne Krege, Peter Albers, Kurt Miller und Axel Heidenreich in der Fachzeitschrift European Urology (doi: 10.1016/j.eururo.2009.10.032) ist bis zur endgültigen Printveröffentlichung kostenlos online erhältlich. Ein Abstract ist jetzt und evtl. später in 2010 auch kostenlos erhältlich.
Über die Annahmen, die Organisation und weitere Ergebnisse des von der urologischen Sektion der "Deutschen Hodentumor Studiengruppe (GTCSG)" getragenen Zweitmeinungsprojekt berichtet eine Projekt-Website.
Bernard Braun, 30.1.10
Making of "Cochrane Reviews"? Kein Geheimnis dank "Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions".
 Cochrane Reviews zählen zu den gründlichsten Analysen und Darstellungen des durch hochwertige empirische, vorrangig randomisierte kontrollierte Studien, belegten oder widerlegten Nutzens von medizinischen oder nichtmedizinischen Interventionen präventiver oder kurativer Art. Neben der Qualität der systematisch reviewten Studien spielen auch die oft mehrjährige Erstellung der systematischen Reviews und Meta-Analysen durch eine Gruppe von Wissenschaftlern, einer so genannten "Cochrane Group", und die für deren Arbeit festgelegte, öffentlich bekannte und daher im Gegensatz zu vielen primären Studien gut nachvollziehbaren Vorgehensweise eine große Rolle für die Verlässlichkeit der Ergebnisse eines Cochrane Review.
Cochrane Reviews zählen zu den gründlichsten Analysen und Darstellungen des durch hochwertige empirische, vorrangig randomisierte kontrollierte Studien, belegten oder widerlegten Nutzens von medizinischen oder nichtmedizinischen Interventionen präventiver oder kurativer Art. Neben der Qualität der systematisch reviewten Studien spielen auch die oft mehrjährige Erstellung der systematischen Reviews und Meta-Analysen durch eine Gruppe von Wissenschaftlern, einer so genannten "Cochrane Group", und die für deren Arbeit festgelegte, öffentlich bekannte und daher im Gegensatz zu vielen primären Studien gut nachvollziehbaren Vorgehensweise eine große Rolle für die Verlässlichkeit der Ergebnisse eines Cochrane Review.
Festgelegt sind die Regeln im "Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions", dessen Version 5.0.2 zuletzt im September 2009 geupdatet wurde.
Dieses Handbuch gliedert sich in eine Einführung in die Besonderheit der Cochrane Reviews (CR), der sich zwei große Abschnitte über die allgemeine Methodik der CR und spezielle Ausprägungen und Besonderheiten der CR sowie ein methodischer Anhang anschließen.
Im Teil über die CR-Methodik wird u.a. theoretisch aber auch anhand von Beispielen aus abgeschlossenen CRs dargestellt, wie Fragen gestellt werden, wie nach Studien gesucht wird, welche Verzerrungen beachtet und bewertet werden sollen, wie Meta-Analysen durchgeführt werden, wie die Ergebnisse dargestellt werden, Resultate interpretiert und Schlüsse gezogen werden. Unter den besonderen Fragestellungen finden sich u.a. Darstellungen darüber wie nicht-randomisierte Studien berücksichtigt werden, adversen Effekten, wie man ökonomische Evidenz mitberücksichtigt, welche Rolle die von Patienten berichteten Ergebnisse spielen, wie Reviews mit individuellen Patientendaten aussehen, prospektive Metaanalysen durchgeführt werden, das Gewicht qualitativer Forschung in ihre Einbindung in die Welt der CR aussieht und Reviews über Fragen der öffentlichen Gesundheit und Gesundheitsförderung aussehen.
Wer CRs besser verstehen und sich auch mit methodischer oder inhaltlicher Kritik an einigen von ihnen fundiert auseinandersetzen will oder selber einem Ergebnis kritisch gegenüber steht, sollte sich mit den Vorgaben zum Verständnis und zur Methodik der CR umfassend beschäftigen. Erfreulicherweise ist das Handbuch trotz RCTs und Evidence based medicine (EBM) verhältnismäßig verständlich geschrieben und wichtige Aspekte werden anschaulich beschrieben.
Das mehrere Hundert Seiten umfassende "Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions" wird von Julian PT Higgins und Sally Green herausgegeben, regelmäßig überarbeitet, erscheint in gedruckter und elektronischer Form und ist als PDF-Datei kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 11.1.10
Was soll sektorenübergreifende externe Qualitätssicherung wie machen? "Sagen Sie es bis zum 25.1.2010!"
 Die Qualitätssicherungs-Landschaft im deutschen Gesundheitswesen ist zumindest was ihre Institutionen betrifft in Bewegung. Ob dies auch für die inhaltliche Entwicklung gilt, kann man fast vom Startblock der neuen Institution für die sektorenübergreifende Qualitätssicherung gemäß §137a SGB V weg mit verfolgen und beeinflussen. Konkret geht es darum, dass seit dem 1. Januar 2010 das Göttinger "Aqua-Institut" das für diese Aufgaben zuständige "interessenunabhängige und neutrale Dienstleistungsunternehmen" ist - im Auftrag von und mit Richtlinien des "Gemeinsamen Bundesausschusses". Das Institut hat sich auf Qualitätsförderungsprojekte spezialisiert und ging 1995 aus der 1993 gegründeten "Arbeitsgemeinschaft Qualitätssicherung in der ambulanten Versorgung" hervor.
Die Qualitätssicherungs-Landschaft im deutschen Gesundheitswesen ist zumindest was ihre Institutionen betrifft in Bewegung. Ob dies auch für die inhaltliche Entwicklung gilt, kann man fast vom Startblock der neuen Institution für die sektorenübergreifende Qualitätssicherung gemäß §137a SGB V weg mit verfolgen und beeinflussen. Konkret geht es darum, dass seit dem 1. Januar 2010 das Göttinger "Aqua-Institut" das für diese Aufgaben zuständige "interessenunabhängige und neutrale Dienstleistungsunternehmen" ist - im Auftrag von und mit Richtlinien des "Gemeinsamen Bundesausschusses". Das Institut hat sich auf Qualitätsförderungsprojekte spezialisiert und ging 1995 aus der 1993 gegründeten "Arbeitsgemeinschaft Qualitätssicherung in der ambulanten Versorgung" hervor.
Die im Wesentlichen zuletzt durch das Wettbewerbsstärkungsgesetz (WSG) aus dem Jahr 2007 in den gesundheitspolitischen Vordergrund geschobene sektorenübergreifende externe Qualitätssicherung ist insbesondere aus den folgenden Gründen notwendig: Stationäre Aufenthalte werden immer kürzer, Patienten werden häufig ambulant und stationär sowie zum Teil auch in verschiedenen Bundesländern behandelt. Behandlungsverläufe sind in der bisherigen gesetzlichen Qualitätssicherung kaum sichtbar, Ergebnisse daher schwer interpretierbar. Informationsbrüche und Kommunikationsprobleme zwischen den Sektoren führen zu Qualitäts- und Sicherheitsmängeln.
Die eingangs des Methodenpapiers bereits genannten wichtigen Herausforderungen an die sektorenübergreifende Qualitätssicherung sind daher:
• Die Priorisierung von Themen und Bereichen der Qualitätssicherung in einem offenen Prozess, in den einerseits wissenschaftliche Erkenntnisse von Experten und den beteiligten Institutionen nach § 137a SGB V einfließen, andererseits aber auch die weitere Öffentlichkeit Vorschläge einbringen kann.
• Die Veränderung des bisherigen strukturierten Dialoges von einem Kontrollverfahren mit Konzentration auf "Auffälligkeiten" (sog. "bad apples") zu einer kontinuierlichen Qualitätsförderung, die Anreize und Motivation zur ständigen Weiterentwicklung des internen Quali-tätsmanagements gibt.
• Die Schaffung eines transparenten Koordinatensystems zur Abbildung der Qualität, das Wahlentscheidungen der Versicherten unterstützt.
• Die Schaffung von Möglichkeiten zum Benchmarking auf der Ebene von Regionen, Einrichtungen und Abteilungen.
• Die Umsetzung eines transparenten und wissenschaftlich abgesicherten Entwicklungsprozesses von Qualitätsindikatoren und Messinstrumenten, der sich über Publikationen auch der internationalen Diskussion und Kritik stellt.
Obwohl es in vielen ausländischen Gesundheitssystemen auch eine Sektoralisierung der Behandlung gibt und damit Defizite in Behandlungsverläufen, gibt es nach Angaben von AQUA "weltweit bisher kein Vorbild für ein indikatorengestütztes, umfassendes sektorenübergreifendes Koordinatensystem zur Abbildung der Qualität der Versorgung."
Zu seinen ersten Arbeitsschritten, dies für die Bundesrepublik zu ändern, gehört daher der am 5. Januar 2010 von AQUA veröffentlichte erste Entwurf eines Methodenpapiers, das im Rahmen des gesetzlich vorgeschriebenen Stellungnahmeverfahrens bis zum 25. Januar 2010 von den nach § 137 a SGB V zu beteiligenden Organisationen sowie von der interessierten Öffentlichkeit erörtert und kritisiert werden kann. Wer will und es für notwendig hält, kann auf diesem Weg auch Vorschläge einreichen, die in einem förmlichen Verfahren darauf hin geprüft werden, ob sie in das künftige Routineverfahren zur Qualitätssicherung aufgenommen werden können.
Welche Schritte mit welchen Zielen und mit der Unterstützung welcher Experten und Versorgungsakteure dafür gemacht werden müssen, um die entsprechenden Qualitäts-Indikatoren zu entwickeln und sie in den Versorgungsalltag zu implementieren, sind zwei Kerninhalte des Methodenpapiers. Dabei bleibt manches notwendigerweise abstrakt. Das Papier versucht dies etwas zu lindern indem am Beispiel eines denkbaren Auftrags des G-BA die Qualitätssicherung im Bereich von Harninkontinenz aufzubauen, die von AQUA als Entwicklungsschritte vorgeschlagenen Institutionen und Verfahren vorgestellt und mit Leben gefüllt werden.
Der Ende November 2009 erstellte erste Entwurf des Methodenpapiers "Allgemeine Methoden für die wissenschaftliche Entwicklung von Instrumenten und Indikatoren im Rahmen der sektorenübergreifenden Qualitätssicherung im Gesundheitswesen nach § 137a SGB V" mit 127 Seiten Umfang ist kostenlos zu erhalten. Zugleich ist dies ein guter und auch für die Implementationsphasen anderer Innovationen wünschenswerter Einstand für die hoffentlich dauerhafte Transparenz in der ja keineswegs konfliktarmen Qualitätsberichterstattung und -sicherung.
Bernard Braun, 8.1.10
Qualitätssicherung in der medizinischen Versorgung: Was denken Patienten und Versicherte?
 Das Konzept der Qualitätssicherung wird in Deutschland nicht selten mit Argwohn betrachtet, zumindest dann, wenn es nicht um die Qualität von Hi-tec-Geräten oder Produkten der Automobilindustrie geht, sondern um die medizinische Versorgung. Minister Rösler: "Ich habe angefangen Medizin zu studieren, weil ich mit Menschen zu tun haben wollte. Als ich fertig war, hatte ich mehr mit Qualitätssicherungsbögen zu tun. Also mehr Zeit für Bürokratie als für Behandlung. Da habe ich mir gesagt: Jetzt kannst du gleich selber in die Politik gehen und solche unsinnigen Gesetze abschaffen. Wenn es ein gutes Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patienten gibt, wenn Ärzte und Pfleger Zeit für ihr berufliches Ethos bekommen, brauchen Sie auch keine Qualitätssicherungsbögen."
Das Konzept der Qualitätssicherung wird in Deutschland nicht selten mit Argwohn betrachtet, zumindest dann, wenn es nicht um die Qualität von Hi-tec-Geräten oder Produkten der Automobilindustrie geht, sondern um die medizinische Versorgung. Minister Rösler: "Ich habe angefangen Medizin zu studieren, weil ich mit Menschen zu tun haben wollte. Als ich fertig war, hatte ich mehr mit Qualitätssicherungsbögen zu tun. Also mehr Zeit für Bürokratie als für Behandlung. Da habe ich mir gesagt: Jetzt kannst du gleich selber in die Politik gehen und solche unsinnigen Gesetze abschaffen. Wenn es ein gutes Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patienten gibt, wenn Ärzte und Pfleger Zeit für ihr berufliches Ethos bekommen, brauchen Sie auch keine Qualitätssicherungsbögen."
Diese Aussage des neuen Bundesgesundheitsministers Philipp Rösler in einem Interview mit der Bild-Zeitung charakterisiert ein durchaus gängiges Verständnis von Qualitätssicherung in der medizinischen Versorgung, in dem das allerorten verhasste Merkmal der Bürokratisierung und Gängelung ärztlichen Handelns im Vordergrund steht. Neue und ungewohnte Dokumentationspflichten werden weniger als Qualitätskontrolle zum Nutzen von Patienten, sondern eher als stupide Verwaltungsarbeit wahrgenommen, die von genuin ärztlichen Tätigkeiten abhält.
Dass diese genuin ärztlichen Tätigkeiten nicht selten auf veralteten Kenntnissen beruhen, überholte Behandlungsmethoden einsetzen und in manchen Fällen Patienten mehr schaden als nutzen, wird dabei gerne übersehen, obwohl es für diese Defizite durch medizinische Über-, Unter- und Fehlversorgung eine Vielzahl seriöser Belege gibt. Und wie sieht es aus auf Seiten der Bevölkerung? Erkennen Patienten und Versicherte solche Defizite im Versorgungssystem, dass deshalb Veränderungen in der Qualitätssicherung nötig sind? Inwieweit werden ärztliche Fortbildungsmaßnahmen und Praktiken der Zulassung als Arzt als sinnvolle Qualitätssicherungs-Maßnahmen bewertet und welche Einstellungen gibt es zum sogenannten "Ärzte-TÜV" und zu Arztbewertungsportalen? Der "Gesundheitsmonitor" der Bertelsmann-Stiftung hat dazu Daten veröffentlicht, die aus Erhebungen im Herbst 2008 und Frühjahr 2009 stammen, wobei jeweils eine repräsentative Stichprobe von ca. 1.500 Männern und Frauen im Alter von 18-79 Jahren befragt wurde. Wesentliche Befunde der Befragung waren folgende:
• Es zeigt sich eine überaus starke Kritik an der Versorgung, etwa, wenn fast 60 Prozent sagen, es gäbe einige gute Dinge in unserem Gesundheitswesen, aber einschneidende Maßnahmen seien nötig, um es zu verbessern. Und ein ähnlich großer Anteil der Bevölkerung erwartet Verschlechterungen im Hinblick auf die Qualität der medizinischen Leistungen, die Zeitdauer für das Arzt-Patient-Gespräch und Wartezeiten auf Praxis-Termine.
• Vor diesem Hintergrund werden dann auch umfassende Forderungen zur Qualitätssicherung laut (vgl. Grafik). Durchweg alle in der Befragung genannten Vorschläge werden mehrheitlich befürwortet, mit Zustimmungsquoten zwischen 55 und 83 Prozent. Eindeutige konzeptuelle Präferenzen sind dabei nicht erkennbar: Kontrollmaßnahmen (wie der "Ärzte-TÜV") stoßen ebenso auf große Zustimmung wie veränderte Regelungen bei der beruflichen Fortbildung, Kriterien der Zulassung als Arzt oder auch eine Ausweitung von Informationen über die Behandlungsqualität von Arztpraxen. 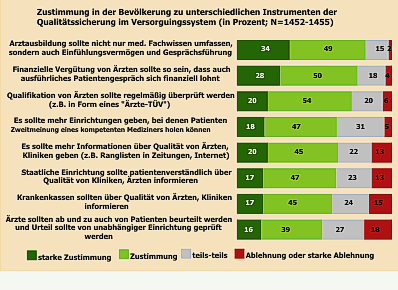
• Überraschend ist, dass in diesem Zusammenhang ärztliche Kommunikation als Qualitätsmerkmal ganz besonders hervor gehoben wird: Die von Patienten am meisten unterstützten Maßnahmen betonen eine Berufsausbildung mit mehr sozial-kommunikativen Inhalten und Ansätze eines Pay for Performance, die das ausführliche Gespräch mit Patienten honorieren. Und auch bei der Zulassung als Arzt sollen nach Patientenmeinung Aspekte wie Gesprächsführung oder Einfühlungsvermögen stärker berücksichtigt werden.
• Eine differenzierte Analyse, ob dabei bestimmte Bevölkerungsgruppen besonders lautstark ihre Stimme erheben, ergibt einen ebenso überraschenden wie nachdenklich stimmenden Befund: GKV-Versicherte erheben in diesem Zusammenhang sehr viel nachdrücklicher Forderungen zur Qualitätssicherung als dies bei privat Versicherten der Fall ist. Es liegt nahe, dass dies auch ein Reflex auf Medienberichte über eine "Zwei-Klassen-Medizin" ist, deren Wahrheitsgehalt zwar von Gesundheitspolitikern bestritten, von Ärzteverbänden jedoch immer wieder unterstrichen worden ist.
Der Aufsatz steht hier im Volltext zur Verfügung Gerd Marstedt, Juliane Landmann: Qualitätssicherung im Versorgungssystem: Patienten fordern weit reichende Veränderungen (Gesundheitsmonitor Newsletter 4/2009)
Gerd Marstedt, 6.1.10
Kanada: Fast keine Auswirkungen veröffentlichter Performance-"Report cards" auf die Versorgungsqualität in Krankenhäusern
 Aussagefähige Indikatoren für die Versorgungsqualität, vergleichbar und in verständlicher Form veröffentlicht, fördern den Wettbewerb zwischen Gesundheitseinrichtungen um die beste Performance und damit die Versorgungsqualität - so weit das Mantra entsprechender Berichtswesen und -formen.
Aussagefähige Indikatoren für die Versorgungsqualität, vergleichbar und in verständlicher Form veröffentlicht, fördern den Wettbewerb zwischen Gesundheitseinrichtungen um die beste Performance und damit die Versorgungsqualität - so weit das Mantra entsprechender Berichtswesen und -formen.
Auch von dem in Nordamerika weit verbreiteten System der "public report cards" über die Leistungsqualität in Krankenhäusern wurde dies behauptet, angenommen und in einigen unkontrollierten Beobachtungsstudien auch belegt.
Die jetzt in der US-Fachzeitschrift "JAMA" veröffentlichten Ergebnisse der bevölkerungsbezogenen clusterrandomisierten und kontrollierten Studie EFFECT (Enhanced Feedback for Effective Cardiac Treatment) an 86 Krankenhäusern und Krankenhausketten im kanadischen Ontario kommt aber für den Bereich der Versorgung von PatientInnen mit akutem Herzinfarkt (5.676=Baseline/4.165=Follow up in Interventions- und 5.070/3.581 in Krankenhäusern, die zur Kontrollgruppe gehörten) oder chronischer Herzinsuffizienz (5.073/4.316 und 4.220/3.935 zu einem deutlich anderen Ergebnis: Die frühe Veröffentlichung der Qualitätsindikatoren einer Baseline-Untersuchung der Qualität bei einer Gruppe von Krankenhäusern hat gegenüber einer für eine zweite Krankenhausgruppe um 1 ½ Jahre späteren Veröffentlichung weder signifikant zur Verbesserung der mit 12 Indikatoren gemessenen Versorgungsqualität beim Herzinfarkt noch der mit 6 Indikatoren abgebildete Versorgungsqualität von Patienten mit chronischer Herzinsuffizienz beigetragen.
So verbesserten sich die insgesamt betrachteten Werte aller 12 Qualitätsindikatoren für die Behandlung des Herzinfarkts in der frühen Gruppe von 57,4% zum Zeitpunkt der Baselinemessung (1999) auf 65,6% zum Zeitpunkt des Follow-up im Jahr 2005, also um absolut 8,2 Prozentpunkte. Ähnliches tat sich aber in der Kontrollgruppe: Der Wert der Qualitätsindikatoren verbesserte sich von 56,5% auf 63,6%, d.h. um 7,1 Prozentpunkte. Die absolute Differenz der beiden Krankenhausgruppen betrug zwischen beiden Krankenhaustypen betrug 1,5%, war aber mit p=0.43 sehr weit von einem akzeptablen Signifikanzwert entfernt. Nur bei einem der 12 individuellen Qualitätsindikatoren gab es einen statistisch signifikanten Unterschied zugunsten der Krankenhäuser mit früh einsetzender Qualitätsberichterstattung. Bei der Qualität der Versorgung von an chronischer Herzinsuffizienz erkrankten Menschen waren die absoluten Unterschiede in den Veränderungsraten aller der 6 Indikatorenwerte mit 0,6% (p=0.81) noch geringer und zufälliger. Detailliert betrachtet verbesserte sich einer der 6 Indikatoren statistisch signifikant.
Beim Vergleich harter Werte für die Ergebnisqualität (z.B. 30-Tage-Sterblichkeit nach akutem Herzinfarkt oder 1-Jahres-Sterblichkeit bei chronischer Herzinsuffizienz) gab es in der Gruppe, deren Qualitätswerte früh veröffentlicht wurde, fast durchweg bessere Ergebnisse. Nur bei den Werten für die 1-Jahressterblichkeit für die Herzinsuffizienz war aber die absolute Veränderung in der Interventionsgruppe signifikant besser geworden (p=0.007) als in der Kontrollgruppe, in der sich dieser Wert sogar verschlechterte.
Obwohl die ForscherInnen selber keine Erklärung für den fehlenden Beitrag öffentlicher Qualitätsberichterstattung mit "report cards" liefern, lassen sich mehrere Schlüsse ziehen, die zum Teil auch erklärenden Charakter haben: Veränderungen in solch komplexen sozialen Systemen wie einem Krankenhaus sind meist nicht Folge eines einzelnen Faktors oder einer noch so gut gemachten und qualitativ aussagefähigen Transparenz, sondern die einer Vielzahl von kognitiven Einwirkungen und sozialen Aushandlungs- und Entscheidungsprozessen.
Der 9-seitige Aufsatz "Effectiveness of Public Report Cards for Improving the Quality of Cardiac Care. The EFFECT Study: A Randomized Trial" von Jack Tu; Linda Donovan; Douglas Lee; Julie Wang; Peter C. Austin; David A. Alter; Dennis Ko erschien in der Zeitschrift JAMA. (published online Nov 18, 2009; (doi:10.1001/jama.2009.1731)) und ist komplett kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 18.11.09
Vom unerwarteten Ende einer Verbesserung der Behandlungsqualität nach P4P-Start für Familienärzte in Großbritannien 1998-2007.
 Seitdem der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Köhler bei jeder Gelegenheit verkündet, es werde und müsse sich "das ärztliche Honorar immer mehr an der erbrachten Qualität orientieren" und dies könne durch Qualitätszuschläge im Einheitlichen Bewertungsmaßstab erreicht werden, rückt auch in Deutschland eine qualitätsbezogene Vergütung, international auch als "Pay for Performance" (P4P) bezeichnet, näher. Dass die KBV es ernst meint, zeigt die Ankündigung in den Online-Nachrichten des "Deutschen Ärzteblatts" vom 24. Juli 2009, ein derartiges System könne ohne Pilotphase in der zweiten Hälfte des Jahres 2010 eingeführt werden.
Seitdem der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Köhler bei jeder Gelegenheit verkündet, es werde und müsse sich "das ärztliche Honorar immer mehr an der erbrachten Qualität orientieren" und dies könne durch Qualitätszuschläge im Einheitlichen Bewertungsmaßstab erreicht werden, rückt auch in Deutschland eine qualitätsbezogene Vergütung, international auch als "Pay for Performance" (P4P) bezeichnet, näher. Dass die KBV es ernst meint, zeigt die Ankündigung in den Online-Nachrichten des "Deutschen Ärzteblatts" vom 24. Juli 2009, ein derartiges System könne ohne Pilotphase in der zweiten Hälfte des Jahres 2010 eingeführt werden.
Da dies immerhin noch etwas Vor(be)denkzeit bedeutet, sollten sich die KBV-Planer gründlicher als bisher die wissenschaftlich evaluierten Erfahrungen, etwa die bis 2007 mit P4P-Systemen in verschiedenen Ländern gemachten oder die aktuellsten Ergebnisse einer mehrjährigen Analyse der Qualitätsverbesserung unter P4P-Bedingungen in Großbritanien anschauen.
Im Vereinigten Königreich wurde erstmals 2004 ein P4P-Programm für Familienärzte eingeführt. Das Programm enthielt 136 unterschiedliche Indikatoren für die Behandlungsqualität von sieben Erkrankungsarten, die erreicht werden mussten, um in den Genuss der materiellen Vorteile des Programms zu kommen. An dem freiwilligen Programm nahmen 2006 99,6% der Familienärzte teil. Zahlungen aus dem P4P-Programm trugen maximal zu 25% der Einkünfte der Ärzte bei.
WissenschaftlerInnen untersuchten nun mittels der Dokumentationen und Datensätze der Behandlungen die Qualitätsveränderung bzw. -entwicklung in 42 repräsentativen Praxen und zwar in den Jahren 1998 und 2003, also vor Einführung des P4P-Programms, und dann in den Programmjahren 2005 und 2007. Die Wahrnehmungen oder Wünsche der Patienten über den Zugang zur Behandlung, ihrer Kontinuität und einer Reihe interpersonaler Charakteristika wurden per standardisiertem Fragebogen (General Practice Assessement Questionnaire) erhoben, der an jeweils 200 erwachsene Patienten pro Praxis versandt wurde. Der Fragebogen wurde von mageren 38% (1998 und 2007) und 47% (2003) der Patienten beantwortet. In die Analyse gingen sowohl Behandlungsmerkmale ein, die mit materiellen Anreizen aus dem Programm versehen waren als auch Merkmale für deren Qualität es keinen direkten materiellen Anreiz gab.
Die Ergebnisse waren durchweg statistisch hochsignifikant und unerwartet:
• Die Qualitätsscores, d.h. eine Art Sammelindikator für mehrere der 136 relevanten Qualitätsindikatoren, stieg vor Einführung von P4P in beiden Jahren für die Behandlung von Asthma, Diabetes und Herzerkrankungen.
• Nach Einführung des P4P-Programms stiegen die Qualitätswerte für Asthma und Diabetes weiter, aber wesentlich langsamer als vorher.
• Die Qualität der Behandlung von Herzerkrankungen verbesserte sich nach Einführung von P4P nicht mehr, obwohl durchaus noch Verbesserungsbedarf bestand.
• Nach Einführung der P4P-Programme fanden die ForscherInnen keine Veränderungen bei der Wahrnehmung von Patienten zum Zugang bzw. Erhalt von Leistungen oder interpersoneller Aspekte der Behandlung.
• Bei jeder der drei Erkrankungsarten gab es aber auch Behandlungsmerkmale auf die die Anreize von P4P überhaupt nicht einwirkten oder die sich sogar verschlechterten.
• Unmittelbar nach dem Start des Programms verschlechterte sich die Behandlungskontinuität und verblieb dann den gesamten Untersuchungszeitraum auf dem niedrigeren Niveau. Eine spezielle Erklärung setzt an dem Phänomen an, dass das P4P-Programm den schnellstmöglichen (innerhalb 48 Stunden) Zugang zu einem Arzt belohnt, nicht aber den Kontakt zu einem speziellen vertrauten Arzt. Die Patienten hätten danach zunehmend Schwierigkeiten, "ihren" Arzt zu sehen.
• Bei Asthma und Herzerkrankungen gab es eine zweigeteilte Entwicklung: Qualitative Behandlungsmerkmale für die das Programm keine Anreize enthielt verschlechterten sich zwischen 2005 und 2007 wogegen sich die Qualität von Behandlungsmerkmalen, für die das Programm materielle Anreize oder "Belohnungen" enthielt im selben Zeitraum weiter verbesserte.
Wodurch die Qualitätsverbesserung vor Einführung des P4P-Programms befördert wurde und wie es zu den fatalen Effekten nach seiner Einführung kommen konnte, untersuchten die britischen WissenschaftlerInnen nicht ausführlich, obwohl dies von enormer praktischer Bedeutung gewesen wäre.
Trotzdem stellen sie vier mögliche Erklärungen zur Debatte: Erstens könnten in einigen Bereichen bereits vor dem Start des Programms nahezu maxomale oder optimale Werte erreicht worden sein, zweitens könnte es schwierig sein, die Verbesserungsdynamik zu verstetigen, drittens könnten die Ärzte relativ schnell das oberste Niveau der möglichen Einnahmen durch hohe Behandlungsqualität erreichen und damit immer weniger Anreize zur Verbesserung bestehen und viertens könnten die Familienärzte mit ihrem Einkommen so zufrieden sein, dass der materielle Anreiz des Programms zu schwach ist.
Angesprochen aber nicht weiter vertieft wird von den britischen WissenschaftlerInnen aber auch die Erkenntnis mehrerer anderer Studien über Programme à la P4P "that financial incentives result in small improvements in quality".
Von der Studie "Effects of Pay for Performance on the Quality of Primary Care in England" von Stephen M. Campbell, David Reeves, Evangelos Kontopantelis, Bonnie Sibbald und Martin Roland im "New England Journal of Medicine (NEJM)" (2009;361:368-78) gibt es kostenlos ein Abstract aber auch den 11 Seiten umfassenden Kompletttext.
Bernard Braun, 26.7.09
Unerwünschte Ereignisse in schwedischen Krankenhäusern - 70 Prozent wären vermeidbar
 Auch in schwedischen Krankenhäusern sind unerwünschte Ereignisse alltäglich, verursachen erhebliches menschliches Leid und nehmen einen signifikanten Anteil der verfügbaren Ressourcen der Krankenhäuser in Anspruch. Dies ist jedenfalls das Ergebnis der jüngsten Analyse der Inzidenz, Natur und Konsequenzen unerwünschter und vor allem vermeidbarer Vorkommnisse bei einer repräsentativen Stichprobe von 1.967 zwischen dem Oktober 2003 und September 2004 in 28 Krankenhäusern entlassenen PatientInnen - insgesamt wurden in dieser Zeit 1,2 Millionen Personen entlassen.
Auch in schwedischen Krankenhäusern sind unerwünschte Ereignisse alltäglich, verursachen erhebliches menschliches Leid und nehmen einen signifikanten Anteil der verfügbaren Ressourcen der Krankenhäuser in Anspruch. Dies ist jedenfalls das Ergebnis der jüngsten Analyse der Inzidenz, Natur und Konsequenzen unerwünschter und vor allem vermeidbarer Vorkommnisse bei einer repräsentativen Stichprobe von 1.967 zwischen dem Oktober 2003 und September 2004 in 28 Krankenhäusern entlassenen PatientInnen - insgesamt wurden in dieser Zeit 1,2 Millionen Personen entlassen.
Die Untersuchung erfolgte auf der Basis der medizinischen Dokumentationen und mit Hilfe von 18 Screening-Kriterien. Diese reichten vom unerwarteten Tod über eine ungeplante Wiederaufnahme, einer ungeplanten Verlegung von einer normalen Station in die Intensivstation bis zur ungeplanten Verlegung in ein anderes Akutkrankenhaus. Die Bewertungen der medizinischen Dokumente erfolgte in einem mehrstufigen Verfahren durch Pflegekräfte und Ärzte.
Die Ergebnis sind einerseits nicht völlig unerwartet, zeigen aber andererseits, dass trotz einer Reihe vergleichbarer älterer Untersuchungen mit ähnlichem Ergebnis sich immer noch wenig getan hat, derartige Mängel zu beseitigen. Die wichtigsten Ergebnisse lauten:
• 12% der untersuchten Behandlungsfälle hatten mindestens ein unerwünschtes Ereignis.
• Davon waren nach Meinung der bewertenden Ärzte und Pflegekräfte 70% vermeidbar.
• 55% dieser vermeidbaren Ereignisse führten zu Verletzungen und Behinderungen, die während der Krankenhaus-Behandlungszeit oder innerhalb eines Monats nach Entlassung beseitigt werden konnten. 33% der Ereignisfolgen wurden innerhalb des ersten Jahres behoben, 9% der Ereignisse führten zu dauernder Behinderung und 3% trugen sogar zum Tod der betroffenen PatientInnen bei.
• Vermeidbare unerwünschte Ereignisse verlängerten den Krankenhaus-Aufenthalt um durchschnittlich 6 Tage. Die Hälfte der unerwünschten Ereignisse führte außerdem zu einem oder mehr Besuchen bei ambulanten Ärzten.
• Mit 10 der 18 Indikatoren konnte man 90% des gesamten unerwünschten Geschehens erkennen.
• Rechnet man die Ergebnisse auf die im Untersuchungsjahr behandelten 1,2 Millionen Personen bzw. Fälle hoch, gab es insgesamt 105.000 unerwünschte Ereignisse und 630.000 eigentlich nicht notwendige zusätzliche Krankenhaustage.
Während also im Rahmen der Fallpauschalenbezahlung stationärer Behandlung um jeden Tag gefeilscht wird und aufwändige Qualitätssicherungsprogramme durchgeführt werden, gibt es gleichzeitig offensichtlich selbst in Versorgungssystemen, die sonst immer als vorbildlich gelten, einen Berg von menschlich und ökonomisch folgenreichen Versorgungsmängeln. Und sage niemand, in deutschen Krankenhäusern gäbe es so etwas nicht, außer er könnte dies nach einer vergleichbaren Analyse eindeutig belegen.
Dass eine bessere Transparenz über unerwünschte Ereignisse außerhalb solch etwas aufwändigerer Studien gar nicht so leicht ist und auch nicht automatisch mit eindeutigen Ergebnissen zu rechnen ist, zeigt ein anderer Aufsatz in derselben Ausgabe der Zeitschrift "International Journal for Quality in Health Care".
Eine Gruppe us-amerikanischer ForscherInnen untersuchte den Grad der Übereinstimmung dreier in US-Krankenhäusern aber zum Teil auch in deutschen Kliniken verwendeten Messmethoden für unerwünschte Ereignisse. Konkret ging es um die Bewertungen bei allen im Jahr 2005 in den Mayo-Rochester-Kliniken entlassenen 60.599 PatientInnen.
Bei der Messung unerwünschter Ereignisse kamen folgende Methoden zum Einsatz: Die "Agency for Healthcare Research and Quality-defined patient safety indicators (PSIs)", die im Wesentlichen die Kodierungen nach der Diagnoseklassifikation ICD-9 benutzten; Berichte, die von den Krankenhäusern geliefert wurden und Ergebnisse des "Institute for Healthcare Improvement Global Trigger Tool", dessen Ergebnisse jeweils von Ärzten bestätigt werden mussten. Die wesentlichen Ergebnisse sahen so aus:
• Bei über 4% aller entlassenen PatientInnen (n=2.401) zeigte mindestens eine der Methoden ein unerwünschtes Ergebnis an.
• Rund 38% der bekannten unerwünschten Ereignisse wurden durch die behandelnden Kliniken selber angezeigt. Bei rund 43% der Ereignisse handelt es sich um Verletzungen und vergleichbare Eingriffe, 23% waren Ereignisse im Zusammenhang mit Medikamenten und bei 1,8% spielte die technische Ausstattung des Krankenhauses eine Rolle.
• Wenn eine der Methoden bei einem Patienten ein unerwünschtes Ereignis meldete, wurde dies für gewöhnlich nicht noch zusätzlich durch eine andere Methode bestätigt: Nur für 6% der nach der aus Sicht der Patienten-Methode identifizierten Ereignisse gab es auch einen entsprechenden Krankenhaus-Bericht und nur für 10,5% der von Krankenhaus-Akteuren berichteten Ereignisse lag ein Hinweis auf der Basis eines "Patientensicherheits-Indikators (PSI)" vor.
Angesichts dieser geringen Übereinstimmung mehrerer für sich zuverlässig erscheinenden Berichtsmethoden geben die ForscherInnen zwei praktische Hinweise: Erstens empfehlen sie eine Kombination der Berichtsmethoden für unerwünschte Ereignisse und zweitens werfen die beobachteten Inkonsistenzen der unterschiedlichen Methoden und die geringe Assoziation von dokumentierten Schäden und entsprechenden Berichten Zweifel auf, ob derartige Messungen der Patientensicherheit für die öffentliche Berichterstattung und Vergleiche der Performanz von Krankenhäusern genutzt werden sollen. Sieht man wie sich deutsche Krankenhäuser unabhängig vom durchaus umstrittenen "Wert" einzelner Methoden auf den Einsatz einer einzelnen der vielen Methoden konzentrieren, sollte der zweite praktische Hinweis gerade hierzulande besonders ernst genommen werden.
Von der schwedischen Studie "The incidence of adverse events in Swedish hospitals: a retrospective medical record review study" von Michael Soop, Ulla Fryksmark, Max Köster und Bengt Haglund in der Fachzeitschrift "International Journal for Quality in Health Care" (2009 21(4):285-291; doi:10.1093/intqhc/mzp025) gibt es ein Abstract aber auch die komplette PDF-Fassung von 7 Seiten.
Von der Studie "A comparison of hospital adverse events identified by three widely used detection methods" von James M. Naessens, Claudia R. Campbell, Jeanne M. Huddleston, Bjorn P. Berg, John J. Lefante, Arthur R. Williams und Richard A. Culbertson (International Journal for Quality in Health Care 2009 21(4):301-307; doi:10.1093/intqhc/mzp027) ist nur ein Abstract kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 18.7.09
1990-2007: "Lack of detection and widespread under-reporting". Qualitätssicherung durch Ärzte-"peer review" in US-Krankenhäusern
 Seit dem 1. September 1990 existiert in den USA auf der gesetzlichen Basis des "Health Care Quality Improvement Act" aus dem Jahre 1986 eine bundesweite Datenbank für Informationen über Krankenhausärzte, denen Behandlungsrechte in Krankenhäusern durch ein so genanntes internes "peer review"-Verfahren für mehr als 30 Tage entzogen oder begrenzt worden sind.
Seit dem 1. September 1990 existiert in den USA auf der gesetzlichen Basis des "Health Care Quality Improvement Act" aus dem Jahre 1986 eine bundesweite Datenbank für Informationen über Krankenhausärzte, denen Behandlungsrechte in Krankenhäusern durch ein so genanntes internes "peer review"-Verfahren für mehr als 30 Tage entzogen oder begrenzt worden sind.
Auch wenn die so genannte "National Practitioner Data Bank" nur in depersonalisierter Form als "public use file" für die breite Öffentlichkeit zugänglich ist, sollten diese Meldungen der Krankenhäuser vor allem auch zu einer Art selbstreinigenden innerprofessionellen Transparenz beitragen, die Krankenhausverwaltungen z.B. bei Neueinstellungen Informationen über möglicherweise fachlich nicht qualifizierte Ärrzte geben sollte und damit letztlich auch Patienten zu Gute kommen sollte. Das US-Medizinjournal JAMA nannte das "hospital peer review one of the pillars of quality assurance in the United States" und sah die Wirksamkeit dieses Verfahrens der von staatlichen und professionsfremden Kontrollen und Kontrolleure überlegen.
Im Vorfeld des Start dieser Datenbank im Jahre 1990 schätzte die US-Bundesregierung aufgrund der zuvor beobachteten Häufigkeit solcher innerprofessioneller Disziplinierungsmaßnahmen der Ärzteschaft, dass dort mindestens 5.000 derartiger Meldungen jährlich eingingen. Die American Medical Association ging sogar von 10.000 Meldungen aus. Sie stützte sich dabei auf eine Studie der "American Hospital Association (AHA)", also des Verbandes der Krankenhäuser, die festgestellt hatte, dass es pro Jahr in jedem Krankenhaus durchschnittlich 2,5 interner fachlicher Disziplinarmaßnahmen gab, was bei rund 5.000 Kliniken zu der geschätzten Anzahl von Meldungen geführt hätte.
Ein von der gemeinnützigen Public Citizen's Health Research Group am 27. Mai 2009 der Öffentlichkeit vorgestellter Bericht analysierte nun das tatsächliche Meldeverhalten soweit es aus verschiedenen öffentlich zugänglichen Quellen erkennbar war und kam zu ernüchternden Ergebnissen:
• Die durchschnittliche Anzahl der in den 17 untersuchten Jahren pro Jahr eingehenden Berichte betrug 650, also ein Achtel der von der Regierung und ein Sechzehntel der von der Mediziner-Assoziation geschätzten Anzahl.
• 49% der US-Krankenhäuser sandte in den 17 Jahren keinen einzigen Bericht.
• 34,2% aller Krankenhäuser berichteten während der 17 Jahre wenigstens einen Fall.
• Die Durchführung von "peer reviews" und entsprechende Meldungen variierte zwischen einzelnen Bundesstaaten enorm: Während 70% aller Kliniken in Louisiana niemals Meldungen sandten waren es in Conneticut "nur" 25% Nie-Melder.
• Aber auch in Bundesstaaten mit hohem Berichtsniveau konzentrierten sich die Meldungen nach Feststellung der Berichterstatter oft auf wenige Einrichtungen.
• In zahlreichen Fällen folgte einer oder mehreren Meldungen über Ärzte keine erkennbare aber zwingend notwendige Folgeaktion wie etwa die eines wie auch immer gearteten Lizenzentzugs. Dies gilt z.B. für 952 unter den insgesamt gemeldeten 9.877 Ärzten mit zwei und mehr Reports über unerwünschte Handlungen und 31 mit fünf und mehr dieser Meldungen.
• Da das Problem bereits seit langem bekannt war, gab es seit 1996 verschiedene Anläufe, den Zustand der Transparenz zu verbessern oder Sanktionen einzuführen. Aber schon der Versuch, von den Krankenhäusern mehr über die Gründe ihrer zurückhaltenden Nutzung von "peer review"-Verfahren und der Meldung von Ereignissen zu erfahren, scheiterte 2002. Die Unternehmensberatung PwC versuchte 42 Krankenhäuser und 36 Managed Care Organizations in eine Pilotstudie einzubeziehen, musste aber die Studie einstellen, weil sich nur 3 Krankenhäuser und 5 MCOs zur Teilnahme bereit erklärt hatten.
Die AutorInnen des Public Citizen-Reports schließen trotz der desillusionierenden Geschichte ihren Bericht mit einer Reihe von Verbesserungsvorschlägen, ohne aber genau angeben zu können, warum diese wirklich etwas am Verhalten der Krankenhäuser ändern sollen.
Trotz der deutlichen Zahlen und der langen Geschichte systematischer und kontinuierlichen Unterberichterstattung beharrt die "American Hospital Association" schließlich auf folgender Sicht der Dinge: "Hospitals are actively involved in a wide variety of efforts to continuously improve care and talk publicly about the care we provide". Derartige Reaktionen verstärken die Zweifel an der Wirksamkeit von Qualitätssicherungen, die ausschließlich auf Selbstverpflichtungen und Freiwilligkeit beruhen und bei denen offenkundige Verstöße nicht sanktioniert werden - so unwohl man sich bei staatlich verpflichtenden Alternativen auch fühlen mag.
Der sehr detaillierte, material- und quellenreiche Bericht "Hospitals Drop the Ball on Physician Oversight. Failure of Hospitals to Discipline and Report Doctors Endangers Patients" von Alan Levine und Sidney Wolfe umfasst 38 Seiten und ist kostenlos erhältlich.
Wer mehr über das im Prinzip interessante Modell der National Practitioner Data Bank. Healthcare Integrity and Protection Data Bank erfahren will, erhält hier einen kostenlosen Zugang.
Bernard Braun, 29.5.09
Hausgeburten sind bei Müttern mit geringem Geburtsrisiko und guter Notfall-Infrastruktur so sicher wie Krankenhaus-Entbindungen
 Auch wenn es in Deutschland und einigen vergleichbaren europäischen Ländern (z. B. England und Wales 2,7 % aller Geburten in 2006) immer noch relativ wenige Geburten außerhalb von Krankenhäusern, also in Geburtshäusern oder zu Hause, gibt, liegen doch seit Jahren Daten über die Qualität dieses Teils des Geburtsgeschehens vor. Über die insgesamt positiven Ergebnisse eines der letzten "Qualitätsberichte", die regelmäßig von der von den Hebammenverbänden getragenen "Gesellschaft für Qualität in der außerklinischen Geburtshilfe e. V. (QUAG)" erstellt werden, wurde im Forum-Gesundheitspolitik bereits berichtet.
Auch wenn es in Deutschland und einigen vergleichbaren europäischen Ländern (z. B. England und Wales 2,7 % aller Geburten in 2006) immer noch relativ wenige Geburten außerhalb von Krankenhäusern, also in Geburtshäusern oder zu Hause, gibt, liegen doch seit Jahren Daten über die Qualität dieses Teils des Geburtsgeschehens vor. Über die insgesamt positiven Ergebnisse eines der letzten "Qualitätsberichte", die regelmäßig von der von den Hebammenverbänden getragenen "Gesellschaft für Qualität in der außerklinischen Geburtshilfe e. V. (QUAG)" erstellt werden, wurde im Forum-Gesundheitspolitik bereits berichtet.
Ob die Sicherheit dieser Art von Geburt auch noch gewährleistet ist, wenn ein höherer Anteil der werdenden Mütter beschließt, ihr Kind nicht in einer Klinik und dominant von Ärzten entbinden zu lassen, sondern außerstationär unter maßgeblicher Beteiligung von Hebammen, war bisher noch umstritten oder offen. Dies lag u.a. auch daran, dass es nur sehr wenige und dann auch nur kleine Studien gab, bei denen der Geburtsort bei der Randomisierung eine wichtige Rolle spielte.
Dieser unbefriedigende Zustand und damit auch die Ängste vor Sicherheitsrisiken von Hausgeburten, haben mit dem Abschluss einer landesweiten Studie in den Niederlanden ein Ende gefunden. An der Studie waren 529.688 Frauen mit einem als gering eingeschätzten Geburtsrisiko beteiligt, die während ihrer Schwangerschaft überwiegend oder primär von Hebammen betreut wurden und ihr Kind zwischen dem 1.Januar 2000 und 31. Dezember 2006 zur Welt brachten. Damit handelt es sich um die bisher größte Untersuchung über die Verteilung der Geburtsort-Präferenzen und die Sicherheit der verschiedenen Geburtsvarianten.
Für die Diskussion in Deutschland ist bereits interessant, dass 60,7 % der Frauen eine Hausgeburt geplant hatten, 30,8 % in ein Krankenhaus gehen wollten und es für 8,5% der Frauen keine Daten zum Entbindungsort gab.
Die ForscherInnen fanden, dass mehr Frauen, die eine Hausgeburt planten 25 Jahre alt und älter und Holländerinnen waren und der mittleren bis höheren Sozialschicht angehörten. Unter ihnen war der Anteil der Frauen größer, die schon zwei oder mehr Kinder hatten.
Die Sicherheit der Geburtsvarianten wurde an Hand der so genannten perinatalen Sterblichkeitsrate der Kinder während der ersten 24 Stunden des Geburtsgeschehens und während der ersten Woche nach der Entbindung gemessen.
Die Ergebnisse waren eindeutig:
• Bei den Gesamt-Sterblichkeitsraten gab es keine statistisch signifikanten Unterschiede zwischen den Frauen, die zu Hause oder im Krankenhaus mit jeweiliger Hilfe einer Hebamme entbunden hatten.
• Kinder einer geplanten Hausgeburt mussten mit einer vergleichbaren Wahrscheinlichkeit, nämlich sieben Neugeborene pro 1.000 Neugeborene, wegen Geburtskomplikationen in einer Intensivstation für Neugeborene ("Neonatal intensive care unit (NICU)" behandelt werden wie Kinder, deren Mütter sich von vornherein für eine Entbindung im Krankenhaus entschieden hatten.
• Das Risiko für einen schlechten Verlauf bzw. Komplikationen bei der Geburt war nach den Studienergebnissen höher bei den Erstgebärenden, bei Frauen in der 37ten oder 41ten Schwangerschaftswoche (im Vergleich mit jenen Frauen, die zwischen der 38ten und 40ten Woche entbanden), bei Frauen, die 35 Jahre oder älter und unter 25 Jahren alt waren und nichtholländischer Herkunft waren. Diese Faktoren wurden beim Vergleich zwischen den geplanten Haus- und Krankenhausgeburten in Rechnung gestellt, sodass sie keine Rolle bei Unterschieden oder Nichtunterschieden spielten.
• Nahezu ein Drittel der Frauen, die eine Hausgeburt planten und auch mit ihr praktisch starteten, musste sie wegen medizinischer Komplikationen beim Fötus oder wegen der Notwendigkeit einer wirksameren Schmerzbehandlung (z. B. Epiduralanästhesie) bei der Gebärenden in einem Krankenhaus und dort in ärztlicher Behandlung beenden.
• Dass das Sterblichkeitsrisiko dieser Mütter und ihrer Kinder nicht höher war als bei Müttern, die von Beginn an ins Krankenhaus gingen, liegt nach Ansicht der WissenschaftlerInnen aber dann auch an der Schnelligkeit der Transporte und den kurzen Wegen in ein Krankenhaus innerhalb der Niederlande.
Unter der Voraussetzung, dass es sich bei den werdenden Müttern zum Zeitpunkt der Geburtssituation um "low-risk women" handelt, eine entsprechende Notfall-Infrastruktur existiert und nicht zuletzt die Schwangeren über die unerwarteten Notfallsituationen beraten wurden, die während der Geburt auftreten können und eine schnelle Reaktion erfordern, sind Hausgeburten nach der niederländischen Studie "as safe as hospital".
Künftige Forschungsarbeiten sollten u.a. die Sicherheit der Hausgeburten mit Geburten von "low-risk-women" vergleichen, die entweder für eine maßgeblich von Ärzten oder maßgeblich von Hebammen mitgetragene Geburtsvariante optierten.
Der komplette Aufsatz "Perinatal mortality and morbidity in a nationwide cohort of 529 688 low-risk planned home and hospital births" von A. de Jonge, BY van der Goes, ACJ Ravelli, MP Amelink-Verburg, BW Mol, JG Nijhuis, J Bennebroek Gravenhorst und SE Buitendijk ist in der Zeitschrift "BJOG An International Journal of Obstetrics and Gynaecology" (2009;116: 1-8) veröffentlicht und kostenlos erhältlich.
Bernard Braun, 19.4.09
Erste Ergebnisse einer Evaluationsstudie: Patienten mit Diabetes profitieren von der Teilnahme an einem DMP nachhaltig
 Für Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2 scheint sich die Teilnahme an einem Disease-Management-Programm (DMP) zu lohnen. Nach jetzt veröffentlichten ersten Ergebnissen der sogenannten ELSID-Studie (Evaluation of a Large Scale Implementation of Disease Management Programmes, Evaluation eines umfangreichen Einsatzes von DMP) gibt es deutlich weniger Todesfälle im Vergleich zu Patienten, die nicht in ein solches Programm eingeschrieben sind. Die Ergebnisse stammen aus der bundesweit ersten kontrollierten Studie zum Vergleich zwischen DMP-Teilnehmern und Patienten in der Regelversorgung, die von der Abteilung Allgemeinmedizin und Versorgungsforschung am Universitätsklinikum Heidelberg in Kooperation mit dem AOK-Bundesverband durchgeführt wird. Die Daten der Patienten waren über einen Zeitraum von zweieinhalb Jahren beobachtet worden.
Für Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2 scheint sich die Teilnahme an einem Disease-Management-Programm (DMP) zu lohnen. Nach jetzt veröffentlichten ersten Ergebnissen der sogenannten ELSID-Studie (Evaluation of a Large Scale Implementation of Disease Management Programmes, Evaluation eines umfangreichen Einsatzes von DMP) gibt es deutlich weniger Todesfälle im Vergleich zu Patienten, die nicht in ein solches Programm eingeschrieben sind. Die Ergebnisse stammen aus der bundesweit ersten kontrollierten Studie zum Vergleich zwischen DMP-Teilnehmern und Patienten in der Regelversorgung, die von der Abteilung Allgemeinmedizin und Versorgungsforschung am Universitätsklinikum Heidelberg in Kooperation mit dem AOK-Bundesverband durchgeführt wird. Die Daten der Patienten waren über einen Zeitraum von zweieinhalb Jahren beobachtet worden.
Nach den ersten Endergebnissen lag die Sterblichkeitsrate bei den älteren Diabetikern im DMP mit 10,9 Prozent deutlich niedriger als bei den Patienten in der Regelversorgung mit 18,8 Prozent. Da jedoch die Patienten in der Regelversorgung etwas älter waren, verglichen die Heidelberger Wissenschaftler eine Teilgruppe von DMP-Patienten und eine zweite vergleichbare Gruppe mit Patienten in der Regelversorgung mit gleichem Alter, Geschlecht, Diabetes-Schweregrad und Begleiterkrankungen. Auch hier zeigte sich bei der Sterblichkeitsrate ein Unterschied: Während unter den DMP-Teilnehmern 9,5 Prozent der Patienten verstarben, waren es in der Kontrollgruppe der Nicht-Teilnehmer 12,3 Prozent. "Wir führen dies auf die Kombination der verschiedenen Maßnahmen zurück, die im DMP für Typ-2-Diabetiker vorgesehen sind", erklärte Prof. Joachim Szecsenyi vom Universitätsklinikum Heidelberg. "Die regelmäßigen Untersuchungstermine und die Vereinbarung von Therapiezielen in Kombination mit Schulungen und gezielten Informationen für Patienten und Ärzte tragen möglicherweise besonders dazu bei, dass gesundheitliche Komplikationen und Probleme bei den Patienten vermieden oder schneller erkannt werden."
Ausgewertet wurden die Daten von 2.300 älteren DMP-Teilnehmern, die in 85 Hausarztpraxen in Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz behandelt wurden. Die Kontrollgruppe der Nicht-Teilnehmer umfasste 8.779 Diabetiker aus 337 Praxen. Alle Patienten wurden mit antidiabetischen Medikamenten behandelt. In die ELSID-Studie, die Ende 2005 gestartet ist, fließen sowohl medizinische Daten als auch gesundheitsökonomische Parameter wie Verordnungen oder Klinikeinweisungen ein. Weitere Auswertungsergebnisse, unter anderem zu den Kosten der Behandlung, sollen in den nächsten Monaten veröffentlicht werden.
Schon bei einer Patientenbefragung im Rahmen der ELSID-Studie hatten sich positive Resultate zugunsten der DMP-Teilnehmer gezeigt. Danach waren die DMP-Patienten mit dem Ablauf und der Organisation ihrer Behandlung deutlich zufriedener als Patienten in der Regelversorgung. Zudem wurden sie von ihrem Arzt häufiger nach ihren Vorstellungen bei der Gestaltung des Behandlungsplans gefragt und wurden besser darin unterstützt, sich konkrete Ziele in Bezug auf ihr Essverhalten und ihre körperlichen Aktivitäten zu setzen. Die DMP-Patienten erhielten auch eher im Vorfeld Informationen, wie sie in schwierigen Phasen mit ihrer Erkrankung umgehen können.
Die Disease-Management-Programme sind in Deutschland 2003 eingeführt worden, um die Versorgung von chronisch kranken Patienten zu verbessern. Insgesamt nehmen derzeit knapp 2,3 Millionen Versicherte an den Behandlungsprogrammen der AOK teil. Schon seit mehreren Jahren bietet die AOK bundesweit Programme für Patientinnen und Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2, Koronarer Herzkrankheit, chronisch-obstruktiven Lungenerkrankungen (COPD) und Brustkrebs an. In den meisten Ländern können sich die Versicherten darüber hinaus in Programme zur Behandlung von Asthma und Diabetes mellitus Typ 1 einschreiben. Mit fast 1,4 Millionen bilden die Zuckerkranken die größte Gruppe unter den Teilnehmern der AOK, gefolgt von Herzpatienten (580.000) und Patienten mit COPD (150.000).
Eine wissenschaftliche Veröffentlichung zur Evaluation gibt es bislang nicht. Von daher bleibt auch abzuwarten, ob sich die Befunde auch bei einer noch strengeren methodischen Kontrolle (Einbezug von weiteren denkbaren Einflussfaktoren wie Rauchen, BMI, Bewegung usw.) bestätigen. Die AOK hat jedoch jetzt schon Materialien zum Download zur Verfügung gestellt:
• Folienvortrag Prof. Dr. Joachim Szecsenyi, Ärztlicher Direktor der Abteilung Allgemeinmedizin und Versorgungsforschung des Universitätsklinikums Heidelberg
• Pressemitteilung des AOK-Bundesverbandes und des Universitätsklinikums Heidelberg zur Studie
• Statement Dr. Bernhard Egger, Leiter des Stabsbereichs Medizin im AOK-Bundesverband
• Statement Prof. Dr. Joachim Szecsenyi (Abstract der Studie und Befunde)
Gerd Marstedt, 13.8.2008
Evaluation von Programmen zum Disease-Management (DMP): Die Bilanz ist gemischt
 Disease-Management-Programme stehen mit etwa 3 Millionen Teilnehmern in Deutschland noch ganz am Anfang und ebenso sind Evaluationsstudien überaus rar. Die Entwicklung solcher Programme ist beispielsweise in den USA sehr viel weiter fortgeschritten, dort gibt es bereits eine Vielzahl spezialisierter Firmen, die im Auftrag von Unternehmen oder Versicherungen arbeiten und 2005 einen Jahresumsatz von fast 2 Milliarden Dollar erzielten. Gleichwohl ist in den USA die Frage umstritten, ob sich der Einsatz von DMPs auch gesundheitsökonomisch lohnt. Eine Metaanalyse von Evaluationsstudien, die jetzt im "American Journal of Managed Care" veröffentlicht wurde, hat nun versucht, eine Zwischenbilanz zu ziehen.
Disease-Management-Programme stehen mit etwa 3 Millionen Teilnehmern in Deutschland noch ganz am Anfang und ebenso sind Evaluationsstudien überaus rar. Die Entwicklung solcher Programme ist beispielsweise in den USA sehr viel weiter fortgeschritten, dort gibt es bereits eine Vielzahl spezialisierter Firmen, die im Auftrag von Unternehmen oder Versicherungen arbeiten und 2005 einen Jahresumsatz von fast 2 Milliarden Dollar erzielten. Gleichwohl ist in den USA die Frage umstritten, ob sich der Einsatz von DMPs auch gesundheitsökonomisch lohnt. Eine Metaanalyse von Evaluationsstudien, die jetzt im "American Journal of Managed Care" veröffentlicht wurde, hat nun versucht, eine Zwischenbilanz zu ziehen.
Basis der Metaanalyse waren 29 Veröffentlichungen, die das Ergebnis von 317 verschiedenen Evaluationsstudien umfassen. Zwar wird in dem Aufsatz nicht erwähnt, in welchen Ländern diese Studien und DMPs durchgeführt wurden. Da die Literaturrecherche über die Datenbanken PubMed und MEDLINE erfolgte, lässt sich jedoch folgern, dass die Studien vermutlich in einer Vielzahl von Ländern weltweit statt fanden. Erfasst wurden DMPs für sechs verschiedene chronische Erkrankungen: Koronare Herzerkrankung (Herzinsuffizienz), Koronare Arterienerkrankung (Arteriosklerose), Diabetes mellitus, Asthma, chronisch-obstruktive Lungenerkrankung, Depression.
In der Auswertung der Befunde wurden verschiedene Kriterien zur Bewertung der Effekte berücksichtigt:
• Klinischer Versorgungsprozess (Berücksichtigung von Leitlinien und "best practices")
• Gesundheitsverhalten der Teilnehmer (körperliche Bewegung, Arzneimittel-Compliance)
• Mittelfristige Ergebnisse zur Krankheitskontrolle (z.B. Hämoglobinwerte bei Diabetikern)
• Klinische Ergebnisse (Mortalität, funktioneller Status)
• Patientenerfahrungen (Zufriedenheit, Lebensqualität)
• Inanspruchnahme der Versorgung (z.B. Krankenhaus-Einweisungen)
• ökonomische Effekte (Versorgungskosten, Nettoeinsparungen)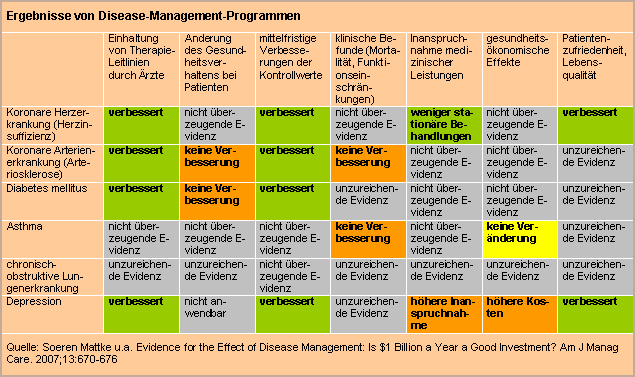
Das Ergebnis der Metaanalyse (vgl. Abbildung) zeigte dann eine gemischte Bilanz:
• Für die Einhaltung von Leitlinien und ebenso für Zwischenergebnisse zur Krankheitskontrolle zeigen sich fast durchweg (für 4 von 6 Krankheiten) positive Befunde.
• Für klinische Befunde auf der anderen Seite und ebenso für Änderungen des Gesundheitsverhaltens zeigen sich dort, wo hinreichend fundierte Evaluationen vorlagen, keine Verbesserungen. Allerdings ist die Forschungslage hier nur für 2 von 6 Krankheiten befriedigend.
• In gesundheitsökonomischer Hinsicht ist nur für zwei Krankheitsarten ein eindeutiges Urteil formulierbar: Bei Asthma zeigt sich keine Veränderung, bei Depressionen werden sogar höhere Kosten festgestellt aufgrund einer gestiegenen Inanspruchnahme.
• Insgesamt wird deutlich, dass der Forschungsstand noch überaus unbefriedigend ist und bei einer großen Zahl von Kriterien abschließende Urteile noch nicht möglich sind.
Es stellt sich allerdings auch die Frage, ob man bei einer Evaluation von "Disease Management Programmen" die Details und Rahmenbedingungen der verschiedenen Programme völlig unberücksichtigt lassen kann. Da es keine standardisierten oder einheitlichen Kriterien des therapeutischen Vorgehens gibt, da das Ausmaß der Patienten-Beteiligung unterschiedlich intensiv sein kann, wäre es nicht überraschend, wenn auch die Effizienz einzelner DMPs von solchen Faktoren abhängt. Hier wäre es wohl lohnend gewesen, wenn hinausgehend über die quantifizierende Bilanz auch eine etwas detaillierte Bewertung der unterschiedlichen DMP-Komponenten und damit bewirkter Effekte stattgefunden hätte. Dass dies zeitaufwändiger, aber ertragreich ist, hat unlängst eine andere Studie gezeigt: Gesundheitsförderliche Schulernährung: Eine "realistische" Meta-Analyse bringt mehr Erkenntnisse als übliche Cochrane-Studien.
Die Metaanalyse ist hier im Volltext: Soeren Mattke u.a.: Evidence for the Effect of Disease Management: Is $1 Billion a Year a Good Investment? (The American Journal of Managed Care, December 2007, 670-676)
Gerd Marstedt, 17.12.2007
Bessere Versorgungsqualität für Diabetes-Patienten im Disease Management Programm der Barmer
 Diabetes-Patienten, die in Disease-Management-Programmen (DMP) medizinisch betreut werden, genießen den Vorzug einer besseren Versorgungsqualität gegenüber Patienten außerhalb solcher DMPs, das ergab eine jetzt veröffentlichte Studie der Angestelltenersatzkasse "Barmer" mit etwa 160.000 Versicherten. Die Diabetes-Patienten in DMPs wiesen weniger Schlaganfälle und Amputationen auf, eine häufiger nach Leitlinien durchgeführte medikamentöse Versorgung sowie mehr vorsorgende Augenarztkontakte.
Diabetes-Patienten, die in Disease-Management-Programmen (DMP) medizinisch betreut werden, genießen den Vorzug einer besseren Versorgungsqualität gegenüber Patienten außerhalb solcher DMPs, das ergab eine jetzt veröffentlichte Studie der Angestelltenersatzkasse "Barmer" mit etwa 160.000 Versicherten. Die Diabetes-Patienten in DMPs wiesen weniger Schlaganfälle und Amputationen auf, eine häufiger nach Leitlinien durchgeführte medikamentöse Versorgung sowie mehr vorsorgende Augenarztkontakte.
Seit dem Jahr 2002 werden Disease-Management-Programme in Deutschland durchgeführt, anfänglich beschränkt auf die Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2 und Brustkrebs, später auch für andere chroniosche Erkrankungen wie Diabetes mellitus Typ l, koronare Herzkrankheit, Asthma und chronisch-obstruktive Lungenerkrankungen. Bis Mitte 2007 hatten sich etwa 3,3 Millionen Versicherte in der GKV in ein DMP eingeschrieben, der größte Teil darunter (2,2 Millionen) leidet unter Diabetes. Während DMPs bei der Behandlung chronischer Erkrankungen anfangs noch umstritten waren, zeigen heute zunehmend mehr Studien, dass die Teilnahme daran eine bessere Versorgungsqualität bietet.
In einer großen Evaluationsstudie hat jetzt auch die "Barmer" anonymisierte Leistungsdaten von je 80.000 Patienten mit Diabetes Mellitus von DMP-Teilnehmern und Nichtteilnehmern in den Jahren 2005 und 2006 verglichen. Es wurde untersucht, ob sich hinsichtlich diabetesspezifischer Komplikationen und Begleiterkrankungen, aber auch der medikamentösen Behandlung und Vorsorge Unterschiede zwischen beiden Gruppen erkennen lassen. Als Ergebnis zeigte sich:
• Die Zahl der Schlaganfälle lag im Jahr 2006 bei DMP-Teilnehmern rund ein Drittel niedriger als bei Nichtteilnehmern (8,8 Fälle auf 1000 Versicherte bei männlichen DMP-Teilnehmern vs. 12,7 Fälle bei Nichtteilnehmern; 7,8 bei weiblichen DMP-Versicherten vs. 12,4 bei Nichtteilnehmerinnen).
• Bei der Zahl der Fuß- und Unterschenkelamputationen ergibt sich sogar ein noch deutlicherer Vorteil zugunsten der DMP-Teilnehmer (4,5 vs. 7,3 bei männlichen und 1,6 vs. 3,8 Fälle bei weiblichen Versicherten, jeweils bezogen auf 1000 Versicherte).
• Insgesamt weisen DMP-Teilnehmer weniger Krankenhausbehandlungen auf, wobei schwere Ereignisse (u.a. Herzinfarkte, Herzinsuffizienz) seltener und leichtere Fälle (z.B. Angina Pectoris, chronische KHK) häufiger im Krankenhaus behandelt wurden.
• Zudem ist die Zahl der für eine leitliniengerechte Vorsorge notwendigen augenärztlichen Kontakte bei DMP-Teilnehmern signifikant höher. Von 1000 Diabetikern hatten 780 Teilnehmer und nur 538 Nichtteilnehmer mindestens einen Augenarztkontakt im Jahr 2006.
• Auch die Zahl der Patienten, die eine leitliniengerechte Medikation zur Behandlung von Begleiterkrankungen wie Bluthochdruck und Fettstoffwechselstörung und damit zum Schutz vor entsprechenden Folgeschäden erhielten, war bei den DMP-Teilnehmern durchweg höher.
Hier ist eine Pressemitteilung der Barmer: Diabetes-Patienten in DMP signifikant besser versorgt
Ein 8seitiger Bericht zur Studie (PDF): Versorgungsmerkmale des Diabetes mellitus in Disease-Management-Programmen
Gerd Marstedt, 2.12.2007
Verbessern leistungsorientierte Arzthonorare die Versorgungsqualität? Bilanzen aus den USA und dem UK
 Qualitäts- und leistungsorientierte Vergütungssysteme für Ärzte und Kliniken befinden sich im internationalen Vergleich in einem sehr unterschiedlichen Stadium der Realisierung. Während sie in Deutschland noch fast keine Rolle spielen, nimmt ihre Verbreitung in den USA - wenngleich sehr zögerlich - doch kontinuierlich zu. In England hingegen wurden sie im Zuge einer allgemeinen Reform des Gesundheitssystems für Allgemeinärzte (General Practioner, GP) 2004/2005 flächendeckend eingeführt. Sie brachten nicht nur eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen für Ärzte mit sich (Abschaffung der 24-Stunden-Bereitschaft), sondern auch erhebliche finanzielle Verbesserungen, die im Durchschnitt zu etwa 30prozentigen Einkommensverbesserungen führten. Allerdings wurde die Höhe der zusätzlichen Vergütungen fortan auch daran geknüpft, ob und in welchem Umfang bestimmte Qualitätsstandards und Leitlinien bei der Therapie eingehalten werden. Seither machen qualitätsabhängige Honoraranteile etwa 20-30 Prozent des Einkommens von GPs im United Kingdom aus. vgl. zusammenfassend etwa: BBC: Q&A: GPs' pay
Qualitäts- und leistungsorientierte Vergütungssysteme für Ärzte und Kliniken befinden sich im internationalen Vergleich in einem sehr unterschiedlichen Stadium der Realisierung. Während sie in Deutschland noch fast keine Rolle spielen, nimmt ihre Verbreitung in den USA - wenngleich sehr zögerlich - doch kontinuierlich zu. In England hingegen wurden sie im Zuge einer allgemeinen Reform des Gesundheitssystems für Allgemeinärzte (General Practioner, GP) 2004/2005 flächendeckend eingeführt. Sie brachten nicht nur eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen für Ärzte mit sich (Abschaffung der 24-Stunden-Bereitschaft), sondern auch erhebliche finanzielle Verbesserungen, die im Durchschnitt zu etwa 30prozentigen Einkommensverbesserungen führten. Allerdings wurde die Höhe der zusätzlichen Vergütungen fortan auch daran geknüpft, ob und in welchem Umfang bestimmte Qualitätsstandards und Leitlinien bei der Therapie eingehalten werden. Seither machen qualitätsabhängige Honoraranteile etwa 20-30 Prozent des Einkommens von GPs im United Kingdom aus. vgl. zusammenfassend etwa: BBC: Q&A: GPs' pay
In den USA nimmt die Bedeutung von "Pay-For-Performance"-Systemen (P4P) zu. Wie eine neue Studie des "Commonwealth Fund" jetzt gezeigt hat, beinhaltet etwa die Hälfte der (staatlichen) Medicaid-Programme auch P4P-Komponenten und man erwartet, dass dies in den nächsten fünf Jahren etwa bei 85 Prozent der Fall sein wird. Allerdings sind die leistungsbezogenen Komponenten sehr unterschiedlich, sowohl im Hinblick auf die verwendeten Qualitätskriterien wie auch hinsichtlich der Vergütungsart und -höhe. vgl. als Zusammenfassung: Pay-for-Performance in State Medicaid Programs: A Survey of State Medicaid Directors and Programs
Der komplette Bericht ist hier verfügbar (PDF, 76 Seiten)
Vorrangiges Ziel der Einführung von P4P-Vergütungen ist nicht die Einsparung von Kosten, sondern eine Verbesserung der Versorgungsqualität. Inwieweit dazu allerdings standardisierte Therapie-Kriterien in der Lage sind, war und ist bei vielen Medizinern umstritten. Es gab daher bereits frühzeitig wissenschaftliche Bemühungen zur Evaluation der Effekte von P4P-Programmen. In einer Sekundär-Auswertung schon veröffentlichter Studien (auf der Basis von 17 in einer Meta-Analyse berücksichtigten Veröffentlichungen) kam im August 2006 ein Bericht unter dem Strich zu dem Fazit, dass die Datenlage derzeit sehr defizitär ist, vorliegende Studien eher deskriptiver Natur sind denn wissenschaftlich fundierte Evaluationen und dass man bei der Bewertung der Effekte sehr genau die Details der P4P-Komponenten berücksichtigen muss: Verwendete Kriterien, Empfänger (einzelne Ärzte, Versorgungszentren, Kliniken), Höhe und Art der Vergütung, Häufigkeit und Zeitpunkt der Honorierung usw. Unter dem Strich wurde festgestellt: "5 der 6 Studien, die Auswirkungen finanzieller Anreize für einzelne Ärzte untersuchten, und 7 der 9 Studien, die solche Anreize für medizinische Einrichtungen prüften, fanden partielle oder positive Effekte für Indikatoren der Versorgungsqualität."
Trotz der von den Autoren beklagten überaus bescheidenen Datenlage heben sie auch einige wichtige Detail-Befunde hervor:
• Einige Untersuchungen legen nahe, dass es nach der Einführung von P4P-Programmen eher zu einer Verbesserung der Dokumentationen und Statistiken in den Einrichtungen kommt als zu einer Veränderung der diagnostischen oder therapeutischen Vorgehensweisen.
• Eine Studie hat auch nachdrücklich auf unerwünschte Effekte aufmerksam gemacht. So kann es auch zu Selektionseffekten kommen, derart, dass Einrichtungen eine Behandlung besonders kranker (älterer, multimorbider) Patienten zu vermeiden trachten.
• Die Höhe des leistungsbezogenen Honoraranteils bzw. ihr Anteil am Gesamthonorar scheint eine sehr große Rolle zu spielen. In mehreren Studien, in denen das qualitäts-bezogene Finanzvolumen überaus gering war, zeigten sich folgerichtig keinerlei Effekte auf das Versorgungsgeschehen. In einer Studie wird geschätzt, dass ein Verbesserung der Versorgungsqualität erst ab einer Höhe von etwa 5% des P4P-Anteils am Gesamthonorar zu erwarten ist.
• Eine nachträgliche Vergütung am Ende eines Abrechnungsjahres scheint eher ungünstig zu sein, um Veränderungen zu bewirken, da den beteiligten Medizinern der finanzielle Anreiz unter diesen Bedingungen kaum mehr gegenwärtig ist.
Die Studie ist hier nachzulesen: Does Pay-for-Performance Improve the Quality of Health Care? (Annals of Internal Medicine, 15 August 2006 | Volume 145 Issue 4 | Pages 265-272)
Zwei neuere Studien, über die jetzt auch im "Deutschen Ärzteblatt" berichtet wurde, bestätigen nun diese Ergebnisse weithin: "pay-per-performance": Studien zeigen Für und Wider einer erfolgsorientierten Honorierung (DÄ 6. Juni 2007). So wurden in einer Studie zur Behandlung eines Myokardinfarkts (NSTEMI) 54 Kliniken mit einem P4P-Programm mit 446 Kliniken ohne Bonus-Anreiz verglichen. Es zeigte sich, dass nur in zwei von sechs Qualitätsparametern Kliniken, denen ein Bonus in Aussicht gestellt war, besser abschnitten, bei vier anderen Kriterien hingegen nicht. Als Ursache vermutet wurde zum einen, dass die Behandlungsqualität bereits vor Einführung des Anreizprogramms so hoch war, dass kaum noch Steigerungsmöglichkeiten offen blieben. Zum andern liegt nahe, dass der Anreiz selbst mit durchschnittlich etwa 15 Tausend Dollar im Jahr pro Klinik viel zu niedrig war. vgl. das Abstract der Studie: Pay for Performance, Quality of Care, and Outcomes in Acute Myocardial Infarction (JAMA 2007; 297: 2373-2380)
In einer anderen jetzt veröffentlichten Studie wurden hingegen Effekte von Pay-For-Permance bei der Behandlung von Diabetikern in London dargelegt. So stieg dort der Anteil der Diabetes-Patienten, die auch eine Beratung aufsuchten zur Raucher-Entwöhnung von 48% auf 84% an. Und ebenso wurde der Anteil der Raucher in dieser Patientengruppe von 20% auf 16% gesenkt. Allerdings basieren diese Daten auf Angaben der Ärzte und behandelten Patienten, so dass gewisse Verfälschungstendenzen nicht völlig ausgeschlossen werden können - wie dies auch im Editorial der Zeitschriftenausgabe explizit betont wird. vgl.: Impact of a pay-for-performance incentive on support for smoking cessation and on smoking prevalence among people with diabetes (CMAJ 2007; 176: 1717-1719)
Gerd Marstedt, 10.6.2007
KBV kündigt den "Ärzte-TÜV" für niedergelassene Haus- und Fachärzte an
 Von Patienten wird er seit langem gewünscht, der sogenannte "Ärzte-TÜV", also eine regelmäßige Kontrolle der fachlichen Kompetenzen und Weiterbildungsmaßnahmen niedergelassener Ärzte. Der "Gesundheitsmonitor" der Bertelsmann-Stiftung hat seit 2003 zweimal jährlich eine repräsentative Bevölkerungsstichprobe befragt und regelmäßig zeigte sich: 75-85% stimmten der Aussage zu "Die Qualifikation von Ärzten sollte regelmäßig überprüft werden (z.B. in Form eines "Ärzte-TÜV")". (vgl. Gesundheitsmonitor Newsletter 2-2005).
Von Patienten wird er seit langem gewünscht, der sogenannte "Ärzte-TÜV", also eine regelmäßige Kontrolle der fachlichen Kompetenzen und Weiterbildungsmaßnahmen niedergelassener Ärzte. Der "Gesundheitsmonitor" der Bertelsmann-Stiftung hat seit 2003 zweimal jährlich eine repräsentative Bevölkerungsstichprobe befragt und regelmäßig zeigte sich: 75-85% stimmten der Aussage zu "Die Qualifikation von Ärzten sollte regelmäßig überprüft werden (z.B. in Form eines "Ärzte-TÜV")". (vgl. Gesundheitsmonitor Newsletter 2-2005).
Im Ausland (zum Beispiel USA, Schweiz, United Kingdom) ist die Erhebung, Auswertung und auch Veröffentlichung von Daten zur Behandlungsqualität nicht nur von Kliniken, sondern auch Arztpraxen schon seit längerem Gepflogenheit. Und mehr noch, in vielen Ländern gilt auch das "P4P"-Prinzip (Pay for Performance), also eine qualitätsabhängige Vergütung ärztlicher Leistungen. Recht überraschend kündigte nun die Kassenärztliche Bundesvereinigung auf ihrer Website unter dem Titel "Die Qualität der Ärzte sichtbar machen" ein ähnliches Vorhaben für den ambulanten Sektor in Deutschland an. In der Pressemitteilung heißt es: "Die KBV hat nun für anderthalb Jahre eine Projektgruppe eingerichtet. Diese soll Qualitätsindikatoren für die Arbeit niedergelassener Ärzte in Deutschland ermitteln und sie in Pilotpraxen testen lassen, unter anderem auf Aussagekraft und Praktikabilität hin."
Das Pilotprojekt soll auch internationale Erfahrungen berücksichtigen und auch eine Befragung von mehr als 200 Berufsverbänden, medizinischen Fachgesellschaften und Bundesverbänden der Patientenorganisationen ist vorgesehen. Geplant ist dann die Erarbeitung eines ersten Test-Registers mit Qualitäts-Indikatoren und deren Überprüfung in einer begrenzten Zahl von Arztpraxen. Ob auch das "P4P"-Prinzip, also eine Kopplung der Honorare an die ermittelten Qualitätsdaten erfolgt, lässt man noch offen. Zum weiteren Vorgehen heißt es: "Ein externes wissenschaftliches Institut wird das KBV-Set dann in sogenannten Fokuspraxen testen. Das A und O dabei: Den Ärzten sollen auf keinen Fall zusätzliche Dokumentationspflichten zugemutet werden. Zurückzugreifen ist deshalb auf Daten, die ohnehin erhoben werden. Liegen die Ergebnisse der Praxistests vor, wird die KBV sie genau analysieren und ihr Set entsprechend anpassen."
Offen gelassen wird in der KBV-Mitteilung auch, ob die ermittelten Daten nur eine intern zu handhabende Kontrollfunktion bieten oder auch veröffentlicht werden sollen. Damit würde für kritische oder informationswillige Patienten die Möglichkeit bestehen, sich über das Abschneiden ihres Haus- oder Facharztes zu informieren oder bei der Arztsuche gezielter als bislang möglich vorzugehen.
In England ist dies schon jetzt möglich. Wer es ganz genau wissen möchte, sucht sich im Internet zunächst aus, für welche Region oder welche Stadt, für welche medizinische Indikation oder Erkrankung und für welche Art von Qualitätsindikatoren er gerne detaillierte Informationen bekommen möchte: NHS Health and Social Care Information Center. Geboten wird dann eine Excel-Tabelle, die für lokale Versorgungseinrichtungen, aber auch einzelne Praxen Punktwerte für die einzelnen Qualitäts-Indikatoren auflistet. Um zu erkennen, welche Praxis hinter welchem Code steht, schaut man sich dann die NHS Practice Code Look-up Tabelle an. Und eine genaue Beschreibung der einzelnen Qualitäts-Indikatoren findet man dann im 120seitigen Manual NHS Quality and Outcome Framework.
Wer nicht so detailverliebt ist, für den gibt es im Internet und auf NHS-Seiten allerdings auch Übersichten, die weniger detailliert sind und nur zusammenfassende Bewertungen enthalten. Der Ärzte-TÜV wurde im UK auf freiwilliger vertraglicher Basis im Jahre 2004 eingeführt. Derzeit werden etwa 150 Qualitätsindikatoren berücksichtigt, die überwiegend die Einhaltung bestimmter Leitlinien-Kriterien bei chronischen Erkrankungen beinhalten. Darüber hinaus gibt es jedoch auch Indikatoren zur Praxisorganisation, Aktenführung und beruflichen Fortbildung. Vier Indikatoren berücksichtigen darüber hinaus Angaben zur Patientenzufriedenheit.
Die Anwendung und noch mehr die Veröffentlichung der Qualitäts-Indikatoren ist keineswegs unumstritten. Zwar stimmt man weithin überein, dass eine Kontrolle der Behandlungsqualität sinnvoll ist. Der Teufel steckt jedoch im Detail. Für Kliniken gib es bei hohen Fallzahlen behandelter Patienten auch die Möglichkeit, Ergebnis-Daten zu verwenden und dabei eine Risikoadjustierung vorzunehmen, also zu berücksichtigen, welche unterschiedlichen Vor- und Parallelerkrankungen die Patienten in den einzelnen Krankenhäusern oder Stationen aufweisen. Die dazu vergleichsweise geringen Fallzahlen in Arztpraxen, die auf einzelne Erkrankungen anfallen, erlauben dies jedoch kaum, so dass man überwiegend auf Indikatoren angewiesen ist, die nicht das Ergebnis der Therapie messen, sondern nur das therapeutische und diagnostische Vorgehen. Bei Diabetes ist dies im NHS zum Beispiel, ob und wie oft bei Patienten der Blutdruck und HbA1C-Wert gemessen oder ein Serum-Kreatinin-Test durchgeführt wurde. Darüber hinaus wird noch berücksichtigt, bei wie vielen Diabetikern nach einem bestimmten Zeitraum noch Übergewicht oder ein zu hoher Blutzuckerspiegel festgestellt wurde.
Dass diese pauschale Bewertungsmethodik nicht unproblematisch ist, zeigt ein neuerer Aufsatz von Michael F. Cannon: "Pay-for-Performance: Is Medicare a Good Candidate?" (Yale Journal Of Health Policy, Law, And Ethics VII:1, 2007), der eine Reihe von Widrigkeiten aufzeigt. Er beschreibt dort etwa die Schwierigkeit des Abweichens von der Leitlinienvorschrift bei multimorbiden Patienten, die unzureichende Berücksichtigung von sozial-kommunikativen Aspekten bei der Arzt-Patient-Kommunikation oder auch die mögliche Tendenz von Arztpraxen, sich aus Reputations- oder Honorargründen sehr starr und formalistisch am vorgegebenen Bewertungsschema zu orientieren und davon abweichende diagnostische oder therapeutische Maßnahmen zu unterlassen, auch wenn sie im Einzelfall sinnvoll wären.
Trotz dieser Kritik, die vor allem darauf zielt, ob tatsächlich ebenso zuverlässige wie aussagekräftige Indikatoren berücksichtigt werden, sind sich allerdings Kassenärztliche Bundesvereinigung wie Patienten diesmal einig. "Von einem guten Set von Qualitätsindikatoren profitieren alle: Niedergelassene, Patienten, ärztliche Selbstverwaltung und die Politik", ist Dr. Andreas Köhler, Vorsitzender des Vorstands der KBV überzeugt. Und Patienten kritisieren ohnehin schon seit langem, dass in Deutschland "die Qualität der Ärzte und ärztlichen Einrichtungen zu unterschiedlich ist". In den schon zitierten Bevölkerungsumfragen des Gesundheitsmonitor stimmen regelmäßig mehr als zwei Drittel der Bevölkerung dieser Aussage zu.
Gerd Marstedt, 9.5.2007
Qualitätsorientierte Vergütung bei US-Ärzten: Ein sich langsam entwickelndes Minderheitsgeschehen.
 Eine zuerst in den USA konzipierte und mit einigen Programmen (z. B. P4P oder "pay-for-performance") auch vor einigen Jahren gestartete Methode, Ärzten finanzielle oder Vergütungsanreize für qualitätsorientierte Leistungen zu geben, verbreitet sich wesentlich langsamer als erwartet oder erhofft.
Eine zuerst in den USA konzipierte und mit einigen Programmen (z. B. P4P oder "pay-for-performance") auch vor einigen Jahren gestartete Methode, Ärzten finanzielle oder Vergütungsanreize für qualitätsorientierte Leistungen zu geben, verbreitet sich wesentlich langsamer als erwartet oder erhofft.
Das ist jedenfalls das Ergebnis einer Studie von Reschovsky und Hadley , die für den Zeitraum von 1996/97 oder 2000/2001 bis 2004/2005 die Entwicklung der Vergütungsanreize in us-amerikanischen Gruppen- und Einzelpraxen untersucht hat. Es handelt sich um Ergebnisse des USA-repräsentativen "HSC Community Tracking Study Physician Survey", in dem zwischen 6.600 und 12.000 amerikanische Ärzte seit 1996 in mehrjährigen Abständen u. a. mit Unterstützung der "American Medical Association" befragt werden (Näheres über Methode und sonstige Inhalte des Surveys finden sie hier).
Die Ergebnisse sind im Januar 2007 unter dem Titel "Physician Financial Incentives: Use of Quality Incentives Inches Up, but Productivity Still Dominates" in der Nummer 108 des Informationsdienstes des "Center for studying Health System Change (HSC)" veröffentlicht worden und lauten folgendermaßen:
• In Gruppenpraxen nahm der Anteil der Ärzte, deren Bezahlung zu einem spürbaren Teil in Abhängigkeit vom Erreichen vereinbarter Qualitätszielen erfolgte, leicht und statistisch signifikant von 17,6 % im Jahre 2000/01 auf 20,2 % im Jahr 2004/05 zu. Der Anteil der Ärzte für den Qualität einen sehr wichtigen Faktor der Vergütung darstellte betrug 2004/05 aber lediglich 9,1 %.
• Für einen praktisch unveränderten Anteil von 70,4 % aller Ärzte in "non-solo-practises" waren aber weiterhin Vergütungssysteme wichtig, die sich an ihrer Produktivität, d. h. im wesentlichen an den Mengen ihrer Leistungen orientierten. 2004/05 war diese Form der Vergütung immer noch für 51,8 % der Gruppenpraxis-Ärzte sehr wichtig. Ärzte mit Qualitätsanreizen arbeiteten auch meist immer noch parallel nach Produktivitätsanreizen.
• Die qualitätsorientierte Vergütung kommt bei bestimmten Ärzten und bei bestimmten Praxisformen häufiger vor: Dazu gehören Primärärzte (2004/05 waren es 27,9 % dieser Arztgruppe bei denen Qualität ein Vergütungsfaktor ist), Arztpraxen mit mehr als 30 Ärzten (25,9 %) und die allerdings wenigen von HMOs getragenen Praxen (64,3 %). Aber selbst bei diesen Ärzten steigt der Anteil bei dem Qualität ein sehr wichtiger Vergütungsfaktor ist maximal auf 26,4 % bei den HMO-Ärzten. Eine unterdurchschnittliche Rolle spielte die qualitätsorientierte Vergütung bei Fachärzten (17,8 %), Spezial-Chirurgen (12,6 %) und in Praxen mit weniger als 10 Ärzten (11,1 %).
• Nur ein sehr kleiner Teil des Zuwachses qualitätsorientiert vergüteter Ärzte beruht darauf, dass Ärzte sich bevorzugt in Praxisformen niederlassen, die qualitätsorientiert arbeiten und vergütet werden.
Als Ursachen dieser zögerlichen und uneinheitlichen Entwicklung erscheinen den Wissenschaftlern mehrere Faktoren plausibel: die noch zu geringe Entwicklung von mehr und besseren krankheitsspezifischen Qualitätsindikatoren und die hemmende Funktion von Einzelpraxen mit ihren relativ wenigen Patienten und Fällen ("The 'small number' problem makes it difficult to apply quality/performance measures with the statistical reliability crucial to their acceptability.") für die Verbreitung qualitätsorientierter Vergütungsanreize.
Hier finden Sie den vierseitigen "HSC Issue Brief Physician Financial Incentives: Use of Quality Incentives Inches Up, but Productivity Still Dominates."
Bernard Braun, 8.1.2007
Rechtsprechung und Gesundheitsversorgung: Das Beispiel Qualität der Geburt im Geburtshaus.
 Dass das Gesundheitswesen in hohem Maße von rechtlichen Regelungen geprägt und gesteuert wird, lässt sich regelmäßig bei den so genannten Gesundheitsreformen erkennen. Zig Gesetze mit Tausenden von Paragraphen haben seit 1977, dem Jahr des ersten großen Kostendämpfungsgesetzes in der alten Bundesrepublik, sowohl die Finanzierung und die Struktur der Krankenversicherung als auch die Qualität der gesundheitlichen Versorgung umgekrempelt. Immer intensiver ist daran auch fast zwangsläufig die Rechtsprechung beteiligt.
Dass das Gesundheitswesen in hohem Maße von rechtlichen Regelungen geprägt und gesteuert wird, lässt sich regelmäßig bei den so genannten Gesundheitsreformen erkennen. Zig Gesetze mit Tausenden von Paragraphen haben seit 1977, dem Jahr des ersten großen Kostendämpfungsgesetzes in der alten Bundesrepublik, sowohl die Finanzierung und die Struktur der Krankenversicherung als auch die Qualität der gesundheitlichen Versorgung umgekrempelt. Immer intensiver ist daran auch fast zwangsläufig die Rechtsprechung beteiligt.
Ein Urteil des Bundessozialgerichts mit dem Aktenzeichen B 1 KR 34/04 R aus dem Februar 2006 zeigt besonders deutlich die normative Relevanz und Eingriffstiefe in die gesundheitliche Versorgung mancher dieser Entscheidungen oberster Bundesgerichte. In dem dem BSG vorgelegten Rechtsstreit ging es darum, ob eine Krankenkasse bei einer Versicherten aus Thüringen die vollen Kosten einer in Rechnung gestellten Geburt in einem Geburtshaus übernehmen muss oder lediglich einen Teil. Sachlich wichtig ist, dass es sich bei den Geburtshäusern um Einrichtungen handelt, die meistens von Hebammen geleitet werden und in denen komplikationsfreie Geburten meist ohne Ärzte durchgeführt werden. Sollte es aber zu Komplikationen kommen, ist entweder ein Arzt oder eine Ärztin in Rufbereitschaft oder die entbindende Frau wird in ein Krankenhaus verlegt.
Das Geburtshaus stellte der klagenden Frau 507 Euro in Rechnung, die Krankenkasse bezahlte lediglich die Hebammenleistungen in Höhe von 153 Euro. Den Rest von 354 Euro für Unterkunft und Pflege sollte die Frau selbst bezahlen.
Das BSG gab der Kasse nun Recht: Das Geburtshaus sei zwar wie erforderlich gewerberechtlich zugelassen gewesen, es fehle aber in dem konkreten Fall eine Zulassung durch die Kassen. Hierfür kämen auch nur "Krankenhäuser im weiteren Sinne" in Betracht, urteilten die Kasseler Richter. Denn wie bei anderen stationären Leistungen wolle das Gesetz auch bei Entbindungen "einen qualitativ hochwertigen Standard gewährleisten". Die "Pflege in einer allein von Hebammen geleiteten Einrichtung" sei danach einer Krankenhausbehandlung "nicht gleichwertig". Ob die Kassen ein Geburtshaus anerkennen müssten, an dem auch ein Arzt beteiligt ist, hatte das BSG nicht zu entscheiden. Wichtig ist zum weiteren Verständnis, dass einige Krankenkassen Verträge mit Geburtshäusern haben und auch die vollen Kosten des dortigen Aufenthaltes übernehmen.
Kritische Kommentatoren des BSG-Urteils empfehlen daher allen Schwangeren, vor der Entscheidung für ein Geburtshaus zu prüfen, ob ihre Krankenkasse alle Kosten übernimmt oder nicht. Wenn nicht, wird die entsprechende Versicherte wohl oder übel die mehreren Hundert Euros aus eigener Tasche zahlen müssen oder muss weit im Vorfeld der Geburt, wenn nicht sogar der Zeugung für alle Fälle ihre Krankenkasse wechseln.
Wenn man aber die BSG-Entscheidung noch etwas kritischer betrachtet, stellt sich die Frage, ob die der Entscheidung implizite Annahme, ein Geburtshaus gewährleiste nicht den "qualitativ hochwertigen Standard" wie ein Krankenhaus, sachlich haltbar und zutreffend ist.
Daran kann man erhebliche sachliche Zweifel hegen. Anders als die Krankenhäuser, an denen nach Angaben des Statistischen Bundesamt im Jahr 2003 98,7 % aller Lebendgeburten stattfanden, betreiben nämlich die Geburtshäuser seit Jahren eine umfassende Form der Qualitätsüberprüfung und -transparenz, deren Ergebnisse deutliche andere Qualitätsurteile zulassen als die vom BSG vertretenen.
Dazu führt die von den Hebammenverbänden getragene "Gesellschaft für Qualität in der außerklinischen Geburtshilfe e. V. (QUAG)" seit Jahren jährliche aufwändige Qualitätsuntersuchungen fast aller außerklinischen Geburten durch und dokumentiert sie in "Qualitätsberichten".
Von den 9.912 außerklinischen Geburten, die 2004 stattfanden, wurden im weit über 100-seitigen "Sechsten Qualitätsbericht 2004" fast 90 % erfasst, was die Ergebnisse repräsentativ macht.
Die wichtigsten qualitätsbezogenen Ergebnisse für Geburtshaus- und Hausgeburten lauten:
• Rund 12 % der außerklinisch begonnenen Geburten mussten und konnten fast immer problemlos klinisch beendet werden.
• 73,9% der Gebärenden gaben als Motivation für eine außerklinische Geburt das langfristige Vertrauensverhältnis zur Hebamme an.
• Bei den Geburtshausgeburten erfolgen die meisten Geburten in Einrichtungen, die eine genügend große Geburtenzahl im Jahr vorweisen.
• 91,1% aller Kinder - und damit etwas mehr als 2003 - wurden in einem guten bis sehr guten Zustand geboren. Insgesamt 3,8% aller Kinder (im Vorjahr 4,1%) hatten einen befriedigenden Zustand nach der Geburt. In die Gruppe mit Morbiditäten und/oder Verlegungen in eine Kinderklinik wurden 4,2% aller Kinder (4,3% im Vorjahr) eingestuft. Perinatale Mortalität im Gesamtkollektiv des Jahres 2004 trifft auf 14 Kinder oder genau 0,14% aller Geburten zu (2003: 17 Kinder oder genau 0,17% aller Geburten).
• Fazit: "Die geburtshilflichen Ergebnisse über den gesundheitlichen Zustand von 9.892 außerklinisch betreuten Frauen und Kindern belegen für das Jahr 2004 ein gutes Outcome sowie eine hohe Ergebnisqualität der geleisteten Geburtshilfe durch die an der Dokumentation beteiligten Hebammen und Einrichtungen. An Hand der validen Daten zur Verlegung, zum Geburtsmodus, zu den Geburtsverletzungen sowie zu den Befunden vor, während und nach der Geburt wurden für die gewordenen Mütter insgesamt gute Werte ermittelt." (99)
• Direkte Vergleiche mit den klinischen Geburten werden von QUAG selber aber für problematisch angesehen, weil sie nicht die höhere Anzahl von Problemgeburten in Kliniken berücksichtigen, die dort zwangsläufig zu schlechteren Abläufen und Ergebnissen führen dürften. Außerdem existieren aber die für einen Vergleich notwendigen identischen Qualitätsdaten in der Mehrheit der Krankenhäuser nicht.
• Erfahrungen aus England und der Schweiz mit ihrem wesentlich höheren Anteil nichtklinischer Entbindungen bestätigen im übrigen die hohe Qualität dieser Geburtsform und ihrer vorrangig nichtärztlichen Akteure.
Angesichts der hohen, wenn nicht sogar höheren Qualität des außerklinischen Geburtsgeschehens unter maßgeblicher Regie von Hebammen ist also das Qualitätsurteil des BSG unverständlich und sachlich ungerechtfertigt. Stattdessen greift es letztlich ideologisch massiv und einseitig in die Auseinandersetzung über die Existenzberechtigung einer nicht-medikalisierenden, gering-technisierten und nicht primär ärztlichen Hebammen-Geburtshilfe ein. Dies ist aber bei aller Würdigung der Unabhängigkeit der Rechtsprechung nicht ihre Aufgabe bzw. diskreditiert ihre Unabhängigkeit.
Unter dem Datum vom 21.2. 2006 finden Sie hier den Entscheidungstext des Urteils des Bundessozialgerichts zum Thema "Krankenversicherung - Kostenübernahme - stationäre Entbindung - zugelassenes Krankenhaus - Verfassungsmäßigkeit".
Bernard Braun, 31.12.2006
Die Bedeutung der Untersuchungsdauer für die Ergebnisqualität: Das Beispiel der Koloskopie.
 Eigentlich könnte es einem fast der gesunde Menschenverstand sagen, aber eine wissenschaftliche Studie hat es jetzt auch ans Tageslicht gebracht: Die Wirksamkeit und Ergebnisqualität der Darmkrebsfrüherkennung durch so genannte Koloskopien hängt in hohem Maße und "nahezu linear" von der Untersuchungszeit und der Zahl der gefundenen und entfernten Polypen ab.
Eigentlich könnte es einem fast der gesunde Menschenverstand sagen, aber eine wissenschaftliche Studie hat es jetzt auch ans Tageslicht gebracht: Die Wirksamkeit und Ergebnisqualität der Darmkrebsfrüherkennung durch so genannte Koloskopien hängt in hohem Maße und "nahezu linear" von der Untersuchungszeit und der Zahl der gefundenen und entfernten Polypen ab.
In einer Studie, die mit erfahrenen Ärzten (alle mit mindestens 3000 Koloskopien) im Krankenhaus einer kleineren Stadt im mittleren Westen der USA durchgeführt wurde, und deren Ergebnisse jetzt im "New England Journal of Medicine" (NEJM 2006; 355: 2533-2541) veröffentlicht wurden, zeigten sich erhebliche Unterschiede bei der Dauer der Untersuchung (Zeit des Rückzugs des Untersuchungsinstrumentes aus dem Darm). Sie schwankte zwischen rund 3 und fast 17 Minuten und zwischen fast 6 und 19 Minuten, wenn Polypen gefunden und entfernt wurden. Dies ist ganz nebenbei ein interessanter Hinweis auf die möglicherweise unscharfe Aussagefähigkeit der Menge oder Anzahl als alleinigem Indikator für hohe Qualität medizinischer Prozeduren.
Die Bedeutung der Untersuchungszeit zeigt sich darin, dass langsamer untersuchende Ärzte mehr verdächtige und weniger verdächtige Wucherungen und Gewächse fanden als ihre schnellen KollegInnen. Die Unterschiede lagen um den Faktor 2 bis 3.
Wie die Autoren selber sagen, muss die Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse dieser Fallstudie durch weitere Untersuchungen bestätigt werden. Wenn solche Untersuchungen, wie in Deutschland, aber flächendeckend angeboten werden sollen, muss die Kontrolle der Dauer, der Ergebnisse der Untersuchung und der Nutzen von Entdeckungen genau untersucht werden.
Hier finden Sie ein Abstract der Studie "Colonoscopic Withdrawal Times and Adenoma Detection during Screening Colonoscopy" von Ronert Barclay et al.
Bernard Braun, 15.12.2006
P4P: Typische US-Modeerscheinung oder Zukunftsmodell "für alle"?
 Da immer mehr us-amerikanische Krankenversicherungen so genannte "P4P"- oder "pay-for-performance"-Verträge mit Leistungserbringern abschließen und auch europäische und deutsche Versicherungen mit dem Prinzip liebäugeln, lohnen Blicke auf die Empirie dieser neuen Vertragsstrategien in den USA.
Da immer mehr us-amerikanische Krankenversicherungen so genannte "P4P"- oder "pay-for-performance"-Verträge mit Leistungserbringern abschließen und auch europäische und deutsche Versicherungen mit dem Prinzip liebäugeln, lohnen Blicke auf die Empirie dieser neuen Vertragsstrategien in den USA.
P4P meint zunächst einmal eine Bezahlungsweise, die sich am Erreichen von vereinbarten Leistungsqualitätszielen orientiert und nicht nur an der Menge oder sonstigen quantitativen Indikatoren. Die Debatte und die technisch-organisatorische Entwicklung wird nicht zuletzt durch eine im September 2006 veröffentlichte Studie des "Institute of Medicine (IOM)" der amerikanischen Ärzteorganisation mit dem Titel "Rewarding Provider Performance: Aligning Incentives in Medicare" gefördert.
Insbesondere im Bereich privater Krankenversicherungen nimmt die Anzahl von Unternehmen mit einer solchen Vertragspolitik in letzter Zeit rasch zu. Aber auch die öffentliche Krankenversicherung Medicare überlegt sich, hier einzusteigen. Ein im "New England Journal of Medicine (NEJM)" am 2.1. 2006 veröffentlichter Aufsatz von Rosenthal et al. (S. 1895-1902) über "Pay of Performance in Commercial HMOs" bestätigt die Vermutungen über den Verbreitungsstand: Unter 252 kommerziellen Health Maintenance Organizations (HMO) aus 41 Regionen der USA nutzten 126, die 80 % aller Versicherten der untersuchten HMOs repräsentierten, P4P in ihren Arzt- (90 % aller Verträge) und Krankenhaus-Verträgen (38 % aller Verträge). Ob HMOs solche Programme einsetzen, hängt stark von der Region ab (z.B. geringere Häufigkeit im Süden der USA) und von anderen bisherigen Politiken gegenüber oder mit Ärzten (z.B. deren Nutzung als Gatekeeper).
Auf die Schwierigkeiten und möglicherweise erheblichen unerwünschten Wirkungen der Performance-Orientierung im Gesundheitsbereich und entsprechender Verträge weist allerdings in derselben Ausgabe des NEJM Elliott Fisher unter der Überschrift "Paying for Performance - Risks and Recommendations" hin. Der Verfasser weist zunächst auf den enormen Aufwand hin, der selbst für für große Praxen und Krankenhäuser aber mit Sicherheit für die große Mehrheit der kleinen Artztpraxen nötig ist, um die Leistungs-Performance zu messen. Niemand weiß bisher auch, ob oder wann die Bonusvorteile der P4P-Programme so groß sind, dass sich der Aufwand amortisiert. Zusätzlich macht Elliott auf weitere qualitative und auch bereits in dem IOM-Report angesprochenen unbeabsichtigten Konsequenzen aufmerksam. Danach könnte es Ärzte geben, die ihre hohe Performanz durch die Vermeidung komplizierter und sehr kranker Patienten verbessern. Zu den Effekten, die "more harm than good" sein könnten, rechnet Elliott auch die Unterhöhlung moralischer Prinzipien und den Verlust des professionellen Wert des Altruismus.
Auf der Basis des Hinweises, dass die Evidenz für das Funktionieren von P4P schwach ist, und das bei möglichen unerwünschten Wirkungen, kommt Elliott zu dem für alle gesundheitspolitischen Shooting-Stars und Patentrezepte gültigen Schluss: "Accountability for performance on the basis of evidence is now the watchword for clinical services. We would be wise to apply a similar standard to the implementation of our health policy reforms."
Bernard Braun, 26.11.2006
Über- und Fehlversorgung beim PSA-Screening für ältere Männer
 Die meisten spezifischen Leitlinien empfehlen nicht, älteren Männern ein Screening für das so genannte prostataspezifische Antigen (PSA) und die damit verfolgte Absicht, einen Prostatakrebs identifizieren zu können, anzubieten. Angesichts der zum Teil begrenzten Lebenserwartung drohen nämlich die unerwünschten und belastenden Folgen dieser Untersuchung (z.B. bei falsch-negativen Ergebnissen) die erwartbaren Vorteile zu überwiegen. Wie oft bei älteren Männer trotzdem PSA-Tests angeboten und durchgeführt werden, war bisher nicht an größeren Gruppen untersucht worden.
Die meisten spezifischen Leitlinien empfehlen nicht, älteren Männern ein Screening für das so genannte prostataspezifische Antigen (PSA) und die damit verfolgte Absicht, einen Prostatakrebs identifizieren zu können, anzubieten. Angesichts der zum Teil begrenzten Lebenserwartung drohen nämlich die unerwünschten und belastenden Folgen dieser Untersuchung (z.B. bei falsch-negativen Ergebnissen) die erwartbaren Vorteile zu überwiegen. Wie oft bei älteren Männer trotzdem PSA-Tests angeboten und durchgeführt werden, war bisher nicht an größeren Gruppen untersucht worden.
Diesen Zustand hat jetzt der von Louise C. Walter; Daniel Bertenthal; Karla Lindquist und Badrinath R. Konety in der Fachzeitschrift JAMA (2006;296:2336-2342)veröffentlichte Forschungsbericht "PSA Screening Among Elderly Men With Limited Life Expectancies" beendet.
Bei einer Analyse der Daten von knapp 600.000 70 Jahre alten und älteren Männern, die 2002/2003 beim US Departement of Veterans Affairs (VA) oder Medicare krankenversichert waren, zeigte sich folgende Screening-Wirklichkeit:
• 56 % der Gesamtkohorte erhielten innerhalb eines Jahres einen PSA-Test,
• die Screeningrate sank zwar mit zunehmendem Alter, aber immerhin wurden auch noch Männer, die 85 Jahre und mehr alt waren noch getestet - obwohl weniger als 10 % dieser Männer die nächsten 10 Jahre überleben werden und Leitlinien solche Tests nicht empfehlen, wenn die Lebenserwartung der Personen kürzer als 10 Jahre ist,
• die Screeningsrate hatte auch kaum etwas mit dem Gesundheitszustand der Männer zu tun: Bei den 85+-Personen erhielten 34 %, die sich bester Gesundheit erfreuten genauso wie die 36 %, deren Gesundheitszustand sehr schlecht war, den Test. In multivariaten Analysen hatten viele nichtklinischen Faktoren und Merkmale, wie etwa der Familienstand und die Region in einem Bundesstaat einen größeren Effekt auf die Duurchführung von PSA-Tests als der Gesundheitszustand.
Männern im fortgeschrittenen Alter und mit ernsten sonstigen Erkrankungen - so die Autoren - "should be told that PSA screening is more likely to harm them than to help them". Hier handelt es sich also neben der Überversorgung mit einem hinsichtlich seines Nutzens heftig umstrittenen Test auch um Fehlversorgung, wenn ein möglicher mentaler Folgeschaden größer ist.
Damit werden auch die Ergebnisse von drei bereits im Sommer veröffentlichten Studien in kleineren Gruppen von Männern bestätigt, deren Zusammenfassung der von den Herausgebern des renommierten "New England Journal of Medicine" getragene Medizin-Informationsdienst "Journal Watch. Medicine that matters" bereits im September veröffentlichte. Zum Hintergrund der Verbreitung des PSA-Tests bei älteren Männern aber auch in anderen Altersgruppen führten die Journal Watch-Autoren aus: "Many factors, including media hype, ambiguous messages from professional and advocacy groups, and physicians' fear of litigation, undoubtedly contribute to these trends."
Weitere kritische Anmerkungen zum Sinn und den Risiken des PSA-Tests aber auch anderer Früherkennungsuntersuchen stehen auf der Website Mythos Krebsvorsorge
Hier finden Sie das Abstract des Aufsatzes.
Bernard Braun, 15.11.2006
Mehr Transparenz über Krankenhäuser: Start der strukturierten Qualitätsberichte
 Seit dem 1. August können Patienten und Ärzte online recherchieren, welches Krankenhaus sich in der Region auf die Behandlung eines bestimmten Krankheitsbildes spezialisiert hat, wie oft ein Krankenhaus bestimmte Operationen durchführt und wo die Komplikationsrate in ausgewählten Bereichen besonders gering ist. Erstmalig veröffentlichen die Bundesverbände der Gesetzlichen Krankenkassen sowie der Verband der Privaten Krankenversicherung strukturierte Qualitätsberichte der Krankenhäuser im Internet.
Seit dem 1. August können Patienten und Ärzte online recherchieren, welches Krankenhaus sich in der Region auf die Behandlung eines bestimmten Krankheitsbildes spezialisiert hat, wie oft ein Krankenhaus bestimmte Operationen durchführt und wo die Komplikationsrate in ausgewählten Bereichen besonders gering ist. Erstmalig veröffentlichen die Bundesverbände der Gesetzlichen Krankenkassen sowie der Verband der Privaten Krankenversicherung strukturierte Qualitätsberichte der Krankenhäuser im Internet.
Die Krankenhäuser sind zur Abgabe eines strukturierten Qualitätsberichtes - erstmalig im Jahr 2005 für das Jahr 2004 - gesetzlich verpflichtet. Die Krankenkassenverbände wiederum müssen diese vollständig und unverändert veröffentlichen. Die Kliniken sollen ihren Bericht bis zum 31. August 2005 abgeben, sie werden dann unmittelbar ins Internet eingestellt. Die ersten Berichte sind bereits Anfang August fertiggestellt und online verfügbar.
Die Qualitätsberichte sind nach einem einheitlichen Schema aufgebaut, das zwischen den gesetzlichen Krankenkassen und der privaten Krankenversicherung am 31. Januar 2005 in einer 40-seitigen Datensatzbeschreibung zur Umsetzung des strukturierten Qualitätsberichts nach § 137 Abs. 1 Satz 3 Nr. 6 SGB V für das Jahr 2005 vereinbart wurde. Danach sollen die Berichte Struktur- und Leistungsdaten sowie Informationen zur Qualitätssicherung enthalten. Die Inhalte sind so aufbereitet, dass sie auch für medizinische Laien verständlich sind.
Die Hauptkritikpunkte an der geschilderten Auswahl von Indikatoren konzentrieren sich auf zwei Punkte: Erstens stützte sich dieser Prozess nicht auf eine Erhebung der Informationsbedürfnisse von Patienten. Zweitens konzentrieren sich die Berichte auf viele Mengenangaben und vernachlässigen die Darstellung der Zusammenhänge von Menge und Qualität oder die Ergebnisqualität der Behandlung. Selbst nach dem Verweis auf 23 dafür geeignete Indikatoren der US-amerikanischen "Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ)" empfehlen die Krankenkassen für den ersten Bericht lediglich drei Indikatoren: Komplikationen bei der Anästhesie, Dekubitus und ausgewählte Infektionen im Krankenhaus.
Die nächsten strukturierten Qualitätsberichte sind erst wieder im Jahr 2007 für das Jahr 2006 zu erstellen.
Bernard Braun, 2.8.2005
Wissen, Handlung und Verhalten im Gesundheitssystem
 Eine qualitativ bessere und wirtschaftlichere gesundheitliche Versorgung erfordert die Existenz und verbindliche Geltung wissenschaftlich gesicherter, evidenzbasierter Behandlungskonzepte und Leitlinien. Damit diese tatsächlich wirken, müssen besondere und gesonderte Strategien und Konzepte entwickelt werden, die Erkenntnisse an Ärzte und andere Leistungserbringer sowie an Patienten heranzutragen und ihr Verhalten zu verändern.
Eine qualitativ bessere und wirtschaftlichere gesundheitliche Versorgung erfordert die Existenz und verbindliche Geltung wissenschaftlich gesicherter, evidenzbasierter Behandlungskonzepte und Leitlinien. Damit diese tatsächlich wirken, müssen besondere und gesonderte Strategien und Konzepte entwickelt werden, die Erkenntnisse an Ärzte und andere Leistungserbringer sowie an Patienten heranzutragen und ihr Verhalten zu verändern.
Einen sehr guten Überblick darüber, welche Methoden der Wissensverbreitung, Verhaltensbeeinflussung und Implementation die nachweislich wirksamsten und effizientesten sind, gibt die umfangreiche Expertise "Getting evidence into practice" des "NHS Centre for Reviews and Dissemination" an der Universität York (UK) aus dem Jahr 1999.
Hier ist die Expertise des NHS Centre for Reviews and Dissemination
Bernard Braun, 17.7.2005